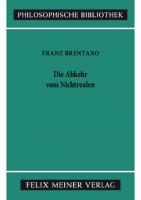Paradiese des Teufels : Biographisches und Autobiographisches - Schriften und Briefe aus dem Exil
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ruth Greuner Meine Großväter waren ein Bank- und ein Theaterdirektor. Als gan
150 36 17MB
German Pages [490] Year 1977
Polecaj historie
Citation preview
Balder Olden • Paradiese des Teufels
Balder Olden Paradiese des Teufels Biographisches und Autobiographisches Schriften und Briefe aus dem Exil
Rütten & Loening ■ Berlin
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ruth Greuner
!. Auflage 1977
© für diese Auswahl Rütten & Locning, Berlin, 1977 Der Abdrude von „Paradiese des Teufels** erfolgt mit Genehmigung des Universitas*
Verlags Berlin (West) Rechte für die Schriften und Briefe bei Margaret M. Olden und Christoph Olden-Stegmann
Einbandgestaltung Gerhard Kruschel Betriebsschule Rudi Arndt, Berlin 4700
Printed in tbe German Democratic Republic Lizenraummer *10. 4^5/11/77
Bestellnummer 611105 I
DDR 8,70 M
Autobiographische Schriften
Mein Leben
Ich entstamme halb der Bohème, halb der Bourgeoisie. Meine Großväter waren ein Bankdirektor und ein Theater direktor, in meiner Kindheit habe ich nicht gewußt, ob ich zur Bourgeoisie oder zur Bohème gehöre, und ich stand beiden Welten skeptisch gegenüber. Als ganz junger Student - ich studierte in Freiburg i. B. Literatur, Geschichte, Philosophie lernte ich Micha Al'exandrowitsdi Bakunin kennen, der ein treuer Nachfahr seines großen Onkels war, etliche Jahre älter als ich, Philosoph, drei Häupter höher ragend als alles Studen tengewächs der deutschen Universitäts-Kleinstadt. Dusch ihn wurde ich - nachdem ich schon Bierkommerse gefeiert, Säbel mensuren geschlagen, Reserveoffizierskurse absolviert hatte zum individuellen Menschen erzogen. Das war kein praktischer Gewinn in jenen Tagen, ich geriet in Konflikte zu allem, was Geltung hatte, und meine erste Publikation, mit zwanzig Jah ren, war ein leidenschaftliches Buch, eine Novellensammlung, gegen den preußischen Militarismus, der sich seither als Wiege des Hitlertums erwiesen hat. - Ich hatte schon vom zwanzig sten Jahr an den Kampf ums Leben allein zu bestehen, denn ich entfremdete mich meiner Familie, kaum daß ich zu denken anfing, wurde Hauslehrer, Schauspieler, Journalist, betrieb die Romanschriftstellerei anfangs nur als Erwerb. Aber schon in meine ersten Zeitungsromane tropfte ich Empörung gegen die einzige Welt, die ich kannte, die militaristisch-aristokratisch bourgeoise. Als früh entdeckter Feuilletonist durfte ich im Auf trag der größten deutschen Zeitung jener Jahre, der „Köl nischen“, viele Weltreisen machen, wurde 1914 vom Krieg in Ostafrika überrascht, geriet nach langem Kämpfen 1916 in 7
englische Gefangenschaft, saß hinter Stacheldraht in Indien und kam erst 1920 nach Deutschland zurück. Mit dem antiimperia listischen Kriegsroman „Kilimandscharo“ begann meine eigent liche Produktion. Ich schrieb viele Bücher, darunter eine RomanBiographie des deutschen Kolonialgründers Carl Peters, eines Kolonial- und Vor-Hitler-Nazi, ein Buch, das ich für schweres Geschütz gegen die Nationalisten hielt, das aber gerade von ihnen akklamiert wurde. Ein Oger war Peters, von mir mit Ekel geschildert - sie legten cs ihren Kindern auf den Konfir mationstisch, in Tausenden von Exemplaren. Der Gefahr, ein gefeierter Autor derer zu sein, die ich verabscheute, entrann ich knapp durch meine Biographie jenes Roger Casement, der sein Leben durchkämpft und am Galgen geendet hat, um den Kongonegern, Putumayo-Indianern, Iren, allen mit Folter und Daumenschrauben Entrechteten, zu helfen. Ich habe den größeren Teil meines Lebens - seit ich als „freier“ Schriftsteller wählen konnte - im Ausland verlebt. Durch Zufall war ich gerade 1931—1953 in Deutschland. Als Hindenburgs Staatsstreich das Reich an Hitler auslieferte, fuhr ich über die Grenze, ohne Zwang, um Herr meiner Gedanken zu bleiben. An der deutschen Grenze, auf tschechoslowakischem Boden, schrieb ich den „Roman eines Nazi“ und gleich darauf in Wieland Herzfeldes „Neuen Deutschen Blättern“ ein Mani fest gegen den Hitlerismus „Mir wäre nichts Besonderes pas siert“. Diesen Publikationen verdanke ich vielerlei Ehre: Mein Vermögen wurde beschlagnahmt, die Bestände aller meiner Bücher wurden eingestampft, ich wurde ausgebürgert. Und wurde zum Ersten Schriftstellerkongreß der UdSSR ein geladen 1 1934 nahm ich an dieser historischen Tagung teil und gewann während eines dreimonatigen Aufenthaltes in Rußland mehr Erkenntnis als während der Jahrzehnte meiner Fahrten durch alle Weltteile. Bis dahin hatte ich nur erkannt, daß wir krank ten, und auf die Wunden gewiesen. Seither weiß ich, daß es konkrete Wege gibt, um zu gesunden.
Stationen meines Lebens
1 Zu einer Zeit, die fast schon graue Vorzeit ist, sah man Tag um Tag einen schönen und eleganten, sehr jungen Herrn einen Kinderwagen durch die Alleen von Heidelberg schieben, in dem ein entzückendes Baby lag. Es machte dem jungen Herrn Freude, daß alle Köpfe sich nach ihm und dem Baby drehten, daß Getuschel und Gewisper um ihn war, denn er spielte abends, zweiundzwanzig Jahre alt, im Heidelberger Stadt theater den Romeo, den Don Carlos, den Melchthal. Die ganze Stadt kannte Hans Olden, die Mädchen schrieben ihm tolle Briefe, die Kolleginnen vergaßen in seinen Armen, daß sie Theater spielten. Romeo mit einem Kinderwagen: Das wirkte erhebend und rührend zugleich, und da die neunzehnjährige Mutter Ilschens mit ihrem vertrauenden, edlen Kindergesicht nicht einmal neun zehnjährig aussah, hatte Heidelberg seine Freude an diesem Idyll. Bald darauf wurde Hans Olden an das viel wichtigere Stadt theater in Zwickau engagiert, da begann mein krauser Lebens lauf. Hans Olden schäumte vor Zorn - ein Töchterchen, das er vergötterte, das hatte ihm das Publikum mehr als verziehen. Aber zwei Kinder, das war Verrat, da wurde er ja lebendigen Leibes Patriarch, während seine eigene Mutter noch eine junge Frau war! Aber ich blieb ihm nicht erspart - meine Frau Mama war sanft und lieblich, aber sie hatte - und erhielt sich bis zum Ende - einen Starrkopf, der mit ihrem ganzen Wesen seltsam kontrastierte. Sic war zahm und gehorchte gern, aber hatte sie sich etwas in den Kopf gesetzt - leider war ich es in diesem Fall -, dann hielt sie es störrisch fest.
9
Damals war es Theatersitte, den Hauptdarstellern gegen Ende der Saison einen „Benefizabend*' zu geben. Sie durften das Stück bestimmen, bekamen drei Viertel der Tageskasse und, wenn sie beliebt waren, Kränze, Blumen, nach der Vorstellung ein Bankett, das bis zum Morgen dauerte. Während Hans Olden, als Graf Wetter vom Strahl, seinen Ehrentag feierte, begann meine Geburt. Meine Mutter hat mir vierzig Jahre später in einem Geburts tagsbrief geschrieben, daß diese Nacht die schrecklichste ihres Lebens war. Man hatte mich noch nicht erwartet, mit schreck licher Mühe wurde endlich eine Hebamme zur Stelle gebracht, und die war betrunken. Mama hatte viel gelitten, als Hans Olden, den Applause umrauscht, viele Reden gefeiert und viele Frauen geküßt hatten, Champagner im Blut, mit einem riesigen Waschkorb voll Lor beer, Gold und Silber nach Hause kam. Dieser Korb wurde mein erstes Bett. Meine Mutter hörte noch, wie Hans Olden zornig sagte: „Noch dazu ein Junge!“ Aber die allmählich nüchtern gewordene Hebamme sagte zu mir, um alles Versäumte gutzumachen: „Du wirst viel Un glück anrichten mit diesen viel zu blauen Augen!“ Dann schlief meine arme Mutter ein, ein wenig getröstet für alle Qual durch diese Weissagung der weisen Frau, daß andere Mädchen an mir leiden würden. Ich weiß nicht, war es trotz allem erwachter Vaterstolz, 'oder war es Wut über mein Kommen, am anderen Tag lief Hans Olden aufs Standesamt und gab mir den Vornamen Balder, keinen zweiten Vornamen, wie sorgliche Eltern es tun! Nun hieß ich Balder Olden und war in jener Stadt geboren, die zwar Robert Schumanns Heimat war, aber dennoch - Zwickau heißt. Unter diesem Namen habe ich hart gelitten, er klebte an mir wie ein Nessushemd aus bunten Flicken, und als ich anfing zu schreiben, glaubten selbst gütige und kluge Menschen, er sei ein Pseudonym, ich habe den Namen des Frühlingsgottes usur piert. Es muß von meiner Mutter ererbter Starrsinn sein, daß ich später diesen Namen, der wie ein Pseudonym klingt, nicht gegen ein Pseudonym vertauscht habe, das wie ein Name klänge.
io
Es gibt ein Foto, aus der Zeit, als meine Schwester schon Zöpfchen trug und ich noch im Kinderwagen saß, ein Foto, auf Blech kopiert - das hat mich immer weinerlich gestimmt. Den Hintergrund bildet eine dampfende Lokomotive - natürlich war es die Dekoration eines Fotografen-Ateliers -, im Vorder grund sieht man zwei knorrige Eichenstümpfe aus Pappe, und darauf sitzen meine Eltern und sehen aus - er ein strahlender Bub, sie ein kaum erblühtes Mädchen - wie ein Liebespaar, das den Eltern entflohen ist. Aber welch eine Hochzeitsreise ausstattung ! - Ilse und ich I Diese Lokomotive im Hintergrund, welch ein schauriges Symbol! Keiner von uns ist je im Leben seßhaft geworden. Mein Vater war reich, er hätte seine Familie ansiedeln können, als er uns - empört über die Geburt eines dritten Kindes zwei Jahre später verließ. Meine Mutter hätte sich den Ort wählen können, der ihr und ihrer Brut zuträglich war, um dort zu ankern. Aber auch sie hatte die Unrast im Blut; wenn eine Wohnung fertig war und Behagen gab, fanden sich zwingende Gründe, ein anderes Asyl zu suchen. München, Meran, Regens burg, das Salzkammergut, Wiesbaden, Freiburg i. B. waren die Hauptstationen unserer Kinderzeit. Es macht mir oft Vergnügen, daß ich so viele deutsche Mund arten beherrsche und mich, wie ich will, als Bayer, Hesse, Ba denser, Österreicher ausgeben kann. Aber diese brotlose Kunst ist unter Tränen erlernt worden, denn ein Eisenbahnkind hat es schwerer als andere Kinder. Eisenbahn und Dampfschiff blieben unsere eigentliche Hei mat. Heute, in fast weißem Haar, stelle ich fest, daß ich nur an einem einzigen Ort volle vier Jahre lang ausgeharrt habe: das war die langweilige, kleine Stadt Ahmednagar in Indien. Dort bewohnte ich ein Kriegsgefangenenlager, um das war ein vierfacher Stacheldrahtverhau gezogen.
Nach Meran reisten wir, weil ich Keuchhusten bekam, das war wohl ein Anlaß, München zu verlassen: In Meran wach sen Edelkastanien wie anderwärts Kiefern, die Passer rauscht, das Passertal ist voll von Blumenduft, Meraner Rosen über all - ich empfinde ewig wieder ihren Duft. Wir trugen Meraner 11
Bauernkleider, wie die echten Bauernkinder sie höchstens am Sonntag trugen, wir wohnten in der innen modernisierten Burg Pienzenau in Obermais, und mit acht Jahren verlor ich zum erstenmal mein Herz. „Sie“ hieß Emmi von Drechsel und war unsere Gouvernante, sanft, hold, großäugig und emsig. Sie er widerte meine Liebe, sie zog mich oft in ein stilles Zimmer und küßte mich ohne Ende. Meine Schwester war furchtbar gescheit, sagte wundervoll auf und tanzte graziös, ich war sehr stolz auf sie. Aber meine Liebe zu ihr war damals ein bißchen scheue Bewunderung. Obwohl ich sie einmal im Streit „scheuß liche Madame“ nannte - aber dies „Madame“ beweist doch, wie sehr sie mir imponierte. Als dies Wort Hel, lief Ilse laut weinend davon und war lang nicht zu beruhigen. Um es gutzu machen, rede ich sie heute in meinen Briefen „lieblichste Madame“ an. - Aber wenn ich in den Armen Emmi von Drechsels lag, war ich ein glücklich Liebender, kein Bübchen, kein Adorant. Leider lernte ich viel zu gut bei meiner geliebten Lehrerin. Mit neun Jahren war ich reif fürs Gymnasium, und jetzt mußte es, Gott weiß, warum, ein deutsches Gymnasium sein. So über siedelte die Familie nach Regensburg - von den sanften, melo dischen Tirolern fort zu den rauhesten aller Bajuvaren, aus dem Passertal, in dem das Blühen auch im Winter nicht endet, an die grimmige Donau, aus den Armen der holden Emmi zu den bayrischen „Professoren“. Sie nannten uns „Studenten“, knallten aber so brutale Ohrfeigen, daß mein liebster Sexta freund Woelfel an einer professoralen Ohrfeige starb. Er hatte die Mütze auf dem Kopf, als ein Professor ins Schulzim mer trat, in dem nur noch er und ich waren, und vergaß, sie abzunehmen. Seine Eltern schickten mir all sein Spielzeug, aber ich hatte meinen ersten lieben Freund verloren und konnte mit dem Zeug nicht spielen. Das war Germanien! Und Woelfcls Vater war Direktor der Walhalla! Er hat gegen die Schule nichts unternommen, viel leicht nahm er an, sein Söhnchen sei dank einer Hirnhautent zündung ins Walhall eingezogen. Gottlob, schon in der Quinta blieb ich sitzen! Das wurde ein 12
hochwillkommener Anlaß, nach Wiesbaden zu übersiedeln, denn ich blieb im August sitzen, und in Preußen war zu Ostern Klassenwechsel. So kam ich mit nur sechs Monaten Zeitverlust in die Quarta, und als ich dort in Obertertia abermals sitzen blieb, übersiedelten wir nach Freiburg im Breisgau, wo wieder Herbstversetzung war. Unsere Mutter war gar keine Pädagogin, aber eine sehr lei denschaftliche Mutter. Wenn ich sitzenblieb, verwünschte sie die verständnislosen Lehrer und schrieb ihnen zornige Briefe. Sie tröstete mich, ließ den Möbelwagen kommen und wechselte mit ihren Eltern und Kindern die Garnison. Einen Vater hatten wir nicht, obwohl ein schöner, eleganter Herr, der sich „Papa" anreden ließ, etwa alle vier Jahre zu Besuch kam und Ilschen leidenschaftlich den Hof machte. Ich fand nie eine Anrede für ihn, bis ich als Obersekundaner Homer las. Von da an sagte ich „Verehrter Erzeuger". „Mein Vater“ habe ich fast nie gesagt; es muß schön sein, das sagen zu können. Viel später, wenn ich gefragt wurde: „Sind Sie ein Verwandter von Hans Olden?", gab ich zur Antwort: „Das ist ein entfernter Vater von mir.“ Meine Lehrer benutzten mich gern als abschreckendes Bei spiel für die Klasse. Einer von ihnen hielt allwöchentlich einen Vortrag über „verbummelte Genies“, in dem er mich von allen Seiten beleuchtete. Ein anderer behauptete, aus mir könne höchstens ein „Schornalist“ werden - es gäbe auch gebildete und ehrbare Männer bei der Presse, aber das seien „Journa listen“, zu denen würde ich niemals zählen. Gewiß hat mein Beispiel und haben all diese Hinweise auf meine Zukunft die Moral der Klasse gehoben und beigetragen, daß meine Mit schüler gute Bürger wurden. Viele wurden gewiß schon meines abschreckenden Beispiels wegen Säulen des Dritten Reiches. Aber die Lehrer behielten nicht ganz recht, wenn sie meine Zukunft prophezeiten, denn viel früher als all meine Kamera den konnte ich eine kleine Familie erhalten und mußte ich Steuern zahlen. Sie hatten auch nicht ganz recht in ihrer Ana lyse meines Wesens. Ich war nicht so zerstreut, wie sie annah men, sondern viel zu konzentriert, allerdings auf andere Dinge, ij
als sie lehrten. Ich hatte mir schon als Tertianer angewöhnt, die Nächte am Schreibtisch zu sitzen, ich las die Klassiker und studierte Rollen, ich lernte so viel Poesie auswendig, daß ein Schatz fürs ganze Leben sich in mir häufte. Ich hatte ein Ohr für fremde Sprachen und hörte wohl, wie grausam sie diese Sprachen mißhandelten. Ich hatte die Biographien der deutschen Dichter studiert und stellte fest, daß meine Lehrer sie nicht kannten. Meine Lehr- und Wanderjahre gingen nicht nur durch Bayern, Hessen-Nassau, Baden und Hessen-Darmstadt, sondern auch durch das Gymnasium, die Oberrealschule, das Realgym nasium und eine sogenannte Presse in Darmstadt, in der ich auf das wilde Abitur vorbereitet wurde, aber zugleich Schüler und Lehrer war. Auf all diesen Fahrten sind mir nur zwei Pädagogen begeg net: der bucklige, gütige Zwerg Dr. Elias in Darmstadt, der sich mit mir in Leidenschaft für deutsche Dichtung entflammte, und e*iner, Herrmann Stuber. Den habe ich oft besucht, er be kam all meine Bücher, und wir schrieben einander bis ins Jahr 19;;. Seit den Märztagen dieses Jahres hatte ich an keinen Menschen in Deutschland mehr geschrieben, aber 1938 bekam ich aus Paris einen Brief von ihm, der lief: „Sagt es Ihnen denn nicht die Antenne an Ihrem Kopf, daß ein Mensch von der Place de la Concorde bis zum Arc de Triomphe auf den Händen laufen möchte vor Freude darüber, daß Sie noch leben und schaffen?" Im Gegensatz zu Dr. Elias war dieser Lehrer ein schlanker, schönäugiger Riese mit einem guten, großen Künstlerkopf. Ein Doppeldenkmal dieser beiden Männer müßte komisch wirken. Aber in meinem Herzen ist dies Doppeldenkmal errichtet, und ich hege es in Ehrfurcht. Als sie zwölf Jahre alt war, focht Ilse mit einer kleinen Freundin ein Match aus: wer die meisten Haselnüsse verschlin gen könnte. Als sie wieder auf dem Wege der Genesung war, durfte ich sie besuchen, sie war abgezehrt, sehr blaß, und mit einem unvergeßlichen Schock empfand ich plötzlich: sie ist schön I „Du siehst aus wie eine junge Mutter“, flüsterte ich ihr zu -
t4
etwas Schöneres konnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, von dieser Stunde an liebte ich sie mit einer Eifersucht, die ihr und mir viel Kummer gemacht hat. Ich erlaubte nicht, daß sie allein zu ihren Mädchenkränzchen und in die Schule ging, wir zankten uns oft im Gehen, dann begleitete ich sie auf der an deren Seite der Straße, ließ aber kein Auge von ihr, und als sie in ein Pensionat kam und eine Lehrerin liebgewann, schrieb ich ihr zornige Briefe in Versen: auch die beste Lehrerin dürfe sie nicht lieber haben als mich. Eines Tages wurde sie „ausgeführt“, wie es damals hieß, wenn man junge Mädchen der guten Gesellschaft auf den Heiratsmarkt schleppte. Der alte Lenbach, damals König aller deutschen Porträtisten, malte sie ein dutzendmal, die Porträts der „Miß O.“ wanderten durch ganz Europa und wurden viel reproduziert, alle Welt fragte, wer diese Miß O. sei, und er fuhr es. Sie selbst merkte nicht, daß sie eine gefeierte Dame war, sie spielte Theater für die Armen und tanzte auf Wohltätigkeits festen, sie lockte und floh wie die Prinzessin Ilse im Ilsenstein. Daneben stand ich, ein Taugenichts von Schulbub, in dem es kochte und gärte, im Kampf gegen jede Disziplin, ein Zigeuner, der die eleganten Herren verabscheute, sein eifer süchtiges Mißverhältnis zu dieser Welt der feinen Leute nicht nur in Versen entlud. Rudi, unser kleiner Bruder, paßte ganz in diese sittsame, vornehme Welt. Er ging reibungslos durch die Klassen, brachte als Sekundaner die erstaunliche Leistung zuwege: aus der Realschule ins klassische Gymnasium zu wech seln, ohne auch nur ein Semester zu verlieren, vor allem, ohne einmal geschwitzt zu haben. Sein Kopf war so klar und kri tisch, daß er schon als Abc-Schüler seine Lehrer auf Wider sprüchen ertappte und festnagelte. Er hatte nie den Ehrgeiz, Schullorbeeren zu ernten, sondern den entgegengesetzten Ehr geiz: sich nie im geringsten für die Schule zu bemühen und dennoch zu bestehen. Rudi, dem es bestimmt war, ein Michael Kohlhaas im Rechts wesen der deutschen Republik zu werden, ein Paladin der deutschen Freiheit - und ihr Märtyrer -, dem später ein Tag ohne Kampf kein guter Tag war, er war mit fünfzehn Jahren
ein vollendeter Herr, kein Stäubchen an seinem stets gebügel ten Anzug, von einer Höflichkeit, die eisig werden konnte, schlank hochgewachsen, aristokratisch in jedem Gestus. Ich aber war auch äußerlich ein Struwelpeter. Großeltern, Mutter und Tanten suchten Rudi meinem Einfluß zu entziehen und litten, weil es nicht gelang. Denn in diesen tollsten Strudeln meines Lebens begriffen nur diese beiden, Ilse und Rudi, daß ich ein armer Kerl war, der mit sich selbst nicht fertig werden konnte, und nur sie glaubten an meine Zukunft. Als Student im ersten Semester wurde ich sanft, aber be stimmt aus dem gepflegten häuslichen Garten entfernt, in dem ich wie ein Stachelkaktus zwischen Reseden wirkte. Ich bezog eine Bude im poetischen Immental, dort lernte ich Micha Alexandrowitsdi Bakunin kennen, politischer Emigrant, Neffe des großen russischen Revolutionärs Bakunin. Er studierte Philosophie, war Jahre älter als ich, sein Kopf war kühl, sein Blut war wild. Er erbarmte sich meiner, schmeidigte meine borstige Seele, gab dem unreifen, unklaren Revolutionär in meiner Brust Ziel und Form. Wir lebten in vielen Räuschen, Wein- und Freiheitsräuschen, Zarathustra-Räuschen, aber er hatte Stil, war in seiner ganzen Gestalt, geistig wie körperlich, ein Meisterwerk der Natur, und mir würde viel verziehen, weil er mich seiner Freundschaft würdigte. Ich ging selten ins Kolleg, schrieb viel, lernte viel auswen dig, denn ich dachte mir meinen Weg so, wie Hans Olden ihn gegangen war: über das Theater zur Literatur. Um Bakunin sammelte sich ein erlesener Kreis von Studenten und werden den Künstlern, die das Bierstudententum der Korps und Bur schenschaften ekelte, , die sich die Gesichter nicht mit Schmissen verunzieren ließen. Sie ließen auch mich gelten, hörten zu, wenn ich Heine, Herwegh, Freiligrath, die Sänger der deut schen Revolution von 1848 rezitierte, Szenen aus dem „Götz“, den „Räubern“ - das Gärtnerhaus im Immental war ein Heim entflammter Musen. Dort hätte ich länger bleiben sollen. Aber vor mir stand das Militärjahr, vor dem mir grauste. Micha Alexandrowitsdi selbst riet mir, es hinter mich zu brin gen, ehe ich den Zwang der Schule ganz vergessen hatte. Viel16
leicht würde es mir glücken, solange ich sehr jung war, unbe schädigt durch dies stachlige Gitter zu kriechen. Das Jahr wurde furchtbar - für meinen Hauptmann. Ich ahne nicht, warum er mir soviel Langmut zeigte. Ich habe zwölf Monate lang aus innerstem Instinkt gegen militärische Disziplin, gegen Drill und Uniform gekämpft; einmal war es ein he roischer Kampf, als ich einen Sergeanten wegen Rekrutenmiß handlung meldete, was ihm sechs Wochen bei Wasser und Brot, mir aber den Haß fast aller Unteroffiziere der Kompanie ein trug. Meist war es ein Lausbubenkampf. Zweimal bin ich wäh rend dieses Jahres in die Schweiz desertiert, nach Basel ins Holbein-Museum, zu den Bildern Böcklins, die mich heute ent setzen würden, aber damals begeisterten. Dieser Parademarsch, dies Exerzieren mit Gliedern steif wie Stöcke, dies „Herr Unter offizier haben ...", „Zu Befehl"-Sagen, Strammstehen, dieser Zotenhumor in der Mannschaftsstube, ich fand es Wahnsinn, ein ganzes Jahr des kurzen Lebens so zu verbringen. Abermals nachts, auf der Rheinbrücke in Basel, wurde es mir beide Male klar, daß ich deutscher Dichter nicht ohne Deutschland werden könne. Der Vers Storms „Kein Mann gedeihet ohne Vaterland“ schien mir für einen Mann, dem die deutsche Sprache Heimat und Werkzeug werden sollte, als Schauspieler oder Dichter, doppelt zu gelten, und mit dem letzten Personenzug fuhr ich wieder zurück, kroch im Morgen grauen in die Uniform, radelte in die Kaserne und übte den Präsentiergriff, den Langsamschritt, das „Hinlegen“, „Sprung auf, marschmarsch“ und die edle Kunst, mit dem Gewehr an derer Mütter Söhne zu töten. Ich glaube, die Tatsache, daß meine Schwester das schönste Mädchen von Freiburg war, hat mich vor den schlimmsten Folgen meiner Disziplinlosigkeit geschützt. Die Leutnants, die mit ihr tanzten und Tennis spielten, sagten ihr viele schöne Sachen, aber auch die häßliche, daß sie Angst hätten, ich könnte rabiat werden, Mord oder Selbstmord begehen. Es haben wohl noch andere Umstände mitgespielt, daß mir alles hinging. Ich kam nie ins Loch, ich brachte es beim Abgang sogar zum Ge freiten, obwohl ich nicht der schlechteste, sondern der mise rabelste Einjährige des Regiments war. 2
Paradiese
17
Ganz im Anfang meines Dienstjahres aber passierte mir außerdienstlich ein widriges Erlebnis. Ein für mich uralter Kandidat der Medizin - er stand schon vor dem Staats examen der als der beste Säbelfechter von Freiburg galt, überfiel mich, den er nicht kannte - mit dummen, sinnlosen Beleidigungen. Ich schlug ihm ins Gesicht. Er forderte mich auf Säbel s. s., ich war ein leidenschaftlicher Gegner des Zwei kampfes, dieser albernsten Erscheinungen im deutschen Stu dentenleben. Aber ich nahm die Forderung an - es wäre sonst mit der gesellschaftlichen Stellung unserer Familie aus gewesen. Einen Sohn und Bruder, der im „Verruf gemeiner Feigheit“ stand, hätte man ihr nie verziehen. So diente ich mein Jahr zu Ende in der Gewißheit, nach diesen zwölf Monaten qualvollen Zwanges von einem Muskel riesen geschlachtet zu werden. Ich hatte wenig Übung im Fech ten, dieser cand. med. war ein Meister. Ich wog höchstens 55 Kilo, er war ein muskelbepackter Bär. Ich stellte mich. Als ich wieder zum Bewußtsein kam, natürlich im Kranken haus, schien der Sehnerv meines rechten Auges gelähmt. Dann floß langsam das Blut ab, das Auge fing wieder einen Schim mer Licht, und bald konnte es wirklich sehen. Aber die Mus keln der rechten Gesichtshälfte waren gelähmt, ich lachte links, ich weinte links, rechts war Maskenstille. Mit dem Theater war cs aus - wo gab es Rollen für einen Schauspieler, der nur auf der linken Gesichtshälfte Empfindung ausdrücken kann? Es war noch mit viel anderem aus. Meine Schwester wurde verheiratet, ich haßte den Mann. Freilich hätte ich jeden Mann gehaßt, der sie mir nahm. In meinem ersten Frack, einen Chapeau claque, der nicht mir gehörte, unter dem Arm, nahm ich an der Hochzeit in der Kirche, auf dem Standesamt, auch abends an der Hochzeits feier teil, die mir furchtbar wurde. Welche Taktlosigkeiten bei einem solchen „Diner“ gesprochen werden, vom Pfarrer, von den Freunden und Verwandten - jede Hochzeitsfeier scheint mir seither Bloßstellung. Ich habe nie wieder an einer solchen Prozedur teilgenommen, obwohl ich selbst dreimal geheiratet habe. Ilse sah aus . wie eine kindliche Sklavin, ihr Gatte wie ein Menschenräuber.
8
Als das Brautpaar plötzlich versdhwunden war und ich von Gram zerwühlt und von Champagner aufgepeitscht, fuhr ich mit dem letzten oder schon dem ersten Zug ins Höllental. So heißt es wirklich, dies Tal im Schwarzwald, in das ich ein laufen mußte. Ich verzog mich in den Wald, schmetterte mei nen Chapeau claque gegen Bäume, riß meinen Frack in Fetzen, junge Fichten aus dem Grund, ich tobte gegen die Natur. Ich war Anarchist, ich wollte keine göttliche noch menschliche Autorität mehr anerkennen, ich riß Rinde von den Tannen bäumen und fraß davon.
Wenig später versetzte ich mein Fahrrad und entfloh meiner Familie. Ich fuhr vierter Klasse von Frankfurt nach Berlin. Die vierte Klasse hatte keine Bänke, man stand oder saß auf sei nem Handkoffer, aber nicht alle Reisenden besaßen Handkoffer. So legte mir eine Arbeiterfrau ihr Kind auf die Knie, ein prangend schönes Maideli von fünf oder sechs Jahren, und ich fühlte den lieben, duftigen, gesunden Körper an meiner Brust. Aber das schlafende Kind wog schwer. Deshalb schlief ich nicht ein, als die Nacht kam. Ich machte Inventur: ein mißglückter Schüler, ein davongelaufener Stu dent, ein mißglückter Soldat, ein Schriftsteller, dem all seine Manuskripte „wegen Raummangel“ von den Redaktionen zu rückgeschickt wurden, ein für das Theater untauglicher Schau spieler, ein stets Verliebter, den Liebe nie erquickt hatte, und meine einzige Schwester die Beute eines Korsaren ... In folgenden Jahren träumte ich immer wieder denselben Traum: Im Gedrängel eines Bahnhofs legt mir eine Frau ihr Kind in den Arm und verschwindet. Dies Kind zerbröckelt in meinen Händen, Stück um Stück fällt auf den Boden. Ich bücke mich, sammle ein Ärmchen, ein Beinchen, um es wieder anzufügen, aber ein anderer Teil des kleinen Körpers zerbricht mir abermals. An diesem Traum habe ich lange gelitten. Viele Jahre später kam eine Zeit, da glückte mir alles, da hatte ich in Fülle, was man in der Jugend sich wünscht, und war noch lange nicht zu alt, um es zu genießen. Äpfel und Nüsse und Mädchen und Wein, sogar ein wenig von dem, was man Ruhm nennt, alle Fernen gehörten mir. Ich hatte schon 19
viel von der Welt bereist, und alle Länder standen mir offen. Ich war kein Taugenichts, ich konnte wirken. Da entsann ich mich dieses Alptraums meiner Zwanzig, und plötzlich wurde mir sein Sinn bewußt. Das Kind, das in mei nen Armen zerbröckelte, als ich zwanzig zählte, war meine eigene Jugend, auf dieser Fahrt durchs Höllental meiner Ju gend.
II In einer Mainacht, als der Morgen schon graute, kehrte Hans Olden von einer Minnefahrt nach Wien in seine Berliner Woh nung zurück. Die ganze Nacht über hatte er im D-Zug seine Braut angedichtet, ein sprödes Mädchen aus einer noch sprö deren Familie. Jetzt war die Palme errungen, der neue Bund fürs Leben gutgeheißen, der baldige Hochzeitstag angesetzt. Mit des Bräutigams Behagen öffnete er die Türe zu seiner Wohnung, legte ab, freute sich auf das kalte Souper, die Flasche Champagner, die er telegrafisch beordert hatte, um all das Frühlingsglück zu fassen, einsam nachzufeiern. Da hing ein fremder Herrenpaletot in seinem Vorzimmer In der Luft lag ein Odeur von vierundzwanzig Stunden Eisen bahnfahrt vierter Klasse, Zigarettenrauch und Bahnhofsbier. Vor der Tür des Gastzimmers stand ein Paar Männerschuhe. Er trat behutsam ein, knipste das Licht an, hoffte einen armen Kollegen aus der Schauspielerzeit oder wenigstens einen Ein brecher zu finden, dann war ihm zumute wie Orest, einst eine seiner Lieblingsrollcn, den die Erinnyen hetzen. Im sauberen Gastbett lag sein leibliches Kind, ein unrasier ter Lümmel von zwanzig Jahren, die rechte Schädelscite bis zum Augenlid von einem kaum vernarbten, furchtbaren Säbel hieb zerspalten - sollte er den seiner Braut als Morgengabe be scheren? Hans Olden, ein sehr erfolgreicher Dramatiker, Shakespeareforscher und klassischer Bonvivant der Berliner Gesellschaft, wenig über vierzig und eben vom Glück ganz hoch geschaukelt, ich glaube, er weinte in dieser ersten Nacht seiner Brautschaft. 20
Mindestens zitterte seine Stimme, die man so oft mit dem Klang einer Cellosaite verglichen hat. „Das geht nicht, Jungchen, das geht wirklich nichtI" So unglücklich wie dieser erste Besuch hatte ihn selbst mein Eintritt ins Leben nicht gemacht. Gleich darauf sauste der zweite Schicksalsschlag auf ihn nie der. „Ilse erwartet ein Kind!“ Bei der Flasche Champagner, die er hochherzig mit mir teilte, mußte ich ins Vaterhaus verlaufener, verlorener Bub ihn trö sten. „Ich zeige mich nirgends, ich verschwinde! Und ich verrate niemandem, daß du dich Großva__ verzeih, daß ich mich Onkel fühle.“ Mir war zumute, als seien wir zwei Komplizen bei einem sehr üblen Streich, obgleich ich nie im Leben an einem Ver hängnis schuldloser war. Damals begann ein kollegiales Freundschaftsverhältnis zwi schen Hans Olden und mir, das leider die erste Feuerprobe, vier Jahre später, nicht bestand. Er rechnete es mir hoch an, daß ich seine Kreise nicht störte, er widmete viele Stunden seiner letzten Junggesellentage, die sehr bedrängt waren - denn es galt, mehrere linkshändige Familienbande behutsam zu lösen -, meinen Arbeiten, er war ein klarer und kluger Mentor. Ich fand Obdach bei einer gütigen, geistvollen Schwester meiner Mutter. Sie war Opernsängerin, gewesen, führte den Titel „Kammersängerin“ und sang Liederi Schubert, Schumann, Brahms, Loewe, wie ich sie nie wieder herrlicher und gescheiter singen hörte 1 Denn zum Ariensingen taugt jeder herrliche Kehlkopf, wenn ein leidliches Stück Leichnam daran baumelt. Aber zum Liedersingen braucht es Hingabe, Seele, Verstand und Temperament - die Stimme ist fast Nebensache. Ich habe Ludwig Wuellner gehört, als sein Kehlkopf fast verloschen war. Man nannte ihn damals den „Caruso ohne Stimme". Hätte ich heute die Wahl, den jungen Caruso oder den alten Wuellner noch einmal zu hören - es wäre keine Wahl.
21
Tante Melanie war damals über fünfzig und hatte einen Männerkopf, ein bißchen Ziethen aus dem Busch, sehr viel George Sand im Ausdrude. Sie ist mehr als neunzig Jahre alt geworden, ohne alt zu werden, und war die gewaltigste Frau, die mir begegnet ist. Obwohl sie von früher Jugend an enorm verdiente und zudem als Witwe eines preußischen Obristen eine respektable Pension bezog, pumpte sie jeden Menschen an, der ihr nahe kam. Sie selbst lebte anspruchslos, aber sie zahlte jahraus, jahrein die von ihrem Gatten hinterlassenen Schulden ab, damit auf seinem Andenken kein Schatten bliebe. Zwei schöne, hochbegabte Söhne zog sie im Luxus auf und mußte sich bald angewöhnen, auch deren Schulden zu zahlen. All diese Lasten betrübten sie nie, sie hatte niemals Zeit, be trübt zu sein. Ihre glänzende Opernlaufbahn hatte sie dieser Ehe opfern müssen, denn auch für den dümmsten preußischen Offizier war im Kaiserreich die Ehe selbst mit der größten Bühnenkünstlerin unstandesgemäß. Jetzt war sie Gesangpädagogin, bildete junge Künstler bis zur Bühnenreife, und ihr Haus war von edelster Musik erfüllt. Daß sie meine Leidenschaft für das deutsche Lied erweckt und entwickelt - ich bin sonst unmusikalisch wie eine Kiste - und mir damit ganz neue Glücksmöglichkeiten fürs Leben geschenkt hat, vergesse ich nie. Oft saß sie bis tief in die Nacht am Flügel und sang, ganz allein für mich, sie, die Künstlerin, deren Ruf große Säle füllte, Lieder, Lieder, immer neue Lieder, immer wieder dieselben Lieder. Es gibt ja so wenig Lieder auf'der Welt, daß in alle Sprachen das deutsche Wort „Lied“ als.Fremdwort eingedrungen ist. Während sie unterrichtete, saß ich in einem entfernten Stüb chen ihrer Wohnung und schrieb mir Haß und Geifer gegen den Militarismus vom Herzen. Ich habe nie bedauert, daß ich dies Militärjahr absolviert habe - ein Junge, der das Leben umarmen will, muß auch etwas zu hassen haben. Ich selbst war beim Kommiß mit Glac£handschuhen angefaßt worden, mein Hauptmann hatte die Flüglein beide über mich gesprei tet, wenn der Satan von Korporälen mich verschlingen wollte. Aber was hatte ich mitangesehen? Für mich war die Wurzel allen Übels auf Erden die Kaserne, 22
in der man fromme, stille Knaben aus dem Schwarzwald zum Morden dressierte, in der sie wie Hunde verprügelt, zum Steh len und Lügen abgerichtet, ihrer Zartheit entkleidet, zum Got tesdienst kommandiert werden, bis sie selbst in der Lehre des gütigen, lieben Jesus Christus nur noch ödes Geschwätz hören. Wer drei Stunden mit bepacktem Tornister und bei glühender Sonne Strafexerzieren mußte, weil er in der Kirche geschlafen hat, dem ist Gottesdienst nur noch militärischer Drill. Der Feldwebel, der bei Orgelklang und Choral die Namen der Rekruten aufschreibt, denen der Kopf nach vorn hängt, scheint ihm mächtiger als irgendein Gott, der kein Notizbuch zwischen den Knöpfen des Waffenrocks trägt. Und jede Macht hienieden wird angebetet, Gott sei’s geklagt, solange wir leben. Ich bedaure mein Dienstjahr nicht, es hat mich in Konflikt zur herrschenden Macht gebracht, es hat mich zum Nachdenken über die Wurzel alles Bösen gezwungen, und vom Pazifisten zum Sozialisten kostet es den Denkenden nur einen Schritt. Wahrscheinlich tat ich dem Militarismus unrecht, wenn ich preußischen Militarismus verallgemeinerte. Ich hatte später Gelegenheit, die englische, die französische, die schweizerische, vor allem die Sowjet-Armee zu beobachten: In diese Zwangs gemeinschaft junger Männer läßt sich viel Gutes tragen. Zudem ist die Einrichtung wundervoll, daß gesunde junge Männer mindestens ein volles Jahr lang in freier Luft körper lich üben. Die Muskeln, die mir damals antrainiert wurden, haben öfters mein Leben gerettet. Herz und Lungen bekamen Kraft, um tausend Mühsale zu bestehen. Aber dennoch: das grausige Triumvirat Bismarck, Wilhelm II., Hitler hätte nie ent stehen und die Kultur dieser Erde in Trümmer schmeißen kön nen ohne diese Schule der Gemeinheit, die alle deutsche Jugend durch Jahrhunderte in der Kaserne passieren mußte. So entstand ein Dutzend „Geschichten aus der Mannschafts stube“, die ich in alle Welt verschickte und, dank dem stets beigelegten Rückporto, aus aller Welt zurückbekam. Stets lag ein gedruckter Brief bei, in dem die Redaktion erklärte, mein Opus könne wegen Raummangels nicht veröffentlicht werden. Dieser Raummangel im deutschen Blätterwald war qualvoll, deutete an, daß für mich selbst kein Raum auf Erden sei. 2J
Hans Olden meinte, ich sei zu jung für das Literaturhand werk. Ich solle nach Amerika gehen - der Einfall war nicht schlecht, denn seine Hochzeit stand vor der Türe - und solle etwas Praktisches treiben, Bierbrauerei sei ein so gut bezahltes Gewerbe... Ihm wäre ein bierbrauender Sohn im Urwald ge wiß lieber gewesen als ein Verschwörung brauender Literat im Grünewald. Wenn ich ein paar Jahr läng ins wirkliche, prak tische, wilde Leben gebissen hatte, sollte ich in Gottes Namen wieder gegen den Raummangel der Zeitungen kämpfen. Da errang ich mir, unter sechsundneunzig Bewerbern, dar unter einem Divisionsprediger a. D., die Stellung eines Redak tions-Volontärs der „Oberschlesischen Grenzzeitung“ und setzte meine Vierter-Klasse-Reise durch Deutschland fort. Ein Volontär ist die nützlichste Kraft für jedes Unterneh men - man kann ihm jede Arbeit zumuten, denn gerade die Ausbildung in allen Zweigen des Betriebes ist ja sein Honorar. Er kann, da er überhaupt nichts zu fordern hat, niemals seine Forderungen erhöhen und muß also den bezahlten Angestellten ein Beispiel geben. Als junger Besen wird er drei bis sechs Monate gut kehren, alle Korrekturen lesen, Stadtnachrichten sammeln, Gerichtssaal- und Theaterberichte, Leitartikel und Lokalplaudereien schreiben, wird auch die Redaktion auskeh ren, den Hund des Verlegers auf die Straße führen und seiner Frau Gedichte senden, die ihre Seele wärmen, zumindest drei Monate lang, dann bekommt er ein vorzügliches Zeugnis, und der Verleger findet einen' neuen Volontär. Natürlich sind zwei Volontäre noch profitabler als einer. Mein Kollege hieß Norbert Jacques und stammte aus Luxemburg. Er hatte in Bonn Germanistik studiert, als er sich in eine reizende Schauspielerin verliebte, die jedoch von Bonn nach Beuthen in Oberschlesien engagiert wurde. Er mußte mit ihr fahren, er wäre ihr auch in die Hölle ge folgt. So teilte er seinen Eltern mit, der beste Lehrstuhl für Germanistik stünde derzeit in Breslau, dort wolle er seine Stu dien fortsetzen. Aber aus Sparsamkeit wolle er nicht in Breslau selbst wohnen, sondern in einem hübschen Vorort: Beuthen. Es liegen tatsächlich sechs Schnellzugstunden zwischen der Stadt und diesem Vorort, aber von Luxemburg aus schien es 24
nicht so weit, und der Vater Jacques schickte seinem Sohn ver trauensvoll den Wechsel von zweihundertfünfzig Mark all monatlich nach Beuthen bei Breslau. Wir wurden in dem engen Redaktionslokal gute Freunde; es ist seltsam, daß gerade wir beiden, in der Vorkriegsepoche die größten Weltumsegler der deutschen Presse, daß wir beiden Beuthener Volontäre rivalisierende Romanschriftsteller wurden, nachdem wir ein paar Monate lang im Korrekturlesen rivali siert hatten. Norbert Jacques nahm wenige Jahre nach dieser Beuthener Episode einen großen Anlauf. Er schrieb den zauberhaft schö nen Roman „Funchal", wachte eines Morgens auf und war be rühmt! Daß er dann auf das Niveau seines Welterfolgs „Dr. Mabuse“ herabstieg, daß er vom Dichter zum Filmbuchautor sank, einen Achtzehn-Zylinder-Mercedes fuhr und gute Literatur für einen sinnlosen Sport erklärte, war das Verhängnis seines zu frühen Erfolgs. Je höher die Honorare sausten, um so tiefer tauchte der Poet - das ging hier auf, dort ab - von Stufe zu Stufe. Ein halbes Jahr Oberschlesien, wieder ein halbes Jahr Berlin, ein Jahr Hamburg - da hatten sich viele Nebel verflüchtigt, und in der deutschen Presse herrschte kein Raummangel mehr, sondern Mangel an Stoff. Meine Geschichten aus der Mann schaftsstube liefen so schnell durch die Spalten der Linkspresse ganz Deutschlands, daß ich nicht folgen konnte. Vorgestern waren sie nicht das Papier wert, jetzt wurden sie gestohlen, aber gerade darauf war ich stolz! Denn niemand stiehlt wert loses Gut. „Aus der Mannschaftsstube“ wurde mein erstes Buch, das mir viel Ehre brachte, denn es kam sofort auf eine Liste in den Kasernen verbotener Literatur. Ein Musketier oder Ulan, in dessen Spind es gefunden wurde, bekam zumin dest drei Tage Arrest. Wahrscheinlich - denn es erschien in Auflagenwellen - hat es der Summe meiner Leser viele Jahr zehnte Mittelarrest eingetragen. Arme Musketiere und Ulane! Aber kann jemand ein Buch vergessen, für das er drei Tage lang bei Wasser und Brot auf einer Holzpritschc saß oder lag? *5
Mein Haß gegen die preußische Armee hatte eine zum Mar tyrium bereite Gemeinschaft gefunden. Mit zweiundzwanzig Jahren wurde ich Feuilleton-Redakteur einer demokratischen Hamburger Zeitung und schrieb fast täg lich eine lange Spalte - ich durfte mich austoben wie ein junges Pferd auf der Weide. Ich machte sechzehn Stunden Dienst, denn nach den Redaktionsarbeiten gab es fast jeden Abend eine Premiere, einen Vortrag, eine wichtige Versammlung, und zweimal wöchentlich mußte ich eine „Hamburgiensie“ liefern, das heißt ein aktuelles Feuilleton mit starkem Lokalkolorit. Ich ging in die Schwurgerichtsprozesse und schrieb darüber novel listische Stimmungsbilder, immer gegen die Anklage, immer für die Angeklagten. Ich durchstreifte den Hafen, fand vieles, das im Baedeker nicht steht, besuchte Streikversammlungen und nahm die Partei der Arbeiter, trieb mich in Sankt Pauli herum und durchleuchtete die dunkelsten Winkel. So entstand mein zweites Buch „Der Hamburger Hafen“. In Hamburg lebten damals drei große Poeten, Richard Dehmel, Detlev von Liliencron und Gustav Falke. Sie empfingen mich, ließen sidi von mir porträtieren, antworteten auf meine Briefe. Dann entstand der „Bund für Mutterschutz“, eine revolu tionäre Bewegung gegen die herrschende Unsittlichkeit, die uneheliche Mütter und Kinder Not und Schmach tragen ließ. An der Spitze dieses Bundes standen drei Frauen, deren Namen wohl unvergessen sind: Lydia Gustava Haymann, Anita Augspurg, Adele Schreiber. An der Spitze der Hamburger Gruppe stand der Rechtsanwalt und Reichstagsabgeordnete Siegfried Hekscher - er ließ mich in großen Versammlungen sprechen. Zum ersten Mal erlebte ich stürmische Applause, die mir gal ten. Hans Olden kam oft mit seiner jungen Frau nach Hamburg, um mich zu besuchen - ich war kein Orestes mehr für ihn. Zu alledem trug ich einen goldenen Ring am Finger, denn so prächtig sah meine Zukunft aus, daß ich schon im ersten Halbjahr aufs Standesamt eskortiert worden war - und den noch ... Nacht für Nacht am Schreibtisch, bis der Morgen durch die
26
Scheiben schlich, war ich plötzlich ernüchtert und faßte nicht, daß so viele gewichtige Männer, Sozialreformatoren, Dichter, Künstler, meine Kollegen sogar, mich ernst nahmen. Ich war doch nur ein dreimal sitzengebliebener Schuljunge, halbgebil det - oft kam ich mir wie ein Hodistapler vor, der sich als Literat ausgibt. Aber dann nahm sogar der Staatsanwalt mich ernst! Ich hatte ein Gerichtsurteil der Nordhausener Strafkammer so scharf kritisiert, daß sie Strafantrag stellte! Als ich vor einem Kollegium weißbärtiger Richter stand, die mich nicht ohne Güte, aber sehr erstaunt anblickten - denn ich sah noch jünger aus, als ich war -, als der Präsident meinen inkriminierten Artikel vorlas, mit seiner müden Stimme meine schäumende Empörung unterstrich, fühlte ich ganz meine Un reife. Dann donnerte der Staatsanwalt: „Und dieses dreiundzwan zigjährige Herrchen wagt es ...“ Immer wieder. „Dieses kaum dreiundzwanzigjährige__ ", als wäre gerade das mein Verbre chen, jung zu sein. Siegfried Hekscher verteidigte mich: „Mag der Angeklagte auch in Maß und Form geirrt haben, bedenken Sie das leiden schaftliche Temperament dieses Jünglings, der es nicht ertragen würde, unwidersprochen zu lassen, was er für Unrecht hält! Bedenken Sie seine dreiundzwanzig Jahre__ " Ich bekam das letzte Wort und sagte: „Der Herr Staats anwalt bucht meine Jugend, als straferschwerenden, mein Ver teidiger als mildernden Umstand. Ich bitte, beide Argumente abzulehnen. Ich habe ein Amt; was ich geschrieben habe, ver trete ich - bitte verurteilen Sie mich, wenn Sie es für nötig halten, als ob ich sechzig auf dem Rücken hätte." Ich hatte, glaube ich, Lust, ein paar Monate ins Gefängnis zu gehen, ein bißchen Märtyrer zu sein und mich gründlich auszuschlafen. Aber ich bekam nur eine hohe Geldstrafe, die nach herrschendem Brauch jdcr Verleger zu tragen hatte. Dann wurde ich zu einem Sektfrühstück eingeladen. Abends mußte ich dem Verleger den Ablauf der Verhand lung schildern. Er knurrte kaum, der ganze Prozeß war billige Propaganda für sein Blatt. 27
Ich zog mich zurück mit den Worten: „Und jetzt schreibe ich mein Nachwort zu dieser Verhandlung.“ Er aber telefonierte sofort an den Metteur: „Herr Olden wird Ihnen heute ein Manuskript geben, das nicht gesetzt wird!" Und dem Redaktionsdiener befahl er: „Bringen Sie Herrn Olden viel schwarzen Kaffee."
III Ich habe erzählt, wie ich mit dreiundzwanzig Jahren eifrigster Kuli in einer Hamburger Inseraten-Plantage war, Familien vater, schlecht bezahlt, aber hoch geachtet im Vergleich zu dem Respekt, den ich selbst vor meiner Leistung empfand. Zwei Jahre lang ging ich diesen Weg, freilich mit endlosen Seitensprüngen - dann geriet ich in einen Zustand zwischen Erbrechen und Zerbrechen. Ich packte einen Rucksack und lief einfach davon - mein ehrenwertes Publikum fand eines Tages im „General-Anzeiger“ einen Abschiedsbrief, der mit zornigen Versen durchsetzt war:
Ihr braucht mir gar nicht bös zu sein, Daß ich anhub zu laufen Ich war ja viel zu lange In Eurer grauen Stadt. Was hatt ich denn zu schaffen Mit allem, was Ihr schafftet, Ich will nur durch die Welt Auf lauter Lieder lauschen. Ich will ja nur vergessen, Daß Ihr mich eingespannt habt, Zu ziehen an Eurem Wagen, War einst ein freier Gesell 1
Bin wieder einer geworden. All Straßen sind mein eigen -
28
Auch meiner Frau, für die ich viel zu dumm und die viel zu klug für mich gewesen, schrieb ich ein Abschiedslied ins Blättchen, ihr aber ein zärtliches, das begann:
Du Feines, Weißes, Liebes, Hör nicht auf all die andern, Ich hab Dich liebgehabt, Hör Du, lieb, lieb, liebgehabt Morgen muß ich wandern. Zum Schluß dieses Briefes bat ich sie:
Zieh ein buntes Kleid Dir an, Wasch Dir blank die Augen Draußen ziehn viel Burschen jung, Hörst Du, Mädel, jung, jung, jung, Die Dir alle taugen.
Sieh, aus mir wird nie was Rechts, Solch ein Bursch wird Meister! Du Frau Meist’rin, ei potzdaus, Klippklappklipp geht’s dann durchs Haus, Ich bin ein Verreister ... Viel mehr als Papier und Blei konnte ich auf diese Fahrt, die mehr ein Purzelbaum ins Bodenlose war, nicht mitnehmen, dazu die Aufgabe, als unbehauster, unbekannter Literat eine kleine Familie zu ernähren. Solche Purzelbäume haben sich in meinem Leben oftmals wiederholt. Es ging durch furchtbare Krisen, mein Dasein drehte sich wie ein Kork im Wirbel vieler Strudel, aber ich schrieb, kritiklos oft, eilfertig, Nacht um Nacht, wie ich es in Hamburg gelernt hatte, und hielt mich oben. Von den Näch ten der folgenden zehn Jahre habe ich gewiß zwei Drittel am Schreibtisch verbracht, bis die Sonne aufging und der Tages lärm mich ins Bett scheuchte. Immer wieder zog die Bour geoisie mich an ihre warme, flaumige Brust - einmal war ich Madrider Korrespondent der damals höchstgeachteten „Köl29
nischen Zeitung“, mußte einen Zylinder tragen und in der Bot schaft verkehren, war hochbezahlt und pensionsbereditigt -, ein Jahr später hieß es aber „Morgen muß ich wandern“. Ge halt und Pensionsberechtigung blieben hinter mir im Staub liegen. Daß ich damit weise handelte, wußte ich nicht, ich folgte ja nur, wie ich mußte, dem Gesetz, nach dem ich an getreten. Dank dieser Treue aber habe ich mein Leben voll gelebt, die Meere befahren, die fernsten Länder durchzogen, ich habe mich nie gelangweilt, keine Stunde war leer, und ich brauchte nie Konzessionen zu machen! All das war bezahlt mit einer Altersrente, die ich nicht zu beklagen brauche, denn heute säße ich ja doch irgendwo, wo kein Scheck aus Köln mich erreichte. 1914 trat ich eine Reise an, die sechs Jahre dauern sollte eine Rundfahrt durch alle deutschen Kolonien, die in Ost afrika, Südwest, Kamerun, Togo, die in der Südsee, die an der chinesischen Küste. Ob einer meiner Leser sich erinnert, daß Deutschland einmal so reich war? Mein Unternehmen war aktuell, denn damals war das Deutsche Reich im Begriff, die riesigen portugiesischen Kolonien Angola und Mocambique käuflich zu erwerben, mit Englands und Frankreichs Zustim mung, und damit hätte es Zentralafrika völlig beherrscht, ohne Blutvergießen. Meine Reise hat wirklich genau sechs Jahre lang gedauert, aber sie verlief nicht völlig programmäßig. Die letzte Zeitung, die ich auf dem Kontinent las, berichtete vom Empfang eines englischen Geschwaders in Kiel, der ein großes Verbrüderungsfest der beiden Flotten war. „Es gibt nur zwei Gentlemen-Nationen auf Erden“, erklärte beim Bankett ein englischer Admiral, „die deutsche und die englische!“ Kein Prophet und kein Astrologe sagte damals Krieg vor aus. Aber als mein Dampfer in Mombasa an Land ging, war der österreichische Thronfolger von ein paar serbischen Fana tikern ermordet worden, und Wilhelm II., der schlimmste Dilet tant der Weltgeschichte, hatte Österreich die Nibelungentreue seines Volkes zugesichert, für alle Konsequenzen, die sich er gäben, wenn es Serbien züchtigen wolle. So etwas träumt man
jo
vielleicht nach einem Whiskygelage - Serbien sollte gezüditigt werden für eine Untat; die zwei jugendliche Serben auf öster reichischem Boden begangen hatten? Aber es war kein Traum, soviel Wahnsinn gebiert kein Traum, das konnte nur in der Wirklichkeit sein. Ich unternahm eine Besteigung des Kilimandscharo, mein Begleiter war ein lustiger junger Hauptmann der Schutztruppe, der mich und seinen Boy und seine Träger sogar um unser Schicksal beneidete. „Sie Dichter“, sagte er, „Sie schreiben drauflos, gut oder schlecht, aber Sie üben Ihren Beruf aus. So ein armes Schwein von Offizier-Soldat hat überhaupt nicht gelebt, wenn es keinen Krieg gibt! Und es kommt keiner!“ So pessimistisch dachte er noch, als wir die Bergtour an traten. Ein paar hundert Meter unter dem Gipfel des Kili mandscharo fingen uns Nebel ab, wir hätten uns sonst als siebter und achter Kilimandscharo-Bezwinger ins Gipfelbuch eintragen können. Statt dessen lagen wir zwölf Stunden lang in eisiger Kälte auf einer Felsplatte, die nicht viel größer war als ein Billardtisch, rechts und links steiler Abgrund, in unbe schreibliches Dunkel gehüllt. Der Hauptmann deckte sich mit Negerfleisch zu, schlief und träumte von Trommelschlag und Hörnerklang. Ich schlief nicht, aber im Wachen träumte ich von anderen Dingen. Die frierenden Neger heulten laut, sie ver fluchten diese Bergregion, in der Scheitani, der Teufel, haust! Zwei Tage später lachte uns wieder das Tal, die Sonne schien, wir zogen durch duftigen Urwald, Alfen schimpften uns aus, und Vögel jubelten. Dann kam ein weißer Knabe uns ent gegengerannt, beinahe heulend vor Glück. „Krieg!“ schrie er, „Deutschland, Österreich, Serbien, Rußland, Frankreich... I“ Der Hauptmann war plötzlich so jung wie dieser Knabe, sie sprangen in die Luft, sie führten einen Indianertanz auf, sie umarmten einander und umarmten auch mich, über dessen un schuldigem Haupt das schöne Bild der ganzen Welt zusammen brach. Ich war der einzige Schriftsteller in Deutsch-Ostafrika und hätte als Kriegskorrespondent in des Generals Lettow-Vorbeck Auto durchs Land fahren können. Aber das Abenteuer überP
wand mich. Da nun einmal Kämpfe, Schlächtereien stattfinden sollten, drängte es midi dabeizusein. Ich redete mir freilich ein, gerade als Pazifist müsse ich mitmachen, um nicht später als einer zu gelten, der aus Angst den Frieden predigt. So stieß ich sofort zu einer Schar undisziplinierter Kolonialverteidiger, ritt Patrouillen, von denen eine vier Wochen dauerte, tief ins englische Gebiet hinein, wo wir ein Stückchen Feldbahn spreng ten, ein paar Salven mit einer ebenso undisziplinierten eng lischen Freischar wechselten und mit einem erbeuteten Maul tier stolz den Kampfplatz verließen. Wir wurden Wilde, die verkommensten und verwegensten Soldaten der Afrikatruppe. An der Mauer des Urwalds ließen wir Feuer aufflammen, von denen die Wolken sich wie Blut und Schwefel färbten, zehn Meilen weit Freund und Feind verrieten, wo die „Berittene Neunte“ lag. Im ersten Halbjahr verloren wir zehn Prozent unserer Mannschaft durch Kämpfe, Typhus und Schwarzwasserfieber - wir lagen um unser Feuer, leerten Flaschen Whisky, deren Marken „Stacheldraht“ und „Heldentod“ hießen, grölend und tobend wie wilde Tiere, bis wir am lodernden Feuer in Schlaf fielen. Rings im Kreis um diese Feuer klafften schwarze, rund offene Schlünde, schnarchten arme Teufel von Europäern, die sehr viel Schnaps gebraucht hatten, um zu vergessen, daß sie allein waren, nichts von ihrem eigenen Leben mehr wußten, keinen Brief von ihren Frauen, kein Wort von ihren Kindern hatten - seit endlos langer Zeit. Daß hinter ihnen eine ver dorrte Pflanzung lag, ein zerstampftes Stück Lebensarbeit, ver rottet aller Glaube an die Zukunft. Daß sie schießen und het zen mußten, bis sie fielen oder selbst im Urwald verhetzt zu sammenbrachen, daß kaum einem von ihnen auf dieser Erde noch ein zärtliches Wort ins Herz fallen würde. Daß sie aus lauter Not Säufer und Helden geworden. Unser Führer hieß Büchsei, und unser Kriegslied hatte den Refrain: Das ist Büchseis wilde versoffene Jagd. Ich war auf Patrouille und Vorposten gut zu brauchen, im Lager aber wirkte ich wie Dynamit, je mehr aus unserer wil-
3*
den versoffenen Jagd eine ordentliche Truppe wurde. Anstelle des Abenteurers Büchsei trat ein peinlich korrekter MarineOffizier, der Ruhe und Disziplin forderte wie auf einem Kriegsschiff. So wurde ich immer eingesetzt, der Herr Kapitän leutnant fand keinen Schlaf, wenn ich im Lager war. Er wollte mich los sein, tot oder lebendig, und wurde mich los. Ende 1916 fuhr ich als Gefangener nach Indien, bald war ich wieder der gesittete junge Literat, als der ich ausgezogen, der leiden schaftliche Pazifist, und begriff nicht mehr, daß ich ein toben des Untier gewesen. Ich schrieb zwei Bücher, wurde Regisseur, Hausdichter, Schauspieler im Lager-Theater, Professor der Lager-Hochschule, ich trug sechs Jahre lang den dornigsten Jungfernkranz, denn zu tief lebte in mir das Gedächtnis schö ner, kultivierter weißer Frauen, als daß ich sie im Arm einer Schwarzen hätte vergessen können. Genau sechs Jahre nach der Ausfahrt, im Frühjahr 1920, kehrte ich nach Deutschland zurück - in das besiegte Deutsch land, das hungrig und kalt war, aber eine neue, edlere Ideo logie als die der Kaiserzeit entwickelte. In ein siegreiches Deutschland wäre ich nicht heimgekehrt. Dort schrieb ich als Vorwort meines Romans „Kili mandscharo" einen Brief an die weiße Dame: „Immer, seit ich, nach Kampf und Gefangenschaft in den Tropen, Europa wieder betrat, empfinde ich vor jeder Frau, deren Blick nach dem Erlebten, Durchlittenen fragt: Dir bin ich treu gewesen! Auf den Treppen eines Theaters, im Bahn wagen, in Parks und Gassen begegnet mir jetzt hundertfach, in immer lockender Gestalt, dieser Gegenstand meiner zähen und erhabenen Treue: die weiße Dame. Sie hat ihre Silhouette ver ändert, auch ihr Wesen blieb vom Kriege nicht unberührt, seit ihre Hände in blutigen Verbänden gewühlt, seit sie - deren Aufgabe es doch schien, uns durch so viel Daseinsnot hindurch zulächeln - eine Welt miterleben mußte, auf die zur Antwort es nur Tränen gibt. Aber ganz geglaubt hab ich kaum ihr siegreiches, geliebtes Lächeln, als sie zärtliche Seide an noch verhüllten Fesseln trug, und so ist sie mir weder rätselhafter noch deutlicher, seit sie den armen Flor zeigt. Ich kenne sie nicht, ich kannte sie nie, 5
Paradiese
33
ich liebe sie nur, und das geht sie nichts an. Aber es geht sie an, daß ich treu war, denn durch sechs Jahre, in denen mein Arm fast das Bewußtsein warm umschlossener, weicher Hüften verlor, hab ich sie gefüttert und schwatzen, tanzen und beten lassen, hab sie an- und ausgezogen, die zappelnde Badepuppe, hab ihre Torheiten angebetet, ihr jede Schändlichkeit verziehn, hab sie in oft verkrampftem Herzen durch afrikanische Steppe, über die Meere, durch Wüsten der Gefangenschaft getragen. Sechs Jahre lang, ohne den Hauch eines zärtlichen Wortes, im Zölibat, das bis in die Adjektive puritanisch zensierter Briefe reichte - sechs Jahre lang! Die ihr die Herzen der Menschen kennt, sagt, war es Liebe? Fast bin ich ja verbrannt. Und härt ich es verdient, daß die weiße Dame jetzt meine wunden Nerven streichelte, meine Prosa lobte, die Furchen in meinem Gesicht nicht sähe?“ Ich bekam zahlreiche Briefe weißer Damen zur Antwort. In einem hieß es: „Natürlich wollen wir gern Deine wunden Nerven streicheln. Du müßtest nur genauer sagen, um welche Nerven es sich handelt.“
IV Wenn der Krieg tobt und die jungen Männer, Ehegatten, Bräutigame und präsumptive Bräutigame in Hekatomben fal len, lesen die Mädchen - soweit sie klug und ehrlich gegen sich selbst sind - mit Befriedigung, daß auch viele Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten. Sie suchen sich auf gut Glück Schützlinge hinter den Stacheldrähten, schreiben ihnen, schicken Selbstgebackenes und Selbstgereimtes - briefliche Verlobungen zwischen Menschen, die einander nie gesehen haben, sind häu fig. Wie hoch aber die Verlobungswelle in den Heimkehrer lagern geht, das meldet keine Statistik, man muß es erlebt haben. Da treten Rotkreuzschwestern und Sekretärinnen, frei willige Helferinnen, Blut- und Blumenspenderinnen voll heili gen Eifers an; die Jungens, nach ihrer langen Liebeshungerzeit, jauchzen vor Glück und binden sich für ewig, lang ehe sie prüften, ob Strenge sich mit Zartheit paart. 34
Es war schon 1920, als wir „Inder“ heimkehrten. Noch sta ken die deutschen Städte in eisigkaltem Elend, nachts waren die Straßen dunkel und gefährlich, in den Cafés glühten Aze tylenlampen, deren Schein die Gesichter leichenhaft färbte. Aber wir fanden so offene Herzen, so weiche Arme, so freudi ges Geben - und über diesem umdüsterten, ausgebluteten, aus gehungerten deutschen Reich wehte die Fahne von 1848, strahlte die Weimarer Verfassung, die andere, bessere Zeiten verhieß als die des Hohenzollernstaates. Nach solcher Trennung, sol chem Erleben die liebsten Menschen, die alten Freunde wieder zu sehen - das ist ein so unbeschreibliches Glück, daß sechs Jahre voll Leid und Angst von der zermürbten Seele einfach abfielen wie Aprilschnee. Meine Schwester Ilse eilte mir mit zweien ihrer nun schon großen Kinder aus der Schweiz nach Berlin entgegen; sie war gar nicht verändert, hatte dieselben Augen, dieselben Worte, wir waren nie getrennt gewesen 1 Dann aber fand, als wir kaum eine Woche im Land waren, eine Begrüßung statt, die den grausen Namen „Kapp-Putsch“ führte. Die Brigade Ehrhardt kam aus dem Baltikum anmar schiert, besetzte die Reichshauptstadt wie feindliches Land, ein paar Tage lang pfiffen Maschinengewehre über Plätze und Straßen, Handgranaten flogen, es wurde gesungen, geprügelt und gesoffen, die legitime Regierung floh, Reichswehr und Polizei standen stramm, wer ein schiefes Maul zog, lag blu tend im Dreck. Und uns regierte ein dem Nichts entstiegener Herr Kapp, ein strenger Herr, der freilich nicht lang regierte. Denn die Berliner Arbeiterschaft streikte, daß es eine Lust war zu hungern, zu frieren, ohne Telefon, ohne Tram und Bus einander doch zu finden, von Stunde zu Stuúde die feindliche Macht wegschmelzen zu sehen - es dauerte kaum eine Woche, da flüchtete Kapp, diese Marionette der Herren mit dem lan gen Säbel, nach Schweden, zu Ludendorfi, zu Göring, kurz, in gute Gesellschaft. Am Kapp-Putsch gab es etwas zu lernen, aber gute Schüler waren nur die Schwarz-Weiß-Roten, nicht die Schwarz-RotGoldenen. Kapp stellte sich zwei Jahre später dem Reichs gericht und erhielt einen Verweis nebst etwas Festungshaft, die
Verschwörer verloren sich in der Landschaft, Feme und politi scher Mord tobten, die Republik anzuspeien war Sport, sie zu verteidigen Spiel mit dem Tod. Wer die Zeitungsarchive jener Jahre durcharbeitet, wird sich verneigen müssen vor einer Reihe politischer Schriftsteller, die schrieben, als gäbe es all das nicht, Revolver und Totschläger, Reichsgericht und Kerker, die immer schärfer, bissiger, glänzender schrieben, je höher die Gefahr wuchs. Der einst preußischer als die Itzenplitze war, zum Präventiv krieg gedrängt, den Friedenswärter Prinz Eulenburg in den Tod gequält hatte, Maximilian Harden, kämpfte jetzt für Wei mar und wurde im dunklen Grünewald mit Eisenstangen zer schlagen. Fritz Wolff, Siegfried Jacobsohn, Stefan Großmann, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Egon Erwin Kisch, Rudolf Olden - keiner von ihnen hielt sich eine Garde, keiner trug eine Waffe, keiner verrammelte seine Tür. Ich zählte hier nur wenige auf, die ich aus engster Nähe gekannt habe. Sie be kamen täglich Briefe mit schrecklichen Todesdrohungen, ihre Frauen zitterten vor den ewigen Telefonanrufen „Hier Feme“, „Hier Schwarze Hand“, und vielleicht zitterten sie selbst. Aber am Schreibtisch war jeder ein Winkelried, der Breschen in die Feindeslinien riß, indem er ihre Hellebarden auf die eigene Brust lenkte.
Als Siebzehnjähriger hatte ich einen Zyklus Zigeunerlieder geschrieben; ahnungsvoll erkannte ich damals, daß ich nie zur Ruhe kommen würde. Mit siebenunddreißig wollte ich das nicht mehr wahrhaben, wollte nicht länger ein Vagabund auf den großen Straßen des Globus sein, begann ich, Hotels, Baracken und Zelte zu hassen. Die Frau, mit der das Ehefieber des Heimkehrers mich verbun den hatte, war fast noch ein Kind - und auch ein Eisenbahn kind, wie ich es gewesen. Mich überkam ein Verlangen nach Heimat, sattem, grünem Land, nach Bauersein. Zwischen meiner Mütze und den Ster nen sollte ein festes Dach sein, eigener Boden unter unseren Füßen. Wie dieser Traum ganz plötzlich Wirklichkeit wurde, das 36
Luftschloß sich in ein Maria-Theresia-Schlößchen aus schweren Quadern, der Wolkenboden sich in fünfundsiebzig Hektar herr liches Land verwandelte, das freilich von hochprozentigen, rauschenden Hypotheken beschattet war, klänge mir heut selbst märchenhaft, wenn ich es hier erzählte. Unser Landgut hieß „Klein-Sternberg“ und lag am Ende des weitgestreckten Wörther Sees, ein stattlicher Hügel, der vom Fuß bis zum Gipfel unser Eigentum wurde. Es war kein An kauf, mit dem wir „Klein-Sternberg“ erwarben, sondern eine Eroberung, ein Liebesakt. Wir gaben hin, was wir besaßen, und unterschrieben, was man uns vorlegte, sahen die Löcher in den Dächern, zählten das Vieh nicht, so unbeschreiblich waren wir verliebt. Rings um die Waldkuppe unseres Berges bauten wir eine Reitbahn, gut zwei Kilometer lang, in weichen Acker boden. Dort lehrte ich mein Kindweib galoppieren und traben, bei jeder Runde wechselten diese Bilder wie im Panoptikum. Da war der hohe Triglav mit der ungeheuren Pracht seines Gletscherfeldes, da ruhte der Wörther See, jetzt kam das Hexental, dicht bewaldetes Hügelland, in das der Sternberg rücken sich verlor; dann nach Norden, über ein paar Bauern höfe hin, lag breit und gelb die Landstraße, auf der wir vor wenigen Wochen erst im knarrenden Ford diese Heimat gesucht hatten. Sie lief am Schneebach hin, gischtend hastigem Wasser in einem felsigen Bett; eine Brücke spannte sich darüber, das Ganze war mit gelber Postkutsche, Bauernfuhrwerk und Mühle wie ein Blatt aus einem Kinderbilderbuch. Und jetzt blaute wiederum der See, sah man Schlößchen und Wirtschaftsgebäude unseres Landguts, Obstbaumplantagen, das rotgedeckte Gärt nerhaus, das Glashaus davor, darunter gebreitet die weiten Gemüsefelder, auf denen erste und letzte Sonne des Tages lag. Kein Laut kam hier herauf als manchmal das Brüllen einer Kuh, der man ihr Kind geraubt, das Pfeifen, Schrillen, Heu len der Schweine, ihr Dankjubel, wenn der Trog sich füllte. Am Fuß des Sternbergs aber zog ein glitzernder Schienen strang hin - den durchfuhr der große, feurige Expreß, der zwischen Osten und Westen, zwischen Paris und Warschau, quer durch Europa tobte und dessen Rhythmus zum SternbergSchlößchen dröhnte. Aus dem D-Zug lehnten Menschen aus 37
Bukarest, Bordeaux, Madrid, Menschen in Eile, denen selbst dieser Zug viel zu langsam fuhr. „Die haben’s gut, die wissen, wo sie daheim sind", mochten sie denken, wenn sie unsere prangende Heimat sahen. „So sind wir auch einmal ruhelos durch die Welt gejagt“, dachten wir. „Ihr Armen I“ Dann aber kam, als gerade unsere ersten Wechsel reiften, also nach sechs Monaten Gutsherrenglück, die Zeit der Bubi köpfe. Mein Weib war eine Bäuerin geworden, ging in schweren Röcken und festen Stiefeln, nannte den Kuhstall unsere beste Stube und griff mit zu, wenn ein Kälbchen kam. Jetzt mußte sie in die Stadt hinein, um sich die langen brau nen Flechten abnehmen zu lassen, all mein Bitten und Grollen half nicht. Drei Tage lang trug sie wieder über einem Nichts von Kombination ein Nichts von Kleidchen, kleine Schuhe statt der Haflinger mit doppelten Sohlen, seidene Strümpfe statt der wollenen. Klein-Sternberg war ihr plötzlich kein Glück mehr, als der Friseur ihre Zöpfe, ein schweres Bündel, in Seidenpapier ge schlagen und ihr überreicht hatte. Glück war es, laue Luft durch flatternde Kleidchen zu fühlen, das Haupt ohne das Gewicht der Zöpfe frei zu tragen, sich selbst in spiegelnden Auslagen zu bewundern, auf den Straßen, im Theater zu fühlen, daß sie bewundert wurde. Dann taten ihr die Reisenden im Ost-West-Expreß nicht mehr leid, sie sehnte sich danach, selbst wieder Passagier zu sein, all das schöne Rindvieh in unseren Ställen war ihr ver haßt. Lange Tage hindurch lag sie im verdunkelten Zimmer, mochte den Mond nicht mehr sehen, wie er seine Brücke über den Wörther See schlug, und haßte die Sonne. Das Erwachen kam grausam vehement - plötzlich wußte auch ich, daß es nicht mein Beruf war, Herden zu weiden und Wechsel zu schreiben, ich schmiedete neue Reisepläne, und der Gutshof, der wirklich im Aufblühen gewesen, sank zurück in jenen schläfrig-schmuddeligen Zustand, in dem ich ihn über nommen hatte. Als es zur Versteigerung kam, lag ich sterbens krank im Hospital von Buenos Aires. Und als ich aus monate langem Fieber erwachte, war meine Ehe geschieden, Klein-
Sternberg verweht, aber nicht vergessen. Viele Jahre lang ließ er mich nicht los, dieser Traum, mit dem ich mein Herz genährt hatte. Erst als ich hörte, daß Kärnten eine Nazi-Hochburg ge worden, daß von allen Dächern am Wörther See das Haken kreuz flatterte, zerriß mir dies Gespinst.
Nach schweren Schicksalsschlägen, schwerer Krankheit kommt ein Zustand, den ich Euphorie der Genesung nenne. Da ist kein Ziel zu fern, kein Werk zu schwer, man war schon alt, fast schon tot gewesen, jetzt tanzt es sich wieder, das Herz schlägt Wirbel, ein Narr, wer zweifelt, daß er ewig lebtl Auch Deutschland selbst gab sich damals einer Euphorie der Genesung hin. Für Künstler und Dichter zumal hat es nie eine Zeit wie diese Jahre bis 1930 gegeben! Oder war auch das nur Phantom, tanzten wir an einem Ab grund, war der Boden nicht längst unterwühlt? Mein Schicksal von 1914 wiederholte sich. Als ich am Gipfel des Kilimandscharo klebte, brach der Weltkrieg aus. Diesmal schaukelte ich auf den Wellen des Viktoria-Njassa-Sees im Herzen Afrikas, da brach eine Eruption in Deutschland aus, die Wirtschaftskrise! Berlin sah bläßlich, hungrig, mutlos aus, als ich es 1920 nach langer Trennung wiedersah. Als ich es 1931 wiedersah, schien es in Not und Jammer er trunken. Die Bettelei war Epidemie geworden, auf den Stra ßen sah man Menschen, die sich in Hungerkrämpfen wanden. Wie hatten die Gesichter sich verändert! Die Augen sprühten Mörderblicke, Haß wurde geschürt und stieg in braunen Lohen empor bis zu den Wolken. Als wären die wenigen guten Jahre nur Katneval gewesen, als fielen nun die Masken und graute der Karfreitag, als sei es Sünde und Diebstahl gewesen, daß man den fröhlichen Tag genossen hatte, so schaute nun die Welt drein. Das war die rechte Zeit für den schamlosen Propheten, der ungeheuren Lüge, die man nach seiner Lehre hunderttausend mal wiederholen muß, um Gläubige zu finden.
?9
V 1917» als die Aussichten eines deutschen Sieges über die ganze übrige Welt sehr hoch standen, hatte ich eine Vision des sieg reichen Deutschen Reiches. Ich sah Regimenter von Zivilisten mit Abzeichen und Fahnen zu Kaisers Geburts- und hundert anderen Gedenktagen durch die Straßen marschieren, sah Metzgerläden mit dem Plakat „Inhaber Träger des E. K. I.“, hörte und roch eine Menschheit, die von den eigenen Kriegstaten auf den Knien liegt und von vergossenen Blutbädern träumt. Damals beschloß ich, nicht heimzukehren, irgendwo auf Erden zu siedeln, wohin von dem Nachgedröhne der eisernen Jahre kein Laut dränge. Die hochgesinnte deutsche Republik, die dann entstand, als Deutschland besiegt und schwach war, die freilich habe ich geliebt I Aber 1933 wurde im besiegten Deutschland Wirklichkeit, was ich damals im indischen Gefangenenlager als Traum erlebt hatte. Schwarz-Weiß-Rot mit dem Hakenkreuz wehte von allen Dächern und aus allen Fenstern, durch alle Straßen Deutsch lands marschierten die Kolonnen der SA, der SS und des Stahl helm - es wurde ein Sieg über die ganze Welt gefeiert, der sich gottlob niemals ereignen sollte. Vorschußlorbeer auf kom mende Waffentaten und ein Blutgestank lagen in der Luft, wie ich ihn 1917 empfunden hatte, und von dem Rhein bis an die Donau sang man Lieder, deren unsere fernsten Enkel sich noch schämen werden. Vor diesem Anblick, diesem Gestank, diesem Rachegeheul entfloh ich. Ein paar Monate später erreichte mich ein Brief der Goeb bels-Offiziösen Thea von Harbou, in dem ich dringend aufge fordert wurde, nach Deutschland zu kommen. „Diese Zeit braucht ihren Gestalter“, schrieb GoebbelsHarbou, „und der können nur Sie sein.“ Auf diese Einladung antwortete ich mit einem Manifest „Mir wäre nichts Besonderes passiert“, dem ich ein Motto aus „Wilhelm Teil" voraussetzte:
40
Ich lebte still und harmlos - Das Geschoß War auf des Waldes Tiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt, in gärend Drachengift hast du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt.
Dann hieß es: Ich gehöre zu denjenigen, die „viel zu früh über die Grenze gegangen sind“, denen nach Herrn Bartels beruhigenden Worten „nichts Besonderes passiert“ wäre, wenn sie das „Dritte Reich“ erwartet und begrüßt hätten. Ich war ja nur ein ganz unpolitischer Romancier. Mein Roman „Kili mandscharo“ hatte zwar die Überzeugung erweckt, daß ich den Krieg nicht für den Vater aller Dinge hielt und selbst einen so glorreichen Feldzug wie den von I9i4bis 1918m Afrika geführten verabscheute. Aber andererseits prangte mein CarlPeters-Roman „Ich bin Ich“ in vielen deutschnationalen Bücher schränken, zahlreiche Nationalisten hielten ihn, wenn auch irr tümlich, für die Verherrlichung eines der Ihren. Als Nichtjude, als Frontkämpfer, durch Jahrzehnte Mitarbeiter bürgerlicher, auch konservativer Zeitungen und Zeitschriften, war ich der Reichstagsbrandstiftung völlig unverdächtig und hätte weiter leben können, wie ich gelebt hatte. Als ich den Staub Deutsch lands schon lange von meinen Pantoffeln geschüttelt hatte, er reichten mich noch wohlgemeinte Briefe inzwischen gleich geschalteter Redaktionen, ich sollte Beiträge senden, und im Exil wurde ich mit dem Rufe begrüßt: „Was wollen Sie denn? Sie hätten doch weiß Gott nicht zu fliehen brauchen 1“ Ich habe diese Ansicht erst später begriffen, erst vor kurzem eigentlich, als vier unserer besten Dichter sich zu einem Kompro miß mit dem Dritten Reich bereit erklärten. Mir war der Ge danke, die Hitlerregierung schweigend zu dulden, unvorstellbar. Ich wußte längst, daß Hitler von all seinen Versprechungen nur die Greuel wahrmachen würde, weil sie das einzige waren, was er wahrmachen konnte. Brot hatte er nicht zu geben. Zu neuer Macht konnte er das Reich nicht führen. Sein Geheim plan, dessen Ausführung er keiner anderen Regierung gegönnt hätte, mit einem Schlag die Arbeitslosigkeit aus der Welt zu
4i
schaffen, blieb auch nach der Machtergreifung sein Geheimnis. Aber Zehntausende der tapfersten Deutschen zur Dauerfolter verdammen, den Geist in Eisen legen, sechshunderttausend Juden unter gräßlicher Seelenpein in den Hungertod treiben, Galgen und Schafotte über das Reich hinsäen, Inquisitions kammern in jedem Marktflecken des Landes errichten, die Hochschulen in Kasernen verwandeln, die Freunde des inter nationalen Friedens zu Feinden der Nation und vogelfrei er klären, zarte Kinder beim Abc zu Mördern und Folterknechten erziehen, aus der deutschen Justiz, die seit langem erbärmlich krankte, eine grauenhaft stinkende Leiche machen - diesen ganzen Teil seines Programmes, der in den Boxheimer Doku menten festlag, konnte er im Handumdrehen ausführen. Eine Satrapenschar, wie die Welt sie noch nie erlebt hat, eine Schar approbierter Fememörder, Ministermörder, gemein gefährlich befundener Geisteskranker stand ihm zur Verfügung. Ich sah ihn mit entsetzten Augen noch entstehen, diesen Garten der Qualen: Deutsches Reich. Auf offener Straße droschen die Totschläger der SA Menschenschädel zu Trümmern, Zuchthäus ler wurden Polizeibeamte, jedes Haus, in dem man sich schlafen legte, konnte über Nacht zur Todesfälle werden. Mit jedem Wort des Protestes sprach man sich selbst das Urteil. Was die eigenen Augen gesehen hatten, durfte der Mund nicht wieder geben. „Sie hätten doch weiß Gott nicht zu fliehen brauchen!“ Was wäre denn dort meine Aufgabe gewesen? Die Augen, die Ohren zu schließen, heitere Romane, friedvolle Stimmungs bilder aus vergangenen Tagen zu schreiben, ein Lügner zu wer den, wie ihn Gott nicht erbärmlicher schaffen konnte. So hätte ich in Schanden grau werden, vielleicht auch das Dämmern einer besseren Zukunft erleben können, für das andere Men schen kämpften. Aber dann wäre mein Grab ja einst ein Mist haufen unter Zypressen gewesen. Es gab nur Selbstmord oder - nein, auch die Flucht aus Deutschland war keine Flucht vor dem Selbstmord! Das Brüllen der Gequälten tobt für den, der hören will, millionenstimmig über alle Grenzen des Hitlerreiches, man kann nichts anderes denken, wie sollte man ande res schreiben?
42
Um mich nicht ausrotten zu müssen, mußte ich gegen den Geist des Bösen kämpfen, aber wie, mit welchen Waffen? In den ersten Monaten des Exils hatte ich fast vergessen, daß ich eine Waffe besitze, daß ich Romane schreiben kann, daß eine Tat zu versuchen war, wie sie einst „Onkel Toms Hütte“ gewesen ist, dies fromme Werk eines redlichen Frauenzimmers, das wie kein anderes Buch die Schmach der Negersklaverei von der Erde tilgen half. Diesen Roman habe ich nun ge schrieben, nicht im Fieber der Wut, sondern so kalt, wie nur der tiefste, ehrlichste Haß macht. Er soll dort wirken, wo Leit artikel und Pamphlete nicht hindringen, er soll bildhaft machen, was die zivilisierte Menschheit heute noch nicht fassen kann. Nur ein Tausendstel, ein Zehntausendstel aller Greuel, von denen ich wußte, durfte ich andeuten, um dieses Ziel zu erreichen - nur soviel, wie die Menschheit mit ihren dumpfen Organen und trägen Herzen gerade noch aufnehmen kann. Manchmal, während der Arbeit, kam ich mir wie ein Lügner vor, weil ich so viel Wahres verschwieg. Aber es war doch schön zu denken, daß dies Zehntausendstel Ohren aufreißen und Herzen zum Sturm entfalten könnte, bis sie Kraft genug haben, die ganze Wahrheit zu hören und zu glauben, bis sie nicht mehr zaudern können, das Infame auszurotten. Aber, selbst wenn mein Buch ein Fehlschlag werden sollte, wenn mir der große Fanfarenstoß nicht gelungen ist - was meine Kraft vermag, habe ich getan. Zu diesem Zweck, um meine Seele retten zu können, war es weiß Gott nötig, daß ich das Land verließ, für das ich in Ost afrika im Weltkrieg gekämpft, dem ich eine Steuer von sieben meiner besten Jahre entrichtet habe und in dem mir vielleicht nichts „Besonderes“ passiert wäre. Heute wissen wir alle, daß ich die Macht des Bösen damals unterschätzt habe, aber nicht den Geist des Bösen. Wir wissen auch, daß mein „Roman eines Nazi“, obwohl er in England, Amerika, Rußland viel gelesen wurde, so wenig Wirkung hatte wie alle anderen Bücher der emigrierten deutschen Literatur, die von schauriger Wahrheit strotzenden Berichte von Bredel, Langhoff und anderen aus dem KZ, wie alles, alles Gedruckte, Gezeichnete, Gesprochene, das an das Weltgewissen rühren 45
wollte. Es gab kein Weltgewissen wie in den Tagen der Skla venbefreiung, wie noch vor wenig Jahrzehnten die KongoGreuelberichte Sir Roger Casements, wie jenes Manifest des Tiersdiutzvereins oder des Vereins zur Bekämpfung des Mäd chenhandels, den es nicht gab. Eine kostbare Anerkennung aus dem Dritten Reich aber brachte mir dies erste Auftreten als Politiker: Ich wurde ex patriiert! Im ersten Hundert, auf Liste 3 stand mein Name mit einer ganzen Liste schwerer Delikte. Dies Ausbürgerungsdekret war nicht nur ein Orden, sondern auch eine mächtige Hilfe Besseres hatte dies zertretene und versklavte Vaterland seinen treuesten Söhnen nicht zu geben. Es wurde uns natürlich nicht vom Konsul des Dritten Reiches offiziell zugestellt, aber die Listen wurden in allen Zeitungen der Erde abgedruckt - ich bekam, mit Glückwünschen, einen Ausschnitt aus Holländisch indien -, und die schwedischen Konsulate gaben uns auf Wunsch eine hochoffizielle Bestätigung. Das war ein kostbares Stück Papier, halb Todesurteil, halb Diplomatenpaß.
VI Im Sommer 1934 wurde ich durch ein langes Telegramm aus Moskau überrascht, das von einer Reihe russischer Schriftsteller mit weltberühmten Namen unterzeichnet war, eine Einladung, am „Ersten Weltkongreß revolutionärer Schriftsteller“ teilzu nehmen. Ich kam mit Freuden, aber mit der Absicht, nicht zu sprechen, nur Augen und Ohren aufzumachen, skeptisch zu sein und skeptisch zu bleiben, was immer ich sähe. Zwischen Bahnhof und Hotel erlebte ich eine geschäftige Großstadt mit vielen prächtigen Neubauten, gänzlich ohne Bett ler, ohne sichtbares Elend, gänzlich ohne Eleganz, viel gut uniformiertes Militär allenthalben, ausgezeichnete Verkehrs ordnung. Auf dem Weg vom Hotel zum Adelspalais, in dem unser Kongreß tagte, erlebte ich mehr: Kilometerweit standen auf allen Zugangsstraßen Männer und Frauen in Arbeiterkleidung Spalier! Es war kein Hallo, kein Fahnenschwenken wie in den 44
Zarentagen, wenn die Aristokratie des Russenreiches sich hier versammelte, auf diesen Tausenden von Gesichtem lag Weihe, Jubel brach aus, wenn Maxim Gorki, Abgott der Sowjetunion, gesichtet wurde oder einer ihrer hohen Staatsmänner, aber auch dieser Jubel war gedämpft, klang fast andachtsvoll, viel mehr „Kyrie eleison" als „Hurra". Aus allen Weltteilen waren Literaten in diesem Palais ver sammelt, China und Japan waren vertreten, Angehörige aller politischen Richtungen, die gegen den Faschismus kämpften. Im Sitzungssaal erschienen auf der Tribüne Vertreter aller Berufe und Industrien, Kinder-Delegierte, Soldaten des Heeres und der Marine, alle, um uns zu begrüßen, uns ihre Herzen aus zuschütten, ihre Programme zu entwickeln. „Kommt auf unsere Schiffe, Ihr sollt die besten Kabinen be kommen!“ rief ein Soldat der Schwarzmeer-Flotte. „Wir lehren euch schießen, und ihr lernt uns kennen!" Vier Wochen lang tagten wir, und diese vier Wochen hin durch gab es in den Zeitungen ganz Rußlands kaum einen Winkel für Leitartikel - alle waren sie voll von den Kongreß reden, Fotos und Karikaturen der Redner, Biographien der Delegierten. An den Nachmittagen besuchten wir Fabriken und Kasernen, die Kulturparks, Gefängnisse, wurden in den Ministerien emp fangen und diskutierten mit den höchsten Beamten des Riesen reiches, die ausnahmslos jung waren, Männer und Frauen. Später teilten wir uns in kleine Gruppen, die in eigenen Waggons durch die Provinzen fuhren. Führer meiner Gruppe war der Verfasser von „Brülle, China!“, der große Schriftsteller Sergej Tretjakow. Ernst Toller war dabei, Oskar Maria Graf, Theodor Plivier, Albert Ehrenstein, Adam Scharrer, die Spa nier Rafael Alberti und Maria Teresa Leon, die ich zehn Jahre später in Buenos Aires als Flüchtlinge wiedersah. Wir reisten durch den Kaukasus, ans Kaspische Meer, ans Schwarze Meer, besuchten deutsche Siedlungen, in denen kaum ein Mensch eine andere Sprache als Schwäbisch sprach - und überall war dieser Enthusiasmus für die Literatur, ihre Freude über Gäste, deren Namen - mit Ausnahme des meinigen und der Spanier - allen bekannt waren.
45
„Mit verelendeten, hungernden Menschen über geistige Dinge zu sprechen wäre einfach dumm", äußerte damals Mussolini in einer Donnerrede, und ich fand das Positivum zu dieser mehr als richtigen These: „Nur ein Volk, das aus Elend und Hunger heraus ist, kann sich so leidenschaftlich mit geistigen Dingen beschäftigen.“ Noch zwanzig Jahre zuvor waren 75 Prozent aller Russen Analphabeten gewesen. Jetzt waren 75 Prozent aller Russen leidenschaftliche Bücherleser! Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, Mein Weib! Wir haben aucl^ Arbeit, und gar zu zweit, Und haben die Sonne und Regen und Wind, Und uns fehlt nur eine Kleinigkeit, Um so frei zu sein, wie die Vögel sind: Nur Zeit!
läßt Richard Dehmel seinen deutschen Arbeitsmann sprechen, und das Gedicht schließt: Nur Zeit! Wir wittern Gewitterwind, Wir Volk. Nur eine kleine Ewigkeit; Uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind, Als all das, was durch uns gedeiht, Um so kühn zu sein, wie die Vögel sind. Nur Zeit.
Es sprach aus den wachen, begeisterten, gepflegten Gesich tern dieser russischen Arbeiter, daß sie „die kleine Ewigkeit" überwunden hatten. Sie hatten Bett und Kind, Theater und Musik, Bibliotheken und Radio in der engsten Hütte. Sie hat ten alljährlich vier Wochen bezahlten Urlaub, dazu zweiund fünfzig freie Tage mehr als die Arbeiter aller anderen Länder und weniger tägliche Arbeitsstunden als sie, um das Kulturgut unserer Erde zu genießen. Daß sie Zeit und Kraft besaßen, die Verteidigung dieser 46
Errungenschaften vorzubereiten, bestreitet heute selbst Hitler nicht - daß er es damals nicht glaubte, wurde sein Verderben. Als ein ganz neuer, bis ins Fundament veränderter Mann kehrte ich nach Prag zurück, wo fast jeder Mensch mir er zählte, was ich in Rußland gesehen hatte. Man hatte uns Potemkinsche Dörfer gezeigt, behauptete jeder, Hungertyphus, Knutenherrschaft, Bettlerscharen, Tyrannei hatte man uns ver steckt, das wußten sie alle. Aber sehr bald taten sich mir die großen, offiziellen Vor tragssäle in Prag und Deutsch-Böhmen auf, und diesmal war ich der Redner. Die bisher alles über Rußland anders und besser gewußt hatten als ich, mußten jetzt zuhören, und mit angehaltenem Atem hörten sie viele Stunden lang. Daß ich richtig gesehen und Wahrheit verkündet habe - die Weltgeschichte hat es bisher bewiesen.
Im Juli 1939 veranstaltete der Schutzverband Deutscher Schriftsteller in Paris eine Gedächtnisfeier für Ernst Toller, der sich wenige Tage zuvor in New York das Leben genommen hatte. Vielerlei Unglück war auf ihn eingestürmt, sein Leben lang hatte der Tod ihn gleich stark gelockt wie bedroht. Hun dertmal war er seinen Feinden entronnen, den Feinden der Freiheit, die nach keinem Leben gieriger trachteten als nach dem seinen. Tapfer und listig hatte er ihre Pläne durchkreuzt, um gleich darauf, wenn er sein Leben gerettet hatte, inbrünstig nach dem Tode zu verlangen - keine Stunde lang in vielen, vielen Jahren war der Gedanke an Selbstmord ihm fern ge wesen. Damals gehörte all seine Tatkraft den Opfern des spani schen Krieges, für die er in Amerika um Hilfe warb, für die er schon Hunderttausende von Dollars gesammelt hatte. In dieser Aktion war er unersetzlich, das wußte er und wollte der süßen Lockung des Todes nicht erliegen. Zum erstenmal seit vielen Jahren besaß er keine Waffe, kein Gift. Die Verzweif lung überfiel ihn dann so plötzlich, daß er sich an dem Gürtel seines Bademantels aufhängte, mitten aus der Arbeit heraus. Seine Sekretärin hatte nur für Minuten das Zimmer verlassen, da wurde es stärker als er selbst. 47
Heute ist es leicht zu begreifen, daß er mit den sensibel sten Nerven einfach nicht nur fühlte,, sondern plötzlich wußte, welches Unheil über die Welt hereinstürzen sollte, eine Katastrophe, in der seine und unser aller Kräfte nichts mehr bedeuten konnten. Wozu dann weiter die Last des Lebens tragen, die ihm gräßlich geworden war, Tagessorgen und verschmähter Liebe Qual? Die Totenfeier in einem der größten Pariser Säle vereinigte, wie nie zuvor eine unserer Tagungen, emigrierte Vertreter fast aller europäischen Länder. Es war wie ein Kongreß der euro päischen Geistigkeit, über die in jedem einzelnen Land der Stab gebrochen war. Deutsche, Österreicher, Tschechoslowaken, Spanier, Griechen, alle vertrieben, vom Faschismus verfolgt, alle zu jener Stunde noch tief überzeugt, daß nur Frankreich noch eine Heimat der Humanität und des Geistes sei. Vieles war geschehen, das in dieses Bild nicht mehr paßte, aber unser Glaube war unerschüttert, und in unseren Reihen saßen viele der besten französischen Intellektuellen, die unsere Brüder waren und mit uns an Frankreich glaubten. Zwei Tage später fand eine andere Gedächtnisfeier statt, für den Diditer Joseph Roth, der sich tot getrunken hatte - auch er ein hoffnungslos gewordener Kämpfer, der keinen Ausweg sah. Er war dem Alkohol nicht erlegen wie ein Schwächling, sondern ganz bewußt hatte er diese Form des langsamen Selbst mordes gewählt, bei der es ihm bis zum letzten Tage möglich war, das Verderben zu vergessen, das über uns lagerte, und schöne Bücher zu schreiben. Sein letztes Werk, die „Trinker legende“, war auch sein reinstes, das dichterisch edelste, ja zweifellos das trostvollste Buch, das er geschrieben hat. An Ernst Toller, der sich in größter Verzweiflung das Leben ent rissen hatte, wurde strengere Kritik geübt als an Joseph Roth, der sich in konsequenter Selbstvergiftung Jahre hindurch die ser Welt entzogen hatte. Ich nahm Tollers Andenken in Schutz: „Er hat so gut gekämpft, wie er konnte, er hat so lang ge kämpft, wie er konnte!“ Dies Wort wurde feurig akklamiert. Kämpfen war damals noch ein Begriff für uns. Wir hatten in Paris Zeitschriften, Zeitungen, Versammlungs 48
recht. Die Idee der Menschenrechte mußte in den Herzen der Menschen lebendig gehalten werden. Fast alle großen Revolu tionen sind im Exil vorbereitet und geschürt worden, denn kein Revolutionär ist zäher und feuriger als der emigrierte. Seit Hitlers Machtantritt folgte eine Krisis der anderen, immer schien der Krieg vor der Türe zu stehen. Jedesmal hatte ich mich, wie die meisten in unseren Reihen, der Regierung zur Verfügung gestellt. Aber die Beamten der französischen Repu blik, die der Volksfront ebenso wie der Regierung Daladier, schienen ihre Zeitungen nicht zu lesen, oder sie glaubten ihnen nicht. „Konflikt mit Deutschland?" fragten sie grob. „Davon träumen nur Sie! Wir brauchen Sie nicht.“ „Aber Sie könnten morgen .. „Wenn wir Sie brauchen, werden wir Sie zu finden wissen.“ Als der Krieg dann Wirklichkeit wurde, an den sie nicht hat ten glauben wollen - da wußten sie uns zu finden I Wir, die 1953 wie Sturmvögel aus Deutschland entflohen waren, um die Welt zu alarmieren - wir wurden gefangen und in enge Käfige gesperrt. Und später, im Waffenstillstandsvertrag, verhandelte Mar schall Pétain unsere Köpfe an Hitler - im Namen Frankreichs!
VII An einem Sommertag 1940 lag ich in strahlender Sonne auf einer Wiese der Bretagne, hörte das Meer singen und hielt im Arm eine bauchige Flasche mit Vieille Grappe, einem grimmig starken, wohlschmeckenden Schnaps. In meiner Tasche steckte ein versiegeltes Glas mit Zyankali, das ich immer wieder be rührte und zärtlich streichelte. Dies liebe Gift hatte Primavera mir zugeschmuggelt, als die Hitler-Armee in Frankreich einmarschierte und die LavalRegierung alle erprobten Hitlerfeinde, deren sie habhaft wer den konnte, in den Kerker warf. Ich streichelte das Glas, als wären es Primaveras Wangen, ich dachte an sie und Ilse, nichts Häßliches, nichts Trauriges zog durch meinen Sinn, mir war sterbensfröhlich zumute. 4
Paradiese
49
Denn fünfzehn Kilometer vom Gefangenenlager entfernt waren die Deutschen auf ihrem phantastischen Siegesmarsch von Dünkirchen bis Cap Finistère gestern gemeldet worden, und es konnte nur noch Minuten dauern, ehe sie unser Lager erreichten. Vor Folter und Beil würde diese Gabe grenzen loser Liebe mich bewahren. Wir waren kaum ein Dutzend Männer im Lager auf Cap Finistère, denen Folter und Beil gewiß waren, wenn die Nazis uns fingén, aber Hunderte, denen das deutsche KZ gewiß war. Der Lagerkommandant hatte vor wenigen Tagen sein Wort verpfändet, wenigstens uns entfliehen zu lassen. Aber in dieser letzten Nacht und an diesem letzten Morgen standen Doppel posten mit entsichertem Gewehr rings ums Lager, der Herr Kapitän war nicht zu sprechen. Das Lager war kirchhofsstill. Dann plötzlich knackten Gewehrschlösser, eine grelle Stimme kommandierte „Allez marche!“, so wie man Hunden zu ruft. Ich fuhr aus meiner schönen Betrunkenheit auf - da stand eine Mauer von Menschen fünfzig Meter vor der Hütte, die als Kommandantur diente, und gegen sie war ein Zug Land wehrleute angetreten, die Gewehre im Arm wie zum Sturm, und der sie kommandierte, war ein Stabsarzt, ein unheimlicher Kerl, zwei Meter lang, hager und schmal wie Don Quichote, mit spitzem Bart und Hakennase, gespenstisch und teuflisch anzusehen. Die Soldaten rückten ausgeschwärmt vor und riefen den Arbeitern zu: „Auseinander, wir schießen!" Die Arbeiter rissen ihre Hemden auf und schrien: „Schießt, vive la Francei“ Vor dem Lager, am Stacheldraht standen bretonische Frauen in hohen, gestärkten Hauben und weinten laut. Dann wußte ich plötzlich: Wenn ich jetzt mein Zyankali schluckte, vergifte ich meiner Schwester und Primavera das Leben, denn sie werden nie erfahren, daß ich selig betrunken gestorben war. Es wurde mir später erst klar, was ich nun tat. Schnurstracks ging ich auf die Schützenkette zu, so zielbcwußt, so selbstver-
jo
stündlich, daß die Soldaten mich passieren ließen. Ich betrat das Büro des Capitains, ohne zu klopfen, er starrte mich an, sein Gesicht war. schweißübergossen und aschfahl. Er erkannte mich, sprang auf, faßte mich an der Schulter und stammelte: „Monsieur, ich kenne Ihre Situation" - und ein verzweifelter Gestus drückte aus, er sei machtlos. Ich rief: „Und Ihr Ehrenwort, Capitain? Sie werden nie wieder schlafen können, wenn Sie sich zum Henkersknecht machen!“ Er flüsterte seinem Adjutanten einen Befehl zu, ich hörte die Worte: „Folgen Sie mir!“ Sekunden später stand vor einer niedrigen Mauer, die eben noch ein Doppelposten bewacht hatte, ein Tisch, über Tisch und Mauer kletterten Männer wie geängstigte Ameisen. Von unten geschoben, von oben gezogen, flog man auf den Kamm der Mauer, half den nächsten Mann nachziehen und sprang auf weichen Ackerboden. Von der Mauer aus hatte ich gesehen, daß deutsche Soldaten auf Motorrädern das Eingangstor schon besetzt hatten, jetzt knatterten auch schon Motore auf die an dere Seite des Lagers auf uns zu. Hundert Meter weit war ich gekommen und sah mich um, da hielten an der Stelle der Mauer, die ich gerade übersprungen hatte, zwei Motorräder, und acht deutsche Soldaten sprangen ab, scheuchten die Un glücklichen zurück, die uns folgen wollten. Ein Soldat winkte uns zu, wir sollten zurückkommen, ein grauhaariger Mann, der eine schwere Last trug, brach vor mir zusammen und stöhnte: „Ich bin herzkrank.“ Er lag da, seine Last im Arm, wie eine umgedrehte Schildkröte. „Es ist aus, sie schießen“, sagte ein anderer Mann mit schneeweißen Haaren zu mir. Es war mein Jugendfreund Leon hard Frank, den ich bis dahin nicht bemerkt hatte. Aber sie schossen nicht, wir liefen in einen Wald hinein, sie verfolgten uns nicht. Ich hatte nichts zu tragen als einen Sommermantel, der mir auf dem Rasen als Kopfkissen gedient hatte. Sonst besaß ich nichts, denn ausgerüstet hatte ich mich ja zum Sterben, nicht zu einer Landpartie.
5i
Diese Landpartie dauerte genau dreißig Tage, von einer Vollmondnacht zur nächsten. Sie ging durch immer dichter be setztes Land, oft auf Tuchfühlung an deutschen Posten und Patrouillen vorbei. Das war, trotz aller Gefahren und grimmigen Strapazen, eine unvergeßbar schöne Reise, die Franzosen, Landarbeiter und kleinen Bauern, an deren Türen wir - ein Gefährte und ich - immer wieder klopfen mußten, hatten offene Herzen, offene Arme, zeigten uns fremden Landstreichern eine Soli darität der Armen und Unbewehrten bis zur Grenze des Herois mus. Denn ihre Gastfreundschaft konnte ihnen deutschen Haß, furchtbare deutsche Nazijustiz eintragen, und sie wußten es. Wie mir zu Beginn der Flucht tausend Francs in die völlig leere Tasche glitten, wie wir über die reißende Loire kamen, die nach endlosen Regengüssen mit grauer Flut ihr Bett über schwemmt hatte, wie wir die Demarkationslinie zwischen dem besetzten Frankreich überschritten - das Wunder, und viele Menschen erschienen an unserem Weg wie Engel der katho lischen Legende. Ja, es war eine schöne Fußpartie über sechshundert Meilen Seitenwege, durch glühende Hochsommersonne, durch wochen lang strömenden Regen, die Füße im Schlamm, denn an jeder Wegbiegung stand der Tod, und jedesmal erschien uns dieser rettenden Engel einer. Nur daß ich an nichts denken durfte, was mir lieb war, sonst hätte Angst meine Füße gelähmt. Viel später erfuhr ich, daß Primavera sich aus Paris gerettet hatte, ganz allein an fangs, zu Fuß im Strudel der fliehenden Pariser, daß sie die Küste erreicht, an Bord einer englischen Kriegsschaluppe nach London gekommen war, daß meine Schwester mit ihren Kin dern am Genfer See, lebendig und in Sicherheit war, daß die Engländer meinen Bruder in der Nervenkrisis des nahenden Blitzkrieges - genau wie die Franzosen - ins Lager gesperrt hatten, einen kranken Mann, der mit einer machtvollen Feder immer gegen Unrecht und Tyrannei gekämpft hatte, warnend, beschwörend, seit die Hitlergefahr am Himmel stand. Ja, das war eine schöne Landpartie, aber ich durfte an nichts denken, das mir lieb war. J2
Vierzehn Tage schon lag ich im Obdachlosenquartier von Chateauroux, auf Stroh natürlich wie in jeder Nacht seit drei Monaten, und war sehr schlank geworden, denn die letzten fünfzig Francs hatte ein Telegramm an meine Schwester ge kostet, deren Adresse ich nur unklar ahnen konnte. Eine lange, hagere Beamtin am Schalter für postlagernde Briefe knurrte mich immer unfreundlicher an, wenn ich nach Post fragte, an fangs dreimal täglich, zuletzt nur noch jeden zweiten Tag. Aber einmal, als ich schon ganz verzagt, fast beschämt dem Schalter nahte, erschien mir wieder ein Engel, eine ganz junge, liebliche und zarte Beamtin! Sie griff ins Fach für O - da lag nichts. Aber ihre Himmelsstimme sprach: „Warten Sie einen Augen blick, Monsieur, ich glaube ...“ Und ihre Engelsfinger griffen in das Fach B ! Da stellte sich heraus, daß meine Post unter Balder verteilt und unter Olden gesucht worden war - seit Wochen lagen da Telegramme voll guten Inhalts, Briefe voll Zärtlichkeit, so viele Nachrichten, die mich glücklich machten, dazu Tausende von Francs ! Ich wagte mich, ein Vagabund in Fetzen, in ein Café und wurde seltsamerweise bedient. Dort las ich, las jede Zeile zehn mal ... Es dauerte noch eine lange Woche, da fiel mir Ilse um den Hals, im Foyer eines Hotels am Genfer See. Sie hatte mich am Zug erwarten wollen, aber der Hotelconcierge hatte gesagt: „Nein, Madame, ich nehme Sie nicht mit. Sie müssen sich in einen Fauteuil legen, bis ich Ihren Bruder bringe. Die Züge kom men oft Stunden zu spät, ich nehme Sie absolut nicht mit.“ Ilse hatte für mich gearbeitet, mit zahllosen Telegrammen und Briefen, lang ehe sie wußte, daß ich den Nazis entrinnen würde. Mein Name stand dank ihrer Sorge schon auf der Liste gefährdeter Schriftsteller, denen die Vereinigten Staaten einen Notpaß geben wollten. Er stand freilich auch auf der Liste ge fährlicher Schriftsteller, deren Auslieferung Pétain im Waffen stillstandsvertrag Hitler versprochen hatte. Aber nicht jede Selbstbeschmutzung, die Pétain versprochen hatte, wurde von seinen Beamten ausgeführt - sie ließen mich entkommen. Vier Jahre später standen wir beide, Ilse und ich, am Quai 5J
von Buenos Aires, vor einem englischen Dampfer, der eben festmachte. An Bord war Primavera ... In diesen vier Jahren voll Schlacht, Angst, Blitzkrieg und hartem Dienst schien sie mir noch schöner und jünger gewor den.
J4
Episode in Paris
Am 8. Mai 1940, als die französische Front noch stand, sollte ich Paris verlassen, um irgendwo in der Provinz résidence forcée zu beziehen. Diese Order von der Polizei-Präfektur machte mich verzweifelt - seit Monaten wartete ich auf Ver wendung im Kampf gegen den Todfeind der Franzosen und meinen eigenen. Ich ging zum PEN-Club, der großen litera rischen internationalen Vereinigung der europäischen Schrift steller, und bat um Hilfe gegen das grausame Schicksal, in die ser Epoche der Entscheidung kaltgestellt, aus der Front ver bannt zu werden. Am 9. Mai bekam ich einen Brief von Jules Romains an den Polizei-Präfekten Langevin, den er „Lieber Freund und Prä fekt“ ansprach. Romains war im Begriff, das Ministerium für Propaganda zu übernehmen, er schrieb, daß er mich für den Radio-Dienst brauche, meine Aufenthaltserlaubnis müsse auf Monate oder Jahre verlängert werden. Am 9. Mai wurde ich in die Präfektur bestellt, nein - ge beten! Wo man sonst, als Flüchtling, zitternd eintrat und eisig behandelt wurde, begrüßten Primavera und mich tiefe Diener und Händedrücke - im Allerheiligsten des Präfekten wurde ich wie ein Freund empfangen. Jawohl, ich sollte alles haben, Aufenthaltserlaubnis, einen besonderen Ausweis zum Schutz gegen Fremdenrazzien und Belästigung, jede Hilfe, deren ich bedurfte. Primavera strahlte den Privatsekretär des Präfekten an, und er erklärte, daß er für uns beide zu jeder Stunde zu sprechen sei. „Jetzt sind wir die bestgeschützten Emigranten in ganz Paris“, stellten wir später fest, das Interview hatte wohl eine Stunde gedauert. „Jetzt an die Gewehre!" Und ich
55
entwarf, beriet, feilte die erste Radio-Rede in deutscher Sprache, die man an der Front und in Deutschland hören sollte: Nieder mit den Tyrannen ! Um vier Uhr morgens des 10. Mai drangen fünf Geheim polizisten in mein Hotelzimmer ein - das Manuskript der Rede war fast vollendet. Sie waren entzückend höflich, wir tranken zusammen einen Cognac, sie trösteten Primavera, die ein sehr gelbes Gesichtchen hatte, aber sie nahmen mich mitl Die erste Fahrt meines Lebens im grünen Wagen dauerte viele Stunden lang, ging rings um Paris. In jedem Vorort wur den ein paar Menschen aus den Betten geholt, alle grün und klapprig. Nur ich war guter Dinge, ich unterhielt mich leise mit dem schwerbewaffneten Polizisten an meiner Seite und glaubte zu wissen, daß ich spätestens um zehn Uhr wieder in meinem Bett liegen würde. Als wir die Präfektur erreichten, ging ein Bombardement über Paris nieder. Ich dachte: „Arme Primaveral Man läßt dich heute nicht schlafen 1“ Wir saßen dann, an hundert Menschen aller Nationen der Welt, Frauen, Männer, in einem kahlen Saal und flüsterten. Langsam erfuhr ich, daß die meisten entlassene Sträflinge und Prostituierte waren, beschimpft und geohrfeigt wurden, und ein paar der kommunistischen Gesinnung verdächtige Arbeiter. Plötzlich war Primavera da, man erlaubte uns, drei Minuten miteinander zu sprechen. Sie war schon im Kabinett des Prä fekten gewesen. Der Sekretär hatte die Hände gerungen und sich machtlos erklärt. „Da gibt man sich solche Mühe ...“, hatte er gestöhnt, „und sie machen einem alles kaputt!“ „Pauvre madame, ma chère pauvre madame!“ Das erzählte sie mir, immer noch ihr tapferes Lächeln auf dem gelbgrünen Gesicht. Es stank nach Angst und Schmutz in dem viel zu engen Saal, Gendarmen kommandierten, im Nebenraum wurde vernommen, gebrüllt und geheult - wir lachten einander kläglich an und küßten uns. Wir werden uns wiedersehen - aber heute ist dieser Ab schied schon drei Jahre her, drei Jahre und ...? Primavera entkam später, als die Deutschen in Paris ein 56
rückten, nach England - zu Fuß bis Orléans, ganz allein, dann auf einem englischen Soldaten-Camion, dann auf dem letzten englischen Schiff, das einen französischen Hafen verließ. Ich aber, ich grübelte in finsteren Verließen und Lagern, im Eisenbahn-Transport, auf einer dreißigtägigen Flucht durch das besetzte Frankreich: wer hat mich denunziert? Welchem Schur kenstreich danke ich diese Trennung? Erst Monate später wußte ich es. Den Haftbefehl hatte der Brief des tapferen und patrio tischen Jules Romains an seinen Freund Langevin bewirkt! In jener Nacht vom 9. auf den 10. Mai war der Geist von Vichy - damals noch ein kleiner Badeort in Südfrankreich - in Paris ausgebrochen. In jener Nacht vom 9. auf den 10. Mai war Frankreich ver raten worden. Im Herzen der Hauptstadt, in den Hallen und Kammern der Präfektur war die Fünfte Kolonne ausgebrochen und hatte die Fassade der Republik zertrümmert. Das hat Millionen Franzosen um Glück und Leben ge bracht - dürfen wir uns beklagen?
57
Fünf Briefe aus dem Lager
Balder Olden an den damaligen französischen Propaganda minister, aus dem Lager „Roland Garros“ bei Paris, geschrieben nach dem if. Mai 1940, undatiert.
Herr Minister: Als bekannter deutscher Schriftsteller habe ich Deutschland im Jahre 1933 verlassen, um gegen Hitler zu kämpfen und die zivilisierte Welt gegen die Bedrohung von Barbarei und Krieg zu alarmieren. Das habe ich mit solcher Eindringlichkeit getan, daß mir die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, und ich wurde zum Tode per continumaciam verurteilt. Alle meine Bücher, selbst die in Privatbibliotheken befindlichen, wurden eingestampft, mein Vermögen wurde beschlagnahmt, und der „Angriff“ forderte seine Leser auf, mich totzuschlagen, wo sic mich fänden. Am Beginn dieses Krieges wurde ich interniert, dann nach neun Wochen freigelassen durch die Sichtungskommission. Ich habe der Propaganda der Französischen Republik sofort meine Dienste angeboten, besonders als Radiosprcchcr. Ich habe dort bekanntgegeben, daß ich nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als alter Lcttow-Vorbeck-Kämpfer (eine Truppe, die ein fast mystisches Ansehen genießt) darauf rechnen könnte, daß sehr zahlreiche Ohren in Deutschland mich anhören würden. Als der Weg zum Mikrophon mir schon offen schien, wurde ich am 15. Mai 1940 verhaftet und ins Lager „Roland Garros“ gebracht. Der Kommissar der Präfektur, Monsieur Guinaud, sagte mir, daß, wenn ich nie Mitglied irgendeiner politischen Partei ge 58
wesen bin, meine Inhaftierung höchstens ein paar Tage dauern würde. Sie dauert noch an, obwohl ich nie irgendeiner Partei angehört habe und nur meiner Tätigkeit als Romanschriftsteller und Weltreisender nachgehe.
Anstatt der Republik wirksam dienen zu können, falle ich ihr zur Last. Ich bin ein guter Redner, und mein Haß gegen das Nazitum würde mir noch mehr Feuer geben. Ich bin bereit, in die Schützengräben zu gehen und von dort aus, durch Lautsprecher, zu den deutschen Soldaten zu spre chen. Ich bin mir vollkommen bewußt, daß selbst ein besiegtes und friedfertiges Deutschland mir diesen Dienst nie verzeihen würde. Ich biete ihn an. Ein Angebot wie das meine ist nicht alltäglich. Ich kenne zwei deutsche Dichter von internationalem Ansehen, Nicht juden wie ich, die bereit wären, dasselbe zu tun. Dies würde der Sendung einen außerordentlich eindrucksvollen Charakter geben, wie er nie dagewesen ist, und deren Wirkung bestimmt sehr stark wäre. Bitte empfangen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner Ergebenheit und größten Hochachtung.
Balder Olden an Margaret M. Kershaw, aus dem Lager „Ro land Garros" bei Paris, geschrieben am 19. Mai 1940.
Was für ein schrecklicher, „komischer“ Geburtstag! Laß uns alles vom nächsten erhoffen! Du bist schön und jung wie einst vor elf Jahren, aber geschult und gereift. - Das Leben wird wieder neu anfangen unter günstigeren Sternen. Und ich liebe Dich, bin sehr traurig, Dich heute nicht umarmen zu können. Ich hatte Pläne gemacht, um gerade diesen Geburtstag zu feiern, oft habe ich daran gedacht während der letzten Wochen. Fatal, ich habe nichts für Dich als meine Liebe. - Schreib doch ein paar Zeilen an Ilse und bitte sie um Nachrichten. Wenn Rudi noch nicht naturalisiert wäre, würde er sich jetzt auch in der Misere befinden. Nur - die englische Misere wird nicht so ungenießbar sein wie diese hier. Francillon - welch schöner 59
Traum I Trotz allem habe i■
67
jookm durch totes, totes Land. Es bellte kein Hund, es gakkerte kein Huhn, es stand kein Rauch über den verfallenen Häusern, es kreuzte kein Auto unseren Weg, wir sahen wenig Menschen, nur Gebeugte, Verhärmte, Zerlumpte. In Figueras nahmen wir jeder ein Stück Brot, ein Ei und ein Stückchen Käse aus unseren Vorräten und kehrten in eine Bar ein. Zwanzig Menschen etwa saßen darin, die leise sprachen oder schweigend vor sich hinstarrten - so sind die Spanier ge worden! Als wir unser Ei schälten und den Käse auswickelten, fühlte ich mich plötzlich beobachtet und blickte auf - da starrten all diese Gäste, der Wirt, die Wirtin, der Kellner, alle starrten uns an mit so furchtbar hungrigen Blicken, daß ich glaube, nie war ein Angsttraum schrecklicher als diese Wirklichkeit. Dann sprach mich ein Offizier in blendend weißer Uniform an, min destens ein Major: „Usted habla castellano?“ - und bat um ein Stüde Käse. Nur einen Bissen! Seit Monaten und Jahren habe er so etwas nicht auf der Zunge gehabt. Es war wie eine Demonstration, daß gerade er, der prunkvoll Gekleidete, den Bettler machte... In Barcelona und Madrid gibt es kein Brot, das man so nennen könnte, aber in den Hotels und Geschäften alle Herr lichkeiten dieser Welt. Das Elend ist von den Hauptstraßen weggefegt, des braven Soldaten Schwejk kategorischer Impera tiv: „Mehr Strenge gegen die armen Leute!“ wird dort peinlich befolgt. Gäbe es nicht die klaffenden Lücken in den Reihen der Hochhäuser und Paläste, die aus der Konjunktur des letz ten Weltkrieges entstanden sind, dann könnte man glauben, daß es nie einen Bürgerkrieg gab. Nur - auch unter den Wohl gekleideten, die Zutritt zu diesen Boulevards haben - welche Menge von Einarmigen, Einbeinigen, Einäugigen! Von jener berühmten „Ciudad Universitaria“ und dem Cárcel Modelo, den wunderbarsten Anlagen ihrer Art von ganz Europa, sieht man auch nicht einen Stein mehr, das ganze Gebiet ist kahl, wie ein Bauplatz von Schützengräben durchzogen. Portugal hat keinen Krieg und keinen Bürgerkrieg durchgemacht, nur jener grausige Orkan hatte vor kurzem getobt, der ganze Flottillen verschlungen und hundertjährige Alleen 68
entwurzelt hat. Von den Anlagen einer kleinen Weltausstellung am Strande von Lissabon hat er nur ein paar Soffitten ver schont - aber sonst wirkt das Land wie ein vorgeschobenes Stückchen Amerika. Denk Dir, dort gibt es einen Diktator, der ist so gut, ein gütiger, alter Universitätsprofessor, daß alle Menschen ihn preisen. Wie könnte man dieses System nennen eine demokratische Diktatur? Eine Diktatur mit Butter statt Kanonen? Denn Butter gibt es dort, in der bescheidensten Pension Menüs, die endlos sind, Licht und froher Lärm die ganze Nacht hindurch I Durch meine vornehmen Reisegefähr ten - ich habe nur dieser Geschichte wegen und nicht aus Renommage von ihnen gesprochen - lernte ich einen flüchtigen König und seine Freundin kennen, die ein Wunder von Geist und Grazie, deren Lächeln ein Märchen ist. Dieser König war in den Lufthafen gekommen, um - das Herz voll Neid - die Abfahrt des Klippers anzusehen. Daß ich beide Visen hatte, das für USA und das für Argentinien, daß es solchen Reich tum auf Erden gibt, konnten der arme König und sein Lieb nicht fassen. Ich liebe die Aufs und Abs des Lebens, denn sie erhalten jung - so freute ich mich, daß auf dem spanischen Dampfer kein Kajütenplatz mehr war, und fuhr mit innigem Vergnügen im Zwischendeck. Hygienisch gesehen, waren selbst die Lager in Frankreich besser, aber man konnte auf Deck schlafen, und alles andere war erträglich. Die Reise dauerte endlos lang, weil eine Maschine defekt war, ein bewaffnetes Ruderboot hätte uns kapern können. Aber niemand dachte an Minen oder Kriegsschiffe, Rettungsboot-Manöver wurden' einmal angesagt, aber nicht abgehalten. Vielleicht hätte sich sonst ergeben, daß entweder zu viel Passagiere oder zu wenige Boote an Bord waren. Auf Teneriffa - das ist ein Zauberlandl - sagte mir ein Landeskundiger, es würde viel gekidnapped. Ich machte mit Bordfreunden eine Fahrt über Land und ging an einem Haken kreuzflugplatz vorbei, auf dem eine riesige Junkers stand. Spä ter, in einem prächtigen Badehotel, war der Saal plötzlich ganz voll junger Deutscher! Auf dieser Junkers wäre sicher ein Frciplatz für mich gewesen, aber ich wollte die selbstgewählte
69
Reise fortsetzen und hielt mich anonym. Jedoch am Abend in Veracruz - welche Ehre! - stand mein Name im Blättchen, auf einer Liste prominenter Passagiere der „Buena Esperanza“! Da mahnte mich die innere Stimme, rasch einen Schnaps zu trinken, den letzten meines Lebens auf europäischem Boden, und ich gehorchte. Sechsundzwanzig Tage hat diese Überfahrt gedauert, und sie sollte zehn bis zwölf Tage dauern! Eine alte Frau wurde wahn sinnig. „Mein Sohn, dieser Hund, hat mich auf ein Schiff ge bracht, das nie ankommt!" schrie sie. Der arme Junge hatte sich als Landarbeiter das Geld für ihre Reise zusammengespart, jetzt kam sie in die Zwangsjacke und hatte das Herz voll Haß gegen, ihn. Am Quai in Buenos Aires stand alles, was mit Dir, und damit mir, in diesem Land verwandt ist, und der herrliche Ernesto, dem ich so viel und meine Visa verdanke, sic mußten stundenlang stehen, es war rührend, sie taten cs! Alle sahen aus, wie gesunde Menschen aussehen sollen, die Qualen Euro pas nicht durchlaufen, diese stete Angst, die jeder um den anderen leidet, dies Betteln und Laufen und Nächte hindurch Queue-Stehen um Einreisevisa, Durchreisevisa, Ausreisevisa, dieses Gefühl, in einem Kerker zu leben, in dem die Luft immer dünner wird, das Brot immer schmaler, die Nacht immer dunkler, die Sirene immer greller. Wer sich in Cadiz nicht eingeschifft und Lissabon nicht er lebt hat, dem könnte der erste Blick auf Buenos Aires gefähr lich werden. Was ist da, seitdem ich vor fünfzehn Jahren zum letzten Mal hier war, für eine Wunderstadt aus der Erde ge schossen! Die Avenida de Mayo, damals der Stolz der ganzen Republik, ist heute armselig im Vergleich mit diesen glänzend neuen Boulevards und Aveniden. Die ganze Schönheit der amerikanischen Wolkenkratzer-Architektur erlebte ich zum ersten Mal und wirst bald auch Du zum ersten Mal erleben. Diese Lichterpracht in den nächtlichen Straßen, Lichtströme in allen Straßen, dieser schön geregelte Riesenverkehr - freue Dich, mein Schatz, Amerika hat seine ureigenste Pracht! Und wirst Du müd - Ricardo hat seine sagenhafte Insel, groß wie ein Märchengarten, sein Campo, sein Reich.
7°
Man lebt hier wie einst in Prag, ein deutsches Dorf in einer anderssprachigen Stadt. Eigentlich sind es zwei Dörfer, das republikanische und das „nazionalistische“, das nicht halb so nazistisch ist, wie man ihm vorschreibt. Ich sehe da durch Mauern, wie der hinkende Teufel Asmodi, denn die beiden Dörfer sind unübersteiglich getrennt. Eine junge Frau, bei einer deutschen Firma angestellt, die mit mir ins Theater ging, wurde am andern Tag fristlos entlassen - „vertrauensunwürdig in ihrem Privatleben“. Wir haben nämlich ein Theater, die andern haben auch eins, wir haben jeder eine Zeitung, jeder eine Schule, Vereine, Vor träge - in einer Umwelt deutsche Welt und deutsche Un weit ... Aber die Trennung ist so absolut, daß man in einem Dorf vergessen kann, daß das andere existiert. Ich wenigstens konnte es bisher. All mein Hoffen, all mein Hassen ist drüben in Europa auf den Schlachtfeldern, schwebt über dem verratenen deutschen Reich, das so entsetzlich büßen muß, weil es nicht Wache hielt gegen die Unholde, von denen unsere deutschen Märchen so deutlich sprachen und vor denen sie warnten. Ich zähle in langen Nachtstunden Petroleum, das höhet mir den Mut. Als ich in Buenos Aires ankam, am 4. Mai, sagte ich einem Interviewer, Hitler würde Rußland an einem nahen Tage angreifen müssen, weil cs mit dem vor Jahresfrist er beuteten Petroleum zu Ende ginge, und Stalin werde gegen seinen Willen kämpfen müssen. Wenn Rußland standhalte, würden ganz plötzlich die Nazi-Ruder stillstehen, die Motore, die Propeller------ und nun wehren sie sich! Jeder Kilometer, den die Nazis erobern, kostet, wie das Herzblut seiner Soldaten, das Herzblut seiner Armee, das unerreichbar weit, jenseits des Kaukasus am Kaspischen Meer glitzernd aus der Erde tropft. Ich rechne nach, was erbeutet, rechne nach, was vergeudet wurde, und weiß: Das Wasser steht ihnen am Hals, das Benzin an der Sohle ihrer Fässer. So wahr ich ohne Dich, ohne Dein heroisches Mühen und Opfern, seit langem unter der Erde wäre, werde ich den Frie den genießen mit Dir - ich bin tief überzeugt, daß er nah ist! Mit Dir und Primavera, die so allein ist, so fern von mir, so 7i
nahe, wenn ich die Augen schließe! Aber auch ihr Kommen steht nahe bevor! Ich umarme Dich und sie in diesem einen Brief, Ihr Gelicb-
Balder Olden an Annette Kolb, Buenos Aires, geschrieben am ii. Juni 1941.
Liebe Annette, Sie haben am Klipper in Lissabon vollständig vergessen, uns die Hand zu geben! Vier tief enttäuschte Gesichter sahen Ihnen nach, als Sie in dem weißen Vogelbauch verschwanden, und abends klagte ich Ilse telephonisch mein Leid. Sie sagte mir, ihr Abschied in Genf sei genauso gewesen. So bin ich halb entschuldigt, daß ich Ihre beiden lieben Briefe nicht früher be antwortet habe. Ich bin wenige Tage nach Ihnen aus Lissabon abgefahren, geriet auf den Kanarischen Inseln in einen Hotel garten, voll von deutschen Soldaten in Zivil, und zwanzig Schritte von uns stand ein riesiger Junkers, auf dem zweifel los ein Platz für mich frei gewesen wäre. Weil ich aber nicht wollte, gab ich mich gar nicht zu erkennen. Aber im Abend blatt stand dann eine Liste prominenter Passagiere, auf der mein Name nicht fehlte. Zugleich erzählte mir ein Touristen agent, daß Kidnapping auf diesen schönen Inseln von beiden Seiten betrieben würde. So war ich sanft erregt, bis unser Schiff endlich abfuhr. Ich reiste zwar im Zwischendeck, aber ich fühlte mich trotzdem sehr glücklich. Gott sei Dank, daß Sic nicht bei mir waren! Aber das gilt nur für diese eine Gelegen heit, sonst bin ich sehr traurig, Ihnen so fern zu sein. Ich bin hier großartig in Empfang genommen worden, mit vielen Interviews etc. begrüßt, so daß ich mit einem Sprung in das öffentliche Leben von Buenos Aires hineinkam, alte Freunde traf und neue fand, und die ersten Wochen waren so voll Trubel, daß ich erst jetzt zum Briefeschreiben komme. Sie fragen nach meinem Verlag, und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Angebot. Leider habe ich von meinem Litera turmäzen noch nichts gehört noch gesehen. 72
Von Primavera hatte ich einen langen Brief vom io. Mai, dem Tag des furchtbarsten Bombardements von London. Aber Gott sei Dank war sie gerade an diesem Tag auf Urlaub ir gendwo am Strand. - Ich habe berechtigte Hoffnung, daß es mir glückt, ihr die Einreisevisa zu verschaffen; bis dahin bin ich, wenn auch auf Rosen, so doch auf sehr dornigen gebet tet... Sie schreiben, daß der Anfang in New York so hart ist. Sie arme, liebe Person! Ich kann’s mir vorstellen, auf BermannFischcr allein läßt sich schwer eine Existenz gründen, und was für grüne Äste gibt es dort noch, auf die Sie sich schwingen könnten? Trotz allem - wir müssen uns täglich zehnmal gratu lieren, daß wir auf der anderen Seite angekommen sind. Und dann haben Sie doch noch viele gute Freunde in New York, Kurt Wolff, Franz Werfel und viele andere! Sobald ich Nach richt von meinem Geldgeber habe, bitte ich Sie, mir „Daphne Herbst“ zu schicken, falls ich es nicht hier vorfindc. Tausend herzliche Grüße und viele gute Wünsche von Ihrem ganz und gar ergebenen Balder Olden Balder Olden an Theo Balk, Buenos Aires, geschrieben am 19. September 1941.
Lieber Theo, hab vielen Dank für Deinen Brief vom 5. September. Leider bist Du ebenso wortkarg wie die meisten unserer Freunde, von denen dann und wann einer an mich schreibt. Ich wüßte gern viel mehr über das Leben, das Ihr in Mexico ge startet habt. Daß die Familie Netti glücklich angekommen ist, wußte ich schon durch den hier lebenden Bruder, den ich häufig sehe. Aber wer noch von der „Pariser Schriftsteller familie“? Von Renn hörte ich schon vor langer Zeit, daß er drüben irgendein Amt bekleidet. Wie ist Bodo auf die Beine gekommen? Sind Kantors glücklich eingelaufen? Ich hatte vor mehreren Wochen einen Brief von ihnen aus irgendeiner west indischen Insel-Republik, auf der sie festsaßen und nicht vor wärts noch rückwärts konnten. Ich habe sofort via Reuters ge-
7}
antwortet, aber nichts mehr gehört. Sind Katz und Ilschen in Mexico? Von ihnen habe ich nie wieder gehört, seit Katz da mals verhaftet wurde. Egonelc hat mich kürzlich grüßen las sen, aber ich weiß seine Adresse nicht. Von ihm hörte ich immerhin, daß er ein autobiographisches Buch geschrieben hat, das anscheinend in deutsch hier erscheinen soll. Ich lege Dir die Kopie eines Briefes an Wieland bei, den Du auch Netti und allen, die sich dafür interessieren, zeigen kannst. Über das Schicksal von Rudolf hörte ich von Dir zum ersten mal. Ich bin sehr bestürzt, sehe aber gar keine Möglichkeit einer Intervention. Abgesehen davon, daß ich wohl der einzige Leut mit Namen in Buenos Aires bin, der von Rudolf weiß, fürchte ich, daß jede Intervention aus Linkskreisen sein Schicksal nur schwieriger gestalten würde. Ich glaube, solange diese VichyRegierung besteht - ich glaube aber nicht, daß sie noch lange besteht -, schaden wir ihm nur, wenn wir Notiz von seinem Schicksal nehmen; als unus ex multis besteht immerhin die Hoffnung, daß er in Vernet bleibt. Machen wir ihn wichtig, dann wird er zweifellos ausgeliefert. Ich begreife nicht, daß er sich hat schnappen lassen. Es wäre doch für ihn sehr leicht gewesen, spurlos in Frankreich zu verschwinden. Als ich ihn das letztemal sah, damals in Marseille, als auch wir uns zum letztenmal sahen, schien cs mir, als ob er nichts ande res im Sinn hätte. Er sagte, er wisse bestimmt, daß er auf der Liste steht. Schließlich war daran ja auch nicht zu zwei feln. Hier erschien übrigens auch in dem Verlag der „Scmana Israelita“ ein Tagebuch aus Vernet von Dr. Bruno Weil, der einige Monate Euer Schicksal geteilt hat. Primavera ist noch in London. Es hat sich überhaupt nicht viel geändert, seitdem ich meinen Bericht im „Aufbau“ publi ziert habe, aber ich hoffe trotz aller Widerstände, daß ich sic in einigen Monaten hier haben werde. Sic hätte die ganze Zeit in Oxford oder einer anderen friedlichen Provinzstadt leben kön nen, blieb aber in London, und jetzt schrieb sic mir, sic sei sehr stolz, diesen Winter über Londonerin gewesen zu sein. Das Haus, in dem sie ursprünglich wohnte, ist von den Bom74
ben zerstört worden. Das habe ich aber von anderer Seite, nämlich von Carl Rössler, gehört. Die Bombardements sind ihr offenkundig besser bekommen als mir, denn ich habe einen Herzklaps davongetragen, teils durch die ewigen Aufregungen, teils durch die Flaschen mit französischem Cognac, die ich zu meinem Trost geleert habe. Dabei fällt mir ein, daß Du, als ich damals nach Colombes mußte, mich abgehorcht hast und ein Emphysem festgestellt hast. Sollte das eine façon de parier für angina pectoris ge wesen sein? Minna Flake und verschiedene andere Doktor-Freunde rieten mir später, ich solle mich krank melden, wenn der Zustand im Lager unerträglich würde, und Angina vorgeben. Dr. Olbrich schrieb mir aus Edinburgh ins Lager, ich solle ihm den Namen meines Lagerarztes mitteilen, er könne dann Angaben machen, daß ich sofort für lagerunfähig erklärt würde. Dieser Orakelspruch war mir bisher unverständlich, aber jetzt scheint mir alles auf dasselbe hinauszulaufen. Hier hatte ich kürzlich einen Anfall, und der erste Arzt be hauptete, ich sei sehr schwer herzkrank, der zweite, der mich mit Röntgen und Kardiograph gründlich untersucht hat, be hauptet, es könne sich um Pseudo-Angina handeln. Da beide kein Emphysem gefunden haben, ist es mir sehr interessant von Dir zu hören, ob Du mich damals freundschaftlich beschwin delt hast. Im übrigen bin ich, wenn überhaupt, bisher ein sehr leichter Fall. Ein paar Tage Sanatorium haben mich vollstän dig auskuriert, und an Pseudo glaube ich nicht, weil ich nie an eine solche Möglichkeit gedacht habe. Schließlich habe ich noch vor genau einem Jahr zirka dreißig Tage- resp. Nächtmärsche gemacht à 35 km und hatte kein Herzklopfen, auch wenn cs unmittelbar an deutschen Posten vorbei ging. Dabei fällt mir ein: Alexandro Maaß ist wohl in Mexico aufgetaucht? Wenn nicht, dann dürfte er in irgendeinem afri kanischen Lager sitzen. Und dann ist noch dieses Ehepaar, der junge Mensch, der in Vernet Dein Nachbar war mit der Frau und dem Kind, bei denen Ruth während dieser Zeit zu Gast war. Sind die in Mexico angekommen? Der Verlag, den ich vor der Hand im Sinne habe, soll nur
75
Belletristik bringen, aber für das Buch, das Du schreibst, eignet sich vielleicht die „Freedom Publishing Co.“, uWest 42nd Street, New York, die eben einen Riesenwälzer von Rauschning für 2.50 Dollar herausgebracht hat. Die allerherzlichsten Grüße von Deinem B. O. Balder Olden an Hanna und Hermann Budzislawski, Buenos Aires, geschrieben am 22. Oktober 1941.
Liebe Hanna und Hermann, ich wußte schon, daß Ihr alle glücklich in USA gelandet seid, hatte aber keine Ahnung, wie es Euch weiter ergangen ist. Jetzt hatte ich eine große Freude mit dem gemeinsamen Brief. Leider steht über die Kleine nichts drin, auch nicht über den Großvater, der mir schon vor zwei Jahren sagte, „er stünde jenseits des Greisenalters“. Aber da sie beide nicht erwähnt sind, nehme ich an, daß es ihnen gut geht. Das letztemal sah ich Hermann, als ich ihn an den Zug be gleitete vor Eurer Pyrenäen-Expedition, die eine unfaßbare Leistung gewesen sein muß. Es wäre wirklich wert, sie zu schil dern. Mit Säuglingen und dergleichen sind ja viele hinüber gegangen, aber mit diesem uralten Mann! Ich freue mich, daß ich Ihnen nur einmal totgesagt worden bin, plus einmal im Konzentrationslager. Viele meiner Freunde haben mich zwei- bis dreimal beweinen müssen. Tatsächlich saß ich die ganze Zeit bis zu meiner Abreise teils in Annecy, teils in Marseille und überall in der besten „assiette“, aber irgendwelche Beamtentücke verhinderte es, daß meine Schwe ster zu mir herüberkommen durfte, und außerdem war ich so scharf beobachtet, daß ich nichts schreiben konnte, da ich nichts zu schreiben hatte, was Vichy angenehm gewesen wäre. So war die ganze Zeit viel mehr Sanatorium, als mir lieb war, aller dings mit einer Dose Paprika, denn ich stand natürlich auf der berühmten Liste und bekam wer weiß wie lange kein Ausreise visum. Ich wollte auch nicht zu früh in Lissabon sein, weil ich hoffte, Primavera dort treffen zu können, um mit mir zusam men hinübcrzusegeln. Als ich mich endlich doch entschlossen 76
hatte, über die Berge zu gehen, bekamen die Préfectures das Recht, Ausreise-Visen auszugeben, und - I took my chance__ Hier in Argentinien ist alles Materielle sehr wundervoll, aber trotzdem war die Emigrationszeit in Paris vergleichsweise wunderschön, bis zu Beginn des Krieges. Die Argentinier haben außer mir nicht einen Intellektuellen ins Land gelassen. Außerdem wurde bald nach meiner Ankunft ein Verbot er lassen, auch im kleinsten Kreis in fremder Sprache öffentlich zu sprechen, und so ist das Ganze ein zauberhaft schöner Iso lations-Kasten. Als ich ankam, erwartete man sich von mir eine beträchtliche Auffrischung des geistigen und gesellschaftlichen Lebens, aber ich habe hundertprozentig versagt. Allerdings glaube ich, daß selbst Kisch und Kuh versagt hätten, denn man kann aus Torf keine Funken schlagen ... Eine neue Zeitschrift? Es wäre sehr schön, wenn Hermann die „Weltbühne“ wieder herausbringen könnte, aber es ist wohl sehr wenig Aussicht. Eine Auflage, wie er sie in Prag und Paris hatte, würde heute wohl nicht entfernt zu erreichen sein, und eine Freiheit der Anschauung und des Wortes, wie sie damals herrschte, wird auch heute in keinem Land der Welt gewährt werden, abgesehen davon, daß der Mitarbeiterkreis über alle Teile der Welt zerstreut wurde. Ich hatte auch eine ähnliche Idee, als ich hier ankam, habe sie aber längst be graben. Statt dessen schrieb mir kürzlich Frei, daß er mit den Freunden in Mexico eine kleine Zeitschrift - plant, deren erste Nummer schon im, Oktober erscheinen sollte. Jetzt, nachdem Ihr einen schönen, langen Sommer in Twin farms verbracht habt und wieder mal eine lange Periode voll Ruhe, Sorglosigkeit und Anregung vor Euch liegt, kommt es Euch wohl vor, als wäret Ihr über den Styx gereist. Ich habe Sie, liebe kleine Hanna, damals in Paris sehr be wundert! Was Sie durchgemacht und tapfer bestanden haben, ohne je den kleinsten Wehlaut von sich zu geben, wäre für zwei Walküren genug gewesen. So haben wir jetzt eine stattliche Reihe verlorener Revolutionen und Kriege hinter uns und müs sen bei allem noch sagen, daß wir Dusel gehabt haben. Da Ihr beide außerdem noch sehr jung seid und es bei den Kriegen immer noch darauf ankommt, wer den letzten gewinnt, und
77
da es Hitler nicht sein wird, Ihr außerdem das entzückende, gescheite Kind habt, kann ich Euch von Herzen gratulieren. Euch allen, vor allem auch Dorothy Thompson, der ich in Berlin einmal flüchtig begegnet bin und die - glaube ich - mit meinem Bruder befreundet war, und den gemeinsamen Freun den, die wärmsten, herzlichsten Grüße: Euer B O
Balder Olden an Bruno Frei, Buenos Aires, geschrieben am 24. Oktober 1941. Lieber Bruno Frei, für die Oktober-Nummer Ihrer neuen Zeitschrift kam Ihre Einladung leider zu spät, aber hoffentlich kommt der bei liegende Beitrag noch rechtzeitig für den November. Sie hätten anscheinend lieber einen Bericht aus Argentinien, aber das Emigrations-Leben ist hier völlig stagnierend, haupt sächlich, weil seit ca. sechs Monaten nicht mehr in einer frem den Sprache öffentlich geredet werden darf, auch sonst stagniert das politische Leben - das werden Sie ja aus Zeitungen wissen. Alles, was geschieht, geschieht unter der Decke. Man muß sich auf jede Art von Überraschungen vorbereiten und kann als Immigrant nichts Besseres tun, als still sein. Ich nehme aber an, daß Ihre Zeitschrift, auf deren erste Nummer ich mich sehr freue, nicht ausgesprochen politisch sein soll, sondern ein viel weiteres Programm hat: als wahrschein lich einzige Zeitschrift in deutscher Sprache all das zu sammeln, was heute in den tausend Winkeln der Welt politisch, litera risch, künstlerisch vor sich geht. Hoffentlich stehen Ihnen die Mittel zur Verfügung, um durchzuhalten. - Es könnte dann etwas entstehen, das seine Bedeutung auf ferne Zeiten hinaus behält. Sie sind erst seit Anfang September in Mexico? Ich nehme an, daß auch Ihre Überfahrt eine Odyssee war, denn Sie waren doch schon im März in Marseille ziemlich reisefertig? Haben Sie Ihre Kinder glücklich mitgebracht? Mir scheint, der einzige aus Ihrer Gruppe, der nicht entkommen ist, ist Rudolf Leon hard? Theo Balk schrieb mir kürzlich, ich solle auch hier in 78
Argentinien versuchen, prominente Kreise für ihn zu inter essieren. Natürlich habe ich die Fühler ausgestreckt, aber über all dieselbe Ansicht vorgefunden, die ich selbst von vornherein hatte: daß ihm nichts gefährlicher wäre, als wenn man ihn denen, die ihn gefangenhalten, „interessant“ macht. Sie lesen ja ebenso wie ich die Zeitungen und wissen, daß nachgerade all unsere französischen Freunde mindestens eingekerkert worden sind, auf der letzten Liste stand Prof. Langevin. In keinem der Briefe, die ich bisher aus Mexico bekam, stand ein Wort über Gustav Regler. Ich weiß natürlich, unter welchen Umständen er aus Le Vernet entlassen wurde und welche Diskrepanz der Anschauung zwischen Ihnen und ihm bestand, aber ich kann doch nicht annehmen, daß der Konflikt, der sich zu einer Zeit erhob, als uns allen gleichzeitig eine Keule auf den Schädel knallte, so daß keiner mehr recht wußte, wohin der Weg geht, nicht überbrückbar wäre. Oder lebt er gar nicht in Mexico? - Auch von Otto Katz habe ich nie gehört, der doch auch die Visa für Mexico hatte? Viele herzliche Grüße an alle Freunde und die allerbesten Wünsche für die neue Zeitschrift! yjlr
Balder Olden Balder Olden an Ludwig Renn, Buenos Aires, geschrieben am 2.S. April 1943.
Lieber Ludwig Renn, ich danke Ihnen herzlichst für Ihren Brief und freue mich aufrichtig, nun auch mit Ihnen in direkten Kontakt zu kom men. - Was Sie mir über Peter Käst schrieben, hat mich sehr erschüttert, denn ich kann mir sein Schicksal nicht anders als tief tragisch vorstellen. Er war mit seinen französischen Papie ren in ziemlicher Unordnung, und es ist kaum anzunehmen, daß die Franzosen ihm bei der Besetzung von Südfrankreich irgend welchen Schutz gewährt haben. Ich glaube, wenn er auch als Filmschreiber in Mexico keine Zukunft gehabt hätte, hätte er sich trotzdem über Wasser halten können; ich glaube, er ist Elektrotechniker oder etwas Ähnliches, jedenfalls arbeitet er in einem Beruf, in dem er mit der Sprache nichts zu tun hat.
79
Ich war anderthalb Monate von Buenos Aires weg und fand nach meiner Rückkehr, wie zu erwarten war, den Streit Mexico-Buenos Aires resp. Renn-Siemsen ausgebrochen. Dr. Siemsen hat seine Anträge zur Gründung eines Südameri kanischen Komitees erst auf dem Kongreß vorgebracht, als Ihr Rundsdireiben schon in unseren Händen war. Es ist eine be wußte Gegengründung, in der es sich für ihn nur um die Füh rerrolle handelt. Nachdem Siemsen, resp. DAD, auf dem Kon greß die revolutionärsten Forderungen erhoben haben, die sich stellenweise mit den radikalsten sozialistischen Forderungen decken und wogegen gerade ich und unsere Freunde protestier ten, behauptet er jetzt, es sei unmöglich, sich in die Gefolg schaft einer „getarnten politischen Partei“ zu begeben. Die' Montevideaner Beschlüsse sind meines Erachtens null und nichtig; Sie wissen ja aus meinen Artikeln, wie diese Parodie auf eine gesetzgebende Körperschaft zustande kam. Aber DAD steht nicht allein, die viel wichtigere Gruppe Vorwärts und eine kleine Splittergruppe werden sich ihm an schließen, und so entstehen, sechs Monate nach Gründung der Comisión Coordinadora, wieder zwei Richtungen resp. zwei Bewegungen, die tatsächlich dasselbe Programm haben. Ich habe durch Annahme ihrer Einladung des Sitzes ins Ehren-Präsidium meine Stellung klar genug fixiert und glaube, daß die Mehrheit der in der Kommission .zusammengeschlos senen Gruppen mit mir der Alemania Libre beitritt. Es ist aber auch da ein Haken 1 Die Strasser-Leute nennen sich schon seit Jahren Alemania Libre und haben sich diesen Namen zweifellos gesetzlich schützen lassen. Aber auch wenn dieser gesetzliche Schutz nicht besteht, müssen wir uns hüten, mit die ser Gruppe verwechselt zu werden. So weiß ich noch gar nicht, wie wir uns nennen sollen, wenn es zu einer neuen Konstitu tionsgründung kommt. Einstweilen verweise ich immer wieder auf die enormen Leistungen der Alemania Libre, die in einem Jahr erzielt wurden und mit denen sich nichts vergleichen kann, was in zehn Jahren in Argentinien entstand. Ihnen und allen Freunden die herzlichsten Grüße. Ihr B. O. 80
Paradiese des Teufels Das Leben Sir Roger Casements
Erstes Kapitel Der irische Dichter Louis McQuilland schildert Roger Casement: „In manchen Teilen von Irland trifft man heute noch Männer, häufig Bauern, die spanische Granden sein könnten - hohe Gestalten mit tiefen, dunklen Augen, das Haar fast purpurn in seiner Schwärze, lange, ovale Gesichter in der Farbe von altem Elfenbein, und ihr Gebaren hat eine gewisse Größe, eine Er lesenheit der Form, die sonst auf diesen Inseln fremd ist.“ „Eine der ausgeprägtesten Erscheinungen dieses castilischen Typus in Irland ist Sir Roger Casement, der absolut aus einem Bild des Velasquez herauszutreten scheint.“ Casement trug sich auch wie ein spanischer Grande, das leicht gewellte Haar länger, als es die Mode war, und ebenso den früh ergrauten Bart. Sein Gesicht war von Fanatismus ge zeichnet, und in seinen großen, umschatteten Augen lag eine Traurigkeit bis zur Verzweiflung - diese Augen hatten vom Jammer der Welt mehr gesehen als irgendeines anderen Men schen Augen. Ein Bild.von Sarah Purser, dessen Reproduktion vor mir liegt, zeigt den Ausdruck eines seelisch Gefolterten, der nicht gebrochen und noch zu Ungeheurem fähig ist. Schmal und lang wie seine Gestalt waren auch die pathetischen Hände, die auf diesem Bilde zu zucken scheinen, der ganze Mann ist balladesk, düster und von einem großen Wahn beseelt. Wenn es eine Kirche der reinen Menschlichkeit gäbe, müßte sie Roger Casement heiligsprechen, denn sein ganzes Leben war ein einziger Kampf für die Mißhandelten, Erniedrigten und Schwachen, und in diesen Kämpfen prüfte er nie die Macht des Gegners, berechnete er nie die Gefahren, die ihn bedrohten, 6*
nie die Opfer, die er bringen sollte. Nie dachte er an andere Siege als die seiner heiligen Sache. Die katholische Kirche hat keinen Heiligen, der freudiger als er Leiden ohne Maß auf sich genommen, in Wüsten gedient, sein Leben dargebracht hätte als Roger Casement. Wie ein echter Märtyrer der Legende hat er ein Leben ohne Freuden, ohne Frauen, ohne Freunde geführt, hat als Anachoret in Wüsten und Sümpfen gelebt, und am Ende seines Lebens stand der Galgen. Seine großen Taten: er hat die Kongo-Greuel der achtziger Jahre aufgedeckt und Millionen von Kongo-Negern den Fäusten grausamer Ausbeuter entris sen. Er hat die Putumayo-Greuel aufgedeckt, ein Land, das man „Paradies des Teufels“ nannte, von diesem Teufel befreit und seine bis zur Unvorstellbarkeit gequälte Bevölkerung sanft mütiger, wehrloser, kindhafter Indianer vor der Vernichtung gerettet. Er hat den letzten, entscheidenden Anstoß zur Befrei ung Irlands von jahrhundertelanger Fremdherrschaft gegeben, unter der die Iren stöhnten, die ihr nach Roger Casements Über zeugung Hungersnöte, Mißwirtschaft und Raubbau bedeutete und ihre Jugend zu Hunderttausenden in die Fremde trieb. Als er diesen letzten Kampf aufnahm, war er mit noch nicht fünfzig Jahren ein Mann, dessen Tage gezählt waren. Der Kongo und das Paradies des Teufels auf dem Äquator, Kämpfe ohne Maß und vor allem der Anblick von Folterun gen, die sein Herz zerrissen, hatten ihn längst zum Wrack ge macht, ihn, der als Riese an Kraft und Wuchs mit einund zwanzig Jahren auf Stanleys frischen Spuren in das unerforschte Afrika eingedrungen war. Aber auch diesen Rest seines Lebens, hohes Ansehen unter den besten Männern seiner Zeit, Frieden und Heimat, hat er mit übermenschlicher Achtlosigkeit darge bracht, um einen Weg der Leiden zu gehen. Viele Kritiker Roger Casements haben ihn mit Don Quijote verglichen, dem edlen Ritter von der Mancha, der mit gleich hohen Zielen ausritt - und gegen Windmühlen kämpfte. Es kann sein, daß mit kühlerem Blut, klügerer Ausnützung der politischen Lage, weiserer Strategie die Befreiung Irlands ge glückt wäre, ohne daß Roger Casement den Giftbecher bis zum letzten Tropfen leerte, ohne die wilden Blutopfer, die Irland, «4
von seinem Vorbild hingerissen, später brachte. Es kann sein beweisen läßt sich nie, was geschehen wäre, wenn Menschen anders gehandelt hätten, als sie gehandelt haben; denn jedes Geschehnis und jede Tat ist unwiderruflich. - Mehr kann kei ner tun, als Roger Casement getan hat: nach dem Gesetze leben, mit dem er geboren, sich selbst verleugnen und herrlich, herrlich, heldisch sterben, wie er gestorben ist. Er ist als Verräter gestorben, als Hochverräter am Galgen! Der Prozeß, in dem er verurteilt wurde, ist juristisch ohne Lücke. Nachdem er zwanzig Jahre lang im Dienste der eng lischen Krone gestanden, hatte er vom König von England den Titel eines Ritters und eine lebenslängliche Pension an genommen und hat dann die letzte Glut seines Lebens aufge wandt, um gegen die Hoheit dieses Königs Aufruhr zu predi gen, vom Feinde Waffen zu holen und sie den irischen Unter tanen dieses seines Königs in die Hände zu drücken! Darf man das, einen Verräter wie diesen verherrlichen, ihn mit den Ge stalten der Heiligenlegende in einem Atem nennen? Ich weiß, daß mein Bericht von Roger Casement im ersten W'ort schon auf diesen Vorwurf stößt und viele abschrecken könnte, mir zu folgen. „Deutschland hat sich dieses Verräters bedient, aber es stellt den Verrat deshalb nicht höher“, könnte man mir entgegen werfen. Dies Argument muß ich entkräften, ehe ich beginne, und deshalb an den Anfang meiner Erzählung setzen, was erst gegen ihr Ende diskutiert werden sollte. Casement war Ire, und Irland war eine von England unter worfene Nation, die durch Jahrhunderte immer wieder für ihre Befreiung blutige Opfer gebracht hatte: Als er sich entschloß, vom König abzufallen und nur noch der irischen Sache zu dienen, hat er diesen Entschluß in einem „Offenen Brief an das irische Volk“ feierlich kundgetan und damit auf alle Rechte und Würden verzichtet, die England ihm schuldete. Damals sandte er auch zwei hohe Orden, die ihm der König vor Jahren verliehen und für die er geziemend seinen Dank ausgedrückt hatte, in der ungeöffneten Postverpackung - mit höflichem Bescheid zurück. «5
Er hat „Hochverrat" im juristischen Sinne des Wortes be gangen, aber Bernard Shaws Urteil über sein Handeln wiegt schwerer als das des Tribunals. „Kein weiser Mann wagt hier das Wort .Verräter'. Wer für die Freiheit seines Landes kämpft, mag schlechtberaten und ein verzweifelter Narr sein; aber er ist kein Verräter und wird seinen Landsleuten nie ein Verräter scheinen. All die erschla genen Männer und Frauen der Sinn-Fein-Bewegung kämpften und starben für ihr Vaterland so ernsthaft wie irgendein Soldat in Flandern für das seine kämpfte und starb.“
Zweites Kapitel Die väterliche Familie Roger Casements, der am i. September 1864 in Dublin geboren wurde, ist wahrscheinlich nicht von rein keltischem Blut. Man glaubt, daß sie im Anfang des 18. Jahrhunderts von der Isle of Man nach Irland gekommen ist und ursprünglich aus Frankreich stammt. Aber sie hatte sich gründlich akklimatisiert, so gründlich, daß die Casements zu den „schwarzen Protestanten“ zählten, den Angehörigen der Irischen Kirche, von denen es heißt, die Römischen Katholiken seien ihnen Heiden und Götzendiener. Sie glaubten, es sei ihre Pflicht, allezeit in Irland zu leben wie die Juden in der Gefangenschaft, Holz zu schlagen und Wasser zu pumpen. Im übrigen war jeder Ulstermann, ob Katholik, Protestant, Presby terianer oder Methodist, ein harter Puritaner voll Nüchternheit und Entsagung, bibelkundig und buchstabenfromm. So waren auch die Eltern Casements, die ein Bauerngut in der Graf schaft Antrim besaßen, Rogers Vater war Hauptmann der Bür gerwehr. Beide Eltern starben, als ihre drei Kinder noch klein waren. Sie kamen dann in ein ebenso freudloses Heim zu Ver wandten in derselben Grafschaft. Aber früh schon rebellierte ihr Blut gegen all die Bravheit ringsum, gegen das ewige Grau einer klösterlich-bürgerlichen Welt. Rogers älterer Bruder Tom war ein Satan von Bub, unzähm bar wild und abenteuerhungrig. Er brach aus, als ihm die Flü gel eben gewachsen waren, fuhr als Schiffsjunge nach Austra 86
lien, führte dort ein wildes, hartes Leben, reiste bei Ausbruch des Burenkrieges nach Südafrika, wurde Soldat und kämpfte wie ein Ajax. Später war er Goldsucher, Großwildjäger, poli tischer Agitator, er hatte sich gründlich ausgetobt und die Welt kennengelernt, ehe er in gesetzten Jahren eine Reiseagentur er öffnete. Vom jungen Roger erzählten die Schulkameraden, daß er voll Sonne und Leben war, ein krasser Gegensatz zu der finste ren Härte, die seiner Familie Erbteil. Er ging fast spielend durch die Klassen und gewann, wie etwas Selbstverständliches, alle Schulpreise, aber zugleich war er der Häuptling seiner Mit buben in allen Kämpfen und bei streng verbotenen Taten. Mit siebzehn Jahren verließ er die Schule und fing an, sich auf einen Beamtenberuf vorzubereiten. Aber schon nach einem Jahr schien diese Zukunft ihm viel zu eng. Damals tobte sein Bruder sich schon durch alle Abenteuer der wildesten Welt, Roger sehnte sich nach Kampf und Gefahr - er war ein Dich ter, der Verse schrieb, aber an Versen kein Genüge fand. „Wenn das Meer keine Stürme hätte, wäre ich jung gestor ben.“ Damals, zu Beginn der achtziger Jahre, war das tropische Afrika Ziel aller romantischen Sehnsüchte. Livingstone hatte den Viktoria-See entdeckt, Speke die Quellen des Nils gefun den, Schweinfurth und Nachtigal die unteren Nilländer durch forscht. Von Norden her war Emin Pascha bis zum Äquator vorgedrungen, Stanley hatte den Weg von der Kongomündung ins Herz Afrikas gewagt und festgestellt, daß der Kongo schiffbar war, ein breiter Weg ins damals noch dunkelste Afrika. Nur wenn ein Luftschiffer etwa den Mars erreichte und voll von den Gesichten einer anderen Welt auf die Erde zurück fände, könnte die Phantasie unserer heutigen Jugend sich ent flammen, wie die der Jugend von 1880 bis 1890 sich an den Afrikaberichten entflammte. Ein neuer Weltteil tat sich aufl Urwald und Steppe, Sklavenjäger, Menschenfresser, Pygmäen, Löwen und Riesenschlangen, ein gewaltiges Meer im Herzen dieses Weltteils - es war genug, die Herzen einer ganzen Gene ration in Flammen zu versetzen. 87
Weit populärer als heute die Namen von Rekordfliegern, Olympioniken und Meisterboxern waren damals die Namen all der tapferen Männer, die in den afrikanischen Busch einfielen, jungfräuliches Land durchzogen, selten nur eine Kunde ihrer Taten und Funde nach Hause senden konnten. Tauchten sie, oft jahrelang verschollen, wieder an irgendeiner Küste auf - aber viele von ihnen waren dem Fieber, den Giftpfeilen, den tau send Schrecknissen der Tropen erlegen -, dann horchte die Welt, dann trank die Jugend sich toll und voll an ihren Aben teuern, Auf den Spuren der Forscher zogen die Eroberer hinaus. Es war plötzlich ein toller Wettlauf um „Kolonialbesitz“ ausge brochen, denn nicht nur von Wunden und Leiden hatte man gehört, sondern von einer Welt voll ungehobener Schätze. Gummi, Elfenbein, Erze und Gold, Land, das dreimal im Jahr Ernten trug, Korn, Baumwolle, Früchte - es schien des Schwei ßes der Edlen wert, zur rechten Stunde noch dort Fuß zu fas sen. England, Frankreich, Belgien, Portugal griffen gewaltig zu, nur Deutschland hielt sich unter Bismarcks Führung zurück. Aber auch Bismarck - der den ganzen Kolonialtraum für eine Schimäre hielt - konnte nicht verhindern, daß ein mit tausend Volt Energie geladener junger Deutscher, Carl Peters, auf eigene Faust eine deutsche Kolonial-Gesellschaft organisierte und, mit wenigen tausend Mark bewaffnet, den Wettbewerb mit den großen Mächten aufnahm, Ostafrika an sich riß und zur deutschen Kolonie machte. Am 2 5. November 1884 wurde in Berlin eine internationale Konferenz abgehalten, die von allen kolonialinteressierten Mächten beschickt war. Sie stand unter dem Zeichen von Stan leys Erforschung des Kongolaufes und sollte eine internationale Rechtsbasis für die neue Welt schaffen. Bismarck betonte, daß Europas Wunsch berechtigt sei, diese bisher unberührten, poli tisch herrenlosen Länder für europäischen Handel und Verkehr zu erschließen, vor allem europäische Zivilisation zu verbreiten. Indessen zogen die Emissäre all der am Konferenztisch ver sammelten Mächte durch Afrika und erbeuteten Land in Zehn tausenden von Hektaren. „Freßt um euch wie Wölfe!“ rief Peters seinen Pionieren zu. 88
Roger Casement fand auf einem Afrikadampfer Stellung als Hilfszahlmeister und kam so, einundzwanzig Jahre alt, an die Küste von Westafrika. Damals wurden in Europa Gesellschaften gegründet und Kapitalien gezeichnet, um Reichtümer aus dem Busch zu holen. Missionen zogen aus, um die Neger zu Christen zu machen, Soldaten, um sie zu unterwerfen. Mit alldem hatte Roger Casement nichts zu tun. Er verließ sein Schiff, ohne Amt, ohne Ziel und ohne Ver mögen betrat er den Boden Afrikas, der ihm heilig schien. Groß, stark, von eiserner Gesundheit, ein Träumer, der in Europa nach Romantik gehungert hatte, ein Dichter, der die blaue Blume der Romantik sucht - so begann ein großer Afri kaner seinen Weg ins Innere. „Ich kann Sie versichern, daß er ein reiner Mensch ist", schrieb Joe Conrad, der polnisch-englische Dichter, der bald darauf als Kapitän eines Flußdampfers den Kongo hinauffuhr, viele Jahre später über Roger Casement. „Es ist ein Hauch vom Eroberer in ihm, ich habe ihn in die unausdenkbarste Wildnis eindringen sehen, einen Knotenstock als einzige Waffe schwingend, zwei Bulldoggen, Paddy (weiß) und Biddy (gefleckt) an seiner Seite, dazu einen Luanda-Boy, der sein Bündel trug, als einzige Gesellschaft. Ein paar Monate später sah ich ihn zurückkehren, ein wenig hagerer, ein wenig brauner, mit seinem Stock, den Hunden, dem Luanda-Boy, und so heiter, als käme er von einem Spaziergang durch den Park... Er konnte Dinge erzählen! Dinge, die ich versucht habe zu vergessen. Dinge, die ich nie erfahren hätte!“
Drittes Kapitel Die Menschheit hat sich stets gegen neue Erkenntnis gewehrt und die Männer verdammt, die ihr ein Fenster zum Kosmos aufstießen, als gelte es, Rache an ihnen zu nehmen, weil die Wahrheit, die nun hereindrang, zunächst die Augen blendete, weil mit dem Erwachen Bewegung und Unrast im Kerker de; Erdbagno entstand. Das ist die Mythe von Prometheus, den 8
Zeus an einen Felsen schmieden ließ, wo ein Geier seine Leber zerhackte, weil er den Menschen das Licht gebracht. Jesus Christus, Sokrates, Giordano Bruno, Hus, Galilei: Kreuz, Feuer, Gift, Folter ... Die Reihe derer, die unser Weltbild weiteten und darüber Märtyrer wurden, wäre ins Unendliche fortsetzbar, wenn man zu Gift und Feuer den Hunger zählte. Einheitlich und tragisch ist auch das Schicksal derjenigen, die nicht eigentlich unseren geistigen Kosmos erweitert, aber das Bild unseres Globus selbst und unsere geographische Welt vergrößert haben. Christoph Kolumbus starb, ein armer Geächteter, im Kloster zu Valladolid und mußte Gott dankbar sein für die Wohltat dieses Sterbelagers aus Stroh. Er hatte zwar Amerika entdeckt und der spanischen Krone unterworfen, dort aber nur geringe Verwaltungstalente bewiesen. Aus der Neuen Welt, die er der Menschheit geschenkt hatte, wurde er in Ketten nach Spanien zurückgebracht, vor Gericht gestellt und seiner Ämter entsetzt. Fernando Cortez, der 1519 mit fünfhundert Soldaten dem König von Spanien Mexiko erobert hatte, stand 15 26 vor Ge richt und entging mit knapper Not der schwersten Kerkerstrafe. Er starb in der Verbannung. Sir Walter Raleigh begründete zwar die Kolonie Virginia und wurde damit der Schöpfer dessen, was man heute USA nennt. Aber gerade durch den Namen, den er seiner Gründung gab, Virginia, das heißt Jungfrauenland, kompromittierte er seine Freundin, die jungfräuliche Königin Elisabeth, wurde als Hochverräter vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und zu lebenslänglicher Kerkerhaft begnadigt. Jedoch trotz dieser Be gnadigung entging er dem Richtbeil nicht. Dreizehn Jahre spä ter befreite ihn König Jakob L, weil er ihn als Führer einer Expedition nach Bujana brauchte. Auf dieser Expedition geriet Raleigh in ein Gefecht mit spanischen Truppen, in dem sein Sohn fiel, er aber seine Befugnisse überschritt. Das letzte Wort sprach der Henker. Lord Clive, der für England die Kolonie Britisch-Indien be gründete und das Land Bengalen erobert hatte, wurde 1767 vom englischen Parlament wegen seiner Grausamkeiten gegen
90
Eingeborene vor Gericht gestellt. Das Urteil, das nach Jahren gefällt wurde, lief zwar nur auf einen Tadel heraus, aber Lord Clive war so erschüttert, daß er sich selbst den Tod gab. Emin Pascha, ein deutscher Arzt, der in englisch-ägyptischen Diensten Gouverneur im Sudan war und - mehr als irgendeiner der Konquistadoren ein erhabener Menschenfreund - diesem Land Kultur brachte, wurde ein Opfer seiner Eingeborenen politik. Für seine Bekämpfung des Sklavenhandels rächte sich die Partei der Sklavenhändler, denen er halb blind in die Hände fiel. Sie schnitten ihm in langwieriger Prozedur den Hals durch. Carl Peters, der auf eigene Faust deutsche Kolonialpolitik trieb, der im Kampfe gegen die ganze Welt, die deutsche Regie rung selbst nicht ausgenommen, für Deutschland ein Kolonial reich so groß wie Indien erobert hatte, wurde wegen Mißbrauch der Amtsgewalt vor den Disziplinargerichtshof gestellt und ohne Pension aus dem Reichsdienst entlassen. Beschimpft und geächtet, verließ er Deutschland, wo man bald mehr vom Peters- Skandal als von der Kolonie Deutsch-Ostafrika wußte. Selbst Hermann Wissmann, von den deutschen Afrika-Pio nieren nach Bismarcks Wort der einzige, der „mit weißer Weste aus den Kolonien heimkehrte“, hat durch Selbstmord geendet man weiß den Grund nicht und wird ihn nie erfahren. Aber das Gemeinsame dieser Schicksale muß wohl im Gemeinsamen ihrer Träger verwurzelt sein. Nur Menschen besonderen For mates unternehmen es, in jungfräuliche Wildnis einzudringen, Länder zu erobern, Reiche zu gründen. Zu dem Impetus, der solche Taten bedingt, scheint oft eine souveräne Verachtung der Rechte und des Lebens anderer Menschen zu gehören, immer eine noch großartigere Verachtung des eigenen Lebens. Es mag sein, daß Wissmann nur deshalb mit fünfzig Jahren dem eigenen Leben ein Ziel setzte, weil ein Altern in Ruhe und Sicherheit, betitelt und pensioniert, reizlos für ihn war, der die Natur an ihrem Schöpfungsmorgen belauscht hatte, weil ein „Strohtod im Bette" ihm, dem alten Recken, nicht genügte, von dessen Genossen der Jugend so viele auf dem gemein samen Kampfplatz geblieben waren. So scheint es auch Schick sal, in die Sterne geschrieben und unentrinnbar, daß Roger Casement von Henkershand starb. 9«
Ihn aber unterscheidet von den Kolumbus, Cortez, Raleigh und Clive, daß er - wie Livingstone und Emin Pascha - nie mit den Starken, immer mit den Schwachen paktierte und daß die Rechte, die er mißachtete, nie die verbrieften, immer die natürlichen, von Gott selbst, wie er ihn verstand, erlassenen waren. Als er zum erstenmal die Kongomündung hinaufzog, traf er ein Volk von schwarzen Hirten und Bauern an, deren Herzen ohne Arg dem weißen Menschen entgegenflogen. Der Weiße erschien überall im schwarzen Weltteil dem Eingeborenen zu nächst als ein Gott, voll von Weisheit, voll von Gerechtigkeit. Unbegrenzt ist selbst heute noch sein Glaube an unser Können, an den Geist des Europäers, der fast den Elementen gewachsen ist. Das erste Dampfschiff, das erste Flugzeug, das die Neger zu sehen bekamen, hat sie nicht erschüttert. „Europäerarbeit“, sagten sie und staunten nicht. Sie ahnten nicht und ahnen auch heute nur in den ganz erschlossenen Provinzen Afrikas, daß es in Europa Abermillionen von Weißen gibt, die ihr eigenes Los teilen, Arbeiter, Hungernde, Schwache, auch Diebe und Wege lagerer. Sie stellten sich die Heimat des blauäugigen, blaß gesichtigen Eindringlings wie ein anderes Afrika vor, in dem wenige Weiße gleichfalls über die Scharen eines Volkes anderer Rasse herrschen. Noch 1915 wollte mir mein Diener in Ost afrika - trotz des Krieges, der uns Weiße um vier Fünftel unse rer Privilegien brachte - nicht glauben, daß es in Europa keine Farbigen gäbe. „Wer macht euch denn die Arbeit?“ fragte er. Wohl waren schon vor Jahrhunderten von Europäern be mannte Segelschiffe an den Küsten von Westafrika erschienen, um Handel zu treiben, vor allem, um Sklaven zu erbeuten, und sie hatten Abertausende von schwarzen Menschen in die Fremde geführt, von denen nie wieder Kunde kam. Sie hatten ge schossen, gerauft und gelogen, aber der Schwarze ist ein Mei ster des Vergessens, und bis ins Innere war ein Bericht dieser argen Besucher wohl nie gedrungen, nicht bis ins Bewußtsein der Völker. Viel schlimmer als diese um 1880 höchstens noch sagenhaften Sklavenräuber, die gekommen waren, um Amerika mit „schwar zem Elfenbein“ zu versorgen, waren ja die Araber, die nie 92
aufgehört hatten, das ungeheuere Menschenreservoir Zentral afrikas zu plündern. In ihre Hände zu fallen war das schreck lichste Schicksal ganzer Dörfer, ganzer Stämme - sie holten die Ware Neger, wo sie spottbillig war, und achteten es gering, wenn auf dem Weg zum nordafrikanischen Markt, wo sie hoch im Kurs stand, ein großer Prozentsatz verkam. Sie waren die Pestilenz des Landes, das personifizierte Böse, und von den Weißen konnte nur Schutz gegen diese Hyänen, nur Gutes kom men. Diese gläubige Unterwürfigkeit, die die Eingeborenen jedem Weißen entgegenbrachten, hatte verschiedene Wirkung. Viele Europäer glaubten langsam, sie seien wirklich Übermenschen. Unter glühender Sonne, den Geist oft von Fiebern umdunkelt, fühlten sie sich, wie sie empfunden wurden, als schützende oder strafende Gottheit. Diesen Titanenwahn, der endlich im Schwarzen kein verwandtes Menschenwesen mehr erkennen wollte, nur noch eine Masse von Herdenvieh, oft boshaft, oft faul, völlig rechtlos und von geringerem Wert je Stück als eine Ziege, nannte man „Tropenkoller“. Das Wort ist heute aus unserem Sprachgebrauch fast ganz geschwunden. In den ersten Jahrzehnten der Kolonialergreifung war es jedem Zeitungsleser furchtbar geläufig. Andere Europäer, so Livingstone, Emin Pascha, so der junge Ire Roger Casement, waren bis in die Seele gerührt, ja er schüttert, von dieser Menschen Arglosigkeit, ihrem kindlichen Vertrauen. Sie wollten nicht wieder nach Europa zurück, ihnen war dies Afrika trotz seiner Gluten, trotz Malaria, Dysenterie und Schwarzwasserfieber ein paradiesischer Garten, über den sie gern schützend die Hände gebreitet hätten. „Tritt leise auf, Europa! Hier ist heiliges Land!“
Viertes Kapitel In den ersten Jahren der Erschließung des Kongo zog manche Expedition in seine Wildnis ein, von der man nie wieder hörte, der Urwald tat sich ihnen auf und schloß sich über ihnen, wie das Meer sich über einem gesunkenen Schiße schließt. Sie alle 9J
zogen aus, um Elfenbein zu holen, es mit Tauschwaren einzu handeln oder mit der Winchesterbüchse zu erbeuten. Das war fast dasselbe, denn was die Eingeborenen als „Ware“ betrach teten und wofür sie die in heldischen Kämpfen erbeuteten Elefantenzähne hingaben, war Messingdraht in winzigen End chen, Kalikostoff von erbärmlicher Qualität, Glasperlen. Sie brachen in die Welt der Schwarzen ein wie Räuber, um ihnen Schätze abzupressen, ihre Reisen waren schlecht vorbereitet, ihre Kenntnis der Tropen gleich Null. Der breite Kongostrom war das Einfallstor, sie charterten erbärmliche, halb wracke Dampf boote und vertrauten sich einem Fahrwasser, reich an Untiefen, an, das keiner kannte; sie dressierten Neger zu Steuerern, Maschinisten, Matrosen, die eine Last halb verwestes Flußpferdfleisch als einzige Nahrung an Bord brachten und oft vor Hunger stöhnten. Der Maschinist glaubte, daß in seiner Maschine ein furchtbarer Geist stecke, den er mit öl und Wasser nähren müsse, um ihn in gnädiger Laune zu erhalten. Im Strom waren zahllose Inseln, auf denen Flußpferde und Alligatoren sich sonnten, an den Ufern stand strotzender Ur wald, zwei gewaltige Mauern aus Baumstämmen und Lianen. Irgendwo in der Nähe einer Negersiedlung verließen die Ex peditionsteilnehmer das Schiff und errichteten eine „Station“, auf vier Pfählen ein Dach aus Wellblech, Wände aus Gras. Armseliges Mobiliar schleppten sie mit sich. „Jede Station soll ein Leuchtturm auf dem Wege zu einer besseren Zukunft sein. Ein Mittelpunkt für den Handel, natür lich aber auch aller Bestrebungen, die Belehrung, Besserung, Verbrüderung bedeuten.“ So wurden diese Unternehmen deklariert. Aber nie haben Menschen etwas ganz Teuflisches unternommen, ohne sich der göttlichsten Ziele zu rühmen. Was diese Elfenbeinhändlcr trieb, war nur die Gier, sie erpreßten und quälten die armen Neger, die ihren Glauben an die Gottähnlichkeit der Weißen bald verloren. Manchmal setzten sie sich mit Pfeilen und Speeren gegen neue Eindringlinge zur Wehr. Auch Roger Casement nahm auf Kredit einen kleinen Waren vorrat auf und wurde Elfenbeinhändler. Aber ihm war der 94
Gewinn gleichgültig, er zog nur dem Abenteuer nach, zwei Jahre lang. Ihm diente der Handel nur, um die winzigen An sprüche decken zu können, die auch er befriedigen mußte, um leben zu können. Er lernte viele Kongo-Dialekte, und man kann annehmen, daß er gründlich „vernegerte“, tage- und nächtelang mit seinen Schwarzen zusammenhockte, sich Mär chen und Lieder anhörte, aus einem Topf mit ihnen aß. Joe Conrad erzählt in seiner herrlichen Novelle „Das Herz der Finsternis“, wie er als Kapitän auf dem Kongofluß seine „Kaffeemühle“ durch einen Hagel von Pfeilen hindurch steuert - man sieht die Angreifer nicht, sie stecken in der un durchdringlichen Urwaldmasse. Aus dem Schiff wird mit Kugeln und Schrot in diese Masse hineingepfeffert, bis alle Munition verschossen ist, aber sichtbar ohne Erfolg. Da zieht er die Dampfpfeife, ihr Schrei gellt über Urwasser und Urwald, und plötzlich ist kein Feind mehr am Ufer. Ferner und ferner hört man ein herzzerreißendes Klagegeschrei der flüchtenden Neger, eine Art Klagegesang - es hat sich ein neuer Gott, dem diese gellende Stimme gehört, mit den Weißen verbunden. Bald darauf erreichte der Dampfer eine Lichtung, auf einem Hügel stand das baufällige Haus eines Europäers. Am Ufer wartete ein weißer Mann, der einen Hut von der Größe eines Wagenrades trug und unermüdlich mit dem ganzen Arm winkte. Dann begann er zu brüllen, er forderte den Kapitän dringend auf zu landen. „Wir sind angegriffen worden“, schrie der Führer der „Ex pedition“. „Ich weiß, ich weiß“, schrie der andere zurück in denkbar herzlichem Ton. „Kommt nur, es ist schon recht.“ Sein Khakianzug war über und über mit bunten Flicken be setzt, er sah aus wie ein Harlekin. „Im Sonnenschein sah er unendlich lustig und dabei sehr sauber aus, man merkte genau, wie sorgfältig die Flickarbeit gemacht worden war. Ein bart loses Knabengesicht, keine ausgeprägten Züge, eine Nase, die sich eben schälte, Lächeln und Stirnrunzeln, die einander auf dem offenen Gesicht folgten wie Sonnenschein und Schatten auf einer windgepeitschten Ebene.“ „Die Eingeborenen sind noch im Busch“, wird ihm gesagt. Er versichert, daß alles in Ordnung sei.
95
„Es sind einfältige Leute. Sie hatten nichts Böses im Sinn. Nicht geradezu Böses ...“ Dann rät er dem Kapitän, Dampf im Kessel zu halten, da mit er im Notfall die Dampfpfeife blasen könne. „Ein guter Pfiff wird mehr für Sie tun als alle Gewehre. Es sind einfältige Leute.“ Diese Conradsche Novellengestalt ist nichts anderes als ein Porträt Roger Casements, obwohl Conrad nach Dichterbrauch aus dem Iren einen Russen, aus dem dunkelhaarigen Mann einen Blonden macht. Seine Schilderung ist trotzdem so hundertkarätig echt, wie sie nur ein ganz großer Dichter geben kann, der wohl Hinter gründe und äußerliche Zusammenhänge vertauschen mag, dem aber die Substanz der menschlichen Seele heilig ist, ein Gott gegebenes, an das er nicht rührt. Ohne das leuchtende Bild des reinen Knaben Roger, das ich hier zitiere, wäre es nicht mög lich, den späteren Mann Roger Casement zu begreifen. „Ich sah ihn an, in Verwunderung verloren. Da stand er vor mir, kostümiert, als wäre er einer Komödiantentruppe ent laufen, begeistert, unwahrscheinlich. Sein Dasein selbst war un wahrscheinlich, unerklärlich und ganz und gar zum Erstaunen. Er war ein unlösbares Problem. Es war unbegreiflich, wie er hatte leben, wie er hatte so weit kommen können, wie er es fertiggebracht hatte, durchzukommen - und warum er nicht im Augenblick sich in nichts auflöstc. ,Ich ging ein wenig weiter', sagte er, ,und dann noch ein wenig weiter - bis ich nun so weit gekommen bin, daß ich nicht mehr weiß, wie ich jemals zurück kehren soll. Macht nichts. Massenhaft Zeit. Wird sich schon finden.* Der Zauber der Jugend überglänzte seine bunten Flikken, seine Verkommenheit und Einsamkeit, die trostlosen Male seines ziellosen Wanderns. Durch Monate - durch Jahre war sein Leben keinen Pfifferling wert gewesen; und da stand er nun vor mir, ganz springlebendig, hochherzig, unbekümmert und allem Anschein nach unantastbar, nur infolge seiner jungen Jahre und seiner bedenkenlosen Kühnheit. Ich fühlte mich zu etwas wie Bewunderung, ja Neid versucht. Ein Zauber trieb ihn voran, ein Zauber hielt ihn unversehrt. Er verlangte sicher nichts weiter von der Wildnis als Raum, um atmen und immer
96
weiterwandern zu können. Er wollte leben und unter den denk bar größten Gefahren und schlimmsten Entbehrungen sich wei terbewegen. Wenn je der völlig reine, nicht berechnende, wirk lichkeitsfremde Abenteurergeist ein menschliches Wesen be herrscht hatte, so diesen flickenbesäten Jungen. Ich beneidete ihn beinahe um den Besitz der kleinen, klaren Flamme. Sie schien alle Gedanken an das Ich so gründlich aufgezehrt zu haben, daß man sogar, während er mit einem sprach, völlig ver gaß, er selbst - der Mann da vor einem - sei durch alle diese Dinge gegangen.“ Zum Schluß dieser Begegnung erbittet der flickenbesetzte Junge sich ein Paar Schuhe - er trug nur noch Sohlen, mit vielgeflickten Schnüren sandalenartig unter die nackten Füße gebunden - und eine Handvoll Jagdmunition, die er zu einem Buch in die knallrote Tasche seiner Jacke stopfte. Nicht sehr fern erwartet ihn ein Kanoe mit drei schwarzen Freunden. Er hat eine Menge Freunde unter den Wilden. „Sie sind einfältige Leute - und ich brauche ja nichts, wissen Sie.“
Fünftes Kapitel 1885, also ein Jahr nach der ersten Berliner Konferenz, war der „unabhängige Kongostaat“ konstituiert und von allen Mäch ten anerkannt worden, „gegründet von Seiner Majestät dem König der Belgier, um Afrika mit Zivilisation und Handel zu durchdringen, wie auch für andere humane und wohltätige Zwecke“. Dieser Staat war der Nachfolger von „Leopold II.Kongo-Handelsgesellschaft“. Leopold wurde - erst nur ein königlicher Kaufherr, jetzt ein handeltreibender König - sein Präsident und Sachwalter, damit unbeschränkter Gesetzgeber und Herr über ein Gebiet von fast zweieinhalb Millionen Quadratkilometern Afrika, über eine Bevölkerung, die auf mehr als zwanzig Millionen Menschen geschätzt wurde. Für ein Königreich im Umfange von 304 000 Quadratkilometern und mit etwa fünf Millionen Einwohnern, das erst seit fünfund fünfzig Jahren als selbständiges Reich bestand, war dieser Ge 7
Paradiese
97
biets- und Machtzuwadis unfaßbar, er bedeutete für Leopold zugleich eine unerhörte Steigerung seines persönlichen Ansehens. Tatsächlich war er der erste Machthaber, der die Wichtigkeit von Stanleys Erforschung des Kongo-Gebietes erkannt, der erste, der seine Hand auf diese neue Welt gelegt hatte. Aber politisch waren es zwei Zufallsumstände, die es möglich mach ten, daß er sich nun an die Spitze aller kolonialhungrigen Mächte setzen konnte. Einmal war er ein Vetter der Königin Viktoria von England; sein Vater, den sie grenzenlos verehrt und bewundert hatte, war ihr Onkel gewesen, er hatte seine Krone aus den Händen Englands empfangen. Andererseits war Belgien ein ungefährlidier kleiner Staat, dessen Neutralität für alle europäischen Kriege von den Großstaaten garantiert war. Es war nicht zu befürchten, daß ein noch so riesiges Afrikareich im Besitz Belgiens je den Frieden Europas be drohen würde. Im übrigen wurde der Kongo mehr ein europä isches Mandat als Eigentum der belgischen Krone, denn den Vertretern aller Nationen waren absolut gleiche Handelsrechte gewährleistet, und der Warenverkehr auf dem Kongostrom blieb an bestimmte Normen gebunden. Maßgebend für das Eingehen Europas auf die Vorschläge Leopolds war jedoch vor allem die Persönlichkeit dieses Poten taten. Er galt als einer der klügsten und klarsten Regenten, unter dessen Zepter Belgien aufgeblüht war, zugleich als ein Philantrop, der nicht national, sondern kosmopolitisch fühlte. So schien es ungefährlich, ihm viel weiterreichende Gewalt über den Kongo zu geben, als die Verfassung sie ihm über Belgien verlieh. Man wird später sehen, daß er dies Vertrauen der Welt schändlich mißbrauchte. Zwei Jahre lang hatte Roger Casement einsam im Busch ge lebt, als er 1887, ein Dreiundzwanzigjähriger, der zu den besten Kennern des Landes, seiner Sprachen und der Psyche seiner Eingeborenen gehörte, wieder an der Küste erschien. Damals rüstete ein reicher Amerikaner, General Sanford, eine große Expedition ins Innere, um zu beweisen, daß auch die USA „dabei“ waren, wenn es galt, Zivilisation und Christentum in die Wildnis zu tragen. 98
Casement trat in den Dienst des Generals, dessen Expedi tion wohlausgerüstet und von Leopolds besonderer Gunst be gleitet war, denn diesem König war nichts wichtiger als die öffentliche Meinung in Nordamerika. Mit dieser Reise begann Roger Casements große politische Karriere. General Sanford erkannte in ihm den fähigsten seiner Begleiter, ein Land nicht nur zu durchreisen, sondern wirklich zu erforschen, seine Mög lichkeiten für Handel und Industrie, die Notwendigkeiten sei ner Verwaltung. Casement war ein Augenmensch, ein starker Intellekt, der vorzüglich sprach und schrieb, ein begeisterter „Afrikaner“. Als die Expedition mit reichen Ergebnissen an die Küste zu rückgekehrt war, entsandte ihn General Sanford nach Amerika, um in öffentlichen Vorträgen über seine Pionierfahrt und den Stand der Dinge im Kongo Bericht zu erstatten. Sanford selbst gab seinen offiziellen Bericht an die Regierung der USA, und bald war die ganze Welt sich darüber einig, daß König Leo polds Besitzergreifung des Kongo ein Segen für die Mensch heit sei. Die Neger würden unter seinem weisen Regiment von ihren schlimmsten Feinden, den arabischen Sklavenhändlern, befreit werden. Der Kannibalismus, noch zwischen verfeindeten Stämmen üblich, würde verschwinden, Sicherheit und Gesittung würden im ganzen Lande herrschen. Seine Reichtümer an Holz, Gummi, Erzen, seine Anbauflächen und Weiden könnten bin nen kurzem erschlossen werden, umgekehrt würde ein neuer, unschätzbarer, reicher Absatzmarkt für die europäische Indu strie erstehen. 1891, nach seiner erfolgreichen Rundfahrt durch die Städte Amerikas und einem Wiedersehen mit Irland, das er sechs Jahre zuvor verlassen hatte, kam Roger Casement wieder nach Borna, der Haupt- und Hafenstadt des neuen Reiches. Nun bemächtigte sich das Englische Kolonialamt dieses nach allen Seiten hin bewährten jungen Forschers und entsandte ihn als „Regierungsreisenden“ nach Norden in das englische Protekto rat Nigerien. Auf seltsamen Wegen war er nun doch in den Staatsdienst gelangt, dem er ursprünglich bestimmt gewesen. Als Knabe war er der vorbereitenden Schule entlaufen, um sich ins Abenteuer zu stürzen. 99
Drei Jahre lang studierte Roger Casement Nigerien, das ähnlich wie der Kongo im ersten Stadium der Erschließung stand. Seine Berichte und Vorschläge bewährten sich und fan den hohe Anerkennung. Mit zweiunddreißig Jahren galt er als einer der besten Männer im Kolonialdienst, als bester Kenner der Eingeborenenfrage. Seine nächste Ernennung war die zum Konsul in Laurengo Marques, der Hauptstadt von PortugiesischOstafrika. Auch dieses Amt war kein Ruheposten, und Roger Casement war kein Beamter, der gemächlich das pensionsfähige Alter abzuwarten gedachte. Lauren^o Marques lag fern von Nigerien, die ostafrikanischen Neger waren ein anderes Volk mit anderer Sprache als die Westafrikaner. Casement bereiste bis zum Aus bruch des Burenkrieges das riesige Gebiet der portugiesischen Kolonie, wie man damals in Afrika reiste: zu Fuß an der Spitze einer Trägerkarawane, allen Unbilden des tropischen Klimas preisgegeben. Sein Haus war das Zelt mit Sonnensegel, sein Lager das Zeltbett. Das war goldener Luxus gegen die erste Kongofahrt, er war immer noch Spartaner, aber kein Jüngling mehr. Drei Jahre später versetzte ihn seine Behörde abermals an die Westküste, als Konsul für die portugiesische Kolonie Angola. Aber bald nach seinem Antritt dieses Amtes brach der Burenkrieg aus, und nun bekam er Ordre nach Kapstadt. Seine gründliche Kenntnis der Nachbarländer des Transvaal machten ihn in der Zentrale unentbehrlich. Man muß diese Stationen eines Menschenlebens auf der Karte verfolgen, um die Stellung zu erfassen, die Roger Casement damals schon im britischen Weltreich einnahm. Er war nicht einer der Konsuln, sondern „der“ Afrikaner, der bestgerüstete an Wissen, Menschenkenntnis, Eingeborenensprachen unter allen Dienern der englischen Krone. Er schien ein Mann aus Eisen, immun gegen alles, was andere Europäer in Afrika zermürbt und rasch verbraucht, es gab keine Anstrengung, die man ihm nicht zumuten konnte. Er war der Mann, der absolut richtig sah und richtige Schlüsse zog. Auf der Grundlage seiner Berichte konnte man Kolonien gründen und internationale Verträge schließen, die auf unabsehbare Zeit Geltung haben würden.
ioo
Ob Casements Gerechtigkeitsfanatismus während des Buren krieges erwachte, in dem sich England ein freies und tüchtiges Volk ohne jeden moralischen Anlaß unterwarf, ist aus den Publikationen seiner Briefe und Tagebücher nicht bekannt. Es ist freilich bisher nur ein sehr geringer Teil dieser Schätze ver öffentlicht worden, vieles Unersetzbare ist in den Wirren sei nes Lebens verlorengegangen. Aber es ist wahrscheinlich, daß der eigentliche, historische Casement damals noch gar nicht entstanden war, auch das Schicksal des eigenen irischen Volkes scheint ihm erst später bewußt geworden zu sein, und so trat er wohl allen Handlungen der britischen Regierung kritiklos gegenüber als ein guter britischer Beamter und Untertan. Die Erweckung im Leben dieses Märtyrers sollte erst später kom men. Jedenfalls brachte der Burenkrieg ihm zwei Jahre relativer Ruhe, zwei Jahre in dem guten Klima von Südafrika, unter den Lebensverhältnissen einer zivilisierten Welt. . Als die kleinen Burenarmeen nach beispiellosem Widerstand zusammenbrachen und der Friede diktiert wurde, konnte Case ment wieder für seinen eigentlichen Spezialdienst verwendet werden. Diesmal hieß die Garnison des Konsuls Kinchassa am Kongo, ein paar hundert Meilen stromaufwärts von der Mün dung des Stromes. Fünfzehn Jahre war es her, seit Casement gerade hier, gerade in diese Welt, mit der Sanford-Expedition als Forscher eingedrungen war, in der man jetzt schon Städte gebaut hatte und Konsuln brauchte. Damals betrat er als ein nach Wundern, hungernder Knabe jungfräuliches Land, jetzt kehrte er als berühmter Veteran aus heroischer Stanley-Epoche, aber mit kritisch-strengen Augen, in eine entzauberte Welt zu rück.
Sechstes Kapitel Roger Casement war nicht nur nach Kinchassa am Kongostrom entsandt worden, um als Konsul in dieser von hundert oder hundertfünfzig Europäern bewohnten, brandneuen Stadt die
IOI
Handelsinteressen Englands oder die Rechte einzelner Englän der zu vertreten. Das war die offizielle Maske, unter der er kam, sein Auftrag war so verantwortungsvoll, so gewichtig und peinlich, daß nur der beste Mann, nur er ihm gewachsen war. Seit Leopold II. mit vielen Versprechungen, den Mund übervoll von idealen Zielen und Menschheitsbeglückung, von den Mächten Europas die Vollmachten eines absoluten Monar chen über den Kongo erlangt hatte, waren Jahre vergangen. Zum Kampf gegen die Sklavenräuber hatte der ehrwürdige König Weißbart gleich im ersten Jahr seiner Herrschaft mehr als zehntausend Mann weißer Truppen in das Land geworfen und ein Vielfaches davon an schwarzen Rekruten ausheben lassen. Diese Armee wuchs seither von Jahr zu Jahr, das Rie senland war ganz von Militär überzogen, seine endlosen Gren zen waren mit starken Posten besetzt. Nun mußten ungeheure Summen an Steuern und durch Fiskalarbeit aus den Eingebo renen herausgeholt werden, um die bewaffnete Macht zu unter halten. Schon seit Jahren liefen Klagen in London ein, Missionare und englische Geschäftsreisende hatten zuerst die Stimme er hoben, die Zeitungen gaben ihre Proteste wieder, schon war es zu dringenden Anfragen im Unterhaus gekommen. Fünfzehn englische Handelskammern hatten sich mit schweren Anklagen ans Ministerium des Auswärtigen gewandt. Diese Anklagen lauteten vor allem: „Die garantierte Gleichberechtigung der Angehörigen aller Nationen, im Kongo Handel zu treiben, würde absolut nicht gewahrt.“ „Leopold II. mache aus dem .freien Staat* sein privates Han delsmonopol, aus dem er ungeheure Reichtümer ziehe.“ „Die Bevölkerung wäre rechtlos und würde ausgesaugt, ihre Zahl ginge in Riesenziffern zurück." Es wurde zu jener Zeit aus allen Kolonien und in allen europäischen Ländern so viel von Skandalen, Tropenkoller und Mißbrauch der schwarzen Arbeitskraft kolportiert, daß man anfangs dazu neigte, alle diese Beschwerden für typischen „Buschtratsch“ zu halten. Allmählich aber hatten sich die Vorwürfe derart gehäuft, daß
102
der Minister des Auswärtigen, Lord Lansdowne, im Jahre 1902 eine Note an die belgische Regierung richtete. Sie betonte die Verpflichtung Belgiens, Zivilisation und Menschlichkeit im Kongo zu verbreiten, und besagte, man habe soviel von Grau samkeit und Unterdrückung gehört, daß in England allgemeine Empörung gegen Leopold II. herrsche. Die belgische Regierung antwortete einige Wochen später mit einem höhnischen Memorandum: Lord Lansdownes Note enthielte nichts als vage Verdächti gungen. Auf solches Material hin könne kein Gericht der Welt - weit davon, ein Urteil zu fällen - anders reagieren als durch glatte Zurückweisung. Englands Kolonialwirtschaft sei mehr als die irgendeiner anderen Nation Gegenstand von Angriffen und Anklagen der bedenklichsten Art gewesen, bis in die neueste Zeit hinein. England habe sich blutige Kriege gegen die Eingeborenen, Unterdrückung und Freiheitsberaubung vorhalten lassen müs sen. Vor ganz kurzer Zeit erst sei es in der verkommenen Kolonie Nigerien nach englischen Zeitungsberichten zu militä rischen Maßnahmen gegen die Eingeborenen gekommen, bei denen siebenhundert Neger ihr Leben verloren hätten, darunter alle Häuptlinge und der Sultan. Man erinnere auch an den Aufstand im Somaliland, der blutig unterdrückt worden sei, ohne daß das Parlament Notiz davon genommen habe, es sei denn, um die Kosten dieses Zwischenfalles zu kritisieren. Es sei merkwürdig. So viele Vorwürfe hätten England gleich gültig gelassen, aber wenn vom Kongostaat die Rede sei, rege sich das Gewissen der Nation. Die höhnisch-kalte Note sdiloß: „Jedenfalls ist anzunehmen, daß die Eingeborenen des Kongostaates die Regierung durch unsere kleine und friedfer tige Nation jeder anderen vorziehen. Die Ziele des Kongo staates sind so friedlich wie seine Entstehung. Unsere Regie rung ist gegründet auf Verträgen, die wir mit den Eingeborenen selbst geschlossen haben.“ Dies Memorandum hatte Lord Lansdowne sich nicht hinter den Spiegel gesteckt! Er wollte auf den Gegenstand zurüdc-
IOJ
kommen, wenn Roger Casement seine Erhebungen gemacht und darüber Bericht erstattet hatte. Nach mehr als zehn Jahren Wanderns durch Afrika betrat Roger Casement zum erstenmal wieder den Boden des Kongo. Hier war die Stätte, auf der er als junger Mensch die tiefsten Eindrücke seines Lebens empfangen hatte, deren Menschen, deren Wälder, Ströme und Steppen er liebte. Er ging in Borna an Bord eines glänzenden, modernen Dampfers, der mit allen Bequemlichkeiten für Passagiere ausgestattet war; diese uni formierten, smarten Offiziere, diese vorzüglich gedrillten Mannschaften erinnerten in nichts an die Flußschiffahrt zur Zeit der Sanford-Expedition. Längs des Stromes lief eine Eisenbahn, vorzügliches Material, fahrplanmäßig wie in Europa. In geradezu amerikanischem Tempo war der Kongo indu strialisiert worden! Eine stattliche Menge europäischer Waren wurde ins Innere befördert, mächtig war der Export von Holz und Kautschuk. Die Handelshäuser, einst wacklige Hütten, waren nun schmucke Gebäude, jede Station längs des Kongo zeugte von Reichtum, dem Sinn für Wohlleben und Reinlich keit. Auf dem Kongo liefen in regelmäßigem Verkehr fünfzig Dampfschiffe, die der Regierung gehörten. Diese MonopolSchiffsgesellschaft buchte in offiziellen Ausweisen bei einer Million jährlicher Unkosten einen Reingewinn von zwei Millio nen Goldfrancs. Wohl besaßen eine Reihe konzessionierter Handelsgesellschaften eigene kleine Dampferflotten, aber diese Schiffe durften nur im Konzessionsgebiet selbst verkehren. Mußte die Gesellschaft ihre eigenen Dampfer mit eigener Fracht und eigenen Passagieren zu einer weiteren Reise, etwa zur Küste, benutzen, dann zahlte sie der Regierung dieselben Fracht- und Passagesätze, als wenn sie einen der Regierungs dampfer benutzt hätte. So war es um die „absolute Gleich berechtigung aller Handeltreibenden“ im Kongo beschaffen. Es war bald nach der großen Regenzeit, als Casement sich eingeschifft hatte, noch wehte frische Luft des tropischen Früh lings über den Steppen, der Urwald glänzte von jungem Grün. In den stillen Nächten, unter schimmernden Sternen, stand 104
Roger Casement an der Reling des Dampfbootes und horchte hinaus in seine Wildnis, in seinen Urwald, wo ihm jeder Tierlaut und jeder Vogelruf eine Erinnerung brachte. Wenn er als junger Mensch auf dem knatternden, fauchenden „Kaffeekessel" hier hinaufgefahren war, jungfräulichem Land entgegen, war es in solchen Nächten oft passiert, daß man aus dem dichten Busch heraus menschliches Klagen gehört hatte, halb Weinen, halb Singen, vielstimmig, herzzerreißend, das sich langsam entfernte, leiser und leiser wurde, bis es ganz in der Nacht versank. Es hatte geklungen, als bejammerten Menschen oder Geister, die in diesem Busch zu Hause waren, das Kom men der europäischen Maschine, als wüßten sie, daß auf den Planken dieser polternden Schiffe Europa mit seiner Gier und seiner Brutalität bei ihnen eindrang, um den Garten, der ihre Heimat war, ihre Jagdgründe, das Glück ihrer Dörfer zu vernichten. Davon war nichts mehr zu hören, aber auch im hellsten Schein der Sonne entdeckte der Reisende, wenn er mit seinem Feldstecher die Ufer absuchte, fast nichts mehr vom Leben der Schwarzen. In Leopoldville erreichte er eine Landschaft, die er aufs genaueste kannte. Ihre Bevölkerung hatte man damals auf fünfzigtausend Menschen geschätzt, die in einer Art dörf licher Anarchie lebten. Von Staat, Nationalität, Grenzen hatten die Neger hier keinen Begriff gehabt, sie bildeten, meist unter selbstgewählten Häuptlingen oder Dorfschulzen, kleine Ge meinden, bauten gemeinsam ihr Getreide und ihre Bananen, besaßen gemeinsame Viehherden, jagten gemeinsam, mit primi tiven Waffen, Nilpferde und Elefanten. Sie waren so glücklich und gastlich gewesen, wie alle Bantu-Neger auf freier Scholle es sind, feierten häufig und mit Leidenschaft Feste, ihr Singen und Lärmen, das Gestampfe ihrer Tänze, hallte oft meilen fern durch die Steppe. Von diesen Dörfern war keine Spur ge blieben ... Statt dessen war Leopoldville erstanden, nach dem ehr würdigen Monarchen im weißen Bart genannt, Hauptsitz der Regierung, Garnison, Flußhafen. Hier fand Casement stattliche Regierungsgebäude, fast ein Hundert schmucker EuropäerBungalows in blühenden Gärten, Geschäfte, Lagerhäuser, ein
105
vorzüglich eingerichtetes Hospital für Europäer, dessen Chefarzt ein Tropenspezialist mit berühmtem Namen war. Aber auf den Straßen dieser Stadt sah er von Eingeborenen nur uniformierte Soldaten, uniformierte Amtsdiener, uniformierte Diener. Außerhalb des Europäer-Viertels war ein „Eingeborenen dorf“ angelegt worden, lange Reihen ganz gleichartiger, elender Lehmhütten, mit geringen Abständen, militärisch ausgerichtet, armselig. Hier wohnten etwa dreitausend Menschen, FiskalArbeiter mit ihren Familien, dem Wald und der Steppe ent fremdet, ohne Felder, ohne Gärten. Casement hielt sich nicht lange bei den Würdeträgern des Staates und den emsig buchenden, addierenden Geschäftsher ren auf. Sein Interesse galt den Eingeborenen, er wanderte durch die Reihen der Proletarierhütten. Von dem heimischen Stamme der Ngaliema, an den er sich so wohl erinnerte, unter dem er gute Freunde gezählt hatte, fand er nur'wenige. Diese dreitausend gehörten den verschiedensten Stämmen an, ein heitlich war nur der sture, scheue Blick, der elende Zustand ihrer Körper, die Armseligkeit ihrer an Zahl geringen Brut. Vor der Hütte eines Ngaliema blieb er stehen, Weib und Kin der verkrochen sich, der klapperdürre Familienvater fragte zit ternd nach seinen Befehlen. „Ich bin vor vielen Jahren ein Gast deines Stammes ge wesen", sagte Casement. „Idi habe viele Freunde unter den Deinen, und vielleicht hast du von mir gehört? Ich bin der erste weiße Mann gewesen, der in eure Hütten eingekehrt ist.“ Der Mann war stumpf und dumpf, er konnte sich jener Zeit kaum erinnern. „Wo, wo sind sie alle hin, deine Verwandten und Stammesgenossen, die meine Freunde waren? Der Platz ist leer, wo eure Dörfer standen, wo euer Vieh weidete. Wo sind eure Jäger und Krieger?" Der Ngaliema wies mit trübem Gesicht nach Norden, über den Strom. Dort lief nahe dem Flußufer die Grenze hin, die das Kongogebiet in zwei Kolonien teilte, das belgische und das französische Protektorat. „Wohin?“ „Zu den Francesi. Fort von den Belgiern, alle, alle. Alle
106
fort, die laufen konnten. Nur ein paar Alte und Kranke sind damals geblieben." „Und wann geschah das?" „Zwölf Sommer her, zehn Sommer her, ich weiß es nicht.“ Es klang wie ein Märchen, unfaßbar, daß ein ganzes Volk, das an seiner Heimat und seinem kleinen Wohlstand hing, auf einmal in die Fremde gegangen war, einem unbekannten Schick sal entgegen. Der Konsul ging von Hütte zu Hütte und fragte. Er kehrte in die Europäerstadt zurück und fragte sich von Pontius bis zu Pilatus durch - das Unfaßbare bekam immer festere Gestalt. So war es gewesen! In einer einzigen Nacht hatte dieser weite, fruchtbare, vom Kongo bespülte Landstrich sich entvölkert, Männer, Frauen, Kinder, an fünfzigtausend Menschen, waren den belgischen Vögten entflohen.
Siebentes Kapitel Viele Tage verbrachte Casement noch in dem barackenähnlichen Eingeborenenquartier von Leopoldvilk und machte Feststellun gen. Die Männer waren als Arbeiter für die Verwaltung tätig. Man hatte sie aus fernen Dörfern von Soldaten herbeisdileppen lassen, sie waren nicht wie Sklaven gehalten, sondern wie Sträflinge. Ihr einziger Lohn für harte Arbeit war Wohnung und Nahrung, aber diese Nahrung war so beschaffen, daß ihr ganzes Leben langsames Verhungern bedeutete. Der Leopoldville in weitem Ring umgebenden Landschaft, deren Einwoh ner noch nicht geflüchtet waren, hatte die Regierung auferlegt, täglich eine Ration von Cassavawurzeln aufzubringen, die zur Ernährung der dreitausend Stadt-Heloten ausreichte. Diese Wurzel, eine Art süßer Kartoffel, wurde abwechselnd gekocht, geröstet oder zerrieben und als Brei zubereitet, irgendein an deres Nahrungsmittel schien den Belgiern für ihre Staatssklaven entbehrlich. Aber selbst an dieser armseligen Nahrung herrschte täglich steigender Mangel. Wohl zog eine Trägerschar unter der Führung von schwarzen Soldaten täglich in die fernen Dör fer hinaus und requirierte, was an der Kartoffelfrucht irgendwie vorrätig war, die Soldaten arbeiteten mit Revolver und Peitsche i°7
und fragten nicht, ob den Bauern das Nötigste zum eigenen Lebensunterhalt blieb. Aber diese Unglücklichen hatten längst gelernt, die einzige Waffe anzuwenden, die auch der Schwächste gegen den Starken besitzt, sie starben ... Die Schlafkrankheit, früher auf kleine Herde in dem riesigen Reich beschränkt, hatte um sich gegriffen, seit man die Ein geborenen willkürlich von Distrikt zu Distrikt verschleppte, Eisenbahnen und Straßen baute. Sie dezimierte die Dorfbewoh nerschaften; schlecht genährt und hoffnungslos, leisteten die entkräfteten Menschen ihr keinen Widerstand. Wo eine Hoff nung winkte zu entkommen, flohen die Gesünderen und Star ken, Gott weiß, wohin, in den französischen Kongo oder in ferne Einöden, die der belgische Askari noch nicht besetzt hatte. Die Weißen lebten von dem Ertrag eigener Gärten, die sie von ihren Dienern pflegen ließen, aus kleinen Farmen, in denen sie Vieh und Hühner hielten, von Konserven, die der Dampfer ihnen aus Europa brachte. Aber für diese dreitausend schwar zen Menschen, den Überrest von mehr als fünfzigtausend, die hier noch vor wenig Jahren reichlich zu essen hatten, brachte die ganze Provinz das Minimum an Nahrung nicht mehr auf. Über ihr Los schien niemand sich Gedanken zu machen, kein Beamter fürchtete, verfolgt und bestraft zu werden, wenn in seinem Distrikt die Neger zu Tausenden darbten und Hungers starben. Als Roger Casement so viel Hunger und Verzweiflung ge sehen hatte, erfuhr er, daß es immerhin ein EingeborenenHospital in Leopoldville gab. Vielleicht war dort zu spüren, daß der eingeborene Arbeiter in seinem Elend doch nicht ganz verlassen, regte sich dort ein Keim von Menschlichkeit? „Als ich die drei schmutzigen Hütten besuchte, die als Hospi tal dienen, waren sie alle dem Einsturz nahe, von zweien war das Dach fast ganz zerstört. Siebzehn Schlafkranke, Männer und Frauen, lagen im Dreck herum, die meisten auf der nack ten Erde - manche auf dem Fußweg vor den Häusern... Eine Frau war, gerade vor meinem Kommen, im letzten Sta dium der Krankheit in ein offenes Feuer gefallen und hatte sich schwer verbrannt. Sie war zwar verbunden, aber noch immer lag sie auf dem nackten Boden, den Kopf ganz nahe
108
dem Feuer. Ich versuchte sie anzusprechen, sie wandte sich zu mir, und bei dieser Bewegung stieß sie an einen Topf mit kochendem Wasser, das ihr über die Schulter floß. Diese sieb zehn Patienten waren alle dem Ende nahe; bei meinem zweiten Besuch, zwei Tage später, fand ich einen von ihnen tot vor der Tür liegen.“
Vier Wochen lang war es den belgischen Behörden nicht möglich, dem Konsul des britischen Reiches, dem Belgien seine staatliche Existenz und die Kongo-Kolonie verdankte, eine Kabine mit dem nötigen Komfort auf einem stromaufwärts fahrenden Dampfer anzuweisen. Während dieser vier Wochen konnte eine bedeutsame Mitteilung an alle kleinen und klein sten Verwaltungsstellen ergehen: „Ein gefährlicher Besucher kommt! Sorgt dafür, daß er nichts zu sehen bekommt!" Auch heute noch ist man in Belgisch-Kongo nicht erfreut, wenn kritische Besucher sich melden. Das Zureise-Visum dieser Kolonie ist nur direkt vom Kolonialministerium in Brüssel zu erlangen und wird beispielsweise Journalisten sehr ungern er teilt, jedenfalls nur nach langen Erhebungen. Die Tore aller englischen Kolonien stehen im Vergleich dazu weit offen, wie auch einst die der deutschen Kolonien. 1929 sagte man mir auf dem belgischen Konsulat in Kairo mit herzlicher Offenheit: „Wir hatten schon zu viel Berichterstatter im Kongo, die uns nur Ärger gemacht haben." Gerade damals hatte Belgien alle Welt zu seiner KolonialAusstellung in Brüssel geladen. „Aber ihr macht doch diese Ausstellung, um eure Kolonial leistungen zu demonstrieren?“ fragte ich. „Ja", war die Antwort, „in Brüssel.“ Ob man noch an Casement denkt, wenn von Berichterstattern die Rede ist, „die nur Ärger verursacht haben"? Meine Recher chen, die ich später an der Kongogrenze anstellte, haben nichts ergeben, was die belgische Verwaltung belastet hätte. Nach der Ansicht englischer Geschäftsleute, die von dort kamen, sind die Belgier von heute eher zu intim, frère, sœur et cochon mit ihren schwarzen Untertanen, als grausam. So kann es wohl sein, daß den Kolonialbeamten Belgiens noch 1929 der Schreck in 109
den Gliedern steckt, den Roger Casement ihnen 1903 eingejagt hat... Endlich aber war kein Hindernis mehr zu finden oder zu er finden, um Casements Reise ins Innere aufzuhalten. Das Ver derben nahm seinen Lauf, es sollte Millionen von Negern Ret tung und Segen bringen. Hundertsechzig Meilen stromaufwärts nahm Casement seinen ersten Aufenthalt und betrat abermals eine Landschaft, deren Bild aus früheren Jahren tief in sein Gedächtnis fixiert war. Eine Kette von Dörfern, etwa fünftausend Menschenseelen, Friede, Wohlstand, Glück - so war dies Bild. Busch und Lianen wucherten, wo vor sechzehn Jahren Dör fer gewesen. Ein paar hundert Stadt-Skelette hausten in Ruinen, von schwarzen Soldaten bewacht. Sie waren angesiedelt, um längs des Telegraphenstranges, der sich am Flußufer hinzog, einen Pfad frei zu halten. Seit einem Jahr hatten sie keinen Lohn bekommen. Die Frauen dieser Wegarbeiter hatten Befehl, eine Holzfällerkolonne im nahen Wald zu verpflegen; sie mußten Kwanga-Blätter sammeln, zubereiten, kochen und die Speise den Holzfällern zutragen. Diese Arbeit wurde bezahlt; zwei hundertundfünfzig Menschen hatten zusammen als Lohn für einen Monat härtester Arbeit Messingdraht im Wert von neun zehn Franken bekommen. Roger Casement begann Erhebungen zu machen, und schnell, wie nur das Gerücht läuft, wurde weithin bekannt, es sei ein Weißer gekommen, der sein Ohr für die Klagen der Armen geöffnet habe, der ihre Sprache verstand und milden Herzens sei. Sie kamen herbeigelaufen und gekrochen, Schatten von Menschen, und sahen in die schönen, traurigen Augen eines großen, bärtigen Mannes, dessen Gesicht weißer als Elfenbein war. „Wir können unsere eigenen Äcker nicht bestellen, großer Herr! Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sammeln wir Wurzeln und Blätter, bereiten sie zu, kochen, schleppen sie einen Tag weit zu den Holzfällern. Wir verhungern selbst, hoher Herr, wenn wir die richtige Menge abliefern wollen.“ „Und wenn ihr zuwenig liefert?" „Dann gibt es die Peitsche, Herr, sehr, sehr viel Peitsche!“
HO
Sie wiesen ihre nackten Rücken, da war kein Gesäß und keine Schulter ohne tiefe Narben von Peitschenhieben. Auch hier war es der Behörde entgangen, daß die Bevölke rung hinschmolz. Sie verlangte dasselbe Quantum Arbeitslei stung von den Hunderten, das sie vor Jahren den Tausenden auferlegt hatte. „Wir können nichts tun als sterben, hoher Herrl“ Jeder Baum, der im Urwald gefällt wurde, kostete das Leben eines dieser Menschen, so etwa mußte die Rechnung sein. Sklavenjagd und Sklavenhandel gab es nicht mehr im Kongo, statt dessen herrschte Raubbau am Menschen. Wie man Wäl der niederschlug, ohne für die Zukunft neu aufzuforsten, so fraß der Staat sein wichtigstes, lebendiges Kapital, die Ein geborenen, auf, ein Moloch, wie die Geschichte ihn bisher kaum gekannt. Sklave, Eigentum eines anderen Menschen zu sein schien unvorstellbares Glück neben diesem Zustand. Ein Skla venhalter achtet in seinem Leibeigenen gewiß nicht den Men schen, aber doch den Besitz, die Summe von Geld oder Vieh, die er in ihm investiert hat. Welcher Bauer quält seine Kuh tot, reitet ohne dringende Not sein Pferd zuschanden, läßt seinen Ochsen, der Arbeit leisten soll, hungern? Keiner tut das, jeder Mensch liebt seinen Besitz. Hier aber herrschte mit allen Machtvollkommenheiten des absoluten Staates blindwütig ein privater Kapitalismus, der über die eigene Nase nicht hinaus sah. Dividenden! Dividenden! Wichtig war der Abschluß die ses Jahres. Wer in zehn Jahren Holz fällen, die Holzfäller nähren würde, danach fragten Leopolds Fronvögte nicht und noch weniger die mit hohen Steuern belasteten Gesellschaften, die Leopold duldete. Sie wußten nur, daß der Arbeiter nichts kostet, da galt er auch nichts und mochte eingehen. Die Neger hatten keine Heimat mehr, sie wurden durchs Land getrieben und zur Arbeit eingesetzt, wo man gerade Hände nötig hatte. Ein schwarzer Soldat trat aus dem Wald hervor in ihre Hütte und kommandierte: „Drei Männer, drei Weiber - du, du, ihr beide da - marsch!“ Er trug links den Karabiner und in der rechten Hand die Peitsche, da gab es kein Widersprechen, denn wer sich wehrte, bekam Hiebe, wer zu fliehen versuchte, die Kugel. So wurden in
die Kinder auf den Rücken gebunden, der Spaten in die Hand genommen, und nun ging es in die Fremde. Wohin? Auf lange? Für immer? Keiner wußte es, auch der; Soldat nicht, der, gut genährt und gut bezahlt, seinen Befehjausführte. Roger Casement weinte in seinen) Herzen, ihn brannte die Scham, ein weißer Mann zu sein. War er mitschuldig an dieser Schmach, war er nicht gerade der Schuldigen einer? Unbewaff net, ein Freund der schwarzen Menschen, war er als Jüngling hier eingedrungen, gerade hier an dieser Biegung des Kongo. Aber er hatte jenen anderen, den bewaffneten Friedenstörern, den Weg gezeigt! Er hatte die Expedition Sanford hierher geleitet, er war nach Amerika gefahren, um von aller Herrlich keit, allem Reichtum des Kongo zu berichten, und seine Be richte hatten beigetragen, die organisierten Räuberscharen hier herzulocken. Roger Casement, der nie ein Puritaner wie seine Vorfahren, aber immer ein sehr religiöser Mann, ein betender Mann war, der jeden seiner Schritte darauf prüfte, ob er vor Gott bestand, schwur einen heiligen Eid: jede Not, jede Unbill auf sich zu nehmen, um diesem Volk, das sonst der Vernichtung geweiht war, zu helfen - und bei diesem Hilfswerk keine Minute mehr zu verlieren! Jeder seiner Märsche mußte ein Eilmarsch wer den ! Jede Stunde der Ruhe mußte er für seine Berichte verwen den! Vor seinen Augen durfte nichts verborgen bleiben!
Achtes Kapitel Casement besuchte ein Eingeborenen-Gefängnis, in dem seit Jahren ein Neger englischer Nationalität saß. Der Mann war selbst Gefängnisaufseher gewesen und zusammen mit drei wei ßen Beamten zu langer Freiheitsstrafe verurteilt worden, als eine Kontrolle die furchtbaren Zustände in ihrem Gefängnis aufdeckte. Die Weißen waren nach Europa geschafft worden, der schwarze Mann saß im Neger-Zuchthaus und hatte einen Notruf an seinen Konsul entsandt. „Du bist verurteilt worden“, sagte Roger Casement zu dem vernichteten und verzweifelten Mann, „weil du unrechtmäßig 112
Weiber in Haft genommen hast. Sie sind unter deiner Obhut verhungert. Kannst du das leugnen?" „Ich habe sie auf Befehl meiner Herren in Haft genommen.“ „Und du hast sie verhungern lassen? Wie viele sind in deiner Obhut gestorben?“ „Mehr als hundert Weiber und Kinder sind unter meiner Obhut gestorben. Aber ich hatte kein Recht, sie vorher in Frei heit zu setzen. Und ich bekam keine Nahrung für sie, sosehr ich mich mühte und für sie bettelte.“ Casement prüfte die Akten, der Mann sprach die Wahrheit I Der höchste Gerichtshof des Landes hatte festgestellt, daß die höheren Beamten einer konzessionierten Gesellschaft die Schuld an jener Tragödie trugen, nicht die unteren. Es war das System, das Geiselsystem. Wenn die Massenpanik in einem der „Kolo nisation“ zu erschließenden Gebiet ausbrach, flohen zuerst die kräftigen Männer, um der Zwangsarbeit zu entgehen. Rasch griff man nach ihren Weibern und Kindern, sperrte sie als Geiseln ins Gefängnis und ließ sie darben. Die Wilden, die in den Urwald geflüchtet waren, konnte man nicht greifen, aber das Hungergeschrei ihrer Familien drang bis zu ihnen, und sie ertrugen es nicht. Mann um Mann kamen sie zurück, stellten sich der Gewalt, ertrugen ihre Strafen und nahmen die Zwangs arbeit auf sich, um die Geiseln zu befreien, die ihnen teurer waren als die Freiheit. Manchmal freilich kam es vor, daß sie den grauenhaften Entschluß zu spät gefaßt hatten... Gab es dann Ausbrüche der Verzweiflung, die nicht zu überhören waren, dann bekamen die kleinen Werkzeuge der großen Menschen-Verschrottungs-Maschine ihren Denkzettel... Es ging immer um Gummi, alle Qual, alle Tränen, alles Sterben war bedingt durch das unersättliche Begehren der Märkte nach Gummi. Der wuchs überall, in dichten Wäldern von Ficus Elastica, blühenden, grünen Gummibergwerken im Strahl der Sonne, vom Nachtwind durchweht, vom Regen be gnadet. Vögel sangen durch diese Bergwerke, scheue Tiere hatten dort ihren Wechsel, diese Gummiwälder waren von Gott nicht geschaffen, Gärten der Qualen zu sein. Die Neger hatten in diesen Wäldern bisher nichts gesehen als ihre Jagd gründe, schattige Ruheplätze. Der zähe, milchige Saft, der in 8
Paradiese
113
den Stämmen dieser Bäume trieb, war für sie ganz ohne Be deutung gewesen. Für die europäischen Zivilisatoren war er nidit nur das Blut der Wälder, sondern das Blut des Landes, sein Reichtum der Zweck ihres Kommens. Wenn man ein scharfes Messer, besser eine Hacke, nimmt und die Rinde des Ficus Elastica anschlägt, vergießt sie den Gummisaft, genau wie eine angeschlagene Birke ihre Milch gibt. Er rinnt in langen, zähen Fäden hervor, bis die Wunde sich ausgeblutet hat, man fängt ihn in einem aus den eigenen Blät tern dieses verwundeten Baumes gefertigten Korb auf. Man reinigt die Masse dann in fließendem Wasser, rollt sie um eine Stange zu langen Walzen, und jede solche Walze ist nun eine fertige, in der Industrie heißgefragte Ware. Die Gummiwälder kosteten nichts, die Arbeiter kosteten nichts, nur die staatliche Erlaubnis, Wälder und Menschen auszuschlachten, kostete Geld. So ergab sich das System des Raubbaus an beiden ganz von selbst. Jedem beschlagnahmten Neger - Mann, Weib, Kind - wurde anbefohlen, ein bestimmtes Quantum Gummi täglich zu liefern. Je nachdem bekam er ein Stück Messingdraht als Lohn, wenn er genügend schaffte, und Prügel, wenn er versagte, oder es gab auf keinen Fall Lohn, und die Alternative lautete nur: keine Prügel oder Prügel. Aus den jungen Soldaten, Bambote genannt, war mit der Zeit eine Meute von Bluthunden erzogen worden, auf die Ver laß war. Sie wurden nicht in ihrer Heimat zum Dienst ver wandt, sondern in fernen Provinzen des Reiches, deren Sprache sie kaum verstanden, mit deren Menschen sie nichts verband. Sie wußten nichts, als daß sie hochgestellte, gutgenährte Knechte der Weißen waren, auserwählt aus der Masse des Volkes. Diese Masse aber war schlechter als Holz, seelenlos, rechtlos. Der Bambote wurde selbst bestraft, an seinem Beutel oder mit der Peitsche, wenn er nicht so viel Gummi zur Stelle schaffte, wie sein Distrikt zu liefern hatte. Natürlich drosch er selbst die arme schwarze Haut der Unterworfenen, statt die seine dreschen zu lassen. So war das Bild, das Casement im Zentrum der kolonisa torischen Kultur fand, in einem Gebiet, das der Kontrolle am
IM
bequemsten zugänglich war, täglich von Eisenbahnen und Dampfschiffen durchzogen, dem Auge des flüchtigsten Reisen den offen. Ihn schauderte vor dem, was auf den fernen Außen posten seiner wartete, in den Stationen, die nur in mühseligen Fußmärschen zu erreichen waren, aber er war entschlossen, sich dem Grauenhaften zu stellen. Das war seine Aufgabe als Ab gesandter der englischen Regierung, das war sein heiliges Amt als Mensch, der vor der ganzen Menschheit Verantwortung trug. Es war nicht unmöglich, daß ein alltägliches Afrikanerschick sal ihn erwartete, wenn er vom breiten Weg abwich, um auf den Spuren des Bösen in seine dunklen Verstecke einzudringen. Auch einem so bewährten Pfadfinder wie ihm, der in allen tropischen Breiten dem Fieber, den Leoparden und Schlangen, den Giften und Giftpfeilen aufgescheuchter Wilder entgangen war, konnte einmal etwas Menschlich-Afrikanisches begegnen, und wenn er irgendwo am Urwaldrand unter dem Boden der Steppe lag, würde keine Behörde, auch nicht die eifrigste Kriminalkommission, nachweisen können, daß sein Ende viel leicht nicht allein von den Tücken der Natur bedingt gewesen. Das britische Weltreich stand hinter ihm mit riesiger Macht, aber wenn er jetzt mit seinem Hund in die Wildnis marschierte, dann galt diese Macht fast nichts mehr. Er zauderte keinen Augenblick, er sah dieser Gefahr ins Ge sicht und vergaß sie. An die eigene Sicherheit zu denken wäre ihm in dieser Mission niedrig erschienen. E. D. Morel, ein anderer großer Afrikaner und Publizist, der ihn zu jener Zeit kannte, schrieb von ihm : „Ein Mann, den seine Freunde fast anbeteten, eine Persön lichkeit, die Respekt und Bewunderung erzwang, ganz ehren haft, ganz furchtlos; er war voll von Afrika, von Afrikas Herr lichkeit, seiner Weite, der Unberührtheit seiner Wälder, der naturhaften Güte und Gastlichkeit seiner Menschen.“
Vor vier Jahren waren aus einer „Domaine de la Couronne“, einer Domäne des Königs bei Bolobo, die Eingeborenen ent flohen, in rasenden Märschen hundertfünfzig Meilen weit ins Innere, um sich freiwillig in die Sklaverei eines befreundeten
s*
ui
Stammes zu begeben. Sie waren nicht verfolgt worden und würden jetzt vielleicht den Mut gefunden haben, frei zu er zählen, was sie in die Fremde getrieben hatte. Von einigen Führern und Trägern geleitet, brach Roger Casement auf. Nach langen Märschen stieß er auf eine Lichtung im tropi schen Wald, ein Dorf von hundertfünfzig Hütten, von lauter emsigen Handwerkern bewohnt. Hier wurden Matten gefloch ten, Palmenfaserstoffe gewirkt, hier waren Schmiede und Töp fer an der Arbeit, das ganze Dorf war ein kleines, tropisches Industriezentrum. Der unbewaffnete, bärtige Weiße ohne Soldaten, ohne Uni formknöpfe, erschreckte die fleißigen Leute nicht. Er sprach sie in ihrer Sprache an, er trug ein Buch in der Hand und schrieb viele Zeichen hinein, von seiner Erscheinung gingen Kraft und Güte aus. So wie er war nie ein weißer Mann unter ihnen er schienen, wie er hatte keiner zu ihnen gesprochen. Casement trat in die Werkstatt eines Schmiedes ein, fünf Männer waren bei der Arbeit. Sie schauten auf, sie hörten seine Fragen: „Warum habt ihr euer Dorf verlassen? Euer Vieh und eure Felder? Warum seid ihr Arbeitssklaven eines anderen Stammes geworden?“ Bald hockten außer den Schmieden noch sechs erwachsene Männer, zehn Weiber, viel junges Volk um ihn auf dem glatt gestampften Erdboden. Jeder nannte willig seinen Namen, sie starrten ihn mit offenen Augen und Mündern an, ihre weißen Zähne blitzten im Halbdunkel. Ein Mann hub an zu sprechen, die anderen fielen ein, sie erzählten im Chor. Das war ein Kapitel aus Dantes „Inferno“ im afrikanischen Busch: ein Chorus erlöster Seelen schildert das Fegefeuer, durch das sie alle gegangen. „Jedes Dorf in unserem Land sollte viermal im Monat zwan zig Traglasten Gummi einbringen.“ „Was bekamt ihr dafür?“ „Wir bekamen gar nichts.“ Damit begann, ganz ohne Pathos, ein herzzerreißendes Klagelied, wie es zu jener Zeit in abertausend Strophen durch alle Breiten, alle Verstecke des Kongo hallte. Die Entronne nen steigerten sich beim Erzählen zur Ekstase, erlebten das
116
Unsagbare noch einmal, sie ahmten das Schwirren der Peitsche und das Knallen der Kugeln nach, und mit verzerrten Ge sichtern gellten sie die Kommandos nach, mit denen man sie zur Folter, Ungezählte ihrer Gefährten zum Tode verurteilt hatte. Viele waren- diesen aufschäumenden Erinnerungen, diesem Noch-Einmal-Erleben vervielfachten Todes nicht gewachsen. Sie fielen in Zuckungen, wälzten sich auf der Erde und schrien zu ihrem Gott, wie sie zu ihm geschrien hatten, als all das Gegenwart war.
Neuntes Kapitel Der Chorus dem Fegefeuer entronnener Seelen berichtete: „Unser Dorf erhielt Baumwollstoff und ein wenig Salz, aber nicht die Leute bekamen es, die gearbeitet hatten. Unsere Häuptlinge bekamen den Lohn, einen Streifen Stoff und einen Löffel Salz für jeden großen Korb voll Gummi, die Arbeiter bekamen gar nichts davon. Zehn Tage .lang waren wir im Wald, um die zwanzig Körbe voll Gummi zu schaffen, und wenn es zu spät wurde, schossen sie uns tot." „Wir mußten weiter und weiter in den Wald gehen, um den Gummibaum zu finden, ohne Essen. Da hungerten wir, und wilde Tiere, vor allem Leoparden, fraßen viele von uns auf, wenn wir im Wald arbeiteten, viele starben vor Hunger, und wir bettelten den weißen Mann um Gnade. Aber der weiße Mann und seine Soldaten sagten: ,Ihr seid doch selbst nur Tiere, ihr seid nichts als ein paar Stücke Fleisch.1“ „Viele von uns wurden erschossen, manchen schnitten sie die Ohren ab; viele bekamen einen Strick um den Hals und wurden davongeschleppt. Manchmal wußten die weißen Män ner auf den Stationen nicht, wie schlecht die Soldaten zu uns waren, aber es waren doch immer die weißen Männer, die die Soldaten geschickt hatten, um uns zu strafen, weil wir nicht genug Gummi brachten.“ Sie nannten die Namen ihrer Peiniger und der weißen Offi ziere, die sie befehligt hatten, Cascment trug die Namen in 117
seine schwarze Liste ein. Jeder dieser Menschheitsverheerer war heute schon, da Casements Mission bekannt war, sein persön licher Feind, der nichts inniger wünschte als seinen Tod. Bis zur letzten Stunde würden sie alle, über die er ein Strafgericht heraufbeschwor, gegen die er die Empörung, den Ekel der Kulturwelt zu entfesseln hatte, seine persönlichen Feinde blei ben, das wußte er, während er ihre Namen schrieb. Und wirklich: dreizehn Jahre später, als Sir Roger Casement, zum Tode durch den Strang verurteilt, im englischen Zuchthaus saß, bekam er ein höhnisches Telegramm: „Wollen Sie nicht in letzter Stunde in sich gehen und die Verleumdungen zurücknehmen, die Sie gegen mich gerichtet haben?" Aber auf dem Schafott dachte dieser Ritter des Erbarmens am wenigsten daran, ein einziges Wort zu widerrufen, das er je als Waffe gegen menschliche Bestialität gebraucht hatte. Es hatte unter den Weißen natürlich auch Männer gegeben, die sich in Brüssel für die Neger einsetzen wollten und ihnen eine bessere Zukunft versprachen. Aber die ganz entfessel ten Teufel hatten den Bambote, den Soldaten, zugerufen: „Ihr könnt ja nur Weiber abknallenI Wagt ihr euch nicht an Män ner?“ Das war ein ungerechter Vorwurf, diese Soldaten konnten auch wehrlose, nackte Männer töten und hatten es längst ge konnt. Von nun an verstümmelten sie die Leichen der ermor deten Männer und legten ihren Kommandeuren eindeutige Be weise ihrer Tapferkeit vor. „Ein weißer Mann soll das befohlen haben?“ brüllte Case ment mit Entsetzen auf. „Nkotol Nkoto!“ heulten die Schmiede. „Viele weiße Män ner!“ und nannten die Namen. Es hatte belgische Offiziere gegeben, die an „faulen“ Gummi sammlern die Durchschlagkraft ihrer Gewehre,erprobten. Sie stellten ein halbes Dutzend Menschen hintereinander auf und töteten sie mit einem Schuß ... Während Casement sein Protokoll aufnahm, wuchs der Kreis um ihn, wurde die Stimmung aus Haß und Grauen immer ekstatischer. Bis zum Morgengrauen klang das Heulen der einn8
mal entfesselten Seelen, die in Casement einen Gott sahen und ihn anflehten, ihre Toten zu rächen, ihre Brüder zu retten. Dieses Heulen klang für alle Tage in seinen Ohren. Auf seinem Rückmarsch zum Kongostrom passierte der Konsul die Dörfer anderer Emigranten, die in die Wälder flüchteten mit dem Angstschrei: „Ein weißer Mann, ein weißer Mann!“ Sie waren noch zu verängstigt, noch zu nahe dem Schreckens regiment, um ihm Rede zu stehen. Er wollte sich nicht wieder einem belgischen Schiff anver trauen, ganz allein wie jetzt eben in der Urwaldlichtung wollte er seine weiteren Erkundungen machen. Ein günstiger Zufall gab es, daß er eine Dampfbarkasse zu chartern bekam. Er heuerte eine Mannschaft zusammen - fünf Francs den Monat war eine phantastisch hohe Löhnung. Aber der Häuptling, aus dessen Dorf er fünf Männer in Dienst nahm, geriet in Ver zweiflung, holte Soldaten herbei und arretierte die Männer. „Wie soll ich mein Gummi schaffen, wenn du mir diese fünf nimmst?“ schrie er. „Du verdammst mich zum Tode!“ Casement mußte ihm Geld geben, mit dem er andere fünf für diese Leute anwerben konnte. So aber sah die Befreiung von der Sklaverei aus, die der christliche König Leopold im Namen Europas dem Kongo gebracht hatte.
Immer tiefer ins Land ging Casements Fahrt, und vor ihm her lief die Kunde, daß er als Rettender und Heiland kam. Wo seine Barkasse anlegte, kamen die Verzweifelten herbei, um sein Ohr mit ihren Klagen zu füllen, in sein Herz allen Jammer zu schütten, mit dem Europa diese blühende Welt er füllt hatte. Auch Weiße, auch belgische Funktionäre, kamen oder schrie ben an ihn. Sie waren nicht alle Teufel. Aber hinter den weni gen, die Menschen geblieben waren, stand nicht, wie hinter Casement, das britische Weltreich, sie besaßen nicht das Echo Europas. Ein Offizier schrieb an ihn: „N. N. übernahm die Station X. und besichtigte das Ge
119
fängnis. Er wurde fast ohnmächtig, so gräßlich war der Zu stand, so grauenhaft waren die atmenden Gespenster von Ge fangenen.“ Dieser N. N. hatte wahrheitsgetreu an seine vorgesetzte Behörde berichtet. „Ich habe die Antwort seines Kommandeurs an N. N. selbst gelesen“, lief der Brief weiter. „Er schrieb, N. N. sollte weni ger reden und mehr handeln. Bei der letzten Unruhe habe er nur einen einzigen Mann umgelegt. Das sei keine Disziplin. N. N. wird in drei Monaten in Belgien eintreffen und am ersten Morgen nach seiner Landung Klage erheben.“ Ein anderer Weißer, ein Missionar, berichtete von einer Gummisammelstation, die ganz verödet war. „AZZe Eingeborenen waren getötet worden, verhungert oder entflohen.“ Elefanten und Leoparden nahmen überhand, seit die Jäger des Stammes keine Zeit mehr hatten, sie zu bekämpfen. Eine Schar von Flüchtlingen war dem Briefschreiber auf seiner Reise über Land begegnet, fast geistesgestört vor Angst. Die Leute waren aufs Haar dem Schicksal entgangen, unter den Hufen einer Elefantenherde zu enden. Der Missionar hatte sich an ihre Spitze gesetzt und ihnen Schutz versprochen. Aber im ersten Nachtlager durchraste ein Sturm den Forst, riesige Bäume waren niedergebrochen und hatten viele Flüchtlinge er schlagen. Der Flüchtlingszug hatte eine verödete staatliche Gummi station berührt. Im Gras lagen haufenweise menschliche Knochen, Schädel und ganze Gerippe. Ein Überlebender geisterte um diese Schä delstätte herum, er erzählte dem Missionar: „Als die Bambote kamen, um Gummi einzutreiben, wurden so viele von uns ge tötet, daß wir müde wurden, sie zu begraben. Manchmal woll ten wir sie.begraben, aber wir durften nicht.“ „Warum haben sie euch nur ermordet?" „Manchmal überraschte uns die Wache, wenn wir uns etwas zu essen kochten, statt Gummi zu zapfen, und schoß zwei oder drei von uns nieder. Manchmal erwischte sie uns, wenn wir ein wenig auf unserem Felde arbeiteten, dann schossen sie auch,
120
um uns zu lehren, daß wir zum Gummisammeln da waren und nicht zum Ackerbau. Manchmal mußten wir vierzehn Tage im Wald verbringen, ohne Nahrung zu bekommen. Wir konnten uns auch kein Feuer machen, und viele erfroren." „Was hat das nur für einen Sinn?" hatte der Briefschreiber gefragt. „Je weniger ihr werdet, um so weniger Gummi konntet ihr sammeln.“ „Ja, das verstehen wir auch nicht, Herr... Aber so ist es gewesen ..."
Casements Feder kam nicht zur Ruhe, wochen- und monate lang füllte er Protokoll um Protokoll, und immer schauerlicher wurde der Inhalt. Drinnen im Land hatten einzelne Stämme zu Pfeil und Speer gegriffen, um sich zu wehren, da ward „Krieg“ erklärt, und die Bambote mordeten um des Mordens willen. Viele von ihnen gehörten den wildesten Stämmen an, die selbst vor Leopolds glorreicher Herrschaft Menschen ge jagt und Menschenfleisch gefressen hatten - gerade sie waren nun zu Pionieren der Zivilisation bestellt und auf die sanften Bauernstämme losgelassen. Sie schonten Mädchen, deren Eltern sie ermordet hatten, und schleppten sie als ihre Sklavinnen im Trosse mit sich, um ihre Patronen für die Jagd zu sparen, hack ten sie Knaben und Männern die Hände ab und brachten diese Trophäen mit sich ins Lager. Roger Casement war in Afrika eingezogen, wie Joe Conrad ihn geschildert hat, ein strahlender Jüngling, sorglos, eine glückliche Seele. Zehn Jahre Afrika hatten von seinem Frohsinn nichts genommen, nichts von seiner Liebe zu den Menschen und seinem Glauben an sie. Auf dieser letzten Reise durch Afrika, den Kongo hinauf und hinunter, nahm sein Gesicht den Ausdruck hoffnungsloser Traurigkeit an, der jeden erschütterte, der ihn sah. Er war immer ein großer Marschierer gewesen, langbeinig und schmalhüftig wie ein Wilder durchmaß er die Steppe und fühlte nicht, wie die Sonne brannte. Aber auf diesen Erkun dungsmärschen, bei denen es ihm auf Stunden ankam, stellte er Rekorde auf. Auf fünfzig Meilen Tagesleistung, achtzig Kilo meter, brachte er es, achtzig Kilometer verlassenen, verdorrten
121
Landes durchmaß er an einem Tag, um den Geflüchteten sei nen Trost zu bringen. Und dennoch, dennoch - obwohl es unfaßbar scheint - war es ihm bestimmt, in ein zweites Inferno zu blicken, noch grauen hafter als der Kongo-Garten der Qualen. Noch lag vor ihm das Paradies des Teufels.
Zehntes Kapitel Wie viele abgehackte Hände, mumienhaft eingetrocknet, breite Männerhände, schmale Knabenhände, hatte er gesehen? Wie viele Krüppel waren vor ihn getreten, ohne Hände, ohne Arme, und hatten ihm die verstümmelten Glieder gewiesen? Den Tag über lag jetzt brütende Hitze auf dem Strom, aus den Sümpfen kam manchmal, wenn Casements Barkasse sich dem Ufer näherte, ein heißer, fauliger Dampf wie aus dem Rachen eines gigantischen Tieres, das mit überfressenem Bauch im Schlamm lagert. Casement fuhr mit der Strömung und voll geheiztem Kes sel, er machte nur kurze Stationen, um Holz und Nahrung auf zunehmen, und hatte nicht mehr viel Zeit für die Eingeborenen, die immer noch an ihn drängten, wo sein Schiff Anker warf. Dem einzelnen konnte er nicht helfen, um allen zu helfen, durfte keine Stunde verloren werden - und er fühlte zugleich, daß er die Monotonie des Entsetzlichen nicht länger ertragen würde. Seine Reise war zur Flucht geworden; er fürchtete, daß die Dämonen hingemordeter Völker, daß die Erinnyen des Urwalds sich auf ihn stürzen würden, wenn er diesen Greuelberichten länger standhielt, auf ihn, nicht auf die Folterknechte der Zivilisation. Er fürchtete um seinen Verstand. Wie konnte er schlafen, wie konnte er essen, wie konnte er den Sonnen aufgang lieben und die Stimmen der Nacht, solange all das unausgesprochen auf seiner Seele lastete? Hinaussprechen, hin ausbrüllen mußte er es, daß Europa die Ohren dröhnten I Ein schauerliches Echo mußte er den hunderttausendfachen Schreien wecken, die bisher der dunkle Gummiwald verschlungen hatte, ehe er selbst sie verwinden konnte.
122
Auf dem Verdeck war ein Sonnensegel gespannt, darunter stand Roger Casements Arbeitstisch und sein Feldstuhl. Un ablässig schrieb seine Hand, baute er seine in zehn Wochen steten Recherchierens gesammelten, mit genauen Namen und Daten versehenen Notizen zu langen Protokollen aus, deren eiskalte Sachlichkeit jeden Zweifel zu Boden schlagen mußte. Aber während er schrieb - eine ganze Bibliothek solcher Proto kolle, ein Riesendossier von Manuskript entstand so -, wäh rend er bei Sonnenlicht und Lampenlicht schrieb wie ein Ge hetzter, war sein Herz nicht eiskalt und sachlich, es lag auf der Folter. Moskiten umschwirrten seine dampfende Stirn, dann war es Tag - Fledermäuse huschten durch das offene Zelt, und Nachtschmetterlinge prallten gegen seine Lampe, dann war es Nacht -, mehr wußte er nicht vom Außen. „Die Geschichte der jungen Susum“, hieß eines dieser Protokolle, das man lesen muß, um zu erleben, wie ein von Teilnahme blutendes Herz Herr über solchen Stoff wird, ohne einen Laut der Teilnahme von sich zu geben, der Sache, der Rache willen: Die Erzählung der jungen Susum
„Eines Tages kamen die Soldaten in Susums Dorf, um zu kämpfen. Sie wußte nicht, daß die Soldaten gekommen waren, ehe sie die Leute aus dem einen Ende des Dorfes ans andere rennen sah, dann begann auch sie zu laufen. Ihr Vater, ihre Mutter, ihre drei Brüder und eine Schwester waren mit ihr. Im ersten Zusammenstoß wurden vier Männer getötet. Bei diesem Gefecht wurde ein Mädchen ihres Dorfes, P. P. P., ge fangengenommen. Nach mehreren Tagen, die sie in einem an deren Dorfe verbracht hatten, kehrten sie wieder in ihr eigenes Dorf zurück. Dort waren sie erst einige Tage, als sie hörten, daß die Soldaten, die inzwischen in den Nachbardörfern ge wesen waren, wiederkommen würden. Die Männer nahmen ihre Bogen und Pfeile auf und rückten aus, um auf die Sol daten zu warten und sich zu verteidigen. Nur wenige Männer blieben mit den Frauen und Kindern zurück." „Susum und ihre Mutter gingen in den Garten, um zu arbeiin
ten. Dort erzählte Susutn ihrer Mutter, sie habe geträumt, daß Bula Matari (so nannten die Neger die Regierung des KongoStaates) kommen würden, um gegen sie zu kämpfen, aber ihre Mutter sagte ihr, sie sollte sich keine Geschichten ausdenken. Darauf ging Susum in das Haus zurück und ließ ihre Mutter im Garten. Als sie kurze Zeit mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Schwester im Hause gewesen war, hörte sic Schüsse. Sie griff nach ihrer kleinen Schwester und einem großen Korb mit einer Menge Eingeborenengeld, aber sie konnte mit beidem nicht fertig werden, so ließ sie den Korb zurück und rannte mit dem' jüngsten Kinde davon. Der kleine Knabe lief allein davon. Die älteren Knaben waren mit ausgerückt, um sich den Soldaten entgegenzustellen. Im Davonlaufen hörte sie ihre Mutter rufen, aber sie schrie ihr zu: ,Lauf doch in einer an deren Richtung!* und versuchte, mit der kleinen Schwester davonzukommen. Das Kind war zu schwer für sie, sie konnte nicht sehr schnell laufen, die anderen stürmten an ihr vorbei, und sie blieb mit der Kleinen allein. Da verließ sie die Straße und ging in den Busch, um sich zu verstecken.“ „Als es dunkel wurde, versuchte sie, auf die Straße zurück zukommen und den Leuten nachzugehen, die an ihr vorüber gerast waren, aber sie fand niemanden, so mußte sie allein im Busch schlafen. Sie wanderte sechs Tage lang allein durch den Busch, dann erreichte sie ein Dorf namens S. S. Auch in die sem Dorf waren kämpfende Soldaten. Bevor sie das Dorf be trat, grub sie ein paar Süßkartoffeln aus, um zu essen, denn sie war sehr, sehr hungrig. Sie suchte nach einem Feuer, um ihre Kartoffeln zu rösten, aber sie konnte keines finden. Dann hörte sie ein paar Leute miteinander sprechen, sie versteckte ihre kleine Schwester in einem verlassenen Haus und ging den Stimmen nach, in der Hoffnung, es seien Leute aus ihrem Dorfe, die da sprachen. Aber vor der Hütte, aus der die Stim men kamen, saß ein Soldatenboy, sie verstand die Sprache auch nicht ganz, erkannte, daß es nicht ihre Leute waren, er schrak und lief davon, in einer anderen Richtung als dorthin, wo sie ihre Schwester gelassen hatte.“ „Als sie aus der Stadt hinausgekommen war, stand sie still, jetzt fiel ihr ein, daß Vater und Mutter sie schelten würden, 124
weil sie ihre Schwester zurückgelassen hatte, so kehrte sie wie der um, als die Nacht kam. Sie stieß auf ein Haus, in dem der weiße Mann wohnte. Sie sah den Posten vor dem Haus in einem Segeltuchstuhl liegen, wahrscheinlich schlief er, denn er bemerkte sie nicht, als sie vorbeischlich. Dann erreichte sie das Haus, in dem ihre Schwester war, nahm sie und lief mit ihr weg. Sie schliefen in einer verlassenen Hütte am äußersten Ende der Stadt. Am frühen Morgen schickte der weiße Mann die Soldaten aus, um die ganze Stadt nach Leuten abzusuchen. Susum stand vor der Hütte und versuchte, die kleine Schwe ster zum Laufen zu bringen, denn sie war sehr müde. Aber das Kind war zu schwach, um zu laufen.“ „Als sie so standen, kamen die Soldaten und packten sie beide. Einer von den Soldaten sagte: ,Wir könnten sie beide behalten, das Mädel ist nicht häßlich.* - Aber der andere sagte: .Nein, wir können sie nicht den ganzen Weg schleppen, die Kleine müssen wir umbringen.* Er stieß dem Kinde ein Messer in den Bauch, und sie ließen die Leiche liegen. Susum nahmen sie ins nächste Dorf mit, in das der weiße Mahn sie kommandiert hatte, um zu kämpfen. Sie kehrten nicht zu der Hütte zurück, wo der weiße Mann war, sondern marschierten geradenwegs ins nächste Dorf. Der Name des weißen Mannes war C. D. Die Soldaten gaben Susum ein wenig zu essen. Als sie das nächste Dorf erreichten, fanden sie, daß alle Menschen entflohen waren. Am Morgen befahlen die Soldaten Susum, hinauszugehen und Manjok für sie zu suchen, aber sie fürchtete sich, denn die Soldaten sahen aus, als wollten sie sie umbringen. Die Soldaten prügelten sie durch und wollten sie aus der Hütte stoßen, aber ein Korporal N. N. N. kam, nahm sie bei der Hand und sagte: ,Wir wollen sie nicht umbringen ... Wir füh ren sie zu dem weißen Mann.* Dann kehrten sie in die Stadt zurück, wo C. D. war, und zeigten ihm Susum. C. D. gab sie einem der Soldaten in Pflege. In dieser Stadt waren drei Menschen gefangen worden, darunter war eine alte Frau, und die Soldaten, die Kannibalen waren, baten C. D., er solle ihnen die alte Frau zu essen geben, und C. D. sagte, sie soll ten sie nehmen. Die Soldaten nahmen die Frau, schnitten ihr die Kehle durch, teilten und aßen sie.“
125
„Susum sah das alles mit an. Am anderen Morgen wurde der Soldat, der Susum bekommen hatte, von C. D. fortge schickt. Bevor er ging, befahl er Susum, in der Nähe des Hauses Manjok zu suchen und zu kochen. Als er fort war, tat sie, was er befohlen hatte, da gingen die Kannibalensoldaten zu C. D. und meldeten, daß Susum davonlaufen wollte, sie wollten sie lieber töten... Aber er befahl ihnen, sie nur zu binden. Da banden die Soldaten sie an einen Baum, und dort stand sie fast einen ganzen Tag in der Sonne. Als der Soldat, dem sie anvertraut war, zurückkam, fand er sie angebunden. C. D. fragte ihn nach Susum, er erklärte, daß Susum auf sei nen Befehl gehandelt hätte, da wurde ihm erlaubt, sie loszu binden." „Sie blieben mehrere Tage in diesem Dorf, dann fragte C. D. Susum, ob sie all die Dörfer ringsum kenne, und sie sagte: ,Ja.‘ Dann befahl er ihr, ihm den Weg zu zeigen, so daß seine Leyte hinausgehen könnten, um Menschen zu fangen. Sie kamen in ein Dorf, da war nur eine einzige kranke Frau, die im Sterben lag. Die Soldaten töteten sie mit einem Messer. In mehreren Dörfern fanden sie keine Seele, aber endlich kamen sie in eine Siedlung, in die mehrere Leute sich geflüch tet hatten, weil die Soldaten überall kämpften. Hier töteten sie viele Leute, Männer, Frauen und Kinder, und andere nahmen sie als Gefangene mit. Den Getöteten schnitten sie die Hände ab und brachten sie zu C. D. Sie warfen die Hände vor ihm auf einen Haufen." „Dann marschierten sie nach Bikoro zurück. Sie schleppten eine Menge Gefangene mit sich. Die abgeschlagenen Hände ließen sie liegen, denn der weiße Mann hatte sie gesehen, so war es nicht nötig, sie mitzunehmen. Ein Teil der Soldaten wurde mit den Gefangenen nach P. geschickt, aber C. D. selbst und die anderen Soldaten marschierten nach T., wo ein anderer weißer Mann sich aufhielt. Susum war vielleicht zwei Wochen in P., dann entfloh sie in den Busch und hielt sich drei Tage lang dort versteckt. Am vierten Tage wurde sie gefunden und zu dem weißen Mann zurückgebracht. Er fragte, warum sie davongelaufen sei. Sie sagte, weil die Soldaten sie geprügelt hatten.“
126
„Susums Mutter wurde von den Soldaten getötet, ihr Vater starb Hungers, denn er weigerte sich zu essen, weil seine Frau und all seine Kinder ihm entrissen waren.“
Elftes Kapitel Roger Casement ging an Bord eines großen Überseedampfers. Es glänzte um ihn von blankem Messing und gebeiztem Holz, seine Kabine war voll Licht und Behagen, im Speisesaal schim merten Kristall, Silber, Damast. Schnelle, aufmerksame, in ihrer Dienstbarkeit selbstbewußte Stewards bedienten ihn. Für die Reisenden sind diese Art Afrikadampfer ein schwim mendes Stück reiches, behagliches Europa, das jeder genießt, der Ausfahrende, dem es für Jahre und Jahre Abschied be deutet, der Heimkehrer, der all seine guten, herrlichen Dinge lange entbehrt hat. Man lernt in wenig Tagen mehr Menschen und ihre Schicksale kennen als während aller Jahre im Busch, man hört und wird gehört, mißt sein Schicksal, seine Ent behrungen, seine Erfolge an Schicksalen anderer und tauscht Abenteuer gegen Abenteuer. Pioniere, die tief im Busch waren, sehen zum erstenmal wieder weiße Frauen. Sie haben jahre lang nur unterwürfige, nackte Weiber gesehen, mit Talg be schmierte Glieder, Wollhaar auf dem Schädel. Jetzt kommt dies wunderbare Erlebnis: bekleidete Frauen, Frauen, mit denen man in der eigenen Sprache reden, mit denen man tanzen, tafeln, die man lieben kann. Daß sie bekleidet sind, sogar mit Strümpfen und Schuhen, ist unsagbar erregend. Sie scheinen eine ganz neue, zerbrechliche und bezaubernde Art menschlicher Wesen - und mit jeder Stunde rückt Europa näher, man fühlt: dort gibt es ihrer so viele, daß man wählen kann, welche man zum Feste führt, welche von ihnen, die alle herrlich sind, man in den blauen, linden Abend begleiten wird, dorthin, wo Flieder blüht und Jasmin, um sie zu küssen. Abends spielt das Schiffsorchester, man kleidet sich mit Sorgfalt, die jungen Offiziere in weißer Tropenuniform haben beim Becher am meisten zu erzählen. Sie haben Soldaten ge drillt und Aufstände niedergeworfen, Länder befriedet, Pro 127
vinzen beherrscht wie souveräne Fürsten, Löwen geschossen, die das Vieh der Eingeborenen bedrohten. Sie waren Ärzte und Richter gewesen da drinnen im „Affenland“. Urlaub, red lich verdienter Europa-Urlaub, ist etwas Herrliches, aber „ihr“ Afrika ist ihnen dennoch ans Herz gewachsen, dort ist ihr Beruf, auf den sie stolz sind. Die jungen Herren sind geschei telt und rasiert, die Seeluft bräunt ihre Gesichter, die unter dem Tropenhelm blaß geworden, sie strahlen Kraft aus und redlichen Ernst. Roger Casement hält sich einsam, er arbeitet Tag und Nacht, wird noch viele Wochen lang Tag und Nacht arbeiten müssen. Aber er erscheint im Speisesaal und macht seine kleinen Deck spaziergänge an der Reling auf und ab, um elastisch zu blei ben. Er sieht die fröhlichen jungen Herren und rätselt in ihren Gesichtern. „Ist das möglich? Könnte einer von diesen jener Leutnant C. D. sein, der am Lulongafluß die Strafexpedition gegen träge Dörfer geführt, der seinen Soldaten die kleine Susum zur Lust und ein altes Weib zum Fraß vorgeworfen hat? Gab es andere, gab es viele Leutnants C. D. unter ihnen - oder trugen solche C. D.’s ein Kainsmal, wenn sie unter reinere Menschen traten, hatten sie blutbefleckte Hände, bluttriefende Träume?" Immer war Casement den Menschen gut gewesen, aber den Schwarzen oft mehr als den Weißen, den Kindern mehr als den Großen. Jetzt sehnte er sich danach, nur noch Kinder und Tiere um sich zu sehen, Kühe, Pferde, Schafe, Schweine, sie alle auf grüner Weide, Kinder und Tiere. Er war krank und nicht mehr jung nach dieser „Dienstreise" in die tiefsten Ab gründe der Menschheit. Im September 1903 war das hämisch-erpresserische Memo randum aus Brüssel nach London gegangen, in dem die junge Kolonialmacht Belgien dem alten Kolonialstaat England gleich sam augenzwinkernd bedeutet hatte: „Wir sind doch beide Krähen, hacken wir einander kein Auge aus.“ Es hatte zur Folge gehabt, daß der Konsul Roger Casement ohne Zögern auf seine „Investigation" entsandt wurde, im Januar 1904 erschien er mit dem riesigen Dossier seiner Protokolle in London. 128
Diese Leistung eines Reporters, dessen Bericht kein Wort enthalten durfte, das nicht der strengsten Prüfung aller inter nationalen Instanzen standhielt, auf dessen Zuverlässigkeit die englische Weltpolitik fußen wollte, ist Rekord. Im Laufe von drei Monaten hatte Casement auf Schiffs- und Fußreisen im Kongo weit über dreitausend Kilometer zurückgelegt, Hun derte und aber Hunderte von Verhören gemacht, Tausende von Beobachtungen in Zehntausenden von Zeilen niedergelegt, und jede Zeile klang überzeugend, obwohl sie Unvorstell bares meldete. Jetzt konnte die Antwort dem diplomatischen Kurier nach Brüssel übergeben werden, von dieser Antwort sollte Europa widerhallen. Lord Lansdowne teilte der belgischen Regierung mit, sein Abgesandter, Konsul Roger Casement, habe zur Wahrung der Interessen englischer Untertanen den Kongo bereist. Ein dies bezügliches Memorandum über zahlreiche Fälle, die zu Klagen Anlaß gaben, läge bei und sei Beweis für den konsularischen Charakter von Casements Reise. Der allgemeine Bericht Casements über die Zustände in Belgisch-Kongo aber ginge zu gleich nicht nur der belgischen Regierung, sondern allen Lega tionen der englischen Krone in den Ländern zu, die in der Berliner Konvention zusammengetreten waren, also den Ge sandten und Botschaftern in Paris, Berlin, Wien, St. Peters burg, Rom, Madrid, Konstantinopel, Brüssel, den Haag, Kopenhagen, Stockholm und Lissabon. Lord Lansdownes Antwort auf das mehr als vier Monate alte belgische Memorandum lautete: „Mr. de Cuveliers Note weist ausführlich auf die Notwen digkeit hin, die Eingeborenen durch irgendeine Form von Abgaben zu den Bedürfnissen des Staates beitragen zu lassen, und auf die Vorteile, die ihnen selbst durch Erziehung zur Arbeit erwachsen. Die Geschichte der Entwicklung britischer Kolonien und Schutzgebiete in Afrika beweist, daß die Regie rung Seiner Majestät diese Notwendigkeit stets erkannt hat. Mängel der Verwaltung von der Art, wie sie in Mr. de Cuvcliers Note berührt werden, müssen sich zweifellos immer ein stellen, wo sie mit unzivilisierten Rassen zu arbeiten hat, die über weite Gebiete zerstreut sind und in Sitten, Gebräuchen 9
Paradiese
129
und allen Vorbedingungen eines sozialen Systems weit von einander abweichen. Aber wo immer Schwierigkeiten entstan den sind, so besonders im Fall der Sierra-Leone-Unruhen, die Mr. de Cuvclicr besonders erwähnt, ist sofort eine gründliche Untersuchung öffentlich vorgenommen worden; wo es gerecht erschien, sind Klagen berücksichtigt worden, und jede An strengung wurde gemacht, eine so wohlwollende Behandlung der Eingeborenen zu sichern, wie sie mit den Bedingungen eines Staates irgend vereinbar ist.“ Damit zog Lord Lansdowne einen breiten Strich zwischen dem Kolonialstaat Belgien und dem Kolonialstaat England, dem alle anderen europäischen Mächte sich bald anschlossen. Belgien stand allein, am Schandpfahl Europas stand Leo pold II., der im Kongo Millionen gewonnen und sein „Gesicht“ verloren hatte. Die Veröffentlichung von Casements Bericht ging durch alle Zeitungen und alle Parlamente, ein Widerhall des Entsetzens wurde laut und wuchs zum Sturm, der alles übertraf, was Cascmcnt selbst erwartet hatte. In England standen freiwillige Eideshelfer für ihn auf, sein Freund E. D. Morel, der KongoMissionslcitcr Dr. Guinness und viele andere. Sie zogen durchs Land und sprachen zum Volk, kein lebender Europäer oder Amerikaner, der in jenen Tagen schon Zeitungsleser war, kann vergessen haben, in welcher tiefsten sittlichen Empörung die Welt loderte. Ein Hundert gottvergessener, im Tropen koller rasender Weißer hatte die „Kongogreuel“ entfesselt, Millionen von Weißen aller Bekenntnisse brüllten gegen sie auf, wiesen mit Schauder und Zorn jede Gemeinsamkeit mit diesen Schändern ihrer Ehre von sich. Leopold II. wehrte sich verzweifelt gegen den Regen von Pfeilen aus Roger Casements Köcher - er wehrte sich mit den schlechten Waffen der Verleumdung gegen die guten Waffen der Wahrheit. Roger Casement sei der bezahlte Agent eng lischer Handelsgruppen, die den Kongo-Kautschuk an sich reißen wollten. Er sei ein Werkzeug des britischen Protestan tismus, der einem katholischen Staat kein Kolonialgebiet gönne. Mit Bestechung und Drohung habe er falsche Aussagen gegen
I}0
die belgische Verwaltung erzwungen, diese Verwaltung, unter der sich die Eingeborenen glücklicher fühlten als die unter englischer Herrschaft. Er sei ein Hysteriker, Lügner, Verleum der, der alte König der Belgier selbst donnerte Schimpf gegen den englischen Konsul. Aber Whitehall hielt zu seinem Emissär, Lord Lansdowne wies jeden Zweifel an der reinen Persönlichkeit Casements zurück, dessen Bedeutung im diplomatischen Dienst während dieser Wochen unerschütterlich wurde. „Ein Ritter Bayard ohne Furcht und Tadel“ nannte ihn die Presse. Leopold II. sah sich gezwungen, noch im selben Jahr* eine Untersuchungskommission in den Kongo zu schicken, die aus drei sorgfältig ausgewählten Beamten bestand. Sie fanden jedes Wort, das Casement geschrieben hatte, furchtbar bestä tigt, sie kehrten zurück - drei belgische Beamte, drei belgische Patrioten - und erklärten, Belgien selbst schulde dem he roischen Ankläger Dank. Sie segneten ihn, der ihre Behörden vor aller Welt gezüchtigt hatte.
Zwölftes Kapitel Leopold II. kämpfte weiter mit Zähnen und Klauen um seinen afrikanischen Besitz - sein Ruf als Philanthrop war da hin, aber noch war das Gummibergwerk auf dem Äquator nicht abgebaut, das Blutreservoir nicht ganz erschöpft, und der erpreßte Millionenschatz in des Königs Schatulle ließ sich noch immer vergrößern. So leicht gab er das glänzende Ge-> schäft nicht auf I Eine „Kongo-Reformgesellschaft“ war gegründet worden, der alle Minister, Bischöfe, alle Großen Englands angehörten, sie wurde Roger Casements schärfste Waffe, als das Auswär tige Amt ermüdete. Er war eine Macht geworden, seine riesige Energie, die gewaltige Kraft seiner Sprache, seine Untadelig keit und diplomatische Geschicklichkeit hatten in der ganzen Welt Bewunderung gefunden. Er, der vor zwanzig Jahren vor dem „Zivildienst“ ins wildeste Afrika geflohen war, galt nun 9'
Ui
als eine der besten Stützen dieses Dienstes. Die Türen aller Ministerien standen ihm offen, in allen Kolonialfragen war sein Urteil höchste Instanz, wo er erschien „wie ein Grande von Spanien, der aus einem Bild des Velasquez steigt“, war er der Mittelpunkt allen Interesses, aller Gespräche. Eine unabsehbare Karriere lag vor ihm, mit vierzig Jahren auf solcher Höhe! Aber sein persönlicher Erfolg interessierte Casement nicht, gerade jetzt nahm er Urlaub. Irland, die grüne Insel, zog ihn heim. Die alte Grafschaft Antrim, das Land der Weiden und Hirten, das brauchte er nach zwanzig Jahren irrer Wanderschaft. Er verzichtete auf Gehalt, seine Bedürf nisse waren gering, und er hatte in den Konsuljahren gespart, ohne an Sparen zu denken. Ein neuer Posten? Stockholm sollte bald „frei werden", ob er Stockholm haben wollte? Nein! Solange der Sieg über Leopold nicht vollkommen, die Rettung der Kongoneger nicht absolut verbrieft war, nahm er auch den herrlichsten Posten nicht an. Er wollte Ruhe schöpfen und die gute Luft seiner Heimat atmen, aber keinen Augenblick die Front verlassen, die gegen Leopold im Felde stand. Irland sah wie eine Insel des Friedens aus. Casement, der große, weltrund gefeierte Sohn des Landes, wurde mit Jubel begrüßt. Er war sein ganzes Leben hindurch einsam gewesen, hier suchte er erst recht die Einsamkeit. Aber nun streck ten sich tausend Hände nach ihm aus. Die Heimat bot ihm, was sie zu bieten hatte, grüne Fluren und stille Hütten, den salzigen Wind, der vom Meere kam, die guten, ehrlichen Gesichter ihrer Bauern, den engen, warmen Kreis seiner Geschwister und Jugendfreunde. Aber sie stellte auch Forde rungen. Roger Casements Familie hatte zu der Minorität protestan tischer Ulsterleute gehört, die im schroffen Gegensatz zu den Katholiken die englische Herrschaft begünstigte. Als Knabe hatte Roger es nicht anders gewußt, als daß die Geschicke seiner Heimat von London aus gelenkt wurden, englische Ver waltungsbeamte in Cork residierten, englische Truppen das Land besetzt hielten. All dies schien vom Schicksal bestimmt und notwendig. Er war in der englischen Sprache erzogen
worden, als ob Irland keine eigene Sprache habe, war in den englischen Dienst aufgenommen worden, ohne Widerstand zu finden, und als englischer Beamter hatte er im großen Kampf der Menschheit gegen Barbarei die Fahne tragen dürfen. Nun gab es plötzlich ein irisches Problem, das Jahrhunderte alt war, einen irischen Kampf gegen England, der in diesen Jahrhunderten nicht zum Austrag gekommen war. Gerade jetzt rührte sich eine neue Bewegung, die „Sinn Fein" hieß, ein gälisches Wort, das auf deutsch „Wir selbst“ heißt. „Wir selbst“ wollte Irlands Geschicke leiten, in den Schulen seine eigene Sprache lehren, seine eigene Dichtung pflegen, seine Industrie entwickeln, seinen Außenhandel von englischer Bevormundung lösen, der Auswanderung nach Amerika ein Ziel setzen, die Irland entvölkerte. Casement hörte zum ersten Male gälisch singen, sah gälische Tänze und Trachten, hörte nationale Reden und erfuhr, daß in diesem Volk stiller Hirten ein brünstiger Haß gegen Eng land lebte. Er begriff es zuerst nicht, starrte wie geblendet in dies Feuer, das schon geglüht hatte, als er hier ein Knabe war, und das er niemals wahrgenommen. Er stürzte sich in die Literatur, mit vierzig Jahren studierte er zum ersten Male die Geschichte seines Volkes, und das ganze Bild geriet ins Wanken, das er sich bisher von der Welt gemacht hatte. Dann kam der große Tag, an dem Leopold II. sein persön liches Regiment über den Kongo niederlegte und ein neues Regiment dort einsetzte, das der parlamentarischen Regierung Belgiens unterstand. Wie England, Deutschland, Holland ihre tropischen Kolonien verwalteten, würde es nun auch Belgien tun - unter dem Gesichtspunkt, daß der Reichtum jedes tro pischen Landes seine eingeborene Bevölkerung ist, die zu nehmen sollte, nicht abgewürgt werden durfte, und daß nur ein glückliches, gutgenährtes, gutregiertes Volk sich vermehrt. Jetzt würden sie in ihre Dörfer zurückkehren, die Überleben den der Kongogreuel, ihre Felder wieder bestellen, von Soldaten-Massaker und Hunger nicht mehr bedroht. Schlimmer als Pest und Schlafkrankheit hatten zwanzig Jahre lang Gewalt und Gier über ihre Heimat hingetobt, sie hatten gelitten ohne M3
Maß und wären in weiteren zwanzig Jahren ausgestorben wie einst die Indianer unter spanischer Herrschaft, hätte Gott ihnen keinen Retter gesandt. Im Kampf gegen ihre Verderber hatte Roger brave Genossen gefunden, aber tausend Stimmen in den Parlamenten, in den Zeitungen aller Sprachen sagten ihm immer aufs neue, daß nur er den Lorbeer des Sieges be anspruchen durfte. Nie hatte ein staatlicher Mechanismus schneller und exakter gearbeitet als in seiner Hand, aber eine langsamere Aktion als die seine - vom Kabinett zu Kabinett, von einer Amtsstube zur anderen - hätte auch das Verderben nicht mehr aufgehalten. Wenn England herrlich dastand vor aller Welt, Zuflucht der Schwachen, Schwert der Menschlich keit, in diesem Falle war es einzig sein Verdienst. Aber während draußen in der Welt die Glocken seines Sieges geläutet wurden, starrte Roger Casement in die Blätter der Geschichte eines anderen unterdrückten, mißhandelten und dezimierten Volkes, und das war sein eigenes. Er las von Blutbädern und Hungersnöten, der systematisdien Verarmung eines reichen Landes, Massensterben und Massenflucht wie am Kongo. Grausame Zahlen traten da auf: in den sechs Jahren von 1846 bis 18 51 hatte Irland über zwei Millionen Menschen verloren, teils durch Hungersnot und Hungertyphus, teils durch Flucht nach Amerika! Und doch war es ein reiches Land, denn in diesen sechs Jahren hatte es Lebensmittel - Korn, Vieh und Gemüse - im Werte von zwei Milliarden Mark nach England verschifft! Abermals fegte er Protokolle an, Weißbücher, die später einmal an die Regierungen aller Welt geschickt werden soll ten. „Die Politik Englands gegenüber Irland ist immer von zwei Grundsätzen geleitet worden: erstens galt es, die eingeborene Bevölkerung Irlands so schnell wie möglich loszuwerden und dafür das Land mit Engländern zu kolonisieren, zweitens in den Bewohnern Irlands, einerlei welcher Abstammung sie waren, den irischen Gedanken zu ertöten und dafür eine unterwürfige Anhängigkeit an England zu erzielen. All dies geschah natürlich nur, damit der Reichtum Irlands ungehindert nach England fließen könne.“ 1J4
„Um die Entvölkerung Irlands zu erzielen, wurden Jahr hunderte hindurch Kriege oder richtiger Massenschlächtereien in Irland veranstaltet. Um die Ertötung des irischen Gedan kens zu erzielen, wurde die unehrlichste und schamloseste Regierungsform, die jemals ersonnen worden, für Irland ein gesetzt. Es war dies die Aufhebung des irischen Parlaments und seine Vereinigung mit dem englischen Parlament, das von nun ab mit einer Majorität von fünf englischen gegen einen irischen Vertreter die Geschicke Irlands leitete. Durch diese »Vereinigung*, im Jahre 1801 vorgenommen, wurde die Aus plünderung Irlands .legalisiert*. Die Engländer konnten sogar behaupten, daß die Irländer selbst mit dieser Politik einver standen seien, das Parlament in London führte ja den Titel .Parlament von Großbritannien und Irland*. Lord Byron hat diese Vereinigung der beiden Königreiche verglichen mit der Vereinigung, die der Haifisch mit seiner Beute vornimmt." „Als die Union geschaffen wurde, war Irland unter den europäischen Ländern, auch England gegenüber, eine Groß macht. Seine Bevölkerung war sechs Millionen stark, während England ungefähr neun Millionen Einwohner hatte. Dublin, die Hauptstadt Irlands, war die zweitgrößte und wichtigste Stadt des britischen Reiches und vielleicht die dritte oder viert größte Stadt von ganz Europa. Heute ist Dublin unbekannt. Damals war es größer als Berlin, Petersburg und vielleicht so gar Wien. München hatte damals vielleicht fünfzigtausend Einwohner, Dublin über zweihunderttausend. Dazu prangte die Stadt im Schmucke wundervoller öffentlicher Gebäude und besaß die besten Straßen von allen Städten Europas. Es ent wickelte sich schnell zu einem Mittelpunkt literarischen, musi kalischen und künstlerischen Lebens, das große Geister und Künstler von weit her anzog.** „Durch die Vereinigung mit England kam all dies zu einem plötzlichen Ende. Die irische Aristokratie wurde nach dem gemeinsamen Regierungssitz London gelockt und langsam verengländert. Die Interessen der irischen Aristokratie wurden denen Englands angegliedert, indem die englische Regierung und das englische Parlament einzig und allein den Wünschen und Begierden dieser Aristokraten diente, stets zum Nachteil
«35
des Landes, das sie im Stich gelassen hatten. Alle Maßnahmen der englisch-irischen Gesetzgebung waren darauf gerichtet, die Besitzrechte dieser im Ausland lebenden Eigentümer irischen Bodens zu stärken, denn nur auf diese Weise konnten die Einkünfte Irlands nach England geleitet werden.“ „Die einst blühende irische Wollweberei, Baumwollspinne rei, Tuchfabrikation, Messerschmiederei, Glas- und Leder industrie, Möbeltischlerei, Buchdruckerei und Buchverlag, Schiffahrt und Schiffsbau, alle diese vom fleißigen Irland hoch entwickelten Wirtschaftszweige, die für ein aufblühendes Volk Lebensnotwendigkeit sind, wurden gewaltsam und systema tisch unterdrückt und durch die zwangsweise Einführung eng lischer Produkte ersetzt.“ „So wurde Irland immer ärmer, England immer reicher.“ Neunzehn Monate lang dauerte der Urlaub, den Roger Casement sich selbst bewilligt hatte. In diesen neunzehn Mo naten veränderte sich jedes Atom seines Wesens, und später bekannte er, diese Zeit sei die fruchtbarste und damit glück lichste seines Lebens gewesen. Er lernte seine Heimat bis zum Fanatismus lieben, jede Wiese schien ihm ein Paradies, jeder Ire ein Edelmann, jedes irische Wort ein Kleinod. Er durch wanderte diese köstliche Welt, lebte in Poesie, dichtete Verse, er trat dem Sinn Fein mit vollem Herzen bei, sammelte jun ges Volk um sich, um zu lehren, was er selbst erst jetzt, als ein gereifter Mann, erlernt hatte. Ein englischer Konsul schrieb in Sinn-Fein-Blättern gegen den englischen Imperialismus! Ein englischer Konsul arbeitete mit zwei Sinnfeinern ein Pamphlet gegen den Eintritt junger Iren in die britische Armee! Bald, so schwur er, würde er sich für den Rest seiner Tage in Irland niederlassen, um ganz den Wiesen und Weiden, ganz dem Sinn Fein zu leben! Dann wurde das Konsulat in Santos, dem großen brasilia nischen Kaffeehafen, frei und Casement angeböten. Lockte ihn, den Abenteuerfrohen, eine völlig neue Welt? Nahm er den Posten an, weil seine Geldreserven zu Ende gingen und er nicht - wie die vielen anderen - aus der Politik, die ihm heiliger Beruf war, einen Erwerb machen wollte? Daß er Sinnfeiner geworden war, konnte seiner Behörde kein Ge-
heimnis sein. Wenn sie kein Bedenken hatte, ihn die „Ver einigten Britischen Königreiche" im Ausland vertreten zu las sen, brauchte er aus sittlichen Gründen diese Vertretung nicht abzulehnen; noch war ja Irland ein Teil des Reiches, dem er dienen sollte. Der Sinnfeiner Roger Casement ging als englischer Konsul nach Santos. Aber er schrieb später: „Alles, was ich getan habe seit jenen neunzehn Monaten in Irland, scheint mir nur natürliches Aufkeimen der Saat, die damals gesät wurde."
Dreizehntes Kapitel Von Santos, wo er unter erträglichem Himmel und in an genehmer Umgebung ein Jahr lang gedient hatte, wurde Case ment 1908 wieder auf den Äquator beordert, nach Parä an der Mündung des Amazonenstroms. Während aller Jahre, die er im Konsulatsdienst verbracht hatte, in allen Einöden und tropischen Exilen, muß Roger Casement unablässig und zäh an sich gearbeitet haben. Mit neunzehn Jahren war er der Schule entlaufen, eine Universi tät hatte er nie besucht, seine Jugend hatte er auf Abenteurer fahrten im wildesten Busch verbracht. Nun stand er auf Posten, die Wissen, Routine und schnelle Entschlüsse verlang ten. Er stand als Autodidakt neben Fachleuten, die außer juristischen und handelstechnischen Studien, erfolgreichen Prü fungen, die gründlichste Spezialschule im konsularischen Dienst absolviert hatten. Es ist ein anderes, auf einer rasenden Fahrt durch tropisches Land Material zu sammeln, zu sichten, auszuarbeiten und dar aus wuchtige Schriftsätze zu formen, ein anderes, täglich dicke Aktenkonvolute in allen Sprachen der Welt durchzuackern, subtile Rechtsfragen zu ergründen, diplomatische Verhandlun gen zu führen. Roger Casement, der Abenteurer und Schön geist, der sich später als politischer Schriftsteller von unge heurer Wucht entpuppte, als Historiker und Rechtsphilosoph, war auch dieser Arbeit gewachsen. In seinem Auftreten war er ein vollendeter Diplomat. Er B7
wirkte so uraristokratisch und überlegen, daß man schwer be greift, wie er, der irische Bauernjunge, zu solchem Stil ge kommen ist. Von seinen Geschwistern hatte keines diesen Adel in Haltung und Aussehen, diese müde Lässigkeit kraftgefüll ter Glieder, diesen melancholischen Abstand zu allen Men schen bei wärmster Herzlichkeit. Es schien Casement bestimmt, einmal unter die Granden der Welt als einer der ihren zu tre ten, und er war auf dem Wege dazu I Nach einem Jahr Parä, mit fünfundvierzig Jahren, wurde er zum Generalkonsul in Rio de Janeiro ernannt. In der kon sularischen Karriere gab es nun kaum mehr ein Höherkom men, aber der Weg konnte sich fortsetzen, aus Generalkonsuln werden Botschafter, Minister, Gouverneure. Bis zum Thron eines Vizekönigs von Indien kann ein erlesener Vertreter Englands immer höhere Stufen erklimmen ... Das Generalkonsulat in Rio de Janeiro nahm Roger Case ment nicht an. Ihn drängte sein düsterer Genius auf einen anderen Wegl An dem letzten, unzugänglichsten Winkel des Erdballs, am Oberlauf des Amazonenstroms, dort, wo Brasilien, Ekuador, Peru und Kolumbien aneinanderstoßen, in der Landschaft Putumayo, waren vor Jahren Gummifunde gemeldet worden. Die Gründung von Gummiausbeutungsgesellschaften war ge folgt, nun wurde die Kunde von Gummigreueln verbreitet, so furchtbar, daß die Welt sich weigerte, sie zu glauben. Selbst Roger Casement I Als er die erste große Veröffentlichung der Zeitschrift „Truth" las, glaubte er, hier müßte die Phantasie eines Marquis de Sade dem Berichterstatter die Feder geführt haben. Neben den Qualen, die angeblich von den Indianern in Putumayo erlitten wurden, schienen selbst die Kongogreuel blaß. Aber Casement wußte, bis zu welchem Maß - wenn es um Gold oder Gummi geht - der Mensch des Menschen Wolf werden kann. Er wußte, er kannte die Bestie, die im weißen Menschen steckt, und, einmal losgelassen, keine Grenze der Bestialität kennt. Aus dem tiefsten Innern von Südamerika, dreitausend Mei len fernher, heulten Menschen um Gnade und Schutz, heulten 1)8
Indianer in seine Nächte hinein und rissen ihn aus dem Schlaf. Zeitungsgerede? Berichte sensationsgieriger Commis voyageurs, die von ihrer Reise den Amazonas hinab etwas Rechtes er zählen wollten? So mochten andere sich beruhigen. Casements menschliches Gewissen arbeitete wie ein Seismograph, der un trüglich feststellt, wenn irgendwo auf Erden das Antlitz der Schöpfung verunstaltet und geschändet wird. Dort war sein Platz, in Putumayo, dort mußte er hinl Nicht in die kühlen, hellen Räume des Generalkonsulats von Rio de Janeiro, nicht zu Konferenzen und Gastereien. Sondern auf die Schanzen der Gesittung, wo immer sie berannt wurden I Um die Mission zu erhalten, nach der er verlangte, mußte Casement erst nach London fahren und mit dem Ministerium Rücksprache nehmen. Er machte die schöne Reise, fast krank vor Ungeduld. In seinem Rücken spürte er das heisere Ge wimmer der elenden Indianer. Auch diesmal wählte man natürlich die Form, in der Roger Casement auf seine letzte Kongofahrt entsandt worden war. Er reiste zum Schutz der Sicherheit und der Interessen briti scher Untertanen. Uber dies Thema sollte er berichten. Aber seine Instruktion lautete außerdem: „Senden Sie in gesonderter Fassung alle Informationen, die Sie bei dieser Mission über die Methoden der Gummigewin nung und die Behandlung der Eingeborenen sammeln. Selbst verständlich ist Ihnen äußerste Vorsicht zur Pflicht gemacht, um jede Kränkung der Regierungen des von Ihnen bereisten Distrikts zu vermeiden. Sir Edward Grey gibt Ihnen absolute Freiheit über die Schritte, die Sie für nötig halten, und über die Geldmittel, die Ihnen nötig scheinen, um zu einem unpar teiischen, selbständigen Urteil zu kommen.“
Phantastischer als alle Menschenhirne arbeitet das Leben, unglaubhafter als Roger Casements Weg ist kein Traum. Der Kongo und der Amazonas I... Beide schneiden sie auf Äqua torbreite tief in ihre Erdteile ein, beide schiffbar, beide sind die natürlichen Einfallstraßen von Europa und seiner Kultur in tropische Wildnis. Im Kongo und in Brasilien wuchsen Gummiwälder, am Kongo wie am Amazonas hatte sich, um IJ9
des Gummis willen, Europa in die Stille eingefressen und wütete gegen die eingeborenen Menschen. Den Kongo hinauf, den Amazonas hinauf, wurde innerhalb von fünf Jahren Roger Casement entsandt, um dem Unheil Europa zu steuern 1 Es gab vor ihm wenige Europäer, die sich bis Putumayo ge wagt, wie es wenige Europäer gab, die vor ihm den Oberlauf des Kongo betreten hatten. In Putumayo war - wie damals im Kongo - bisher kein regionaler Forscher gewesen, kein Geograph, hier nur „Konquistadoren" blutgierigster Sorte, dort die konzessionierten Kongo-Harpyen. Der Putumayo war fieberdurchseucht, ein Weißer konnte unmöglich dauernd hier leben - unwegsam, durch viele Mauern von der Kultur geschieden. Für einen Mann in Casements Alter, dessen einst mächtiger Organismus in zwanzig Tropen jahren gelitten hatte, war dieser Vorstoß allein eine Helden tat, zumindest eine Tat der Selbstaufgabe, die an Opferung grenzte Über dem Putumayo wehte und weht noch heute die Fahne keiner Nation. Es war „keines Mannes Land“, wie man später im Krieg den Boden zwischen den Schützengräben nannte. Wenn gerade Casement dort erschien, Casement mit seinem internationalen Namen, wußte jeder den Zweck seiner Reiset Aber keine Macht, keine Verwaltung, weder Polizei noch Militär, verbürgte sich für seine Sicherheit. Noch weniger als am Oberlauf des Lulanga galt hier sein Diplomatenpaß, er griff mit nackter Hand in einen Hornissenschwarm. Der Putumayo war ein Gebiet außerhalb aller Gesetze. Selbst von den christlichen Missionen, die überall auf dem Globus voranmarschiert oder tapfer in den Fußstapfen der ersten Forscher gegangen sind, hatte sich hierher noch keine gewagt. Bis in diese lianenumflochtene Teufelsgrotte hatte bis her nur Geldgier etliche weiße Menschen gelenkt,, nicht einen Christenmut und Aposteltum. Casement war der erste weiße Mann, der sich dem Schrecken dieses Landes aussetzte, ohne Schätze rauben zu wollen. Zugleich mit ihm fuhr eine Kommission der „Peruanischen Amazonas-Gesellschaft“, deren Agenten die Gummigewinnung in Putumayo betrieben und gegen die sich die Beschuldigungen
140
der Presse gerichtet hatten. Der Führer dieser Kommission, ein alter Obrist, mußte schon in Mafiaos zurückgelassen wer den, vom Fieber außer Gefecht gesetzt. Vier Europäer, ein Gummifachmann, ein Tropenlandwirt, ein Kaufmann und ein Sekretär, setzten die Reise fort: aber nicht als Casements Stab, denn sie waren seine natürlichen Gegenspieler. Das Bett des Amazonas ist von der Mündung bis zu der Stadt Mahaos, also tausend Meilen weit, so breit, daß er eher ein flutender See als ein Strom scheint. Ozeandampfer befah ren ihn, man kann von London bis Mahaos, also ins Herz Brasiliens, reisen, ohne ein einziges Mal das Schiff zu verlas sen. Parä, wo Casement ein Jahr lang als Konsul gewaltet hatte, ist eine Stadt voll feurigen Lebens. „Paris auf dem Äquator“ hört es sich gern nennen. Die Fahrt bis Mahaos wird als ein Traum geschildert, durch klare Wasser, auf denen die Victoria Regia blüht, zwischen Urwäldern und grünen Inseln hin, auf denen von der „Kultur“ kaum bedrängte Indios ein frohes Amphibiendasein führen. Weiter stromaufwärts lösen Flußdampfer den Ozeandamp fer ab, es kommt das Land der Berge und giftigen Sümpfe. Die letzte Etappe von Casements Reise war eine gefahren umdrohte Fahrt von sechshundert Meilen auf dem Putumayostrom. Die Bevölkerung des Putumayo wurde von den ersten Kon quistadoren auf etwa fünfzigtausend Seelen geschätzt, die in vier Stämme zerfielen. Ihre Farbe war dunkelbraun, beinahe sdiwarz, der Schnitt ihrer Gesichter aber nicht negerhaft, son dern ausgesprochen mongolisch. Casement schrieb über sie in einem seiner ersten Berichte: „Das Bild eines Borneo-Mannes mit seinem Blasrohr könnte sehr mit dem eines Boras-Indianers mit seiner .Cerbantana* verwechselt werden. Auch die Waffen und ihre Handhabung sind fast die gleichen. In mehr als einer Beziehung ist die Ähnlichkeit zwischen zwei so weit voneinander getrennten Ras sen erstaunlich. Zwischen den Stämmen hat es sichtlich lang ausgedehnte Fehden gegeben, die häufig zu .Kriegen* führten. Im Kampf wurde auffallend wenig Blut vergossen, aber die Sieger pflegten ihre Gefangenen zu fressen. Ihre Auffassung
141
darüber war seltsam: viele hielten es für ein höchst ehren haftes Ende, vom Feind gefressen zu werden.“ Blasrohre und leichte Wurfspeere waren keine Abwehr gegen die Hyänen des Gummihandels gewesen, denen Casement jetzt entgegentrat. Diese Gummipiraten fraßen kein Men schenfleisch, in den Zahnrädern ihrer Kiefer zu verbluten war auch für die Putumayo-Indianer kein rühmliches Ende. Aber es war ihr Schicksal bis zu Casements dramatischem Auftritt.
Vierzehntes Kapitel Iquito hieß ein gottverlassener Platz am Amazonenstrom, im Winkel der drei Republiken Brasilien, Peru und Ekuador, den Casement im August 1909 erreichte. Hier sausten allen Weißen die Ohren von Malariafieber oder Chinin, das sie zum Schutz gegen die Malaria in Mengen schluckten. Sie sahen fahl und gelb aus, hatten zitternde Hände, tranken scharfe Getränke zum Schutz gegen Typhus und Dysenterie, bewegten sich lang sam, ängstlich, keinen Schritt ohne Moskitohelm, im erbar mungslosen Brennwinkel der übertropischen Sonne und emp fanden ihr Dasein als ein infernalisches Exil. Hier war, vor kurzem erst, ein englischer Konsul ernannt worden, der Auftrag hatte, Roger Casement mit „Untertanen der Krone von England“ bekannt zu machen, und er führte ihm etliche Neger zu, die von der englischen Insel Barbados im westindischen Archipel stammten. Sie waren dort vor fünf Jahren als „muchachos“, als „Jungen“ schlechtweg, für Putumayo geheuert worden und hatten nur gewußt, daß ihre Dienste mit etwa fünf Pfund monatlich herrlich bezahlt wür den. Daß sie als Folterknechte und Henker dienen sollten, hatten sie nicht gewußt. Sie waren Christen und sprachen englisch. Gerade diese Barbados-Jungen waren, als die ein zigen „englischen Untertanen" weitum, die Leute, die Case ment für seinen Auftrag nötig hatte. Ihre Interessen wahrzu nehmen war seine Aufgabe. Wenn er sie tagelang verhörte, konnte die Regierung keines Landes sich verletzt fühlen. Im Putumayo herrschten - das erfuhr Casement bald - un-
142
geschriebene Gesetze, die selbst dem Kongo fremd waren. Ein Weißer, der mit Indianern freundschaftlich verkehrte, war des Hochverrats schuldig und verendete, verschwand spurlos im glühendheißen Sumpf. Ein Weißer, der einem anderen Gummi stahl, verfiel derselben Feme. Stahl ein Weißer Indianer lebendige, atmende Indianermenschen konnte man „stehlen“ -, dann verfiel er mit allen, die zu ihm gehörten, der Blutrache. Diese Gesetze galten und wurden ausgeführt, seit vor fast dreißig Jahren die ersten Gummihyänen ihren Fuß in den Nacken der Putumayo-Indianer gesetzt und begonnen hatten, den Gummireichtum ihres Landes abzubauen. Sie hatten sich nicht geändert, seit die Amazona-Gummi-Exportgesellschaft den ganzen Handel zu ihrem Monopol gemacht hatte, obgleich so zivile, würdige Herren von London aus den Handel organi sierten, obgleich in Roger Casements Gesellschaft Gentlemen als Beauftragte dieses Welthauses reisten, deren Bildung und Manieren vollendet waren. In den Busch hinein, in die Fiebersümpfe und Höllengluten war ja keiner von ihnen gefahren. Dort hinein wurden Agen ten geschickt, die an ihrer „Produktion“ mit Prozenten betei ligt waren. Lange hielt es keiner dort aus - für geringen Ge winn nahm keiner ein paar Jahre Putumayo auf sich. Sie woll ten für diese kurze Frist Teufelsinsel, für ein nicht wieder einbringbares Stück Gesundheit, soviel Geld gewinnen, daß der Handel sich lohnte. Das war im Keim schon teuflischer als im Kongo. Dort thronte ein König im weißen Patriarchen bart über dem Ganzen, den die Welt zur Verantwortung zie hen konnte. Dort wurden staatliche Konzessionen vergeben, die Gummierpresser waren Beamte und standen unter Gesetzen, konnten ihrer Pension verlustig gehen, konnten ins Zuchthaus wandern, wenn scharfes Licht auf ihre Wege fiel. In Putumayo, im „Niemandsland“, gab es solche Gesetze nicht. Es gab einen Stapelplatz, auf dem die Gummibeute jedes Agenten gewogen wurde, eine Schreibstube, in der er seine Pfunde kassierte, und niemand fragte, wie er zu den vielen Doppelzentnern der gesuchtesten Marktware gekommen war. Die Barbados-Jungen waren nicht redselig, wenn Casement sie befragte. Ihre Negergesichter blickten böse und verzerrt. UJ
mit den Augen von Raubtieren, die jagten und selbst gejagt wurden, Folterknechte, die selbst vor der Folter zitterten. Aber dann kam einer, Frederick Bishop, eben erst aus dem Putumayo eingetroffen, der Casement Glauben schenkte, daß er vor jeder Verfolgung sicher war, wenn er alle Wahrheit be kannte, daß er trotzdem seinen Lohn für den Dienst von fünf Jahren richtig erhalten und Barbados sicher erreichen würde. Frederick Bishop sprach - es überlief Casement, schauriger noch als damals in den Hütten der entflohenen Schmiede im Kongoland. Widerwärtiger Blutgeschmack trat ihm auf die Zunge, sein Magen drehte sich in furchtbarem Brechreiz. Sie saßen in Segeltuchstühlen auf einer schattigen Veranda des Konsulats, Casement, der Konsul von Iquito und Herr Barnes, der Führer der Handelskommission. Auf dem Boden zwischen ihnen hockte Frederick Bishop. Aber dieser Kreis genügte Casement nicht mehr, er sprang auf, als der Bericht kaum begonnen hatte, und befahl, daß alle Herren der Kom mission zusammentraten. Casement war krank, seine alte Malaria war in diesem verseuchten Tal neu ausgebrochen, er trug einen warmen Mantel, unter dem seine Glieder im Schüt telfrost flogen. Seine Stirn brannte, als lohten Flammen dar unter, er klapperte mit den Zähnen. Aber seine Worte klangen wie immer, ruhig, sachlich, unwidersprechbar: „Ich wünsche, daß alle Herren der Kommission hören, was dieser Mann be richtet.“ „Worin bestand dein Dienst, Frederick?" „Dafür sorgen, Herr, daß jeder Indianer sein Quantum Gummi abliefert. Wenn ein Indianer davonlief, ihn verfolgen. Ihn fangen oder äbschießen, Herr. Das war mein Dienst.“ „Und wenn ein Mann zuwenig Gummi gebracht hat?“ „Dann bekam er die Peitsche.“ „Auch die Frauen?“ „Selbstverständlich, Herr. Frauen, Kinder, das ist ganz egal." „Wie wurde gepeitscht?“ „Im Bock, Herr. Sie wurden nackt auf ein Gerüst gespannt und ausgepeitscht. Die Peitsche war aus Tapirhaut geflochten, einen Finger dick, anderthalb Meter lang."
M4
„Wie viele Hiebe bekamen sie?" „Das war verschieden. Bis das Gesäß zerrissen war, bis sie ohnmächtig wurden, bis sie tot waren ...“ „Hast du selbst? .. „Selbstverständlich, oft, Herr, das war ja mein Dienst." „Hast du diesen Dienst gern getan?“ Die gequälte Negerfratze verzerrte sich mehr von Wort zu Wort. „Verflucht sei alles, Herrl Aber in Putumayo ist man kein Mensch und darf nicht widersprechen.“ „Wieviel Lohn bekommen die Indianer?" „Lohn? Nur die Peitsche, Herr.“ „Wie werden sie ernährt?“ „Darum kümmert sich niemand. Sie fressen Wurzeln und Blätter, bis sie verhungern.“ „Wer war dein Chef, Frederick?“ „Der Señor Elias Martinengui. Du kannst ihn nicht fragen, er ist in seine Heimat gereist, er hat viele tausend Pfund ge macht.“ „Hat der Señor Martinengui selbst das alles befohlen?“ „Nur erl Wenn Indianer geflohen waren und wir haben sie eingefangen, hat er ihnen auch mit der Machete den Kopf abschlagen lassen. Das habe ich zweimal gesehen. Und da war ein anderer weißer Mann, Señor Montt. Der hat vier Indianer vom Bock abschnallen lassen und gefesselt in die Wälder ge schickt mit zwei Muchachos. Sie waren nichts mehr wert, wir hatten sie halbtot gepeitscht. Am Abend sind die Muchachos zurückgekommen und haben die Ketten abgeliefert. Ein paar Tage später bin ich denselben Weg gegangen, da..." Frederick hielt sich die Nase, man sah nur noch das Weiße seiner Augen und die gefletschten, gleißenden Zähne. „Da hat es gestunken wie Pestilenz. Da lagen die vier Kadaver auf einem Haufen.“ „Und ihr habt immer getan, was der weiße Mann befohlen hat?" „Nein, Herr, da war ein Muchacho, der heißt Dyall. Der hat etwas angefangen mit einer Indianerin, die dem weißen Mann gehört hat. Señor Montt hat ihn in den Bock spannen . io
Paradiese
145
lassen, die Hände und Füße zwischen zwei Bretter. Aber die Löcher zwischen den Brettern waren zu eng für seine Gelenke, denn wir haben stärkere Knochen als die Indianer. Das Holz hat ihm das Fleisch zerrissen. Er hat gebrüllt vor Schmerz, den ganzen Tag und die ganze Nacht hat er so gelegen und gebrüllt. Auf Ellbogen und Knien ist er am anderen Tag in seine Hütte gekrochen. Aber dann hat ihn der weiße Mann noch einmal geholt und an einem Baum hochgewunden, mit einer Kette um den Hals, daß seine Füße nur mit den Zehen auf den Boden reichten. Für viele Stunden, Herr!“ „Ein britischer Untertan!" grollte Casement mit furchtbaren Augen. „Sie hören das, meine Herren, dieser Dyall ist ein britischer Untertan! Meine Regierung hat mich entsandt zum Schutz britischer Untertanen.“ „Ich auch!“ heulte Frederick. „Ich habe auch im Bock ge legen für Stunden und Stunden.“ „Ich sichere dir jeden Schutz zu, Frederick. Niemand wird dir ein Haar krümmen, wenn du bei mir bist. Willst du noch einmal in den Putumayo, mit mir, und jedem weißen Mann ins Gesicht sagen, was du von ihm weißt?“ „Ja, Herr!" kam es, geheult und gebrüllt, in grenzenlosem Haß aus dem Negermund. „Ich allen sagen Wahrheit! Ich alle hassen! Und dann ich weg von Putumayo, für immer!“ Zum erstenmal, sagte er, würde eine Klage aus dem Para dies des Teufels hinüber über seine Grenzen dringen. Viele tausend Klagen seien erhoben worden, aber die großen Her ren in England hätten nichts gehört. „Bei Gott, nein, wir haben in London kein Wort von all dem gehört!“ schwuren die Herren der Kommission. Seit der Neger Frederick gebrüllt hatte, ja, er wollte und würde seine Anklage überall wiederholen, waren sie erschüttert und ge brochen. Dieser Muchacho Dyall, Joshua Dyall, sollte kein Gespenst des Busches bleiben. Ein paar Wochen später, ein paar hun dert Meilen tiefer im Innern der Hölle, trat er in Fleisch und Blut vor Casement und die Herren der Kommission. Konsul Casement hielt in Chorrera, dem Umladeplatz der Gummi ballen, Verhöre ab, da schleppte sich ein lahmer Neger her-
146
bei, ein junger Mensch, der so zerstört war, daß er auf das eigene Schicksal spie, nur noch anklagen wollte. „Hört mich, Herren I Ich weiß, daß Ihr gekommen seid, um zu wissen, wie es in des Teufels Paradies zugeht I Ich bin mit der Büchse und hundert Patronen ausgeschickt worden, zur Jagd auf entlaufene Indianer, Gott weiß, wie oft, Gott weiß, wie viele ich geschossen habe.“ Er erzählte von einem Weißen namens Fonseka, der an Grausamkeit selbst Martinengui und Montt noch weit über traf. Als Abkömmling eines Spaniers, der mit Christoph Kolumbus nach Westindien gekommen war, gehörte Fonseka zur höchsten Aristokratie Südamerikas. Fonseka hatte auf einen im Bock liegenden Indianer gezeigt und Dyall befohlen: „Schieß ihn ab!“ Er trug dabei einen gewaltigen Knüppel in der Hand, und als Dyall nicht schießen wollte, hatte Fonseka den Knüppel durch die Luft sausen lassen. „Schieß, sonst hast du keine ganze Rippe mehr im Leibi“ „Da hab ich geschossen, Herr!“ Casement, dem es zumute war, als wate er seit Wochen durch Blut und über zuckende Menschenleiber, fragte mit sei ner ganzen, furchtbaren Sachlichkeit: „Was hatte der Indianer verbrochen?“ „Verbrochen?“ Dyall, der durch Folter verkrüppelte, zum Folterknecht und Henker erniedrigte schwarze Mensch Dyall, reckte die Arme, stieß eine hysterische Lache aus, die den weißen Män nern wie Haßgebrüll des Urwalds klang. „Verbrochen hatte er nichts! Fonseka wollte nur sein Weib haben!“ Denn das war so... Ein Indianer, dem der Weiße sein Weib genommen hatte, war nie wieder zur Arbeit zu bringen. Kette und Peitsche und dunkler Kerker, alles versagte, das wußte man. Deshalb ließ Fonseka jeden Mann kurzweg erschießen, dessen Weib ihm gefiel. Er besaß einen Harem voll solcher Witwen, mit denen er Rudel von Kindern zeugte. Mit dem Bild ihrer ge mordeten Gatten im Hirn, in der Seele, mußten sie Fonsekas Kinder empfangen, tragen, gebären. IO*
U7
Und auch das war noch nicht alles, noch lange nicht alles, was der Muchacho Joshua Dyall erzählen, der Muchacho Frederick Bishop bestätigen wollte. „Schließen Sie das Verhör, Konsul!“ flehte Señor Tizón, Chefrepräsentant der Peruanischen Amazonas-Gesellschaft am Putumayo. „Wir unterstellen als wahr, was diese Zeugen aus sagen. Montt und Martinengui und alle von ihnen belasteten Weißen sind in dieser Stunde schon entlassen, nur machen Sie ein Endel“ Aber Casement stand noch an der Schwelle des Putumayo, weithin bekannt als Paradies des Teufels. Er war krank, in seinem Blute kreisten Malariaparasiten, seine Seele war schon jetzt zerstört von soviel Entsetzlichem. Aber er kannte keine Gnade mit sich selbst und diesen weißen Männern, er setzte seinen düsteren Weg fort wie ein Engel der Rache.
Fünfzehntes Kapitel Am Unterlauf des Putumayostromes, der in den Amazonas mündet, lebt kein Mensch und hat nie ein Mensch gelebt. Es ist flaches Sumpfland im prallen Strahl der Äquatorsonne, die Luft ist vergiftet vom Fäulnishauch, der aus den Morästen steigt, und darin hängen wie dicke Wolken Insektenschwärme, die sich blutgierig auf jedes Stück Menschenhaut stürzen. Diese Strecke durchfuhr ein Dampfer der Peruvia-Amazonas-Gesellschaft, Generalkonsul Roger Casement und die Kommission an Bord. Der spanische Peruaner Tizón, unter dessen direktem Befehl alle Angestellten der Gesellschaft standen, hatte sich ihnen angeschlossen; ein passiver Mitschuldiger der Gummi verbrechen, reiste er mit Casement, saß bei den Vernehmungen neben ihm wie ein Richter. Casement war auch diese Gesellschaft lieb, ihm war jeder Zeuge willkommen, denn er zweifelte, ob er das Paradies des Teufels lebendig verlassen würde. Er fühlte sich kränker von Tag zu Tag, sein Gesicht schrumpfte zusammen, seine Augen krochen tief in ihre Höhlen zurück. „Sie haben genug gesehen, kehren Sie um!“ rieten die Her-
148
ren der Kommission. „Lassen Sie alles andere unsere Sorge sein!“ Aber Casement wollte hier sterben wie ein Soldat bei der Fahne oder die ganze Wahrheit selbst nach London bringen, das Faszikel seiner Protokolle und den Bericht des Selbst geschauten. Was hieß das, sterben? Eine Welt verlassen, die so voll Elend, so abstoßend war, daß ihre Gesichter ihn vielleicht noch über das Grab hinaus quälen würden. Was waren Fieber und alle Not des Sterbens? Ein Leichtes, ein Nichts, im Ver gleich mit dem, was hier täglich zu leiden jedes Eingeborenen selbstverständliches Los schien. Als der Sumpfgürtel überwunden war, kam Casement lang sam wieder zu Kräften. Das Sdiiff - ein kleiner Dampfer im Besitz der Peru-Amazonas-Gesellschaft - erreichte endlich das eigendiche Putumayogebiet, und Casements Energie über wand die Krankheit. In Fußmärschen durchzog er die Gummi wälder, besuchte Station um Station, sah die Indianer bei ihrer Galeerenarbeit. Es existierte wirklich keine Spur von staatlicher Verwaltung in diesem Gebiet, wie der tapfere Mann in der Zeitschrift „Truth“ berichtet hatte, kein Zivilbeamter, kein Gendarm, kein Soldat. Höchste Autorität war Señor Tizón, dessen Dienst ort Chorrera war, Hunderte von Meilen fern, und bald stellte sich heraus, daß ohne seinen Schutz die ganze Expedition ver unglückt wäre. Wahrscheinlich hätte die Feme der Gummi piraten Casement selbst ereilt, ganz sicher hätte kein Barba dos-Muchacho und noch viel weniger ein Indianer die Todes verachtung besessen, ihm Rede zu stehen. Es war auch so ein gefährliches Beginnen. Unter den Barba dos-Leuten, die sich herbeidrängten, um ihr Gewissen zu ent lasten, unzählige Morde zu bekennen, die sie auf Befehl der Weißen begangen hatten, war James Mapp. Er wußte, daß jeder Muchacho sich verdächtig machte, der dem englischen Konsul Bericht gab, aber er wollte nichts verbergen. „Vor vier Jahren“, erzählte er, „glaubte mein Chef, Señor Jiménez, daß die Indianer sich zur Wehr setzen wollten. Er hatte in einer Nacht dreißig Stück abgeschossen, da kam ihm U9
von selbst diese Idee. Er stellte Muchachos als Posten aus, ich war einer davon.“ „In der nächsten Nacht hörte ich Telephonieren - so nennen wir es, wenn die Indianer sich von Hügel zu Hügel mit den großen Trommeln Signale geben. Auf der Wache war ein eingeborener Muchacho, ein Boras-Indianer, den holte ich mir. ,Hör zu*, sagte ich, ,was sie trommeln.* Der Junge horchte in die Nacht hinaus. ,Die Andokes-Indianer rufen die Boras zu Hilfe*, sagte er. ,Sie wollen Krieg gegen uns machen.*“ „Ich lief in die Hütte des Señor Jiménez und meldete ihm das. Wir hatten aber viele Gefangene auf der Station, alle mit Armen und Beinen in den Bock geschlossen, den wir Cepo nennen. Ein Tischler aus Barbados hatte uns viele Cepos gemacht, viele Dutzend. Sie waren verstellbar, für jede Größe, man kann sie auseinanderziehen, wenn ein Mensch darin steckt, daß seine Gelenke zerrissen werden.“ „Señor Jiménez befahl: .Nehmt alle Gefangenen aus dem Cepo und schlagt sie tot.* ** „Wir schlugen sie tot, Herr, aber einer, ein Alter, wollte nicht sterben. Ich schlug ihn mit der Machete ins Genick, aber er war noch immer nicht tot. Da mußten wir trockene Blätter um ihn häufen, und die setzte Señor Jiménez in Brand__ “ „Die Toten haben wir immer verbrannt. Von dem vielen Peitschen waren ihre Körper schon voll Maden und halb in Verwesung, ehe sie starben, es war keine Zeit, sie zu begraben. Wir übergossen die Leichen mit Kreosine-Öl, dann verbrann ten sie rasch. Aber Lebendige hat nur Don Jiménez verbrannt.“ „Es wäre aber alles nicht nötig gewesen, Herr, die Indianer hatten gar nicht an Angriff gedacht. Der Boras-Muchacho muß das Trommeln falsch verstanden haben.“ James Mapp wollte das Land eilig verlassen, nachdem er seinen Bericht beendet hatte, der endlos laufend, stundenlang, immer Gleiches, gleich Unfaßbares enthielt. Er'war mit einer Indianerin verheiratet, die wollte er holen und mit ihr fluß abwärts nach Chorrera fahren, dann weiter, in seine Heimat. Mit Papieren von Señor Tizón ausgerüstet, machte er sich auf die Fahrt flußabwärts ... Aber wenige Tage später erreichte er die Station wieder,
ijo
auf der Casement ihn vernommen hatte, ohne sein Weib, ver hetzt und verzweifelt. „Du hast mir Schutz versprochen, Herri Hilf mir, Don Aguero will mich ermorden lassen!-Nie werde ich meine Frau wiedersehen, nie komme ich nach Haus!“ Er hatte einen Hafenort, Providencia, erreicht, am nächsten Tage sollte ein langer Fußmarsch ihn zu seiner Frau bringen. Aber der Leiter von Providencia, Señor Aguero, hatte ihm befohlen zu bleiben. „Ich weiß alles, du warst bei dem Eng länder, Bursche!“ James Mapp sollte nicht hingerichtet wer den, das wagte der Mann in diesen Tagen nicht. Andere Muchachos waren bestellt, einen Streit vom Zaun zu brechen und James zu erschlagen. Aber es gelang ihm zu fliehen. „Mein Weib! Mein Weib!" jammerte er. „Sie ist allein und soll bald ein Kind gebären.“ Die Kommission hatte später Mühe, den Mann mit seiner Familie zu vereinen und sicher nach Brasilien zu bringen. Die fatalistische, fast tierische Unterwürfigkeit der Indianer war zweifellos mit schuld, daß im Putumayo-Gebiet der Tro penkoller sich so entfesselt hatte wie nie und nirgends sonst auf Erden. Wenn sie ihre Gummibeute ablieferten, blickten sie ernsthaft auf die Zunge der Waage und lasen selbst die Zahl der Kilos ab. War das Gewicht nicht voll, dann streck ten sie sich; Mann, Weib, Kind, ohne Befehl in den Staub und boten ihre nackten Körper der Peitsche, ohne um Gnade zu bitten. Trotzdem war der Cepo erfunden worden, das Brennen, Dunkelarrest, Ersäufen, Unterwasserhalten bis zum letzten Stadium des Ersäufens. Kinder wurden ausgepeitscht, weil ihre Eltern zuwenig Arbeit getan hatten, Mütter zur ^Strafe für die Faulheit ihrer Kinder. Man hatte Menschen in den Cepo gespannt, bis sie verhungert waren, ganze Familien waren zugleich ausgerottet worden. Alle Satansphantasie scheint in den Torturen erschöpft, die ich nach Casements Bericht hier wiedergegeben habe. Aber es finden sich dennoch Scheußlichkeiten darin, die ich ver schweige - es gibt eine Grenze dessen, was man lesen kann. Casement durfte diese Rücksicht nicht nehmen; er, der mit-
151
leiden konnte bis zum Mitsterben, er schleppte sieb hin durch letzten Wust und Morast der Entmenschtheit. Aus der ganzen, dreißig Jahre alten Historie des Putumayo hörte er von einem einzigen Fall bewußten Widerstandes, von einem einzigen Indianer, der gekämpft hatte! Katenere hieß dieser tapfere Mann, der vielleicht als Held in den Gesängen seines, dank Roger Casements Expedition, heute noch existierenden Stammes lebt und weiterleben wird. Dieser Häuptling hatte einen kleinen Trupp seiner Leute organisiert, den Weißen Gewehre und Munition geraubt und war mit seiner Freischar in die Wälder geflohen. Sie lernten rasch, die Waffen zu gebrauchen - oft genug hatten sie ja gesehen, wie man ladet, zielt und auf fliehende Menschen schießt. Sie lauerten im Busch und wurden das Gespenst der Gummihändler, die sich bis dahin, von Orgien erschöpft, be soffen, in den Strohwänden ihrer Harems so absolut sicher gefühlt hatten. Eine Strafexpedition von schwerbewaffneten Muchachos unter der Führung eines Weißen namens Vasquez wurde gegen Katenere entsandt. Sie erfolterten Angaben, köpften und erschossen viele, die nicht sagen wollten oder konnten, wo Katenere sich aufhielt, andere schleppten sie in Ketten mit sich. Sie fanden die Hütte, in der Katenere mit seiner Frau lagerte, aber der Häuptling war nicht darin. Sie fingen seine Frau und vier seiner Gefährten - in dem einzigen, wirk lichen Kampf, den das Paradies des Teufels je erlebt hatte, fiel ein Muchacho. „Mit zwölf Gefangenen zogen wir uns wieder zurück“, er zählte ein Barbados-Mann, der an .dieser Schlacht unter Vasquez teilgenommen hatte. „Die meisten von Kateneres Leuten hatten wir getötet. Señor Vasques tobte vor Wut. Er ließ Kateneres Weib in den Cepo spannen. Vor allem Volk warf er sich auf sie und schändete sie. Dann zogen wir weiter. Da lief uns ein Kind nach, das sah die gefesselte Indianerin und weinte laut. .Gnade! Gnade für das Kind!* schrie Kateneres Frau. ,Das ist dein Junges, du Tier?* fragte Vasquez. Das Weib schrie nur ,Gnade!*, sie konnte nicht lügen, konnte nicht leugnen, daß dies Indianerlein ihr Junges
152
war. .Kopf abl‘ befahl Vasquez. Der jüngste der Muchachos schwang die Machete und - tat, was ihm befohlen war.“ „Derselbe Muchacho mußte an diesem Tage noch .drei Ge fangene köpfen - ein Weib und zwei Knaben, die erschöpft zusammengebrochen waren -, dann zwei Männer erschießen, die nicht mehr Schritt halten konnten, denn es dämmerte, und Vasquez fürchtete sich. Er wollte seine Station erreichen, ehe es dunkel war.“ „Was geschah mit den Leichen?“ „Die Leichen blieben am Wege liegen, natürlich, Herr.. Wir hatten nur noch fünf Gefangene, als wir in die Station kamen, drei Männer, Kateneres Weib und ein Kind. Sie be kamen kein Essen und kein Wasser, sie wurden für die Nacht in den Cepo gesperrt.“ „Vasquez wußte, daß kein Indianer sein Weib im Stiche läßt, deshalb ermordete er Kateneres Frau nicht, er ließ sie in Ketten arbeiten und nachts vor dem Stationsbau schlafen. Er stellte Posten aus; solange Katenere lebte, fühlte er sich gehetzt.“ „Eines Nachts erspähte dieser Posten den Schatten eines Mannes, der die Station umschlich. Er weckte einen anderen Muchacho, die beiden pirschten sich hinaus und sahen im blas sen Mondlicht einen nackten Indianer, der wie gebannt in den Hof spähte, so starr und sehnsuchtsvoll, daß er die Feinde nicht nahen hörte. Vielleicht schlug sein Herz so laut, daß ihn die gefesselte Frau, zwanzig Schritte vor ihm, wahrnahm und in ihrem Elend diesen Trost erfuhr: .Katenere ist dal Er lebt, mein Gatte lebtl* Vielleicht vernahm er selbst den Herz schlag seiner Frau und hörte deshalb die Schritte der Feinde nicht.“ „Dann knallten Schüsse, der nackte Mann schoß zurück, einer der Muchachos fiel, dann fiel er selbst.“ „Und war tot?" „Jawohl, Herr. Vasquez ließ den Leichnam vor den Augen seiner Frau köpfen und zerstückeln. Rumpf und Glieder wur den begraben. Aber nicht der Kopf. Den behielt Vasquez als ein Zeichen dafür, daß der Weiße stärker ist als alle seine Feinde.“ 153
Sechzehntes Kapitel Die Regierungen von Peru und den Nachbarrepubliken des Putumayo hatten in einem Land, auf dessen Herrschaft sie Anspruch erhoben, ein Inferno entstehen lassen, das zum Him mel stank. Aber ihre Machtbefugnisse waren nicht deutlich ab gesteckt, für sie gab es ein Mauseloch, moralisch zu entwischen. Die Peruanische Amazonas-Gesellschaft hatte Gummi aus dem Putumayo holen lassen und große Gewinne an ihre Aktio näre verteilt, ohne sich um das Los derer zu kümmern, die für sie schafften. Aber die Aktionäre selbst protestierten, als Hardenberg die ersten Notschreie der Indianer in ihre Ohren gellen ließ, und es spricht immerhin für die Leiter der Amazonas-Gesellschaft, daß sie eine Kommission in den Putu mayo entsandten. Mindestens retteten sie sich damit vor der Verdammnis ihrer Zeitgenossen und handelten würdiger als wenige Jahre zuvor der König der Belgier, indem sie Roger Casements Recherche unterstützten und seiner Person nach Kräften Sicherheit boten. Die Muchachos aus Barbados hatten Hekatomben von Men schen geschlachtet und mit der Peitsche gearbeitet wie Bauern auf der Tenne. Aber sie waren selbst hilflose Neger, durch Generationen versklavt, und sie nahmen die erste Gelegenheit wahr, durch offenes Bekenntnis ihre Seelen rein zu waschen. Aber diese Männer aus Hidalgoblut, Weiße und Katholiken, diese Fonseka, Aguero, Jiménez und wie sie alle hießen mit Geldgier allein ist ihr Wüten nicht erklärt und entschul digt, wenn selbst Geldgier als stärkster Impuls menschlicher Kreatur gelten und jede Untat erklären würde. Kerker und Todesdrohung waren ihnen zuerst Mittel gewesen, um ihren Zweck zu erreichen, aber sie hatten längst den Zweck über dem Mittel vergessen, die Arme gelähmt, die für sie schaffen konnten, die Mütter erwürgt, die ihnen Arbeitet* geboren hät ten. Wie es Goldrausch gibt, der die Sinne umnebelt, so gibt es Blutrausch. Auch er kann epidemisch werden, und es scheint durch den Fall der Berserker von Putumayo bewiesen, daß er der stärkere ist. Menschen, denen das Röcheln ver blutender Mütter und das Wimmern verschmachtender Säug154
linge Ohrenschmaus ist, Menschen, die den Geruch von damp fendem Menschenblut mit Lust atmen - das gab es, das lebte und lachte, das streckte einem Roger Casement die haarige Tatze entgegen und begrüßte ihn: „Muy buenas, SeñorI" Ihm blieb nichts erspart, es blieb ihm nicht erspart, mit diesen Caballeros der Unterwelt an einem Tisch zu sitzen, als ihr Gast unter einem Dach mit ihnen zu schlafen, weil es keinen anderen Tisch und kein anderes Dach gab, weil er essen und schlafen mußte, um seine Aufgabe ganz zu lösen. Er saß einem Menschen namens Normand, einem Bolivianer, der in England erzogen worden war, gegenüber, der ein Tischgebet sprach und das Kreuz schlug - in Casements Akten lag Mate rial gegen diesen Mann zum Beweis, daß er mit eigener Hand Hunderte, Hunderte von Indianern getötet hatte nach Martern seiner eigensten Erfindung. Er hatte ein Weib in Stücke ge schlagen, weil sie sich weigerte, einem seiner Diener zu fol gen, dem er sie geschenkt hatte. Er hatte einen Häuptling vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder lebendig ver brannt, dann die Frau geköpft und die Kinder zerstückelt. Diese Leute machten kein Geheimnis aus ihrer Praxis. „Mit Güte kommt man bei diesem Volk nicht immer aus“, sagten sie heiter. „Ganz ohne Strafen geht es nicht.“ Dabei beriefen sie sich einer auf den anderen. „Der hat es versucht, aber bald ist ihm das Gesindel auf der Nase herum getanzt.“ Casement hörte ihnen zu, undurchdringlich war sein Ge sicht, und grub ihre Worte in sein Gedächtnis. Auf manchen Stationen war der Koch im Nebenamt Peit schenmeister, zwei von ihnen wurden Casement als solche vorgestellt. Er schrieb in sein Tagebuch: „Ich aß die Speisen, die sie gekocht hatten, und ihre Opfer schleppten mein Gepäck von Station zu Station. Ich sah auf ihren nackten Gliedern die schrecklichen Narben, die diese Männer ihnen zugefügt hatten." Er sah es mit eigenen Augen, wie eine Indianerfrau, eine Witwe, die als Dienerin auf einer Station war, von Aguero gepackt und in seinen Harem geschleppt wurde, um das Dut zend seiner Lustsklavinnen vollzumachen. Sie schrie und weinte, «55
niemand erbarmte sich ihrer. Auch Casement konnte nicht helfen, er war nur in Vertretung englischer Untertanen zum Handeln berechtigt. Die Peitsche war durch Generalerlaß kurz vor seiner An kunft verboten worden. Aber er sah trotzdem Gesäße mit offenen, blutenden Wunden und versuchte, aus den Vorräten seiner Reiseapotheke Schmerzen zu lindern. Seit dem Verbot wurde mit der flachen Klinge der Machete gepeitscht. Er begleitete zwei Tage lang eine Karawane von Trägern, die Gummilasten aus dem Wald zum Flußdampfer trugen. Die Sonne brannte, die Durchschnittslast wog fünfzig bis sieb zig Kilogramm, es wurde täglich zwölf Stunden lang mar schiert. Voran zogen bewaffnete Muchachos, dann kamen Trupps von Männern, Frauen, Kindern, ganz kleine Mädchen darunter, die nichts tragen konnten als ein Stück Cassavabrot, das ihre Mütter tags zuvor gebacken hatten und das für eine Reise von im ganzen hundertundzehn Kilometern die einzige Nahrung dieser Familie war. Der Pfad, den sie zogen, war so schlecht, daß auch ein unbelasteter, tüchtiger Fußgänger schwer mit ihnen Schritt hielt. Zwischen den Trupps gingen abermals Muchachos, den Schluß machte mit seiner Leibgarde jener Mordbube Normand, ein Bolivianer, der in England aufgewachsen war. Er sah viele von diesen Leuten auf dem Rückmarsch in ihren zerfallenen Hütten, fußkrank, matt zum Sterben. Ihr bißchen Brot war längst verzehrt, sie nährten sich von Wurzeln und Blättern, sie brachen Zweige nieder und kauten Holz, sie schlugen ihre Zähne in die Rinde von Bäumen und füllten ihre Mägen mit Holzmehl. An manchen Plätzen, wo sie gelagert hatten, war der Fußweg versperrt von Zweigen und Ranken, als hätten wilde Tiere hier gehaust. Das waren „Señor Nor mands Indianer“ bei ihrer Mahlzeit gewesen. Er hörte, daß die Peruaner mit ihren Muchachos Sklaven jagden über die bolivianische Grenze hinaus gemacht hatten, weil ihr Arbeiterstamm „aufgefrischt“ werden mußte. Von einer dieser Jagden hatten sie aus Versehen drei weiße Män ner mitgebracht, die unter den Indios lebten.
156
Wie würde das Strafgericht ausfallen, das seine Anklage über den Häuptern dieser Höllengarde entfesselte? Casement prüfte die Kontobücher der Gesellschaft - sie waren alle im Vorschuß, hatten längst ihre Gewinne in Sicherheit gebracht. Wenn der Tag der Verantwortung kam, würde kein Verant wortlicher mehr auffindbar sein. Nur einer, aber das war der schlimmste aller Teufel, Armando Normand, stand mit vierunddreißigtausend Mark Guthaben in den Büchern. Er war entlassen, aber sein Konto war gesperrt I Der würde vielleicht vor Gericht erscheinen, „auspacken“ und zu seiner Verteidigung andere belasten.
Auf der Fahrt von Pari nach Cherbourg sichtete Roger Casement sein Anklagematerial wie vor wenig Jahren auf der Reise von der Kongomündung nach London. Ein Europäer in Iquitos, der den Putumayodistrikt kannte, hatte zu ihm gesagt: „So etwa fünf Jahre, schätze ich, wird es dort noch Indianer geben ...“ Selbst wenn sich jetzt schon manches bessern mochte - denn die Peru-Amazonas-Gesellschaft konnte sich nicht länger unwissend stellen -, tat doch Hilfe so dringend not, als loderte das ganze Land in Flam men. Fünf Jahre war keine lange Frist, aber wahrscheinlich doch eine optimistische Schätzung. Während der letzten sechs Jahre war Putumayogummi im Wert von ziemlich genau achtzehn Millionen Mark auf den Londoner Markt gekommen, an Gewicht viertausend Tonnen. Eine englische Gesellschaft hatte die Ware auf englischen Schiffen nach London gebracht - das Paradies des Teufels war eine Sache, die England betraf. Die Zahl von Indianern, die während dieser sechs Jahre verhungert, erschossen, ersäuft, zu Tode gemartert worden waren, betrug mit Frauen und Kindern - „kein Alter und Ge schlecht war verschont geblieben“ - etwa vierzigtausend, denn auf fünfzigtausend Köpfe hatte der peruanische General konsul in Manaos im Jahre 1906 die Bevölkerung geschätzt, und auf achttausend schätzte man sie jetzt, zu Beginn des Jahres 1911. Zugleich aber war die Produktion von 645000 Kilo im Jahre 1906 auf 236000 im letzten Jahre gefallen. Es 157
ließ sich leicht errechnen, daß jede Tonne Gummi das Leben von sieben Menschen gekostet hatte. So stand jedes einzelne Indianerleben in dieser Verrechnung mit einem Reinertrag von etwa drei Pfund Sterling zu Buche.
Siebzehntes Kapitel Seit Casements brennende Wahrheitsliebe die ganze Vertuschungs- und Verleumdungskunst eines regierenden Königs zunichte gemacht -hatte, wagte keine Seele in Europa, an der Heiligkeit seines Wortes zu zweifeln. Aber was geschah jetzt, da sein Zeugnis die gräßlichen Gerüchte über den Putumayo in noch viel gräßlichere Wahrheit verwandelt hatte, jetzt, da die Regierungen wußten, daß im Jahre 1910 christlicher Kul tur in einem christlich-katholisch beherrschten Lande gefoltert, verbrannt, ersäuft, genotzüchtigt wurde wie kaum im Dreißig jährigen Krieg, wie kaum in den verfluchten Tagen der spa nischen Besitzergreifung von Mittelamerika, wie kaum in Asien unter Dschingis-Khans Horden? Wurden die Menschenvernichter in Eisen gelegt und zum Hochgerichte geschleppt? Eilten Kolonnen des Roten Kreuzes, eilten Missionen der christlichen Kirchen und der Kirche der Menschlichkeit in das blutgetränkte Land, um Wunden zu heilen, Nahrung zu spenden, Spaten und Saatgut zu verteilen, die Wilden zu lehren, daß es so etwas gibt wie christliches Gewissen? China hatte einen Sühneprinzen kaiserlichen Blutes nach Berlin gesandt, der sich tief in den Staub beugte, um gutzumachen, was ein paar Fanatiker seines Volkes gegen deutsche Vertreter gesündigt hatten - sandte die Gemeinschaft der Weißen einen Sühneträger nach Putumayo, der die acht tausend Überlebenden von fünfzigtausend zu Tode Gequälten demütig um Vergebung bat? Es geschah, daß das Londoner Ministerium des Auswärti gen seinen Botschafter in Lima anwies, die peruanische Regie rung „vertraulich und freundschaftlich" zu bitten, sie wolle die Schuldigen ihrer Strafe zuführen und die Fortdauer oder
158
Wiederaufnahme von Roheiten im Indianergebiet verhin dern ... Es geschah, daß vier Wochen später die peruanische Regie rung dem Londoner Ministerium Bescheid gab, sie habe eine gerichtliche Untersuchungskommission ernannt, die in weiteren vier Wochen ihre Tätigkeit beginnen würde. Es geschah, daß die schlimmsten Verbrecher auf Roger Casements schwarzer Liste zwar den Putumayo verlassen und sich in Iquitos zur Verfügung der Behörde halten mußten, aber mit vollen Taschen dort spazierengingen, ohne zu fürch ten, daß ihnen ein Haar gekrümmt werde; daß einer von ihnen sich frisch bewaffnet in ein anderes Indianerterritorium begab, um dort zu brennen und zu morden, hoffend, die Indianer in Caqueta würden durch einen Aufstand'das Inter esse von Putumayo ablenken. Es geschah, daß die Peru-Amazonas-Gesellschaft ihr Agen tenstatut änderte. Die Leute bekamen offiziell jetzt feste Ge hälter statt Prozente ihrer Gummiförderung; die Geschäfts leitung versprach weitere Maßregeln zum Schutz der Indianer und „erwartete viel“ von der in Aussicht stehenden juristischen Untersuchung. Es geschah, daß zweimal soviel Monate verflossen, wie Casement für seine ganze Erkundung mit Hin- und Rückfahrt über den halben Globus gebraucht hatte, ohne daß irgend etwas geschah. Es sei denn, daß etwas geschah, als Fonseka, Aguero und ein dritter Bluthund angefangen hatten, sidi in Iquitos zu langweilen, die ritterliche Haft gebrochen hatten und über die Grenze gegangen waren. Aus dem peruanischen Gebiet hatten sie einige Dutzend Indianer verschleppt, die sie „drüben“ zu fünfzig Pfund oder tausend Mark das Stück losschlugen. Ein paar Dutzend Tausender hatten sie jetzt wieder im Sack und waren frei. Das geschah 1911. Es geschah endlich, daß Sir Edward Grey sich an die Regie rung der Vereinigten Staaten wandte, um auch einen Druck Washingtons auf Lima zu erbitten, und daß Washington die schwarze Liste Casements in Empfang nahm. Die Zeitungen brüllten, die Parlamente drängten, aber in
U9
Lima hatte man die Ruhe, kaltes Blut und warme Sonne. Im Januar 1911 hatte der kranke Roger Casement in wahnsinni ger Hast seinen endgültigen, das ganze Material erschöpfen den Bericht geschrieben und an Sir Edward Grey gesandt, am 20. Juni ging das Aktenstück in spanischer Übersetzung nach Lima. Das war alles, was zwischen Januar und Juni 1911 geschah. Inzwischen hatte Casement sich nach Irland zurückgezogen, um seine zerstörten Nerven zu pflegen und seine Malaria aus zuheilen. Aber er wußte, daß in Putumayo noch immer der Satan tobte, er hörte das Winseln und Schreien, seine Nächte waren voll von Gewissensqualen, während die Verbrecher ruhig schliefen. Er bombardierte das Ministerium mit Tele grammen und Zuschriften wie ein Querulant, er zerquälte sein Hirn, was er noch unternehmen könnte, um diesen Indianern, von deren Sprache er nichts verstanden hatte als den Ausdruck ihrer Verzweiflung, Hilfe zu bringen. Er steigerte sich in einen fanatischen Bluthaß gegen die Fonseka, Aguero, Normand und jeden einzelnen dieser Herodesse. Sein Mitleid verwan delte sich in ganz persönlichen, herrlichen, heroischen Haß. Er litt an diesem Haß, als hätte er selbst erlittene Schmach zu rächen, diesmal heilte die grüne Insel ihn nicht, sondern ge rade die Ruhe zehrte das Blut aus seinen Adern. So ging der Winter hin, der Frühling, so kam der Sommer. Im Sommer wurde Casement durch die Huld des Königs für seine Verdienste um England der persönliche Adel ver liehen. Diese Auszeichnung hat in England andere Bedeu tung, als sie etwa im kaiserlichen Deutschland hatte, wo der persönlich Geadelte sein Prädikat mit all denen teilte, die von ritterlichen Urahnen männlicher Linie stammten und selbst keinen Schatten von Verdienst aufweisen konnten. Der SirTitel ließ sich nicht erben. Casement hieß jetzt nicht mehr Generalkonsul oder Mister Casement, sondern Sir Roger, was nicht „Herr Roger“, sondern „Ritter Roger" bedeutet. Für diese Ehrung dankte Casement in einem düster-wür digen Ton, „ich empfinde tief, welche Ehre Seine Majestät mir .angedeihen läßt...", der eine Spur ironisch klingt. Ihm be-
160
deutete sie nur eins: die Regierung von Peru würde aus der Titelverleihung schließen müssen, daß England hinter ihm stand und weiter stehen müsse! Manchmal hatte er ja in die sen sechs Monaten trostlosen Wartens die Empfindung ge habt, als sei dies Telegrammewechseln leere Spiegelfechterei und als wäre er tatsächlich ganz allein in seinem Kampf. Seine Freunde in Irland glaubten nicht, daß Sir Roger das Ende dieses Kampfes erleben würde. Er war noch nicht sicbenundvierzig Jahre alt, aber ganz verbraucht, von innen her aus verzehrt, hager, fahl und sterbensmüdc. Ihn hatte schon der Tod gezeichnet. So fühlte er sich auch, aber dieser erhabene Mensch, dessen Gestalt mir immer höher und zeitloser scheint, je mehr ich mich in sein Leben vertiefe, dieser Unwahrscheinliche, Über menschliche fragte nicht: „Wie verlängere ich die Zahl meiner Tage?“, sondern „Wie nütze ich diese letzten, die mir bleiben, für meine Schützlinge?“ Anfang Juli begann Grey, den Peruanern zu drohen, er werde Sir Roger Casements Rapport als Weißbuch seiner Regierung vollinhaltlich veröffentlichen, wenn die Verbrecher von Putumayo nicht endlich arretiert und vor Gericht gestellt würden - Casements Rapport, den er mit Blut und Tränen im Januar dieses Jahres geschrieben hatte! Was konnte diese Drohung anderes erreichen als neue Notenwechsel und neue Verschleppung? Nicht einmal sein wiederholtes Flehen war er hört worden, man möge katholische Missionare ins Paradies des Teufels schicken. Mitte Juli kam die Antwort aus Lima und klang wörtlich, wie er sie erwartet hatte: Der Richter Paredes habe eineh dreizehnhundert Seiten lan gen Bericht erstattet und so viele Arrestbefehle erlassen, daß das Gefängnis von Iquitos zu klein sein würde, die Arrestan ten zu fassen, wenn - man sie hätte ... War das Hohn? Hieß das, Peru wollte erst die Gefängnisse bauen, um seine Verbrecher einzusperren, auf deren Spur Roger Casement sich fast zu Tode gehetzt hatte? Ja, das war Hohn, derselbe Hohn, der vor sechs Jahren aus der Note König Leopolds klang: „Die Kongoneger fühlen sich auf der Basis n
Paradiese
161
freiwillig geschlossener Verträge glücklicher unter seinem Regi ment als die Eingeborenen irgendeines anderem Schutzstaates.“ Sir Roger hatte noch Kraft genug, diesem blutigen Spott zu begegnen! Er mußte selbst noch einmal ins Paradies des Teufels, in die Fiebersümpfe, er mußte noch einmal den Gif ten und Dolchen seiner Todfeinde trotzen, dem bedenken losesten und im Mord bestgeübten Abschaum aller Verbre cher der Welt. Sir Edward Grey gab seinem wütenden Drän gen nach, am i. Oktober traf Sir Roger abermals in Iquitos ein, genau ein Jahr, seit er zum ersten Male diesen vergifteten Boden betreten hatte.
Schon auf dem Amazonas hörte er: Fonseka und Alfredo Montt zapften ihren Gummi jetzt auf brasilianischem Boden. Ihre Knechte waren Indianer, die sie aus dem Putumayo ver schleppt hatten. Die von Casement angerufenen Bemühungen der brasilianischen Regierung, sie zu vertreiben, scheiterten an der Unzulänglichkeit ihrer Verstecke. Von zweihundertsiebenunddreißig in Iquitos erlassenen Arrestbefehlen waren neun ausgeführt worden. Unter den Arrestanten war ein ernstlich Kompromittierter, die anderen acht waren kleine Angestellte und armes Werkzeug in den Hän den ihrer Chefs gewesen. Aber auch gegen diese neun konnte nach peruanischem Recht erst verhandelt werden, wenn die fehlenden zweihundertachtundzwanzig verhaftet waren. Viele von ihnen waren Barbados-Muchachos, die zugleich mit Case ment und mit seiner Unterstützung Putumayo für immer ver lassen hatten. Viele waren Peruaner, die nach Casements Reise entflohen und unerreichbar waren, wie Fonseka und Montt, obwohl man ihren Aufenthalt und die Schauerliste ihrer neuen Verbrechen kannte. Viele - und darunter die am schwersten Belasteten - gingen ihrem alten Handwerk nach, unangefochten, obwohl ihre Namen auf der Liste des Richters Paredes standen. Viele hielten sich gemütlich in Iquitos auf und standen mit der Polizei auf so gutem Fuße, daß der Haftbefehl sie nicht im geringsten störte. Die Lage war absolut klar: der Schock, den Roger Case162
ments Kampagne erzeugt hatte, war verflogen. Das Gesetz hatte sich als wirkungslos erwiesen, es war neu bestätigte Wahrheit, daß die Indianer rechtlos sind. Es gab ihrer noch genug, etliche tausend Tonnen Gummi zu verschiffen ... Dann würde der Spuk von selbst ein Ende nehmen, wenn ihm jetzt kein Blitz ein Ende machte. „Ich führe einen Kreuzzug durch die Vereinigten Staaten“, beschloß Sir Roger. Den letzten Rest seiner Kraft wollte er dort einsetzen, wo die Statue der Freiheit steht. Er fuhr nach Parä zurück, dann nach New York. Dort holte ihn der englische Gesandte ab, sie fuhren zusammen nach Washington, der Botschafter Englands und der Botschafter des Gewissens. Präsident Taft empfing ihnl Casement hämmerte mit aller Kraft seines Wortes auf ihn und alle Großen des Staates ein. Er gewann im Augenblick den Zusammenschluß der Vereinigten Staaten mit England. Endlich sollte sein Putumayo-Rapport als Blaubuch der Regierung gedruckt, veröffent licht, allen Kulturstaaten der Welt zugesandt werden! Die Vereinigten Staaten entsandten einen Konsul nach Iquitos, und plötzlich erfuhr die Regierung von Peru, daß sie der ganzen zivilisierten Welt einsam gegenüberstand. Casements Blaubuch, eines der furchtbarsten Dokumente der Welt geschichte, erschütterte ihren moralischen Kredit nicht nur im Ausland, sondern bis in die tiefsten Schichten des eigenen Volkes. Sie mußte handeln, und endlich gab sie den eigenen Gesetzen Kraft, strafte, reinigte. Die letzten Indios von Putumayo waren gerettet, ihr Retter kehrte wie ein Gespenst in die Heimat zurück. Von ihm er wartete niemand mehr anderes als. den Tod an Erschöpfung, den Greisentod eines noch nicht Fünfzigjährigen. Er hatte ge geben, was an Kraft und Leben in ihm war, jetzt schien er am Ende. Sir Roger nahm seinen Abschied aus den Diensten Englands, dem er auf seinem Feld so viel Ehre gemacht hatte wie Nelson und Kitchener auf dem ihren, und wurde huldvoll entlassen. Sein Ruhegehalt betrug sechstausend Mark das Jahr, er würde es - glaubten viele - nicht lange in Anspruch nehmen. ii'
i6j
Und doch war ihm ein drittes Paradies des Teufels, ein drit ter Kampf, beschieden, und erst den dritten glorreichen Sieg seines Lebens sollte er mit dem Tode am Galgen bezahlen.
Achtzehntes Kapitel Als Casements Denkschrift über den Putumayo endlich als Blaubuch der englischen Regierung verbreitet wurde, läuteten ihm, dem Ritter ohne Furcht und Tadel, zum zweitenmal alle Glocken des Ruhmes! Der Name dieses Todkranken leuch tete überall unter den besten Namen der Zeitgeschichte, und trotz seiner Pensionierung zählte man Sir Roger weiter zu den Säulen des englischen Staates. Er mochte rasten und sich er holen, solange es ihm nötig schien, wenn er mit fünfzig oder zweiundfünfzig Jahren wieder nach Tätigkeit verlangte, wür den die wichtigsten Plätze ihm offenstehen. Sir Roger aber zürnte der Regierung, war tief zerfallen mit dem Ministerium des Auswärtigen und seinem alten Bewun derer Sir Edward Grey. Wie unsagbar schwer war es diesmal gewesen, diesen Motor anzuwerfen, wie sinnlos lang hatte man Peru nur den warnenden Finger gezeigt, statt sofort das Blaubuch zu zücken, diese von ihm geschmiedete furchtbare Waffe! Ein ganzes Jahr noch hatte man Kugel und Peitsche durch den Putumayo rasen lassen, als diese größte Schmach des Jahrhunderts schon klar erkannt war. Warum fürchtete sich England vor Peru? Weil dort ein englisches Riesenvermögen investiert war. In der gesamten Gummi-Industrie arbeiteten hundertfünfzig Millionen Pfund Sterling, die zehn bis fünfundzwanzig Prozent Dividende tru gen ... Um die Welt dieser Interessen nicht zu beunruhigen, ein Kapital nicht zu gefährden, das unter der Flagge Perus Blut und Schweiß der Indianer nach England pumpte, hatte der britische Löwe sich schmiegsam und geduldig gezeigt. „Was ist entscheidend, Christentum oder Dividenden?“ hatte Casement immer wieder gefragt, und die Antwort war Sir Edward Grey im Munde steckengeblieben, bis Casement Amerika zum Verbündeten gewonnen hatte. Daß seine letzte Kraft sich in 164
diesem Kampf gegen zwei Fronten zerrieben hatte, warf Sir Roger nicht in die Waagschale, aber daß nach seinem Feldzug noch Tausende von Indianern unnütz Opfer der Bestialität geworden, das verzieh er England nidit. Man hat später, als er den Iren offenen Kampf gegen Eng land predigte, ihren Aufruhr organisierte und sich selbst zum Martyrium drängte, behauptet, Sir Roger sei geistig zerrüttet aus dem Paradies des Teufels nach Hause gekommen. Wohl wollende hatten geltend gemacht, so wie er handle nur ein Besessener. Aber alle Taten dieses Bayard sind von einem Geiste er füllt, sein ganzes Leben hat ein immer gleiches Gefühl gerad linig gesteuert. So ist er immer ein Besessener gewesen, oder er ist auch in die letzte Phase seines Daseins als Weiser ge gangen. Als der Putumayo-Handel abgeschlossen war, hatte er die Absicht, nach Südafrika zu fahren und in der Stille des „Gro ßen Karu“ sein Herz zu prüfen, Gerichtstag über das eigene Ich zu halten. Er kam nicht mehr dazu. Er erkannte plötzlich, daß er nicht Herr über seine Zeit war, sondern schon am ersten Tag seiner Freiheit vom Amt der Bewegung Sinn Fein dienen mußte, der er sich gelobt hatte. So kehrte er nach Irland zurück, um ein Sinnfeiner zu wer den, irischer Nationalist, dessen Ziel es war, die grüne Insel von England loszureißen, ihre eigene Politik und eigene Wirt schaft zu erkämpfen. Wurde dieser Weltbürger Nationalist? Todfeinde . seiner Bewegung waren die protestantischen Ulsterleute im Norden Irlands, und gerade dieser Landsmann schaft entstammte Casement, in ihrem zelotischen Glauben, in ihrer Treue zu England war er erzogen worden. Als „Natio nalist“ hätte er gerade im Sinn-Fein-Lager nichts zu suchen gehabt. Sein „Wahnsinn“ bestand in nichts anderem, als daß er von den Unterdrückern zu den Unterdrückten übertrat, von den Machthabern zu den Geknechteten - er machte sich die Sache der Iren zu eigen wie einst die Sache der Kongoneger und später die der Indianer. „Wo es Starke gibt, immer auf der Seite der Schwachen“ - das war sein Nationalismus.
165
Er war übrigens nicht der einzige Sinnfeiner, den Begeiste rung, nicht Blut und Herkunft, zum irischen Nationalisten ge macht hatte. De Valera, heute Präsident der irischen Republik, damals Vorkämpfer des Sinn Fein, ist halb spanischen Blutes, die Gräfin Markiewicz, die in Barrikadenkämpfen, im Kerker, in Hungerstreiks ihr Leben ganz der irischen Sache geopfert hat, war halbe Engländerin von Blut, Polin durch ihre Heirat. Sir Roger hielt sich zurück, wie ein Spieler die höchste Trumpfkarte zurückhält, bis die Entscheidung nahe scheint. Dieser Moment trat 1912 ein. 1912 spürte und wußte er aus geheimnisvollem Ahnungsvermögen, daß der Weltkrieg vor der Tür stand und daß Irlands Schicksal sich in diesem Krieg entscheiden würde. In dieser Stunde trat er hervor, um zu lehren, wo Irlands Stellung sein müßte, neben England oder gegen England. Klarer kann kein Handeln sein, und klarer als Casement hat auch nie ein Mensch über seine Schritte Rechenschaft ab gelegt. In einem Brief an die „Times" schrieb er bald danach: „Ihr Korrespondent war so liebenswürdig, mich als einen Mann zu bezeichnen, der Weltbürgertum mit einem leiden schaftlichen Hang zu romantischem Nationalismus vereint." „Es war zweifellos ein leidenschaftlicher Hang zu roman tischer Humanität, der mich den Kongo und den Amazonen strom hinaufführte, ohne diese Eigenschaft hätte ich die Unter suchungen nicht führen können, die allein zu führen mir in beiden Regionen bestimmt war.“ „Was die Menschheit verloren hat, als ich ein Ulster-Narr oder Phantast wurde, mag die Mitwelt entscheiden.“ „Ich aber darf sagen: was mir immer vergönnt war, in fremden Ländern an Gutem zu tun, verdanke ich Irland! Ich kannte nicht nur seine heutige Lage, sondern auch die ge schichtlichen Ursachen, die sie bedingt haben. Nur von dort her kam das Licht, in dem ich die Welt sah, und das mich befähigte, Menschenqual zu erkennen und mitzuempfinden, die, wie auch die Umgebung wirken mag, bedingt sind durch den alten und weitverbreiteten Hang, menschliche Kraft auszu keltern. Einen Hang, dem zivilisierte Völker nicht nur gegen Wilde und Barbaren nachgeben." 166
„Sie werden zugeben, daß eine umfassende Kenntnis der Welt sich sehr wohl verträgt mit einer tiefen und innigen Be ziehung zu den Dingen, zwischen denen man geboren und auf gezogen wurde. Ich bin nach Geburt und Erziehung ein Ulster mann, wenn auch sehr unähnlich denen, die im englischen Parlament sitzen.“ Noch fühlte Casement sich krank und müde, aber um ihn rauschte es von neuen Formationen wilder Begeisterung, nach langer Friedhofsruhe erwachte das junge Irland. „Ich bin zu alt, liebe Jugend", schrieb Sir Roger an einen seiner Schüler, „um ein politischer Führer zu sein, auch habe ich für meine Person gar keinen Ehrgeiz. Wäre ich zwanzig Jahre jünger, oh, dann wollte ich mich ins Gewühl Stürzen I“ Wenige Tage nach diesem Brief erschien er in einer Ver sammlung, und sein altes Temperament riß ihn mit. Er sprach, rief die protestantischen Ulsterleute zur Teilnahme an der irischen Sache auf, die eine Menschheitssache sei, schleuderte Brände gegen diejenigen, die als Iren auf den Bänken der englischen Konservativen saßen. Von da an hatte ihn die Be wegung ganz, er sprach, er schrieb, und das Feuer seines Wor tes spottete der Behauptung, daß er ein müder, alter Mann sei. „Nie hat ein unterworfenes Volk die Freiheit als Geschenk zurückerhalten; immer mußte sie erobert werden. Nie kam die Freiheit zu einem Volk, das sein Blut nicht opfern wollte! Nur durch seine Todesbereitschaft kann Irland leben!“ Das erste revolutionäre Amt, das Sir Roger annahm, war die Verwaltung eines Schatzes zum Ankauf von Uniformen und Wallen. Ulster hatte seine freiwilligen Garden, nun stellte das „grüne“ Irland sie gleichfalls auf. Im Oktober 1913 fand in Dublin eine Versammlung statt, zu der Tausende drängten: das irische Freikorps wurde organi siert. Viertausend Rekruten verpflichteten sich, sofort die Waf fenübung zu beginnen. Casement schäumte in einer seltsamen neuen Jugend, er agitierte, trat in gegnerischen Versammlungen auf, in der man Stuhlbeine nach ihm warf, korrespondierte mit Deutschland und den irischen Organisationen in Amerika, er brannte vor. Tatenlust. Der Hafen Queenstown, die zweitgrößte Stadt Irlands, 167
wurde seit langem von der englischen Schiffahrt boykottiert. Casement schrieb an Albert Ballin, die Hamburg-AmerikaLinie möchte wöchentlich einen ausfahrenden und einen rück kehrenden Amerika-Dampfer in Queenstown anlaufen lassen. Er schrieb an die deutsche Regierung und entwarf seine An sichten über die Rolle Irlands im kommenden Krieg: der Sieg Deutschlands müsse es unabhängig und souverän machen, seine Haltung während des Krieges könnte nur auf dieses Ziel ge richtet sein. Ein freies, starkes Irland aber würde eine Garantie für die Befreiung der Meere vom englischen Regiment sein. Aber wenige Tage nach der großen Rekrutierungsversamm lung erließ die englische Regierung eine Proklamation, die jede Waffeneinfuhr in ganz Irland verbot. Wenige Tage, nach dem Ballin versprochen hatte, den Dampfer „Hamburg“ als Er öffnung der neuen Verbindung am 6. Januar in Queenstown an laufen zu lassen, mußte er sein Versprechen wieder zurückziehen. Es war selbstverständlich, daß nur der Druck Englands den für beide Partner aussichtsreichen Pakt zerschlagen hatte. Aus Cascments politischer Anti-England-Haltung wurde zorniger Haß. „Die Enthüllung der Queenstown-Schändlichkeit ist an sich nur etwas Geringes. Aber welche Aussichten!" schrieb er einem Freund. „Ein großes Tor öffnet sich, und mit Gottes Hilfe ge denke ich, cs weit offcnzuhalten. Diesen Kampf werde ich, beim Himmel, weiter treiben, als sie in Downing Street den ken, bis zu einer Entscheidung, vor der sie zittern mögen. Für diese Diplomatie werden sie mir bezahlen! Unser ganzes Volk soll jetzt anfangen zu denken, freie Menschen-, nicht Sklaven gedanken. Denn die Lösung ist nur in unsere Hände gegeben. An dem Tag, an dem wir die Freiheit wollen, erringen wir sie auch. Seien Sie dessen sicher: England versklavt uns nicht, es behandelt uns nur als Sklaven, solange wir Sklaven sind.“ „Ich bin in großer Eile, ich habe viel zu tun und gehe in wenigen Wochen an meine große Aufgabe. Glauben wir an uns selbst! Feuern Sic jeden Mann in Cork an, ein Kämpfer im härtesten Sinne des Wortes zu werden! Den Tod statt der Schande zu wählen! Lieber zu sterben, als unter dem schänd lichsten Joch der Ausbeutung zu leben, das ein imperialisti sches Regime je errichtet hat.“
168
„Ich schaffe auch die Waffen, keine Angst! Ich bewaffne fünfzigtausend Mann, stellt Ihr mir die Männer bereit.“ An jenem Tage aber standen schon hunderttausend Frei willige auf den Übungsplätzen. Bald darauf fand in London eine geheime Zusammenkunft statt zwischen Ulsterleuten und Sinnfeinern, zu der auch Casement delegiert war. Es wurde über Möglichkeit und Taktik eines gemeinsamen Kampfes diskutiert, Casement sah nur ein Problem, die Einfuhr von Waffen. Der Weg, sie ins Land zu schmuggeln, war nicht schwer zu finden, nur um die Mittel zum Ankauf handelte es sich. Für die erste Lieferung sollten drei ßigtausend Mark flüssig gemacht werden, die Hälfte wurde sofort gezeichnet. Die andere Hälfte brachte Roger Casement in wenigen Tagen auf, er ging als Bittsteller von einem Haus seiner Freunde zum anderen. Ein Teilnehmer jener Verschwörung schilderte später den grauen Nachmittag an der Themse, an dem Nebel wie eine graue Mauer vor den Fenstern standen: „Von diesem Aspekt hob Sir Roger Casement sich ab, der ganze Mensch im Fieber! Auf seinen Zügen lag jener Aus druck stolz getragener Schwermut, als hätte er alles Leid der Welt auf sich genommen. Ich sah sein Gesicht im Profil, sein schönes Haupt wie einen Scherenschnitt vor den lichtgrauen Nebeln. Seine Riesengestalt schien noch gebieterischer als sonst, der schwarze Bart und das gewellte Haar schienen noch länger. Das linke Bein hatte er vorgestellt, im Stiefel klaffte vorn ein großes Loch. Er gab ja alles fort, was er besaß, gerade er, der seiner Gesundheit nichts zumuten durfte. Als ich sprach, verließ er seinen Platz am Fenster und schritt lang sam auf mich zu, das Gesicht durchleuchtet von Kampfeslust.“ Am 2. Juli 1914 schiffte sich Casement zweiter Klasse nach Amerika ein, als Herr Casement und nicht als Sir Roger. Seine „große Aufgabe“ begann. Es galt, die amerikanischen Iren für den Sinn Fein zu gewinnen. Sic, von Not und Hunger aus der Heimat vertrieben, hatten drüben vieles erreicht, sie hielten zusammen wie Rost und Eisen und bedeuteten eine gewaltige Macht.
169
Neunzehntes Kapitel Als Auswanderer hatte Casement sich an Bord des Dampfers „Kassandra“ nach Kanada geschmuggelt, aber diese Ausreise wäre kaum geglückt, wenn die englische Regierung ihn und das ganze irische Problem damals schon ernst genommen hätte. Wenige Monate später mußte sie - zu Beginn des Weltkrie ges! - dieses Sir Roger und seiner Agitation wegen die eng lische Garnison in Irland von zwanzigtausend auf sechzig tausend Mann ihrer besten Truppen erhöhen. Damals mag ihr der Mann, der - eben zum Ritter der englischen Krone geschlagen - den Abfall seines Heimat landes gegen diese Krone predigte, als ein harmloser Sektierer erschienen sein, den beobachten zu lassen nützlich schien, der aber um keinen Preis zum Märtyrer werden durfte. Ihn ver haften, ihm den Prozeß machen - das hätte Sir Roger gepaßt, das wäre Propaganda für seine Ziele gewesen, in Irland und jedem Winkel der Welt, in dem England über andere Völker herrschte! Seine Reden und Schriften allein würden keinen Stein aus der britischen Krone brechen I So reiste Casement unangefochten nach Kanada und genoß die Fahrt, die erste Nordlandfahrt des Vielgereisten. Er sah schwimmende Eisberge, die ersten Naturwunder seines Le bens, die alles Erwartete übertrafen. „Gleich arktischen Palästen, oft grün, golden, kristallen oder blendend weiß wie aus fest gefügtem Schnee, segelten sie an uns vorüber, ihrem Schicksal, dem Golfstrom, entgegen.“ Er dachte, während auch er geruhig seinem Schicksal ent gegensegelte, über einen Bericht seines Lebens nach, den er einmal schreiben würde, den Roman des „aufrührerischen, tollen Iren“, der „im Gewand eines britischen Beamten, aber mit der Seele des irischen Rebellen“ Erdteile durchforscht hatte. „Hätten die Engländer meine innersten Gedanken und die Impulse gekannt, die mich zu allen Taten drängten, auf die sie stolz waren, dann hätte ihre Presse meinen .Heldenmut* und meine ,Ritterlichkeit* kaum so laut gepriesen, wie sie es damals tat. Jener entwurzelte Patriot T. P. O. hätte mich bei den Wahlen in Reading nicht .eine der höchstragenden
170
Gestalten in det Geschichte des britischen Imperiums* ge nannt.“ In New York führte Casements erster Weg zur Redaktion des „Irischen Amerikaners“, einer wichtigen Zeitung, auf die er sich stützen wollte. Jetzt hatte er seinen Kampfplatz erreicht, jetzt war keine Stunde mehr zu verlieren. In diesen Tagen mußte die Privatjacht, die er nach Deutschland entsandt hatte, um Gewehre zu kaufen, mit ihrer kostbaren Fracht in dem versteckten irischen Hafen Howth eintreffen. Nun sollten seine Freiwilligenbataillone die Waffen führen und damit ein neues Kapitel in der Geschichte Irlands beginnen. Wenn der Krieg kam, den Casement als ein unvermeidbares Faktum ansah, mußte Irland bewaffnet sein und sich neutral erklären! Soviel Blut, Ströme von Blut, hatten seine Lands leute Jahrhunderte hindurch für Englands Politik vergossen diesmal sollte es einem Kampf fernbleiben, der „ihre Ehre und Vaterlandsliebe nichts anging“. Die erste Versammlung, in der Roger Casement wenige Tage nach seiner Ankunft sprach, fand in Norfolk im Staate Virginia statt. „Die ganze Stadt war mit grünen Fahnen und Sternenbannern beflaggt. Man sah nur irische und amerika nische Farben.“ Wenige Tage nach dieser Eröffnung seiner Kampagne Helen die Schüsse von Sarajevo, und nun war bald keine Stunde mehr ohne furchtbar deutliche Merkmale, daß Roger Casement ein Prophet war, auf dessen Gesichte man bauen konnte. Der Krieg kam, den keiner wollte, er wälzte sich über den Globus, in Irland wie in Indien, in Ägypten und in Südafrika wurden Soldaten geworben und Blutopfer gefordert. Zwei Jahre lang hatte Casement sein Volk auf diese Stunde vorbereitet und ihm gezeigt, welchen Weg es zu gehen hatte, in letzter Stunde hatte er ihm Waffen geliefert, um seine Ruhe zu verteidigen. Denn das Schiff mit Mausergewehren war richtig in Howth gelandet! Die Behörden hatten Lunte gerochen, sie wollten die Verteilung der Gewehre verhindern, nachdem sie wenige Monate zuvor ruhig zugesehen hatten, wie die Ulsterleute unter gesetzlich ganz gleichen Bedingungen ein Schiff mit Waf fenladung gelöscht hatten. Aber die Intervention kam zu spät, 171
als britische Soldaten in Howth erschienen, hatten die Frei willigen ihre Mauserflinten schon im Arm und ließen sie «ich nicht mehr entreißen. Es war zu einer Schießerei gekommen, es hatte einige Tote gegeben, die ersten Opfer der Friedens kampagne. Diese Nachrichten erhielt Roger Casement in Philadelphia, im Kreise irischer Gesinnungsgenossen. Ein großes Protest meeting wurde auf den nächsten Sonntag einberufen, der Hauptredner war Casement, das Thema: „Die Opfer von Howth“. Ende Juli 1914 erregte diese Schießerei in einem irischen Hafenstädtchen die Gemüter der Amerikaner, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers dagegen erschien ihnen als ein alltägliches Balkan-Abenteuer. So war Casements Hotel von Reportern und Photographen belagert, sein Bild, seine Interviews erschienen groß aufgemacht in allen Blättern, er hatte das Ohr der Vereinigten Staaten. Aber bis zum 2. August, dem Tag der großen Protestver sammlung, raste die Weltgeschichte voran. Das Attentat in Sarajevo war plötzlich kein Balkanstreich mehr, Rußland, Deutschland, Österreich, Frankreich machten mobil. Kriegs erklärung folgte auf Kriegserklärung. Die Amerikaner glaub ten, es ginge sie nichts an, aber sie starrten dennoch mit glasi gen Augen in den Abgrund, der Europa zu verschlingen drohte. Als Casement die Tribüne betrat, um das Weltgewissen anzu rufen, weil englische Soldaten ein paar Zivilisten in Irland ge tötet hatten, war das Riesensterben, das größte Menschenster ben aller Geschichte, schon ausgebrochen, war Englands Ein treten in den Krieg schon beschlossene Sache. In jenen Tagen wurden in allen Ländern zwischen den Par teiführern Kriegsbeile vergraben und Friedenspfeifen geraucht. Wilhelm II. kannte keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, und die Deutschen vergaßen selbst, daß sie Parteien gewesen. Rote Fahnen wurden verbrannt, geschworene Kriegsgegner drängten sich in die vordersten Reihen der Kämpfer, selbst ein vor zehn Jahren erst von England besiegtes und brutalisiertes Volk, die Buren, stellte seine Jugend unter die Fahnen des
172
Todfeindes von gestern. England versprach den Iren das Recht der Selbstverwaltung, um das sie Jahrzehnte vergeblich ge beten hatten, sie sollten nur, als Gegenleistung, Freiwillige an die Front schicken. Damals wurden mit einem riesigen Schwamm tausend Schuldkonten ausgewischt, jedes Volk glaubte, ein Wunder an Einheit und innerer Größe zu er leben. Hätte Sir Roger sich damals, wie es die Führer der Oppo sition überall taten, der gemeinsamen Sache zur Verfügung ge stellt ... Ein Besuch beim englischen Botschafter in Washington, ein Telegramm nach London, dann war er wieder die leuchtende Gestalt in Englands Geschichte! Der Mann, der die Kongound Putumayo-Greuel aufgedeckt hatte, war ja so nötig, um die Kriegsgreuel der Gegner zu protokollieren! Dem Mann, der sich im Dienste der Menschlichkeit den makellosesten internationalen Namen gemacht hatte, stand jeder Botschafter-, jeder Ministerposten zur Verfügung. „In einer internen, unter geordneten Frage des Imperiums hat er wohl einmal Ansichten vertreten, die denen seiner Regierung entgegenliefen, in der Stunde der Gefahr aber..." Die Leitartikel zur Feier dieses Sünders, der Buße tat, waren ja schon in Satz. Zwei Wege taten sich vor Roger Casement auf: der eine führte über Kompromisse, die ihn nicht entehrten, auch in den Augen seiner irischen Partisanen nicht entehrt hätten, zur höch sten Stellung im britischen Reich - der andere ins Exil, in Not, vielleicht an den Galgen. Er hatte längst gewählt und schwankte auch in dieser Stunde nicht, in der die Mehrzahl aller Propheten anzubeten begann, was sie verbrannt hatten, und zu verbrennen, was sie angebetet hatten. In einem „Offenen Brief an das irische Volk“, der zugleich in Amerika und Irland erschien, brach er alle Brücken hinter sich ab. „Irland hat kein Blut zu geben für ein anderes Land, eine andere Sache als für Irland und die Sache Irlands. Unsere Pflicht als christliches Volk ist es, dem Blutvergießen fernzu bleiben: und unsere Pflicht als Iren ist es, unser Leben für Irland zu geben. Irland braucht alle seine Söhne. Während der
173
letzten 'achtundsechzig Jahre ist unsere Bevölkerung um mehr als vier Millionen gesunken, auf allen Gebieten nationalen Lebens spürt man, wie die Kraft unseres Volkes erlischt.“ Er wies die Selbstverwaltung zornig ab, die mit Irlands Teilnahme am Krieg bezahlt werden sollte, „ein Tauschhandel, den nur Narren eingehen würden“. „Nicht Deutschland war es, das die nationale Freiheit des irischen Volkes zertreten hat. Wir können sie nicht wieder erwecken, indem wir Feuer und Schwert in ein anderes Land tragen!“ Sir Edward Grey antwortete persönlich auf diese Kriegs erklärung, die unter Casements vollem Namen erschienen war: „Da Sie unter gewissen Umständen noch verpflichtet sind, dem König zu dienen, ersuche ich Sie, sich darüber zu äußern, ob Sie der Verfasser des betreffenden Briefes sind.“ „Ich verbleibe, mein Herr, Ihr gehorsamst ergebener Die ner ...“ Das klingt, als könnte der Minister es noch immer nicht fassen, daß ein Mann in Sir Rogers Stellung handeln konnte, wie er es tat; als wollte er ihm noch eine letzte goldene Brücke bauen, um heimzufinden. Mehr als zwanzig Dienstjahre in den Tropen, das entschuldigt vieles ... Aber Casement beantwortete den Brief nicht. Er ließ sich vom deutschen Botschafter in Washington, Graf Bernstorff, ein Beglaubigungsschreiben an das deutsche Mini sterium des Auswärtigen geben, verschaffte sich einen fälschten Paß und schiffte sich als „Mr. James C. Landy“, amerikani scher Nationalität, auf einem norwegischen Dampfer nach Christiania ein. Als sein Diener begleitete ihn ein junger nor wegischer Heizer, Adler Christensen, der ihm halbverhungert am ersten Abend seines Aufenthalts in Amerika in die Hände gelaufen war, dem er zuerst mit Almosen geholfen, dann eine Stellung verschafft hatte. Christensen führte seihe Kasse und verwahrte seine wichtigsten Papiere, denn Casement rechnete natürlich mit der Möglichkeit, auf dieser Fahrt in die Hände seiner Feinde zu fallen, und wirklich sollte er diesem Schick sal nur durch ein Wunder entgehen.
174
Zwanzigstes Unter falschem Namen und mit einem Paß der USA, der für einen anderen Mann ausgestellt war, glatt rasiert, in seinem Äußeren ganz auf amerikanisch zugestutzt, einen boxtüchtigen Leibgardisten zum Schutz gegen Überfälle an Bord, den er nur wenig kannte, der ihn aber ganz in der Hand hatte, sein Geheimnis wußte, seinen Kriegsschatz von zehntausend Mark, seine Papiere verwahrte - so trat Roger Casement die letzte Ozeanreise seines Lebens an, die seine abenteuerreichste wurde. An Bord des Norwegers „Oskar II.“ herrschte Spionenangst und Kriegsfieber wie auf jedem Schiff, das damals, im Ok tober 1914, das Meer befuhr. Casement saß bei Tisch dem aus Japan heimkehrenden österreichischen Gesandten gegenüber. Das hätte eine wichtige Begegnung werden können, aber es wurde von New York bis Christiania kaum ein Wort zwischen ihnen gewechselt. Er hatte kurz vor seiner Abfahrt eine hoch verräterische Broschüre „Irland, Deutschland und die Freiheit der Meere" erscheinen lassen, die sah er in den Händen des Österreichers, der, mit dem Bleistift in der Hand, jede Zeile sorgfältig las und viele Bemerkungen an den Rand schrieb... Casement war sofort eine verdächtige Gestalt, denn mit jedem Wort, das er sprach, verriet sein Akzent, daß er kern Amerikaner war. Also ein englischer Spion... folgerte man. Dann war sein Diener, der zweiter Klasse fuhr, gleichfalls; Spion! Zweifellos gaben die beiden drahtlose Telegramme auf und würden dem Norweger ein englisches Kriegsschiff auf den Hals hetzen. Dies Kriegsschiff „Lancaster“ tauchte schon am ersten Tag: auf und hielt sofort Kurs auf „Oskar II.". Aber ehe es den Befehl zu stoppen gegeben hatte, fuhren ganz nahe zwei andere Schiffe ineinander, von denen eines, der Engländer „Matapan“, tödlich gerammt wurde. Das Hinterschiff sackte im Augen blick ab, der Bug richtete sich steil in die Höhe, dann legte es sich vornüber. Seine toten Schrauben starrten in die helle Luft, und furchtbar, rasch verschwand es. Der „Lancaster'^ mußte der schiffbrüchigen Besatzung zu Hilfe eilen, Boote aus setzen, „Oskar II.“ entkam. Er wechselte seinen Kurs und
schlug einen Haken hoch nach Norden, um den Spürhunden der Weltmeere zu entgehen. Nahe der norwegischen Küste hörte Casement abermals rufen: „Ein englischer KreuzerI" Der Kreuzer fuhr im entgegengesetzten Kurs vorbei, dann wendete er und dampfte dem Handelsschiff nach. „Er wird uns gleich haben!“ dachte Casement, da donnerte auch schon ein Schuß, Rauch stieg auf, „Oskar II.“ drehte ge horsam bei und stellte seine Maschinen ab. Casement rannte in seine Kajüte, sichtete, was an seiner Habe ihn verdächtig machen konnte. Broschüren, Zeitungsaus schnitte, Tagebücher, alles flog durchs Bullauge hinaus in die stürmische See. Gleich darauf legten sich zwei vollbemannte Boote längs des Norwegers, der seine Strickleitern auswarf, Marinesolda ten kletterten auf Deck, der Dampfer war beschlagnahmt. Casement tauchte aus seiner Kajüte empor, grün und gelb. Zu seinem Glück war er seekrank, das verbarg seine Angst. Auf den Mützen der Prisenmannschaft las er das Wort, das ihm vor allen Worten damals heilig war, „Hibernia" - das lateinische Wort für „Irland“. Sie schnitten die Marconileitung durch, hißten den „Union Jack“, stellten Posten auf, und ein englischer Offizier übernahm das Kommando. „Tut mir leid“, erklärte er dem Kapitän. „Muß Sie nach Stornoway bringen." Für den Abend war „Captain’s Dinner“ vorbereitet, denn tags darauf schon hätte „Oskar II." den ersten norwegischen Hafen anlaufen sollen. Es fand statt, der Speisesaal war festlich beleuchtet und geschmückt, bei jedem Gedeck lag ein Fähnchen in den Nationalfarben der Reisenden, bei Roger Casements Gedeck das Streifen- und Sternenbanner. Aber bei diesem Festessen ging es traurig her, viele Gesichter waren verweint, nasse Augen sahen anklagend auf Casement. Ein Däne kam im Auftrag einer deutschen jungen Dame zu ihm. „Wird man die deutschen Frauen an Bord gefangennehmen, Herr?" Casement, dem die Schlinge wirklich schon um den Hals 176
lag - denn seine Broschüre, die sein Vis-à-vis in der Rocktasche trug, war offener Hochverrat -, lächelte heiter. „Wie kann ich das wissen? Aber ich glaube nicht, daß die Engländer sowenig ritterlich sind.“ Stornoway ist ein Hafen in den Hebriden, vor dem „Oskar II.“ am nächsten Morgen aftkerte. Ringsum ragten spitze, steile Klippen, die ganze Hafeneinfahrt sah aus wie ein geöffnetes Haifischmaul. Im inneren Hafen lagen vier ge kaperte Schiffe, ein Norweger, ein Amerikaner, zwei Dänen. Im Laufe des Vormittags ließ der „Hibernia"-Offizier sechs Reisende verhaften und an Land bringen, zwei junge Deutsche, die als blinde Passagiere zu ihren Fahnen gestrebt hatten, zwei deutsche Matrosen, zwei Schiffsbeamte deutscher Abkunft. Sie wurden an Land gebracht. Casements Paß war nicht beanstan det worden ! Er winkte den Deutschen Abschied zu und veranstaltete eine Sammlung für sie. Dann legte er sich in die Koje, sein Herz schlug wieder leichter, aber die Qual war groß gewesen. Am Nachmittag verließ die „Hibernia'-Mannschaft das Schiff, „Oskar II.“ war frei I Nachts, zwischen den Shetland- und Orkney-Inseln, hielt ein Torpedoboot den Dampfer an, aber er durfte weiterfahren, als er seinen Namen gemeldet hatte. Acht Schlachtschiffe waren ausgesandt worden, um diesen einen Dampfer zu visitieren. Die kostbarste Beute war England dennoch entgangen! Der letzte Reisetag wurde fröhlich nach vierzehn Tagen voll Angst. Man bedauerte, Casement unrecht getan zu haben, er war kein Spion. „Sie sind Ire!“ sagte ein deutscher Herr zu ihm, der Gene ralkonsul in Australien gewesen war. „Ich habe das sofort er kannt und allen gesagt, daß man Sie nicht zu fürchten braucht. Aber als die ,Hibernia* auftauchte, habe ich für Sie gezittert.“ Auch er hatte die Broschüre „Irland, Deutschland und die Freiheit der Meere“ in seinem Gepäck. „Das ist ein wundervolles Buch, Herr... Herr Landy. Ich werde es in Berlin dem Minister einreichen.“ So leicht war die Entdeckung möglich t „Steward, zwei Whisky-Soda!“ 12
Paradiese
177
Von seinem ersten Schritt in Christiania an fühlte Casement, daß er beobachtet wurde. Er setzte sich in sein Hotelzimmer und schickte Adler Christensen mit kleinen Besorgungen in die Stadt. Schon in der Halle sprach ein Herr den Burschen an. „Sie sind heute morgen aus Amerika angekommen? Wollen wir einen Spaziergang zusammen machen?“ An der Straße wartete ein großes Privatauto mit livriertem Chauffeur. „Steigen Sie ein!“ Dann zum Chauffeur: „Drammensweg 70." Christensen war neugierig und gehorchte. Drammensweg 70 war ein kleines Palais. Ein distinguierter Herr, graumeliert, empfing Casements Diener in seinem Arbeitszimmer. Er sperrte die Doppeltür hinter sidi ab und begann ein Verhör. „Auf Ihrem Schiff ist ein großer, dunkler Gentleman als Passagier erster Klasse gereist, den Sie kennen. Ein gewisser Herr ... Herr ...?“ Adler Christensen erinnerte sich. „Ja, das war aber ein Amerikaner. Der Name fällt mir nicht ein, ein komischer Name .. „Und wo ist dieser Herr jetzt?“ „Ich denke, abgereist.“ „Na, ich hoffe, daß es Ihnen in Amerika gut gegangen ist. Aber ich möchte wirklich den Namen dieses gewissen Herrn wissen. Wollen Sie ihn mir sagen?“ „Ganz bestimmt nicht, Sir.“ Christensen war entlassen, er eilte ins Hotel, um Bericht zu erstatten. Casement schlug im Adreßbuch von Christiania nach, Drammensweg 70 war die britische Gesandtschaft. Am Abend besuchte Casement den deutschen Gesandten, Graf Oberndorff. In der Hotelhalle lauerte wieder jener Vigi lant, der Christensen abgefangen hatte, und folgte Casement. Casement bat, ihm eiligst das Einreisevisum für Deutschland zu besorgen. „Ich fürchte nicht für mich, aber für meine, das heißt Irlands Sache, Exzellenz. Ich weiß, wie englische Behörden mit irischen Nationalisten umgehen - sie werden versuchen, mich hier auf 178
norwegischem Boden abzufangen. Ich reise unter falschem amerikanischen Paßl Durch Vermittlung der amerikanischen Gesandtschaft wird es leicht sein, mich verhaften zu lassen." Graf Oberndorf! versprach, das Visum telegraphisch einzu holen. „Warten Sie im Hotel, Sir Roger. Ich gebe Ihnen Nachricht. Spätestens morgen nachmittag können Sie fahren!" Das Hotel sei von Vigilanten umstellt, berichtete Christen sen, als Sir Roger zurückkam. Vor seinem Fenster stand ein Doppelposten, die ganze Nacht, den ganzen nächsten Tag. Am Morgen ließ Christensen sich abermals nach Drammensweg 70 locken. Diesmal trat ihm ein anderer Herr entgegen, der sich ohne weiteres vorstellte: „Ich bin der britische Gesandte.“ Auch er sperrte die Tür ab. „Sie sind Adler Christensen aus Moss in Südnorwegen. Der Herr, als dessen Diener Sie reisen, ist Sir Roger, er will nach Deutschland fahren und von dort aus einen Aufstand in Irland anzetteln.“ Der Gesandte hieß Findlay. Er ging schnurstracks auf sein Ziel los. „Die Iren haben schon oft geputscht und nie etwas erreicht, sie werden auch diesmal nichts erreichen. Aber wir wollen trotzdem verhindern, daß Sir Roger nach Berlin kommt. Da bei können Sie uns helfen, Christensen.“ „Sir Roger war sehr gut zu mir, Sir, wie ein Freund in der Not.“ „That’s balls, das sind Redensarten. Niemand kümmert sich hier um sein Schicksal, die Amerikaner nicht, weil sein Paß falsch ist, die Deutschen nicht, weil sie keine Schwierigkeiten mit den Neutralen haben wollen, und die Norweger erst recht nicht, weil er nicht richtig gemeldet ist. Der Mann existiert juristisch gar nicht, es wäre ein Kinderspiel, ihn verschwinden zu lassen.“ Christensen glotzte den Minister an, so offen hatte er sich die diplomatische Sprache nicht vorgestellt. Mr. Findlay fuhr fort: „Schließlich hätten Sie wohl nichts dagegen, für den Rest Ihres Lebens gut versorgt zu sein? So gut, daß Sie nie wieder eine Hand zu rühren brauchten ...“ 12’
!79
Er dachte eine Sekunde über Christensens Haltung nach. „Wenn dieser Ire eins über den Schädel bekäme, würde man gut bezahlt werden.“ Christensen versprach nichts, Findlay schloß die Unter redung: „Da haben Sie einstweilen fünfundzwanzig Kronen für Ihre Autos. Wenn Sie sich die Sache überlegt haben, kommen Sic wieder. Ich erwarte Sic bis heute nachmittag um drei.“ Casemcnt befahl dem Burschen, pünktlich in der Gesandt schaft anzutreten, seine Reisepläne zu verraten und scheinbar auf den Mordplan einzugehen. Christensen trat diesmal mit der Shagpfeife im Mund und beiden Händen in den Hosen taschen vor Seine Exzellenz, den Gesandten. „Sie sind wahrscheinlich ein Schuft und halten mich auch dafür, Mr. Findlay? Go on with your dirty business, reden Sie los!“ Er fluchte im besten Seemanns-Englisch und zeigte sich hödist vertrauenswürdig. „Für dreckige fünf Dollar, wie die heute morgen, rühre ich jedenfalls keinen Finger!“ „Davon ist keine Rede. Locken Sie uns Sir Roger ins Skagerrak oder in die Nordsee, wo wir ein Kriegsschiff für ihn bcreithalten können. Dann hat er ausgesorgt, und Sie be kommen ...“ „Na, alter Mann, wieviel?“ „Fünftausend.“ „Fünftausend Kronen? Da spucke ich Ihnen drauf, daß Sie’s nur wissen.“ „Natürlich. Ich spreche von fünftausend Pfund Sterling, in Gold.“ „Das ist etwas anderes. Und welche Garantie?“ „Mein Ehrenwort. Mein persönliches Ehrenwort als Gentle man und britischer Gesandter! Fünftausend garantiere ich. Aber ich werde telegraphisch versuchen, von meiner Regie rung noch mehr herauszuholen.“ Christensen fluchte noch einiges und lümmelte Findlay weiter an, aber er schien nachzugeben. „Außerdem, Christensen, bekommen Sie bis dahin für jedes Schriftstück, das Sie Sir Roger entwenden und uns schicken" 180
er malte mit Druckbuchstaben eine Deckadresse auf ein Stück Karton „ein entsprechendes Honorar. Und hier sind einst weilen hundert Kronen, alles, was ich bei mir trage. Bisher haben Sic ja auch nichts geleistet. Was Sie mir erzählt haben, wußte ich schon." Christensen brummte eine unhöfliche Einladung und pol terte hinaus. Die Unterredung hatte lange gedauert, er traf Casement in fiebernder Unruhe. In einer halben Stunde mußte er per Bahn nach Kopenhagen auf brechen! Er fürchtete, Christensen sei der Versuchung erlegen oder ein Opfer eng lischer Gewalt geworden. Aber der Bursche händigte ihm grinsend und stolz die Hundcrt-Kronen-Note aus.
Einundzwanzigstes Kapitel Ein britischer Gesandter versuchte, im neutralen Land Meu chelmörder gegen einen Mann zu dingen, der - gestern noch sein Kollege - aus Überzeugung und in offener Haltung ins feindliche Lager getreten war! Bezahlter Meuchelmord als Mittel des Krieges, Bravi als Soldaten... Nichts in seinem Leben, das ihn in tausend Lektionen des Grauens gelehrt hatte, wie abgründig schlecht der Mensch werden kann, hatte Casement so erschüttert wie die Eröffnungen, die Adler Christensen ihm nach seinem zweiten Besuch bei Mr. Findlay machte. Dieser junge Mensch hatte gesagt, daß Casement sein Wohltäter sei, ihn vor dem Asphalttod in New York gerettet hatte, daß er sein väterlicher und vertrauender Herr war! Das alles hatte Findlay nur als einen besonders günstigen Umstand betrachtet, ihm ans Leben zu gehen. Er hatte kleine Noten gezückt und mit einem großen Scheck gewinkt, um die reinen menschlichen Gefühle von Dankbarkeit und Treue des jungen Seemanns beiseite zu fegen. Von dieser Stunde an sah Casement in jedem englischen Wort einen Meineid, in jeder englischen Tat eine Tücke, und sein Kampf für Irland wurde ein Feldzug gegen das Infame, das er in jedem Engländer verkörpert sah. Das paßte gut in
181
die dumpfe Psychologie des Krieges, die nicht mehr zwischen guten und schlechten Menschen, nur noch zwischen anbetungs werten und verruchten Nationen unterschied. Aber Roger Casement wurde in dieser Stunde so hemmungslos England hasser, daß er selbst in Deutschland Mißtrauen erregen mußte. Mit zwei fertigen Kriegsplänen zog er in Berlin ein, wo man ihn im Ministerium höflich, aber nicht begeistert empfing. Er wollte die Iren aus den Kriegsgefangenenlagern Deutsch lands ausmustern und zu einer bewaffneten Brigade formieren, die auf irischem Boden gegen den Erbfeind kämpfen wurde. Er wollte ferner aus dem Findlay-Attentat den ungeheuersten Skandal aller Zeiten machen, der England moralisch so völlig bloßstellte, daß seine Weltherrschaft in sich zusammenbrach wie ein morsches Gerüst. Im übrigen würde er natürlich durch alle Kanäle, die sich boten, mit glühendem Wort seine Iren weiter aufreizen, das englische Joch abzuwerfen, und dann schien ihm sicher - Irlands Beispiel würden Indien, Süd afrika, Ägypten und alle anderen Zwangsvasallen der briti schen Krone im Augenblick folgen I Diese Freiheit verlangenden Völker mußten vor allem wis sen, daß von einem Deutschland, das mit ihrer Hilfe gesiegt hatte, keine Gefahr, kein neues Joch drohte! Gerade dahin ging ja Englands Propaganda: die Deutschen seien Berserker, Hunnen, siegreiche Hunnen würden die Welt in Schutt und Asche legen. Die deutsche Regierung, zu der Casement als Botschafter eines noch nicht bestehenden Staates kam, sollte diesem Staat Garantien für Freiheit und Sicherheit geben, die unwiderrufbar waren. Als Casement zum erstenmal im Wartezimmer des Auswär tigen Amtes' saß, hielt er sich für den Exponenten einer großen Macht auf Erden: der Gesamtheit aller politisch Entrechteten und Verfolgten. „Gelingt mir alles, so bedeutet das die nationale Auferste hung, ein freies Irland, ein Weltvolk nach Jahrhunderten der Sklaverei, ein Volk, das im Mittelalter verlorenging und für Europa wiedergefunden wird. - Die Zeit ist gekommen, das britische Empire abzubrechen .. Er selbst, schreibt Roger Casement in der gleichen Tagebuch
182
eintragung, würde Irland nicht wiedersehen. Nur ein Wunder von Sieg, an das er selbst nicht zu glauben vermochte, würde ihn wieder an seine Gestade tragen. Auf jeden Fall aber, selbst wenn Deutschland besiegt wurde, „muß der Schlag, der heute für Irland geführt wird, den Kurs der englischen Politik gänz lich ändern. England wird nie mehr mit der .irischen Frage* spielen dürfen. Homerule muß wahrhaft Selbstregierung wer den." Es folgen wilde und wirre Ausbrüche von Casements Ge fühlen gegen die englische Regierung, wie er sie von nun an nicht nur in seine Tagebücher, sondern auch in Pamphlete und Aufsätze ergoß, aber in der Sache selbst zeigt er sich auch auf dieser Tagebuchseite prophetisch klar. Der Sieg, den er nicht zu erhoffen wagte, ist trotz vieler Jahre des Siegens nicht erkämpft worden. Er selbst hat die Gestade Irlands nur auf seinem letzten Weg in den Tod wiedergesehen, aber die Dinge in Irland sind nie wieder die gleichen geworden, und aus der Schein-Homerule ist wahrhafte Selbstregierung geworden. Um Findlay - und in seiner Person die ganze Verwaltung Englands - zu diffamieren, war cs nötig, daß Adler Christen sen den Vertrag „fünftausend Pfund für einen Meuchelmord“ schwarz auf weiß nach Hause brachte. Um dieses Ziel zu er reichen, verschwendete Casement seine besten Kräfte. Er zer nagte sein Hirn, um Findlay teuflische Fallen zu stellen. Wie ein Kurier sauste Christensen zwischen Berlin und Christiania hin und her. Casement verrannte sich in die Rolle eines poli tischen Sherlock Holmes. Er dichtete tolle Romankapitel in Form von Briefen oder Memoranden, in denen waffenbeladene Frachtschiffe, die im Hafen von Kopenhagen zur Abfahrt nach Irland bereit lagen, Expeditipnskorps und Minenleger auf tauchten, die es selbst in Casements Phantasie noch nicht gab. Diese handschriftlichen Dokumente lieferte Christensen als Diebesbeute dem Gesandten in Christiania ab und ließ sich die Taschen mit Geld stopfen. Findlay biß auf jeden Köder. Das Kopfgeld für Sir Roger stieg langsam auf zehntausend Pfund, aber noch wollte Findlay nichts Schriftliches von sich geben. Immerhin vertraute er dem seltsamen Burschen, den er
183
doch für einen hundertprozentigen Halunken halten mußte und der im Kaschemmenton mit ihm verkehrte, einen Geheim schlüssel der Gesandtschaft an. Christensen ging bald auch in den deutschen Amtsstuben aus und ein. Er kleidete sich wie ein Stutzer, warf das Geld um sich und war ein kompromittierender Begleiter für Roger Cascmcnt, der - anfangs unter dem Namen Hammond, dem dritten Decknamen während eines Jahres - dürftig lebte, keine Handschuhe besaß und bittere Geldsorgen litt. Obwohl der eigentliche Fallensteller Christensen war und Casement der Geführte, machte er sich Vorwürfe, weil er den Burschen'Zum Lügen anhielt. „Ich will nicht, daß Sie um meinetwillen in Ungelegcnhcitcn kommen oder etwas Unrechtes tun, abgesehen von dem Un recht, das wir beide tun, wenn wir Betrug mit Betrug vergel ten. Ich will, daß Sie ein anständiger, guter Mensch werden, lieber Adler. Deshalb bin ich unglücklich, wenn ich denke, daß Sie für mich lügen; und geschähe dies nicht aus Gründen, die Sie kennen, ich würde nicht dareinwilligen." So schrieb er an diesen Jüngling, der wie ein Kork auf den Wellen internationaler Intrigen schaukelte, nach beiden Seiten mühelos log, daß sich die Balken bogen, und all die großen Herren, mit denen er auf gleich und gleich verkehren durfte, für ausgesuchte Schwachköpfe hielt. „Ich zweifle, ob nicht der Fall Findlay vom Standpunkt der irischen Sache aus mehr bedeutet als selbst die Bildung einer irischen Brigade“, schrieb Casement in sein Tagebuch. Aber er wollte nicht früher losschlagcn, als er das „Findlay-Dokument“ in seinen Akten hatte. Und wirklich, Christensen brachte es zur Stelle! Es liegt mir im Faksimile vor. Der Gesandte hatte es eigenhändig und sauber auf einen Briefbogen mit dem englischen Aufdruck „Britische Gesandtschaft, Christiania, Norwegen" geschrieben und mit seiner offiziellen Firma gezeichnet. Allerdings enthielt es nicht die Aufforderung, Casement zu ermorden - in diesem Punkt blieb es bei Findlays Ehrenwort -, aber immerhin scheint es ein erstaunliches Stück offizieller Gesandtentätigkeit. „Für die Britische Regierung verspreche ich; daß, wenn auf
184
Grund von Informationen, die Adler Christensen beigebracht hat, Sir Roger Casement entweder mit seinen Begleitern oder ohne diese gefangengenommen wird, besagter Adler Christen sen von der Britischen Regierung die Summe von fünftausend Pfund Sterling zu erhalten hat, zahlbar nach seinem Wunsch.“ „Adler Christensen soll ferner persönliche Immunität ge nießen und freie Überfahrt nach'den Vereinigten Staaten er halten, im Falle er dies wünschen sollte. M. dc C. Findlay, Seiner Britischen Majestät Minister.“ Die Authentizität dieses Schriftstückes ist tatsächlich nie be stritten worden, aber seine spätere Veröffentlichung hat weder Findlay, und noch viel weniger der englischen Regierung, moralisch den Hals gebrochen. Findlay wurde zwar zunächst „zu seiner Erholung" beurlaubt, bekam aber bald darauf den hohen Orden des Hosenbandes und stolperte trotz seines schwer verzeihlichen Ungeschickes die diplomatische Treppe hinauf, nicht hinab. Die englische These „Gut oder schlecht: fürs Vaterland“ galt noch wie seit Jahrhunderten. Einstweilen aber wurde Casement das Schriftstück gar nicht ausgehändigt, das ihn Gewissensnöte, Arbeit und schlaflose Nächte ohne Zahl gekostet hat. Christensen verkaufte es für vierhundert Mark dem Auswärtigen Amt, das es erst nach langem Zögern herausgab. Über diesen Adler Christensen schrieb später John Devoy, ein irischer Führer und Freund Casements - und auch dieser Brief, der später in einem englischen Weißbuch „Dokumente über die Sinn-Fcin-Bewegung“ erschien, wurde nie dementiert, weder von der Regierung noch von Adler Christensen selbst. „Christensen, der ihn gerettet hat, ist einer der dunkelsten Schurken, die mir je begegnet sind. Er stand seit langer Zeit in englischem Sold. Casement war längst von Irland aus vor ihm gewarnt worden, aber er teilte dem Burschen selbst die Warnung mit und nannte ihm den Mann, von dem sie kam. Christensen wollte später gegen ihn als Zeuge auftreten und all unsere Geheimnisse verraten, aber wir hielten ihn fest.“ Volles Licht wird wohl nie in diese Labyrinthe fallen, in
185
dies Satyrspiel von Spionage und Antispionage, in das Casement sich nie hätte wagen dürfen. Er war in seiner Reinheit in eine Hexenküche der Gemeinheit geraten, auf diesem Feld war er tausendmal einfältiger als der entlaufene Schiffsjunge Christensen, nicht viel mehr als sein Werkzeug. Dies eine Mal in seinem Leben ist Casement von seiner Linie abgedrängt worden, dies eine Mal hat ihn Haß verblendet. Sein erster Schritt in Berlin war ein ganzer Erfolg gewesen. Die offizielle Erklärung der deutschen Regierung über ihre Stellung zu den Iren erschien wenige Wochen nach seiner An kunft in den deutschen Amtsblättern. Sie begann: „Der sehr bekannte irische Nationalist Sir Roger Casement ist im Aus wärtigen Amt empfangen worden“, und ihr wichtigster Passus lautete: „Die deutsche Regierung weist die in der von Sir Roger Casement angeführten Darstellung ihr zugeschriebenen schlim men Absichten entschieden zurück und benutzt diese Gelegen heit, um eine kategorische Erklärung des Sinnes abzugeben, daß die deutsche Regierung nur das Beste des irischen Volkes, seines Landes und seiner Institutionen wünscht.“ „Die kaiserliche Regierung erklärt in aller Form, daß unter keinen Umständen Deutschland in Irland einfallen wird mit der Absicht, es zu erobern oder eine der angestammten Insti tutionen dieses Landes zu beseitigen.“ „Sollte in diesem großen Kriege, den Deutschland nicht ge wollt hat, das Glück es jemals mit sich bringen, daß deutsche Truppen an den Gestaden Irlands landen, so würden sie dort landen nicht als eine Armee von Eindringlingen, die plündern und zerstören, sondern als Streitkräfte einer Regierung, die einem Lande und einem Volke gegenüber, dem Deutschland nur nationale Entfaltung und nationale Freiheit wünscht, von nichts als von Wohlwollen geleitet ist.“ Damals kam die Wilhelmstraße Casement in vollem Ver trauen entgegen, an der Findlay-Sache zeigte sie von Anfang an kein Interesse. Daß Casement ihr trotzdem zäh und - wie er glaubte listig wie ein Indianer nachging, hat das letzte Jahr seines großen Lebens vergiftet. 186
Zweiundzwanzigstes Kapitel Die besten Söhne Irlands waren es vielleicht nicht, die zum englischen Kalbfell gelaufen waren, junge Burschen, die von der Geschichte ihrer eigenen Nation nichts wußten oder nichts wissen wollten. Aber gute Soldaten, harte Landsknechte waren diese Söhne eines kernigen und kriegerischen Bauernstammes; sie fragten nicht, für wen und gegen wen sie kämpften. Kämp fen war ihr Beruf, und besser zu kämpfen als irgendeine ändere Truppe der verbündeten Armeen war ihr Ehrgeiz. Im Burenkrieg hatten Iren sich wie Teufel geschlagen und nicht bedacht, daß ihre Hiebe einem anderen braven Bauernstamm das irische Schicksal bereiten halfen. Gegen die Deutschen stürmten sie mit derselben grimmen Lebensverachtung an und wußten nicht oder achteten nicht, daß ein deutscher Sieg die Freiheit Irlands bedeutet hätte. Durch Trommelfeuer und alle Höllen waren ein paar tau send Iren gegangen, ehe sie knirschend die Waffen nieder gelegt hatten. Man hatte sie nicht aufgenommen wie einst. Friedrich der Große seine ersten französischen Gefangenen. „Messieurs, da ich es nicht vermag, in französischen Offizieren meine Feinde zu sehen ...“, sondern sie waren behandelt wor den wie all die anderen Tommys, Poilus, Muschiks, die sich als kämpfende Soldaten den Deutschen ergeben mußten, und diese Behandlung hatte nichts Verführerisches. In Deutschland war jede Sehne zur Abwehr einer Welt voll Feindschaft ge spannt, jeder Gedanke war kriegerisch, und auf den politischen Einfall, aus dem gefangenen Gegner einen Freund zu machen, war einstweilen niemand gekommen. Im Feld waren Iren, Briten und Schotten Kameraden gewesen, sie waren es in der Gefangenschaft geblieben, und wer die Atmosphäre von Ge fangenenlagern kennt, weiß auch, daß abwegige politische Ideen dort schlecht gedeihen. Die Männer, denen ein ganz gemeinsames Schicksal von tausend Entbehrungen aufgebürdet ist, haben alle nur einen Feind: den, der sie gefangenhält. Dar aus entwickelt sich in jedem Gefangenenlager ein Gefühl von Einheit und gemeinsamer Ehre, mögen die nationalen Elemente noch so wild durcheinandergemischt sein. 187
Als die deutschen Behörden auf Sir Rogers Plan eingingen, die gefangenen irischen Soldaten in den verschiedenen Lagern auszumustern und ihnen Vergünstigungen zu gewähren, stießen sie auf erbitterte Abwehr. In einem Gefangenenlager, das Roger Casement eben besuchen wollte, um seine Propaganda zu eröffnen, wurde dem Lagerkommando eine Resolution überreicht, die von den Feldwebeln aller im Lager vertretenen irischen Bataillone unterzeichnet war und die auf ihre Bitte dem deutschen Kaiser persönlich überreicht werden sollte. Es hieß darin: „Wir erkennen durchaus die gütige Absicht an, uns erstens unter einem Dach sammeln, zweitens uns bessere Nahrung geben, drittens unseren Arbeitsdienst mildern zu wollen. Aber zu unserem Leidwesen müssen wir Seine Kaiserliche Majestät bitten, solche Vergünstigungen zurückzuziehen, solange sie nicht allen anderen Gefangenen gleichfalls zuteil werden, denn wir haben die Ehre, irische Katholiken, aber außerdem britische Soldaten zu sein .. In Limburg an der Lahn war trotzdem eine Barackenstadt für mehrere tausend Iren aus allen deutschen Lagern errichtet worden. Es war Winter, die Leute waren mit Schuhwerk und Kleidern schlecht versehen, sie hatten keinen Dienst zu tun, hockten zusammen in den stickigen, aber warmen Baracken und fragten einander, was all das bedeuten mochte. Eines Tages wurden ihre Unteroffiziere in eine leere Baracke kom mandiert, um die Ansprache „eines angesehenen irischen Herrn" entgegenzunehmen. Sie traten an. Eine Stunde lang ließ man sie warten, dann erschien zwischen zwei deutschen Offizieren ein schwarzbärtiger, todblasser Riese, der als Sir Roger Case ment vorgestellt wurde. Kaum einer von ihnen hatte je diesen Namen gehört, kaum einer von ihnen wußte, daß ein „Pro blem Irland“ existierte. Sir Roger spürte sofort eine Welle von Mißtrauen und Abwehr, er sprach stockend und nervös, sei ner Rednergabe entsprachen dies Auditorium und diese Um gebung nicht. „Ich begrüße euch als Landsleute!“ begann er in tiefem Ernst. „Erinnert euch, daß wir Pflichten gegen die Heimat haben, die heiliger sind als jede andere Bindung. Ihr steht
188
hier als britische Soldaten, aber ihr alle seid irischen Blutes und entstammt irischen Regimentern. Ich bitte euch, über eure Stellung in diesem Kriege nachzudenken!" Dann setzte er auseinander, daß Deutschland nur in Not wehr gegen Rußland, Frankreich und England zugleich die Waffen ergriffen habe. Zwischen Irland und Deutschland habe nie ein Schatten von Feindschaft bestanden, England aber sei der Erbfeind der Iren__ Kein Hauch von Verstehen kam aus den Reihen, kein lei sester Widerhall. Ein deutscher Soldat verteilte Propagandamaterial, Aus gaben der amerikanischen Iren-Zeitung und der in Deutsch land erscheinenden „Continental Times“. „Wer von euch ist bereit, eine Liste kursieren zu lassen, in die jeder Mann sich einträgt, der einer irischen Brigade bei treten will, die unter deutschem Kommando, aber nur auf irischem Boden eingesetzt werden soll?“ Ein einziger, ganz junger Korporal trat vor ... Draußen im Lager wurden inzwischen Aufrufe an die Barakkenwände genagelt, in denen Casement - der ein besserer Schriftsteller als Redner war - seine Landsleute mit leiden schaftlichen Worten aufforderte, Soldaten der Irischen Brigade zu werden, die unter irischer Flagge, in eigener Uniform und nur für Irland kämpfen sollte, einstweilen aber als Gäste der deutschen Regierung behandelt würden. Bei Kriegsende würde jeder Mann, der es wünschte, mit Geld versehen und nach Amerika transportiert werden. Die Landsleute in Amerika sammelten schon jetzt für die Brigade. „Gott rette Irland!" schloß der Aufruf. Dieser erste Versuch war kein Erfolg gewesen, das wußte Roger Casement selbst, als er das Limburglager verließ. Aber es war eine erste Saat gewesen. Sie brauchte ihre Zeit, um aufzugehen.
Ein trauriger Winter schlich dahin - grau der Himmel, nebelbeschlagen die Fenster, unklarer von Tag zu Tag alle Beziehungen zu den Menschen und Dingen. Flammend von Tatkraft war Sir Roger vor wenigen Mona 189
ten hier eingetroffen, den Deutschen, die er bewunderte, sein Herz entgegenzustrecken. So klar schien das Weltbild damals: Irland war das Land Gottes, aus dem England in jahrhunderte langer Knechtung ein Paradies des Teufels gemacht hatte. Die Deutschen waren Helden und Edelmenschen, die in ihrem Riesenkampf Irland mit befreien würden. Sie nahmen ihn mit offenen Armen auf. Adler Christensen war das treueste Herz unter Gottes Sonne. Sir Rogers eigene Rolle stand mitten im Gewühl unerschütterlich klar, kein Zweifel konnte ihn treffen. Nun aber las er, daß seine jungen Landsleute zu Aber tausenden in die britische Armee eintraten, aus Amerika so gar kamen Scharen junger Rekruten. So irrsinnig es dem schien, der sich die irische Geschichte in Hirn und Herz gegraben hatte - eine Geschichte jahrhundertelanger Mißhandlung, Ent mannung, Ausbeutung durch den mächtigeren Nachbarn Eng land -, es war dennoch Tatsache, daß die halbe Bevölkerung der grünen Insel hingerissen war von Begeisterung für den englischen Krieg. Das hatte viele Gründe: vor allem sah John Redmond, Führer der irischen Homerule-Bewegung, die Zu kunft seiner Heimat im englischen Staatsverband. Er wollte die Bande lockern, aber nicht lösen, aus den Händen eines siegreichen Königs sollte der tapfere irische Vasall so viele Freiheiten empfangen, wie pr für dienlich hielt. Dann aber war Deutschland protestantisch, Belgien und Frankreich da gegen, furchtbar bedrängt, waren katholische Länder wie Irland. Die religiösen und politischen Probleme hatten sich in Irland immer vermengt. Vor allem jedoch besaß die englische Propaganda schon zu Anfang des Krieges eine Macht, die alles nüchterne Denken erschlug. Die Propaganda der Sinnfeiner, dieser jungen, an Zahl der offenen Bekenner noch schwachen Bewegung, vermochte anfangs dagegen nichts. Ähnlich erging es in den anderen Vasallenstaaten: die Aufstände in Süd afrika, in Ägypten und Indien blieben fast gänzlich aus, die alle England feindliche Welt schon in den ersten Tagen des Krieges erwartet hatte.
Das Benehihen der deutschen Regierung wurde rätselvoller von Woche zu Woche. Sie hatte Sir Roger nach langem War 190
ten einen Diplomatenpaß ausgestellt, der aber nur drei Mo nate Laufzeit hatte. Nach zwölf Monaten Wartens hatte der Kanzler, hatte der Minister des Auswärtigen ihn noch nicht empfangen, jedes Eingehen auf seine Vorschläge, jede Be antwortung seiner Briefe und Memoranden ließ endlos auf sich warten. Waren diese Leute unfähig, die ungeheure Bedeutung seiner Aktion zu begreifen - oder mißtrauten sie ihm? Sie trauten ihm nicht ganz, wie man im Krieg keinem ganz traute, der nicht hundertprozentig Landsmann oder Gegner war. Die ganze Findlay-Geschichte war verdächtig, dieser odiose Begleiter Christensen, dessen skurrilen Abenteuerplä nen Sir Roger immer folgte, war verdächtig. Am verdächtig sten war die Tatsache, daß Sir Roger Deutschland glücklich erreicht hatte. Der deutsche Gesandte hatte sein Kommen und seine Mission aus New York in chiffrierten Telegrammen an gemeldet, aber man wußte seither in Berlin, daß England die Telegramme aufgefangen und dechiffriert hatte. Der „Oskar II." war von den Engländern durchsucht worden - und Sir Roger hatte trotzdem seine Reise fortsetzen dürfen! Casement selbst aber begann zu seinem bittersten Schmerz, Adler Christensen zu mißtrauen, seinem Lebensretter! Der Bursche hatte sich verändert, hatte den offenen Blick und die offene Sprache nicht mehr, gab mehr Geld aus, als er von Casement bekam, schimpfte auf die Deutschen und sprach seit seiner letzten Fahrt nach Christiania respektvoll über Findlay. Norwegische Schiffe waren von deutschen Kreuzern versenkt worden. Das hatte ihn auf die andere Seite gezogen, dachte Casement, dessen klare Seele schlimmeren Verdacht nicht fassen konnte. Aber so einsam hatte er sich im Urwald nie gefühlt, nicht so verloren zwischen den Verbrechern im Putumayo! Damals hatte er handeln können, jeder Tag war ein Kampf gewesen, und wenn er von der Hand eines Meuchelmörders fiel, war es doch ein Soldatentod unter den Fahnen der Menschlichkeit. Hier war nichts, wonach er greifen konnte, jedes Ziel ver schwand wie eine Fata Morgana, wenn er ihm näher kam. Das ganze Dasein verrann in elendem Warten. Er erwartete Briefe
191
seiner Freunde in Irland, die auf Schleichwegen, von Ver trautem zu Vertrautem, von Irland nach New York, von New York über Rotterdam oder Kopenhagen, so grausam langsam zu ihm kamen, wartete auf den Sieg über Findlay, wartete jede Stunde auf einen Anruf, ein Telegramm des Auswärtigen Amtes. Es ist tausendmal leichter, für eine gute Sache zu ster ben, als zu warten, das Ticken der Uhr, das Rasseln einer kranken Lunge zu hören und dabei das Zucken wunder Nerven zu fühlen. Konnte er hier die letzte Kraft für Irland so hin geben, daß die geknechtete Insel befreit wurde, oder stand er auf verlorenem Posten, halb ein Gefangener, halb ein Schiff brüchiger? Dann endlich, endlich - ein Ruf zu Bethmann Hollweg 1 Zu Weihnachten entstand der heiß ersehnte Vertrag, gezeich net „von Zimmermann, Staatssekretär, Deutsche Regierung" und „Roger Casement, Irischet Entsandter“, in dem die Er richtung der Irischen Brigade gesetzlichen Boden bekam. Was sie an Waffen, Führung, Kleidern und Nahrung von Deutsch land erhielt, galt als Beitrag für die Sache der irischen Freiheit. Aber kein Mann würde Geld in irgendwelcher Form aus deut schen Kassen beziehen! Deutsche Offiziere durften nur im Einverständnis mit Sir Roger Casement ernannt werden, so lange irische Offiziere nicht zur Verfügung standen. Die Bri gade sollte nur für ihre eigene nationale Sache kämpfen, durfte anderwärts als in Irland nur mit Sir Roger Casements Zu stimmung eingesetzt werden!
Wenige Tage später betrat Sir Roger zum zweitenmal das Limburger Lager. Zweitausend Iren waren dort versammelt. Sie hatten die Zeitungen und Manifeste gelesen, jetzt wußten sie, wer Roger Casement war. Aber nur ein paar Dutzend Männer scharten sich um den Tisch, den Sir Roger bestieg, um seine Botschaft zu verkünden. Sie hörten ihn an, diesmal sprach er siegesgewiß und gewaltig, aber ihre Gesichter blickten finster. Als der Passus kam: „Selbst wenn Deutschland diesen Krieg verlieren sollte und unser Befreiungskampf mißlingt, hat der 192
einzelne nichts zu fürchten. Jeder Mann, der es wünscht, er hält freie Fahrt nach Amerika, eine Anstellung und eine Garan tiesumme von zweihundert Mark“, tobte jählings ein Wutgebrüll aus dem Zuhörerkreis. Ein Mann packte seinen Arm und schlug nach ihm, er wurde vom Podium gerissen... Unter Pfeifen und Johlen mußte Casement fliehen, Pfeifen und Joh len verfolgte ihn über die Stacheldrahtwälle hinaus, die seine Rettung wurden.
Dreiundzwanzigstes Kapitel Die Irische Brigade kam dennoch zustande, aber sie sah an ders aus, als Roger Casement sie der deutschen Regierung ge schildert hatte. Von den Zehntausenden irischer Gefangener, die seine Propaganda erreichte, hatten fünfzig Mann sich be reit gezeigt, sich die bessere Kost, das freiere Leben, die monatliche Löhnung gefallen zu lassen - es ist unwahrschein lich, daß ein einziger von ihnen „irischer Patriot“ war. Aber diese fünfzig waren ihres Lebens im Gefangenenlager nicht mehr sicher und mußten geschützt, die Versprechen der Regie rung mußten gehalten werden. So kam es, daß fünfzig demo ralisierte Gesellen als „Irische Brigade" in grüne Uniformen gekleidet und in ein besonderes Lager überführt wurden. „Wir waren eine Bande von Halunken, wie zwanzig englische Regimenter sie nicht zusammengebracht hätten", schrieb später einer von ihnen. „Fünf von uns waren anständige Burschen, alle anderen Abschaum der Menschheit.. Es war ein Mißerfolg, der Casement zu Boden schlug. So blutig sein Glaube an die Iren enttäuscht worden war, viel schlimmer war es, daß er als ein Don Quichote vor der deut schen Regierung, vor der ganzen Welt dastand. ( Trotz allem fand er im Auswärtigen Amt noch einmal Kredit für einen abenteuerlichen Handstreich gegen England. Er wollte nach Christiania fahren, eine Photographie des Find lay-Dokuments und eine Denkschrift über den Mordanschlag auf neutralem Boden in der Tasche, um vor der Regierung Norwegens oder vor einem norwegischen Gerichtshof Findlay 11
Paradiese
und damit die ganze diplomatische Taktik Englands bloß zustellen. Diese Denkschrift - in Form eines offenen Briefes an Sir Edward Grey - wurde allen in Berlin beglaubigten Vertretern der neutralen Welt mit der Bitte, sie an ihre Re gierungen weiterzuleiten, gleichzeitig zugestellt. Findlay sollte gezwungen werden, ihm Auge in Auge entgegenzutre ten! Dieser offene Brief trägt in seiner leidenschaftslosen, klu gen, formvollendeten Sprache alle Züge von Casements Per sönlichkeit, seine hohe menschliche Würde, die er bis zur letzten Stunde behauptet hat. Es ist der Brief eines Granden im Geiste, wie Casements Erscheinung die eines Granden war. Wer ihn liest, wer ein Ohr für die erhabene Klarheit hat, mit der Roger Casement seine Stellung zur englischen Regierung in wenigen Worten präzisiert, muß erkennen, wie rein und ohne Zweifel das Gewissen dieses allen verdäch tigen, mit allem Schimpf beworfenen Menschen war. Der Brief beginnt: „Zwischen der britischen Regierung und mir hat es sich, wie Sie wissen, niemals um Pension, Belohnung oder Ordens auszeichnungen gehandelt. Ich habe der britischen Regierung treu gedient, solange es mir möglich war; ich habe um meine Entlassung gebeten, als es mir unmöglich wurde. Als auch der Genuß der mir gesetzlich zustehenden Pension für mich un möglich wurde, habe ich ebenso freiwillig auf sie verzichtet, wie ich vorher auf den Posten verzichtet hatte, auf Grund dessen ich sie bezog, und wie ich mich jetzt aller Ehren und Auszeichnungen entäußere, die mir zu verschiedenen Zeiten von der Regierung Seiner Majestät verliehen worden sind.“ „Ich kam im Oktober vorigen Jahres von Amerika nach Europa, um dafür zu kämpfen, daß mein Vaterland Irland so wenig wie irgend möglich unter den unglückseligen Folgen dieses Krieges litte, wie er auch verlaufen möge. Meinen Standpunkt habe ich in einem offenen Brief aus New York vom 17. September niedergelegt, den ich nach Irland zur Ver teilung unter meine Landsleute geschickt habe. Er legt die Ansichten dar, die ich heute wie damals über die Pflichten hege, die ein Ire in dieser Weltkrisis seinem Vaterlande schul 194
dig ist. Kurz nach Abfassung dieses Briefes bin ich nach Europa abgereist.“ „Irland vor manchen Übeln dieses Krieges zu bewahren, das war für mich nicht nur den Verlust aller äußeren Ehren und meiner Pension, sondern sogar die Begehung eines .Hoch verrats* im technischen Sinne des Wortes wohl wert. Ich hatte damit gerechnet, für meine Person jedes Risiko zu tragen und alle Strafen auf mich zu nehmen, mit denen das Gesetz meine Handlungsweise bedrohen mag. Aber ich hatte nicht damit ge rechnet, daß man mir mit Mitteln nachstellen würde, die die Grenze des gesetzlich Erlaubten ebensoweit überschreiten, wie meine Handlungsweise von moralisch verwerflichen Motiven entfernt ist. Mit anderen Worten, als ich mit englischem Recht und mit gesetzlichen Strafen rechnete und das Opfer von Namen und Ruf, von Stellung und Einkommen als den zu zahlenden Preis willig auf mich nahm, hatte ich nicht mit der jetzigen britischen Regierung gerechnet.“ „Ich war darauf vorbereitet, Anklagen vor einem gesetz lichen Gerichtshof standzuhalten: ich war aber nicht darauf vorbereitet, daß mir aufgelauert würde, daß ich gewaltsam ent führt werden könnte, daß meine Gefährten bestochen wür den, mir ,den Schädel einzuschlagen*; kurz, auf alle die Maß regeln war ich nicht gefaßt, zu denen Ihr Vertreter in einem neutralen Lande seine Zuflucht nahm, als er von meiner An wesenheit dort Kenntnis erhielt.“ „Denn der verbrecherische Anschlag, den Herr M. de C. Findlay, Seiner Britischen Majestät Gesandter am norwe gischen Hofe, am jo. Oktober vorigen Jahres in der englischen Gesandtschaft in Christiania mit dem norwegischen Unter tanen, Adler Christensen, plante, umfaßte alle diese Dinge und noch mehr. Der Plan enthielt nicht nur einen gesetz widrigen Angriff auf meine Person, für dessen Ausführung der britische Gesandte meinem Begleiter 5000 Pfund Sterling versprach, sondern er enthielt auch eine Verletzung des Völ kerrechts und des gemeinen Rechts, für die der englische Ge sandte in Norwegen diesem norwegischen Untertanen volle Straffreiheit zusicherte.“ Das Auswärtige Amt setzte in diese Aktion so viel Ver
■>'
195
trauen, daß es Casement drei Geheimpolizisten als persön lichen Schutz mit auf den Weg geben wollte. Als er auf dem Bahnhof .zu ihnen stieß, fast schon im Begriff, den Zug zu be steigen, erschien ein Abgesandter der deutschen Admiralität. „Ich habe den Auftrag, Sie zu warnen, Sir Roger. Wenn Verrat im Spiel sein sollte, wird das Fährboot zwischen Saß nitz und Trelleborg von einem englischen Unterseeboot an gehalten, und Sie werden verhaftet.“ Casement blickte um sich, sah, daß Adler Christensens sonst von Gesundheit strotzendes Gesicht an diesem Tag fahl und nervös war. „Es steht bei Ihnen allein, Sir Roger, ob Sie in diese Gefahr laufen wollen.“ Casement dankte mit einem traurigen Lächeln für diese Warnung. „Ich fürchte das Unterseeboot nicht.“ Er war sehr krank und tödlich erschöpft. Er war arm, fast, mittellos, die Geldzufuhr aus dem irischen Hauptquartier in Amerika stockte, und aus deutschen Quellen wollte er nicht schöpfen. Fünftausend Mark als Ersatz seiner Ausgaben in der Findlay-Affäre hatte das Auswärtige Amt ihm angeboten, fast aufgedrängt - er lehnte sie ab, weil er- der irischen Sache nur mit irischem Geld dienen wollte. Fünfzigtausend Mark hatte ein deutscher Verleger ihm für ein Buch über die FindlaySache geboten, zweitausend Mark eine Zeitung für ein ein ziges Interview. Aber auch das mußte er ablehnen, sein Gefühl verbot ihm eigene Vorteile im Kampf gegen das Infame. Der Zug hatte Verspätung, er erreichte das Fährboot nicht. Es kam eine Nacht in Stralsund, in der Roger Casement, ob wohl er zu schlaff war, die Kleider abzulegen, keinen Schlaf fand. Er fürchtete das Unterseeboot nicht, nicht die Verhaf tung, nicht den Tod, das sollte er später beweisen. Aber seit er beschlossen hatte, seinen Fuß in die Höhle des Löwen zu setzen, war es um Christensens Mut geschehen. „Findlay ist stärker als Sie, Sir Roger! England ist die größte Macht in Norwegen. Sie werden keine Gelegenheit finden zu sprechen. Sie werden kein Ohr für Ihre Klage offen finden! Findlay ist gerissen und skrupellos, er hat alles Gold 196
der Welt hinter sich. Sie sind in Norwegen ein Bettler, Sir Roger, ein Bettler findet nirgends Recht gegen einen Mäch tigen." Zweifel gegen diesen einzigen Zeugen, auf den er sich stüt zen konnte, hatten Roger Casement seit langem gequält. Jetzt erkannte er - mehr mit den Nerven als mit dem Verstand -, daß dieser Geselle haltlos war und in der entscheidenden Stunde versagen würde. Er malte die Gefahren aus, die ihn, Casement, bedrohten, aber er fürchtete für sein eigenes Leben. Wenn Christensen vor dem norwegischen Richter umfiel, all seine Behauptungen widerrief, ihn preisgab? Dann würde das Gelächter, mit dem eine heroische Aktion schloß, noch furcht barer sein als das, mit dem die Geschichte der Irischen Bri gade geschlossen hatte... Das Fährschiff dampfte nach Trelleborg, Roger Casement und seine Begleiter kehrten unverrichteter Sache nach Berlin zurück. Er konnte nicht einmal erklären, warum er so plötzlich, so völlig versagt hatte. „Wir hatten einen Kreuzer bereitgestellt, um Ihr Boot zu eskortieren, Sir Roger I" rief man im Auswärtigen Amt. „Es ging nicht, ich bin mittellos...“ Seltsamer Zufall I Gerade in diesen Tagen war in Berlin eine „Pro-Irische Gesellschaft" gegründet worden, die Irlands Befreiung zu ihrer Sache machen wollte. In der ersten Ver sammlung waren fünfzigtausend Mark gezeichnet worden, ein Kriegsschatz, zu Händen Sir Roger Casements ... „Was fehlt Ihnen noch, Sir Roger? Geld ist dal“ „Ich kann- es nicht annehmen. Ich kann den irischen Be freiungskrieg nicht mit deutschem Geld führen.“ Roger Casement hat später in seinem Tagebuch oft und bitter über die deutschen Beamten geklagt, die ihm mit Miß trauen begegneten. „Die Deutschen verstehen es, sich glänzend zu schlagen, zu sterben, ja selbst zu siegen. Aber sie verstehen es nicht, Menschen und Probleme anzupacken, bei denen Herz und Verstand im gleichen Takte stürmen müssen!“ Er tat ihnen Unrecht. Wie konnte er nach dieser zweiten, erschüttern den Niederlage noch atif Vertrauen rechnen? Audi die Weige rung, Geld für seinen Kampf anzunehmen, sah nicht wie höchste
197
Ehrenhaftigkeit, sondern wie sdhlechtes Gewissen aus - viele hielten ihn für einen Narren oder Abenteurer, viele für einen Spion. Er vereinsamte, trostlos und untätig saß er bald da, bald dort in einem Hotelzimmer. Auch die wenigen Menschen, die er sprach, trauten ihm nicht. Ein ganzes Jahr ging so dahin. Robert Monteith, der ihn in jenen Tagen aufsuchte, berich tet: „Sein bronzenes Gesicht war fast aschfarben, sein Gesicht hager und zerstört. Ich nahm seine Hand - sie glühte, dagegen war seine Stirn eisig kühl; das Malaria brütende Tiefland Afrikas stand plötzlich vor meinen Augen.“ „Er wies mir einen Stuhl an und schwieg eine Weile. Mit tonloser Stimme sagte er dann, er habe mich kommen lassen, weil sein Tod nun eine Gewißheit von wenig Tagen sei." Monteith wollte zum Arzt stürzen, aber Sir Roger verbot es so leidenschaftlich, daß er gehorchen mußte. Der Mann, der sich sterbend glaubte, wollte nicht, daß Geld für ihn ausge geben würde, das anderen Zwecken dienen konnte. Auf einem Schreibtisch lagen Dokumente und Briefe, die Monteith durchblättern sollte, um ihm das Wichtigste vorzu lesen. Es waren Kritiken all seines Handelns, schonungslos roh im Ton. Briefschreiber in Amerika, die von den Bedin gungen keine Ahnung hatten, unter denen Casement in Deutsch land tätig war, behaupteten, er sei kein würdiger Vertreter des irischen Volkes - solche Anwürfe von angeblich zur Kritik berechtigter Seite waren dem Auswärtigen Amt in Massen zu gegangen, hatten bei den Deutschen nicht nur sein Ansehen, auch den Glauben an den heiligen Ernst der irischen Bewe gung untergraben I Casement erstattete Monteith Bericht über jeden Schritt, den er getan hatte, seit er Irland verlassen. Dann brach er wei nend aus: „Alles ist fehlgeschlagenI Nichts habe ich für Irland vollbringen können!" Aber krank und seelisch gefoltert, hatte er doch kein hartes Wort für jene, die ihn so schmählich aburteilten. Die Veröffentlichung der Findlay-Akten verursachte eine kurze Zeitungssensation und ging im Strudel der blutigen Er eignisse jeden Tages unter. Edward Grey nahm keine Notiz 198
von dem offenen Brief. Er wurde vergessen. Statt dessen wurden in einer New-Yorker Zeitung Lügen verbreitet, die erschreckend dumm waren und dennoch weh taten. Casement sei von der deutschen Regierung mit zwölftausend Dollar ge kauft worden. Er habe Christensen nur gebraucht, um Findlay Geld abzuzapfen. Er säße in einem deutschen Gefängnis, die deutsche Regierung hätte ihn durchschaut. Casement nahm sich vor, diese amerikanischen Blätter zu verklagen, aber auch das war kein Trost. Endlich kam der völlige Zusammenbruch aller Kräfte, das Sanatorium ... Im Frühjahr 1916 lief eine Kunde um, auf die der Todmüde nicht mehr gehofft hatte: Irland stand am Vorabend der Revo lution! John Devoy hatte aus Amerika telegraphiert, Deutsch land möge Waffen und Munition nach Dublin schicken, die Stunde sei da! Deutschland war bereit, zweihunderttausend Gewehre sollten verladen werden. Endlich, endlich! Endlich war es für Casement vorbei, dies trostlose Lebendig-Begrabensein, vielleicht sollte er doch noch handeln dürfen! Er verlangte stürmisch, man möge ihn sofort in einem Unterseeboot nach Irland senden, in der Nähe von Dublin landen! Er würde seinen Freunden mitteilen, daß Waffen ge schickt wurden, die heimlichen Landungsplätze bestimmen, dem Unterseeboot einen genauen Plan mitgeben. Er stürmte, eben noch ein todkranker Mann, zwischen dem Kriegsministerium und dem Ministerium des Auswärtigen hin und her, das Hirn siedend von Plänen. Man wollte nicht zweihunderttausend, sondern nur zwanzig tausend Gewehre schicken, erfuhr er. Selbst das würde eine Hilfe sein. Aber Maschinengewehre und Instruktoren? Beides wurde abgeschlagen ... Aber dann war ja alles verloren! Von seinem ersten Besuch im Ministerium an hatte Casement erklärt, die irische Revolu tion könnte nur glücken - und zugleich den Krieg gegen Eng land entscheiden -, wenn ein deutsches Expeditionskorps auf die Insel geworfen würde. Er hatte den Brand in Irland ge schürt, seine Freunde glaubten ihm, daß sie mit deutscher Hilfe rechnen konnten! Sie würden losschlagenI Die Jugend Irlands
199
würde sich mit Begeisterung in den Kampf stürzen I Nur um abgeschlachtet zu werden? Sie glaubten ihm ja, sie vertrauten auf ihn! Sollte er, der Verräter an England, zum Verräter an Irland gestempelt werden?
Vierundzwanzigstes Kapitel „Bern, 5. April 1916. Lieber Roger Casement. Ich habe, als offizieller Delegierter des Kommandos der Irischen Freiwilligen Armee, den Auftrag, Ihnen mitzuteilen: 1. Der Aufstand ist für den Abend des nächsten Oster sonntags festgesetzt. 2. Die große Waffensendung muß spätestens am Sonnabend in der Tralee-Bucht gelandet werden. 3. Deutsche Offiziere sind zur Führung der Freiwilligen unbedingt erforderlich. Unbedingt! 4. Im Hafen von Dublin ist ein deutsches Unterseeboot nötig. Die Zeit ist kurz bemessen, aber es geht nicht anders; Sie müssen nach eigenem Ermessen handeln, Aufschub wäre ge fährlich. Ich bin der Ihre. Ein Freund von James Malcolm.“ Dieser Brief erreichte Casement durch den deutschen Ge heimdienst, der Name des Absenders wurde ihm nicht ver raten. Er, Casement, durfte den Namen eines Mitverschwo renen nicht wissen! Sie halten mich für einen Spion, dachte er verzweifelt. Auch das nahm er auf sich, wenn nur das junge irische Blut gerettet wurde! Die Freiwilligen mußten erfahren, daß kein Offizier, kein U-Boot, kein Maschinengewehr ihnen zu Hilfe kam, nur eine Bettelgabe von lumpigen zwanzigtausend Mau sergewehren alten Modells. Sie durften nicht unbewehrt in die englischen Feuerschlünde rennen. 200
Casement sah das Gemetzel, hörte das Schreien der Mütter und ihre Flüche, die ihm galten, ihm, der eine hoffnungslose, in der Entstehung schon verlorene Revolte geschürt, jahrelang geschürt und entfesselt hatte. Auf sein Haupt kamen alle Wun den, kam all das vernichtete Leben, wenn er nicht warnen konnte, solange es Zeit war. In Casements Hirn wühlten irrsinnige Pläne, bis zur letzten Spannung arbeiteten die Gedanken: wie kann ich mein Leben für die da drüben geben? Sich selbst vernichten, um damit ein Signal zu geben? Aber auch dazu fand sich kein Weg. Ein U-Boot, das ihn selbst im rechten Augenblick noch an die Küste der Heimat brachte, darum bettelte er fast auf den Knien, aber die Admiräle zuckten die Achseln. Er rief Monteith zu sich, seinen Vertrauten, der vor einem Jahr als Casements Adjutant nach Deutschland geschickt wor den war und, da es sonst nichts zu tun gab, die „Irische Bri gade“ im Zaum zu halten suchte. „Monteith!“ schrie er. „Ich will hier fort, von diesen Deut schen, die mich verraten haben! Ich will die Jungens zu Hause retten und dann in einem englischen Gefängnis, an einem englischen Galgerf sterben!" Zwischen dem Kriegsministerium und dem Auswärtigen Amt irrte er hin und her, ein Gespenst mit verheulten, wahnsinni gen Augen und fliegenden Händen, flehte um Truppen, um Offiziere, um ein U-Boot. Er berief sich auf Versprechungen, die man ihm nie gegeben hatte, fühlte sich verraten, verkauft, betrogen und wollte nicht begreifen, daß seine Bitte unerfüll bar war, daß ein Transport, wie er ihn verlangte, niemals den irischen Hafen erreicht hätte. Fünfmal an einem einzigen Tag erschien er beim deutschen Generalstab mit seiner Bitte: wenig stens ein U-Boot! Das mindeste war es doch, daß seine Lands leute rechtzeitig erfuhren, mit welcher Hilfe sie rechnen konn ten! Aber nur eine Bitte wurde ihm gewährt: er durfte den „Freund von James Malcolm“ in Bern telegraphisch unter richten. In der Stille seines Hotelzimmers fürchtete Casement, wahn sinnig zu werden. Er rief plötzlich die Gräfin Blücher an, eine geborene Engländerin, mit deren Gatten er befreundet war. 201
„Haben Sie eine Stunde Zeit für michl" Die Gräfin glaubte ihn schwerkrank in München, sie emp fing ihn sofort. Sie kannte ihn nur als den vornehmen, immer beherrschten Diplomaten. Jetzt kam er herein alt ein Gehetz ter, prüfte alle Türen und Fenster ihres Zimmers, ob Spione dahinter lauerten, sprach wie im Fieber mit keuchender, ver brauchter Stimme. „Ich sitze in der Falle, ich bin ein Gefangener in Deutsch land. Die Deutschen halten mich für einen Spion im englischen Sold. Die Engländer lassen jeden Schritt beobachten, den ich tue. Ich soll einen Auftrag übernehmen, gegen den mein ganzes Wesen sich empört. Ich werde verrückt, ich soll ein Verräter an der irischen Sache werden.“ Er warf sich in einen Stuhl und schluchzte. Die Gräfin bat: „Erklären Sie mir ...“ „Das kann ich nicht, ich gefährde sonst das Leben von an deren, und es soll doch nur mein Leben geopfert werden. Hier halten sie mir eine Pistole an den Kopf, wenn ich mich weigere mitzutun, und in England wartet der Galgen auf mich.“ Er vertraute ihr einen Stoß Abschiedsbriefe an, die nach sei nem Tode versandt werden sollten. Als er die Gräfin verließ, bat er: „Sagen Sie allen, daß ich Irland treu war, obwohl der Schein gegen mich ist!“ „Mein letzter Tag bricht an“, schrieb Casement in sein Tage buch, als der Morgen dämmerte. „Ich werde noch einmal um ein U-Boot flehen. Ich weiß, daß es nutzlos ist, aber diesen ganzen Tag werde ich nicht ruhen und rasten.“ Aber dieser letzte Tag brachte einen Schimmer von Hoff nung. Der Admiralstab wollte den Plan noch einmal beraten. Das war am 7. April. Am 8. April kam die Zusage. Am 11. April sollte Casement mit zwei Begleitern, seinem Adju tanten Monteith und einem Mann der Irischen Brigade namens Bailey, in Wilhelmshaven an Bord des U-Bootes gehen. So blieb noch eine Woche, um Irland zu erreichen, den blutigen Ostersonntag vorzubereiten - oder zu verhindern.
Schon in Erwartung dieser Reise fand Casement seine Ruhe, seine Zuversicht, seine Größe wieder. Er fuhr in den sicheren 202
Tod. Er hatte tage- und nächtelang getobt, gefleht, gebetet, um diese Fahrt an den Galgen tun zu dürfen. Alle Wirrnis dieser letzten Jahre hatte plötzlich einen Sinn bekommen: er durfte sein Leben opfern, um viele, viele Leben zu retten. Wie gern verließ er diese Welt, diesen Garten Gottes, den Dummheit, Roheit und Gier der Menschen zu einem einzigen Paradies des Teufels gemacht hatten!
An Bord des U 20 wurden Casement und seine beiden Be gleiter festlich willkommen geheißen. Eine Mahlzeit war für sie bereitet, und sie setzten sich sofort hungrig zu Tisch. Die Mannschaft bestand aus dreißig Offizieren und Soldaten, die fast ausnahmslos englisch sprachen und alles taten, ihren Gästen die Reise behaglich und froh zu gestalten. Das Boot machte mit elektrischem Antrieb acht bis neun Knoten unter Wasser und mit schweren Ölmotoren zwölf Knoten an der Oberfläche. Es führte zwei Torpedos, Laufröhren, zwei Peri skope und die Einrichtung für drahtlose Telegraphie. Nach dem Urteil Captain Robert Monteith', dessen von Spannung strotzender Lebensbericht vor wenig Wochen erst als Privatdrude in Amerika erschienen ist, hat es nie eine besser geschulte, in Disziplin und kameradschaftlichem Geist zu gleich höherstehende Schiffsbesatzung gegeben, als er sie auf deutschen U-Booten antraf. Roger Casements Stimmung wech selte, sein zuckendes Gesicht wurde ruhig, all sein Interesse galt jetzt dem Wunder eines deutschen Unterseebootes. Als das erste Tauchmanöver vorgenommen wurde, zeigte sein Ge sicht den Ausdrude eines staunenden Kindes. Das wurde ein feierlicher Augenblick. An Bord herrschte bei emsigem Manövrieren tiefste Stille, eine Stille, die man beinahe fühlen konnte. Dann erklang ein leises, ratterndes Geräusch, dann Rauschen von Wasser, das die Tanks füllte. Scharf klang ein einziges Kommando „Achtung“, dann ging U 20 in die Tiefe I In der Kapitänskajüte, in der die drei irischen Gäste unter gebracht waren, sah man nichts von den mächtigen Tiefen, in die das Schiff versank, man fühlte nur, daß ein Wunderwerk der Technik sich bereitgestellt hatte, um Roger Casement an sein Ziel zu bringen. Dies Wunderwerk war von deut 203
sehen Händen geschaffen, aber ein Irländer, John P. Holland, hatte es erfunden! Sein Leben lang hatte Holland daran ge arbeitet, und der ausgesprochene Zweck, dem er bei dieser Arbeit diente, war es, eine neue Waffe zu schmieden, die Englands Flotte vernichten und die Freiheit Irlands erzwingen konnte. Während U 20 seine Fahrt über, den Meeresboden hin machte, herrschte an Bord ununterbrochen Schweigen, denn jeder sparte an der Kraft seiner Lungen und seines Herzens. Die Maschinen arbeiteten geräuschlos, aber der gesteigerte Luftdruck machte die Nerven beben. Nach einer Reise von anderthalb Tagen zwang ein Maschi nendefekt zur Unterbrechung. U'20 mußte Helgoland ahlaufen, dort stellte sich heraus, daß Reparaturarbeiten nötig waren, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Auf die Stunde genau aber mußte Casement vor der Tralee-Bucht in SüdIrland mit dem Blockadebrecher „Aud“ und einem Lotsenboot Zusammentreffen. Dies Lotsenboot sollte kenntlich sein durch zwei grüne Lichter, grün, die Farbe der Hoffnung und die Farbe der freiheitsdurstigen Insel.. Zwei Stunden später schon war ein Ersatzfahrzeug herbei gerufen, U 19. Die Iren mußten Abschied von ihren Gast freunden nehmen. Diese zwei Stunden hatte Captain Monteith verwendet, um sich in der Bedienung eines kleinen Motorbootes unterrichten zu lassen. Es konnte notwendig werden, falls das Stelldichein mit dem Lotsen mißglückte, daß er in einem sol chen Boot die Landung zu bewerkstelligen hatte. Er ließ den Motor mehrmals anlaufen und stoppte ihn wieder, aber ein mal feuerte die Stange zurück und prellte gegen sein Hand gelenk. Sir Roger war ein schwerkranker Mann, jetzt war auch sein Adjutant Halbinvalide, nur der Sergeant Bailey war noch ein Kerl mit ganzen Gliedern und gesunden Organen. Er aber verriet seine beiden Kameraden, ehe der Hahn dreimal ge kräht hatte... Der Aufenthalt in Helgoland hatte im ganzen vier Stunden gedauert, dann führte U 19 die Iren in eine schwere, kochende See. Sir Roger, der in seinem Leben unzählige Seemeilen rings um den Globus zurückgelegt hatte, war dennoch ein schlech 204
ter Segler. Auch diesmal wurde er seekrank, das Quartier war kleiner als auf U 20, die Nahrung weniger reichlich, weniger lockend. Von den drei Iren konnte keiner essen, ihr Magen nahm nichts an als Kaffee und schwarzes Kriegsbrot. Während der Fahrt tauchten sie täglich ein- oder zweimal, nur um die Manövrierfähigkeit des Schiffes zu kontrollieren, ein einziges Mal, weil sie feindlichen Kreuzern nahe kamen. Sooft sie neutralen Schiffen begegneten, wechselten sie den Kurs, denn es war bekannt, daß die Engländer auf all diesen Booten Beobaditungsposten hatten. An Bord der Handels schiffe unter neutraler Flagge herrschte ängstliche Bewegung beim Anblick des U-Bootes. Signale flogen an den Masten hin auf, und jedesmal wurde eilig die weiße Flagge gehißt. Das U-Boot nahm keine Notiz davon. Bei grober See wurde die Fahrt von Helgoland zur TraleeBucht, rund um die Insel Irland, in fünf Tagen zurückgelegt. Während Monteith in einem geliehenen Ölanzug den größeren Teil der Reise in frischer Luft auf dem Beobachtungsturm ver bringen durfte, saß Casement all diese Zeit, nervenkrank, see krank und dennoch froh, in der schlechten Luft des Quartiers. Er war zu schwach, um durch die engen Mannlöcher empor zuklettern, er hätte Kälte und Sturm dort oben nicht wider standen. Am 20. April 1916, kurz nach Einbruch der Dämmerung, näherte sich U 19 der Mündung des Shannon und wagte sich bis fünf Meilen an die Küste heran. Im letzten Abendlicht wurde die „Aud“ gesichtet, dann leuchteten ruhig die Signale des Hafendienstes, kein Patrouillenfahrzeug der Engländer tauchte beunruhigend auf. Aber es hatte keinen Sinn, mit der „Aud“ Fühlung zu nehmen, solange das Lotsenboot seine grü nen Lampen nicht zeigte, die nach der Vereinbarung mit dem deutschen Admiralstab abwechselnd gegen Westen und Nord westen funkeln sollten. Dann war der Treffpunkt erreicht, so genau auf Länge und Breite, wie ein Stelldichein auf See nur möglich ist... Eine Stunde, noch eine halbe Stunde lang kreuzte U 19 um diesen Punkt, aber in der Nacht erschien kein Grün der Verheißung. Zuletzt raffte auch Casement sich auf, erreichte den Beobach
205
tungsturm, sah ganz nah vor sich die geliebte Küste und bohrte und spähte mit dem Feldstecher die Wellen ab. Der Pilot war nicht erschienen, Lichter kamen und gingen, weiße, grüne, rote, aber nicht das grüne Augenpaar. Der Tragödie letzter Akt begann. Ist dies ganze Unternehmen ein Manöver des deutschen Admiralstabes, um sich drei unwillkommene Gäste vom Halse zu schaffen? fragten sich die furchtbar enttäuschten Menschen, deren Herzen wie Trommeln schlugen. Oder war es möglich, daß irische Revolutionäre am Vorabend ihres größten Schlages so schamlos, so pflichtvergessen versagten? Aber die Deutschen waren empört und ehrlich enttäuscht. Was die deutsche Sprache an Flüchen besitzt, konnten die Iren in diesen eineinhalb Stun den Wartens studieren. Als U 19 lange genug wie ein graues Gespenst an der Küste hingehuscht war, erklärte der Kapitän, länger könne er die Ge fahr für sein Schiff und seine Mannschaft nicht verantworten. Unter höchster Geschwindigkeit, mit beinahe vierzehn Kno ten, segelte er die Traleebucht an. Drunten in der Kabine saß mit seinen beiden Begleitern Roger Casement, ein geschlagener Feldherr vor der Schlacht, und rüstete die Landung. In wenigen Minuten würden sie ganz allein sein, ganz ohne Hilfe und ohne Aussicht auf Hilfe den Boden Irlands betreten. Ihre Tornister waren gepackt, jetzt wurden Pistolen und Munition verstaut. „Wissen Sie, wie man so ein Ding ladet, Sir Roger?“ fragte Monteith. „Nein, ich habe nie eine Waffe geführt. Nie in meinem Leben habe ich töten wollen.“ „Sie werden lernen müssen, Sir Roger. Jetzt wird es sehr bald heißen: ,Töte oder werde getötetI*“ Dann versuchte Casement, in einem kurzen Schlaf neue Kräfte zu sammeln. Mit geschlossenen Augen saß er an die Wand der Kajüte gelehnt, aber er schlief nicht ein. Nach einer halben Stunde sprach er plötzlich, ganz klar, in die Stille hin ein: „An uns liegt nicht viel. Aber es ist schade, daß die eng lischen Patrouillen morgen fast sicher das Waffenschiff finden werden. Darum ist es sehr schade.“
206
Er überdachte alles: wenn es ihm nicht gelang, zur rechten Stunde noch den Aufstand abzublasen, würden die irischen Jungen morgen mit nackten Händen in den Kampf ziehen. Es würde ihre Hoffnung sein, von einem fallenden Freund oder Feind ein Gewehr zu erben, und jeder, der so focht, trug un sichtbar eine hänfene Schnur um den Hals. Das Unterseeboot stoppte, eine Nußschale von Boot wurde zu Wasser gelassen. Man drückte ringsherum viele Hände, man sagte einander im Flüsterton „Fahrt wohl“ und „Gut Glück!“ Dann nahm die kleinste und armseligste Okkupa tionsarmee, von der die Geschichte weiß, ihren Start. Den Motor, der vor wenig Tagen Captain Monteiths’ Arm zerschlagen hatte, hatte der U-Boot-Kapitän verweigert, sein Geräusch hätte U 19 verraten können. Monteith wollte sein Wort verpfänden, daß er den Motor nicht anwerfen würde, solange das U-Boot in Sicht war. Aber seine Bitte war nicht gehört worden, und zuletzt hatte Casement selbst dem Kom mandeur recht gegeben. Welch ein Wahnsinn, diesen kranken Mann in den sicheren Tod zu führen! dachte Monteith, während das U-Boot im Morgendämmer verschwand. Es fanden sich drei Ruder in der schaukelnden Nußschale, aber kein Steuer. Casement und Bailey wußten nicht mit Rudern umzugehen. Monteith hatte seit zwanzig Jahren keins in der Hand gehabt. Casement saß im Stern des Fahrzeugs und versuchte, mit einem der Ruder die Richtung zu geben. Aber er war zu schwach, bald gab er es auf. Monteith und Bailey warfen sich in die Riemen, so gut sie konnten, aber sie hatten sich schon naß und müde gearbeitet, als die Küste noch nicht hundert Meter näher gekommen. Ihre Ruder hatten nicht die gleiche Länge, so hatten sie mit furchtbarster Anstrengung einen wei ten Kreis beschrieben, und nun gab es - zwischen Tod und Leben, aber näher dem Tod als dem Leben - Streit. „Sie ziehen nicht ordentlich an, Captain“, murrte der Sergeant. „Allein kann ich’s nicht schaffen. Pfui Teufel und Hölle!“ Casement sagte scharf: „Ich habe hier das Kommando, Sie sollen schweigen und rudern.“ 207
Zuletzt nahm Monteith beide Rudet und manövrierte sich an die Klippen heran. Aber er fuhr Zickzack, mit zwei unglei chen Rudern und einem zerschlagenen Handgelenk. Je näher sie der Küste kamen, um so rauher wurde die See. Das Boot tanzte über schäumende Brecher hin, machte Berg- und Talfahrt, Monteith gab den letzten Rest seiner Kraft hin. Als seine rechte Hand zu einem unförmigen Klum pen geschwollen war, mußte Bailey wieder das Ruder neh men. Casement gab die Richtung, tröstete, feuerte an. „Mehr Backbord I Etwas Steuerbord I Nur noch hundert Meter! Gleich habt ihr’s geschafft!" Wenn Monteith mit schweißüberströmten Augen nach Case ment blickte, sah er als Hintergrund seiner pathetischen Er scheinung einen drohenden Wall von gischtender See. Es blieb nicht lange beim Drohen, plötzlich kam eine Riesenwelle her angerollt, brach sich am Stern des Bootes, schleuderte Case ment auf Bailey und beide zugleich gegen Monteith. Sie versuchten ihre Plätze wieder zu gewinnen, da fauchte eine neue Brandung heran, stürzte das Boot und schleuderte seine Insassen hinaus, wie eine Seemannsfaust Würfel aus dem Becher rollt. Die Rettungsgürtel hielten sie über Wasser, sie kämpften sich wieder an das Fahrzeug heran, richteten es auf, kletterten auf ihre Sitze zurück. Wieder versuchten sie, den Kampf mit Rudern zu bestehen, aber gleich darauf wurde das Boot auf eine Sandbank ge worfen, und jetzt schlugen so furchtbare Brecher auf die tod müden Menschen ein, daß jeder Widerstand sinnlos wurde. Schwimmend und watend, immer in Gefahr, an die Felsen geschmettert zu werden, erreichten sie endlich die Küste. Monteith, der nur mit einem Arm schwimmen konnte, war der letzte. Er fand seine Kameraden im Sand ausgestreckt, sie hatten nicht mehr die Kraft gehabt, drei Schritte weit land einwärts zu gehen. Immer wieder rollte die Flut über ihre Körper hin, Casement schien es nicht zu empfinden, er hatte wohl das Bewußtsein verloren. Mit geschlossenen Augen lag er im dünnen Mondlicht und sah aus, als ob er friedlich schliefe. Es schien Monteith, daß er an ein zufrieden schlum 208
merndes Kind erinnerte. Monteith zerrte dann seinen schweren Körper aus der Flut, versuchte Casements Arme und Beine zu bewegen, um das Blut wieder in Umlauf zu bringen. Auch Bailey war dem Erliegen nahe. Achtzehn Monate Ge fangenschaft, viele Entbehrungen lagen hinter ihm. Seit ihrer Abfahrt aus Wilhelmshaven hatte keiner von ihnen gegessen, seit vierundzwanzig Stunden keiner geschlafen. Später warfen sie die Kleider ab, standen nackt in der eisi gen Brise, wrangen das triefende Zeug Stück um Stück aus, rieben ihre Glieder, gossen Bäche von Wasser aus den See stiefeln. Dann wurde ihnen wohlcr. „Ein hübsches kleines Abenteuer, Sir Roger?“ sagte Mon teith. „Wir können zufrieden sein." Casement schlug ihm leicht auf die Schulter, wie es seine Gewohnheit war, wenn er sich heiter fühlte, und gab zur Antwort: „Ja, Captain Monteith, wir haben ein schönes Kapitel Roman angefangen und sind dem Ende schon nah." Später, als Casement seinen Kalvarienweg vollendet hatte, dachte Monteith mit Bitterkeit an diese letzte Stunde zurück. Hätte ich ihn schlafend liegen lassen, von eisigen Seen über rollt, dachte er. Wie gut hat es das Meer mit ihm gemeint I Wie sanft und großmütig hatte sich der Tod ihm damals ge naht ... Am gleichen Tag segelte das Frachtschiff „Aud“ unter nor wegischer Flagge, beide Schiffsbreiten in norwegischen Farben frisch bemalt, die Südwestküste von Irland hin. Die „Aud“ hatte sich, kommandiert von Kapitän Karl Spindler, mit phantastischer Gewandtheit durch die Blockade geschlichen, durch die Ostsee, durchs Skagerrak und Kattegat in die Nordsee, war nordwärts bis über den Polarkreis, dann in einem Riesenbogen nach Westen ausgewichen und hatte sich endlich wagemutig mitten hinein in den irischen Küstendienst gestürzt. Auf Tag und Stunde ihrer Verabredung treu, lagen beide, das U-Boot und die „Aud", vor dem Hafen von Tralee. „Es ist unaufgeklärt und wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben, warum Casement den U-Boot-Führer nicht veranlaßt 14
Paradiese
209
hat, nach uns Ausschau zu halten, noch auf die verabredeten Signale wartete, die ich selbst mit ihm vereinbart hatte", be richtete Spindler vier Jahre später. Bald darauf erschien die „Aud“ dem englischen Kriegsschiff „Bluebell" verdächtig. Es signalisierte sie an, die „Aud“ gab zurück, sie sei auf der Fahrt nach Genua. „Folgen Sie uns in den Hafen!“ Die „Aud“ gehorchte nicht, ehe ein Schuß über ihren Bug ins Wasser zischte. Dann änderte sie den Kurs und folgte der „Bluebell“ zehn Meilen weit in der Richtung auf Queenstown. In der Einfahrt zum Hafen stoppte sie ihre Maschinen. Auf Steuerbord stieg eine dicke weiße Rauchwolke auf. In diesem Augenblick war die „Bluebell“ nur wenige hundert Meter entfernt. Am Hauptmast der „Aud" wurden plötzlich zwei deutsche Fahnen gehißt. Die „Bluebell“ schoß noch zweimal über ihren Bug. Die „Aud“ ließ vollbemannte Boote nieder, die unter der Kapitulationsflagge auf das Kriegsschiff zuruder ten. Es waren deutsche Seeleute unter dem Befehl von zwei Marineoffizieren. Die „Aud“ sank; zehn Minuten später war nichts mehr von ihr zu sehen. Sie nahm zwanzigtausend deutsche Mausergewehre und ihre Munition mit sich auf den Grund des Meeres. Später erfuhr man, daß der britischen Admiralität schon seit einer Woche bekannt war, wo und wann das deutsche Hilfs schiff zu erwarten war. Einem Expeditionskorps, wie Roger Casement es ersehnt hatte, wäre dasselbe Schicksal beschieden gewesen.
Fünfundzwanzigstes Kapitel „Das beste, was Gott dieser Erde gab, ist der Tod." An einem seiner letzten Tage, den Blick fest auf den Galgen gerichtet, vor dem nichts ihn mehr bewahren konnte, schrieb Casement in einem Abschiedsbrief an seine Schwester: „Als ich an jenem Morgen in Irland landete, schwimmend und watend einen fremden Strand erreichte, war ich seit viel mehr als einem Jahr zum erstenmal glücklich. Ich wußte, daß
210
dies Schicksal auf mich wartet, aber ich war glücklich und konnte wieder lächeln. Ich kann Dir nicht beschreiben, was ich fühlte. Die Sandhügel waren voll von Feldlerchen, die sich in die Morgendämmerung aufschwangen, zum erstenmal seit Jahren hörte idi sie - ihr Gesang war das erste, was ich durch das Brausen wahrnahm, als ich mich durch die Brecher kämpfte. Sie stiegen immer wieder empor und hingen über der Burgruine von Currshone, wo ich stand und meinen Begleitern den Weg wies. Ringsum blühten Primeln und wilde Veilchen, die Lerchen schlugen, und ich war wieder in Irland. Als es heller wurde, war ich ganz von Glück erfüllt, ich fühlte immer, daß ich nach Gottes Willen hier stand.“ Am Strand von Tralee gab es nur wenige Häuser, in denen niemand wachte. Hier brauchte man keine Waffen - Casement, sein Adjutant Monteith und Bailey, Sergeant der Irischen Brigade, vergruben ihre Pistolen und Patronen in den Sand. Roger Casement, dessen Erscheinung aufgefallen wäre, ver barg sich im Gemäuer einer zerfallenen Ritterburg, Monteith und Bailey marschierten nach Tralee, um auszukundschaften, wie die Dinge statfden. Es war Karfreitag, die Glocken läute ten, die Straßen waren voll von Menschen, die zur Messe gin gen. .. Zwei Stunden später fuhren drei Führer der irischen Bewe gung im Auto zu der Ruine am Strand, um Casement heimzu holen. Aber sie fanden ihn nicht mehr, sein Schicksal war schon entschieden. Ein Fischerkind hatte die geladenen Revol ver beim Spielen aus dem Sand gegraben, ein Radfahrer hatte die Polizei alarmiert, Roger Casement hatte im ersten Dämmer licht die Küste seiner Heimat betreten und war gefangen, ehe sie im Mittag stand. Nie wieder sollten ihm die Lerchen schlagen, die Primeln leuchten und die Veilchen duften.
Der Gefangene nannte sich Richard Morton aus Dublin, aber die Revolver, seine nassen Stiefel, ein fremdes Boot, das nah dem Strande schaukelte, machten ihn so verdächtig, daß der Gendarm ihn ins Gefängnis führte. Dort verlangte der Arrestant sofort einen katholischen Priester. Es erschien ein Dominikaner-Pater, und Casement gab sich ihm zu erkennen.
M'
211
„Ich beschwöre Sie, Pater, teilen Sie den Freiwilligen in der Stadt und überall sonst mit, daß sie ruhig bleiben. Sagen Sie ihnen, daß ich gefangen bin, der Aufstand wäre eine verlorene, hoffnungslose Sache, denn der Beistand, den sie erwarten, trifft nicht ein!" Tags darauf erschien in den Zeitungen ein verstecktes Inserat: „In Anbetracht der kritischen Lage werden alle Befehle aufgehoben, welche den irischen Freiwilligen für den morgigen Tag gegeben wurden." Mit dieser „kleinen Anzeige“ sollte eine große Revolution abgeblasen werden. Nun war die ganze Last von Roger Casements Herzen ge nommen, unter deren Druck er in Berlin geweint und gebetet hatte, die seine Fahrt im deutschen Unterseeboot, das von Kriegsschiffen gejagt wurde, zu einem Kalvarienweg gemacht hatte. Er ging nun sterben, das kam ihm so leicht vor, daß er die letzte Stunde herbeisehnte. Sein Märtyrertod war es, was die irische Bewegung brauchte, um so mächtig zu werden, daß sie die Freiheit der grünen Insel erreichen würde, auch ohne deut sche Waffenhilfe - statt beim ersten Aufflackern schon in Blut ersäuft zu werden. Nur eine Bitternis sollte ihn noch treffen: der Brigadier Bailey verriet ihn und Monteith, Bailey, der ein zige von „seinen Soldaten“, dem er Vertrauen geschenkt hatte!
Henry W. Nevinson, ein Freund aus alten Tagen, besuchte Sir Roger im Untersuchungsgefängnis, drei Tage vor der Hauptverhandlung. „Seine Augen waren so frei, geradaus und blau wie immer. Er war bezaubernd höflich, er sprach zu dem Wärter wie zu einem Freund: ,Ich hoffe, unser Gespräch hält Sie nicht zu lange auf?' Er erzählte von Deutschland, als käme er von einer Studien reise. ,Die Deutschen würden gern Frieden machen, Belgien und die besetzten Provinzen von Frankreich freigeben. Man spürt dort gar nichts von Haß gegen Frankreich, sie sagen nur, Eng land habe den Dolchstoß von hinten geführt. Aber selbst gegen uns ist der Haß im Schwinden, das ganze Volk denkt nur an seine Verteidigung gegen einen Ring von Feinden.* 212
Es wurde ein kluges, lebhaftes Plaudern, das drei Viertel stunden dauerte und alle Themen berührte, nur nicht Casements eigenes Schicksal. .Bitten Sie doch Bernard Shaw, er möchte über Max Dauthendey schreiben! Ein deutscher Dichter, der in Java fest gehalten ist und vor Heimweh beinahe stirbt!“* Nevinson schließt seinen Tagebucheintrag: „Wir durften beim Abschied einander die Hand nicht drücken. Als er in seine Zelle zurückgeführt wurde, winkte mir sein Arm den irischen Gruß." „Wahrscheinlich wird er in einem Monat gehenkt, nie werde ich dies einzig vornehme und schöne Gesicht wiedersehen." Am 26. Juni erschien Sir Roger Casement vor dem höchsten Gerichtshof Englands. Die ganze Welt blickte auf diese Ver handlung. Er trat auf wie ein freier Mann, der nichts zu fürch ten hat. Ein Teilnehmer an dieser Verhandlung schrieb: „Er schien der vornehmste Mann in diesem Saal und der glück lichste.“ Drei Tage dauerte die Beweisaufnahme, Zeuge um Zeuge... Frühere Gefangene aus dem Lager in Limburg, die wegen Krankheit ausgetauscht worden waren, schilderten seine Agita tion, schilderten, wie er im Bund mit dem deutschen Armee kommando Freiwillige gegen die englische Krone geworben hatte. Er sprach kein Wort, drei Tage lang ließ er Ankläger und Verteidiger in alle Falten seines Wesens leuchten, ohne einmal das Wort zu ergreifen. Es gab da kein Geheimnis, nichts, dessen er sich schämen mußte. Seinen Kampf hatte er mit offenem Visier und im hellsten Lichte des Tages geführt. Sein Verteidiger stellte vor allem fest: „Sir Roger Casement war nicht im Dienste Englands. Er war im Dienste des Vereinigten Königtums; im Dienste Sr. Ma jestät war er nur insofern, als das ganze Reich Domäne Sr. Ma jestät ist. In Irland gibt es nicht nur ein Volk für sich, Irland ist ein Land für sich. Die Treue eines Iren ist Treue zu Irland, und es wäre ein Schicksalstag für das Reich, an dem diese Treue eines Mannes zu seinem Volk als Verrat an seinem Schwestervolk gebrandmarkt würde." Als der Gerichtshof eine Stunde lang beraten hatte und mit
213
dem einstimmig gefällten Urteil „Schuldig“ in den Saal zurück kehrte, erhob sich Roger Casement zum letzten Wort. Er hatte oft daran gedacht, sein Todesurteil und dessen Vollziehung schweigend hinzunehmen, er hatte ja abgeschlossen mit allem auf der Welt. Aber die Geschichte der Revolutionen lehrte, daß die letzte Rede eines gefangenen Märtyrers der Sache besser dient als alle Reden und Taten derer, die noch frei sind, deren Schicksal noch Sieg werden kann, und so schuldete er der seinigen noch diesen einen Dienst. Roger Casements letzte Rede war durchdacht und aufge baut wie das Plädoyer eines großen Advokaten, der zugleich Geschichtsphilosoph ist, so kristallen klar und so schön wie vielleicht keine andere Rede seines Lebens. Sie wird noch heute in den Schulen des dank Roger Casements und seiner todesverachtenden Genossen frei gewordenen Irlands gelesen; es ist kein Wort von Haß darin, kein Wort von Chauvinis mus - er stellt nur fest, daß in Irland Menschenrechte zer treten werden seit Jahrhunderten. Die englischen Richter, die ihn verurteilten, seien nicht seine Richter. Er, der er als Ire in Irland gelandet und gefangen worden war, habe An spruch auf ein irisches Gericht. „Eigene Regierung ist unser Recht, das darf uns ein anderes Volk sowenig nehmen wie das Recht zu leben - wie das Recht, die Sonne zu empfinden, Blumenduft zu atmen, das eigene Blut zu lieben. Nur dem Sträfling, der überführt und verurteilt ist, werden diese Rechte vorenthalten. - Irland, das niemandem Unrecht getan hat, kein anderes Land gekränkt, nie danach verlangt hat, andere zu beherrschen, Irland wird heute behandelt, als sei es unter allen Völkern der Welt ein überführter Sträfling. Wenn es Aufruhr ist, gegen solch ein unnatürliches Los zu kämpfen, dann bin ich stolz darauf, ein Rebell zu sein, und hänge mit dem letzten Tropfen Blut an meiner Rebellion.“ Er sprach für die Iren, wie er einst für die Kongo-Neger und für die Putumayo-Leute gesprochen hatte, er, der evan gelische Ulstermann, der nur deshalb Sinnfeiner geworden war, weil er nicht ertragen konnte, Gewalt und Barbarei herr schen zu sehen. 214
„Wo aus allen Rechten ein einziges Unrecht wird, wo der Mensch mit stockendem Atem um Erlaubnis flehen muß, seine eigenen Gedanken zu denken, die eigenen Lieder zu singen, die Früchte seiner eigenen Arbeit zu ernten - und während er fleht, all diese Dinge weiter von sich gerissen sieht -, da ist es tapferer, klüger und treuer, ein Rebell im Geist und in der Tat zu sein, als solchen Zustand wie natürliches Schicksal demütig hinzunehmen!“ Das letzte Wort sprach der Vorsitzende, Viscount Reading, und dabei war sein Gesicht schauerlich weiß über dem scharlach roten Talar: „Sir Roger Casement, Sie werden von hier ins Gefängnis geführt und aus dem Gefängnis an die Hinrichtungs stätte, und dort werden Sie so lange am Hals aufgehängt, bis Sie sterben. Gott der Herr sei Ihrer armen Seele gnädig!"
Aus den vielen Gnadengesuchen, die an den Premierminister gerichtet wurden, ist ein Argument bemerkenswert. „Sie finden gewiß nicht, Sir Roger sei ein Nationalheros. Und wir glauben, Sie wünschen nicht, daß er es werde. Aber es gibt ein unfehlbares Mittel, ihn zum Nationalheros zu machen - lassen Sie ihn hängen!“ „Morgen, am Sankt Stephanstag, sterbe ich den Tod, den ich gesucht habe“, schrieb er am 2. August in sein Tagebuch. In diesen Wochen zwischen dem Todesurteil und seiner Voll streckung, die voll klarer Heiterkeit waren, trat Roger - jetzt nicht mehr Sir Roger - zum katholischen Glauben über. „Welch ein schöner Morgen!" sagte er, als der 5. August anbrach. Er hatte lange und gut geschlafen, seine Stimme war fest geworden, und seine Hände zitterten nicht mehr - bis zur Abfahrt nach Tralee war er ein zerstörter Mann gewesen, dem Wahnsinn nahe. Die Hände auf den Rücken gebunden, schritt er aufs Scha fott, hoch aufgereckt. Ein Abschiedswort an seine Priester, die vor dem Galgen knieten, sprach er mit Lächeln. Sein Leichnam mit dem schönen, ruhevollen Gesicht wurde zwischen früheren Opfern des Galgens beigesetzt. Die Behörde verweigerte ihm ein Grab in Irland, aber fünf Jahre später war Irland ein freier Staat. 215
Antifaschistische Publizistik
Anno vierunddreißig in der UdSSR
Drei Monate hat das Glück nur gedauert, und nun sind schon wieder drei Jahre darüber ins Land gegangen. Ich kam in Moskau so unwissend und so skeptisch an wie nur irgend einer aus dem Lager der bürgerlichen Demokratie, den erst der Faschismus zum Revolutionär gemacht hat. Dann schien ich mir ein Gulliver, der durchs Land der Riesen, der Lili putaner, der Pferde reist - ich sah lauter Wunder und traute lange Zeit den eigenen Augen nicht. Was ich in einem Leben voll ewigen Reisens gesehen hatte, in Ägypten, von einer Welt, die vor Jahrtausenden lebendig gewesen, in Indien, wo jeder Europäer sich verzaubert glaubt, in Zentral-Afrika, wo tollste Knabenträume und waghalsigste ' Filmphantastik plötzlich Wirklichkeit waren - all das schien mir jetzt abgestanden, war nicht mehr groß, nicht kühn, nicht Fata Morgana. Ich war nie ein Redner gewesen, nur im kleinen Kreis ein frischer Erzähler. Aber jeder Mensch redet gut, ja gewaltig, wenn ihm das Herz voll ist von unerhörten Eindrücken und wenn er es für heilige Pflicht hält, diese Eindrücke weiterzu geben. So bestieg ich - zum erstenmal in meinem Leben ohne Lampenfieber - in Prag eine Tribüne, um über meine RußlandReise zu berichten, ohne Manuskript, nur ein Dutzend Stich worte auf einem Blättchen Papier, und mein erster Vortrag, während dessen kein Hörer abtrünnig wurde, dauerte drei Stunden; aber mein Material war nicht halb erschöpft. So konnte ich vor dem gleichen Publikum ein zweitesmal und ebenso lange sprechen, ohne mich zu wiederholen, ich wurde in die deutsch-tschechischen Provinzstädte gerufen, um auch dort zu berichten, und wieder erzählte ich anderes. 219
Was mich schrankenlos begeistert hatte und worauf all das für die Hörer im kapitalistischen Land so Märchenhafte hin auslief, war die geistige Situation in Rußland, die Wißbegier, die Lernbegier, die Kunstfreudigkeit, die sich zugleich der breitesten Massen bemächtigt hat in einem Lande, das von zahlreichen Nationen und so verschiedenen Rassen bewohnt wird. Um dies Phänomen aus der materiellen Lage der Union auf die ich sonst wenig einging - zu erklären, rief ich einen Eideshelfer herbei, der sonst vor Begeisterten der kommunisti schen Welt selten zitiert wird, Mussolini. Mein Zitat lautete: „Es ist die grausamste Ironie, Menschen, deren Mägen leer sind, ein Buch in die Hand zu drücken. Kann man denn mit Hungernden über Politik und Ethik, Kunst, Literatur und Wirtschaft sprechen? Nur der Satte ist imstande, menschlich zu denken.“ Ich will - denn meine drei Jahre alten Eindrücke sind heute schon wieder historisch-interessant - einen Extrakt des sen wiedergeben, was damals so aufrührerisch und funkelnd neu war: lauter Satte und menschlich Denkende - wo immer ich russischen Menschen begegnet war - hatten über Politik und Ethik, Kunst, Literatur und Wirtschaft zu hören, zu spre chen gewünscht, in den Fabriken, in den Kasernen, in den Klubs und Schulen und Sanatorien.
Am ersten Tage in Moskau gab man mir Gelegenheit, eines der größten Industrieunternehmen Rußlands zu besichtigen, ein Werk, das damals zwanzigtausend Arbeiter beschäftigte und in dem am laufenden Band Lastautomobile hergestellt werden, deren Entstehen vom Motorgehäuse bis zum fertig karossierten Wagen man Phase um Phase in weniger als zwei Stunden beobachten kann. Im Hauptportal dieser riesigen Arbeitsstätte war eine ganze Wand mit engbeschriebenen oder betippten Plakaten behängt, und wir Besucher sahen um diese Wand zeitung Arbeiter und Arbeiterinnen gedrängt, Zeile um Zeile eifrig studieren. Wir mutmaßten, der russischen Schrift und Sprache nicht kundig, daß hier ein Bericht von der Arbeits front täglich geliefert werde, eine Liste der „Stoßbrigadler“ veröffentlicht würde, die sich durch hervorragende Leistungen
220
aus der Masse ihrer Kollegen hervorgehoben hatten. Es mochte freilich auch sein, daß man die Tageswirachaft des inneren Betriebes hier anschlug. Aber darum handelte es sich jetzt nicht. Was die Arbeiter in der ersten Minute ihres Antritts zum Tagewerk und was sie abends nach Beendigung ihrer Schicht zu lesen bekamen und mit Gier lasen, war ein Ver zeichnis der neuerschienenen Bücher mit Angaben des Inhalts und der Tendenz, dazu die ersten Urteile namhafter Kritiker und Kollegen der Autoren. Diese erstaunliche Wandzeitung bewirkte, daß ich auch im Innern des Werkes mehr als dem Verlauf eines Arbeitspro zesses, der sich mit den größten Betrieben der Neuen Welt wie der Alten messen kann, dem nachforschte, was diese Arbeiter an geistiger Nahrung zu sich nahmen. Da war die Bibliothek, in der Tausende von Bänden bereit sind und unablässig ausgetauscht werden, es gab kaum einen Arbeiter oder eine Arbeiterin unter den zwanzigtausend, die nicht zu den ständigen Benützern dieser Bibliothek gehörten. Neben der technischen und soziologischen Literatur spielte die schöne Literatur in ihrem Verbrauch eine gewaltige Rolle, nicht nur die Werke der jungen Generation sowjetrussischer Schriftsteller, sondern auch die des Auslandes, nicht nur die russischen Klassiker, sondern auch die der Weltliteratur wur den reihum unermüdlich gelesen - aber nichts fanden wir hier von dem, was man in Deutschland zwar verächtlich als Kitsch bezeichnet, was aber das leidenschaftlichste Interesse unserer jugendlichen Leser, unserer Frauen und Männer erregt, nichts von all dem Detektiv- und Verbrecher-Roman-Machwerk, des sen Auflageziffer in Europa wie in Amerika die der ernsten Literatur weit in Schatten stellt. In diesem Automobilwerk erschien eine Tageszeitung, die nicht nur alle internen Fragen des Betriebes besprach, sondern auch ein geistiger Führer der Arbeiter sein wollte und war, in die sem Werk gab es neben der Bibliothek Arbeit»- und Lesesäle, und gerade dies literarische Departement, diese Bibliothek und diese Räume, in denen kein lautes Wort fällt, in denen jeder über seine Bücher gebeugt sitzt, schien das Herz des gan zen Werks zu sein. 221
In früheren Jahrzehnten, in denen Hygiene in der ganzen Welt noch ein Vorrecht der besitzenden Klassen war, hat ein Philosoph behauptet, man könne den Kulturstand eines Volkes an seinem Verbrauch von Seife errechnen. In unseren Tagen neigt man mehr dazu, den Verbrauch an Büchern zum Wert messer einer Kultur zu machen, und soweit dieser Verbrauch sich in Auflagehöhen ermessen läßt, marschierte Rußland schon 1934 so weit voraus an der Spitze aller Nationen, daß eigent lich kein Vergleichen mehr möglich war, daß wir Träger der westlichen Zivilisationen nichts als staunen und uns schämen konnten. In den letzten sechzehn Jahren betrug allein die Gesamt auflage der in der Sowjetunion herausgegebenen Werke Maxim Gorkis 29,7 Millionen Exemplare! Dieser Rekord schlägt nicht nur um ein vielfaches alles, was im Laufe der Jahrhunderte irgendein ernster literarischer Autor irgendwo auf Erden er zielt hat, er schlägt sogar die erfolgreichsten Vertreter des literarischen Schundgewerbes wie etwa den sagenhaften Edgar Wallace. Freilich stand Maxim Gorki auch in Rußland auf einsamer Höhe, aber es gab außer ihm noch eine ansehnliche Reihe von Autoren, von deren Werken Millionenauflagen im Umlauf waren. So hatte der ganz junge, erst seit wenig Jahren bekannte Kosakenschriftsteller Michail Scholochow es zu einem Gesamtabsatz seiner drei Werke von 2,3 Millionen gebracht, also den für Westeuropa völlig einmaligen Sensationserfolg von Remarques „Im Westen nichts Neues“ zu seinem Durch schnitt gemacht. Zur Feier des Schriftstellerkongresses wurden im russischen Staatsverlag nicht weniger als sechs Millionen Exemplare rus sischer und ausländischer Autoren wie Barbusse, Romain Rol land, Stefan Zweig gedruckt, und sie waren im Augenblick abgesetzt, durch zahllose Kanäle in die Masse des Volkes ge pumpt. Vor solchen gigantischen Zahlen wende man nicht ein, daß Rußland eben ein Volk von hundertsiebzig Millionen ist und daß man naturgemäß andere Maßstäbe als für Frankreich, England oder Deutschland anwenden müsse. Tatsächlich setzt sich beispielsweise das deutsche Lesepublikum aus annähernd neunzig Millionen Deutschsprechenden der verschiedenen 222
Nationen zusammen. England schließt in seinen Leserkreis das weite Gebiet der Dominions und Kolonien ein - und vor allem: von den hundertsiebzig Millionen Russen waren zu Beginn der Revolution, also vor damals siebzehn Jahren, noch mehr als zwei Drittel Analphabeten! Um selbst auf dieses gigantische I noch einen Punkt zu set zen: Produzenten und Konsumenten der Literatur klagten gleicherweise, daß die Papierindustrie Rußlands noch lange nicht weit genug sei, um den Bedürfnissen zu entsprechen. Es würden so viele Bücher hergestellt, wie die Papierproduktion nur irgend gestattete, aber die riesigen Auflagen seien im Augenblick vergriffen, und niemand könne berechnen, wie stark der Absatz wäre, wenn, so wie im übrigen Europa, nur das Bedürfnis, nicht die Lieferungsmöglichkeit die entscheidende Rolle spielte. Täglich und stündlich sah man vor dem Eingang zum Ge werkschaftshaus, in dem der Kongreß tagte, ein paar hundert Menschen dicht aneinandergedrängt und lautlos Spalier stehen, Arbeiter aller Berufe, Männer und Frauen, die stundenlang ausharrten, um den einen oder anderen ihrer Lieblingslehrer, Lieblingsdichter von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Immer waren die Galerien des Kongreßsaales überfüllt, Kopf an Kopf standen die Menschen dort oben, stundenlang, und woll ten kein Wort verlieren von dem, was diskutiert wurde. Und doch war es natürlich auf einem Fachkongreß nichts anderes als das, was man in Deutschland als Fachsimpelei bezeichnen würde: ästhetische Probleme, vergleichende Literaturwissen schaft, kaum ein Wort von Politik, nie ein Wort von Gewerk schafts- und sozialen Fragen. Eines Tages erschien im Kongreß eine Schar von „roten Pionieren". Es waren Buben und Mädchen zwischen zwölf und vielleicht sechzehn Jahren, alle gleich und sehr bescheiden gekleidet, mit nackten Beinen und nackten Armen, offenen sonnengebräunten Gesichtern und einem herrlich frischen, selbstbewußten Auftreten. Eine Abordnung dieser Kinder be stieg die Estrade, zwei Fanfarenbläser gaben Signale, und jetzt standen zwölf Kinder vor dem Vorstandstisch, in dessen
Mitte unfeierlich und dennoch ehrwürdig Maxim Gorki saß. Die Kinder wollten ihren Schriftstellern für das danken, was sie schon für sie getan haben, sie wollten vor allem kund geben, welche Wünsche sie für die Zukunft hegen. Das ganze Programm dessen, was sie zu lesen wünschten, hatten sie in Verse gebracht und trugen es mit verteilten Rollen vor. Sie wollten nur Wirklichkeit, nichts Erdachtes und Ausphantasier tes, aber die romantisch bunte, gewaltige Wirklichkeit des gan zen Erdballs von den Tropen bis zur Arktik, sie wollten die Taten und Abenteuer von Männern und Kindern, die wirk lich gelebt haben, sie wollten uns mitteilen, daß ihr Hunger nach Weltkenntnis durch die bestehende Literatur noch lange nicht gesättigt sei. Als sie ihre Verse zu Ende gesprochen, ge schmettert hatten, streuten sie Hände voll Blumen über Maxim Gorkis Haupt und Hände, streuten Blumen in den Saal hin aus, und dann verließen sie marschfest, mit stolzen Gesichtem den Kongreß. Zu einer anderen Stunde erschien eine Deputation von Sol daten, dann wieder kamen Matrosen der Roten Marine, es kamen Arbeiter-Deputationen der verschiedensten Werke aus fern gelegenen Städten - alle wollten sie den Augenblick be nützen, in dem so viele Autoren, „Ingenieure der Seelen", zu sammensaßen, nicht um Begrüßungsphrasen zu dreschen und unter dem Stabe einer guten Regie Volksinteresse für die Literatur zu mimen, sondern um knapp und klar an richtiger Stelle zu sagen, wonach sie verlangten. „Kommt zu uns auf unsere Kriegsschiffe I“ rief der Vertreter der Seesoldaten. „Wir werden euch die beste Kammer und unser bestes Essen geben, wir werden euch verwöhnen und schießen lehren, wir werden euch unsere Herzen öffnen, euch an unserem ganzen Leben und Denken teilnehmen lassen. Aber dann geht hin und schreibt uns Bücher vom Marine soldaten, in denen wir uns wiedererkennen und im Spiegel eurer Augen sehen!“ Entsprechend der Stellung des Schrifttums im öffentlichen Leben von Rußland war der Platz, den Rußlands repräsenta tivster Schriftsteller Maxim Gorki einnahm. Sein Bild hing überall neben dem Lenins oder Stalins, er war der Freund und 224
Berater aller Männer, die in diesem Riesenreiche die verant wortungsvollsten und wichtigsten Posten einnahmen. Wie man ihn liebte, wie man auf jedes seiner Worte lauschte, wie man ihn las - all das ist nie dagewesen. In keinem Lande der Welt, in keiner Zeit hat ein lebender Schriftsteller, ja hat auch nur ein toter Schriftsteller solches Ansehen, soviel Liebe ge nossen! „Vielleicht!“ schrieb damals Jean Richard Bloch, „hat das Volk von Athen an seinen Aischylos ähnliche Forde rungen gestellt und ähnlich an ihm gehangen wie die Völker der Sowjetunion heute an ihren Dichtern und Erzählern. Aber der Athener waren vielleicht fünfzigtausend, die Sowjetrepublik zählt hundertsiebzig Millionen Bürger!" Wir ausländischen Delegierten und eine große Zahl russischer Autoren waren zu Gast auf Maxim Gorkis „Datsche“, seinem Landsitz - es war ein stilles altes Schlößchen in Gärten und Wäldern, eine gute Autostunde von Moskau. Maxim Gorki beantwortete Fragen, sprach seine Eindrücke über neue Werke aus, erkundigte sich nach den Problemen und Meinungen in den Heimatländern seiner Gäste. Es war ein geselliges Bei sammensein, kein Kongreß, wer sprechen und fragen wollte, verlangte das Wort. Da stand ein Chinesenmädchen auf, eine zierliche, dunkelhäutige, junge Schriftstellerin, Hu-Lan-Schi, unser aller Liebling. Sie sprach deutsch, aber nur in Satz brocken, Substantiven, seltsam akzentuierten kleinen Wort schreien, und sie erzählte von einer Freundin, die Maxim Gorki ins Chinesische übersetzt hat und die sich so sehr gewünscht habe, „alte Golki“ einmal nur ins Auge blicken zu dürfen. Aber man hatte sie lebendig begraben, nach ihr sind in China noch zwei Übersetzer von „alte Golki“ ermordet worden, und die Zahl der ermordeten, lebendig begrabenen, totgefolterten Dichter und Schriftsteller in China sei riesengroß. „Aber wenn man ein Herz hat - man kann es nicht schweigen“, sagte Hu, und weinend erklärte sie, sie und ihre Kameraden würden weiter dichten und schreiben und für die Freiheit sterben. Gorki weinte - das war seltsam, denn Hus Rede war noch nicht übersetzt, und er hatte uns nicht verraten, daß er Deutsch verstand. Er kannte wohl auch nur wenige Worte, wohl die selben, die Hu beherrschte - und als er sich dann zu ihr neigte, ij
Paradiete
nur um durch Tränen in ihr tränennasses Gesicht zu lächeln, war es, als läge sie, zart und winzig, an seiner breiten, guten Bauernbrust, sein Schützling, sein Kind. Hu hat in Gefängnissen gesessen, zuletzt in einem deutschen Gefängnis, viele Monate lang, und sie ist jung, sie wird noch lange leben und leiden. Aber diesen ganzen Abend, der sich bis zum Morgen zog, war sie immer neben „alte Golki“, sprach mit ihm, trank mit ihm und fühlte sidi der gemordeten Freun din nah. Eines Abends kamen wir - eine kleine Gruppe ausländischer Kongreßteilnehmer - in Charkow an und erfuhren, daß ge rade eine Versammlung von Udarniks (Stoßarbeiter) des Trak torenwerkes tagte. Unangemeldet gingen wir dorthin, der Versammlungssaal lag im Hause des Arbeiterklubs, es sah aus wie in einem klei nen Parlament, in dem sich um die Sitze der Parlamentarier Hunderte von Neugierigen drängen. Unsere Ankunft unter brach einen Redner, das Zauberwort „ausländische Schriftstel ler“ wirkte wie Sesam tue dich auf, man bahnte uns einen Weg durch die Menge, räumte uns an dem erhöht stehenden Vor standstisch Plätze ein. Als wir vorgestellt wurden, jeder mit seinem Namen und seiner literarischen Tätigkeit, dröhnte der Saal von Beifall, und dann stellte sich ein merkwürdiger Zu fall heraus: diese Udarniks hatten sich versammelt, um einen Bericht über unseren eben abgelaufenen Moskauer Schriftstel lerkongreß entgegenzunehmen und zu diskutieren 1 Aus den Zeitungen, die sie eifrig gelesen hatten, waren ihnen jeder einzelne von uns durch Bild und Wort bekannt, die Begeiste rung über unseren Besuch war so groß, daß ein Udarnik er klärte, er werde seiner neu zusammengestellten Arbeitskolonne den Namen geben: Brigade „Besuch der ausländischen Schrift steller“.
In Baku, der Naphtastadt am Kaspischen Meer, gerieten wir auf einen Kulturboden, den man als den jüngsten der Erde ansprechen kann. Von dieser Stadt hatte Maxim Gorki etliche Jahre vor dem Krieg geschrieben: 226
„Die Naphtawerke sind mir als ein genial gemachtes Bild der Finsternis im Gedächtnis geblieben. Mitten in dem Chaos der Bohrtürme duckten sich lange, niedere, aus rötlichem und grauem unbehauenem Stein unordentlich zusammengefügte Be hausungen vorhistorischer Menschen. Ich habe nie so viel Schmutz und Unrat um menschliche Wohnstätten, so viel ein geschlagene Scheiben in den Fenstern und so viel dürftige Armut in den höhlenartigen Zimmern gesehen. Keine Blume, kein Strauch ..." Wir erlebten Baku als eine frohe, gesunde, junge Stadt mit grünen Plätzen und sehr viel Blumen - aber davon will ich nicht sprechen, sondern von der geistigen Entwicklung, die ihre Bevölkerung genommen hat. Die Mehrzahl von Baku ist türkischen Stammes und war mohammedanischer Religion Man weiß viel über die geistige Situation der Türkinnen in ihrer orthodoxen Heimat, aber so tierisch wie im alten Baku ist die Frau nirgends in Europa gehalten worden. Selbst in den wohlhabenden Kreisen gab es zur Stunde der Revolution noch 99 Prozent Analphabetinnen, die Mädchen wurden in religiösen Instituten „unterrichtet", aber Lesen und Schreiben zu lernen war ihnen verboten; sie hätten durch Briefe mit der Außenwelt in Verbindung treten, dem Haus entfliehen und Schmach über ihre Familie bringen können. Aus der Leibeigenschaft des Vaters gingen sie in die des Gatten über, den sie bis zur Stunde der Hochzeit selten kannten. Aus eigenem Antrieb zu heiraten, sich scheiden zu lassen, Arbeit zu suchen - alles war ihnen ebenso streng ver boten wie ein Buch oder eine Zeitung. Diese unterdrückten Wesen hatten sich in fünfzehn Jahren völlig auf den Status der modernen Sowjetbürgerin und damit der freiesten, modernsten Frauen aller Länder emporgearbeitet. Vor der Revolution gab es in dem ganzen russisch-türkischen Reich Aserbaidshan keine Hebammen, keine weiblichen Ärzte, und die Hilfe männlicher Ärzte zu nehmen verbot den Frauen ihre Religion. Auch nach der Revolution, als das Gesetz sie schon frei gemacht hatte und die Religion nicht mehr eine Institution des Staates war, verboten die Familienvorstände ihren Töchtern, Unterricht bei einem männlichen Lehrer zu nehmen, er sei denn ein Greis.
So war der „Zentrale Frauenklub“, der das Bildungswesen zu organisieren unternahm, gezwungen, eine Schar von Weißbärten auf die Katheder seiner Schulen zu berufen. Die ersten Mädchen, die den Mut hatten, mit männlichen Kollegen zusammen Schulen zu besuchen, sich im Theater zu zeigen, Sport zu treiben, mußten für jede dieser Freiheiten furchtbare Kämpfe bestehen. Noch 1923 war eine Türkin mit dem Tode bedroht, die als Rednerin oder Schauspielerin auf zutreten wagte, und ebenso jedes Mädchen, das sich bei einer Sportveranstaltung mit nackten Armen oder Beinen zeigte. Um von der Bildungsarbeit im Klub abzuschrecken, wurde verbreitet, das Klubhaus sei ein Hurenhaus. Es kam vor, daß Studentinnen auf ihrem Schulweg mit kochendem Wasser be gossen oder mit Hunden gehetzt wurden. Daß kein Mädchen, dem man auch nur die geringste Beziehung zu diesem Klub nachsagen konnte, je einen Mann finden würde, galt als Selbst verständlichkeit. Dann geschah es im Jahre 1928, daß Sarial Haliliwa, eine Zwanzigjährige, die sich mit unverhülltem Ge sicht im Theater gezeigt, im Sporttrikot auf den Turnplätzen erschienen war, die öffentlich für die Emanzipation gesprochen hatte, zur Märtyrerin wurde. Ihr Vater und ihre Brüder hiel ten Gericht über sie, verurteilten sie zum qualvollsten Tode, schnitten sie lebendigen Leibes in Stücke. Ihr Märtyrertod brachte den großen Wendepunkt in der Kulturgeschichte von Aserbaidshan. Der geschändete Leichnam Sariais wurde den Eltern genom men und im Klub aufgebahrt, eine Ehrengarde umstand ihn Tag und Nacht. Während dieser Aufbahrung strömten Mäd chen und Frauen in Scharen in den Klub und meldeten sich zum Eintritt. Sariais Mörder wurden hingerichtet, seither wag ten es Väter und Brüder nicht mehr, sich gegen den Siegeszug der Kultur zu stemmen. Seither studieren Knaben und Mäd chen in einem Hörsaal, auf einer Bank sitzend. 19)3 schon gehörten achtzig Prozent aller Frauen zu den Gebildeten (wäh rend es 1920 erst neun Studentinnen gab), studierten nicht weniger als eintausendvierundvierzig in den Hochschulen, gab es dreihundert Hebammen im Lande, hatte der eine Frauenklub hundertfünfzig Tochterklubs in der Republik errichtet. Aus der 228
Arbeit an den Wandzeitungen ging eine Anzahl Schriftstellerin nen und Journalistinnen hervor, eine Frau war Vorsitzende des Sowjetausschusses. Es gab weibliche Ingenieure in den Naphtawerken, Fabrikdirektoren, Ärztinnen, sogar Fliegerinnen. Die Mädchen, die in diesem Befreiungskampf eine führende Rolle gespielt hatten - viele von ihnen waren kaum fünfundzwanzig Jahre alt -, bildeten die bewunderten Spitzen der Gesellschaft, und während sie mit zwanzig Jahren „sitzengeblieben“ sind, riß man sich fünf Jahre später um ihre Hand.
Von der Kabardinisch-Balkarischen Republik und ihrer Hauptstadt Naltschik wußte ich bei meiner Ankunft nichts, als daß sie sich noch vor weniger als zehn Jahren in einer Art Urzustand befunden hat, in einer Verkommenheit, die ehr fürchtig anmutete - dreihundertfünfzigtausend Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, dreihundertfünfzigtausend Menschen, die mit heißem Wasser und Seife wenig oder nichts zu tun hatten. Dreihundertfünfzigtausend Hütten1- und Höh lenbewohner. Daß dann während der Revolution oder bald danach ein starker Mann aus dem Volke, der Bolschewik Kalmykow, die Zügel ergriff und ein erstaunliches Tempo im Aufbau zu geben verstand. Ich lernte ihn kennen, es war ein nicht nur starker, sondern magisch überzeugender, durch Wort und Beispiel hinreißender Mann, der von der Welt draußen nichts gesehen hatte, aber so viel Weltgefühl in den Finger spitzen besaß, daß er imstande war, dieses Land den Ländern nachzuspornen, die über Technik und alle Kultur verfügten. Trotzdem - was konnte in Naltschik anderes auf uns war ten als ein System von Acker- und Gartenbau, das dank der Energie dieses Bolschewiken Kalmykow seit drei Jahren vor züglich bewässert wurde, seit er alle Flüsse des Landes über die durstige Steppe leiten ließ, dazu ein paar Straßen mit neuerrichteten, einandei gleichenden Häusern, ein paar Schulen, in denen die schwere Kunst des Abc und des Einmaleins ge lehrt wird? Es war späte Nacht, als ich in Naltschik einfuhr. Im Schim mer des Mondes, aber zugleich im Strahl vieler elektrischer Bogenlampen lag da eine Stadt, die wie einer der schönsten 229
und gepflegtesten Villenkurorte Süditaliens anmutete. Sie schimmerte, denn ausnahmslos jedes Haus war frisch geweißt. Wir fuhren über stille, breite Boulevards zwischen Reihen junger Bäume dahin, und am Horizont schwebten die zackigen Schatten der kaukasischen Bergwand. Dann kam ein Hotel, weiß schimmernd wie Marmor, in einem großen Garten, ein Hotel mit achtzig oder hundert Zimmern, einem riesigen Speisesaal, der von weißer Tischwäsche und geschlißenem Glas blitzte. An diesen schön gedeckten Tischen saßen furchtbar ernst und seltsam feierlich in langen Röcken, den Dolch in schönem Gehänge über der Brust, bärtig und mit Gesichtern, die wie aus Holz geschnitzt wirkten, die Patriarchen der Repu blik beisammen, die aus fernen Tälern zusammengekommen waren, um über die nächsten Taten ihrer Gemeinschaft zu beraten. Unter den Prominenten Naltschiks, die uns empfingen, war ein klug und energisch aussehender Jüngling, der auf alle Fragen, die wir ihm stellten, die sicherste Antwort gab. Es stellte sich bald heraus, daß dieser selbst dem Studentenalter kaum Entwachsene der oberste Leiter des Schulstädtchens Lenin war, eines Lehrinstituts, das aus Mittelschule und drei Hochschulen für Pädagogik, Agronomie, Medizin besteht. Er betreut den Bildungsweg aller Jugend der Balkarischen Repu blik, aus seiner Obhut sind jenes Jahr siebentausend junge Akademiker, Männer und Frauen, hervorgegangen, Sekretäre der Rayonkomitees, Lehrer, angehende Ärzte, Hebammen, Agronomen ... Siebentausend I Siebentausend - und vor sieb zehn Jahren gab es in diesem ganzen Land nur dreitausend Menschen, die des Lesens notdürftig kundig waren I In dieser Nacht gingen wir noch in einem riesigen Park spazieren, zwischen Rabatten der sibirischen Blaukiefer, zwi schen duftenden Büschen und mit großer gärtnerischer Kunst angelegten Blumenbeeten, an einem Sportplatz vorbei, an einem Musikpavillon, an lustigen kleinen Kiosken und Er frischungspavillons und glaubten uns abermals in einem Kur ort hinten in Europa, in dem für die Valutakräftigen Hoch gebirgsluft und landschaftliche Schönheit zu riesigen Preisen abgegeben wird.
2}O
Diese Stadt, dies Land gäben mir ungeheure Eindrücke davon klingt es in mir wie von jener nordischen Sagenstadt Rungholt, die vor Jahrtausenden in den Fluten ertrunken ist und plötzlich wieder auftaucht, sich neu belebt, prangender und blendender als all die lebendigen Städte rundum. Aber ein Erlebnis in Naltschik wirkt über alle hinaus, das war ein Besuch im Kinderklub, der zwei oder drei Stunden währte und so verlief, daß diese Stunden zu den schönsten meines Lebens gehören. Es gab in Naltschik etwa viertausend Kinder, die ausnahms los im Wirkungskreise dieses Klubs standen, der ihnen alles vermittelte, was die Schule allein nicht zu geben vermag: Kunst, Lektüre, Sport, Technik, Spiele und Tänze, den Aufent halt in schönen, hellen Räumen, in denen die Kinder allein Herren sind, die Erwachsenen dürfen ihnen nicht pädagogisch oder streng, sondern nur als Kameraden gegenübertreten. Es gab da eine Gruppe, die am Theaterspielen ihre Freude hatte, es gab Klassen, in denen modelliert und gemalt wurde, die Kinder konstruierten unter der Leitung eines Technikers kleine Flugzeuge, bauten sich selbst Photoapparate, Radioempfänger, man führte ihnen Kino-Komödien und Märchen vor. Jedes kleine Talent unter den Acht- bis Sechzehnjährigen wurde ent deckt, von liebevollen Händen geformt und gefördert. Nichts in diesem seltsamen Institut war obligatorisch, gegen seinen Willen hielt kein Kind sich dort auf, kein Pfennig Geld wurde von den Eltern der Kleinen erhoben, aber die Säle waren immer gefüllt, und es kam im Winter zu Massenveranstaltun gen, bei denen die ganze Jugend der Stadt zu einer einzigen Familie wurde. In diesem Klub wurden junge Mentoren aus gebildet - nicht Lehrkräfte, sondern Spiel- und Sportunter richtskräfte -, die nach einiger Zeit in die Dörfer der Republik verschickt wurden, um dort Tochterklubs nach dem Vorbild des Naltschiker Mutterklubs zu errichten. Wir wurden im Festsaal, in dem kein Apfel zur Erde fallen konnte, so zahlreich war die Jugend herbeigeströmt, um aus ländische Schriftsteller zu empfangen, den Kindern genauso sachlich und ernst vorgestellt, wie man uns in allen Versamm lungen, auf Bahnhöfen, bei städtischen Banketten, den Ver231
tretern der Städte präsentiert hatte. Aber die Kinder waren zu diesem Empfang mit Armen voll Herbstblumen erschienen, und jeder von uns, der aufstand, um sich den Kleinen zu zei gen und für ihre Begrüßung zu danken, wurde mit Blumen überschüttet. Ein siebenjähriges Mädchen hielt die erste offi zielle Ansprache, die mit den seltsam ehrlichen und großen Worten schloß: „Wenn wir erwachsen sind, werden wir eben solche Schriftsteller werden wie ihr." Unser Besuch hatte eigentlich nur eine halbe Stunde dauern sollen, aber wir fühlten uns so glücklich zwischen diesen blan ken Engelsgesichtern, beim Strahl dieser vielen hundert zärt lichen und neugierigen Augen, daß wir zu bleiben beschlossen. Als unsere Absicht kundgegeben wurde, erhoben sich Begeiste rung und Jubel, ein neuer Blumenregen, als hätten wir die Kinder mit Schätzen bedacht. Jetzt führten sie ihre Tänze vor, sangen uns ihre Lieder, deklamierten selbstverfaßte Gedichte und vor allem wollten sie hörenX Jeder von uns mußte etwas erzählen, eine Episode aus dem eigenen Kinderleben, ein Abenteuer, einen kleinen Bericht aus fremden Ländern; und bis zu den winzigen Puppen von vier oder fünf Jahren herab hingen sie an unseren Lippen. Obwohl wir doch in fremden Sprachen redeten, rührten sie sich nicht und warteten gierig auf die Übersetzung in ihre Sprache. Als die Stunde schlug, in der wir Abschied nehmen mußten, wurden von den lieben weichen Patschen unsere Hände liebkost, und es war schwer zu wissen, daß wir diesen Chor zärtlich klopfender Kinderherzen nie wieder hören würden. Aus diesen Kindern muß eine Generation von Männern und Frauen erwachsen, denen das Schöne Gesetz ist, die auch auf dem Feld und in der Fabrik, im Stall und in der Küche, in einer geistigen Atmosphäre leben, Musik im Herzen und eins mit den Dichtern ihrer Sprache, mit den Gestalten ihrer Lite ratur, auf einer höheren schöneren Ebene, als die Masse irgend eines anderen Volkes sie bis heute erreicht hat.
Rafael Alberti und Maria Teresa Leon, die Seele voll eines Landes, das dem ihren um Jahrhunderte voraus war, trennten sich in Sewastopol von uns und reisten zurück in ihre spa
232
nische Heimat. Mit Stolz wissen wir sie, unsere Freunde und Reisegefährten, an der Spitze der geistigen Phalanx, die seit mehr als einem Jahr unermüdlich die Milizen zum Kampf und die Zivilisten zum Ausharren aufruft. Sie brauchen keine Schlagworte und Phrasen, wenn sie den Spaniern eine Zukunft ausmalen, die aus den Krämpfen und Wehen dieser Zeit geboren werde. Sie können das, was dort erstehen soll, in Bildern voll lebendiger Farbe malen, denn sie haben mit ihren wachen, scharfen Augen voll Liebe diese Zukunft selbst geschaut. Mitten im blutigen Krieg gründen sie Schulen, Bibliotheken, Kinderklubs...
Moskauer Wunderdinge
Volle vierzehn Tage lang hat der erste Schriftstellerkongreß der Republik, an dem ich teilnahm, gedauert, und während dieser vierzehn Tage konnte kaum eine Zeitung andere Leit artikel, andere Feuilletons, andere Notizen und Illustrationen bringen als über den Kongreß. Sogar der Telegrammdienst erstickte in diesem Literaturdickicht - Rußland erfuhr fast nichts mehr aus der großen Welt, erfuhr nur noch, was seine Schriftsteller sprachen, dachten, sahen. Es erschienen Deputa tionen der verschiedensten Berufe, Werke, Gruppen im Kon greßsaal, begrüßten die Schriftsteller, stellten ihre Erwartun gen auf neu entstehende Literatur fest, übten Kritik an dem Erschienenen und baten um Kritik an ihrem eigenen Schaffen. Die Deputierten einer Papierfabrik erklärten, sie hätten zwar ihren Fünfjahresplan zu 130 Prozent erfüllt, müßten aber den noch um Nachsicht bitten - sie wüßten wohl, daß Rußland das Doppelte und Dreifache dessen an Papier benötigt, was sie schaffen können. In diesem Lande, das vor sechzehn Jahren noch 75 Prozent Analphabeten zählte, erscheinen russische Bücher nie unter 300000 Erstauflagen, selbst deutsche, ukrai nische, grusinische usw. selten unter 100000. Beliebte Autoren verkaufen zwei bis drei Millionen ihrer Bücher, aber zweibis dreimal soviel könnten sie verkaufen, wenn sie lieferbar wären. Statt seiner 75 Prozent Analphabeten zählt Rußland heute 75 Prozent Bücherverschlinger, Bücherkäufer - freilich ist das Buch hier auch der billigste aller Bedarfsartikel. Ein sauber gedruckter Roman kostet weniger als ein Paar Socken, und wenn diese Entwicklung anhält, wird das russische Volk in abermals sechzehn Jahren 75 Prozent Schriftsteller zählen,
234
denn in jeder Schule, jedem Betrieb, jeder Dorfgemeinschaft existiert ein „Literarisches Kollektiv“. Ein Land, in dem die Schnapsläden leer, die Bücherläden überfüllt sind ... Wir waren zur Besichtigung des Luftgeschwaders „Maxim Gorki" geladen, standen vor einer Front von neunundzwanzig Flugzeugen, dessen Flaggschiff (der Luftriese „Maxim Gorki“) eine fliegende Zeitungsdruckerei darstellt, die mit einem Ge samtstab von hundertdreißig Mann - Schiffspersonal, Redaktions-, Radio-, Druck-Personal - je zweistündig ein vierseitiges Blatt in zehntausend Exemplaren herstellt und über die Lande streut. Es liegen zwölf Kilometer elektrischer Leitungen an Bord, alle Räume sind telefonisch untereinander verbunden. Eine Lautsprecheranlage kann aus tausend Meter Höhe ein Landgebiet von zwei Quadratkilometern mit gesprochenem Wort überstreuen. Zu unserer Begrüßung waren einige be rühmte russische Autoren erschienen. „Sie sind unsere Gäste“, sagte einer von ihnen. „Diese Flotte haben wir aus eigener Initiative und ohne staatliche Beihilfe erbaut.“ Ein Redakteur der „Prawda", Michail Kolzow, hat vor zwei Jahren den Plan entworfen, ein paar Wochen lang haben alle Mitarbeiter des Blattes ihn propagiert und die Leser zu frei willigen Beihilfen aufgerufen, da waren auch schon acht Millio nen Rubel eingegangen, und unverzüglich wurde gebaut. Heute hat das Geschwader schon an sechstausend Flüge absolviert es protegiert neue Anbau-, Arbeits-Methoden, bringt politische Aufklärung und würde im Kriegsfälle den marschierenden Truppen vorauseilen. „Die .Kölnische Zeitung* war mir 1870 mehr wert als ein Armeekorps jenseits des Rheins“, hat Bis marck in seinen Erinnerungen geschrieben - entsprechend schätzt man den Wert dieses Propagandageschwaders. Wir sahen, wie drei Militärflugzeuge aus tausend Meter Höhe je fünfundzwanzig Soldaten per Fallschirm abwarfen ein viertes ließ den Soldaten lebende Kühe und Schweine nachfallen. Eine junge Pilotin sprang aus fünftausend Meter Höhe ab und öffnete den Fallschirm erst dreihundert Meter über der Erde. Viertausendsiebenhundert Meter sauste sie wie ein Stein durch das Weltall und zählte dabei langsam bis 235
neunzehn. Bei neunzehn mußte sie „reißen“, sonst war sie Staub, vor neunzehn durfte sie nicht reißen, es war ihr verboten. Wir besichtigten ein Arbeitskollektiv, das etliche Fabriken betreibt und aus dreitausend vom Gefängnis beurlaubten Ver brechern besteht. Um diese Kolonie zieht sich keine Mauer, kein Zaun, sie kennt keine Posten und keine Polizisten, kein Arrest lokal, keine Strafbestimmung. Diesen Gefangenen droht nur eine Sühne für unsoziales Verhalten: die Verbannung aus ihrem Arbeitslager. Unsere Besichtigung begann im Schulhaus, das lag in gepflegten Gärten, hatte breite Treppen und Korri dore, es war alles voll Licht; ein Turnsaal war da, blitzend und ausgestattet wie der Turnsaal eines Sanatoriums, wir sahen Hörsäle, Bibliotheken, Laboratorien, eine Gemäldeaus stellung. Unter den Sträflingen sind ein paar wirklich geniale Maler - darunter der Begabteste ein „Besprisorni", einer aus den Hunderttausenden jener Nachkriegskinder, die wie Wölfe aufwuchsen, nackt und hungrig in Rudeln durchs Land zogen, raubend, mordend, und lange Zeit als das ernsteste Problem Sowjetrußlands galten. Er hat Bilder aus diesem BesprisorniLeben gemalt, die das Herz zerreißen, und dann sich selbst. Wie er heute aussieht: mit festen Zügen, klaren Augen, einer hohen, schönen Stirn. Von seinen Schicksalsgefährten ist ein anderer unter die Schriftsteller gegangen, auch einer, der viele Kinderjahre hindurch von erkämpftem Unrat gelebt und im Unrat geschlafen hat. Sein erstes Buch heißt „Ich liebe“. Das Kollektiv „Bolschewo“ hat nur einen von der Regierung er nannten Leiter, alle anderen Funktionäre sind Sträflinge. Die ser Leiter hat das Recht, dem Verwaltungsausschuß Vorschläge zu unterbreiten, über die man diskutiert und abstimmt. Besitzt er keine Mehrheit in diesem Parlament, dann ist es um seine Stellung geschehen. Ihm zur Seite steht als Vizedirektor ein ker niger, kleiner Mann mit breiten Schultern und harten Blicken, der uns die Hände drückte und auf jede Frage klug und ge messen Rede stand. Der war jahrzehntelang als König der Geld schrankknacker Rußlands beinahe so berühmt wie etwa Dillin ger in Amerika; er kannte alle Sorten Gefängnisse Rußlands und war kurz vor der Revolution zum Tode verurteilt.
zj6
In allen Gebäuden dieser kleinen Fabrikstadt hängen Wand zeitungen, schön geschrieben, schön illustriert, die über Arbeit und Erfolg des Kollektivs, die über tausend innere Dinge be richten und zugleich als Schandsäule dienen. Da waren drei Männer abkonterfeit, und es stand darunter, daß sie abscheu liche Flucher sind ... Ich ließ mir einen Artikel übersetzen, in dem es hieß: „Bürger N. N. hat die Bürgerin N. N. wegen einer geringen Differenz beschimpft und ein Tintenfaß nach ihr geworfen, ihr Gesicht beschmutzt und ihr Kleid ruiniert. Ein solches Benehmen ist unserer Gemeinschaft unwürdig und verdient strengsten Tadel." Mehr als diese Zeitung ist in unserem Gefängnis von der russischen Knute nicht übriggeblieben, aber sie genügt, denn es gibt hier fast keine Kriminalität. Die Strafkollektivisten dürfen heiraten, wen sie wollen, aber ihre Wahl muß von einem Ausschuß gebilligt werden, sonst bekommt die Familie keine Einzelwohnung und die Frau keine Arbeit. Die ganze Stadt hat eine gemeinsame Küche, das heißt eine „Speise fabrik“. Ihre Köche tragen blendend weiße Dresse, in den Speiseräumen stehen gedeckte Tische mit Blumenvasen; es gab, als wir zu Gast waren, Suppe, Fleisch mit Gemüse und Torte, dazu heißen Tee, und vor der Mahlzeit hatte jeder Arbeiter gründlich Toilette gemacht. In seinen freien Stunden steht es jedem frei, nach Moskau zu fahren, in Flüssen zu baden, Tennis oder Fußball zu spielen, zu lesen, Musikfeste vorzubereiten, für das eigene Theater Stücke zu schreiben, einzustudieren. Sie verdienen ihrer Leistung entsprechend, in vestieren die Überschüsse gemeinsamer Arbeit in immer neuen Unternehmungen, Wohnhäusern, Parkanlagen und Konsum warenhäusern. Wenn sie neue Arbeitsplätze geschaffen haben, schicken sie eine Kommission in die Gefängnisse und lassen sich neue Arbeitsgenossen ausmustern. Nach ein paar Jahren tüch tiger Leistung im Kollektiv ist jedes Strafurteil erloschen, die Vergangenheit ausgewischt. Der Entsühnte ist frei, aber er denkt selten daran, sein Kollektiv zu verlassen, lebt hier mit Frau und Kind, wird langsam ein Patriarch.
Moskauer Bühnenfestspiele
Über diese Tatsache kann es keine Diskussion geben, daß die Musen in dieser Arbeiterrepublik heimischer sind, als sie es im Zarenreich, als sie es je in einem anderen Lande waren. Hier sind Lyriker von äußerster künstlerischer Strenge wie Pasternak populärer als siegreiche Generäle, hier kann man schwerlich ein vor zwei Jahren erschienenes Buch kaufen, weil Riesenaüflagen den Verlagen aus den Händen gerissen wer den, hier , gibt es Literatur-, Musik-, Theatergruppen in jedem Betrieb, jedem Dorf, in den Schulen, Kasernen, im Gefängnis. In Moskau öffnen sechzig Theater allabendlich ihre Tore, in ganz Rußland sind es zwar - neben den Tausenden von Ama teurbühnen - achthundertsiebzehn, und nie ist ein Platz leer, wenn der Vorhang sich hebt. 95 Prozent aller Plätze sind laut amtlicher Statistik im Durchschnitt verkauft, und die etlichen Hundert Theaterfachleute aus ganz Europa, die zu den Moskauer Festspielen erschienen sind, konnten dieses Wunder kaum fassen. Wie leicht, dachten sie, kann man absolute Thea terkunst bieten, wenn das Budget vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag des Jahres feststeht, wenn Erfolg oder Miß erfolg eine prinzipielle Frage ist, keine materielle... Aber diese Begeisterung für die Bühne ist kein Göttergeschenk, das den Direktoren und Künstlern in den Schoß gefallen ist, son dern Resultat einer Arbeit, die mit so asketischer Leidenschaft, so fanatischem Ernst geleistet wurde wie, während der glei chen sechzehn Jahre, der Aufbau einer riesigen Industrie. Vor sechzehn Jahren war die russische Seele Neuland für Literatur und Theater, ungebildet, aber auch unverbildet, jetzt kennt man ihre Gezeiten, ihre Gesetze und ihr Verlangen.
zj8
An den Konferenzen, die jeder neuen Einstudierung voraüsgehen, nehmen außer Direktor, Autor, Darstellern auch Arbeiter als Vertreter des Publikums und eine Abordnung des Kulturministeriums teil - so ist hier selbst ein Ballett, selbst ein Stück, in dem Kinder für Kinder spielen, eine Haupt- und Staatsaktion. Jede Bühne besitzt eine Schule, in der sie sich ihren Nachwuchs selbst heranzieht, ein Museum, in dem für die fernen Enkel erhalten bleibt, was von dem Spiel etlicher Stunden in Schränken, auf Filmstreifen und Schallplatten nur irgend erhaltbar ist. Diese Pedanterie ist wichtig und notwen dig, denn von Jahr zu Jahr wird das russische Theater weiter hin seine alten Formen zerschlagen, neue Revolutionen er leben. Schon ist Meyerhold am Bau einer uralten, für un$ aber neuen Bühnenform: eines dem klassischen Amphitheater ähn lichen Baues, auf dem die Bühne inmitten eines fünfzehntau send Personen fassenden Zuschauerraumes liegt, der Schau spieler, von der realen Welt seines Publikums völlig umgeben, die Illusion des Spiels ganz aus eigenen Kräften schaffen muß. Sogar die Garderoben werden auf der Bühne selbst stehen, so daß er beim Kostümwechsel das Stück weiter erlebt, seinen Rhythmus nicht aus den Nerven verliert. Zugleich schafft Tairow an einem neuen Typus Drama: einer Synthese aus Puschkins Poem „Ägyptische Nächte“, Shake speares „Antonius und Kleopatra" und Bernard Shaws „Cäsar und Kleopatra"! Vielleicht- wird- es einst nötig sein, nach so gewaltsamen Vorstößen in fremde Sphären in die uns vertraute alte zurückzufinden? Neben der revolutionären Bühnenkunst wird jedoch in Moskau noch sehr viel konservative, fast reaktionäre gepflegt. Wir sahen im großen Opernhaus das vieraktige Ballett „Der Schwanensee“ von Tschaikowski. Seine süße, liebe Musik klang allen vertraut, aber nicht vertrauter, als die Graubärte unter uns die ganze Aufführung empfanden. Da gab es Corps de ballet in fleischfarbenen Trikots und Gazeröckchen, Spitzen tänze von hundert in perlenden Walzerrhythmen exakt gedrill ten, jedweder Individualität baren Mädchenbeine, und wie vor dreißig, vierzig, fünfzig Jahren spielt dje Handlung zu Füßen einer holden Königin, die hienieden alles vermag, ist ein ge
2J9
krönter, kein Märchenprinz der Mittelpunkt alles Geschehens, wölbt sich ein azurener Himmel über einem azurenen See, den königliche Schwäne durchsegeln, erhebt sich die himmlische Liebe gegen die irdische Liebe. Ebenso steht es um die mit großem Pomp und herrlichen Stimmen aufgeführte Oper Rimski-Korsakows „Die Zarenbraut**, die gegen Ende des letz ten Jahrhunderts entstand. Obwohl Stanislawskis großer Name die Regie verantwortet, obwohl das Programm behauptet, nicht Opernsänger, sondern „singende Schauspieler" trügen die Handlung, sahen wir eine vollendete Aufführung, die genauso vor dreißig Jahren möglich gewesen wäre. „A bas l’art réactionnaire!** hörte ich im Auditorium flüstern, aber später rauschte der Beifall der Menge wie am Schwanensee und be wies, daß alle Kunst zeitlos ist, daß alle neuen Schulen die Freude am Alten nicht erschüttern, wenn es echt. ist. Im „Akademisch-Jüdischen Theater" gab man „200 000" von Scholem Alejehern - eine ganz revolutionäre Einstudierung, die auf Gastspielen dunch Westeuropa schon gezeigt worden ist. Diese Bühne wurde, damals mit achtzig Sitzplätzen, ein Jahr nach der Oktoberrevolution gegründet und gilt als das höchstentwickelte unter Rußlands „Nationaltheatern“, in denen Art und Sprache der hundertachtundsechzig nichtrussischen Nationalitäten der Union gepflegt werden. Alejchem hat sich sein an die Shylock-Tragödie gemahnendes Drama gewiß nicht in solchem Rhythmus, in solcher Stilisierung vorgestellt, wie man es hier aufführt. Es wird das Experiment gemacht, tra gische Dinge in einer Art Marionettenkarikatur zu spielen, das wehe menschliche Herz gleichsam durch einen Harlekinmantel pochen zu lassen, und das konnte wahrscheinlich nur jüdischen Schauspielern, die sentimental und zynisch zugleich sind, ge lingen. Michoels, der Hauptdarsteller und Bühnenleiter, hielt vor Beginn des Spiels eine Ansprache, in der er den Gästen aus aller Welt zurief: „In diesem Lande sind wir frei, sind unsere Leiber, unsere Köpfe, unsere Seelen frei!“ Das war zugleich eine Analyse seiner Arbeit und eine kleine, jüdisch politische Demonstration... Drei Zeitdramen, „Die Intervention“ von Slawin, „Ljubow Jarowaja“ von Trenjow und „Optimistische Tragödie" von 240
Wischnewski, zeigten Episoden aus den Bürgerkriegen, die in den letzten Nervenenden jedes Russen lebendig sind, während der Weltkrieg hier vergessen ist, als wäre er nie gewesen. Allen drei Stücken ist es gemeinsam - obwohl Trenjow ein Greis ist, die beiden anderen Autoren revolutionärer Nach wuchs -, daß sie viel mehr dramatische Reportage als Drama bedeuten, daß es in ihnen von Blut trieft, Menschenleben gleich Fliegenleben gelten, daß sie mit Siegen der Roten über ihre Feinde, die Weißen, die Interventionstruppen, die Anar chisten, enden, daß sie in einer Welt spielen, die Eros nicht kennt, die nicht ein Lächeln dieses Gottes auch nur für Se kunden beglänzt. Das sind grausame Theaterstücke, sie spie geln eine Zeit, neben deren Schrecken der Dreißigjährige Krieg und selbst der Weltkrieg blaß werden, Verrat und Meuchel mord in den Reihen der einander bekämpfenden Armeen wüten... Grausigeres ist nie erlebt, ist nie auf einer Bühne gezeigt worden ... In der „Optimistischen Tragödie“ entfaltet Tairow Möglichkeiten, auf einer kleinen Bühne Massen zu be wegen, wie man sie kaum geahnt hat. Man riecht Blut und Dreck, Wunden fühlt man, wird von Ängsten geschüttelt, eine Hölle, unvorstellbar, wird lebendig. Der einzelne Schauspieler geht fast unter in diesem Gebrodel vor die Rampe gedrängter Weltgeschichte, und es sind Schauspieler vom allerhöchsten Rang, die sich so von der Masse aufsaugen lassen! Meyerhold hat Dumas’ „Kameliendame“ inszeniert, dies Bild einer faulen, genäschigen, bornierten Epoche - ein wenig mit Ekel vor dieser Menschheit, ein wenig verliebt in ihre Verliebtheit, Faulheit, Genäschigkeit. Zugleich wird in einem anderen Theater seine Inszenierung von Gogols „Revisor“ ge geben. Immer sprengt er den Rahmen der Bühne, sein Souffleur sitzt auf einem Stuhl frei vor den Zuschauern, Aufgang und Abgang erfolgen durch das Parkett, einzelne Szenen werden mitten im Publikum gespielt. Der Vorhang fällt nie, Arbeiter im Kostüm des Stückes und Arbeiter im gewöhnlichen Anzug bauen auf und um - Meyerhold hat dekretiert: „Schauspieler und Zuschauer leben nicht in gesonderten Welten.“ Aber trotz allem haftet einer „Kameliendame“ ohne Sarah Bernhardt so viel Muff an, daß kein Zauberstab sie lebendig macht, wäh16
Paradiese
241
rcnd der „Revisor" herrlicher wurde, als man ihn je gesehen hatte. Und dann das Kindertheater I In einem der vielen, täglich spielenden, täglich von Jubel vibrierenden Kindertheater Ruß lands spielt man „Das Ncgerlein und der Aße“. So frei und stolz, beglückt und genial haben wahrscheinlich die Kinder noch nie Theater gespielt, so phantastisch beseligend und be freiend ist Kindern noch nie ein Stück Welt gezeigt worden. Überall ließ sich in Moskau Neues sehen und lernen - dies Kindertheater aber stößt Türen zu einer strahlenden Zukunft auf, die man gestern noch nicht geahnt hat.
24t
Ein russischer Trauertag
Rußland ist stolz auf jeden Fortschritt in technischer Zivilisa tion, und deshalb macht es Riesenfortschritte. Es lag jahrhun dertelang zurück im Wettrennen der Nationen, jetzt kann es nicht schnell genug gehen. Die erste Untergrundbahn wurde in Moskau in Angriff genommen - welch ein Traum, welche Romantik, welch ein Sieg! Daß sie ein Segen für diese Stadt werden muß, die in wenig Jahren ihre Bevölkerung beinahe ver dreifacht hat und an Verkehrsmittelnot furchtbar leidet, das nur nebenbei. Das Unternehmen an sich war so betörend schön! Von der ersten Stunde an blickte ganz Rußland auf den neuen Bau. Es kamen Erdbohrmaschinen aus Amerika, „Schlitten" genannt, die als das Vollendete auf ihrem Gebiet galten. Die Bemannung einer solchen Maschine bildet eine „Brigade“, ihre Arbeit unter unnatürlichem Luftdruck, in Staub und Dreck, in ungewohnter Temperatur ist die denkbar härteste. Den Arbeitern wurde ein hoher Tagelohn und eine Prämie für jeden Zentimeter Schichtleistung ausgesetzt, der über einem aus Amerika übernommenen Minimum liegt. Bald waren sie trainiert, erfanden eine Verbesserung des Schlittens um die andere, ließen das Minimum weit hinter sich. Die Tagesleistungen der einzelnen Brigaden wurden notiert und publiziert, sie stiegen, die Brigaden traten in ein Wetteifern ein, das durch Monate und Jahre kein Finish kannte. So wie dort, in den Tiefen der Erde, gearbeitet wurde, so spielt man anderwärts vielleicht Fußball, mit solchem Feuer, solchem Ehr geiz, solchem Sportgeist, mit solcher Leidenschaft nimmt etwa England an dem Wettrudern zwischen Oxford und Cambridge teil. Wie diese Jugend - Burschen und Mädchen - sich in die .6«
24}
Arbeit stürzten, wie sie freiwillig Doppelschichten machten, sich das Essen in den Stollen bringen ließen, um keine Minute zu verlieren, wie sie mit Siegerausdruck auf den Gesichtern in ihren verschlammten, verkrusteten Overalls der Tiefe ent stiegen - nur wer das gesehen hat, begreift das Geheimnis des neuen Rußland und damit ein wichtiges Stück Weltgesche hen. Den Ruhm im Schacht zu suchen, die Arbeit zur natio nalen Tat, zum Sport, zur eigensten Sache jedes einzelnen zu machen, Tag um Tag, Nacht um Nacht aufs neue, die Helden der Arbeit wie Kriegshelden zu feiern und feiern zu lassen, mit Orden zu zieren, in Gedichten zu preisen, das ist das Neue, wahrscheinlich das Entscheidende. Vor ein paar Monaten wurde die erste Teilstrecke der Untergrundbahn dem Verkehr übergeben, das war ein natio naler Jubeltag. Seine Helden zogen im Triumph durch die Straßen, dann wühlten sie sich neu in die Erde ein. Der junge Schriftsteller und „Prawda"-Redakteur Michail Kolzow, selbst Pilot und Luftadmiral, hatte die Idee, eine fliegende Druckerei zu schaffen, die imstande wäre, hoch in den Lüften eine Zeitung herzustellen, in Zehntausenden von Exem plaren über Städte und Dörfer zu streuen. Er und Sergej Tretjakow (der Autor von „Brülle, China“) schrieben darüber eine moderne Jules-Verniade in berauschenden Bildern, formu lierten Aufrufe zu freiwilligen Bauspenden. Dies Neue erhitzte die Phantasie, die Rubel strömten herein, in kurzen Wochen acht Millionen. So entstand ein Zeitungs-Luftgeschwader; der Riesenbau „Maxim Gorki“, das Massen-Passagierboot „Prawda“, siebenundzwanzig Eskortenflugzeuge. Der „Maxim Gorki“, eine Maschine, die den geliebtesten aller russischen Namen trug, wurde selbst von den Millionen geliebt und vergöttert. Den „Maxim Gorki“ in der Luft zu sehen, umschwärmt, umknattert, umflattert von diesen gewaltigen Hornissen, die mit ihrer 2 jo-Kilometer-Geschwindigkeit seinen Gang fast ge mächlich erscheinen ließen, war eine Sensation, die an den Nerven riß. „Ich glaube es nicht!“ erklärte ich meinen russi schen Freunden.
244
Im Inneren war der „Maxim Gorki“ beinahe feierlich nüch tern. Arbeitsraum an Arbeitsraum gereiht, im Rumpf, in den Flügeln Redaktionszimmer, Druckerei, Radioaufnahme- und Radiosenderaum, Schlafgelegenheiten, eine Kantine, ein Laut sprecher, dessen Stimme aus fünfhundert Metern Höhe kein Bewohner einer Stadt von zwanzig- oder dreißigtausend Ein wohnern überhören konnte. Der Übervogel kreiste über fernen Provinzen Rußlands, warf Pamphlete ab, hielt Vorträge, feuerte zu neuen Arbeits methoden, neuem Eifer an. Man hat festgestellt, daß infolge dieses Luftbesuches die Getreideproduktion eines Bezirkes wesentlich stieg. Das war Friedensarbeit. Im Kriege - „Die .Kölnische Zei tung' war mir 1870 mehr wert als ein Armeekorps jenseits des Rheins“, hat Bismarck erklärt -, im Kriege kann so ein „Maxim Gorki“ Schlachten gewinnen.
Einen Flug an Bord dieses Märchenflugzeuges zu machen war natürlich der Traum aller russischen Jugend, höchste Ehre, höchste Belohnung. Solchen Lohnes würdig war keiner mehr als die Stoßbrigadler der Moskauer Metro. Mit Musik, an einem Maitag, stiegen ihrer fünfunddreißig in die Lüfte - mir ist, als sähe ich ihre jungen, glückbestrahlten Gesichter. Welch ein Höhepunkt des Lebens für diese tapferen Kinder! Dann geschah das Herzzerreißende. Wieviel Tränen mögen in dieser Nacht geflossen sein! Aber tags darauf wurde der Beschluß gefaßt, drei neue Luftriesen gleicher Art für den einen, verlorenen „Maxim Gorki“ in Bau zu geben.
Seltsame Abenteuer eines Dichters
Ich spreche mit Liebe und Hochachtung von Oskar Maria Graf, dem Romancier aus Berg am Starnberger See, der selbst nur ein „Provinzschriftsteller" sein wollte, dessen Werk aber, gegen alles Erwarten seines Schöpfers, langsam aus der bayrischen Provinz ins Reich und dann weit über die Grenzen Deutsch lands hinausgedrungen ist. „Wir sind Gefangene“ ist sein Hauptwerk und erzählt von einer Jugend unter den Bleidächern der Armut. Es führt kein Blumenpfad vom Bäckerburschen zum großen Erzähler, aber daß dieser Weg durch soviel Nacht geht, an so grausigen Schlünden vorbei und über vereiste Schroffen, die dem Wanderer Wolle und Epidermis von den Gliedern reißen, das wirkte, erschütterte und machte Grafs Buch zum Weltbuch. So war Oskär Maria - den zweiten Vor namen führt er Rilke zu Ehren, der ihn in den Anfängen er kannt und gefördert hat - in Rußland schon bekannt und ge liebt, als er diesen Sommer zum Schriftstellerkongreß in Moskau eintraf. Oskar Maria Graf ist hoch und breit wie einer der drei gewaltigen Gesellen im „Faust", aber zu seiner ungeschlachten Gestalt gehört ein rundes Bubengesicht, ein Kindergesicht, in das die Hunger- und Lungerjahre, Dunkelarrest und Irrenhaus, wohin er sich vor dem Schlachtfest des Krieges geflüchtet, keine Spuren gegraben haben. Man muß den Mann, der bei Rilke vom Geheimnis des schwingenden Wortes gekostet und an der Hand Dostojewskis seine ersten Schritte ins Seelen land getan hat, den muß man am gedeckten Tisch sehen! Rabelais und Balzac würden ihre Freude daran haben, wie et tafelt, es sieht aus, als läge ein Riesensäugling am Busen 246
einer Riesenamme und pumpte sich voll mit Kraft und Sonne. Als er zum ersten Mal den feierlichen Kongreßsaal betrat, reckten sich alle Hälse, Maxim Gorki lächelte, der feierliche Lyriker Pasternak strahlte, André Malraux’ düster-gallisches Gesicht wurde hell, und achthundert Schriftstellerköpfe ver änderten den Ausdruck. Er trug die bayrische Wichs, kurze, zerfranste Lederhosen, ein weißes Hemd mit ledernen Hosen trägern, die grüne Joppe über eine Schulter gehängt und das grüne Samthütel im Genick. „Du bist der Olden“, sagte er, als er neben mir Platz nahm. (Mit „Sie“ spricht er nur Menschen an, die ihm zuwider sind.) „Ich kenn Dich, weißt, von die Photographien.“ Ihn kannte nach wenigen Tagen ganz Rußland, so viel wie er sind kaum die Tscheljuskin-Helden photographiert, kinematographiert, gezeichnet und karikiert worden. Zwei russische Worte hatte Oskar Maria Graf bald erlernt, „karascho“ und „spassiwo“. Darüber hinaus reichte sein Wort schatz nicht, als wir abends in den Kulturpark gingen, einen Lust- und Sportpark, der Zehntausende von Menschen faßt. Dort sahen wir Feuerwerk und hörten ein Feuerwerk von Reden, es war ein Festtag erster Ordnung. Aber das Schönste waren die Kinder. Unter Kinderrudel geriet Oskar Maria Graf, tanzte und spielte mit, und dann sagte sich wahrscheinlich ein kleiner Bub: „Warum er wohl Lederhosen trägt? Gewiß als so eine Art Panzer.“ Dergleichen muß ausprobiert werden, eine Stecknadel war gleich zur Hand, fuhr in das Sitzfleisch des Dichters und gab ihm einen gehörigen Schock. „Spassiwo!“ brüllte Graf und fuhr herum. Da jauchzten die Kinder, denn das heißt „danke“, und auf der anderen Seite fand sich auch eine Stecknadel, die noch tapferer eindrang als die erste. „Karascho!“ - das klang wie ein Wutschrei, aber es hieß „schön!“, und das ganze Spiel schien mithin dem freundlichen Bären wohlzutun. So ging es weiter, bis ein „Miliz“ endlich die Buben verjagte. Graf, der den Pfeil’ und Schleudern des wütigen Geschicks so oft getrotzt hat, wäre sonst Nadelstichen erlegen. Wir gingen auf Reisen. Auf dem Bahnhof in Kursk, südlich 247
des Kaukasus, hatten wir Aufenthalt, da sprach ihn ein Mann auf deutsch an: „Oskar Maria Graf, wie geht es Ihnen?“ Daß man den Dichter aus Berg am See in Kursk erkennt, war ja verständlich, man hatte ihn in Baku und Tiflis und Sewastopol erkannt. Aber dieser deutsch sprechende Mann in Kursk war ein Kairenser, im Schatten der Pyramiden groß geworden und eben erst in Rußland eingelaufen. In Moskau hatte Graf kein Hemd aufgetrieben, in das er hineinkam, er hatte seine Hoffnung auf den Kaukasus ge setzt, wo die Menschen angeblich so gewaltig sind, aber auch dort bekam er nichts, nicht am Kaspischen Meer, nicht am Schwarzen Meer. Die ganze Reise wurde zur Hemdensuche, er trug schon blütenweiße Fasern am Leib, als wir nach Moskau zurück kehrten. Dort hatte sich Geld aufgehäuft, das Honorar für zwei neue Bücher, russische, ukrainische, baschkirische Ausgaben, die ganze Union liebt Graf und will ihn lesen. Die Russen zahlen gut, aber man kann ihr Geld nicht mit nach Hause nehmen, und Graf wollte nach Brünn zurück, an die Schreib maschine. Jetzt lief er, in frisch gebleichten Fasern, durch Moskau, mit grimmigem Antlitz; er wollte kaufen, für seine Rubel nützliche, schöne, wertbeständige Waren einhandeln, seiner Frau Geschenke mitbringen. Aber was er auch kaufte, was er auch verschenkte, wie er auch seine Freunde traktierte, Schofföre und Kellner beglückte - wenn er abends nach Hause kam, war schon wieder ein Scheck da, es wurde furchtbar langsam weniger. Man konnte Pelze und Kaviar und tausend Schätze erwerben, aber Graf war doch nur ein Rubclkrösus und wollte nach Brünn - der Einfuhrzoll mußte in Kronen gezahlt werden. Er wurde nervös, er wurde bitter. Millionär in Rußland zu sein ist kein heiteres Los, die Risse in seinem Hemd wurden größer und größer. Bis wir, endlich! entdeckten, daß man im Warenhaus Mostorp Hemden nach Maß bekommt, aus Flanell, aus Battist, aus Seide, wie man will, und zugleich stellte sich heraus, daß steter Tropfen auch die dickste Brieftasche leert. Am letzten Tag bekam Oskar Maria für seine letzten Hunderter sechs herrlich passende Hemden! Es fröstelte schon gehörig, er zog 248
einen bürgerlichen Anzug mit langen Hosen, Weste und Rock über die neue Wäsche und konnte als Reisezehrung gerade noch ein Kilo Käse und eine Flasche Wodka erschwingen. Dann war es wie im Märchen, Graf war auf einmal der zum Frosch verwandelte Prinz! Die Kinder jubelten nicht mehr, wo er sich zeigte, die Mädchen prusteten nicht mehr, es stäubte kein Gold mehr um ihn, die reisenden Fellachen auf den Bahnhöfen grüßten nicht mehr „Salaam, Oskar Maria Graf!“ Er zog mit mir durch die Lande und sah genauso aus wie ich oder sonst irgendein armer, grauer Mausckerl.
¿49
Tschapajcw-Film
Von drei Jahren Weltkrieg spricht kaum mehr ein Mensch in Rußland. Was sie auch an Grauen und Vernichtung brachten, wurde in der Erinnerung verwischt durch vier Jahre Bürger und Interventionskrieg, die ihm folgten. Von diesen Kämpfen weiß man in Westeuropa fast nichts, in den Schulen werden sie flüchtig erwähnt, auf den Universitäten lehrt kein Histo riker ihren Verlauf. (Man liest ja auch selten ein Wort über den phantastischen Krieg, den seit Jahren Sowjetchina gegen die Armeen des weißen China führt.) Im Moskauer Revolu tionsmuseum sieht man aus historischen Karten, daß zeitweise bis zu Dreiviertel des russischen Bodens von den ganz euro päisch gerüsteten und geführten Interventionstruppen besetzt war. Man studiert Aberhunderte von Fotos, mustert ein Arse nal oft mittelalterlicher Waffen und kann nicht begreifen, daß ein solcher Krieg möglich war, daß er mit einem Sieg halb bewaffneter Militärautodidakten gegen alle Strategie und Kriegsmaschinerie des zwanzigsten Jahrhunderts enden konnte. Der Halbzigeuner Wassili Tschapajew war unehelicher Ge burt, ungelernter Arbeiter, Vagabund, Drehorgelspieler, An alphabet. 1914 zog er ins Feld, bekam die ganze Garnitur der vier Andreas-Kreuze, brachte es bis zum Feldwebel. Aber ein Offizier verhöhnte ihn wegen seiner Unbildung, Tschapajew beschimpfte den Vorgesetzten und verlor zur Strafe alle Orden und Tressen. Es bedeutete ihm wenig, denn der Stachel jener Beleidigung saß. Er lernte lesen und stürzte sich jetzt in die Bücher statt in die Gefechte. Ein paar Jahre später kom mandierte er, fünfunddreißig Jahre alt, eine Division der Roten Armee. „Erst vor vier Jahren habe ich lesen gelernt“, 250
sagte er damals, „mein ganzes Leben habe ich wie im Dunkel zugebracht.“ Sein Biograph Furmanow zieht so die Synthese seines Wesens: „Er vereinigte in seiner Person besonders glücklidi all jene Eigenschaften und Charakterzüge, die seine Kampf genossen nur teilweise besaßen und deren Konzentration in einer Person ihn zum Symbol, zum Abgott jener Masse, jener Zeit macht." Der Abgott und Führer dieser Proletarierarmee fiel im Kampf; den Ural durchschwimmend, traf ihn eine Kosaken kugel. Um seine Gestalt woben sich weiterhin Legenden, sein Name gehört zu den wenigen, die das russische Volk nicht vergessen wird. Wenn heute, anderthalb Jahrzehnte nach sei nem Ende, in den Städten der Union ein Film angezeigt wird, dessen Titel sein Name ist, fiebert alle Welt danach, ihn zu sehen. Was auf der Leinwand gesdiieht, ist von vornherein Herzenssache eines jeden, bedeutet eine Begegnung mit dem Manne, der Vorbild der Knaben und Traum der Mädchen ist. Von der russischen Botschaft veranstaltet, wurde der Film „Tschapajew“ einem geladenen Prager Publikum vorgeführt und mit ganz anderen Augen gesehen. Sehr wenige wußten überhaupt, daß der Held eine historische Gestalt ist, sehr wenige ahnten etwas von dem Zauber, den seine Persönlich keit ausstrahlt. Tschapajew war ein hinreißender Redner, und sicher klangen jene Ansprachen wörtlich wider, mit denen er einst seine Partisanen zum lebensverachtenden Enthusiasmus hingerissen hat, aber hier blieben sie unverständlich. Die drastisch-tolle Terminologie seiner Diskussionen mußte hier verpuffen, und so blieb hier auch wirkungslos, daß in Boris Babotschkin ein Darsteller gefunden wurde, der Tschapajew verblüffend ähnlich sieht und für die Russen eine Gestalt wiedererstehen läßt, die jedem von ihnen ins Herz geschrieben steht. So konnte dieses Prager Publikum nur dunkel ahnen, was der Film an Zündstoff und Affekt in sich trägt, diese bewußt unfrisierte, undramatisierte Geschichte eines Partisanenlebens, für uns nur eine Kette aus Diskussionen, Schlachtenführen, Einzelgefechten, Siegen und Niederlagen. Trotzdem - und ZU
obwohl dies Werk in den technischen Dimensionen wie in genialen Einzelheiten mit „Potemkin“, „Sturm über Asien“ oder „Die Mutter“ kaum vergleichbar ist - war die Wirkung tief. Man fühlte, daß ein Kapitel Weltgeschichte vorüberzog, wie sie nie zuvor ablief und nie wieder ablaufen kann; das große Ringen der Ideenbeseelten gegen die Maschinegewor denen. Manche Bilder wird man nie wieder vergessen, so den Marsch der Schwarzen Offizierbrigade unter Totenkopfban nern, im Stechschritt, fast eine Parade, gegen eine Schützen kette zerlumpter Partisanen, die alle verloren sind, wenn ein einziger Schuß aus ihren Reihen zu früh fällt. Diese unglaub liche Disziplin in einer scheinbar disziplinlosen Rotte: so muß es gewesen sein, nur so konnte der unfaßbare Sieg erfochten werden.
252
Maxim Gorki
Es ist fast dreißig Jahre her, da saß ich, ein fahrender Schüler, auf einer Bank am Meerbusen von Napoli, und zu mir setzte sich ein zerlumpter Bursche meines Alters, der so schöne, fremde Augen hatte, daß ich neugierig auf sein Schicksal wurde. Wir verständigten uns in einem Mosaik von Vokabeln aus vielerlei Ländern, sehr rasch verstanden wir einander gut. Er war Russe, Arbeiterpoet, hatte ein revolutionäres Gedicht drucken lassen, war nach Sibirien verbannt worden, entflohen und seit vielen Monaten auf dem Weg zu Maxim Gorki. In Moskau und Petersburg hatte er ihn nicht gefunden - immer weiter zu Fuß, ohne eine Kopeke im Sack, hatte er Paris er reicht und erfahren, daß Maxim Gorki in Capri sei. Von Paris nach Neapel - das sei kein weiter Weg gewesen, überall hätte er die Bauern gastlich gefunden wie in Rußland und Finnland und Schweden... Aber von Neapel auf die Insel Capri - das kostete sechs Lire. Nein, Gorki kenne ihn nicht, aber er würde ihm helfen. Es handelte sich nur um die sechs Lire. Die konnte ich ihm geben, und er nahm sie, als hätte ich nur meine Pflicht erfüllt. Ein paar Monate später kam ich selbst nach Capri - der Vagabund trug jetzt ganze Schuhe, eine russische Bluse, sein Haar war gescheitelt, sein Gesicht rasiert und rund geworden. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt, aber er begrüßte mich, schloß mich in seine Arme, wie es russische Art ist, er sprach jetzt fließend französisch. Maxim Gorki... Ein ganzer Kreis junger Emigranten war um ihn geschart, er ließ sie unterrich ten, lehrte sie selbst, nährte und kleidete sie. Rostbraun von Gesicht, das bäurisch und priesterlich zugleich 25}
war, straff, hager, die Augen hartnäckig forschend auf Men schen und Dinge geheftet, immer gekleidet wie ein russischer Bauer am Sonntag, immer begleitet von einer blonden, pracht voll gesunden, bäuerlichen Frau in weißer Russenbluse - ich sah ihn oft, lernte ihn auch kennen. Jeder Mensch auf der Insel kannte ihn, das war kein Wunder, denn sein Name war lange schon weltberühmt, der Künder der Vagabundenseelen, der Dichter des „Nachtasyl", der Revolutionär wider den Zarismus I Aber auch er kannte jeden wieder, dem er einmal begegnet war, sein Wandeln war ein Botanisieren durch die Mensch heit, ein nie unterbrochenes Beobachten, Festhalten, Durch leuchten. Dies Leben begann in Armut, Unbildung, Sehnsüchten, die unerfüllbar schienen, schwere Krankheit schattete darüber, dem Zwanzigjährigen schien Zeit und Zukunft Bitternis. Aber früh entfaltete es Kräfte und Säfte, daran die Menschheit aller Nationen sich labte. Mit vierzehn Jahren ein ausgehungerter Analphabet, mit zwanzig reich an Wissen und seines Zieles bewußt, ein Kenner der Höhen und Tiefen des menschlidien Herzens, ein Kenner der Literatur, von unendlichem Vermögen zu genießen, sub tilem Instinkt für das Edelste. Mit vierundzwanzig, als er kaum seine erste Novelle veröffentlicht hatte, wurde er in den Kreis der erlesensten Geister Rußlands aufgenommen und ihnen zugezählt, war ein vertrauter Freund Leo Tolstois, des höchsten, ehrwürdigsten Greises Europas, der dem Volk ein Heiliger schien. Was der junge Gorki schrieb, wurde schon damals in alle Sprachen übersetzt, er war noch nicht dreißig, da kannte ihn die Welt. Als die Regierung des Zaren es wagte, ihn zu ver haften, in die Peter-Pauls-Festung einzusperren, gellte ein Aufschrei über die zivilisierte Erde „Rettet Gorki“. Nicht nur die Zeitungen des Proletariats, nicht nur die Organe und Ver bände der Intellektuellen - alles, was Presse heißt, die Zivili sation vertritt und verteidigt, alles, was Bücher liest und die Literatur als Bollwerk der Kultur betrachtet, stieß diesen Schrei aus, in Versammlungen, auf Plakaten, als Schlagzeile
2J4
der Zeitungen, Tag um Tag. Solch eine Weltbewegung um einen einzelnen - wetes nicht miterlebt hat, faßt es nicht. Da war einer, dessen großes Herz und dessen große Kunst so unmittelbar die persönlichste, innigste Liebe der Fernsten, selbst der Dumpfen und Skeptischen erobert hatte, daß sein Schicksal ihr Schicksal war, daß ihre Nerven es nicht ertragen konnten, ihn in Not und Gefahr zu wissen. Wäre Maxim Gorki mit vierzig Jahren gestorben - und seine kranke Lunge drängte ihn oft an die Ränder des Le bens -, dann hätte man ihn begraben als einen, der für alle Zeiten gelebt hat. Aber er blieb, um weiter zu dichten, zu wirken, um an Wirkung und Macht Höhen zu erreichen, die nie - in keiner Epoche, in keinem Lande - ein Dichter vor ihm erreicht hat. Die Revolution propagierte „Lesen, nicht beten!“. Sie stürzte Kirchen und Schlösser ein, aber sie baute Schulen. Als sie be gann, waren fünfundsiebzig Prozent der Bevölkerung Analpha beten, die dunkel wußten, daß das Buch Freiheit und Glück gibt; sie hatten es bisher nur in den Händen der Reichen und ihrer Vögte gesehen, jetzt rissen sie es an sich. Kinder und Graubärte, Mädchen und Mütter, Partisanen mit der Helle barde im Arm, Kosaken, die fünf Stunden Ritt zur Schule brauchten - sie alle stürzten sich ins Buch, als gälte es, einen Durst zu stillen, der durch Jahrhunderte immer bewußt ge wesen. Zwanzig Jahre später gab es nur noch zwanzig Prozent Analphabeten, jedes Dorf, jeder Arbeitsbetrieb, jedes winzige Kollektiv hatte seine Bibliothek. Von den Trägern großer Namen der russischen Literatur lebten nicht viele - der größte lebende Repräsentant dieser erhabenen Kunst, zu erzählen, das Dasein zu entwirren, den Menschen hochzustellen und auch sein kleinstes Schicksal als bedeutendes zu sehen, war Maxim Gorki - er, der auch die Ideen der Revolution vorangetragen, das Ethos der sozialen Revolution in früher Jugend schon verkündet hatte. Es entflammte in diesen Millionen gleichsam neugeborener Literaturadepten eine leidenschaftliche Hingabe, Verehrung, Dankbarkeit für die Person Gorkis, als hätte er ganz allein den Göttern das Licht geraubt und in seinen Händen in die
2JJ
dunklen, dunstigen Wälder getragen, darin Menschen wie Molche hausten. Sie stellten ihn neben den Abgott Lenin, sein Glanz verdunkelte den der revolutionären Märtyrer, Sieger, Baumeister. 1934 nahm ich an dem Ersten Schriftstellerkongreß der UdSSR teil, der drei Wochen lang währte. Drei Wochen lang war jede Zeitung der Union - dieses Staatenbundes von hun dertfünfzig Nationen und hundertsiebzig Millionen Menschen zu drei Vierteln, manchmal zu vier Fünfteln mit Kongreß berichten, Auszügen der Vorträge und Debatten, Bildern der Teilnehmer angefüllt. Ehrenpräsident dieses Kongresses, dessen Sitzungssaal drei Wochen lang für jeden Russen le nombril de la terre schien, war natürlich Maxim Gorki. Jede der zahllosen Arbeiter-, Soldaten-, Schüler-, Kinder-Deputationen, die aus allen Pro vinzen nach Moskau geschickt wurden, um dem Kongreß Sym pathie zu künden und sehr präzise Wünsche auf kommendes Schrifttum vorzubringen, sprachen nicht, ehe sie dem Genossen Gorki ihre ganz persönliche Verehrung ausgedrückt hatten. In den Lüften kreuzte der Riesenaeroplan „Maxim Gorki“, ein fliegender Zeitungsverlag, und in den Kongreßsaal rief der Führer einer von der Schwarzmeer-Kriegsflotte entsandten Deputation: „Dasselbe Recht wie die Flieger haben auch wirl Wir verlangen einen Kreuzer ,Maxim Gorki* I“ Neunzehn Millionen seiner Bücher - nicht Heftchen ein gerechnet, richtige Bücher - waren damals in der Union ver breitet, kein Dorf ohne Maxim-Gorki-Straße, kein Versamm-t lungssaal, kaum ein Zimmer ohne sein Bild.
In seinem Landhaus, eine Autostunde von Moskau, gab Gorki den ausländischen Kongreß-Teilnehmern und seinen engeren Freunden einen Empfang. Sein Landhaus war ein klei nes Palais, in feierliche Gärten gebettet, und es faßte etliche hundert Gäste. Rostbraun war sein Gesicht, wie ich es in Capri gesehen hatte, nur der buschige Schnurrbart gebleicht, hager und straff seine Haltung wie damals. Immer noch bäurisch und priester lich zugleich, saß er oben an der Festtafel, neben ihm ein
kindlich zartes Chinesentnädchen, politischer Flüchtling, durch die Kerker vieler Länder geschleift, in seiner Heimat zum Tode verurteilt. Lü-Tang hielt mit dünner, oft erstickter Stimme eine Rede auf „alte Golki“, die seine Weltbedeutung furchtbar illustrierte. Zwei ihrer Freunde - ein Jüngling und ein Mädchen, die Gorkis Werk ins Chinesische übertrugen waren verraten, verurteilt, lebendig begraben worden__ Aber ihr Sdiicksal hatte nicht abgeschreckt! Andere Qual und Tod Verachtende waren an ihre Stelle getreten. Jedes Buch, das er geschrieben, war ins Chinesische übersetzt, illegal gedruckt, geht - dem Leser Glück und Gefahr zugleich - heimlich von Hand zu Hand. Die Rede kam nicht zum Abschluß, bald lag die Kleine weinend, von seinem Arme bedeckt, an der mäch tigen, kranken Brust des weinenden Gorki. (Mir fiel fast peinigend ein, wie stolz Goethe war, weil ein Chinese mit zitternder Hand Werther und Lotte auf Glas gemalt.) Als zum Abschied Maxim Gorki auch meine Hand zwischen seine starken, braunen Hände legte und mir seine traurigen, Güte strahlenden Augen zuwandte, hatte ich ein seltsames Gefühl: so warm, so wirklich, so nahe - und ist er nicht den noch Mythos? Fand in unserer Welt, die wir kärglich und grausam kennen, ein so überirdisches Schicksal Raum? Das wuchs ja fast in die Dimensionen griechischer Göttersagen. Hat es die Geschichte je erlebt, daß ein Künstler von so herber, prunkloser, kantiger Art-und in keiner anderen Ausdrucksform als dem Wort diesen Gipfel erreicht, solche Macht über die Völker gewinnt? Verzeichnet die Geschichte ein zweites, so zur Erfüllung gelebtes Leben?
2J7
Die schöne Literatur
Viele Schriftsteller, auch solche von Rang, blieben in Deutsch land - es ist unzutreffend, daß die deutsche Literatur sich als Ganzes gerettet habe. Aber statt als Poeten die Poesie zu kommandieren, wurden sie selbst unter Kommando gestellt, von Polizisten beobachtet, auf das Prokrustesbett der Nazikulturgesetze gestreckt, mit Verhängung des Berufs todes ständig bedroht. Zugleich brach ihr Markt zusammen, nicht nur, weil ihre Produktion von Jahr zu Jahr dünner und schattenhafter wurde, sondern weil die Kaufkraft des Publikums rapide abnahm. In atemloser Wechselwir kung gingen Leistung und Gegenleistung zurück, die heutige Inlandsproduktion ist ein Bettel und wird mit Almosen gezahlt. Von den emigrierten Schriftstellern hat eine winzige Gruppe, die längst im Ausland populär war, weiterschaffen können, und eine Handvoll den deutschen Geist repräsentierender Werke ist im Exil entstanden. Aber ihre früher in Deutschland er schienenen Werke, die literarische Ernte einer Generation, wurden eingestampft, auch wenn die anderen nie ihr Wort gegen das Dritte Reich erhoben hatten, und sie konnten nur zum winzigen Bruchteil im Ausland neu verlegt werden. Den meisten ist der Atem ausgegangen - Zum Kriegführen kann man Anleihen erpressen und Noten drucken, zum Dichten ge hört Geld, Geld und zum dritten Mal Geld. Ein Nachwuchs konnte sich unter den intra wie extra muros herrschenden Be dingungen überhaupt nicht entwickeln, obwohl im Nachtrags band zum Großen Brockhaus Hunderte neuer Dichtemamen stehn. Wirklich bekannt wurden nur zwei neue, Bredel und zj8
Langhoff, die beide die Hölle der Konzentrationslager über standen hatten und sie mannhaft zu schildern vermochten. So ist die Stätte der deutschen Belletristik wüst und leer ge worden, und wer nach den Riesen fragt, wird sie bald nicht mehr Enden.
Zum Tode Rudolf Thomas’
Vier Wochen nach dem Reichstagsbrand hatte ich vom Dritten Reich genug gesehen, um meine Aufgabe zu wissen. Ich rettete meine Feder in die Tschechoslowakei, um die Welt auf die Schanzen zu brüllen, um alle Gesitteten wissen zu lassen, wel ches Schicksal über Deutschland hereingebrochen, welches Schicksal Europa erwartete, wenn es nicht auf der Hut war. In den Ländern, auf die es ankam, gab es noch keinen NaziWiderstand, zumindest nur schwachen. Da herrschte Demo kratie, gab es eine liberale Presse von höchster Bedeutung, gab es offene Herzen. Freilich, den flüchtigen Proletariern, verhungert und verprügelt, war in der Kriegszeit schwer zu helfen, sie führten meist ein Leben wie ausgestoßene Hunde. Aber dem Flüchtling von Distinktion, dem Schriftsteller von Ruf, taten sich viele Türen auf. Ihm - nicht seinem Wort! Ich schrieb in fiebernder Hast den „Roman eines Nazi“, der an einer deutschen Bourgeoisfamilie demonstrierte, was Naziherrschaft bedeutet. Es war kein Greuelbericht, ich schil derte an Atrozitäten nur ein Tausendstel dessen, was ich kannte, ich bändigte mein Entsetzen und meinen Zorn, weil ich die Trägheit des menschlichen Herzens kannte und ihren Widerwillen gegen das Mitleid. Aber das half nichts - kein Blatt deutscher Sprache, mit Ausnahme des „Pariser Tage blatt“, brachte den Tendenzroman, auch kein deutschsprachiger Verlag. Er tat in England, USA, UdSSR einige Wirkung wo man deutsch sprach, liefen meine Agenten sich nutzlos die Hacken ab. Einer dieser Agenten war Stefan Großmann in Wien, der - wissend, daß er am Vorabend seines Todes stand - Pakete von Briefen diktierte und seine verlöschende
260
Stimme am Telefon abquälte, um diese Warnung zu verbreiten. Nichts nützte es, die Österreicher, die Tschechoslowaken, dje Schweizer sollten nichts wissen I Ein demokratischer Studentenverband, dessen Mitglieder und alte Herren die ganze Republik Masaryks umspannten, wollte mir das Wort zu einer großen Demonstration geben. Es stand ein öffentlicher Festkommers auf ihrer Tagesordnung, ich wurde ersucht, die Festrede zu halten, und ihr Titel lautete „Der Prophet Heinrich Mann“. Aber ein Mitglied der deutsch demokratischen Landtagsfraktion - der Name dieses Imbezil len fällt mir nicht ein -, der vor mir eine kurze Begrüßung sprechen sollte, trieb Sabotage. Demokrat, Deutscher, Jude, „begrüßte“ er zwei Stunden lang, bis Mitternacht. Die Rek toren der Prager Hochschulen, die Professoren, hohen Beamten und älteren Herren verzogen sich, ich fand nur noch eine Handvoll ermüdeter Hörer. So war’s, so war's immer wieder - Proletarierzeitungen und Zeitschriften standen uns offen, aber die Bürger wollten, sollten nichts wissen. (Und die Proletarier wußten auch ohne uns ...) Damals lernte ich Rudolf Thomas kennen, Chef vom Dienst des „Prager Tagblatt“, der jung war, blitzend von Gescheit heit, voll Güte, ein so strahlender Mensch, daß ich sein Lachen nie vergessen werde. Er galt etwas, wenn er gewonnen wurde, war viel gewonnen I „Rudi“ hieß er im Haus und in der Stadt, jeder Mensch liebte ihn. Obwohl ihm etliche Stellen vorgesetzt waren - die Besitzer des Blattes, der „Herausgeber", der Chefredakteur konnte er, als der Tätigste und Klügste des Verlags, die Hal tung des Blattes bestimmen. Er hatte immer Zeit zu disku tieren, hörend, redend, in einem Gewimmel von Gästen und Redaktionswanzen, erledigte er Berge von Arbeit. Sein Zim mer war immer offen, man spielte Schach, man trank. Anton Kuh gab, an Rudis Schreibtisch sitzend, stundenlang Seancen, und viele Häuser weit dröhnte unser Lachen durch die Höfe der Panskä. Trotzdem wurde das Blatt auf die Minute fertig. Rudis Herz war groß, er riet und half, schenkte den Mäd chen bunten Schmuck und den Hungernden Brot, aber zum Kampf war er nicht zu bringen. 26t
Welch einen Gerechtigkeitsfanatismus entwickelte er in stun denlangen Diskussionen 1 Da jeder Botokudenstamm seine be malten Krieger habe, müsse auch Deutschland eine Armee aufstellen. Die Hitler-Regierung werde sich saturieren, aus absurd sich gebärdendem Most ein Wein werden. Einzelne Atrozitäten bewiesen nichts gegen ein System. Er sagte ganz offen, daß er tausend Rücksichten nehmen müsse. Die Besitzerinnen des Verlagshauses Mercy seien mit Aristokraten verheiratet, die man nicht verletzen dürfe. Ich ahne ja nicht, was für blonde Engelgesichter diese beiden jungen Damen gehabt, als er vor zwanzig Jahren ins Blättchen kam. Audi sei das Geschäft nicht sein Geschäft, es ging schlecht genug, seit das Blatt in Deutschland verboten war, er müsse die Sudetendeutschen schonen. Ich sdirieb mancherlei für ihn, er tat alles, um mich über Wasser zu halten. Aber er kontrollierte meine Beiträge mit Argusaugen, in jedem Filmreferat forschte er nach polemischen Kuckuckseiern, die ich freilich emsig genug legte - seine Leser sollten nichts wissen. Einmal Erschien F. C. Weiskopf in der Redaktion und zog aus der Tasche einen blutigen Strick. SA-Leute hatten einen vaterlandslosen, unpolitischen, armen, alten Juden, der seit Jahrzehnten mit einer deutschen Christin lebte, über die Grenze geschleppt und auf tschechoslowakischem Boden gehenkt! Der Strick war gerissen, ehe der Mann tot war, hier war er, vor der Tür stand der zu drei Viertel ermordete Mann mit den blutigen Strangulationsmarkertam Hals. Nein, darüber könne das „Prager Tagblatt" nichts bringen I „Wenn Ihr keine Menschen seid, dann seid doch wenigstens ein bißchen Journalisten!" höhnte Weiskopf. Schließlich einigte man sich - wenn der Bericht an anderer Stelle erschien, würde das „Prager Tagblatt" Notiz davon neh men. So geschah es: auf sechs Zeilen in kleiner Schrift wurde von einer Verletzung des Hoheitsbodens der Republik durch ein himmelschreiendes Verbrechen - mit allem Vorbehalt und Hinweis auf die allein verantwortliche Quelle - „Notiz ge nommen“. Man mußte mit der Lupe suchen, um diese Infor mation zu entdecken. 262
Ich versuchte in der „Neuen Weltbühne“ berühmte deutsche Schriftsteller, die keine Stellung zur Nazikulturpolitik nehmen wollten, zu provozieren. Rudi las meine Polemiken mit Ver gnügen, er las auch meine Berichte über eine Rußlandreise im Manuskript, das er mir dann mit Lobsprüchen zurückgab. Dann bat er mich, Beiträge für sein Blatt nur noch mit dem Vornamen zu signieren, ich sei jetzt endgültig kompromittiert. So war er, so waren sie alle... Die Vernebelung Prags wurzle gigantisch, hundert Meilen von der deutschen Grenze wußte man nichts. Ein Redakteur der „Bohemia“ entdeckte, daß in seinem Blatt, unter Pseudonym, Afrikareporte aus meiner Feder erschienen, von einem Freund hineingeschmuggelt, um mir ein paar hundert Kronen zuzuschanzen. Er machte Krach. „Wenn Balder Olden ein anständiger Mensch wäre, hätte er nicht zu emigrieren brauchen!“ fauchte 1934 der jüdische Redakteur einer demokratischen Zeitung Prags. Hundertundeinmal hatte ich mir den Schädel an solchen Mauern wund gestoßen, als ich einsah, daß an Kampf nicht zu denken war. Ich beschloß zu reisen, das „Prager Tagblatt“, froh, einen ewigen Vorwurf loszuwerden, griff mir unter die Arme. Unter den Freunden, die geschenkebeladen um Mitternacht auf dem schönen Wilsonbahnhof erschienen, als ich mit Primavera ins Dunkel fuhr, war auch Rudi, der strahlende, immer Liebe Gebende. Ich sehe noch sein offenes Gesicht mit der freien Stirn, seine lustigen Augen, seinen lachenden Mund. Bald darauf wurde der Chefredakteur Dr. Blau pensioniert und Rudi Thomas sein Nachfolger. Ich glaubte, der Kurs ginge nun endlich nach links! Aber das „Prager Tagblatt“ übernahm den Nachrichtendienst der „Times“, und was ihre Leser hinfort aus der großen Welt erfuhren, war durch die trübe Citybrille gefiltert. Rudi Thomas hielt sich selbst, hielt seinen Lesern die Augen zu. Zwei Jahre lang tobte der Freiheitskampf in Spanien, nie hat er - außer Havastelegrammen - ein Wort darüber ge bracht! Jetzt hat er seine Frau und sich vergiftet, gegen die Furchtbarkeit der Tatsachen hielt sein Zynismus nicht stand. Ob er der Katastrophe, die über sein Vaterland hereingebro263
dien, widerstanden hätte, in dem Bewußtsein, ein Wächter und Kämpfer gewesen zu sein? Vielleicht auch dann nicht. Vielleicht wartet auf uns alle der gleiche Tod, in unserem Reiseutensil ist der Giftbecher der wichtigste Gegenstand. Aber so bitter wird er uns nicht schmecken wie denen, die geschwiegen haben, als es galt, „Zu den Waffen!“ zu rufen.
Lieber Rudi Thomas! Guter, schwacher, fröhlicher Zyni ker - dies alles soll kein Vorwurf gegen Dich sein. So wie Du waren die in München, die in Berlin, in Wien und die in London, überall, überall, zehn Jahre lang, als hab'e sich ihr Selbsterhaltungstrieb unter einem lähmenden Blick jählings ausgeschaltet. Wäre es anders, dann hätte dieses Dunkel nicht wachsen können!
Ja und Nein
i
Bruno Frank hat einst das achtzehnte als „sein“ Jahrhundert erklärt, jetzt zeigt er sich im sechzehnten ebenso vertraut, kennt und versteht er das Spanien Philipps II. ebenso innig wie das Preußen Friedrichs des „Großen“. Es fällt unserem Weggenossen vielleicht besonders leicht, dieses Stück Spanien zu erfassen, denn zahllos sind die Analogien zum jüngsten Deutschland. Ein Cervantes, als junger Akademiker in den Weltkrieg gegen die Ungläubigen geschleudert, im Kampf verkrüppelt, von Piraten gefangen und auf fünf Jahre ins algerische Konzentrationslager geworfen, wund und unjung ¿war befreit, aber der Arbeitslosigkeit, dem Hunger in der Heimat ausgeliefert, dann zum niedrigsten und verhaßtesten Schergendienst erniedrigt, mischblütiger Abstammung geziehen und voi.ein Ahnenprüfungs-Tribunal gestellt, trotz hoher Ver dienste und schwerster Opfer für, den Staat verfolgt, ins Ge fängnis geworfen - diese Daten seines Lebens stehen fest. Ein deutscher Dichter unserer Tage konnte es getrost unterneh men, den Träger solcher Mißgeschicke darzustellen, als habe er ihm oft, in Kameradschaft und Liebe, ins Auge gesehen. Der Roman „Cervantes“ ist eine viel festere, treuere, wahrere Biographie geworden als die meisten ganz wissenschaftlichen, aber im Saus entstandenen Werke unserer Plutarche. Frank bringt, als Künstler, viel Leidenschaft für seinen Helden auf, seine Sprache schwingt, das freie Walten im Detail hat sein Werk nicht unseriöser, sondern stärker gemacht. Weit und klar liegt die Struktur jenes Spanien der Weltgeltung und des Niedergangs vor uns, deutlich trägt jedes kleine Begebnis seine geschichtliche Bedingtheit, herrlich wirkt die Gestalt i
265
des zarten, tapferen, anachronistischen Pilgers, der, zu seiner Befreiung, aus eigenem Blut den wunderlich-tapferen Don Quijote schuf. Bruno Frank sieht die Gestalten, die den Weg seines Helden gekreuzt haben, fühlt und träumt und weiß, was zwischen ihnen geschehen ist, liest zwischen den Zeilen ihrer vergilbten Briefe ihr Wollen und Leiden. Solche Fähigkeit, Zeitgenosse der Gewesenen zu sein, ist das Spezifische des Dichters.
II „Mit weldi edlem Anstand er sich leicht verneigte, sein feines, leicht spöttisches und doch so liebenswertes Lächeln um die schmalen, erfahrungsvollen Lippen 1 .... dachte Leonie, wäh rend sie seine schmale Hand betrachtete, die mit einer freien und unnachahmlichen Geste die unausbleibliche Zigarette hielt.“ - „Sie ließ das Papier zu Boden gleiten und barg ihr Antlitz, das tränenüberflutete, in ihren Händen.“ - „Auch in seinen Augen standen mit einem Mal die glitzernden Perlen der Tränen. Leise beugte er sich herab und küßte ihr die schimmernde Feuchtigkeit aus den Augen.“ - „Er lächelte ein ganz klein wenig, aber nicht viel.“ - „Mit seinen harten, stahl blauen Augen hielt er ... Ausschau." - „Melden Sie, rief er dem Mädchen zu, Baron Cosinsky und Baron Sternenfeldt sind unten und möchten Baronesse Cosinsky eiligst zur Galavorstel lung ins Stadttheater abholen.“ - „Ein kleines wehes Lächeln flog um ihren zitternden Mund.“ Man sieht aus diesen Zitaten, daß das dritte Buch des jungen Peter Mendelssohn nicht gerade Erfüllung dessen ist, was 1934 in der deutschen Emigration entstehen sollte, um künstlerisch und damit zugleich politisch für diese Emigration zu zeugen. Aber es wäre nicht schlimm, wenn zufällig im Ausland ein deutsches Marlitt-Talent, auch begrifflich ganz in der Marlittzeit verblieben, sich entwickelte; schlimm ist, daß ein zum Kampf bestimmter, mit kostbarem Kampfkapital begründeter Emigrationsverlag ein Buch solcher Art druckt, verschwende risch ausstattet und mit dem Fanfarenstoß herausgibt: „Endlich
266
einmal wieder ein Roman, ein wirklicher, guter Roman - keine Zeitgeschichte, keine Reportage I“ Menschen, aus der Heimat verjagt, beschimpft, bespien, Zeugen der grausigsten, letzten Niedertracht, die über die Kulturwelt niedergehen konnte, reiben sich die Peitschenschwielen auf Arsch und Seele und flüstern : .......nur keine Zeitgeschichte, keine Reportage“. Sie träumen von harten, stahlblauen Augen und lassen das Dienst mädchen „melden": „Baron Cosinsky und Baron Sternenfeldt sind unten und möchten Baronesse Cosinsky zur Galavorstel lung ins Stadttheater abholen.“ Sie sind ja so dankbar, daß man sie nicht - nur die anderen - zur Galavorstellung im Columbiahaus abgeholt hat, um sie dort die „schimmernde Feuchtigkeit glitzernder Perlen“ vergießen zu lassen.
267
Ein Dutzend Steckbriefe
Willi Bredel, Hamburger, von Haus aus Eisendreher, später kommunistischer Parteifunktionär, wurde am i. März 1933 in Schutzhaft genommen; war dreizehn Monate gefangen, davon elf Monate in Einzelhaft, von diesen wieder viele Wochen in Dunkelhaft; wurde - wie die meisten Schutzhäftlinge - un gezählte Male ausgepeitscht; lag nächtelang wie zertrampelt auf dem Boden des Folterkellers in seinem Blut. Er verwahrte einen Strick unter seinem Hemd, der ihm hinüberhelfen sollte, wenn die Summe seiner Leidenskraft erschöpft war. Ein Zellen nachbar, der sich selbst tags darauf erhängte, klopfte ihm nach einer Auspeitschung zu: „Du mußt durchhalten, um später zu berichten, wie die Faschisten mit wehrlosen Arbeitern um gehen!" Von den im Konzentrationslager Fuhlsbüttel Gefan genen wurden während dieser Zeit siebzehn Mann in den Selbstmord gefoltert oder buchstäblich tot gepeitscht, vierzehn enthauptet. Bredel kam zur Entlassung, man glaubte, jede Widerstands kraft sei in ihm erloschen. Er aber, noch nicht dreißig Jahre alt, ein Mann von kleinem Wuchs, aber gewaltiger Konstitution, sei nem politischen Bekenntnis mit Liebe und Leidenschaft hingege ben, sammelte neue Kräfte und flüchtete unter viel schlimmerer als Lebensgefahr aus Deutschland, um die Aufgabe zu erfül len, an die der sterbensbereite Genosse ihn erinnert hatte. In der ersten Stunde schon, als er auf sicherem Boden stand, verlangte er nach einem Arbeitsraum, einer Schreibmaschine ... Er hatte keine Zeit, sich pflegen und trösten zu lassen. Vier Monate später war „Die Prüfung" - ein Report in Form eines Romans - im Manuskript vollendet. 268
Willi Bredel hat mit aufeinandergepreßten Zähnen das Wüten der Folterknechte über sich ergehen lassen. Er hat auch den Bericht seiner Höllenzeit abgestattet, ohne einen Schrei auszustoßen. Deshalb die Form eines „Romans“, in dem er die Schicksale anderer berichtet, um Distanz zu nehmen, um das Wort „ich“ zu vermeiden, das angesichts dieser Schick sale pathetisch klänge. „Die Prüfung“ ist der erste Bericht aus den Konzentrations höllen, in dem es nicht nur um Vorgänge, sondern um Men schen geht. Aus der Schar der Märtyrer von Fuhlsbüttel er leben wir ein Dutzend so deutlich, ihr Denken, ihre Worte, ihre Reaktion auf das unfaßbare Schicksal, daß wir sie wirk lich kennen, und so wird die Tragödie der Zehntausende für uns die Tragödie von einzelnen, die unsere Freunde werden. So zwingt dieses machtvolle Buch jeden Leser, sich selbst und wenn es ihm den Schlaf vieler Nächte raubt - in ihre Lage zu versetzen, zwingt statt zum Mitleid für Anonyme zum Mit-Leiden, Mit-Erleben. Drei Elemente der Menschen schändung sind dort sinnreich vereint: preußische Rekruten schule, Zuchthaus und Inquisition. Die Prüfung des einzelnen besteht darin, daß er zugleich - für unlimitierte Zeit - wie ein preußischer Rekrut gedrillt, wie ein Verbrecher in Einzel haft gehalten und wie ein Negersklave mit Peitschen traktiert wird. Die Prüfung ist bestanden, wenn er trotz und trotz dem allen sein Selbstbewußtsein, seinen Kampfgeist bewahrt, wie es Bredel vermochte. Man fragt sich oft, wenn man die Berichte aus Deutschland Entflohener liest, oder - was noch furchtbarer ist - anhört: Aus welchem Pfuhl sind die Sadisten zusammengesucht, die Nacht für Nacht und Tag für Tag „Volksgenossen“ bis zur Aufgabe ihres Ichs quälen? Sind das überhaupt noch Men schen? Bredel antwortet. Er malt diese Gestalten, gibt ihr Denken und Reden wieder, er scheint sie ganz ohne Haß zu sehen, und es zeugt von höchster künstlerischer Disziplin, von einem bewundernswerten Ethos, daß er sie eher vermenschlicht als verzerrt. Man wird die Originale dieser Figuren eines schaurigen Romans erkennen, wenn man dieses Buch in Hamburg liest. 269
Sie sind mit ihren echten Namen benannt. So sehr ist dieser „Roman“ Protokoll, daß er ein Dutzend Steckbriefe gegen Verbrecher enthält, die krimineller sind als die weltberühmten Massen-Lustmörder deutscher Nation, Haarmann, Kürten und so weiter. Diese Sturmführer Dusenschön, Harms, Zirbes, Meisel, König, Reichsstatthalter Kaufmann, Standartenführer Kaufmann, Ellernhusen (Adjutant des Reichsstatthalters und hamburgischer Staatsrat), treiben wohl noch heute ihr niedriges Handwerk, sind ehrengeachtet, ziehen über die Straße, besau fen sich auf den „Kameradschaftsabenden". Die deutschen Be hörden, denen Bredels Buch zugeht, brauchten nicht lange zu suchen, wenn sie ihr Tun.mißbilligten. Es sind vereidigte, be amtete, soldatisch eingegliederte Personen, sind auch keine Wesemänner, da läßt sich nicht ableugnen, daß sie „von amt lichen deutschen Stellen Aufträge erhalten haben; die mit der Angelegenheit in Zusammenhang stehen". Machen wir uns keine Illusionen, denen geschieht nichts; was sie tun, heißt im Dritten Reich treue Pflichterfüllung. Aber Bredels edles, gewaltiges Buch wird vor vielen anderen Instan zen Zeugnis ablegen, nur das offizielle Deutschland wird sich taub stellen.
270
Der Unpolitische
Thomas Mann hat kürzlich eine Tischrede gehalten, die mit den wuchtigen Worten begann: „Für den Schriftsteller ist es heute unumgänglich, auf irgendeine Weise in die politische Diskussion einzugreifen, da die Zeit sich des Menschen in einer neuen, verhängnisvollen Weise bemächtigt.“ Diese Einleitung las ich und rollte die Augen vor Gier auf das Kommende - aber das Stenogramm gab nichts mehr von dem, was ich erwarten durfte. „Einen neuen Humanismus“ sah der Deutschen repräsentativster Dichter am Himmel sich künden, ohne seine Symptome zu registrieren; sein Auge flog über die Gegenwart hinweg, dorthin, wo menschliche Zukunft angeblich silberstreift, und erklärte ihr sein Vertrauen. „Wenn diese neue Liebe wieder herrschend geworden ist, dann wird die Welt besser und schöner sein, als sie heute aussieht.“ Mehr hatte der Nobelpreisträger nicht in die politische Diskussion einzugreifen. In den Kreisen der deutschen Intellektuellen Prags, die eben seinen Besuch als hohe Ehre und seinen Vortrag über Richard Wagner als die Kundgebung eines Erlauchten empfunden hat ten, hörte ich auch den Brünner Trinkspruch eifrig, wehmuts voll, bewundernd diskutieren: Ein Dichter vom Höhenflug Thomas Manns könne und solle sich nicht tiefer in den Streit der Parteien mischen. Weltabgewandt zu sein beweise und ziere den adligen Geist. Ich hörte nur Bewunderung, nirgends loderte Enttäuschung, es sei denn, in Winkeln der Herzen, die sich hermetisch verschlossen. Aber cs stimmt dies alles nicht; wenn Thomas Mann von jedem Schriftsteller verlangt, daß er in die politische Diskus
sion eingreife, ist er sich bewußt, keine Ausnahme zu sein und keine Ausnahme machen zu dürfen. Rücksichten auf mir un bekannte Dinge, aber nicht auf den Mimosencharakter der Poetenindividualität ließen ihn dann in rosa Zukunft zurück schrecken und den eigenen Mut bereuen. Es war nicht immer so: Mir haben sich ganze Absätze aus den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ silbenscharf ins Gedächtnis gegraben, die Thomas Mann während des Krieges schrieb und die ich, als Kriegsgefangener, als wutfauchendes Opfer des Krieges, mit Entsetzen las. Wie er da dem Krieg seine Ehre gab - das war nicht weltabgewandt. Wie er sich selbst „wegen eines Minimums von Objektivität“ in den „Schützengräben und im Trommelfeuer der öffentlichen Meinung“ sah, das war nicht reserviert. Wenn Deutschlands Krieg anders geendet hätte, mit einer nur fünfzigprozentigen Niederlage, dann wäre Thomas Mann auf dieses Buch hin ein Bardengott in Germanien gewesen. Nur langsam, unendlich zögernd, schloß er sich dann der Republik an, aber diese zage Republik erwartete kein freudiges „Ja“ der begabtesten und verwöhntesten Deutschen. Sie ging unsichtbar ihrem Ende schon entgegen, als Thomas Mann sich endlich zu ihr erklärte - und dahn wirklich, im „Berliner Tageblatt“ demokratischen Andenkens, den Catilinas ein prachtvoll-majestätisches, ein so formschönes wie feuriges „Quousque tandem“ entgegenrief, weltzugewandt, unbeschadet der eigenen Aura, erdhaft-politisch. Aber gleich darauf ging das Bestehende aus den Fugen wie vierzehn Jahre zuvor das vom „Unpolitischen“ erdhaft-politisch Bewunderte. Seither schweigt Thomas Mann. Deutschland, sein Heimatland, Wurzelland, wurde zur Öde. Vernichtet die Verfassung, die Justiz eine Sechs-Tage-Bahn für Radfahrer, die sich nach oben bücken, nach unten tram peln, die Hochschulen verwüstet, in Turnhallen und Hörsäle für Rassenunlehre verwandelt, der freigeborene Mensch zum Fußball der Machthaber erniedrigt, jedes Recht des Indivi duums aufgehoben, aufgehoben Redefreiheit und Pressefreiheit, verschwunden das Recht auf Forschung, Lehre, Denken. Die Schulen Prügelanstalten, die Gefängnisse Prügelanstalten, der ganze Staat eine friderizianische Kaserne. Ohne Gericht, ohne *7*
Verteidigung, auf unbegrenzte, von Willkür bestimmte Zeit gehen Hunderttausende in jene Schreckenskammer, die sich Konzentrationslager nennt. Dort wird gefoltert, wie im Mittelalter und in der Inquisition nicht gefoltert wurde. Denn da mals wollte man durch Martern die juristische Wahrheit fin den; heute ist Folter bis zum Tod Selbstzweck, Strafe für Andersdenkende oder eine Art Demagogie. Zehntausende wer den zu Krüppeln geprügelt, in Nacht und Wahnsinn gequält. Die Kirchen werden exerziert, die Priester mit Fußtritten ge leitet. Es werden die Leuchten der Wissenschaft gedrillt, die Sucher und Propheten, die Mütter und Poeten, die Greise, die Mädchen, die Kindlein. Es wird gemordet, Judenblut trieft vom Messer, und eine Nation feiert in Liedern dies Begebnis. Es wird femegemordet, beamtete Bravi werden ins Ausland gesandt, Revolver knallen und Karabiner rauchen, die deutsche Justiz, längst eine Hure, wird zur Megäre. „Zwischen der deutschen Regierung und mir bestehen keiner lei Divergenzen“, manifestierte Thomas Mann, als ihm der Paß verweigert wurde. Zwischen dem, dfer Deutschlands Ge wissen zu sein hätte, und den regierenden Marodeuren, den Leichenfledderern unserer Zivilisation bestanden keinerlei Divergenzen? Hatte der Weltabgewandte von all der Schmach nichts ver nommen, davon ich hier nur ein Bruchteil nennen konnte? Hat er sie heute noch nicht wahrgenommen, nach zwei Jahren mora lischer Sintflut? Sein Bruder, der viel akademischer denkt, hat seinen Ekel hundertmal in die Weite geschrien, um der Menschheit die Ohren aufzureißen. Sein Bruder, dessen hohe Dichterqualität er anerkennt, ist dem Ossietzkyschicksal, daß „die Zeit sich seiner in einer neuen, verhängnisvollen Weise bemächtigte“, nur durch Zufall entronnen. Seine Kinder, fünf hochbegabte, auf ihren Vater stolze Kin der, sind in Deutschland als Nichtarier zu Parias geworden, vaterlandslos, weil Frau Thomas Mann die Tochter eines jüdi schen Gelehrten und Nobile ist. Sein Sohn Klaus ist ausgebürgert, verfemt, vogelfrei erklärt, weil er in die Fußtapfen des Onkels Heinrich trat. 18
Paradiese
273
(Sein, Thomas Manns, Eigentum wurde nebstbei beschlag nahmt; das wäre gleichgültig, es hätte ihn nur aufmerksam machen müssen, wenn er wirklich, im eleusischen Hain irrend, die Gegenwart überdämmert hätte.) Will er nicht wissen? Thomas Mann schweigt, läßt weiter seine Bücher in Deutsch land erscheinen. Er besiegelt durch jedes neue Buch, durch jede Zeile, die er in Deutschland drucken läßt, daß er sich neben Gerhart Hauptmann stellt, den Epikuräer ä tout prix, nicht neben Heinrich Mann und alle, die man in der Geschichte die Getreuen bis in den Tod nennen wird. Viel danke ich dem Dichter Thomas Mann; ich bin auch dem Menschen tief verpflichtet. Aber ich halte es für wichtiger als dankbares Schweigen, zu seinem Schweigen dies auszu sprechen: Nicht Neider viel gewinnt Thomas Mann, wenn er weiterhin Wahrheit schweigt! Mit der Krone des Lebens spielt Thomas Mann und hat sie vielleicht schon verspielt - ehe die Welt „schöner und besser ist, als sie heute aussieht“.
Eine Biographie des Nil
Bismarck - Wagner - Dehmel - Goethe - Rembrandt Napoleon - Wilhelm II. - Jesus Christus - Hindenburg Mussolini - Masaryk ... Dazu in kürzerer Fassung: Friedrich II., Stein, Stanley, Peters, Rhodes, Lenin, Wilson, Rathenau, Leonardo, Shakespeare, Rembrandt, Voltaire, Byron, Lassalle, Schiller, Dehmel, Bang, Nansen, Masaryk, Briand, Motta, Lloyd George, Venizelos, Stalin ... Das wäre - noch nicht einmal vollständig - das essayistisch historische Werk des fünfundfünfzigjährigen Emil Ludwig, der zugleich als Lyriker, Dramatiker, Romancier, Literaturhisto riker aufgetreten ist. Diese Fülle der Themen, sagt man sich, kann nur Überfülle sein, weckt Mißtrauen. Natürlich kann ein Mensch nicht gelesen haben, was zur Quelle von soviel Wissen diente, Ludwig hat nicht geforscht, sondern forschen lassen und das Lesegut seiner Mitarbeiter gemünzt, kann nur dank der glücklichsten leichtesten Schreibehand unserer Epoche, journalistisch geformt haben. Er muß - im Gewände des Historikers - beim Journalismus geblieben sein, von dem er kam. Dies Œuvre jedoch ist überall packend, auf jeder Seite, die ich aufschlage, hat es den Goût von hart erkämpfter Erkennt nis, auch dort, wo Stil und Standpunkt mir zuwider gehen. Wird nicht trotzdem eine künftige Literaturkritik Ludwig unter die genialen Dilettanten reihen, die ihre Zeit in tausend facher Brillanz zu blenden wußten und über ihre Zeit hinaus wenig vermochten? Ich glaube es nicht mehr. Emil Ludwig hat den ersten (dreihundertfünfzig Seiten starken) Band einer 18*
275
völlig unerwarteten Biographie erscheinen lassen, ein kurzes Jahr nach dem „Hindenburg“! Ihr Titel: „Der Nil", Band i, „Von der Quelle bis Aegypten" (Querido-Verlag). Hier geht es um Geographie und Wirtschaft, Biographie und Irrigation, Fauna und Industrie, Psychologie und Politik, um lauter Dinge, die biologisch, geschichtlich und aktuell zugleich sind, hier wird kein Aphorismus sich ablenkend vor ein Pro blem stellen, kein glücklich formuliertes Referat eine Erkennt nis ersetzen können. Ich habe sehr gierig dieses Buch zuerst durchflogen, dann studiert, denn ich habe in kolonialen Pro blemen gesteckt, kenne den Nil von der Mündung bis zur Quelle, kenne seine Literatur, habe mich von „alten Afrika nern“ aller Fächer unterrichten lassen. Nun, dieses Buch ist echt, diese Reisen vom Tana-See und Spekes Golf bis Wadi Haifa - der die Reise von Wadi Haifa bis Port Said und Alexandrien folgen wird - hat kein Routi nier geschildert, um zur Tagesfrage Abessinien rasch einen Beitrag zu liefern, sondern ein ganzer Mensch hat mit allen Organen in die afrikanische Welt getastet, nach dem Warum der Erscheinungen gesucht, Zusammenhänge erforscht und er kannt, die Bilder Afrikas auf seine Seele wirken lassen wie ein Jüngling, der zum ersten Mal reist. Seltsam, das Sehen ist frischer, die Sprache echter, die Bildung weniger aufdringlich als in desselben Verfassers erstem Buch über Afrika. Vielleicht ist „Der Nil" sein bestes Buch, vielleicht Afrika seine stärkste Liebe. Vor dreißig Jahren erschien ein entzückendes Reisebuch, „Caput Nili“, dessen Autor, Richard Kandt, ein sonst ganz unliterarischer Arzt, von sich und seinen Erlebnissen auf einer Forschungsreise durchs Kagera-Gebiet mit Seele und Laune berichtete. Seltsam, daß an diesem Thema der Fachmann fast zum Dichter wurde, während der Dichter Ludwig ganz zum Fachmann wird, der eigenen Person kaum Erwähnung tut. Duft und Farbe einer solchen Reise hat der Tropenarzt ge schildert, der Dichter beschränkt sich auf die Erkenntnis. Das soll nicht sagen, daß Ludwigs Buch trocken sei. Es ist im Gegenteil ein schimmerndes Bilderbuch, kurze Kapitel wie das über die Mondberg-Pygmäen, die Elefanten, Samuel
Baker, Gordon, den tollen Hitler-Typus des Mahdi - der in zwanzigjähriger Herrschaft acht Millionen Sudanesen auf zwei Millionen schmelzen ließ -, die Stauwerke hei Assuan, sind in kleinem Format große Epik. Es soll nur einen ungerechten Ludwig-Mythos zerstören. Er hat das Buch in Eile redigiert, das beweist die Interpunktion, aber mit Gründlichkeit konzi piert und geschrieben, es ist das Resultat mehrerer großer Reisen und ernstester Beschäftigung mit einer Spezialbiblio thek. Herodot war ein viel tollerer „rasender Reporter“, er hat das Material für sein ewig fortblühendes Werk über Ägypten in zehn Wochen gesammelt. Der Grund aber, das Werk hastig abzuschließen, ist seine brennende Aktualität. Der Feldzug in Abessinien, der dro hende Aufstand in Ägypten, Englands plötzlich so leidenschaft liche Treue zum Völkerbund, die Drohung eines Weltkrieges, die heute die hellste Stunde verbittert - all das steckt wie im Ei in den Gegebenheiten: Nil und Suez-Kanal. Das Herzstück dieses Werkes ist ein Bericht über Abessinien und seine jüngste Geschichte, besonders deshalb mußte es eilig erscheinen. Und auch den zweiten Band voll brennend aktueller Themen muß Ludwig überstürzt erscheinen lassen, denn die Welt braucht es.
277
Der letzte Zivilist
Wer noch ein Herze hat, dem soll’s Im Hasse nur sich rühren . . .
Ernst Glaeser läßt, drei Jahre nach dem Umsturz, einen Roman erscheinen (Verlag des Europäischen Merkur, Paris), der die Geschehnisse in Deutschland bis zu diesem Umsturz schildern will, nicht vom Standpunkt der Geschlagenen, sondern von dem der Sieger her. Wie ergeht es einem deutschen Burschen von Format und Gewissen - das ist sein Problem -, der an Hitler glaubt, zu seinem Haufen stößt und langsam inne wird, wohin der Marsch geht? Der Primaner Hanns Diefenbach zu Siebenwasser in Würt temberg hat mit anderen jungen Nazis im Theater demonstriert. Sie haben sich mit „Deutschland erwache! Fort mit dem Juden dreck!“ undsofern heiser gebrüllt, Hanns Diefenbach erscheint vor dem alten Direktor seines Gymnasiums, der Humanismus trieft und für die Roheit seines Schülers nur Tränen hat. Ein Polizeioffizier, der den Burschen eskortiert und immerhin vom „Tatbestand des Landfriedensbruchs" spricht, wird von ihm angedonnert, gegen den begeisterten Jüngling aber nur der Vorwurf erhoben, „Sie haben gebrüllt, wo Sie hätten über zeugen sollen, Sie haben Platon verletzt! ..." Soviel steckt der Primaner noch ein. Als aber sein Direk tor weitergeht und auf Hitler deutet: „Damals war es wenig stens Alkibiades, der den Göttern die Köpfe abschlug und euch verführte, wenigstens Alkibiades, ein Grieche. Ein Ab trünniger, aber wenigstens ein Abtrünniger. Heute aber hat euch der Barbar, der stumpfe Gewaltanbeter, der Hexen meister, der Rattenfänger in seinen Klauen ..wird es dem Hitlerianer zuviel, und er schlägt seinem greisen Direk tor eins hinein, daß die Brille zerbricht. Als Holzapfel
278
einen Ersatzzwicker auf der Nase hat, blickt er Hanns „liebe voll“ an. „Hanns, ihr seid gute Jungens. Ihr alle glaubt Deutschland verraten. Ihr wollt es retten. Ihr werdet es zu Tode retten I“ Die Szene schließt, indem Direktor Holzapfel die beiden, Hanns und den Polizeioffizier, verabschiedet: „Ich danke Ihnen, meine Herren.“ So gab sich die Macht in der deutschen Republik? Oder schreibt Glaeser eine Parodie? Diefenbachs Mutter ist Kriegswitwe, früh vertrocknet. Eines Tages hört sie „den Führer“ zum Volk sprechen, daß die Mauern dröhnen: „Wir machen jetzt Schluß mit der verdamm ten Demut 1 Wir sind erwacht 1“ Der Roman berichtet: „Es war Hertha, als dröhne die Kup pel unter einem gewaltigen Hammer, so geschlossen war der Schrei der Menge. Sie schloß die Augen. Sie gab sich der Stimme hin. So hatte sie noch kein Mann besessen.“ Weiter wird von ihr berichtet: „Sie nähte Tage und halbe Nächte. Aber alles war ihr jetzt verklärt. Die Not war nicht mehr aussichtslos. Sie brauchte nicht mehr auf die himmlische Gerechtigkeit des Pfarrers Möl ler zu warten. Sie saß in der Küche und las die Worte des Mannes von München. Was war dagegen die Verheißung der Bibel?“ Sie findet bald einen Nazi vom echtesten Streichertyp und liebt ihn so hingebend, daß sie den eigenen Sohn darüber ver stößt und sogar vergißt. In der Familie seines Vaters habe es jüdisches Blut gegeben, lügt sie ihm nach, nur sein Tod für die Bewegung könne die Schande löschen. Hanns springt ins Wasser, ein älterer PG, ehemaliger Offi zier, homosexuell, rettet ihn und macht ihn zu seinem Gelieb ten. Aber später, als Gutseleve, gewinnt der Lustknabe ein schönes Mädchen, die Tochter seines Gutsherren, und als sie schwanger wird, kann er „plötzlich nicht mehr hassen“, ent fremdet sich der Bewegung. Mit zwanzig Jahren ist er ein un politischer Landmann, zimmert und bemalt für das erwartete Kind eine Wiege und würde bald, aller Konflikte ledig, als Schwiegersohn des reichen Bäuerle die eigene Scholle bebauen, 279
wenn er nicht der Feme seiner Partei verfiele. Denn einmal, als er, verliebt und glücklich, den Blutorgasmus seiner Führer nicht mehr ganz verstand, hat er bei einer Rauferei zum Schutz eines Antinazi, eines verkrüppelten Kriegsveteranen, interve niert. Dafür, vor allem aber, weil sein homosexueller Freund sich exponiert hat, wird er auf eine sehr typische Naziart bloß gestellt und begeht Selbstmord, zur gleichen Stunde, da Irene sein Kind gebiert. Wir müssen, Ernst Glaeser zulieb, hinnehmen, daß ein Bursche, der seinem verehrungswürdigsten greisen Lehrer ins Gesicht schlägt, trotzdem besserer und edlerer Art sei als die Masse der braunen Jugend. Wir müssen es sogar als Rekompensation gelten lassen, daß er einen Invaliden in Schutz nimmt. Die Hingabe eines geschlechtlich Normalen an einen Homo sexuellen darf uns nur als typisches Jugendschicksal erscheinen, auch dies - wenn selbst ein Vorwurf zu erheben wäre - gelte als gutgemacht durch seine Liebe zu einem hochstehenden Mäd chen. Wenn er als armer Gutseleve bürgerliche Karriere im Bett dieses Mädchens macht, sollen wir reinen Herzens ■ glau ben, er denke nur an das Mädchen, nicht an das Landgut, das sic ihm zuträgt. In Gottes Namen ... Aber daß in dem Jungen kein Blutstropfen lebendig wird, als er sogar am eigenen Leib erfährt, wie nichtswürdig die Abgötter seiner Knabenzeit sind, das begreift sich schwer. So vollzieht sich der Umschwung in diesem Helden, der doch wohl das bessere Deutschland repräsentieren soll. „Hanns liegt auf dem Rücken. Er spricht auf sich ein. Was ist nur mit dir? Wer bist du denn überhaupt? Hanns Diefen bach, das war wohl einmal, das ist jetzt ein Toter? Hast du alles vergessen? Holzapfel, Gerhart, die Kameraden? Und jetzt kommt der Führer, und du liegst hier im Gras und schaust nach dem Himmel. Nein, eine Hummel betrachtest du, ein kleines, lächerliches, dummes Tier, wie es da in der Blüte wühlt und sich staubig macht mit dem Samen. Hanns, ein Abtrünniger bist du, ein Weiberknecht, ein Verlorener.“ Und so vollzieht sich sein Ende, noch ehe die Nacht über Deutschland hereingebrochen, noch ehe Hitler Reichskanzler ist. Er spricht mit dem Vater. „,Ich weiß nicht, wo du bist',
280
sagt er leise, .aber es ist dein Herz, das ich habe. Es ist ein einfältig Herz... ja, und es genügt nicht, daß es gut ist... siehst du, es genügt... heute nicht mehr .. .* Und plötzlich nimmt er das Bild. Er zerreißt die Photographie. ,Ich könnte ja noch leben*, sagt er laut, .aber mich ekelt.* Jetzt nimmt er die Waffe." So weit kann unser Verstehen nicht reichen, daß wir diesen Burschen ohne Verachtung hinnähmen, dies windelweiche Ge schöpf, unfähig zur Liebe - denn er läßt nur aus Dégoût Weib und Kind im Stich -, unfähig zum Haß, unfähig zur Kamerad schaft, unfähig zum Leiden, roh und sentimental, hysterisch und berechnend. Vielleicht wollte Glaeser an ihm demonstrie ren, wie erbärmlich die deutsche Bourgeoisie war, und daß eben deshalb kommen mußte, was kam. In ganz Siebenwasser ist dieser Selbstmord eines Waschlappens die einzige Demonstra tion gegen die aufsteigende Herrschaft der Barbaren. Aber dann war es nicht recht von Glaeser, daß er in Siebenwasser kein politisches Proletariat existieren läßt, es sei denn, daß eine Handvoll Kommunisten erwähnt wird, die nach kurzer Diskussion zu Hitler überlaufen. Dieser Roman, der vierhundert Seiten lang ist, stellt den Anspruch, das ganze Deutschland von 1927 bis 1953 lebendig zu machen, und enthält ein gutes Dutzend Episoden, die mit der Haupthandlung nichts zu tun haben, nur die politische Situation klarlegen sollen. Es wird aber nur ein Segment der deutschen Welt geschildert, in dem es kein Zentrum, keine Kirche, keine Marxisten, nicht einmal Stahlhelm und Konservative gibt. Der unpolitische Kriegsinvalide, der einmal mit seiner Beinprothese um sich schlägt, weil die Naziroheit ihn anwidert, ist kein Repräsentant irgendeiner Gruppe, sondern, falls überhaupt glaubhaft, nur ein sauberer Sonderling. Auch Bäuerle, der „letzte Zivilist“, bleibt trotz vieler Worte ein individueller Schatten; er ist als Knabe, süddeutsche achtundvierziger Ideen im Kopf, nach Amerika ausgewandert und 1920 rückgewan dert, weil ihm nach Versailles „die Preußen“ aus seiner Heimat vertrieben schienen. Nach Hitlers Sieg wandert er, mit Tochter und Enkel, abermals aus - um den Hals des Säuglings hängt ein Beutelchen mit „Erde von daheim“ -, um Zivilist bleiben
281
zu können. „Seine Gefühle, seine Vorstellungen, seine Liebe zu Deutschland waren in ein schmerzliches Schwanken ge raten.“ Eine Gruppe vertritt auch er nicht. Plus des Romans bleibt eine Reihe lebendig geschilderter Nazifiguren nach lebenden Modellen und vortrefflich gemalter Einzelgescheh nisse. Der junge Meister vom „Jahrgang 1902“ versagt nie vor Schwierigkeiten literarischer Technik. Aber wenn er mit Men schen- und Engelszungen predigte - er hat weder der Liebe noch des Hasses, so hat auch seine Sprache nicht mehr das alte Korn. Aus Ekel vor den Roheiten der Nazis erschießt sich Hanns Diefenbach, aus Ekel wandert Bäuerle nach Amerika zurück. Nur als Ausdruck seines Ekels hat Glaeser dies Buch ge schrieben. Ekel verdrängt der ästhetische Mensch lieber, als er ihn ausdrückt, und so ruft auch Glaeser dem segelnden Bäuerle zu: „Laß deine Trauer nicht in Haß ertrinken. Ver beiße den Fluch! Schweige, schweige, wie es die Würde der Liebenden verlangt!“ Auch ein Kommentar des Verlags unterstreicht, daß sein Werk „nicht von Verbitterung und Haß getragen wird“. Nur ein „schmerzlich bewegtes Herz“ wird Ernst Glaeser nebst „unerbittlich klarsehenden Augen“ nachgerühmt. Das ist wenig, nach drei Jahren bornierter Terrorherrschaft, während deren Deutschland schon für Jahrzehnte verrottet und geschändet wurde und die noch lange nicht gebrochen ist. Aber mehr als das wird man dem Roman kaum nachrühmen können.
2S2
Notwendige Kritik
Selbst an den in deutschen Quällagern Konzentrierten und durch die Fremde irrenden Emigranten gibt es etwas zu fled dern: das Mitleid, das ihnen gebührt, so herzlos geizig die Welt es zumißt. Die Emigrationsämter haben viel saure Arbeit mit solchen Nutznießern der grausigsten Konjunktur; aber sie treiben ihr Handwerk nicht nur als Klinkenputzer, sondern auch in Schrift und Druck. Vor kurzem lief durch das Feuilleton eines Emigrantenblat tes ein langer Bericht aus Dachau, der solche Fledderei be deutet. Ein Mensch erzählte da als sein eigenes Schicksal das Erlebnis eines rückkehrenden jüdischen Emigranten, der ver haftet und in Dachau „geschult“ wird. Es handelt sich nicht um den literarischen Versuch eines fingierten Reports - der Autor hat sich an mich und zweifellos an zahlreiche Menschen ge wendet, um Hilfe zu finden und mit Leiden zu prunken, die andere leiden und erlitten haben. Erniedrigung, Hunger, Peit schenhiebe, Bunker, dies alles eskamotierte er, ein masochisti scher Tartarin de Tarascon. In seinem Bericht stand, er und „alle anderen“ Häftlinge fürchteten, „wegen des ewig bohren den Hungergefühls wahnsinnig zu werden“. Sogar das Fetz chen Papier fehlte, das zur Hygiene gehört, grausam und ekel haft wurde dargestellt, wie sie sich zu helfen versuchten. Im gleichen Abschnitt kommt ein Mann vor, der in dieser isolier ten Baracke „aus Brot und Papier" Spielzeug herstellt, dar unter Schachspiele. Im gleichen Kapitel wird erzählt, daß einer dieser geknebelten Juden sich auf andrer Kosten „ein leichtes Leben verschaffte“, daß F. „ein guter Unterhalter war“. „Gr. unterhielt uns manche frohe Stunde“, F. „klaute mit gro285
ßer Geschicklichkeit Brot aus den Brotkästen“, P. „war ver fressen wie keiner". Erst erfahren wir, Rasierapparate, Seife wurden zurückgehalten, einige Fortsetzungen darauf heißt es: „Außerdem hatten wir zu drei Rasierapparaten etwa zehn Klingen.“ Später wird die Isolierung der Judenbaracke aufgehoben, und die Remigranten nehmen an einem „Fußballwettspiel um die Lagermeisterschaft“ teil. Die bis zum Wahnsinn Ausge hungerten, grausig Mißhandelten, durch Sträflingsarbeit Er schöpften sind in Fußballteams eingeteilt und veranstalten Meisterschaftskämpfe! Der Fußball fällt in den Stacheldraht verhau, und ein Linienrichter bittet den Posten um Erlaubnis, ihn zu holen. Der Soldat erlaubt es, schließt aber im Augen blick, da der bejahrte Mann, Familienvater, nach dem Leder greift, den elektrischen Kontakt, und der Gefangene wird vom Strom getötet. Der Erzähler weiß nicht, daß der Drahtverhau ums Konzentrationslager ständig elektrisch geladen ist, so daß jede Berührung den Tod bringt, was aber jeder Gefangene weiß. Auf keinen Fall kann der einzelne Posten den Strom ein- oder ausschalten. Aber der Pseudomärtyrer ahnt vom System der elektrisch geladenen Drähte sowenig wie von den Wirkungen des Hungers, er ahnt nichts von den Bedingungen des Lagerlebens, hat weder Phantasie noch Einfühlungsgabe. Er hat Berichte aus Kriegsgefangenenlagern, Konzentrations lagern und Gefängnissen gelesen, daraus macht er einen Absud. Das wird gedruckt, weil ein Redakteur gleich ahnungslos oder schläfrig ist; der Autor, der zwar pseudonym schreibt, aber in diesem Report unter seinem wahren Namen als Mißhandelter auftritt - ein Goebbelsepigone, Goebbels log auch, er sei in Gefängnissen von den Belgiern gepeitscht worden -, kann jetzt die armen Tropfen Teilnahme auffangen, die den wirk lich der Hölle Entronnenen gelten. Dafür hat er grenzenlosen Schaden angerichtet, denn da er Unmögliches, sich selbst Widersprechendes erzählt, entzieht die Welt zugleich mit ihm den Glauben auch jenen Seger, Bredel, Langhoff und vielen anderen, die Erlittenes Weitergaben und nicht nur auf der Epidermis, sondern auch im Stil Zeugnisse der Wahrheit ihres Berichtes tragen. 284
Der Nazi-Presse wird es leicht, an Hand so plump gemach ter Greuelgedichte die furchtbare Wahrheit der Greuelberichte zu erschüttern. Aber sie finden in dem Pseudoreport noch bes sere Weide. Da gibt es einen jüdischen Goliath, der seine Schicksals genossen grausamer mißhandelt als die SS-Schergen. Ein Jude wird Barackenkorporal und wird der schlimmste all dieser Sadisten. Die gefangenen Juden aber - unter denen es von Karikaturen wimmelt, aber kein ernstes Gesicht auftaucht sind einander alle sehr bald „zum Kotzen". Moralisch weniger schwer liegt der Fall eines anderen Autors, der sich Konrad Merz nennt und das Buch „Ein Mensch fällt aus Deutschland" bei Querido erscheinen läßt. Er be zeichnet sich - obwohl der Roman aus Briefen, Notizen, Tage buchfetzen in Ich-Form besteht - nicht ausdrücklich als den Helden, sondern widmet sein Buch „Den Opfern“. Wer sehr aufmerksam liest, erkennt immerhin, daß er Romanhaftes liest. Aber der Versuch, irrezuführen, liegt dennoch vor - „Kunst werk und Zeitdokument“ nennt auch der Verlag das Werk -, und deshalb darf es nicht wie ein neutrales Buch gleichen lite rarischen Niveaus ignoriert werden. Es muß gewarnt werden: Lest kritisch, das klingt wie ein Bericht und ist Phantasterei. Im Anfang stehen immerhin zweiundzwanzig Zeilen starker Prosa: „Und so konntet ihr denn unsere .glücklich? Geburt hoch erfreut* anzeigen. Wir kamen auf die Welt, und nach uns kaum .hocherfreut* schon der Krieg. Und dann durften wir bald nach 50 Gramm Butter anstehen und nach .Morgentranksuppe* auf stoßen und zu einer Siegesfeier in die Aula und in die Kälte ferien nach Hause Zu den Kohlrüben. Und dann war wieder ein Sieg errungen und wieder eine Schulfeier und dann kam der Brief: .Vater gefallen!* und dann war wieder eine Schlacht gewonnen und der ganze Krieg selbstverständlich auch. Und dann ging der ganze Krieg auch selbstverständlich verloren. Drunter und drüber. Weg mit dem Kaiser, her mit der Repu blik; her mit der Inflation, weg mit dem letzten kleinen Wohl stand. Dann die Scheinblüte, und dann blühten die Stempel 285
ämter. An jeder. Haltestelle ein neuer Betrug. So war unser ganzes Leben: ein Fahrstuhl nach unten - und mit uns fiel auch unser Gott den Fahrstuhl hinunter. Dann kam Hitler: Erdgeschoß, aussteigen!“ Das Schicksal seiner Generation steckt also hinter diesem Autor - das Schicksal von Hunderttausenden und wegen dieser Formulierung in zweiundzwanzig Zeilen möchte ich ihm nicht absprechen, daß er einmal etwas Lesbares schreiben wird. Aber dies Buch bezeichne ich - seines wirren Aufbaus wegen mußte ich es wiederholt lesen - nicht als Talentprobc und gar nicht als Dokument, es sei denn für den Psychiater. (Daß diese Jugend zwischen Skylla der SA-Erziehung und Karybdis des Emigrationselends pathologisch wird, ist unab wendbar.) Der „Ich“ des Romans ist deutscher Werkstudent, hat eine Mutter, ein Mädchen „Ilsepuck" und einen Freund Heini, mit dem zusammen er „so ganz anders“ ist, „als die andern sind“. Heini konspiriert und erschießt sich vor dem Versuch eines Attentats. „Und als man Deine Leiche nahm, da fand man vor Deiner Brust - meinen Namen." Der Träger dieses Namens, Winter, entkommt nach Holland und erlebt dort tolle Dinge. Er wird Knecht bei einem Bauern, der im Herbst vier Kühe zu der einen vorhandenen kauft, sie aber sofort in den Stall sperrt, weil er „die Wiese verpachten muß“. Obwohl die fünf Kühe nicht mehr das Futter der einen haben, geben sie Milch und sehr viel Mist, den Winter auszu räumen hat. Winter wird überfahren, sein Oberschenkel zer splittert, das Fleisch wird brandig. Im Hospiz verliebt sich eine Ärztin in ihn, deren Gatte - ein Deutscher - im Konzen trationslager sitzt, zerpeitscht, verhungert, von ihr vergessen, obwohl sie ihn bei der Festnahme verteidigt hat, wobei auch ihr das Gesicht zerschlagen würde. Aber Winter weiß mit ihrer opfertätigen Liebe nichts anzufangen, entflieht ihr, kaum halb geheilt, und qualifiziert sich plötzlich als Kraulschwim mer solchen Stils, daß er - hätte er eine Nation zu vertreten Olympiaanwärter wäre. Nach vielen Monaten Krankenlager, kaum halb geheilt I 286
So geht das weiter - ein Boxkampf mit Blut und K. o., bei dem die metaphysische Diskussion zwischen den Boxern nicht aufhört. Ein Brief an die geliebte, ersehnte Ilsepuck nach Deutschland: „Dietrich meinen Handschlag. Und sage ihm, die Kuh Kleopatra hat noch immer keinen Stier (wenn Dietrich Dich nötig hat, Du wirst ja wissen ...).“ Roheit der Gefühle, Unwissenheit im Sachlichen, Fälschung aller bestehenden Gesetze der Emigration, psychologisch wie materiell, es ist ein peinliches Buch; der Stil halb Blubo, halb Symbolismus von 1910. „Krumme Schleier streicheln um die Dinge. Grenzenlos. Wüste. Unter den Rippen ist mir, als wäre ich gänzlich leergestohlen. Ich muß doch hier irgendwo Wasser angeln für die Kühe. - Gänzlich ausverkauft.“ Oder: „Es ist traurig, wenn man die Trauer mit der Trauer trauert, man sollte sie mit Lachen lächeln, denn man ist gar nicht so wich tig, wie man sich dauernd zutrauert.“ So Grausiges haben nervöse Knaben im Pubertätsalter zu allen Zeiten geschrieben, im Selbstverlag drucken lassen und niemandem geschadet. Heute aber geht so ein jugendliches Hysteriogramm als Historie hinaus, und der Schade ist groß. Dem Knaben Merz, der sich, vielleicht wirklich einbildet, in Dachau gewesen zu sein, selbst dem Fall von Pseudologia phantastica gilt nicht mein härtester Tadel. Das Schlimme ist, daß ihre Bübereien publiziert werden, weil sie grauenhafte Aktualität fälschen. Wer im Emigrationsland Druckerschwärze verwaltet, trägt viel Verantwortung, denn die literarischen Dokumente dieser Zeit sind wichtig. Wer zerpeitschte Hun gerwahnsinnige Fußball spielen läßt und frohe Stunden ver leben, oder ungefütterte Kühe im Stall melkt, weil die Weide verpachtet ist, hat überhaupt nichts zu erzählen; wer das als Zeugnis der Wirklichkeit druckt, verstopft die Quellen der Wahrheit. Wahrheit und pathologische Erfindung zu trennen ist leicht, wenn man ein Ohr für die Sprache - oder wenig stens einmal Fußball gespielt, gehungert, ein Bein gebrochen, Kühe gehalten, in der Wirklichkeit gelebt hat.
287
Notwendige Replik
Unter Emigranten, die wenig Beziehungen zur Umwelt haben, glaubt man, die Welt sei völlig im Bild über das, was in Deutschland geschieht, über den Wert öffentlicher Abstimmun gen, die Anwendung der Dauerfolter als politische Repressalie, den Hohn deutscher Gerichtsprozeduren, die Notwendigkeit für Zehntausende an Leib und Leben Bedrohter, über die Grenze zu fliehen, und ihr meist jammervolles Schicksal im Zufluchtsland. Das ist Optimismus, den ich wohl verstehe, aber bekämpfen muß - die Welt weiß nichts und will noch nichts wissen. Hundertmal habe ich von liberalen, mit Politik viel beschäftigten Menschen im Ausland gehört, Hitlers Diktatur sei durch die Plebiszite durchaus legitimiert, vereinzelte Grau samkeiten gehörten organisch zu jeder Staatsumwälzung, die deutschen Konzentrationslager seien eine (vielleicht harte) Notwendigkeit, die Massenverurteilungen zu endlosem Zucht haus ein Beweis, wie sehr gefährdet das deutsche Reich durch den Bolschewismus ist. Nichts weiß die Welt nach drei Jahren des Terrors von diesem Terror. Ich traf kürzlich eine deutsche Künstlerin von Weltruf, der man in Nazi-Deutschland goldene Stühle geboten hat und die aus ¿«ttrtpolitischen Gründen auf Germanien verzichtete. Sie erzählte mir viel Interessantes, das ich nicht veröffentlichen darf, weil sie Verwandte in Deutschland hat. Zuletzt fragte sie mich: „Glauben Sie aber an diese Greuelgeschichten? Und an diese Grausamkeiten in den Lagern?" (1956!) Ihre Kammerjungfer hatte ihr den Langhoff, „Moorsoldaten“, nach fünfzig Seiten Lektüre konfisziert; „Gnädige Frau regen sich zu sehr auf mit diesen Schwindelgeschichten.“
288
Ich bat diese Frau, das Buch zu Ende zu lesen, ich bot ihr andere Literatur an, ich sagte ihr, daß ich Bredel, Langhoff selbst kenne und daß ich viele ihrer Schicksalsgenossen ge sprochen habe. Sie hob bittend die Hände. „Ich beschwöre Sie - ich will das nicht wissen I“ Das ist eine Frau, die hochgeehrt im Ausland lebt, eine Deutsche, die von Deutschland als ihrem „untergegangenen Vineta“ spricht - eine Frau, die durch eine Manifestation un geheure Wirkung tun könnte. Aber sie will nichts wissen, ob wohl ihr Name in Deutschland nicht mehr genannt wird. Ich versuchte ihr von den an unserem Freund Erich Mühsam ver übten Grauentaten zu erzählen - Dinge, die ich nicht, aus der Zeitung, sondern aus dem Munde seiner Frau und seiner Lagergenossen erfuhr. Wir saßen in der Halle eines vornehmen Hotels, es klang wie Hohn, von Konzentrationslager zu spre chen, und sie hielt sich zitternd die Ohren zu. Die gleiche Erfahrung habe ich schon hundertmal gemacht, und wenn ich Namen nennen dürfte, würde man erkennen, daß Knut Hamsun kein Einzelfall ist, daß Menschen, die Re präsentanten edelster Menschlichkeit sind, sich weigern, die grausigsten Verbrechen zur Kenntnis zu nehmen, die in der Geschichte je gegen ihre Ideale verübt worden sind. Daß von hundert Emigranten kaum einer zu sprechen wagt, weil seinen zurückgebliebenen Freunden und Verwandten die Repressalie absoluter Vernichtung droht, macht es hundertfach schwer, der Wahrheit eine Gasse zu brechen. Dennoch glaube ich, daß es so etwas gibt wie menschliches Gewissen, daß es plötzlich erweckt und zur Macht werden kann, glaube ich an die Notwendigkeit und Nützlichkeit unse rer Propaganda, glaube ich, daß seine systematische Miß achtung des Rechts und der Menschenwürde sich ganz plötz lich als wundester Punkt des Hitlersystems erweisen werden. Die jüngste Geschichte Europas enthält viel Material, das die sen Glauben stützt. Aber aus diesem Grunde gilt es mir als verbrecherisch, Kon zentrationslager und Folterkammern zu einer Art Roman requisit zu machen, anders als mit Ehrfurcht vor den Opfern an diese Altäre der Barbarei zu rühren, darf es nicht hin19
Paradieie
289
gehen, daß federgewandte Hyänen mit diesem Entsetzen Spott treiben. Ein Karl May, der dafür in Greisentagen angepran gert und grausam gestraft wurde, hatte niemandem geschadet, als er sich zum Helden der Indianerwelt machte und Länder schilderte, die er nicht kannte. Aber wer als Karl-May-Epigone heute den durch Ozeane von Tränen geheiligten Boden be tritt, von dem ich spreche, schadet furchtbar, mag er selbst kaum erwähnenswert sein. Meine „Notwendige Kritik“ in Nummer 17 des „Neuen Tage-Buch" galt zwei Publikationen, die ich unter diesem Gesichtspunkt verurteilte. Es handelt sich um „Reichslager Dachau 1936“, einen langen Bericht von Fabian Stietencorn, der im „Pariser Tageblatt“ erschienen war, und „Ein Mensch fällt aus Deutschland“ von Konrad Merz. Im Falle Stietencorn habe ich aus riesiger Fülle ein halbes Dutzend Widersprüche herausgegriffen, die ohne weiteres be weisen, daß Stietencorn nicht berichtet, sondern fabuliert und durch seinen Beitrag zur Greuelpropaganda - die jeder Kri tische als Münchhauseniade erkennt - der ganzen, wichtigen Propaganda ein Bein stellt. Seltsamerweise hat das „Pariser Tageblatt“ nicht erkannt, daß es mit dem Abdruck dieses Be richtes einen Fehler begangen hat, der nach Kräften gutzu machen ist, sondern es hat mich in einer geharnischten „Erklä rung“ gerade der Verbrechen bezichtigt, die ich ihrem Reporter vorwerfe: „am Schreibtisch ausgetüftelt“, „aus den Fingern gesaugt“. All meine Argumente - daß vom Hungerwahnsinn Bedrohte nicht Spielzeug aus Brot herstellen, frohe Stunden verleben, Fußballwettspiele veranstalten undsofern - werden bedeutungslos gegenüber der Tatsache, daß der Redaktion ein Schein vorgelegen hat, der die Entlassung ihres Berichterstat ters aus dem Lager Dachau bestätigt. Bewiese selbst dieser Schein, daß der Träger des Pseudonyms Stietencorn wirklich in Dachau war, so bewiese er doch gar nichts für die Redlich keit seines Berichtes, dessen Unwahrheit ich, am Schreibtisch allerdings, aus dem Bericht selbst gesaugt habe. Man lese als Zustand in der Isolierbaracke: 1. „Wir leckten unsere und die Teller der anderen nach kärglichen Überresten aus.“
290
2. „Wir zogen das, um uns zu amüsieren, sehr militärisch auf, indem wir einen Besen wie ein Gewehr über der Schulter hielten. Wenn die ,Ablösung* kam, wurde im Paradeschritt marschiert. Der .Posten*: .Parole?* Die .Ablösung*: ,Parole Scheißhaus!* Wechsel im Paradeschritt. Die SS, die wohl mal von draußen hereingesehen haben mag, wie das klappte, fand gewiß, daß wir schon was gelernt hätten.“ Man lese in der ij. Fortsetzung, daß „Feldwebel Aismann der i. Kompanie, einer von den ersten im Lager“, „kommu nistischer Funktionär aus Nürnberg“ ist, und ebenso der Kor poral der I. 1., Bischoff, „der gleichzeitig eine Art Adjutant für den Aismann vorstellt". Ein anderer Kompanieführer und schlimmster Menschenschinder ist der „weißblonde, blauäugige Seemann Fischer, Mittelmeerkapitän auf der Palästinalinie, seit Jahren ansässig in Palermo und in der Kapitänskajüte“. Ein Jude. Wie der nach Dachau kam, wird nicht erzählt. Dachau liegt fünfzehn Kilometer nördlich von München; wer in Bayern war, weiß, daß man auf der Reise von München ehestens von Starnberg (fünfunddreißig Kilometer südlich von München) an sehr klaren Tagen die Alpenspitzen mit bloßem Auge erspäht. Stietencorn sieht im Bericht Nummer i von einem Podium in Dachau „die schneebedeckten Gipfel des deutschen Alpenrückens bis zum Zugspitz-Massiv“ so deutlich, daß er täglich aus ihrer Farbe das kommende Wetter ablesen kann. In Nummer 4 braucht er das Podium nicht mehr, son dern berichtet von der Lagergasse aus: „Über den Alpen gibt es wunderbare Morgendämmerungen in herrlichen Rots aller je gedruckten Kitsch-Postkarten“, in Nummer 18: „In blauer Ferne lagen die Alpen, dahinter eine vaterlandslose Freiheit“. Wer diesen Report gelesen hat, hält sich nicht mehr zitternd die Ohren zu wie jene Künstlerin, von der ich sprach, wenn man ihn zum Miterleben der deutsdien Greuel wecken möchte; das „Pariser Tageblatt“ schilt mich, der eine Diskreditierung der gemeinsamen Front abzuwehren versucht, und traut einem gestempelten Schein mehr als dem eigenen Verstand.
Zur Verteidigung von Konrad Merz hat der holländische Kritiker Menno ter Braak einen heftigen Brief gegen meine
•»*
291
Kritik an die Redaktion des NTB gerichtet. Er hält Konrad Merz für ein Talent, und darüber läßt sich natürlich nicht streiten: zweifellos hält ihn auch der Querido-Verlag für ein Talent, sonst hätte er das Buch nicht gedruckt, und Klaus Mann hat eine höchst anerkennende Kritik über sein Buch ver öffentlicht. Jedenfalls hat Herr ter Braak recht, wenn er sagt, daß die Emigrantenkritik sehr belanglose Bücher berühmter „Kollegen" mit Zärtlichkeiten zu überhäufen pflege und daß meine Kritik, an diesem Maßstab gemessen, allzu streng ist. Aber mir kam es nur darauf an, vor einem Buche zu warnen, das meiner Überzeugung nach den Emigranten schadet, indem es die psychischen wie materiellen Bedingungen des Emigran tenlebens falsch darstellt, das auch Konzentrationslager, Ver folgung und Emigration als billiges Romanrequisit verwendet und dadurch entwürdigt. Es ist ein von mir oft verfochtenes ästhetisches Gesetz, daß der Romancier unter strengstem Gebot der Wirklichkeit steht, daß er finden, nicht erfinden, verdich ten, nicht erdichten soll. Von Balzac bis zu Heinrich und Thomas Mann wird man diese Spießbürgerkritik an jedes Werk unserer großen Romanciers legen dürfen, ohne meine These widerlegt zu sehen. Nun gar, wenn es sich um die bren nende Gegenwart handelt, um die Schicksale einer tragischen Gruppe von Zehntausenden, die wie Leprakranke des Mittel alters durch die Lande trotten; muß man nicht widersprechen, wenn ihr Los verballhornt wird, noch ehe die Welt Notiz von ihnen genommen hat? Daß dies geschieht, habe ich an einigen konkreten Stellen des Romans zu beweisen versucht. Herr ter Braak widerspricht mir. In Nordholland pflegten die Gärtner Kühe zu halten, die sie - während die Weide verpachtet wird - in den Stall sper ren und mit Futterrüben aus dem Garten ernähren. (Wer pachtet aber die überflüssige Weide in Nordholland?) „Die .Unwissenheit im Sachlichen* ist hier also auf der Seite Oldens; daß er sich mit dieser Unwissenheit brüstet, um einen noch unbekannten Schriftsteller der Unwissenheit zu bezichtigen, scheint mir wenig loyal." Der Zweck meiner Schreibe wäre dann also gewesen, einem noch unbekannten Schriftsteller den Weg zu verlegen? So ist 292
es nicht, Herr ter Braak. Da von den bekannten Schriftstellern der Emigration oder des Auslands noch keiner das große Buch geschrieben hat, das - wie einst „Onkel Toms Hütte“ - Ge schichte macht, die harthörige Welt zum Aufhorchen zwingt, die lautlose Klage der Hinsterbenden zum Orkan werden läßt, sehnen wir uns nach dem heute noch Unbekannten, der solche Kraft des Wortes, dies Genie des Herzens, besäße! Aber wir dürfen, seiner wartend, nicht dulden, daß die Tat bestände, die er schildern soll, verkitscht oder verniedlicht werden. Im Kuhstall weiß ich besser Bescheid, als Herr ter Braak annimmt. Ich habe mich zwei Jahre lang intensiv mit Viehzucht beschäftigt. Weder in Nordholland' noch irgendwo auf Erden kann man Kühe mit Rüben - die fast nur Wasser enthalten füttern. Man kann das Vieh im Stall halten, dann muß man ihnen draußen das Futter schneiden, wer die Weide verpachtet, muß die Kühe schlachten. Es kommt auch nicht vor, daß eine Kuh sich monatelang nach einem Stier sehnt wie die Försters tochter nach einem Liebsten. Sie verlangt ihn nur etwa zwei Tage lang, und während dieser zwei Tage ist jeder recht, dem der Bauer sie zuführt. Versäumt er den Termin, dann ist ein halbes Jahr lang nichts mit ihr anzufangen, und sie verfällt dem Metzger. Oder soll auch das in Nordholland anders sein? Mein Kritiker macht mir auch zum Vorwurf, daß ich zwei Stilproben aus dem Buch anführe, die ich „willkürlich zusam menraffe", aber nichtsdestoweniger „als Ganzes präsentiere“. Das tue ich nicht, zwischen den beiden Zitaten - zwei unver kürzten, völlig unabhängigen Absätzen des Buches - steht bei mir „oder:“. Damit der Leser sich selbst ein Urteil bilde, muß der Kritiker zitieren. Herr ter Braak fragt, ob ich mich solcher Methoden nicht schäme. Nein, ich halte diese Methoden für ab solut handwerksgerecht ehrenwert. Ich selbst habe mich immer gefreut, wenn die Kritiker meiner Bücher Zitate brachten. Zum Schluß: Jünglinge mit wuchernder Phantasie mögen über Eisbärjagden im Kongo oder Liebesabenteuer in der Strato sphäre berichten, ich werde kein Wort dazu sagen. Aber Kon zentrationslager und Emigrationselend - wer damit spielerisch manipuliert, der entheiligt den Schmerz, und Schmerz ist heilig. 295
Traumgefährten
Leonhard Frank kann mit Stolz und Glück verzeichnen, daß er als der erste emigrierte deutsche Autor all seine Werke ge rettet hat. Sie erscheinen - in Deutschland verbrannt und ein gestampft - noch diesen Herbst neu im Amsterdamer QueridoVerlag. Man wird diese wundersame Erscheinung eines blitzschnell aus der Asche wieder auftauchenden Sängers dann neu defi nieren, den beiden Linien in Leonhard Frank nachfühlen: dem fränkischen Proletariersohn, der von „Die Räuberbande“, „Die Ursache“, über „Der Mensch ist gut“, das „Ochsenfurter Män nerquartett“ bis „Von drei Millionen drei“ an seiner Kindheit hing, und dem anderen Leonhard Frank, der sich - wie in „Bruder und Schwester“ - mit sublimen Nerven in das Leben einer anderen Klasse hineintastet, der seine verdienten Er folge ihn beigesellt haben. Seine Liebe zu dieser Gesellschaft der über Alltagssorge Lächelnden und komplizierteren Nöten als Hunger und Nacktheit mit Inbrunst Hingegebenen ist rein ästhetisch, hat mit Klassenbewußtsein nichts zu tun. Auch diese Menschen sind da wie Orchideen oder Epidemien, der Dichter wertet nicht, er schildert; richtet nicht, sondern um faßt, Dennoch überfällt Leonhard Frank ein Schauer von Fremd heit und Bewunderung, wenn er seine Leser in die Boudoirs, Lustgärten, Palais führt. Er muß betonen, daß die Herren dieser Kreise in Turnieren gestählt, von Tropensonne für alle Jahre gebräunt, in höchsten Sphären des Geistigen beheimatet sind; er beschreibt mit trauriger Lust, wie eine Dame sich von der Fußsohle zum Scheitel salbt, pflegt, ihre edlen Glieder in
294
die Sonne bettet, für Maniküre und Posterioraküre soviel Zeit verwendet wie eine andere für die Pflege ihrer Kinder. In seinem neuen Buch stellt einer sich einer solchen Dame vor: „Frimar, Baron Frimar“. Vom Gatten dieser Dame er fahren wir beim Entrée: „Der Rittmeister besaß das Riesen gut, das Schloß und zwanzig Millionen.“ Als es zwischen dem Rittmeister und Frimar zur Entscheidung über Eve kommt, schreibt der Rittmeister, „er habe die Scheidung schon ein geleitet, biete ihr jedoch eine Jahresrente von dreißigtausend Mark an für den Fall, daß sie sich auch von Frimar trenne.“ Frank ist unsicher auf diesem Boden, die zwanzig Millionen unterm Parkett machen ihn schwindeln. Er liebt die so unter bauten Existenzen, ohne sie zu kennen, wie ein Künstler hohen Ranges seine Modelle kennen sollte. In „Traumgefährten“ treten nur hochwohlgeborene Geistes kranke auf. Der Hauptteil des Buches spielt logisch in einer psychiatrischen Klinik. Kompetent zur Rezension dieses Buches, das sich „Roman“ nennt, aber in oft erregend schöner Form geschriebene Psychiatrie ist, ist nur ein Psychiater. Mir macht es den Eindruck, als träfe Frank mit seinen Diagnosen und Krankheitsgeschichten absolut die Wahrheit, als müßte das alles sein, wie er es schildert: das Mädchen, das sich für eine unbefleckte Gattin und Mutter hält, der Jüngling, der seine angebetete Mutter mit dem Geliebten überrascht hat und nun sie und den Sexus haßt; die Frau, die sich im Arm des Ge liebten stets als Beute „eines Kleinen, Fetten“ und auf seinem schmutzigen Lager glaubt - sicher ist das alles klinische Wahr heit, mit höchster Kenntnis geschrieben. Aber diese reichen Leute sind nur reich, um krank zu sein, und diese Kranken sind nur krank, weil sie reich sind. Ihr Schicksal geht den Psychiater an und die Angehörigen seiner Patienten, es wird nicht zu Literatur. Man liest und hat plötz lich das Gefühl, durch die Lektüre eine Indiskretion zu begehen. Dies Buch klingt manchmal wie eine Parodie auf Franks herrlichen, ewig herrlichen Roman vom Männerquartett, dem ich einen hohen Rang unter allen Romanen unserer Epoche gebe. Formulierungen dort, die sich mir fürs Leben eingeprägt haben, klingen wieder an, so umgelautet, daß ich mich beinah 295
schäme. Manchmal gleitet die Sprache fast ins Pitigrilleske. So, wenn Eve ein Bad nimmt: „Kritisch prüft sie ihr Gesicht im Spiegel - sie war fünfundzwanzig, gelebt hatte sie noch nicht verteilte schnell zwei Dutzend Toilettengegenstände an die passenden Plätze, in wenigen Sekunden das fremde Badezim mer in ihr eigenes verwandelnd, und drehte den dicken Warm wasserhahn auf.“ „Sie zog sich aus. Die fingerfertigen Hände arbeiteten selbst tätig, der Blick wich dabei nicht vom Spiegel, auch dann nicht, als sie aus dem hinabgesunkenen Kleide herausstieg. Hemd herunter und wieder Blick in den Spiegel. Es ist in jedem Falle eine ungeheure Intimität, dachte sie." „Mit ihrem Körper schien sie ein für allemal zufrieden zu sein, der wurde nicht geprüft, da war alles vollendet: die dünnen, gezogenen Arme und lebendig bewegten Schultern, der zwischen zart geschwungene Hüft- und Beckenlinien delikat hineinmodellierte kleine Leib und die langen Schenkel einer Frau, die seit Jahren täglich viele Stunden im Herrensattel saß. Auch das macht hart, innerlich hart, hatte sie früher oft gedacht." „Die dünnen Fingerspitzen beider Hände auf den Wannen rand gestützt, wartete sie, bis die Temperatur richtig war, und holte dann aus dieser Stellung heraus, schön das Gleichgewicht behaltend, indem sie ein Bein nach rückwärts hochsteigen ließ, mit langem Griff die Flasche mit dem grünen Badesalz.“ Susanne im Bad. Zwei Alte spionieren hinein, von denen einer weg möchte: Frank und sein Leser. Grandioser Leonhard aber zum Schluß: wie das geistes kranke Paar junger Liebender sich auf ein Sargauto schwingt und darauf ins dunkelste Verderben karriolt.
296
Heinrich Mann über Pachulke
Wer Heinrich Mann persönlich oder auch nur von Bildern kennt, steht unter dem Eindruck seiner aristokratisch-ableh nenden Haltung, äußerster Reserve in Sprache und Gestus, seinem fühlbaren Abscheu davor, sich auf banale Themen und mit schlecht erzogenen, systemlos denkenden oder gar in Roheit und Saftworten argumentierenden Menschen einzulassen. Er unterstand auch, soweit ich seine Biographie kenne, kaum je dem Zwang, am Biertisch, in soldatischen Formationen, im Kriegsgefangenenlager, oder wo immer etwa mein Schicksal es wollte, diesem Pachulke nahe zu kommen. Dennoch ist er ein solcher Kenner seiner Porno-Ideologie, seiner Fafnirlist, Denk- und Sprechart, daß kein anderer Schriftsteller neben ihm bestehen kann. Der „Untertan“ wurde vor dem Krieg schon geschrieben, als die braunen Landesherren sich noch begnügten, auf dem Kasernenhof - plötzlich einschrumpfend, wenn ein Offizier erschien - den Unrat ihrer Seele hinauszubrüllen und wehr losen Rekruten ihre Macht durch Fußtritte kundzugeben. Hier ist das gewaltige Porträt dieses „Schersanten“ (Sergeanten), der heute Deutschland repräsentiert, und es fehlt ihm kein Zug, den wir seither im Gesicht Pachulkes erkennen. Aber die ses Dichters Hellkenntnis Pachulkes hat eine noch stärker überzeugende Probe geliefert. In dem Roman „Die Armen“, der gleichfalls ein Jahrzehnt vor dem ersten Auftreten Padiulkes auf der politischen Bühne entstand, ist unsere ganze Epi sode vorauserzählt, als hätte sie nicht anders werden können. Da wird der Reichstag - im Symbol ist es die Villa Springorum - vom Fabrikherren selbst in Brand gesteckt, der 297
liberale Besitzer steht mit den Händen im Sack auf der Brand stätte und betet laut die Macht an, die seinen Besitz zerstört. In seinem Haus verbrennt die Verfassung (hier ist es ein Ver trag zwischen dem Fabrikbesitzer und seinen Arbeitern, der diesen Rechte gibt), und dann hetzt Pachulke die Polizei zur Verfolgung von Arbeiterführern, die er seiner Schofeltat be zichtigt. Alle, alle wissen, wer der Brandstifter war, aber die Justiz marschiert, wie es die Macht will. 1933, im Herbst, hielt ich - außerhalb Deutschlands - vor einer großen Versammlung junger Leute, die schwarz-rot-gol dene Bänder über der Brust trugen, ein Referat über diesen Roman, sprach nur über den Roman, als hätte es nie einen Reichstagsbrand gegeben. Da lösten sich Schreie der Über raschung, Schreie der von plötzlicher Erkenntnis Befallenen, denn damals hatte noch kein Dimitroff die Welt aufgeklärt. Aber wenige Zitate aus „Die Armen“ bewiesen wie ein durch Wochen geführter Prozeß den ganzen Tatbestand, auch denen, die so raffinierte Schändlichkeit nicht hatten glauben wollen. „So war es, nur so kann es gewesen sein I“ Das neue Buch von Heinrich Mann - „Es kommt der Tag“ (im Europa-Verlag, Zürich) - umwandert das Dritte Reich und läßt aus hundert Blickpunkten Licht auf viele Segmente dieses unglaubhaften Staatsgebildes fallen. Immer wieder gibt der klassische Meister der Pachulkologie anderen Denkern und Dichtern das Wort: den Autoren der Bibel, Horaz, Kant, Nietzsche, Platen, Grillparzer, Gottfried Keller - dessen auf Louis Napoleon gemünztes Gedicht „Ein Ungeziefer ruht...“ heute das deutsche Gipfelwerk aller politischen Lyrik scheint -, und so führt er eine ganze Phalanx hoher Geister zur Abstim mung über sein Problem. Kern und Ziel der Untersuchung muß immer wieder die Kreatur Pachulke sein, und der ihrer Bio logie gewidmete Aufsatz ist das thematisch Bestimmende die ses großen Werkes. Ich zitiere einige ihrer Leitsätze, traurig, nicht wenigstens dieses Kapitel und das von Heinrich Mann zitierte Gedicht Kellers als Ganzes wiedergeben zu können: „Pachulke ist gottlos. Er hat nichts gelernt; Wissenschaft und Kunst, die für die Religion eintreten können, er besitzt sie so wenig wie diese. Er kennt keine Ehrerbietung, umso eher
298
plagt ihn der Drang, sich zu unterwerfen. Deshalb wird er sich einen Gott-Ersatz machen, aus dem Haupt aller Pachulkes macht er sich seinen Gott-Ersatz.“ „Pachulke ist infantil. Er wird Menschen quälen, wie der Schuljunge einen Frosch. Dieselbe ehrlose Form, der Stärkere zu sein, dasselbe Fehlen der Vorstellungskraft.“ Heinrich Mann bekennt sich zu zwei Idealen: Sozialismus und Christentum. „Wer sind diese Geschöpfe? Wer hatte denn wirklich die liederliche Unverschämtheit, sich zum Feinde des Sozialismus und des Christentums aufzuwerfen (beides Gebilde derselben Sittlichkeit, und es gibt keine andere) ?“ Die ganze Abhandlung - denn aus neununddreißig Essays und vielen Zitaten ist eine einzige Abhandlung geschmiedet gliedert sich in drei Etappen des Denkens: Sehen - Ver achten - Lernen. Sie mündet in das programmatische Wort, das Mann in Deutschlands dunkles Innere ruft: „Fürchte Dich nicht I Die Furcht vor dem Chaos wird absichtsvoll von Deinen Unterdrückern genährt. Nach ihnen kommt kein Chaos, son dern endlich der Volksstaat. Die Prüfungen waren groß genug, daß endlich Gläubige und Denker, Demokraten und Sozia listen, Arbeiter und Intellektuelle nur eins noch herbeiwünschen und erkämpfen wollen: Deutschland - ein Volksstaat." Manchmal scheint es - die Leser dieser Zeitschrift kennen den größeren Teil der neununddreißig Essays und haben viel leicht schon ähnlich empfunden -, als übersehe der Autor in seiner Gewißheit einer nahen, vollständigen Niederlage Pachulkes manche seiner Stellungen; als traue er - noch 1936 zu fest auf die Unbezwingbarkeit der Wahrheit, des Ethos, des Geistes. Ich glaube ihm, auch gegen Zweifel im eigenen Hirn, ich glaube ihm, weil er sich als Vorausseher bestätigt hat, als Prophet nicht im metaphysischen Sinn, sondern vor allem im strategischen, vielleicht im Sinn eines Schach-Genies. Er hat bewiesen, daß er den Wald sieht und seine Grenzen fühlt, wo andere nichts mehr als Bäume und schreckliches Dunkel empfinden. Trotzdem zwingt intensivstes Beschäftigen mit jedem Ge danken des Buches zur Diskussion. Ich empfinde ein Buch wie „Es kommt der Tag“ als eine Waffe, die uns allen gehört, das 299
Modell einer starken Waffe, die immer neu geschmiedet wird. Heinrich Mann möge gestatten, daß wir von Auflage zu Auf lage, von Übersetzung zu Übersetzung, bei ihrem Guß mit helfen, Mängel zu beseitigen, die Zielstärke und Schußkraft zu bestärken. Deshalb gestatte er eine Diskussion, die ich selbst mit dem Thema „Heinrich Mann und Bismarck“ eröffne.
Heinrich Mann und Bismarck
Einen „guten und tapferen Mann“ nennt er ihn und fährt fort: „Er war ein Mann der Gesittung und des Maßes, ebenso fein als stark, mit zarter Haut und hoher Stimme.“ „Für sein Selbstgefühl bedurfte Bismarck keiner Schlachten.“ „Aber Fürsten brauchen allerdings Schlachtensiege, und ein Volk wie dieses deutsche konnte auf keine andere Art zum Mit handeln bewogen werden, als wenn man ihm äußere Feinde gab.“ Ist es nicht letzte Gemeinheit, einem Volk äußere Feinde zu „geben“? Wir wissen, daß Bismarck 1864 den schroffen Überfall auf das winzige Dänemark, 1866 die Infamie eines durch nichts provozierten Angriffs auf Österreich und 1870 die Emser Depeschenfälschung, die den Krieg gegen Frankreich erzwang, auf dem Gewissen hat. Drei todeswürdige Verbrechen an Europa, dreifachen Verrat an allem, was Heinrich Mann und den ihm heiligen Geistern heilig ist. Drei Ozeane von Blut, drei Hekatomben von Leichen sind die Marksteine seines Wandels, und all das führte er bereits im Schild, als er noch auf der untersten Stufe zur Macht stand. Wozu, wozu hat er diese Lawinen von Unglück über Europa gerollt? Er sah nicht weit - sah über den von ihm zu errichtenden Kaiserthron nicht hinaus, auf dem er die wahrscheinlich unfähigste der deutschen Dynastien postierte. Weit sahen, nach Zitaten in Heinrich Manns Buch, Schiller, „Die Majestät des Deutschen ruhte nie auf dem Haupte seiner Fürsten“, und Wilhelm von Humboldt, der von einem neuen kollektiven deutschen Staat anstelle des Deutschen Bundes sagte, es würde ein erobernder Staat sein, „was kein echter Deutscher wollen kann“. JOI
Bismarck schwenkte seine Mütze, als er sein schnödes Werk vollendet hatte, und entsprang mit den höhnenden Worten: „Ich habe das deutsche Volk in den Sattel gesetzt, reiten wird es schon können.“ So sieht ein guter und tapferer Mann aus? Ein Reichsgründer, der noch rühmenswert wäre, obwohl schon zwanzig Jahre nach seinem Abgang das von ihm geschaffene Reich sich selbst und halb Europa zur Abdeckerei wurde, obwohl es die Welt verpestet, Generationen aller Völker Todessehnsucht zum Atmen gemacht hat? „Er hätte das Zeug gehabt, jeden anderen Weg als diesen pomphaften und blutigen zu gehen“, glaubt Heinrich Mann. Nun, wer andere Wege zu seinem Ziel hat als pomphafte und blutige, diese aber vorzieht, ist kein Mann der Gesittung und des Maßes, selbst wenn er gutes Deutsch schreibt und Shake speare liest. Heinrich Mann führt selbst alles an, was sein Urteil über Bismarck widerlegt: „Wer hat in dem jungen Wilhelm das Unheil selbst in ganzer Gestalt heraufsteigen sehen - und ihm ausgeliefert ein wehrloses Volk, eine Nation, die er selbst nicht mehr erziehen konnte?“ „Zu seiner Zeit machte er das Reich mit den Fürsten und den Kapitalisten, weil es anders nicht zu machen war.“ Warum mußte es gemacht werden? Weil die Deutschen „danach jammerten und lechzten“. Im Rheinland, in Holstein, in Bayern, Baden, Württemberg, in Elsaß und Lothringen hat, nadi meiner Kenntnis der Ge schichte, kaum ein Deutscher danach gejammert und gelechzt. Viele Deutsche in Preußen, Schlesien, Sachsen haben um das Entgegengesetzte gejammert und gelechzt. Und hätten sie es selbst getan: „das alles begann mit Wilhelm II. und endete mit Hitler"... Das heißt, es begann, siehe oben, mit Bismarck. Wenn ein Mann drei Kriege entfesselt, dazu einen Kulturkampf gegen die katholische Kirche und einen Vernichtungskrieg gegen den Sozialismus führt, um als Endresultat den Vor-Pachulke Wil helm II. zum Herrn Deutschlands zu machen; wenn er Deutsch land eine Verfassung aufzwingt, die diesem nebulösen Selbst anbeter Macht gibt, den Weltkrieg anzuschwabbeln, aus pri-
joz
vatem Ressentiment gegen die engste Familie herbeizudilettieren - darf eines solchen Übeltäters rühmend gedacht wer den? Hätte Bismarck mit Graufen und Blut etwas Dauerndes ge schaffen - man müßte ihn respektieren. Aber seine monströse Schöpfung stand ja nur für wenig Jahrzehnte auf skrofulösen Beinen. Hätte er, wie Napoleon, nur an sich gedacht, an Gloire, Kaiserkrone, höchste Manifestation des Größenwahns - man könnte wenigstens zitternd seiner gedenken. Aber der war ja „Monarchist bis auf die Knochen“ und starb, pfui Teufel, als „treuester Diener“ seines imbezillen Herrn, verächtlich den kommenden Generationen, die in reinerer Luft atmen wer den. Gerade weil er gutes Deutsch schrieb und im Promenieren Shakespeare las, gerade weil er größeres Format und klarerer Kopf war, gerade deshalb sei er verdammt und vergessen! Er bot ein rührendes Bild als „Alter im Sachsenwald“, mit Wil helms II. Stiefelspur im Gesäß, über seine „Gedanken und Er innerungen“ gebeugt, um, wie andere Weltverderber, in letzter Stunde alle Schuld von sich auf andere zu wälzen. Dies rüh rende Bild hat den jungen Heinrich Mann ergriffen - er hörte, während er es sah, den Riesenlautsprechermund des undank baren Adolf I. durch die Lande dröhnen, und das haftete in ihm durch Jahrzehnte. Ein solcher Widerspruch aber, eine Umwertung des Senti mentalen ins Rationale, muß korrigiert werden in einem Werk, das sich mit Recht „Lesebuch“ nennt und kommenden Genera tionen als Lehrstoff dienen soll.
JOJ
Bemerkungen-Führer u. Co.
Rudolf Leonhard ist unter die Dramatiker gegangen. Seine politische Komödie „Führer u. Co." spielt „an vier aufeinander folgenden Abenden unserer Zeit, in jeder Republik“, und es ließe sich hinzufügen, daß sie seit etlichen Jahrzehnten in einer bestimmten Republik ununterbrochen spielt. Es handelt sich um die Redaktion einer monarchistischen Zeitung, deren Her ausgeber zugleich die Führer einer monarchistischen Bewegung sind. Sie arbeiten mit allen Mitteln modernster Demagogie, richten ein paar hundert junge Burschen und Mädchen ab, je nach Bedarf „goldene Jugend", kochende Volksmenge, diszi plinierte Freude zu agieren, stecken mit der Polizei unter einer Decke und sind alles in allem nichts als die Garde der Rü stungsindustrie. Ihre Situation wird peinlich, als auf dem Höhe punkt der, Agitationssaison ein junger Mann auftaucht, der wohl legitimiert ist, die Sehnsucht all der brennenden Herzen nach einem König zu erfüllen. Ihre Frauen und Töchter werfen sich dem sehr bescheidenen und gesitteten Jüngling an den Hals oder zu Füßen, die Sprechchöre der goldenen Jungen wogen Begeisterung, die Masse taumelt vor Glück, denn der Geweissagte ist da, ein Bismarck, Sonnenkönig, ein Peter der Große, ein Tamerlan, alles in einer Person! Da wird ein Pfiff laut, der Polizeikommissar löst die Versammlung auf, der junge Mann ist von der Last seines erhabenen Berufes frei, die Repu blik ist gerettet. Wer hat im Dunkel gespielt? Herr Kulankoff, der Rüstungsfabrikant, in höchsteigener Person. Er ist so stark, daß er es sich „manchmal leisten kann, seine Karten aufzu decken", und gibt den Kommentar zu seinem Eingreifen. „Nicht die Monarchie interessiert mich, sondern der natio304
nalistische Brennstoff. Ich habe also auch die Zurückberufung dieses Prinzen begünstigt, weil mir der Nationalismus der ge genwärtigen Regierung durch viele Rücksichten gehemmt schien. Ich wollte einen Gegendruck auf sie ausüben, durch die Dro hung der Restauration. Das ist aber nicht mehr nötig; die Anleihe für die Igumag-Produktion, von der ich neulich sprach, ist gestern nachmittag perfekt geworden. Ich habe mich also entschlossen, den jungen Mann fallen zu lassen.“ Den verblüfften Herren vom Stab der Bewegung macht er den Standpunkt klar, den sie seit langem einnehmen, ohne es zu wissen: „Wenn die Monarchie da ist, hört der Monarchismus auf. Wenn der König zurückkommt, verliert die Arbeit der Monarchisten ihren Sinn, verlieren die Monarchisten ihre Arbeit und ihr Brot - und finden keinen gleichwertigen Ersatz. Sie, meine Herren, wie ich, wir Führer alle, können nur den Monar chismus gebrauchen und nicht die Monarchie!“ Sie bleiben unentwegte und unbeugsame Monarchisten, der angehende Monarch ist wieder „junger Mann“, nur von der goldenen Jugend schwenkt ein kleiner Teil zu den Kommu nisten ab. Ich weiß nicht, ob dies witzige Theater für eine wirkliche Bühne gedacht ist - auf jeder politischen Marionettenbühne aber müßte es Repertoirestück werden, und jedenfalls ist es (in den billigen Editions du Phenix erschienen) eine so lehrwie geistreiche Lektüre. Da Leon Daudet sehr gut deutsch versteht, wird er es hoffentlich einer Besprechung würdigen.
3°5
Renn und Graf
I. Vor großen Wandlungen Ludwig Renn war sächsischer Baron, Hauptmann im Weltkrieg, später Polizeioffizier. Sein pazifistischer Roman „Krieg“ machte ihn berühmt und verhaßt, bei Ausbruch des Dritten Reiches wurde er ins Zuchthaus und nach Verbüßung seiner „Strafe“ ins Konzentrationslager gesperrt. Erst vor einigen Monaten gewann er die Freiheit. Der Bayer Oskar Maria Graf erlernte das Bäckerhandwerk, bestand viel Arbeitslosigkeit und Not, mußte als Infanterist in den Schützengraben und entrann ihm durch die psychia trische Klinik. Sein autobiographischer Roman „Wir sind Ge fangene“ machte ihn berühmt und verhaßt, vor dem Dritten Reich floh er nach Wien, nach dem Februar 1934 ging er nach Brünn. Jetzt haben, fast am gleichen Tag, Renn und Graf jeder ein Buch erscheinen lassen: „Vor großen Wandlungen“ (Verlag Oprecht, Zürich) und „Der Abgrund“ (Malik-Verlag, London). Beide erzählen an der Hand von Einzelschicksalen die jüngste Geschichte Deutschlands. Die als Polizeihauptmann und als arbeitsloser Bäckergeselle begannen, politisch zu sehen, die Feder zu üben und als Waffe zu brauchen, stehen nicht nur seit langem in einer Front; sie sind, fast bis zur Identität des Gedankens, zur gleichen Erkenntnis gekommen. In Grafs Roman wird sie einmal so formuliert: „Ich bin nicht fanatisch, gar nicht, aber ich glaube, bevor uns der Klassenkampf nicht so was wie eine selbstverständliche Religion geworden ist, ge winnen wir auch nie..." Bei Renn heißt es: „Wir wollen unser eigenes Glück, und das hat es bisher überhaupt noch nicht ge geben, höchstens in Rußland.“ Grenzenlos verschieden sind 306
diese beiden Talente und Temperamente, sind die Erfahrun gen und Quellen, aus denen ihr Wissen über Deutschland ge speist wurde, sind nach Art und Herkunft die Gestalten ihrer Romane; aber nirgends erscheint ein Widerspruch zwischen ihren Darstellungen im Stofflichen, im Psychologischen - weil beide das Dritte Reich so schildern, wie es ist, weil all dies Unglaubhafte, wie irrsinniger Anachronismus Wirkende, Wahr heit in ihrer ganzen Schmach ist.
„Vor großen Wandlungen“ ist eine Geschichte in vorüber jagenden Bildern, vielleicht mehr Filmszenarium als Roman, herausgeschleudert von einem Mann, den man eben durchs Inferno geschleift hatte. Er mußte seine Seele entlasten, für die im Inferno Zurückgebliebenen eine Tat verrichten. Die Hauptfigur seines Buches ist jener Nazi (hier ist es ein Kurländer, Baron Oetting), der an den Sozialismus im Natio nalsozialismus geglaubt hat und sich daran klammert, bis die Tatsachen seinen Glauben zerschlagen. Er erlebt das Nazireich von vielen Seiten, ist zuerst Landhelfer auf Gütern, zugleich Kreisleiter der Partei, dann Führer eines „Arbeitslagers“, des sen halbwüchsige Insassen bei Frost und Hunger Gräben durchs Moor ziehen und exerzieren. Dann wird er - angeekelt von dem Geist seiner vorgesetzten Behörden - Monteur im Heinkel-Werk, einer 1935 noch sehr geheim arbeitenden Waf fenfabrik. Dort raucht es von Arbeit, aber was an Kriegs material in Fiebereile fabriziert wird, wird doch nur Parade material. Nichts stimmt ganz, als Konstrukteure sind kaum absolvierte, aber politisch zuverlässige Hochschüler tätig, „Hauptsache ist der Akkord“ nebst Geländeübung und Schei benstand. Ein Arbeitskollege erzählt Oetting: „Du kennst das doch, wie das Abflußrohr des Olkühlers mit der Überwurf mutter befestigt ist? Da haben sic die Mutter so wenig fest angezogen, daß sie sich schon durch die Vibration loslösen mußte. Da läuft dann das ganze öl aus, und son Motor ist in Minuten erledigt. Flugzeugrümpfe sind um Zentimeter nicht nur um Millimeter! zu breit oder zu kurz, und dann paßt natürlich alles nicht mehr!“ Der Eingeweihte begründet diese planmäßige Sabotage mit JO*
}°7
dem 30. Juni 1934: „Ja, Mensch, kannst du dir denn das gar nicht erklären? Bedenke doch, wie wild die SA-Männer ge worden sind, jetzt nach dem großen Betrug, den Hitler an ihnen begangen hat! Da darfst du dich über nichts mehr wun dern!“ In der folgenden Nacht brennt eine Halle des Heinkel-Werks mit dreißig neuen Flugzeugen ab. Der Wächter wird später, gebunden und mit einem Knebel im Mund, aus dem Wasser gefischt. Langsam erkennt Oetting, daß die Werkleitung selbst Spionage treibt. Oetting ist keiner, der rebelliert, schreibt oder Flugblätter verteilt, er liest nicht einmal, was illegal publiziert wird. Er tut und spricht nichts Revolutionäres, fühlt nur, daß diese Welt nicht bestehen kann, in jeder Zelle brüchig ist. Er wird verhaftet, ins Irrenhaus gebracht, sein Schicksal ist besiegelt. Jetzt heißt es „Schizophrenie“ bekennen - oder ins Konzentra tionslager! Schizophrene aber werden sterilisiert. Oetting muß es schriftlich geben, daß er an Bewußtseinsspaltung leidet, ein vorgeblich Geisteskranker wird auf Grund seines eigenen Gut achtens operiert! Hätte Renn oder sonst ein Normaler sich diese Prozedur auszudenken vermocht? Nein, so die Logik auf den Kopf zu stellen vermag nur die deutsche Wirklichkeit.
Im Hintergrund dieses rasenden Films durch das Dritte Reich sieht man Deutschlands Historie. Das Reich wird an den Prokuristen des Großkapitals verschachert, der fast blinde Lustknabe van der Lubbe schleicht aus Fememörder Heines’ Bett ins Reichstagsgebäude, um Herostrat zu spielen. Dann geht der Prozeß um den Reichstagsbrand über die Leinwand, Dimitroff erhebt sein gewaltiges Haupt, Lubbe wird auf Grund eines erst nach Begehung seines Deliktes erlassenen Straf gesetzes geköpft... Ob die Fidschi-Insulaner um 2000 all das glauben werden, wenn der Film vor ihren Augen abläuft? Ich glaube es nicht, diese Dinge spielen zu abseits der Möglich keiten, die selbst den Fidschi-Leuten in hundert Jahren Reali tät scheinen werden. Selbst heute glaubt sie, trotz aller Auf klärungsarbeit, kaum ein winziger Bruchteil der zeitunglesen
308
den Menschheit. Gerade wenn alles so pointillistisdi hinge tupft ist wie bei Renn, erkennt man, daß es die Krankheits geschichte von Irren ist, unfaßbar für Nichtirre. Zwei kurze Bilder: Die Häftlinge in einem Konzentrationslager werden kommandiert, Tornister mit Klopfpeitschen auszustauben. Ein Häftling fragt den Aufseher, einen der wenigen, die human sind, ob sie nicht im Schatten arbeiten dürfen. „Nein.“ Der Häftling meldet, daß die Arbeit beendet ist. „Weiter peitschen!“ Später stellt sich heraus: Es war hoher Besuch im Lager, eine Kontrollkommission. Sie hielt das stundenlange Peitschen knallen für Lagerzucht an Sozialisten und erklärte sich zu frieden. Wäre die Arbeit auf der Schattenseite des Hofes ge macht worden, dann hätten die Beamten sehen können, daß Tornister, nicht Menschen gedroschen wurden, und das hätte keinen guten Eindruck gemacht. In einem Dorf gibt es einen „Neger“, einen braven Waisen jungen, dessen verschollener Vater ein Schwarzer war. Wie das Produkt von „Rassenschande“ arbeitslos gemacht, isoliert, von der Stempelstelle gejagt, mißhandelt und endlich erschla gen wird - das hätte sich kein Grabbe ausgedacht!
„Vor großen Wandlungen“ ist ein optimistischer Titel, aber dies furchtbare Buch schließt in tiefer Hoffnungslosigkeit. Die wir als Kämpfer und Führer in hellere Zukunft kennenlernen und verehren, sie enden bis auf einen in den Folterkammern. Der eine, Bulte, ein tapferer Kommunist, den das Konzen trationslager wieder hergegeben hat, spricht nichts als dies: „Ich faulenze jetzt. Das muß man auch mal können - für später.“ Oetting sagt, als er zur Operation geführt wird: „Wenn wir auch keine Kinder haben werden, die uns rächen könnten...“ Ein Gedankenstrich enthält alles, was er von Zukunft weiß. Ein anderer Held des Romans, der niemals tätig war, nur teilnehmender Betrachter, endet freiwillig sein Leben, mit fol gender Überlegung: „Der höchste geistige Wert wäre eine Welt, die das Geistige nicht allzu hoch achtete, aber den Menschen 309
die Möglichkeit gäbe, nützlich zu seinl Arbeit! - Aber ob es so eine Welt geben kann? Ob nicht immer wieder solche Hitler hinaufkommen und die Werner umgebracht werden?“ So verzweifelt sah es in dem tapferen Renn aus, auch als er wieder sprechen und schreiben durfte; in ihm, dem ein Gott gegeben hat, zu sagen, was er leidet, in ihm, der den feurigen Glauben zum Sozialismus in sich trug, als sein Martyrium be gann ! Und dennoch gibt es noch Hoffnung, gibt es noch Hoffende, denn es gibt Kämpfende! Nächstens berichte ich über das Buch von Oskar Maria Graf.
II. Der Abgrund Der Münchner Joseph Hochegger hat als junger Gewerk schaftler Bebel und Wilhelm Liebknecht, Ignaz Auer, Vollmar und Grillenberger gehört, gelesen, manchmal diesen unver rückbaren Symbolen seines Glaubens „hingerissen und ehr fürchtig“ gegenübergestanden. Den großen Aufstieg der Sozial demokratischen Partei hat er als treuer Parteikämpe mitge macht, war unter den hundertzehn Gewählten, die 1912 in den Reichstag einzogen, 1914 die Kriegskredite bewilligten und in den Burgfrieden eintraten. Als dann, angesichts der zerbrochnen Reichsarmeen, Friedrich Ebert Kanzler wurde, trank er sich einen Rausch an und dachte: „Der Bebel, wenn der das noch erlebt hätte!“ Er glaubte seine Partei am Ziel all ihres Strebens, als in Weimar die Nationalversammlung dem neuen Reich seine Verfassung gab, saß da in einem Taumel von Glück. Dann nahm er seinen Posten als Parteibeamter wieder ein, war Stadtrat in München, amtete in der Leitung des Kon sumvereins, des Mieterschutzes, der Wohnungsfürsorge, es galt aufzubauen, das Eroberte auszubauen. „Jetzt war man der Staat. Ganz groß und sichtbar strahlte die Macht. Unerschütterlich funktionierte der Apparat der Organisation. In allen Regierungen saßen Genossen als Mini ster, in allen staatlichen, kulturellen und kommunalen Körper schaften gab es eine sozialdemokratische Fraktion. Ein unum 310
gängliches Faktum im öffentlichen Leben war die Partei ge worden. Sie und ihre Gewerkschaften waren verankert in der Wirtschaft, schier schon so wie die Kapitalien in der Industrie.“ Er sah, er ahnte nicht, daß er und seine Partei am Abgrund standen, ehe der sich auftat und sie verschlang. Wer sie gekannt hat, die stattlichen und zufriednen Herren Genossen mit ihrem unerschütterlichen Glauben an die Demo kratie, mit ihrer Legalität, mit ihrer ehrlichen Milde für den Putscher und ihrer zornigen Verachtung für den Revolutionär, wohlgenährt, würdigen Ernst um den bartgezierten Mund, ein schalkhaftes Zwinkern im Auge, der kennt heute ihr Schicksal und damit Joseph Hocheggers typisches Schicksal. Als Grau köpfe, die nicht kämpfen, ihre Jugend nicht zum Kampf stellen wollten, aus der eigenen Biederkeit auf Biederkeit überall schließend, wurden sie jäh aus ihren Ämtern und Parlamenten geprügelt, unter die „Krapüle“ der Revolutionäre geschleudert, über die Grenzen gejagt oder ins Konzentrationslager gewor fen - am Abend eines Lebens, das ihnen siegreich schien, zer bricht der Himmel ihrer Illusion, verschlingt sie gnadenlos die schwarze Nacht. Instinktstärker als die alten Hocheggers ist die junge Gene ration. Sein Ältester, wohlbestallt als Bibliothekar in einem Parteiunteinehmen, bewährt im Außendienst, ein tüchtiger Redner und Debattierer, beginnt lang vor der Katastrophe gegen den Parteistachel zu locken, fordert Zusammenschluß der kampfbereiten Proleten aller Parteien, Widerstand statt endloser Kompromisse... Er wird mit Rügen, Redeverbot, Gehaltsherabsetzung gemaßregelt, wird immer mehr Frondeur, aber ohne ganz aus dem Rahmen der Partei zu treten. Hoch eggers jüngere Kinder, in die demoralisierende Zeit der Ar beitslosigkeit hineingewachsen, kampfbereit, aber nicht zum Kampf geführt, fallen dem Nationalsozialismus zu, wider standslos, wie angefaultes Obst vom Ast fällt. Wir haben das alles miterlebt. Oskar Maria Graf kann uns (in: „Der Abgrund“, Malik-Verlag) nichts Neues erzählen aber herzzerreißend wirkt das Alte, wie er es erzählt. Nach dem letzten Reichstagswahltag, am 9. März 1933, erfahren die Sozialdemokraten Münchens, daß die Nazis ihr Ge
werkschaftshaus stürmen wollen. Ihre Schufo besetzen es. „Jetzt wird’s Ernst, jetzt kommt die Entscheidung.“ Es wird alles verbarrikadiert, mit Tischen und Stühlen, Stacheldrahthinder nisse werden gespannt, Hydranten angelegt, Wachen postiert. Aber Waffen geben die Gewerkschaftsführer nicht aus, wäh rend draußen das Unwetter sich zusammenzieht. Es seien nur Donnerschläge im Büro. Und es waren hundert Infanteriegewehre mit Munition, zwei Maschinengewehre, zweitausend gegurtete Patronen dazu, drei ßig Handgranaten im Hause eingemauert! Das erfuhren die jungen Kämpfer nicht. . . Der „freie Abzug", den die Leitung durch Parlamentäre erreichte, wurde ein Spießrutenlaufen jedes einzelnen - und dann kam all das Köpfen, Foltern, kamen Lager und Zuchthaus, schrecklicher hätte es auch nach einer verlorenen Schlacht nicht kommen können. Vater und Sohn Joseph Hochegger retten sich und treffen einander in Wien, als Emigranten, wieder. Der Alte hat ein gutes Stück Geld gerettet, das er mit seiner jüngeren Frau ge mächlich verzehrt, auch gern mit dem Sohn und sehr bedürf tigen Genossen teilt. Er ist längst abgekämpft, denkt nur noch an den verlorenen Hausrat in München, und sein höchster Traum ist es, wieder ein Pöstchen zu erlangen. Der Junge aber und seine Frau - diese Klara ist wohl die echteste, prächtigste, vorbildlichste Frauengestalt unserer Emigrations-Literatur -, sie wollen kämpfen, die Bruderpartei beleben, illegale Wege zu denen bahnen, die daheim noch der Freiheit verblieben sind. Dann gehen sie in Wien den ganzen Passionsweg noch einmal, den sie in München gegangen ... Joseph entkommt, mit einem Schuß im Bein, in die Tschecho slowakei, dank Klaras Kraft und Unermüdlichkeit. Als die Wunde geheilt ist, geht er ins bayrische Grenzgebiet, um die Verbindung mit den Gruppen in der Heimat aufzunehmen ... Am Schicksal einer für Millionen typischen Familie demon striert Graf von Abstimmung zu Abstimmung, von Fanal zu Fanal, von einer Niederlage der Unentschlossenen zur anderen die ganze Höllenfahrt, an der er teilhatte. Nüchtern wird jedes politische Geschehen registriert, auf jeder Seite seines Buches weiß man, an welcher Stelle der Geschichte wir halten. JIZ
Aber diese Prosa wirkt nur wie die Texte im alten Stumm film, die Handlung selbst zieht in Bildern an uns vorüber. Alle Sinne des Lesers werden geweckt, durch Auge, Ohr und Nasenlöcher geht ihm auf, wie das geschah, was kom mende Generationen ohne ein solches Bilderbuch nicht fassen und glauben könnten. Dieser Roman spannt bis zur Qual, ob wohl sein Ausgang vorgezeichnet ist. Graf ist einer von den wenigen Schriftstellern unserer Zeit, die ihr Handwerk durch aus beherrschen. Immer trifft sein Ausdruck ins Schwarze, nie verliert er über dem Einzelnen das räumlich und zeitlich Ganze. Mit Wucht verdichtet er - und das ist ja überhaupt meine Definition von Dichten - den Abschnitt Leben, den er sich zum Stoff erkoren hat. Immer ist, von „Wir sind Gefan gene“ bis zum „Abgrund“, sein Stoff ein Stück Leben, was uns alle angeht und unsere Urenkel noch angehn wird. Graf hat einen gewaltigen Verstand, ist ein kluger Barde, ein Könner, der nicht mitreißt, sondern überzeugt, er nimmt in dem großen Kampf unserer Zeit einen wichtigen Posten ein.
3'3
Der unbekannte Barde
In einer Sammlung von Gedichten, die im Dritten Reich er schien, ist die „Loreley“ abgedruckt mit dem Zusatz: „Ver fasser unbekannt“. Wie seltsam, der Mann ist euch unbekannt, der euch durch den ganzen Klempnerladen von Hakenkreuzen, Orden und Fangschnüren, durch die Glasur eurer verlogenen Idealistik geblickt, der euch vor hundert Jahren in der Nase hatte mit dem ganzen spezifischen Duft, den euer „neues Deutschland“ ausstrahlt und der euch Mann um Mann zu schildern wußte? Wer ist denn das sonst, von dem er sagte: „Stets brutal zugleich und blöde / Statt Gedanken, jammervoll / Ein Gewieher ihrer Rede / Eine Bestie jeder Zoll.“ Und welches andere Reich als das „Dritte" meinen die Weber, wenn sie zu Gott schreien: „Ein Fluch dem falschen Vater lande / Wo nur gedeihen Schmach und Schande Wo jede Blume früh geknickt / Wo Fäulnis und Moder den Wurm er quickt.“ Wer ist es sonst als das Heer brauner Führer, das sich rühmt: „Der große Esel, der mich erzeugt / Er war von deut schem Stamme / Mit deutscher Eselsmilch gesäugt / Hat mich die Mutter, die Amme.“ Hat Heine sich das aus den Fingern gesaugt, oder hat er es gesehen oder gehört, wenn nach den Worten des Patrioten: „Wir stiften das große EselsreichWo nur die Esel befehlen" - wenn da „Im Saal die Esel Beifall rufen / Sie waren alle national / Und stampften mit den Hufen. / Sie haben des Redners Haupt geschmückt / Mit einem Eichen kranze. / Er dankte stumm und hochbeglückt / Wedelt’ er mit dem Schwänze.“ Hat er das über 1844 oder 1956 gesagt: „Wahrhaftig, Schufterle ist nicht tot, er lebt noch immer und
3M
steht seit Jahren an der Spitze einer wohlorganisierten Bande von literarischen Strauchdieben, die in den böhmischen Wäl dern unserer Tagespresse ihr Wesen treiben... und jedem leisesten Pfiff ihres würdigen Hauptmannes gehorchen.“ Da hat er doch gewußt, was es bedeuten soll, daß ihr ihm sein Lied „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ stehlt und einem unbekannten Barden des Eselsreiches in die Harfe praktiziert. Wer ist denn wohl der König Kobes, diese „Blume des Kno ten“, den die Deutschen zum Sprecher erwählten und dessen Lobes sie so voll sind, wenn er nicht ein brauner Häuptling ist? Von dem sie rühmen, „Ja, seine ganze Ignoranz/Hat er sich selbst erworben / Nicht fremde Bildung und Wissenschaft / Hat ihm sein Gemüt verdorben." Dieser „Karnevalskaiser“, der Kobes der Erste heißen soll, mit wem umgibt er sich? „Die Gecken des Kölner Faschingwesens / Mit klingenden Schellenkappen / Die sollen seine Minister sein ...! / Der Drickes sei Kanzler und nenne sich / Graf Drickes von Drickeshausen / Die Staatsmätresse Marizibill / Die soll den Kaiser lausen.“ Sogar die Namen stimmen, denn Drickes und Goeb bels, Marizibill und Riefenstahl, das sind fast identische Namen, im Klang nicht zu unterscheiden. Wenn der Kobes gekrönt wird aber: „Die Glocken, die eisernen Hunde der Luft / er heben ein Freudengebelle“ - haben wir das alles nicht gehört mit eigenen schauernden Ohren, wie ihn der Graf Goebbels von Goebbelshausen proklamierte, wie die eisernen Hunde der Luft heulten? „Wird Kobes Kaiser, so ruft er gewiß / Die Funken wieder ins Leben. / Die tapfere Schar wird seinen Thron / Als Kaisergarde umgeben. / Wohl möcht ihn gelüsten an ihrer Spitz / In Frankreich einzudringen. / Elsaß, Burgund und Lothringerland / An Deutschland zurückzubrin gen.“ Also - ihr kennt den nicht, der euch auswendig weiß, bis in die Ecken der Mördergrube, die bei euch Herz ist? Das glaubt euch keiner. Sogar der kennt ihn, der „in huld reich hochwohlweisem Walten“ dekretiert hat: „Wer auf der Straße räsoniert / Wird unverzüglich füsiliert / Das Räsonie ren durch Gebärden / Soll gleichfalls hart bestrafet wer den.“
P5
Ihr kennt ihn nicht? Kann die intimste aller Bekanntschaf ten so einseitig sein? Im Dritten Reich hat man seine Bücher verbrennen lassen, weil soviel Dynamit darin ist, der ihre braunen Paläste in die Luft sprengen könnte.
Zu Ernst Thälmanns 50. Geburtstag
In der Türe jeder Einzelzelle der deutschen Gefängnisse ist ein Guckloch angebracht, und der Gefangene weiß zu keiner Stunde, ob er beobachtet wird. Der Einzelgefangene Ernst Thälmann aber weiß zu jeder Stunde, zu jeder Minute, daß ein Späherauge auf ihn blickt, denn er, den fünf Millionen deutscher Stimmberechtigter zum Reichspräsidenten wählen wollten, der seit drei Jahren für einen riesigen Schauprozeß präpariert wird, die Rolle des Widerrufers seiner Sendung zu spielen, ist von ungeheuerster Bedeutung für den Regisseur der deutschen Weltspektakel. Ein Moment der Schwäche in diesen drei Jahren, und jede Silbe des Wehrufes wäre über dreißig Radiostellen, über zehn tausend Telegraphenstationen in alle Weltteile als Triumph gemeldet worden. Ernst Thälmann, der das weiß, der für den Sieg des Proletariats und einen Fortschritt der Menschheit steht, wie er je und je nur in der UdSSR erreicht wurde, hat sich dreimal dreihundertfünfundsechzig Tage lang unbeugsam gezeigt. Auch wenn es nur ums Dulden von Martyrien ginge, wenn das nicht zählte, was er als Kämpfer geleistet hat, müßte er dafür allein zu den Großen der Menschheitsgeschichte zählen.
Neue politische Epik
Wie einen Kranz möchte ich auf das eben geschlossene Grab von Hermann Wendel meinen Dank für sein nachgelassenes Werk „Die Marseillaise“ (Europa-Verlag, Zürich) legen. Am 27. Juni 1936 schloß er sein Geleitwort zu diesem Buch mit den Worten: „Der Äther selber schwirrt und schwingt von den Takten des .Allons, enfants de la patrie*: Frankreich begeht heute den hundertsten Todestag Rougets." Es waren vielleicht die letzten Worte, die er schrieb. Die Biographie der Marseillaise kann ihresgleichen in unse rem Jahrtausend nicht haben - welcher andere Sang hätte so viel Geschichte gemacht, soviel Geschichte selbst erlebt? Diese gewaltigen Rhythmen, voll Liebe zum Vaterland, Haß gegen die Despoten und ihre Soldmörder, Fluch den Verrätern, dieser Anruf der Göttin Freiheit, der mit „Marchons, marchons" immer zum Singen führt, haben durch bald hundertfünfzig Jahre Herzen und Glieder der Menschheit hingerissen. Die Marseillaise war Revolutionsgesang, wurde Nationalhymne, ward unterdrückt und erstand neu, wenn es galt, die Massen zum Sturm zu führen. Sie hatte Napoleon zu seinen großen Siegen begleitet, aber schon 1804 wollte er sie verschwinden lassen, denn Rouget hatte ihm ins Gesicht gefaucht: „Bona parte, Sie richten sich zugrunde, und, was schlimmer ist, Sie richten Frankreich zugrunde!“ Hatte ihm die Reihe seiner Ver brechen vorgezählt: „Vergewaltigung der Freiheit, Hinopfe rung der Wehrkraft, Zerstörung des Volkswohlstandes, Ver nichtung des Handels, Bruch seines Eides, dem Volk Frieden und Freiheit zu bringen.“ Der Dichter konnte hart gemaß regelt werden, aber dem Sang war ein Napoleon I. sowenig }i8
gewachsen wie später der dritte Napoleon, der die Freiheit mordete und den Freiheitssang verbot. Als Napoleon III. nach der Kriegserklärung an Preußen das Messer aber selber an der Kehle fühlte, telegrafierte er an sei nen Minister: „Das Lied gestatten, Polizeipräfekt benachrich tigen.“ Zwanzig Jahre hindurch war die Marseillaise heimlich überall gesungen worden, wo man Bonaparte den Meineidigen nannte; nun konnte er die enfants de la patrie nicht ohne ihr Lied ins Feuer führen. Es behauptete sich sogar noch im trost losen Maschinenkrieg. Am 28. Februar 1915 schmetterte eine abseits aufgestellte Kapelle bei Verdun ihre Melodie, während das 46. Linienregiment zum Sturm vorging: „Blaß, die Nerven zum Reißen gespannt, blasen sie .Allons, enfants de la patrie* unter höllischer Begleitung von Geschütz und Maschinengewehr, und ob einer nach dem andern getroffen hinstürzt, erst die Flöte, dann die Bratsche, dann der Kontrabaß, dann die Posaune, der Takt gerät nicht ins Wanken.“ Obwohl Frankreichs Rechtsparteiler heute versuchen, den Sang der Revolution zu usurpieren - auch bei den Kammerwah len 1936 trugen kommunistische Plakate in Paris ihre Verse, und auch weiterhin wird sie ihre Feuerspur durch Frankreich ziehen! Worte und Melodie sind, in einer einzigen Nacht der Freiheitstrunkenheit, einem dreißigjährigen Hauptmann der Genietruppen zugeströmt, einem Dilettanten der Poesie und Musik, dem zuvor nichts geglückt war und nie wieder etwas glücken sollte. Die Nation zeigte ihm für das göttliche Ge schenk wenig Dank, sie ließ ihn einsam altern, grausam hun gern, er dachte, dem natürlichsten Tod schon nahe, viel an Selbstmord. Wendel war mit seinen fünfzig Jahren, trotz schwerer Lei den - ein ganz Junger, zur höchsten Begeisterung fähig. Sein letzter Stoff hat ihn beglückt, durch alle Seiten dieses Werkes hört man das schmetternde „Marchons, marchonsl“. Er schrieb ein Deutsch von Prägnanz und Wucht, die Biographie eines Liedes enthält wahre Prosa-Rhapsodien, mit denen ein großer Rezitator Massen entzücken könnte.
5*9
Klaus Mann schreibt die Geschichte eines Schauspielers, der 1950 als Mitglied einer bescheidenen Provinzbühne mit „Rot Front!“ grüßt, 1932 zu den deutschen Prominenten zählt, sich aber noch immer zum Kommunismus bekennt und dem Publi kum eines ultralinken Kabaretts zuruft: „Nichts von Berühmt heit, Staatstheater, ich bin Euer Genosse Höfgen!“ - aber 1933 „Heil Hitler“ brüllt, erster Darsteller, erster Regisseur, endlich Senator, Staatsrat, Intendant des Berliner Staatstheaters wird, im Hause des Cäsars von Preußen Freund und Bruder ist. Also ein Korruptionist mit seltenem Glück und Talent? So einfach scheint Klaus Mann der Fall nicht zu liegen, und so einfach liegen die menschlichen Dinge wohl auch selten. Heinz Höfgen ist ein ruhmsüchtiger, von Eitelkeit geblähter Mann, der im Genuß seiner Triumphe nach tiefster Erniedrigung schmachtet. Frauen werfen sich ihm zu Füßen, wohin er tritt - er läßt sich alle gefallen, nimmt viele, heiratet manche. Aber tief verbun den ist er nur einer käuflichen Halbnegerin, die hohe Schaft stiefel trägt und eine scharfe Peitsche erbarmungslos schwingt. Wie um den Erotiker Höfgen ist es auch um den Karrieristen beschaffen: während Nazigunst und Ehren auf ihn nieder regnen, empfindet er es tief, ein Schuft, vielleicht der größte Schuft im Land zu sein. Schon ist die Suggestion seines Namens so mächtig, daß ihm alles zum Ruhm wird, selbst die vor sei nen Augen mißglückteste Leistung. Aber, Beifallsstürme noch im Ohr, quälen ihn in der Stille seines Zimmers Gespenster, gibt er sich dem Bewußtsein hin, ganz verkommen zu sein, ein Gesinnungslump, ein Stümper, es pfeifen von Furien geschwun gene Peitschen um sein entblößtes Ich. Endlich bettet er sein verheultes Gesicht in den Schoß der Mutter und schluchzt: „Warum verfolgen sie mich? Weshalb sind sie so hart? Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler!“ Klaus Mann, den die Muse dorthin geführt hat, wo das Leben grotesk-ekelhaft wird, als wollte es den eigenen Wider sinn in schmutziger Parodie lösen, kann dafür nicht gescholten werden, daß seine Schilderung einen haut goüt ausströmt, der für schwächere Konstitutionen schwer erträglich ist. Er wollte eine führende Gestalt aus dem Dritten Reich restlos analysie ren, und wer das mit Rücksicht auf zarte Nerven unternähme,
320
wäre ein Stümper. So entstand eine sexual-pathologisch-politischc Studie voller Beweiskraft. Wenn der Intendant Höfgen in einer Anwandlung von Ehrenhaftigkeit seinen Jugendfreund aus dem Konzentrationslager befreit, den halbtot Gefolterten mitleidig und lüstern sogleich nach dem Erlittenen ausforschen möchte und enttäuscht ist, weil ihm keine Details geboten wer den, wird zweifellos jene Situation klar, von der ein Psychiater gesagt hat: „Früher haben wir sie behandelt, jetzt regieren sie «< uns. „Mephisto“ (Querido-Verlag, Amsterdam) heißt diese Kampfschrift gegen die Kalibanokratie; es ist eine Werbeschrift für den Sozialismus, sehr gekonnt wie alles aus der Feder die ses zweiunddreißigjährigen Autors. Seine Mängel kennt er selbst; er begegnet der Kritik mit einer Apologie, die er einer seiner Gestalten in den Mund legt: „Der Kampf hat andere Gesetze als das hohe Spiel der Kunst. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, zu erkennen oder Schönes zu formen, sondern zu wirken - soweit das in meinen Kräften steht. Es ist ein Opfer, welches ich bringe - das schwerste.“ Die Ähnlichkeit des Stoffes drängt zum Vergleich mit einem Werk, das politisch ungeheuer gewirkt hat und dennoch den strengsten Gesetzen der Kunst genügt, dem „Untertan“ von Heinrich Mann. Szenen kongruenten Inhalts hat Heinrich Mann mit seiner Souveränität, mit seinem Humor so dargestellt, daß mit Lächeln zu lesen ist, was hier bei Klaus unwohl macht. Aus Gründen, die ich nicht sehe, vermerkt Klaus Mann in einem Nachsatz: „Alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Porträts.“ Gerade wenn er erkannt hat, daß die hohe Synthese aus Kampf und Kunst nicht ganz* geglückt ist, wenn es ihm nur auf die Kampfwirkung ankommt, sollte er darauf verweisen, daß nichts in seinem Buch Roman, jedes Bild ein Photo ist. Typen haben ihr typisches Schicksal, den „Roman einer Karriere" kann nur der, sei es an Talent, sei es an Charakterlosigkeit Einmalige machen. Ich widerspreche dem Autor, um ihm preisen zu können: nichts in diesem Aufgebot unwahrscheinlicher Gesichter und Begebnisse ist typologisch zu verstehen, alles ist, hieb- und stichfest, Deutschland von gestern 2i
Parndieae
521
und heute. Hier haben wir ein brillantes Pamphlet in Roman form, es wird in Kreise dringen, die unserer Anklage-Literatur bisher nicht erschlossen wurden. In Deutschland wird es ver boten und verschlungen werden.
Ein polnischer Autor, Josef Wittlin, der als Lyriker und als Homerübersetzer im Gebiet seiner Sprache hohe Ehren ge nießt, hat in einer Trilogie von Romanen die Geschichte des „geduldigen Infanteristen“ dargestellt. Schon die Titel dieser drei Bände - „Das Salz der Erde“ (Ihr seyd das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Matthäi V. 13); „Ein gesunder Tod“ und „Das Loch im Himmel“ - deuten an, daß der geduldige Infanterist dem bra ven Soldaten Schwejk näher steht als den uniformierten Helden der Kriegsromane im Dritten Reich. Aber trotzdem ist er auch Schwejk sehr fern - er ist eine so passive machtergebene, zum Denken ungeschulte und unfähige Manneskraft, wie die Impe rien es in Millionen Stück brauchen, die auf Kosten und gegen die Interessen ihrer Bürger Krieg vorbereiten und führen. Peter Unbekannt heißt der geduldige Infanterist, er ist Pack träger auf einem Bahnhof im Huluzenland, Analphabet, weiß nicht, wer sein Vater war, hat die Mutter früh verloren, stiehlt manchmal im kleinsten Maßstab und küßt dem Bahnhofs vorstand ergeben die Hand, wenn der ihm dafür in die Zähne haut. Sein Ehrgeiz ist es, einmal eine ärarische Dienstmütze tragen zu dürfen, und als er, bald vierzig, bei Ausbruch des Weltkrieges Vertreter eines Streckenwärters wird und diese Mütze tragen darf, ist er eigentlich am Ziel. Im Vorgefühl hohen Ranges hat er seine Lebensgefährtin nicht geheiratet, die zwar jung, fleißig, hübsch und ihm ergeben ist, aber den Ansprüchen eines höheren Standes nicht entspräche. Leider wird Peter aus dem Streckenwärterhäuschen geholt und unter Franz Josephs Fahnen „einrückend gemacht“. Wir erleben dies alles, erleben den Transport ins Rekrutenlager, den Anfang seiner Ausbildung, lernen ein paar seiner Schicksalsgenossen, seinen Oberstleutnant, einen jüngeren Offizier und vor allen die Stabsfeldwebel kennen, und endlich sind wir dabei, wenn die Kriegsartikel verlesen werden. Soweit bringt uns die Hand-
322
lung des ersten Bandes auf fast vierhundert Seiten („Das Salz der Erde“, Verlag Allert de Lange) - das heißt nicht, mit bil liger Spannung arbeiten. Ich darf weiter gehen, ich darf sagen, daß dies Buch als Ganzes zu dem lang-verweilendsten der Weltliteratur gehört und eines der langweiligsten wäre, wenn es nicht aus vierhundert Seiten voll schimmernd heller Klein prosa bestünde. Peter Unbekannt ist ein absoluter Niemand, ohne Aufruhr im Herzen, ohne Humor, nur geduldig, ein Korn dummes Salz - gerade deshalb hat der Künstler Wittlin ihn zum Helden gewählt. Er läßt uns ahnen, durch enge Ritzen im Zaune die Peter umhüllende Dummheit erspähen, daß da drin in seinen Nerven, in seinem Hirn, ein blasses Wesen schlummert, das erweckt, genährt, von Sonne und Freiheit be strahlt werden könnte - dann stünde ein Peter Unbekannt da, der ließe sich vom Stabsfeldwebel Bachmatiuk nicht anbrüllen: „Dich will ich zum Menschen machen!“ Der ließe sich nicht von den Drohungen der Kriegsartikel ins Heldentum peitschen und zu Kanonenfutter verarbeiten. Ein Zitat soll illustrieren, wie zündend noch aus der Über setzung Wittlins Beobachtung und Sprache sind: „Als der Stabsfeldwebel Bachmatiuk mit den Kriegsartikeln fertig war, schwebten über den Jahrgängen die Gespenster der siebenunddreißig Todsünden des k. u. k. Soldaten. Jetzt sollte man ein Vaterunser beten', dachte Peter, .oder wenigstens sich bekreuzigen.' Und er wollte die Hand hochheben, aber er konnte sie nicht bewegen. Sie lag leblos an der Naht der kaiserlichen Hose, wie von Bachmatiuks Wort gelähmt. Bach matiuk schaute verzückt auf die erstarrten Gesichter, Unifor men und Stiefel. In seinen Ohren summte eine ideale Stille, aus seinem Wort geboren. Er atmete den süßen Geruch des Gehorsams und der Angst. Und er war glücklich.“ Bachmatiuk hat ihn „zum Menschen gemacht“. An diesem Werk rühmt die Akademie der Unabhängigen in Polen, die cs preisgekrönt hat, „Adel der Gesinnung, Sorge um menschliche Dinge und außergewöhnliche Sorgfalt der Form". Ich freue mich, daß cs eine Akademie in Polen gibt, die so ins Schwarze preiszukrönen weiß.
}2J
Willi Bredel, der 1934 in seinem berühmt gewordenen Kon zentrationslager-Roman „Die Prüfung“ Talent und Leidenschaft, aber noch manche Unsicherheit verriet, hat in kurzer Frist sein Handwerk enorm entwickelt. In seiner Novellensammlung „Der Spitzel“ (Malik-Verlag) ist keine schwache Seite und vor allem kein Versuch, die Grenzen seines Könnens zu überschätzen; er will nicht Leyer schlagen, will nicht Tiefenpsychologie trei ben, er will schildern, was er kennt, dazu hat er die klaren Augen und die festen, ehrlichen Hände. Er knüpft an jenen deutschen Literaturzweig an, der „Kalenderbücher“ hieß, an die Hebel, Gotthelf, Hansjakob; nur ist sein Glaube der Sozia lismus, nicht die religiöse Moral. Er war Soldat der Revolution in Hamburg, hat achtzehn Monate Konzentrationslager durch litten, von den Kampfgenossen seiner Jugend haben erschüt ternd viele als Märtyrer geendet. Sein neues Buch ist wie das erste dem Gedächtnis totgeprügelter oder enthaupteter Freunde gewidmet, dieses dem Jungkommunisten Carl Burmeister, Rudolf Esser, Rudolf Lindau. Mit denen war er im Kampf und in der Fuhlsbütteler Hölle zusammen, wenn er dort sagte, er trüge einen Strick unter dem Hemd, um Schluß zu machen, wenn die Kraft ihn ver ließe, sagten sie: „Du darfst das nicht! Du mußt durchhalten, um später zu erzählen, wie man in Deutschland mit den Ar beitern umgeht." Jetzt sieht er sie um sich, die Lebenden wie die Toten, wenn er am Schreibtisch sitzt, hört ihre Stimmen, sieht ihre Augen auf sich gerichtet, weiß, was sie von ihm verlangen. Seine Stoffe bilden die zum Erbarmen alltäglich gewordenen Notizen der Hamburger Zeitungen. Ein Spitzel wird von den Drohungen seiner Opfer in den Selbstmord getrieben, eine illegale Druckerei geht hoch, eine Gruppe von SA-Führern hat ein Komplott gegen den Führer geschmiedet und ist verhaftet worden, bei einer Nacht-Luftschutzübung wurden von den Dächern herab mit Steinen gefüllte Marmeladeneimer auf SSTruppen geschleudert, als Repressalie sind dreißig junge Ar beiter der betreffenden Straße „zum freiwilligen Wiederaufbau unseres Vaterlandes" in Arbeitsdienstlager verschickt worden, irgendwo haben Arbeitsdienstler gemeutert, und zur Strafe ist
jeder fünfte ins Konzentrationslager gekommen. Bredel kennt die Menschen, kennt die Hintergründe, er sieht Wort um Wort und Griff um Griff, wie alles geschah, er erzählt es mit den anspruchslosesten Worten, läßt seinen Zorn im Stillen glühen und nur die Geschehnisse wirken. Was so entsteht, ist gute Munition für den Sturm gegen verbarrikadierte Herzen und verstopfte Ohren, das geht durch legale Zeitungen des Aus lands und die illegalen im Dritten Reich, das wirbt Truppen für den Kampf um Menschenrechte.
Gerhart Hauptmanns Novum
Die Fabel „Wilhelm Meister“ ist Goethes schönste Prosadichtung, zumal als „Urmeister“, in der Fassung, die erst wenige Jahre vor dem Krieg ein Zufall ans Licht brachte. Es ist ein echter Roman, voll von seltsamen Menschen und Dingen, strahlend von der Jugend seines Schöpfers. Ein Theaterroman, in dem wunder bar die Bretter Welt bedeuten und die Welt zur Bühne wird. Ist es denkbar, daß Gerhart Hauptmann sich unterfing, den Werdegang des herrlichen Jünglings Wilhelm Meister neu zu gestalten? Oder umgekehrt, daß Goethe das Werden - des jungen Hauptmann gestalten wollte? (Der dreißig Jahre nach seinem Tod geboren wurde.) Man lächle nicht über das Irrationale dieser Problemstellung Hauptmanns neues Buch wird vom Verlag als Bildungs roman mit autobiographischen Elementen aus der Frühzeit des Dichters charakterisiert und erzählt neu die Schicksale des jungen Meister. Man urteile: Wilhelm Meister, ein junger Handelsherr, verläßt für eine kurze Reise zu geschäftlichen Zwecken sein Vaterhaus, seine liebenswerte Braut, und reitet in die Welt, das Herz frei von Zweifeln über seine Gefühle, sein Einssein mit Beruf und Hei mat. Er stößt auf eine Theatergruppe, gesellt sich zu den Schauspielern, entdeckt seine dramatische Sendung, vergißt seine Ziele und wird Führer der Komödiantentruppc. Ihn fes selt vor allem Shakespeares „Hamlet“, die Notwendigkeit dramaturgischer Umgestaltung der auf uns gekommenen, nicht authentischen Fassung, die Problematik seiner Inszenierung. Zwei Frauen helfen, ihn zu fesseln und die Braut vergessen zu machen - ein Kolibrimädchen, flatterndes Seelchen, zart und
326
zärtlich, gering vor dem Sittenrichter ihrer Zeit, groß in ihrer Liebe, und eine schöne, feierliche Frau, von tragischem Schick sal nicht zerbrochen und würdig eines neuen edleren Schicksals. Neue Leidenschaften, Ziele, Lieben - Wilhelm vergißt, woher er kommt, wohin er gehen sollte; wird aus dem Kaufmann ein Künstler, aus den Jüngling ein Mann, nun weiß man nicht, ob er aus einem Traum erwacht oder in einen Traum versunken ist. Dann findet er Halt und Klarheit in einem Kreis erlauchter Geister, die aus weiter Ferne sein Werden verfolgen und die Akten seines Lebens geführt, ihn ihrer Freundschaft würdig befunden haben. Erasmus Gotter, Hauptmanns Romanheld, verläßt, dreiund zwanzigjährig, aus gleich guter Familie wie Meister, nicht eine Braut, sondern eine junge Gattin, um Ferien von der Ehe zu nehmen. Er gerät in die Kreise eines Hoftheaterchens in Granitz auf Rügen, gesellt sich zu den Schauspielern, vergißt seine Ziele und wird Führer der Komödiantentruppe. Ihn fesselt vor allem Shakespeares „Hamlet“, die Notwendigkeit dramatur gischer Umgestaltung der auf uns gekommenen, nicht authen tischen Fassung, die Problematik seiner Inszenierung. Zwei Frauen helfen, ihn zu fesseln und die Frau vergessen zu machen, ein Kolibrimädchen, flatterndes Seelchen, zart und zärtlich, gering vor dem Sittenrichter ihrer Zeit, groß in ihrer Liebe. (Bei Wilhelm Meister heißt sic Philinchen, bei Dr. Erasmus Gotter Irina, nennen wir sie Irinchen.) Die andere trägt gleich falls ein tragisches Schicksal und ist würdig eines neuen, edle ren, ist nicht hoheitsvoll und feierlich, dafür aber Prinzessin (aus regierendem Haus) und reich. Neue Leidenschaften, Ziele, Lieben - Erasmus vergißt, woher er kommt, wohin er gehen wollte, wird aus dem Dichter ein Bühnenkünstler, aus dem Jüngling ein Mann, nur weiß er, daß er nicht träumt, und steckt den Trauring in die Westentasche. Als die Konflikte sich tür men - denn eines Tages erscheint auch noch die verlassene Frau -, rettet sich Erasmus nicht unter erlauchte Geister (Für sten und Prinzessinnen wären ja auch kaum zu übertreffen), sondern, da Freud inzwischen gelehrt hat, in eine Krankheit. Das Freimaurer-Schloß Wilhelm Meisters ist bei ihm ein Sana torium in Davos, topographisch, nicht geistig hoch über dem
Niveau der Vergangenheit. Aber das ist eine Eigenwilligkeit Gerhart Hauptmanns, dreihundert Seiten lang deckt sich im Geschehen der Inhalt seiner Autobiographie mit der Biographie Meisters, deckt sich bis zu winzigen Einzelheiten. Es gibt ein schaurig-süßes Kapitel im „Meister“, der sich dem verliebten, holden Philinchen lange versagt hat. Eines Nachts kommt er, weinumdämmert, jugendselig in sein Zimmer, schläft ein und hat am Morgen eine dunkle Erinnerung an etwas Schönes, das Philinchens Züge trug. In dieser Nacht aber hat sich das Koli brimädchen in sein Lager gestohlen und hat das Kind von ihm empfangen, wonach es Verlangen trug. Doktor Erasmus Gotter hat, nach solennem Probenkrach mit Rauferei, ein Champagnergelage veranstaltet, das mit einer nächtlichen Landpartie endet. „Erasmus fand sich am folgenden Morgen gegen vier Uhr in irgendeinem ländlichen Gasthaus wieder, wo Irina seine Zim mergenossin war. Erst allmählich ging ihm auf, wie er dorthin und in diese Gesellschaft gekommen war.“ Der Roman verrät nicht, ob Irinchen von dem besoffenen Erasmus wie Philinchen von dem weinumfangenen Wilhelm ein Kind empfangen hat. Aber es ist anzunehmen - und damit überlasse ich den Parallelismus beider Romane den Philologen, die noch Hunderte von Belegen ohne Schwierigkeit finden wer den, um mich dem Hauptmannschen Dichtwerk zu widmen. Bewiesen scheint mir aus diesem kurzen Versuch, daß es gewiß frecheres Plagiat, aber kaum je naiveres gegeben hat als Haupt manns Werk, das, grausam gegen Sprache und Begriffslehrc, betitelt ist: „Im Wirbel der Berufung“.
Der Stil Konnte Wilhelm Meister SA-Mann werden? Er ist cs, soweit Erasmus Wilhelm ist, geworden. Ich will es an dem Fall Irin chen demonstrieren. Nach dem Mordskandal auf der Probe hat Erasmus seine Acteurs und Actricen zu einem Gelage versammelt. „Kaffee,- Zigarren, Zigaretten, Liköre wurden hcrumgcrcicht,
328
hernach bis zum Rande gefüllte Sektgläser. Alle waren damit zufrieden. Den kleinen Kreis überkam eine gleichsam triumphie rende Festlichkeit.“ Der Hoftheaterdirektor erscheint und berichtet, wie er die von Erasmus Gotters . Shakespeare-Auffassung abweichende Schauspieler-Fronde beruhigt hat. „Eben habe ich mir die ganze Gesellschaft gelangt. Ich hörte sie lärmen im .Felsenkeller*, dieser großfressige Syrowatka immer voran. Ich habe sie ins Theater zitiert und ihnen etwas zu hören gegeben. Diese Burschen machen das, versichere ich Sie, im Laufe der nächsten hundertundachtzehn Jahre nicht zum zweitenmal!“ Damit klappten Georgis Arme zusammen, und er preßte Erasmus an die Brust. Bald erscheint, als erster Bote dieser für hundertundacht zehn Jahre besiegten Fronde, die Actrice Pepi Rößler, macht, drollig auf den Knien rutschend, „pater peccavi“ und bekommt Champagner. „Kinder, Jungens, Leute, Bengels!“ sagte sie, nachdem sie gleich mehrere Gläser gestürzt hatte, „bei Kosch wird heute zehnmal soviel Schnaps als gewöhnlich gesoffen. Direktor Dok tor Trautvetter liegt vollständig dun, nur immer was von .Sein und Nichtsein* lallend, vor der Destille. Der Geist des alten Hamlet geht um. Bei Gott, der Mann hat den Geist ge sehen, geharnischt, Kinder, wahrhaftiger Gott. Der Geist und der Kümmel haben ihn umgeworfen. Syrowatka hat sich übri gens sofort als Zahnarzt etabliert, er ist Zahnarzt geworden. Ihr wollt das nicht glauben mit dem Geist? Es gibt nur einen einzigen Menschen in Granitz, den Bourtier, der den Geist nicht gesehen hat.“ Wie nennt Hauptmann ein Gesaufe bei solcher Sprache? Er nennt es „dionysisch“. „Die kleine Zusammenkunft war von vornherein so diony sisch beseelt, daß ihre Schwungkraft unhemmbar in ein Gelage ausarten mußte.“ Und dionysisch wird der Verlauf. „Die leeren Champagnerflaschen vermehrten sich, allerlei Delikatessen wurden herbeigezaubert, der Stimmenlärm drang durch die offenen Fenster über den Zirkusplatz, das Glück des
329
Augenblicks mehrte, das Gedächtnis verminderte sich, und wie sich dann in der Dunkelheit die selig betäubte Gesellschaft vereinzelte und auseinanderkam, war später nur wenigen gegen wärtig.“ Sie kam sich nicht ganz auseinander, denn meine Leser wis sen bereits, daß Erasmus tags darauf mit Irinchen in einem Zimmer wohnte, ohne recht zu wissen, wie dies Zusammensein entstanden war. Langsam hellt sich sein Gedächtnis auf - kein Junggeselle ahnt, was Kater heißt. „Grauen würde Kitty augenblicklich getötet haben, wenn sie mit Augen gesehen hätte, was im Kornfeld geschah, als seine Ähren über mir und Irina zusammenschlugen.“ Kitty ist Frau Dr. Gotter, die Mutter seiner Kinder. Er meditiert weiter: „War es nicht übrigens Wahnsinn, was wir gewagt hatten?“ Er schmeckt die Situation nach: „Der Knoten ihres Haares zerbarst, die lichtbraunen Sträh nen peitschten umher. Kaum unterschieden sie sich von dem Lager aus niedergedrückten Wcizenhalmen.“ „Wenn man uns hier gefunden hätte?“ „Ich hatte die Schultern des Mädchens entblößt. Über die eine von ihnen, die rechte, hinweg, sah ich Laufkäfer, prächtig gold-grün schillernde Goldschmiede.“ Er analysiert Vorgang und Reflex. „Das Herz in Irinas Brust schien sich befreien zu wollen, so wild, so unregelmäßig, so dumpf, erschreckt und empört pochte es. Wie? wenn es brach? Wenn das zarte Geschöpf dem Übermaß der Erregung nicht standhalten konnte? und mir plötzlich tot in den Armen hinge? Und welcher Aufruhr zu gleich in der eigenen Brust! Die Gier des Raubtieres, seine scheue Hungerraserei, verbunden mit der Angst, entdeckt zu werden.“ „Und drang nicht eine überweltliche Eiseskälte auf mich ein, als das gewaltsam erschlossene Mysterium sich mehr schrecklich als lustvoll enthüllt hatte?“ Nachdem sich das gewaltsam erschlossene Mysterium mehr schrecklich als lustvoll enthüllt hat, nachdem die lichtbraunen Strähnen von Irinchens Haar lang genug umhcrgcpeitscht 33°
haben und ihre Schulter nicht mehr entblößt war, entkriechen die beiden auf allen vieren dem Weizenfeld. In der Seele Erasmus’, der Irinchen mit Inbrunst liebt, sieht es so aus: „Hätte das Kitty!, der Fürst!, Georgi!, Frau Herbst, wo möglich Syrowatky gesehen, niemals würde ich mich von dem unauslöschlichen Gelächter der Verachtung erholt haben.“ „Es hätte dann keiner Lungenblutung oder ähnlicher Kata strophe mehr bedurft, meinem Leben ein Ende zu machen und meiner Erniedrigung.“ Sie finden eine „stille und gütige Krämersfrau“, die sie auf nimmt. Welches Glück für zwei bis in die Grundtiefen ihres Wesens erschütterte, empfindsame, zarte Menschen! „Wenn Sie vorliebnehmen wollen, so kann ich Ihnen gern dienen mit einem einfachen Abendbrot.“ Für kurze Zeit wech selt Idyll mit dem gewaltsam erbrochenen Mysterium. „Zwei Gedecke mit je zwei blauen Fayencetellern, schweren Silberlöffeln und Silberbesteck wurden aufgelegt. Wie ein freundlicher Schatten ein- und ausgehend, brachte die Witwe allerlei unerwartete Dinge herein: Sardellen, Sardinen, Ancho vis, Kieler Sprotten und andere Räuchcrwarcn, einen großen Block Butter, westfälischen Schinken und frisches Brot. Sie entschuldigte sich, daß sie dann nur noch eine Fleischbrühe bieten könnte und außer ein paar Spiegeleiern mit Salat ein gebratenes Huhn. Dabei vervollständigte sic die Tafel mit mehreren Gläsern eingemachter Früchte, die sie selbst konser viert hatte. Es könnte, betonte sic immer wieder, hier leider nicht wie in der Großstadt sein, wo man alles zur Hand habe. Wir aßen und tranken mit Appetit. Mich erfreute ein spani scher Wein, der, noch von dem alten Kapitän und Gatten unserer Wirtin heimgebracht, im Keller gestanden hatte. Ein gewisser, fast dämonisch fester Entschluß und die Protektion geheimer Mächte, die hicrob zu walten schienen, überließen mich nun ganz dem Augenblick und nahmen selbst den großen, dunklen, erstaunten Augen Kittys, die ich dann und wann, im Geist, auf mir ruhen fühlte, ihre verwirrende Kraft.“ Falls der Roman autobiographisch ist, liegt all das fünfzig Jahre zurück, und so freuen wir uns über Hauptmanns Ge dächtnis, der zwar am nächsten Morgen kaum wissen wird, wie 331
er mit Irinchen in ein Zimmer geriet, aber das Menü vom Vor abend so exakt melden kann. Kaum hat später die stille, gütige Krämersfrau einen Para vent zwischen zwei Betten eines vor Sauberkeit duftenden Zimmers gestellt und bedauert, daß sie nicht zwei Schlafzim mer habe, „aber die eine Nacht muß es gehen“, tut sie folgen des: „Sie ging, die Tür verschloß sich von innen, und wir stan den, Irina und ich, unauffindbar versteckt im Mysterium. Ich löste Irina die vollen Haare.“ Wahrscheinlich ging es die eine Nacht, denn der Shakespearologe muß beim Erwachen konstatieren, daß es die Ler chen sind, die schlagen. „Zu unserm Leidwesen“, betont er, ähnlich wie Romeo. Jetzt wird gebadet - oh, neue Wunder! „Es scheint, daß der Begriff der Reinheit nachts und tags verschiedenen Inhalt hat. Mit einer ganz andern Wollust als der hinter uns liegenden, nächtlichen, einem Gefühl der Reini gung und der Läuterung, verwühlten wir uns in die klaren und frischen Fluten.“ Dramaturgen wurden durch ein Zusammensein mit der jugendlichen Naiven ihres Theaters nicht immer so zum Tief sinn erschüttert. Aber hier tobt die große Leidenschaft eines jungen Genies im Wirbel seiner Berufung. Erasmus hat schon im ersten Kapitel „Irinchen gleichsam als einen reinen Engel, als unberührtes Gebilde aus Gottes Händen“ angesehen. Als ihm dann erzählt wird, das Mädchen hätte ein Verhältnis, ge schieht Schreckliches: „Ein mefitisches Schlangengewimmel, das sein geliebtes Asyl erfüllte, machte Erasmus die friedliche Kammer zur Hölle, aus der er flüchten mußte.“ Jetzt, nachdem er Irinchen als unberührtes Gebilde aus Got tes Hand empfangen hat, leidet er anders geartete grausame Qualen, denn: „Nie hatte Erasmus außer seiner geliebten Frau, der Mutter seiner Kinder, ein Weib erkannt. Trotz seines sonst eigen willigen Denkens war er in diesem Punkte altmodisch.“ Tragische Situation! 3J2
„Ausflüchte, Kopfschütteln, Selbstvorwürfe, Winseleien, Pinseleien und Feigheiten waren hier nicht angebracht. Kluges Abwarten, energisches Handeln mußten den Knoten glücklich lösen.“
Drei Tage später dringt die entzückende Prinzessin Ditta, aus regierendem Haus, mit neunzehn Jahren eben majorenn erklärt und Herrin eines überfürstlichen Vermögens, nachts bei Erasmus ein. Sie ist durch zwei Fenster geklettert - sie muß wissen, ob Erasmus nun wirklich, wie man munkelt, ein Revo lutionär sei. „Das schöne, stolze Geschöpf, das als Mitglied eines regie renden Hauses über allen Parteien, ja über dem Gesetze stand, kannte die verhängnisvollen Folgen nicht, die ein so unverhüll tes Bekenntnis haben mußte, wenn es ein Bürger, ein Untertan, ablegte.“ (Ein Bürger, ein Untertan, der „Hannele" und „Die Weber“ mindestens konzipierte, wenn er sie nicht schon ge schrieben hatte.) So sagte Erasmus: „Durchlaucht, Sie erschrecken michl Den Verdacht, ich könnte ein Revolutionär sein, hat Exzellenz Bourtier, wenn er es getan hat, gewiß unter allen Menschen zuerst geäußert. Hat er mich aber, und zwar ohne Vorbehalt, etwa mit diesem Ausdruck gekennzeichnet, so würde er «in Verleumder sein. Haben Sie nun diesem Verleumder Glauben geschenkt, so möchte ich die Hoffnung aussprechen, daß mein schlichter, ehrlicher Widerspruch Sie vom Gegenteil überzeugt." Falsch, Herr Dr. Erasmus Gotter! Die Prinzessin erklärt ihre ganze dynastische Umgebung für Schwindel, „glänzendes Elend, aufgeblähte, dünkelhafte Rückständigkeit“. Mit dem ist sie „ein für allemal“ fertig. Nun muß der Poet - „hinter den Büschen des nächtlichen Gartens sangen Mondscheinlerchen im Überschwang“ - seine Ansicht über den Revolutionär revidieren. „Macht Denken und Schreiben zum Revolutionär? Dann ist auch für mich diese Bezeichnung zutreffend“, erklärte er. Einige Seiten lang jagt sich nun so Unvorstellbares, daß ich fürchte, man glaubt meinem Referat nicht. Aber wo hätte
JiJ
ich je genug Phantasie verraten, um das Folgende zu erdich ten? Prinzessin Ditta, die nebstbei überirdisch schön ist, erzählt, warum sie so ist und Revolutionäre sucht. Ihre Kindheit war Hölle, als Vierzehnjährige ist sie für nichts von der Gouver nante nackt mit einer „vorher in Wasser getauchten ledernen Reitpeitsche barbarisch verdroschen worden“. Bei dieser Erzählung nimmt ihr Gesicht „den Ausdruck einer sardonischen Maske an“, und hingerissen sagt Erasmus: „Sie sollten den Hamlet spielen!“ Vielleicht sagt er das nur, „um die schöne Besucherin aufzu heitern“, und ihr „unaufhaltsames herzliches Lachen“ beweist ihm, daß die Ablenkung gelungen ist. Aber auf die Dauer nützt alle List nichts, die berauschende Prinzessin, einem gött lichen Jüngling, einem Apoll ähnelnd, neunzehn Jahre alt, majorenn, millionenreich, will auf und davon mit Erasmus. Was kann ihn hindern? Seine Frau Kitty, die ihn quält, deren Trauring er verschwinden läßt, wenn er in die Eisenbahn steigt? Oder Irinchen, der holde Flederwisch, mit der er die letzten Dinge erlebt und in einer Pause u. a. Sardinen, Flun dern, Speck, Aal und andere Räucherwaren genossen hat? (Und in die er verbrannt ist wie Kaiser Karl in seine Geisel, Hein rich in Rautendelein etc. etc.) Beide fallen ihm nicht in den Arm. Sondern Erasmus zögert aus tieferer Überzeugung. „Schon dieses nächtliche Stelldichein konnte die schwersten Folgen haben. Wahrscheinlich falls es ruchbar würde, war da mit seinen Granitzer Ruhmestagen ein rühmloses Ziel gesetzt, und er mußte sich Knall und Fall davonmachen. Wer weiß, was ihm sonst noch begegnen würde. Es fielen ihm Beispiele über Beispiele ein, wie man Liebschaften bürgerlicher Menschen mit Prinzessinnen aus regierendem Hause gerächt und dem Liebhaber das abhandengekommene Bewußtsein seines Paria tums mit Faust, Stock oder Reitpeitsche beigebracht hatte.“ Schweigen die Sinne des Dreiundzwanzigjährigen vor solcher Gefahr? Keineswegs! „Andererseits fing die Nähe des schönen Mädchens, das den Adel seiner Geburt als göttlichen Stempel in jeder Bewegung,
H4
jeder Linie darstellte, allmählich an, seinen Geist zu umnachten, bis er kein Gestern und Morgen und überhaupt nicht die Hand vor den Augen mehr sah. In dieser Nacht war am Ende sein ganzes bisheriges Leben, Kitty und die Kinder, ja selbst Irina, versunken, und nur Ditta, Prinzessin Ditta, soweit die Kontur und die blonde Substanz ihrer Formen reichte, ver drängte die Finsternis.“ Nun aber, es muß schon Morgen sein, wird bekannt, daß Ditta alles weiß: das im Kornfeld, das im Haus der stillen, gütigen Krämerin, alles. Wie stellt sich Erasmus jetzt zu Irinchcn, deren Mysterium er gewaltsam erbrochen hat und die er bis zum Vorabend dieser Nacht mit Leidenschaft liebte? Erst versucht er, sich herauszumogeln. „Wem wäre ich in die Schlinge gegangen?“ Dann aber „macht ihm der ruhige Blick der Prinzessin klar, daß eine Lüge in diesem Augenblick ihn aufs tiefste erniedrigen müßte“. Und er gibt ritterlich zu: „Irina, nun ja, verachten Sie mich!“ Ein Mann ist das, Herrgott, ist das ein Mann! Zwischen Ditta und Irina schwankend, wird Erasmus von Kitty heimgesucht, Kitty, die ihm zwei Kinder geboren hat und ein drittes unter dem Herzen trägt. Wie sieht sie aus? „Ein still gezogener Vergleich mit Granitz zwang ihn, zu gestehen, daß ihm dort eine so aristokratisch feine Erscheinung nicht begegnet war.“ Aber trotzdem: „Er schämte sich geradezu seiner Frau. Man wird lächeln, ja kichern, dachte er, wenn ich mit ihr in Granitz auftrete. Eine Lösung ganz anderer Art, als die tragische, könnte eintreten, wenn Irina und wenn die Prinzessin mit spöttischen Mund winkeln registrierten, daß ich, von einem berechtigten weib lichen Nutznießer meiner Person begleitet, unter Aufsicht bin. Ich hätte dann gar nicht mehr nötig, mir über die Art, wie ich mich aus ihren Schlingen löse, Gedanken zu machen, denn höchstwahrscheinlich wäre ich ihnen fortan nur noch lächerlich.“ So würde Hamlet empfunden haben? Es scheint, denn Erasmus fühlt allmählich, „wie er fast in der Hamlet-Gestalt aufgegangen war und diese mit ihm ein und das gleiche wurde“ 355
Als der „Hamlet“ in seiner Inszenierung dann endlich, zum Ge burtstag des Fürsten, gespielt wird, kann niemand sich diesem Eindruck entziehen. Der Eindruck „grenzte an Erschütterung“. „Der Fürst und die Fürstin streichelten des jungen Dichters Haupt, als er beiden darauf die Hand küßte.“ „Aber nun laßt ihn zufrieden“, rief der Fürst, „er soll nun mal essen und trinken zuvörderst!“ Wie Erasmus nun gefeiert wird - das geht fast über die seelische Kraft eines Dreiundzwanzigjährigen, und der Drei undsiebzigjährige kann es zuvörderst nur mit zitternder Feder berichten. „Damit er sich ungeniert stärken könne, bildete man eine Mauer um ihn. Beinahe unzählige Hände bedienten ihn, so daß er im Nu eine Häufung von Kaviar, Hummer, Austern, Roast beef, gekochten Schinken, Kartoffelsalat und wer weiß noch was auf dem Teller hatte. Auf einer Menge anderer Platten hielt man ihm Sardinen, russische Eier, Räucherlachs, Ochsenmaul salat, Wildschweinpastete mit Sauce Cumberland und aus erlesene Delikatessen in Menge hin, zu deren Vertilgung min destens ein Dutzend ausgehungerter Grenadiere nötig gewesen wäre.“ Dies halkyonische Fest dauert lang, denn: „Aus unerschöpf lichen, geradezu gewaltigen gläsernen Bowlegefäßen verteilte man immer weiter Getränke.“ Für Irina ist es kein reines Fest, obwohl sie als Ophelia ge glänzt hat. „Die Entfernung von Erasmus Gotter und der Prin zessin hatte sie furchtbar aufgeregt." Was aber war aus diesen beiden geworden? Hauptmann gesteht es nur halblaut. „Am Rain jenseits des weitgedehnten Weizenfeldes waren zwei Menschen hervorgetreten und bewegten sich Hand in Hand. Wer die Ährenflut von oben erblickt hätte, würde in ihr etwas wie die Bahn eines Nachens auf einer Wasserfläche er blickt haben.“
Da solche Menüs und. zwei tiefe Nachenspuren im Weizen feld bei Granitz auf Rügen für einen Hamletiden allzuviel sind, erleidet Erasmus den Blutsturz und enteilt, lorbeer 336
geschmückt, Fürstenhände geküßt haben dürfend, nach Davos. Über den Ablauf seiner Ekstasen berichtet ein Brief an den fürstlichen Bibliothekar in Granitz, in dem unser Revolutionär zu melden hat: „Sie würden erstaunt sein, midi zu sehn. Ich habe nicht fünf, nicht zehn, sondern dreißig Pfund zugenommen. Ich habe auf eine mir selber unbegreifliche Weise .ausgelegt*; mein Brustumfang hat um mehr als ein Drittel des bisherigen zu genommen."
Vorhang Prosa enthüllt alles. Wie in Hauptmanns Fall diese Prosa be schaffen ist, brauche ich nicht zu definieren, nach soviel Zita ten, aber auch in schlechter Spielhagen-Prosa enthüllt sich der Mensch, der sie schreibt. Wehe, daß ein Genius in diese SA-Haut gefahren istl Kein Pamphlet konnte Gerhart Hauptmann, Abgott meiner Jugend, tiefer stellen als sein Selbstporträt Dr. Erasmus Gotter, und was konnte ihn mehr entwürdigen als dieser eitle Wahn, Wilhelm Meister, Goethe und Hamlet in einem zu sein, wäh rend er sich zugleich als Paria fühlt. Goethe - Gott - Gotter... I Vielleicht war er ein ganz ande rer, als wir ihn liebten? Aber der feige, von Eros verlassene, Fürstenhände küssende, den Namen Revolutionär fürchtende, in der herrlichsten Brautnadit Räucherwaren schlingende, in den Armen der Prinzessin vor Ohrfeigen bebende, der Mutter seiner Kinder sich schämende, die Geliebte verleugnende, nach den Katastrophen rings um ihn dreißig Pfund zunehmende Jüngling muß er gewesen sein. Er könnte sonst als Greis nicht so von sich berichten. Daß er den Arm gehoben und „Heil Hitler“ gerufen hat, den Nazis „ein Bild für Götter“, hat uns erstaunt? Nach die ser Selbstenthüllung erstaunt es uns nicht mehr.
22
Paradiese
337
Der humpelnde Reporter
Zu einem Antikriegskongreß, der 1934 in Melbourne tagen sollte, wurde Egon Erwin Kisch vom „Europäischen Weltkomi tee gegen Krieg und Faschismus“ durch Henri Barbusse delegiert. Kisch hatte Bedenken, sein Name stand auf der schwarzen Liste der englischen Konsulate, die englischen Behörden hatten ihm schon einmal die Einreise versagt. „Es wäre doch sinnlos, eine Weltreise zu machen und dann nicht landen zu dürfen.“ Barbusse erwidert: „Delegierte zu Kongressen gegen Krieg und Faschismus stoppt man immer. Dafür sorgen schon die HitlerDiplomaten im betreffenden Land.“ - „Also werde ich doppelt gestoppt?“ - „Vielleicht. Aber Sie kommen herein.“ Kisch bekam ohne Zögern seine Visa für Australien, obwohl zu seiner linken Hand die schwarze Liste auf dem Schreibtisch des britischen Generalkonsulats lag. Aber man kann sich den Text vorstellcn, der am gleichen Tage an die australischen Behörden gekabelt wurde. Über Kischs Lehr- und Wandertage durch Australien ist in der Folge so viel gekabelt worden, daß die Post- und Telegraphenministcrien aller Welt sich die Hände reiben konnten. Er fuhr sechs Monate später dritter Klasse wieder ab, wie er gekommen war, aber seine Reise hatte in Telegrammen, deren Gegenstand oder, sagen wir besser, Held er war, ein Riesenver mögen verschlungen. Wir erinnern uns - denn alle Zeitungen des Globus brach ten ihr tägliches Communiqué vom Schauplatz des Belagerungs krieges, den Kisch gegen die Festung Australien führte - der wichtigsten Etappen. Wie der berühmte Reporter einer Intclligenzprüfung unterworfen wurde, in der er seine Würdigkeit,
JJ8
Australien zu besuchen, nachweisen sollte und in der er durch fiel. Wie er dann, durch einen Sprung vom Schiff aus achtzehn Fuß Höhe, den Eintritt in Australien erzwang - „Sie kommen herein“, hatte Barbusse gesagt -, dabei aber das Bein und mehrere australische Gesetze brach, wie er zunächst des „Com monwealth of Australia“ (des Allermenschenglücks von Austra lien) hinter schwedischen Gardinen teilhaftig wurde, zu sechs Monaten Zuchthaus und 1500 Pfund Gerichtskosten verurteilt wurde, um dennoch siegreich, wenngleich an Krücken, durchs Land zu ziehen, statt an dem einen versäumten Kongreß an hundert Massenmeetings teilzunehmen und endlich wie ¿in Triumphator abzufahren. Wir erinnern uns auch, daß Kisch, der Deutsch, Tschechisch, Russisch, Französisch und Englisch vorzüglich beherrscht, seine Intelligenz durch ein Diktat in schottisch-gälischer Sprache nachweisen sollte, einem beinahe fossilen Idiom, das nur im Mund von wenig hundert Dorf insulanern lebendig geblieben ist, und daß gerade diese Finte die australische Einwanderungsbehörde dem Gelächter der Welt preisgegeben hat. Eine Intelligenzprüfung, in der eine hohe prüfende Behörde durchfällt.. . Jetzt aber hat Kisch den Bericht seiner Abenteuer selbst ge schrieben - „Landung in Australien“ -, und aus den verein zelten Tatsachen, die uns im Gedächtnis hafteten, wird eine grenzenlos spannende Erzählung, eine Odyssee, zugleich ein Stück Kulturgeschichte, so souverän geschrieben, wie Kisch nun einmal schreibt, und überreich an Einzelheiten, die noch phan tastischer sind als die von seinen australischen Kollegen bisher berichteten. Kisch war den Australiern völlig unbekannt, aber als ihm die Landung verweigert wurde, die Rote Hilfe, die Labour Party und der Kongreß Protest erhoben, dauerte es nur Stun den, da war sein Name auf allen Lippen. „Kisch soll landen“ wurde ein Fcldgcschrei, von Versammlungen, Protesten an die Regierung, Anfragen im Parlament, Flugschriften, Demonstra tionen zitterten ganz Australien die Nerven. Als er nicht an Land gehen durfte, um zum Volk zu sprechen, kam das Volk zu ihm an den Quai, vom Oberdeck seines Dampfers aus wird ein Meeting organisiert, und obwohl eine ganze Abteilung 559
Polizei aufmarschiert, wird der Regierung ein volles Maß Empörung vernehmbar. Aber es blieb nicht bei Protesten, denn es gibt Gesetze in Australien, das trotz allem ein Rechtsstaat ist, es gibt eine Rote Hilfe und ihr ergebene Rechtsgelehrte. Der erste Schritt zu Kischs Befreiung war ein Strafverfahren wegen Menschenraub, eingeleitet gegen den Kapitän des Damp fers, auf dem Egon Erwin Kisdi festgehalten wurde. Indessen dies Verfahren schwebte, setzte der Dampfer „Strathaird" mit dem gekidnappten Friedensdelegierten an Bord seine Rund reise durch die australischen Häfen fort: in Melbourne wird der Quai abgeriegelt und jeder Besuch des Gefangenen unter sagt. Aber seine von der Roten Hilfe bestellte Anwältin findet dennoch den Weg zu ihm, auch ein Senator und ein Deputier ter, die, ohne Greise- zu sein, als die ersten Arbeitervertreter im australischen Parlament historische Gestalten sind. Solange die Klage wegen Menschenraub schwebt, bleibt Kisch Gefangener auf der „Strathaird*', aber zugleich ist die „Strat haird*’ seine Gefangene, denn sie darf den Hafen von Melbourne nicht verlassen. Diesmal jedoch arbeitet die Mühle des Gesetzes rasch wie eine Turbine - und die Klage wird abgelehnt. Jetzt ist die „Strathaird“ frei, um Kisch weiterzuschleppen, die Signalpfeife schrillt, alle Besucher von Bordi Aber hatte Barbusse nicht gesagt „Sie kommen herein,**? Und nun folgt jener Sprung aus fünfeinhalb Meter Höhe. (Kisch! Beinahe fünfzig Jahre alt und mindestens siebzig Kilo schwer! Mir sträuben sich heute noch die Haare.) Mit doppelt gebrochenem Bein lag er dann auf dem Quai und damit auf einem völlig veränderten Rechtsboden. Da er in Australien war, konnte er nicht mehr ferngehalten, höch stens noch ausgewiesen werden. Zwar wurde er sofort ver haftet und an Bord zurückgeschleppt, aber mit juristischem Fug und Recht brüllte er: „Wenn Sie mich an Land verhaftet haben, dürfen Sie mich nicht auf ein Schiff bringen.“ Zwei Tage später liegt die „Strathaird“ im Hafen von Sidney, und während dieser zwei Tage hat die antifaschistische Bewegung neue Anhänger in Massen gewonnen. „Reverend Rivett, ein achtzigjähriger Priester und Menschen freund, verehrt auf dem ganzen Kontinent, predigt in der
J4O
Kirche und spricht in Versammlungen zu dem Thema ,Kisch muß landen*, als wäre das eine Bibelstelle.“ Zugleich aber durchreist ein anderer Delegierter des Friedenskongresses, Gerak Griffin aus Neu-Seeland, dem gleichfalls der Eintritt verboten war, den fünften Kontinent, taucht in vielen Städten auf, spricht in vielen Meetings und verschwindet spurlos, wenn sein Speech beendet ist. Eines Tages wird er an Bord der „Strathaird“ erscheinen, „hinter mir Nacht, vor mir Tag, daß mich niemand sehen mag“, und dem Kollegen aus Europa einen Krankenbesuch abstatten__ Vom Reverend Rivett aber empfängt Kisch einen Brief, in dem es heißt: „Eine unaufschiebbare Pflicht aber hält mich ab. Sie heute zu besuchen. Ich bete zu Gott, daß wir einander dennoch sehen können. Mit besten Wünschen, Ihr aufrichtiger Arthur Rivett." . Ehe die „Strathaird" abermals ihre Anker zieht, hat das Gericht Kischs Freilassung verfügt. Illegal war seine Festhal tung, legal war sein Sprung vom Deck des Schiffes, denn „jeder Ehrenmann darf mit allen Mitteln versuchen, sich aus unrecht mäßiger Haft zu befreien, und wäre selbst dann nicht strafbar, wenn er dabei fünfzehn Menschen, getötet hätte“. Nun aber kommt es zu jener Diktatprüfung, die gegen einen weißen, nicht kriminellen Einwanderer noch nie verfügt wurde. Kisch kann nicht gälisch und wird abermals verhaftet. „Herr Kisch wird entweder der Passagier eines Schiffes oder der Insasse eines von Seiner Majestät Gefängnissen sein“, steht in einem Communiqué der Bundesregierung. Für seine Freilassung arbeiten viele, an sichtbarster Stelle die Anwältin Christina Jolly Smith. Ein wohlhabender Säufer, gegen den Christina einen Scheidungsprozeß geführt hat, liest das, den Bauch voll Whisky und Wut gegen die Roten, be waffnet sich mit einem Eisenhaken, dringt in das Anwaltsbüro ein und schmettert der Anwältin seine Waffe über den Schädel. „Sie soll keine Roten mehr verteidigen I Ich will wegen vor bedachten Mordes angeklagt werden“, brüllt er. Die Überfallene kommt mit dem Leben davon, nicht aber der Mörder. Er bekam in der Haft keinen Schnaps, und daran starb er nach wenig Wochen qualvoller Entgiftung. 341
Wieder einmal erscheint Kisch vor dem Richter, auf eine Bahre hingestreckt, das Bein in Gips, blaß, stöhnend, „jeden Augenblick - so scheint es - kann seine Seele aus dem zerknit terten Pyjama entweichen". Trotzdem verlangt der Staats anwalt Fortdauer der Haft wegen Fluchtgefahr. „Was?“ unterbricht er den Staatsanwalt, „Sie wollen mir weismachen, daß ein Mann in diesem Zustand fliehen kann?“ „Ich vertage die Verhandlung auf nächsten Freitag. Der An geklagte ist gegen eine Sicherstellung von ioo Pfund bis zur Urteilsverkündung frei.“ Ein Zauberwort! Sogleich erhebt sich der Sterbenskranke und humpelt ohne Beistand zur Tür. Er ist krank und in Ge fahr, zeitlebens ein Krüppel zu bleiben. Aber jetzt heißt es: dasein! In einer Massenversammlung unter freiem Himmel spricht der greise Reverend, der zu Gott gebetet hat, er und Kisch möchten einander noch sehen. Als Kisch im Auto eintrifft, be richtet man ihm, mit solchem Feuer habe der Alte noch nie gesprochen. Kisch sieht ihn im Näherfahren und hört ihn: „Käme Christus hierher, um für den Frieden der Menschen auf Erden zu werben, unsere Landpfleger und Zöllner würden ihn daran zu hindern versuchen, weil er ein Ausländer sei und keine europäische Sprache beherrsche, zumindest nicht gälisch.“ Nun sieht der Reverend auch Kisch, von weitem, aber sein Wunsch ist erfüllt. Er weist auf das Auto. „Dort naht unser Gast, dessen Einlaß man verhindern wollte. Freuen wir uns, daß wir nicht vergeb lich gekämpft haben, freuen wir uns, daß wir ihn sehen. Meine Zeit ist um, ich schließe.“ Mit diesen Worten sinkt der Veteran im Kriege für die Menschlichkeit tot zu Boden ... Zweimal wird der Versuch gemacht, Kisch auf ein Nazischiff zu verschleppen, der Eisenkäfig an Bord ist jedesmal schon parat. Er wird zweimal vor Gericht gestellt und mit Zucht haus bedroht. Zum dritten Verfahren ist es nach dem Gut achten eines Ministers zu spät: Heute kann man den Mann nicht mehr cinsperren, die Arbeiterschaft und weite Kreise der
342
Intellektuellen stehen auf seiner Seite." Eben aber hat der Generalstaatsanwalt erst öffentlich erklärt: „Je länger Kisch sich der über ihn verhängten Strafe entzieht, desto länger wird er in Australien bleiben müssen. Nicht ein Tag der Haftzeit wird ihm geschenkt. Das ist mein letztes Wort in dieser An gelegenheit.“ Was kann die Regierung tun, um die Massen nicht zu revo lutionieren und den Generalstaatsanwalt nicht zu desavouie ren? Sic entsendet den Vertreter der Anklagebehörde als Ver treter des Commonwealth zum Silberjubiläum des Königs von England nach London! Aber immer noch humpelt Kisch von Kundgebung zu Kund gebung, während eines Aufenthaltes von vier Monaten hat er einhundert Mal öffentlich gesprochen, trotz Krankenhaus, Ge fängnis, Gerichtsverhandlungen. Zum ersten Mal in der Ge schichte haben in seinen Versammlungen schwarze Australier am politischen Leben der Weißen massenhaft teilgenommen. So haben Grifffn und Kisch tausendmal mehr Wirkung ge tan, als sie, unbeanstandet, unverfolgt, auf dem Kongreß in Melbourne hätten tun können. Ihr Doppelauftreten war dank freilich auch den treuen Staatsanwälten! - eine Riesen demonstration, die Hunderttausenden drüben die Augen ge öffnet hat. In seinem Bericht aber und in nachfolgenden Miniaturen aus der grausamen Geschichte Australiens hat der humpelnde Reporter Kisch beinahe den rasenden geschlagen. Das ist ein Buch, das das Herz erfreut!
343
Der falsche Nero
Ort der Handlung dieses neuen historischen Romans von Lion Feuchtwanger ist Mesopotamien, Zeit 80 n. Chr. Cejon, der eben ernannte kaiserlich-römische. Gouverneur der Provinz Syrien, wurde in Knabentagen „Streckmännchen“ geheißen und ist ein Streckmännchen geblieben. Dank einer überbetonten Zackigkeit seines Äußeren, die nicht ganz imstande ist, die echte Breiigkeit seines Wesens zu verbergen, hat er mit fünfzig einen wichtigen Posten im Weltreich erklettert und tritt ihn an mit der Absicht, „diesen Orientalen“ zu zeigen, was römische Zucht und Ordnung ist. Der Römer Varro, sein Antagonist schon aus Schülertagen, tausendmal begabter als er, aber auch phantastischer, intuitiv, mit Bewußtsein amoralisch, mit fri schen Sinnen allem Laster zugetan, hat eine große Zukunft hinter sich. Er war Senator, ein Intimer des Kaisers Nero, sein Vertrauter bei weltumspannendem Planen. Aber nach Neros Ermordung kam unter dem bäuerlich-strengen Regiment Vespasians sein Stern ins Niedergehen. Vor dem Sturm der Militär revolte hatte er sich fluchtartig nach Syrien begeben, ohne je doch die Schifte hinter sich zu verbrennen. Aber in absentia wurde ihm eines belanglosen Bordellskandals wegen die Sena torenwürde aberkannt, seine Stellung in Rom erschüttert. So blieb er in Syrien, erwarb zu seiner alten römischen etliche orientalische Staatsbürgerschaften. Er machte Geschäfte, wurde ein Wirtschaftskapitän der Kolonie und damit eine Säule des Imperiums, das er in seiner Repräsentation Titus haßte, wie er den früh verstorbenen Vespasian gehaßt hatte. Nun stand er - Großkapitalist und Empörer zugleich - dem Streckmänn chen von der ersten Stunde an mit lauerndem Blick und ge344
fletschten Zähnen gegenüber. Seine Tochter Marcia, weiß, schön, streng, nun zwanzig Jahre alt, hatte als Kind davon geträumt, Vestalin zu werden, jenes Leben voll Keuschheit und Größe zu führen, das nur Töchtern der würdigsten Römer offenstand. Jetzt schritt sie einsam durch den Straßenwirbel des Orients, der ihr schmutzig schien, mied jede Berührung, durchschaute, verachtete, liebte und bewunderte ihren Vater. Der Töpfer Terenz ist als Leibeigener Varros geboren, der ihn später freigab. Mit dreißig sah er Nero so ähnlich, seine Gestalt, Haut und Haar, jeder Zug seines Gesichtes, daß Varro ihn dem Kaiser vorführte, und es war ein Vergnügen des ver spielten Tyrannen, ihn als menschlichen Affen um sich zu hal ten, sich von ihm studieren, seinen Gang, seine Stimme, sein Gehabe imitieren zu lassen. Er trieb den Spaß so weit, daß er Terenz an seiner Stelle eine Botschaft an den Senat verlesen ließ, im kaiserlichen Purpur, und freute sich kaiserlich, daß die Komödie völlig gelang, Terenz seine Rolle würdig spielte, der Senat keinen Verdacht schöpfte. Als die Garde Nero er mordete, entging sein Doppelgänger nur um Haaresbreite dem gleichen Schicksal. Im Kielwasser Varros flüchtete auch er nach Syrien, mit Caja, seiner nüchtern-ehrlich-energischen Frau und seinem Leibeigenen Knops. Sie kamen als Bettler an, aber der reiche Varro bot ihm die Hand, und in kurzem entstand die keramische Fabrik Terenz, sie wurde - dank Cajas und Knops’ Fleiß - groß und einträglich. Terenz selbst stieg empor zum Zunftmeister der Töpfer von Edessa, der Hauptstadt des souveränen Staates Edessa. Dieser Terenz ist ein begabter Mann. Das Handwerk inter essiert ihn nicht, er hat es - trotz niedrigster Herkunft - zur vollen Bildung seiner Epoche gebracht, spricht römisch, grie chisch und aramäisch mit Wucht und Wohlklang, kennt die griechischen und römischen Klassiker wie ein Gelehrter oder Schauspieler, liebt Theater und Künste und ist ein Volksredner von gewaltiger Wirkung. Einem Unbegabten hätte auch Nero nicht die eigene, kaiserliche Rolle anvertraut, einen Nur-Affen hätte er nicht um sich geduldet. Wirklich ist Terenz dem Nero nicht nur ähnlich, sondern tief verwandt, und das ist - wie Feuchtwanger den Nero sieht - nichts Geringes. Groß und
345
grausam, ein Politiker, der in Weltteilen denkt, der über die Brücke Mesopotamien hinüber den Alexandertraum verwirk lichen will, Rom mit dem Fernen Osten zu vereinen - und verspielter Knabe zugleich -, ein Künstler, ein der Leidenschaft fähiger Liebender, so wird uns Nero geschildert, auch fähig, heroisch zu sterben. Einen Mann von solchem Format wieder auferstehen zu lassen, als leibeigen geborener Töpfer durch Jahre und unter den Augen der ganzen Welt einen Nero glaub haft zu spielen vermag nur ein Genie. Varro ist es, der ihm die Rolle aufdrängt - zunächst, um dem Streckmännchen das Leben sauer zu machen, mehr noch, um dem verhaßten Titus einen Knüppel in die Speichen seiner Quadriga zu werfen, vielleicht sogar, um den Alexander-NeroTraum Wirklichkeit werden zu lassen. Aber Feuchtwangers Psychographie läßt die Frage offen, ob es sich überhaupt nur um die Laune eines gelangweilten Hasardeurs handelt, der bereit ist, das eigene Schicksal, Blut und Leben von Tausenden auf eine Karte zu setzen, nur weil der Augenblick höchster Spannung ihm überirdisch scheint. Nun erfährt die Welt, Terenz sei ein falscher Töpfer, Terenz sei der echte Nero! Der vor elf Jahren als Nero erschlagen, eingeäschert und beigesetzt wurde, war der echte Töpfer Terenz! Wie Varro dies Märchen glaubhaft macht, seiner Kreatur eine mächtige Plattform baut, mit orientalischen Fürsten und Priestern um seine Legende ringt und sie durchsetzt, hat Feuchtwanger subtil geschildert. Marcia selbst, die reine, das einzige Wesen, das Varro liebt, wird seiner Kabale geopfert. Sie muß zu Terenz ins Brautbett, als Beweis, daß Varro selbst an Nero glaubt. (Das Brautbett aber ist die erste Szene, in der Terenz seiner Rolle nicht gewachsen ist.) Noch ist der wiedererstandene Kaiser für Rom ein Schwind ler, ein Verbrecher, den König Philipp von Edessa in seinem Hoheitsgebiet duldet, den er aber - nach internationalen Ver trägen - ausliefern muß, wenn Rom durch seinen Statthalter in Syrien den Antrag stellt. Aber nicht immer werden Verträge zwischen Staaten erfüllt, wenn die militärische Lage ein Aus weichen ermöglicht. Rom hat in Syrien starke Garnisonen, aber 346
auf einen Krieg mit Edessa will cs die Regierung nicht an kommen lassen, denn es ist ein dritter wichtiger Faktor im Spiel, der Partherkönig Artaban. Zwischen Römern und Parthern ist schon viel Blut vergossen worden, Krieg gegen Edessa könnte zugleich Krieg gegen die Parther bedeuten. Da König Philipp seinen Gast Nero nicht ausliefern will, liefert er ihn also trotz aller Verträge nicht aus. Mit Varros List und Varros Gold ist der falsche Nero schon jetzt eine Macht, er kauft sich den römischen Hauptmann Trebon mit seinen dreihundert Legionären, andere römische Truppen laufen zu ihm über, und da er nun im Heer befehligt, nennt er sich König von RömischSyrien und Mesopotamien. Er besitzt keinerlei Macht über diese Länder, einstweilen genügt der Titel.. . Der Partherkönig verspricht ihm Anerkennung, Truppen und Anleihen, wenn er nachweist, daß Syrier und Mesopotamier ihn zum König wünschen. Mit dreißigtausend Mann bester Par thermiliz und zweihundert Millionen Sesterzen würde die römische Macht im Osten dann wohl zu bestehen sein ... Aus Terenz’ Leibeigenem Knops ist ein Staatssekretär seines noch nicht existierenden Staates geworden, ein windig-tücki scher Geselle, der finstere Schliche ersinnt und als Klimax aller Staatskunst die These gefunden hat: „Je dicker eine Lüge ist, desto sicherer wird sie geglaubt.“ An der syrischen Grenze wohnen zahlreiche Christen. Feinde Neros, denn der echte Nero hatte ihre Glaubensbrüder in Rom grausam verfolgt. Wenn man jetzt in Syrien ein großes nationales Unglück ge schehen ließe - wenn durch Zerstörung einer Euphratschleuse etwa eine Wasserkatastrophe verursacht würde - und wenn man die Christen beschuldigen könnte, dies Verbrechen be gangen zu haben, angestiftet vom römischen Statthalter Cejon - dann wären die Syrier gewonnen! Sie würden an die Gefahr glauben, die Christen vernichten, und der Flut könnte Kaiser Nero als Erlöser entsteigen. Hauptmann Trebon, ein Haudegen mit Cäsarenwahnsinn, so ruchlos wie eitel, und Knops sind Hand und Hirn bei diesem Werk. Ein Teil der Euphratstadt Apamea geht unter Sturz fluten zugrunde, wenige Stunden später ist es Gewißheit, daß die Christen, Abschaum der Menschheit, Feinde des Eigentums J47
und der Familie, im Solde der Verbrecherregierung Titus* dies Attentat begangen haben, „Nero aber stand groß vor der untergehenden Stadt-, ihr Sänger, ihr Erretter, und ließ sein Angesicht über sie leuchten". „Ein Leibeigener macht einen Kaiser nach, ein schlechter Schauspieler einen anderen schlechten Schauspieler, und die Welt fällt auf diesen traurigen Komödianten eines Komödian ten herein, jubelt ihm zu, entfesselt zu seinen Ehren eine Flut, die Tempel, Städte und schließlich die Menschheit selber ver nichten muß. Was für ein Triumvirat des Ekels: dieser Töpfer, der den Kaiser nachäfft, zu seiner Rechten der feiste, größen wahnsinnige Feldwebel, zu seiner Linken der kleine, gerissene, ehrgeizzerfressene Betrüger, der alle Kraft aus der Über zeugung schöpft, die Menschen seien immer noch dümmer, als selbst der abgebrühteste Skeptiker es wahrhaben will. Und das Scheußlichste: vor diesem dreiköpfigen Höllenhund wälzt sich wirklich in Staub und Ekstase difc Welt.“
Feuchtwanger nennt dies Buch zwar „Roman“, aber er setzt als Motto ein Zitat aus dem Buch der Prediger voraus, das beginnt: „Was gewesen ist, das gleiche wird sein, und was geschehen ist, das gleiche wird geschehen, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.“ In einem Nachsatz schreibt er: „Nachrichten über einen Falschen Nero und Hinweise finden sich bei Tacitus, Sueton, Dio Cassius, Zonaras und Xiphilin, außerdem in der Apokalypse des Johannes und im Vierten Buch der Sybille.“ So ist der Prozeß seines Schaffens klar erkennt lich: er läßt zugleich Gerippe aus den Grüften Mesopotamiens mit Fleisch und Blut von Heutigen, mit ihren Worten sogar und Gesten wandeln und kleidet die heute Agierenden in Ge wänder des ersten Jahrhunderts. Vor allem kommt es ihm darauf an, in dem - zweifellos historischen - Ausklang der tragischen Terenz-Harlekinade darzutun, wie das Ende jeder Epoche sein muß, in der Menschen-Ungeziefer sich zu entsetz licher Macht emporgaunert, Schrecken sinnt und Vernichtung sät. Der Rachegeist wird sie zu Schutt und Moder zertreten. Auf der Höhe seiner finsteren Herrlichkeit, nachdem er durch Blutbäder gewatet ist, den Begriff Recht in sein Gegen 348
teil verwandelt, alles sittliche Denken aus seinem Staate ge rodet hat, stürzt den Tyrannen Terenz plötzlich ein zynisches, böses, seiner spottendes Lied. Er ist erkannt, der Terror wirkt nicht mehr, die Getretenen erkennen die Erbärmlichkeit dessen, der ihnen lange Zeit ein Gott schien. Plötzlich, noch Schwert und Geißel schwingend, ist er ihnen ein böser Narr. In diesem Augenblick, ohne daß die Erde bebt, ohne daß Armeen in Marsch gesetzt werden, bricht das Podium ein, auf dem der dreiköpfige Höllenhund thront! Plötzlich auch versagt der Kehlkopf des redemächtigen falschen Nero - in dem Augen blick, in dem er den höchsten rednerischen Trumpf ausspielen will, kommt ihm kein Ton, nur mißtönendes Gekrächze. Das Fluidum seines Glaubens an sich selbst versagt, schlotternd flieht er ins Dunkel, er und seine Gesellen. Sie fallen, fast ohne gestoßen worden zu sein. Ihr Ende ist das Ende, das sie vielen bereitet haben - Pranger, Peitsche, Qual -, dann sterben sie am Kreuz. Feuchtwangers Buch ist eine zwingende Demonstration, daß es nicht so kommen kann, sondern daß es so kommen muß, wenn auf einem Unterbau von Lügen und ideenloser Ideo logie eine Realität der Gewalt errichtet wird. Mit Bedacht hat er seinen Terenz viel glänzender ausgestattet, als es der TerenzEpigone unserer Tage ist - musisch und menschlich begabt oder nicht, Gelehrter oder Analphabet, wer von der Lüge lebt, muß an der Lüge ersticken. Ein Roman? In Jahrzehnten vielleicht wird man dies Buch als Roman lesen können. Für uns ist es eine mit aller Kunst des großen Romanciers geschriebene Diagnose. Wie in Röntgen bildern erkennen wir den Herd der Krankheit unserer Zeit, sehen wir ihr Ansteigen zur Krisis, den Ablauf. „Wie kann ein kleiner Fisch so stinken!“ sagt Kaiser Titus, als er die Berichte aus Mesopotamien liest. Dies selbe Staunen bleibt dem Diagnostiker unseres Zwischenstromlandes.
Schickeies „Flaschenpost“
Richard Wolke wohnt in einem rebenumspannten und aus den Mauern bunt blühenden Haus an der Blauen Küste, auf einem Hügel, in Blumenduft und Meeresatem. Die Menschen, denen er dort begegnet, sind fromm, oft schlau, niemals schlimm. Die Härten des Lebens kennt er nicht, er besitzt mehr, als er braucht. Immer fühlt er um sich das Sorgen einer Mutter, die schön und fröhlich ist, und wenn er an den Tod denkt, fühlt er diese Mutter ganz nah, weiß er, daß eine Mutter ihr Kind in der letzten Stunde nicht allein lassen wird. Aber mehr und mit den Jahren immer heftiger belagert ihn das drohende WeltVerderben, ihn, den Jungen, und er fürchtet sich. „Eine Mutter sollte ihr Kind, das sie in Schmerzen geboren hat, in Wollust wieder zu sich nehmen, in sich schließen“ - Richard Wolke sehnt sich nach einer Erlösung vom Leben, ohne sterben zu wollen. Richard Wolke gilt den Leuten auf seinem Hügel als ein liebenswürdig-gütiger Narr. Vor kurzem war er noch ein an derer, hat die Menschen gesucht, Freunde geliebt, Frauen um sich versammelt, und sein mächtiges provencalisches Bett war dem Eros geweiht. Dann wuchs die Angst. Es ist im Tagebuch Wolkcs von den europäischen Diktatu ren, von ausgebrochenem Bürgerkrieg und glimmendem Welt krieg niemals die Rede. Wolke hat auch in seiner USA-Heimat, noch ein Kind, den letzten Weltkrieg kaum deutlich empfun den. Seine Nerven aber haben die kosmische Reizbarkeit jener seltenen Menschen, die bei den Juden „Propheten“ hießen. Was noch gebraut wird, ist ihm schon Ereignis, ihn umdröhnen Ge-
350
schütze, die noch nicht gegossen sind, Kommendes würgt ihn, das vielleicht ausbleiben wird. Er riegelt sich ein. „Ich konnte auf einmal nicht mehr unter Menschen leben, die das Stampfen des Aufmarsches von all den Kreuzfahrern, die zur gegenseitigen Abschlachtung ihre Stellungen beziehn, mit Händeklatschen und den Litaneien des Irrsinns begleiten. Die das fast schon vergessene Mordgebrüll: ,Tue! TueT wie Musik trinken. Die den Knochenmann am Horizont nicht wahrhaben wollen, der, deutlich erkennbar, mit seiner riesigen Sense ausholt, um in des Teufels Namen reinen Tisch zu machen . . .“ Er wird Anarchist, „ein wissenschaftlicher, versteht sich, kein Bombenschmeißer, Bakunin, Krapotkin, Stirner, Wolke. So.“ Wenn er das Schicksal nicht ändern kann, vielleicht kann er cs auf halten? Dieser Gedanke spukt durch sein Hirn, das schon weiß, daß es aus dem Gleichgewicht verrückt ist, und fragt: „Warum sich eigentlich eine Familie durch einen Geistes kranken geschändet fühlt, nicht aber durch Diebe und Mörder, von denen es in gehobenen Häusern wimmelt?“ Wolke hält sich gern auf Friedhöfen auf, dort wird sein Ängsten milder, dort ergeht er sich leichten Sinnes, wie bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung. „Ich wandle gern zwi schen Toten“, schreibt er in sein Tagebuch. „Sie haben ein Stück der Bedrohung, die über uns hängt, mit sich in die Grube genommen. Dank ihnen ist die unserm Planeten bestimmte Masse Tod um einiges geringer geworden. Wir fühlen uns ent lastet, vermuten einen Aufschub zu unsern Gunsten, gewon nene Zeit. Kirchhöfe stimmen mich heiter.“ Sein Schicksal wird Alfonso XIII., Exkönig von Spanien, der mit seiner Freundin Pipette ein Nachbarhaus auf dem Hügel bezieht. Zwar gibt der Spanier sich als etwas ganz anderes aus, er nennt sich Casimir Castro und deutet an, daß er ein poli tisch Verfolgter sei, den Tag und Nacht je zwei Geheimagenten beobachten. Aber Wolke weiß, das sind des Exkönigs Leib wächter, eine Verschwörung der Potentaten ist im Gang, der Pharaonen, Habsburger, Kapetinger und Bourbonen, alle Greuel der Weltgeschichte sollen von vorn anfangen, „mit den entsprechenden technischen Verbesserungen der Neuzeit“. Jetzt
351
kreisen alle Gedanken um Alfonso und Pipette, sogar in sei nen Träumen erscheint der drohende Monarch, und auch dafür haßt ihn Wolke, denn „anständige Menschen stören einander nicht im Schlaf“. Schlimmer aber als alles Schicksal ist es, daß Wolke und Pipette einander lieben. In einer Nacht, da Alfonso abwesend ist, flüchtet Pipette vor den Naditspitzeln, die ihr einsames Haus umlagern, in Wolkes Haus und drängt in sein Bett. Er, der unter Toten fröhlich ist und die Brücken zum Leben hinter sidi abbrechen möchte, ahnt: eine Nacht in den Armen dieser Frau, die er so sehr liebt, daß jedes Härchen an seinem Leib davon weiß, bedeutet Rückkehr in die Wirklichkeit. Sie ist ihm fleischgewordene Heiterkeit des Lebens, mit einer gedan kenvoll ernsten Stirn, seine verspätete Eva, er muß sie fliehen, sich im längst nicht mehr bewohnten Gastzimmer vor ihr ver bergen, das nach Mottenpulver und Ammoniak riecht, und als sie ihn auch dort aufsucht, flüchtet er zurück in sein Bett. Er kann ihr nicht verständlich machen - zumal er es ja selbst nicht weiß -, warum eine so ungeheure Angst in seiner Liebe klafft. Sie leben mehr als ein halbes Jahr nebeneinanderhin, zwei Gestirnen gleichend, die sich einander nähern und vonein ander entfernen nach einem Gesetz, das ihnen Geheimnis ist. Er ist ein Stiefkind der Liebe - wo sie ihm nicht droht, Macht zu werden, vermag er alles. Pipette beugt sich seinem Schick sal, wie sie sich seinem Willen beugen würde. Nur einmal klammert sie sich für Sekunden an ihn, es ist fast ein Überfall, und stammelt: „Dich lieb, Dich lieb, Dich lieb, Dich lieb.“ Indessen erlebt er mit hingegebenen Sinnen alles Weben der Natur um sich, das Brüllen der Frösche, das ihm ein Wett gesang von Troubadouren ist, das Locken und Rufen des Käuz chens nach seiner Freundin, den ersten Schlag des Finken, das große Wecken in der Natur, das die schwarzköpfige Grasmücke erschallen läßt. Denn Wolke ist schlaflos, seine Nerven stehen immer offen, er, der an jeder Beerdigung teilnimmt, umfaßt Men schen, Tiere, Blumen, Gestirne und Wolken um sich mit gleicher Bereitschaft, ein Schiffbrüchiger, der um sich Weltuntergang fühlt und stündlich Abschied von der Schöpfung feiert. 3J2
Einmal, als „der Abendstern beim abnehmenden Mond Wache steht“, kommt Pipette, um zu klagen, daß Casimir sie mißhandelt hat. Ob die blutunterlaufenen Stellen auf ihrem Busen in Wahrheit Mäler der Lust sind, mit denen sie den Verängsteten aus seiner Verzauberung wecken will, erfahren wir nicht. Aber die Erweckung geschieht, zum ersten Mal ver einen sich die Liebenden, finden die große Erfüllung, nach der alle Entflammten dürsten, in einem gemeinsam vergossenen Strom von Tränen. Über einen Tisch hinweg verschränken sie ihre Finger, und ihre Füße berühren einander, sie küssen sich nicht, sie weinen nur und erleben „den Segen der Tränen“, ein Glück, davon Wolke zehren soll bis zum Ende. Er empfindet, so wie der Tisch zwischen ihm und der Geliebten mitbebt im Zittern ihrer Knie, so weine mit ihnen die Welt. Danach ist es, als wiche das letzte Erdreich unter Wolkes Füßen, er gleitet, sein Bewußtsein findet keinen Halt mehr. Eine Großmacht verfolgt ihn, er könnte in seine Heimat flüch ten, aber dann bekäme der König im Nachbarhaus freie Bahnt Wolke schleicht im Dunkel hinüber, vielleicht ist Pipette allein? - und muß erleben, daß sie in Alfonsos Armen liegt in Liebeserfüllung. Es erwacht ein Tag aus Seide und Licht. „Ein Tag wie die Haut der Geliebten. Ein Tag mit leichtem Blut. Die Öl bäume schütteln den Schlaf ab und erzählen sich silberne Träume.“ An diesem Tag nimmt Richard Wolke schluchzend von S. M. - der wirklich kein König ist, sondern ein verfolgter Terrorist - Abschied und erschießt ihn. Durchs Fenster hört er die Geliebte singen, ihr Lied erklimmt „den Gipfel der Menschentrauer“. Der Mörder geht nach Hause, er hat sein Lebenswerk getan. Im Irrenhaus, das für die Reichen ein Luxus-Sanatorium ist, verbrennt Wolke seine ungeschriebenen Bücher. Er rechnet mit dem Menschen ab, den er weder als belehrbar noch als ver trauenswürdig befindet, er repetiert die Weltgeschichte und erkennt, daß sic ein Greuel ist. Er fühlt sich mächtig, weil er allein ist und - als einer, der für irre gilt - jeden Gedanken unbedroht bis zum gefährlichen Ende denken kann. „Unsere Zivilisation beruht auf dem Verschweigen der Tatsache, daß die 23
Paradiese
353
Gesunden unter dem Knüppel eines Häufleins besonders be gabter Irrsinniger leben.“ Eine Erkenntnis wie diese brächte draußen das Todesurteil. Deshalb tiefer, immer tiefer in die Einsamkeit. Als Wolke erfährt, daß seine schöne, fröhliche Mutter ge storben ist, nimmt er letzten Abschied von der Welt. Er will auch von Pipette, von den Geschwistern nichts mehr hören, gibt der Direktion bekannt, daß er keine Post und keinen Be such mehr zu empfangen wünscht. Seefahrer auf einem untergehenden Schiff pflegen Abschieds briefe an die Welt in eine Flasche einzukorken und vertrauen sie den Wellen an. Einmal, vielleicht in vielen Jahren erst, wird die Flasche ans Gestade geworfen, und oft findet der Brief sein Ziel. So handelt Richard Wolke - er reicht sein Tagebuch, verpackt und an seine Geschwister adressiert, durch einen Türspalt ins Leben hinaus. Nun hat er mit alldem nichts mehr gemein. Orgelklang aus einem zerschossenen Dom .. . Hemmungslose Klage um den Menschen unserer Tage, der in Irrsinn verfallen muß. Wenn seine Vorstellungskraft stark genug ist, um ihn erleben zu lassen, was täglich geschieht. Goyas Desastres de la guerra, die wir einmal bebend durch blättert und für Bilder der Geschichte gehalten haben - zwei Flugstunden von unserem Wohnort entfernt, sind sie in tau sendfacher Vergrößerung neue Wirklichkeit geworden. Und was geschieht drei Stunden weit östlich, dort, wo man unsere Sprache spricht! Und wie wird, zwei Flugstunden weit gen Süden, die Menschheit zertreten, verdorben! Wenn wir heiter durch den Tag gehn - in Madrid 1957 zeigen die Kinothcater Filmdramen „von stärkstem Nervenreiz“ an -, ist es nur, weil unsere Phantasie sich kuscht vor dem Entsetzlichen, weil Stumpfsinn und Gewöhnung unsere Herzen mit Nilpferdleder gepanzert haben. Mit-Leiden, wer das kann, steht schon am Rande des Wahnsinns, Kugeln zerschmettern ihn, die anderen galten. René Schickele geht (in seinem Buch „Die Flaschenpost“, Verlag Allert de Lange, Amsterdam) mit ungeheurer künstle 354
rischer Ökonomie zu Werk. Er deutet nur an, was seinem Wolke zum Verhängnis wird, malt die Desastres de la guerra keineswegs aus, die Wolkes Weltbild völlig beherrschen. Ge rade deshalb - weil er die Immanenz der Weltbedrohung auf den einzelnen als Selbstverständlichkeit wirken läßt, weil er demonstriert, daß diese walfenstarrende Anarchie die Kultur unseres Globus vernichten muß - gebührt ihm der höchste Preis für dies Werk, das alle künstlerisch pazifistische Literatur übertrifft an großer Intuition, an Unwiderlegbarkeit, an Schön heit. Das Motto „In den offenen Särgen schläft nichts mehr als die Kinder“ fordert zu einem Vergleich mit Jean Paul heraus. Jean Paul hat oft die deutsche Sprache zu Klangherrlichkeiten gehoben, wie sie dies Werk durchbrausen. Aber mit seiner Skurrilität, seinem Abschweifen, seinem Spieltrieb besteht er kaum neben Schickeies erhabenem Ernst. Schauriger Gedanke: aus diesem Buch wird in den Grenzen Deutschlands kein Ohr einen Ton aufnehmen dürfen; denn um dies Volk von sechsundsechzig Millionen ist ein Filter ge legt, der alles Deutsche fernhält, das den Gipfel der Mensch lichkeit erklimmt wie Pipettens Singen. Und doch, wie sehnen sich in Deutschland die Herzen nach solcher Musik! Orgelklang aus einem zerschossenen Dom.
355
Die Versuchung
F. C. Weiskopf hat als erster der Roman-Historiographen des Dritten Reiches eine Frau zur Zentralgestalt gemacht und läßt die Geschehnisse zwischen Dezember 31 und Sommer 33 durch ihr Sehen, ihr Denken filtrieren. Diese Lissy ist Verkäuferin in einem Warenhaus, die Tochter eines alten SPD-Gewerkschaft lers, sie selbst fast apolitisch. Der Ausbruch des Nationalsozia lismus erschreckt sie, sie empfindet das Rohe und Dumme in dieser Agitation und stellt sich gefühlsmäßig in die Nähe ihres Vaters; aber sie orientiert sich nirgends, versucht auf keinem Weg, der Ideologie hüben und drüben nahe zu kommen. Sie ist eine ordentliche Person, die tüchtig arbeitet und im Bett ihre Frau steht, ohne sich mit allen Sinnen an einen Mann zu binden, auch an den nicht, der sie heiratet, als sie zufällig schwanger wird. Kleinbürgerlicher Wohlstand mit Bad und Nußbaumgarnitur im Speisezimmer, bei festen Bezügen und gelegentlich einem Vergnügen - eigentlich kommt es ihr nur darauf an. Als die Krisis schnell hintereinander sie selbst, ihren Mann, ihren Vater, ihren jungen Bruder stellenlos macht, hält sie den Nacken hoch und übernimmt das Ruder, aber es kommt wenig dabei heraus. Die Gelegenheit, ihrem Mann durch ein bißchen Prostitution eine neue Stellung zu verschaffen, vermag sie, die sich oft und gern verschenkt hat, aus mora lischer Schwäche nicht auszunützen. Kind, Mann und Nuß baummöbel hätte sie retten können. Aber von dem inzwischen ganz verkommenen Bruder läßt sie sich mit gestohlenem Geld aufs trockene ziehen. Später hat sie wenig dagegen, daß ihr Mann Scharführer bei der SA wird, und da er fieberschnell von Rang zu Rang emporsteigt, liegt sie bald - ohne Skrupel 356
unter einer seidenen Bettdecke, hat ein weißgekacheltes Bad und wird bedient. Sie verliebt sich in einen charaktervollen SA-Mann Klaus, der den großen Schwindel im Nazibetrieb nicht mitmachen will (und später von seinen Kameraden feme gemordet wird), aber auch diese Liebe reißt ihr die Augen nicht auf. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler feiert sie mit, selig, wie eine Hochzeitsnacht. Erst der Meuchelmord an Klaus, ein SA-Überfall auf den freundlichen Arzt Doktor Danziger, der sie behandelt hat, die Verfolgung eines SPDFreundes aus ihren jungen, besseren Tagen machen sie skep tisch, und in einem entscheidenden Moment rettet sie diesen Freund vor der Verhaftung, ohne selbst viel zu riskieren. „Die Versuchung“ heißt der Roman (Verlag Oprecht, Zürich), und der Autor meint wohl, seine Lissy sei in- Versuchung geführt, aber - ein edles Glied der Geisterwelt - vom Bösen gerettet worden. Ich sehe scheel, weil er so gütig ist. Die Studie dieser Sozialamphibie ist vortrefflich, aber das Vorzeichen falsch, und der Akzent müßte völlig anders sitzen. Welche Schicksale, was für Heldinnen des Proletariats stehen zwischen Bukarest und Sevilla dem Zeitdichter heute Modell! Und er gibt ge rade dieser traurigen Frouwe den Kranz einer dicken Mono graphie! Sie hat auf jeder Seite etwas anderes verdient. Weiskopfs glänzender Journalismus verleugnet sich auch bei dem mißgegriffenen Stoff nicht, er zeichnet vorsichtig und mit klug verhaltener Demagogie eine Reihe vortrefflicher Bilder, deren eines die „Neue Weltbühne" brachte.
357
Schriftsteller Goebbels
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Joseph Goebbels auch nur eine Seite seiner politischen „Schriften“ selbst zu Papier ge bracht, überlegt, gefeilt hat, wie es dem Wesen dessen, was wir Literatur nennen, eigentlich entspräche. Seine Schreibe ist stets nur eine Rede, meistens eine Schimpfe, im Trubel dema gogischen Getobes zwischen debattierenden PGs, in die klap pernden Maschinen gebrüllt. Das ist keine bloße Annahme, Goebbels rühmt seinen jetzt zum Buch gesammelten Artikeln nach, sie ersetzten, „soweit das überhaupt möglich ist“, das ge sprochene Wort, und Hans Schwarz van Berk, der seinem Band „Der Angriff“ das Vorwort schreibt, erzählt von Goeb bels: „Am Schreibtisch hat er... am wenigsten gesessen, der größte Teil seiner Zeitungsaufsätze ist unterwegs entstanden, oft in der Bahn, auf Versammlungsfahrten herunterdiktiert worden.“ Ein Schriftsteller, der nichts ist noch sein will als ein Stegreif redner, könne nicht „mit umständlicher Gelehrsamkeit einen ausgeklügelten Artikel zurechttüfteln“, entschuldigt Schwarz van Berk, aber dennoch vergleicht er Goebbels mit Hans Sachs, Luther, Kleist und weist ihm damit einen Platz an, den er in der Geltung des Dritten Reichs tatsächlich einnimmt. Es liegen vier Bände gesammelter Aufsätze von Goebbels vor, sorgfältig gedruckt und ausgestattet, zu Zehntausenden verbreitet, und was darin steht, hat politische Wirkung getan, tut sie noch. Sie haben wohl mit Literatur gar nichts zu tun, sind höchstens Grammophonplatten, aber als die literarische Produktion eines - wohin auch immer - führenden Mannes sind sie zu betrachten.
358
„Mit modernen Mitteln und einem absolut neuen und mit reißenden Stil haben wir von früh die öffentliche Meinung zu beeinflussen versucht“, schmeichelt sich der Verfasser dieser Bände. An einer anderen Stelle behauptet er, die national sozialistische Bewegung „erfand für die politische Agitation eine ganz neue Sprache“. Worin bestehen diese modernen Mittel, wo ist das Wesent liche der ganz neuen Sprache, deren Meister nach allem Gesag ten Goebbels selbst sein will? Auf diese Fragen gibt er viel fache Antwort. Einmal: die Primitivität des Ausdrucks. Die Nazipropaganda „vereinfacht die Probleme, sic entkleidet sie mit Bewußtsein ihres verwirrenden Beiwerks, um sie in den Horizont des Volkes hineinzupassen“. An einer anderen Stelle definiert er seine Polemik: „Das geschah meist in einer so kes sen und unverfrorenen Frechheit, daß . . .“ Also: Primitivität des Ausdrucks, Verfälschung der Probleme durch „Vereinfachung“, kesse und unverfrorene Frechheit das sind die „modernen“ Mittel eines ganz neuen und hinrei ßenden Stils? Nicht die einzigen. Goebbels gibt zu, daß er und seine Mit streiter schon im Besitz all dieser Ausdrucksmittel waren, als noch Plakate und Flugzettel ihrem „literarischen“ Bedürfnis genügten. Ms der „Angriff“ begründet wurde, standen sie der schweren Aufgabe gegenüber, ihre „Kunst“ auf das Gebiet des Journalismus zu übertragen. Von der Litfaßsäule zur Zei tung, von der Zeitung zum Buch, welch dorniger Weg! Er schreibt: „Die Bewegung hatte hier nur einen Lehrmeister: den Marxismus . . . Die marxistische Presse hat niemals informato rischen, sondern immer nur tendenziösen Charakter gehabt. Marxistische Leitaufsätzc sind geschriebene Reden. Die ganze Aufmachung der roten Presse ist bewußt auf Massenbceinflussung eingestellt. Hier liegt eines der großen Geheimnisse des marxistischen Aufstiegs. Die Führer der Sozialdemokratie, die ihre Partei in vierzigjährigem Ringen zu Macht und Ansehen brachten, waren in der Hauptsache Agitatoren und blieben das auch, wenn sic zur Feder griffen. Niemals haben sic bloße Schrcibtischarbcit geleistet. Sic waren von dem Ehrgeiz be sessen, aus der Masse heraus für die Masse zu wirken.“
3 59
Daß Hitlers Partei, die im Namen des Deutschtums die deutsche Kultur, im Namen des Sozialismus den Sozialismus, im Namen einer Arbeiterpartei die Arbeiter bekämpft, eine Trödelbude gestohlenen und arglistig verfälschten Gedanken gutes aller Parteien und Weltanschauungen, die jemals Erfolg hatten, darstellt, daß sie mit gestohlenen und verunstalteten Melodien, Märschen, Liedtexten agitiert, brauchte Goebbels nicht erst zu verkünden. Aber daß ihr Schrifttum nur einen Lehrmeister hatte, den „Marxismus“, ist ein erstaunliches Be kenntnis, wenn man vergleicht, welcher Terminologie sich Goeb bels und die Seinen sonst in bezug auf diese Vorbilder be dienen, auch in vornehm gedruckten und gebundenen Schrift werken wie denen Goebbels’! Die Anstrengung glückte, unfaßbar schnell. Bald hatten die marxistischen Lehrmeister, behauptet Goebbels, „unserer scharf durchdachten, logischen Beweisführung nichts mehr entgegenzu setzen“, und es blieb ihnen - die Sturmscharen und Saalschutz kommandos winkten vergeblich mit ihren Ölzweigen! - „nichts als ,Appell an die rohe Gewalt’". Der Schriftsteller Goebbels schreibt seine Werke nicht, er findet auch nicht die Zeit, sie zu lesen. In einem Atem bringt er Behauptung und Widerlegung, unmittelbar an seine Klage über die rohe Gewaltanwendung der Antifaschisten reiht er den Satz: „Man soll auch nicht glauben, daß es den Männern der jüdi schen Feder imponiert, wenn man versucht, es ihnen an Bril lanz des Wortes und Feinheit des Stils gleich zu tun. Ihnen imponiert am Ende doch nur die Macht und sie werden erst dann kleinlaut werden, wenn man ihnen die Faust unter die Nase setzt.“ Welch ein „Schriftsteller“ ist dieser Goebbels, wenn er schreibt: „Die Bewegung hatte den Feind in seiner eigenen Burg auf gesucht, hatte ihn zum Kampf gezwungen und war, als der Kampf unvermeidlich geworden war, ihm nicht feige ausgcwichen.“ In einem kurzen Satz rühmt er seine Bewegung, den Gegner überfallen, zum Kampf gezwungen zu haben, beklagt er, daß
j6o
der Kampf unvermeidlich geworden sei, und jubelt, daß der Angreifer im Angriff nicht ausgewichen sei. Nicht einmal das Wort Angriff - nämlich Gegensatz von Ausweichen - wendet der Begründer des „Angriff" richtig an! Ungewollt und dennoch sehr präzis verrät er, worin die „geistige Überlegenheit seiner Argumente“ beruht; zu Beginn seiner Tätigkeit in Berlin sah er das Drama „Gneisenau“ von Wolfgang Goetz und erzählt: „Ein Satz jenes einsamen Gene rals, der die Welt nicht verstand, und den die Welt nicht ver stehen wollte, ist mir nun auf immer unvergeßlich geblieben: ,Gott gebe Euch Ziele, gleichgültig, welche!'“ Wirklich konnten ein bestimmtes, hohes Ziel anstrebende Denker nicht gegen die argumentieren, die „gleichgültig welche Ziele“ und je nach dem Bedarf der Stunde alle Ziele der Poli tik zugleich anstrebten! Goebbels schäumt vor Ekel über die Schriftsteller der „jüdi schen“ Presse: ihre Leitartikel waren „so geistreich geschrieben, daß der Leser Brechreiz bei der Lektüre bekam“; sie „spiegel ten sich eitel und selbstzufrieden in der schillernden Kompli kation ihres Intellektualismus, sie verfeinerten sich in einem zivilisierten Stil so wirklichkeitsfremd, daß ihre Sprache am Ende von den Massen nicht mehr verstanden wurde“. Aber er behauptet keineswegs, seine unzivilisierte, wirklich keitsnahe Sprache sei etwa Stimme der Wahrheit; im Gegen teil bekennt er die Verlogenheit in seinem Stil, wenn er schreibt: „Radikaler und rücksichtsloser als wir denkt der kleine Mann, der es nicht gelernt hat, das Wort richtig zu gebrauchen, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht.“ So tobt er gegen die Unzulänglichkeit einer Regierung, die mit Mitteln der Politik, Erfüllung ihrer Verträge, Friedens willen konkrete Ziele zu erreichen sucht. Aber als diese Poli tik große Erfolge bucht, brüllt es aus der Mördergrube dessen, der „das Wort richtig zu gebrauchen“ versteht: „Daß Frank reich den Rhein räumt, daß es auf den Reparationsagenten verzichtet, daß es der Republik einen Teil der ihr durch den Dawcsvcrtrag gänzlich geraubten Souveränitätsrechte zurück gibt, das ist eigentlich die tiefste Schmach, die die deutsche Regierung im Haag eingehandelt hat; und sie täte gut daran, 361
sich darum in Grund und Boden zu schämen, anstatt damit auf den Märkten der Politik hausieren zu gehen.“ All das stand im Programm der Nazipartei! Welche Schänd lichkeit nun, daß ohne ihre Hilfe das Rheinland geräumt wurde. „Wir gratulieren der Regierung zu diesem Erfolg. Er enthebt uns des Beweises dafür, daß diese Regierung feige ist und gar nicht mehr den Mut aufbringen will, sich gegen die ewige Sklaverei zur Wehr zu setzen. Frankreich, der schärfste, kritischste und argwöhnischste Beobachter Deutschlands, sieht keinen Grund mehr, Sicherheiten zu fordern.“ Geistreiche Argumentationen sind diesem Stilisten „zum Ekel“, aber: „der Gegner darf sich nicht beklagen, wenn wir von nun ab mit Pfeilen schießen und im Notfall die Spitze dieser schlanken Geschosse nicht immer in die Milch der from men Denkungsart, sondern manchmal und zuweilen auch in das Gift der Bosheit und in Galle der verhaltenen Wut hin eintauchen“. So ein Pfeil, in Gift und Galle getaucht, wird gegen Ernst Thälmann geschleudert: „Von dem deutschen Kommunistenführer Ernst Thälmann erzählt man sich, daß er während des Hamburger Aufstan des . . .“ Und nun folgt eine Sudelei, die einfach nicht wiederzugeben, von der auch nur das beiläufige „während des Hamburger Auf standes“ wichtig ist - in einem Buch, das Z936 (!) erscheint. Seit drei Jahren saß Thälmann, vom Henker bedroht, damals schon im Kerker, weil „man sich erzählt“, er habe den Hamburger Aufstand (1923!) geführt. Dieser Schriftsteller, dem jedes Ziel recht ist, rühmt sich, daß er hinterrücks, mit „meuchlerischem Lachen“ zu töten wisse, und verhöhnt zugleich eine Regierung als erbärmlich, weil sie ihm sein Handwerk nicht legte: „Nur wenn ein Unter drückungsregiment um sich Schrecken und Angst und panik artige Furcht verbreitet, kann es am Ende eine Bewegung für eine Zeitlang aufhalten.“ Diese Erkenntnis, schon 1927 gefunden, ist deutlich genug formuliert, um zu sagen, was die Nazis unter Freiheit je ver standen. Natürlich ist das - und überhaupt alles, was Goebbels 362
sagt - nicht von ihm. Goebbels’ großes „literarisches" Verdienst ist es, nicht der k. und k. österreichischen Volksschule entspros sen zu sein - er ist Hitler auf preußisch. Wenn man sein Werk ins Breiige, in österreichisches Gerichtsvollzieherdeutsch zurück übersetzte, entstünde: „Mein Kampf“. Aber, obwohl preußisch, sogar berlinisch, würde sich eine Goebbelssche Formulierung nie als unübersetzbar erweisen, denn kein Satz, kein Wort ist spezifisch. Van Berk rühmt Goebbels’ Überschriften, die den Leser „einfach packen“, zum Beispiel „Eine Mücke hat gehustet“. Das Wort ist schwacher Kerr. „Finden Sie, daß Isidor sich richtig verhält?“ Das ist - nur hieß es statt Isidor Konstanze von Barnowsky, einem jüdischen Theaterdirektor. Dann ein Wort, auf das Goebbels ungeheuer stolz ist, „Journaille“, ein Produkt aus den Worten „Journal“ und „Kanaille". Das ist von Harden . . . Ich hatte mehr erwartet, wie ich an eine Studie von Goebbels’ Prosa ging, als Gerede, das dumpfe Hirne betäubt, wenn es mit großem Geschick in die Säle geschmettert wird, aber schwarz auf weiß nichts ist als verlogenes Klischee. Immerhin gibt es Sätze, die nur zur falschen Stunde leer waren, zehn Jahre später Inhalt haben könnten. Um Goebbels gerecht zu sein, erteile ich ihm das Schlußwort: „Da habt ihr Brot! Zwar nicht genug für Euch alle. Aber für einige . . . Was hat man Euch nicht alles versprochen, seitdem Ihr Euer Geschick selbst in die Hand nahmt? Und nun rechnet auf: Was hat man Euch gehalten? Nichts! Steine gab man Euch statt Brot. Einen Geßlerhut statt Freiheit. Und ein Hundeleben für ein Paradies auf Erden. Man hat Euch betrogen. Man wird Euch in alle Ewigkeit be trügen, wenn Ihr nicht mit der Faust dreinschlagt und d,em Verbrechen am Volk ein ganzes Ende macht!“
365
„Bolwieser und Sittinger"
Es handelt sich um zwei Roman-Biographien von Oskar Maria Graf, soeben im Malik-Verlag erschienen, die Geschichten zweier unscheinbarer Spießbürger der bayrischen Kleinstadt, von denen sechzig ein Schock und zwanzig Millionen diejenige Klasse der deutschen Bevölkerung machen, der wir heute Füh rung und Führer verdanken. Bolwieser ist Bahnhofsvorstand, brauchbar im Dienst, mit telgroß, breit, wohlgenährt, blond, von Politik unberührt, häus lich; er scheint bestimmt, von Tragik unberührt durchs Leben und in Pension zu gehn, nicht viel interessanter als jedes an dere Bahnhofsrequisit. Mit fünfunddreißig aber, als er schon Fett ansetzt, wider fährt ihm der Überfall des Eros. Frau Bolwieser sieht von weitem der Frau Marie Grubbe ähnlich, noch ähnlicher Madame Bovary, wie auch Bolwieser selbst ein ferner Schicksalsvetter des Doktor Bovary ist. Er frißt ächzend vor Glück, was sein Hannerl ihm kocht, aber "im Genuß des Fressens verschmachtet er vor Begierde nach dem, was die Ehe weiterhin bietet. „,Also so was Großartiges heut wieder! Also so ein Gu lasch, Hannerl! Einfach eins a! Herrgott, da soll ich nicht dick werden! Rein zu Tod essen könnt ich mich!“ lobte er ihre Kochkunst und gabelte munter weiter: ,So was Pikfeines, m-mhm-m!“ Mit Leib und Seele war er dabei. Er konnte eben immer nur eins ganz tun, und jetzt war das Essen an der Reihe. Ein Groll stieg in Hanni auf. ,Ich bin für ihn auch nichts anderes als dieses Essen“, fiel ihr ein. Er schmatzte und schlang 364
in sich hinein. Sie sah ihn an. Schweißperlen standen ihm auf Stirn und Nase. ,A-aah! Das hilft dem Vater auf die Mutter!' hielt er inne und wischte sich mit der Serviette den soßebesudelten Mund ab. Er nahm einen starken Schluck Bier und graunzte aber mals behaglich.“ In diesen zehn Zeilen steckt das ganze Bolwieserproblem. Der „Gockel“, der „Hengst“, wie Hannerl ihn oft nennt - und die Worte schmeicheln ihm -, widert sie an. Es widert sie auch, daß er ihre Launen hinnimmt wie Gottes Fügung, ihre Worte ihm Befehl sind; daß es neben der Ehe keine Welt für ihn gibt. So geht sie zu anderen - von ihm hat sie nichts zu fürch ten -, erst zum Metzger, der mannhafter, dann zum Friseur, der edler ist, zu dem sie „aufschauen" kann. Aber die Kleinstadt sieht alles und weiß alles. Es kommt an die große Glocke, es kommt zu einem Prozeß wegen übler Nachrede, und Bolwieser schwört, dumpf in seiner Hörig keit, einen Meineid, der den Ruf Hanneris rettet. Natürlich kommt auch der Meineid ans Licht, armer Bolwieser! Wäh rend er im Zuchthaus sitzt, läßt sie sich scheiden, heiratet den Friseur. Wie diese Menschen und ihre Verhältnisse sind, kann es nicht anders kommen, gewiß ist das Buch an der Hand von Prozeßberichten entstanden. Der arme, dumpfe, stets geduckte Gockel, die hübsche Henne mit geplustertem Gefieder, der Edelhahn mit dem Kamm in der Brusttasche und von Wohl gerüchen triefend, all das böse, feindselige, geschwätzige Feder vieh rings in Fenstern und auf Zäunen - das ist Kleinstadt, wie sie nie besser gezeichnet wurde. Der Schluß wird romantisch, er paßt schlecht zu diesem künstlerisch höchst ehrenwerten Report aus Bayrisch-Kräh winkel. Bolwieser, dem Zwang und Despotie Wonne sind, der ohne Ketten nicht leben kann, wird ein vortrefflicher Zucht häusler und müßte nach seiner Entlassung jeden Anlaß be nutzen, um wieder ins Zuchthaus zu kommen. Warum ver greift er sich nicht an Hanni, der er Briefe schreibt wie diesen: „Du bist schuld, hast mich ruiniert - Du Hurenweib - Du Dreckfetzen - gewissenlose Ehebrecherin - herzliebste, gute 365
Hanni! - Du Satan - Du scheinheilige Furie - verlogenes Mensch, Du-------- Liebherzige, arme, gute - heilige Ha —“. Ist das nicht der Brief eines Menschen, der morden muß? Statt dessen wird Bolwieser Fährmann, wie die alte Frau Marie Grubbe Fährweib wird, und er, der die Umwelt nie empfun den hat, wächst in die Natur hinein, wie ein Tier, fast wie ein Baum. „Nur das unablässige Auf und Ab der Elemente rührt ihn noch .. Das glaube ich nicht. Gerade deshalb wurde Bolwieser ja geschrieben, weil sein einziges Element die Hanni ist. Daraus hat er geschöpft, daran ist er verdorben. Und da ein anderer sie hat, er sie nicht mehr haben kann, muß sie hin sein. Danach wird Bolwieser das Zuchthaus abermals eine Zuflucht sein, das Schafott gleichfalls. Nur eins kann er nicht ohne sie: leben. Graf packt ein heißes Eisen an, wenige Romanciers haben sich so nahe daran gewagt. Plötzlich läßt er es fallen. Er war auf dem Weg, die Notwendigkeit einer Mordtat unwiderlegbar zu schildern. Herrn Postdirektor Sittinger ist Eros nie begegnet, dieser einzigen Gefahr auf dem Lebensweg der Blassen, Vielzuvielen, und deshalb glückt ihm sein ganzes Mäusedasein. Die Frau, die für ihn kocht und seine Launen duldet, war stets nur Sittingers Ehegattin, zu seiner Geliebten hat sie es nie gebracht, hat es keine gebracht. Sittinger ist ein Muster von Bürger und Be amten, a-sexuell und a-politisch wie ein Engel, und stünde die Hölle gegen ihn auf, er wiche nicht vom Weg, der jeweils sicher und geboten ist. Allerdings hat er Gold im Krieg gehamstert, als es längst Delikt am Vaterland war, aber so geschickt, daß die Frau selbst nichts merkte, und ebenso geschickt weiß er es im richtigen Moment wieder umzusetzen. Dafür hat er gelitten, daß seine Frau einen Teil ihres Vermögens in Kriegsanleihe anlegte und verlor; erträgt er es mit gedämpftem Groll, daß die bankrotte Republik später seine Pension kürzt. Als in seiner Malwine späte Frühlingsgefühle für einen Nazi erwachen, stürmt nichts in seiner Brust, obwohl er den Kerl anrüchig findet und sich von den Nazis nichts erhofft. Aber er wartet gleichmütig die
366
Stunde ab, in der er ihn gefahrlos abwimmeln kann. Gleich mütig abzuwarten ist Sinn und Inhalt seines Lebens. Durch viele Jahre, durch Hunderte von Situationen hat Graf diesen mehr wurmigen als wurmstichigen Patron verfolgt, be horcht, berochen, ein redlicher Biologe, dem alle Kreatur gleich viel gilt. Nur einmal geht ihm die Galle hoch, seltsamerweise mitten im Buch, und er sagt - aus dem Rahmen des Kunst werkes redend -, was er von den Sittingers hält: „Menschen wie Sittinger gibt es in allen Ländern Abertausende. Ihre Zahl ist Legion. Alle Gescheitheit und List, aller Unglaube und alle Erbärmlichkeit einer untergehenden Schicht ist in ihnen ver einigt. In manchen Zeiten heißen sie ,du‘ und ,ich‘. Dennoch wird niemand glauben, daß er auch zu ihnen gehört. Er würde sich schämen und belächelt sie verächtlich. Er weiß nicht, daß diese Verachtung ihn selber trifft. Sie erscheinen harmlos, und ihr giftiger Egoismus gibt sich stets bieder. Sie sind die plump sten und verheerendsten Nihilisten unter der Sonne. Man hat politisch mit ihnen zu rechnen, wenn man die Welt verändern will, nur darf man sich nie dem Wahn hingeben, als seien sie für das Erringen einer besseren Zukunft brauchbar. Sie sind nicht einmal gärende Gegenwart, nur Vergangenheit, und darum die unangreifbarsten Totengräber jeder gerechten Gesellschafts ordnung.“ Wahrhaftig, so sind sie - und ihrer sind Millionen, die alles geschehen lassen und mit allem Kompromisse schließen; die jedem Umsturz Gefolgschaft leisten, wenn sie hoffen dürfen, gerade ihre Gewohnheiten und ihr Besitz werden nicht an getastet. Sie sitzen oft auf höchsten Stühlen, müssen nicht Postbeamte, können auch bescheidene Schriftsteller, Staats männer oder Zuhälter sein, darauf kommt es nicht an. Sie ahnen niemals, wo Gott wohnt; stürzt die Welt ein, dann fra gen sie: wie rette ich meine silbernen Löffel? Und noch unter den Fußtritten des Siegers, dem sie den Sieg bereitet haben, bewundern sie seine Genialität und Wucht. Da ist unser Weltgeschehen: Morbide, die an sich hilflos wären wie Gonokokken auf heißem Sand, werden Triumpha toren im Brutbett einer kompromiß-schwellenden Sittingerschaft, die alle Basteien besetzt hält.
367
Sittinger ist ihr Prototyp, diese Gestalt sagt mehr über unsere jüngste Geschichte, als dicke Historien sagen werden. Nur ein genial Begabter kann eine Kreatur so durchleuch tend gestalten, die ihm polar entgegensteht wie Sittinger dem Graf; sich ganz in das Leben eines so Verhaßten hineinknien, seine Düfte schlucken, seine Niedrigkeit ausloten, aus seiner widrigen Substanz Zeitgeschehen und Weltengang deuten. Viel Trost gibt dies Buch nicht, das mit einem Ausspruch Sittingers schließt, als der sich endlich auf der rechten Seite weiß: „Bloß, wie lang wird das dauern?“ fragte er sich oft und oft. „Wenn ich nur wüßte, was dann kommt...“ Aber es gibt viel Klarheit.
368
Der Märtyrer Für Carl von Ossietzky
Seine Sprache war rein und erhaben, denn so waren seine Begriffe. Nie mußten wir einen seiner Sätze zweimal lesen, um ihn zu erfassen, man las jeden zweimal und öfter, um ihn zu genießen. So rein und erhaben war auch sein Weg. Er kämpfte gegen den Krieg, und kein Gedanke an das eigene Schicksal machte seine Schritte unsicher. Er ging ins Gefängnis, statt ins sichere Ausland zu gehen, weil er sich in Deutschland, auch hinter Gittern, als stärkeren Gegner empfand, auch gebrandmarkt als „Landesverräter“. Er blieb nach dem Reichstags brand abermals auf seiner Wacht, des Martyriums gewiß, weil er an die Macht des Märtyrertums glaubte. Nach drei Jahren systematisch dosierter Folterqual - so dosiert, daß er nicht an Wunden starb, sondern noch an Tuberkeln sterben konnte, durfte er ein einziges Mal sprechen, als Zeuge vor Gericht. Da sagte er, er habe gezaudert, aber den Nobel-Friedenspreis endlich angenommen, weil er sich dieser Auszeichnung nicht unwürdig fühle. Ein Plutarch der Zukunft wird dies Wort verzeichnen und nichts hinzufügen.
369
Gedichte von Alfred Kerr Und ich will das Urteil sprechen über jene, die den Mord brauen, über jene, die den Mord üben, über die falschen Zungen und über alle Gleichgültigen in der Welt, die ihren Schrecken abschüttcln wie Wasser und denken: Was geht cs mich an ? Kurt Kersten
Die Lyrik Kerrs war seit jeher gereimter Journalismus. Im „Roten Tag“, dem keineswegs roten Scherl-Blatt, und später im „Berliner Tageblatt“ erschienen seine verisifizierten Thea terkritiken, Jubiläumsfeiern, Nekrologe, Polemiken und mach ten vielen Pläsier, die der trockenen Prosa gerade satt waren. Mit einer Reimgewandtheit ohne Hemmung begabt, ließ Kerr aus schlecht verborgenen Untiefen Einfälle plätschern, aus der Stimmung des Tages heraus und schauerlich oft unvertretbar schon am nächsten Tag. Es gibt wenig deutsche Schriftsteller, die sich so zahlreicher brauchbarer Formulierungen in Vers und Prosa rühmen können wie Alfred Kerr, aber auch wenige, die den Geist, die Absicht ihres Schreibens der Formulierung so durchaus unterworfen haben wie er. Immer schüttelt er die deutsche Sprache, aber noch häufiger scheint er von ihr bis zur Ohnmacht gebeutelt, bestürmt von Reimmöglichkeiten und Wortspiel-Gelegenheiten, von denen auch nur ein Winziges sich entgehen zu lassen er nie die Kraft hatte. Seltsamer Einfall, 1938 eine Anthologie dieser nur für die Minute hingeworfenen, so unmelodischen wie unharmonischen Glößlein - und noch dazu unter dem Titel „Melodien“ - hcrauszugeben! (Edition Nouvellcs Internationales, Paris.) Das soll eine Art lyrischer Autobiographie sein, Vermächtnis eines mehr als Siebzigjährigen, und schließt entsprechend mit einem „Rückblick“ von sechs Zeilen. Das Dasein habe doch „Spaß“ gemacht, summiert ein deutscher Poet, der Weltkrieg, Hungers not, Niedergang und sechsundsechzig Monate Hitlcrismus mit angesehen hat, und seine Enderkenntnis bimmelt: „Das Erden leben bis zum Tode bleibt eine fesche Episode.“ Auf der vor-
370
letzten Seite des Bandes lesen wir, auf einen „Peregrinus, der öffentliche“ gemünzt: „Bald Großmaul und bald Wimmerer, bald Klügerer, bald Dümmerer, bald Weicherer, bald Härterer, bald Pojatz and bald Märtyrer. Ein aller Logik lediger, maul toller Wanderprediger." Gott weiß, wer mit diesem Peregrinus gemeint ist, aber sicher auch ein Deutscher, dem dies Leben bis 1938 eine fesche Episode war oder wäre, der „lästig durch Geschrei ist und überall dabei ist, will aller Augen auf sich ziehn und wähnt, die Welt guckt nur auf ihn“. Kerr mindestens guckt nicht auf die Welt, nur auf sich. Der Schrei mißhandelter Kreatur, totgefolterter Ossietzkys, Mühsams, all der Hunderttausende, über die ein Machthaber ver hängt hat, daß ihnen nichts zu bleiben habe als die eigenen blutigen Tränen, erreicht den Helden einer feschen Episode nicht. Er resümiert: „Also: ward dein (von mir gesperrt. B. O.) Leben auch zum Wrack, kannst d u (siehe oben) sie hier draußen doch vergessen, die PGs, diese braunen Fressen, dieses Pack. Stehst ja frei im Strom des Mittaglichts; heißt das nichts?“ Es heißt alles für den, der schon vor Jahren erkannt hat: „Mit guten, mit bösen Mächten im Bund sein, der Unterschied ist nicht so groß... aber nur leben und gesund sein! Man soll leben und gesund sein.“ Nichts kümmert einen, der gefühllos genug ist, „Härterer“ auf „Märtyrer“ zu reimen, die Härte des einen, die ihn nicht trifft, das Martyrium des anderen, das ihm erspart bleibt. Er wäre folglich mit den Nazis im Bund, wenn sie ihn leben und gesund sein ließen. „Manchmal fühlt das Herz sich sehr erheitert, / Trotz der zugeschlagenen deutschen Tür;/Weil die Flucht den Horizont erweitert, / Ja, du dankst den Jägern fast dafür. / War dir (siehe oben) noch so lausiges Leid geschehen, / Kriegst du zur Belohnung was zu sehen. / Bei der Dummheit aller Lebens schlachten / Ist ein solches Plus nicht zu verachten.“ Das sind Roheiten; aber er kann die Roheiten so setzen, daß es am Ende jeder Zeile scheppert; davon eine letzte Probe aus dem „Pariser Frühlingslied“ des Emigranten: „Das Lebens meer braust hold und weit; / Noch werfen die Wellen mir Gold und Geschmeid.“ Wenn Kerr das Lebensmeer heute „Gold und Geschmeid“ 24*
371
wirft und er darüber alle vergißt, die wir lieben und zu denen wir wie Glieder eines Leibes gehören, fehlt ihm das Wesent liche des Dichters: Einfühlungskraft und überhaupt alles, was, nach einer kühnen These, den Menschen allein vom Tier unter scheidet. - „Selig auf einer Bank in der Avenue Foch“, nimmt er nicht wahr, daß die tausend Mit-Emigranten im „Holden Exil“ alle Nöte der Menschheit leiden - und immer noch glücklich zu preisen sind im Vergleich mit jenen Gefähr ten ihres Lebens, die nicht emigrieren konnten. Ob er gar nichts von ihnen weiß? ... Doch, das erste Gedicht ist den illegalen Kämpfern in Deutschland gewidmet. Sie sind „die Heiligen und die Ritter des Menschenreiches, / Das kommen wird“. Kerr selbst aber, „Verbannter, Leiderkorener“, lebt, ist gesund und - prophezeit, daß er im Vierten Reich ein „Klassiker“ sein wird. Mit dem eigenen Namen treibt er Blödelei, 1-9-3-8! Und selbst das noch ohne echte Blödheit, nur um reimzukuppeln. Wie kann man einen solchen Leiderkorenen abtun? Durch Zitieren. Ich habe nur zitiert, den Strick hat Kerr sich selbst geredet, immer wieder seit 1914. Selbst den verruchten Reim „Serben“ und „Sterben“ hat er in seinen „Melodien“ abermals geschmet tert, nur mit entgegengesetzter Tendenz wie 1914. Er reimt nichts, es reimt ihn.
Ausgebürgerter Unruh
Auf der AusbQrgerungsliste Nr. 126 i«t unter Nr. 140 vcrzeiduiet: „von Unruh, Fritz, geb. am 10. 5. 1884 in Koblenz.“
Ursprünglich lautete der Name Ohn-Rug, das heißt etwa ohne Furcht und Tadel. Die Ritter, die diesen Namen trugen und durch Jahrhunderte Weitergaben, können sich nicht selbst so genannt haben. Unruhs Vater war General, seine Söhne wurden im Kadet tenhaus erzogen. Das war eine spartanische Schule, zehnfach grausam für ein seelisch zartes und musisches Kind wie Fritz von Unruh. Später wurde er einer ausgewählten kleinen Zahl von Kadetten zugeteilt, die mit den kaiserlichen Prinzen er zogen wurden. Auch das war eine eisige Jugend. In Unruh strebte alles zu anderen Sphären, er malte, model lierte, dichtete. Der Tag verlief nach eisernen Normen, jede Stunde war Dienst oder streng geregelte Erholung. Trotzdem las er, las alles, was nicht zum Lehrplan gehörte. Er fraß Bücher, heimlich, beraubte seinen Schlaf. Die Kaiserin erkannte sein Talent zur Malerei, sie ließ ihn bei Menzel studieren, Menzel, der nie einen Schüler gehabt hatte, sah stolz auf die Versuche dieses einen. Aber die Familie Unruh wollte es anders, sie waren immer Offiziere gewesen, so sollte es bleiben. Fritz wurde Gardeleutnant, er mußte es werden. Nachts schrieb er Verse, die bald gedruckt wurden. Er schrieb das Drama „Offiziere“, das in Deutsch-SüdwestAfrika spielt, während des Herero-Feldzuges. Das deutsche Theater brachte es heraus. Jetzt hatten die Preußen nach Kleist und Platen wieder einen Dichter. Unruh nahm den Abschied, ging auf die Universität, stu dierte die deutschen Philosophen, deutsche Literatur, Ge schichte, deutsche Musik und Musikgeschichte. Dabei schrieb er
J7J
Drama um Drama, war Regisseur, schrieb Gedichte und Prosa. Er war nahe daran, auch Schauspieler zu werden und seine Helden selbst zu spielen. Reinhardt erkannte auch hier die große Begabung. Dann kam der Krieg. Unruh wurde Kürassier, mußte noch einmal Rekrutendienst machen, exerzierte, wurde geschliffen, ritt Patrouillen, wurde verwundet, dekoriert, bekam zum zwei ten Mal das Portepee. Im Schützengraben, nachts auf Patrouil len, in Hagel und Schnee, zwischen den Schlachten, schrieb er sein Kriegstagebuch, das bald gedruckt wurde. Er wurde aber mals verwundet, so schwer, daß er für Jahre ausgeschaltet war, am Rand des Grabes hinsiechte. Dann stellte er sich der deut schen Republik, seine Leidenschaft, seine Feder, seine Gaben als Redner, der die Massen hinreißt. Immer hatte er den Krieg gehaßt, hatte sich nur ausgezeichnet, um ihn dereinst bekämp fen zu können, auf der Bühne, im Buch, auf der Rednertribüne. Für die deutsche Republik und gegen den Krieg - das füllte sein Leben. Tag ohne Kampf, das war kein guter Tag. Bis die Barbarei ausbrach. Da verließ er, die Seele voll Deutsch land, den deutschen Boden. Seit vielen Jahren schreibt er am Bericht seines Lebens, der zugleich Gerichtstag über das eigene Ich und das Vaterland sein wird. Fritz von Unruh ist ausgebürgert worden und das mit Recht. Er gehört dem anderen Deutschland an, das da kommen wird.
374
Der Vulkan
Klaus Mann läßt ein neues Buch erscheinen: „Der Vulkan, Roman unter Emigranten“. Sein Fleiß ist horrend, er reist durch die Länder, über die Meere, schreibt für die Blätter, spricht, interviewt, gibt heraus, stellt Jahr um Jahr einen schweren Band her. Wahrscheinlich war er zu anderem bestimmt, zum Beschaulichen, zum Analysieren, Verdichten der Menschen schicksale, nicht zum Journalismus in vielerlei Form. Er ist auf diesen Weg gedrängt worden, die Zeit erlaubte es nicht anders. Freuen wir uns, wenn das Kompromiß gelingt, oder sagen wir herzlicher: die Synthese aus Reporter und Roman cier. Im „Vulkan“ ist sie so weit gelungen, daß Fernstehende dem Begriff „Emigration“ nahekommen - kaum so weit, daß die Emigration selbst Trost darin finden könnte. Er will sie ganz erschöpfen, in allen Typen: Wirtschaftsflüchtlinge, unpoli tische Juden, militante Politiker, proletarische Klassenkämp fer; im Hintergrund dieser Flüchtlingsschicksale steht der Krieg in Spanien, stehen die März- und Septemberkrisen, rattert die Karre Europa steil abwärts ins Dunkel. Nein, aus keiner der vielen Gruppen, die er geschildert hat, wird Klaus Mann Dank zurücktönen. Bankdirektor Bernheim, der einen Kreis Schma rotzer mit teuren Drinks traktiert und nicht weiß, ob er eine antifaschistische Zeitung oder eine Protzenbar finanzieren soll, dann aber die Bar finanziert, wird sich nicht freuen. Die homo sexuellen Ästhetiker, die sich auf diesem Vulkan Süchten er geben, im Kokainrausch sterben oder im religiösen Wahnsinn münden, werden degoutiert sein und ihr Porträt nicht wahr haben wollen. Polygame Mädchen, eitles Kabarett-Artistenvolk, Vielredner und Nichtsvollbringcr - davon wimmelt es
375
in dieser Emigration zwischen Boulevard St. Germain und Montparnasse, man wird sich dort nicht geschmeichelt fühlen. Die geflüchteten Proletarier werden gar nicht zugeben, daß sie hier überhaupt gemeint sind, daß diese Romangestalten auch nur ihren Schatten glichen - sie haben keine Stammkneipen, darin sie debattieren, suchen nicht das nächste kleine Hotel auf, wenn sie ein Mädchen kennenlernen, ihr Los ist anders, ihre Sprache, ihr Trotz. Auch ich habe etwas einzuwenden: daß der Kampf in Spanien, das größte, tragischste Heroentum ewiger Zeiten, mit den Augen eines religiösen Ekstatikers ge sehen wird, eines „Wurzellosen, Schwebenden, Entrückten, Fremden, Teilnahmsvollen“ - und nebstbei Qualligen, Infan tilen -, den ein Engel in Fliegerdreß über Tortosa und über den Heldenanger der Universitätsstadt von Madrid führt, hat mich tief verletzt. So rasch, asturischer Minero, internationaler Legionär - es gibt keine Namen, die herrlicher klängen -, durf tet ihr nicht Gegenstand skurriler Artistik werden! Aus den selten begrüßens werten Typen ragen jedoch ein zelne hervor, die man liebt und ungern vergessen würde. Unter den Leitartikeln, die in den Zeitroman eingefügt sind, ist man cher von Bedeutung, manche Schilderung fast grandios, viel Lyrisches apart und gekonnt. Viel Begabung, viel Handwerk, aber allzuviel Selbstbewußtsein und Hetze. - Um drei Monate längere Schaffensfrist, dann wäre dies Werk um zweihundert Seiten kürzer, und Klaus Mann könnte stolzer darauf sein.
Spruch auf den Weg Für Egon Erwin Kisch
Mein guter Aker, jetzt komm ich aus dem Lager zurück, denke, in dieser kahl und kalt, noch kahler und kälter denn je ge wordenen Welt gibt es Dich doch noch. Dein warmes Herz, Deinen Witz, die kostbare Freundesatmosphäre, die um Dich und Gisl besteht - und linde Dich nicht. Wie oft hast Du Dich aufgemacht über die Meere, wie oft ich selbst während dieser dreißig Jahre unserer Freundschaft. Das war nie ein Abschied, fremde Länder zu durchforschen hatten wir uns ja beide zum Beruf gemacht, waren nicht ge trennt, wenn wir, Du in Ostsibirien und ich vielleicht zugleich in den argentinischen Pampas, unsere Maulesel ritten, auf klapp rigen Fords ganze Breitengrade durchmaßen, das Ohr ans Herz fremder, farbiger, in anderen Lauten ihr Weh, ihr Hoffen, ihr Einssein mit aller Kreatur kundtuender Menschen legten. Ge rade dann waren wir vereint, zogen gemeinsam in den Sielen der einen Idee: die Menschen einander nahezubringen, ein ander lieben zu lehren, zwei gute Zebuochsen im freudig ge tragenen Joch einer helleren Zukunft. ... Wir waren auch zeitlich nicht getrennt, denn Du und ich, wir ließen unsere Erlebnisse widerhallen. In Zeitungen, Büchern schrieben wir einander, da war steter Kontakt. Ich habe manch mal gezittert, wenn Du gar zu wagemutig ins Leben hinein stießest, aber wirkliche Angst habe ich nie um Dich gelitten. Du warst immer einer, dem „nichts passieren kann“, zu sehr Jüngling, noch mit Bauch und meliertem Haar, in Deinem Knabenherzen des Schutzengels sicher. Es ging dann karg her, als wir die Heimat verloren. Wir lernten wieder, längst „arriviert“, bescheiden zu sein, wie wir J77
kaum als Studenten gewesen, das war ein scharfes Training. Aber so macht es Dir heute nichts aus, im Zwischendeck nach Chile zu fahren, und ich habe leicht ertragen, ein paar Monate lang auf Stroh zu liegen, in einem Stall mit vielen Dutzend Schicksalsgenossen, die mir gute Genossen eines trüben Schick sals waren. In Deutschland wurden unsere Bücher eingestampft, in denen kein politisches Wort stand, selbst Romane, die nicht einmal historischen Hintergrund, viel weniger zeitgeschichtlichen hat ten. Kinderbücher sogar. Buchhändler, die ein paar übrigge bliebene Exemplare dennoch zu verleihen wagten, wurden öffentlich mit furchtbaren Strafen bedroht. Wir bekamen es sogar im klarsten Stil, den die Goebbelspresse je geschrieben hat, schwarz auf weiß zu lesen, daß wir nicht länger leben dürften, auch in der Fremde sei unser Leben verwirkt. Du hast nie besser, klarer, feuriger geschrieben als während dieser Jahre. Wir hatten und haben nur einen Feind, den Mör der Deutschlands, der zum Mörder Zentraleuropas wurde, wir schrieen „Mordio!“ durch alle Gassen der Welt, wir lernten hassen, und der Vers des achtundvierziger Demokraten Herwegh wurde die Maxime unserer friedlichen Herzen: „Vernich tet sie ohne Unterlaß, / Die Tyrannei auf Erden, / Und heili ger wird unser Haß / Als unsere Liebe werden!“ Unsere Kader lichteten sich. Ernst Toller, Josef Roth ..., die rissen Lücken, als sie am Kampf verzweifelten! Der letzte, den wir verloren, war Arnold Höllriegel. Aber noch hatten wir Hörer und Leser, jedes Wort, das aus dem zerstörten Vaterland kam, stärkte unsere Wut und Glut, und unsere Liebe für die Menschen, für das Erbe an deutschem Kultur schatz, für die Sprache, die wir, nur wir im Exil rein zu er halten strebten. Uns ging es nicht um die Sache von Nationen, von Parteien, Juden- oder „Arier“-tum, es ging um das Ganze, das sich nur mit einem Wort umreißen läßt: um die Freiheit. Jetzt bist Du fort. Du bist nicht „hinüber“ gefahren, um an Lust und Qual anderer teilzunehmen, auf Große zu lauern, auf Kleine zu achten, Reisebriefe und Reisebücher zu schreiben, wie Du sie mit immer frischer Lust, mit Witz und Feuer drei ßig Jahre lang geschrieben hast. Wohin? Für wen? Deine Ge 57»
meinde ist in eine neue Diaspora gegangen. Du hast kein Papier mehr, um Briefe zu schreiben, und schriebest Du sie, wie fänden sie ihre Adressaten? Einstweilen wirst Du in spa nischer Sprache über Zeitungskunde und die Kunst der Repor tage dozieren, Du großer Handwerksmann des Wortes, wirst Theorien lehren, Schüleraufsätze korrigieren, warten, warten ... Das ist das härteste Los, nach einem Leben, das Sturm war, eine lange, herrlich lange Jugend voll Sturm war wie das Deine, warten zu lernen. Ein Künstler, der warten muß, um wieder kämpfen zu dürfen, ein Hasser, der seinen Haß auf Eis legen muß. So fasse ich diese Trennung auf, das ist ein Abschied, vielleicht auf lange Jahre, das ist ein Scheiden, das weh tut. Aber Angst habe ich nicht, nicht um Dich, nicht um uns, nicht um unsere Sache. Du kannst nicht alt werden, auch in diesem sechsten Jahrzehnt Deines Lebens nicht, das so düster anhebt. Dir ist es nicht gegeben, müd zu werden. Deine Stimme kann nicht rosten! Liebe zu unserer Kultur, Haß gegen den, der sie vernichten will, das lodert weiter, und heiliger wird unser Haß als unsere Liebe werden! Komm gut hinüber auf Deinem düsteren Boot, weiße Segel werden leuchten von den Masten des Schiffes, auf dem Du heimkehren wirst. Die da drüben, in unserer Heimat, irrlehren, Völker auf einanderhetzen, Hunger und Pest über Europa streuen, unsere Sprache verhunzen, unser heiliges Literaturgut vernichten möch ten, es kommt der Tag und straft sie alle Lügen! Auf Wiedersehen, mein guter Jugendfreund I
379
Die deutsche Literatur heute und... ?
I. Keulen gegen Gedanken Weh Euch, verfluchte Hallen, Nie töne süßer Klang Durch Eure Mauern wieder, Nicht Harfe noch Gesang. Des Sängers Fluch
Die deutsche Republik baute Modellzuchthäuser für ihre glü henden Anhänger und rekrutierte aus den Reihen ihrer dekla rierten Todfeinde das hohe Beamtentum, die Diplomatie, Richterschaft und Reichswehr. Ihr Feind stand rechts, aber sie sah ihn links - und wütete gegen die Linke, bis sie von der Rechten abgewürgt war. Noch in letzter Todeszuckung schlug sie nach links. Aber dies bleibt ihr nachzurühmen, den vierzehn Jahren ihres Bestehens: Künste und Wissenschaften wurden gehegt. Die schöne Literatur durfte sich auf breitester Fläche entfalten, fand materielle Unterstützung wie nie in der Geschichte Deutschlands. „Der Kürschner", das Lexikon deutscher Schrift steller, vor dem ersten Krieg ein schmaler Band, schwoll zu einem mächtigen Volumen mit sechstausend Namen; die Schriftstellerei war nicht, wie in den Nachbarländern Deutsch lands, ein edles Vergnügen begabter Post- oder Bankbeamter, sondern sie wurde ein solider Beruf. Wo ein Talent sich, schüchtern noch, manifestierte, da ström ten Entdecker und Helfer herbei, es gab Vorschuß-Lorbeer und Vorschuß-Honorare. Auch in den reichsten Ländern Europas gab es nicht so viel Dichter und Schriftsteller mit festem Monats einkommen, deren Verleger sich graue Haare wachsen ließen, indes sie selbst Herz und Hirn frei hatten für ihren Beruf. 380
Das deutsche Volk las Bücher, die es gekauft hatte - freilich mußten sie teurer aussehen und von Künstlerhand geschmückt sein -, indes die Engländer ihre Lektüre aus der Leihbibliothek bezogen und die Franzosen auch ihre großen Autoren in billig ster Broschüre und auf billigstem Papier druckten. Die Bankkrise von 1930 fiel dann schwer auf diesen Muster gatten der Republik, aber viel weniger schwer als auf die mei sten anderen Felder. Bourgeois und Arbeiter, einmal ans Lesen gewöhnt, lasen gerade in diesen öden Zeiten noch eifriger, wenngleich sie nicht mehr kaufen konnten. Statt dessen schos sen Leihbibliotheken wie Pilze aus der Erde, und in ihrer Gesamtheit nehmen sie stattliche Auflagen ab. Der „Wohl fahrtsstaat“ ermöglichte es den Millionen Arbeitsloser nicht, sich sattzuessen, aber sie konnten sich sattlesen. Autoren dran gen in die Massen, die bisher nur einer Elite der Leserschaft bekannt waren, und blieben haften. Das „Buchhändlerbörsen blatt“ erschien noch immer wöchentlich als starkes Konvolut, von Seite zwei bis Seite hundert voll von Verlagsanzeigen. Die deutsche Literatur wäre in dieser Krise - auch wenn sie lange angehalten hätte - nicht erstickt. Sie konnte nur mit Keulen niedergeschlagen werden. Das begann am 27. Februar 1933, als der Reichstag brannte und die besten Bücher in den Scheiterhaufen flogen. Die Flammen der Bûcher-Autodafés waren harmlos, waren eher ein letztes Aufzucken glorreicher Wirklichkeit der ver brannten Autoren als ihr Tod. Aber dann kam das Beschlagnahmen aller Literatur, die dem Geist der Braunen zuwider war. In den Verlagskellern, Kom missionslagern, bei den Sortimentern, in Leihbibliotheken und den Bücherschränken kleinster Privatleute wurde geschnüffelt, gefahndet, beschlagnahmt und eingestampft, was Blüte deut schen Geistes war - von Heine und Börne bis zum Jüngsten, Klaus, der Dichterdynastie Mann. Zitternd vor dem Konzentrationslager steckten die Armen selbst ihre Lieblingsbücher ins Feuer, kochten magere Suppen mit dem, was einst ihr Stolz gewesen, ihres Dichters Sehn suchtslaut. Nicht nur wegen ihres unnazistischen Inhalts, ganz allein
381
der Namen ihrer Autoren wegen - sei es, weil die Namen jüdisch klangen, sei es, weil ihre Träger sich nicht gleichge schaltet hatten - wurden tausende Tonnen deutscher Literatur eingestampft, Liebeslyrik und Elegie, Kindergeschichten, Romane, Märchen, Biographien ohne politische Vorzeichen alles, alles, was nicht mit dem siegreichen Geist der Nieder tracht vereinbar war. Nie in der Geschichte ist ein solcher Raub an einem Volk begangen worden. Als Österreich in die Hände der Barbaren fiel, war es gleich falls aus mit Schrifttum, Schriftstellern und Bücherbeständen. Wie Schweine und Hunde, die edle Trüffeln aufspüren und aus der Erde wühlen, fanden Literaturexperten der Gestapo in Lä den und unter Strohsäcken, was sie suchten, und vernichteten es. Dann fiel der dritte Keulenschlag in der Tschechoslowakei, dort war noch viel zu holen. Die Emigrations-Verlage in Hol land, Frankreich - alles geistige Gut wurde Brei. Nur die Schweiz blieb übrig, eine Art Asilo, ein Reservat deutscher Literatur, aus dem man schöpfen kann, wenn einmal neu gedruckt werden darf. Aber selbst in der Schweiz - das weiß ich aus erster Quelle wurde von uns toten und lebenden verfemten Autoren vieles vernichtet, als 1940 ein Überfall der Hitlerarmee drohte. Eine Neuauflage des „Großen Brockhaus“, der besten deut schen Enzyklopädie, war 19 3 5 etwa bis zum „R“ erschienen, und seltsamerweise wurde dieser Millionenwert geschont. So kann Mit- und Nachwelt bis zum „R“ erfahren, was deutsche Kultur, deutsche Literatur war. Von „R“ bis „Z“ wurde das vorhandene Material braun gefärbt. Ernst Toller, René Schickele, Fritz von Unruh, Arnold Zweig und Stefan Zweig - diese leuchtenden Namen wird der Lite raturbeflissene kommender Jahre vergeblich suchen. Statt des sen findet man in den Bänden „R" bis „Z“ nicht Dutzende, sondern ein paar Schock von Namen deutscher „Dichter“, die einfach nicht existieren, noch je existieren werden, wo man ge dankenvolles, edles Deutsch spricht; die Namen jener feder fuchtelnden Rowdys, die den Revolver entsichern, wenn je mand das Wort „Kultur“ ausspricht.
582
II. Die in Deutschland blieben Es ist leider falsch, was oft behauptet wurde, daß „die deutsche Literatur“ geschlossen auswanderte, als in Deutschland nichts mehr laut werden durfte als Seufzen nur und Stöhnen und öder Sklaventritt. Nein, es ist nicht wahr, zu unserer Schande sei es gesagt! Gerhart Hauptmann - wie hatten wir den geliebt! Seinen siebzigsten Geburtstag hatten wir ein ganzes Jahr lang gefeiert wir, das andere Deutschland! Kaum eine Bühne auf deutschem Boden, die in diesem Jahr 1932 nicht mindestens eins seiner Stücke in ihr Repertoire neu aufgenommen hätte. Acht oder neun Berliner Bühnen spielten zugleich seine Dramen in langen Serien, eine Lebensernte, wie kein Dichter sic je eingeheimst hat. Ich sah ihn im „Deutschen Theater“, als „Rose Bernd“ mit der neuen herrlichen Wessely gespielt wurde - wie haben wir ihm zugejubelt, wir, das an dere Deutschland! Vielleicht wäre er Hindenburgs Nachfolger geworden - es gab Hunderttausende, die ihn kandidieren und wählen woll ten. Er machte „Heil Hitler" und hob den Arm zum römischen Sklavengruß, als die Tinte noch nicht trocken war, mit der Hindenburg den neuen Reichskanzler ernannt hatte. „Einen Anblick für Götter“ nannte ein Naziblatt diese Szene. Das hohe Alter entschuldigt Hauptmann nicht, er wurde so sehr zum Verräter an sich selbst wie wenige Menschen der Geschichte. Vielleicht wird die Nachwelt mitleidig an seinem Gedächtnis vorbeigehen, wenn sie erfährt, daß Hauptmann in Wein und Sekt und Austern und jeder Art Wohlleben schon verkommen war lang vor jener Zeit. Ich habe ihn fressen und saufen sehen, das war ein fataler Anblick, lang vor seinem moralischen Ende. Ich weiß von einem Verlagsdirektor, der ihn häufig besuchen mußte, daß er vom Aufstehen an trank und überhaupt nicht nüchtern wurde - morgens, mittags, nachts. Dieses unter Spiritus am Leben gehaltene Menschenpräpa rat - es hatte nichts zu tun mit dem Dichter, den wir geliebt haben.
385
Rudolf G. Binding, Hans Carossa, Ricarda Huch, Max Mell, Herbert Eulenberg, Oskar Loerke, der 1942 starb, die Präsi denten der „Dichter-Akademie“, Wilhelm von Scholz und Wal ter von Molo, Emil Strauss, Wilhelm Schäfer, der Gutes tat und Bestes schrieb, sie alle, die schon weiß waren, als sie braun wurden oder zumindesten sich braun färbten, weil es galt: Auswandern oder Mimikri - nehmen wir an, sie haben das Ungeheure nicht mehr fassen können, diesen Einbruch des Urwalds in eine Welt, in der sie gestaltet haben. Mit Aus nahme von Binding sind sie wenigstens verstummt, da sie blieben__ Gottfried Benn, der unser Avantgardist war, den Massen fremd, im engsten Kreise hoch verehrt, der zu Kiabunds Tod die schönste Grabrede gehalten hat, die je einem feurigen Pazifisten und Menschheitsfreunde gehalten wurde - er wurde zur braunsten Bestie! Richard Billinger, der sogar durch Konzentrationslager ging; Hans Fallada, ein Empörer in vorzüglichen Romanen, Feind diesem Nazigesindel in jeder Faser seines Wesens; Ernst Glaeser, einst ein Talent, dann verwässert, erst rot, dann braun, dann als Märtyrer und Meisterschnorrer in der Tschechoslowa kei, in der Schweiz, dann heimgekehrt und wieder braun ... Hanns Heinz Ewers, der einmal ein Buch über die Juden schrieb, in dem er sie und die Deutschen die Elite der Welt nannte. Er wurde Nazi-Poet... Hans Reimann, oft witzig, aber immer Filou und Arrivist, na ja... Erich Kästner, so liebenswert, so tapfer - von ihm will ich nicht sprechen, von dieser leuchtenden Knabengestalt im Parnaß der Republik. - Er wurde totgesagt, sein Tod wurde demen tiert. Solange man nicht weiß, ob er tot ist, nicht von ihm sprechen 1 Aber wären sie alle, und Thomas Mann zu Seiten seines Bruders Heinrich, aufgestanden und davongegangen, Ekel um den Mund, Feuer im Herzen, auf der Zunge - damals, da mals, 1933t Und ihnen nach die großen Führer der Wissen schaft, der Musik, der bildenden Kunst, die Nicht-Verfolgten, aber mit den Verfolgten Fühlenden - vieles wäre nicht ge584
schchen, das Schlimmste wäre nicht geschehen? Zumindest hät ten sic ihre Seele gerettet. Es war grauenhaft, ich betrat im März 1933 die damals so heilige, gute Erde der Tschechoslowakei: und glaubte, sic seien alle schon da, zumindest im Kommen. Es war grauenhaft, sie waren nicht da, so viele dachten nicht an Kommen. Aber stumm sind sic geworden ! Was sie auch inzwischen schrieben - cs fiel traurig aus. Ihr Gesang? So singt man mit Eisen und Hanf an der Kehle. Die deutsche Literatur in Deutschland hat nichts hervor gebracht in zehn Jahren, davon je zu sprechen wäre. Sic ruht in Schanden.
III. Die Götter dürsten Verengter Überrest der Welt, wo man für eine Weile wcitcrlcbt und hat nicht einmal zu bedauern, was vcrlorcnging. Das meiste mußte nicht nur: cs wollte. Aus einem Rrief von Heinrich Mann
Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Egon Fricdcll, Walter Hasen clever, Ernst Weiss, Irmgard Keun, Walter Benjamin, Stefan Zweig sind freiwillig gestorben - das sind acht von den fünf undfünfzig prominenten Schriftstellern, die ins Exil gegangen waren, als die Hitler-Herrschaft ausbrach. Aber eine Art Selbstmord - im Sinne der Psychoanalytiker haben in der gleichen Zeit auch Jakob Wassermann, Joseph Roth, Max Herrmann-Neisse, Franz Hessel, René Schickele, Arnold Höllricgel und Anton Kuh begangen, indem sie sich einer medizinisch wenig bedeutsamen Krankheit widerstands los hingaben, sich „in die Krankheit flüchteten“, um ihr zu er liegen. Zählt man sie den Freiwilligen zu, dann sind es fünf zehn von fünfundfünfzig binnen zehn Jahren. Nur einer von ihnen sechzig Jahre alt, die meisten unter fünfzig. Siegmund Freud und mein Bruder Rudolf Olden gehören in keine dieser Rubriken. Freud war über achtzig, als in Lon don sein Leben endete, Rudolf Olden starb an Frost, Hunger Paradicie
385
und Erschöpfung im Rettungsboot des torpedierten Dampfers „City of Benares“, der unter dem Roten Kreuz gefahren war. Meine Zahl „fünfundfünfzig“ stützt sich auf eine sehr über zeugend und sorgfältig gemachte Statistik von Hans Kafka, die im „Aufbau“ veröffentlicht wurde, und auf den „Großen Brock haus“ von 1933, in dem sich die angeführten Namen mit einer Ausnahme finden dürften. Die meisten habe ich gut gekannt. Viele waren meine näch sten Freunde seit Jugendtagen, und was über ihr Ende zu er fahren war, habe ich erfahren. Seinen Grund hatte jeder, jeder einen anderen . . . Alle den gleichen! Tucholsky war an der Welt verzweifelt, er hat ein sehr wür diges, sehr radikales Testament in Form eines Briefes an Arnold Zweig hinterlassen. Er litt an Gefäßstörungen, aber vor allem ertrug er es nicht, selbst in Schweden ständig vom Meuchelmord bedroht zu sein. Ernst Toller stand zwei Jahrzehnte lang im Kampf um die Freiheit ganz vorn. Aber er litt an Schlaflosigkeit, dieser Tortur der Torturen. Und während er in Spanien an der Front lag, verließ ihn in New York seine Frau, ein elbisches Wesen, schön und gefährlich. Er mußte fort, er wollte nicht. Weltkrieg im Schützengraben, Revolution in Bayern, viele Jahre schwerster Festungshaft mehr Zuchthaus als custodia honesta - all das verwindet sich nicht. Wie oft er dem Tod listig entgangen war, wenn der ihn schon sein glaubte - immer wieder suchte er ihn. Er war so grimmig entschlossen, weiter für die Freiheit zu kämpfen, daß er keine Waffe und kein Gift besaß, als er unwiderruflich fort mußte. Er hat sich an der Schnur seines Bademantels erhängt, mitten in der Arbeit. Joseph Roth hat sich mit Bewußtsein totgetrunken. Er wollte, er sah alles kommen, was später kam, sein Selbstmord hat fast zehn Jahre gedauert. Sein Geist starb nicht mit, er schrieb sein bestes, ein herrliches Buch, „Trinkerlegende“, als er kaum mehr imstande war, Bücher zu lesen. Egon Friedell hat sich mit seinem Hund aus dem Fenster gestürzt, als die Deutschen eben Wien besetzt hatten und es
386
an seiner Tür läutete. Er war ein wackerer Zecher, ein Lebens genießer und hatte von der Gestapo nicht besonders viel zu fürchten, denn was' er in seiner „Geschichte der Menschheit“ geschrieben hatte, war den Nazis gar nicht sehr zuwider. Walter Hasenclever\ Er schien Grazie und Jugend für hun dert Jahre zu besitzen und war wenig über vierzig. Er hat sich im französischen Lager vergiftet, als die Deutschen an rückten, als einziger! Der Kommandant hatte seinen Internier ten versprochen, alles für ihre Rettung zu tun, und hat sein Wort nach Kräften gehalten. Walter Hasenclever hatte eine schöne Geliebte in Nizza und im Brustbeutel zwanzigtausend Francs. Er war ein Nachkomme von Goethes Schwester und hatte kaum Stellung gegen die Nazis genommen - nicht alle Literaten sind militant. Aber er wußte schon seit langem, seit 1933 und ganz fest seit 1939. daß er nicht zusehen konnte, wie beide Welten, denen er entstammte, in Blut und Bestiali tät untergingen, die Goethes und die seiner jüdischen Groß mutter. Ernst Weiß, ein viel zuwenig berühmter Romancier von Dostojewski-Maßen, war in Paris, als die Deutschen einrück ten. Er war Tschechoslowake, Jude, er haßte natürlich die Nazis. Aber er hatte nichts gegen sie geschrieben - war er be droht? Wahrscheinlich auch, denn er war voll Geist. Über die letzte Epoche seines Lebens weiß ich nichts, nur daß er sie abschloß, indem er sich im Bad die Pulsader öffnete. Aber ich habe ihn zu gut gekannt, um nicht zu wissen, daß ihn die glei chen Motive von hinnen jagten wie Walter Hasenclever. Zu dem stand er ganz allein auf der Welt, arm, krank, ein großer wehr- und waffenloser Dichter. Irmgard Keun hat sich etwa am gleichen Tag wie Ernst Weiß umgebracht. Sie hatte gegen die Nazis geschrieben, aggressiv und geistreich, sie mußte aus dem Leben, da sie im rechten Moment nicht aus Paris geflohen war. Wie hätten sie die zu Tode gequält, die braunen Teutonen! Denn sie kannte sie besser als wir alle, diese deutsche Proletarierin, deren Pfeile immer ins Herz der Hitlerianer trafen. Walter Benjamin, ein skurriler Kopf, witzig und blöd zu gleich, wenig bekannt, sehr arm, hatte die Papiere, um nach 3«7
USA zu flüchten. Er erreichte Spanien, wurde aber zurück geschickt und brachte sich mit Veronal um. Andere haben zweiund dreimal diese Reise hin und her über die französische Grenze gemacht und kamen endlich doch durch. Aber er wollte und konnte nicht mehr. René Scbickele litt an Asthma und hat in einem seiner letz ten Meisterwerke, dem Roman „Flaschenpost“, dargestellt, wie er an der Zeit litt und sterben mußte. „Das war eine schlimme Zeit, Freunde", schrieb er 1918, „und ein zweites Mal würde ich sie nicht überleben.*.* Ich glaube, er war der größte Dichter unserer Epoche, jedenfalls war er der empfindsamste Mensch und der menschlichste. Er litt, was in Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei gelitten wurde. Er schrieb mir in einem seiner letzten Briefe: „Seit der Einnahme von Prag ist meine Atemnot furchtbar gestiegen.“ Wie viele Bücher hätte er noch geschrieben, wieviel herrliche Bücher! Aber eine Bronchitis hatte leichtes Spiel und warf ihn um, denn auch das schrieb er mir 1938, ein Jahr vor seinem Ende: „Ich will nicht mehr.“ Der große Lyriker Alfred Mombert starb 1940 in einem französischen Lager. Über das Ende von Max Herrmann-Neisse (kaum fünfzig Jahre alt), Franz Hessel (ca. 57) und Anton Kuh (50) weiß ich wenig. Herrmann und Hessel waren sehr arme Emigranten, Kuh aber plötzlich in New York ganz groß arriviert und reich, zum ersten Mal in seinem Leben. Er hatte keine Sorgen mehr als das verratene Deutsche Reich und die verratene Mensch heit. Gesund war er, er konnte Hufnägel fressen. Ich glaube, auch diese drei starben, weil sie keinen Sinn mehr wußten, zu leben. Nun aber Stefan Zweig\ Viele haben ihn gescholten, die auch Ernst Toller gescholten hatten, als sein Freitod bekannt wurde. Stefan Zweig, ein Liebling des Glücks sechzig Jahre lang, auch im Exil noch sorglos, bewundert, umhegt, ein Schrift steller, der in zwanzig Sprachen gelesen wurde, er habe kein Recht gehabt, seine Gemeinde, die unsere Welt umfaßte, allein zu lassen. Wer sein Werk besser kannte als die Menge, der schalt ihn nicht. 388
... Menschen ist die große Lust Gegeben, daß sie selber sich verjüngen. Und aus dem reinigenden Tode, den Sie selber sich zur rechten Zeit gewählt. Entstehn, wie aus dem Styx Achill...
zitiert er in seinem Essay über Hölderlin. Und weiter zitiert er: „Oh, gebt Euch der Natur, eh sie Euch nimmt." Dazu spricht Stefan Zweig: „Herrlich rauscht der Gedanke des Frei todes in ihm auf, und schon versteht der Weise den hohen Sinn rechtzeitigen Untergangs, das innere Muß seines Todes: Das Leben zerstört durch Zerstückelung, der Tod erhält rein durch Auflösung im All.“ Er zitiert weiter: Laßt die Freien sich bei guter Zeit Den Göttern liebend opfern. und setzt hinzu: „Nur der Tod kann das Heilige des Dichters retten, den ungebrochenen, vom Leben nicht besudelten Enthusiasmus." Mit solchem Glauben im Herzen seit früher Jugend - wie konnte er eine Zeit überstehen, die jeden Enthusiasmus, jede Phantasie, jeden Traum mit den Bildern einer entmenschten Menschheit besudelte? Diese edlen Selbstmörder alle starben am „inneren Muß des Todes“. Die Dichter Robert Musil und Arthur Holitscber sind in der Schweiz gestorben, Musil nur in Armut, Holitscher im Armen haus. Robert Musil war nach dem Urteil vieler ein Klassiker, dem nur eine ferne Nachwelt gerecht werden konnte. Arthur Holitscher hat wunderbar über ferne Länder berich tet, ein Enzyklopädist an Wissen, ein großer Meister der deut schen Sprache, ein Geist voll Freiheit des Urteils, Kraft und Menschenliebe - wie sehr er sich den Tod ersehnt hat, wie sehr er an dieser Welt litt! ... 1933 schrieb er einen Brief an die „Neue Weltbühne“, der war fast trunken von Traurigkeit, aber
389
nicht über sein Schicksal, sondern über das Schicksal der Menschheit - ein Brief, der wie große Poesie rauschte, späteren Generationen noch zurauschen wird. Von den großen Essayisten der deutschen Republik sind so viele in diesen Jahren gestorben, daß es fast undenkbar scheint, eine neue Generation könnte ganz ohne Führer erstehen. Karl Kraus - Sprachmeister, Sprachkritiker, der stärkste Analytiker vielleicht unserer Zeit, zu dem alle, ausnahmslos, soweit sie großes Deutsch schreiben, in die Schule gegangen sind. Dazu - welch ein Dichter in „Die letzten Tage der Menschheit“! Es wurde schon 19 j 3 Theodor Lessing ermordet, der Philo soph, Essayist, Poet, Pädagoge, der auf Hindenburg und Hitler das Wort geprägt hat: auf jeden Zero der Geschichte folgt ein Nero - lang, ehe Hitler ein Nero war. Als der herrlich denkende Kunsthistoriker Carl Einstein vor der Wahl stand, Hitler oder Laval in die Hände zu fallen, wählte er den Tod - kein anderer Weg stand ihm dorthin offen als tiefes Wasser. Alfons Goldschmidt starb in Mexiko, der National-Ökonom, Universitätslehrer, Kosmopolit, Historiker, Literat - ein Mann von leuchtenden Gaben, der sein ganzes Leben lang gegeben hatte. Rudolf Olden starb, den das wahre, andere Deutschland liebte, der in seiner Trilogie von Biographien „Stresemann“, „Hindenburg“, „Hitler“ - und im Zusammenhang dieser drei Bücher wird man sein Werk „Geschichte der deutschen Solda teska“ nennen - tiefer als all seine Vorgänger in die Entwick lung Deutschlands geleuchtet hat, aufdeckend, warnend, unge hört .. . „Eine Fackel deutscher Freiheit“ nennt ihn Ulrich Becher. Hellmut von Gerlach starb, ein Politik und Geschichte schreibender borussischer Junker, der durch zwei Weltkriege vergeblich, aber unermüdlich und tapfer bis zur Selbstaufgabe für den Frieden gekämpft hat. Das tragischste Ende aber fanden drei Schriftsteller, die edle und gütige Menschen waren, Propheten der Liebe: Ericli Mühsam, Carl von Ossietzky, Armin T. Wegner. 59°
Sie konnten nicht emigrieren, in der ersten Stunde ihrer Machtvollkommenheit schon ergriffen sie die Hitler-Henker und zerrten sie ins Lager der Qualen. Langsam, gierig, ihrem Stöhnen lauschend, wurden sie dort zu Tode gefoltert, ganz langsam, Jahre hindurch.
IV. Dichter im Exil Mein Geist fühlt sich in Frankreich exiliert, in eine fremde Sprache verbannt. Heinrich Heine
Jeder Schreibende ist im Exil, dem das Land seiner Sprache für immer entrissen ist - nicht Wälder und Täler, oh, wie schön, nicht das Vaterland, das teure, sind unsere Heimat, die Sprache selbst ist es, und keine andere kann sie ersetzen. Es gab einen großen Dichter, Max Dauthendey, der die ganze Welt umsegelt hatte, aus jedem Weltteil reiche Ernte, Romane, Schilderungen, Verse nach Hause gesandt hatte. 1914 überraschte ihn der Weltkrieg auf einer paradiesischen SüdseeInscl. Tropische Landschaft, braune Menschen, Urwälder und Lagunen in Sonnenglut - alles war sein. Fern von ihm tobte die Hölle, starben Menschen am Krieg, an Grippe und Hun ger - er konnte eine Friedcnswelt genießen, erforschen, ge stalten, der immer seine Sehnsucht gegolten hatte. Aber kaum zwei Jahre waren vergangen, da starb er an Heimweh, buchstäblich an Heimweh. Eine fast komische Tra gödie - der Dichter der exotischen Welt, kann nicht zwei Jahre die nordische Heimat entbehren? Doch, das hätte er gekonnt, er starb an Heimweh an der nordischen Sprache, nach zärt lichen Worten in dieser Sprache, nach seiner literarischen Welt. Arnold Zweig, Else Lasker-Schüler, Max Brod leben in Palästina. In Kinderjahren schon schlug jedem von ihnen das Herz nach Neu-Zion; sind sie glücklich, sind sie daheim im tiefsten, herrlichsten Sinne les Wortes? Sie widmen sich in Palästina dem Theater in deutscher Sprache, sie schreiben weiter in deutscher Sprache Verse, Er zählungen, Dramen, sie leben wie auf einer Insel. Es dringt 591
selten ein Wort von ihnen in unsere Exilländer, und so viel Jahre haben wir kaum ein neues Buch dieser drei erlebt. Aber vielleicht, und wir hoffen es mit ganzer Seele, ist ihnen die Sprachinsel im Gelobten Land ihrer Sehnsucht wirklich Heimat geworden. Vielleicht ist ihnen die winzige Gemeinde, die aber geschlossen ist, heute mehr ans Herz gewachsen als jene andere, die sie einst besessen, die Hunderttausende zählte? Nach Kafkas Statistik waren es fünfundsiebzig Dichter, Romanciers, Dramatiker, Essayisten und Historiker, die 1933 in Deutschland als prominent und populär gelten konnten. Es mögen mehr, es mögen hundertzwanzig gewesen sein. Fünfundfünfzig von ihnen sind in die Fremde gegangen. Von ihnen tragen fünfzehn die Last des Lebens nicht mehr, die drei in Palästina sind für die weite Welt, für ihre treuesten Leser und Freunde stumm geworden, aber geborgen. - Es bliebe über das Schicksal jener sicbcnunddreißig zu berichten, die über Eng land, die beiden Amerika und Rußland verstreut leben. Mit vier oder fünf Ausnahmen ist ihrer aller Schicksal das gleiche: elend zu sein. Als sie Deutschland verließen, dachte keiner, daß er Abschied fürs Leben nehme. Nicht einmal für Jahre sollte es sein, und jeder gedachte, diese Jahre gründlich auszunützen. Da und dort, in Holland, in der Schweiz, in Paris, Prag, Stockholm, fing man an, deutsche Bücher zu drucken, Manu skripte strömten herbei. Alte Zeitschriften wurden neu gegrün det, die im Exil besser geschrieben wurden als früher, Schrei ben war Dienst, Kampf gegen die Barbarei, fast über die ganze Literatur jener Jahre konnte man das Wort Hcrweghs setzen: Wer noch ein Herz hat, dem soll’s Im Hasse nur sich rühren. Allüberall ist dürres Holz, Um unsere Glut zu schüren. Die Ihr der Freiheit noch verbliebt, Singt durch die deutschen Gassen: Wir haben lang genug geliebt Und wollen endlich hassen!
392
Dann kam der Krieg - von vielen fast herbei gebetet. Jetzt schien auch ihre Stunde gekommen, die Stunde der Barden, der Herzaufwieglcr. Ein halbes Hundert der besten deutschen Federn waren be reit, feurig und freudig, mit allem was das Wort vermag, zur Vernichtung des Hitler-Geistes und der Hitler-Armeen beizu tragen. Gegen einen armseligen Vorstadt-Journalisten englischer Herkunft, der sich (am Stuttgarter Radio) in Hitlers Dienst stellte, stand die ganze Phalanx der Dichter und Essayisten, die das Herz, das Ohr Deutschlands seit langem besaßen! Jeder stellte sich zur Verfügung, drängte ans Mikrophon, in die Presse, wollte Flugblätter und Pamphlete schreiben, Film storte, sein Lied vom Haß durch die deutschen Gassen singen. Da war's, als äffte uns ein Spuk - im Herbst 1939 konnte Goebbels lächelnd eine genau zutreffende Liste der deutschen Schriftsteller publizieren, die in französischen und englischen Konzentrationslagern saßen und ihre Herzen fraßen. Eine dünne Strohschicht bestenfalls als Lager, Kuhfleisch aus dem Blcchtopf als Nahrung, Stachcldraht und Bajonette ringsum davon hätte man nicht gesprochen. Aber nicht dabei zu sein in diesem Kampf, der über die Zukunft der ganzen Welt entschied, verstummen zu müssen gerade zu dieser Stunde, in der der Chorus unserer Stimmen Geschichte bedeutet hätte - das war Jammer, unerklärliches, unverdientes Geschick! Es* saßen damals allein in Frankreich hinter Stachcldrähten oder in einer Art Hausarrest mit striktestem Schweigeverbot: Heinrich Mann, Franz Werfel, Leonhard Frank, Lion Feuchtwanger, Fritz von Unruh, Alfred Döblin, Friedrich Torberg, Walter Mehring, Wilhelm Speyer, Alfred Polgar, Annette Kolb, Robert Neumann, Alfred Wolfcnstcin, Rene Schickclc, Irm gard Kcun, Franz Hessel, Anna Scghcrs, Theo Balk, Bodo Ulise, Rudolf Leonhard, Hermann Budzislawski, Professor Gumbel, Arthur Kocstlcr und viele andere, darunter ich, indes mein Bruder Rudolf Olden und seine Kollegen in England fast das gleiche Schicksal litten. Als Dünkirchen geschlagen war, die Nazis halb Frankreich
39?
besetzten, hoben viele dieser Läget sich spaltweis auf. Im Strom von Millionen zu Nomaden gewordener Franzosen trie ben wir über die Landstraßen des von den Deutschen besetzten süßen Frankreich, Bettler, denen Folter und Schafott drohten. Dann, im „freien Frankreich“ angekommen - was stand da in der Zeitung? Die Regierung Pétain hat sich verpflichtet, uns alle - jeden von uns, den Hitler verlangte - an ihn, den grausamsten aller Todfeinde, auszuliefern ! Und wir dachten - aber mit Neid! - der Toten, der Toten. In New York, Hollywood, London, Mexiko, Moskau haben sich kleine Zentren gebildet, in denen eine Gruppe literarisch interessierter deutschsprachiger Menschen sich um je sechs bis acht deutsche Schriftsteller schart, Vorträge hört, wo dann und wann ein Buch gedruckt, eine Theateraufführung veranstaltet wird, eine mit Not und Sorgen ringende Zeitschrift erscheint. Emil Ludwig, Lion Feuchtwanger in Hollywood, Thomas Mann und Franz Werfel in New York sind am Arbeitstisch geblieben nach allen Stürmen, die sie umbrausten. Sie haben zu sich zurückgefunden, produzieren wieder Buch um Buch, in das die schreckliche Gegenwart nicht schattet, wahren nach Kräften die heilige Flamme. Werfels „Heilige Bernadette“ war ein Welterfolg und ist gewiß das holdeste, zugleich stärkste und liebenswerteste sei ner Bücher. Entstanden in wenigen Monaten, ehe noch die Wunden geheilt waren, die sein Herz auf der Flucht aus Frankreich erlitten hatte. Auch Vicky Baum lebt und schafft in Hollywood, ist aber keine deutsche Schriftstellerin mehr. Sie hat es gelernt, englisch zu denken und zu schreiben - „Ein Fluch dem falschen Vater lande .. .“ Heinrich Mann hat sich mit fast siebzig in die Tretmühle der Kino-Produktion gewagt, wo nur wenige der jüngsten Emigranten prosperieren. „Vorläufig bin ich beauftragt, Filme zu schreiben. Sogar ein Roman wurde mir erlaubt, unter Vorbehalt der Verfilmungs rechte, als Gegenleistung. Gedreht wird nicht, gedruckt auch nichts mehr; man schreibt unter Ausschluß der Öffentlichkeit, 394
wie einst mit zwanzig Jahren“, sagte er in einem Brief. „Da gegen hätte ich nichts einzuwenden, das Hervorbringen erhält den Arbeiter doch bei Mut und Kraft. Nur kann die Verwen dung von uneinträglichen Mitarbeitern schwerlich sehr lange dauern. Außerdem sind dies Zeitläufte, in denen man sich nütz lich machen möchte.“ Noch ein trauriges Wort steht in diesem Brief des großen, tapferen Poeten: „Sie haben dort Wein, ich kenne seit Frank reich nur den Bodensatz und die Erinnerung - an manches außer dem Wein.“ Inzwischen war auch das kleine Einkommen eines „uneinträglichen“ Filmautors, dem ein Roman „erlaubt wurde“, für ihn Erinnerung. Aus New York schreibt mir Oskar Maria Graf, sein bestes Buch, „Das Leben meiner Mutter", sei englisch erschienen, und er habe in drei Jahren kaum zweitausend Exemplare verkauft. „Ich schreibe natürlich unentwegt. Drei Romane sind inzwi schen fertig geworden, aber von Anbringen keine Rede mehr. Ist ja auch ein wenig komisch, zu denken, daß so was inter essiert. Ehrlich gesagt, ich bin aber verliebter in fertige Manu skripte als in veröffentlichte Bücher." Aus London schrieb mir Joe Lederer, deren Bücher - eine stattliche Reihe, in wenig Jahren entstanden - in fünf Spra chen entzückte Gemeinden fanden und noch heute in den Leih bibliotheken größte Attraktion sind. „Dann tauchte Leslie auf und mit ihr eine anonyme Spende von fünfzig Pfund, damit ich ein Buch schreiben kann. Was ich auch tat. Aber wie der Roman in der ersten Hälfte war, kam der Fall of France. Und ich bin in einen Abgrund von Verzweiflung gesunken, von Romanschrciben war keine Rede. Nach der Verzweiflung kam eine tierische Apathie, und nach der Apathie kamen die Bom ben. Inzwischen war ich aber eine der besten Silberputzerinnen geworden, perfekt im Servieren, Badewannen saubermachen und schmutzige Taschentücher aufklauben." In Mexiko schaffen Ludwig Renn, Theo Balk, an ihrer Spitze Anna Scghers. Sie alle haben Höllen durchschritten und immer gewußt: „Eh diese Hand in Asche stirbt, soll sie vom Schwert nicht lassen.“ Es sei denn, daß sie das Schwert mit der Feder vertauschten.
395
„Das Siebte Kreuz“ von Anna Seghers ist das erste Werk unserer gesamten Aufklärungsliteratur, das in der großen Welt Wirkung tat, ganz visionär, herzerbebend als Leistung, qual voll zu lesen. Denn es schildert Grauen und Jammer der deut schen Arbeiter im Konzentrationslager wie in der „Freiheit“. Davon wollte und wollte das Publikum nichts wissen, zehn Jahre lang, ob wir uns die Finger krumm schrieben, die Kehle blutig schrien. Jetzt hat diese Dichterin Anna Seghers durch die Macht ihrer Sprache all die tauben Herzen gezwungen wie einst die Dichterin von „Onkel Toms Hütte“ -, einfach gezwungen, zuzuhören und mitzuleiden. Im Kriege gegen Hitler wiegt dieses Buch schier ein Luftgeschwader auf, denn es wird in Hunderttausenden gekauft, fand dabei Millionen von Lesern und wird verfilmt.
V. Die Zukunft Verkauft, besiegt, verraten Sind unsre besten Taten Wie Träume leer und hohl Und lassen keine Spuren. Platen
Jede Literatur braucht ihren Boden, ihr Volk, ihre Tradition. Die Toten müssen zu den Lebenden, die Alten zu den Jungen sprechen, in Schulen und Hochschulen müssen sie gemeinsam erzogen werden, Schaffende und Genießende. Seit zehn Jahren lehrt keine deutsche Schule mehr: Bücher lesen und die Götter ehren - es seien denn Bücher voll Schwert geklirr und Götter, die sich dick saufen an Menschenblut. Wenn diese Not einmal gebrochen, in diese Polarnacht deut scher Menschheit wieder der Strahl junger. Sonne fällt - wo werden die Saaten liegen, die sie reifen möchte? Was Anna Seghers einen Arbeiter-Märtyrer im Lager über die deutsche Arbeiterbewegung denken läßt, das gilt auch von der Literatur in Deutschland. „Was beinahe nie in der Geschichte geschehen war, aber schon einmal in unserem Volke, das Furchtbarste, was einem Volk überhaupt geschehen kann, das sollte jetzt uns geschehen:
J96
ein Niemandsland sollte gelegt werden zwischen die Genera tionen, durch das die alten Erfahrungen nicht mehr dringen könnten. Wenn man kämpft und fällt und ein anderer nimmt die Fahne und kämpft und fällt auch, und der nächste nimmt sie und muß dann auch fallen, das ist ein natürlicher Ablauf, denn geschenkt wird uns gar nichts. Wenn aber niemand die Fahne mehr abnehmen will, weil er ihre Bedeutung gar nicht kennt? Da dauerten uns die Burschen, die Spalier standen zu Wallaus Empfang und ihn bespuckten und anstierten. Da riß man das Beste aus, was im Lande wuchs, weil man die Kinder gelehrt hatte, das sei Unkraut. All die Burschen und Mädel da draußen, wenn sie einmal die Hitlerjugend durchlaufen hatten und den Arbeitsdienst und das Heer, glichen den Kindern der Sage, die von Tieren aufgezogen werden, bis sie die eigene Mutter zerreißen.“ Wie lange wird es dauern, bis aus dieser zum Wolfsrudel gewordenen Jugend wieder Dichter erwachsen? Hitlers „Juda, verrecke!“ hat zugleich bedeutet: „Deutsche Kunst, deutsche Literatur, verrecket!“ Unter den größten deutschen Schriftstellern unserer Genera tion ist ein bedeutender Prozentsatz von Juden, sie werden keine Nachfolger haben. Von den Theater- und Kunstenthusiasten der abgelaufenen Epoche aber, von den Bild- und Bücherkäufern, den TheaterMäzenen, den Organisatoren des Literaturwesens, den Lesern, den Helfern und ergebenen Freunden der Künstler, ist der Prozentsatz der Juden überwältigend. Da haben sie sich wirk lich vorgedrängt, wo es galt, Talente zu entdecken, zu fördern, das Genie zu feiern, die Wankenden zu stützen, Opfer zu bringen - in allen Ländern, allen Sprachen! Im deutschen Land, in der -deutschen Sprache werden sie es nicht mehr tun können, denn sie sind nicht mehr. Was aus ihrem Samen dennoch nachsprießen mag - das Deutschtum wird von ihrer Glut, ihrer tätigen Liebe, ihrer Passion für das Schöne nichts mehr haben. Wenn es einmal wieder deutsche Genies der Kunst gibt, sie werden hungern und frieren müssen, wie es die deutschen Genies vor der Emanzipation der Juden in Deutschland taten. 397
Das furchtbarste Buch der Weltgeschichte
Ein Schwarzbuch über den Naziterror in Europa ist.vor kur zem in Mexiko erschienen und zur Besprechung in meine Hände gelegt worden. Ich hätte es, wie gerne, nicht gelesen! Von all dem Grauen, dem Rückfall in eine Urwaldbestialität, die auch der Urwald selbst nur bei sehr tiefstehenden' tierischen Wesen, nicht bei den sogenannten Raubtieren kennt, weiß ich ja schon seit einem Jahrzehnt, und schon vor einem Jahrzehnt habe ich es als heilige Menschen pflicht empfunden, die Augen nicht zu schließen, die Gärten der Qual mit zu durchwandern, und soweit meine Stimme drang, hinauszuschreien, was ich wußte. Wie taub die Welt sich zeigte, die Welt der demokratischen, der freien Repu bliken, wie kühl bis ans Herz hinein gegen das abgrundtiefe Leid ihrer Mitkreatur sie war - das weiß sie heute und das büßt sie heute. Denn hätte sie uns gehört, hätte sie menschlich empfunden - wie damals etwa, als Sir Roger Casement sie an rief zum Schutz der Kongoneger und der Putumayo-Indianer -, dann wäre ja dieser Krieg gar nicht gekommen, dann hätte man den Folterknechten schon vor zehn Jahren den Kopf vor die Füße gelegt, hätten Molotow, Eden und Hüll vor zehn Jahren in Moskau an einem Tisch gesessen! Die dreißig oder vierzig Millionen Menschenleben, die dieser Krieg verschlingt, das biß chen Glück, Heim und Arbeitsruhe von einer halben Milliarde Menschen aller Nationen, Farben, Bekenntnisse war ja so leicht zu erhalten! Hinter dem höllischen Anschlag war damals gar keine Kraft, stark wurde der Höllenhund nur durch die er bärmliche Gleichgültigkeit des menschlichen Herzens. Diese Pflicht mit zu leiden und Mitleid zu geben, ist in die 598
sen zehn Jahren nicht erloschen, auch das Schwarzbuch mußte ich lesen, abermals in den Brunnen der Schmerzen tauchen, das furchtbarste Buch der Weltliteratur studieren. Alle guten Geister unserer Zeit haben daran mitgearbeitet, die Staatspräsidenten von Mexiko, Peru und der Tschechoslowa kei, die besten Schriftsteller und Zeichner aller Länder, und so ist in Wort und Bild ein Panorama des heutigen Europa ent standen - kommenden Generationen wird es schwer sein, zu glauben, daß der Dreißigjährige Krieg, wie Grimmelshausen ihn beschrieben hat, eine Felddienstübung der Umpenschlichkeit war, verglichen mit diesem Krieg. Das Schicksal, das Hitler zuerst nur den Juden und den deutschen Antifaschisten gebracht hatte, ist nun auch den Fran zosen und Belgiern und Holländern und Russen und - und-ist aber und aber Millionen von Menschen geworden. Man spricht viel von Lidice, der böhmischen Stadt, deren Bewohner restlos vertilgt und deren Mauern gestürzt wurden, aber es gibt im Osten Europas Hunderte von Lidices. Statistiken erscheinen in diesem Buch - die Zahlen lohen und rauchen zum Himmel wie Scheiterhaufen. Dennoch blieb wohl dem Volk der Juden das höchste Maß an Leid zu tragen, von Hunderttausenden sind in vielen Ländern kaum Hunderte am Leben geblieben, das Los der meisten war verhungern,, vergast, erschossen, zu Tode gefoltert werden. Und wieviel Tapferkeit haben sie oft gezeigt! In Warschau waren dreiundneunzig Judenmädchen gesammelt worden, um ein Nazi-Bordell zu füllen, amtlich verfügte „Rassenschande“! Sic wurden in ein Palais gesperrt, bekamen warme Bäder, seidene Nachthemden, die Säle waren hell erleuchtet, die Bet ten festlich. Aber sie hatten sich mit Gift, versehen, und ehe die Soldaten kamen, tranken sie das Gift alle dreiundneunzig. „Heute waren wir vereint und haben einander den ganzen Tag die letzte Beichte abgenommen. Unser letztes Bad war unsere Purification vor •dem Sterben. Wir haben keine Angst. . .“ Das schrieb eine der dreiundneunzig in einem Abschiedsbrief, der durch die Mauern der lichterfüllten Gruft die Menschheit erreichte. Ein Brief, würdig neben dem letzten Brief von 399
Gabriel Peri zu stehen, dem kommunistischen Helden und Märtyrer Frankreichs, in dem cs heißt: „In wenig Minuten werde ich als Geisel erschossen werden. Zum letzten Mal habe ich mein Gewissen geprüft. Das Resultat ist äußerst positiv. Wenn ich mein Leben noch einmal beginnen müßte, ich würde denselben Weg gehen.“ Noch furchtbarer als alle Worte in diesem Schwarzbuch wir ken etliche Photos, die von todesmutigen Amateuren gemacht und über die Grenzen, die Meere geschmuggelt wurden. Bil der von Massen Erhängter, Bilder von Haufen Verhungerter, Bilder von Hekatomben Verbrannter und Erschossener aus Polen, aus der Ukraine, aus Weißrußland. Zu Tode gefolterte Kriegsgefangene, ermordete Frauen, denen man die Kleider vom Leib gerissen hat, ehe die Kugeln sic zerfetzten. Kleider, die als Liebesgabe nach Deutschland geschickt wurden. Es ist furchtbar schwer, wenn man dies Buch erlitten hat, überhaupt noch zu glauben, daß Deutschland Gnade verdient cs scheint, als sei diese Soldateska das deutsche Volk und müsse vertilgt werden. Es schiene so, hätten wir Deutsche selbst nicht unsere Hun derttausende von Märtyrern, von mit dem Hackbeil Geköpf ten, von Erhängten, durch die Zuchthäuser und Konzentra tionslager Gegangenen. Sic sind es, meist blutige Schatten, die dennoch für Deutschland zeugen. Freilich - es wird viele Jahrzehnte dauern, ehe ein Volk von systematisch Entmenschten wieder zu Menschen erzogen ist, und wir müssen Ströme von Blut vergießen, um alle auszu rotten, die sich als unheilbar, als Schänder des Menschen gesichtes erwiesen haben.
400
Lang, lang ist’s her
Mein lieber Egonek, etwas Ähnliches ist mir kürzlich auch passiert, aber es ging sänftlich vorbei, und die Wunde ist schon ziemlich vernarbt. Dein Dies Irae fällt zudem in eine Epoche, in der alle Glocken der Welt läuten und alle Böller böllern werden - genieße den Freudentaumel als einer, der diesen Sieg mitfeiern darf als braver Kombattant mit vielen Dienstjahrzehnten. Meine Glückwünsche gelten aber vor allem dem guten Freund und Genossen vieler Schicksale. Vielleicht sind wir die letzten aus der Bande, deren Haushalt vor vierzig Jahren das Café des Westens am Kurfürstendamm war und die einander nicht aus den Augen ließen, zumindestens bis - 1933. Denk Dir einen schlanken, fußballtrainierten Egonek mit einem Bubengesicht und über der schwarzen Haarflut einen sehr staubigen Zylinder, der von Temperament sprühte, voll der Kraft zum Haß, der Macht zur Liebe war, und dem es in jedem Satz zustieß, daß statt der vorbedachten Sentenz ein blühender Witz seinem Mund entsprang - so hab ich Dich in frühester Erinnerung, und dies Bild hat sich nicht verwischt, als ich Dich mit einem Bauch, grauen Haaren und ohne Zylin der zum letztenmal sah. Es hatte sich auch außer diesen Äußer lichkeiten nichts an diesem Kisch verändert, dessen Lippen und Füllfedern flössen, als säße er immer am Kastalischen Quell. So wirst Du wohl auch heute noch sein, nachdem ich Dich geschlagene fünf Jahre nicht gesehen habe, Du Beaujolais 1923 unter den Kerlen! Ach, diese Kerle, wenn doch noch ein paar von ihnen übrig blieben und wir in irgendeiner Spelunke von Berlin oder Wien 26
Paradiese
401
wieder unsere cénacles wie im Café des Westens bilden könn ten ! Oder wenn neue heranwüchsen - aber wie sollte aus dieser Generation verbildeter, verprügelter, auf Mord dressierter Buben ein Erich Mühsam, ein René Schickele, ein Rudolf Jo hannes Schmied, Benno Bernais, Moissi, Steinrück, Georg Heim, Ferdinand Hardekopf, van Hoddis, Rudolf Olden, Egon Erwin Kisch herangären? Den Leonhard Frank gibts noch, vielleicht die Lotte Pritzel und den Ali Hubert. Heinrich Mann und Alfred Polgar, Carl Rössler, Roda Roda zähle ich deshalb nicht in dieser Kategorie, weil sie schon lang vor uns im Café des Westens saßen. Der große Pan erhalte sie ! Einen besonderen Dank schuldet die Zeit Dir für das, mein Kisch: NIE bist Du ein rasender Reporter gewesen, der Spal ten in die Maschine feuert. Du hast von Kind auf unser Hand werk feierlich ernst genommen, Du hast immer gearbeitet, daß der Schweiß rann. Welche Sünde sonst Dein Gewissen drücken mag - der deutschen Sprache hast Du in jedem Satz treu und züchtig gedient. Ein Ichthyosaurus prustet dem andern - hoffnungsvoll, trotz des Sieges - seinen Glückwunsch zu! Grüße die Gisl! Dein Balder
Anhang
Nachwort
Ende 1938 hatte Balder Olden (1882-1949) ¡m Schutzverband Deutscher Schriftsteller vor Freunden und antifaschistischen Emigranten in Paris aus dem entstehenden Manuskript seiner Autobiographie „Stationen meines Lebens" gelesen. Von früher, verwöhnter Kindheit in einem bürgerlich-liberalen, boheme nahen Milieu war da die Rede, von grauer Gymnasialzeit in Regensburg, deutschen Oberlehrern, charmanten Gouvernan ten ... Bodo Uhse, einer der Zuhörer und aufmerksamer Beobach ter der Veranstaltung, hielt den Stil der Proben für „lyrisch, doch völlig unsentimental, draufgängerisch und überlegt, dia lektisch - wenn auch bei weitem nicht im materialistischen Sinne“. In der „Neuen Weltbühne", unter der bezeichnenden Überschrift „Vorfreude auf ein Buch", lobte er bald darauf an seinem Verfasser „Optimismus“, „Unverdrossenheit des Ge müts" und die seltene Fähigkeit, sich „den Blick für die Schön heit der Welt zu bewahren“, auch wenn die Welt zu dieser Zeit alles andere als schön war. Er wollte mehr erfahren, „sehen, was diese Augen gesehen“, wissen, „wie dieser Mensch erlebt hat - den Untergang der Republik, die Emigration, Prag, Paris, Moskau, das Leben als Emigrant, als Dichter und als politischer Kämpfer“. Bodo Uhse ermutigte den Kame raden aus dem bürgerlichen Lager: „Um des streitbaren Huma nismus willen, der das Wenige, was wir kennen, durchklingt, wollen wir das Ganze hören. Glauben wir nicht als Paten in seltsamer, aber förderlicher Vereinigung Ulrich von Hutten und Heinrich Heine zu erkennen?" Der Zeitpunkt für Oldens Lesung ist bemerkenswert, eigent-
405
lieh selbst schon wieder Station: Ein Flüchtling, ein Emigrant, ein Heimatloser im vollen Hintersinn des Wortes, vergewisserte sich hier in einem Augenblick seiner Herkunft und seines Da seins, in dem die politische Wirklichkeit die Abenteuer seiner Jugend durch die unerbittliche Ernsthaftigkeit der Ereignisse weit übertraf. Olden wie Uhse müssen sich damals der Relationen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Bedrohungen der nahen Zu kunft bewußt gewesen sein, sonst hätte der eine nicht so inten siv das zurückliegende Leben befragt und der andere sich Zeit genommen, ein Buch, noch nicht zu Ende geschrieben, öffent lich mit solcher Aufmerksamkeit, solchem Wohlgefallen zu bedenken. Die Entstehungsgeschichte dieser Autobiographie zu rekon struieren ist schwierig. Keinesfalls handelt es sich um ein „Memoirenbuch“, das der Autor an ruhigem Lebensabend, er innernd, in einem Zuge heruntergeschrieben hat. Balder Olden war immer auch ein wahrheitsbesessener Reporter und Journa list, unmittelbar beteiligt, mit Herz und Verstand engagiert. Viele größere publizistische Arbeiten (Reiseberichte, Fortset zungsreihen aus Krieg, Gefangenschaft und Lager) wurden von vornherein in Form persönlicher Erlebnisberichte entworfen. In den zwei Jahrzehnten vor 1933 und in der Emigration ent standen kürzere autobiographische Skizzen, Bekenntnisse, Pole miken, Würdigungen und Epitaphe, die in ursprünglicher oder veränderter Fassung in das unvollendet gebliebene Manuskript „Stationen meines Lebens" eingegangen sind. Ihr Verfasser verstand sich - selbst dort, wo er als „rich tiger Erzähler“ auftrat - gern als Dokumentarist. Er wollte „nicht mehr Phantasie haben als nötig“, seinen „eigenen Augen und Ohren glauben zu können“, wollte ein Fachmann sein, „der sein Material kennt wie irgendein treuer Professionist“, und verlangte, daß ein „solider Dichter“ mit „Zentimetermaß und Kurszettel, mit allem Rüstzeug kleinbürgerlichen Krämergeistes“ an sein Handwerk zu gehen habe. Nach Erscheinen des CarlPeters-Romans (1927) schrieb er: „Bei mir wird nichts erdich tet, nichts erfunden I So tief ist mein Respekt vor der Kreatur, die ich schildern muß, weil es mein Beruf ist, daß ich sie selten,
406
ungern Worte sprechen lasse, die ich nicht wirklich einmal gehört. Ehe bei mir ein Kerl auftreten darf, muß ich seinen ganz individuellen Geruch in der Nase haben wie ein Hund den vom Wild, weiß ich in seinem Hirn und in seinem Porte monnaie Bescheid und schwindle ihm auch nicht eine schöne Idee oder eine Mark mehr hinein, als er wirklich besitzt.“ Neben der „Exotik des Realen“ - „die Tatsachen jeden Tages sind so ungeheuer, die Fäden im Gewebe des Lebens so bunt“ - hat Balder Olden der „Urwald der Gefühle“ von je interessiert. Emotional orientiert, von einer jungen Mutter (in der Familie respektlos-liebevoll „das Hühnchen" genannt) erzogen, lebenslang mit der um zwei Jahre älteren, klugen und schönen Schwester Ilse innig verbunden, empfand sich der Autor in einer ohnehin exzentrischen Umgebung als Enfant terrible, das vorläufig nirgendwo recht einen Platz fand. Olden äußerte von Zeit zu Zeit die Absicht, seine bewegte Vita als Familien- und Zeitgeschichte zu Papier zu bringen. Als Hedwig Liechtenstein, eine Tante mütterlicherseits, starb und Schwester Ilse ihm einen Waschkorb mit Briefen der hochbe gabten, eigenwilligen Frau überließ, sprach er davon, Auszüge aus der Familienkorrespondenz in „sein Buch“ aufzunehmen, sollte er vielleicht - „nicht doch zu bescheiden sein“. „Viele Nächte habe ich schon über Tante Hedwigs Briefen zugebracht, eine tief erregende Lektüre“, heißt es am 5. De zember 1937 in einem Brief aus Le Lavandou an die Schwe ster Ilse Seilern. „Wirklich, für mich kann es kein zweites Buch wie dieses geben. Obwohl ich viel mit ihr zu hadern habe... es ist sehr gut, daß Du mir diesen Korb mit Briefen mit gegeben hast.“ Ein Jahr darauf besaßen die Emigranten in Frankreich Kenntnis von der begonnenen Autobiographie Bal der Oldens. In den eigenen Briefen, auch in den wenigen, die in unseren Band aufgenommen werden konnten - oft mit dem Bleistift geschrieben und in einer steilen, nervösen Handschrift verfaßt zeigt sich Balder Oldens leidenschaftliche, tempe ramentvolle, ganz dem Partner zugewandte, jedoch auch häufig von widersprüchlichen Stimmungen und anhaltenden Depres sionen erfaßte Persönlichkeit. In „Höllental meiner Jugend" hat Balder Olden aufgezeich407
net, was ihm widerfuhr, ehe er das Dienstjahr in der kaiser lichen Armee absolvierte. Obgleich er Protektionen genoß, die ihn vor Korporalswillkür schützten, sah er bald „die Wurzel allen Übels“ in der Kaserne, „in der man fromme, stille Kna ben aus dem Schwarzwald zum Morden dressierte, in der sic wie Hunde verprügelt, zum Stehlen und Lügen abgerichtet, ihrer Zartheit entkleidet“ wurden. Trotz peinigender Erfah rungen bedauerte er seine Dienstzeit nicht. Sie zwang ihn zum Nachdenken über die Machtverhältnisse im Wilhelminischen Deutschland, entwickelte seinen Gemeinschaftssinn und sein Gerechtigkeitsgefühl. „Ganz oben“ und „ganz unten“ erwarb er sich früh einen sicheren Blick für das Soziale und Politische, für die Klassengegensätze der Welt. Verstört, doch entschlossen, Seelentorturen nicht hinzuneh men, skizzierte er 1901/02 ein Dutzend auf rüttelnde, ankläge•rische Geschichten, vorläufig betitelt: „Aus dem preußischen Rekrutenleben“. Hans Olden, der Vater, damals „auf der Höhe seiner Laufbahn“ und gerade im Begriffe, noch einmal zu hei raten, wollte den unbequemen Sohn für die Bierbrauerei ge winnen und mit einem Scheck nach Amerika dirigieren. So entstanden die spontan-antimilitaristischen Erzählungen im Hinterzimmer der Grunewald-Villa seiner Tante Melanie von Tempsky, einer Wagner-Sängerin, der Olden manches ver dankte: „Oft saß sie bis tief in die Nacht am Flügel und sang, ganz allein für mich, sie, die Künstlerin, deren Ruf große Säle füllte.“ Die Geschichten fanden vorerst keinen Verleger. Mehr aus Verlegenheit denn aus „Berufung“ wurde Balder Olden neben Norbert Jacques Volontär an der „Oberschlesischen Grenz zeitung" in Beuthen. Ein halbes Jahr Schlesien, wieder ein halbes Jahr Berlin, dann avancierte der Zweiundzwanzigjährige zum Feuilletonredakteur einer angesehenen demokratischen Zeitung in Hamburg. 1905 erschien die erste Buchausgabe eines Teiles seiner Erzählungen unter dem Titel „Aus der Mannschaftsstube". Nachdrucke in der liberalen Presse folgten. Das Buch erschien auf einer Liste der in den Kasernen ver botenen Literatur. Richard Dehmel, Detlev von Liliencron und Gustav Falke 408
empfingen den jungen Autor und ermutigten ihn zur Schrift stellerei. 1905 entstand sein zweites Buch, „Der Hamburger Hafen“, in der Reihe „Großstadtdokumente“ bei Hermann Seemann Nachfolger, Berlin und Leipzig, mehrmals verlegt. In den Skizzen über typische Gewerbe und Lebensumstände zeigte sich ein ausgesprochen kritisch-realistisches Talent. Hier fanden sich schon die prägnanten Stimmungsbilder und deutlich umrissenen Charaktere, die Balder Oldens ernstzunehmende Romane später auszeichneten. Der junge Literat genoß die An erkennung, Kontakte zu Gleichgesinnten stellten sich her. Im Herbst 1906 wanderten er und sein Bruder Rudolf, die „schöne Schwester Ilse und das charmante Oldenmütterchen“ mit Carl Sternheim und „anderen vergnügten Leuten“ durch den „laub bunten Schwarzwald“. Auch die viele Krisen überdauernde Freundschaft zu Egon Erwin Kisch reicht in diese Jahre zurück. Noch nach dem zwei ten Weltkrieg erinnerte sich Olden seines gemeinsamen Haus halts mit Kisch in einem Atelier in der Nähe des ehemaligen Cafés des Westens in Berlin. Hier ging es laut und verrückt zu wie auf der Börse. In den verschiedenen literarischen Rich tungen behaupteten sich nur die ausgeprägtesten Talente. Olden besaß wohl ein Ohr für die Nöte einfacher, unterdrückter Kreatur, aber weder sicheren Kunstgeschmack noch das Vor bild bestimmter literarischer Traditionen. So entstanden nach dem hoffnungsvollen Debüt zwischen 1905 und 1914 auch meh rere flache, in ihrem Stil dem gefällig-gekünstelten Unterhal tungston höherer Töchter und gelangweilter Lebemänner an gepaßte „Gesellschaftsromane“, goldschnittig, unerheblich. Auch später, als er sich längst als „seriöser“ Schriftsteller bestätigt sah, schrieb Olden für große kapitalistische Verlagshäuser marktgängige Unterhaltungsromane. Als sein eigentliches Metier betrachtete er vor 1914 die Reisereportage. Im Auftrag der „Kölnischen Zeitung“ plante Olden 1913 eine Weltreise. Überzeugt von den kulturfördern den Wirkungen des internationalen Handels und den angeblich grandiosen Möglichkeiten, die ein klug und tolerant verwalte tes Kolonialreich nicht nur der Wirtschaft seines Mutterlandes eröffnen könnte, brach er auf. Der Krieg überraschte ihn in 409
Ostafrika. An Heimkehr war nicht zu denken. Als einer der achtzig Patrouillenreiter des Generals Lettow-Vorbeck kämpfte Balder Olden zwei Jahre in den Reihen der sogenannten deut schen Schutztruppe, deren Brutalität legendär wurde, im Gebiet um den Kilimandscharo. 1916 geriet er nach schweren Kämpfen in englische Gefangenschaft. Vier Jahre verbrachte er hinter Stacheldraht, zwei davon in einem englischen Lager in Ahmednagar (Nordindien). Briefe an Verwandte und Freunde aus dem Jahre 1917 sprechen von seelischen Erschütterungen, Mala ria-Anfällen und Hoffnungslosigkeit. Den Zusammenbruch des Kaiserreichs und den Auftakt zu entscheidenden Veränderungen in Deutschland konnte er nur von fern verfolgen. Das Jahr 1919 erschien ihm wie ein Hexen kessel. Zurückgekehrt aus Ahmednagar, erlebte B. O. die Konsolidierung der alten Verhältnisse im Schutz der neuen Republik. Die Folgen imperialistischer Politik hatte Olden im afrikanischen Kolonialkrieg aus nächster Nähe erfahren. Seine Abneigung gegen Drill und Unterwerfung griff über auf das ganze System, schwächer entwickelte Völker in Abhängigkeiten zu zwingen, wirtschaftlich auszurauben und ihren Widerstand in Strömen von Blut zu ersticken. Im April 1920 erschien im Unterhaltungsblatt der „Kölni schen Zeitung*' Oldens Erlebnisbericht „Weltbummel in Eisen". Mit dieser Darstellung begann eine Periode ernsthafter Selbst verständigung, als deren vorläufiges Ergebnis der Roman „Kilimandscharo“ (1922) zu betrachten ist. Hier wurde schon die schaurig-barbarische Szene sichtbar, auf der die Interessen gegensätze zwischen den Kolonialmächten England und Deutschland im ersten Weltkrieg auch in Ostafrika ausgetragen wurden. Die kritiklose Beschreibung des fragwürdigen, bruta len Kameradschaftsgeistes der Männer um Lettow-Vorbeck und Anleihen vom „edlen“ Kolportageroman haben das Schick sal des Buches besiegelt. Keinesfalls aber ist es nur Reminiszenz an „alten Afrikanergeist" und „die versunkene Schönheit wil der Tropennächte“. Viel später, auf der Flucht vor den Hitlertruppen in Frankreich, hat Olden betont, daß mit diesem Roman seine eigentliche literarische Tätigkeit begann. 1922 wär der Schriftsteller vierzig Jahre alt. In der Geschichte
410
der Kolonialisierung Afrikas fand er sein spezifisches Thema. Die nächsten acht Jahre reiste er mit kürzeren Unterbrechun gen von Kontinent zu Kontinent. Bald kannte er sich bei den Lappen so gut wie bei den Bantu-Negern aus. Er reiste, um zu schreiben, und schrieb, um zu reisen. Nur selten finanzierten illustrierte Blätter seihe Touren. Gern hätten sie aus ihm einen Starfeporter gemacht, der dem Sensationsbedürfnis ihrer Leser durch geschickt dosierte Berichte immer neue Nahrung gibt. Olden hingegen wollte mit seinen Schilderungen der Lebens gewohnheiten anderer Nationen und anderer Rassen kein Schaugeschäft betreiben. „Was sie essen, wie sie’s erwerben, was sie besitzen, was sie sich wünschen..das interessierte ihn auf allen Erkundungsfahrten ins Unbekannte und Frenide. Sein Peters-Roman „Ich bin Ich“, 1927 erschienen, machte ihn weithin bekannt. Thomas Mann beglückwünschte ihn „zu seinem sehr glücklichen Wurf“ und „einer künstlerischen Ener gie, die der aktiven Ihres Helden würdig ist“. Das war ein zweischneidiges Lob. Denn das Jahr 1927 war auch das Jahr des ersten Internationalen Kongresses gegen Kolonialismus und Imperialismus, der auf Initiative der Liga gegen koloniale Unterdrückung in Brüssel stattfand. Dort arbeiteten bekannte bürgerliche Antimilitaristen mit Kommunisten oder der KPD nahestehenden Persönlichkeiten Hand in Hand. Sie wußten, daß der Sieg der Oktoberrevolution in Rußland die Periode des antiimperialistischen Befreiungskampfes eingeleitet hatte, und erblickten in der „Aufklärung weitester Kreise über den Charakter der Kolonialpolitik und ihre Wirkungen auf unter drückende und unterdrückte Völker“, in der „Durchführung von Protestaktionen gegen alle Gewalttaten des Kolonialismus“ ihre vornehmste Aufgabe. Die Frage, ob der Anspruch auf Kolonialbesitz ethisch und historisch zu rechtfertigen sei, hatte die bürgerliche Friedensbewegung und die ihr nahestehende Presse seit 1925 verstärkt beschäftigt. Im Oktober 1928 gelang es der Generalversammlung der Deutschen Friedensgesellschaft in Erfurt, eine Resolution anzunehmen, in der das angebliche „Recht eines Volkes auf Herrschaft über andere Völker“ ein hellig abgelehnt wurde. Zur gleichen Zeit forderten Vertreter des deutschen Monopolkapitals lautstark die Rückgabe ehe-
4i i
maliger deutscher Kolonien, alte und neue Kolonialgesellschaf ten starteten einen Propagandafeldzug großen Stils. In dieser Situation erschien Balder Oldens Peters-Roman eine differenzierte Studie zur Mentalität des deutschen „ÜberMenschen“ und „Vor-Nazis“, in der besonders die Darstellung der ideologischen Affinität des imperialistischen Eroberungs praktikers zur Philosophie Friedrich Nietzsches hervorzuheben ist. Abscheu vor den Herrschaftsmethoden des kaiserlichen Reichskommissars, der aus geringfügigstem Anlaß MassenExekutionen befahl und junge Negermädchen zu Tode prügeln oder aufhängen ließ, hatte Olden bewogen, dieses Buch zu schreiben. Daß das Peters-Porträt auch Eingang in die Bücher schränke ausgemachter Kolonialschwärmer fand, erklärt sich aus Akzentverschiebungen in seinen letzten Kapiteln. Die starke Kritik an den kaiserlichen Geheimräten im Auswärtigen Amt warf auf Peters’ „Landnahme“ den Schimmer einer außer gewöhnlichen Pioniertat. Oldens Konzeption verfing sich in der These, Peters’ Leben sei nach einem inneren, ihm von Ge burt vorausbestimmten „tragisch-heroischen Gesetz" verlaufen. Dadurch erzeugte der Autor beim Leser eine Art sportliches Mitleid, eine Haltung, die sicher nicht beabsichtigt, aber auch nicht verhindert worden war. 1928 und 1929 gab es zwei PetersProzesse, deren langwierige Verfahren Balder Olden sechzehn Monate am Reisen hinderten und seine Arbeit fast täglich unterbrachen. Olden mußte sich ehrenrühriger Angriffe all deutscher Journalisten erwehren, die im Auftrag der Witwe des „Eroberers" seine schriftstellerische Leistung verunglimpf ten und ihn der Fälschung bezichtigten. In beiden Fällen ge lang Olden die Widerlegung dieser Anwürfe an Hand schlag kräftiger Beweise aus den Tagebüchern und Briefen Carl Peters’. Seine Prozeßgegner mußten die Kosten der Verfahren übernehmen und erklären, daß ihre Verleumdungen durch nichts gerechtfertigt waren. Die Prozesse, in denen Olden von vornherein als Schuldiger behandelt wurde, vermittelten ihm aufschlußreiche Einblicke in das Wesen der Weimarer Klassenjustiz. Am 16. April 1929 schrieb Olden in einem Bericht fürs „Tage-Buch“:...... von der Justiz weiß ich nun mehr, als ich je geahnt. Wenn an meiner 412
Stelle etwa ein Buchhalter Schulz stand ..was bleibt ihm, mag seine Sache noch so gut sein, als der Strick?“ Kurz nach Erscheinen von „Ich bin Ich“ gab Olden seiner alten Afrika-Liebe noch einmal nach. In „Madumas Vater“ (1928) >erscheint der „sehr hohe weiße Herr“ immer noch als der verehrte Kultivator. Obwohl Olden besonders die Fähig keit der Afrikaner zu Treue, Freundschaft und Aufopferung darstellte, war die Erzählung nicht frei von Vorurteilen und schulterklopfender Überheblichkeit. Olden hat das wohl selbst bald gespürt. Beifall von rechts wehrte er ab. Als Hans Grimm mit seinem Reisebericht „Drei zehn Briefe über Deutsch-Südwest" 1928 die alldeutsche Kolo nialpropaganda demagogisch unterstützte, distanzierte sich Olden mit Nachdruck von allen „Kolonialschreiern". „Ich halte viel von Politikern“, schrieb er, „die eine knappe, präzise Sprache schreiben, weil ich glaube, daß klare Gedanken ihren knappsten Ausdruck gar nicht verfehlen können. Wer sich auf einer Reise mit der Woermann-Linie zur Diamanten-Börse Walfischbucht auf einem .Flüchten vor Gott' glaubt, ist mir verdächtig, selbst wenn er das Ideen-Wischiwaschi in .Volk ohne Raum' nicht zuvor angerichtet hätte. Ein Politiker, der 1928 von deutscher und südafrikanischer .Untertanenschaft* spricht, wenn er Staatsbürgerrechte meint, der einen Admini strator einen .Landpfleger* nennt..., ist entschieden unklarer Ideen verdächtig.“ Oldens aktive antiimperialistische Haltung in der kolonialen Frage gipfelte in den Feststellungen: „Kein Land bleibt einem anderen, sei es zehnmal ,Mutterland*, tribut pflichtig, wenn es erst atmen kann“, und: „Dem Schrei nach Kolonien folgt der Schrei nach Kriegsflotten. Wir haben momentan mit einem Panzerkreuzer genug.“ Später hat er es noch schärfer formuliert. „Tropenkoller“, so schrieb er 1936, „ist nämlich keine Folgeerscheinung des Kli mas“, Tropenkoller ist „Machtkoller". Und: „Aus welchen Schichten aber würde das Deutsche Reich beute seine Kolonial beamten rekrutieren! Die ganze Kolonie wäre ein einziges Dachau - und würde bald ein einziger Friedhof sein. Dem Dritten Reich eine Kolonie geben hieße, die Bevölkerung aus rotten.“ 4B
19)2 beendete Balder Olden ein Manuskript, das nicht nur ein Pendant, sondern eine Korrektur der Peters-Biographie darstellt. Es markiert in der Werkreihe des Schriftstellers einen Abschluß und einen Neubeginn. Deshalb macht unsere Aus wahl mit der Sir-Roger-Casement-Biographie „Paradiese des Teufels" bekannt. 1975 schrieb Margaret M. Olden an die Her ausgeberin: „Die Hoffnung, daß ,Paradiese des Teufels* in Buchform wieder verlegt wird, mag ich so schnell nicht auf geben. Sie haben vollkommen recht, Balder schrieb das Buch als Reaktion auf das Aufkommen der Nazigreuel und um eine Parallele zu ziehen zwischen dem Freiheitskampf der Iren und dem des deutschen Volkes, das schon wie von fremden Macht habern überzogen war. Damals war es eine Tat, war als Tat und Kampfhandlung gemeint und wurde so auch gelesen, denn man las schon zwischen den Zeilen.“ Nicht mehr der gewalttätige Machtmensch, der willens geladene Übermensch (Carl Peters) stand im Mittelpunkt des neuen Buches, sondern ein Held, der sein Leben aus sittlicher Verantwortung immer wieder für Schwächere uneigennützig aufs Spiel setzte und hingerichtet wurde, weil er danach trach tete, seine Ideale in der Praxis zu verwirklichen. Olden hat versucht, in der Casement-Biographie weltanschauliche, taktische und moralische Fragen zu einer Zeit zu stellen, da für weite Teile der deutschen bürgerlichen Intelligenz solche Probleme wie das der „Legalität“ aktiver Handlungen gegen den Faschismus, Fragen wie: Was ist echtes Heldentum, echter Patriotisipus, wahre Vaterlandsliebe? von aktueller Bedeutung waren. Struktur und Diktion des Buches werden von einem leiden schaftlichen Pathos bestimmt. „Paradiese des Teufels" sind die authentische Lebensbeschreibung eines Mannes, der um die Jahrhundertwende auf die schamlose Kolonialpolitik Leo polds II. in Belgisch-Kongo aufmerksam machte und auf die schändlichen Praktiken englischer. Handelsgesellschaften und ihrer südamerikanischen Zwischenhändler am Putumayo, einem Nebenfluß des Amazonas, unerschrocken hingewiesen hat. Daß er schließlich, in der letzten Phase seines Lebens, im Dienst der englischen Krone geadelt und ergraut, im irischen Unab-
4M
hängigkeitskampf als ehemaliger „Ulster“ alle konfessionellen Streitigkeiten hinter sich ließ und im ersten Weltkrieg irische Freiwilligen-Brigaden für den Kampf gegen England aufstel len und mit deutscher Hilfe bewaffnen wollte, verleiht der Ge stalt den tragischen Charakter eines irischen „Don Quichote“. Die Beschreibung manisch-romantischer Züge, paranoider Veränderungen im Persönlichkeitsbild Casements wurden in den „Paradiesen des Teufels“ nicht ausgespart. Problematischer je doch, als Balder Olden in seinem Porträt das „Zwangsbünd nis“ Casements mit dem Wilhelminischen Deutschland dar stellte, waren die geheimen Verhandlungen des Iren mit dem deutschen Auswärtigen Amt. Eine kritischere Sicht der deutsch irischen Episode in der letzten Lebensphase Casements wäre notwendig gewesen, die Aufhellung der historischen Hinter gründe fehlt. Die Grenzen seines Helden wurden auch für Olden verhängnisvoll - kommentarlos gab er Casements Sicht der irisch-deutschen Beziehungen wieder und konnte, ohne sich mit ihm ausdrücklich zu identifizieren, die strategischen Inten tionen des deutschen Imperialismus nicht durchschauen. „Paradiese des Teufels“ war das letzte Buch Oldens, das in Deutschland erscheinen konnte. 1933 verließ der Autor Deutsch land und ging mit seiner beträchtlich jüngeren Lebensgefährtin Margaret Maria Kershaw nach Prag. Sie, die er Primavera nannte, war die letzte große Liebe des Schriftstellers. Er genoß, seinen Freunden zu erzählen, „daß er - schon ein reifer Mann sich in. Hauseingängen versteckte, um sie zu sehen, wenn sie aus der Schule kam. Später ließ er ihr von seiner Wirtschafte rin Blumen bringen. Dann lebten sie zusammen ...“ Der jun gen Frau, die Olden in die Emigration begleitete, fiel die Anpassung an das ihr fremde Milieu nicht leicht. Olden arbei tete oft Tage und Nächte hintereinander und antwortete auf Störungen gereizt. Klug und mit natürlichem Kunstverstand versuchte sie, günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Eine Zeitlang half sie im Büro 4es Malik-Verlages, der unter kompli zierten juristischen Bedingungen seit April 1933 in Prag sein altes, auf die Verbreitung proletarischer und bürgerlich-huma nistischer Weltliteratur gerichtetes Programm weiterverfolgte. In Prag schrieb Olden seine entschlossene Absage an den
415
Faschismus in Deutschland. Ähnlich wie Oskar Maria Graf, der von den Nazis öffentlich gefordert hatte, seine Bücher zu verbrennen, bekannte sich Olden mit seinem Pamphlet „Mir wäre nichts Besonderes passiert“, das später in die „Stationen“ übernommen worden ist, zu einem kämpferischen Patriotismus und aktivem Widerstand gegen die Nazis. In einem Brief an die Schwester Ilse berichtete Olden im Sommer 1953 von einem Vorhaben, das ihn bis Ende des Jah res beschäftigen sollte, einem Roman, „der Deutschland im Querschnitt von Dezember 1932 bis Mai 1933 schildert. Aber sprich wirklich nicht, mit niemand, trotz allem - es ist der Roman, der mehr Waffe gegen die Barbaren bedeutet als alle Broschüren und Artikel, hoffentlich mehr Hieb als Dichtung." Der Autor berichtete hier von dem in deutscher Sprache bisher nur einmal in einem Fortsetzungsdruck des „Pariser Tageblatts“ erschienenen „Roman eines Nazi“, für dessen jüdische Figuren, die Naumanns, Roda Rodas Familie die Vorlage abgegeben hat. Der „Roman eines Nazi“ wurde endgültiger Anlaß für die faschistischen Machthaber in Deutschland, Balder Olden auf die dritte Ausbürgerungsliste zu setzen, Wohnung und Ver mögen zu beschlagnahmen, seine Bücher zu vernichten. Als im Herbst 1933 die ersten Nummern von Wieland Herz feldes „Neuen Deutschen Blättern“ von sich reden machten, zählte Balder Olden zu den Autoren der bedeutenden Litera turzeitschrift der frühen Emigration. Der Kreis um Wieland Herzfelde, der für die Vielfalt der antifaschistischen Literatur und die Fortsetzung der sozialistischen Traditionen kämpfte, bezog Balder Olden in die lebendigen Auseinandersetzungen mit ein und erleichterte ihm den Anschluß an die in enger Ge meinsamkeit kämpfenden proletarisch-revolutionären und bür gerlich-humanistischen Künstler im Exil. Im Hinblick auf die Lage in Deutschland, auf Hitler und die Frage „Was tun?“ schrieb Olden im Sommer 1933 in einem Brief an die Schwester: „Diesen Großbäcker töten wäre falsch - es würde nur Pogrome anrichten, das System nicht vernichten. Vielleicht kommt die Zeit, wo wir ihn besser stra fen. Aber er ist ja gar nicht interessant - das Übel steckt
416
tausendmal tiefer. Die Barbarei und Armseligkeit der ganzen Nation war nötig, um ihn erscheinen zu lassen, er war nur der richtige Erwecker der Brutalität, die schon glimmte, als ich in Freiburg ii;er (Einjähriger beim 113. Regiment - R. G.) war. Von der ,Mannschaftsstube* bis zu diesem Buch (.Roman eines Nazi* - R. G.) geht ein einziger Zug durch all meine Bücher Tante Hedwig hat schon vor bald dreißig Jahren gesagt, ich sollte doch aufhören zu hassen. Aber ich hasse heute mehr als damals.** Die Frauen, die den Schriftsteller am besten kannten, Ilse Seilern und Margaret M. Olden, sahen noch Jahrzehnte später, lange nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus, wesentliche Ursachen für Balder Oldens kompromißlose Haltung dem Nazismus gegenüber in seiner „Unfähigkeit zur Lüge“ und in einer „Dynamik des Herzens“, die alle Entschlüsse seines Lebens bestimmten, gleich, ob sie politische oder private Ent scheidungen betrafen. Im August 1934 nahm Olden neben Becher, Bredel, Graf, Herzfelde, Klaus Mann, Plivier, Toller, Walden, F. C. Weis kopf und Friedrich Wolf am I. Unionskongreß der Sowjet schriftsteller in Moskau teil. Zum ersten Mal erlebte er die junge Sowjetunion. Im Anschluß an den Kongreß fuhr er wochenlang kreuz und quer durch verschiedene Sowjetrepubli ken und gewann dabei „mehr als während der Jahrzehnte (s) einer Fahrten durch alle Weltteile“. Auf eine Umfrage aus dem Jahre 1937 antwortete er: „Bis dahin hatte ich nur er kannt, daß die Welt krankt, und auf die Wunden gedeutet. Seither weiß ich, daß es konkrete Wege gibt, um zu gesunden.“ Begeistert berichtete der Schriftsteller nach seiner Rückkehr in verschiedenen Emigrationszeitschriften von dieser Reise; von einem erstaunlichen Propagandafeldzug der sowjetischen Luft flotte für die junge sozialistische Literatur, über seinen Besuch bei Gorki, von belustigenden Hemdeneinkäufen mit Oskar Maria Graf, den Mädchen von Baku, die die Fesseln der mohammedanischen Religion abstreiften und sich mutig eman zipierten ... Als der Schutzverband Deutscher Schriftsteller in Paris mit der Freiheitsbibliothek im Juni 1935 die Tarnschrift „Deutsch 27
Paradiese
417
für Deutsche“ für den Vertrieb im Ausland und die illegale Verbreitung im „Reich“ herausbrachte, erklang auch Oldens Stimme im Chor der einundvierzig bürgerlich-humanistischen und proletarisch-revolutionären Schriftsteller, die in diesem kleinen Buch der Welt bewiesen, daß die wahre deutsche Lite ratur lebte und sich anschickte, den Kampf gegen Faschismus und Krieg in vorderster Frontlinie mitzuführen. Erfaßt vom „heiligen Zorn“ über die „Leichenfledderer unserer Zivilisation“ polemisierte Balder Olden im gleichen Jahr in der „Neuen Weltbühne“ heftig gegen Thomas Mann und Max Brod. Dem einen warf er falsche Rücksichtnahme und dem anderen Objektivismus im Verhalten zur Nazi-Ideologie vor. Aus Unkenntnis der wahren Sachlage tadelte er die ver meintlich anhaltende unpolitische Haltung Thomas Manns noch zu einem Zeitpunkt, als der Künstler begann, seine Neutralität aufzugeben und sich deutlich vom Faschismus zu distanzieren. Erneut erörterte er den alten Gegensatz zwischen den Brüdern, zwischen dem „Unpolitischen“ und dem „Engagierten“, und stellte das Verhalten des einen der Haltung des anderen schroff gegenüber. Heinrich Mann verkörperte für Olden - wie für so viele Schriftsteller und Künstler in der Emigration - den lei denschaftlichen, aufrechten Vorkämpfer für einen besseren sozialen und demokratischen deutschen Zukunftsstaat. Seit 1935 in Frankreich, richtete Balder Olden seine Hoffnun gen auf das Zustandekommen einer breiten, verschiedene Welt anschauungen und Lager umfassende Volksfrontbewegung gegen Hitler. Als die Redaktion der antifaschistischen Wochenschrift „Der Gegen-Angriff", zu deren leitenden Mitarbeitern Alexan der Abusch, Egon Erwin Kisch, Bruno Frei und Kurt Stern gehörten, sich am 8. Juni 1935 an „alle Menschenfreunde“, „alle freiheitlichen Menschen" wandte, um ihnen zuzurufen: „Man muß etwas tun! Wir schlagen vor: Deutsche Einheitsfront gegen Hitlerterror“, antwortete Balder Olden: „Ihr Aufruf, eine Einheitsfront gegen den Hitlerismus zu schaffen, hätte schon vor Jahren, mindestens vor der letzten Reichspräsiden tenwahl erschallen sollen, denn was inzwischen geschehen ist, war ja damals schon zu greifen nahe. Sehr spät kommt die Er kenntnis, daß es nur zwei Lager geben darf, solange der Hitle-
418
Aber wenngleich spät, käme sie doch nicht zu spät, um Reste der deutschen Kultur zu retten und Deutschlands Nachbar länder, nächst ihnen Europa, vor dem Verfall aller Kulturen rismus existent ist: das der Hakenkreuzler und ihrer Gegner, zu bewahren. Es ist beschämend, die Einheitsfront gegen eine geistige Untermediokrität vom Range Hitlers zu bilden, aber wir müssen uns der Scham entschlagen, denn dieses Vakuum an Geist ist reale Macht zu allem Bösen. Ich trete jedem Bünd nis bei, das gegen ihn geschlossen wird, und ich glaube, so tut jeder politisch Denkende, der nicht seines Ungeistes ist.“ Die Arbeit im Schutzverband Deutscher Schriftsteller machte ihn mit Programm und Taktik der Kommunistischen Partei Deutschlands nach dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale und der Brüsseler Parteikonferenz bekannt. Als der Pariser Ausschuß zur Vorbereitung der deutschen Volks front im Dezember 1936 den „Aufruf für die deutsche Volks front, für Frieden, Freiheit und Brot" erließ, unterzeichneten von Seiten der Schriftsteller neben Becher, Budzislawski, Feuchtwanger, Herzfelde, Kisch, Heinrich und Klaus Mann, Toller, Uhse und Arnold Zweig auch beide Brüder Olden. Als Literaturkritiker für die „Neue Weltbühne“, das „Neue Tage-Buch“, „Das Wort“ und andere Exilzeitschriften war Bal der Olden in diesen Jahren bemüht, die entstehende anti faschistische Literatur im Exil vom Standpunkt der Volks frontpolitik zu erfassen und zu empfehlen. Ohne das Rüstzeug einer wissenschaftlich fundierten Methode, aber auf Grund sei ner kämpferischen antifaschistischen Haltung und einer beacht lichen literarischen Bildung übte er zumeist eine richtungwei sende, die Entwicklung und Sammlung der Volksfront-Lite ratur fördernde Kritik. Unsere Auswahl vereint die Mehrzahl seiner Rezensionen zu Neuerscheinungen deutschsprachiger Schriftsteller im Exil, eine Reihe Würdigungen und Polemiken gegen Autoren, die mit den Nazis paktierten, mußte aber Besprechungen fremd sprachiger Autoren unberücksichtigt lassen. Balder Olden be obachtete und interpretierte nicht ausschließlich Probleme und Erscheinungen des literarischen Exils. Unter seinen publizisti schen Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1949 befinden sich 27'
419
Manuskripte zu Schalom Aschs „Juden“, Agnes Smedleys China-Büchern, zu Hemingway und Kipling, André Gide, Céline, Bernard Shaw und Charles Dickens. Oldens Geisteshaltung glich Mitte der dreißiger Jahre der der engagiertesten unter den deutschen Emigranten. „Spanien macht uns allen“, so schrieb er am i. August 1936 in einem Brief an die Schwester Ilse aus Le Lavandou, „das Herz schwer - das ist eigentlich nicht mehr Politik, das ist die eigenste Privatsache aller Menschen, die ein Herz und Nerven haben. Ein friedliches Land, das sich verfassungsgemäß und demokratisch reformieren will, von der eigenen Armee über fallen, ein Krieg ohne Kriegsrecht, Gefangene werden füsi liert - und halb Europa sympathisiert mit den entmenschten Verbrechern. Zum Glück sind alle Menschen, die wir hier sehen, der gleichen Ansicht.“ Im Sommer des folgender! Jahres erhielt auch Balder Olden eine Einladung zum zweiten Internationalen Kongreß zur Ver teidigung der Kultur nach Valencia und Madrid, nahm sie aber aus gesundheitlichen Gründen nicht wahr. Als der Schutz verband Deutscher Schriftsteller anläßlich der Pariser Welt ausstellung im Sommer 1937 im Quartier Latin die Ausstellung „Das deutsche Buch in Paris 1837-1937“ veranstaltete, hießen die zwei deutschen Sprecher, die nach der Eröffnungsrede Feuchtwangers das Wort ergriffen: Anna Seghers und - Balder Olden. Er gehörte zum Blöde antifaschistischer Künstler, die hier vielen tausend Besuchern aus Nazideutschland bewiesen, „daß die emigrierten deutschen Schriftsteller die besten Werte der freiheitlichen deutschen Kultur wahren und mehren und so beitragen, den Freiheitskampf des deutschen Volkes zu unter stützen". Die Annexionen Österreichs und der Tschechoslowakei durch den deutschen Faschismus verstand Balder Olden als Vorspiele weltweiter Aggressionen Hitlerdeutschlands. Sein leidenschaft lich-zerfahrener Briefwechsel mit Primavera, die sich seit 1937 unter anderen deutschen Künstleremigranten in Le Lavandou an der Côte d’Azur aufhielt, um Oldens Budget in Paris nicht zu stark zu belasten, spiegelt seine Ratlosigkeit und die Vor ahnung kommenden Unheils.
420
Olden wollte der Entwicklung trotzen und litt schwer an seiner Ohnmacht. Aus dieser Gefühlslage heraus wurde er oft bitter und ungerecht. So kam es Anfang 1939 zu einer KerrPolemik, die unter den exilierten Schriftstellern manchen Widerspruch hervorrief. Kerr hatte zwischen 1914 und 19 33 mitunter auch zynische Geistreicheleien produziert, gehörte aber in der Londoner Emigration zu den unbescholtenen Antifaschi sten. Als seine Gedichtsammlung „Melodien“ erschien, stieß sich Balder Olden daran, daß die Anthologie alte Reime wie „Das Erdenleben bis zum Tode/bleibt eine fesche Episode“ konservierte und nachdrücklich als gültige Dichtung auswies. Er schlußfolgerte überspitzt: „Nichts kümmert einen, der gefühl los ist, ,Härterer* auf .Märtyrer* zu reimen. Die Härte des einen, die ihn nicht trifft, das Martyrium des anderen, das ihm erspart bleibt. Er wäre folglich mit den Nazis im Bunde, wenn sic ihn leben und gesund sein ließen.“ An Kerrs ehrlichem Antifaschismus jedoch war nicht zu zweifeln. 1938/39 sah sich Balder Olden deshalb an den Grenzen einer Betrachtungs weise, die - von Spontaneität geprägt - die Einsicht verhin derte, daß die deutsche Exilliteratur ganz besonderen Entwick lungsgesetzen unterworfen war. Nach der Kerr-Affäre ergriff Olden nur noch gelegentlich in der „Neuen Weltbühne** das Wort. So wandte er sich gegen esoterische Züge in Klaus Manns Roman „Der Vulkan" und resümierte: „Die geflüchteten Proletarier werden gar nicht zu geben, daß sie hier überhaupt gemeint sind__ “ Ein rührend besorgter Brief Primaveras aus Le Lavandou kennzeichnet die Stimmung beider wenige Wochen vor dem Überfall Hitlers auf Polen: „Wenn kein Krieg kommt, sollte man sein Bündel nach Übersee schnüren, nichts wie weg... Hier wird viel geraten und geredet, alle nehmen Tuchfühlung, keiner will allein sein... Im Ort gibt es keinen Zucker, keine Kerzen und keinen Kredit mehr - Panik, aber nicht fremden feindlich ... Ich danke Dir für alle lieben Worte, Du bist gut, aber Du darfst Dich nicht so quälen, so grauenhaft. Trink keinen Cognac, er ist Gift für Dich, macht alles schlimmer, gespenstischer, gigantisch. Leb am Tage, nicht nachts, die Nacht erzeugt Gespenster, sei nicht allein, geh in die Sonne —“
421
Olden wollte Paris nicht verlassen. So teilte er im Mai 1940 das Massenschicksal der deutschen Emigranten. Die „Episode in Paris“ und seine Briefe aus dem Lager „Roland Garros“ spiegeln nicht nur seinen Existenzkampf; sie sind zugleich Zeugnisse eines ungebrochenen Lebenswillens und sprechen von dem Wunsch, gegen den deutschen Faschismus persönlich und mit den Mitteln des Worts, begriffen als Waffe, anzu treten. Nach dem Aufenthalt in verschiedenen Durchgangslagern wurde Balder Olden im Juni 1940 in Cap Finistère in der Bretagne interniert. Bei der Übernahme des Lagers durch die deutsche Wehrmacht floh er aus dem im Hof angetretenen Block, setzte über eine Mauer und gewann nach einem dreißig tägigen Fußmarsch quer durch das besetzte Frankreich in Marseille Leben und Freiheit - wie er es später in dem auto biographischen Kapitel „Auf der Flucht“ geschildert hat. Noch dachte er nicht an eine Überfahrt. „Ich kann nicht in Amerika leben“, sagte er in Marseille zu Maximilian Scheer. „Ich bleibe hier.“ Nach dem Waffenstillstand des Vichy-Regimes wohnte er noch eine Zeitlang mit gefälschten Papieren als „Elsässer“ und „Lehrer" in der südfranzösischen Hafenstadt, ehe er sich im April 1941 unter dem Zwang der Umstände zur Übersiedlung nach Südamerika einschiffte.
Argentinien nahm ihn auf. Hier gab es feste demokratische und sozialistische Traditionen unter den ansässigen Deutschen, zugleich aber auch beachtliche Einflüsse des deutschen Imperia lismus, unter dessen Druck das öffentliche gesellschaftliche Leben der demokratischen Deutschen nach 1933 immer stärker behindert und gleichgeschaltet worden war. Um 1937, stärker noch nach der Ankunft der Emigranten, änderte sich diese Situation. Deutsche Kommunisten, Sozialdemokraten und links bürgerliche Kreise um das „Argentinische Tageblatt“ (Buenos Aires) rückten enger zusammen. Eine Gruppe, an ihrer Spitze August Siemsen, gründete „Das Andere Deutschland“ (La Otra Alemania), um wirksamer gegen die zunehmende faschi stische Gefahr auftreten zu können. 422
Balder Olden fand rasch Anschluß an die antinazistischen Kräfte in Buenos Aires und beteiligte sich an kultureller und propagandistischer Arbeit auf vielerlei Weise. So gehörte er bald zu den Autoren, die in der ¿Pestalozzi-Gesellschaft“, einer pädagogischen Exilorganisation, Vorträge hielten. Er sprach, wie auch Stefan Zweig und Emil Ludwig, über lite raturgeschichtliche Themen. Gleichzeitig unterstützte er die Sammelbestrebung der Hitlergegner in ganz Südamerika durch Korrespondenzen, in die unsere Auswahl einen kleinen Ein blick gestattet. Als Ende 1942 in Buenos Aires durch gemeinsame Bemühun gen verschiedener antinazistischer Gruppen und Vereinigungen, in denen sich Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche Demokraten zusammengefunden hatten, die Gründung eines Arbeitsausschusses deutscher Demokraten in Argentinien (Co misión Coordinadora de los Alemanas Democráticos en la Argentina) gelang, war Balder Olden ihr Präsident. Am i. Dezember 1942 veröffentlichte der Arbeitsausschuß einen von Dr. August Siemsen (für „Das Andere Deutsch land“), Erich Sieloff (für die Gruppe und die Zeitung „Das Volksblatt"), Erich Bunke (für den Verein „Vorwärts“) und Balder Olden gezeichneten Aufruf, in dem die Notwendigkeit gemeinsamen Vorgehens im Kampf gegen den Hitlerfaschismus und seine Fünfte Kolonne in Argentinien nachdrücklich betont wurde. Dieser Appell erschien kurz vor der vom DAD an geregten und zusammen mit anderen deutschen Antinaziorgani sationen in Südamerika Ende Januar 194) nach Montevideo einberufenen Konferenz. Aufgabe des Kongresses sollte es sein, über die Erfahrungen des Kampfes gegen die Fünfte Kolonne und die weitere Arbeit unter den in Südamerika lebenden deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen und Emigranten so wie Möglichkeiten des weiteren Zusammenschlusses aller deut schen Hitlergegner zu beraten. Vor allem mit antikommunistischen Vorbehalten belastete Anhänger des DAD verhinderten jedoch, daß von dem Kon greß in Montevideo entscheidende Initiativen für die konse quent und gemeinsam geführte Arbeit der deutschen Hitler gegner in ganz Lateinamerika beschlossen wurden. Auch August
42}
Siemsen gehörte zu denjenigen, die sich einem umfassenden antifaschistischen Bündnis verschlossen. Er geriet damit in schroffen Gegensatz zu Balder Olden, der an der Seite der Kommunisten und anderen Antifaschisten dem Affront gegen die Bewegung „Freies Deutschland" in Mexiko, in deren Namen Ludwig Renn zur gleichen Zeit die Bildung eines Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen vor schlug und begründete, nicht folgen konnte. Balder Olden, einer der Präsidenten der Januarkonferenz in Montevideo, vermochte weder auf der Konferenz noch in den Wochen danach die Diskussion im Arbeitsausschuß deut scher Demokraten in Argentinien im Sinne eines kollektiven Anschlusses an das lateinamerikanische Komitee „Freies Deutschland“ zu entscheiden. Trotz bemerkenswerter Initiative hierzu, die besonders von der Gruppe „Volksblatt“ ausging, brach im Frühsommer 1943 der Arbeitsausschuß deutscher Demokraten in Argentinien auseinander. Balder Olden, der auch im „Anderen Deutschland“ veröffentlicht hatte, trat in dieser Zeitschrift nicht mehr in Erscheinung. Im Spätherbst 1943 übersiedelte er nach Montevideo, ohne daß seine aktive politische Haltung ersichtlich an Schwung ein gebüßt hätte. Hier, im Hause des Deutschen Antifaschistischen Komitees, in der Calle Andes 1206, eröffnete er 1943 eine Vortragsreihe zum Thema „Wahre deutsche Kultur“ mit lie benswürdig und lebhaft vorgetragenen persönlichen Erinne rungen an bekannte Gestalten der zeitgenössischen deutschen Literatur. Die günstigen bürgerlich-demokratischen Verhältnisse in Uruguay erleichterten dem Sechzigjährigen Übersiedlung und Eingewöhnung. Uruguay hatte alle Beziehungen zu den Ach senmächten abgebrochen und bemühte sich erfolgreich um Wiederherstellung normaler diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion. Bald gehörte Olden zu den regelmäßigen Mit arbeitern der deutschsprachigen Rundfunkstunde bei Radio Aguila. Ein Teil der Manuskripte ist erhalten geblieben und in unserer Auswahl vertreten. Für die Sendung „Stimme des Tages“ las er zum Beispiel eine für den Funk bearbeitete Folge aus dem entstehenden Buch „Stationen meines Lebens“.
424
Gesprochenes Wort ist flüchtig. Ab 1944 gibt es immer weni ger Hinweise und Informationen über Balder Oldens litera rische und politische Tätigkeit im Exil. Sicher ging die Arbeit am „Lebensroman“ weiter. Zwei größere Aufsätze über das Schicksal deutscher Schriftsteller waren noch 1943 erschienen. In dem einen, „Die deutsche Literatur heute und...?“, wür digte Olden nach einem pessimistischen Resümee Anna Seghers* Roman „Das siebte Kreuz“, vermochte aber das Wort „mor gen“ schon nicht mehr auszusprechen. Der andere ist ein Nach ruf, gewidmet dem Bruder Rudolf, der im September 1940 beim Untergang der „City of Benares" mit seiner Frau Ika umgekommen war. Über den privaten Anlaß hinaus erlangte das Epitaph Bedeutung, weil Balder Olden in ihm warnend aussprach, was das deutsche Volk von seinen Junkern und Militärs in nächster Zukunft zu erwarten habe:...... heute wis sen sie (die Junker - R. G.), daß selbst ein deutscher Sieg, an den sie nicht mehr glauben, ein Sieg über sie wäre. Sie wissen noch besser, daß aus dem Blitz- ein Abnutzungskrieg geworden ist, verloren schon im Ei, schon in der Zelle wie der letzte. Was bleibt ihnen zu tun? Sie werden den böhmischen Gefrei ten fortfegen, wie sie ein paar hunderttausend entwaffneter nur formell von Hitler, aber de facto von ihnen entwaffneter SA fortfegen kannten. Und dann mit dem letzten Tropfen Petroleum im Tank, mit der letzten Handgranate am Gürtel, mit dem letzten Sieg in der Tasche, werden sie - ein Erzberger-Mann aus dem Volke, den sie später ermorden lassen, wird sich Enden - Frieden verlangen. Sie werden auf die Waage werfen, was sie 1918 zu werfen hatten und Vichy heute bietet: Kampf gegen links. Das ist so in der Luft, das ist eine Frage von übermorgen, das spürt, wer, sei’s auch in Buenos Aires, die Nase vors Fenster hält. Was dann erfolgt? Dann wird sich erweisen, ob mein Bru der zu Nutzen der Welt gelernt und gelehrt hat und wofür er gestorben ist.“ „Unverdrossenheit des Gemüts", jener zähe Trotzdem-Optimismus, von dem Bodo Uhse 1939 gesprochen hatte, als er den Lebensroman des Gefährten begrüßte, noch ehe er als 42J
Lebensäußerung abgeschlossen und vollendet war, mußten sich jetzt bewähren. Als Präsident des Deutschen Antifaschistischen Komitees in Montevideo, als Mitglied des Ehrenpräsidiums des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen (Mexiko) gehörte Olden zu den antifaschistischen Schriftstel lern im Exil, die für die Ziele der Bewegung „Freies Deutsch land“ eintraten und sich trotz Meinungsverschiedenheiten immer zuverlässig und unbeirrt zur Einheits- und Volksfront politik der Gesamtbewegung „Freies Deutschland" bekannten. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit Primavera im Haus seiner Schwester Ilse in Uruguay. 1947 findet sich in einer Berliner Literaturzeitschrift die redaktionelle Bemerkung, Olden erwäge ernsthaft eine Rückkehr nach Deutschland. Zu der auch von Freunden erwarteten Reise ist es nicht mehr ge kommen. Im Herbst 1947 erlitt Olden einen ersten, im Som mer 1948 einen zweiten Schlaganfall. Margaret M. Olden er innert sich in einem Brief an die Herausgeberin: „Er kannte kein Wort mehr sprechen, war dabei aber bei hellstem, klar stem Bewußtsein. Er konnte auch nicht schreiben, denn die rechte Hand war gelähmt... Balder ertrug es mehr als ein Jahr - es gab keine Hoffnung." Am 23. Oktober 1949 schied der Siebenundsechzigjährige freiwillig aus dem Leben. Er war der letzte in der Reihe Tucholsky - Toller - Stefan Zweig - Klaus Mann. Aus Man gel an Verantwortungsgefühl ist er gewiß nicht gegangen.
August 1976
426
Ruth Greuner
Zu diesem Band
Die vorliegende Auswahl umfaßt sieben Kapitel der unvoll endet gebliebenen Autobiographie Balder Oldens „Stationen meines Lebens“, die Biographie Sir Roger Casements „Para diese des Teufels“, eine Sammlung antifaschistischer Publi zistik aus den Jahren der Emigration (1933—1945) sowie eine Reihe Briefe an Verwandte, Freunde und Mitstreiter des Autors, die dessen Entwicklungsgang vom Bohemien und unbe kümmerten Erzähler zum kritisch-realistischen Schriftsteller, konsequenten Antifaschisten und Weggefährten der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko detaillierter dokumentieren. Mit Ausnahme der Casement-Biographie entstanden alle Texte unseres Bandes nach Balder Oldens Abkehr von Deutsch land. Die Fülle des autobiographischen und - publizistischen Materials aus den verschiedenen Lebensphasen des Schriftstel lers verlangte von vornherein Beschränkungen. Unberücksichtigt blieben deshalb entsprechende Arbeiten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg und den Jahren der Weimarer Republik, ebenso Aufsätze und Kommentare, in denen sich der Verfasser mit außerliterarischen Erscheinungen auseinandersetzte, zum Beispiel auch die Äußerungen Balder Oldens zur deutschen Kolonialpolitik. Beiläufigere Betrachtungen zur deutschsprachi gen Literatur, manches Polemische, auch Oldens Kritik an der faschistisch eingefärbten Großen-Brockhaus-Redaktion (1936), die Würdigungen fremdsprachiger Autoren oder ihrer Werke (Hemingway, Kipling, Shaw, Agnes Smedley, Schalom Asch), selbst das bewegende Memorial für den Bruder („Rudolf Olden und die Junker“) konnten nicht aufgenommen werden. Eine vollständige Bibliographie der kleinen Schriften steht
427
noch aus; auf eine vorläufige Teilbibliographie haben wir ver zichtet, weil die Bestandaufnahme in den Pressepublikationen des südamerikanischen und amerikanischen Exils nur mit er heblichem Aufwand zu leisten gewesen wäre. Insgesamt stützt sich unsere Auswahl auf Beiträge Oldens in antifaschistischen Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren und Sammelbänden der deutschen Emigration oder solcher ihrer Gastländer, auf die noch kurz vor dem Machtantritt der Fa schisten in Deutschland im Universitas-Verlag (Berlin) er schienene Biographie „Paradiese des Teufels“ sowie auf Archivund Nachlaßmaterial aus dem Besitz der Witwe des Schrift stellers. Alle Briefe sind Erstveröffentlichungen und lagen im Original vor. In einigen Briefen wurden auf Wunsch der Erben und aus Rücksicht auf Dritte einzelne, für unsere Aus wahl unwesentliche Textstellen eliminiert und entsprechend gekennzeichnet. Die Mehrzahl der autobiographischen und publizistischen Texte sind nach ihrer Veröffentlichung in Zei tungen und Zeitschriften des Exils beziehungsweise der unmit telbaren Nachkriegszeit nie wieder erschienen. Die Anordnung innerhalb der einzelnen Abteilungen er folgte chronologisch. Vor- oder Rückblenden wurden dort vor genommen, wo es galt, zeitlich übergreifende Darstellungen politischer und literaturgeschichtlicher Prozesse besonders sinn fällig zu placieren. Genauere Hinweise zur Quellensituation, zu den Varianten und gegebenenfalls zur Verbreitung der einzelnen Beiträge finden sich in den Anmerkungen. Orthographie und Interpunk tion wurden unter Berücksichtigung der persönlichen Diktion in den Briefen der heutigen Schreibweise angeglichen. Verlag und Herausgeberin möchten an dieser Stelle Frau Margaret M. Olden (Uruguay) für ihre uneigennützige Hilfe, vor allem aber auch für die Bereitstellung zahlreicher Texte, Bild- und anderer Dokumente herzlich danken. Danken für freundlichen Rat und Förderung möchte die Herausgeberin ebenfalls den Herren Dr. Wolfgang Kießling und John Peet (Berlin).
428
Quellen und Anmerkungen
Für häufig zitierte Quellen werden folgende Abkürzungen gebraucht:
DZZ FD NDB NTB NWB IL Staatl. ZA
Deutsche Zentral-Zeitung (Moskau) Freies Deutschland (México) Neue Deutsche Blätter (Prag) Das Neue Tage-Buch (Paris, London) Die Neue Weltbühne (Prag, Paris) Internationale Literatur (Moskau) Staatliches.Zcntralarchiv Potsdam
Autobiographische Schriften Mein Leben (S. 7)
Quelle: Staatl. ZA, Akten Pariser Tageszeitung, 216, Bl. 7), 74. Dieses Typoskript hat der Redaktion „Das Wort“ (Moskau) im Frühjahr 1937 vermutlich als Grundlage für eine Kurzbiographie B. O.’s gedient, die mit faksimilierter Unterschrift in Heft 4/5 (Doppelnummer) 1937 erschienen ist. 7 Bakunin - Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814-1876); Mit begründer und Ideologe des Anarchismus; russischer kleinbürger licher Revolutionär; 1848 Teilnehmer am Barrikadenkampf in Dresden; 1864 bis 1872 Mitglied der Internationalen Arbeiter assoziation. * erste Publikation - „Aus der Mannschaftsstube“, Erzählungen, Berlin und Leipzig 1905. „Kölnischen“ - „Kölnische Zeitung“. 8 „Kilimandscharo“ - Roman, Berlin 1922; ab Februar 1922 unter dem Titel „Mikatera“ auch als Fortsetzung in der „Kölnischen Zeitung“ gedruckt.
429
8 Roman-Biograpbie des deutschen Kolonialgründers Carl Peters — „Ich bin Ich“, Roman, Berlin 1917- Carl Peter» (1856-1918) grün dete 1884 die Gesellschaft für deutsche Kolonisation (seit 1895 Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft); unterwarf mit grausamen Terrormaßnahmen die Kerngebiete Ostafrikas; 1891 bis 1895 Kaiserlicher Reichskommissar in den deutschen Kolonien; Massen proteste gegen sein grausames Vorgehen erzwangen 1897 seine Entlassung aus dem Staatsdienst. Oger - menschenfressender Riese. Casement - Sir David Roger Casement (1864-1916); irischer Po litiker und Patriot, nannte sich selbst „romantischer Humanist"; 1892 bis 1913 im britischen Kolonialdienst; 1911 geadelt; erwarb sidi große Verdienste bei der Aufdeckung der Konquistadoren methoden Leopolds II. in Belgisch-Kongo (1903/04); rettete mit seiner von der englischen Regierung als Blaubuch verbreiteten Denkschrift über die Methoden bei der Gummigewinnung am Putumayo 1912 Tausenden Indianern am Amazonas das Leben. Nach seinem Abschied aus dem Kolonialdienst unterstützte er aktiv die irische Sinn-Fein-Bewegung (vgl. Anm. zu S. 133), die seit 1905 die Forderung nach Selbstregierung (Homerule) und Unabhängigkeit am nachhaltigsten erhob. Casement wurde als einer der Initiatoren des Dubliner Osteraufstandes 1916 des Hochverrats bezichtigt und hingerichtet, 1963 postum rehabilitiert. „Roman eines Nazi" - In deutscher Sprache vollständig erstmals im Frühjahr 1934 im „Pariser Tageblatt“ als Fortsetzungsdruck erschienen. Vorabdruck des Kapitels „Zu spät“ in: NDB, 1933, Nr. 4, des Kapitels „Dr. Schnierwind“ in: IL, 1935, Nr. 2. Engli sche Ausgabe unter dem Titel „Dawn of Darkness“, Jarrold Publishers, London 1933. Amerikanische Ausgabe unter dem Ti tel „Blood and Tears“, D. Appleton-Century Company, New York 1934. Russische Ausgabe im Staatsverlag, Moskau 1936. „Mir wäre nichts Besonderes passiert" - Unter diesem Titel er schien B. O.’s Antwort an das deutsche , Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zuerst in Wieland Herzfeldes NDB, 1933, Nr. 3. Bei der Übernahme des Bekenntnisses in die Autobiographie erfuhr die ursprüngliche Fassung leichte Abwand lungen (vgl. „Stationen meines Lebens", S. 9 dieses Bandes). B. O.’s Absage, adressiert an die mit Goebbels befreundete Thea von Harbou (vgl. Anm. zu S. 40) provozierte einen nochmaligen Briefwechsel; vgl. dazu NDB, 1933, Nr. 5. Erster Schriftstellerkongreß der UdSSR - Gemeint ist der I. Unionskongreß der Sowjetschriftsteller vom 17. August bis 1. Sep
430
tember 1954 in Moskau. Zur deutschen Delegation gehörten Becher, Bredel, Ehrenstein, Graf, Herzfelde, Klaus Mann, Schar rer, Toller, Friedrich Wolf u. a. Stationen meines Lebens, I-V1I (S, 9)
Quelle: Abschriften aus dem Archiv des „Argendnischen Tage blatts", Buenos Aires. Die Kenntnis dieser Kapitelfolge eines großen, aber nicht beendeten autobiographischen Romans ver danken wir Frau Margaret M. Olden (Montevideo), die freund licherweise auch die Texte zur Verfügung stellte. Olden hat diese Fassungen in der deutschsprachigen Rundfunk stunde „La Voz del Dia“ („Die Stunde des Tages“) bei Radio Montevideo vorgetragen und später auch im „Argentinischen Ta geblatt" veröffentlicht: Kapitel I - 10. November 1946, Kapitel II 17. November 1946, Kapitel III - 24. November 1946, Kapi tel IV - 1. Dezember 1946, Kapitel V - ij. Dezember 1946, Ka pitel VI - 22. Dezember 1946, Kapitel VII - 29. Dezember 1946. Varianten und weitere Episoden sind: „Auf der Flucht", in: FD, 1942, Nr. 12; „Höllental meiner Jugend", in: FD, 1945, Nr. 7; „Aufstieg", in: FD, 194}, Nr. 10; „Nun gerade!", in: NTB, 1936, Nr. 31; „Ein Lehrer der Nation“, in: NTB, 1936, Nr. 34; „Als Sextaner in der Fremde", in: Staatl. ZA, Teilnachlaß B. O., 90 Ai, Bl. 134-148. Daß Olden die Berichte über seine Teilnahme am Afrika-Feldzug (1914) und aus den englischen Kriegsgefangenenlagern in Indien, die er für die „Kölnische Zeitung" unter dem Titel „Weltbummel in Eisen“ (1920) als Fortsetzungsserie geschrieben hat, in seinen Lebensroman aufnehmen wollte, kann angenommen werden. 9 Olden - Eigentlich Hans Oppenheim (18,9-1932); B. O.’s Vater; Schauspieler, Bühnenautor und Übersetzer. neunzehnjährige Mutter - Rosa Veronika Olden, geb. Stein (1861 bis 1927). llschen - Ilse Seilern-Anspang, Gräfin, geb. Olden (1880-1974); B. O.’s Schwester, die dem Schriftsteller in vielen verzweifelten Situationen uneigennützig geholfen hat. ii drittes Kind - Rudolf Olden (1885-1940); linksbürgerlicher Pu blizist und Strafverteidiger in der Weimarer Republik; vor 1933 Redakteur am „Berliner • Tageblatt"; Hauptverteidiger im Hoch verratsprozeß gegen Carl von Ossietzky; Verfasser politischer Bio graphien über Hindenburg, Stresemann, Hitler; Unterzeichner des Aufrufs „Für Frieden, Freiheit und Brot" zur Sdiaffung einer deutschen Volksfront Anfang Januar 1937. Das Verhältnis zu sei
431
16
18 24
26
31
36
nem Bruder schilderte B. O. im Brief an die Schwester Ilse vom 28. September 1940 (vgl. S. 6j dieses Bandes) und in „Rudolf Ol den und die Junker“ („Argentinisches Tageblatt", Beilage „Hüben und Drüben“, 28. August 194)). Zaratbustra-RdusAe - Anspielung auf die dionysischen Ekstasen des Künstlermenschen, wie dieser von Friedrich Nietzsche in „Also sprach Zarathustra“ als Archetyp gesehen wurde. s.1. - sine satisfactione: (lat.) ohne Genugtuung. Jacques - Norbert Jacques (1880-1954); bürgerlich-demokrati scher Reiseschriftsteller; Verfasser des Romans „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1921); Freund B. O.’s seit der gemeinsamen Volontär zeit. JJer Hamburger Hafen“ - Erschien in der Reihe „Großstadtdo kumente", Hermann Seemann Nachfolger, Berlin und Leipzig 1905. .Bund für Mutterschutz“ - Bund für Mutterschutz und Scxualreform; nahm sich vor allem notleidender Mütter und unehelicher Kinder von weiblichen Dienstboten an. Haymann - Lidia Gustave Heymann (1868-194$); bürgerliche Frauenrechtskämpferin; 191$ Mitglied des Bundes Neues Vater land; nach 1918 führendes Mitglied der Internationalen Frauen liga für Frieden und Freiheit; 19$$ Emigration. Augspurg - Anita Augspurg (1857-1943); Führerin des radikalen Flügels der deutschen Frauenstimmrechtsbewegung; Mitbegründerin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Schreiber - Adele Schreiber (1872-1957); Schriftstellerin, Sozialpo litikerin; gründete 1920 die deutsche Abteilung der Internationa len Vereinigung für Kinderhilfe und die Abteilung Mutter und Kind beim Roten Kreuz. Hekicber - Siegfried Hedcscher (1870-1929); Jurist, Sozialrefor mer und Reichstagsabgeordneter der Freisinnigen Vereinigung (1893-1910); auch Bühnenschriftsteller und zeitweilig Direktor der Hamburg-Amerika-Linie. Lettow-VorbeA - Paul von Lettow-Vorbeck (1870-1964); 1904 bis 1907 Hauptmann der deutschen Schutztruppe im damaligen Deutsch-Südwestafrika; 1913 Ernennung zum Kommandeur; 1918 leitete er den Überfall auf Rhodesien; später Kommandeur einer Reichswehrbrigade; berüchtigter Kolonialist und Militär. Prinz Eulenburg - Philipp Prinz Eulenburg, Fürst zu Eulenburg und Hertefeld (1847-1921); seit 1884 preußischer Gesandter in Oldenburg und Braunschweig; 1890 in Stuttgart, 1891 in Mün chen, 1894 deutscher Botschafter in Wien; Vertrauter Wilhelms II.; wurde 1906 in den Skandalprozessen, die Maximilian Harden
(vgl. die folgende Anm.) gegen den Kaiser und die Hofkamarilla führte, schwer kompromittiert; zog sich 1908 vom Hof zurück. 36 Harden - Felix Emst Witkowsky, Pseudonym Maximilian Harden (1861-1927); Schauspieler, bürgerlich-demokratischer Journalist; Mitbegründer der „Freien Bühne"; Herausgeber der „Zukunft"; wegen seiner republikanischen und pazifistischen Gesinnung ver übten Nationalisten 1922 ein Attentat auf ihn. Wolf] - Fritz Wolff; in der englischen Emigration bis 1944 Mit glied des Arbeitsausschusses der Freien Deutschen Bewegung in Großbritannien. Jacobsohn — Siegfried Jacobsohn (1881 — 1926); Berliner Theater
40
42
43
44
45
28
kritiker und Journalist; Gründer und verantwortlicher Redakteur der „Schaubühne“, die am 1. April 1918 in „Weltbühne“ umbe nannt wurde. Hier führte er seine berühmt gewordenen Kämpfe gegen Fememorde und Wiederaufrüstung in der Weimarer Republik. Großmann - Stefan Großmann (1871 — 1935); gab mit Leopold Schwarzschild bis 1927 „Das Tage-Buch“ (1920-1933) heraus; be kannt wurde sein Roman „Chefredakteur Roth führt Krieg“; Teil nahme am Untersuchungsausschuß der Roten Hilfe nadi den MaiEreignissen 1929 in Berlin; lebte nach 1933 schwerkrank in Wien. von Harbou - Thea von Harbou (1888-1954); deutsche Schau spielerin und Drehbuchautorin der Fritz-Lang-Filme „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1922), „Die Nibelungen“ (1924), „Metropolis“ (1927), „M" (1931) u. a.; sic stellte sich nach 1933 ganz in den Dienst der nationalsozialistischen Kulturpolitik (vgl. Anm. zu S. 8); „Nationaler Filmpreis 1937“ für „Der Herrscher“ (nach Gerhart Hauptmanns „Vor Sonnenuntergang"). Boxheimer Dokumente - Im Herbst 1931 auf einer Konferenz der Gauleitung Hessen der NSDAP im Boxheimer Hof bei Worms ver faßter Plan terroristischer Sofortmaßnahmen zur Machtergreifung. Berichte von Bredel, Langhoff - Gemeint sind: Willi Bredel, „Die Prüfung", Roman, Malik, London 1935, und Wolfgang Langhoff, „Die Moorsoldaten, 13 Monate Konzentrationslager", Spiegel-Ver lag, Zürich 1935. Kongo-Greuelberichte Sir Roger Casements - Vgl. „Paradiese des Teufels“, S. 81 dieses Bandes. Tretjakow - Sergej Michajlowitsch Tretjakow (1892-1939); Lyri ker, Dramatiker, Essayist, Kunsttheoretiker; sein Drama „Brülle, China I“ erregte 1929 auch in Deutschland großes Aufsehen; Freundschaft mit Brecht und Eisler; schuf u. a. beeindruckende Porträtskizzen von Becher, Heartfield, Friedrich Wolf, Bredit und Eisler. Paradiese
4Ji
45 Alberti - Rafael Alberti (geb. 1902); spanischer Lyriker; seit 1930 Mitglied der KP Spaniens; bereiste mehrfach die UdSSR; als Pro pagandist Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg; gehört zu den namhaften Persönlichkeiten der Weltfriedensbewegung; lebte in Argentinien und Rom; 1977 Rückkehr in seine Heimat nach acht unddreißig Jahre währendem Exil. Leon - Maria Teresa Leon; spanische Schriftstellerin und Über setzerin; Frau von Rafael Alberti; gab mit ihm gemeinsam die spanische kulturpolitische Zeitschrift „Octubre" Mitte der dreißiger Jahre heraus. 48 „Trinkerlegende“ - Joseph Roth, „Legende vom heiligen Trinker“, Roman, Allert de Lange, Amsterdam 1939. 49 Regierung Daladier - Unterzeichnete 1938 das Münchner Abkom men; mitverantwortlich für den „komischen Krieg“ (vgl. Anm. zu S. 59); im September 1940 von der Vichy-Regierung abgelöst. Pétain - Henri-Philippe Pétain; reaktionärer französischer Politiker und Militär; 1939/40 Gesandter in Franco-Spanien; Staatschef der Vichy-Regierung. Primavera - Das ist Margaret Maria Olden, geb. Kershaw, auch „Buzz“ genannt (geb. 1910); seit Ende der zwanziger Jahre Ge fährtin B. O.’s; begleitete ihn in die Emigration; Heirat am 8. Fe bruar 1944 in Buenos Aires; lebt heute in Montevideo (Uruguay). Laval-Regierung - Genannt nach Pierre Laval (1883-1945), der als Vertreter profaschistischer Kreise der Großbourgeoisie 1940 Ministerpräsident der Vichy-Regierung wurde. Episode in Paris (S. 55) Quelle: „5 Jahre .Die Stimme des Tages' ", Montevideo 1943. Die ser Beitrag, den B. O. zum fünfjährigen Bestehen der deutsch sprachigen Rundfunksendung bei Radio Montevideo geschrieben und vorgetragen hat, gehört in den Umkreis von „Stationen mei nes Lebens“. 5 5 Résidence forcée - (franz.) Zwangsaufenthalt. Romains - Jules Romains (1885-1972); französischer Schriftsteller; unterhielt enge Beziehungen zu dem faschistischen Komitee France-Allemagne. 56 „Pauvre madame, ma chère pauvre madamel" - (franz.) „Arme gnädige Frau, meine liebe arme gnädige Frau!“ 57 Camion - (franz.) kleiner Lastwagen, auch Militärwagen. Geist von Vichy - Vichy, Sitz der mit den Nazis kollaborierenden Regierung unter Pétain, wurde nach dem 10. Mai 1940 zum Inbe griff des Verrats.
454
Fünf Briefe aus dem Lager (S. 5 8) Quelle: Privatbesitz Ruth Greuner. 58 Balder Olden an den damaligen französischen Propagandaminister, aus dem Lager „Roland Garros“ bei Paris, geschrieben nach dem 15. Mai 1940, undatiert - Als Textvorlage diente der Entwurf eines Briefes, den B. O. im Lager vermutlich einem jungen Spa nier diktiert hat. per continumaciam - (lat.) Verurteilung in Abwesenheit des Ange klagten.
59 zwei deutsche Dichter - Fritz von Unruh (1885-1970) und Leon hard Frank (1882-1961). „komischer“ Geburtstag - Anspielung auf „drôle de guerre": (franz.) „komischer Krieg"; Bezeichnung für die Kriegshandlungen zwischen Nazideutschland und Frankreich im Zeitraum vom 1. Sep tember 1959 bis zum 10. Mai 1940. Die gegnerisdien Truppen lagen sich an der Maginot-Linie gegenüber, ohne daß es zu nennenswerten Aktionen kam, während die Fünfte Kolonne der Naziwehrmacht in Frankreich Fuß faßte und die französische Innen- und Außenpolitik auf die dann folgende Kollaboration mit den Nazis umschwenkte. Francilion - Dorf in der Nähe von Blois, in dem ein Teil der Zivilgefangenen im Herbst 1959 interniert war. 60 gardes mobiles - (franz.) Mobilgarden; vom Militärdienst frei gestellte, im Kriegsfälle zu Hilfszwecken herangezogene Truppen; im zweiten Weltkrieg wurden sie zu „Schutzmaßnahmen“ mobilisiert. Medizin — Gemeint ist Gift. Daphne - Eine englische Freundin. 61 Monsieur Bohec - Besitzer des Hotels, in dem Margaret M. Ker shaw und B. O. vor dessen Verhaftung wohnten. désirables - (franz.) Erwünschte; hier in der Bedeutung von Ge duldete. Die meisten „indésirables" („Unerwünschte") waren nach dem berüchtigten Lager Le Vernet in den Pyrenäen abtransportiert worden. Buffalo - Pariser Sportplatz, der seit September 1959 als Inter nierungslager für Ausländer diente. M. M. - Margaret Maria Kershaw, vgl. Anm. zu S. 49. Käsesurprise - Glasröhre mit Zyankali, die B. O. bei seiner un erwarteten Verhaftung zurücklassen mußte und die ihm, auf seinen dringenden Wunsch, verborgen in einer Portion Quark, ins Lager geschickt wurde. Speyers - Verwandte des deutschen Schriftstellers Wilhelm Speyer (1887-1952), die in Paris wohnten.
28*
435
61 Minna - Minna Flake, erste Frau von Otto Flake, Ärztin; auf Sei ten der Interbrigadisten im Spanienkrieg; war seit langem mit B. O. gut bekannt und lebte damals in Paris. Annas Gatte - Anna Seghers* Mann Lorenz Schmidt (geb. 1900). Nationalztg. - „Nationalzeitung"; gegründet 1842; renommierte de mokratische Tageszeitung in der Schweiz (Basel), die nach 1935 vielen antifaschistischen Emigranten ihre Spalten öffnete. Zukunft - „Zukunft. Ein neues Deutschland! Ein neues Europa!“ Organ der antifaschistischen Deutsch-Französischen Union; Heraus geber Willi Münzenberg; erschienen vom Oktober 1938 bis Mai 1940. Tagebuch - „Das Neue Tage-Buch“; Herausgeber Leopold Schwarzschild; erschienen vom Juli 1933 bis Mai 1940. Kurt S. - Kurt Stern. 62 Ken - Pseudonym eines jungen Mannes, vermutlich Nelken, der als Journalist Anfang 1933 in Berlin die Bekanntschaft B. O.’s ge sucht hatte. Später veröffentlichte er unter dem Namen „Ken“ Er lebnisse aus dem Konzentrationslager, die B. O. nicht für authen tisch hielt. Ursula - Die Titelfigur aus B. O.’s Roman „Flucht vor Ursula". Continental - Sitz des Propagandaministeriums in Paris. blood and tears - (engl.) Blut und Tränen. tranebees - (franz.) Schützengräben. Pseudoabri - Behelfsluftschutzbunkcr. Pneu - Rohrpostbrief. 63 Carlos Tod — Carlos Seilern, Gatte von B. O.’s Schwester Ilse, der in den letzten Maitagen 1940 in der Schweiz gestorben war. Mandel - George Mandel, eigentlich Jerobeam Rothschild (1885 bis 1944); französischer Politiker; vom 10. April 1938 bis 19. März 1940 in der Regierung Daladier und vom 21. März 1940 bis 19. Mai 1940 Propagandaminister.
Zwei Briefe aus dem unbesetzten Frankreich (S. 64) Quelle: Privatbesitz Margaret M. Olden. 64 Balder Olden an Ilse Seilern, Locbes (lndre-et-Loire), geschrieben am 20. Juli 1940 - Der Brief wurde in französisch geschrieben. Es ist der erste, den B. O. nach seiner Flucht aus dem Internierungs lager bei Audierne (Bretagne) und seiner Ankunft im unbesetzten Frankreich an seine Schwester gerichtet hat. Wir folgen einer Übersetzung von Margaret M. Olden. Bimmcben - Ilse Seilern, geb. Olden, vgl. Anm. zu S. 9.
436
6 5 Balder Olden an Ilse Seilern, Annecy, geschrieben am 19. Septem ber 1940 - Am 27. September 1940 hatte B. O. die Nachridit vom tragischen Tod seines Bruders Rudolf und dessen Frau Ika er halten, die beim Untergang des Kinderevakuierungsschiffes „City of Bernares" (von deutschen U-Booten torpediert) umgekommen waren. 66 das Kind - Rudolf und Ika Olden hatten ihre zweieinhalbjährige Tochter Mary, genannt Kutzi, einige Monate zuvor nach Kanada evakuiert und wollten ihr im Sommer 1940 via Nordamerika folgen.
67
68 69
70
71
73
Sechs Briefe aus Buenos Aires (S. 67) Quelle: Privatbesitz Margaret M. Olden Brief aus Buenos Aires - Wir folgen einer handschriftlich korri gierten Kopie des Typoskripts. Auf der Kopie befindet sich der Vermerk „Erschienen im Aufbau und im Argentinischen Tage blatt“. Ein Nachweis konnte nicht beigebracht werden. der lange Alexander - Alexander Maaß, bis 1955 Mitarbeiter am Westdeutschen Rundfunk Köln; Kollege B. O.’s. Weggefährte auf der Flucht ins unbesetzte Frankreich. B. O. erwähnt ihn in „Sta tionen meines Lebens", vgl. S. 52 dieses Bandes, und als „Kräh“ in der Skizze „Auf der Flucht“, in: FD, 1942, Nr. 12. Fürst S. - Fürst Schwarzenberg. „Usted babla castellanol“ - (span.) „Sprechen Sic spanisch?“ dort gibt es einen Diktator - Antonio de Oliveira Salazar (1889 bis 1970); gründete 1930 die faschistische Staatspartei Nationale Union; seit 19)2 Ministerpräsident der klerikal-faschistischen Diktatur in Portugal. der herrliche Ernesto - Gemeint ist Dr. Ernesto Alemann, Chef redakteur und Besitzer des „Argentinischen Tageblatts", einer im 19. Jahrhundert mit Schweizer Kapital gegründeten deutschsprachi gen Zeitung, die sich 1933 nicht gleichschalten ließ. Teufel Asmodi - Anspielung auf den Roman „Der hinkende Teu fel" (deutsch 1711) des französischen Schriftstellers Alain-René Lesage (1668-1747). Wir haben nämlich ein Theater - Freie Deutsche Bühne, Buenos Aires, das einzige ständige deutschsprachige Exiltheater in La teinamerika, geleitet von Paul Walter Jakob. Wolff - Kurt Wolff (1887-1963); deutscher Verleger und Schrift steller; gründete 1913 den Kurt Wolff Verlag in Leipzig (Verlag der Schriften von Karl Kraus und zahlreicher Expressionisten); seit 1922 Hinwendung zum Kunstbuch; 1930 Liquidation des Ver lags; 1933 Emigration nach Frankreich, Italien, später New York.
4Î7
Tj „Dapbne Herbst“ - Titel eines Romans von Annette Kolb, in dem
die Atmosphäre und Bedeutung der Kunststadt München vor 1914 geschildert werden. Familie Netti - Familie von Anna Scghers, geb. Netty Reiling. Bodo - Bodo Uhse. Kantors - Alfred und Friedl Kantorowicz. 74 Katz und llscben - Otto Katt (189J-1932); Pseudonym André Si mone; tschechoslowakischer Schriftsteller und Journalist; mit Alex ander Abusch einer der beiden Redakteure des „Braunbuchs über Reichstagsbrand und Hitler-Terror" (Paris 193)); seit 1922 in Berlin; Mitglied der KPD; vor 1933 Direktor der Piscator-Bühne und Leiter des Verlages der Internationalen Arbeiterhilfe; 1933 Emigration nach Frankreich, 1941 nach Mexiko; Mitbegründer der Zeitschrift „Freies Deutschland“; 1946 Rückkehr in die Tschecho slowakei. Egonek - Egon Erwin Kisch (1883-1948). Wieland - Wieland Herzfelde. Rudolf - Rudolf Leonhard (1889-1933); konnte 1940 nicht aus
Frankreich entkommen; wurde aus Le Vernet nach Castres (Aus lieferungslager) verschleppt; nach der Flucht aus Castres Teil nahme am französischen Widerstandskampf. unus ex multis - (lat.) einer von vielen. „Semana lsraelita“ - „Die jüdische Wochenschau“; Zeitung des jüdischen Hilfskomitees Buenos Aires; erschienen 1940 bis 1949. Weil - Bruno Weil (1883-1961); deutscher Schriftsteller; emi grierte 1933 in die USA, 1939 nach Frankreich, von dort nach Ar gentinien; nadi 1943 Vizepräsident des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Bericht im „Aufbau“ - Vgl. den „Brief aus Buenos Aires“, S. 67 dieses Bandes, den B. O. im Frühsommer 1941 sowohl an die Re daktion des „Argentinischen Tageblatts“ (Buenos Aires) als auch an den „Aufbau“ (New York) gegeben hatte. Rössler - Carl Rössler (1864-1949); Münchner Theaterschriftstel ler; emigrierte 1933 nach Wien, 1938 nach London. 73 façon de parier - (franz.) höfliche Umschreibung. Dr. Olbrich - Oscar Olbrich; Arzt, der im Prager Exil mit B. O. befreundet war; emigrierte 1938 mit seiner Frau nach Frankreich und dann nach England. Alexandro Maaß - Vgl. Anm. zu S. 67. Ruth - Ruth Jensen; nahm zusammen mit ihrem Mann Fritz Jen sen, der als Arzt die Interbrigadisten betreute, am Spanienkrieg teil; war mit Bodo Uhse, Thep Balk, Kurt und Jeanne Stern be-
4)8
freundet; schrieb im amerikanischen Exil Erzählungen unter dem Namen Ruth Domino. 76 Rauscbning - Hermann Rauschning (geb. 1887); schrieb als ehe maliger Senatspräsident von Danzig, der 193, demonstrativ aus der NSDAP ausgetreten war, im Exil das Buch „Gespräche mit Hitler“ (1940). „assiette“ - (franz.) Teller, Platz; hier: Lage. mit einer Dose Paprika - Gemeint ist: mit einer Dosis Gift, vgl. Anm. zu S. 61.
77 1 took my chance - (engl.) Ich nahm meine Chance tfahr. Kuh - Anton Kuh (1891-1941); Wiener Feuilletonist und Steg reifdichter; vor 1933 in Wien, Prag und Berlin zu Hause; be redter Gegner von Karl Kraus; antifaschistischer Satiriker; emi grierte 1938 nach England, von dort nach New York. kleine Zeitschrift - Gemeint ist die Zeitschrift „Freies Deutsch land“ (México); erschien von November 1941 bis Juni 1946; Chefredakteure: anfangs Bruno Frei, später Alexander Abusch. 78 Tbompson - Dorothy Thompson (1894-1961); nordamerikanisdie Publizistin, Frau von Sinclair Lewis; als Auslandskorrespondentin vor 1933 in Deutschland; sprach öffentlich aus, daß sich Hitler auf die Dauer nicht an der Macht halten könne; Ausweisung durch die Nazis; hat sich außerordentlich um die Unterstützung deutscher Emigranten in den USA verdient gemacht. 79 Langevin - Paul Langevin (1872-1946); französischer Physiker und Politiker; befürwortete in den dreißiger Jahren eine antifa schistische Volksfrontpolitik; nach 1943 Engagement in der Welt friedensbewegung. Regler - Gustav Regler (1898-1963); Schriftsteller; Anfang der dreißiger Jahre Emigration in die Sowjetunion; Schwiegersohn von Heinrich Vogeler; Spanienkämpfer; 1943 Emigration nach Mexiko; Anschluß an trotzkistisdie Kreise; starb in Indien. Käst - Peter Käst (1894-19,9); sozialistischer Journalist und Autor; vor 1933 Reporter der „Roten Fahne“. B. O. bezieht sich hier auf eine Mitteilung Renns (Ludwig Renn an B. O., México, 24. März 1943), nach der Käst kein Visum für Mexiko erhalten hatte, nach der Besetzung in Frankreich geblieben war und seit Januar 1942 als verschollen galt. Tatsächlich war Käst aber die Flucht aus dem Internierungslager St. Cyprien gelungen; 1945 Rückkehr aus der Schweiz in die damalige sowjetische Besatzungs zone. 80 Streit Mexico-Buenos Aires - Vgl. Nachwort, S. 421 f.; vgl. auch Wolfgang Kießling, „Alemania Libre in Mexiko", Berlin 1974, Bd. 1.
439
8o Siemsen - August Siemsen (1884-1939); Dr. phil., Studienrat; seit 1915 Mitglied der SPD, Reichstagsabgeordneter; 1931 Mit begründer der SAP und Mitglied ihres Parteivorstandes; 1936 Emigration nach Argentinien; Chefredakteur der Zeitschrift „Das Andere Deutschland“; 1952 Rückkehr in die BRD; 19;; Über siedlung in die DDR. DAD — Abkürzung für die Bewegung Das Andere Deutschland (Argentinien) um August Siemsen und die gleichnamige Zeitschrift. Gruppe Vorwärts - Verein Vorwärts, der schon seit 1882 von Verfolgten des Sozialistengesetzes in Argentinien gegründet worden war und auch nach 1933 seine progressiven und sozialistischen Traditionen bewahrt hatte; arbeitete seit 1938 unter der Leitung des deutschen Kommunisten Erich Bunke auf einer konsequent antifaschistischen Basis. Alemania Libre - Bewegung Freies Deutschland (Mexico); vgl. dazu; Wolfgang Kießling, „Alemania Libre in Mexiko“, a. a. O. Strasser-Leute - Gruppe um Otto Strasser (1897-1974), den Gründer der Schwarzen Front; geriet als „linke Gruppe" der Nationalsozialisten in Widerspruch zu Hitler; ihre in der Emigra tion geschaffene Organisation Frei Deutschland! wurde ins Spanische ebenfalls mit Alemania Libre übersetzt.
Paradiese des Teufels. Das Leben Sir Roger Casements Unser Text folgt der Erstausgabe des Universitas-Verlages, Ber
lin 19H83 McQuilland - Louis McQuilland; irisch-englischer Schriftsteller; Erzähler, Dramatiker, Lyriker. Veläsquez - Diego Rodríguez de Silva y Veläsquez (1599 bis 1660); spanischer Maler; seit 1623 Hofmaler Philipps II. in Ma drid. Purser - Sarah Purser; irische Porträtistin, aus Dublin; Ehrenmit glied der Royal Hibernian Academy; 1883/86 Teilnahme an einer Akademie-Ausstellung in London. 84 Stanley - Sir Henry Morton Stanley (1841-1904); englischer Afrikareisender und Kolonialist; später Journalist; 1899 geadelt; erreichte 1876 und 1877 vom Tanganjikasee aus den LualabaKongo und befuhr den noch völlig unbekannten Mittellauf des Kongo bis zu dessen Mündung; eroberte im Auftrag Leopolds II. 1879 bis 1884 große Teile des Kongogebietes für die belgische Krone; 1887 bis 1889 zweite Durchquerung Afrikas.
440
8 j in einem „Offenen Brief an das irische Volk“ - Brief Roger Casements vom 16. September 1914 aus New York, der - mit Casements Unterschrift versehen - am 5. Oktober 1914 im „Irish In dependent“ (Dublin) endiien. Casement sprach offen darin aus, daß die irischen Interessen auf der Seite Deutschlands lägen, und beschwor die Iren, im Falle eines Krieges nicht in die britische Armee einzutreten; Wortlaut des Briefes in: Sir Roger Casement, „Gesammelte Schriften“, Jos. C. Huber Verlag, Diessen vor Mün chen 1917 (2. erweiterte Auflage). 86 Bernard Shaws Urteil - Nach dem Todesurteil für Roger Casement vom 30. Juni 1916 richteten angesehene Persönlichkeiten Englands privat oder öffentlich Gnadengesuche an den Rechtsausschuß im britischen Oberhaus. Auch George Bernard Shaw (18$6-1930) so lidarisierte sich mit Roger Casement; er veröffentlichte im „Man chester Guardian" vom 22. Juli den Appell „Shall Casement hang?“ („Soll Casement hängen?“). 87 Livingstone - David Livingstone (1813-1873); schottischer Mis sionar und Afrikareisender; entdeckte 1849 den Ngamisee; er kundete 1831/32 den oberen Sambesi und durchquerte 1832 bis 1836 das südliche Afrika von Loanda (Angola) bis Quelimane (Mocambique); entdeckte 1833 die Viktoriafälle und 1867 bis 1873 die Kongoquellflüsse. Seine Entdedcungen begünstigten das Vordringen des englischen Kolonialismus in Afrika. Speke - John Hanning Speke (1827-1864); englischer Kolonial forscher; entdeckte mit Richard Francis Burton um die Mitte des 19. Jahrhunderts Tanganjika, den Viktoriasee und den Ursprung des Weißen Nils. Scbweinfurth - Georg Schweinfurth (1836-1923); deutscher Afrikaforscher; bereiste 1863/66 Ägypten und die Küstengebiete Nubiens; entdeckte 1869 bis 1871 das Bahr-el-Ghasal-Bedcen im Obernilgebiet und die Nil-Kongo-Wasserscheide. Nachtigal - Gustav Nachtigal (1834-1883); deutscher Afrikafor scher und später kaiserlidier Kommissar; bereiste 1869 bis 1874 die Sahara und den Sudan; okkupierte 1884 im Auftrage des deutschen Kaiserreiches Togo und Kamerun. Emin Pascha - Mehmed Emin Pascha, eigentlich Eduard Schnitzer (1840-1892); deutscher Arzt und Kolonialist; trat 1876 in ägyp tischen Dienst; Leiter der Medizinischen Hilfe in der Äquatorial provinz (Sudan); reiste im Auftrag Gordon Paschas (vgl. Anm. zu S. 277) nach Uganda und Unyoro; 1878 bis 1889 Gouverneur in der Äquatorialprovinz; seit 1890 im Dienst der Deutsch-Ostafri kanischen Gesellschaft; eroberte für das deutsche Kaiserreich 29
Paradieie
441
88
89
90
91
97
442
Ugogo und Unyamwesi; 1892 als Vergeltung für seine Massaker an den Arabern ermordet. internationale Konferenz - Berliner Kongo-Konferenz, die vom 2,. November 1884 bis 26. Februar 1885 dauerte; vermittelte zwi schen englischen, französischen und belgischen Herrschaftsansprü chen im Kongo so, daß zwar Leopold II. die volle Anerkennung seiner Besitzungen (achtzigmal so groß wie Belgien) erreichte, aber gleichzeitig die „Handelsfreiheit aller Nationen im Kongogebiet“ garantiert war. Joe Conrad - Joseph Conrad, eigentlich Theodor Josef Konrad Korzömowski (1857-1924); englischer Schriftsteller polnischer Her kunft; Kapitän der englischen Handelsflotte; B. O. zog dessen Ro man „Das Herz der Finsternis“ (1902, engl.) als Quelle für sein Casement-Bild heran. Raleigb - Sir Walter Raleigh (um 1JJ2—1618); englischer See fahrer und Entdecker; erfolgreicher Kaperkapitän im Kampf gegen die spanisdie Kolonialflotte; gründete 1584 die englische Nieder lassung Virginia; 1603 bis 1616 unter dem Vorwand einer Ver schwörung gegen Jakobi, eingekerkert; 1618 nach dem Fehlschlag der Eroberung Guayanas hingerichtet. Königin Elisabeth - Elisabeth I. (1,33-1603); Tochter Heinrichs Vni.; seit i,,8 englische Königin; letzte Regentin des Hauses Tudor; förderte die Entwicklung der englischen Handels- und Fi nanzbourgeoisie durch Begünstigung der Schiffahrt und des Han dels. Jakobi. - Jakobi. (1,66-162,); Sohn der Maria Stuart und Darnleys; seit 1,67 als Jakob IV. König von Schottland; nach dem Tode Königin Elisabeths 1603 als Jakob I. bis zu seinem Tode König von England. Lord Clive - Robert Baron Clive of Plassey (1725-1774); An gestellter und Offizier der britischen Ostindienkompanie; als Gouverneur und Oberbefehlshaber Indiens (1764-1767) er oberte er Bihar und Nordorissa; bereicherte sich bei der Ausplünderung Indiens maßlos; 1772 wegen Amtsmißbrauch ver urteilt. Wissmann - Hermann Wissmann (18,3-1905); deutscher Afrika forscher; unterdrückte 1888/89 *m Auftrag der kaiserlichen Regie rung 'die Araberaufstände im damaligen Deutsch-Ostafrika; 1891/96 Gouverneur in Deutsch-Ostafrika. LeopoldII. - Leopold II. (183,-1909); König von Belgien; be rüchtigt durch seine grausame Kolonialpolitik und seine Börsen spekulationen; zog allein aus dem Gummi- und Elfenbeinraubbau
98
100
103
109 131
133
139
140
in den Kongobesitzungen zwischen 189, und 190, ca. 71 Millio nen Francs Reingewinn. Nach den Enthüllungen über die belgischen Greueltaten, die von einer belgischen Untersuchungskommission vor der Weltöffentlichkeit 1904 bestätigt wurden, mußte er 1908 den sogenannten Kongo-Freistaat gegen eine Zahlung von 8 Millionen Goldmark als Kolonie abtreten und auf einen Großteil seiner pri vaten Besitzungen verziditen. Königin Viktoria - Viktoria L, Königin von England (1819-1901); während ihrer Regierungszeit (1837 bis 190t) erlebte England die Blütezeit seiner Industrie- und Kolonialmacht, das legendäre „Vik torianische Zeitalter“. General Sanford - Henry Shelton (1823-1891); amerikanischer Diplomat in Belgien; Unterzeichner der Anerkennungsakte des Kongo-Freistaates 1885. Burenkrieg - Annexion der Burenrepublikcn Transvaal, Kapland und Natal durch den britischen Imperialismus (1899-1902). Lord Lansdowne - Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice Mar quis of Lansdowne (1843-1927); britischer Konservativer; 1900 bis 1905 Staatssekretär, später Minister im Auswärtigen Amt; rich tete 1902 an die Signatarstaaten der Berliner Kongo-Konferenz eine Note, die auf die Mißstände und Greueltaten der belgischen Ko lonialverwaltung hinwies. Das belgische Gegenmemorandum ver anlaßte Lansdowne, Casement mit genauen Untersuchungen in Belgisch-Kongo zu beauftragen. frère, saur et cochon - (franz.) Bruder, Schwester und Schwein; übertragen im Sinne von „mit Kind und Kegel“. „Ein Ritter Bayard ohne Furcht und Tadel“ - Anspielung auf Seigneur de Pierre du Terrail (1476-1524); errang in den italieni schen Kriegen Karls VIII., Ludwigs XII. und Franz' I. den Ruf des tapfersten Ritters der Nation („Chevalier sans peur et sans reproche" [franz.] : Ritter ohne Furcht und Tadel). Sinn Fein - (irisch) Wir selbst; bürgerlich-nationale Bewegung in Irland; 1905 aus verschiedenen patriotischen Gruppen im Kampf um die Unabhängigkeit hervorgegangen; gewann durch aktive, mit den Volksmassen geführte Politik Erfolg; stand bis zum Abschluß des Dominionvertragcs an der Spitze des nationalen Unabhängig keitskampfes. Commis voyageur - (franz.) Geschäftsreisender Grey - Edward Grey, Viscount of Fallodon (1862-1933); briti scher Staatsmann; 1905 bis 1916 Außenminister. die Fahne keiner Nation - Zutreffend für 1932, heute zu Brasilien gehörend.
44 i
IJ4 Hardenberg - Gustav Graf von Hardenberg (1864-19)8); deut scher Konsul; später kaiserlicher Staatsbeamter im Auswärtigen Amt. 15j „Muy buenas, Señor!“ - (span.) „Alles Gute, mein Herr!" 16) Taft - William Howard Taft (1857-1930); sechsundzwanzigster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (1909 bis 1913). Nelson - Horatio Viscount Nelson, Herzog von Bronte (1758 bis 1805); britischer Admiral und populärer Seekriegsheld; sein Sieg über die französisdie Flotte bei Trafalgar (1805) sicherte Großbritannien im 19. Jahrhundert die Vorherrschaft auf den Meeren. Kitebener - Horatio Herbert Kitchener, Earl of Kharthum (1850 bis 1916); britischer Kolonialoffizier; 1892 Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee; unterwarf 1896 bis 1898 den Sudan; „Held“ des Burenkrieges; 1910 bis 1914 Feldmarschall und Oberbefehls haber in Ägypten; 1914 bis 1916 britischer Kriegsminister. 166 De Valera - Eamon De Valera (1882-1975); bürgerlicher irischer Politiker; linker Sinnfeiner; 1916 Teilnehmer am Dubliner Oster aufstand; als gebürtiger Amerikaner nicht zum Tode verurteilt; 1959 Staatspräsident der Republik Irland. Gräfin Markiewicz - Constance Gore-Boothe, Gräfin Markiewicz (1876-1927); irische Freiheitskämpferin, genannt die „grüne Grä fin"; Malerin und Schriftstellerin; leidenschaftliche Parteigängerin des irischen Arbeiterführers und Gewerkschaftsfunktionärs James O’Connolly (1870-1916); Teilnahme am Dubliner Osteraufstand; wurde - weil sie eine Frau war - begnadigt. Brief an die „Times“ - Die Londoner „Times“ hatte in einem Leitartikel Ende 1911 Casements furchtlose Kritik englischer Gum mihandelsgesellschaften wegen ihrer Beteiligung an den Putumayo-Greueln gelobt und gesdirieben, er verdiene dafür „den Dank der Nation". Casements Antwortschreiben konnte nicht nach gewiesen werden. 170 Patriot T. P. O. - T. P. O'Connor (1848-1939); irischer Journalist; Abgeordneter der Irischen Partei seit 1880. 174 Bernstorff - Johann Heinrich Graf Bernstorff (1862-1939); deut scher Gesandter in Washington; schrieb „Deutschland und Amerika. Erinnerungen aus dem fünfjährigen Kriege", Berlin 1920. 175 „Irland, Deutschland und die Freiheit der Meere“ - Englischer Titel „Irland, Germany and the Freedom of the Seas"; in: Sir Roger Casement, „Gesammelte Schriften“, vgl. Anm. zu S. 85. 178 Graf Oberndorff - Alfred M. Graf Obemdorff; Dr. jur.; 1912 bis 1915 deutscher Gesandter in Norwegen.
444
179 Findlay - Sir Findlay (1861-19,2); englischer Diplomat; zeitwei lig englischer Gesandter am Sächsischen Hof; 1911 bis 192, Ge sandter in Norwegen. 182 Findlay-Attentat - Vgl. dazu: Charles E. Curry, „Sir Rogct Ca sement. Seine Mission in Deutschland und die Findlay-Affaire. Auf Grund seiner Tagebücher und Korrespondenzen dargestellt0, Mün chen 1922. 18, Tdgebuebeintragung - Ehe Sir Roger Casement im März 1916 Mün chen verließ und nach Berlin reiste, um von dort aus auf einem deutschen U-Boot nach Irland zu fahren, übergab er angeblich sei nen gesamten schriftlichen Nachlaß, Briefe, Manuskripte und Ta gebücher, an seinen Freund Charles E. Curry, der sie nach münd lichen Instruktionen Roger Casements zuerst veröffentlichte. Aller dings wird die Echtheit der Dokumente von verschiedenen Seiten angczweifelt. H. O. Makey („The Live and Times of Roger Ca sement“, London 1956) hält einige sogar für Fälschungen von tot land Yard beziehungsweise für Abschriften, die Casement während seines Aufenthalts am Putumayo von den Tagebüchern Armando Normands für Scotland Yard angefertigt haben soll. Die Tage bücher Casements befinden sich heute im Public Record Office, London. 18} Devoy - John Devoy (1842-1928); prominenter Führer der Irish Rcvolutionary Associations (amerikanischer Zweig der Irish Republican Brotherhood, der damals illegal in Irland für den Auf stand arbeitenden paramilitärischen Organisation, abgekürzt I. R. B.); während des ersten Weltkriegs wichtiger Verbindungsmann zwischen Deutschland und Sinn Fein; enger Vertrauter Roger Ca sements. 186 Wilbelmstraße — Sitz des Auswärtigen Amtes in Berlin. 190 Redmond - John Edward Redmond (18,6-1918); bürgerlicher irischer Politiker; führte seit 1891 den linken Flügel der Irischen Nationalpartei, seit 1900 die Vereinigte Irische Nationalpartei; beschränkte sich im Kampf um Selbstbestimmung auf parlamenta rische Methoden und unterstützte bei Ausbruch des ersten Welt kriegs den Eintritt irischer Soldaten in die englische Armee (2,0000 Iren folgten der englischen Fahne); verlor 1915/16 jede Massenbasis.
192 Betbmann Hollweg - Theobald von Bethmann Hollweg (18,6 bis 1921); konservativer deutscher Politiker; 190, preußischer Minister des Inneren; 1907 Staatssekretär des Rcichsamts des Inneren; 1909 Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident; wegen taktischer Meinungsverschiedenheiten in der Kriegszielfrage von der deut-
44)
192
198
200
201
sehen Schwerindustrie, den Alldeutschen und der Obersten Heeres leitung 1917 gestürzt. Zimmermann - Arthur von Zimmermann (1864-1940); 1911 Un terstaatssekretär im -Auswärtigen Amt; hatte neben Bethmann Hollwcg, von Jaguw, Graf Bernstorff und anderen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes während Cascments „Deutschland-Mission“ häufig Verbindung mit diesem. Monteith - Robert Monteith (geb. um 1880); Verbindungsmann des irischen Revolutionskomitees (vorbereitender Ausschuß für den Dubliner Aufstand 1916) zu Roger Casement in Deutschland; ehe maliger Organisator der Irish Volunteers; Mitglied der Irischen Brigade; lebte nach Austritt aus der englischen Armee als Emi grant in New York; schrieb das Buch „Casements Last Adventure", Dublin 19 5 j. Malcolm - James Malcolm (1887-1916); Deckname John Plunkett; Verbindungsmann zu Casement; als einer der Organisatoren des Ostcraufstandes 1916 und Unterzeichner des Aüfstandsappells hingerichtct. Gräfin Blücher - Evelyn Blücher von Wahlstatt; veröffentlichte Erinnerungen unter dem Titel „Tagebuch 1914-1918“, München 1924.
2 12 Nevinson - Henry W. Nevinson (1856-1941); englischer liberaler Journalist.
Antifaschistische Publizistik Anno viernnddreißig in der UdSSR (S. 219) Quelle: Das Wort (Moskau), 1958, Nr. 2. Dieser Artikel, eine Retrospektive, bestätigt, was B. O. im Anschluß an seine einzige Reise in die Sowjetunion (1934) für mehrere Zeitungen und Zeit schriften in verschiedenen Ländern zu Protokoll gegeben hat. Ei nige Aufsätze, deren Gegenstände in größeren Arbeiten aufge gangen sind, wurden in unserer Auswahl nicht berücksichtigt, z. B.: „Mit Oskar Maria Graf in der Sowjetunion“, NTB, 1935, Nr. 4; „Bei Maxim Gorki“, NWB, 1934, Nr. 36; „Die Mädchen von Baku“, NWB, 1935, Nr. 5; „Was man in Moskau kauft“, Pariser Tageblatt, 1934, Nr. 5. Die Aufsätze, die in der DZZ, Moskau, erschienen sind, waren nicht erreichbar. 22) Bloch - Jean-Richard Bloch (1884-1947); französischer Schrift steller und Publizist; seit 1921 Mitglied der KP Frankreichs; gründete 1937 zusammen mit Aragon die antifaschistische Tagcs-
446
zcitung „Ce soir"; 1941 Emigration in die UdSSR; Kommentator beim Moskauer Rundfunk. 22} Hu-Lan-Sebi - B. O. gab den Namen dieser Frau in seinem Auf satz über Maxim Gorki (vgl. S. 25 j dieses Bandes) mit Lü-Tang wieder. Oskar Maria Graf berichtet den gleichen Vorgang über Emi Siao, Willi Bredel spricht in „Besuch bei Gorki“ (1L, 1936. Nr. 9) nur von einer „chinesischen Schriftstellerin“. Moskauer Wunderdinge (S. 234) Quelle: Pariser Tageblatt, 1934, Nr. 278. 235 Kolzow - Michail Jefimowitsch Kolzow (1898-1942); sowjetischer Journalist und Schriftsteller; 1922 bis 1938 ständiger Mitarbeiter der „Prawda“; zeitweilig Leiter des sowjetischen Zeitungs- und Zcitschriftenunternehmens „Shurgaz“; 1934 Organisator des Ersten Allunionskongresses der Sowjetschriftsteller in Moskau.
238 239
240
241
Moskauer Bübnenfestspiele (S. 238) Quelle: Pariser Tageblatt, 1934, Nr. 296. Pasternak - Boris Leonidowitsch Pasternak (1890-1960); russisch sowjetischer Lyriker, Romancier und Übersetzer. Meyerhold - Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold (1874-1942); prägte praktisch und theoretisch den „Theateroktober“, strebte nach Revolutionierung des Theaters. Tairow - Alexander Jakowlewitsch Tairow (1883-1930); einer der bekanntesten Reformatoren des Moskauer Theaters in den zwanzi ger und dreißiger Jahren; leitete 1914 bis 1949 das von ihm be gründete Moskauer Kammertheater. „A bas l’art réactionnaire!" - (franz.) „Nieder mit der reaktionä ren Kunst!“ Alejchem - Schölern Rabinowitsch AIejehern (1839-1916); jüdi scher Schriftsteller und Klassiker der jüdischen Theaterliteratur. Slawin - Lew Issajewitsch Slawin (geb. 1886); russisch-sowjetischer Dramatiker. Trenjow - Konstantin Andrejewitsch Trenjow (1876-1943); rus sisch-sowjetischer Dramatiker; stellte in seinem Schauspiel „Ljubow Jarowaja“ (1926), einem Bürgerkriegsstück, den Konflikt zwischen subjektiver Neigung und gesellschaftlichem Pflichtgefühl anhand einer Liebesgeschichte dar. Wischnewski - Wsewolod Witaljewitsch Wischnewski (1900-1931); sowjetischer Dramatiker; seit dem Bürgerkrieg mit der sowjetischen Armee und Flotte verbunden; Werke: „Die erste Reiterarmee“ (1930) ; „Optimistische Tragödie“ (1932), „Wir aus Kronstadt“ (1936).
447
241 Bernhardt - Sarah Bernhardt (1844-1923); französische Schau spielerin von Weltruhm; seit 1872 Mitglied, später Teilhaberin der Comédie Française; spielte als eine der ersten Schauspielerin nen auch Männerrollen. Ein russischer Trauertag (S. 243) Quelle: NTB, 193 b Nr. 22. 244 Jules-Verniade - Anspielung auf Jules Verne (1828-1905), „Fünf Wochen im Ballon“, deutsch 1887. Seltsame Abenteuer eines Dichters (S. 246) Quelle: NTB, 1935, Nr. 4 und 5. Dieser Bericht korrespondiert mit den Bemerkungen Grafs über B. O. (vgl. dazu: Oskar Maria Graf, „Reise in die Sowjetunion 1934“, Verlag der Nation, Berlin 1977)247 Malraux - André Malraux (1901-1976); französischer Schriftstel ler; in den dreißiger Jahren aktives politisches Auftreten gegen den Faschismus; Mitglied des Internationalen Antifaschistischen Komitees, Vorsitzender des Komitees zur Befreiung Thälmanns, Fliegeroffizier im spanisdien Bürgerkrieg; Teilnahme an der Rési stance; 1945/46 und 1958 Minister in der Regierung de Gaulle. Tscheljuskin-Helden - Das sowjetische Forschungsschiff „Tschelj uskin“ war im Juli 1933 zu einer Arktis-Expedition ausgelaufen und im Eis gesunken. Die Mannschaft konnte durch sowjetische Flieger gerettet werden. Das Schicksal der Tscheljuskin-Mannschaft war damals in aller Munde.
Tschapajew-Film (S. 250)
Quelle: NWB, 1935, Nr. 10 zu dem Tonfilm „Tschapajew“ der Brüder Sergej und Grigori Wassiljew. 251 Furmanow — Dimitri Andrejewitsch Furmanow (1891-1926); schrieb als ehemaliger Kriegskommissar der Tschapajcw-Division eine weitverbreitete Tschapajew-Biographie. Maxim Gorki (S. 253)
Quelle: NTB, 1936, Nr. 27. 256 le nombril de la terre - (franz.) der Mittelpunkt der Erde. Die schöne Literatur (S. 258)
Quelle: NWB, 1937, Nr. 6. 258 intra wie extra muros - (lat.) innerhalb wie außerhalb der Mau ern.
448
Zum Tode Rudolf Thomas' (S. 260) Quelle: Pariser Tageszeitung, 16-/17. Oktober 19)8. 260 Atrozitäten - Scheußlichkeiten. „Pariser Tageblatt" - Antifaschistische Tageszeitung der deutsch sprachigen Emigranten; erschien vom 12. Dezember 193) bis- 11. Juni 1936 unter der Leitung von Georg Bernhard; ab 12. Juni 1936 bis Februar 1940 als „Pariser Tageszeitung“ fortgeführt; seit An fang 1937 Chefredakteur; Carl Misch. 261 Republik Masaryks - Gemeint ist die Tschechoslowakische Repu blik, die in der Zeit von 1918 bis 1937 von verschiedenen bürgerlichen Koalitionsregierungen geführt wurde, sich stark am britischen und amerikanischen Imperialismus orientierte. Mit anti kommunistischen Vorbehalten belastet, schlug sie das Bündnisan gebot der Sowjetunion aus und fiel mit dem Münchner Abkommen 1938 in die Hände der deutschen Faschisten. „Prager Tagblatt“ - Gegründet 1876; war bis in die Zeit der ersten Tschechoslowakischen Republik die größte liberale deutsche Tageszeitung in Böhmen; stellte 1938 ihr Erscheinen ein. 263 „Die Neue Weltbübne“ - Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft; erschien nach dem Verbot der Berliner „Weltbühne“ (7. März 1933) zunächst als „Wiener Weltbühne“ und wurde nach ihrer Übersiedlung nach Prag als „Die Neue Weltbühne“ zu einer wichtigen Exilzeitschrift; Chefredakteur Willi Schlamm wurde im März 1934 von Hermann Budzislawski abgelöst (vgl. Anm. zu S. 393); bis zum 2. Juni 1938 erschien die Zeitschrift wöchent lich in Prag, dann in Paris; Ende August 1939 wurde sie auf gelöst. „Bohemia“ - Älteste deutschsprachige Tageszeitung in der Tsche choslowakei; 1828 als „Untcrhaltungsblätter“ gegründet; seit 1918 im Besitz der deutschen Zeitungs-A. G. Havastelegramme - Telegramme der Agence Havas (französische Nachrichtenagentur).
Ja und Nein (S. 265) Quelle: NDB, 1935, Nr. 3. Zu: Bruno Frank, „Cervantes“, Roman, Querido, Amsterdam 1934; Peter de Mendelssohn, „Das Haus Cosinsky“, Roman, Oprecht und Helpling, Zürich 1934.
Ein Dutzend Steckbriefe (S. 268)
Quelle: NDB, 1935, Nr. j. Zu: Willi Bredel, „Die Prüfung“, Roman, Malik-Verlag, London >93 5-
449
27° Haarmann - Gefürchteter Serienmörder in den zwanziger Jahren; zwischen 1918 und 1923 Polizeispitzel in Hannover. Kürten - Wurde wegen Mordes an mindestens neun Menschen vom Düsseldorfer Schwurgericht zum Tode verurteilt. Wesemänner - Hans Wesemann, ehemaliger Völkerbundjournalist, ab 1933 Spitzel der Deutschen Botschaft in Paris, seit 1934 im Dienste der Gestapo, hatte die Entführung des emigrierten Welt bühnenautors Berthold Jacobs aus der Schweiz nach Nazideutsch land inszeniert. Der Unpolitische (S. 271)
Quelle: NWB. 1935, Nr. 11. 271 Tischrede - Thomas Mann befand sich in der zweiten Januar hälfte 1935 auf einer Vortragsreise, die ihn über Prag nach Brünn, Budapest und Wien führte. Im April 1933 ließ er auf der Nizzaer Tagung des Comité International pour la Coopération Intellec tuelle einen Beitrag verlesen, in dem er erstmals wieder öffent lich zu aktuellen politischen Fragen Stellung nahm. 272 „Berliner Tageblatt" - 1872 von Rudolf Mosse als Berliner Lokal blatt gegründet; nach 1918 bürgerlich-demokratische Tageszeitung unter Chefredakteur Theodor Wolff. Catilinas - Catilina (108-62 v. u. Z.) hatte bei römischen Kon sulatswahlen dreimal eine Niederlage erlitten und versuchte, mit tels einer Verschwörung die Macht zu erlangen. „Quousque tandem" - (lat.) „Wie lange noch“; Beginn der Rede Ciceros im Senat, die Catilina entlarvte: „Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra" („Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld mißbrauchen"). 274 à tout prix - (franz.) um jeden Preis. Eine Biographie des Nil (S. 275) Quelle: NTB, 1935, Nr. 52. Zu: Emil Ludwig, „Der Nil. Lebens lauf eines Stromes", 1. Band, Qucrido, Amsterdam 1933. 273 Goût - (franz.) Geschmack, Neigung, Stil. 276 Tagesfrage Abessinien - Mit dem Überfall des faschistischen Ita lien auf das unabhängige Kaiserreich Äthiopien im Oktober 1935 begannen die militärischen Expansionen des europäischen Fa schismus. Die Aggression führte 1936 zur Vereinigung der italieni schen Besitzungen Eritrea und Somaliland in der Kolonie Italie nisch-Ostafrika. 277 Baker - Samuel Baker (1821-1893); englischer Kolonialist; 1869 erhielt er vom Khediven Ägyptens den Auftrag, in Äquatoria
450
einen Verwaltungsapparat aufzubauen, dem Sklavenhandel ent gegenzutreten und die Handelswege für die europäischen Groß mächte zu eröffnen. 277 Gordon - Charles George Gordon Pascha (1855— 1883); seit 1877 Generalgouverncur (englischer Herkunft) im Sudan. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die ägyptischen Sklavenhändler betrieb er eine Politik der Ausschaltung Ägyptens zugunsten Groß britanniens. Der letzte Zivilist (S. 278) Quelle: NTB, 19)6. Nr. 3. Zu: Ernst Glacser, „Der letzte Zivilist“, Roman, Humanitas-Vcrlag, Zürich 1935. 278 Wer noch ein Herze hat, dem soll's im Hasse nur sieb rühren. .. Freies Zitat aus dem „Lied vom Hasse“ („Gedichte eines Leben digen“, i. Teil, 1841) von Georg Herwegh. 279 Streichertyp - Anspielung auf den Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“, Julius Streicher (1883-1946), der seinen zynischen Rassenhaß vor allem in verzerrenden Karikaturen jüdi scher Bürger äußerte. 28 t Dégoût - (franz.) Abscheu, Ekel. Notwendige Kritik (S. 28}) Quelle: NTB, 1936, Nr. 17. Zu: Konrad Merz, „Ein Mensch fällt aus Deutschland. Bericht“, Querido, Amsterdam 1936. 283 Bericht aus Dachau - Fabian Stietencorn, „Reichslager Dachau“, als Fortsetzungsdruck 1936 im „Pariser Tageblatt“ veröffentlicht. Seger - Gerhart Seger (1896-1967); vor 1933 Reichstagsabgeord neter der SPD und Generalsekretär der Deutschen Friedcnsgescllschaft; 1933 Häftling im Konzentrationslager Oranienburg; Flucht und Emigration in die Tschechoslowakei; Verfasser des Berichts „Oranienburg“ (mit einem Geleitwort von Heinrich Mann), Karls bad 1934. 283 Merz - Kurt Lehmann, Pseudonym Konrad Merz (geb. 1908); Psychotherapeut; im Exil Mitarbeiter des „Neuen Tage-Buchs“ und verschiedener holländischer Zeitschriften. Klaus Mann sprach in seiner Rezension zu „Ein Mensch fällt aus Deutschland“ anerken nend über Buch und Autor (vgl. dazu: Klaus Mann, „Prüfungen“, Schriften zur Literatur, München 1968). Notwendige Replik (S. 288) Quelle: NTB, 1936, Nr. 19. Zu: Menno ter Braak, „Notwendige Kritik", in: NTB, 1936, Nr. 19.
4SI
289 Hamsun - Knut Hamsun (1839-1952); norwegischer Schriftsteller; Nobelpreisträger von 1920; kollaborierte mit dem Hitlcrfaschismus; seit 1955 Mitglied der Nationalsozialistischen Partei Norwegens; wurde 194} von einem norwegischen Gericht als Landesverräter und Quisling zu einer hohen Geldbuße verurteilt. 291 ter Braak - Menno ter Braak (1902-1940); niederländischer Schriftsteller und Kritiker; wies B. O.'s Polemik gegen Konrad Merz als „Irreführung" und „groteske Verzerrung“ zurück.
Traumgeführten (S. 294) Quelle: NWB, 19)6, Nr. 21. Zu: Leonhard Frank, „Traumgefähr ten", Roman, Querido, Amsterdam 1936. 29; Entrée - (franz.) Eintritt, Beginn. ins Pittigrilleske - Nach Art des Pittigrilli, eines italienischen Kol portageschriftstellers, dessen laszive. Romane in den zwanziger und dreißiger Jahren viel gelesen wurde. Heinrich Mann über Pacbulke (S. 297) Quelle: NWB, 1936, Nr. 34. Zu: Heinrich Mann, „Es kommt der Tag“, Aufsätze, Europa-Verlag, Zürich 1936. 297 Fafnirlist - Fafnir ist in der germanischen Heldensage der Dra che, den Siegfried erschlug. 298 „Ein Ungeziefer ruht. . - Zeile aus dem Gedicht „Die öffent lichen Verleumder" von Gottfried Keller.
Heinrich Mann und Bismarck (S. 301) Quelle: NWB, 1936, Nr. 35. 301 1S64 - Dänisch-Deutscher Krieg; wurde im April 1864 mit dem preußischen Sieg auf den Düppeler Schanzen entschieden. 1S66 - Deutsch-Österreichischer Krieg; hatte die Auflösung des Deutschen Bundes und den Anschluß Österreichs, die Annexion einer Reihe von Kleinstaaten sowie die Bildung des Norddeut schen Bundes zur Folge. 1S70 - Emser Depeschenfälschung; Wilhelm I. hatte in einer Un terredung mit dem französischen Gesandten die Forderung Na poleons III. nach Verzicht der Hohenzollern auf den spanischen Thron abgelehnt, weitere Verhandlungen allerdings nicht aus geschlossen. Bismarck formulierte diese aus Bad Ems eingetroffene Nachricht in der „Emser Depesche“ mit provokativer Ausschließ lichkeit so, daß Frankreich Preußen darauf am 19. Juli 1870 den Krieg erklärte. 303 Gloire - (franz.) Ruhm, Ehre.
452
Bemerkungen - Führer u. Co. (S. 304) Quelle: NWB, 1936, Nr. 44. Zu: Rudolf Leonhard, „Führer & Co.“ Eine politische Komödie, Edition du Phénix, Paris 1936. 304 Tamerlan - Timur-Leng (der Lahme), auch Timur (1336-1405); Herrscher des Mongolenreiches; Förderer der Wissenschaften und der Künste. 301 Daudet - Léon Daudet (1867-1942); französischer Schriftsteller und Politiker; Sohn von Alphonse Daudet; Gründer der „Action Française", des Kampforgans der klerikalen Monarchisten und französischen Faschisten. Renn und Graf (S. 306) Quelle: NWB, 1936, Nr. 45 (I. Vor großen Wandlungen); Nr. 46 (II. Der Abgrund). Zu: Ludwig Renn, „Vor großen Wandlungen“, Roman, Oprccht, Zürich 1936; Oskar Maria Graf, „Der Abgrund“, Roman, Malik, London 1936. 307 Heinkel-Werk - Benannt nach Ernst Heinkel (1880-1950); deut scher Flugzeugkonstrukteur; maßgeblich beteiligt am Aufbau der faschistischen Luftwaffe. 308 van der Lubbe - Marinus van der Lubbe; holländischer Anar chist; Mitangeklagter im Leipziger Reichstagsbrandprozeß im De zember 1933; von den Nazis bei der Brandlegung als Werkzeug mißbraucht, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Herostrat - Hcrostrat steckte 356 v. u. Z. aus Geltungssucht den Artemistempcl in Ephesos in Brand. 310 Auer - Ignaz Auer (1846-1907); seit 1869 Mitglied der SDAP; 1875 Wahl zum Sekretär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei; Lassallcaner; Rcichstagsabgeordneter; enger Mitarbeiter August Bcb'els; trat gegen die tradcunionistischen Bestrebungen in den Ge werkschaften auf. Vollmar - Georg Heinrich von Vollmar (1850-1922); neben Bern stein führender Revisionist innerhalb der Sozialdemokratie; be fürwortete die Kolonialpolitik und die Eroberungsprogramme Wilhelms II. Grillenberger - Karl Grillenberger (1848-1897); Mitglied der So zialdemokratischen Arbeiterpartei und der Internationalen Metallarbciter-Gewerkschaftsgenossenschaft ; unterstützte Vollmar und hatte wesentlichen Anteil’ an der Durchsetzung opportunistischer Auffassungen in den Führungsgremien der SDAP in Bayern.
311 „Krapüle“ - Gesindel. 312 Schufo - Schutzformation; halbmilitärisch organisierte und ausge bildete Formation des Reichsbanners; 1930 gegründet; schützte
45 J
die Versammlungen und das Eigentum der Parteien des Reichs banners, insbesondere der SPD und der Freien Gewerkschaften, gegen den Naziterror; wurde aber auch zu arbeiterfeindlichen Aktionen mißbraucht. Der unbekannte Barde (S. 514)
Quelle: DZZ, 19)6, Nr. 39. 315 Riefenstabl - Leni Riefenstahl (geb. 1907); Schauspielerin und Regisseurin im Dienste der faschistischen Kulturpolitik; Reichs parteitagsfilm „Triumph des Willens“ (1934). Film über die Olym piade 1936 in Berlin. Die Funken - Landsknechtsformation; später Narrentanzgruppc beim Kölner Karneval. Zu Ernst Thälmanns ¡0. Geburtstag (S. 317)
Quelle: DZZ, 1936, Nr. 88. 317 Der Einzelgefangene Ernst Thälmann - Ernst Thälmann erlebte seinen 50. Geburtstag im Gefängnis Berlin-Moabit. Die weltweite Solidaritätsbewegung für seine Freilassung galt auch gleichzeitig der Befreiung Ossietzkys, Mierendorfis und aller anderen antifa schistischen Opfer des Naziterrors. Neue politische Epik (S. 318) Quelle: NWB, 1937, Nr. 2. Zu: Hermann Wendel, „Die Marseil laise. Biographie einer Hymne", Europa-Verlag, Zürich 1936; Klaus Mann, „Mephisto“, Roman, Querido, Amsterdam 1936; Josef Wittlin, „Das Salz der Erde“, Roman, Allert de Lange, Amster dam 1936; Willi Bredel, „Der Spitzel", Erzählungen, Malik, Lon don 1936. 318 Wendel - Hermann Wendel (1884-1936); Journalist und Schrift steller; gebürtiger Elsässer; 1933 Emigration nach Frankreich; Mitarbeiter des NTB. Rouget - Claude-Joseph Rouget de Liste (1760-1836); französi scher Offizier. Wenige Tage nach Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Österreich/Preußen schrieb er in Straßburg den „Kriegsgesang der Rheinarmee“, der vom Marseiller FrciwilligenBataillon nach der Bildung der revolutionären Commune bei der Erstürmung der Tuilerien unter der roten Fahne gesungen wurde, von da an als Revolutionsgesang galt und den Namen „Mar seillaise“ erhielt; 1795 erklärten die Jakobiner die Marseillaise zur Hymne der bewaffneten Streitkräfte der Französischen Repu blik.
454
)2i Kalibanokratie - Eine Gesellschaft von Barbaren; abgeleitet von Kaliban, einer Figur - halb Tier, halb Mensch - aus Shakespea res „Sturm“. 321 Wittlin - Josef Wittlin (geb. 1896); polnischer Schriftsteller; stu dierte Philosophie in Wien und Lemberg; Dozent an einem Theater seminar; floh 1941 vor den Nazis nach New York. 324 Carl Burmeister, Rudolf Esser, Rudolf Lindau - Die Widmung bei Bredel lautet: „Meinen Genossen und Freunden, den Jungkom munisten Carl Burmeister, der, aus dem Konzentrationslager Ham burg-Fuhlsbüttel entlassen, die illegale Arbeit wieder aufnahm und bei seiner zweiten Verhaftung nach stundenlangen Mißhand lungen aus dem fünften Stock des Folterhauses des .Kommandos zur besonderen Verwendung* gestürzt wurde; Rudolf Esser, der, aus dem Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel entlassen, die illegale Arbeit wieder aufnahm und bei seiner zweiten Verhaf tung totgeprügelt wurde; Rudolf Lindau, der im Januar 1934 im Hamburger Untersuchungsgefängnis enthauptet wurde". (Zitiert nach: Willi Bredel, „Der Spitzel“, Verlagsgenossenschaft Auslän discher Arbeiter in der UdSSR, Moskau und Leningrad 1936.) Gerbart Hauptmanns Novum (S. 326)
Quelle: IL, 1937, Nr. 1. Zu: Gerhart Hauptmann, „Im Wirbel der Berufung“, Roman, S. Fischer Verlag, Berlin 1936. 336 Spielbagen-Poesie - Anspielung auf Friedrich Spielhagen (1829 bis 1911); erfolgreicher bürgerlicher Romancier nach 1848; anachro nistisches und illusionäres Gesellschaftsprogramm. Der humpelnde Reporter (S. 338) Quelle: Das Wort (Moskau), 1937, Nr. 3. Zu: Egon Erwin Kisch, „Landung in Australien", Reportagen, Allert de Lange, Amster dam 1937.
Der falsche Nero (S. 344)
Quelle: Das Wort (Moskau), 1937, Nr. 6. Zu: Lion Feuchtwangcr, „Der falsche Nero“, Roman, Querido, Amsterdam 1936. 348 Tacitus - Publius Cornelius Tacitus (um jj-um 120); römischer Geschichtsschreiber; Prokonsul der römischen Provinz Asien; schil derte in den „Annales Abcxcessu divi Augusti" (Vom Tode des Augustus) auch Abschnitte der Regierungszeit des Nero. Sueton - Tranquillus Gaius Sueton (um 70-um 150); römischer Philologe und Biograph; Privatsekretär Kaiser Hadrians; besaß Zutritt zu den kaiserlichen Archiven.
455
348 Dio Cassius - Dio Cassius (um 15J-229); griechischer Histo riker; beschrieb die Zeit von der Gründung Roms bis 229 in 80 Büchern. Sein Werk ist eine der Hauptquellen für die Geschichte des Altertums. Zonaras und Xipbilin - Johannes Xiphilinos Zonaras; byzanti nischer Schriftsteller in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts; schrieb die „Annales", die durdi Auszüge aus den verlorenen Tei len des Dio Cassius sehr wichtig sind und die Ereignisse von der Erschaffung der Welt bis 1118 darstellen. Apokalypse des Johannes - Letztes Buch des Neuen Testaments (Offenbarung des Johannes) ; endet mit einer Vision des Jüngsten Gerichts. Viertes Buch der Sibylle - Gemeint sind die Bücher der Sibylle von Cumae (Süditalien). Mit dem Apollon-Kult erwarben die grie chischen Orakelverse auch unter den Römern Beachtung. Der Überlieferung nach befanden sich die Schriften der Sibylle von Cumae im Besitz des letzten Königs von Rom (Tarquinius Super bus). Schicketes Flaschenpost (S. 350) Quelle: NWB, 1937, Nr. 20. Zu: René Schickele, „Die Flaschen post“, Verlag Allert de Lange, Amsterdam 1937. 3,1 Tue! Tue! - (franz.) Tötel Tötel Krapotkin - Pjotr Alexejewitsch Fürst Krapotkin (1842-1921); russischer Anarchist und Volkstümler; floh 1876 nach West europa; 1917 Rückkehr nach Rußland; begrüßte die Oktoberre volution. Stirner - Max Stirner (1806-1856); Philosoph, Junghegelianer; Hauptwerk „Der Einzige und sein Eigentum" (1845); Begründer des philosophischen Anarchismus. Alfonso XIII. - Alfonso XIII. (1886-1941); spanischer König, re gierte von 1902 bis 1931; betrieb, gestützt auf den katholischen Klerus und die Armee, eine extrem arbeiterfeindliche Innenpolitik; begünstigte 1923 die faschistische Diktatur Primo de Riveras; wurde 1931 gestürzt und emigrierte in das faschistische Italien. 354 Goyas Desastres de la guerra - Francisco Goyas (1746-1828) be rühmte Graphikfolge „Plagen des Krieges“. Die Versuchung (S. 356)
Quelle: NWB, 1937, Nr. 34. Zu: F. C. Weiskopf, „Die Versu chung", Roman, Verlag Oprecht, Zürich 1937.
456
Schriftsteller Goebbels (S. 358)
Quelle: Das Wort (Moskau), 1958. Nr. 1. Zu: Joseph Goebbels, „Der Angriff. Aus der Kampfzeit“, Franz Eher, München 1935. 358 „Angriff“ - Der Titel bezieht sich auf die Zeitung „Der Angriff"; 1927 gegründet; erschien bis 1930 als Montagszeitung mit dem demagogischen Untertitel „Für die Unterdrückten. Gegen die Aus beuter"; Herausgeber war Joseph Goebbels; ab 1930 Tageszeitung. 363 Barnowsky - Victor Barnowsky (1873-1952); Schauspieler, Re gisseur und Theaterleiter im Berlin der zwanziger Jahre. „Bolwieser“ und „Sitlinger“ (S. 364) Quelle: NWB, 1938, Nr. 28. Zu: Oskar Maria Graf, „Bolwieser“, Roman, Malik, London 1937. Oskar Maria Graf, „Anton Sittinger", Roman, Malik, London 1937. Der Märtyrer - Für Carl von Ossietzky (S. 369)
Quelle: NWB, 1938, Nr. 19. Der Zusatz „Für Carl von Ossietzky“ stammt von der Herausgeberin. Carl von Ossietzky war am 4. März 1938 an den Folgen jahrelanger KZ-Haft im Sanatorium Nordend, Berlin-Niederschönhausen, gestorben. Oldens Beitrag erschien innerhalb einer Reihe erster Würdigungen für den anti faschistischen Publizisten und Fricdensnobelpreisträger von 1936. Gedichte von Alfred Kerr (S. 370) Quelle: NWB, 1939, Nr. 1. Zu: Alfred Kerr, „Melodien“. Ge dichte. Edition Nouvelles Internationales, Paris 1938. B. O.'s temperamentvolle Kritik an der Lyrik Kerrs gab Anlaß zu heftigen Erwiderungen und Ehrenrettungen des antifaschistischen Autors. Kisch versuchte in seinem Beitrag „Zu Balder Oldens Kerr-Kritik“, NWB, 1939, Nr. z, zu vermitteln, da die Polemik der Sammlungsbewegung unter den Hitlergegnern objektiv schadete. Auch die Redaktion der NWB wandte sich gegen die Verken nung der Bündnisfragc und gab Kerr in der NWB, 1939, Nr. 3, Gelegenheit zur Verteidigung. Kerr äußerte sich heftig und bis sig. Die Redaktion zitierte in der Spalte „Antworten“ in Nr. 5, 1939, noch einmal aus einem Brief B. O.'s und beendete die Dis kussion, die viel Staub aufgewirbelt hatte, B. O. aber nicht bewog, seine Meinung zu ändern. 370 Kersten - Kurt Kersten (1891-1962); Schriftsteller; 1934 Emi gration in die Schweiz; 1940 in Marokko, von 1940 bis 1945 in La Martinique; seit 1946 in den USA; Rückkehr in die BRD; 1939 und 1940 Herausgeber des Deutschen Freiheitskalenders. jo
Paradiese
4J7
}7O „Roter Tag“ - Gemeint ist „Der Tag“, eine in gründete nationale Tageszeitung: wegen ihrer im Voljcsmund „Roter Tag“ genannt. 571 Peregrinus - Kurt Friedländer (geb. 1899); Emigration nach Schweden; seine Arbeiten schwedischen Übersetzungen.
Berlin um 1900 ge roten Überschriften Schriftsteller; 1933 erschienen nur in
Ausgebürgerter Unruh (S. 373)
Quelle: Pariser Tageszeitung, 9. August 1939. Zu: Anlaß war die Veröffentlichung der Ausbürgerungsliste Nr. 140. Dort wurde das Geburtsjahr Unruhs fälschlich mit 1884 angegeben. Der Schriftstel ler wurde am 10. Mai i88j geboren. 374 Reinhardt - Max Reinhardt (1873-1943); Schauspieler und Thea terleiter; verhalf durch seine Regiekunst dem deutschen Theater in den zwanziger Jahren zu Weltruf; 1933 Emigration nach Österreich, 1938 in die USA, wo er als verarmter Schauspicllehrcr starb. Der Vulkan (S. 373)
Quelle: NWB, 1939, Nr. 32. Zu: Klaus Mann, „Der Vulkan“, Ro man, Querido, Amsterdam 1939. 376 Minero - (span.) Bergarbeiter. Spruch auf den Weg - Für Egon Erwin Kisch (S. 377)
Quelle: Pariser Tageszeitung, 24. Dezember 1939. Der Zusatz zur Überschrift „Für Egon Erwin Kisdi" stammt von der Heraus geberin. Die deutsche Literatur heute und . . . ? (S. 3 80) Quelle: „Zehn Jahre Aufbauarbeit in Südamerika“. Ein Sammel band. Herausgegeben von der Asociación Filantrópica Israelita, Buenos Aires 1944. Bedingt durch die Isolation im südamerikanischen Exil, irrte sich B. O. in einigen Fällen bezüglich des Fluchtwegs und der Lebens daten. 383 Wessely - Paula Wessely (geb. 1908); Schauspielerin und Produ zentin; 1929 bis 1944 beim Wiener Theater in der Josefstadt und am Deutschen Theater in Berlin. 384 Binding - Rudolf G. Binding (1867-1938); präfaschistisch-elitärer Lyriker und Erzähler. In einem Brief an Romain Rolland („Ant wort eines Deutschen an die Welt“) erklärte er sein Einverständ nis mit den Faschisten.
4 J8
384 Carossa - Hans Carossa (1978-19,6); Lyriker und Erzähler; schlug 1933 die Wahl in die durch die Nazis „gesäuberte“ Preußi sche Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst, aus, ließ sich jedoch später zum Präsidenten des faschistischen „Europäischen Schriftstellcrvcrbandes “ wählen. Mell - Max Mell (1882-1971); österreichischer Erzähler, Drama tiker und Lyriker; christlich-konservative Haltung; Freund Carossas. von Scholz - Wilhelm von Scholz (1874-1969); konservativer Schriftsteller; bevorzugte als Schriftsteller preußisch-patriotische Stoffe. Strauss - Emil Strauss (1866-1960); Prosaist und Dramatiker; trat 1931 mit Kolbenheyer aus der Preußischen Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst, aus; unterstützte den von den Nazis gegründeten Kampfbund für deutsche Kultur. Schäfer - Wilhelm Schäfer (1868-1952); Erzähler, Publizist, Dramatiker; seine ersten Werke standen im Zeichen des Natura lismus, später betont „völkische“ Haltung; ging folgerichtig mit den Nazis konform. Billinger - Richard Billinger (1890-196)); österreichischer Dra matiker, Lyriker und Erzähler; durdi von Hofmannsthal und Mell gefördert; 1932 Kleistpreis; Heimatdichter. Ewers - Hanns Heinz Ewers (1871-1943); schrieb 1911 den Ro man „Alraune", 193z eine Horst-Wessel-Biographie. 385 Keun - Irmgard Keun (geb. 1910); 1933 Weigerung, der Reichs schrifttumkammer beizutreten; Berufsverbot; 1935 Emigration in verschiedene europäische Staaten; 1940 nicht Freitod, wie B. O. irrtümlich angibt, sondern amerikanisches Exil; lebt heute in der BRD.
386 custodia honesta - (lat.) ehrenvolle Bewachung. 387 Ernst Weiß - B. O. irrt, daß Weiß nichts gegen die Nazis ge schrieben habe. Sein Roman „Der Augenzeuge“, 1963 erst aus dem Nachlaß veröffentlicht, bezieht engagiert Stellung gegen Hitler. 388 Mombert - Alfred Mombert (1872-1942); Dramatiker und Reli gionswissenschaftler; seit 1928 Ordentliches Mitglied der Preu ßischen Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst; 1933 von den Nazis ausgeschlossen; 1940 von der Gestapo in Frankreich verhaftet; in Gurs schwerkrank interniert; von Freunden für 30 000 Franken „freigekauft“; starb in einem Sanatorium in der Schweiz. 389 Holitscber - Arthur Holitscher (1869-1941); linksbürgerlidier, der Arbeiterklasse nahestehender Publizist und Schriftsteller; Mitglied
459
des Bundes Neues Vaterland; bereiste schon 1920 die SU, war ein unermüdlicher Kämpfer für die Freundschaft zwischen allen Völ kern; von den Nazis als „Novembcrverbrcchcr" geächtet; Emigra tion in die Schweiz; starb hier in Armut und Krankheit, nachdem er sich vergeblich um die Einreise in die USA bemüht hatte. 390 Lessing - Theodor Lessing (1872-1933); 1922 bis 1926 Professor für Philosophie an der TH Hannover; emigrierte 1933 in die Tschechoslowakei; wurde am 31. August 1933 an seinem Schreib tisch in Marienbad von Faschisten hinterrücks ermordet. Einstein - Carl Einstein (1885-1940); expressionistischer Erzähler, Dramatiker, Essayist und Lyriker.; kunstwissenschaftliche Studien; Autor der „Aktion"; ging bereits 1930 nach Paris; kämpfte bei den Internationalen Brigaden in Spanien; nahm sich beim Einzug der deutschen Truppen in Frankreich das Leben. Goldschmidt - Alfons Goldschmidt (1879-1940); Professor für Wirtschaftsgeschichte; bekannter linksbürgerlicher Publizist und Propagandist; stand der KPD nahe; Autor zahlreicher Rciscbücher über die Sowjetunion; Mitglied der Vereinigung Freunde der Sowjetunion; emigrierte nach Moskau; ab 1939 wieder in Mexiko; Präsident der Liga für deutsche Kultur in Mexiko, Vor kämpfer der Bewegung Freies Deutschland (Mexico). von Gerlacb - Hcllmut von Gerlach (1866-1935); linksbürger licher Politiker und Publizist, Pazifist; bis 1933 im Vorstand der Deutschen Friedensgescllschaft, der Deutschen Liga für Men schenrechte, des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold; übernahm 1932 die Leitung der „Wettbühne“; an den Vorbereitungen zur Schaf fung einer deutschen Volksfront maßgeblich beteiligt. Wegner - Armin T. Wegner (geb. 1886); Lyriker, Erzähler und Publizist; Besuch der Schauspielschule von Max Reinhardt; wäh rend der zwanziger Jahre Reisen in den Orient und die Sowjet union; 1933 Verbot seiner Bücher; schrieb am 11. April 1933 einen Brief an Hitler: „Ich beschwöre Sie - wahren Sie die Würde des deutschen VolkesI"; Gefängnis und KZ-Haft; emigrierte 1937 nach Italien; lebt heute noch in Rom. 393 Torberg - Friedrich Torberg (geb. 1908); österreichischer Schrift steller, Kritiker und Publizist; 1938 Emigration in die Schweiz; 1939 nach Frankreich; 1940 nach Portugal; seit 1941 in Amerika; 1950 Rückkehr in die Geburtsstadt Wien; bekannt wurde sein historischer Roman über den jüdischen Minnesänger „Süßkind von Trimberg“ (1972); erklärter Antikommunist. Balk — Theodor Balk, eigentlich Fodor Dragutin (1900-1975); jugoslawischer Herkunft; lebte vor 1933 in Berlin; seit 1929 Re
460
dakteur an der „Linkskurve“; 19J5 Emigration in die Tschecho slowakei; bis 1935 in Frankreich; 19)6 bis 1938 als Chefarzt der französischen 14. Internationalen Brigade Teilnahme am Kampf gegen Franco; 1941 Emigration nach Mexiko, hier Autor des Ver lags „El Libro Libre“; nach 194J Chefredakteur jugoslawischer, nach 1948 tschechoslowakischer Zeitungen; lebte zuletzt in Prag. 393 Budzislawski - Hermann Budzislawski (geb. 1901); Journalist; seit 1948 Professor für Journalistik; 1928 Eintritt in die KPD; 1935 Emigration; von 1934 bis 1939 Herausgeber der „Neuen Welt bühne“ (Prag und Paris); im Herbst 1940 Emigration in die USA; 1948 Rückkehr nach Berlin; von 1967 an erneut Herausgeber und Chefredakteur, seit 1971 Herausgeber der „Weltbühne“ (Berlin) ; heute Mitglied des Weltfriedensrates und Mitglied des Büros der Weltföderation der Wissenschaftler. Gumbel - Emil J. Gumbel (1891-1966); Mathematiker und Militärwissenschaftlcr; machte sich in der Weimarer Republik um die Aufdeckung .der Fememorde und militärischer Geheimbünde ver dient; Mitarbeiter der alten „Weltbühne". Koalier - Arthur Koestler (geb. 1905); in den zwanziger Jahren Korrespondent der Ullstein-Presse im Nahen Osten und in der Sowjetunion; 1931 Eintritt in die KPD; 1933 Emigration nach Frankreich; als Korrespondent von „News Chronicle“ Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg; nach seiner Rückkehr aus Spanien Trotzkist und engagierter Antikommunist; lebt seit 1940 in Lon don. 395 Lederer - Joe Lederer (geb. 1907); österreichische Schriftstellerin; vor 1933 in Wien und Berlin; 1933 Emigration nach China; spä ter Aufenthalt in Österreich und Italien; 1938 Flucht nach Eng land.. Das furchtbarste Buch der Weltgeschichte (S. 398)
Quelle: „Argentinisches Tageblatt“ (Buenos Aires), 18. Januar 1944, S. 44. Zu : Schwarzbuch über den Naziterror in Europa, È1 Libro Libre, México 1943. Spanischer Titel: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa. Testimonios de escritores y artistas de 16 naciones. Comité de redacción: Antonio Castro Leal. 398 Molotow - Wjatscheslaw Michailowitsch Skrabin Molotow (geb. 1890); sowjetischer Staatsmann; 1930-1941 Vorsitzender des Rates der Volkskommissare; 1939-1946 Außenminister. Eden - Robert Anthony Eden, Earl of Avon (geb. 1897); bri tischer Politiker; Mitglied der Konservativen Partei; 193J bis 1938 und 1940 bis 194 5 Außenminister.
461
$98 Hüll - Cordell Hüll (1871-1955) ; amerikanischer Politiker; enger Mitarbeiter und Außenminister Roosevelts; im zweiten Weltkrieg trat Hüll für Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ein. Lang, lang ist’s ber... (S. 401)
Quelle: FD, 194;, Nr. 6. 401 Dies irae - (lat.) der Tag des Zorns. 402 cénacles - (franz.) literarische Gesellschaften. Schmied - Rudolf Johannes Schmied (geb. 1906); Sohn eines deutschen Einwanderers in Argentinien; deutschsprachiger Schrift steller und Kinderbuchautor; Freund B. O.’s; starb in Argenti nien. Moissi - Alexander Moissi (1879-19$$); seit 190; Schauspieler am Deutschen Theater in Berlin. Steinrück - Albert Steinrück (1872-1929); Charakterschauspieler, berühmt geworden in Sternheim- und Wedekindrollen; spielte in Berlin und München. Hardekopf - Stefan Wronski, Pseudonym Ferdinand Hardekopf (1876-1954); zentrale Figur des frühen Expressionismus. van Hoddis - Hans Davidsohn, Pseudonym Jakob van Hoddis (1887-1942); expressionistischer Lyriker; schrieb für Waldens „Sturm“ und Pfemferts „Aktion“. Pritzel - Lotte Pritzel (1887-1952); Kunstgewerblerin, bekannte Puppen- und Marionettenschöpferin; eng mit der künstlerischen Zielstellung des Dadaismus und Expressionismus und des Kaba retts der zwanziger Jahre verbunden; „Schwabinger Muse". Hubert - Ali Hubert; Maler und bildender Künstler; verkehrte in der Beniner und Münchner Boheme der zwanziger Jahre; auch mit René Schickele und Erich Mühsam befreundet.
Register
Aguero iji i J4 f. ijÿf. Aischylos 22 ? Alberti, Rafael 4, 232 Alejchem, Schölern 240 Alemann, Ernesto 70 Alexander III., König von Makedonien 346 Alfonso XIII., König von Spanien 3 j 1 f. Alkibiades 278 Artabanus I., König der Parther 347 Auer, Ignaz 310 Augspurg, Anita 26 Auguste Viktoria, deutsche Kaiserin 373
Barnowsky, Victor 363 Bartels, Adolf 41 Baum, Vicky 394 Bebel, August 310 Becher, Ulrich 390 Benjamin, Walter 38 5 Benn, Gottfried 384 Bermann-Fischer, Gottfried
73 Bernais, Benno 402 Bernhardt, Sarah 242 Bernstorff, Johann Heinrich Graf von 174 Bethmann Hollweg, Theobald von 192 Billinger, Richard 384 Binding, Rudolf G. 384 Babotschkin, Boris 251 Bishop, Frederick 144 ff. Baily 202 204 207 ff. Bismarck, Otto von 23 88 91 23} Baker, Samuel 277 »45 27J 300-304 Bakunin, Michail Alexandrowitsdi Blau 263 7 16 3Ji Bloch, Jean-Richard 223 Bakunin, Michail Alexandrowitsch Blücher, Evelyn B. von Wahlstatt (Neffe) 7 16 200 Balk, Theodor 73 78 393 39; Böcklin, Arnold 17 Ballin, Albert 168 Börne, Ludwig 381 Balzac, Honoré de 60 246 Bohec 61 292 Braak, Menno ter 291 ff. Bredel, Willi 43 258 268 ff. Bang, Hermann 27, Barbusse, Henri 222 33S f. Briand, Aristide 275 Brod, Max 391 Barnes 144
465
Bruno, Giordano 90 Büchscl 32 f. Budzislawski, Hanna 76 Budzislawski, Hermann 76
393 Burmeister, Carl 324 Byron, George Noel Gordon IJ! *7J
Carossa, Hans 384 Caruso, Enrico zi Casement, Roger 8 44 81 83-215 398 Casement, Tom 86 Catilina 272 Cervantes Saavedra, Miguel de 265 Christensen, Adler 174 178—181 183 ff. 190 f. 195 f. Clive, Robert Baron of Plassey, Lord 92 Conrad, Joseph 89 95 f. 121 Cortez, Fernando 90 92 Cuvclicr 92 Daphne 60 Daladicr, Edouard 49 Daudet, Leon 305 Dauthcndcy, Max 213 391 Dchmcl, Richard 26 46 275 De Valera, Eamon 166 Dcvoy, John 185 199 Dillinger 236 Dimitroff, Georgi 308 Döblin, Alfred 393 Dostojewski, Fjodor Michailowitsch 246 387 Drechsel, Emmi von 12 Dschingis-Khan 15 8 Dumas, Alexandre 241 Duscnschön 270 Dyall, Joshua 145-148
464
Ebert, Friedrich 310 Eden, Robert Anthony Earl of Avon 398 Eduard VII., König von England 85 160 174 194 f.
343 Egonck siehe Kisch Ehrenstein, Albert 45 Einstein, Carl 390 Elias 14 Ellcrnhuscn 270 Emin Pascha 87 92 f. Ernesto siche Alemann Esser, Rudolf 324 Eulenberg, Herbert 384 Eulenburg, Philipp Fürst zu Hcrtcfcld und 36 Ewers, Hanns Heinz 384
Falke, Gustav 26 Fallada, Hans 384 Feuchtwanger, Lion 344-349 393 fFindlay 179-187 191-196 Flake, Minna 61 75 Fonscka 147 154 159!. 162 Frank, Bruno 265 f. Frank, Leonhard 51 62
294 ff. 393 400 Franz Joseph L, Kaiser von Österreich 322 Frei, Bruno 77 ff. Frciligrath, Ferdinand 16 Freud, Sigmund 385 Fricdell, Egon 385 f. Friedländer, Kurt 371 Friedrich II., König von Preußen 187 265 275 Furmanow, Dimitri Andrejewitsch 251
Gerlach, Hcllmut von 590 Glacscr, Ernst 278-282 Goebbels, Joseph 40 284 )16 358-363 378 393 Goethe. Johann Wolfgang
2JT 275 387 Gogol, Nikolai Wassiljewitsch 241 Goldschmidt, Alfons 390 Goring, Hermann 35 Gordon, Charles George 277 Gorki, Maxim 222 224 f. 233 244 f. 253-257 Gotthclf, Jeremias 324 Goya, Francisco José de 354 Grabbe, Christian Dietrich 309 Graf, Oskar Maria 45 246-249 306 3'0-313 364 366 393 Grey, Edward 139 159-162 164 174 194 198 Griffin, Geralt 341 343 Grillcnbcrgcr, Karl 310 Grillparzer, Franz 298 Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von 399 Großmann. Stefan 36 260 Guinaud 58 Guiness 130 Gumbel, Emil J. 393 Haarmann 270 Haliliwa, Sarial 228 Hamsun, Knut 289 Hansjakob, Heinrich 324 Harbou, Thea von 40 Hardekopf, Ferdinand 402 Harden, Maximilian 36 Hardenberg, Gustav Graf von
154 Harms 270 Hasenclevcr, Walter 385
Hauptmann, Gerhart 326-329 331 336 f. 383 Hebei, Johann Peter 324 Heine, Heinrich 16 314 381 391 Heines, Edmund 308 Heckscher, Siegfried 26 f. Herodot 277 Herostrat 308 Herrmann-Neiße, Max 385 388 Herwegh, Georg 16 378 392 Herzfclde, Wieland 8 74 Hessel, Franz 385 388 393 Heym, Georg 402 Heymann, Lidia Gustava 26 Hindenburg, Paul von Beneckcndorf und von 8 275 f. 383 390 Hitler, Adolf 8 23 41 47 49 53 58 71 77 262 277 f. 280 f. 286 302 f. 308 320 33B 360 363 383 390 f. 393 f. 396 f. 399 Hoddis, Jakob van 402 Hölderlin, Friedrich 389 Höllriegel, Arnold 378 385 Holbein, Hans 17 Holitscher, Arthur 389 Holland, John P. 204 Horaz 298 Hubert, Ali 402 Huch, Ricarda 384 Hu-Lan-Schi 225 257 Hull, Cordell 398 Humboldt, Wilhelm von 301 Hus, Jan 90
Jacobsohn, Siegfried 36 Jacques, Norbert 24 f. Jakob L, König von England 90 Jean Paul 355 Jensen, Ruth 75 Jesus von Nazareth 275 Jimenez 149!. 154
465
Kästner, Erich ,84 Kafka, Hans 386 391 Kalmykow 229 Kandt, Richard 276 Kant, Immanuel 298 Kantorowicz, Alfred 73 Kantorowicz, Friedl 73 Kapp, Wolfgang 35 Käst, Peter 79 Katenere 15 2 f. Katz, Ilse 74 Katz, Otto 74 79 Ken siehe Nelken Kaufmann 270 Keller, Gottfried 298 Kerr, Alfred 363 370 ff. Keun, Irmgard 38} 387 393 Kisch, Egon Erwin 36 74 77 H«-343 377 ff- 4Oi f. Kisch, Gisl 377 402 Kitchener, Horatio Herbert 163 Kiabund 384 Kleist, Heinrich von 338 373 König 270 Koestler, Arthur 393 Kolb, Annette 72 393 Kolumbus, Christoph 90 92 Kolzow, Michail Jefimowitsch 235 244 Krapotkin, Pjotr Alexejewitsch Fürst 351 Kraus, Karl 390 Kuh, Anton 77 261 388 Kürten 270 Langevin, Paul 79 Langhoff, Wolfgang 43 239 284 290 f. Lania, Leo 61 Lansdowne, Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice 103 129 ff.
466
Lasker-Schüler, Else 391 Lassalle, Ferdinand 273 Laval, Pierre 390 Lederer, Joe 393 Lehmann, Kurt 283 287 290 ff. Lenbach, Franz von 13 Lenin, Wladimir Iljitsch 224 236
*75 Leon, Maria Teresa 43 232 Leonardo da Vinci 273 Leonhard, Rudolf 74 78 304 595 Leopold IL, König von Belgien 97 ff. 102 f. in 119 121 130-133 143 134 158 161 Lessing, Theodor 390 Lettow-Vorbeck, Paul von 31 58 Levi 62 Liebknecht, Wilhelm 310 Liliencron, Detlev von 26 Lindau, Rudolf 324 Livingstone, David 87 92 f. Lloyd George, David Earl L. G. of Dwyfor 275 Loerke, Oskar 384 Lubbe, Marinus van der 308 Ludendorff, Erich 33 Ludwig, Emil 273 ff. 394 Lü-Tang siehe Hu-Lan Schi Luther, Martin 338
Maaß, Alexander 67 75 McQuillancf, Louis 83 Malcolm, James 200 f. Malraux, André 247 Mandel, George 63 Mann, Heinrich 261 273 f. 292 297-303 321 384 f. 393 f. 402 Mann, Katia 273 Mann, Klaus 273 292 320 f. 375 f. 381
Mann, Thomas 271-274 292 384 394 Mapp, James 149 ff. Markiewicz, Constance Gore-Booth Gräfin 166 Martninegui, Elias 14; 147 Marlitt, Eugenie 266 Masaryk, Jan 261 27; May, Karl 290 Mehring, Walter 393 Meisel 270 Mell, Max 384 Mendelssohn, Peter de 266 Menzel, Adolph von 373 Merz, Konrad siehe Lehmann, Kurt Meyerhold, Wsewolod Emiljewitsch 239 241 Moissi, Alexander 402 Molo, Walter von 384 Molotow, Wjatscheslaw Michailowitsch 398 Mombert, Alfred 388 Monteith, Robert 198 201 203-209 211 f. Montt, Alfredo 145 147 162 Morel, E. D. 115 130 Morton, Richard 211 Motta, Giuseppe 275 Mühsam, Erich 289 390 Musil, Robert 389 Mussolini, Benito 46 220 273
Nachtigal, Gustav 87 Nansen, Fritjof 275 Napoleon I., Kaiser von Frankreich 27; 303 318 Napoleon III., Kaiser von Frankreich 298 319 Nelken 62 Nelson, Horatio Herzog von Bronte 163
Nero, römischer Kaiser 344-348 390 Neumann, Robert 393 Nevinson, Henry W. 212 f. Nietzsche, Friedrich 298 Normand, Armando 155 f. 160 Oberndorff, Alfred M. Graf 178 f. O’Connor, T. P. 170 Olbrich, Oscar 75 Olden, Hans 9 f. 13 16 20 f. 24 26 Olden, Ika 6) Olden, Margaret Maria, geb. Kershaw (Primavera) 49 f. 32 34 ff. 61 f. 64 ff. 71 73 t. 76 263 Olden, Mary (Kutzi) 66 Olden, Rosa Veronika 9 ff. 13 Olden, Rudolf 13 f. 36 32 39 63 f. 385 f. 390 393 402 Ossietzky, Carl von 36 273 369 39°
Paredes 161 Pasternak, Boris Leonidowitsch 238 247 Peregrinus siehe Friedländer Peri, Gabriel 400 Pétain, Henri-Philippe 49 3 3 394 Peter L, Zar von Rußland 304 Peters, Carl 8 88 91 273 Philipp, König von Edessa 346 Philipp IL, König von Spanien 263 Platen, August Graf von 298 373 396 Platon 278 Pli vier, Theodor 45
467
Polgar, Alfred 39} 40z Pritzel, Lotte 402 Purser, Sarah 83 Puschkin, Alexander Sergejewitsch 239 Rabelais, François 246 Raleigh, Walter 90 92 Rathenau, Walter 27; Rauschning, Hermann 76 Reading 21 ; Redmond, John 190 Regler, Gustav 79 Reimann, Hans 384 Reinhardt, Max 374 Remarque, Erich Maria 222 Rembrandt Harmensz van Rijn 275 Renn, Ludwig 73 79 f. 306 308 ff- 395 Rilke, Rainer Maria 246 Rhodes 27; Riefenstahl, Leni 315 Rimski-Korsakow, Nikolai Andrejewitsch 240 Rivett, Arthur 340 ff. Rössler, Carl 402 Rolland, Romain 222 Romains, Jules 5; 57 Roth, Joseph 48 378 385 f. Rouget de Lisle, Claude-Joseph 318 Rudolf siehe Leonhard Ruth siehe Jensen
Sachs, Hans 338 Sade, Donatien Alphonse François Marquis de 138 Sand, George 22 Sanford siehe Shelton Schäfer, Wilhelm 384 Scharrer, Adam 45
468
Schickele, René 330 334 382 385 388 393 Schiller, Friedrich 273 301 Schmied, Rudolf Johannes 402 Schmidt, Lorenz (Familie Netti) 61 73 Scholochow, Michail Alexandrowitsch 222 Scholz, Wilhelm von 384 Schreiber, Adele 26 Schumann, Robert 10 Schwarzenberg, Fürst (Fürst S.) 67 Schwarz von Berk, Hans 327 338 363 Schweinfurth, Georg 87 Seger, Gerhart 284 Seghers, Anna 61 73 393 393 f. Seilern, Carlos 63 Seilern-Anspang, Ilse von, geb. Olden 9-21 33 49!. 32 f. 59 ff. 63 f. 72 76 Shakespeare, William 239 273 302 Shaw, George Bernard 86 213 239 Shelton, Henry 98 f. 104 112 Siemsen, August 80 Simone, André siehe Katz, Otto Slawin, Lew Issajewitsch 240 Smith, Christina Jolly 341 Sokrates 90 Speke, John Hanning 87 Speyer, Wilhelm 61 393 Spindler, Karl 209 Stalin, Josef Wissarionowitsch 71 224 275 Stanislawski, Konstantin Sergejewitsch 240 Stanley, Henry Morton 84 87 f. 101 273 Stein, Heinrich Friedrich Carl Reichsfreiherr von und zum 273
Stcinrück, Albert 402 Stern, Kurt 61 Stietcncorn, Fabian 290 Stirner, Max }fi Strasser, Otto 80 Strauss, Emil 384 Streicher, Julius 279 Stresemann, Gustav 390 Stuber, Herrmann 14 Sueton 348 Tacitus 348 Taft, William Howard 163 Tairow, Alexander Jakowlewitsch 239 241 Tamerlan 304 Tempsky, Melanie von 22 Thälmann, Ernst 316 362 Thomas, Rudolf 260 f. 263 f. Titus, römischer Kaiser 344 346 34» fThompson, Dorothy 78 Tizon 148 Toller, Ernst 45 47 f. 376 382 38; f. 388 Tolstoi, Lew Nikolajewitsch
254 Torberg, Friedrich 393 T. P. O. siehe O’Connor Trenjow, Konstantin Andrejewitsch 240 f. Tretjakow, Sergej Michailowitsch 45 244 Tschaikowski, Pjotr Iljitsch 239 Tschapajew, Wassili Iwanowitsch 250 385 fTucholsky, Kurt 36
Uhse, Bodo 73 393 Unruh, Fritz von 62 373 f. 382
393
Vasquez 15 2 f. Veläsquez, Diego Rodríguez de Silva y 83 132 Venizelos 275 Vespasian, römischer Kaiser 344 Verne, Jules 244 Victoria I., Königin von England 98 Vollmar, Georg Heinrich von 310 Voltaire 275 Wagner, Richard 271 275 Wallace, Edgar 222 Wassermann, Jacob 38 j Wegner, Armin T. 390 Weil, Bruno 74 Weiskopf, Franz Carl 262 336 f. Weiß, Ernst 62 385 387 Wendel, Hermann 318!. Werfel, Franz 73 393 f. Wesemann, Hans 270 Wessely, Paula 381 Wieland siehe Herzfelde Wilhelm II., deutscher Kaiser 23 30 172 188 273 302 f. Wischnewski, Wsewolod Witaljewitsch 241 Wilson, Thomas Woodrow
275 Wissmann, Hermann 91 Wittlin, Josef 322 f. Woelfel 12 Wolfenstein, Alfred 393 Wolff, Fritz 36 Wolff, Kurt 73 Wuellner, Ludwig 21
Zimmermann, Arthur von 192 Zirbes 270 Zweig, Arnold 382 386 391 Zweig, Stefan 382 383 388 f.
469
Inhalt
Autobiographische Schriften
5
Mein Leben 7 Stationen meines Lebens 9 Episode in Paris 5 5 Fünf Briefe aus dem Lager 58 Zwei Briefe aus dem unbesetzten Frankreich Sechs Briefe aus Buenos Aires 67
64
Paradiese des Teufels. Das Leben Sir Roger Casements
Antifaschistische Publizistik
81
217
Anno vierunddreißig in der UdSSR 219 Moskauer Wunderdinge 234 Moskauer Bühnenfestspiele 238 Ein russischer Trauertag 243 Seltsame Abenteuer eines Dichters 246 Tschapajew-Film 250 Maxim Gorki 253 Die schöne Literatur 238 Zum Tode Rudolf Thomas' 260 Ja und Nein 265 Ein Dutzend Steckbriefe 268 Der Unpolitische 271 Eine Biographie des Nil 275
471
Der letzte Zivilist 278 Notwendige Kritik 283 Notwendige Replik 288 Traumgefährten 294 Heinrich Mann über Pachulke 297 Heinrich Mann und Bismarck 301 Bemerkungen - Führer u. Co. 304 Renn und Graf 306 Der unbekannte Barde 314 Zu Ernst Thälmanns 50. Geburtstag 317 Neue politische Epik 318 Gerhart Hauptmanns Novum 326 Der humpelnde Reporter 338 Der falsche Nero 344 Schickeies „Flaschenpost“ 350 Die Versuchung 356 Schriftsteller Goebbels 358 „Bolwieser“ und „Sittinger“ 364 Der Märtyrer 369 Gedichte von Alfred Kerr 370 Ausgebürgerter Unruh 373 Der Vulkan 375 Spruch auf den Weg 377 Die deutsche Literatur heute und ...? 380 Das furchtbarste Buch der Weltgeschichte 398 Lang, lang ist’s her 401
Anhang
403
Nachwort 405 Zu diesem Band 427 Quellen und Anmerkungen Register 463
429
1 Hans Olden, der Vater 2 Rosa Olden, die Mutter
3
Hans Olden mit Tochter Ilse 4 Die Schwester Ilse 5 Rudolf und Balder Olden, Meran lüg
6 Balder Olden in Sankt Moritz» um 1913 7
Balder Olden, etwa 1925
8 Balder Olden und Margaret M. Kershaw
9 Balder Olden und Margaret M. Kersbaw, August 1929
IO Balder Olden, Ende der zwanziger Jahre, gezeichnet von B. F. Dolbin
11 Thomas und Katia Mann mit Balder Olden auf einem Rennen, Kairo 1950 12 Balder Olden in Afrika, ¡950 Margaret M. Kershaw im Romanischen Café, Februar 19a Von links nach rechts: Dr. Josef Löbel, Margaret M. Ke/shaw, Roda Roda, Carl Rössler, Waldemar Bonseis
¡4 Rudolf Olden, gezeichnet von B. F. Dolbin Balder Olden im März 1955, aufgenommen von Franz Pfempfert, Photo-Atelier „Dorit“, Karlsbad, Alte Wiese 16 Balder Olden auf dem i. Unionskongreß der sowjetischen Schriftsteller in Moskau 1934. Porträtzeichnung aus „Der Gegen-Angriff"
17 Balder Olden mit Freunden 1937 in Le Lavandou. Von links nach rechts: Erica Bär, E. A. Rheinbardt, Dr. Hammerschlag, Balder Olden, Margaret M. Ker shaw
iS Rudolf Olden mit Tochter, ii)}S in Oxford
{9 Balder Olden nach der geglückten Flucht, Annecy 1940
a^ fic
'n. t/xd f'*J
r^T
¿¿¿4 J^UiLtV
^C
^¿¿¡¿¿£> //Ct^
20 Balder Olden im Deutschen Antifaschistischen Komitee, Montevideo, Juni 1943. Von links nach rechts: Willi Eckermann, Vorsitzender des DAK, Balder Olden, Kurt Wittenberg, Sekretär des DAK in Montevideo, im Vordergrund Herseht Läufer
1} Balder Olden in der Rundfunkstunde „Stimme des Tages", August 1944 in Montevideo Von links nach rechts: Balder Olden, Erich Kleiber, Heinrich Geiger-Torrei ¡4 Annette Kolb mit Balder Oldens Schwester Ilse nach 194s
Meine Großväter waren ein Bank-
und ein Theaterdirektor. Als ganz junger Student in Freiburg i. B.
lernte ich Micha Alexandrowitsch Bakunin kennen, der ein treuer
Nachfahr seines großen
Onkels
war. Durch ihn wurde ich - nach
dem ich schon Bierkommerse ge feiert, Säbelmensuren geschlagen,
Reserveoffizierskurse
absolviert
hatte - zum Menschen erzogen. Ich
hatte schon mit zwanzig Jahren den Kampf ums Leben allein zu
bestehen.
Als
früh
entdeckter
Feuilletonist durfte ich im Auf trage der größten deutschen Zei tung jener Jahre, der „Kölnischen“,
viele Weltreisen machen, wurde
1914 vom Krieg in Ost-Afrika überrascht,
geriet
nach
langen
Kämpfen in englische Gefangen schaft. 1920 kam ich nach Deutsch
land zurück.
Mit
dem
antiimperialistischen
Kriegsroman
„Kilimandscharo“
(1922) begann meine wahre Pro duktion. Ich schrieb viele Bücher,
darunter eine Roman-Biographie des
deutschen
Kolonialgründers
Carl Peters, eines Kolonial- und
Vor-Hitler-Nazi. Ein Gegenstück
Scbutzumscblagenlwurf Gerhard Kruscbel
war meine Biographie jenes Roger Casement, der sein Leben durch
kämpft und am Galgen geendet
hat, um den Kongonegern, Putumayo-Indianern, Iren, allen
mit
Folter und Daumenschrauben Ent
rechteten zu helfen. Als Hinden burgs Staatsstreich das Reich an Hitler ausgeliefert hatte, fuhr ich
über die Grenze. Auf tschechoslo
wakischem Boden schrieb ich den „Roman eines Nazi“ und gleich
darauf in den „Neuen Deutschen Blättern" ein Manifest gegen den
Hitlerismus, „Mir wäre nichts Be sonderes passiert“. Diesen Publi kationen
verdanke
ich
vielerlei
Ehre: mein Vermögen wurde be
schlagnahmt, die Bestände meiner
Bücher wurden eingestampft, ich wurde ausgebürgert.
1934 nahm ich am Schriftsteller
kongreß der UdSSR teil und ge wann während eines dreimonatigen
Aufenthalts in Rußland mehr als während der Jahrzehnte meiner
Fahrten durch alle Weltteile. Bis dahin hatte ich nur erkannt, daß die Welt krankt, und auf die Wun
den gedeutet. Seither weiß ich, daß
es konkrete Wege gibt, um zu ge
sunden.
Balder Olden, igyj