Martin Heidegger: Sein und Zeit [2., bearb. Aufl.] 9783050050171
Ohne Martin Heideggers „Sein und Zeit“ von 1927 läßt sich weder die Philosophie des 20. Jhs. noch die philosophische Geg
258 114 1MB
German Pages 330 Year 2010
Polecaj historie
Citation preview
Martin Heidegger
Sein und Zeit
Klassiker Auslegen Herausgegeben von Otfried Höffe Band 25
Otfried Höffe ist o. Professor für Philosophie an der Universität Tübingen.
Martin Heidegger
Sein und Zeit Herausgegeben von Thomas Rentsch
2., bearbeitete Auflage
Akademie Verlag
Titelbild: Martin Heidegger, um 1920 © Dr. Hermann Heidegger
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-05-004375-3 © Akademie Verlag GmbH, Berlin 2007 Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Gesamtgestaltung: K. Groß, J. Metze, Chamäleon Design Agentur, Berlin Satz: Sabine Gerhardt, Berlin Druck und Bindung: MB Medienhaus Berlin Printed in the Federal Republic of Germany
V
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
1. Die Wiedererweckung der Seinsfrage auf dem Weg einer phänomenologisch-hermeneutischen Destruktion (§§ 1–8) Jean Grondin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. Der Status der Existentialen Analytik (§§ 9–13) Franco Volpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3. Die Weltlichkeit der Welt und ihre abgedrängte Faktizität (§§ 14–18) Romano Pocai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4. In-der-Welt-sein und Weltlichkeit: Heideggers Kritik des Cartesianismus (§§ 19–24) Hubert L. Dreyfus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
5. Hermeneutik der Alltäglichkeit und In-der-Welt-sein (§§ 25–38) Christoph Demmerling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
6. Die Sorge als Sein des Daseins (§§ 39–44) Barbara Merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
7. Heideggers Todesanalyse (§§ 45–53) Anton Hügli/Byung Chul Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
VI
Inhalt
8. Wie es ist, selbst zu sein. Zum Begriff der Eigentlichkeit (§§ 54 –60) Andreas Luckner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
9. Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins und die Zeitlichkeit als der ontologische Sinn der Sorge (§§ 61–66) Marion Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
10. Zeitlichkeit und Alltäglichkeit (§§ 67–71) Thomas Rentsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
11. Existentialontologie und Geschichtlichkeit (§§ 72–83) Hans-Helmuth Gander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
12. Das Versagen von Sein und Zeit: 1927–1930 Theodore Kisiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
13. Sein und Zeit im Rückblick. Heideggers Selbstkritik Dieter Thomä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
Auswahlbibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
Personenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
Hinweise zu den Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
VII
Vorwort
Ohne Sein und Zeit und die ebenso einmalige wie weltweite Wirkungsgeschichte dieses Fragment gebliebenen Buches von 1927 läßt sich weder die Philosophie des 20. Jahrhunderts noch die internationale philosophische Gegenwartsdiskussion zu Beginn des 21. Jahrhunderts verstehen. Ein neuer Zugang zur Konstitution der Welt und ein neues Verständnis von Zeit, Geschichte und Verstehen deutete sich an – auf dem Hintergrund einer tief ansetzenden Kritik traditioneller Ontologie, Metaphysik und Erkenntnistheorie. „Mit einem Schlage war der Weltruhm da“ (Gadamer). Bereits die unmittelbaren Schüler, die im Umfeld der Ausarbeitung des Werkes und der thematisch in seinem Umfeld gehaltenen bedeutenden Marburger Vorlesungen ihren Weg in die Philosophie fanden – ich nenne hier nur Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, Karl Löwith und Herbert Marcuse – erlangten weltweite Anerkennung und dauerhafte Wirkung. Die Hauptwerke von Arendt, Gadamer, Jonas, Löwith und Marcuse lassen sich entweder überhaupt nur oder zumindest besser auf dem Hintergrund von Sein und Zeit – mitunter als produktiver Negativfolie – verstehen. Die großen Rezeptionsschübe von Heideggers Hauptwerk müssen auch Kritiker und Gegner seiner Philosophie erstaunen. Sie wurden selbst zu Hauptströmungen der Philosophie und zu Signaturen der Epoche. Die erste große, bereits internationale Rezeptionsphase kann mit dem Titel Existenzialismus (Existenzphilosophie) überschrieben werden: Ohne Sein und Zeit kein Jean-Paul Sartre, kein L’ Être et le néant (1943, dt. Das Sein und das Nichts), aber auch keine Existenzialtheologie und kein Entmythologisierungsprojekt Rudolf Bultmanns und seiner Schule, keine katholische Heidegger-Schule mit Karl Rahner an der Spitze, keine Existenziale Phänomenologie wie die Merleau-Pontys, keine so intensive, mit vielen dieser Strömungen verbundene systematische Kierkegaard- (und später auch Nietzsche-) Rezeption. Ob Nihilismus oder erneute, verantwortliche Aneignung religiöser Sinntradition – sie entfalteten sich nicht ohne Heideggers opus magnum. Die zweite große, weltweite Wirkung trägt den Titel Hermeneutik: Ohne Sein und Zeit kein Gadamer, kein Ansatz wie der von Wahrheit und Methode (1960), keine werkimmanente wie ebenso keine wirkungsgeschichtliche, rezeptionsästhetische Methode der Literaturwissenschaft, keine Hermeneutik Paul Ricoeurs. Die dritte, neueste Rezeptionsphase ist die Wirkung
VIII
Thomas Rentsch
Heideggers sowohl auf den Strukturalismus wie auf den Poststrukturalismus, den Dekonstruktivismus und die Postmoderne: Ohne Sein und Zeit kein Michel Foucault, kein emphatisches Konzept der Selbstsorge, kein Le souci de soi (1984, dt. Die Sorge um sich). Foucault äußerte kurz vor seinem Tod: „Mein ganzes philosophisches Werden wurde durch meine HeideggerLektüre bestimmt. … Nietzsche und Heidegger, das war der PhilosophieSchock!“ und hinterließ „Tonnen von Heidegger-Notizen“ (siehe dazu Schneider, M.: „Heidegger – tonnenweise“. Zu Michel Foucaults „Dits et écrits“, in: Merkur 585 (1997) 1134 –1138). Foucault übersetzte auch das Buch Traum und Existenz (1930) des neben Medard Boss und Jacques Lacan wichtigsten an Heidegger anknüpfenden Psychoanalytikers, Ludwig Binswanger. Ohne Sein und Zeit aber auch kein Jacques Derrida, kein Poststrukturalismus, kein L’ écriture et la différence (dt. Die Schrift und die Differenz) und keine Grammatologie (beide 1967). Man erhält den Eindruck: Wohin sich der Zeitgeist auch wendet – Martin Heidegger ist schon da. Das galt auch für den „Heidegger-Marxismus“ der Neuen Linken und Herbert Marcuses, eines Heidegger-Schülers, dessen systematischer Ansatz seit Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit („Was diese Arbeit etwa zu einer Aufrollung und Klärung der Probleme beiträgt, verdankt sie der philosophischen Arbeit Martin Heideggers“, Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit, Frankfurt a. M. 31975, 8) und bis zu Der eindimensionale Mensch (1964) unverkennbar an der Existenzialen Analytik geschult ist. Es galt und gilt nicht nur für die einzelwissenschaftliche Rezeption in der Theologie, Psychologie und Psychoanalyse, Literaturwissenschaft und in Literatur und bildender Kunst. Es gilt auch für politisch-kulturelle, innovative Bewegungen wie zum Beispiel die Umwelt- und Ökologiebewegung, deren tiefste Ansätze die seinsgeschichtliche Fundamentalkritik Heideggers am okzidentalen Rationalitätsverständnis bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert antizipierte. Auch diese Fundamentalkritik ist ohne das Projekt der Destruktion der Ontologie, wie es in Sein und Zeit zuerst systematisch entfaltet wird, nicht verstehbar. Politisch bedeutend ist Heideggers Werk auch für den internationalen Dialog der Kulturen. So liegt Sein und Zeit in zumindest sechs verschiedenen japanischen Übersetzungen vor (noch nicht einmal für die Kritik der reinen Vernunft gilt das), und eine japanische Gesamtausgabe ist im Entstehen. In Asien und Südamerika befinden sich Zentren intensiver Rezeption. In Deutschland prägte der Einfluß Heideggers die Nachkriegsphilosophie und die Generation von K.-O. Apel und Jürgen Habermas. Insbesondere die frühen erkenntnisanthropologischen Arbeiten von Apel sowie sein Projekt einer Transforma-
Vorwort
IX
tion der Philosophie (1973) werden mit Rückbezug auf Heideggers Analysen in Sein und Zeit entwickelt. Die pragmatisch-operationalistischen und sprachkritischen Systemelemente und der Ansatz bei der lebensweltlichen Alltäglichkeit wirkten sich auf die konstruktive Wissenschaftstheorie der Erlangen-Konstanzer Schule aus, vermittelt über den Heidegger-Schüler Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen, einen Schüler Oskar Beckers. Die internationale Gegenwartsdiskussion, verbunden mit Namen wie Richard Rorty in den USA, Emmanuel Lévinas, J. F. Lyotard und Jacques Derrida in Frankreich, in Italien Gianni Vattimo, bezieht Heideggers Denken in ihre Reflexion ein, nimmt es oft zum Ausgangs- und Ansatzpunkt. Auch neueste Entwürfe einer seinsgeschichtlich-ontologischen Reflexion stehen in der Tradition der Heideggerschen Destruktion und Rekonstruktion der Ontologiegeschichte. Ich nenne nur das Werk von Michael Theunissen über Pindar (Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit, München 2000) und das von Emil Angehrn über die Entstehung der Metaphysik. (Der Weg zur Metaphysik. Vorsokratik, Platon, Aristoteles, Weilerswist 2000). Zudem verstärkt sich das Interesse an Heidegger auch im Bereich der Analytischen Philosophie. Die Kompatibilität von Sein und Zeit und der dort entfalteten Analytik des alltäglichen In-der-Welt-seins mit Ansätzen Ryles und Wittgensteins war lange schon evident; mittlerweile sind es vor allem die Systemelemente des Pragmatismus und seiner normativ-geltungskonstitutiven Implikationen, die für das analytische sprachphilosophische Denken vielfältige Anknüpfungspunkte bieten, so bei Robert Brandom (vgl. Auswahlbibliographie, 3.1). Auch durch die entstehende Heidegger-Gesamtausgabe fällt neues Licht auf Sein und Zeit. Einmal durch die jetzt nachzuvollziehende, spannende Vorgeschichte des Werkes in der epochalen Umbruchssituation der 20er Jahre (nur ein Stichwort: Hermeneutik der Faktizität), dann durch die das Werk umgebenden großen Vorlesungen der 20er Jahre zu Aristoteles, zu Kant, zum Zeitbegriff, zu Grundproblemen der Phänomenologie und schließlich durch das jetzt allererst sichtbar werdende Gesamtwerk selbst mit seinen ca. 100 Bänden, den vielen Vorlesungen und unveröffentlichten Texten von oft erstaunlicher publikationsreifer und substanzieller Qualität. Zentrum dieses beeindruckenden Lebenswerkes, das nicht zuletzt die Geschichte der Philosophie in systematischer Reflexion abschreitet, ist und bleibt Sein und Zeit, auf das es zuläuft und von dem es sich selbst wieder abstößt. Auf welche Weise, ist Gegenstand der Forschung der Gegenwart. Sein und Zeit ist wie alle wirklich bedeutenden Werke ein schwieriges Buch, das gerade durch seine bahnbrechende Zwischenstellung zwischen
X
Thomas Rentsch
Ontologie, Transzendentalphilosophie, Phänomenologie, Existenzialanalyse und Hermeneutik hinführende Kommentierung auf dem neuesten Stand der Forschung dringend erforderlich macht. Die Beiträge des vorliegenden kooperativen Kommentars bieten diese hinführende und begleitende Hilfe bei der intensiven Aneignung des Werkes im Seminar und Selbststudium. Alle Autorinnen und Autoren sind durch besondere Forschungsleistungen zu Sein und Zeit hervorgetreten. Es ist mir eine besondere Freude, der internationalen Diskussion dadurch Rechnung zu tragen, daß ich so exzellent ausgewiesene Autoren wie Jean Grondin, Franco Volpi, Hubert Dreyfus, Byung Chul Han und Theodore Kisiel für die Mitarbeit gewinnen konnte. Eine Besonderheit des Bandes über die immanente Kommentierung hinaus stellen die Beiträge von Theodore Kisiel und Dieter Thomä dar, die die Gründe für den Abbruch von Sein und Zeit bzw. Heideggers eigene spätere Rezeption des Werkes thematisieren – und damit Forschungsfragen, die so eng mit der Interpretation verbunden sind, daß sie zum Kommentar gehören. Für die Beiträge war es mir wichtig, die jüngere Generation zu Wort kommen zu lassen, die von Schulzwängen und Einseitigkeiten befreite, ebenso kritische wie konstruktive Zugriffe – insbesondere auch im Blick auf die Bedeutung von Sein und Zeit für die praktische Philosophie – vorlegt. Bei der Redaktion der Beiträge und der Herstellung des Bandes waren mir Christoph Demmerling, Christoph Henning, Dirk Mende und Morris Vollmann eine oft große Hilfe. Für die Erstellung der Bibliographie gilt Herrn Henning, für die Anfertigung des Sach- bzw. Personenregisters gilt Herrn Mende und Herrn Vollmann besonderer Dank. Das gilt auch für die Textverarbeitung durch Frau Brigitte Proft. Last not least bedanke ich mich bei Herrn Dammaschke vom Verlag für die sehr gute Kooperation. Dresden, im September 2007
Thomas Rentsch
1 Jean Grondin
Die Wiedererweckung der Seinsfrage auf dem Weg einer phänomenologischhermeneutischen Destruktion (§§ 1–8) „Wir nehmen ,Sein und Zeit‘ als den Namen für eine Besinnung, deren Notwendigkeit weit hinausliegt über das Tun eines Einzelnen, der dieses Notwendige nicht ,erfinden‘, aber auch nicht bewältigen kann. Wir unterscheiden daher die mit dem Namen ,Sein und Zeit‘ bezeichnete Notwendigkeit und das so betitelte ,Buch‘ (,Sein und Zeit‘ als Name für ein Ereignis im Seyn selbst. ,Sein und Zeit‘ als Formel für eine Besinnung innerhalb der Geschichte des Denkens. ,Sein und Zeit‘ als Titel einer Abhandlung, die einen Vollzug dieses Denkens versucht).“1 Die Einleitung zu Sein und Zeit ist die Einführung in ein Werk, das wir nicht kennen. Sie versteht sich tatsächlich als die Einführung zu einem Buchprojekt, aus dem „nur“ 2 Sechstel vorliegen. Zeitgenossen, wenn nicht Heidegger selbst, erwarteten lange die versprochenen Teile, aber das Werk behielt hartnäckig – gleichsam als Dokument eines lehrreichen Scheiterns – seinen „fragmentarischen“ Charakter. Gewiß kann man versuchen, und es wurde nicht selten getan, die Intentionen der fehlenden Teile zu rekonstruieren.2 Aber das Buch ist – trotz seiner faszinierenden 437 Seiten, die es zu einem der Hauptwerke der philosophischen Literatur des 20. Jahrhunderts werden ließen – faktisch ein Torso geblieben. In die Entstehungs1 Heidegger, 1971, 229; vgl. auch GA 49, 27. 2 Das 3. Sechstel, der Abschnitt Zeit und Sein, dessen erste Fassung geschrieben, aber alsdann von Heidegger zurückgehalten wurde, wurde nämlich in der Vorlesung vom SS 1927 erneut in Angriff genommen, und der Kant, Descartes und Aristoteles gewidmet sein sollende 2. Teil läßt sich ebenfalls aus den Vorlesungen im Umkreis von Sein und Zeit in seinen Grundzügen erahnen. Vgl. dazu die Textangaben in dem unüberbietbaren Einleitungskommentar von Hermann 1987, 402–403.
2
Jean Grondin
phase des Werkes bietet allein die Einleitung einen gewissen Einblick. Als solche ist sie bereits der erste Kommentar zum faktisch vorhandenen Werk. In ihr treten auch Schwerpunkte in Erscheinung, die im gedruckten Werk eher unterbelichtet erscheinen. Das gilt ganz besonders für die Seinsfrage. Das veröffentlichte Werk (das heißt die Fundamentalanalyse des Daseins) wollte sie gewiß vorbereiten, ließ sie aber unentfaltet. Das verblüffte bereits viele Zeitgenossen: das Buch schien viel mehr vom menschlichen Dasein als vom Sein selbst zu handeln, sei also mehr „Existenzphilosophie“ als Ontologie. Heidegger beeilte sich, darin ein Mißverständnis und eine Verkürzung zu sehen, war aber meist redlich genug, einzusehen, daß er bzw. das „fragmentarisch“ gelassene Werk daran schuld war. So mochte er bedauert haben, den geschriebenen 3. Teil trotz seiner Mängel nicht doch veröffentlicht zu haben, um wenigstens die von ihm angestrebte Richtung anzuzeigen.3 Dieses Bedauern wird man jedoch relativieren dürfen: Wenn die vierzig Seiten der Einleitung es nicht vermocht haben, die erwünschte Richtung anzumahnen, wäre in einem fehlenden Teil schwerlich eine völlig andere Perspektive zu Tage getreten. Es sieht beinahe so aus, als wäre sich Heidegger erst während der Niederschrift seines Werkes des vollen Gewichtes der Seinsfrage, die seine Lebensfrage werden sollte, bewußt geworden. Auch wenn sie sich als Beiträge zu einer „Geschichte der Ontologie und Logik“ verstanden, hielten Heideggers programmatische Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles von 1922 noch fest: „Der Gegenstand der philosophischen Forschung ist das menschliche Dasein als von ihr befragt auf seinen Seinscharakter“.4 Der Seinscharakter des Daseins, also nicht unbedingt das Sein als solches stand 1922 im Mittelpunkt. Die Einleitung von 1927 wird zuweilen denselben Eindruck vermitteln, aber den Akzent doch stärker auf die Seinsfrage und ihre Vergessenheit legen. Diese Akzentuierung werden die späteren Arbeiten und die Uminterpretationen von Sein und Zeit noch verschärfen. Sein und Zeit – und selbst dieser Titel entstand, als die Arbeit beendet war – markiert damit eine Wegscheide. Das gilt erst recht für die Einleitung. Sie ist emblematisch für Heideggers Denkweg, insofern sie sich unterwegs zur Seinsfrage weiß, ohne je an ein Ende gekommen zu sein, als sei hier das Unterwegssein das Entscheidende. Dafür ist die Einleitung sehr systematisch angelegt. Heidegger ist vielleicht nirgendwoanders so systematisch gewesen wie in ihr. Ein erstes Kapitel verteidigt eindrucksvoll, aber zugleich provokativ die „Notwendig3 Vgl. dazu GA 66, 414. 4 Heidegger 1989a, 237 f.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
3
keit, Struktur und [den] Vorrang der Seinsfrage“ (§§ 1 bis 4). Aus der Evidenz dieser wiedergewonnenen Frage heraus entwickelt ein zweites Kapitel die Doppelaufgabe der Werkes, die einer „ontologischen Analytik des Daseins“ (§ 5) und einer „Destruktion der Geschichte der Ontologie“ (§ 6), die die Zweiteilung des Werkes nach sich zieht. Aus dieser Doppelaufgabe fließt auch die phänomenologische (und hermeneutische) Methode (§ 7) des Werkes und dessen Plan (§ 8). Kein Zweifel: die Einleitung bietet eine kondensierte Fassung des gesamten Konzeptes von Sein und Zeit. Es ist aber die einzige Spur eines Werkes, das es als solches nicht gibt. Die Einleitung ist Sein und Zeit in nuce, aber in vielem wegweisender als das Werk selbst. Wir folgen der Zweiteilung der Einleitung, indem wir zunächst den Sinn der Seinsfrage und alsdann die vielfache Aufgabe des Werkes aufrollen.
1.1 Der Sinn der Seinsfrage Die Seinsfrage ist heute in Vergessenheit geraten, proklamiert die erste Zeile von Sein und Zeit. Es ist 1927 vielleicht nicht ganz klar, ob dieses Vergessen ein Versehen oder, wie der späte Heidegger betonen wird, eine Notwendigkeit darstellt (in diese Richtung weisen jedoch bereits Andeutungen der Einleitung – (6; 36) –, auf die wir zurückkommen). Der späte Heidegger wird nämlich die Seinsfrage zunehmend als eine solche charakterisieren, die das abendländische Denken nicht bzw. nicht zureichend gestellt hat oder hat stellen können, so daß das Versäumnis der Seinsfrage zur Signatur der abendländischen Ontologie werden wird. Auch wenn es gegen diese Vergessenheit anrennt, malt Sein und Zeit ein etwas weniger düsteres Bild aus. Die Frage, behauptet er, habe nämlich bereits „das Forschen von Plato und Aristoteles in Atem gehalten“, um erst von da an zu verstummen (2). Daß diese Frage das antike Philosophieren, wie es auch heißt, „in die Unruhe trieb“, ist übrigens eine historisch diskutable Sache. Daraus geht jedenfalls hervor, daß es Heidegger in der Einleitung doch um die Wiedergewinnung einer verstummten Frage geht. Auch wenn das Buch und die Einleitung historisch ansetzen, mit Plato und Aristoteles, werden sie im allgemeinen mit historischen Nachweisen eher zurückhaltend sein (die zweifelsohne im zweiten, historisch destruierenden Teil breiter ausgeführt worden wären). Die Einleitung will zunächst in systematischer Absicht die Notwendigkeit der Seinsfrage erweisen. Wie argumentiert Heidegger?
4
Jean Grondin
Der erste Paragraph, der diese Notwendigkeit nahelegen will, muß als ein erster Anlauf betrachtet werden, über dessen Grenzen sich Heidegger auch bewußt war (da er sie wenige Seiten später auch vermerkte). In Wahrheit soll diese „Notwendigkeit“ allein aus dem später erörterten Vorrang der Seinsfrage, ja aus dem Ganzen von Sein und Zeit, wenn nicht aus Heideggers gesamtem Opus hervorgehen. Es ist überhaupt schwer, eine solche Notwendigkeit in wenigen einleitenden Seiten darzutun. Deshalb genießen diese ersten Seiten nur eine „protreptische“, das heißt eine zur Frage hinleitende Funktion. Denn Heidegger begnügt sich dort weitgehend damit, gängige, in dieselbe Richtung gehende Vorurteile über die „Unnötigkeit“ der Seinsfrage namhaft zu machen, wobei er sich – ob ironisch oder mit vollem Ernst, ist nicht immer auszumachen – an der herkömmlichen Definitionslogik, aber auch an der ihm näher liegenden ontologischen Tradition von Aristoteles bis Thomas von Aquin orientiert: 1) Das Sein sei der allgemeinste Begriff (und folglich der Erörterung unbedürftig); 2) Es sei zudem (aber als Konsequenz aus dem ersten Vorurteil) undefinierbar; 3) Es sei schließlich auch der selbstverständlichste Begriff, verstehe ihn doch jeder ohne weiteres. Alle drei Vorurteile sollen von einer ausdrücklichen Thematisierung der Seinsfrage abhalten. So einfach ist das nicht, suggeriert nun Heidegger, ohne wohlgemerkt die Gültigkeit der Vorurteile entschieden in Abrede zu stellen. Die Allgemeinheit, macht er erstens geltend, schließe nicht ein, daß der Seinsbegriff „der klarste und aller weiteren Erörterung unbedürftig“ (3) sei. Das stimmt, aber es demonstriert allein nicht die Notwendigkeit einer solchen Erörterung. Zweitens dispensiere die Undefinierbarkeit nicht von der Frage nach dem Sinn des Seins, sondern fordere sie gerade heraus. Dies mag auch sehr wohl sein, aber Heidegger weicht damit der Frage aus, inwiefern eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins, die die Einleitung in Aussicht stellt, auf keinen Fall doch so etwas wie eine ,Definition‘ im weiten Sinne wäre. Die dritte Erwiderung wird die Diskussion wenig später weiterbringen: Ein selbstverständlicher Begriff könne doch Indiz eines nur selbstverständlich gewordenen Tatbestandes sein, den es kritisch zu hinterfragen gilt. Unvermeidlich wird man dabei an Hegels berühmtes Wort in der Phänomenologie des Geistes denken: „Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt“. Ist aber damit die „Notwendigkeit“ der Seinsfrage – im starken Sinne – wirklich erwiesen? Der Schluß, den Heidegger aus seiner knappen Diskussion zieht, geht wohl zu weit: „Daß wir je schon in einem Seinsverständnis leben und der Sinn von Sein zugleich in Dunkel gehüllt ist, beweist die grundsätzliche Notwendigkeit, die Frage nach dem Sinn von
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
5
,Sein‘ zu wiederholen.“ (4). Das geht zu weit, weil das doch von sehr vielen, wenn nicht von allen Begriffen gilt: Wir leben doch alle in einem gewissen Verständnis von Kunst, vom Guten, vom Gerechten, von Liebe, von Vaterschaft, usw., dessen Sinn auch etwas dunkel ist, ohne daß damit die absolute Dringlichkeit einer philosophischen Frage nach ihnen demonstriert worden wäre. Wieso ausgerechnet das Sein? Bislang spricht für ihre Notwendigkeit allein, wie Heidegger später auch zugeben wird (8), die „Ehrwürdigkeit ihrer Herkunft“ und das „Fehlen einer bestimmten Antwort“. Die Notwendigkeit der Seinsfrage wird damit nicht mehr als suggeriert, zumal die ehrwürdige Tradition der Ontologie, wie man später in Erfahrung bringen wird, einer Destruktion unterzogen werden kann! Die weiteren Erörterungen über die Struktur und vor allem den Vorrang der Seinsfrage werden diese Notwendigkeit auch einsichtiger machen helfen. Die Reflexionen über deren Struktur (§ 2) packen die Seinsfrage zunächst auch nicht direkt an, da sie sich von der Struktur einer jeden Frage her legitimieren lassen. Heidegger greift hier auf Erörterungen über die Struktur des Fragens zurück, die er gelegentlich in seinen Vorlesungen vorgetragen hatte.5 Diese Struktur hat den Vorteil, die bislang etwas unspezifisch erscheinende Seinsfrage und damit den Gang der Heideggerschen Untersuchung zu gliedern. Heideggers Erörterungen werden auch besonders viel Wert auf die hier zu gewinnende Durchsichtigkeit legen. Im Fragevollzug lassen sich nach Heidegger ein Gefragtes (wonach im allgemeinen gefragt wird), ein Befragtes (bei wem angefragt wird) und ein Erfragtes (das Intendierte) unterscheiden. Gefragt wird ganz allgemein nach dem Sein. Das Sein, führt Heidegger aus, ist aber das Sein des Seienden, muß also vom Seienden unterschieden werden. Damit „praktiziert“ Heidegger die „ontologische Differenz“ von Sein und Seiendem, die als solche erst in den Schriften unmittelbar nach Sein und Zeit thematisch und zentral werden wird. Sie ist aber bereits in den ersten Seiten von Sein und Zeit präsent – und noch bevor das Dasein als solches eingeführt wird. Diese Unterscheidung impliziert für Heidegger vor allem, daß sich das Sein nicht durch die auf das Seiende zugeschnittenen Begrifflichkeit fassen läßt. Das Sein fordert nämlich „eine eigene Aufweisungsart, die sich von der Entdeckung des Seienden wesenhaft unterscheidet“, „verlangt“ also „eine eigene Begrifflichkeit“ (6). Läßt sich die Begrifflichkeit für und das gängige Sprechen über das Seiende terminologisch als „ontisch“ bezeich5 Vgl. die viel komplexere Aufstaffelung (mit 12 Strukturmomenten!) der Fragelogik in der Vorlesung vom WS 1923/24: GA 17, 73. Dort erfolgt sie noch ohne spezifische Anwendung auf die Seinsfrage, die in der Vorlesung vom SS 1925 (GA 20, 194 ff.) statthat.
6
Jean Grondin
nen, wird die Rede vom Sein rein „ontologisch“ sein müssen. Die programmatische Trennung zwischen der ontologischen und der ontischen Ebene läßt sich nicht als die von zwei strikt voneinander geschiedenen Regionen fassen, weil dies wiederum zu „ontisch“ gedacht wäre. Trotz ihres unmittelbar einleuchtenden Charakters birgt die von Heidegger praktizierte ontologische Differenz enorme Rätsel in sich. Heidegger wird sich nämlich bis zum Ende seines Denkweges fragen, ob es so eine „ontologische“ Redeweise überhaupt gibt und immer neue Möglichkeiten erproben, darunter die der Dichtung und des Schweigens, um das Sein hörbar werden zu lassen. Diese Rätsel wohnen aber bereits der Einleitung zum Hauptwerk inne. Denn die dort konstruierte Seinsfrage bleibt auf das „Seiende“ auf zweifache Weise angewiesen: Zum einen besagt Sein immer Sein des Seienden (später wird Heidegger gelegentlich das Sein noch schärfer vom Seienden unterschieden wissen wollen6), zum anderen wendet sich die Frage nach dem Sein an ein spezifisches Seiendes. Dieses Seiende, das das „Befragte“ in der Fragestruktur buchstäblich verkörpert, ist nämlich das Seiende, das wir selber sind und das Heidegger terminologisch als Dasein fixiert. Damit fällt Heideggers wichtigster und berühmtester Terminus für die Weise, in der er den Menschen anspricht. Unter Dasein soll man also zunächst gleichsam nur so viel hören wie: „Da [ist das] Sein“. Da Sein „da“ und nur da ist, wird dieses Dasein auf sein Sein hin (ab)gefragt werden müssen. Die Frage nach dem Sein wird also den „Umweg“ bzw. den Königsweg einer Herausstellung des Seins des Daseins einschlagen müssen. Wie ist aber Sein „da“ im Dasein? In einem gewissen „Seinsverständnis“, antwortet Heidegger konsequent. Wir „bewegen uns immer schon in einem Seinsverständnis“ (5). Diese allgemeine, aber vage Seinsorientierung oder 6 Erinnert sei an den berühmten Passus des Nachwortes (1943) zur 4. Auflage von Was ist Metaphysik? (Wegmarken, GA 9, 304), wo Heidegger die Formel wagte, „daß das Sein wohl west ohne das Seiende“. In der 5. Auflage modifizierte Heidegger seinen Text und schrieb, auf die Position von Sein und Zeit zurückkommend, „daß das Sein nie west ohne das Seiende“. Die Abhandlung Zur Seinsfrage von 1955 wird wiederum prägnant das Sein als das „ganz Andere zum Seienden“ apostrophieren (vgl. GA 9, 385 ff.). Auf diese Erfahrung des Seins, ja auf dieses Erstaunen vor dem Sein, das wir nicht „machen“, aber in dem wir sind, aber nur für eine atemverschlagende sterbliche Weile, kam es Heidegger immer an. Heidegger wußte, daß er diese Erfahrung etwas verkürzte, als er sie in Sein und Zeit in einen begrifflich-transzendentalen Rahmen preßte. Mit um so mehr Energie kehrte er im Nachwort zu seiner Antrittsvorlesung von 1929, Was ist Metaphysik, das „Wunder aller Wunder“ hervor, daß Seiendes ist, daß es etwas – und uns – gibt und nicht vielmehr nichts (GA 9, 303 ff.). Diese Erfahrung ist – schlicht und einfach – die des Seins für Heidegger. Sie kann nur zeitlich sein und eine Erfahrung dessen sein, was sich entzieht und unbegreiflich bleibt.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
7
-vertrautheit wird Heideggers Leitfaden und das eigentliche „Befragte“ seiner Fragestellung werden. Das Ziel seiner Untersuchung (das Erfragte also) wird es somit sein, den Sinn dieses so verstandenen (und gekannten) Seins zu ermitteln, um gleichsam dieses Verständnis zu einem besseren Verständnis seiner selbst zu bringen. Heideggers Ausführungen machen auch völlig klar, was dabei angestrebt ist. Es geht bei der Frage nach dem Sinn von Sein nicht etwa um den „Sinn des Lebens“ (so sehr dies auch mitanklingen mag), sondern um die begriffliche Herausstellung des Sinnes dessen, was unter „Sein“ vage und durchschnittlich verstanden wird. Das unter Sein Verstandene soll zur Transparenz, zur begrifflichen „Durchsichtigkeit“, zur „Aufklärung“ gebracht werden. „Aus der Helle des Begriffes“ (6) sollen schließlich, verkündet Heidegger, die Weisen des durchschnittlichen Seinsverständnisses und die seiner Verdunkelung (womit angedeutet ist, daß das Versäumnis der Seinsfrage alles andere als ein zu berichtigendes Versehen ist) erklärt werden. Damit scheint das Ziel der Fragestellung Heideggers deutlich abgesteckt zu sein: die Aufhellung des Sinnes von „Sein“. Der Eindruck kann also entstehen, es ginge Heidegger dabei um eine analytische Worterklärung dessen, was allgemein, aber vage unter „Sein“ verstanden werde. Heidegger würde sich hier nahezu wie ein analytischer Philosoph ausnehmen. Wenn er das nicht ganz ist, liegt es an der eigentümlichen Struktur der Seinsfrage selber, die mit immer mehr Deutlichkeit hervortreten wird. Denn diese Frage ist nicht irgendeine, die nach lexikalischer Klarheit verlangt, sondern eine solche, bei dem das Sein dessen, das von ihr betroffen wird, auf dem Spiel steht: „Die wesenhafte Betroffenheit des Fragens von seinem Gefragten gehört zum eigensten Sinn der Seinsfrage“ (8, vgl. GA 20, 200). Damit wird angedeutet, daß die Seinsfrage die dringlichste Frage eines jeden Daseins ist, dem es doch ständig um das eigene Sein geht. Damit wird übrigens die „Notwendigkeit“ der Seinsfrage näher begründet. Sie liegt an der Unausweichlichkeit der Seinssorge für das Dasein. Was sich hier langsam „meldet“ (8), ist ein Vorrang des Daseins für die Seinsfrage, den Heidegger im § 4 als „den ontischen Vorrang der Seinsfrage“ auszeichnen wird. Diese sich aufdrängende Thematik nahezu vertagend, wird Heidegger aber vorher den „ontologischen“ Vorrang der Seinsfrage (§ 3) herausstellen, gleichsam um die ontologische Zielrichtung seiner Fragestellung vor die rein daseinsontische zu stellen. Wiederum wird die Problematik des Seinsverständnisses die des ontologischen Vorranges bestimmen, der sich vor allem im Hinblick auf die Wissenschaften festmachen lassen soll. Die Analyse von Heidegger nimmt dabei eine nahezu wissenschaftstheoretische, transzendentale Wende, die sich im neukantischen Kontext seiner Zeit einer gewissen Evidenz erfreute,
8
Jean Grondin
die Heidegger jedoch geschickt ins Ontologische zurückbiegt. Der Neukantianismus, so wie ihn zumindest Heidegger verstand, ging vom Faktum der Wissenschaft aus und bemühte sich, die logischen Bedingungen ihrer Möglichkeit zu rekonstruieren. Eine sehr ähnliche Argumentation führt bei Heidegger zum Vorrang der ontologischen Frage: Jede Wissenschaft hat es nämlich mit einem bestimmten Bereich des Seienden zu tun. Sie behandelt ihn mithilfe von Grundbegriffen, die meist aus der vorwissenschaftlichen Erfahrung gespeist sind. Diese Grundbegriffe oder Hinsichten auf das Seiende sind aber selber nichts Seiendes, nichts Ontisches. Sie betreffen nämlich das Sein des jeweils behandelten Gebietes. Grundbegriffe der Mathematik, der Physik oder der Geisteswissenschaften gründen also in einer „vorgängigen Durchforschung des Sachgebiets“ (10), die nur ontologischer Natur sein kann: „Sofern aber jedes dieser Gebiete aus dem Bezirk des Seienden selbst gewonnen wird, bedeutet solche vorgängige und Grundbegriffe schöpfende Forschung nichts anderes als Auslegung dieses Seienden auf die Grundverfassung seines Seins“ (10). Es ist aber nicht Aufgabe der (nur ontischen) Wissenschaften selber, diese ontologische Klärung vorzunehmen, sondern die der Philosophie. Als „produktive Logik“ muß sie „den positiven Wissenschaften vorauslaufen“, versichert Heidegger (10). Als Beweis, daß dies möglich ist, weist er wieder auf Plato und Aristoteles hin. Damit wird so etwas wie ein ontologischer – und zudem sehr anspruchsvoller – Vorrang der Philosophie behauptet. Er liegt darin, daß die Philosophie die spezifischen Ontologien auszuarbeiten hat, in denen die Wissenschaften jeweils stehen. Es geht Heidegger aber darüber hinaus um den ontologischen Vorrang der Seinsfrage selber, noch vor diesen Ontologien (Husserl sprach hier von ,regionalen‘ Ontologien). Dieser Vorrang der Seinsfrage rührt daher, daß jede ontologische Explikation, die die Philosophie zu Diensten der Wissenschaft zu leisten hat, zuvor die grundsätzliche Frage nach dem Sinn von Sein geklärt haben muß. Eine sich als fundamental und damit ontologisch verstehende Philosophie wird darin ihre Frage par excellence erkennen müssen: „Ontologisches Fragen ist zwar gegenüber den ontischen Fragen der positiven Wissenschaften ursprünglicher. Es bleibt aber selbst naiv und undurchsichtig, wenn seine Nachforschungen nach dem Sein des Seienden den Sinn von Sein unerörtert lassen. […] Die Seinsfrage zielt daher auf eine apriorische Bedingung der Möglichkeit nicht nur der Wissenschaften, die Seiendes als so und so Seiendes durchforschen und sich dabei je schon in einem Seinsverständnis bewegen, sondern auf die Bedingung der Möglichkeit der vor den ontischen Wissenschaften liegenden und sie fundierenden Ontologien selbst“ (11). Bei aller Ablehnung einer deduktiven Genealogie scheint
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
9
Heidegger den ontologischen Vorrang doch auf dem Weg einer Reduktion auf elementarere Fragestufen zu etablieren: Vor den ontischen Wissenschaften liegen die sie fundierenden Ontologien, die die Philosophie als produktive Logik zu erarbeiten hat, und vor ihnen liegt die noch grundsätzlichere Frage nach dem Sinn von Sein, wobei erneut präzisiert wird, daß es um eine begriffliche Vorverständigung geht: „Und gerade die ontologische Aufgabe einer nicht deduktiv konstruierenden Genealogie der möglichen Weisen von Sein bedarf einer Vorverständigung über das, was wir denn eigentlich mit diesem Ausdruck ,Sein‘ meinen“ (11). Wirkte Heidegger wie ein analytischer Philosoph, als er mit solchen Wendungen im § 2 nach dem Sinn von Sein fragte, so entpuppt er sich im § 3 als ein nahezu transzendentaler Philosoph, wenn er den ontologischen Vorrang der Seinsfrage darin erblickt, daß die Seinsfrage auf die Bedingungen der Möglichkeit einer jeden gegenständlichen und wissenschaftlichen Thematisierung abzielt. Die alsdann einsetzenden Ausführungen über den ontischen Vorrang der Seinsfrage (§ 4) werden indes zeigen, daß Heideggers Grundfaktum nicht das der Wissenschaft, sondern das des um sein Sein besorgten Daseins ist. Wissenschaften werden ja selber von Menschen betrieben. Die Menschen zeichnen sich nicht allein durch ihre Wissenschaftskapazität, sondern durch ihren intimen Bezug zum Sein aus. In einem der rhetorisch gelungensten Passagen des Werkes legt Heidegger eine Quasidefinition des Daseins vor: „Es ist […] dadurch ontisch ausgezeichnet, daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht“ (12). Heidegger verwendete die Formel auch sehr häufig, um die Unabdingbarkeit der Seinsfrage nahezurücken.7 Sie meint offenbar die Sorge um das eigene Sein, die das Dasein nicht nur charakterisiert, sondern auch plagt, so sehr, daß das Dasein, wie Heidegger lehrt, nicht zuletzt dazu neigt, der Last dieser bohrenden Frage auszuweichen. Dieses Ausweichen erweist sich aber als eine Flucht vor sich selbst, wenn sich das Dasein tatsächlich
7 Vgl. bereits in den frühen „Anmerkungen zu Karl Jaspers“ von 1919/21 das Abheben auf die „Grunderfahrung des ,ich bin‘, in der es radikal und rein um mich selbst geht“, so daß die Grunderfahrung die „des bekümmerten Habens seiner selbst [ist], welches vor einer möglicherweise nachkommenden, aber für den Vollzug belanglosen ,ist‘-mäßig objektivierenden Kenntnisnahme vollzogen ist“ (Wegmarken, GA 9, 29–30). Vgl. ferner Der Begriff der Zeit (1924), Heidegger 1989b, 14: „Das so charakterisierte Seiende ist ein solches, dem es in seinem alltäglichen und jeweiligen In-der-Welt-sein auf sein Sein ankommt.“ Aus den Vorlesungen, vgl. GA 20, 405: „Das Dasein ist Seiendes, dem es in seinem Sein, in seinem In-der-Welt-sein, um sein Sein selbst geht“ (vgl. GA 21, 220); GA 28, 171: „Damit ist das Seiende bezeichnet, dem seine eigene Weise zu sein in einem bestimmten Sinne ungleichgültig ist“.
10
Jean Grondin
dadurch definiert, daß es vor dieser Frage nun einmal steht. „Dasein“ heißt also für Heidegger auch: vor diese Frage gestellt zu sein, auch wenn man vor ihr wegläuft. Denn auch wenn man ihr ausweicht, bleibt man da, nämlich im Modus der Flucht vor sich selbst, das heißt vor dem Dasein. In späteren Texten wird Heidegger das Dasein, das sich so von sich selbst ablenken läßt, genial als „Wegsein“ kennzeichnen. Das Wegsein darf als der eigentliche Gegenbegriff zum Dasein gelten, wobei das „weg“ eine Weise, vielleicht die primäre, jedenfalls die ,gewöhnliche‘ Weise des „da“ indiziert. So plastisch und dramatisch sich diese Frage nach dem „eigenen Sein“ ausnimmt, darf man sich fragen, was sie mit der bisher erörterten Seinsfrage verbindet. Bislang ging es anscheinend nur um die Worterklärung dessen, was wir unter „Sein“ verstehen, gar um die ontologischen Vorbedingungen der wissenschaftlichen Themenstellung. Auf einen Nenner gebracht: Darf die Frage nach dem eigenen Sein mit der allgemeinen Frage nach dem Sinn von Sein vermengt werden? Handelt es sich um dieselbe Frage? Die Frage stellt sich um so mehr, als der späte Heidegger dazu tendieren wird, das Gewicht der Frage nach dem eigenen Sein zugunsten der reinen Seinsfrage abzuschwächen. Das Dasein, wird er beispielsweise im Brief über den Humanismus von 1946 ausführen, zeichne sich durch die „Sorge für das Sein“ schlechthin aus. Vom späten Heidegger aus wirkt die Sorge um das eigene Sein eher wie ein Anthropozentrismus, zu dem das seinsgeschichtliche Denken immer mehr auf Distanz gehen will. Sein und Zeit redet hier aber eine klare Sprache: Dem Dasein geht es um das eigene Sein und damit ist das „Seinkönnen“ gemeint, für das sich das Dasein zu entscheiden hat. Worin besteht in Sein und Zeit das Band8 zwischen der allgemeinen Seinsfrage und der nach dem eigenen Sein? Man findet es vielleicht nirgends mit letzter Klarheit ausgesprochen, aber es besteht wohl kein Zweifel über die allgemeine Ausrichtung der Heideggerschen Intentionen: Der primäre Tatbestand ist der der grundsätzlichen Sorge um das eigene Sein, das eigene Selbst. Dieses Sein ist nun einmal 8 Thomä 1990, 254, sieht hier – mit gewissem Recht – eine Vermengung von zwei Fragen, die sich nicht auf eine einheitliche Fragestellung zurückführen lassen. Ich versuche im folgendem, ihre Zusammengehörigkeit aus Heideggers Intentionen nachzuweisen, muß Thomä allerdings zugeben, daß Heidegger selber diesen Zusammenhang nicht mit aller wünschenswerter Deutlichkeit dargestellt hat. Suggeriert wird er aber durch Passagen wie der folgenden in dem Vortrag Der Begriff der Zeit (1924), a. a. O., 14: „Die Sorge um das Dasein hat jeweils das Sein in die Sorge gestellt, wie es in der herrschenden Auslegung des Daseins bekannt und verstanden ist.“ Gespannt sein darf man in dieser Hinsicht auf die größere Abhandlung aus dem Jahre 1924, Der Begriff der Zeit, die als Band 64 der GA vorgesehen ist.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
11
vom Tode gezeichnet (nicht cogito sum, sondern sum moribundus ist die Grundgewißheit des Daseins, sagte Heidegger am Ende einer Vorlesung vom SS 1925, GA 20, 437). Wir sind ,da‘, aber nur für eine Zeit (diese Intuition faßt auch der Titel Sein und Zeit zusammen). Das Dasein bleibt so von seinem Sein-zum-Tode beschattet, der ihm natürlich eine wahre Angst einflößt, da es kein Entrinnen gibt. Wenn sich die Sorge um das eigene Sein von daher gut nachvollziehen läßt, welchen Bezug hat diese Sorge zur Seinsfrage im allgemeinen? Diesen: Das gesamte Seinsverständnis des Daseins wird sich nämlich von dieser Sorge aus (und der Flucht vor ihr) bestimmen lassen. Sprechendstes Indiz dafür ist die Tendenz des Daseins, das Sein „zeitlos“, das heißt als permanente Gegenwart zu deuten. Sein ist das, was besteht und immer Bestand hat und haben wird. Geschichtliche Studien von Heidegger werden auf brillante Weise ausführen, wie sehr sich diese Deutung des Seins als stete Gegenwart durch die ganze Geschichte der Ontologie hindurch erhalten hat. Woher aber dieses Bestehen auf Permanenz und Bestand, wenn nicht aus einer Verdrängung der eigenen Zeitlichkeit? Das temporale Seinsverständnis ist also auf seine Quelle im Dasein hin zurückzuverfolgen. Die „Stellung“ des Daseins zu seinem eigenen Sein diktiert nämlich das allgemeine Seinsverständnis und damit den Sinn von Sein überhaupt. Heidegger wird hier insbesondere die eigentliche von der uneigentlichen Zeitlichkeit (und damit die entsprechende Stellung zum Sein) unterscheiden. Die eigentliche versteht sich aus dem radikal ergriffenen Dasein in seiner unüberbietbaren Zeitlichkeit, die uneigentliche als Flucht vor dieser Zeitlichkeit in die Beruhigung des permanenten Immer-so-weiter. Am Leitfaden dieser Ergriffenheit von der eigenen zeitlichen Existenz wird sich das Programm der Destruktion der Geschichte der Ontologie orientieren. Von der Frage nach dem eigenen Sein zur allgemeinen Seinsfrage läßt sich also durchaus eine Brücke schlagen, auch wenn es die Einleitung zu Sein und Zeit meist bei formalen Anzeigen beläßt. Aber die formale Anzeige, die jedes Dasein mit Inhalt zu füllen berufen ist, ist nach Heidegger nun einmal eine Grundeigenschaft jeder philosophischen Begrifflichkeit (vgl. GA 29/30, 421–431). Kehren wir also zu den Anweisungen des § 4 über die Sorge um das eigene Sein zurück. Das Sein, um das es dem Dasein geht, faßt Heidegger terminologisch als „Existenz“ auf. Das Dasein läßt sich also nicht durch eine Wesensdefinition bestimmen, sondern dadurch, daß es „je sein Sein als seiniges zu sein hat“ (12). Das Dasein ist aber immer schon in Existenzmöglichkeiten geraten, die der Aufhellung über sich selbst bedürfen. Diese Möglichkeiten, sofern sie konkrete Existenzvollzüge meinen, lassen sich als existentiell charakterisieren. Sie sind von der sich als rein „existential“ ver-
12
Jean Grondin
stehen wollenden Analyse Heideggers zu unterscheiden. Ihr geht es nämlich nicht um spezifische, „ontische“ Existenzvollzüge, sondern – allgemeiner – um die Strukturen, die die Existenz als solche konstituieren. Die Daseinsanalyse wird also – im technischen Sprachgebrauch, der die Einleitung charakterisiert (den Heidegger aber kurz nach Sein und Zeit fallenlassen wird) – die Form einer Analytik der Existenzialität der Existenz annehmen. Zu diesen Strukturen gehört die prinzipielle Unterscheidung zwischen „eigentlicher“ und „uneigentlicher“ Existenz: „Die Existenz wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nur vom jeweiligen Dasein selbst entschieden“ (12). Der konkret gewählte Vollzug bleibt zwar dem jeweiligen Dasein (,existenziell‘) überlassen, aber daß es vor einer Entscheidung steht, ist nun einmal ein Existential, das es im Hinblick auf seine Bedeutung für die gesamte Seinsproblematik zu befragen gilt. Sicherlich kann man sich mit Autoren wie Jaspers und Löwith fragen, ob sich diese Trennung des „Existentialen“ und des „Existentiellen“ so streng durchhalten läßt. Gewiß nicht, aber sie hat einen beträchtlichen methodologischen Sinn, an dem sich Heideggers Analysen auch kritisch messen lassen dürfen. Heidegger gibt zwar zu, daß seine existentiale Analytik selber „ontisch verwurzelt“ ist (13), aber dies will vor allem unterstreichen, daß die Ergreifung der philosophischen Seinsfrage lediglich die „Radikalisierung einer zum Dasein selbst gehörigen wesenhaften Seinstendenz“ (15) vollzieht. Damit wird, nach Heideggers Analyse, in der Tat das Seinsverständnis, das das Dasein von Hause aus praktiziert, zu sich selbst gebracht, das heißt über sich selbst aufgeklärt. Die Klärung des Seinsverständnisses des Daseins drängt sich hier als die fundamentale Aufgabe von Sein und Zeit auf. Als Fundamentalaufgabe war oben (§ 3) die Klärung des „Sinnes von Sein“ namhaft gemacht worden. Beide Aufgaben scheinen in der Einleitung zu Sein und Zeit ineinander verschmolzen zu sein. Heidegger wird zwar später mit Recht den vorbereitenden Charakter der Daseinsanalyse im Hinblick auf die Seinsfrage hervorheben. Aber das Verhältnis der Fundamentalontologie zur Daseinsanalytik weist eine erstaunliche Schwankungsbreite in der Einleitung auf. Diese Vielfalt dokumentiert sich in drei wichtigen Passagen des § 4, die sich beinahe auf derselben Seite finden: 1) Es wird zunächst als Konsequenz des ontologischen Vorranges der Seinsfrage (§ 3) unterstrichen, daß „auch die Möglichkeit einer Durchführung der Analytik des Daseins an der vorgängigen Ausarbeitung der Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt [hängt]“ (13, Hervorhebung J. G.). Die Fundamentalfrage nach dem Sinn von Sein müßte demnach der Daseinsanalyse voranstehen, wie sie ja jeder Ontologie vorgeordnet ist.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
13
2) Wenige Zeilen später erfährt man indes, daß „die Fundamentalontologie, aus der alle andern erst entspringen können, in der existenzialen Analytik des Daseins gesucht werden [muß]“ (13, Hervorhebung J. G.). 3) Am Ende des Paragraphen wird sich nun zeigen, „daß die ontologische Analytik des Daseins überhaupt die Fundamentalontologie ausmacht“ (14, Hervorhebung J. G.). Die Vielfalt ist in der Tat unerhört.9 Einerseits soll die vorgängige Ausarbeitung der Fundamentalfrage nach dem Sinn von Sein (also die Fundamentalontologie) vor der Daseinsanalyse erfolgen, andererseits soll sie sich in ihr vorfinden bzw. sie sogar ausmachen. Wie ist aus dieser Vielfalt kluger Sinn zu machen? Friedrich-Wilhelm von Herrmann, der auch vom „nicht ohne weiteres einsehbaren Übergang“ von einer Bestimmung zur anderen sprach,10 hat eine elegante Lösung vorgeschlagen: die vorgängige Ausarbeitung der Seinsfrage vor der Daseinsanalytik, die in 1) angedeutet war, sei von Heidegger als unmöglich anerkannt, da sich der Sinn von Sein allein von einer Ontologie des Daseins her verstehen lasse.11 Sachlich trifft das vielleicht zu, aber Heidegger hat diese Unmöglichkeit der direkten Ausarbeitung der Seinsfrage in Sein und Zeit nicht selber hervorgehoben. Als von dem ontologischen Vorrang der Seinsfrage (§ 3) die Rede war, schien sich diese direkte Ausarbeitung, der der spätere Heidegger ohne den Rahmen der Daseinsanalytik auch konsequent nachgehen wird, von selbst aufzudrängen. An ihr „hing“ ja selbst (13) die Analytik des Daseins. Man muß also feststellen, daß der Textbefund zur Bestimmung der Fundamentalontologie in sich undeutlich ist. Aber so ist es nicht selten, wenn Philosophen ihr grundsätzliches Projekt präsentieren (erinnert sei etwa an die knappen, aber ebenso verwirrenden Bestimmungen der Idee des Guten bei Platon, der prima philosophia bei Aristoteles, der transzendentalen Kritik bei Kant, der Wissenschaftslehre bei Fichte, der Phänome9 Die Idee der Fundamentalontologie wird in den kommenden Jahren noch mehrere Verwandlungen durchgehen, bis sie allmählich durch den Entwurf des seinsgeschichtlichen Denkens abgelöst, aber auch erfüllt werden wird. Vgl. insbesondere die Vorlesung vom Sommer 1928 (GA 26, 196–202), wo Heidegger eine völlig neue „Kennzeichnung der Idee und Funktion der Fundamentalontologie“ umreißt (wo die Fundamentalontologie als der erste Teil der „Metaphysik“ erscheint, deren zweiter eine änigmatische „Metontologie“ sein soll), ferner und wohl zum letzten Mal öffentlich den vierten Abschnitt von Kant und das Problem der Metaphysik (1929), insbesondere den abschließenden Teil über „Die Metaphysik des Daseins als Fundamentalontologie“, wo die Endlichkeit zum das Dasein tragenden Grundthema der Ontologie befördert wird. Leider verbietet es der Rahmen des vorliegenden Kommentars, auf diese spannungsvollen und spannenden Wandlungen und ihre Konsequenz einzugehen. 10 von Herrmann 1987, 127. 11 Ebd., 135.
14
Jean Grondin
nologie des Geistes bei Hegel oder der phänomenologischen Reduktion bei Husserl). Es ist schwer zu erklären, aber es ist so: Selten scheinen die Philosophen selber über klare Begriffe zu verfügen, um das Licht, unter das sie ihren Entwurf stellen, zu beleuchten. Vielleicht liegt das in der Sache begründet: Wie kann eine Philosophie das Licht, aus dem der Denkentwurf seine Strahlkraft gewinnt, selber beleuchten? Angesichts des Wesentlichen stammelt man vielleicht immer. Denn wichtiger als die Projektbestimmung ist dessen Grundrichtung. Die der Fundamentalontologie ist in dieser Hinsicht deutlich genug und wurde von F.-W. von Herrmann sachlich zutreffend dargestellt: Soll die fundamentale Frage nach dem Sinn von Sein neu gestellt werden, so ist sie an dem Seienden zu entwickeln (und zu wecken), das dem Seinsproblem ständig ausgesetzt ist: dem Dasein. In der Ontologie des Daseins scheint somit die Grundaufgabe der Philosophie beschlossen. Heidegger warnte zwar davor, dies subjektivistisch mißzudeuten (freilich ohne Erfolg, weshalb er später die direkte Ausarbeitung der Seinsfrage, die die Einleitung nur erwog, doch vorzog). Aber er leistet diesem Mißverständnis selber Vorschub, als er sich im selben Atemzug an den Ausspruch des Aristoteles in De anima positiv anlehnte, wonach die Seele, das heißt (!) das Sein des Menschen, alles sei (14).12 Im Dasein bzw. in dessen Seinsverständnis schien nunmehr das Sein eines jeden Seienden seinen Grund und Boden zu finden. Die Ontologie des Daseins nahm sich so wie eine Art philosophia perennis aus. Ein so hochgesteckter Anspruch war jedenfalls seit Hegel der Philosophie nicht mehr zugemutet worden. Fassen wir die Vielfalt der Seinsfrage zusammen, wie sie uns im ersten Kapitel der Einleitung begegnet, so läßt sich stichwortartig folgender Eindruck gewinnen: Im § 1 tritt ein Philosoph auf, der sich selbstbewußt in die Kontinuität der aristotelisch-thomistischen Tradition stellt, um provokativ und protreptisch die Wiedererweckung der Seinsfrage anzumahnen; im § 2 begegnet alsdann ein quasi-analytischer Philosoph, der sich die Aufklärung dessen, was wir unter „Sein“ allgemein verstehen, zum Ziele macht; im § 3 erscheint plötzlich ein transzendentaler Philosoph, der im Seinsverständnis die apriorische Bedingung jeder wissenschaftlichen Erschließung von Seiendem festnageln will, während der § 4 einen „Existenzphilosophen“ in Erscheinung treten läßt, der in seinem Programm bei allem Festhalten an dem rein ontologischen und existentialen Charakter 12 Auf diese verblüffende Herkunft des Daseins aus der psyche (und nicht aus dem Subjektbegriff, wie es meist geschieht) wies auch Heidegger in seinen Vorlesungen hin (vgl. GA 19, 23, 579, 608; GA 22, 107). Sie wäre einer eingehenderen Interpretation wert.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
15
seiner Untersuchung eine Radikalisierung der zum Dasein gehörenden Seinstendenz durchführt. Was diese Vielfalt zusammenhält, ist allein die „Einheit“ der Seinsfrage. Diese findet sich im Seinsverständnis des um sein Sein besorgten Daseins verankert, aus dem sich das Seinsverständnis überhaupt – in seinen originären und abkünftigen Spielweisen – bestimmen lassen soll.
1.2 Die phänomenologische Hermeneutik des Daseins auf dem Weg einer Destruktion der abendländischen Ontologie Das erste Kapitel ließ bereits so verschiedenartige Facetten der Seinsfrage in Erscheinung treten, daß Heidegger in einem zweiten Kapitel einen neuen Anlauf nimmt, um seine Aufgabenstellung und Methode straffer zu gestalten. Sehr vieles von diesen Aufgaben wurde aber bereits vorweggenommen: daß die Ontologie des Daseins (Aufgabe 1 nach § 5) den Königsweg zur Seinsfrage bildet, wurde nämlich bereits im ersten Kapitel nahegelegt, aber ebenfalls die Tatsache, daß sie eine Destruktion der bisherigen Ontologie nach sich ziehen muß (Aufgabe 2 nach § 6). Die im Grunde einheitliche Doppelaufgabe des Werkes wird also die einer „ontologischen Analytik des Daseins“ und einer „Destruktion der Geschichte der Ontologie“ werden und konsequent die geplante Zweiteilung des Werkes gebieten, das es als solches aber nicht gibt. Ihnen werden sich – nahezu ex post – Erörterungen über die phänomenologische Methode der Untersuchung (§ 7) hinzugesellen. Allen Themenkomplexen des 2. Kapitels ist eine Sorge gemeinsam, die der rechten Zugangsart zum Phänomen des Daseins. Die bisherigen Ausführungen mochten nämlich den Eindruck hervorgerufen haben, das Dasein „müsse auch das ontisch-ontologisch primär gegebene sein“ (15). Dem ist nicht so, stellt nun Heidegger fest. Das Dasein ist sich selbst vielleicht das Fernste. Dies liegt an nichts anderem als dem, was wir mit Hilfe der späteren, aber sehr glücklichen Begrifflichkeit das „Wegsein“ des Daseins genannt haben: Anstatt seinem Dasein gewachsen zu sein, schreckt das durchschnittliche Dasein gleichsam vor ihm zurück, ist also „da“ im Modus des „möglichst-davon-weg“. Dieses Wegsein nimmt in den ersten Paragraphen von Sein und Zeit eine charakteristische Gestalt an: Das Dasein, das von sich „fällt“, „fällt“ nämlich in die Welt und versteht sich aus dieser. Dieses Fallen (von sich und in die Welt) ist freilich in Heideggers
16
Jean Grondin
Augen ein „Verfallen“, so natürlich es auch sein mag. Es besitzt aber nicht nur eine „negative“ Seite. Denn aus dieser Weltverfallenheit des Daseins geht hervor – und dies wird für den weiteren Gang der Heideggerschen Untersuchung von Bedeutung werden –, daß das Dasein als In-der-Weltsein begegnet und sich aus diesem zu verstehen hat. Die Weltverfallenheit ist also nicht als ein „gnostischer“ Abfall zu deuten. Diese Bedeutung schwingt nichtsdestoweniger mit, sofern das Dasein dazu verführt wird, sich nur aus der Welt und das heißt rein „dinghaft“ zu verstehen. So kommt das Dasein dazu, sich als ein vorhandenes Seiendes, als Substanz oder Subjekt mit Eigenschaften und Relationen zu von ihm unabhängigen Objekten zu denken. Diese „Kategorien“, wie man sie gut aristotelisch und kantisch nennen kann, sind nach Heidegger auf die ontische Welt zugeschnitten, dem Dasein als Dasein aber zuhöchst unangemessen. Warum? Weil sie den Existenzcharakter des Daseins verfehlen, nämlich die Aufgabe, die Sorge, den jeweiligen Vollzug, der das Dasein für sich selber immer ist. Etwas plakativ ausgedrückt: Im Dasein liegt die Tendenz, sich rückstrahlend aus der Welt zu verstehen, anstatt die Welt aus dem Dasein zu begreifen: „Das Dasein hat […] gemäß einer zu ihm gehörigen Seinsart die Tendenz, das eigene Sein aus dem Seienden her zu verstehen, zu dem es sich wesenhaft ständig und zunächst verhält, aus der „Welt“. Im Dasein selbst und damit in seinem eigenen Seinsverständnis liegt das, was wir als die ontologische Rückstrahlung des Weltverständnisses auf die Daseinsauslegung aufweisen werden“ (15 f.). Die „Weltlichkeit“ des Daseins erscheint bei Heidegger also auf doppelte Weise besetzt: Einerseits gehört sie unabdingbar zum faktischen Dasein, andererseits verleitet sie es dazu, sich dinghaft und damit inadäquat zu konzipieren. So wird es eine der vordringlichsten Bemühungen der Ontologie des Daseins sein, eine rein auf das Dasein zugeschnittene Begrifflichkeit zu entfalten, die die Kategorien des dinghaften Seienden tunlichst vermeidet und sie sogar aus dem Daseinsvollzug heraus ableitet, wenn sich die These bewahrheiten lassen soll, wonach alles Seinsverständnis im Dasein gründet. Diese Ontologie des Daseins wird dabei nicht zufällig auf die das Dasein konstituierende Zeitlichkeit zusteuern. „Die Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit hin“ bildet somit die erste Aufgabe dieser Ontologie. Sie umfaßt auch die veröffentlichten zwei Drittel des Buchkonzeptes. Dem Programm nach war sie aber kein Zweck an sich, da sie in einem dritten Teil (geplant unter dem Titel „Zeit und Sein“, das man nicht mit der Abhandlung gleichen Titels aus dem Jahre 1962 verwechseln wird) eine „Explikation der Zeit als des transzendentalen Horizontes der Frage nach dem Sein“ vorbereiten wollte. Dazu kam es nicht. Ein erneuter Anlauf zum
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
17
damals zwar niedergeschriebenen, aber anscheinend sofort verbrannten 3. Teil wurde in der Vorlesung vom SS 1927 über Grundbegriffe der Phänomenologie unternommen. Sie gewährt Einblick in die damalige Werkstatt Heideggers, aber der § 5 ließ bereits keinen Zweifel über den springenden Punkt des Heideggerschen Programms. Er greift auf früher Erörtertes zurück sowie in die historische Aufgabe der Destruktion vor. Die im Hinblick auf die Seinsfrage konzipierte Analytik des Daseins setzte sich zum vorläufigen Ziel, alle Strukturen des Daseins als Modi seiner Zeitlichkeit herauszustellen – gemäß den Spielarten der eigentlichen und der uneigentlichen Zeitlichkeit. Aus dieser Zeitlichkeit wird nämlich das Sein verstanden. In Heideggers Worten, die das Beweisziel von Sein und Zeit auch bündig zusammenfassen, sollte also gezeigt werden, „daß das, von wo aus Dasein überhaupt so etwas wie Sein unausdrücklich versteht und auslegt, die Zeit ist“ (17). Wie ist aber hier „die Zeit“ zu verstehen? Eine komplexe Frage, da diese Zeit selber von einem gewissen Existenzvollzug abhängt. Das „positive“ Zeitverständnis, auf das Heidegger aus ist, wird von einem „vulgären“ Zeitverständnis abgekoppelt. „Vulgär“ meint hier nicht etwas Unziemendes, sondern einfach das gängige, übliche, aber dingliche Verständnis der Zeit als reine Abfolge von Jetztmomenten, die sich ewig wiederholen und fortsetzen. Die philosophische Basis für dieses „vulgäre“ Zeitverständnis habe Aristoteles in seiner Physik erbracht, die seitdem die gesamte Geschichte der Ontologie durchherrscht habe. Das Zeitverständnis, das Heidegger dem vulgären entgegensetzt, bleibt etwas im Dunkeln, aber man vermutet unschwer, daß es eine Zeit wäre, die die (übrigens in der Einleitung nicht namentlich auftretende) Endlichkeit ernstnehmen würde. Die Zeit würde sich nicht mehr als endlose Reihe von Jetztpunkten, sondern aus der radikal gefaßten Sterblichkeit heraus verstehen lassen. Man kann auch unschwer erraten, warum in dieser Konzeption die vulgäre Zeit als „abgeleitet“ gilt: Um seine intime, radikale Zeitlichkeit zu verdrängen, vergegenständlicht das Dasein eine Zeit, die sich ewig fortsetzt. Aber so eine Zeit ist ja keine Zeit mehr, sondern nahezu ihr Gegenteil. Diese Ableitung scheint aber Heidegger in diesem Kontext weniger zu interessieren als die daraus zu ziehende ontologische Konsequenz. Heidegger trennt nämlich mehr oder weniger künstlich zwei Schritte in seiner Ausarbeitung der Zeitlichkeit des Daseins als des Horizontes, aus dem her Sein aufgefaßt werden soll. Die Problematik der Zeitlichkeit, erfährt man nun, bleibe auf das Dasein „beschränkt“. Herausgehoben werden soll aber darüber hinaus die Zeitlichkeit des Seins selber. Um sie von der Zeitlichkeit des Daseins getrennt zu halten, bezeichnet Heidegger
18
Jean Grondin
diese rein ontologische Problematik mit einem lateinischen Terminus als die der Temporalität des Seins. Handelt es sich aber sachlich um eine andere Thematik, wenn anders das Sein nur im Seinsverständnis des Daseins begegnet? Bleibt es doch nicht bei der Zeitlichkeit des Daseins als des Horizontes eines jeden Seinsverständnisses? Es ist schwer zu sagen, inwiefern sich die Aufrollung der Temporalitätsproblematik von der Zeitlichkeitsanalyse wirklich abgehoben hätte, da der der Temporalität gewidmete 3. Abschnitt („Zeit und Sein“) unveröffentlicht blieb. Man findet zwar Überlegungen zur Temporalität des Seins in der als Fortsetzung zu Sein und Zeit gemeinten Vorlesung vom SS 1927 (GA 24), aber sie sind offensichtlich von einem Kantischen Schematismus der Zeithorizonte stark geprägt, von dem sich Heidegger sehr bald distanzierte (und die übrigens die Abhängigkeit der Temporalitäts- von der Zeitlichkeitsproblematik eklatant bestätigt). Hätte der 3. Teil eine anschaulichere Entfaltung der Temporalitätsproblematik geboten? Das Ausbleiben seiner Veröffentlichung bezeugt eher ein Scheitern in dieser Hinsicht.13 Die Nichtveröffentlichung ist aber um so bedauerlicher, als Heidegger explizit versprochen hatte, just in der Exposition der Problematik dieser Temporalität „allererst die konkrete Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins“ (19) zu geben. Insofern man Sein und Zeit an seiner präzisen Frage und deren Antwort mißt, wie sie übrigens in der allerletzten Zeile des Buches noch einmal anklingen, darf man an dieser Stelle von einem gewissen „Scheitern“ des Unternehmens sprechen. Es handelt sich aber eher um ein literarisches Versagen vor dem, was Heidegger ausführen wollte und nur andeuten konnte. Mit aller Gerechtigkeit muß man in der Tat anerkennen, daß Heidegger, als er die Einleitung niederschrieb, nicht wissen konnte, daß der ihm damals vorschwebende 3. Abschnitt nie zur Veröffentlichung gelangen würde. Deshalb ist es eine historische Aufgabe der Heideggerforschung, sein damaliges Vorhaben zu rekonstruieren, denn die Grund13 Nach der Auskunft von F.-W. Herrmann hätte Heidegger die erste Fassung des 3. Teiles „bald nach ihrer Niederschrift verbrannt“ (vgl. das Nachwort zu GA 2, 582). Das ist aber offenbar eine späte mündliche Äußerung von Heidegger. In früheren Texten, nämlich im berühmten Brief über den Humanismus (GA 9, 325), aber auch in den Beiträgen (GA 65, 451) sowie in Besinnung (GA 66, 414) bezeichnete Heidegger das Schicksal dieses Abschnittes durchweg mit etwas anderen Worten. Nach all diesen Texten sei der fragliche 3. Abschnitt „zurückgehalten“ worden. Kann man zugleich einen Text „zurückhalten“ und „bald nach seiner Niederschrift verbrennen“? Wohl nicht, denn das „Zurückhalten“ schließt ein, daß das Zurückgehaltene – wenigstens eine Zeit lang – noch existierte. Ein Zurückhalten scheint also – rein sprachlich – ein sofortiges Vernichten auszuschließen. Deshalb gehört der Verfasser wider alle Wahrscheinlichkeit zu denjenigen, die nicht ausschließen möchten, daß dieser 3. Teil eines Tages auftauchen könnte.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
19
züge dazu liegen sehr wohl vor. Philosophisch bedeutete aber die Preisgabe des horizontschematischen Konzepts des 3. Abschnitts nicht unbedingt ein Scheitern, denn sie führte Heidegger vielleicht besser zu seiner eigenen Frage. Das Scheitern machte damit die Kehre möglich.14 Das „Scheitern“ der „konkreten Antwort“ von „Zeit und Sein“ im Jahre 1927 mochte auch damit zusammenhängen, daß Heideggers Stärke weniger in der systematischen Konstruktion als in der historischen-phänomenologischen Destruktion lag, die er vor und nach Sein und Zeit mit sicherem Instinkt praktizierte. Die im § 6 dargelegte Aufgabe der Destruktion bezeichnete ferner wohl auch Heideggers ursprünglichste Forschungsaufgabe, ehe sich die Aufgabe einer Ontologie des Daseins vor sie schaltete. Die Entwürfe zu einer Geschichte der Ontologie, als die sich die Phänomenologischen Interpretationen zu Aristoteles von 1922 (GA 61) empfahlen, beschrieben sich ja ursprünglich als eine destruktive Hermeneutik, das heißt eine Auslegung der ontologischen Tradition auf ihre verborgenen Motive hin. Großartig hieß es dort: „Die phänomenologische Hermeneutik der Faktizität sieht sich demnach, sofern sie der heutigen Situation durch die Auslegung zu einer radikalen Aneignungsmöglichkeit verhelfen will – und das in der Weise des konkrete Kategorien vorgebenden Aufmerksammachens –, darauf verwiesen, die überkommene und herrschende Ausgelegtheit nach ihren verdeckten Motiven, unausdrücklichen Tendenzen und Auslegungswegen aufzulockern und im abbauenden Rückgang zu den ursprünglichen Motivquellen der Explikation vorzudringen. Die Hermeneutik bewerkstelligt ihre Aufgabe nur auf dem Wege der Destruktion.“15 Diese damals Heidegger offenbar voll in Anspruch nehmende Aufgabe der Destruktion wird 1927 zur zweiten, nach der Analytik. Die Konzeption von Sein und Zeit ist insofern reifer, als sie in einer eigens ausgebildeten Ontologie des Daseins auf die Zeitlichkeit hin den Leitfaden festgemacht hat, an den sich eine solche hermeneutische Destruktion allererst zu halten hat. Die Destruktion läßt sich nicht als eine rein historische Aufgabe beschreiben, die der Daseinsanalytik von außen aufgeschraubt worden wäre, als diente sie lediglich der geschichtlichen Veranschaulichung. Denn das Dasein zeichnet sich nun einmal durch seine Zeitlichkeit aus. Zu ihr gehört eine wesentliche Geschichtlichkeit. Mit diesem Thema der Geschichtlich14 Zur Deutung der Kehre in diesem Sinne, vgl. Rosales 1984, 241–262; von Hermann 1994, 64–84; sowie Grondin 1991. Interpreten wie Hans-Georg Gadamer und T. Kisiel sahen freilich in der Kehre eine „Rückkehr“ Heideggers zu seinen Urintuitionen. Aber erst das systematische Scheitern machte diese Rückkehr möglich, so daß die Rede von einer „Kehre vor der Kehre“ cum grano salis zu nehmen ist. 15 Heidegger 1989a, 249.
20
Jean Grondin
keit knüpft Heidegger natürlich an ein Grundkonzept von Dilthey (der in diesem Zusammenhang aber nicht namentlich erwähnt wird) an, das sich auch einer großen Wirkungsgeschichte in Gadamers Hermeneutik erfreuen wird. Heideggers Problematik der Geschichtlichkeit bleibt aber – im Unterschied zu Dilthey und Gadamer – strikt im Hinblick auf die Seinsproblematik konzipiert: Die Seinsfrage ist selbst durch eine Geschichtlichkeit charakterisiert (20), wobei Heidegger die Grundintuition seiner späteren Seinsgeschichte vorwegnimmt. Konzentrierte sich Heidegger früher auf die „Weltverfallenheit“ des Daseins, so wird ihn in diesem Zusammenhang vor allem die „Traditionsverfallenheit“ des Daseins interessieren: „das Dasein hat nicht nur die Geneigtheit, an seine Welt, in der es ist, zu verfallen und reluzent aus ihr her sich auszulegen, Dasein verfällt in eins damit auch seiner mehr oder minder ausdrücklich ergriffenen Tradition“ (21). Vielleicht ist diese Traditionsverfallenheit phänomenologisch sogar einleuchtender als die Weltverfallenheit, sofern das Dasein immer schon einer „überkommenen Daseinsauslegung“ (20) oder Welterschließung verfällt, die sich etwa in den Vorurteilen (Gadamer) oder in Ideologien niederschlägt. Heideggers Akzent liegt hier durchaus auf der ontologischen Tradition. In ihr hat sich nämlich eine Seinsauslegung durchgesetzt, deren Herkunft vergessen und verdeckt bleibt. Die Destruktion zielt just auf diese Verdeckung: „Soll für die Seinsfrage selbst die Durchsichtigkeit ihrer eigenen Geschichte gewonnen werden, dann bedarf es der Auflockerung der verhärteten Tradition und der Ablösung der durch sie gezeitigten Verdeckungen. Diese Aufgabe verstehen wir als die am Leitfaden der Seinsfrage sich vollziehende Destruktion des überlieferten Bestandes der antiken Ontologie auf die ursprünglichen Erfahrungen, in denen die ersten und fortan leitenden Bestimmungen des Seins gewonnen wurden“ (22). Und diese Destruktion trifft nicht primär die Vergangenheit als solche, dies wäre ja nur historisch, sondern das „Heute“ (22), den ontologischen Schlummer der Gegenwart. Ja, es gilt, die Kräfte der Vergangenheit und der Tradition für das Heute neu freizulegen, um den Sinn für die Seinsfrage erneut zu wecken. Insofern ist die Absicht der Destruktion „positiv“. Sie versteht sich als Abbau von Verdeckungen um einer neuen Freilegung willen. Es läßt sich gleichwohl nicht in Abrede stellen, daß Heidegger sehr wohl die Aufmerksamkeit auf Grundentscheidungen in der Geschichte der abendländischen Ontologie richten möchte, die die Seinsthematik auf verhängnisvolle Weise verdeckt haben (der Gedanke einer abfallenden Seinsgeschichte wird damit ebenfalls antizipiert). Welche Entscheidungen gemeint sind, wird in der Einleitung nur angedeutet. Heidegger hat sich
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
21
aber in seinen frühen Vorlesungen so sehr mit ihnen beschäftigt, daß ihm vollkommen bewußt ist, daß er hier über einen Umriß (den die Gesamtausgabe inzwischen mit reichem Inhalt füllen hilft) nicht hinauskommt. Er lenkt jedoch die Aufmerksamkeit auf den ihm wichtigsten Punkt: das Verständnis des Seins aus der Zeit heraus. Denn auch die abendländische Ontologie verstand das Sein aus der Zeit. Sie tat es aber unausdrücklich, d. i. ohne sich ihres Leitfadens bewußt zu werden. So wird es eine der vordringlichsten und überzeugendsten Aufgaben der Destruktion werden, die abendländische Ontologie über ihren eigenen stillschweigenden Leitfaden aufzuklären, der in der griechischen Auslegung des Seins als Gegenwart gründet: „Diese griechische Seinsauslegung vollzieht sich jedoch ohne jedes ausdrückliche Wissen um den dabei fungierenden Leitfaden, ohne Kenntnis oder gar Verständnis der fundamentalen ontologischen Funktion der Zeit, ohne Einblick in den Grund der Möglichkeit dieser Funktion“ (26). Allein Kant hätte sich diesem Bezug zwischen dem Sein und der Zeit genähert, ohne ihn angemessen zu stellen, da er der gängigen Cartesianischen Ontologie des Subjekts verfiel, anstatt eine Ontologie des Daseins auszuarbeiten und von da aus die Seinsfrage neu aufzurollen. Diese Debatte mit Kant wird in Heideggers nächstem großen Buch, Kant und das Problem der Metaphysik (1929), fortgesetzt. Der Anspruch der Heideggerschen Destruktion ist also nicht gerade bescheiden: Erstmals in ihrer Geschichte soll die Ontologie über ihren Leitfaden aufgeklärt werden. Er wird durch einen noch weitergehenderen Anspruch überboten: Erstmals wird in Heideggers Buch auch versucht, dieses fundamentale Verhältnis zwischen Sein und Zeit auf den rechten Boden zu stellen. So sehr Heidegger auf einer Rückkehr zu den Urerfahrungen der griechischen Ontologie bestehen mag, er gibt auch sehr klar zu erkennen, daß die griechische Erfahrung selber auf einer wenn nicht unangemessenen, so doch sehr einseitigen Seinsauslegung beruht, nämlich der Fixierung auf die Gegenwart und die permanente Anwesenheit (ousia), die die Grundausstattung der Substanz ausmacht. Diese Permanenzobsession will Heidegger attackieren, wenn er verspricht, die Zeit nicht mehr von der Gegenwart, sondern von der (endlichen) Zukunft her, also von der radikalen Zeitlichkeit her anzugehen. Zusammenfassend: Die Destruktion, die dem ontologischen Schlummer der Gegenwart gilt, klärt nicht nur die Geschichte der Ontologie über ihren verborgenen Leitfaden auf, sie will es endlich möglich machen, die grundsätzliche Frage nach dem Verständnis des Seins aus der Zeit her zu stellen. Sein und Zeit ist gleichsam das verborgene Thema der gesamten Geschichte der Ontologie, ja der Menschheit, auf das die abendländische Philosophie zusteuert, das aber zum
22
Jean Grondin
ersten Mal in Heideggers Buch sichtbar und gestellt worden wäre. Es nimmt also nicht Wunder, daß die Destruktion, die Heidegger in seiner späteren Auseinandersetzung mit der Metaphysik nur radikalisierte, die primäre und originäre Aufgabe seiner Untersuchungen war. In den frühen Vorlesungen konnte es indes so scheinen, als sei die Destruktion Heideggers eigentliche „Methode“. In Sein und Zeit wird sie nunmehr als „Aufgabe“ gefaßt, da sie die eigentliche Zielrichtung seines Unternehmens anzeigt. Die Methode seiner Untersuchung stellt Heidegger lieber unter den Titel der Phänomenologie (§ 7). Damit reiht er sich offenbar in die Denkrichtung seines „Lehrers“ Edmund Husserl ein (sein eigentlicher „Lehrer“ war er aber nicht, da Husserl erst 1916, nach Heideggers Habilitation bei Rickert, nach Freiburg kam). Man könnte vielleicht bedauern, daß Heidegger dabei keinen direkten oder genaueren Bezug auf Husserls eigene Methode (weder die Reduktion noch die Intentionalität werden in der Einleitung genannt) oder Schriften nimmt. Er beläßt es nämlich bei einer allgemeinen Danksagung an Husserl (38). Heidegger zieht es offenbar vor, seinen phänomenologischen Ansatz eigenständig zu entwickeln. Es wäre aber voreilig, darin einen Affront Husserl gegenüber zu erblicken. Denn ein derartiges direkt auf die Sachen zugehendes Vorgehen war durchaus auch im Sinne Husserls. Der Affront liegt vielleicht anderswo, wie wir sehen werden. Heideggers Phänomenologiebegriff soll sich also von den Sachen selbst her entwickeln lassen. Tatsächlich führt Heidegger seinen Phänomenologiebegriff aber zunächst mit Hilfe von etymologischen Auslegungen der griechischen Termini phainomenon und logos ein. Damit exerziert Heidegger eine „Methode“ der begrifflichen Auslegung antiker Termini vor, mit der er die Zuhörer seiner Vorlesungen bezauberte. Diese Deutungsmethode erhob er zu einer wahren Kunst, sowohl in seiner Lehrtätigkeit als auch in seinen Schriften. Gemessen an diesen hohen Maßstäben läßt sich vielleicht nicht behaupten, daß die Ausführungen von Sein und Zeit über die Herkunft des Phänomenologiebegriffs zu den Meisterstücken dieser Kunst gehören. So imposant sie an sich sein mögen, gelangen sie kaum über Tautologisches hinaus: Phainomenon, erfährt man nämlich, heißt „das Sich-an-ihm-selbst-Zeigende“16, während logos als apophainestai so
16 Zur Charakterisierung des Phänomens als „das Sich-an-ihm-selbst-zeigen“ (31, Z. 3) bemerkte Husserl in einer Randbemerkung seines Handexemplars (Husserl 1994, 17): „Das ist gar zu einfach“. Zur berechtigten Frage „To What Extent was Heidegger a Phenomenologist?“, vgl. die skeptischen Bemerkungen in der klassischen Schilderung von Spiegelberg 1982, 336 – 421.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
23
viel heißt wie Sehenlassen von den Sachen her. Die Zusammensetzung in der Phänomenologie ergibt nicht viel mehr als die folgende, sehr wohl in Kauf genommene Tautologie: „Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen“(34). Ebenso tautologisch fällt die rein deskriptive Anlehnung an eine Maxime aus, die Husserl nur en passant formuliert hatte: „Zu den Sachen!“,17 auch wenn Heidegger den rein prohibitiven Methodensinn einer Fernhaltung alles nichtausweisenden Bestimmens betont. Sofern jede Wissenschaft von den Sachen selbst zu sprechen vorgibt, sind nämlich Versicherungen darüber, daß sich die Phänomenologie an die Sachen selbst zu halten hat, wie Heidegger selber notiert, „reichlich selbstverständlich“ (28). Vermutlich versteckt sich darin sogar ein Seitenhieb gegen die „Naivität“ der Husserlschen Phänomenologiekonzeption. Viel spannender wird es, wenn Heidegger sich zu bestimmen anschickt, was die Phänomenologie primär zu beschäftigen habe. Es ist schön und gut, die Sachen, wie sie von sich aus sind und von sich aus zeigen, auch zeigen zu wollen, aber was soll denn die Phänomenologie sichtbar machen? Was muß Thema einer ausdrücklichen phänomenologischen Ausweisung werden? Heideggers Antwort ist von verblüffender Kühnheit: „Offenbar solches, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, daß es seinen Sinn und Grund ausmacht“ (35). Ausdrückliches Thema der Phänomenologie soll also das sein, was sich nicht (!) zeigt (eine Konzeption, die Husserl natürlich vor den Kopf stieß), was aber dennoch danach verlangt, offenbar zu werden, da es den Grund von allem ausmacht. Das Phänomen, das Heidegger hier im Auge hat, ist offenbar das Sein. Es zeigt sich ja nicht, wird ja sogar als Thema verdrängt, aber die Erörterungen über das Seinsverständnis haben gerade erweisen wollen, daß allem Verstehen und Verhalten zu Seiendem ein solches Verständnis zugrunde liegt. Als Methode bildet also die Phänomenologie die Zugangsart zum Thema der Ontologie (35). Wie soll aber
17 Vgl. Husserl 1984, § 2, 10, wo Husserl von einem zu vollziehenden Rückgang „von den bloßen Worten […] zu den Sachen selbst“ sprach (weitere Texte bei von Herrmann 1987, 286). Heideggers Hinweis auf den tautologischen Ausdruck „deskriptive Phänomenologie“ (35, Z 6 f.) quittierte Husserl mit der Randbemerkung (a. a. O., 18): „Gleichwohl, das ist nicht zureichend“. Über den okkasionellen Charakter der Maxime bei Husserl, vgl. Spiegelberg 1982, 379: „From the start for Heidegger the central idea of phenomenology was expressed in the watchword ‚Zu den Sachen‘, which in Husserl’s own writings occurred only incidentally.“
24
Jean Grondin
die Phänomenologie die Zugangsart zum Sein freilegen? Eine vertrackte, aber notwendige Frage: Wie läßt sich denn das, was sich nicht zeigt, überhaupt zeigen? Es liegt auf der Hand, daß die Phänomenologie ihre zugangserschließende Aufgabe nur erfüllen kann, wenn sie sich als Hermeneutik versteht. Daher erklärt sich Heideggers leider allzu knappe Bezugnahme auf die Hermeneutik am Ende seiner langen Ausführungen über die Phänomenologie. Wie ist sie des genaueren zu verstehen? In der Heidegger-Literatur gibt es eine allgemeine Erklärung, um diese hermeneutische Wende der Phänomenologie verständlich zu machen. Die Phänomenologie etwa wäre hermeneutisch, weil die „Sachen“, mit denen sie es tun hat, interpretatorischer Natur wären. Es gäbe somit keine Sachen an sich, sondern nur interpretierte. Sachlich mag das sinnvoll sein, aber diese Deutung findet keinen direkten Anhalt im Text Heideggers. Nirgends sagt er nämlich, daß die hermeneutische Ausrichtung der Phänomenologie so zu fassen sei. Einschlägiger noch: Nirgends sagt er, daß es keinen Zugang zu den Sachen selbst gibt. Er behauptet geradezu das Gegenteil in der Einleitung, aber auch im zu Recht berühmten § 31 von Sein und Zeit über „Verstehen und Auslegung“, dem hermeneutischen Zentrum des Werkes, wo er expressis verbis von der Auslegung schreibt, daß ihre „erste, ständige und letzte Aufgabe bleibt, sich jeweils Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff nicht durch Einfälle und Volksbegriffe vorgeben zu lassen, sondern in deren Ausarbeitung aus den Sachen selbst her das wissenschaftliche Thema zu sichern“ (153). Heidegger hält durchaus an einer Ausweisung „aus den Sachen selbst“ fest. Es ist also verfehlt, die hermeneutische Orientierung der Phänomenologie allein aus dem interpretatorischen Charakter der Phänomene erklären zu wollen (was die Einleitung auch nicht tut). Der hermeneutische Charakter der Phänomenologie erklärt sich auch besser und einsichtiger aus dem Kontext der Einleitung, wo er explizit gefordert wird.18 Bei der Einführung des Grundproblems der Phänomenologie wird nämlich mehrfach darauf hingewiesen, daß ihr Thema „verborgen“ sei. Heidegger sagt auch vielfach, es sei „versteckt“, „verstellt“, „verdeckt“, „vergessen“, „verschüttet“, usw. Just gegen diese Verdeckung, die eigentlich eine Verdrängung ist, erhebt sich die phänomenologische
18 Vgl. Grondin 1996. Nach von Hermann (1987, 368 ff.) sei die hermeneutische Akzentuierung Heideggers aus ihrer Opposition zur reflexiven Phänomenologie des Bewußtseins bei Husserl zu verstehen. Sachlich ist das einwandfrei, aber der Text der Einleitung legt nicht selbst den Finger auf diesen Aspekt, sondern unmißverständlich auf den Grundtatbestand der Verdeckung, die eine hermeneutische Intervention auf den Plan ruft.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
25
Ausweisung: „Und gerade deshalb, weil die Phänomene zunächst und zumeist nicht gegeben sind, bedarf es der Phänomenologie. Verdecktheit ist der Gegenbegriff zu ,Phänomen‘“ (36; vgl. GA 20, 119: „Das Verdecktsein ist der Gegenbegriff zu Phänomen, und die Verdeckungen sind es gerade, die das nächste Thema der phänomenologischen Betrachtung sind“). Um diese fehlende phänomenologische Ausweisung aber namhaft zu machen als das, was sie ist, das heißt als Verdeckung, bedarf es der Auslegung, das heißt der Hermeneutik. Aus der hermeneutisch gewordenen Phänomenologie sollen nämlich die Motive dieser Verdeckung aufgeklärt, ja destruiert werden. In diesem Sinne sprach ja der oben angeführte Natorp-Bericht von 1922 von den „verdeckten Motiven“, denen die phänomenologische Hermeneutik nachzugehen habe. Dieser kritische Hermeneutikbegriff, der sich übrigens bestens in die Kontinuität der hermeneutischen Tradition stellt, die stets nach dem Motiv (scopus) hinter dem Buchstaben fragte, bildet somit die notwendige Ergänzung einer jeden Phänomenologie. Wiederum zeigt sich hier, wie 1922, daß die Hermeneutik mit der Destruktion Hand in Hand geht. Es soll nämlich erklärt werden, warum das Dasein bzw. die Philosophie das doch dringliche Seinsthema in der Verborgenheit (bzw. Vergessenheit) hält. Darin versteckt sich nämlich eine Flucht der Philosophie und des Daseins vor ihrer primären Sorge, dem Sein. Diese Flucht ist wiederum in der Konstitution des Daseins begründet, nämlich in dessen Hang zum Wegsein, das heißt seiner Tendenz, seiner dringlichsten Frage – das heißt augustinisch gesprochen der Frage, die es doch für sich selber ist19 – auszuweichen. Dies hat beträchtliche systematische Folgen. Die phänomenologische Hermeneutik der Seinsvergessenheit ist in die Hermeneutik des Daseins zurückzuverfolgen. Die Verschüttung der Seinsfrage ist eigentlich die Tat des von sich selbst abfallenden Daseins. Die Hermeneutik will somit das Dasein in seiner eigenen Verfallstendenz erschüttern. Just in dieser Erschütterung und in einem zu erweckenden Wachsein des Daseins über sich selbst sah die frühe Vorlesung vom SS 1923 (GA 63, 15) die Grundaufgabe der Hermeneutik: „Die Hermeneutik hat die Aufgabe, das je eigene Dasein in seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst zugänglich zu machen, mitzuteilen, der Selbstentfremdung, mit der das Dasein geschlagen ist, nachzugehen. In der Hermeneutik bildet sich für das Dasein eine Möglichkeit aus, für sich selbst verstehend zu werden und zu sein. (…) Thema der hermeneutischen 19 Über diesen augustinischen Sinn (die Frage, die ich für mich selbst bin) des Daseinsbegriffs, vgl. Grondin 1997.
26
Jean Grondin
Untersuchung ist je eigenes Dasein, und zwar als hermeneutisch befragt auf seinen Seinscharakter im Absehen darauf, eine wurzelhafte Wachheit seiner selbst auszubilden.“ Die elliptischen und gedrängteren Formulierungen von Sein und Zeit zur Hermeneutik fallen wohl etwas weniger dramatisch aus und beziehen sich zweifelsohne betonter auf die Seinsfrage. Aber der Einführung des Hermeneutikkonzeptes (37 ff.) gingen unmittelbar Überlegungen (36) über die Verstellung, Verschüttung und Verdeckung der Seinsfrage voraus. Sie gründen offenbar in einer Selbstverstellung des Daseins. Die Seinsvergessenheit geht nämlich mit einer Daseinsvergessenheit einher. Aufgabe der Hermeneutik des Daseins, die sich jetzt auch als Ontologie des Daseins bezeichnen läßt, ist es, das Dasein für sich selbst und das Sein für die Philosophie zurückzugewinnen. Allein eine solche destruierende Hermeneutik kann also das Sein und das Dasein phänomenologisch sichtbar werden lassen. Wer sehen, das heißt Phänomenologie treiben will, muß zunächst die das Sehen verhindernden Verdeckungen kraft eines hermeneutischen Rückganges auf die verborgenen Motive der Verschüttung destruieren. Die eigentliche Methode der hermeneutischen Phänomenologie bleibt also die der Destruktion (die stillschweigend die Husserlsche Reduktion ablöst). Deshalb wird die Hermeneutik des Daseins die Basis bilden, von der her die phänomenologische Ontologie ihren Anlauf nehmen wird. Dies ist der bündige Sinn der geschlossenen Philosophiekonzeption, mit der Heidegger seine einleitenden Überlegungen faktisch beschließt: „Philosophie ist universale phänomenologische Ontologie, ausgehend von der Hermeneutik des Daseins, die als Analytik der Existenz das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragens dort festgemacht hat, woraus es entspringt und wohin es zurückschlägt“ (38). So formelhaft die Titel Ontologie und Phänomenologie klingen mögen, ihre hermeneutische Inanspruchnahme und das Zurückschlagen auf die Existenz deuten unmißverständlich auf die ethische Dimension des Heideggerschen Unternehmens hin.
1 Die Wiedererweckung der Seinsfrage
27
Literatur Grondin, J. 1991: Prolegomena to an Understanding of Heidegger’s Turn, in: Graduate Faculty Philosophy Journal (14 –15), 85–108 Grondin, J. 1996: L’herméneutique dans Sein und Zeit, in J.-F. Courtine (Hg.): Heidegger 1919–1929. De l’herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein, Paris 179–192 Grondin, J. 1997: Zur hermeneutischen Wahrheit. Heidegger und Augustinus, in E. Richter (Hg.): Die Frage nach der Wahrheit, Frankfurt a. M., 161–173 Hermann, F.-W. v. 1987: Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Eine Erläuterung von Sein und Zeit. Band I: Einleitung: Die Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein, Frankfurt a. M. Hermann, F.-W. v. 1994: Das Ende der Metaphysik und der andere Anfang des Denkens. Zu Heideggers Begriff der Kehre, in ders.: Wege ins Ereignis. Zu Heideggers ,Beiträgen zur Philosophie‘, Frankfurt a. M., 64 –84 Husserl, E. 1984: Logische Untersuchungen, Husserliana XIX/1, Den Haag Husserl, E. 1994: Randbemerkungen Husserls zu Heideggers Sein und Zeit, in Husserl Studies 11 Rosales, A. 1984: Zum Problem der Kehre im Denken Heideggers, in: Zeitschrift für philosophische Forschung (38), 241–262 Spiegelberg, H. 1982: The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, 3. Aufl., Den Haag u. a. Thomä, D. 1990: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers, Frankfurt a. M.
2 Franco Volpi
Der Status der existenzialen Analytik (§§ 9–13)
2.1 Begriff, Entstehung und Programm der „existenzialen Analytik“ Nach der „Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein“, die die Einleitung von Sein und Zeit bildet, entfaltet Heidegger im ersten Teil des Werkes „Die Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit und die Explikation der Zeit als des transzendentalen Horizontes der Frage nach dem Sein“. Dieser Teil war in drei Abschnitten geplant, von denen nur die beiden ersten veröffentlicht wurden, während der dritte Abschnitt sowie der ganze zweite Teil ausblieben. Der erste Abschnitt des ersten Teils bringt in fünf Kapiteln „Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins“. Er umfaßt die §§ 9–13, in denen Heidegger den allgemeinen Rahmen der „existenzialen Analytik“ absteckt und ihren philosophischen Status bestimmt. Mit dem Terminus „existenziale Analytik“ bezeichnet Heidegger das Programm einer philosophisch rigorosen und adäquaten Analyse des menschlichen Lebens, an dem er seit dem Kriegsnotsemester 1919 intensiv arbeitete und das sich zum Ziel setzt, das Leben in seinen echten Zügen und seiner ursprünglichen Seinsweise, das heißt so wie es sich in seiner faktischen „Bewegtheit“ gibt und entzieht, zu erfassen (GA 56/57). Es ist die philosophische Absicht, das Leben zu verstehen. Dies war ein Problem, das der junge Heidegger mit den Hauptströmungen der damaligen Philosophie teilte. An erster Stelle stand Husserl mit seiner Phänomenologie. Er führte die philosophische Explikation des menschlichen Lebens auf Subjektivität zurück und machte diese zum archimedischen Punkt, auf dem die Gegen-
30
Franco Volpi
stände und deren Horizonte sowie die Welt als der Horizont der Horizonte konstituiert werden. Er traf eine prinzipielle Unterscheidung zwischen der Seinsweise des Konstituierenden und derjenigen des Konstituierten, zwischen Akt und Gegenstand, Subjektivität und Welt. Ebenso hob Max Scheler – mit dem Heidegger einen intensiven Gedankenaustausch pflegte – auf der Grundlage seiner Phänomenologie der Werte die Person als geistigen Werteträger von allem anderen Seienden ab. In einer ähnlichen Richtung engagierte sich auch der Neukantianismus, der eine vergleichbare prinzipielle Unterscheidung geltend machte und für die Subjektivität eine transzendentale Verfassung beanspruchte. Auf der Gegenseite thematisierten der Historismus und die Lebensphilosophie – vor allem Dilthey und der alte Simmel – ebenfalls das Phänomen des Lebens. Statt jedoch daraus den Grundsatz für eine Konstitution von Erfahrung und Erkenntnis zu gewinnen, stellten sie Geschichtlichkeit, Vergänglichkeit und Hinfälligkeit aller menschlichen Gebilde in den Vordergrund und öffneten letztlich dem Relativismus und Irrationalismus Tür und Tor. Auch Jaspers war mit seinem Programm einer Existenzerhellung hervorgetreten. In den zwanziger Jahren spürte Heidegger eine geistige Verwandtschaft zu ihm und hegte die Hoffnung, mit ihm ein echt philosophisches Gespräch und einen gemeinsamen Kampf gegen die sterile und blutlose Universitätsphilosophie führen zu können. Doch auch in Jaspers’ Ansatz war zuguterletzt die verobjektivierende Betrachtungsweise vorherrschend, so daß auch bei ihm das Phänomen des Lebens verdinglicht und verfehlt wurde, wie Heidegger in einer ausführlichen Besprechung der Psychologie der Weltanschauungen des Freundes klarzustellen suchte, die er zwischen 1919 und 1921 schrieb, ohne sie jedoch zu veröffentlichen (GA 9). In der Tat griff Heidegger das Problem des Lebens radikaler und ursprünglicher auf, weshalb er sich an keiner dieser Richtungen orientieren konnte. Im Gegenteil: er kritisierte deren Unzulänglichkeiten und suchte nach einem anderen, eigenen Weg. Er wollte dabei sowohl die theoretische Verfehlung der Faktizität des Lebens durch die Phänomenologie und den Neukantianismus als auch den philosophisch unkontrollierbaren Relativismus und Irrationalismus der Lebensphilosophie und des Historismus vermeiden. Wie wir inzwischen anhand der veröffentlichten Vorlesungstexte Semester für Semester nachvollziehen können, fand Heidegger zu seinem originellen philosophischen Ansatz über eine intensive Auseinandersetzung mit der frühchristlichen Lebenserfahrung, die er sich damals aufgrund ein-
2
Der Status der existenzialen Analytik
31
gehender Exegesen von Paulus, Augustin und dem frühen Luther zueigen machte (GA 60). Daraus gewann er eine fundamentale philosophische Grundintuition: Das Leben kann in seinen echten, eigensten Zügen nicht erfaßt werden, solange man sich darauf beschränkt, es zum Gegenstand abstrakter und neutraler Betrachtung zu machen, also es theoretisch zu verfremden und zu einem Ding unter Dingen zu verobjektivieren. Die eigentümliche „Bewegtheit“ des Lebens wird dagegen ans Licht gehoben, wenn man – wie im Frühchristentum – die Eigenart des menschlichen Daseins, seinen ursprünglichen Charakter als zu vollziehende Praxis beachtet, es also als eine eigene Sache, über die man jeweils zu entscheiden hat, philosophisch auffaßt, und zwar so, daß dieser praktisch-moralische Zug nicht nivelliert und verdeckt, sondern zur Geltung gebracht wird. Aufgrund der philosophischen Aneignung der frühchristlichen Lebenserfahrung nahm Heidegger entschieden von der theoretisch orientierten traditionellen Perspektive Abstand und versuchte, eine philosophische Lebensanalyse praktisch-moralischer Art zu entwickeln, die auf das Leben zurückschlagen, es beleuchten und zur Authentizität, also zum Guten hin lenken sollte. Die Ausarbeitung eigentümlicher, dafür geeigneter Bestimmungen – die in Sein und Zeit in Abhebung von den traditionellen Ding-Kategorien als „Existenzialien“ bezeichnet werden – charakterisiert Heideggers philosophisches Programm, das er in den jeweiligen Entwicklungsstufen verschieden nennt: „theoretische Urwissenschaft“ oder „Vorwissenschaft“ im Kriegsnotsemester 1919, „Hermeneutik der Faktizität“ im Sommersemester 1923 (GA 63), schließlich in Sein und Zeit „existenziale Analytik“. Wenn aber die Gespanntheit der frühchristlichen Lebenserfahrung, deren vertikale Ausgerichtetheit Heidegger als eine immanente Dramatik der endlichen Individualexistenz horizontal auslegte, ihm einerseits das Problem der Faktizität und Geschichtlichkeit in seiner vibrierenden Intensität näherbrachte, so lieferte das Christentum andererseits noch keine zureichende Begrifflichkeit für eine philosophisch adäquate Ausarbeitung des Problems. Genau da kam Heidegger das neuzuentdeckende Potential des aristotelischen Denkens zugute. Das Corpus Aristotelicum – wenn man es freilich von den Verdeckungen und Verkrustungen der Scholastik freimachte – erschien wieder in seinem Glanz und seiner Frische, und bot die rigorose Begrifflichkeit, die Heidegger zur philosophischen Artikulation der Faktizität des Lebens brauchte. Das Programm der existenzialen Analytik unterscheidet sich also grundlegend von den konkurrierenden Ansätzen der damaligen philosophischen Szene. Es grenzt sich in seiner Zugangsart zum Phänomen des mensch-
32
Franco Volpi
lichen Lebens ebenfalls gegen die jeweilige humanwissenschaftliche Betrachtungsweise der Anthropologie, Psychologie und Biologie ab (§ 10). Und es greift das Problem der Seinsweise des Menschen auch radikaler als die traditionellen Definitionen des Menschen an, namentlich die griechische, die den Menschen als vernunftbegabtes Lebewesen (zoon logon echon, animal rationale) bestimmt, und die christliche, die in ihm ein irdisches Ebenbild Gottes, also eine Person mit eigenem Denken und Willen sieht. Die existenziale Analytik charakterisiert sich ferner in methodischer und thematischer Hinsicht so: 1) Methodisch ist sie durch jene kritische Haltung geprägt, die bis zur „Kehre“ die heideggersche Zugangsweise zur traditionellen Philosophie kennzeichnet. Sie wird im § 6 von Sein und Zeit als „phänomenologische Destruktion“ bezeichnet und zusammen mit Reduktion und Konstruktion als eines der drei Bestandstücke der phänomenologischen Methode verstanden. Der Terminus „Destruktion“ wird also bekanntlich nicht in der trivialen, negativen Bedeutung verwendet, mit dem er in der Alltagssprache besetzt ist, sondern im Sinne von Abbau und Zerlegung herkömmlicher philosophischer Begriffe und Systeme, und dies um eines wirklich radikalen, fundamentalen Wiederaufbaus willen. 2) Thematisch zeichnet sich Heideggers Programm der existenzialen Analytik dadurch aus, daß es die Frage nach dem Dasein, also der Seinsweise des Menschen, in seiner Verschränkung mit der Frage nach der Wahrheit und der Frage nach der Zeit anpeilt. Der einheitliche Horizont, innerhalb dessen diese Probleme behandelt werden, ist der Horizont der Seinsfrage, die hier noch im Sinne der Frage nach dem Sein des Seienden, also der Bestimmung der fundamentalen Seinsmodi, namentlich des Seinsmodus des Daseins, entfaltet wird. Von diesen drei Hauptproblemen (Wahrheit, Dasein, Zeit) soll hier vor allem das für die Grundintention der existenzialen Analytik entscheidende betrachtet werden, nämlich das Problem des Daseins, das heißt der ontologischen Verfaßtheit, der fundamentalen und einheitlichen Seinsweise des menschlichen Lebens. Wie kommt aber Heidegger zu dieser Frage, und zwar im Horizont der Seinsfrage, die ihn bereits seit der Lektüre von Brentanos Dissertation Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles beschäftigte (vgl. Heidegger 21976, 81)? Es läßt sich annehmen, daß er jeweils die vier aristotelischen Grundbedeutungen des Seienden – an sich (substanziell) oder akzidentell (kath’hauto e kata symbebekos), nach den Schemata der Kategorien (kata ta schemata ton kategorion), als wahr oder falsch (hos alethes e pseudos), der Möglichkeit oder Wirklichkeit nach (dynamei e energeia) – auf ihre Fähigkeit hin erprobte, als
2
Der Status der existenzialen Analytik
33
tragender Grundsinn von Sein zu fungieren. Gegenüber der ousiologischen Lösung der Seinsfrage, die er in der scholastischen Tradition und bei Brentano vorfand, wurde der junge Heidegger bald skeptisch und vertiefte sich daraufhin in den zwanziger Jahren in die Untersuchung der Bedeutung des Seienden im Sinne des Wahren mit der Absicht, zu prüfen, ob diese Bedeutung als Grundsinn von Sein gelten kann. Die Vorlesungen jener Jahre – etwa diejenige des Wintersemesters 1925/26 (Logik. Die Frage nach der Wahrheit, GA 21) oder der Schlußteil derjenigen des Wintersemesters 1929/30 (Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, GA 29/30) und der erste Teil derjenigen des folgenden Semesters (Vom Wesen der menschlichen Freiheit) – bekunden klar und deutlich, wie entscheidend für Heidegger die aufgrund seiner Aristoteles-Auslegung aufgestellte Gleichung von Sein und Wahrheit ist. In der gleichen Absicht, den einheitlichen Grundsinn von Sein aufzudecken, ergründet er später auch die Grundbedeutung des Seienden im Sinne der Möglichkeit und der Wirklichkeit, wovon die Vorlesung des Sommersemesters 1931, eine Interpretation von Met IX, 1–3, Zeugnis ablegt (GA 33). Im folgenden werde ich systematisch rekonstruieren, wie Heidegger – ausgehend von seinem Interesse für die Problematik der Polysemie des Seienden – zu einer Wiederaufnahme auch der praktischen Philosophie des Aristoteles gelangt, insbesondere der Fragestellung des VI. Buches der Nikomachischen Ethik, welches gleichsam das verborgene Wasserzeichen der existenzialen Analytik darstellt.
2.2 Der phänomenologische Aufgriff des Wahrheitsphänomens Zu berücksichtigen ist zunächst der Umstand, daß Heideggers Weg zur existenzialen Analytik – im Hinblick auf die Seinsfrage und über die hermeneutische Aneignung der frühchristlichen Erfahrung des faktischen Lebens und der aristotelischen Begrifflichkeit – von einer eindringlichen Auseinandersetzung mit Husserl, insbesondere den Logischen Untersuchungen, ausgeht. Indem sich Heidegger mit der von Husserl entwickelten Wahrheitstheorie auseinandersetzt, gelangt er zu der Überzeugung, daß das Urteil, also die Aussage als Verbindung (synthesis) bzw. Trennung (dihairesis) von Vorstellungen, nicht, wie traditionell behauptet, den ursprünglichen Erscheinungsort der Wahrheit, sondern lediglich eine begrenzte Lokalisierung darstellt, die, verglichen mit dem breiteren ontologischen Spektrum des Wahrheitsgeschehens, das Phänomen erheblich
34
Franco Volpi
reduziert. Deshalb stellt er die drei überlieferten Thesen über das Wesen der Wahrheit in Frage. Sie behaupten: 1) die Wahrheit sei Angleichung des Verstandes an den Sachverhalt (adaequatio intellectus et rei), 2) der ursprüngliche Ort ihres Erscheinens sei das Urteil als Verbindung bzw. Trennung von Vorstellungen, 3) die Urheberschaft dieser beiden Sätze sei Aristoteles zuzuschreiben. Schon Husserl hatte mit seiner These, daß nicht nur beziehende und verbindende, sondern auch monothetische Akte einfacher Erfassung wahr sein können, die herkömmliche Wahrheitsauffassung als eine im Urteil stattfindende Angleichung in Frage gestellt und infolgedessen eine Unterscheidung zwischen Satzwahrheit und Anschauungswahrheit eingeführt. Dabei wies er letzterer Wahrheitsweise einen fundierenden und ursprünglicheren Charakter zu. Darüber hinaus hatte er eine entscheidende Neuerung eingeführt, nämlich den Gedanken der kategorialen Anschauung. In Analogie zur sinnlichen Anschauung war diese dazu gedacht, die kognitive Erfassung jener Urteilselemente zu erklären, deren Ausweisung die sinnliche Anschauung übersteigt und die traditionell im Bereich des Kategorialen angesiedelt werden. Diese in der VI. Logischen Untersuchung angestellten Überlegungen dienen Heidegger als Leitfaden, um in der von der Phänomenologie eingeschlagenen Richtung an die Wurzeln zu gehen. So gelangt er dazu, die rein logische Bedeutung des „Wahr-seins“ von der ursprünglicheren, ontologischen Bedeutung der „Wahrheit“ terminologisch zu unterscheiden. Dabei glaubt er, diese Unterscheidung bei Aristoteles vorfinden zu können. In seinen Augen ist in der Tat gerade die ursprüngliche ontologische Tiefe des Wahrheitsphänomens das Bestimmende und Eigentümliche der aristotelischen Wahrheitsauffassung, wiewohl diese sicher auch die eingeschränkte Bedeutung des Wahrseins der Aussage berücksichtigt. Heideggers Infragestellung der traditionellen Wahrheitsauffassung, die im Anschluß an Husserls phänomenologischen Ansatz vollzogen wird, geht mit einer stark ontologisierenden Deutung bestimmter aristotelischer Grundtexte einher, wie des sprachphilosophischen, einleitenden Teils von De interpretatione, des 10. Kapitels des IX. Buches der Metaphysik und des VI. Buches der Nikomachischen Ethik, denen er bewußt ihre volle ontologische Kraft zurückgibt. Dabei gelangt Heidegger zu so etwas wie einer Topologie der Orte der Wahrheit, bei deren Aufstellung er sich die Grundintuitionen der aristotelischen Wahrheitsauffassung zueigen macht und in einer ontologisierenden Umgestaltung zur Geltung bringt. In groben Umrissen kann diese Topologie folgendermaßen zusammengefaßt werden:
2
Der Status der existenzialen Analytik
35
1) Wahr ist in erster Linie das Seiende selbst im Sinne seines Offenbarseins, Entdecktseins, Unverborgenseins. Damit nimmt Heidegger die aristotelische Bestimmung des on hos alethes wieder auf. 2) Wahr ist des weiteren das Dasein, das menschliche Leben, im Sinne seines Entdeckendseins, also seines Verhaltens, das Seiendes entdeckt. Damit macht sich Heidegger die aristotelische Bestimmung der psyche hos aletheuein zueigen. Mehr noch: aus Aristoteles, vor allem aus dem VI. Buch der Nikomachischen Ethik, glaubt er mit gewissem Recht, eine vollständige Phänomenologie der entdeckenden Verhaltensweisen der menschlichen Seele, das heißt für ihn des menschlichen Lebens, des Daseins als In-derWahrheit-seins, schöpfen zu können. Diese Verhaltensweisen lassen sich so näher angeben: 2.1.) Die menschliche psyche, das Dasein, kann durch die ihr spezifische Verbindungsfähigkeit des logos entdeckend sein, und dies geschieht in den in Eth. Nic. VI, 2 genannten fünf Weisen des In-der-Wahrheit-Seins, des aletheuein der menschlichen Seele: episteme, techne, phronesis, nous, sophia. 2.2.) Logoshafte Entdeckung des Seienden ist aber darauf fundiert, daß die menschliche psyche, das Dasein, vorher „intuitiv“, in unmittelbarer Erfassung entdeckend sein kann, und zwar in der aisthesis, die sich je auf ihr Eigenspezifisches (idion) bezieht und so immer wahr (aei alethes) ist, oder in der noesis, die ihren Gegenstand gleichsam durch Berührung (thigein) erfaßt, und entweder vollzogen wird oder aber im agnoein ganz ausbleibt und daher in diesem Fall nicht einmal falsch sein kann. 3) Wahr ist schließlich die ausgezeichnete Form des logos, nämlich der logos apophantikos, die prädikative Aussage, in seinen zwei Formen des Zusprechens (kataphasis) und Absprechens (apophasis). Das Wahrsein der Aussage ist allerdings nur ein abgeleiteter Modus des ursprünglichen Wahrheitsgeschehens, worin sie gründet. Durch diese ontologisierende Rekonstruktion der aristotelischen Wahrheitstheorie will Heidegger das Verständnis des Wahrheitsphänomens von der Struktur der Aussage entkoppeln und den ontologischen Horizont erschließen, in dem er das Problem des Seienden im Sinne des Wahren in seinem vollen Spektrum entfalten kann. Im Rahmen der Analyse der Grundbedeutung des Seienden im Sinne des Wahren konzentriert er sich in den zwanziger Jahren auf den Versuch, die ontologische Grundstruktur der psyche, des menschlichen Lebens und Daseins in seinem Entdeckendsein, aufzugreifen und zu bestimmen. Und im Rahmen der phänomenologischen Frage nach der Grundverfaßtheit der Subjektivität interpretiert er die aristotelische Bestimmung der psyche als aletheuein. So definiert er das Programm der existenzialen Analytik von Sein und Zeit durch die Verbindung von phänomenologischer Zugangsweise und aristotelischen Komponenten.
36
Franco Volpi
Doch warum und woher die zentrale Bedeutung der Nikomachischen Ethik, namentlich des Begriffs der praxis und der Konzeption einer „praktischen Philosophie“, zur Bestimmung der existenzialen Analytik? Es gibt Indizien genug, die dafür sprechen, daß Heidegger zur Nikomachischen Ethik und zur aristotelischen Auffassung der praktischen Philosophie gegriffen hat, um sich aus den Problemen herauszuhelfen, in die ihm zufolge die Husserlsche Auffassung der transzendentalen Subjektivität zwangsläufig führte, und einen eigenen Weg zum philosophischen Verständnis des menschlichen Lebens zu erschließen.
2.3 Die „existenziale Analytik“ als Ontologie des menschlichen Lebens: dessen Verhaltensweisen (theoria, poiesis, praxis) und die Ontologisierung der praxis zu dessen Seinsweise In der Tat: in Heideggers Augen geriet Husserls Bestimmung der Subjektivität in eine fundamentale Ausweglosigkeit, nämlich in die Aporie der Zugehörigkeit des Ichs zur Welt und der gleichzeitigen Konstitution der Welt durch das Ich. Mit der von Husserl in Aussicht gestellten Lösung, derzufolge zwischen dem psychologischen, weltzugehörigen Ich und dem transzendentalen, weltkonstituierenden Ich, zwischen der Realität des einen und der Idealität des anderen scharf zu unterscheiden ist, konnte sich Heidegger nicht zufrieden geben. Gewiß, er war mit Husserl darin einig, daß die Konstitution der Welt nicht durch den Rückgriff auf Seiendes erklärt werden kann, das die gleiche Seinsweise wie die Welt hat. Nichtsdestoweniger nahm er von Husserls Bestimmung der transzendentalen Subjektivität Abstand, denn diese sei primär und einseitig im Horizont einer Privilegierung von theoretischen Erkenntnisakten gewonnen. Wie aus seiner Analyse des Wahrheitsphänomens und aus der gewonnenen Topologie der Orte der Wahrheit klar wird, hegt Heidegger die Überzeugung, die Theorie sei nur eine der mannigfaltigen Weisen des entdeckenden Verhaltens des Menschen zum Seienden. Neben der theoria und vor ihr stehen zum Beispiel praxis und poiesis, die gleichfalls Weisen des Sichverhaltens des Menschen zum Seienden darstellen. Infolgedessen greift Heidegger auf Aristoteles zurück, der in seiner Auffassung vom Menschen die Mannigfaltigkeit der entdeckenden Verhaltensweisen der Seele voll berücksichtigt. In einer weitangelegten Aristoteles-Interpretation, an der
2
Der Status der existenzialen Analytik
37
er seit 1919 arbeitete und deren sichtbare Spuren in den frühen Freiburger und den Marburger Vorlesungen sowie in Sein und Zeit zu finden sind, legt Heidegger in dieser Richtung das VI. Buch der Nikomachischen Ethik aus. Dabei deckt er in der aristotelischen Behandlung der dianoetischen Tugenden entsprechende Bestimmungen des menschlichen Lebens auf, die in der neuzeitlichen und modernen Philosophie, namentlich bei Husserl, nicht in ihrem vollen Reichtum erkannt und thematisiert sind. Eben in diesem Horizont, der durch die Entgegensetzung zur theoretisch orientierten Subjektauffassung der neuzeitlichen und modernen Philosophie und durch die produktive Aneignung aristotelischen Gedankenguts abgesteckt wird, läßt sich der tiefere Sinn der existenzialen Analyse erkennen. Man kann also Heideggers philosophisches Programm der zwanziger Jahre besser verstehen, wenn man die Daseinsanalyse im Lichte der phänomenologischen Auslegung von Aristoteles, insbesondere der Nikomachischen Ethik, erneut liest, und wenn man dabei berücksichtigt, daß die Erträge von Heideggers intensiver Assimilation von Aristoteles sich oft an Stellen sedimentieren, an denen vom Stagiriten nicht explizit die Rede ist. Der aristotelische Hintergrund gewisser in der existenzialen Analytik ausgearbeiteten Grundbestimmungen läßt sich nun dadurch herausstellen, daß man Entsprechungen aufweist, aus denen ersichtlich wird, wie Heidegger in einigen Grundtermini seiner Daseinsanalyse den substantiellen Sinn vieler Grundbegriffe der praktischen Philosophie des Aristoteles wiederaufnimmt, reformuliert und reaktiviert. Die erste, ziemlich auffällige Entsprechung ist die zwischen den drei in der existenzialen Analytik unterschiedenen Seinsweisen des Seienden, nämlich Zuhandenheit, Vorhandenheit und Dasein, und den aristotelischen Verhaltensweisen der theoria, poiesis und praxis: 1) Theoria ist das Verhalten des konstatierenden und beschaulichen Erkennens, das die Erfassung der Wahrheit von Seiendem anvisiert. Sein spezifisches Wissen ist die Weisheit (sophia). Steht Dasein in dieser Einstellung, so begegnet ihm Seiendes in der Seinsweise der Vorhandenheit, das heißt in der Weise des einfach vorliegenden, in neutraler und gleichgültiger Haltung betrachteten Gegenstands. Durch den Terminus „Vorhandenheit“ spielt Heidegger möglicherweise auf den aristotelischen Ausdruck ta procheira an der berühmten Stelle der Metaphysik an, an der es heißt, daß die Menschen seit je durch das Staunen, und zwar über das unmittelbar Vorliegende und Auffällige (ta procheira), zu philosophieren begannen (Met. I, 2, 982 b 12–13). 2) Poiesis ist das Verhalten des produktiven, hantierenden Tuns, das die Herstellung von Gemächten, Artefakta zum Ziel hat. Die ihr entsprechende
38
Franco Volpi
kognitive Einstellung ist die Kunst bzw. Technik (techne). In dieser Einstellung begegnet uns Seiendes in der Seinsweise der Zuhandenheit. 3) Praxis ist schließlich das Handeln, das um seiner selbst willen geschieht und welches das eigene Gelingen, das euprattein zum Ziel hat. Phronesis, prudentia, ist das ihm zugehörige, orientierende Wissen. Das entdeckende Verhalten der praxis wird bei Heidegger – so meine These – zur Auszeichnung der Seinsweise des Daseins herangezogen. Um diese letzte Entsprechung einleuchtend zu machen, welche die bedeutendste, zugleich aber auch die am wenigsten verständliche zu sein scheint, ist eine allgemeine Bemerkung über die Art und Weise der Wiederaufnahme aristotelischer Gedanken durch Heidegger vonnöten. Es liegt auf der Hand, daß Heidegger die genannten Bestimmungen nicht nur wieder aufnimmt, sondern sie dabei zugleich weitgehend umdeutet. Die auffälligste Veränderung ist die Betonung, ja die Verabsolutierung des ontologischen Zugs dieser Bestimmungen, das heißt ihre Transformation von Verhaltensweisen zu Seinsweisen, wobei jede ontische Bedeutung prinzipiell ausgeklammert wird. Heidegger interessiert sich offensichtlich nicht für die einzelnen praxeis, poieseis und theoriai, sondern allein für das ontologische Potential dieser Bestimmungen. – Freilich sind im aristotelischen Text Anhaltspunkte zu finden, die diese ontologisierende Auslegung stützen können. Liest man zum Beispiel die in Eth. Nic. VI, 4–5 eingeführte und erläuterte Unterscheidung von poiesis und praxis in Zusammenhang mit Met. IX, 6, so kann man erkennen, daß es sich dabei nicht um eine ontische Unterscheidung handelt, die sich auf einzelne Handlungsvollzüge bezieht, wovon die einen poieseis und die anderen praxeis sind, sondern um eine Unterscheidung, die vielmehr modalen bzw. ontologischen Charakter hat und zwei verschiedene Seinsweisen abgrenzt, die sich ontisch voneinander nicht abheben lassen. Ein Beispiel: eine Rede halten kann die Seinsweise einer poiesis haben, etwa im Sinne der rhetorischen Herstellung überzeugender logoi von seiten eines Redners; sie kann aber auch die Seinsweise einer praxis haben, etwa im Sinne des Vollzugs einer politischen Rede; auf ontischem Niveau kommt dieser Unterschied nicht zum Vorschein. – Es ist also ausschließlich der ontologische Inbegriff der aristotelischen Bestimmungen, den Heidegger in seiner Differenzierung der Seinsmodi von Dasein, Zuhandenheit und Vorhandenheit extrapoliert und verabsolutiert. Eine weitere entscheidende Transformation ist die Verschiebung der hierarchischen Anordnung, in der diese drei Bestimmungen zueinander stehen. Unter den möglichen Weisen des Entdeckendseins des menschlichen Daseins wird nicht mehr die theoria als die für den Menschen
2
Der Status der existenzialen Analytik
39
vorzuziehende höchste Tätigkeit angesehen. Im Rahmen der angedeuteten Ontologisierung wird vielmehr die praxis samt den ihr eigenen Komponenten zur Grundbestimmung der Seinsweise des Menschen, zu dessen ontologischer Struktur, erhoben. Aufgrund dieser strukturellen Verlagerung ändert sich ebenso das Verhältnis der praxis zu den beiden anderen Bestimmungen: die Zuhandenheit (die der Verhaltensweise der poiesis entspricht) und die Vorhandenheit (die der Bestimmung der theoria korrespondiert) kennzeichnen die Seinsweise von nichtdaseinsmäßigem Seiendem, wobei sie durch die Weise bedingt sind, in der sich Dasein jeweils konstatierend und veritativ oder aber hantierend und produzierend zu Seiendem verhält. Außerdem kommt eine weitere strukturierende Zuordnung hinzu. Poiesis und theoria werden beide als Weisen eines Verhaltens verstanden, das Heidegger „Besorgen“ nennt. Damit erzielt er ein Zweifaches: zum einen weist er einen einheitlichen Zusammenhang zwischen Zuhandenheit und Vorhandenheit, poiesis und theoria, und zwischen diesen beiden und dem Dasein auf; zum anderen bereitet er sich die Möglichkeit vor, zu behaupten, die theoria sei keine ursprüngliche Verhaltensweise, sondern nur ein abgeleiteter Modus der poiesis. Ontologisierung, hierarchische Verschiebung und einheitliche Zuordnung sind also die ausschlaggebenden Umformungen, denen bei Heidegger die Assimilierung der aristotelischen Begriffe von praxis, poiesis und theoria unterliegt. Es bleibt aber immer noch die Frage: Weshalb soll die praxis als die durchgängige Bestimmung aufgefaßt werden, die der Kennzeichnung der Seinsweise des Daseins zugrunde liegt? Deshalb, weil Heideggers existenziale Analyse – wie es mir scheint – das Dasein und seine Grundstruktur in einem eminent praktischen Sinn versteht und bestimmt, und dieser wird aus einem ontologisch umgedeuteten, aristotelischen Begriff der praxis gewonnen.
2.4 Dasein als praxis: Die existenziale Analytik im Lichte der praktischen Philosophie In einem praktischen Sinne ist zunächst einmal die Kennzeichnung der Seinsweise des Daseins als ein „Zu-sein“ deutbar, die Heidegger zu Beginn der existenzialen Analytik in den Paragraphen 4 und 9 von Sein und Zeit einführt. Durch diese Kennzeichnung wird nahegelegt, daß Dasein, das menschliche Leben in seiner Seinsweise, sich ursprünglich zu seinem Sein nicht in einer beschauenden, konstatierenden Haltung verhält, sich selbst also zunächst nicht in einer theoretischen, reflexiven Einsicht, in einer Art
40
Franco Volpi
inspectio sui reflektiert. Dasein verhält sich vielmehr zu seinem Sein in einer praktisch-moralischen Haltung, wobei es je um sein Sein selbst geht, in dem Sinne, daß Dasein über dieses sein Sein zu entscheiden hat und – vor seinem Wollen oder Nichtwollen – die Last dieser Entscheidung auf sich nehmen muß. Das heißt: Dasein bezieht sich primär auf sein Sein – nicht, um es in dessen Wesenszügen (beispielsweise als animal rationale) festzustellen und zu beschreiben, sondern um zu entscheiden, was daraus werden soll, also um unter verschiedenen Möglichkeiten die eigentlich eigene zu wählen und zu vollziehen. Die Last dieser Entscheidung, dieser Wahl und dieses Vollzugs kann Dasein nicht von sich abwenden, sondern es hat in diesem Sinne die „unerträgliche Leichtigkeit seines Seins“ auf sich zu nehmen. Erst die Einsicht in die praktisch-moralische Grundstruktur des Daseins ermöglicht es, die weiteren Bestimmungen des Daseins in ihrem einheitlichen Zusammenhang zu erfassen. Man versteht dann, weshalb Heidegger den Modus der Erschlossenheit durch eine aus der praktischen Philosophie geschöpfte Bestimmung auszeichnet, nämlich als Sorge. Mit diesem Terminus will er ursprünglicher, also nicht allein in theoretischer Perspektive, sondern auch und vor allem im Hinblick auf den praktischen Vollzug des Lebens, das Phänomen erfassen, das Husserl als Intentionalität gekennzeichnet hatte. In der Seinsweise des Daseins soll angezeigt werden, daß das menschliche Leben nicht nur Wahrnehmung und theoretische Erkenntnis bedeutet, sondern ebenso praktischer Vollzug, Handeln und Tun ist. Es läßt sich mutmaßen, daß die Bestimmung der Sorge die Ontologisierung dieses Grundzugs menschlichen Lebens darstellt. Genauer gesagt: es ist das ontologisierende Äquivalent zur Bestimmung des Menschen als orexis dianoetike, die man bei Aristoteles in Nic. Eth. VI, 2 findet. Der Beweis? Es würde genügen, die Stellen der von Heidegger kommentierten aristotelischen Texte zu kollationieren, an denen der Terminus orexis bzw. das Verb oregomai vorkommen, um festzustellen, daß Heidegger jedesmal mit „Sorge“ übersetzt. Die auffälligste Passage ist der Anfang der Metaphysik, deren ersten Satz ( pantes anthropoi tou eidenai oregontai physei ) Heidegger so überträgt: „Im Sein des Menschen liegt wesenhaft die Sorge des Sehens“ (171; vgl. auch Heidegger 1979, GA 20, 380). Zu beachten ist dabei nicht nur die Entsprechung von orexis und Sorge, sondern auch die Ontologisierung von pantes anthropoi durch „Im Sein des Menschen“. Aus der Ontologisierung der praxis, die zur praktischen Bestimmung der Seinsweise des Daseins wird, zieht Heidegger fundamentale Konsequenzen für die existenziale Analytik.
2
Der Status der existenzialen Analytik
41
1) Das Sein, zu dem sich Dasein verhält, ist das dem Dasein je eigene Sein. Heidegger spricht ihm den Charakter der „Jemeinigkeit“ zu. Es läßt sich mutmaßen, daß er durch diese Bestimmung den Sinn eines Grundzugs wiederaufnimmt und ontologisiert, der dem Wissen der phronesis eignet: diese wird nämlich bei Aristoteles als ein hauto eidenai, als ein Wissen um sich selbst und ta hauto agatha kai sympheronta gekennzeichnet (Eth. Nic VI, 1140 a 26–27 und 1141 b 34). 2) Gegen den metaphysischen Vorrang der Zeitekstase der Gegenwart, also gegen die „Metaphysik der Präsenz“, vertritt Heidegger die Priorität der Zukunft. Gerade weil Dasein sich zu sich selbst in einem praktischen Selbstbezug verhält, indem es über sein Sein entscheidet, ist das Sein, das je auf dem Spiel steht, stets ein zukünftiges. Denn – wie Aristoteles in der Nikomachischen Ethik lehrt – betreffen Beratschlagung (bouleusis) und Entscheidung (prohairesis) je Zukünftiges. 3) Angesichts dieser Befunde trifft Heidegger eine radikale Unterscheidung zwischen der ontologischen Verfassung des Daseins und derjenigen des nichtdaseinsmäßigen Seienden. Nur Dasein konstituiert sich als ein Zu-sein, nur Dasein verhält sich zu sich selbst in einem eminent praktischmoralischen Sinne. Aufgrund dieser Unterscheidung kritisiert Heidegger denn auch die unzureichenden metaphysischen Abgrenzungen von Mensch und Natur, Subjekt und Objekt, Bewußtsein und Welt, und zwar vor allem deshalb, weil sie nicht auf der Einsicht in die ursprüngliche praktischmoralische Seinsverfassung des Daseins gründen. 4) Die praktische Bestimmung der Seinsweise des Daseins impliziert schließlich eine Kritik der traditionellen Interpretation des Selbstbewußtseins im Sinne eines Wissens um sich selbst, das konstatierender und reflexiver Art ist und durch so etwas wie eine Einkehr in sich selbst erzeugt wird. Die Identität des Daseins konstituiert sich Heidegger zufolge nicht durch eine solche innere Selbsttransparenz, sondern vielmehr dadurch, daß es sich in seinem Zu-sein wiederfindet, das im Handeln wie auch im Erkennen, in der Transparenz des Rationalen wie im opaken Moment der Stimmungen realisiert wird. Damit hat die Umgrenzung der existenzialen Analytik genaue Konturen angenommen: Heidegger bestimmt die ontologische Verfaßtheit des Daseins am Leitfaden einer ontologisierenden Auslegung der praktischen Struktur des menschlichen Lebens, so daß sich das Programm der existenzialen Analytik – im Ansatz und vor allem in der Terminologie von Sein und Zeit – ein Äquivalent zur aristotelischen Bestimmung des sittlichen Lebens und Seins des Menschen bildet.
42
Franco Volpi
Zunächst einmal ist der generelle Horizont der von Aristoteles erschlossenen Problemstellung wiederaufgenommen. Im Rahmen der „praktischen Wissenschaft“ (episteme praktike) – ein Terminus, den Heidegger mit „Ontologie des menschlichen Daseins“ übersetzt – betrachtet Aristoteles das menschliche Leben als praxis und diese als die dem Menschen spezifische Bewegung (kinesis). Menschliches Leben ist nicht einfach zoe, das heißt Leben und Selbsterhaltung des Lebens, sondern bios, das heißt Lebensentwurf, der sich über die Selbsterhaltung des Lebens hinaus für das Problem der Wahl der Lebensform freimacht, und zwar im Hinblick auf das gute, bestmögliche Leben (eu zen) und die dazu geeigneten Mittel. Das heißt: Als vernunftbegabtes politisches Lebewesen (zoon politikon logon echon) soll der Mensch beratschlagen (durch bouleusis), wählen und entscheiden (durch prohairesis), welche Mittel er zur Erlangung der für ihn bestmöglichen Lebensform ergreifen soll. Es ist bekanntlich der kluge, weise Mensch (phronimos), dem die gute Beratschlagung (euboulia), die gute Entscheidung und das gute Handeln (euprattein) gelingt und der so die Glückseligkeit (eudaimonia) erreicht. Diese fundamentale Intuition wird in der existenzialen Analytik wiederaufgenommen und durch eine ontologisierende Umdeutung zur Geltung gebracht. Auch bei Heidegger ist Dasein in der Tat das ausgezeichnete Seiende, bei dem es je um sein Sein (aristotelisch gesagt: um ta hauto agatha kai sympheronta) geht, und zwar in dem Sinne, daß es über die Möglichkeiten und Weisen seines Vollzugs entscheiden muß, selbst in dem Grenzfall, in dem diese Entscheidung ein Nichtentscheidenwollen, ein Ausweichen vor dem Entscheidenmüssen ist. Und erst dann, wenn Dasein, auf den Ruf des Gewissens hörend, dieses Entscheidenmüssen und damit sein Zu-sein erkennt und es beim Entwurf seiner Möglichkeiten auf sich nimmt, wenn es also die unerträgliche Leichtigkeit seines Seins als das Allereigenste akzeptiert und nicht an die Hilfe des Man abgibt, kann der Vollzug der Existenz „eigentlich“ sein. Freilich führt die Heideggersche Ontologisierung der praxis samt ihren Bestimmungen zwangsläufig zu grundlegenden Veränderungen und Verschiebungen. Dennoch läßt sich zeigen, daß die existenziale Analytik bei der Bestimmung der Erschlossenheit des Daseins – allen Unterschieden zum Trotz – strukturelle Ähnlichkeiten mit dem aristotelischen Verständnis des moralischen Seins des Menschen aufweist.
2
Der Status der existenzialen Analytik
43
2.5 Der praxishafte Hintergrund der existenzialanalytischen Begrifflichkeit Betrachten wir die wichtigsten Existenzialien. Die Erschlossenheit als durchgängiger Grundzug der Seinsweise des Daseins ergibt sich bekanntlich aus der ursprünglichen Einheit von Dasein und Welt. Der einheitliche Sinn der Erschlossenheit samt den Existenzialien ist die Sorge. Deren drei Hauptbestimmungen sind Befindlichkeit, Verstehen und Rede. Man erfaßt die tiefe Bedeutung dieser Termini nur, wenn man bedenkt, daß Heidegger damit die Grundbestimmungen des Menschen als eines praktisch-moralisch handelnden Wesens wiederaufnimmt und im ontologisierenden Rahmen der existenzialen Analytik umformuliert. In der Befindlichkeit potenziert er im ontologisch-transzendentalen Sinne diejenige Bestimmung des Handelnden, unter die man in der herkömmlichen Affektenlehre das Moment der Passivität, Rezeptivität und Leiblichkeit des Handelnden einordnet. Ein signifikanter Nachweis dieser hier nahegelegten Assoziation ist die Tatsache, daß der junge Heidegger bei seiner Augustin-Interpretation den Terminus affectio eben mit „Befindlichkeit“ wiedergibt. Analog dazu ontologisiert Heidegger im „Verstehen“ das aktive, entwerfende Moment der Produktivität und Spontaneität der menschlichen Existenz. Ohne nun auf das dritte, gleichursprüngliche Moment der Rede (logos) einzugehen, läßt sich nahelegen, daß die beiden ersten Momente der existenzialen Analytik zwei zentralen Bestimmungen der aristotelischen Handlungstheorie entsprechen. Was die Befindlichkeit angeht, so ist sie bekanntlich für Heidegger der ontologische Grund für die Möglichkeit ontischer Stimmungen. In ihr öffnet sich das Dasein gegenüber seinem Zu-sein, es wird – wie es im § 29 von Sein und Zeit heißt – vor sein „daß es ist“ und „zu sein hat“ (134) gestellt, und zwar so, daß ihm sein Woher und Wohin verdeckt bleiben. Es erfährt darin seine „Geworfenheit“. Was Heidegger damit anzeigen möchte, ist, daß zur Daseinsstruktur nicht nur reine, transparente und rationale Momente von Spontaneität und Selbstbestimmung gehören, sondern ebenso eine trübe und opake Seite, die traditionell als das Affektmäßige verstanden wird und deren ontologische Möglichkeitsbedingung er durch den Begriff der „Befindlichkeit“ zu bestimmen sucht. Das heißt: Die Identität des menschlichen Lebens vollzieht sich nicht allein in der Transparenz rein rationaler Selbstdarstellung und Selbstbestimmung, sondern ebenso in der unverfügbaren Opazität seiner Stimmungen, für welche die Befindlichkeit die ontologische Möglichkeitsbedingung sein soll. Bei der Erörterung der Befindlichkeit (§ 29) greift Heidegger ausdrücklich auf Aristoteles zurück, und zwar auf die im II. Buch
44
Franco Volpi
der Rhetorik dargestellte Lehre von den Affekten (pathe). Er schneidet allerdings diese Lehre aus dem Zusammenhang der Redekunst, in dem sie bei Aristoteles steht, heraus und behauptet, sie sei „die erste systematische Hermeneutik der Alltäglichkeit des Miteinanderseins“; nach ihr habe es in der ontologischen Interpretation der Affekte bis zur Phänomenologie keinen Fortschritt mehr gegeben. Was die Bestimmung des Verstehens (§ 31) angeht, so ist sie das zur Befindlichkeit komplementäre Moment, das heißt sie stellt den ontologischen Grund für die Möglichkeit aktiver und spontaner ontischer Akte des Daseins dar. Es ist die Bestimmung, in der die Produktivität des Seinkönnens des Daseins zum Ausdruck kommt. Anders als in dem Sinn, mit dem das Wort in der gewöhnlichen Bedeutung besetzt ist und wonach es eine besondere Erkenntnisart meint, bezeichnet Heidegger mit dem Terminus „Verstehen“ die ontologische Grundverfassung des Daseins, sofern dieses Aktivität und Selbstbestimmung ist, das heißt sofern es den Charakter des Entwurfs hat und so sein eigenes Sein in einer eminent praktischen Haltung vorwegnimmt und gestaltet. Daß Heidegger das Verstehen als ontologischen Modus des Seinkönnens in dessen Existenzialität bestimmt, daß er ihm die Struktur des Entwurfs zuschreibt, daß er dessen Bedeutung im Sinne von „etwas können“, „einer Sache vorstehen können“ umgrenzt – all dies ist ein Indiz dafür, daß die existenzialanalytische Bestimmung des Verstehens in Rückgriff auf einen praktischen, handlungsmäßigen Hintergrund zu interpretieren ist. Gewiß, als streng ontologisch gemeinte Bestimmung steht sie vor der Unterscheidung von Theorie und Praxis. Das hindert allerdings nicht daran, zu sehen, wie Heidegger sich bei ihrer Charakterisierung unterschwellig an den Inhalten eines bestimmten thematischen Bezugsphänomens orientiert, und das ist eben nicht das Phänomen der theoria, sondern dasjenige der praxis. Es darf daher nicht verwundern, daß durch die von Heidegger systematisch vollzogene ontologisierende Filterung gleichwohl praxismäßige Komponenten durchkommen. Wenn man zum Beispiel die Erörterung des Verstehens in der Vorlesung des Sommersemesters 1927 (Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24) heranzieht, in der Heideggers ontologischer Filter breitmaschiger und seine Verdrängung des Ontischen lockerer ist als in Sein und Zeit, so findet man dort die für die hier aufgestellte These sehr signifikante Aussage: das Verstehen „ist der eigentliche Sinn des Handelns“ (GA 24, 393). Man versteht denn auch, weshalb Heidegger die Bestimmung des Verstehens von jeglicher erkenntnistheoretischen Mißdeutung im Sinne einer dem Erklären entgegengesetzten Erkenntnisart sorgfältig abschirmt. Er visiert offenbar die Wah-
2
Der Status der existenzialen Analytik
45
rung des praktischen Charakters des Verstehens – selbst in dessen Transformation zu einer Seinsweise des Daseins – an. Der praktische Horizont der Heideggerschen Auffassung des Verstehens kommt auch bei der Bestimmung des Wissens, das Verstehen begleitet und geleitet, deutlich zum Vorschein. Das Verstehen als Entwurf wird nämlich von einer „Sicht“ begleitet, also einem Wissen, das den Entwurf orientiert. Es ist das Wissen um sich selbst, die Sicht seiner selbst, in der das Dasein zur Selbsttransparenz, zur „Durchsichtigkeit“ gelangt. Auf diesen Terminus rekurriert Heidegger – wie er selbst erläutert –, um zu vermeiden, daß die Selbstheit des Daseins im Horizont des Wahrnehmens, Vernehmens, Beschauens, Anschauens mißdeutet wird, das heißt im Rahmen des theoretisch orientierten Verständnisses, das für traditionelle Selbstbewußtseinstheorien bestimmend ist. Ohne nun die offensichtlichen Unterschiede leugnen zu wollen, läßt sich hier eine weitere strukturelle Entsprechung andeuten, die cum grano salis aufzufassen ist. Im Hintergrund der existenzialanalytischen Bestimmung des Verstehens steht der substantielle Sinn dessen, was in der aristotelischen Handlungstheorie durch den nous praktikos geleistet wird. Wie dieser zur orexis komplementär fungiert und mit ihr wesentlich verschränkt ist, so ist das Verstehen die komplementäre Bestimmung zur Befindlichkeit. Gewiß, das Verstehen ist nicht auf Handeln eingeschränkt, sondern prägt das Dasein in dessen Ganzheit: als solches entfaltet es sich in Bezug zum zuhandenen Zeug der Umwelt als „Besorgen“ (das sowohl theoretische als auch poietische Verhaltensweisen umfaßt), in bezug zur Mitwelt der Anderen als „Fürsorge“, und in bezug zu sich selbst als „Worumwillen“; seine einheitliche Wurzel hat das Verstehen in der Sorge. Es ist also ganz woanders angesiedelt als der nous praktikos. Und dennoch: Dadurch, daß Heidegger die Komplementarität und Gleichursprünglichkeit von Befindlichkeit und Verstehen, Passivität und Aktivität, Rezeptivität und Spontaneität, Geworfenheit und Entwurf, Reluzenz und Praestruktion thematisiert, greift er in einem ontologisch radikalisierten Rahmen das gleiche Problem wieder auf, das Aristoteles im VI. Buch der Nikomachischen Ethik aufwirft, wenn er sagt, der Mensch sei das Prinzip (arche), das zugleich denkendes Begehren (orexis dianoetike) und begehrendes Denken (nous orektikos) ist (Eth. Nic. VI, 2, 1139 b 4 –5). Und so wie bei Aristoteles die Verschränkung von orexis und nous stets im Medium des menschenspezifischen logos geschieht, so behauptet Heidegger die Gleichursprünglichkeit der Rede mit Befindlichkeit und Verstehen. Freilich insistiert Heidegger auf der tiefer greifenden ontologischen Radikalität seines Problemaufrisses und somit auf Differenzen. Er be-
46
Franco Volpi
teuert, die Sorge gehe der Unterscheidung von Theorie und Praxis voraus (§ 41) und könne daher durch Rückgriff auf traditionelle Begriffe wie Willen, Drang, Neigung auch nicht erfaßt und erklärt werden. Doch die Tatsache, daß er diese Beteuerung für nötig hält, verrät, daß am Ende die existenzialanalytische Sorge und der aristotelische Begriff der orexis einen thematisch gemeinsamen Hintergrund haben. Gerade deshalb ist die herausgestellte Abgrenzung vonnöten. Im Rahmen dieser Entsprechungen versteht man denn auch, weshalb Heidegger – wie Gadamer berichtet hat (Gadamer 1983, 32) – gegenüber der Schwierigkeit, den Terminus phronesis zu übersetzen, ausrufen konnte: „Das ist das Gewissen!“. Er dachte offensichtlich an die eigene Bestimmung des Gewissens als des Ortes im Dasein, an dem das Zusein, die praktisch-moralische Bestimmung seiner Seinsverfassung, sich dem Dasein selbst bekundet. (Das gleiche Problem glaubt Heidegger übrigens in der Kantischen Bestimmung des „Gefühls der Achtung“ sehen zu können; vgl. GA 3). In der existenzialen Analytik wird in der Tat das Gewissen als der Ort der „daseinsmäßige[n] Bezeugung eines eigentlichen Seinkönnens“ gekennzeichnet; und diese Bezeugung findet dann statt, wenn das Dasein in der Haltung des Gewissen-haben-wollens auf den Ruf des Gewissens hört, und so „eigentlich“ existiert (267–301). Ähnlich bildet auch bei Aristoteles die phronesis den Horizont, innerhalb dessen das gute Handeln, das euprattein, möglich wird. Und so wie bei Aristoteles die phronesis die Kenntnis des richtigen Moments (kairos) verlangt, so ist bei Heidegger das Gewissen stets auf den „Augenblick“ bezogen. Es gibt also gute Gründe, um zu sagen, Heideggers „Gewissen“ entspreche der phronesis. Man kann es noch präziser als Ontologisierung der phronesis interpretieren und sogar die Stelle der Nikomachischen Ethik angeben, die eine entscheidende Motivation zur solcher Ontologisierung bietet. Es handelt sich um den Schluß des 5. Kapitels des VI. Buches: Nachdem Aristoteles die phronesis als eine vernunftbegleitete wahre Haltung (hexis meta logou alethe) definiert hat, erklärt er, diese Definition reiche eigentlich nicht zu, um das Wesen der phronesis ganz zu erfassen, denn diese sei mehr als eine Haltung. Merkwürdigerweise sagt Aristoteles nicht, was sie dann sei, sondern bietet nur einen bestätigenden Nachweis für seine Behauptung: man könne jede Haltung verlernen; die phronesis dagegen könne nicht verlernt werden. Bei der Interpretation dieser Stelle muß Heidegger – so meine Vermutung – gerade der Frage nachgegangen sein, was die phronesis eigentlich „mehr“ sei. Die weitere Überlegung wäre dann: Ist sie mehr als eine Haltung und kann sie nie vergessen werden, so muß sie ein
2
Der Status der existenzialen Analytik
47
Charakter der menschlichen Seele selbst sein, sie muß als ontologischer Grundzug verstanden werden. Man könnte so in der Aufstellung von Analogien fortfahren und zeigen, wie eine ähnliche Ontologisierung auch für weitere Bestimmungen der praktischen Philosophie des Aristoteles vorgenommen wird, die in der existenzialen Analytik eine Entsprechung haben: 1) Der Terminus „Jemeinigkeit“ zeigt bei Heidegger, wie bereits angedeutet, einen ontologisierten Zug des Daseins an, der bei Aristoteles ein Analogon in der Bestimmung der phronesis als eines hauto eidenai hat. 2) Die Kennzeichnung des Daseins als „Worumwillen“ stellt gleichsam die Ontologisierung des hou heneka der aristotelischen praxis dar. Das Eigentümliche an der praxis ist, daß sie ihr Prinzip und Ziel (hou heneka) in sich selbst hat, und nicht um etwas anderen willen (heneka tinos) vollzogen wird. Analog dazu muß das Dasein als ontologisierte praxis den Charakter des hou heneka in ausgezeichneter Weise besitzen. Deshalb wird es als „Worumwillen“ gekennzeichnet. 3) Hinter der Bestimmung der „Entschlossenheit“ kann man die Ontologisierung des substantiellen Sinngehalts der aristotelischen prohairesis erkennen – mit dem Unterschied, daß diese eine besondere Haltung in der aristotelischen Handlungstheorie bezeichnet, die Entschlossenheit dagegen einen Grundzug der Seinsverfassung des Daseins ausmacht. Auch diese Entsprechung wird bezeichnenderweise dadurch bestätigt, daß Heidegger den Terminus prohairesis jedesmal mit „Entschlossenheit“ übersetzt. Es sei hier exemplarisch nur auf eine signifikante Stelle in der Vorlesung des Sommersemesters 1926 (GA 22) hingewiesen. Hier interpretiert Heidegger die bekannte Passage des 2. Kapitels des IV. Buches der Metaphysik, an der Aristoteles den Philosophen sowohl vom Dialektiker als auch vom Sophisten unterscheidet, indem er so übersetzt: „Dialektik und Sophistik haben gewissermaßen dasselbe Gewand angezogen wie die Philosophie, aber sie sind es im Grunde nicht. Die Sophistik sieht nur so aus. Die Dialektik unterscheidet sich durch die Art der Möglichkeiten: Sie hat nur begrenzte Möglichkeiten, sie kann nur versuchen. Die Philosophie dagegen gibt zu verstehen. Die Sophisten unterscheiden sich durch die Art der Entschlossenheit zur wissenschaftlichen Forschung: Sie sind unernst, sie wollen die Leute für sich gewinnen“ (GA 22, 294). Zu beachten ist, daß Heidegger hier mit „Entschlossenheit zur wissenschaftlichen Forschung“ das wiedergibt, was im Griechischen prohairesis tou biou, „Lebenswahl“, heißt.
48
Franco Volpi
2.6 Existenziale Analyse in praktischer Absicht Die aufgewiesenen Analogien machen die These plausibel, daß Heidegger in der existenzialen Analyse von Sein und Zeit Grundintuitionen, Fragen und Bestimmungen der praktischen Philosophie des Aristoteles wiederaufnimmt, transformiert und erneut ins Leben ruft. Unsere vergleichende Betrachtung hat allerdings bisher fast ausschließlich gleichsam die Mosaiksteine unter die Lupe genommen, will sagen die einzelnen Entsprechungen zwischen bestimmten Begriffen und Termini. Es gilt jetzt, insgesamt die Homologie zwischen dem Verständnis des Menschen in der praktischen Philosophie des Aristoteles und der Heideggerschen existenzialen Analytik noch deutlicher herauszustellen (vgl. Volpi 1984 und 1989). Dies kann am besten anhand eines Zitats veranschaulicht werden, das Heideggers Bemühung zeigt, die existenziale Analytik in die Nähe des Aristoteles zu rücken bzw. sich Aristoteles näherzubringen. Gegen Ende der Vorlesung des Sommersemesters 1926 (Grundbegriffe der antiken Philosophie, GA 22) schließt er seine Erörterung der fünf Weisen des In-derWahrheit-seins der Seele mit dieser Definition des Menschen: „anthropos ist zoon, dem die praxis zukommt, ferner logos. Diese drei Bestimmungen zusammengezogen: zoe praktike tou logon echontos (vgl. Eth. Nic. I 7, 1098 a 3 sq.) ist das Wesen des Menschen. Der Mensch ist das Lebewesen, das gemäß seiner Seinsart die Möglichkeit hat, zu handeln“ (GA 22, 312). Beredsam ist ebenso die Fortsetzung des Textes: „Derselbe Mensch taucht dann wieder bei Kant auf: der Mensch, der reden, das heißt begründend handeln kann“, wobei nicht nur die Aufnahme der Praxisfähigkeit in die Definition des Menschen signifikant ist, sondern ebenso die Gleichsetzung von „reden“ mit „begründend handeln“, die einen weiteren Hinweis für die Interpretation des Existenzials „Rede“ gibt. Gewiß, bei seiner Wiederaufnahme radikalisiert Heidegger in ontologischer Hinsicht die aristotelischen Bestimmungen, und nachdem er seine Ontologisierung vollzogen hat, nimmt er von Aristoteles kritisch Abstand: der Stagirit sei nicht bis zur Erfassung der ontologischen Einheit der entdeckenden Hauptverhaltensweisen der menschlichen Seele, das heißt des Herstellens, Handelns und Beschauens gekommen, er habe die ontologische Grundverfassung des menschlichen Lebens nicht gesehen, und zwar deshalb, weil er noch im Horizont eines naturalistischen, chronologischen und nicht kairologischen Zeitverständnisses befangen geblieben sei, die ihm die Einsicht in die ursprüngliche Zeitlichkeit als ontologische Grundverfassung der menschlichen Endlichkeit verwehrt habe. Selbst die bekannte Aporie des Verhältnisses von Zeit und Seele, die Aristoteles
2
Der Status der existenzialen Analytik
49
immerhin ausdrücklich als Problem aufwirft (Physik, IV, 14, 223 a 16–29) und von der uns Heidegger eine souveräne Auslegung liefert (GA 25, § 19 a), biete keinen zureichenden Boden, um Aristoteles aus dem metaphysischen Zeitverständnis herauszuinterpretieren. Doch gilt auch hier: Gerade Aristoteles antizipiert wenigstens auf ontischem Niveau die Intuition, die Heidegger mit der Gleichung von Dasein und Zeitlichkeit ontologisch potenziert. In De anima III, 10 schreibt er dem Menschen das Vermögen der Zeitwahrnehmung (aisthesis chronou) zu, das ihn von anderen Tieren unterscheidet. Heidegger kommentiert diese Stelle im Zusammenhang seiner Auslegung der praxis als des spezifischen Grundzugs des menschlichen Lebens folgendermaßen: „Der Gegensatz von Trieb und eigentlich entschlossener, vernünftiger Handlung ist eine Möglichkeit nur bei lebendigen Wesen, die die Möglichkeit haben, Zeit zu verstehen. Sofern das Lebendige dem Trieb überlassen ist, ist es bezogen auf das, was gerade da ist und reizt, to ede hedy (433 b 9); darauf strebt der Trieb hemmungslos, auf das Gegenwärtige, Verfügbare. Aber dadurch, daß im Menschen die aisthesis chronou liegt, hat der Mensch die Möglichkeit, sich das Zukünftige (to mellon) zu vergegenwärtigen als das Mögliche und das, um dessen willen er handelt“ (GA 22, 311). Hier zeigt sich noch einmal in aller Deutlichkeit die existenzialanalytische Strategie Heideggers: Er liest aus dem aristotelischen Text die vermutete innere Verschränkung von Zeitlichkeit und Handlungsfähigkeit als Eigenart des Menschen heraus, also einen philosophischen Grundgedanken, den er sich zueigen macht und ontologisch in der existenzialen Analytik ausarbeitet. Aus all dem Gesagten wird ersichtlich, wie Heidegger aus der praktischen Philosophie des Aristoteles unbefangen schöpft, sie als Ontologie des menschlichen Lebens auslegt und als reichhaltiges Reservoir für zahlreiche Intuitionen seiner existenzialen Analyse ausnutzt. Er findet darin eine freilich noch unbewußte und verschwommene Vorwegnahme selbst für die entscheidende Entdeckung von Sein und Zeit, nämlich die Identifizierung der einheitlichen Seinsverfassung des Daseins mit der ursprünglichen Zeitlichkeit. Um es pointiert auszudrücken: die existenziale Analytik von Sein und Zeit nimmt sich teilweise wie eine moderne „Übertragung“ der Nikomachischen Ethik aus. Dabei ist Heidegger nicht daran interessiert festzustellen, wie es vom philologischen und historischen Gesichtspunkt her tatsächlich um die Dinge steht, sondern vielmehr daran, sich – und das heißt uns allen und dem Jahrhundert – die grundlegenden Fragen, die Aristoteles zum erstenmal dachte, zueigen zu machen, um daraus eine fundamentale Lehre zu gewinnen. Der Rückgriff auf Aristoteles schafft seinerseits bei der Inter-
50
Franco Volpi
pretation der existenzialen Analytik einen Einsichtssprung, der durch den Vergleich mit der Tradition Heideggers Originalität beim Aufgreifen des Problems des menschlichen Lebens als Zugang zur Seinsfrage klarer zu sehen erlaubt. Die Vergleichsbetrachtung beleuchtet die Probleme und fördert ihre bessere Durchdringung. Dadurch kommt die strukturelle Analogie zwischen dem Status der existenzialen Analytik und dem der praktischen Philosophie deutlich ans Licht. Genauso wie die praktische Philosophie des Aristoteles das menschliche Handeln betrachtet und untersucht, jedoch keine neutrale, praxisferne Beschreibung ist, sondern das Gelingen des Handelns und das gute Leben, das euprattein und eu zen, anvisiert und deshalb praktischen Charakter hat, ebenso ist Heideggers existenziale Analytik keine vom faktischen Leben abgekoppelte Theorie, sondern sie schlägt auf das Leben zurück und orientiert es auf dessen authentischen Vollzug. Die existenziale Analyse ist nicht „wertneutral“, sondern impliziert in ihrem Vollzug die Entschlossenheit zur Eigentlichkeit. Diese Interpretation will freilich nicht Heidegger auf Aristoteles oder umgekehrt Aristoteles auf Heidegger zurückführen und nivellieren. Vielmehr: gegen die rein existenzphilosophische Deutung der Daseinsanalyse und gegen neuere, postmoderne Interpretationen, die etwas leichtfertig in Heideggers Denken nur noch die Destruktion und Überwindung der Metaphysik sehen, zeigt sie, daß Heidegger sein philosophisches Programm durch die metaphysische Überlieferung hindurch gedacht hat, sich mit deren grundlegenden Texten und Klassikern radikal konfrontiert und damit unserem Jahrhundert den Sinn für die fundamentale Bedeutung einer Auseinandersetzung mit den Griechen wiedergegeben hat.
Literatur Denker, A./Figal, G./Volpi, F./Zaborowski, H. (Hg.) 2007: Heidegger und Aristoteles, Freiburg/München Gadamer, H.-G. 1983: Heideggers Wege, Tübingen Thomä, D. (Hg.) 2003: Heidegger-Handbuch, Stuttgart/Weimar Volpi, F. 1984: Heidegger e Aristotele, Padua Volpi, F. 1989: Sein und Zeit: Homologien zur „Nikomachischen Ethik“, in: Philosophisches Jahrbuch 36, 225–240 Volpi, F. (Hg.) 2005: M. Heidegger. Essere e tempo, neue it. Ausgabe, Mailand (mit philologischem Apparat, 513–621
3 Romano Pocai
Die Weltlichkeit der Welt und ihre abgedrängte Faktizität (§§ 14 –18)
Voraussetzungen In der Anlage eines Briefes an Husserl vom 22. Oktober 1927 bezeichnet Heidegger die Frage nach der „Seinsart des Seienden, in dem sich ‚Welt‘ konstituiert“, als „das zentrale Problem von ‚Sein und Zeit‘“ (Heidegger 1927, 601). Wie schon Husserl so betont zwar auch Heidegger die „transzendentale Konstitution“ von Welt, aber im Unterschied zu Husserl begreift er diese Konstitution nicht als Leistung eines weltlosen transzendentalen Ich, sondern als „eine zentrale Möglichkeit der Existenz des faktischen Selbst“ (ebd., 601 f.). Das konstituierende Selbst ist als faktisches je schon in eine Welt geworfen. Sein und Zeit kennt also nicht nur eine transzendental konstituierte Welt, sondern auch eine faktische, ontische Welt, die zum Sein des entwerfenden Daseins gehört. Blickt man auf die Analyse des Weltphänomens in Sein und Zeit, so stellen sich Zweifel hinsichtlich der Angemessenheit von Heideggers Selbsteinschätzung gegenüber Husserl ein. Es wird sich zeigen, daß der Brief eine äußerst produktive Intention benennt, die das Buch jedoch nicht zu realisieren vermag. Denn die mundane Faktizität, die zum Sein des weltkonstituierenden Daseins gehört und diesem damit zuvorkommt, gelangt in der Weltanalyse von Sein und Zeit nicht wirklich zu ihrem Recht. Sie wird vielmehr zugunsten des transzendentalen Weltentwurfs abgedrängt. Dessen Dominanz geht auf die zugleich methodische und inhaltliche Grundentscheidung von Sein und Zeit zurück, auf Heideggers Überzeugung, von der Analyse des Seins des Daseins [= Menschen] aus die fundamentalontologische Dimension „Sein überhaupt“ der philosophischen Deutung zugänglich machen zu können. Heidegger begründet diesen
52
Romano Pocai
Ansatz von der Eigentümlichkeit des Menschen her, „ontologisch“ zu sein. „Dasein“, so die berühmte Seite 12 des Buches, „versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein“. Diesen verstehenden Selbstbezug des Daseins legt Heidegger unmittelbar, ohne dies begründend herzuleiten, als ein allgemeines, uneingeschränktes Verstehen von Sein aus: „Diesem Seienden eignet, daß mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, daß es ontologisch ist“ (12). In dem Sinne, daß ein Sich-Verstehen des Daseins den Horizont für ein allgemeines Seinsverständnis absteckt, begreift Heidegger das Dasein in seinem eigenen Sein als konstitutiv für das Sein alles anderen Seienden und das Sein von Welt: „Das dem Dasein zugehörige Seinsverständnis betrifft […] gleichursprünglich das Verstehen von so etwas wie ‚Welt‘ und Verstehen des Seins des Seienden, das innerhalb der Welt zugänglich wird“ (13). Nun ist Sein und Zeit nicht einfach ein spannungsloses Spätwerk der Subjektphilosophie. Die Intention auf ein Weltverhältnis des Daseins, das Faktizität und Entwurf gleichermaßen berücksichtigt, schlägt sich in Heideggers These vom „In-der-Welt-sein“ als „Grundverfassung des Daseins“ (52) nieder. Denkt man basal vom „Sein in einer Welt“ (13) aus, so eröffnet dies die Möglichkeit, das Sich-Verstehen des Daseins in den übersubjektiven Horizont einer nicht immer schon entworfenen Welt einzugliedern. Heideggers Ausführungen zur „Erschlossenheit“ des In-der-Welt-seins, der Konzeption einer präreflexiven Erfahrung von Welt und menschlichem Selbst (vgl. 132 f.), bilden das eigentlich produktive Potential der Existenzialontologie. Insbesondere ist hierbei der Ansatz zu einer Theorie der Befindlichkeit herauszuheben: Heidegger begreift Stimmungen, vor allem die der Angst, als ausgezeichnete Erfahrungsweisen von Erschlossenheit. Im Rahmen dieser Konzeption ist allererst eine angemessene Ausarbeitung der Faktizität menschlichen In-der-Welt-seins und damit auch der Geworfenheit in eine Welt möglich, die nicht immer schon konstituiert ist.1 Ich werde zuletzt auf das Potential von Heideggers Analyse der Angst für einen unverkürzten Weltbegriff verweisen, das in den §§ 14–18 von dem einseitigen Ansatz beim Entwurfscharakter des Daseins überformt wird. Indem sie dem dominierenden Ansatz des Buches widerstreitet, weist die Phänomenskizze der Angst bereits über das Denken von Sein und Zeit hinaus. 1 Vgl. zu diesem Thema, auch zu den leitenden Interpretamenten der folgenden Überlegungen Pocai 1996.
3 Die Weltlichkeit der Welt
53
3.1 Vorbegriff und Horizont der Analyse Heidegger geht in § 14 so vor, daß er in Abgrenzung von der überkommenen, gewöhnlichen Perspektive auf das Weltphänomen einen Vorbegriff von Welt entwickelt, der zugleich den Horizont der nachfolgenden Ausdeutung in den §§ 15–18 absteckt. Kritisch moniert Heidegger, daß sich die gewöhnliche Vorstellung ganz am Seienden orientiere, das innerhalb der Welt begegnet. Damit werde jedoch das Weltphänomen übersprungen bzw. immer schon vorausgesetzt, de facto in Anspruch genommen. Heidegger unterscheidet innerhalb der kritisierten Position eine vorphänomenologische von einer phänomenologischen Deskription des Seienden, wobei er offenbar mit ersterer die Position des „common sense“, mit letzterer eine defiziente phänomenologisch ausgerichtete Philosophie meint. Zwar vermag die auf das innerweltlich Seiende blickende Philosophie das vorphänomenologische Geschäft eines bloßen Aufzählens und Beschreibens zu überschreiten und „das Sein des innerhalb der Welt vorhandenen Seienden […] begrifflich-kategorial [zu] fixieren“ (63). Sie bleibt jedoch dem Horizont verhaftet, den die Position des Alltagsverstandes vorgibt. Diese Abgrenzung geht auf die traditionskritische Grundthese des Buches zurück, wonach sich die abendländische Philosophie insgesamt am Seienden orientiert und dieses als Vorhandenes, Anwesendes, Gegenwärtiges bestimmt habe (vgl. 25 f.). Heidegger setzt dem zunächst seine eigene These entgegen: „Weltlichkeit ist […] selbst ein Existenzial. Wenn wir ontologisch nach der ‚Welt‘ fragen, dann verlassen wir keineswegs das thematische Feld der Analytik des Daseins. ‚Welt‘ ist ontologisch keine Bestimmung des Seienden, das wesenhaft das Dasein nicht ist, sondern ein Charakter des Daseins selbst“ (64). Eine vorläufige Explikation seiner These gibt Heidegger im nachfolgenden Gedankenschritt, der vier Bedeutungen von „Welt“ unterscheidet. Die Unterscheidung erlaubt es, die Abgrenzungen, die den Horizont der Analyse abstecken, genauer ins Auge zu fassen: „1. Welt wird als ontischer Begriff verwendet und bedeutet dann das All des Seienden, das innerhalb der Welt vorhanden sein kann. 2. Welt fungiert als ontologischer Terminus und bedeutet das Sein des unter n. 1 genannten Seienden. Und zwar kann ‚Welt‘ zum Titel der Region werden, die je eine Mannigfaltigkeit von Seiendem umspannt; zum Beispiel bedeutet Welt soviel wie in der Rede von der ‚Welt‘ des Mathematikers die Region der möglichen Gegenstände der Mathematik. 3. Welt kann wiederum in einem ontischen Sinne verstanden werden, jetzt aber nicht als das
54
Romano Pocai
Seiende, das das Dasein wesenhaft nicht ist und das innerweltlich begegnen kann, sondern als das, ‚worin‘ ein faktisches Dasein als dieses ‚lebt‘. Welt hat hier eine vorontologisch existenzielle Bedeutung. Hierbei bestehen wieder verschiedene Möglichkeiten: Welt meint die ‚öffentliche‘ Wir-Welt oder die ‚eigene‘ und nächste (häusliche) Umwelt. 4. Welt bezeichnet schließlich den ontologisch-existenzialen Begriff der Weltlichkeit. Die Weltlichkeit selbst ist modifikabel zu dem jeweiligen Strukturganzen besonderer ‚Welten‘, beschließt aber in sich das Apriori von Weltlichkeit überhaupt. Wir nehmen den Ausdruck Welt terminologisch für die unter n. 3 fixierte Bedeutung in Anspruch“ (64 f.). Heidegger gelangt zu seinem eigenen Weltbegriff unter n. 3, indem er ihn von dem ontischen Begriff von Welt unterscheidet. Dessen Manko besteht nicht nur darin, daß er das Seiende, das innerhalb der Welt vorkommt, unzulässigerweise mit der Welt selber identifiziert. Defizitär ist laut Heidegger auch, daß er sich als bloßes Verstandesprodukt erweist, das heißt keine Erfahrungsgegebenheit darstellt. Dies zeigt seine ontologische Bestimmung unter n. 2: die „‚Welt‘ des Mathematikers“ ist eine theoretisch konstruierte Welt, die von der Binnenperspektive des existierenden Menschen gerade absieht. Der Ansatz bei einem praktisch-existentiellen Weltbegriff erweist sich innerhalb des existenzialontologischen Projektes als alternativenlos. Insofern ist es plausibel, daß sich Heidegger von der erfahrungsabstraktiven Konzeption unter n. 2 distanziert. Nicht plausibel ist jedoch, daß er nur der theoretisch konstruierten Welt die Totalitätsdimension zuschreibt („All des Seienden“). Damit abstrahiert er nämlich seinerseits von einer zentralen Bestimmung der Lebenswelt: daß ihr ein offener Horizont eignet, der sie als nicht nur vertraute, sondern auch unvertraute, nichtentworfene Welt charakterisiert. Der Totalitätscharakter meldet sich zwar durchaus, wenn Heidegger unter n. 3 eine „Welt, ‚worin‘ ein faktisches Dasein als dieses ‚lebt‘“, anführt. Als immer auch vorgegebener Horizont, der das Dasein umfaßt, widerstreitet die vorontologisch-existentielle Welt jedoch gerade dem „ontologisch-existenzialen Begriff der Weltlichkeit“, dem transzendentalen Weltentwurf unter n. 4. Dies markiert das Grundproblem, dem die Analyse in den nachfolgenden Paragraphen verhaftet bleibt. Den Übergang zur eigentlichen Herleitung seines Weltbegriffs vollzieht Heidegger mittels einer Methodenreflexion. Im Rückgriff auf die entsprechenden Überlegungen aus den §§ 5 und 9 bestimmt er die „durchschnittliche Alltäglichkeit als der nächsten Seinsart des Daseins“ zum „Horizont“ (66) seiner Analyse. In diesem Rahmen erweist sich die Welt näher als „Umwelt“. Den Zugang zu ihr gewinnt Heidegger in den folgenden
3 Die Weltlichkeit der Welt
55
Paragraphen „im Durchgang durch eine ontologische Interpretation des nächstbegegnenden inner-umweltlichen Seienden“ (66). Bestimmt der § 15 das innerweltlich Seiende in seinem Sein, so der § 16 die sich darin als Horizont meldende Umwelt. Spannungsreich ist diese Methode insofern, als sie einerseits ganz im Horizont der „durchschnittlichen Alltäglichkeit“ und ihrer Umwelt verbleibt, andererseits gleichwohl beansprucht, fundamentalontologisch das Sein von Welt überhaupt zu bestimmen.
3.2 Zuhandenheit § 15 bestimmt zunächst das alltägliche In-der-Welt-sein des Daseins als „Besorgen“, das darin begegnende Seiende als „Zeug“ und dessen Sein als „Zuhandenheit“. Im Rückgriff auf die §§ 12 und 13 faßt Heidegger unser alltägliches Sein in einer Welt als praktisches Verhalten und als dessen nächste Art den instrumentellen Umgang, „das hantierende, gebrauchende Besorgen“ (67). Wichtig an diesem Ansatz sind drei Vorentscheidungen. Erstens der Vorrang der Praxis vor der Theorie (vgl. Gethmann 1988); zweitens die Verkürzung der praktischen Sphäre auf das Herstellen, von „Praxis“ auf „Poiesis“; drittens der Zugang zur Welt über das Seiende, das Korrelat eines Besorgens sein kann. Nicht das gemeinsame Sein der Menschen in einer öffentlichen Welt steckt den Horizont ab, sondern das instrumentelle Verhalten des einzelnen Daseins (vgl. dagegen Brandom 1997). Nur vermittelt über die so zugänglichen Gebrauchsgegenstände gelangen die anderen Menschen in den Blickwinkel der Analyse (vgl. 71; 117 f.). Das in der Welt begegnende Seiende bestimmt Heidegger anschließend im Rekurs auf den griechischen Begriff der „pragmata“ als „Zeug“ (vgl. 68) – in ausdrücklicher Gegenstellung zum Begriff des „Dinges“. Er unterscheidet dabei zwischen einem „primär Besorgten“, dem „Werk“, und den darauf bezogenen Materialien und Werkzeugen (vgl. 69 f.). Das Modell für Heideggers Analyse der Welt bildet die vormoderne Arbeitsstätte des Handwerkers. Die ontologische Analyse des Zeugs gelangt zu folgenden Ergebnissen: Erstens faßt Heidegger das Zeug als „etwas, um zu …“ (68). Dieses instrumentelle Sein des Zeugs bringt er auf den Begriff der „Zuhandenheit“ (69). Dem Charakter des Zeugs entnimmt Heidegger zweitens einen Bezug auf Ganzheit: „Die verschiedenen Weisen des ‚Um-zu‘ wie Dienlichkeit, Beiträglichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit konstituieren eine Zeugganz-
56
Romano Pocai
heit“ (68). Es ist dieses Phänomen einer Verweisungsmannigfaltigkeit, einer vorgängig entdeckten „Zeugganzheit“, das die Grundlage für den in § 18 entwickelten Weltbegriff abgibt. Drittens entdeckt den instrumentellen Charakter des Zeugs laut Heidegger der gebrauchende Umgang selbst, nicht etwa ein rein theoretisches Verhalten. Dies ist der Fall, weil ihm ein Verstehen eigener, vorthematischer Art zukommt, die „Umsicht“ (vgl. 69). Viertens unterlegt Heidegger seine Analyse des Zeugs der Bestimmung von Natur. Er nimmt zwar zunächst nur die vergesellschaftete Natur in den Blick: „Hammer, Zange, Nagel verweisen an ihnen selbst auf – sie bestehen aus – Stahl, Eisen, Erz, Gestein, Holz. Im gebrauchten Zeug ist durch den Gebrauch ‚Natur‘ mitentdeckt, die ‚Natur‘ im Lichte der Naturprodukte“ (70). Anschließend weitet er seine These jedoch unzulässigerweise auf alle Naturphänomene aus: „Natur darf aber hier nicht als das nur noch Vorhandene verstanden werden – auch nicht als Naturmacht. Der Wald ist Forst, der Berg Steinbruch, der Fluß Wasserkraft, der Wind ist Wind ‚in den Segeln‘. Mit der entdeckten ‚Umwelt‘ begegnet die so entdeckte ‚Natur‘. Von deren Seinsart als zuhandener kann abgesehen, sie selbst lediglich in ihrer puren Vorhandenheit entdeckt und bestimmt werden. Diesem Naturentdecken bleibt aber auch die Natur als das, was ‚webt und strebt‘, uns überfällt, als Landschaft gefangen nimmt, verborgen“ (70). Diesen Bestimmungen läßt sich eine Tendenz zur Überzeichnung entnehmen, die den praktizistischen Ansatz von Sein und Zeit charakterisiert. Heidegger betrachtet theoretisch-wissenschaftliche und ästhetisch-kontemplative Seinsweisen und Erfahrungen grundsätzlich als Sekundärphänomene. Er begnügt sich nicht damit, die faktische Relevanz des „Besorgens“ für das alltägliche In-der-Welt-sein herauszustellen, sondern entnimmt ihr das ontologische Primat der Zuhandenheit vor der Vorhandenheit und vor einem Sein, das sich nur ästhetisch erfahren läßt, zum Beispiel dem von Landschaft (vgl. dazu Ritter 1963). Für Heidegger gilt: „Zuhandenheit ist die ontologisch-kategoriale Bestimmung von Seiendem, wie es ‚an sich‘ ist“ (71). Die Technikkritik des späten Heidegger ist der Sache nach auch eine Kritik am Denken seines frühen Hauptwerks (vgl. Heidegger 1962).
3.3 Zuhandenheit und Umwelt „Hat das Dasein selbst im Umkreis seines besorgenden Aufgehens bei dem zuhandenen Zeug eine Seinsmöglichkeit, in der ihm mit dem besorgten innerweltlichen Seienden in gewisser Weise dessen Weltlichkeit aufleuch-
3 Die Weltlichkeit der Welt
57
tet?“ (72). Diese Frage versucht der § 16 zu beantworten, indem er drei Transformationen des Zuhandenen darstellt, auf die das Dasein in seiner Alltäglichkeit stoßen kann: „Auffälligkeit“, „Aufdringlichkeit“ und „Aufsässigkeit“. Auffällig wird das Zeug, wenn es unbrauchbar geworden ist, zum Beispiel beschädigt oder ungeeignet, aufdringlich, wenn es vermißt wird, aufsässig, wenn es unerledigt bleibt (vgl. 73 f.). Gemeinsames Merkmal aller drei Transformationen ist, daß sie „am Zuhandenen den Charakter der Vorhandenheit zum Vorschein […] bringen“ (74). Wir sind bereits auf Heideggers These gestoßen, daß das innerweltlich Seiende „an sich“, wesentlich, zuhanden ist und nur in Folge einer Abstraktion in die Vorhandenheit absinken kann. Im aktuellen Kontext ist nun genauer zwischen zwei Grundformen von Vorhandenheit zu unterscheiden, die der Binnendifferenzierung vorgelagert sind, die die Begriffe „Auffälligkeit“, „Aufdringlichkeit“ und „Aufsässigkeit“ benennen. Der Typus von Vorhandenheit, um den es bei allen drei Erfahrungen geht, ist der, der dem Zuhandenen zukommen kann. Davon möchte Heidegger einen Typus bloßer, reiner Vorhandenheit unterscheiden. Er betont, daß beim ersten Typus „das Zuhandene noch nicht lediglich als Vorhandenes betrachtet und begafft“ wird, „die sich kundgebende Vorhandenheit […] noch gebunden [ist] in der Zuhandenheit des Zeugs“ (74), und er unterscheidet das defiziente (auffällige, aufdringliche, aufsässige), „so vorhandene Zeug“ von einem „nur irgendwo vorkommende[n] Ding“ (73). Die Unterscheidung selbst ist zwar plausibel, nicht jedoch der theoretische Rahmen, in dem sie angesiedelt ist. Denn Heidegger möchte den Typus reiner Vorhandenheit, weil er ihn als Produkt einer nochmaligen Abstraktion von Zuhandenheit begreift, als ein in potenzierter Weise defizientes Phänomen bestimmen. Damit unterschlägt er jedoch die Eigenständigkeit einer Vorhandenheit, die irreduzibel jeder Zuhandenheit vorausliegt. Heideggers überspitzte, traditionskritisch motivierte Kampfansage an die Kategorie der Vorhandenheit und das theoretische Erkennen, das er als Korrelat der Vorhandenheit faßt, führen auch im Rahmen anderer zentraler Analysen von Sein und Zeit zu Vereinseitigungen. So wird in der existenzialen Analytik Vorhandenheit auch dort marginalisiert, wo sie im Vordergrund steht: im Kontext der Faktizität des Daseins. Aus der richtigen Beobachtung, daß das Sein des Menschen nicht nach dem Vorbild bloß vorhandener Dinge bestimmt werden dürfe, folgert er unzulässigerweise, daß dem Dasein gar keine Vorhandenheit zuzusprechen sei (vgl. 135, dazu Pocai 1996, 51). Die Absage an die Ontologie der Vorhandenheit macht sich bis in die Grundlagen der Zeittheorie hinein geltend. Sie trägt
58
Romano Pocai
dazu bei, daß Heidegger die Gegenwartsdimension gegenüber Zukunftsausrichtung und Vergangenheitsbezug des Menschen unterbestimmt (vgl. 328). Inwiefern bieten nun Heideggers Überlegungen zur Vorhandenheit des Zuhandenen einen Ansatz dafür, den Weltbezug des Zuhandenen zu explizieren und damit dem Weltphänomen selbst näherzukommen? Der leitende Gedanke hierbei lautet, daß durch die Modi „Auffälligkeit“, „Aufdringlichkeit“ und „Aufsässigkeit“ das Sein des Zuhandenen und damit auch sein Weltbezug allererst ausdrücklich erfahren werden. Wird ein Zeug zum Beispiel unverwendbar, so ist „die konstitutive Verweisung des Um-zu auf ein Dazu […] gestört“ (74), die sein Sein bestimmt. Mit dieser Struktur der Verweisung kommt deren Ganzheit gleichfalls zum Vorschein: „Der Zeugzusammenhang leuchtet auf nicht als ein noch nie gesehenes, sondern in der Umsicht ständig im vorhinein schon gesichtetes Ganzes. Mit diesem Ganzen aber meldet sich die Welt“ (75). Die gleiche Struktur liegt der Aufdringlichkeit zugrunde. Macht sich das Fehlen eines Zeugs bemerkbar, kommt es zum „Bruch der in der Umsicht entdeckten Verweisungszusammenhänge. Die Umsicht stößt ins Leere und sieht erst jetzt, wofür und womit das Fehlende zuhanden war. Wiederum meldet sich die Umwelt“ (ebd.). In der Störung des alltäglichen Besorgens tritt somit allererst zum Vorschein, was dieses je schon konstituiert: eine vorgängige „Erschlossenheit“ von Welt (vgl. 75), eine basale „Vertrautheit mit Welt“ (76). Zum reibungslosen Vollzug alltäglichen In-der-Welt-seins gehört demgegenüber „das Sich-nicht-melden der Welt“ als „Bedingung der Möglichkeit des Nichtheraustretens des Zuhandenen aus seiner Unauffälligkeit“ (75). Dementsprechend bestimmt Heidegger die Unauffälligkeit, Unaufdringlichkeit und Unaufsässigkeit als positive Seinscharaktere des Zuhandenen (vgl. ebd.).
3.4 Verweisung und Zeichen Die Bedeutung von § 17 innerhalb der Gedankenbewegung der §§ 14 –18 besteht darin, die Möglichkeit einer direkten Begegnung mit dem Ganzen von Welt nachzuweisen, und zwar über die Analyse der Struktur von Zeichenphänomenen, die Heidegger grundsätzlich der Kategorie des „Zeugs“ zuordnet. Die Überlegungen zu „Verweisung und Zeichen“ leiten die bisherige Analyse hin zur eigentlichen Bestimmung der Struktur von Welt, die der § 18 leistet. Während bisher eine Erfahrung von Welt nur
3 Die Weltlichkeit der Welt
59
über die Vorhandenheit des Zuhandenen aufgewiesen wurde, so wird sie jetzt ausdrücklich und direkt zugänglich. Damit ist der letztgültige Nachweis erbracht, „wie es Welt ‚gibt‘“ (vgl. 72). Heidegger veranschlagt eine dreifache „Beziehung zwischen Zeichen und Verweisung“. Die beiden ersten von drei Thesen, mit denen er den Ertrag des Paragraphen zusammenfaßt, lauten: „1. das Zeigen ist als mögliche Konkretion des Wozu einer Dienlichkeit in der Zeugstruktur überhaupt, im Um-zu (Verweisung) fundiert. 2. Das Zeigen des Zeichens gehört als Zeugcharakter eines Zuhandenen zu einer Zeugganzheit, zu einem Verweisungszusammenhang“ (82). Heidegger entwickelt seine Zeichentheorie im Horizont seiner bisherigen Bestimmung des innerweltlich Seienden und seines Weltbezuges: Zeichen sind wesentlich „Zeuge“, deren Sein instrumenteller Natur ist. Als solche gehören sie in die jeweilige Ganzheit der utilitaristisch-instrumentellen Bezüge des Daseins.2 Den Unterschied zwischen Zeichen und Gebrauchsgegenständen, Materialien etc. und damit den besonderen Charakter von Zeichen berücksichtigt Heidegger erst mit der dritten These: „Das Zeichen ist nicht nur zuhanden mit anderem Zeug, sondern in seiner Zuhandenheit wird die Umwelt je für die Umsicht ausdrücklich zugänglich. Zeichen ist ein ontisch Zuhandenes, das als dieses bestimmte Zeug zugleich als etwas fungiert, was die ontologische Struktur der Zuhandenheit, Verweisungsganzheit und Weltlichkeit anzeigt. Darin ist der Vorzug dieses Zuhandenen innerhalb der umsichtig besorgten Umwelt verwurzelt“ (82 f.). Die besondere Leistung von Zeichen, etwa des von Heidegger erwähnten Verkehrszeichens „Winker“ besteht darin, „eine Orientierung innerhalb der Umwelt“ (79) zu eröffnen. Das Zeichen erschließt auf direkte Weise den Horizont, innerhalb dessen es wirksam ist. Darin unterscheidet es sich von gewöhnlichem Gebrauchszeug, dem Werkzeug etwa, das primär auf ein anderes Zeug und nur sekundär auf den Zeugzusammenhang verweist. Weil es die Aufgabe der Zeichen ist, „jederzeit durch ein Zuhandenes sich die jeweilige Umwelt für die Umsicht melden zu lassen“ (80), gehört im Unterschied zu gewöhnlichem Gebrauchszeug die „Auffälligkeit“ der Zeichen zu ihrem Sein. Um diesen Charakter hat sich die „Zeichenstiftung“ (ebd.) deshalb besonders zu bemühen.
2 Da Heidegger die Strukturen von Zeichen und Verweisung grundsätzlich im Rahmen seines Ansatzes beim Zeugzusammenhang bestimmt, müssen sprachphilosophisch ausgerichtete Interpretationen von Sein und Zeit die entsprechenden Potentiale des Paragraphen in erster Linie gegen Heidegger herausarbeiten. Vgl. etwa Lafont 1994, 53 ff.
60
Romano Pocai
Vom Phänomen her tritt uns mit der Orientierung am Zeichen zwar im Grunde eine Welt entgegen, die nicht so sehr an die Lebenswelt des Handwerkers und Bauern, sondern eher an eine moderne, abstrakter strukturierte, urbane Welt erinnert. Heidegger geht es aber keineswegs darum, die spezifischen Unterschiede zwischen der Welt des Handwerkers und einer modernen Dienstleistungswelt herauszuarbeiten. Vielmehr universalisiert er die an der vormodernen Welt aufgezeigte Grundstruktur von „Zuhandenheit“ und „Verweisung“. Dem scheint jedoch zu widersprechen, daß Heidegger in bezug auf „primitive“ Kulturen seine Zeichentheorie zuletzt relativiert. Da bei Naturvölkern noch keine Loslösung des Zeichens vom Bezeichneten stattgefunden habe, sind „Zeichen überhaupt nicht als Zeug entdeckt“, besitzt „das innerweltlich ‚Zuhandene‘ überhaupt nicht die Seinsart von Zeug“ (82). Der hier aufscheinende Kulturrelativismus wird von Heidegger aber grundlegend zurückgenommen. Denn er geht davon aus, daß die fundamentalphilosophische, übergeschichtliche Struktur von „Weltlichkeit“ allgemein, „formal“ genug sei, um auch die Welt von Fetisch und Zauber bestimmen zu können (vgl. ebd.).
3.5 Die Weltlichkeit der Welt Zu Beginn von § 18, in dem er die letztgültige Gestalt seines Weltbegriffs entwickelt, macht Heidegger deutlich, daß er einen Perspektivenwechsel vorzunehmen gedenkt. Hat er bis dato einen Bezug auf Welt über die Analyse des Seins des innerweltlich Seienden gewonnen, so soll nun umgekehrt die Welt an die auch methodisch erste Stelle gelangen: „Welt ist es, aus der her Zuhandenes zuhanden ist. Wie kann Welt Zuhandenes begegnen lassen?“ (83). Heidegger beantwortet diese Frage, indem er sich zunächst wieder dem Zuhandenen zuwendet und dessen Sein als „Bewandtnis“ reformuliert: „Das Sein des Zuhandenen hat die Struktur der Verweisung – heißt: es hat an ihm selbst den Charakter der Verwiesenheit. Seiendes ist daraufhin entdeckt, daß es als dieses Seiende, das es ist, auf etwas verwiesen ist. Es hat mit ihm bei etwas sein Bewenden. Der Seinscharakter des Zuhandenen ist die Bewandtnis. In Bewandtnis liegt: bewenden lassen mit etwas bei etwas“ (83 f.). Die Reformulierung von „Verweisung“ bzw. „Verwiesenheit“ in „Bewandtnis“ treibt die Sache der Weltanalyse insofern voran, als Heidegger am Begriff der Bewandtnis nicht nur den Bezug des Seienden auf das Ganze der Welt, sondern auch den auf das weltkonstituierende Dasein expliziert:
3 Die Weltlichkeit der Welt
61
„Welche Bewandtnis es mit einem Zuhandenem hat, das ist je aus einer Bewandtnisganzheit vorgezeichnet. Die Bewandtnisganzheit, die zum Beispiel das in einer Werkstatt Zuhandene in seiner Zuhandenheit konstituiert, ist ‚früher‘ als das einzelne Zeug, imgleichen die eines Hofes, mit all seinem Gerät und seinen Liegenschaften. Die Bewandtnisganzheit selbst aber geht letztlich auf ein Wozu zurück, bei dem es keine Bewandtnis mehr hat; was selbst nicht Seiendes ist in der Seinsart der Zuhandenheit innerhalb einer Welt, sondern Seiendes, dessen Sein als In-der-Welt-sein bestimmt ist, zu dessen Seinsverfassung Weltlichkeit selbst gehört […]. Das primäre ‚Wozu‘ ist ein Worum-willen. Das ‚Umwillen‘ betrifft aber immer das Sein des Daseins, dem es in seinem Sein wesenhaft um dieses Sein selbst geht“ (84). In dieser Passage expliziert Heidegger die Grundthese des gesamten Kapitels: daß Welt ein „Existenzial“, ein „Seinscharakter des Daseins“ ist (64). Welt ist als Bewandtnisganzheit zwar der vorausgesetzte Konstitutionsgrund für das Sein des Zuhandenen, gründet aber ihrerseits im Sein des sich um sich bekümmernden Daseins, in dessen Entwurfscharakter. Daß und wie Heidegger auf diesem Wege die wohl produktivste Intention seiner Weltanalyse verfehlt, den Weltentwurf des Daseins an die Geworfenheit in eine faktische Welt zu binden, dokumentiert der nächste zentrale Gedankenschritt: „Dasein verweist sich je schon immer aus einem Worum-willen her an das Womit einer Bewandtnis, das heißt es läßt je immer schon, sofern es ist, Seiendes als Zuhandenes begegnen. Worin das Dasein sich vorgängig versteht im Modus des Sichverweisens, das ist das Woraufhin des vorgängigen Begegnenlassens von Seiendem. Das Worin des sichverweisenden Verstehens als Woraufhin des Begegnenlassens von Seiendem in der Seinsart der Bewandtnis ist das Phänomen der Welt. Und die Struktur dessen, woraufhin das Dasein sich verweist, ist das, was die Weltlichkeit der Welt ausmacht. Worin Dasein in dieser Weise sich je schon versteht, damit ist es ursprünglich vertraut“ (86). Heidegger spricht hier nicht mehr davon, daß die Welt das Seiende begegnen läßt, vielmehr geht diese Zuständigkeit auf das Dasein über. Zur Deutung der zitierten Passage von Seite 84 hätte sich ja durchaus die interessante Lesart angeboten, daß Heidegger auf keinen im starken Sinne eindimensionalen Konstitutionszusammenhang zwischen dem Dasein und der Welt sowie dem innerweltlich Seienden zielt. Vielmehr müsse von zwei Konstitutionsverhältnissen ausgegangen werden: einem ersten, das vom Dasein zur Welt, einem zweiten, das von der Welt zum innerweltlich Seienden verläuft und eine Teilautonomie gegenüber dem ersten Verhältnis besitzt. Diese Lesart wird aber durch den direkten konstitutiven Bezug
62
Romano Pocai
des Daseins auf das Seiende abgewehrt, auf den wir im aktuellen Kontext stoßen. Der damit zusammenhängende wichtigere Gedanke kommt in der Identität zwischen „Worin“ und „Woraufhin“ zum Ausdruck. Indem Heidegger die beiden Dimensionen von Welt so gleichsetzt, daß er das „Worin“ in das „Woraufhin“ einzieht, legt er die faktische als entworfene Welt aus. Die in § 14 eingeführte vorontologisch-existentielle „Welt, worin ein faktisches Dasein als dieses lebt“ (65), erscheint nun als „ursprünglich vertraute“ Welt, „worin Dasein […] sich je schon versteht“ (86). Zwar negiert Heidegger nicht schlechterdings Faktizität. Aber er transformiert die Geworfenheit des Daseins in eine auch unvertraute Welt in die Form von Faktizität, die dem Weltentwurf selbst zukommt. Diese besteht darin, daß das Dasein Welt „je schon“ entworfen hat. Unter der leitenden Perspektive des Verstehens reformuliert Heidegger im letzten Schritt der Analyse den Konstitutionszusammenhang, der zwischen dem Dasein, der Welt und dem innerweltlich Seienden besteht. Der immer schon vorverstandenen und in diesem Sinne vertrauten Welt, von der her Seiendes begegnen kann, schreibt Heidegger die Struktur der „Bedeutsamkeit“ zu. Er bestimmt dieses Sein einer vom verstehenden Dasein konstituierten Welt, darüber darf der Begriff nicht hinwegtäuschen, als ein vorprädikatives, der Dimension sprachlicher Bedeutung vorgelagertes Sein (vgl. 87). Gegenüber der hier vorgelegten Deutung von § 18 könnte eingewendet werden, daß sie zu einseitig ausgerichtet sei. Schließlich wird Heidegger nicht müde, eine Passivität des Daseins gegenüber dem Seienden zu betonen, die v. a. im Begriff des „Lassens“ wiederholt zum Ausdruck kommt, so in der Rede von einem „Bewendenlassen“, „sein lassen“ (84) und „Begegnenlassen“ (86). Es wäre jedoch verfehlt, wollte man die damit gemeinte Passivität so auffassen, daß sie die entwerfende Potenz des Daseins einschränkt. Denn die Passivität des „Lassens“ entspringt der Souveränität des Daseins, sich zurückhalten zu können, und diese wiederum geht darauf zurück, daß das innerhalb einer entworfenen Welt begegnende Seiende dem Dasein grundsätzlich vertraut ist, also zur Gänze in den Verstehenshorizont des Daseins eingeht. „Das auf Bewandtnis hin freigebende Jeschon-haben-bewenden-lassen ist“, so heißt es in einer prägnanten Formulierung Heideggers, „ein apriorisches Perfekt, das die Seinsart des Daseins selbst charakterisiert“ (85). Analoges gilt für die entsprechende Bestimmung aus dem Kontext der „Bedeutsamkeit“: „Dasein hat sich, sofern es ist, je schon auf eine begegnende ‚Welt‘ angewiesen, zu seinem Sein gehört wesenhaft diese Ange-
3 Die Weltlichkeit der Welt
63
wiesenheit“ (87). Es wäre auch hier ein Mißverständnis, Heideggers These so aufzufassen, als ziele sie auf eine grundlegende Ohnmacht des Daseins gegenüber Welt. Vielmehr gibt die Aktivität des Daseins wiederum den letzten Referenzpunkt ab: „Dasein hat sich auf Welt angewiesen“. Ohnmächtig ist es allein in dem Sinne, daß es „sich je schon auf Welt angewiesen hat“. Das „apriorische Perfekt“ verweist auf die einzige Form von Faktizität, die Heideggers Weltanalyse affirmiert: daß der Mensch durch die unhintergehbare Faktizität seines Weltentwurfs bestimmt ist. Die Analyse des Weltphänomens in den §§ 14–18 leidet somit durchgängig darunter, daß sich Heidegger zu einseitig am Entwurfscharakter des Daseins orientiert. Das verstehende Dasein ist in der Tat dadurch charakterisiert, daß es auf die Totalität des Seienden ausgreifen kann, obwohl es in der Welt existiert. Aber Heidegger totalisiert diesen Seinscharakter und ebnet damit die andere, ebenso basale Weltstellung des Menschen ein: seine Existenz inmitten einer auch nicht entworfenen, auch unverstandenen Welt. Die Weltanalyse des Buches vermag keine Erfahrung zu denken, für die das verstehende Dasein nicht schon eine apriorische Form besitzt.
3.6 Unheimlichkeit und Unzuhause Die in den §§ 14–18 abgedrängte mundane Faktizität macht sich in Heideggers Analyse der Angst aus § 40 am Phänomen gegen dessen Interpretation geltend. In Gestalt dieses Widerspruchs wird manifest, daß der Ansatz von Sein und Zeit beim Entwurfscharakter des Daseins am Phänomen der Geworfenheit auf die Grenze seiner Reichweite stößt. Im Rahmen der Angstanalyse spielt der Weltbezug des Daseins eine wichtige Rolle. Für Heidegger sind alle Stimmungen Weisen einer Erschlossenheit des „ganzen In-der-Welt-seins“ (137), also einer grundlegenden Kopräsenz des Welt- und des Selbstverhältnisses noch vor allen konkreten Bezügen des Daseins zu innerweltlich Seiendem. Denn in den Stimmungen artikuliert sich die jeweilige Gesamtdisposition der menschlichen Existenz, die wiederum die konkrete Affizierbarkeit des Daseins ermöglicht, seine „Angänglichkeit“ (137). Heidegger geht in seiner Angstanalyse – wie vor ihm Kierkegaard – davon aus, daß der Gegenstandsbezug der Angst, ihr „Wovor“, im Unterschied zu dem der Furcht unbestimmt ist. Diese Erfahrung legt er als Zeichen einer grundlegenden Irrelevanz aus: „Die innerweltlich entdeckte Bewandtnisganzheit des Zuhandenen und Vorhandenen ist als solche überhaupt ohne Belang. Sie sinkt in sich zusammen. Die Welt hat den Charakter völliger Unbedeutsamkeit. In der
64
Romano Pocai
Angst begegnet nicht dieses oder jenes, mit dem es als Bedrohlichem eine Bewandtnis haben könnte“ (186). Mit dieser These, wonach die „Bewandtnisganzheit“, also die entworfene Welt, irrelevant wird, scheint Heidegger auf eine grundlegende Erweiterung seiner Analyse von Welt zuzusteuern. Wenn er diese negative Erfahrung als Ausdruck einer eigenständigen „Erschlossenheit von Welt überhaupt“ (ebd.) bestimmt, dann kann damit, folgt man der Logik des Gedankens, nur die Dimension einer mundanen Faktizität gemeint sein, die dem Weltentwurf des Daseins vorausliegt. Dieser Schein trügt jedoch: Heidegger korrigiert anschließend seine These, wonach der Welt der Charakter „völliger Unbedeutsamkeit“ zukommt. Vielmehr ist nur noch von einer „Unbedeutsamkeit des Innerweltlichen“ die Rede. Auf diesem Wege lenkt Heidegger die Angstanalyse zunächst in die Bahnen des transzendentalen Weltbegriffs zurück. Seine These lautet nurmehr, „daß auf dem Grunde dieser Unbedeutsamkeit des Innerweltlichen die Welt in ihrer Weltlichkeit sich einzig noch aufdrängt“ (187). Der Grund für die Rücknahme der These liegt darin, daß der konzeptuelle Vorrang des Entwurfscharakters in Sein und Zeit es verunmöglicht, den Gedanken einer auch nicht-entworfenen Welt auszubuchstabieren. Da Heidegger in den §§ 14 –18 die faktische Welt in den transzendentalen Weltentwurf eingezogen hat, vermag er die Erfahrung einer Negation von Bedeutsamkeit mit seinem Weltbegriff nur so zu vereinbaren, daß er sie auf das innerweltlich Seiende einschränkt. Im weiteren Verlauf des Paragraphen vermag die bis dato abgedrängte mundane Faktizität die transzendentalphilosophische Grundlage von Sein und Zeit dennoch in Frage zu stellen. Dies ist der Fall, sobald sich Heidegger im Anschluß [!] an seine bereits durchgeführte Interpretation der Angst ihrem Stimmungscharakter widmet: der Unheimlichkeit. Diese deutet er vor allem als Ausdruck einer gegenüber dem alltäglichen In-derWelt-sein basalen Fremdheit und Unvertrautheit: „Das beruhigt-vertraute In-der-Welt-sein ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins, nicht umgekehrt. Das Un-zuhause muß existenzial-ontologisch als das ursprünglichere Phänomen begriffen werden“ (189). Wir stoßen hier auf den grundlegenden Widerspruch der Angstanalyse. Die Deutung der Unheimlichkeit ist nicht nur unvereinbar mit der bisherigen Interpretation der Welterfahrung, die in der Angst liegt; vor allem erteilt sie der konzeptuellen Basis von Sein und Zeit eine Absage. Denn der Gedanke, daß der „existenziale Modus des Unzuhause“ die Grundlage der entworfenen Welt abgibt, dementiert den transzendentalphilosophischen
3 Die Weltlichkeit der Welt
65
Ansatz der Weltanalyse, der die faktische Welt in den Weltentwurf des Daseins eingezogen hat. Die Erfahrung der Unheimlichkeit ist ein Dokument für das produktive Potential der Erschlossenheitskonzeption von Sein und Zeit. In ihrer existenzialontologischen Tiefendimension verweist die Unheimlichkeit auf ein Strukturmerkmal menschlicher Existenz, demgegenüber der Entwurfscharakter abkünftig ist: auf die Faktizität, daß wir Welt nicht immer schon entworfen haben.
Ausblick Nicht mehr der Weltentwurf des Daseins, sondern die befindliche Erschlossenheit bildet den Ausgangspunkt des philosophischen Neuansatzes, den Heidegger zwei Jahre später in seiner Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik? skizziert. Mit der Konzeption eines „Sichbefinden[s] inmitten des Seienden im Ganzen“ (GA 9, 110) geht Heidegger vom faktischen In-der-Welt-sein des Daseins aus, der Geworfenheit in eine auch vorgegebene Welt. Der Begriff des „Seienden im Ganzen“, inmitten dessen das Dasein sich befindet, akzentuiert die in Sein und Zeit unterdrückte und schließlich in den Weltentwurf aufgelöste Welt, „worin ein faktisches Dasein als dieses ‚lebt‘“ (65). Im Mittelpunkt von Was ist Metaphysik? stehen Phänomenskizze und Deutung der Angst. Heidegger orientiert sich dabei basal an dem in Sein und Zeit lediglich nachgetragenen Stimmungscharakter der Angst. Die Erfahrung der Unheimlichkeit bestimmt er so fort, daß er damit die offizielle Interpretation von Sein und Zeit zurücknimmt: „Alle Dinge und wir selbst versinken in eine Gleichgültigkeit. Dies jedoch nicht im Sinne eines bloßen Verschwindens, sondern in ihrem Wegrücken als solchem kehren sie sich uns zu“ (GA 9, 111). Die entscheidende Differenz zur Interpretation der Angst in Sein und Zeit liegt darin, daß Heidegger die Erfahrung der Gleichgültigkeit, die das Buch unter dem Titel einer „Unbedeutsamkeit des Innerweltlichen“ zur Sprache gebracht hat, dialektisch faßt. Die Deutung der Angst in Sein und Zeit geht von der „Irrelevanz“ des Seienden aus und zielt auf den Nachweis, daß dessen Belanglosigkeit die Erfahrung der konstitutiven Bedeutung ermöglicht, die der „Weltlichkeit der Welt“, dem Weltentwurf zukommt. In der Antrittsvorlesung hingegen skizziert Heidegger die Angst als Erfahrung des „Wegrückens“ und der „Zukehr“ des Seienden im Ganzen. Gleichgültig, irrelevant wird damit nicht das Seiende, sondern werden vielmehr die je vorherrschenden Ent-
66
Romano Pocai
würfe des Daseins. In Was ist Metaphysik? rückt das Seiende im Ganzen lediglich als Entworfenes weg; es kehrt sich uns jedoch genau darin, daß es als Entworfenes entgleitet, zu: als Nichtentworfenes, Faktisches. Damit liegt der Angsterfahrung der strukturale Sachverhalt zugrunde, daß der Entwurfscharakter des Daseins nicht schlechterdings konstitutiv für das innerweltlich Seiende und die Welt ist. Freilich geht der Ansatz bei der mundanen Faktizität mit einer unhaltbaren Depotenzierung des Entwurfscharakters des Daseins einher. Denn Heidegger deutet die Erfahrung einer unvertrauten Welt als ein übersubjektives Geschehen des „Nichts“ (vgl. GA 9, 114). Auf dieses metaphysische Geschehen führt er den Entwurfscharakter des Daseins zurück, der unter dem Titel „Transzendenz“ mitverhandelt wird (vgl. GA 9, 115). Diese These widerstreitet aber offensichtlich dem Strukturzusammenhang menschlicher Existenz. Denn die Tatsache, daß der Entwurf gegenüber der Geworfenheit abkünftig ist, sofern er sich immer schon „inmitten von Seiendem“ vollzieht, läßt es keineswegs zu, diese Faktizität als übersubjektiven Entwurf zu bestimmen, der den Entwurfscharakter des Daseins entwirft. Somit vermag sich die Erfahrung einer unvertrauten Welt auch nach Sein und Zeit gegen ihre konzeptuellen Verzerrungen nicht durchzusetzen. Heidegger hat sich auch in Was ist Metaphysik? nicht vom hierarchisierenden Zug seines Denkens freimachen können. Wiederum soll ein Strukturmerkmal der Existenz zugleich das Ganze dieses Seins durchherrschen. Gilt es, gegenüber Sein und Zeit der Faktizität des „Inmitten-von-Seiendem-seins“ zu ihrem Recht zu verhelfen, so muß man angesichts der Vorlesung auf dem irreduziblen Strukturmerkmal des Entwurfs bestehen. Damit ist auch schon das basale Defizit angedeutet, das den Übergang von der Daseinsanalytik zur Philosophie des Seins charakterisiert, den Heidegger in Was ist Metaphysik? erstmalig vollzieht: Heidegger kehrt die Ausrichtung des Buches lediglich um und gelangt zu einer Totalaffirmierung der Ohnmacht des Menschen.
3 Die Weltlichkeit der Welt
67
Literatur Brandom, R. 1997: Heideggers Kategorien in Sein und Zeit, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45/4, 531–549 Gethmann, C. F. 1988: Heideggers Konzeption des Handelns in Sein und Zeit, in: GethmannSiefert, Annemarie u. Pöggeler, Otto (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt a. M. 140–176 Lafont, C. 1994: Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers, Frankfurt a. M. Pocai, R. 1996: Heideggers Theorie der Befindlichkeit. Sein Denken zwischen 1927 und 1933, Freiburg/München Prauss, G. 1977: Erkennen und Handeln in Heideggers Sein und Zeit, Freiburg Ritter, J. 1974: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft (1963), in: ders., Subjektivität, Frankfurt a. M. 141–163 Schulz, W. (1984): Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers (1953/54), in: Pöggeler, Otto (Hg.): Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werks, Frankfurt a. M. (1969), 95–139 Theunissen, M. 1977: Der Andere, Berlin/New York Tugendhat, E. 1979: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, Frankfurt a. M.
4 Hubert L. Dreyfus
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit: Heideggers Kritik des Cartesianismus (§§ 19–24)*
Mir geht es darum, die Bedeutung der Analysen zur Weltlichkeit im Rahmen einer Fragestellung, die auf Descartes zurückzuführen ist, zu untersuchen: für das ontologische Projekt, alles auf der Grundlage eines vorhandenen Seienden zu erklären, von dem angenommen wird, es sei unmittelbar zugänglich und verständlich. In der Ontologie von Descartes fungieren Elemente der Natur (naturas simplices), sofern sie Gegenstände der naturwissenschaftlichen Forschung sind, als die grundlegenden Bestandteile des Universums. Stattdessen könnte man jedoch auch versuchen, alles auf Sinnesdaten, Monaden oder – wie zum Beispiel bei Husserl – auf Verhältnisse zwischen „dem Sinn von Prädikaten“ als Basiselementen zurückzuführen, die den Beziehungen unter denjenigen einfachen Merkmalen der Welt entsprechen, auf welche diese Basiselemente zu verweisen scheinen. Heidegger denkt an diese letzte Entwicklungsstufe der atomistischen, rationalistischen Tradition von Descartes bis Husserl, wenn er in Sein und Zeit die Vorstellung kritisiert, die Welt sei ein „Relationssystem“, etwas „in einem ‚Denken‘ erst Gesetztes“ (88). Dieses Projekt Husserls hat seinen vorläufigen Höhepunkt mit den modernen Ansätzen innerhalb der Computerwissenschaft und KIForschung erreicht. Danach ist die Welt mit ihren Objekten eine komplexe Merkmalskombination und der Geist ein Behälter mit symbolischen Repräsentationen dieser Merkmale sowie mit Regeln und Programmen, welche deren Beziehungen untereinander repräsentieren.1
* Aus dem Englischen übersetzt und leicht gekürzt von Christoph Demmerling. 1 Siehe Newell/Simon 1981; Haugeland 1985.
70
Hubert L. Dreyfus
Die traditionelle Ontologie kommt nur dann zu einem Erfolg, wenn es ihr gelingt, alle Weisen des Seins – und dazu gehört auch die praktische Aktivität des Daseins sowie das Zeugganze, in dem das Dasein „aufgeht“ – auf der Grundlage von gesetzes- oder regelähnlichen Kombinationen vorhandener Elemente zu erklären. Wenn hingegen gezeigt werden kann, daß sich die Welt nicht auf Vorhandenes reduzieren läßt, seien es materielle Gegenstände, atomare Tatsachen, Sinnesdaten oder Informationseinheiten, dann erweist sich eine Ontologie des Vorhandenen als verfehlt. Heidegger konzentriert sich im dritten Kapitel von Sein und Zeit auf Descartes’ Versuch, alles unter Verweis auf die physikalische Natur zu erklären.
4.1 Der ontologische Stellenwert der Natur Mit seiner Kritik an einer naturalistischen Ontologie geht es Heidegger nicht darum, zu bestreiten, daß die Natur dem Funktionieren von Zeug zugrundeliegt und die Grundlage dafür darstellt, die Funktionsweisen des Zeugs zu erklären. Mit Eisen und Holz können wir hämmern, nicht jedoch mit Gummi und Eis. Aber was diese scheinbare Priorität der Natur ontologisch bedeutet, erweist sich als eine komplizierte Frage. Heidegger unterscheidet mindestens vier verschiedene Weisen, auf die uns die Natur begegnen kann. Er schreibt: „Natur ist selbst ein Seiendes, das innerhalb der Welt begegnet und auf verschiedenen Wegen und Stufen entdeckbar wird“ (63). Natur zeigt sich uns als zuhanden, als unzuhanden, als vorhanden und auch – merkwürdigerweise – noch auf eine andere Art, die keiner der gerade angeführten Formen entspricht. Diese Seinsarten sollen im folgenden ausgelegt werden, indem für jede die ihr spezifische Weise des Besorgens festgehalten wird. Unsere Fragen lauten: (1) Kann Heidegger seine Fundamentalontologie ausführen und nachweisen, daß alle Seinsarten, also auch das Sein der Natur, nur aufgrund des Seins des Daseins verständlich gemacht werden können, und nicht vice versa? (2) Kann er ontischen, kausalen, wissenschaftlichen Erklärungen der Natur trotzdem einen Platz im Rahmen seiner Überlegungen einräumen?
4.1.1 Natur als Zuhandenes „Das Seiende das Descartes mit der extensio ontologisch grundsätzlich […] zu fassen versucht, ist […] ein solches, das allererst im Durchgang durch
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
71
ein zunächst zuhandenes innerweltliches Seiendes entdeckbar wird […] (Natur)“ (95).
4.1.1.1
Natürliche Materialien
Als Stoff betrachtet, aus dem das Zuhandene gemacht ist – als das „Woraus“ des Zeugs – ist die Natur als rohes Material mitentdeckt, und wird somit im Hinblick auf die Funktion, die sie für das Bereitstellen des Zeugs übernimmt, zugänglich oder verständlich gemacht. „In der Umwelt wird demnach auch Seiendes zugänglich, das an ihm selbst herstellungbedürftig, immer schon zuhanden ist. Hammer, Zange, Nagel verweisen an ihnen selbst auf – sie bestehen aus – Stahl, Eisen, Erz, Gestein, Holz. Im gebrauchten Zeug ist durch den Gebrauch die ,Natur‘ mitentdeckt, die ,Natur‘ im Lichte der Naturprodukte“ (70). Die Eigenschaften des Eisens beispielsweise – seine Bearbeitbarkeit, Dehnbarkeit, Härte usw. – sind dafür verantwortlich, daß es formbar ist und sich dazu eignet, festen Schlägen zu widerstehen. Deshalb kann das Dasein Eisen in eine Bezugsganzheit einfügen. Eisen kann dazu gebraucht werden, um auf Köpfe oder Nägel, auf einen Amboß, Stühle oder Statuen usw. einzuschlagen. Aber dies heißt nicht, daß die Natur auf alle nur erdenklichen Weisen benutzt werden kann. Die vorhandene Natur bestimmt die Grenzen beim Gebrauch des Zeugs. Da die kausalen Kräfte und die bestimmenden Eigenschaften des Eisens feststehen, kann es nicht als Brennstoff oder zu einer nahrhaften Mahlzeit verwendet werden. Das selbstinterpretierende Alltagshandeln des Daseins und die Natur bestimmen erst zusammengenommen, was zu welchem Zweck zuhanden sein kann. Würde das Dasein Zeug immer wieder auf bestimmte Weisen gebrauchen, unabhängig von den Eigenschaften des Materials, aus dem die betreffenden Zeugdinge gemacht sind, würden diese zu Bruch gehen. Wenn etwas auf diese Weise „unzuhanden“ wird, heben sich dessen widerständige Eigenschaften oder Aspekte selbst auf, so, als wäre dies der Tribut, welchen die Natur für die Dienlichkeit des Zeugs fordert. „Zuhandenes hat allenfalls Geeignetheiten und Ungeeignetheiten, und seine ,Eigenschaften‘ sind in diesem gleichsam noch gebunden, wie die Vorhandenheit als mögliche Seinsart eines Zuhandenen in der Zuhandenheit“ (83).
72
Hubert L. Dreyfus
4.1.1.2 Natürliche Regelmäßigkeiten In Sein und Zeit hat sich Heidegger eine instrumentelle Sicht der Natur zu eigen gemacht: „Der Wald ist Forst, der Berg ist Steinbruch, der Fluß Wasserkraft, der Wind ist Wind ,in den Segeln‘“ (70). Später hat er diese Ansicht kritisiert, da hier die Natur wie ein unerschöpfliches Reservoir von Rohmaterialien behandelt wird.2 Die Umweltnatur kann für uns jedoch auch nützlich sein, ohne daß wir sie als Rohmaterial gebrauchen. Ein Beispiel: „Wenn wir auf die Uhr sehen, machen wir unausdrücklich Gebrauch vom ,Stand der Sonne‘, darnach die amtliche astronomische Regelung der Zeitmessung ausgeführt wird. Im Gebrauch des zunächst und unauffällig zuhandenen Uhrzeugs ist die Umweltnatur mitzuhanden“ (71).
4.1.1.3 Natur – in Geschichte aufgehoben „Primär geschichtlich – behaupten wir – ist das Dasein. Sekundär geschichtlich aber das innerweltlich Begegnende, nicht nur das zuhandene Zeug im weitesten Sinne, sondern auch die Umweltnatur als ,geschichtlicher Boden‘“ (381). „Aber auch die Natur ist geschichtlich […] als Landschaft, als Ansiedlungs- und Ausbeutungsgebiet, als Schlachtfeld und Kultstätte“ (388).
4.1.2 Natur als Unzuhandenes: Natürliche Kräfte Natur begegnet uns nicht nur als Zuhandenes, sondern oft auch als Bedrohung innerhalb unserer Zeugzusammenhänge. Hier zeigt sich uns die Natur darin, daß sie stört und wie wir uns gegen solche Störungen schützen. „In den Wegen, Straßen, Brücken, Gebäuden ist durch das Besorgen die Natur in bestimmter Richtung entdeckt. Ein gedeckter Bahnsteig trägt dem Unwetter Rechnung, die öffentlichen Beleuchtungsanlagen der Dunkelheit, das heißt dem spezifischen Wechsel der An- und Abwesenheit der Tageshelle“ (71).
2 Eine detaillierte Analyse zu dieser Thematik findet sich in Dreyfus 1991.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
73
4.1.3 Natur als Vorhandenes Die Natur kann dann, wenn wir sie uninteressiert betrachten, auf verschiedene Weise erscheinen.
4.1.3.1 Pure Vorhandenheit Wir haben bereits gesehen, daß dann, wenn von Natur als zuhanden oder unzuhanden abgesehen wird, sie im privativen Modus reiner Vorhandenheit erscheinen kann. „Von deren Seinsart [derjenigen der Natur, der Übersetzer] als zuhandener kann abgesehen, sie selbst lediglich in ihrer puren Vorhandenheit entdeckt und bestimmt werden“ (70). Wenn wir die so entdeckte Natur in eine Theorie einsetzen, handelt es sich um die von den Naturwissenschaften untersuchte Natur.
4.1.3.2 Naturwissenschaft Es läßt sich auch einsichtig machen, daß die Natur, wie sie in den Wissenschaften studiert wird, sich nicht einer lediglich passiven Betrachtung offenbart, sondern vielmehr einer spezifischen Weise des Besorgens. Diesem spezifischen Besorgen kommt der Charakter „einer bestimmten Entweltlichung der Welt“ zu (65) – einer Entweltlichung, die es ermöglicht, Natur innerhalb einer Theorie zu fassen. Wissenschaftliche Beobachtungen können das Universum so zeigen, als stünde es in keiner Beziehung zu einem menschlichen Um-zu. Dies ist dann die Natur, deren kausalen Kräften das Zeugganze unterliegt und auch das Dasein ist an diese gebunden, da es einen Körper hat.
4.1.3.3 Die Natur in der ‚primitiven‘ Welt und bei den Dichtern „Diesem Naturentdecken [der Wissenschaften, H. D.] bleibt aber auch die Natur als das, was ,webt und strebt‘, uns überfällt, als Landschaft gefangen nimmt, verborgen“ (70). Im wissenschaftlichen Naturentdecken darf „Natur […] aber […] nicht als das nur noch Vorhandene verstanden werden – auch nicht als Naturmacht […] Die Pflanzen des Botanikers sind nicht Blumen am Rain, das geographisch fixierte Entspringen eines Flusses ist nicht die ,Quelle im Grund‘“ (70).
74
Hubert L. Dreyfus
Heidegger bemerkt deshalb: „Vielleicht vermag auch dieser ontologische Leitfaden (Zuhandenheit und Zeug) nichts auszurichten für eine Interpretation der primitiven Welt, erst recht allerdings nicht die Ontologie der Dinglichkeit“ (82). Trotzdem behauptet Heidegger in Sein und Zeit, daß „auch das Phänomen ,Natur‘ etwa im Sinne des Naturbegriffes der Romantik erst aus dem Weltbegriff, das heißt der Analytik des Daseins her ontologisch faßbar“ (65) ist. In seinen späteren Aufsätzen versucht Heidegger allerdings zu zeigen, daß diese Art des Seins der Natur, welche die Griechen als physis erfuhren und die wir manchmal in unseren nichtinstrumentellen und gleichwohl auch nichtkontemplativen Verhältnissen zur Natur erfahren, von unserer Tradition verschüttet wurde und nicht durch den Bezug auf die Belange des Daseins verstanden werden kann.3
4.2 Heideggers Kritik des wissenschaftlichen Reduktionismus Unsere Überlegungen haben gezeigt, daß der Natur tatsächlich jene Seinsweisen zugeschrieben werden können, die Heidegger voneinander unterschieden hat. Die folgende Frage wurde bislang jedoch nicht beantwortet: Ist tatsächlich das Zeug ontologisch grundlegend oder aber bildet nicht vielmehr das Material der Natur, dessen kausale Kräfte das Funktionieren des Zeugs erst ermöglichen, eine Grundlage? An verschiedenen Stellen macht Heidegger auf Phänomene aufmerksam, welche eher die traditionelle naturalistische Sicht der Dinge unterstützen. Er macht deutlich, daß wir dann, wenn unsere praktischen Aktivitäten gestört und unterbrochen werden, den Umstand gewärtigen müssen, daß das Vorhandene immer und überall angetroffen werden kann. „Das Auffallen gibt das zuhandene Zeug in einer gewissen Unzuhandenheit. […] es zeigt sich als Zeugding, das so und so aussieht und in seiner Zuhandenheit als so aussehendes ständig auch vorhanden war“ (73). Vermutlich ist es das allem Seienden zugrundeliegende und konstant vorhandene Material, welches für die Verläßlichkeit des Zeugs (oder umgekehrt: für dessen Unzuverlässigkeit) verantwortlich ist.4
3 Vgl. Das Ding, in: Heidegger 1954, 157–175. 4 Zum Thema der Verläßlichkeit vgl. auch Vom Ursprung des Kunstwerks, in: Heidegger 1950 v. a. 19 f.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
75
Das Vorhandene im Zuhandenen ermöglicht dessen Zuhandenheit. Heidegger gesteht zu: „Zuhandenes ‚gibt es‘ doch nur auf dem Grunde von Vorhandenem“ (71). Aber er fragt unmittelbar im Anschluß an diese Feststellung: „Folgt aber – diese These einmal zugestanden – hieraus, daß Zuhandenheit ontologisch in Vorhandenheit fundiert ist?“ (71, herv., H. D.) Die Annahme, daß die Eigenschaften des Vorhandenen ontologische Priorität gegenüber dem zuhandenen Zeug und seinen Aspekten besitzen, steht Heideggers Hauptthese entgegen. In den Sein und Zeit vorausgegangenen Vorlesungen verläßt Heidegger sogar seinen eigenen Standpunkt, um die Plausibilität derjenigen Auffassung zu demonstrieren, gegen die sich seine Überlegungen richten: „Die Werkwelt trägt gerade Verweisungen auf Seiendes in sich, was am Ende deutlich macht, daß sie – die Werkwelt, das Besorgte – gar nicht das primäre Seiende ist. Gerade wenn wir aus einer Analyse der Werkwelt in der Richtung ihrer Verweisungen auf die Welt-Natur geführt werden, am Ende doch die Welt-Natur als die Fundamentalschicht der Realen anzuerkennen und zu bestimmen, sehen wir, daß nicht das eigentliche Sein in jedem Besorgen in die Sorge gestellt ist, welche primäre weltliche Präsenz ist, sondern die Realität der Natur. Dieser Konsequenz ist, so scheint es, nicht auszuweichen.“5 Es ist allerdings wichtig zu sehen, daß die Ontologie als Wissenschaft von allem, was es gibt, stärkere Annahmen machen muß als die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaften sagen uns, wie ein Hammer funktioniert, aber sie sagen uns nicht, was ein Hammer ist. Die Naturwissenschaft muß sich nicht mit dem Sein von Zeug, wie zum Beispiel einem Hammer, beschäftigen, sondern sie hat lediglich die kausalen Eigenschaften natürlicher Materialien wie Eisen oder Holz – Stoffe, aus denen ein Hammer gemacht ist – zu analysieren. Heidegger macht deutlich, daß die Natur nur als Erklärung dafür verwendet werden kann, warum das Zuhandene funktioniert; sie kann aber nicht angeführt werden, wenn man die Zuhandenheit als Seinsart einsichtig machen möchte, da im Rückgriff auf die Natur das Phänomen der „Weltlichkeit“ nicht expliziert werden kann. „Allein wenn ihr [der traditionellen Ontologie] selbst die reinste Explikation des Seins der Natur gelingt, in Anmessung an die Grundaussagen, die in der mathematischen Naturwissenschaft über das Seiende gegeben werden, diese Ontologie trifft nie auf das Phänomen ,Welt‘“ (63). Heidegger vertritt zwei Thesen. (1) „Weltlichkeit“ kann nicht auf der Grundlage von Natur verstanden werden. 5 Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20, 270 f.
76
Hubert L. Dreyfus
„Ein Blick auf die bisherige Ontologie zeigt, daß mit dem Verfehlen der Daseinsverfassung des In-der-Welt-seins ein Überspringen des Phänomens der „Weltlichkeit“ zusammengeht. Statt dessen versucht man die Welt aus dem Sein des Seienden zu interpretieren, das innerweltlich vorhanden […] ist, aus der Natur. […] ,Natur‘ als der kategoriale Inbegriff von Seinsstrukturen eines bestimmten innerweltlich begegnenden Seienden vermag nie Weltlichkeit verständlich zu machen“ (65). (2) Natur kann nur auf der Grundlage der Weltlichkeit verständlich gemacht werden: „[…] der Sinn von Weltlichkeit [kann] nicht aus bloßer Natur abgelesen werden. Die umweltlichen Verweisungen, in denen Natur weltlich primär anwesend ist, besagen vielmehr umgekehrt, daß Naturrealität nur als Weltlichkeit zu verstehen ist“6. Heidegger expliziert diesen Gedanken, indem er uns daran erinnert, daß alles, was sich uns als verständlich zeigt, sich auf einem Hintergrund von „Bedeutsamkeit“ zeigt, sei es als Bedrohung oder sei es als etwas, das auf irgendeine Weise gebraucht werden kann. Dinge begegnen uns nicht als isoliert vorhandene Seiende, denen wir voneinander isolierte Funktionsprädikate anhängen. Heidegger benutzt die Entdecktheit des Südwinds durch den Landmann als Beispiel. Damit der Bauer den Wind als Zeug entdecken kann, muß der Wind sich immer schon als etwas gezeigt haben, was mit der Alltagswelt des Landmanns zusammenstimmt. Dies ist etwas anderes, als den Wind wie der Meteorologe als Strom vorhandener Luftmoleküle zu betrachten. „Wenn zum Beispiel in der Landbestellung der Südwind als Zeichen für Regen ,gilt‘, dann ist diese ,Geltung‘, oder der an diesem Seienden ,haftende Wert‘, nicht eine Dreingabe zu einem an sich schon Vorhandenen, der Luftströmung und einer bestimmten geographischen Richtung. Als dieses nur noch Vorkommende, als welches er meteorologisch zunächst zugänglich sein mag, ist der Südwind nie zunächst vorhanden, um dann gelegentlich die Funktion eines Vorzeichens zu übernehmen. Vielmehr entdeckt die Umsicht der Landbestellung in der Weise des Rechnungtragens gerade erst den Südwind in seinem Sein“ (80 f.). In diesem Zusammenhang antizipiert Heidegger einen Einwand, der sich aus der Sicht der traditionellen Ontologie möglicherweise erheben läßt:
6 Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, a. a. O., 271.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
77
„Aber, wird man entgegnen, was zum Zeichen genommen wird, muß doch zuvor an ihm selbst zugänglich geworden und vor der Zeichenstiftung erfaßt sein“ (81). Er antwortet: „Gewiß, es muß überhaupt schon in irgendeiner Weise vorfindlich sein. Die Frage bleibt nur, wie in diesem vorgängigen Begegnen das Seiende entdeckt ist, ob als pures vorkommendes Ding und nicht vielmehr als unverstandenes Zeug, als Zuhandenes, mit dem man bislang ,nichts anzufangen‘ wußte, was sich demnach der Umsicht noch verhüllte. Man darf auch hier wieder nicht die umsichtig noch unentdeckten Zeugcharaktere von Zuhandenem interpretieren als bloße Dinglichkeit, vorgegeben für ein Erfassen des nur noch Vorhandenen“ (81). Das „Argument“ für die ontologische Priorität der Weltlichkeit und der Bedeutsamkeit hängt insoweit von der Behauptung ab, daß uns nichts verständlich wird, ohne daß es sich uns zunächst als immer schon in unsere Welt integriert zeigt und zu unserer Bemächtigungspraxis im Umgang mit der Natur paßt.
4.3 Heideggers Kritik des Kognitivismus Geben wir einmal zu, daß das, was sich in der Welt zeigt, und dies mag sogar die Natur betreffen, seine Verständlichkeit durch seinen Platz innerhalb der Welt erhält. Ist damit bereits gezeigt, daß sich auf der Grundlage des Vorhandenen „Weltlichkeit“ niemals verständlich machen läßt? Zu Beginn seiner Antwort unterstreicht Heidegger, daß die traditionelle Ontologie vorgibt, alle Arten des Seienden auf eine grundlegende Art von Seiendem zurückzuführen. Deshalb muß eine solche Ontologie in der Lage sein, alles – auch die Zeughaftigkeit – aus grundlegenden Elementen aufzubauen. Aus Elementen, von denen dann behauptet wird, es seien die letzten Konstituentien der Wirklichkeit. „Descartes hat […] den Grund gelegt für die ontologische Charakteristik des innerweltlichen Seienden, das in seinem Sein jedes andere Seiende fundiert, der materiellen Natur. Auf ihr, der Fundamentalschicht, bauen sich die übrigen Schichten der innerweltlichen Wirklichkeit auf“ (98). Mit der Vorstellung von einer Natur an sich kann Bedeutsamkeit offensichtlich nicht erklärt werden. Die traditionelle Ontologie, die von Descartes entwickelt wurde, sich aber auch in Husserls Phänomenologie sowie in der Psychologie der Informationsverarbeitung und in der KI-Forschung findet, muß die puren Naturdinge, auf die sich die Erklärungen der Natur-
78
Hubert L. Dreyfus
wissenschaften beziehen, mit Funktionen und Wertprädikaten ergänzen, um dem Zeugganzen auf der Grundlage des Vorhandenen Rechnung tragen zu können.7 Dies läuft darauf hinaus, das Ganze, welches Heidegger als „Bedeutsamkeit“ beschrieben hat und welches seinen Teilen vorhergeht, die „Zeugganzheit“, als eine komplexe Totalität zu analysieren, die aus vorhandenen Elementen aufgebaut werden kann. Heidegger gibt eine ironische Paraphrase dieses Ansatzes. Im Rahmen dieses Denkens, dem auch neuere Theorien der Kognition verpflichtet sind, versucht man, alle Seinsweisen in dem scheinbar selbstevidenten und direkt verständlichen Sein der vorhandenen Natur und vorhandener mentaler Prädikate zu fundieren: „Im ausgedehnten Ding als solchem gründen zunächst die Bestimmtheiten, die sich zwar als Qualitäten zeigen, ,im Grunde‘ aber quantitative Modifikationen der Modi der extensio selbst sind. Auf diesen selbst noch reduziblen Qualitäten fußen dann die spezifischen Qualitäten wie schön, unschön, passend, unpassend, brauchbar, unbrauchbar; diese Qualitäten müssen in primärer Orientierung an der Dinglichkeit als nicht quantifizierbare Wertprädikate gefaßt werden, durch die das zunächst nur materielle Ding zu einem Gut gestempelt wird. […] Die cartesische Analyse der ,Welt‘ ermöglicht so erst deren sicheren Aufbau der Struktur des zunächst Zuhandenen; sie bedarf nur der leicht durchzuführenden Ergänzung des Naturdings zum vollen Gebrauchsding“ (98 f.). Heidegger kritisiert diese Position und behauptet, daß es keinen Grund gibt anzunehmen, man könne zu einem Verständnis des Zuhandenen gelangen, indem man die Funktionsprädikate des Vorhandenen zusammenzählt. Die grundlegende Intuition, die hinter Heideggers Kritik des Kognitivismus steht, ist, daß jemand genau dann Eigenschaften des Vorhandenen freilegt, wenn er von deren Bedeutsamkeit absieht. Eigentlich ist es unplausibel, daß sich ein bedeutungshaftes Ganzes ergeben soll, indem immer nur bedeutungslose Elemente miteinander kombiniert werden.
7 Husserls Version dieser These, die ganz offensichtlich auf Heideggers Beispiel des Hammers zugeschnitten ist, lautet wie folgt: „Jedenfalls […] setzt jeder Bau der Aktivität notwendig als unterste Stufe voraus eine vorgebende Passivität […] Was uns im Leben sozusagen fertig entgegentritt als daseiendes bloßes Ding (von allen geistigen Charakteren abgesehen, die es zum Beispiel als Hammer […] kenntlich machen), das ist in der Ursprünglichkeit des es selbst in der Synthesis passiver Erfahrung gegeben. Als das ist es vorgegeben den mit dem aktiven Erfassen einsetzenden geistigen Aktivitäten“ (Husserl 1963, § 38, 112).
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
79
„Wird nicht mit der materiellen Dinglichkeit unausgesprochen ein Sein angesetzt – ständige Dingvorhandenheit –, das durch die nachträgliche Ausstattung des Seienden mit Wertprädikaten so wenig eine ontologische Ergänzung erfährt, daß vielmehr diese Wertcharaktere selbst nur ontische Bestimmtheiten eines Seienden bleiben, das die Seinsart des Dinges hat? Der Zusatz von Wertprädikaten vermag nicht im mindesten einen neuen Aufschluß zu geben über das Sein der Güter, sondern setzt für diese Seinsart die Seinsart purer Vorhandenheit nur wieder voraus“ (99). Der cartesische Ontologe und wohl auch der moderne Kognitionswissenschaftler würden antworten, daß es nicht ausreicht, einfach wie Heidegger zu sagen, daß eine derartige Ontologie an dem Versuch zerbricht, das Ganze aus Elementen zusammenzusetzen, da ja das Sein eines Zeugsdings aus nichts anderem besteht als seiner Rolle im Ganzen der Bedeutsamkeitsbezüge. Der Kognitivist nimmt an, daß man die Beziehungen zwischen verschiedenen Arten von Zeug sehr genau beschreiben muß, um so graduell zu einer Repräsentation des Zeugganzen zu gelangen. So kann man zum Beispiel ganz einfach mit Stühlen, Lampen, Tischen usw. als einzelnen Zeugdingen beginnen, jedes Zeug isoliert betrachten, und dann die Prädikate hinzufügen, mit welchen die Verhältnisse dieser Zeugdinge untereinander beschrieben werden können. Abschließend läßt sich das Verhältnis des so beschriebenen Zusammenhangs zu den menschlichen Zielen und Zwecken betrachten. Wie könnte Heidegger gegen eine derartige Sicht der Dinge argumentieren? Da der Versuch, unser alltägliches Verstehen auf der Grundlage des Vorhandenen zu beschreiben, nur dann sinnvoll zu sein scheint, wenn man die traditionelle Sicht der Welt als einer Menge von Objekten teilt und unsere alltägliche Praxis als regelgeleitet auffaßt, bestünde der erste Schritt, wie wir gesehen haben, darin, zu zeigen, daß die traditionelle Ontologie die „Welt“ einfach überspringt. „Weil die Interpretation der Welt zunächst bei einem innerweltlich Seienden ansetzt, um dann das Phänomen Welt überhaupt nicht mehr in den Blick zu bekommen […]“ (89), sieht sich Heidegger im Vorteil gegenüber traditioneller Ontologie und modernem Kognitivismus. Sobald wir einmal unser In-der-Welt-sein richtig verstehen, so würde Heidegger sagen, sehen wir die Verarmung, die es mit sich bringt, wenn wir von der Bedeutsamkeit der Phänomene abstrahieren, um beim puren Vorhandenen anzukommen, und wenn wir unseren Umgang mit der Welt unterbrechen, um mit dem Überlegen zu beginnen. Die Beweislast hat hier derjenige auf sich zu nehmen, der erwartet, daß diese Strategie erfolgreich sein wird.
80
Hubert L. Dreyfus
Heidegger stehen zwei Wege zur Verfügung, um die Unplausibilität der skizzierten Auffassung deutlich machen. Zunächst wäre es möglich, ein holistisches Argument zu verwenden. Wenn man zur Repräsentation eines Tisches lediglich die Tatsache hinzufügt, daß er dazu dient, um daran zu sitzen, oder auch dafür benutzt wird, um an ihm zu essen, berührt dies kaum die Oberfläche seiner Verwobenheit mit anderem Zeug. Das Um-zu, welches definiert, was es heißt, ein Tisch zu sein, gerät so gar nicht erst in den Blick. Solche Funktionsprädikate würden niemals ausreichen, um zum Beispiel eine Person aus dem traditionellen Japan in die Lage zu versetzen, mit unserer Art von Tischen umzugehen oder auch nur jene Erzählungen aus dem Westen zu verstehen, in denen Tische auf gewöhnliche Weise vorkommen. Alle Aussagen, welche dazu dienen, die „Tischheit“ deutlich zu machen, sind an ceteris-paribus-Bedingungen gebunden; und gleiches gilt für diese Bedingungen usw. Zweitens gibt es ein vergleichbares Argument, welches sich auf unsere praktischen Geschicklichkeiten und Fertigkeiten bezieht. Computer, die als physikalische Symbolsysteme programmiert sind, was heißt, daß sie auf Regeln und Merkmalslisten zurückgreifen können, besitzen keine praktischen Fertigkeiten. Sie geraten niemals in Situationen und entwickeln keine Bereitschaft mit demjenigen, was sich in Situationen zeigt, umzugehen. Ein Computer kann nur bereits Bekanntes verarbeiten. Wenn wir ihn programmieren, müssen wir Daten und Regeln eingeben, die er zu dem Zweck benötigt, das Modell einer Situation aufzubauen um beispielsweise mit Tischen umzugehen. (…) Für KI-Forscher wie auch für Husserl scheint sich damit eine unabschließbare Aufgabe zu ergeben.8 Heidegger zufolge, der unser alltägliches Verstehen als ein umsichtig besorgendes Wissen-wie betrachtet und nicht als ein propositionales Wissen-daß, sieht die Lage für den Kognitivismus noch entmutigender aus. Da unserer Vertrautheit mit der Welt kein großer Korpus von Regeln und Tatsachen zugrundeliegt, sondern sie vielmehr aus Dispositionen besteht, auf Situationen in angemessener Weise zu reagieren, lassen sich die Implikationen unseres alltäglichen Wissens nicht formalisieren. Die Aufgabe ist – folgen wir Heidegger – nicht nur unendlich, sondern hoffnungslos irreführend. Die beiden Argumente, die in Sein und Zeit implizit enthalten sind, können in die Form eines Widerspruchs gebracht werden. Tatsachen und Regeln sind an und für sich bedeutungslos. Um zu erhalten, was Heidegger „Bedeutsamkeit“ nennt, muß ihnen Bedeutung zugewiesen werden. Aber
8 Vgl. Dreyfus 1988.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
81
die Prädikate, die hinzufügt werden müssen, um die Bedeutung von Tatsachen zu definieren, sind ihrerseits bedeutungslose Tatsachen. Und – paradox genug – je mehr Informationen einem Computer eingegeben werden, um so schwieriger wird es für ihn, herauszufinden, welche Informationen in einer aktuellen Situation tatsächlich relevant sind. Um computertechnisch Relevanz in einer bestimmten Situation zu erzeugen, müßte der Computer alle seine Informationen durchsuchen und Regeln folgen, um das zu finden, was möglicherweise relevant ist. Er müßte dann weitere Regeln anwenden, um zu bestimmen, welche Tatsachen gewöhnlich in der aktuellen Situation relevant sind. Schließlich müßte er aus allen diesen Informationen ableiten, welche Fakten gerade jetzt und in gerade dieser Situation relevant sind. In einer großen Datenbank wäre eine solche Suche freilich hoffnungslos schwierig und sie würde um so schwieriger, je mehr Daten jemand hinzufügen würde, um die Suche anzuleiten. Das ursprüngliche Programm würde mehr und mehr steckenbleiben, je mehr es das Programm abfragen würde, welches erstellt wurde, um festzulegen, welche der bedeutungslosen Informationen und Regeln in der großen Datenbank aktuell von Bedeutung wären. Um Heideggers beliebtestes Beispiel zu gebrauchen: Um einen Hammer zu verstehen, sollte ein Computer nicht allen Verweisungen auf Nägel, Mauern, Häuser, Menschen, Holz, Eisen, Türklingeln, Hau-den-Lukas oder Mordinstrumente usw. nachgehen, die sich in einer Datenbank finden. Er sollte nur auf die Informationen zugreifen können, die in einem aktuellen Kontext möglicherweise relevant sind. Aber wie kann ein Programmierer einen aktuellen Kontext für ein losgelöstes theoretisches Subjekt wie den ‚Geist‘ der Kognitivisten oder einen digitalen Computer definieren? Da ein Computer nicht in einer Situation ist, müßte der KIForscher versuchen, daß In-einer-Situation-sein mit Hilfe einer künstlichen Beschränkung zu repräsentieren, welche die Hinweise zu anderen Informationen betrifft, denen der Computer folgen soll. Terry Winograd hat einmal versucht, einen solchen Ansatz für das Verstehen von Geschichten auszuarbeiten. Er stellte fest: „Die Ergebnisse des menschlichen Denkens sind kontextabhängig; zur Struktur des Gedächtnisses gehört nicht nur die Organisation des Langzeitspeichers (Was weiß ich?), sondern auch ein aktueller Kontext (Was steht im Augenblick im Zentrum?). Wir glauben, daß dies ein wichtiges Merkmal menschlichen Denkens ist und nicht eine hinderliche Beschränkung“9.
9 Bobrow/Winograd 1977, 32.
82
Hubert L. Dreyfus
Winograd erkannte, daß „das Problem darin besteht, auf formale Weise über aktuelle Aufmerksamkeitszentren und Ziele zu reden“.10 Seine „Lösung“ bestand darin, daß er die Zeit beschränkte, die dem Computer zur Verfügung stand, um die Datenbank von einem gegebenen Ausgangspunkt aus in allen Richtungen zu durchsuchen. Dahinter stand die Idee, dies würde den Computer in die Lage versetzen, nur dasjenige aufzurufen, was für seine aktuellen Ziele relevant wäre. Der jeweils aktuelle Kontext läßt sich jedoch nicht auf der Grundlage dessen definieren, was in einer vorgegebenen kurzen Zeit über den betreffenden Kontext ermittelt werden kann. Was in einer aktuellen Situation relevant ist, wird vielmehr durch meine Aktivitäten und Vorhaben bestimmt. Ich bewege mich von einer Situation in eine andere durch Verlagerungen meiner Bereitschaft, die ihrerseits durch jahrelange Erfahrungen mit der Entwicklung von Situationen geprägt ist. Dasein ist immer schon in einer Situation und bewegt sich gewöhnlich in eine neue Situation, indem die vergangene Erfahrung organisiert, was als Nächstes relevant wird. Im Unterschied dazu kommt der Computer stets von Neuem in künstlich geschaffene aktuelle Situationen. Die technische Suchbegrenzung ist kein Ersatz für ein Immer-schon-sein in einer sich entwickelnden Situationsfolge. Wie Heideggers Analyse erwarten läßt, hat sich Winograds Lösung des Relevanzproblems nicht bewährt. Winograd hat inzwischen die Schwierigkeit erkannt, „den alltagsweltlichen Hintergrund zu formalisieren, der bestimmt, welche Skripte, Ziele und Strategien wichtig sind und wie diese interagieren.“11 Er hat in der Folge den Suchbegrenzungsansatz verworfen und sein Vertrauen in die KI-Forschung verloren. In seinen computerwissenschaftlichen Seminaren an der Universität in Stanford unterrichtet er jetzt Heideggers Philosophie.12 „Wer selbst Computer programmieren muß, bleibt realistisch. Er hat keine Zeit, den Spekulationen eines Lehnstuhlrationalisten nachzugehen“ – so eine Formulierung, die in der KI-Forschung kursiert, um über den Schwindel cartesianisch gesonnener Kognitivisten zu spotten. Es ist leicht gesagt, man müsse einfach immer mehr Funktionsprädikate und Regeln hinzufügen, die beschreiben, was in typischen Situationen zu tun ist, um
10 Winograd 1976, 283. 11 Winograd 1984, 142. Vgl. auch die Diskussion meines Beitrags zur Debatte, der sich an Heidegger anlehnt: Scientific American, Januar 1990, 33. 12 Vgl. dazu Winograds aktuellen heideggerianischen Ansatz in der KI-Forschung: Winograd/Flores 1986.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
83
dem Verweisungszusammenhang des Zeugs Rechnung tragen zu können. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten in der KI-Forschung deuten jedoch an, daß Heidegger Recht zu geben ist. Zu diesen Schwierigkeiten gehört auf der einen Seite die Unfähigkeit, Forschritte im Umgang mit dem Alltagswissen zu machen, auf der anderen Seite die Unfähigkeit, dasjenige zu definieren, was in einer aktuellen Situation jeweils relevant ist – ein Problem, das manchmal auch als Problem des „Beschreibungsrahmens“ bezeichnet wird.13 Es scheint so zu sein, als könne man das Phänomen der Welt nicht aus bedeutungslosen Elementen aufbauen. Im Lichte dieser Schwierigkeiten – der Erbschaft der ontologischen Annahmen von Descartes – läßt sich Heideggers Gebot, zu den Phänomenen zurückzukehren, besser würdigen. Man muß wissen, was eigentlich erklärt werden soll und ob die Elemente, die zu diesem Zweck verwendet werden, reichhaltig genug sind, um dieser Aufgabe nachzukommen. „Und bedarf diese Rekonstruktion des zunächst ,abgehäuteten‘ Gebrauchdinges nicht immer schon des vorgängigen, positiven Blicks auf das Phänomen, dessen Ganzheit in der Rekonstruktion wieder hergestellt werden soll?“ (99). Nachdem die holistische Natur der Bedeutsamkeit und unserer Vertrautheit mit ihr einmal beschrieben ist, sind wir in der Lage, Heideggers spärliche Äußerungen über formale Modelle zu verstehen. Ein formales Modell ist eine abstrakte Struktur, die sich unabhängig von ihrem jeweiligen Inhalt und diesen betreffenden Handlungsdispositionen spezifizieren lassen muß. Heidegger ist der Auffassung, daß formale oder abstrakte Modelle angesichts des Wissens-wie unserer Fähigkeiten wie des „Hämmerns-mit“ oder des „Sitzens-an“ sowie der Verweisungszusammenhänge der Weltlichkeit versagen – hier handelt es sich nämlich um „Bezüge, darin besorgende Umsicht als solche je schon sich aufhält“ (88). Er schließt: „Den Verweisungszusammenhang, der als Bedeutsamkeit die Weltlichkeit konstituiert, kann man formal im Sinne eines Relationssystems fassen. Nur ist zu beachten, daß dergleichen Formalisierungen die Phänomene so weit nivellieren, daß der eigentliche phänomenale Gehalt verloren geht, zumal bei so ‚einfachen‘ Bezügen, wie sie die Bedeutsamkeit in sich birgt. Diese ‚Relationen‘ und ‚Relate‘ des Um-zu, des Um-willen, des Womit einer Bewandtnis widerstreben ihrem phänomenalen Gehalt nach jeder mathematischen Funktionalisierung“ (88).
13 Vgl. H. and S. Dreyfus 1987.
84
Hubert L. Dreyfus
Heideggers Bemerkung ist exakt und vorsichtig. Er weiß, daß er nicht beweisen kann, daß alle formalen Modelle des Alltagsverstehens bei dem Versuch versagen müssen, die Phänomene, die er beschrieben hat, auf den Begriff zu bringen. Allerdings weiß er auch, daß dann, wenn die Phänomene einmal richtig beschrieben sind, das Projekt der Kognitionswissenschaften ziemlich unplausibel aussieht. Durch Heideggers Verständnis der philosophischen Tradition wird man dazu geführt, den Optimismus der Kognitionswissenschaftler zu erwarten; durch Heideggers Beschreibung der Phänomene wird man dazu geführt, genau jene Sackgasse zu erwarten, in die der Kognitivismus heute geraten ist. Heidegger kann jetzt der modernen Naturwissenschaft und der cartesianischen Ontologie den ihnen angestammten Platz zuweisen. Die Wissenschaft hat einen legitimen Ort innerhalb der Explikation des Zeugganzen. Der Umschlag zur Theorie entbindet das Vorhandene vom Bezugsganzen und vom Um-zu-Zusammenhang. Übrig bleiben bedeutungslose Elemente – Elemente wie man sie für kausale Gesetze sowie für Programme benötigt, denn hier spielen ausschließlich formale Gesichtspunkte eine Rolle. Wenn die theoretische Reflexion etwas aus einem Kontext herausnimmt, konstruiert sie nicht Vorhandenes, sondern – wie Heidegger sagt – sie legt vielmehr das Vorhandene offen, welches bereits im Zuhandenen enthalten war. Wenn wir zum Beispiel davon absehen, daß ein Hammer für eine bestimmte Arbeit zu schwer ist, läßt sich sein Gewicht von 500 Gramm in diesem Sinne offenlegen. Wissenschaft kann also vorhandene Eigenschaften und die kausalen Verhältnisse zwischen diesen Eigenschaften entdecken. Das heißt sie entdeckt die physischen Eigenschaften der Natur, ohne deren Bedeutung für menschliche Zwecke zu erkennen. „Je mehr es nämlich dazu kommt, daß die zunächst erfahrene Welt […] entweltlicht wird, das heißt je mehr die zunächst erfahrene Welt bloße Natur wird, je mehr an ihr bloßes Natur-sein, zum Beispiel im Sinne der Gegenständlichkeit der Physik entdeckt wird, […] desto mehr wird Erkennen selbst als solches geeignet, zu erschließen und zu entdecken“ (GA 20, 227). Aber die traditionelle Ontologie ist nicht imstande, ontische (kausale) und ontologische (phänomenologische) Analysen der Bedeutsamkeit voneinander zu unterscheiden. „Betrachtet man diese Arbeit Descartes’ im Hinblick auf die Konstitution der mathematischen Naturwissenschaften, das heißt auf die Ausarbeitung der spezifisch mathematischen Physik, dann haben diese Betrachtungen natürlich eine fundamental positive Bedeutung. Sieht man sie aber im Zusammenhang einer allgemeinen Theorie der Realität der Welt, dann
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
85
zeigt sich, daß gerade von hier aus die verhängnisvolle Verengung der Fragestellung in Bezug auf die Realität einsetzt, die bis heute noch nicht überwunden ist“ (GA 20, 250).
4.4 Ergebnisse/Schluß Eine phänomenologische Beschreibung der naturwissenschaftlichen Vorgehensweise, das heißt der Gewinnung wissenschaftlicher Tatsachen durch ein Absehen von Bedeutsamkeit, zeigt, weshalb wissenschaftliche Theorien nicht in der Lage sind, der Bedeutung der von ihnen untersuchten Elemente Rechnung zu tragen, da sie erst einmal von allen bedeutungshaften Elementen abstrahiert haben, um zu diesen Elementen zu gelangen. Die Wissenschaft kann nicht rekonstruieren, was bei der Theoriebildung ausgeschlossen wurde; sie kann Bedeutsamkeit nicht explizieren. Aus diesem Grund läßt sich Weltlichkeit in der Perspektive der naturwissenschaftlichen Forschung auch dann nicht verständlich machen, wenn man einräumt, daß die Naturwissenschaft die kausale Grundlage des Bezugsganzen untersuchen kann (vgl. 65). Mit Blick auf dieses systematische Problem hat Heidegger später in seinem Exemplar von Sein und Zeit handschriftlich notiert: „Sondern umgekehrt!“ (65) Es ist also wichtig, sich zu fragen, worauf für Heidegger die (ontologische) Priorität der Weltlichkeit und des Zuhandenen hinausläuft und wie diese Priorität vereinbar ist mit der explanatorischen (ontischen) Priorität der Natur und des Vorhandenen. Auch wenn das Vorhandene notwendig ist, um das Funktionieren des Zuhandenen zu erklären, ist Heidegger der Auffassung, daß das Zeugganze eine notwendige Bedingung dafür ist, um überhaupt etwas erklären zu können. Um etwas als Teil des Zeugs herausgreifen zu können, müssen wir es im Hinblick auf seine Zwecke innerhalb des Zeugganzen beschreiben. Wie wir gesehen haben, kann keine Kombination von Eigenschaften dazu benutzt werden, einen Stuhl phänomenologisch zu erfassen – auch dann nicht, wenn wir das Prädikat „zum Sitzen“ hinzufügen. Aber nachdem ein Stuhl einmal als Phänomen sichtbar geworden ist, läßt sich entdecken, daß er aus Holz oder Stahl gemacht ist, und daß diese natürlichen Materialien und ihre kausalen Kräfte das Funktionieren des Stuhls ermöglichen. Am Beispiel einer Lampe läßt sich das noch besser verdeutlichen. Lampen müssen kein bestimmtes Aussehen haben, sie müssen keine bestimmte Form besitzen und müssen auch nicht aus einem bestimmten Material gemacht sein. Es gibt auch keinen spezifischen Zweck, dem eine Lampe dienen muß, um als Lampe zu
86
Hubert L. Dreyfus
funktionieren – sie kann eine Nachttischlampe sein, eine Straßenlaterne, eine Leselampe oder eine Verkehrsampel. Erst nachdem eine Lampe auf der Grundlage ihrer Funktion beschrieben wurde, läßt sich von ihrer Bedeutsamkeit abstrahieren. Die vorhandenen Eigenschaften, die sich dann enthüllen, und die Gesetze der Wissenschaft können dann für die Erklärung, warum eine Lampe Licht macht, benutzt werden. In diesem Sinne hat die Weltlichkeit als Bedeutsamkeit Priorität. „Welt ist selbst nicht ein innerweltlich Seiendes, und doch bestimmt sie dieses Seiende so sehr, daß es nur begegnen und entdecktes Seiendes in seinem Sein nur sich zeigen kann, sofern es Welt ,gibt‘“ (72). Die traditionelle Ontologie hat immer versucht, die Alltagswelt zu verstehen, indem sie auf der Ebene des Vorhandenen etwas gefunden zu haben glaubte, wie Substanz, Sinnesdaten oder Repräsentationen im transzendentalen Bewußtsein, Dinge, von denen angenommen werden konnte, sie seien ohne Bezug auf etwas anderes verständlich. Dann hat sie versucht zu zeigen, wie alles andere als verständlich angesehen werden kann, da es aus diesen selbstgenügsamen Elementen aufgebaut ist. Heidegger hat argumentiert, daß die Elementenontologie zu verarmt beginnt, um Weltlichkeit explizieren zu können. Es gibt keinen Grund zu glauben, daß etwas Vorhandenes Weltlichkeit verständlich machen könnte. (Der einzige Grund, nämlich der Erfolg der Theorie im Rahmen ontischer wissenschaftlicher Erklärungen, ist kein wirklicher, kein gültiger Grund). Die Phänomenologie versucht stattdessen zu zeigen, daß die alltägliche Welt sich so genügt und so selbstverständlich ist, wie die Objekte der Theorie. Sie kann und braucht auch nicht auf der Grundlage von etwas anderem verständlich gemacht zu werden. Sie kann sogar Rechenschaft über die Möglichkeit und den Ort von Theorie abgeben. Die Welt ist dasjenige, was wir direkt verstehen und auf der Grundlage dessen wir sehen, daß und wie Natur, Zeug, Personen usw. zusammenpassen und Sinn ergeben. So sind die Weltlichkeit und das korrelative Seinsverständnis des Daseins die eigentlichen Themen der Ontologie. Die Beschreibung der Welt auf der Grundlage des In-der-Welt-seins des Daseins und die Beschreibung der Seinsarten, wie sie sich aus dem Besorgen des Daseins mit der Welt ergeben, nennt Heidegger Fundamentalontologie. Es handelt sich um die einzige Art von Fundamentalismus, die er verteidigt. Die Art des Verstehens, welche die phänomenologische Untersuchung erreicht, ist nicht die gleiche wie sie die traditionelle Ontologie gesucht hat, nämlich den Aufbau des Ganzen aus Elementen. Aber Heidegger sagt, daß dies die einzige Art philosophischen Verstehens ist, die wir benötigen und zu erreichen hoffen können.
4
In-der-Welt-sein und Weltlichkeit
87
Anstatt die Beweislasten umzukehren – wie in seiner Antwort auf die Erkenntnistheorie – verändert Heidegger die Fragestellung. Auf der Grundlage von Kausalrelationen zwischen Elementen des Vorhandenen kann die Wissenschaft zwar korrekt das Funktionieren des Vorhandenen erklären. Aber dies ist nicht das, was in der Ontologie in Frage steht. Was in Frage steht, ist Verstehen, nicht Erklären – sinnvoll auslegen, wie die Dinge sind, nicht erklären, wie sie arbeiten. Wir verstehen ein Phänomen, wenn wir sehen, wie es zu anderen Phänomenen paßt. Da sich Zuhandenes nicht auf der Basis der Kombination von Vorhandenem verständlich machen läßt, muß man die Frage umdrehen und sehen, ob man dem Vorhandenen nicht beikommt, indem man zeigt, daß das Vorhandene erreicht wird, wenn man teilweise situationelle Aspekte des Unzuhandenen ausläßt. „Natur ist […] ein Grenzfall des Seins von möglichem innerweltlichen Seienden“ (65). Auf diese Weise können wir die drei Arten, auf die Seiendes begegnen kann, interpretieren. Wir können auch sehen, daß das pure Vorhandene, welches die Basis für die traditionelle Ontologie bereitstellt, an sich selbst im ganzen nicht verständlich ist. Es kann nur verstanden werden als eine illegitime Extrapolation einer legitimen Folge von Transformationen des Zuhandenem, bei der das alltägliche Verstehen eine immer geringere Rolle spielt.
Literatur Bobrow, D. G./Winograd, T. 1977: An Overview of KRL, A Knowledge Representation Language, in: Cognitive Science 1 Dreyfus, H. und S. 1987: How to Stop Worrying about the Frame Problem Even Though It’s Computationally Insoluble, in: Zenon W. Polyshyn ed., The Robots Dilemma, Norwood Dreyfus, H. 1988: Husserl’s Epiphenomenology, in H. R. Otto/J. A. Tuedio eds., Perspectives on Mind, Dordrecht Dreyfus, H. 1991: Between Techné and Technology. The Ambiguous Place of Equipment in Being and Time, in: H. Dreyfus/H. Hall eds.: Heidegger: A Critical Reader, Oxford Haugeland, J. 1985: Artificial Intelligence: The very Idea, Cambridge 1985 Husserl, E. 1963: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Den Haag Newell, A./Simon, H. 1981: The Physical Symbol System Hypothesis, in J. Haugeland (Hg.), Mind Design, Cambridge Winograd, T. 1976: Towards a Procedural Understanding of Semantics, in: Revue International de Philosophie (Foundation Universitaire de Belgique), Nr. 117–118 Winograd T. 1984: Computer Software for Working with Language, in: Scientific American, September Winograd, T./Flores, T. 1986: Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design, Norwood (dt.: Erkenntnis Maschinen Verstehen. Zur Neugestaltung von Computersystemen, Berlin 1989)
5 Christoph Demmerling
Hermeneutik der Alltäglichkeit und In-der-Welt-sein (§§ 25–38)
Im Anschluß an seine Descartes-Kritik in Sein und Zeit fragt Heidegger nach dem Wer und nach dem Wie des Daseins. Die „Fundamentalanalyse des Daseins“ (vgl. 41) erhält deutliche Konturen: Mit- und Selbstsein, das ‚Man‘, Befindlichkeit, Verstehen und Sprache, schließlich das Verfallen des Daseins sind die Themen, denen er sich nun zuwendet. Von systematischem Interesse sind seine Überlegungen aus folgenden Gründen: 1.) Sie führen in der Einzelanalyse vor, wie die Philosophie, die von Heidegger als „phänomenologische Ontologie, ausgehend von der Hermeneutik des Daseins“ (38) verstanden wird, ihre Aufgabe verrichtet. So werfen sie Licht auf die Methode, die Heidegger in Sein und Zeit zur Anwendung bringt. 2.) Sie gestatten es, auf einen Vorwurf einzugehen, den man Heidegger bereits unmittelbar nach der Publikation von Sein und Zeit gemacht hat. Immer wieder wurde moniert, daß Heidegger keinen – zumindest keinen positiven – Begriff von der sozialen Verfassung des menschlichen Lebens entwickelt habe, was als systematische Ursache für ein ethisches Defizit seiner Analysen anzusehen sei. 3.) Heideggers Analysen thematisieren die grundlegende Rolle, welche Affekte im menschlichen Leben spielen. Unter dem Titel der Befindlichkeit diskutiert Heidegger die Unhintergehbarkeit von Stimmungen und Affekten und fragt, auf welche Weise diese das Weltverhältnis und -verständnis des Menschen bestimmen. 4.) Das fünfte Kapitel erläutert zwei für Heideggers Denken in Sein und Zeit wesentliche Grundbegriffe, diejenigen des Verstehens und der Auslegung. Beiden Begriffen kommt zwar bereits im hermeneutischen Denken vor Heidegger eine zentrale Rolle zu, bei ihm erhalten sie jedoch eine ganz charakteristische Wendung. Das Verstehen wird zu einem Existenzial und die Auslegung wird zur „Auslegung des Seins des Daseins“ (38). 5.) Die §§ 33 und 34
90
Christoph Demmerling
skizzieren Grundzüge einer hermeneutischen Sprachphilosophie. Mit ihnen sind Gesichtspunkte sprachphilosophischer Reflexion aufgeworfen, die in anderen Traditionen wie z. B. der analytischen Philosophie nur selten Berücksichtigung finden. 6.) Die Analysen zum „Man“ (126 ff.) und zum „Verfallen des Daseins“ (167 ff.) schließlich enthalten ein kulturkritisches Potential, das auf vielfältige Weise gedeutet wurde. Zur Wirkungsgeschichte gehören sowohl „neomarxistische“ Lektüren z. B. im Sinne des Entfremdungstheorems als auch Interpretationen auf dem Hintergrund einer konservativ-dezisionistischen, gelegentlich antidemokratischen Zivilisationskritik. Keine der Deutungen entspricht jedoch Heideggers eigenem Selbstverständnis.
5.1 Philosophie als Hermeneutik des Alltags und die Auslegung des Lebens „Hermeneutik der Alltäglichkeit“ und „hermeneutische Phänomenologie“ sind Wendungen, die zur Charakterisierung von Heideggers philosophischem Selbstverständnis des öfteren gebraucht wurden. Heidegger verwendet den Begriff der Hermeneutik in einem ungewöhnlichen Sinn. In der Tradition hatte der Terminus „Hermeneutik“ allgemein eine Disziplin bezeichnet, die sich Problemen der Auslegung und Deutung von Texten beispielsweise in Theologie und Rechtswissenschaft widmete. Die neuartige Wendung, die Heidegger diesem Begriff gibt, wird in Sein und Zeit das erste Mal in § 7 expliziert: „Phänomenologie des Daseins ist Hermeneutik in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, wonach es das Geschäft der Auslegung bezeichnet“ (37). Und zwar nicht der Auslegung von Texten, sondern der Auslegung des menschlichen Lebens in seiner Alltäglichkeit. Das Motiv, welches hinter Heideggers Erweiterung der Hermeneutik steht, läßt sich in Diltheys Formulierung „Hinter das Leben kann das Denken nicht zurückgehen“ erblicken (vgl. Dilthey 1957, 5), die für Heidegger auf dem Weg zu Sein und Zeit bestimmend werden sollte. Die Ausweitung der Hermeneutik zu einer Analyse des menschlichen Lebens – zu einer „existenzialen Analytik“ – ist der methodisch grundsätzliche Schritt, der unmittelbar mit einer der Kernthesen des Buches von Heidegger verbunden ist. In der Terminologie Heideggers lautet diese These: Dasein ist immer schon in der Welt. Bereits vor jeder theoretischen Besinnung oder expliziten (propositionalen) Vergegenwärtigung dessen, was und wer wir als Menschen sind und was wir tun und verstehen, gelangen wir durch unsere „unmittelbaren“ Lebensvollzüge und auf der Grundlage unserer
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
91
Lebenspraxis zu einem Verständnis unseres Lebens und der Welt. Unseren primären Lebens- und Handlungsvollzügen ist vor allen kognitiven bzw. reflexiven Weltbezügen ein Vorrang zuzuerkennen.1 Mit der Hermeneutik der Alltäglichkeit knüpft Heidegger jedoch nicht nur einfach an verschiedene Motive der Lebensphilosophie und Hermeneutik Diltheyscher Prägung an. Er kann seine Überlegungen gleichzeitig als eine Radikalisierung der Phänomenologie Husserls begreifen und ihnen einen „transzendentalphilosophischen“ Stellenwert zuerkennen.2 Denn sofern „durch die Aufdeckung […] der Grundstrukturen des Daseins überhaupt der Horizont herausgestellt wird für jede weitere ontologische Erforschung […], wird diese Hermeneutik zugleich ,Hermeneutik‘ im Sinne der Ausarbeitung der Bedingungen der Möglichkeit jeder ontologischen Untersuchung“ (37). Mit der Hermeneutik der Alltäglichkeit soll ein in der Philosophie verbreitetes Bild destruiert werden, welches Heidegger zufolge von Descartes bis zur Phänomenologie Husserls reicht. Es geht um die Destruktion der Vorstellung, daß das ursprüngliche Verhältnis des Menschen zur Welt theoretischer Art ist. Heidegger indessen macht deutlich: Theoretische Beschreibungen der Welt oder eines Teils von ihr sind etwas Abgeleitetes, primär hingegen ist der praktische Umgang des Menschen mit der Welt. Weil das so ist, muß die Philosophie zu einer Hermeneutik des Alltags und zu einer Auslegung des menschlichen Lebens werden bzw. mit einer Erfassung alltäglicher Lebensvollzüge beginnen, die vor allen Beschreibungen der Einzelwissenschaften wie z. B. Biologie und Psychologie ansetzt (vgl. § 10) und gleichzeitig viele Ansätze der traditionellen Philosophie desavouiert. In den §§ 25–38 nun finden sich eine Fülle von Einzelanalysen, welche genau dieser Aufgabe nachkommen wollen, indem sie das menschliche Leben in seiner durchschnittlichen (d. h. gewöhnlichen) Alltäglichkeit auf den Begriff zu bringen versuchen. Die erste Frage, die Heidegger in diesem Zusammenhang stellt, lautet: „wer ist es, der in der Alltäglichkeit das Dasein ist“ (114)?
1 Zur strittigen Diskussion des Verhältnisses von Erkennen und Handeln in Sein und Zeit und zu Heideggers gelegentlich mit dem Begriff „Pragmatismus“ bezeichneten Grundauffassung vgl. insbesondere Gethmann 1993 und Prauss 1976. 2 Vgl. dazu Gethmann 1974.
92
Christoph Demmerling
5.2 Dasein, Mitsein, Selbstsein: das geteilte Leben Der § 25 führt zunächst die in § 19 begonnene Kritik an Descartes fort. War dort die cartesianische Vorstellung von der Welt als einer res extensa kritisiert worden, so wird nun der Komplementärbegriff, derjenige vom menschlichen Subjekt als einer res cogitans destruiert. Heidegger richtet sich gegen die Vergegenständlichung des Menschen und seines Lebens, die mit Begriffen wie „Subjekt“ und „Selbst“ einhergeht. „Man mag Seelensubstanz ebenso wie Dinglichkeit des Bewußtseins und Gegenständlichkeit der Person ablehnen, ontologisch bleibt es bei der Ansetzung von etwas, dessen Sein ausdrücklich oder nicht den Sinn von Vorhandenheit behält. […] Dasein ist unausgesprochen im Vorhinein als Vorhandenes begriffen“ (114). Vergegenständlichung, d. h. das zum Ding machen von etwas, was kein Ding ist – seien es Vollzüge, Verhältnisse, oder aber auch der Mensch und sein Leben – ist Heidegger zufolge eine Grundtendenz der neuzeitlichen Philosophie, die einem angemessenen Verständnis des Menschen und seiner Welt entgegensteht.3 Statt von einem unmittelbar gegebenen „Ich“ auszugehen, weist Heidegger auf die unhintergehbar soziale Verfassung des menschlichen Lebens hin: „Die Klärung des In-der-Welt-seins zeigte, daß nicht zunächst ‚ist‘ und auch nie gegeben ist ein bloßes Subjekt ohne Welt. Und so ist am Ende ebensowenig zunächst ein isoliertes Ich gegeben ohne die Anderen“ (116). Der erste Schritt der Kritik an Descartes hatte darin bestanden, die dualistische Vorstellung zu unterlaufen, derzufolge der Mensch als Subjekt der Erkenntnis der Welt als Objekt der Erkenntnis gegenübersteht. Der zweite Schritt besteht nun darin, die Vorstellung von einem einzelnen, sich unmittelbar gegebenen und sich selbst transparenten Subjekt zu destruieren. Heideggers Ausführungen lassen sich auf verschiedene systematische Diskussionskontexte beziehen: Sie lassen sich im Sinne einer Kritik an der erkenntnistheoretischen Privilegierung des Subjekts oder des Selbst verstehen, wie sie beispielsweise mit unterschiedlichen Argumenten auch in der sprachanalytischen Philosophie Wittgensteins und Ryles formuliert wurde (a); sie können auch im Sinne der Auffassung verstanden werden, daß unsere Vorstellungen von uns selbst und von der
3 Der vergegenständlichungskritische Zug, der für Heideggers Destruktion der Vorhandenheitsontologie insgesamt charakteristisch ist, hat dazu geführt, Sein und Zeit als Gegenentwurf zu den Verdinglichungsanalysen, die Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewußtsein durchführt, zu betrachten: vgl. dazu Goldmann 1975.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
93
Welt immer schon durch die historischen und sozialen Kontexte, in denen wir stehen, vorgeformt sind (b); schließlich können sie – ganz gleich, welche der Lesarten man favorisiert – auf ihre ethischen und sozialphilosophischen Implikationen zumindest befragt werden (c). (a) Die Geschichte der Philosophie der Neuzeit ist vor allem eine Geschichte des Subjekts gewesen. In der gesamten Tradition der später „Erkenntnistheorie“ genannten Disziplin wurde mehr oder weniger davon ausgegangen, daß das Wissen, welches das einzelne Subjekt von sich selbst hat (z. B. von den „Inhalten“ des eigenen Geistes wie Gedanken, Gefühlen oder Empfindungen) unmittelbar gewiß ist, daß es nicht bezweifelt werden kann und daß der jeweils Einzelne einen privilegierten Zugang zu diesem Wissen hat. Dieses Wissen, so dachte man, sei das unerschütterliche Fundament unseres nur mittelbaren Wissens von der Außenwelt und vom sog. „Fremdpsychischen“, also den geistigen Zuständen anderer Subjekte. Die geistige Innenwelt der Subjekte – ihr Bewußtsein – nimmt in diesem Zusammenhang einen erkenntnistheoretischen Vorrang ein und gilt als ein Gegenstandsgebiet eigenen Rechts. Auch wenn es der philosophiehistorischen Nahbetrachtung nicht gänzlich standhält, wird man sagen können, daß Descartes für die Grundlinien dieser Vorstellung zumindest nicht unverantwortlich ist. Ähnlich wie die Überlegungen von Gilbert Ryle, der sich mit seiner Rede von einem „Dogma vom Gespenst in der Maschine“ (vgl. Ryle 1969, 13) gegen Descartes und die Vorstellung von einer subjektiven Innenwelt richtet, ähnlich wie die Analysen Wittgensteins, dessen Ausführungen zur Philosophie der Psychologie immer wieder auf die Begrenztheit der Descartschen „Innen-Außen“-Vorstellung hinweisen und unsere semantische Bezugnahme auf die Innenwelt problematisieren, läßt sich auch Heideggers Beitrag zum „Mitdasein der Anderen“ (117 ff.) im Sinne einer Korrektur des die neuzeitliche Philosophie dominierenden Vorrangs der als Bewußtsein mit privilegiertem Zugang zu den eigenen Zuständen angesehenen Subjektivität verstehen. So, wenn er schreibt: „Im Sein mit und zu Anderen liegt demnach ein Seinsverhältnis von Dasein zu Dasein. Dieses Verhältnis, möchte man sagen, ist aber doch schon konstitutiv für das je eigene Dasein […]“ (124).4 Ebensowenig wie wir uns Heidegger zufolge fragen müssen, wie wir vom Denken und Sprechen aus zur Welt kommen, da wir immer schon in der Welt sind und mit ihr zu tun
4 Vgl. zu dieser Deutung Heideggers im Kontext von Ansätzen der analytischen Philosophie Dreyfus 1991, 141 ff.; ferner: Rentsch 1985.
94
Christoph Demmerling
haben, müssen wir uns fragen, wie wir zum Anderen kommen und diesen erkennen können, da das Verhältnis zu Anderen dem Selbstverhältnis vorhergeht. Strenggenommen läßt sich schon zwischen dem ursprünglichen Weltbezug und dem Verhältnis zu Anderen gar nicht trennen. Denn der Andere begegnet bereits in den als „Zeug“ (vgl. 68 ff.) gebrauchten Gegenständen. „Die ‚Beschreibung‘ der nächsten Umwelt, zum Beispiel der Werkwelt des Handwerkers, ergab, daß mit dem in Arbeit befindlichen Zeug die anderen ‚mitbegegnen‘, für die das ‚Werk‘ bestimmt ist“ (117). Das Haus, das gebaut worden ist, verweist auf diejenigen, die in ihm wohnen; die Kleidung, die angefertigt wird, auf denjenigen, der sie trägt usw. Gestützt wird die Interpretation, daß Heidegger mit seinen Überlegungen zum Mitdasein seine Kritik an der Erkenntnistheorie fortführen und vertiefen möchte, auch dadurch, daß die Rede vom „Mitdasein“ sich keineswegs lediglich auf den faktischen Umstand bezieht, daß wir zufälligerweise immer oder doch zumindest meistens mit anderen zu tun haben. „Auch das Alleinsein des Daseins ist Mitsein in der Welt“ (120) stellt Heidegger fest. Ohne Fremdbezug kein Selbstbezug, dies gilt ganz unabhängig davon, welche konkrete Gestalt die Beziehungen zu anderen Menschen jeweils annehmen. (b) Daß wir uns nicht unmittelbar gegeben sind, sondern unser Verhältnis zu anderen dem Selbstverhältnis vorgelagert ist, läßt sich auch im Sinne der These von der historischen und sozialen Vorgeformtheit aller Vorstellungen, die wir uns von uns und von der Welt machen, verstehen, zumal dann, wenn man an Heideggers Ausführungen zur „Geschichtlichkeit des Daseins“ denkt (vgl. 382 ff.), die erst im zweiten Abschnitt von Sein und Zeit entfaltet werden. Vor Augen führen mag man sich auch die in Heideggers späteren Werken entwickelte Konzeption eines dem Menschen vorgeordneten „Geschicks“ sowie die Rezeption und Umdeutung der Philosophie Heideggers durch die philosophische Hermeneutik Gadamers. Im Kontext des vierten Kapitels wird diese Lesart durch die Analysen des § 27 nahegelegt, in welchem Heidegger die Frage nach dem Wer des Daseins mit dem Hinweis auf „das Man“ (vgl. 126) beantwortet. Bereits im Rahmen unserer scheinbar intimsten Regungen und Selbstbeschreibungen orientieren wir uns an historisch und sozial vorgegebenen Deutungsmustern, die als solche gar nicht Ergebnis unserer eigenen „Natur“ oder unserer eigenen Überlegungen sind, sondern die wir unweigerlich aus dem Bestand der Überlieferung und Tradition der Gesellschaft oder Gemeinschaft, deren Mitglieder wir jeweils sind, entnehmen. Es ist die eigene Tradition, die eigene kulturelle Gemeinschaft, welche unsere Denk-, Handlungs- und
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
95
Lebensmöglichkeiten bestimmt und begrenzt. Heidegger bringt dies auf den drastischen Ausdruck einer „Diktatur des Man“ (vgl. 126) und schreibt: „Wir genießen und vergnügen, wie man genießt; wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt; wir ziehen uns aber auch vom ‚großen Haufen‘ zurück, wie man sich zurückzieht; wir finden ‚empörend‘, was man empörend findet. Das Man, das kein bestimmtes ist und das Alle, obzwar nicht als Summe, sind, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor“ (126 ff.). Wie sehr unser Verständnis von Situationen, Handlungen, Personen durch die Tradition geprägt ist, wird insbesondere dort deutlich, wo es sich um Phänomene handelt, die scheinbar ein besonderes Maß der Vertrautheit mit sich oder mit anderen voraussetzen. So neigen beispielsweise Menschen mit einem gewissen Bildungsstandard in den westlichen (individualistisch geprägten) Industrienationen dazu, sich und ihre persönliche Welt im Alltag mit Hilfe einer psychologischen und mikrosoziologischen Begrifflichkeit zu beschreiben. Es ist davon die Rede, jemand habe dieses oder jenes „verdrängt“, komme mit seiner „Rolle“ als Vater nicht klar, „identifiziere“ sich zu sehr mit den „Normen der Gesellschaft“ usw. Oft werden solche und ähnliche Wendungen gar nicht mehr als solche erkannt, die sich einem bestimmten Theoriebestand, der zu unserer Kultur und Geschichte gehört (hier: Psychoanalyse und Soziologie), verdanken, sondern für eine unmittelbare Beschreibung der jeweils relevanten Belange gehalten. (Heidegger: „Je offensichtlicher sich das Man gebärdet, um so unfaßlicher und versteckter ist es […]“ (128)).5 Obwohl Heidegger in diesem Zusammenhang durch seine mitunter pejorative Rhetorik und eigenwillige Wortwahl suggeriert, das alltägliche Sein des Daseins als Man sei eine im normativen Sinne „mindere“ Form der Existenz und „von dem eigentlichen, das heißt eigens ergriffenen Selbst“ (129) zu unterscheiden, macht er andererseits expressis verbis immer wieder darauf aufmerksam, es gehe ihm nicht um eine „Herabminderung der Faktizität des Daseins“ (128). Im Gegenteil: das Man gehöre „zur positiven Verfassung des Daseins“ (129) und sei vor allem auch in seiner den Einzelnen entlastenden Funktion zu würdigen (vgl. 127 ff.). Heideggers Selbstauskünfte stehen hier im Widerspruch zu seiner Rhetorik. So kann es nicht überraschen, daß gerade die Analysen zum Mitdasein in Verbindung mit dem Vokabular des Verfallens einen Anknüpfungspunkt für eine existenzia-
5 Michel Foucaults vieldiskutierte Analysen zur diskursiven Strukturierung und historischen Prägung selbst scheinbar unmittelbarer Erfahrungen knüpfen hier an Heidegger an; zu Heidegger und Foucault vgl. Schäfer 1995, v. a. 51 ff.
96
Christoph Demmerling
listische Ethik der Authentizität abgeben konnten, wie sie sich etwa im Werk J.-P. Sartres skizziert findet, auch wenn Heidegger solchen Deutungen oft widersprochen hat.6 (c) Trotz seiner eingehenden Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Mitdaseins hat man Heidegger immer wieder vorgeworfen, daß es ihm nicht gelungen sei, einen adäquaten Begriff von der sozialen Verfassung des menschlichen Lebens zu entwickeln.7 Das Mitsein trete stets in der pejorativen Form uneigentlicher Existenz in Erscheinung und deshalb sei in seinem Denken kein Platz für ethische und sozialphilosophische Überlegungen.8 Nun ist es richtig, daß sich Heidegger wiederholt gegen das Ansinnen, aus seinen Schriften eine Ethik herauszulesen, gewehrt hat; richtig ist auch, daß ihm der Gedanke, eine Ethik zu schreiben, fremd war. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang insbesondere an seinen Brief über den Humanismus. Gleichwohl mangelt es nicht an Versuchen, die in Sein und Zeit entwickelte Hermeneutik der Alltäglichkeit und einige ihrer Elemente für die Ethik fruchtbar zu machen.9 Von besonderem Interesse dürften in diesem Zusammenhang die Ausführungen zur Fürsorge im § 26 sein (vgl. 121 ff.), zumal dieser Begriff in der neueren Ethikdebatte als „Anderes der Gerechtigkeit“ einen zentralen Stellenwert einnimmt.10 Nachdem Heidegger bereits im § 12 das „Besorgen“ als charakteristische Seinsart des Daseins als In-der-Welt-sein aufgewiesen hatte (vgl. 57), kann man seine Überlegungen zur Fürsorge als ein weiteres Präludium zur Sorgethematik auffassen, die dann ausführlich im Kapitel sechs des ersten Abschnitts von Sein und Zeit behandelt wird. „Fürsorge“ ist der Name für die charakteristische Gestalt, welche die
6 Zu einer im starken Sinne normativen Deutung von Heideggers Analyse des Man vgl. auch Tugendhat 1979, 230 ff.; Dreyfus 1991, 154 ff. schlägt vor, Heideggers Überlegungen im Sinne eines Vorschlags zur Differenzierung zwischen der positiven (entlastenden) und negativen (entfremdenden) Funktion des Man zu verstehen. 7 Luckner 1997, 54 verwendet deshalb zur Charakterisierung von Heideggers Analysen im Anschluß an Eugen Fink den phänomenologischen Begriff der Koexistenz, da „Mitsein“ und „Mitdasein“ Momente des je einzelnen Daseins seien, konkrete Verhältnisse zu Anderen damit jedoch noch nicht anvisiert seien. Die Koexistenz in diesem Sinn müsse man dann strikt von der „Intersubjektivität“ und wohl auch von der „Sozialität“ unterscheiden. 8 Vgl. zu diesem Vorwurf u. a. Löwith 1928, Lévinas 1961 und Theunissen 1977; Rentsch 1989, 157 sieht in einer mangelnden Reflexion auf Ethik, Politik und Ökonomie die entscheidenden Defizite von Sein und Zeit, die möglicherweise das Einfallstor für Heideggers nationalsozialistisches Engagement dargestellt haben. 9 Vgl. dazu auch Luckner (in diesem Band); ferner: Gadamer 1987, Grondin 1994, Schürman 1990 sowie Vogel 1994. 10 Vgl. dazu u. a. den Sammelband Nagl-Docekal/Pauer-Studer 1993, v. a. die Einleitung 19 ff.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
97
Sorge im Kontext des Mitseins annimmt. Wer an dieser Stelle nun allerdings eine breite Schilderung positiver Weisen des Bezogenseins auf Andere erwartet, der wird enttäuscht werden. Heidegger verwendet den Terminus „Fürsorge“ zunächst ganz neutral; auch indifferente Formen der Begegnung wie das „Aneinandervorbeigehen“ und „Einander-nichts-angehen“ (vgl. 121) fallen in seinen Analysen unter diesen Begriff. Dennoch stellen seine Ausführungen zumindest einen Ausgangspunkt für ethische und sozialphilosophische Überlegungen dar. Heidegger unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Weisen der Fürsorge: der „einspringend-beherrschenden“ und der „vorspringend-befreienden“ Fürsorge (vgl. 122). Erstere ist durch eine paternalistische Tendenz gekennzeichnet, die dem Anderen seine Aufgaben abnimmt und ihn zu einem Klienten degradiert, dem die Wahrnehmung eigener Lebensmöglichkeiten mitunter verwehrt wird. Sensibel für die Machtverhältnisse und Asymmetrien, die dieser Art der Fürsorge innewohnen können, bemerkt Heidegger: „In solcher Fürsorge kann der Andere zum Abhängigen und Beherrschten werden, mag diese Herrschaft auch eine stillschweigende sein und dem Beherrschten verborgen bleiben“ (122). Die „vorspringend-befreiende“ Fürsorge hingegen läßt sich eher als eine Hilfe zur Selbsthilfe begreifen; sie „verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden“ (122). Sie anerkennt den Anderen in seiner Andersheit und versucht allenfalls, ihm mit seinen jeweils eigenen Anliegen auf den Weg zu helfen. Zieht man überdies auch noch Heideggers Charakterisierung der Fürsorge durch die Begriffe der „Rücksicht“ und der „Nachsicht“ (123) in Betracht, ist zumindest eine Möglichkeit geschaffen, mit einer Ethik der Differenz und traditionellen Begriffen aus der ethischen und sozialphilosophischen Diskussion wie „Achtung“ und „Anerkennung“ an Heidegger anzuschließen. Spätere Arbeiten Heideggers – erinnert sei vor allem an das erste seiner Feldweg-Gespräche (1944/45), welches sich u. a. der Thematik der Gelassenheit widmet – greifen solche Überlegungen auf. Heidegger entwickelt hier in der unbegrifflichen Sprache seiner späteren Werke die Vorstellung von einer „Gegnet“ als einer „verweilenden Weite“, in der „das Offene gehalten und angehalten ist, Jegliches aufgehen zu lassen in seinem Beruhen“ (GA 77, 114). Ein Aspekt dieser Überlegungen zur Gelassenheit besteht darin, gegenüber Menschen und Dingen eine Perspektive radikaler Freisetzung und des Gewährenlassens einzunehmen; eine Perspektive, die in Sein und Zeit im Zusammenhang mit der „vorspringend-befreienden Fürsorge“ bereits anklingt. In den §§ 28 ff. verläßt Heidegger zunächst die Thematik des Mitseins und konfrontiert sich mit der Aufgabe, die von ihm sogenannte „Erschlos-
98
Christoph Demmerling
senheit des Daseins“ (vgl. 133) zu charakterisieren. Mit dem Begriff der Erschlossenheit wird auf einen Umstand verwiesen, der bereits bei der Einführung des Wortes „Dasein“ in § 2 anklang und der als Grundgedanke und Leitmotiv der „Fundamentalontologie“ gelten kann: Als Dasein wollte Heidegger dasjenige Seiende bezeichnen, welches als solches schon bestimmte Verständnisse des Seins der Dinge, aber auch seiner selbst besitzt und sich diese auch vor Augen führen, sie mehr oder weniger „durchsichtig“ machen und „beleuchten“ kann. Der Mensch erhält (als Dasein) gerade deshalb einen zentralen Stellenwert im Rahmen von Heideggers Fundamentalontologie, da er sich seiner selbst und der Welt gewahr ist. Gerade deshalb glaubt Heidegger auf seine Grundfrage nach dem Sinn von Sein (vgl. §§ 1–4) mit einer existenzialen Analytik antworten zu können. Gewahrsein darf in diesem Zusammenhang jedoch nicht bereits im Sinn expliziter und propositionaler Kenntnis seiner selbst und der Welt verstanden werden. Gedacht ist vielmehr auch an die diffusen, oft präreflexiven Vorverständnisse unserer selbst und der Welt, innerhalb derer wir uns meistenteils bewegen. Heidegger konstatiert: „Erschlossenheit besagt nicht, als solches erkannt“ (134). „Befindlichkeit“ und „Verstehen“ lauten im folgenden die Begriffe, die Heidegger gebraucht, um gleichursprüngliche Formen der Erschlossenheit zu bezeichnen. Im § 34 schließlich tritt als weiteres Moment die „Rede“ hinzu; durch sie artikulieren sich Befindlichkeit und Verstehen.
5.3 Befindlichkeit, Stimmung, Furcht: das affizierte Leben „Was wir ontologisch mit dem Titel Befindlichkeit anzeigen, ist ontisch das Bekannteste und Alltäglichste: die Stimmung, das Gestimmtsein“ (134). Mit der Rede von der Befindlichkeit als einem Existenzial des Daseins wird der Umstand hervorgehoben, daß der Mensch, sofern er überhaupt nur „da“ ist, gar nicht umhin kommt, immer schon gestimmt zu sein. Stimmungen begleiten unser Selbst- und Weltverhältnis immer und überall. Es wäre ein Mißverständnis, würde man die Triftigkeit der These Heideggers mit dem Hinweis in Zweifel ziehen wollen, es sei auch möglich, unbeteiligt und gleichgültig zu sein bzw. lediglich mit kaltem Verstand in die Welt zu blicken. Auch die Indifferenz – „die oft anhaltende, ebenmäßige und fahle Ungestimmtheit“ wie Heidegger sie nennt (134) – ist eine Stimmung und läßt sich nicht als ein Indiz für die Möglichkeit des Nicht-Gestimmtseins anführen. Mehr noch: die „fahle
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
99
Ungestimmtheit“ ist nicht einfach nur eine Stimmung unter anderen; im Rahmen der Befindlichkeitsanalysen Heideggers nimmt sie scheinbar sogar einen ganz besonderen Stellenwert ein. „Die […] fahle Ungestimmtheit, […], ist so wenig nichts, daß gerade in ihr das Dasein ihm selbst überdrüssig wird. Das Sein des Da ist in solcher Verstimmung als Last offenbar geworden“ (134). In der Ungestimmtheit und Indifferenz offenbart sich der „Lastcharakter des Daseins“ (vgl. 135). Heideggers Überlegungen erwecken zunächst den Eindruck, als sei gerade die „fahle Ungestimmtheit“ eine ausgezeichnete Stimmung, da sie dem Dasein sein „nacktes ‚Daß es ist und zu sein hat‘“ (134) vor Augen führe. Im Fortgang des Textes wird jedoch deutlich, daß er nicht nur die Ungestimmtheit als Stimmung begreift, die dem Dasein das Dasein als „Last“ offenbart, sondern daß dies für alle Stimmungen, auch für die gehobenen (vgl. 134), gelten soll.11 Ein Grund für Heideggers Tendenz, Stimmungen im allgemeinen mit dem „Lastcharakter“ des Daseins in Verbindung zu bringen, ist wohl darin zu sehen, daß wir durch Stimmungen von etwas betroffen werden und uns in ihnen als passiv erfahren. Dies gilt auch dann, wenn wir uns gegen unsere Stimmungen auflehnen, sie „mit Wissen und Willen“ (vgl. 136) zu beherrschen versuchen: „Die Befindlichkeit erschließt das Dasein in seiner Geworfenheit und zunächst und zumeist in der Weise der ausweichenden Abkehr“ (136). Daß wir sind und zu sein haben (vgl. 134), so lautet die Formulierung, mit der Heidegger die Faktizität und Geworfenheit unseres Lebens akzentuiert. Auch wenn wir in unserem Leben vieles verändern können – Wohnorte, Berufe, Partner, Freunde und Lebensstile lassen sich austauschen –, können wir uns der Tatsache, daß wir leben müssen und diesem Leben eine bestimmte Gestalt verleihen müssen, nicht entziehen. Bei allen Veränderungsmöglichkeiten sind es am Ende doch immer wir, die unser Leben zu leben haben. Selbst der Entschluß gegen das Leben und der Freitod sind im Sinne der Analysen Heideggers auch nur bestimmte, vorgegebene Lebensmöglichkeiten, die nichts an dem Umstand ändern, daß wir „irgendwelche“ Möglichkeiten unausweichlich ergreifen müssen. Heideggers Analysen zur Befindlichkeit enthalten einen weiteren Aspekt: Daß wir von etwas in der Welt betroffen werden können, offenbart nicht nur den Lastcharakter des Daseins, sondern stellt gleichzeitig eine Möglichkeitsbedingung des Besorgens dar; die Befindlichkeit kann somit als tragender Grund unseres primär praktischen Selbst- und Weltverhältnisses an11 Eine detaillierte und umfassende Analyse der Befindlichkeitsthematik, welche die Brüche im Gedankengang Heideggers im einzelnen nachzeichnet findet sich bei Pocai 1996, v. a. 36–65.
100
Christoph Demmerling
gesehen werden. Sie liegt noch der zunächst kognitiv verstanden Intentionalität Husserls zugrunde, indem sie „die Weltoffenheit des Daseins“ „existenzial konstituiert“ (vgl. 137). Weiter heißt es: „In der Befindlichkeit liegt existenzial eine erschließende Angewiesenheit auf Welt, aus der her Angehendes begegnen kann“ (137 f.). Würde man den Stellenwert der Befindlichkeit als Existenzial des Daseins verkennen und Stimmungen als existenzielle Phänomene des menschlichen Lebens nicht berücksichtigen, entfiele im Grunde das sachliche Motiv für die „Überwindung der erkenntnistheoretischen Fragestellung“ (vgl. Gadamer 1986, 246), die mit dem gesamten Komplex der Überlegungen zum In-der-Welt-sein ausgeführt werden soll. Das mit dem Titel „Befindlichkeit“ angesprochene Strukturmoment des Daseins muß offensichtlich als das wesentliche Motiv dafür gelten, warum Heidegger das Weltverhältnis des Menschen zunächst als ein praktisches begreift. „Gerade im unsteten, stimmungsmäßig flackernden Sehen der ‚Welt‘ zeigt sich das Zuhandene in seiner spezifischen Weltlichkeit, die an keinem Tag dieselbe ist. Theoretisches Hinsehen hat immer schon die Welt auf die Einförmigkeit des puren Vorhandenen abgeblendet […]“ (138). Wir sind immer schon in einer jeweils spezifischen Weise gestimmt, wir erfahren uns in den Stimmungen als passiv und die Passivität des Betroffenwerdens von etwas liegt unseren praktisch-tätigen Lebensvollzügen zugrunde – so lassen sich die Überlegungen Heideggers resümieren. Stimmungen sind unhintergehbar, durch Stimmungen sehen wir die Welt und uns selbst und Stimmungen sind schließlich Möglichkeitsbedingungen unserer Handlungs- und Lebensvollzüge. Die Analysen Heideggers bilden eine systematische Anschlußmöglichkeit für eine philosophische Reflexion auf Gefühle, die vor allem den Umstand akzentuiert, daß solche Phänomene nicht einfach als das Andere der Vernunft begriffen werden können, sondern ihnen eine eigene „Umsicht“ eignet (vgl. 137), durch die wir uns auf uns selbst, auf andere und auf die Welt beziehen. Im folgenden § 30 führt Heidegger eine konkrete Befindlichkeitsanalyse am Beispiel der Furcht durch. Im Unterschied zur Angst, die später im § 40 als „ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins“ ausführlich betrachtet wird und auch in den Todes- und Gewissensanalysen des zweiten Abschnitts von Sein und Zeit einen zentralen Stellenwert einnimmt, bestimmt Heidegger die Furcht als einen gerichteten Modus der Befindlichkeit. Eine wesentliche Hinsicht der Furcht sei neben dem „Fürchten selbst“ und dem „Worum der Furcht“ das „Wovor der Furcht“ (vgl. 140). Man fürchtet sich nicht einfach ohne Anlaß und Grund. Man fürchtet sich vor dem Gewitter, vor dem Examen oder vor dem Hund des Nachbarn. Furcht
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
101
ist etwas Intentionales, fürchtend sind wir auf ein „Objekt“ in der Welt bezogen. Der Begriff der Intentionalität verweist, zumal in der phänomenologischen Tradition, auf den grundsätzlichen Umstand der Gerichtetheit psychischer bzw. mentaler Zustände auf Sachverhalte. Seit F. Brentano gilt die Intentionalität vielfach als das wesentliche Kriterium zur Unterscheidung zwischen physischen und psychischen bzw. mentalen Zuständen. Daß Heidegger nicht nur gänzlich propositional strukturierten Gebilden wie Gedanken, sondern auch Gefühlen Intentionalität zuerkennt, kann daher als ein weiteres Indiz für die Auffassung gelten, daß solche Phänomene auf basale Weise für unser Selbst- und Weltverhältnis bestimmend sind.12 In Anlehnung an die Terminologie Heideggers läßt sich formulieren, daß durch Stimmungen und Gefühle Welt erschlossen werden kann, da sie von vornherein auf Welt bzw. etwas in der Welt gerichtet sind und es sich nicht lediglich um „private“ Zustände in der Innenwelt von Subjekten handelt.
5.4 Verstehen und Auslegung: das entwerfende Leben Gegenüber der Rede von der Geworfenheit des Daseins, die im Zusammenhang mit der Befindlichkeitsthematik leitend war und sich u. a. mit Hinweisen auf existenzielle Erfahrungen wie Machtlosigkeit oder Ohnmacht erläutern läßt, betont Heidegger im § 32 im Zusammenhang mit seiner Analyse des Verstehens den Entwurfs- und Möglichkeitscharakter des Daseins. Bereits der erste Satz des Paragraphen macht dies unmißverständlich deutlich: „Das Dasein entwirft als Verstehen sein Sein auf Möglichkeiten“ (148). Dasein wird in diesem Kontext in erster Linie als Möglichsein aufgefaßt: „Wir gebrauchen zuweilen in ontischer Rede den Ausdruck ‚etwas verstehen‘ in der Bedeutung von ‚einer Sache vorstehen können‘, ‚ihr gewachsen sein‘, ‚etwas können‘. Das im Verstehen als Existenzial Gekonnte ist kein Was, sondern das Sein als Existieren. Im Ver12 In der neueren Diskussion werden Stimmungen und Affekte bzw. Gefühle allerdings oft im Anschluß an Heidegger unterschieden: während letztere als intentional gelten, gelten erstere als richtungslos; vgl. z. B. Bollnow 1956, 34 ff., Tugendhat 1979, u. a. 205 und Wolf 1999, 160 ff. Erweitert man jedoch den Begriff der Intentionalität und läßt auch unspezifische Formen von Gerichtetheit als solche gelten, dann können Stimmungen wie auch Gefühle als etwas Gerichtetes verstanden werden. Gefühle wären dann in einer spezifischen Weise auf einen konkreten Sachverhalt oder ein bestimmtes Objekt gerichtet, während Stimmungen als etwas begriffen werden können, was in unspezifischer Form auf die Welt oder das Leben im ganzen gerichtet ist.
102
Christoph Demmerling
stehen liegt existenzial die Seinsart des Daseins als Sein-können. Dasein ist nicht ein Vorhandenes, das als Zugabe noch besitzt, etwas zu können, sondern es ist primär Möglichsein“ (143). An dieser Stelle nimmt Heidegger eine sehr weitreichende Ausweitung des Verstehensbegriffs vor, die es bei der Lektüre seines gesamten Buches zu berücksichtigen gilt. Anders als im Rahmen der Hermeneutik Diltheys oder auch im Kontext der wissenschaftsphilosophischen Überlegungen im Neukantianismus Windelbands oder Rickerts, bezeichnet der Begriff des Verstehens keinen besonderen Erkenntnismodus der geisteswissenschaftlichen Fächer, durch den sich diese von den erklärenden Naturwissenschaften unterscheiden, sondern Heidegger bringt seinen existenzialen Begriff des Verstehens von vornherein mit Aspekten des Könnens und schließlich des Möglichseins in Verbindung. Sich auf einen Hammer, auf das Radfahren oder Zigarettendrehen verstehen, heißt mit den fraglichen Dingen umgehen zu können; es heißt auch, um die Möglichkeiten zu wissen, die uns der Hammer, das Rad, Tabak und Zigarettenpapier bieten. Heidegger schreibt: „Das Verstehen betrifft als Erschließen immer die ganze Grundverfassung des In-derWelt-seins. […] Das Zuhandene ist als solches entdeckt in seiner Dienlichkeit, Verwendbarkeit und Abträglichkeit. Die Bewandtnisganzheit enthüllt sich als das kategoriale Ganze einer Möglichkeit des Zusammenhangs von Zuhandenem. Aber auch die ‚Einheit‘ des mannigfaltigen Vorhandenen, die Natur, wird nur entdeckbar auf dem Grunde der Erschlossenheit einer Möglichkeit ihrer“ (144 f.). Während im Zusammenhang mit der Befindlichkeit die Geworfenheit des Daseins in den Vordergrund rückte, ist es im Kontext des Verstehens der Entwurfscharakter des Daseins, der beleuchtet werden soll. Wie sind diese Ausführungen Heideggers zu verstehen? Wie läßt sich die Verschränkung von Geworfenheit und Entwurf, von Ohnmacht und Macht, von Passivität und Aktivität, von Affektion und Konstitution erläutern?13 Bereits im Zusammenhang mit Heideggers Kritik an Descartes ist deutlich geworden, daß das Weltverhältnis des Menschen zunächst einmal praktischer Art ist. Es ist genau dieser Gedanke, den Heidegger aufgreift, wenn er vom Verstehen sagt: „Es entwirft das Sein des Daseins auf sein Worumwillen ebenso ursprünglich wie auf die Bedeutsamkeit als die Weltlichkeit seiner jeweiligen Welt. Der Entwurfscharakter des Verstehens
13 Angesichts der von Heidegger immer wieder akzentuierten Gleichursprünglichkeit von Befindlichkeit und Verstehen sowie der Verschränkung von Geworfenheit und Entwurf spricht Pocai 1996, 27 ff. von einer „grundlegende[n] konzeptuelle[n] Spannung“ in Sein und Zeit.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
103
konstituiert das In-der-Welt-sein hinsichtlich der Erschlossenheit seines Da als Da eines Seinkönnens. Der Entwurf ist die existenziale Seinsverfassung des Spielraums des faktischen Seinkönnens. Und als geworfenes ist das Dasein in diese Seinsart des Entwerfens geworfen. Das Entwerfen hat nichts zu tun mit einem Sichverhalten zu einem ausgedachten Plan, gemäß dem das Dasein sein Sein einrichtet, sondern als Dasein hat es sich je schon entworfen und ist, solange es ist, entwerfend“ (145). Mit der Rede vom „Entwurfscharakter des Verstehens“ und vom Dasein als Entwurf ist eine praktisch-pragmatische Umdeutung der transzendentalphilosophischen Konstitutionsanalysen Kants verbunden. Bei Heidegger ist die (Welt-) Konstitution etwas, was das Dasein praktisch vollzieht. Deshalb notierte er 1927 in einem Brief an Husserl: „Die transzendentale Konstitution ist eine zentrale Möglichkeit der Existenz des faktischen Selbst. Dieses, der konkrete Mensch ist als solcher – als Seiendes nie eine ‚weltlich reale Tatsache‘, weil der Mensch nie nur vorhanden ist, sondern existiert. Und das ‚Wundersame‘ liegt darin, daß die Existenzverfassung des Daseins die transzendentale Konstitution alles Positiven ermöglicht […]“.14 Die Betonung des Entwurfscharakters, die sich in unmittelbarer Folge der Befindlichkeitsanalyse insofern eigenartig ausnimmt, als daß mit den vorhergehenden Analysen ja gerade der Umstand der Geworfenheit des Daseins akzentuiert wurde, ergibt trotz aller Spannungen, die Heidegger sich an dieser Stelle einhandelt, einen Sinn, da er sich darum bemüht, das Verhältnis von Passivität und Aktivität, von Rezeptivität und Spontaneität, fundamentalontologisch zu reformulieren. Man hat sein Subjektverständnis daher als „responsorisch“ bezeichnet. Heidegger mache darauf aufmerksam, daß das Dasein die Konstitution nicht als autonomes Subjekt leiste, gleichwohl aber im Entwurf vollziehe bzw. nachvollziehe.15 Ob dies ein systematisch aussichtsreicher Weg ist, kann an dieser Stelle nicht ausführlich diskutiert werden. Heideggers spätere Entwicklung und sein Konzept einer Seinsgeschichte deuten allerdings eher darauf hin, daß mit der Ausweitung des Verstehensbegriffs die Grundlagen transzendentalphilosophischen Denkens und die Vorstellung von einem seiner selbst mächtigen Subjekt verlassen werden. Streng betrachtet hätte er bereits 1927 nicht mehr vom Entwurfscharakter sprechen dürfen und auch auf den mißverständlichen Begriff der Konstitution verzichten müssen. Die „Konstitution“ ist nämlich keine „Tat“ mehr oder ein „Machen“, sondern letztlich ein vorgegebener Vollzug. Deshalb wird die Konstitution in seinen späteren 14 Heidegger 1927. 15 Vgl. dazu die Analysen von Gethmann 1974, 80.
104
Christoph Demmerling
Arbeiten zum Geschick. Die Kontinuität zwischen der Fundamentalontologie und Heideggers späterem Denken ist weitaus größer, als in der Forschung vielfach angenommen wurde. Im Anschluß an eine Unterscheidung zwischen eigentlichem Verstehen (das Dasein versteht sich „aus dem eigenen Selbst“ (146)) und uneigentlichem Verstehen (das Dasein versteht sich „aus seiner Welt“ (146)), differenziert Heidegger drei Sichtweisen, die mit dem Entwurfscharakter des Daseins als Verstehen zusammenhängen: Umsicht, Rücksicht und Durchsichtigkeit (vgl. 146). In der Umsicht richtet sich das Dasein auf Gegenstände und Dinge in seiner Umwelt (Hammer, Rad, Tabak, Zigarettenpapier); in der Rücksicht wendet es sich an den bzw. die Anderen; Durchsichtigkeit schließlich ist Heideggers Terminus für den Bezug des Daseins auf sich selbst. Das Verstehen im Sinne Heideggers ist freilich nicht unbedingt ein explizites Verstehen. „Der Entwurfscharakter des Verstehens besagt ferner, daß dieses das, woraufhin es entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfaßt“ (145). Das thematische oder explizite Verstehen bezeichnet Heidegger als „Auslegung“. Dieser Begriff steht im Zentrum des nun folgenden § 32. Erneut benutzt er einen Terminus, der in der Tradition des hermeneutischen Denkens vorrangig im Sinne von explicatio, interpretatio und Exegese gebraucht worden war, und nimmt eine folgenschwere Ausweitung des Bedeutungsspektrums dieses Begriffs vor. Als Auslegung bezeichnet Heidegger die „Ausbildung des Verstehens“ (148). „In ihr eignet sich das Verstehen sein Verstandenes verstehend zu“ (148). Um die Reichweite seines Begriffs der Auslegung zu verdeutlichen, führt Heidegger im folgenden eine eingehende Analyse der Auslegung am Beispiel des Verstehens der Welt durch. Der Begriff der Auslegung, der sich traditionell vorrangig auf den Umgang von Lesern mit Texten bezogen hatte, wird im Rahmen der existenzialen Analytik nun für den Umgang von Menschen mit Welt insgesamt verwendet. Heideggers Kernthese zur Auslegung im Kontext des Verstehens von Welt lautet: Alles dasjenige, was ausdrücklich, d. h. explizit und thematisch, verstanden wird, hat die „Struktur des Etwas als Etwas“ (149).16 Er meint, daß immer dann, wenn wir uns auf etwas in der Welt richten (auf Gegenstände oder auch komplexere Sachverhalte), wir die betreffenden Gegenstände bereits als in bestimmten Hinsichten klassifiziert und charakterisiert erfahren. Sie treten uns immer schon als bereits interpretierte Sinngebilde und nicht als bezugslose Einzeldinge „unmittelbar“ entgegen. 16 Heidegger knüpft hier an die aristotelische Wendung tí kata tínoj an; zu dieser Wendung vgl. Tugendhat 1958.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
105
Heidegger gibt an anderer Stelle in seinem Text ein Beispiel, welches sich auf das Hören bezieht: „‚Zunächst‘ hören wir nie und nimmer Geräusche und Lautkomplexe, sondern den knarrenden Wagen, das Motorrad. Man hört die Kolonne auf dem Marsch, den Nordwind, den klopfenden Specht, das knisternde Feuer“ (163). D. h. wir hören das Geräusch als vorbeifahrendes Motorrad oder als Klopfen eines Spechts. Heideggers Vorschlag, die Auslegung im Sinne des ausdrücklichen Verstehens im Rückgriff auf deren Als-Struktur zu erläutern, zieht eine wichtige Frage nach sich: Erfolgt die Klassifikation und Charakterisierung der Gegenstände mit den Mitteln der Sprache, d. h. mit Hilfe von Aussage und Urteil, oder aber werden bereits durch einfache (nichtpropositionale) Wahrnehmung Deutungsleistungen vollbracht, die dann erst nachträglich mit Hilfe von Aussagen zur Darstellung gebracht werden? Diese Frage hat in der Diskussion um ein angemessenes Verständnis der §§ 32 ff. eine heftige Kontroverse entfacht. Der Textbefund im § 32 scheint zunächst einmal eindeutig zu sein. „Der umsichtig-auslegende Umgang mit dem umweltlich Zuhandenen, der dieses als Tisch, Tür, Wagen, Brücke ‚sieht‘, braucht das umsichtig Ausgelegte nicht notwendig auch schon in einer bestimmenden Aussage auseinanderzulegen. Alles vorprädikative schlichte Sehen des Zuhandenen ist an ihm selbst schon verstehend-auslegend“ (149). Wenig später heißt es: „Die Artikulation des Verstandenen in der auslegenden Näherung des Seienden am Leitfaden des ‚Etwas als Etwas‘ liegt vor der thematischen Aussage darüber“ und es sei falsch, dem „schlichten Sehen jede artikulierende Auslegung, mithin die Als-Struktur abzusprechen“ (149). Heidegger macht in diesen Passagen ausdrücklich auf die vorprädikative Dimension der Auslegung aufmerksam, die es erlaube, bereits das vor Aussage und Urteil liegende Wahrnehmen (Sehen, Hören) als Deutungsleistung zu begreifen. Im § 33 wird er das „existenzial-hermeneutische ‚Als‘“ der umsichtig-verstehenden Auslegung vom „apophantischen ‚Als‘ der Aussage“ (158) unterscheiden. Mit diesen Überlegungen sind bereits Grundprobleme der in Sein und Zeit impliziten Sprachphilosophie angesprochen. Trotz der angeführten Textstellen besteht Uneinigkeit darüber, wie Heideggers Ausführungen näherhin aufzufassen sind. Der Streit dreht sich um die Bedeutung des Wortes „vorprädikativ“. Ist mit ihm lediglich auf etwas verwiesen, was vor der Aussage liegt (so der Text) oder aber unterstellt Heidegger hier vorsprachliche Deutungsleistungen?17 Systematisch hängt die Antwort, wel17 Auf der einen Seite finden sich Interpreten wie Dreyfus 1980, 1991, Mittelstraß/Lorenz 1969 und Tugendhat 1979, 186 ff., die das Wort „vorprädikativ“ im starken Sinn von ‚vor der Sprache‘ interpretieren. Kisiel 1993, 17 spricht mit Blick auf den Versuch, eine vorsprachliche
106
Christoph Demmerling
che man an dieser Stelle geben kann, von ganz grundsätzlichen sprachphilosophischen Prämissen ab. Begreift man die Aussage als genuinen und ursprünglichen Sprachmodus, auf den alle anderen Modi der Sprache zurückgeführt werden können, oder gibt es neben der Aussage ihrerseits genuine Sprachmodi, die nicht auf das Aussagen zurückgeführt bzw. aus ihm abgeleitet werden können? Diesen Problemen geht der folgende Abschnitt nach. Zuvor jedoch ist noch der Begriff des (hermeneutischen) Zirkels zu diskutieren. Im letzten Teil von § 32 kommt Heidegger im Zusammenhang mit seiner Thematisierung des Sinnbegriffs auf die sogenannte „Vor-Struktur“ der Auslegung und auf das Problem der Zirkelhaftigkeit des Verstehens zu sprechen. Mit dem Begriff der Vor-Struktur bezieht er sich auf den Umstand, daß alles, was Gegenstand der Auslegung ist oder werden kann, auf eine bestimmte Weise bereits zuvor verstanden sein muß. Man kann sich dies noch einmal mit Hilfe des Unterschieds zwischen (vorthematischem, und heute würde man vielleicht sagen: implizitem) Verstehen und der Auslegung (als thematischem oder explizitem Verstehen) verdeutlichen. Was Gegenstand der thematischen Auslegung werden kann, muß zuvor bereits unthematisch verstanden worden sein. Um noch einmal das im Kontext der Heideggerexegese notorische Beispiel zu bemühen: Um explizite Auskunft auf die Frage geben zu können, was ein Hammer ist, muß ich wissen, wie man mit einem Hammer umgeht. Das Problem eines Zirkels des Verstehens, das in der traditionellen Hermeneutik wiederholt zur Diskussion stand, um auf die Tatsache aufmerksam zu machen, daß z. B. Texte nur dann interpretiert werden können, wenn bereits etwas verstanden ist, wird nach den Begriffen Verstehen, Auslegung und Sinn von Heidegger gleichfalls existenzialisiert interpretiert: „Dieser Zirkel des Verstehens ist nicht ein Kreis, in dem sich eine beliebige Erkenntnisart bewegt, sondern er ist der Ausdruck der existenzialen Vor-struktur des Daseins selbst“ (153). Diese Vor-struktur erläutert Heidegger, indem er drei verschiedene Momente derselben unterscheidet (vgl. 150): Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff. Mit diesen Unterscheidungen macht Heidegger im wesentlichen darauf aufmerksam, daß die Voraussetzungen, die wir („immer
Konzeption (!) von Faktizität zu entwickeln, von einem „lifelong topic of thought“ bei Heidegger. Auf der anderen Seite finden sich Kommentare, die das Wort „vorprädikativ “ gerade nicht so verstehen, als würde Heidegger meinen ‚vor der Sprache‘; vgl. im Anschluß an Apel 1963 Lafont 1994, 80 ff.. Heidegger gehe es vielmehr darum, das Aussagen in etwas vor der Aussage liegendem Sprachlichen zu ‚fundieren‘. Graeser 1993 läßt die Frage offen, räumt allerdings ein, daß die zweite Lesart zumindest möglich ist.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
107
schon“) in Anspruch nehmen und nehmen müssen, wenn wir uns in der Welt bewegen, nicht nur theoretischer Natur sind (Überzeugungen z. B.), sondern auch praktischer Art (z. B. eingeübte und habitualisierte Handlungs- und Umgangsweisen). Der Zirkel des Verstehens läßt sich also nicht nur nicht vermeiden, in ihm verbirgt sich – wie Heidegger mit kritischem Blick auf die exakten Wissenschaften vermerkt – „eine positive Möglichkeit ursprünglichsten Erkennens“ (153). Heideggers Überlegungen zur Vor-struktur der Auslegung lassen sich freilich auch noch in einem stärkeren Sinn verstehen, zumal dann, wenn man sie auf die mit seinem Gesamtprojekt verbundene Destruktion der abendländischen Ontologie bezieht. Dieser Lesart zufolge bezieht sich die Rede von einer Vor-struktur der Auslegung nicht einfach nur auf die Problematik eines unthematischen oder impliziten Verstehens, sondern überdies auf den Umstand, daß die Tradition der Philosophie uns mit einem Koordinatensystem ausgestattet hat, in dessen Rahmen sich unser Denken und Handeln zunächst notgedrungen abspielt. So verstanden soll der Hinweis auf die Vor-struktur der Auslegung auch darauf aufmerksam machen, daß der Hauptstrang der abendländischen Philosophie uns eine Sicht des Menschen und der Welt im Lichte einer Vorhandenheitsontologie vorgeordnet hat. Die Explikation der Vor-struktur verfolgt somit auch den weiterreichenden Zweck, hinter das durch Tradition und Überlieferung bestimmte Koordinatensystem zurückzugelangen. Die Passagen zur Zirkelhaftigkeit des Verstehens sind nicht ganz frei von pejorativen Untertönen gegenüber Wissenschaften wie der Mathematik oder den Naturwissenschaften. Man sollte sie dennoch nicht im Sinne eines methodologischen Freibriefs verstehen, der alles erlaubt, was ein Vertreter der exakten Wissenschaften guten Gewissens nicht mehr dulden kann. Der sinnvolle Kern der Rede von einer positiven „Möglichkeit ursprünglichsten Erkennens“ ist vielmehr darin zu erblicken, daß es der als hermeneutische Phänomenologie verstandenen Daseinsanalyse immer auch darum geht, alle Phänomene, die uns in unserem Denken, Reden und Handeln bekümmern, aus der Perspektive des gelebten Lebens beschreiben zu können. Einer Perspektive, die von den Naturwissenschaften per definitionem nicht eingenommen wird. Und für eine phänomenologisch sensible Beschreibung unseres Lebens und unserer Welt gelten selbstverständlich andere methodische Vorgaben als für Mathematik und Naturwissenschaft. Dies heißt aber nicht, daß es gar keine methodischen Vorgaben gäbe.
108
Christoph Demmerling
5.5 Aussage, Sprache und Rede: das artikulierte Leben „Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch“ (GA 9, 313) – so schrieb Heidegger 1946 in seinem Brief über den Humanismus. Sprachphilosophische Fragestellungen, die insbesondere das Problem betreffen, ob und inwieweit die Welterfahrung des Menschen durch seine sprachlichen Möglichkeiten bestimmt wird und ob die von Heidegger sogenannte Welterschließung primär ein sprachliches Geschehen ist, dominieren v. a. in seinen späteren Werken. Auf den ersten Blick scheint sich in diesen Arbeiten eine Position Geltung zu verschaffen, die einen Bruch mit den Überlegungen von Sein und Zeit darstellt. Neuere Arbeiten zur Sprachphilosophie Heideggers haben indessen deutlich gemacht, daß der Ansatz von Sein und Zeit eine Reihe von Überlegungen enthält, die auf die sprachphilosophischen Überlegungen der späteren Werke vorgreifen.18 In Sein und Zeit denkt Heidegger in verschiedenen systematischen Kontexten über die Rolle der Sprache nach; (zu nennen sind die Zeuganalyse in den §§ 15 ff., die zentralen §§ 33 und 34 sowie schließlich der § 68 d zur Zeitlichkeit der Rede). Im Zusammenhang mit der bereits im letzten Abschnitt aufgeworfenen Frage nach der Bedeutung des Wortes „vorprädikativ“ bei Heidegger sind v. a. seine Überlegungen zur Aussage sowie zum Verhältnis von Sprache und Rede von Belang (§§ 33 und 34). Die Textstellen im § 32 schienen darauf hinauszulaufen, bereits die einfache Wahrnehmung, das „schlichte Sehen“ (vgl. 149) als eine Deutungs- und Verstehensleistung, die vor der Sprache liegt, zu begreifen, indem sie bereits für die Wahrnehmung eine Als-Struktur konstatieren zu können glaubten. Heideggers Überlegungen zur Aussage als einem „abkünftigen Modus der Auslegung“ (vgl. 153 ff.) können auf den ersten Blick als Bestätigung dieser Auffassung gelesen werden. Sicher ist, daß Heidegger von einer Deutungsleistung der Wahrnehmung ausgeht, die in dem Sinne als vorpropositional gelten kann, als daß sie vor der prädikativen Struktur der Aussage anzusiedeln ist. Aber bedeutet dies auch bereits, daß es sich um einen vorsprachlichen Aspekt der Wahrnehmung handelt? Betrachten wir die einschlägigen Textstellen: Die „Aussage ist kein freischwebendes Verhalten, das von sich aus primär Seiendes überhaupt erschließen könnte, sondern verhält sich 18 Zu nennen ist v. a. die Monographie Lafont 1994; vgl. auch Apel 1998; Stassen 1973 verfolgt die Wurzeln der Sprachphilosophie von Sein und Zeit eingehend bis zu Luther, Augustinus und Aristoteles zurück. Sein Buch stellt immer noch eine wichtige Ergänzung neuerer Arbeiten dar.
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
109
immer schon auf der Basis des In-der-Welt-seins. Was früher bezüglich des Welterkennens gezeigt wurde, gilt nicht weniger von der Aussage. Sie bedarf einer Vorhabe von überhaupt Erschlossenem, das sie in der Weise des Bestimmens aufzeigt. […] Der ursprüngliche Vollzug der Auslegung liegt nicht in einem theoretischen Aussagesatz, sondern im umsichtigbesorgenden Weglegen bzw. Wechseln des ungeeigneten Werkzeugs, ‚ohne dabei ein Wort zu verlieren‘. Aus dem Fehlen der Worte darf nicht auf das Fehlen der Auslegung geschlossen werden“ (156 f.). Wie an so vielen anderen Stellen seines Buches kommt in dieser Passage erneut der vielfach diagnostizierte „Praktizismus“ von Sein und Zeit zur Geltung. Jede theoretische Beschreibung der Welt oder eines Teils von ihr ist etwas Abgeleitetes. Primär hingegen ist der praktische Umgang des Menschen mit der Welt, den Heidegger vorrangig mit Begriffen wie denjenigen der Sorge und des Besorgens thematisiert. Die Aussage als eine spezifisch theoretische (oder kontemplative) Form, auf die Welt Bezug zu nehmen, ist nicht nur allein aufgrund ihrer Einbettung in ihr selbst vorgängige Praxisvollzüge verstehbar, sie ist auch nur auf der Grundlage solcher Praxisvollzüge möglich. Innerhalb dieser Praxisvollzüge ist die Welt bereits auf eine vorprädikative Weise erschlossen. Auf die Sprache bzw. Rede wurde in dem angeführten Passus noch nicht Bezug genommen. Daß der Begriff des „Vorprädikativen“ sich bei Heidegger nicht allein auf Vorsprachliches, sondern v. a. auf etwas „vor der Aussage“ bezieht, machen erst weitere Textstellen deutlich. So geht er offensichtlich davon aus, daß es neben der theoretischen Aussage nicht nur weitere, sondern im gleichen Sinn fundamentale Sprachmöglichkeiten gibt, die sich nicht umstandslos auf die Aussage zurückführen lassen: „Zwischen der im besorgenden Verstehen noch ganz eingehüllten Auslegung und dem extremen Gegenfall einer theoretischen Aussage über Vorhandenes gibt es mannigfache Zwischenstufen. Aussagen über Geschehnisse in der Umwelt, Schilderungen des Zuhandenen, ‚Situationsberichte‘, Aufnahme und Fixierung eines ‚Tatbestandes‘, Beschreibung einer Sachlage, Erzählung des Vorgefallenen. Diese ‚Sätze‘ lassen sich nicht, ohne wesentliche Verkehrung ihres Sinnes, auf theoretische Aussagesätze zurückführen. Sie haben, wie diese selbst, ihren ‚Ursprung‘ in der umsichtigen Auslegung“ (158). Weitere Indizien dafür, daß Heidegger den Begriff des Vorprädikativen nicht einfach im Sinne von „vorsprachlich“ gebraucht, erhält man im Zusammenhang mit Heideggers Unterscheidung zwischen „Sprache“ und „Rede“. Insbesondere die hier einschlägigen Passagen machen deutlich, inwiefern die sprachphilosophische Relevanz der Überlegungen von Heidegger nicht allein darin besteht, daß er die Aussage in Verbindung mit einer
110
Christoph Demmerling
vorsprachlichen Praxis bringt, sondern v. a. auch darin, die Aussage in einer ihr vorgängigen sprachlichen Praxis zu fundieren. Und dies ist Heideggers eigentlich starke These. Dies zeigt sich besonders deutlich im § 34 von Sein und Zeit, wo es heißt: „Die Rede ist mit Befindlichkeit und Verstehen existenzial gleichursprünglich. Verständlichkeit ist auch schon vor der zueignenden Auslegung immer schon gegliedert. Rede ist die Artikulation der Verständlichkeit. Sie liegt daher der Auslegung und Aussage schon zugrunde“ (161). Wie Befindlichkeit und Verstehen begreift Heidegger auch die Rede als Existenzial, als ein Moment, durch welches das Dasein in unhintergehbarer Art und Weise gekennzeichnet ist; die Rede gilt Heidegger überdies als das „existenziale“ bzw. „ontologische“ Fundament der Sprache. Sieht man einmal von dem spezifischen Gebrauch ab, den Heidegger vom Begriff der Rede macht, läßt sich die Unterscheidung zwischen Sprache und Rede ein Stück weit als eine Unterscheidung zwischen der Sprache als einem in sich geschlossenen System von Regeln und der Sprache als einem Phänomen des menschlichen Lebens, also als gesprochener und gebrauchter Sprache rekonstruieren. Indem die Rede von Heidegger als ein mit Befindlichkeit und Verstehen gleichursprüngliches Phänomen interpretiert wird, ihr zuerkannt wird, „gegliedert“ zu sein, und sie mehr noch mit dem Zusatz, sie sei „Artikulation der Verständlichkeit“, erläutert wird, erweist sich die Rede als genau dasjenige „sprachliche“ Element, welches vor der Aussage liegt. Mit den Überlegungen zum „abkünftigen“ Charakter der Aussage geht es Heidegger darum, die Vorrangstellung der theoretischen Sprache, die philosophische Orientierung an der mit der Subjekt-PrädikatStruktur operierenden Aussage zu überwinden, ohne deshalb bereits der Illusion zu erliegen, man könne ein sprachlos ungegliedertes Leben in seiner blinden Unmittelbarkeit auffinden. Anders als die Sprache im Sinne der Aussage steht die Rede zudem von vornherein (und zwar auch als Hören und Schweigen; vgl. 161) mit der intersubjektiven Praxis des Menschen in Verbindung und sie ist etwas Soziales, was dann wiederum auf die Analysen zu Mitdasein und Mitsein im § 26 zurückverweist. Wesentlich ist jedoch die Gliederungsfunktion, die Heidegger der Rede zuerkennt: „Reden ist das ‚bedeutende‘ Gliedern der Verständlichkeit des In-der-Weltseins, dem das Mitsein zugehört, und das sich je in einer bestimmten Weise des besorgenden Miteinanderseins hält“ (161). Als wesentliche Strukturmomente der Rede werden von Heidegger 1.) das Worumwillen der Rede, 2.) das Geredete als solches, 3.) die Mitteilung und 4.) die Bekundung genannt. Diese vier Momente gehören ihm zufolge immer zusammen, weshalb es verfehlt ist, die bloße Aussage, in der
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
111
die unter 1.) und 2.) genannten Aspekte überwiegen, als einen ausgezeichneten Zugang zur Sprache anzusehen. Heidegger wendet sich insbesondere gegen einen ausschließlich am propositionalen Gehalt von Aussagen orientierten Zugriff auf die Sprache und macht demgegenüber dialogische und expressive Komponenten der Sprache und des Sprechens stark. Die Orientierung am Aussagesatz und dessen Logik stellt für ihn einen Sündenfall im sprachphilosophischen Denken des Abendlands dar. Mit der Fundierung der Sprache im Existenzial der Rede hingegen, hofft Heidegger, die „Aufgabe einer Befreiung der Grammatik von der Logik“ (165) in Angriff nehmen zu können. Erforderlich ist eine solche Befreiung, da der Sinn sprachlicher Äußerungen nicht angemessen beschrieben werden kann, wenn man sich dabei am Muster oder Modell des Vorhandenen orientiert und die Sprache bzw. den Sinn sprachlicher Äußerungen als etwas Gegenständliches begreift. Dies geschieht im Falle von Aussagen besonders leicht und ist Heidegger zufolge in der Tradition sprachphilosophischen Denkens immer wieder geschehen. Erst im § 68 d zur „Zeitlichkeit der Rede“ werden diese Überlegungen erneut aufgegriffen. Gegen ein „Vorhandenheitsmodell“ der Sprache und ihres Sinns – mit diesem Begriff könnte man die von Heidegger kritisierte Vorstellung kurz bezeichnen – macht er die Zeitlichkeit der Rede (und damit wohl auch die Zeitlichkeit sprachlichen Sinns) geltend: „Die Rede ist an ihr selbst zeitlich, sofern alles Reden über …, von … und zu … in der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit gründet […]. Aus der Zeitlichkeit der Rede, das heißt des Daseins überhaupt, kann erst die ‚Entstehung‘ der ‚Bedeutung‘ aufgeklärt und die Möglichkeit einer Begriffsbildung ontologisch verständlich gemacht werden“ (349). An dieser Stelle wird aus der Frage nach dem Zusammenhang von Sein und Zeit die Frage nach dem Zusammenhang von Sinn und Zeit. Heidegger konstatiert enge Verbindungen zwischen der Zeitlichkeit des Daseins sowie der Zeitlichkeit der Rede bzw. der Zeitlichkeit des Sinns.19 Er hegt außergewöhnlich starke Vorbehalte gegenüber sprachphilosophischen Positionen, welche die Sprache und den Sinn sprachlicher Äußerungen – durch die Orientierung an Aussagen – als etwas Vorhandenes auffassen und er legt nahe, daß diese Vorbehalte mit seiner spezifischen Konzeption der Zeitlichkeit des Daseins zusammenhängen. Obwohl Heideggers Überlegungen zur Sprache sowie zur Rede als Existenzial konzeptionell nicht immer ganz klar sind, obwohl er kein begriffliches Instrumen19 Systematische Überlegungen zu dieser Problematik finden sich in meinem Aufsatz Demmerling 2001, der sich zumindest im Sinne erster Schritte zu einer näheren Charakterisierung des Zusammenhangs von Zeitlichkeit und Sprache versteht.
112
Christoph Demmerling
tarium zur Feinanalyse sprachlicher Äußerungen und ihres Sinns entwickelt hat und seine Überlegungen vielfach programmatisch bleiben, ist festzuhalten, daß er einem überaus reichhaltigen Bild von der Sprache zuarbeitet.20
5.6 Gerede, Neugier und Zweideutigkeit: das verfallene Leben In den Schlußparagraphen des fünften Kapitels schließlich geht Heidegger der Frage nach, wie sich die in den vorhergehenden Abschnitten mit Befindlichkeit, Verstehen und Rede bezeichneten Strukturmerkmale des Daseins als alltägliche Seinsweisen manifestieren. Damit nimmt er ein wesentliches Grundmotiv der existenzialen Analytik wieder auf: Die Daseinsanalyse soll eine Hermeneutik der Alltäglichkeit des In-der-Welt-seins sein. Gerede, Neugier und Zweideutigkeit nennt Heidegger die verschiedenen Formen des Verfallens, die er eingehender charakterisiert. Die Analysen in den §§ 35 ff. schließen an die Überlegungen zur „Diktatur des Man“ im § 27 an und bereiten die Überlegungen zu Gewissen und eigentlichem Selbstseinkönnen vor (§§ 54 ff.). Obgleich Heideggers Ausführungen zum Verfallen des Daseins oft im Sinne einer radikalen Kulturkritik verstanden worden sind, die sich zunächst scheinbar bruchlos in eine Reihe mit der zivilisationskritischen Literatur der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts stellen lassen, wehrt er sich selbst ganz entschieden gegen ein derartiges Verständnis: „Der Ausdruck ‚Gerede‘ [und dies gilt für die Analysen zur Verfallenheit insgesamt, C. D.] soll hier nicht in einer herabziehenden Bedeutung gebraucht werden. Er bedeutet terminologisch ein positives Phänomen, das die Seins-
20 Gerade in den letzten Jahren sind verschiedene Integrationsprojekte zur Verbindung von analytischer Philosophie und philosophischer Hermeneutik formuliert worden, die insbesondere auch die hier einschlägigen Begriffe von Sprache betreffen sollen; vgl. z. B. Tietz 1995. Ich meine, daß solche Versuche bereits aufgrund der in den verschiedenen Traditionen ganz unterschiedlichen Begriffe von Sprache scheitern müssen. Dies gilt besonders für einen Autor, der immer wieder als Gewährsmann angeführt wird, wenn es darum geht, Annäherungen zwischen analytischer Philosophie und Hermeneutik zu konstatieren: für Donald Davidson. Zumindest in einer bestimmten Phase seiner sprachphilosophischen Theoriebildung nimmt er genau diejenige Perspektive ein, die Heidegger mit seiner Forderung nach einer „Befreiung der Grammatik von der Logik“ gerade destruieren möchte. Davidson nämlich blickt aus der Perspektive der Logik auf die natürliche Sprache und spricht davon, daß „Grammatik und Logik Hand in Hand gehen“ müssen (vgl. Davidson 1986, 100).
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
113
art des Verstehens und Auslegens des alltäglichen Daseins konstituiert“ (167). Auch wenn der Gebrauch von Ausdrücken wie „Gerede“ (an anderer Stelle „Geschreibe“, vgl. 169), „Neugier“ und „Zweideutigkeit“ oft mit einer negativen Bewertung einhergeht, auch wenn man Heideggers Selbstauskünften nicht immer vertrauen darf, ist zunächst einmal zu fragen, warum er eigens unterstreicht, daß die Analyse des Verfallens dem Selbstverständnis nach in einer wertneutralen Perspektive erfolgt. Die Formen des Verfallens lassen sich als „uneigentliche“ Entsprechungen der Existenziale Befindlichkeit, Verstehen und Rede auffassen. Als solche sind sie zunächst einmal ebenfalls unhintergehbar, d. h. sie gehören notwendig zum menschlichen Leben, ohne daß dem einzelnen Dasein bzw. dem einzelnen Menschen das Verfallen „vor-“ oder „zugerechnet“ werden könnte. Wer überhaupt nur als Dasein ist, ist verfallen. Das Verfallen ist ein Strukturmoment des Daseins, für welches der Einzelne nicht zur Verantwortung oder Rechenschaft gezogen werden kann. Dieser Mangel an Zurechenbarkeit ist der wesentliche Grund, warum sich Heidegger von „einer moralisierenden Kritik des alltäglichen Daseins und von ‚kulturphilosophischen Aspirationen‘“ (167) distanziert. Sich im Strom öffentlicher Ausgelegtheit treiben zu lassen, zu reden, was man redet und zu schreiben, was man schreibt („Gerede“, „Geschreibe“), aufzumerken, wo man aufmerkt („Neugier“) und gar nicht ermitteln zu können, was einem selbst tatsächlich zugehört und was man nur vermittels der unreflektierten Teilnahme an einem überlieferten Bestand institutionalisierter Praktiken als zu sich zugehörig erfährt („Zweideutigkeit“) – dies macht uns aus, ob wir dies wollen oder nicht. Gerade weil wir als Menschen nicht einfach zwischen der authentischen Gestaltung unseres Lebens („Eigentlichkeit“) und einer mehr oder weniger konformistischen Lebensform („Uneigentlichkeit“) wählen können, ist das Selbstverständnis der Analysen Heideggers zunächst einmal rein deskriptiv. Deskriptiv ist das Selbstverständnis seiner Analysen auch deshalb, da er nicht etwa der Auffassung ist, daß eine bestimmte Form von Gesellschaft das Verfallen ihrer Mitglieder besonders begünstige, was dann gegebenenfalls in „fortgeschrittenen Stadien der Menschheitskultur beseitigt werden könnte“ (176). Ob und inwieweit sich normative Erwägungen mit den Verfallenheitsanalysen verbinden bzw. verbinden lassen, ist eine Frage, die kontrovers diskutiert wird. Gegenstand einer kontroversen Diskussion ist ebenfalls das Problem, ob die von Heidegger immer wieder unterstrichene nichtnormative Dimension seiner Verfallenheitsanalysen nicht doch mit unausgewiesenen starken normativen Unterstellungen operiert. 21 21 Eine ausführliche Diskussion dieser Thematik findet sich in dem Beitrag von Luckner (in diesem Band).
114
Christoph Demmerling
Indem Heidegger im Zusammenhang mit dem Verfallen erneut den Aspekt der Geworfenheit des Daseins akzentuiert, erinnert er noch einmal an die Befindlichkeitsanalyse zu Beginn des Kapitels. Die Verbindung wird von ihm denn auch explizit hergestellt. „Das Dasein kann nur verfallen, weil es ihm um das verstehend-befindliche In-der-Welt-sein geht“ (179). Die phänomenbezogenen Einzelanalysen, die am Ende des Paragraphen mit Begriffen wie Versuchung, Beruhigung, Entfremdung, Verfängnis und schließlich Absturz und Wirbel angedeutet werden (vgl. 177 ff.), thematisieren die Geworfenheit des Daseins noch einmal mit besonderer Drastik. Sie veranschaulichen eindringlich eine der auf das Leben des Menschen bezogenen Grundthesen von Heideggers Buch und machen möglicherweise dessen weit über die akademische Philosophie hinausgehenden Reiz aus: Die phänomenologischen Analysen zu den Lebensvollzügen des Menschen zeigen, daß das Verständnis des Menschen als eines autonomen Subjekts und mithin dominierende Ansätze der neuzeitlichen Philosophie eine wenn nicht falsche, so doch einseitige Darstellung formulieren. Der als Dasein verstandene Mensch ist gerade kein autonomes Subjekt, jedenfalls ist er es nicht ausschließlich. Passivität, Machtlosigkeit, Scheitern gehören in gleicher Weise zu unserem Leben wie die Erfahrungen des Könnens und Gelingens. Ein wesentlicher Impuls, der von Heideggers Hermeneutik der Alltäglichkeit ausgegangen ist, hat darin bestanden, dies in Erinnerung zu rufen.
Literatur Apel, K.-O. 1963: Die Idee der Sprache in der Tradition von Dante bis Vico, Bonn Apel, K.-O. 1999: „Sinnkonstitution und Geltungsrechtfertigung. Heidegger und das Problem der Transzendentalphilosophie“, in: ders., Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, Frankfurt a. M., 505–568 Bollnow, O. F. 1956: Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt a. M. 71988 Davidson, D. 1986: „Die Semantik natürlicher Sprachen“, in: ders., Wahrheit und Interpretation, Frankfurt a. M., 92–105 Demmerling, Ch. 2001: „Vom Sein des Sinns. Überlegungen zu einer hermeneutischen Philosophie der Sprache“, erscheint in: A. Gethmann-Siefert/E. Weißer-Lohmann (Hrsg.), Kunst – Kultur – Öffentlichkeit. Philosophische Perspektiven auf praktische Probleme. München Dilthey, W. 1957: Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Gesammelte Schriften V, hrsg. v. G. Misch, Göttingen 2. Aufl. Dreyfus, H. 1980: „Holism and Hermeneutics“, in: Review of Metaphysics 34, 3–23 Dreyfus, H. 1991: Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Cambridge Gadamer, H.-G. 51986: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen
5
Hermeneutik der Alltäglichkeit
115
Gadamer, H.-G. 1987: „Heidegger und die Ethik“, in: ders., Hegel, Husserl, Heidegger. Gesammelte Werke Bd. 3, Tübingen, 333–374 Gethmann, C. F. 1974: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers, Bonn Gethmann, C. F. 1993: Dasein: Erkennen und Handeln. Heidegger im phänomenologischen Kontext, Berlin Goldmann, L. 1975: Lukács und Heidegger, Darmstadt/Neuwied Graeser, A. 1993: „Das hermeneutische ‚als‘. Heidegger über Verstehen und Auslegung“, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 47, 559–572 Grondin, J. 1994: „Das junghegelianische und ethische Motiv in Heideggers Hermeneutik der Faktizität“, in: ders., Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt Kisiel, T. 1993: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley Lafont, C. 1994: Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers, Frankfurt a. M. Lévinas, E. 1961: Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Den Haag; deutsch als: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg/München 21993 Löwith, K. 1981: Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen (1928), in: ders., Mensch und Menschenwelt. Beiträge zur Anthropologie. Sämtliche Schriften Bd. 1, Stuttgart, 9 –197 Luckner, A. 1996: Martin Heidegger: „Sein und Zeit“. Ein einführender Kommentar, Paderborn u. a. Luckner, A. 2001: „Wie es ist, selbst zu sein. Zum Begriff der Eigentlichkeit“, in diesem Band Mittelstraß, J./Lorenz, K. 1969: „Die Hintergehbarkeit der Sprache“, in: Kantstudien 58, 187–208 Nagl-Docekal, H./Pauer-Studer, H. (Hg.) 1993: Jenseits der Geschlechtermoral. Beiträge zur feministischen Ethik, Frankfurt a. M. Pocai, R. 1996: Heideggers Theorie der Befindlichkeit. Sein Denken zwischen 1927 und 1933, Freiburg/München Prauss, G. 1976: Erkennen und Handeln in Heideggers „Sein und Zeit“, Freiburg/München Rentsch, Th. 1985: Heidegger und Wittgenstein. Existential- und Sprachanalysen zu den Grundlagen philosophischer Anthropologie, Stuttgart Rentsch, Th. 1989: Martin Heidegger – Das Sein und der Tod, München Ryle, G. 1969: Der Begriff des Geistes, Stuttgart Schäfer, T. 1995: Reflektierte Vernunft. Michel Foucaults philosophisches Projekt einer antitotalitären Macht- und Wahrheitskritik, Frankfurt a. M. Schürman, R. 1990: Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy, Bloomington Stassen, M. 1973: Heideggers Philosophie der Sprache in „Sein und Zeit“, Bonn Theunissen, M. 1977: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin Tietz, U. 1995: Sprache und Verstehen in analytischer und hermeneutischer Sicht, Berlin Tugendhat, E. 1958: TI KATA TINOS. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe, Freiburg Tugendhat, E. 1979: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt a. M. Vogel, L. 1994: The Fragile „We“. Ethical Implications of Heidegger’s „Being and Time“, Evanston/Illinios Wolf, U. 1999: Die Philosophie und die Frage nach dem guten Leben, Reinbek bei Hamburg
6 Barbara Merker
Die Sorge als Sein des Daseins (§§ 39 –44)
In den Kapiteln, die dem sechsten Kapitel des ersten Abschnitts von Sein und Zeit vorangehen, hat Heidegger im Detail zu zeigen versucht, warum und in welchem Sinne er das Dasein als In-der-Welt-sein konzipiert. Im einzelnen hat er dort auseinandergelegt, was er unter Weltlichkeit, In-Sein (Befindlichkeit, Verstehen, Rede) und Verfallenheit versteht; und er hat angedeutet, auf welche Weise die Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit des Daseins die formale Struktur des In-der-Welt-seins modifizieren. Das sechste Kapitel mit dem Titel „Die Sorge als Sein des Daseins“ ist ein besonders bedeutsames Kapitel. Es ist bedeutsam zum einen, weil Heidegger hier die bisherigen Ergebnisse zusammenfaßt und das Sein des Daseins als Sorge bestimmt; und es ist bedeutsam zum anderen, weil er mit der Explikation der Sorgestruktur auch die Weichen für seine späteren Untersuchungen zur Zeitstruktur des Daseins stellt. Das sechste Kapitel ist sozusagen das notwendige Bindeglied zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt von Sein und Zeit.
6.1 § 39. Die Frage nach der ursprünglichen Ganzheit des Strukturganzen des Daseins Der erste Paragraph (§ 39) gibt einen Überblick über die restlichen Paragraphen (§§ 40 – 44) des sechsten Kapitels. In diesem Überblick erwähnt Heidegger zwei Motive für seine Konzeption der §§ 40–42. Erstens will er verhindern, daß über den detaillierten Analysen der einzelnen Strukturmomente des In-der-Welt-seins die Einheitlichkeit und Ganzheit des Daseins aus dem Blick gerät. Zweitens will er vermeiden, daß
118
Barbara Merker
sein bisheriger Vorgriff auf das Dasein als In-der-Welt-sein bloß willkürlich konstruiert erscheint. In dieser Befürchtung zeigt sich Heideggers phänomenologische Abneigung gegen rein deduzierende, konstruierende Verfahren in der Philosophie. Im Unterschied dazu will er sich an der phänomenologisch-hermeneutischen Maxime orientieren, daß philosophische (ontologische, existenziale, phänomenologische) Erkenntnisse an vorphilosophische (ontische, existenzielle, phänomenale) Phänomene gebunden bleiben müssen. Die philosophischen „Vorgriffe“ bedürfen ebenso der „Bewährung“ durch diese Phänomene wie umgekehrt die vorphilosophischen Phänomene zu ihrer angemessenen Erkenntnis der philosophischen Interpretation und Begriffsbildung bedürfen. Prinzipiell sind Heidegger zufolge alle vorontologischen Phänomene geeignet sowohl für die philosophisch-ontologische Interpretation als auch für deren Bewährung.1 Doch gibt es nach seiner Auffassung bestimmte Phänomene, die in besonderer Weise geeignet sind, philosophische (ontologische, existenziale, phänomenologische) Erkenntnisse zu befördern und zu bewähren. Im Verlauf seiner bisherigen Analysen haben Phänomene wie Störungen des alltäglichen Besorgens und Zeichen (Zeigzeug) eine eminente Rolle gespielt, weil in ihnen das, was normalerweise in der natürlichen Einstellung nur unthematisch zugänglich ist: der teleologische Mittel-Zweck-Zusammenhang, in dem wir uns in der alltäglichen Praxis bewegen, im Kontext dieser Praxis selber thematisch, wenn auch noch nicht ontologisch angemessen begriffen wird. In solchen „ontischen“ Phänomenen „melden“ sich die phänomenologisch-ontologisch relevanten Phänomene wie die Welt als der Horizont, der Bedingung der Möglichkeit für das praktische und theoretische Sein bei innerweltlich Seiendem ist (§§ 16 f.). Die §§ 40 bis 42 sind mit Blick auf die doppelte methodische Anforderung der Gewinnung und Bewährung ontologischer Erkenntnisse konzipiert. Die §§ 40 und 41 dienen der Gewinnung der Sorgestruktur im Ausgang von einem solchen eminenten Phänomen, nämlich der Grundbefindlichkeit der Angst, die besser als alle anderen Phänomene dazu geeignet sein soll, die vielfältige Struktur des Daseins „vereinfacht“ zugänglich zu machen und auf den Begriff der Sorge zu bringen. Der § 42 dient der vorontologischen Bewährung der gewonnenen ontologischen Sorgestruktur durch die Cura-Fabel des Hyginus. 1 In allen vorontologischen („vulgären“) Phänomenen zeigen sich nach Heidegger die Phänomene, auf die es der Phänomenologie als Ontologie ankommt, „je vorgängig und mitgängig, obzwar unthematisch“ (vgl. 31).
6 Die Sorge als Sein des Daseins
119
6.2 § 40. Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins Im § 40 wendet Heidegger sich zunächst nicht, wie angekündigt und zu erwarten, der nicht-intentionalen Stimmung der Angst zu, sondern einer bestimmte Weise der Intentionalität: der Verfallenheit. Dieses Strukturmoment des In-der-Welt-seins hat er charakterisiert als Sein-bei-innerweltlich-Seiendem und Mit-sein-mit-Anderen. Verfallenheit ist das Sein bei Zuhandenem oder Vorhandenem, aber auch bei anderem Dasein in Gestalt dessen, was gesprochen, geschrieben und sonst noch handelnd veröffentlicht wird. Daß Heidegger diese natürliche Einstellung der Intentionalität metaphorisch „Verfallenheit“ nennt, bringt erstens zum Ausdruck, daß Intentionalität sozusagen asymmetrisch ist: „normal“ ist die intentio recta und nicht die intentio obliqua als Sein bei uns selber. Zweitens bringt seine Metapher zum Ausdruck, daß wir durch das Öffentliche in Raum und Zeit „zunächst und zumeist“ so gefesselt und „benommen“ sind, daß wir auch uns selber nach dem Muster dessen begreifen und gestalten, was uns in der Öffentlichkeit begegnet: als Zuhandenes oder Vorhandenes (als Substanz) und als „Man“. Beides sind Weisen der Uneigentlichkeit.2 Heideggers Bestimmung der Verfallenheit ist notorisch zweideutig; zum einen meint sie formal den Aspekt der intentio recta, zum anderen konkret die Seinsweise der Uneigentlichkeit.3 2 Gegenüber der gängigen Reduktion der Seinsweise der Uneigentlichkeit auf die durchschnittliche Existenz des „Man“ ist es angebracht, daran zu erinnern, daß auch die Kategorienfehler, die wir begehen, wenn wir unsere Existenz nach dem Muster des Seins der Zuhandenheit oder Vorhandenheit begreifen, von Heidegger als „uneigentlich“ charakterisiert werden. Es handelt sich dann um den „Widerschein des uneigentlichen Selbst aus den Dingen“, die als vorhanden oder zuhanden verstanden werden (vgl. GA 24, 229). Eine zusammenfassende Definition dessen, was als „Uneigentlichkeit“ gilt, gibt Heidegger in Sein und Zeit (281). Uneigentlich ist ihm dort jede Seinsweise, die „das ‚Wesen‘ nicht trifft“ (vgl. dazu auch Merker 1989). 3 Ernst Tugendhat gehört zu den wenigen Interpreten, die auf die anscheinende Zweideutigkeit im Begriff der Verfallenheit aufmerksam gemacht haben. Einerseits zitiert er Heideggers Bemerkung, daß das Verfallen das Dasein „nicht an Seiendes“ ausliefert, das es nicht selbst ist, sondern es „in seine Uneigentlichkeit“ drängt, „in eine mögliche Seinsart seiner selbst“(Sein und Zeit, 178); andererseits bemerkt er auch, daß Heidegger „die Uneigentlichkeit vielfach als ein Verfallen an das innerweltliche Seiende versteht …, so daß er das ‚Verfallen‘ auch geradezu als formalen Terminus für das ‚Sein bei‘ innerweltlichem Seienden überhaupt verwenden kann.“ Diese Auffassung hätte „konsequenterweise auch zur Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Verfallens führen müssen“ (vgl. Tugendhat 1970, 315 f.). Für diese Auffassung gibt es auch einige Belege in Sein und Zeit (175, 338, 281). Wie es zu dieser anscheinenden Inkonsistenz kommt, läßt sich vielleicht so verständlich machen, daß Verfallen-
120
Barbara Merker
Überraschend ist im § 40 nun nicht nur, daß Heidegger statt von der Grundbefindlichkeit der Angst zunächst vielmehr nur von der Verfallenheit spricht, sondern auch die Erklärung, die er für dieses Phänomen gibt. Die Verfallenheit nämlich (im Sinne der intentio recta) erklärt er nicht zum Beispiel als evolutionär vorteilhaftes Faktum und auch nicht (im Sinne der Uneigentlichkeit des Man) als Folge unserer Endlichkeit oder entlastender Trägheit. Er erklärt sie vielmehr als in der Angst begründete Flucht vor uns selbst und unserer Eigentlichkeit und damit als ein, uns in der Regel allerdings nicht bewußtes, intentionales Verhalten. Methodisch bedeutsam ist dieser Rekurs auf die Verfallenheit für Heidegger, weil in der Abkehr der Flucht, das, wovor geflohen wird, eben unser eigenes Sein, zumindest latent bekannt sein muß. Existenziell ist „zwar im Verfallen die Eigentlichkeit des Selbstseins verschlossen und abgedrängt“, doch „diese Verschlossenheit [ist] nur die Privation einer Erschlossenheit, die sich phänomenal darin offenbart, daß die Flucht des Daseins Flucht vor ihm selbst ist … Nur sofern Dasein ontologisch wesenhaft durch die ihm zugehörende Erschlossenheit überhaupt vor es selbst gebracht ist, kann es vor ihm fliehen“ (184). Es ist erschlossen in der Abkehr, aber „nicht erfaßt“ oder „in einer Hinkehr erfahren.“ Daher kann innerhalb des „ontischen ‚weg von‘, das in der Abkehr liegt“, trotzdem in „phänomenologisch interpretierender ‚Hinkehr‘ das Wovor der Flucht verstanden und zu Begriff gebracht werden“ (185). Im § 40 macht Heidegger also zunächst deutlich, daß prinzipiell alle Seinsweisen des Daseins mit Blick auf die Struktur des Daseins ontologisch interpretierbar sind. Er orientiert sich dann aber an einer Seinsweise, die er heit im Sinne der intentio recta „zunächst und zumeist“ auch zur Uneigentlichkeit verführt, weil und solange wir nichts anderes als das in der Welt begegnende Seiende kennen. Erst die besonderen eigentlichen Erlebnisse, in denen wir „vor uns selber gebracht werden“ (zum Beispiel in der Angst oder Langeweile) ermöglichen eine „Befreiung“ von der Fesselung durch die Öffentlichkeit (vgl. dazu meine Ausführungen in Merker 1988, 61 ff.). Für die Interpretation der Verfallenheit als spezifische Weise dessen, was Husserl „Intentionalität“ nennt, spricht zum einen auch Heideggers Absicht, durch die Konzeption des Daseins als In-der-Welt-sein der Husserlschen Intentionalität das nötige Fundament zu verschaffen (vgl. Heidegger 1929, 16, 47; GA 24, 249 f.). Zum anderen sprechen für die Konzeption des Verfallens als Sein bei Seiendem in Raum und Zeit, also in der Öffentlichkeit, auch die Kant-Interpretationen Heideggers, in denen er die Verfallenheit explizit mit Kants angeblicher Entdeckung der für die Erkenntnis des Vorhandenen notwendigen Schematisierung der Kategorien des Verstandes durch den Raum in Zusammenhang bringt (vgl. Heidegger 1973, 193; GA 25, 64, 67 f.). Die gängige Interpretation der Verfallenheit als Uneigentlichkeit orientiert sich zumeist am § 38 von Sein und Zeit. Aber auch dort bemerkt Heidegger vorsichtig, daß das Sein und Aufgehen beim innerweltlichen Seienden „meist den Charakter des Verlorenseins in die Öffentlichkeit des Man“ hat (175) – „meist“ heißt aber nicht „immer“.
6 Die Sorge als Sein des Daseins
121
für besonders geeignet hält, das Sein des Daseins als Sorge zu bestimmen. Günstiger nämlich als der zunächst avisierte methodische Ausgang bei der Verfallenheit ist für den existenzialen Interpreten die Anknüpfung an Phänomene, in denen das Dasein als In-der-Welt-sein und Sorge für das Dasein selber nicht nur auf latente Weise, wie in der Verfallenheit, sondern auf manifeste Weise „durch sein eigenes Sein vor es selbst gebracht“ ist (184). Zwar ist „die Orientierung der Analyse am Phänomen des Verfallens grundsätzlich nicht zur Aussichtslosigkeit verurteilt, ontologisch etwas über das in ihm erschlossene Dasein zu erfahren“ (185). Die Interpretation ist keine „künstliche Selbsterfassung des Daseins“, sondern ist nur „Explikation dessen, was das Dasein selbst ontisch erschließt“ (185). Doch „die Möglichkeit, im interpretierenden Mit- und Nachgehen innerhalb eines befindlichen Verstehens zum Sein des Daseins vorzudringen, erhöht sich, je ursprünglicher das Phänomen ist, das methodisch als erschließende Befindlichkeit fungiert“ (185). Eine solche „ausgezeichnete Befindlichkeit“ (184) ist für ihn die Angst, die „für die existenziale Analytik eine grundsätzliche methodische Funktion“ (190) und daher auch methodischen Vorrang vor dem Ausgang der Analyse bei Phänomenen der Verfallenheit bzw. Uneigentlichkeit hat. Daß die Angst diesen methodischen Anforderungen genügt, muß aber zuerst noch gezeigt werden und „ist zunächst eine Behauptung“ (185). Prinzipiell erschließt nach Heidegger jede Weise des In-der-Welt-seins und damit auch jede Befindlichkeit das ganze Dasein als einheitliches Inder-Welt-sein.4 Daß die Angst aber auf besondere Weise geeignet ist, die Grundstruktur des Daseins als In-der-Welt-sein und Sorge mit den Möglichkeiten der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit zu erschließen, begründet er damit, daß in ihr alles innerweltlich Seiende (das Zuhandene und Vorhandene) und die öffentlichen Sinnangebote fremden Daseins, durch die wir uns zunächst und zumeist fremdbestimmen lassen, an Bedeutsamkeit verlieren. Während die Emotion der Furcht bestimmtes innerweltlich Seiendes als Bedeutsames, nämlich als Bedrohliches entdeckt, stört die Angst die Verfallenheit. Alles, was wir in der Welt entdecken, wird un4 Jede Befindlichkeit ist „auf Grund ihres Erschließens für die existenziale Analytik von grundsätzlicher methodischer Bedeutung. Diese vermag, wie jede ontologische Interpretation überhaupt, nur vordem schon erschlossenes Seiendes auf sein Sein gleichsam abzuhören. Und sie wird sich an die ausgezeichneten weittragendsten Erschließungsmöglichkeiten des Daseins halten, um von ihnen den Aufschluß dieses Seienden entgegenzunehmen. Die phänomenologische Interpretation muß dem Dasein selbst die Möglichkeit des ursprünglichen Erschließens geben und es gleichsam sich selbst auslegen lassen. Sie geht in diesem Erschließen nur mit, um den phänomenalen Gehalt des Erschlossenen existenzial in den Begriff zu heben“ (139 f.).
122
Barbara Merker
bedeutsam für uns; es gibt nichts mehr, woran wir uns mit Interesse klammern können. Die Angst nimmt uns somit die Möglichkeit, uns nach dem Muster dessen zu verstehen und zu gestalten, was uns öffentlich zugänglich ist. Sie nimmt uns die uneigentlichen Möglichkeiten zur Selbstinstrumentalisierung und Selbstverdinglichung ebenso wie zur Fremdbestimmung: sie zerstört uns als „Man“ und „vereinzelt“ uns.5 Und sie gibt uns damit die Möglichkeit, uns als uns selbst und ganzes zu erschließen: als je individuelles In-der-Welt-sein, dem es in seinem Sein um dieses Sein geht; das frei ist „für die Freiheit des Sich-selbst-wählens und -ergreifens“ (188), das sich also „als Möglichsein“ auf die Möglichkeiten der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit hin entwerfen kann. Sie zeigt, daß es uns letztlich nicht um bestimmte Weisen des Besorgens und bestimmtes Seiendes in der Welt, sondern um uns selber geht, darum nämlich, daß wir sind und zu sein haben. „Die verfallende Flucht in das Zuhause der Öffentlichkeit“ dagegen deutet Heidegger als „Flucht vor dem Unzuhause, das heißt der Unheimlichkeit, die im Dasein als geworfenen, ihm selbst in seinem Sein überantworteten In-der-Welt-sein liegt“ (189).6 Genau dieses aber ist nach Heidegger in der Angst erschlossen.
6.3 § 41. Das Sein des Daseins als Sorge Insgesamt unterscheidet Heidegger drei Aspekte der Angst: Das Sich-Ängstigen selber als (eigentliche) Weise des In-der-Welt-seins Das Wovor der Angst: das geworfene In-der-Welt-sein (Faktizität) Das Worum der Angst: das (eigene) In-der-Welt-Sein-können (Existenz,Verstehen/Entwurf)
5 Unter anderem hat die Angst auch die Funktion, die phänomenologischen Grundoperationen der transzendentalen Reduktion, Reflexion und eidetischen Reduktion, die nach Husserl eine notwendige Bedingung für die Erkenntnis transzendentaler Subjektivität sind, zu kritisieren, diese Leistungen zu ersetzen und seinem Interesse an der Erkenntnis des Seins des Daseins als Sorge anzupassen. Näher ausgeführt habe ich dies in Merker 1988, 74 ff. 6 Zweideutig ist auch Heideggers Verwendung des Ausdrucks „Angst“. Einerseits unterscheidet er eigentliche Angst und Furcht als uneigentliche Angst. Andererseits ist Angst für ihn immer eine eigentliche Befindlichkeit, die aber eigentlich und uneigentlich verstanden werden kann. So bleibt auch unklar, in welchem Sinne Angst „selten“ ist. Ist die Stimmung der (eigentlichen) Angst selten, obwohl sie eine Grundbefindlichkeit ist und also latent stets präsent ist oder ist das existenzielle und existenziale Verstehen der Angst selten? Vgl. zur Analyse der Stimmungen auch Rentsch 1985, 134 ff.
6 Die Sorge als Sein des Daseins
123
Das Faktum, daß wir ungefragt in der Welt sind und mit dieser Situation zurechtkommen müssen, nennt Heidegger Geworfenheit oder Faktizität. Das Faktum, daß es uns um unser eigenes Seinkönnen geht und wir daher auf die Situation der Geworfenheit: daß wir sind und zu sein haben, reagieren müssen, nennt er Entwurf oder Existenzialität. Indem wir uns auf durch die Faktizität begrenzte Möglichkeiten unserer selbst hin entwerfen, sind wir uns immer schon vorweg. Uns vorweg können wir aber nur sein, sofern wir schon irgendwo sind. Das Faktum, daß wir als endliche, bedürftige Wesen zum Zweck unseres Seinkönnens auf innerweltlich Seiendes angewiesen sind, nennt Heidegger Verfallenheit, das Sein bei innerweltlich Seiendem. Die Angst erschließt „vereinfacht“ diese existenzialen Charaktere des Daseins, die Faktizität, die Existenzialität und die Verfallenheit, die durch die Weisen des In-seins (Befindlichkeit, Verstehen und Rede) erschlossen werden. Heidegger formuliert Existenzialität, Faktizität und Verfallenheit sozusagen nur noch einmal mit Blick auf die folgenden Zeitanalysen um, wenn er das Sein des Daseins als das einheitliche, nicht zusammengestückelte Phänomen des Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt-) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden) und damit als Sorge bestimmt. Von dieser Sorgestruktur behauptet Heidegger, daß sie allen unseren eigentlichen und uneigentlichen Seinsweisen, auch allen konkreten Sorgen und Besorgungen zugrunde- bzw. in ihnen liegt. Entsprechend gibt es Phänomene wie Wünsche, Wollen, Drang und Hang nur, weil es uns in unserem Sein um dieses Sein geht. Allerdings ist die Sorge noch immer eine komplexe, in sich gegliederte Struktur, so daß die Frage nach der Ursprünglichkeit, Ganzheit und Einfachheit des Seins des Daseins sich erneut stellt, auf die Heidegger dann in den folgenden Analysen des Gewissens, des Vorlaufens zum Tode und der Zeitlichkeit des Daseins eine Antwort gibt.
6.4 § 42. Die Bewährung der existenzialen Interpretation des Daseins als Sorge aus der vorontologischen Selbstauslegung des Daseins Der § 42 ist vor allem der „Bewährung“ der Behauptung, das Sein des Daseins sei die Sorge, gewidmet. Daß die ontologische Explikation des Seins des Daseins als Sorge seinen methodischen Ansprüchen gerecht zu werden vermag und keine bloß willkürliche Konstruktion ist, versucht Heidegger durch Rekurs auf die alte Cura-Fabel des Hyginus zu belegen.
124
Barbara Merker
In dieser nämlich finden wir ihm zufolge eine vorontologische Selbstauslegung des Daseinsverständnisses als Sorge, die eben der gesuchte Beleg dafür ist, daß seine Analyse „keine Erfindung“ ist. Die Sorge, so wird es in der Fabel erzählt, geht über einen Fluß und formt, vermutlich nach dem Muster ihres Spiegelbildes im Wasser,7 aus Tonerde eine Gestalt, der der Gott Jupiter auf ihre Bitte hin Geist verleiht. Darauf entsteht ein Streit. Denn die Sorge möchte, daß das Gebilde nach ihr benannt wird, weil sie es geformt hat; die Erde möchte, daß es nach ihr benannt wird, weil es aus ihrem Material besteht; und Jupiter möchte, daß es nach ihm benannt wird, weil er dem Geschöpf den belebenden Geist verliehen hat. Sie bitten schließlich Saturn, den Gott der Zeit, um eine Schlichtung des Streits. Dieser entscheidet, daß nach dem Tod die Erde die Materie des Wesens zurückbekommen soll und Jupiter den Geist, daß aber, solange es lebt, die Sorge es besitzen soll. Weil es aber aus Erde (humus) gemacht ist, soll es Mensch (homo) heißen. – Für Heidegger ist diese frühe Selbstauslegung des Daseins ein Beleg dafür, daß die traditionelle Auffassung des Menschen als Kompositum aus Materie und Geist durch die Konzeption des Daseins als Sorge verbesserungsbedürftig ist und daß letztlich Zeit bzw. Geschichtlichkeit die „Substanz“ ist, aus der der Mensch gemacht ist. Um das mögliche Mißverständnis abzuwehren, daß die Dominanz des Daseins in seinen bisherigen Analysen auf eine „ontologische Grundlegung der Anthropologie“ hinauslaufe, erinnert Heidegger daran, daß auch die Daseinsanalytik ausschließlich im Dienst der Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt steht und daß das Dasein nur aufgrund seines Seinsverständnisses bislang Thema der Analyse war. Wegen seines fundamentalontologischen Hauptinteresses fehlen auch Untersuchungen, die für eine solche Grundlegung der Anthropologie unverzichtbar wären.
6.5 § 43. Dasein, Weltlichkeit und Realität Die Überlegungen des § 43 stehen im Zusammenhang mit den wichtigsten Ergebnissen aus den früheren Kapiteln, in denen Heidegger die Aufgaben seiner Daseinsanalytik mit Blick auf die Suche nach dem Sinn von Sein überhaupt bestimmt. Diese Aufgaben lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 7 Vgl. die Interpretation der Fabel von Blumenberg 1987, 197 ff.
6 Die Sorge als Sein des Daseins
125
Die Daseinsanalytik soll erstens das vorphilosophische (vorontologische, natürliche, alltägliche) und das traditionelle philosophische (ontologische, reflektierte) Verständnis unserer Selbst, der Welt und dessen, was es in ihr gibt, angemessen beschreiben und als unangemessen kritisieren. In unserer „durchschnittlichen Alltäglichkeit“ sind wir Heidegger zufolge selbstverloren, weltvergessen und seinsvergessen. Jedenfalls haben wir „zunächst und zumeist“ kein explizites Seinsverständnis von uns selbst, von der Welt, in der wir uns immer schon befinden, und von dem, was uns in der Welt begegnet. Unser Seinsverständnis ist „ontologisch unbestimmt“ (183), das heißt die Seinsweisen der Zuhandenheit, der Vorhandenheit und unserer selbst als Dasein werden nicht unterschieden, sondern nivelliert. Sobald wir aber versuchen, diese „natürliche Einstellung“ des Alltags in theoretischer, zum Beispiel philosophischer Einstellung explizit zu machen, unterliegen wir einer theoretischen „Grundtäuschung“8, die darin besteht, daß wir unsere disparaten Zugangsweisen zu dem, was es gibt, nach dem Muster theoretischer Einstellung deuten und alles, was es gibt, als vorhandene Dinge begreifen. Zweitens soll die Daseinsanalytik zeigen, wie es uns, dank Heidegger, trotzdem gelingen kann, diese unangemessenen Verständnisweisen zu durchschauen und im Gegenzug dazu zu einem jeweils angemessenen Seinsverständnis zu gelangen. Gegenüber dem impliziten nivellierenden Seinsverständnis der natürlichen Einstellung auf der einen Seite und dem expliziten eindimensionalen Seinsverständnis der theoretischen Einstellung auf der anderen Seite will Heidegger auf die nötigen Differenzierungen und Korrekturen aufmerksam machen und diese auch terminologisch fixieren. Diesem Zweck dient die Unterscheidung der Seinsweisen der Zuhandenheit (des Zeugs), der Vorhandenheit (der Dinge) und der Existenz (des Daseins) sowie der diesen korrespondierenden Weisen der Sicht (Umsicht, Vorsicht, Durchsicht).9 Drittens soll die Daseinsanalytik zeigen, wie es in der natürlichen, alltäglichen Einstellung zum einen und in der traditionellen philosophischen Einstellung zum anderen zu den unangemessenen Verständnisweisen kommt und wieso wir sie normalerweise nicht durchschauen. Das ontologisch unbestimmte, nivellierte Seinsverständnis der alltäglichen, natürlichen Einstellung; das reduktionistische theoretische Seinsverständnis; die Selbst-
8 GA 20, 254. 9 Vgl. den interessanten Versuch der Rekonstruktion dieser Unterscheidungen und der Rechtfertigung der Art der Unterscheidung bei Brandom 1992.
126
Barbara Merker
und Weltvergessenheit ist nach Heidegger ebenso wie die Uneigentlichkeit zurückzuführen auf das Strukturmoment des Daseins, das er Verfallenheit: das Sein bei innerweltlich Seiendem nennt. Indem wir an das verfallen, was uns in der Öffentlichkeit von Raum und Zeit begegnet, vergessen wir zum einen die Strukturen unseres Daseins, die Horizonte sozusagen, die diese Verfallenheit erst ermöglichen; zum anderen verstehen und entwerfen wir uns uneigentlich nach dem Muster dessen, was uns in der Öffentlichkeit begegnet. Wir verstehen uns als Zuhandene oder Vorhandene und in der Grenze der Möglichkeiten, die uns öffentlich angeboten werden, anstatt selber autonom zu entscheiden, welche Seinsmöglichkeiten wir ergreifen wollen. Viertens soll die Daseinsanalytik eine Terminologie entwickeln, die differenziert genug ist, diesem neuen und angemessenen Gesamtverständnis auch gerecht zu werden. Diesem Zweck dient unter anderem auch Heideggers Ersetzung der traditionellen und theoretisch voreingenommenen Rede von Bewußtsein und Selbstbewußtsein durch das Vokabular der Erschlossenheit (des Seins, des Daseins) und der Entdecktheit (des innerweltlich Seienden) und ebenso die Ersetzung der zur Ontologie des Vorhandenen gehörigen Rede von den Kategorien durch die für die Ontologie des Daseins angemessenere Rede von den Existenzialien. Diese Zusammenhänge also stehen im Hintergrund der Überlegungen des § 43, in dem Heideggers Hauptinteresse der traditionellen Ontologie gilt mit ihrer Orientierung am Erkennen vor anderen Weisen des In-derWelt-seins und der Dominanz des Seins als Vorhandenheit, Substanzialität, Realität, Dinghaftigkeit vor anderen Weisen des Seins. Die Genese dieser theoretischen Vorherrschaft schreibt Heidegger eben der Verfallenheit zu. Diese führt unter anderem zu der theoretischen Grundtäuschung, die eben darin besteht, daß das theoretische Erkennen alles Sein nach dem Muster der Vorhandenheit begreift. Dagegen behauptet Heidegger, daß Realität nicht die einzige und auch nicht die dominante Seinsweise ist, daß sie vielmehr zum einen nur eine Seinsweise unter anderen ist und daß sie zum anderen nur eine „abkünftige“, in Dasein, Weltlichkeit und Zuhandenheit fundierte Seinsweise ist. Alles Erkennen ist, wie Heidegger in früheren Überlegungen zu zeigen versucht hat, fundiert im Besorgen, das die Erschlossenheit der Welt und des Daseins voraussetzt. Im § 43 skizziert Heidegger unter den Stichworten: Glaube oder Skepsis bezüglich der Realität der Außenwelt; Beweise der Existenz der Außenwelt; Argumente pro und contra Realismus und Idealismus – bestimmte Probleme, die Philosophen traditionellerweise mit der Realität hatten. Die Strategie, mit der Heidegger diese alten Probleme traktiert, die nach
6 Die Sorge als Sein des Daseins
127
seiner Auffassung Scheinprobleme sind, besteht darin, jeweils auf die unausgesprochenen, in der Regel Cartesianischen oder transzendentalphilosophischen Prämissen dieser Probleme aufmerksam zu machen: daß ein isoliertes, weltloses, mentales, innerliches, reines Subjekt (res cogitans) vorausgesetzt wird, das die äußeren, in Raum und Zeit ausgedehnten Dinge der Welt erkennen soll (res extensa). So formuliert ist das Problem nach Heidegger aber unlösbar. Angemessen formuliert dagegen stellen sich die traditionellen erkenntnistheoretischen Probleme ihm zufolge gar nicht. Heideggers Konzeption des Daseins einmal vorausgesetzt, müssen wir unterstellen, daß wir immer schon in einer Welt sind und daß wir uns, weil es uns um unser Sein geht, auch immer schon in teleologischen Mittel-Zweck-Zusammenhängen bewegen und Zuhandenes entdeckt haben. Die theoretische Einstellung dagegen, in der wir uns in rein erkennender Absicht auf vorhandene, unbedeutsame Dinge in der Welt konzentrieren, setzt die fundamentaleren Weisen des In-der-Welt-seins voraus. Als Skandal erscheint ihm in dieser Perspektive nicht, daß noch immer ein Beweis der Existenz der Außenwelt fehlt, sondern daß immer wieder solche Beweise erwartet und versucht werden. Und den Grund dafür sieht er wieder in der Tendenz der Verfallenheit, das Sein des Daseins zu ignorieren und in der verfallenen theoretischen Perspektive die unterschiedlichen Weisen des In-der-Welt-seins auf das theoretische Erkennen zu reduzieren. Einerseits gibt er daher Philosophen wie Dilthey und Scheler recht, die beide darauf insistiert haben, daß Realität primär nicht im Denken und Erkennen, sondern in strebensmäßiger, voluntativer, praktischer Einstellung als Widerstand erfahrbar wird; andererseits aber kritisiert er sie auch, weil sie die Fundierung solcher Einstellungen im Sein des Daseins als Sorge nicht berücksichtigt haben. Der Gewaltstreich, das skeptische Problem der Existenz der Außenwelt durch Verweis darauf zu lösen, daß das Dasein immer schon in der erschlossenen Welt und bei innerweltlich entdecktem Seienden ist, erweist Heidegger als eine Art Common-sense-Realist,10 der derartige skeptische Zweifel im Kontext alltäglichen Besorgens für ausgeschlossen und unnatürlich hält. Andererseits zählt er sich aber auch einem sehr eigenwillig verstandenen Idealismus zu, insofern er auch diesem die Annahme unterstellt, daß es zwar Reales, Seiendes auch unabhängig vom Dasein gibt,
10 Vgl. zu der Hartnäckigkeit der Skeptiker gegenüber solchen Realisten die Diskussion bei Lanz 1998.
128
Barbara Merker
Realität dagegen als eine Seinsweise abhängig vom Seinsverständnis des Daseins ist. Aus dieser Perspektive begehen diejenigen, die nach der Bewußtseinsunabhängigkeit der Realität fragen, zudem noch einen Kategorienfehler, indem sie nicht nur, wie üblich, Existenzialität mit Substanzialität, sondern auch Sein mit Seiendem verwechseln.
6.6 § 44 Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit Im § 44 kommt Heidegger noch einmal auf die bisher gewonnenen Ergebnisse zurück, um sie aus einer anderen Perspektive neu zu beschreiben. Es geht ihm immer noch um das Dasein und seine Erschlossenheit, aber jetzt versucht er, diese in einen Zusammenhang mit dem alten philosophischen Problem der Wahrheit zu bringen. Heidegger will zeigen, welches der ursprüngliche Sinn von Wahrheit ist und wie es zu dem traditionellen Verständnis von Wahrheit als Übereinstimmung von Erkenntnis (Urteil, Satz, Aussage) und Wirklichkeit kommt, das seiner Auffassung nach „abkünftig“ und „verfallen“, ja verdinglicht ist. Um seinem eigenen Verständnis von Wahrheit größere Plausibilität zu verleihen, beruft er sich unter anderem auf eine umstrittene Etymologie: auf das griechische aletheuein, das nach seiner Übersetzung bedeutet: aus der Verborgenheit, Vergessenheit herausnehmen, entdecken. Wahr sind Heidegger zufolge nun nicht eigentlich Sätze bzw. Aussagen, sondern die Sachen selber, von denen sie handeln. In diesem Sinne bedeutet „wahr-sein“ für ihn dasselbe wie „entdeckt-sein“ oder, auf das Dasein selber bezogen, „erschlossen-sein“. Die Sachen selber sind wahr, wenn sie (in der Wahrnehmung zum Beispiel) entdeckt sind, wenn sie sozusagen für uns geworden sind. Primär wahr aber ist für Heidegger das Dasein selber, weil es dasjenige Seiende ist, das (innerweltliches) Seiendes entdeckt und sich selber erschließt. Durch Befindlichkeit, Verstehen und Rede erschließt sich das Dasein als „Selbst“, als „In-sein“ und als „Welt“, und im umsichtigen Besorgen und theoretischen Erkennen entdeckt es das innerweltlich Seiende. Das eigentliche Erschließen ist für Heidegger die ursprünglichste „Wahrheit der Existenz“. Ist erst einmal klar, in welchem Sinne Heidegger den Ausdruck „Wahrheit“ gebraucht, dann verlieren auch bestimmte, auf den ersten Blick überraschende Sätze von ihm ihre Provokation. Daß die Gesetze Newtons durch das Dasein erst wahr werden, ist unter der Voraussetzung seines Wahrheitsbegriffs ebenso trivial wie die Behauptungen, Wahrheit sei relativ auf das Dasein oder es könne keine ewigen Wahrheiten geben.
6 Die Sorge als Sein des Daseins
129
Mit der „ursprünglichen“ Bestimmung der Wahrheit als Entdecken und Erschließen scheint Heidegger zwar zu garantieren, daß etwas „für uns da“ ist. Aber läßt sich auch die Möglichkeit von Täuschung, von Irrtum in diese Wahrheitstheorie irgendwie integrieren? Heidegger stellt sich offenbar vor, daß die Sachen selber (das Dasein, das Sein, das Seiende) auf unterschiedliche Weise entdeckt bzw. erschlossen sein können: Die Sachen selber können entdeckt oder erschlossen sein so, wie sie an sich selber sind; sie können aber auch so entdeckt oder erschlossen sein, wie sie nicht an sich selber sind. Im Kontext seiner früheren Analyse des Phänomenbegriffs hat Heidegger diese Alternative nicht in der Terminologie des Entdecktseins oder Erschlossenseins, sondern in der Terminologie des Sich-zeigens formuliert: Das Seiende zeigt sich so, wie es an ihm selber ist, oder es zeigt sich so, wie es nicht an ihm selber ist; in diesem Falle zeigt es sich zwar, aber „im Modus des Scheins“. Etwas prätendiert ein Phänomen: das Sichzeigen der Sache selbst so, wie sie ist, zu sein, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Insgesamt scheint Heidegger die Ausdrücke „Entdecktheit“ und „Entdecken“, bzw. „Erschlossenheit“ und „Erschließen“ genauso zweideutig zu verwenden wie den Ausdruck „Phänomen“: einmal meint er damit das bloße „Für-uns-sein“ und „Sich-uns-zeigen“ in einem weiten Sinne, der das „Sich-als-es-selbst“ und „Sich-nicht-als-es-selbst-zeigen“ unter sich begreift; zum anderen scheint er die Ausdrücke aber auch in engerem und spezifischerem Sinne in Opposition zu „Verdecktheit“ und „Verdeckung“ im Sinne von „Schein“ und „Täuschung“ zu gebrauchen. Heidegger hat allerdings kein Interesse an „zufälligen“ Irrtümern und an „zufälligen“ Verdeckungen und Verschließungen anderer Art (wie zum Beispiel: noch nicht zur Kenntnis genommen haben, vergessen haben, nur unthematisch zur Kenntnis genommen haben).11 Ihn interessieren ausschließlich solche Verdeckungen und Verschließungen, die „wesenhaft“ und „notwendig“ sind. So sind dem Dasein als Seinsmöglichkeiten zum Beispiel alle jene notwendig verschlossen, die ihm aufgrund seiner Faktizität: weil es jeweils eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Situation ist, nicht in den Sinn kommen können. Computerspezialistin zu werden, wäre zum Beispiel als Seinsmöglichkeit für eine mittelalterliche Nonne unerschlossen und unerschließbar gewesen. Weiter 11 Als Arten der Verdecktheit der Phänomene hat Heidegger explizit unterschieden 1) Verdecktheit im Sinne der Unentdecktheit; 2) Verdecktheit im Sinne der Verschüttung (etwas war einmal entdeckt, verfiel aber wieder der Verdeckung und zwar entweder 2a) total oder 2b) bleibt sichtbar als Schein (36)).
130
Barbara Merker
können wir Heidegger zufolge aufgrund unserer Verfallenheit und unserer uneigentlichen Orientierung an öffentlich realisierten oder propagierten Seinsmöglichkeiten mögliche eigene gar nicht mehr entdecken.12 Notwendig verdeckend sind die uneigentlichen Seinsweisen seiner Meinung nach auch, weil wir, aufgrund unserer Endlichkeit, nicht mit allen Sachen persönlich in Kontakt kommen können, sondern nur noch – Stichwort „Stille Post“ – aus zweiter, dritter Hand von ihnen wissen: auf dem Umweg über das, was darüber gesagt und weitergesagt wird. Notwendig aufgrund der Verfallenheit ist auch das „Überspringen“ des Weltphänomens und die Verdeckung des In-der-Welt-seins selber.13 Wegen dieser notwendigen Verdeckungsstruktur behauptet Heidegger, das Dasein sei gleichursprünglich erschließend und verschließend, entdeckend und verdeckend, in der Wahrheit und Unwahrheit. Zunächst und zumeist sind seiner Auffassung nach wir selber als Sorge ebenso verdeckt wie das innerweltlich Seiende. Es zeigt sich zwar etwas, insofern ist es entdeckt, aber es zeigt sich zunächst und zumeist alles „im Modus des Scheins“. Diese Annahme ist der Ausgangspunkt der Phänomenologie Heideggers und bestimmt seine Konzeption von Phänomenologie: den Schein zu zerstören und die Sachen, so wie sie an sich selber sind, zu entdecken und zum Sich-zeigen zu bringen, also zum Phänomen zu machen. Heidegger versucht im § 44 zum einen zu zeigen, wie der traditionelle Wahrheitsbegriff, für den der Ort der Wahrheit das Urteil ist (genauer der ideale Gehalt des Urteils), in anderen Weisen des Entdeckens und dem ursprünglichen Phänomen der Wahrheit als Erschlossenheit fundiert ist. Das apophantische Als der Aussage, mit dem wir es zum Beispiel zu tun haben, wenn wir ein Bild an der Wand als schief beurteilen, setzt Heidegger zufolge das hermeneutische Als voraus, mit dem wir es zum Beispiel zu tun haben, wenn wir etwas als geeignet zum Verschönern der Wände der Wohnung interpretieren. Das hermeneutische Als wiederum setzt das Verstehen der Verweisungsbezüge der Welt voraus. Das Bild, das geeignet ist zum Verschönern der Wohnung, verweist auf die Sitte, etwas an die Wände zu hängen, auf bestimmte Geschmacksvorstellungen, zu denen 12 Interessant wäre es hier zu wissen, ob und wie Heidegger das „Entdecken“ im Fall von Seinsmöglichkeiten auch realistisch deuten würde. 13 Die Schwierigkeiten Heideggers, eine Vielfalt an Phänomenen auf die einfache Alternative des Verdeckens oder Entdeckens zu bringen, zeigen sich auch daran, daß die Phänomene, die zwischen der strikten Alternative des völligen Verdecktseins und der Entdecktheit der Sache, so wie sie an sich selber ist, liegen, stets in gewisser Hinsicht als verdeckt bzw. verschlossen und entdeckt bzw. erschlossen betrachtet werden können. Dies gilt insbesondere für das Dasein als In-der-Welt-sein selber.
6 Die Sorge als Sein des Daseins
131
auch gehört, daß Bilder nicht schief hängen sollten, auf die beiden Nägel, die ich nicht horizontal in die Wand geschlagen habe, auf den Keller, aus dem ich sie geholt habe, und den Laden, in dem ich sie gekauft habe, auf den Verkäufer, der mich bedient hat usw. Zum anderen versucht Heidegger, in umgekehrter Richtung, zu zeigen, wie es ausgehend von dem ursprünglichen Phänomen der Wahrheit als Erschließen und Entdecken (zu dem das Verschließen, das Verdecken, die Unwahrheit gehört) zu der verfallenen traditionellen Definition von Wahrheit als Übereinstimmung von intellectus und res kommt. Im Kontext des Besorgens sprechen wir uns gelegentlich über das entdeckte Seiende aus, indem wir zum Beispiel sagen „Das Bild an der Wand hängt schief!“, um jemanden dazu zu veranlassen, es wieder gerade zu hängen. Etwas auszusagen heißt, es zu veröffentlichen und damit auch zum Zuhandenen zu machen: zu etwas, das man benutzt, um anderen etwas über etwas mitzuteilen. Ein Hörer, der die Aussage versteht, entdeckt das Seiende so, wie es in der gehörten Aussage entdeckt ist, nämlich als schiefes Bild. Doch die veröffentlichte Aussage kann verstanden und das Gesagte kann weitergegeben werden, ohne daß der zum Beispiel wahrnehmende Bezug zum im Urteil entdeckten Seienden persönlich hergestellt wird. Es wird vergessen, daß dem im Urteil entdeckten Seienden ein ursprünglicheres, zum Beispiel wahrnehmendes, umsichtiges Entdecken vorausgeht; und es wird nicht gefragt, ob es vorausgegangen ist oder nicht. Losgelöst von der Herkunft im entdeckenden Dasein und vom Kontext des Besorgens wird die Aussage schließlich ebenso wie das, was sie jeweils entdeckt, als bloß Vorhandenes verstanden. Die intentionale Relation des Bezugs auf etwas (das Entdecken) wird als vorhandene Übereinstimmung der vorhandenen Aussage mit der vorhandenen Sache begriffen: als Übereinstimmung von Erkennen und Gegenstand, Subjekt und Objekt, Psychischem und Physischem oder von Bewußtseinsinhalten. Heidegger kritisiert diese verdinglichende Deutung von Übereinstimmung als vorhandener Beziehung zwischen Vorhandenem und interpretiert den Ausdruck „Übereinstimmung“ anders, so wie er auch den traditionellen Ausdruck „Wahrheit“ anders interpretiert hat. „Wahr-sein“ heißt für ihn „Entdeckt-sein“, „Übereinstimmen“ heißt „sich als Entdeckt-sein ausweisen“. Mit dieser Theorie bezieht er sich unter anderem auf Überlegungen, die Husserl unter dem Titel „intuitive Erfüllung einer signitiven Intention“ behandelt hat. Sein Beispiel für diese angemessen verstandene Adäquationstheorie ist das schon erwähnte schiefe Bild. Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand stehend sagt: „Das Bild hängt schief“ und dann mit Blick zur Wand gerichtet seine Behauptung durch Wahrnehmung bestätigt
132
Barbara Merker
findet, wird Heidegger zufolge die Übereinstimmungsbeziehung „phänomenal ausdrücklich“. Das in der Aussage bloß signitiv entdeckte, gemeinte Seiende ist die Sache selbst (das schiefe Bild und nicht irgendwelche Bilder, Ideen oder Vorstellungen im Bewußtsein). Und in der Wahrnehmung, der intuitiven Erfüllung, zeigt sich, daß das Bild in der Aussage genau so gemeint war, wie es an ihm selbst ist. Das im Urteil Gemeinte und das in der Wahrnehmung Gesehene stimmen überein. Das Urteil „bewährt sich“, das heißt das in ihm entdeckte Seiende zeigt sich als dasselbe wie das in der Wahrnehmung entdeckte. Soweit Heideggers Untersuchungen zur Wahrheit. Bevor er sich wieder der Frage nach dem Sinn von Sein zuwendet, stellt er aber die kritische Frage, ob die Sorgestruktur wirklich die „ursprünglichste Ganzheit“ des Seins des Daseins zum Ausdruck gebracht hat.
Literatur Blumenberg, H. 1987: Die Sorge geht über den Fluß, Frankfurt a. M. Brandom, R. 1992: Heidegger’s Categories in Being and Time, in: Dreyfus, H./Hall, H. (eds.), Heidegger: A Critical Reader, Cambridge/Mass., 45–64 Lanz, P. 1998: Kriterien der Angemessenheit für Erkenntnis – Gibt es das?, in: B. Merker/ G. Mohr/L. Siep (Hg.), Angemessenheit. Zur Rehabilitierung einer Metapher, Würzburg, 37–58 Merker, B. 1988: Selbsttäuschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phänomenologie, Frankfurt a. M. Merker, B. 1989: Konversion statt Reflexion. Eine Grundfigur der Philosophie Martin Heideggers, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Martin Heidegger: Innen- und Außenansichten, Frankfurt a. M., 215–243 Rentsch, Th. 1985: Heidegger und Wittgenstein. Existential- und Sprachanalysen zu den Grundlagen philosophischer Anthropologie, Stuttgart Tugendhat, E.1970: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin
7 Anton Hügli/Byung-Chul Han
Heideggers Todesanalyse (§§ 45–53)
7.1 Die Frage nach dem Ganzsein des Daseins und die Erfahrbarkeit des Todes des Anderen Mit dem Begriff der Sorge hat Heidegger die formal existenziale Strukturganzheit des Daseins, nämlich „Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt-) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden)“, zu fassen versucht (192). Heidegger stellt sich nun die Frage, ob die bisherige Daseinsanalyse, die von der Alltäglichkeit zur Ganzheit des Strukturganzen des Daseins als „Sorge“ vorgestoßen ist, der hermeneutischen Forderung nach der „Ursprünglichkeit“ genügt. Eine „ursprüngliche ontologische Interpretation“ müsse sich, so Heidegger, „ausdrücklich dessen versichern, ob sie das Ganze des thematischen Seienden in die Vorhabe gebracht hat“ (232). Er stellt dann fest, daß dies nicht der Fall ist. Die bisherige Daseinsanalyse hat sich auf das „uneigentliche Sein des Daseins und dieses als unganzes“ beschränkt (233). Diese Frage nach der Ganzheit des Daseins bestimmt Heideggers weitere Reflexionen. Aufgrund seiner Seinsart, nämlich des „Möglichseins“, ist das Dasein „mehr“ als es tatsächlich „ist“ (145). Es hat immer Seins-möglichkeiten vor sich, die noch nicht „wirklich“ sind. Zum Dasein gehört, solange es „existiert“, dieses „Noch-nicht“. Es steht immer etwas aus. So bestimmt die „Unganzheit“ bzw. der „Ausstand“ das Dasein. Die Behebung dieses „Seinsausstandes“ bedeutet aber keine Vervollständigung des Seins, sondern dessen Ende. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Tod ist zwar einerseits der Moment, wo alles „verwirklicht“, wo das Dasein „ganz“ wird, denn nach dem Tod gibt es keine zu „verwirklichende“ Möglichkeit mehr. Andererseits vernichtet er das Dasein gänzlich. Das Ganzsein fällt hier mit dem
134
Anton Hügli / Byung-Chul Han
Nicht-mehr-sein zusammen. So kann das Dasein die „Gänze“ seines Seins nicht erfahren: „Das Erreichen der Gänze des Daseins im Tode ist zugleich Verlust des Seins des Da. Der Übergang zum Nichtmehrdasein hebt das Dasein gerade aus der Möglichkeit, diesen Übergang zu erfahren und als erfahrenen zu verstehen“ (237). In diesem Sinne gälte auch für Heidegger das bekannte Wort Epikurs über den Tod: „Wenn ‚wir‘ sind, ist der Tod nicht da; wenn der Tod da ist, sind ‚wir‘ nicht“ (Epikur 1982, 45). Dem Dasein ist zwar bezüglich seiner selbst versagt, den Übergang vom Sein zum Nicht-mehr-sein sich zu vergegenwärtigen. Aber dieser Übergang, der das „ganze Leben“ beendet, ist beim Tod des Anderen objektiv zugänglich: „Um so eindringlicher ist doch der Tod Anderer. Eine Beendigung des Daseins wird demnach ‚objektiv‘ zugänglich“ (237). In Sein und Zeit spricht Heidegger nur an dieser Stelle vom Tod des Anderen. Dieser ist deshalb eindringlich, weil er den Tod zu einer „‚objektiven‘ Gegebenheit“ macht: „Das Dasein kann, zumal da es wesenhaft Mitsein mit Anderen ist, eine Erfahrung vom Tod gewinnen“ (237). Interessanterweise macht hier Heidegger das „Mitsein“ zu einer Bedingung der Möglichkeit für die „Erfahrung vom Tod“. Dieses „Mitsein“ ist für ihn allerdings nichts anderes als ein beobachtendes Dabeisein beim sterbenden Anderen. Ein solches Dabeisein rechtfertigt jedoch nicht Heideggers ausdrücklichen Hinweis, daß das Dasein „wesenhaft Mitsein mit Anderen“ (120, hervorgehoben vom Vf.) sei. Das beobachtende Dabeisein hat wenig mit der „Fürsorge“ zu tun, die das „Mitsein“ ausmacht. Auch die „defizienten Modi der Fürsorge“, nämlich das „Für-, Wider-, Ohne-einandersein, das Aneinandervorbeigehen, das Einander-nichts-angehen“ (121), sind nicht konstitutiv für die „objektive“ Feststellung des Todes Anderer. Wo ein ursprüngliches Mitsein tatsächlich im Spiel wäre, erführe man den Tod des Anderen nicht bloß „objektiv“ als Beendigung des Lebens. Inwieweit der Tod des Anderen für die Erfahrung des Todes überhaupt konstitutiv ist, ist aber nicht Heideggers Frage.1 Für die allein vom emphatischen Mitsein her mögliche Todeserfahrung, die für andere Denker, für Jaspers zum Beispiel (Jaspers 1932, 221 f.), Gabriel Marcel (Marcel 1959, 182) oder neuerdings Lévinas2 von 1 Auch bei Kierkegaard hat mein Tod den Vorrang gegenüber dem Tod des Anderen: „Sich selbst tot denken ist der Ernst; Zeuge sein beim Tode eines anderen ist Stimmung“ (Kierkegaard 1964, 177). 2 Lévinas wendet sich entschieden gegen die Heideggersche Deutung des Todes des Anderen. Angesichts des Todes des Anderen erwache man, so Lévinas, gerade „zur Verantwortung für den anderen Menschen“. (Lévinas 1995, 249). Lévinas spricht vom „Menschlichen, dessen Beunruhigung um den Tod des Anderen stärker als die Sorge um sich ist“ (Ebd.). Das „Wesen“
7
Heideggers Todesanalyse
135
zentraler Bedeutung ist, ist Heidegger, wie schon seine engsten Schüler kritisch vermerkten, seltsam blind. So stellt zum Beispiel Eugen Fink bei Heidegger „einen verhängnisvollen ‚Solipsismus‘ auch in der Todesphilosophie“ fest (Fink 1969, 38). Und Dolf Sternberger kritisiert bereits 1934 (vgl. Sternberger 1977), daß Heideggers Todesanalyse die Deskription des „Sterbens Anderer“ verfehlt. Die Erfahrung des Todes angesichts des Todes des Anderen ist für Heidegger ontologisch nicht von Bedeutung. Sie berührt für ihn nicht die Art und Weise, wie dem Dasein selbst sein Tod gegeben ist. Der Tod des Anderen kann darum, wie Heidegger anhand einer Phänomenologie des Toten zu zeigen versucht, kein Fundament für die Analyse der Daseinsganzheit liefern. Die im Tod erreichte „Gänze“ macht das Dasein des Anderen zum „Nichtmehrdasein im Sinne des Nicht-mehr-in-der-Welt-seins“. Zu beobachten ist ein „merkwürdiges Seinsphänomen“, „das sich als Umschlag eines Seienden aus der Seinsart des Daseins (bzw. des Lebens) zum Nichtmehrdasein bestimmen läßt“ (238). Aber das Dasein verschwindet dabei nicht gänzlich, sondern wird zum „Sein im Sinne des Nur-noch-vorhandenseins eines begegnenden Körperdinges“ (238), dem jedes Wozu bzw. jeder Bezug fehlt. Diese Aussage wird allerdings korrigiert: Es gibt immerhin ein Wozu, das die Leiche „mehr“ sein läßt als ein bloß vorhandenes Körperding. Sie kann nämlich ein „möglicher Gegenstand der pathologischen Anatomie werden, deren Verstehenstendenz an der Idee von Leben orientiert bleibt“. In dieser Hinsicht sei sie kein „lebloses materielles Ding“, sondern ein „des Lebens verlustig gegangenes Unlebendiges“ (ebd.). Heidegger unterscheidet hier ausdrücklich zwischen dem Leblosen und dem Unlebendigen, als hätte dieses doch mehr ‚Leben‘ als jenes. Offenbar bleibt Heideggers eigene Verstehenstendenz an der Idee des Lebens orientiert. Seine Blickrichtung, die in der Leiche einen Gegenstand der Anatomie, das heißt einen Bezug zum Leben und damit einen „Sinn“ sieht, entschärft vielleicht die Abgründigkeit des Toten. Die Leiche ist aber auch mehr als ein „umweltlich zuhandenes Zeug“. Sie hat einen Bezug zu den noch Lebenden. An dieser Stelle unterscheidet Heidegger interessanterweise zwischen dem „Verstorbenen“ und dem „Gestorbenen“. Im Gegensatz zum „Gestorbenen“ hat der „Verstorbene“ die
des Todes ist nicht mein Sterben, das zum „eigensten Seinkönnen“ führt, sondern die „Liebe in ihrer Verantwortung für den Anderen“ (Ebd.). Dem Tod begegnet man nicht in der Angst, die das Dasein auf es selbst vereinzelt. Vielmehr ruft der Tod des Anderen mich zur Verantwortung auf. Diese Verantwortung ist der Sinn des Todes: „Wir begegnen dem Tod im Angesicht des Anderen“ (Lévinas 1996, 116).
136
Anton Hügli / Byung-Chul Han
„Hinterbliebenen“. Das Versterben, das in der ganzen Todesanalyse kein einziges Mal erwähnt wird, ließe sich somit als ein interpersonales Geschehen begreifen, das verständlicherweise in die solipsistische Todesauffassung Heideggers nicht paßt. Das Versterben schließt ein Mitsein im Modus der „ehrenden Fürsorge“ ein. Aber dieser Modus der Fürsorge läßt sich schlecht mit der bisherigen Analyse der Fürsorge in Einklang bringen, nach der es zwei Modi der positiven Fürsorge gibt: die „einspringendbeherrschende Fürsorge“, die dem Anderen dessen „Sorge“ abnimmt und die „vorspringend-befreiende Fürsorge“, die dem Anderen dazu verhilft, „in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden“ (122). Da der Tote kein „Dasein“ ist, darum auch keine Sorge hat, kann man ihm weder „einspringend-beherrschende“ noch „vorspringend-befreiende Fürsorge“ entgegenbringen. Man kann ihm nämlich weder die Sorge abnehmen noch ihm dazu verhelfen, für seine Sorge „frei zu werden“. Die sogenannte „ehrende Fürsorge“ gegenüber dem Toten hat, so müßte man daraus schließen, innerhalb von Heideggers Daseinsanalyse keinen systematischen Ort. Aber sie hat eine wesentliche Funktion. Als ein Seins-Akt, als Handlung und Entwurf des noch lebenden Daseins macht sie den Toten zu einem Quasi-Lebenden (vgl. Han 1998, 17 f.). Die „ehrende Fürsorge“ wäre letzten Endes ein Widerstand gegen das reine, sinn-lose Nichts. Dieses wäre ein Skandalon. Hier folgt Heidegger in gewisser Hinsicht Hegel. Hegel spricht von einer ehrenden Fürsorge der Lebenden gegenüber dem Toten. Die ehrende Fürsorge der Familie als „Bewegung des Bewußtseins“ entzieht den Toten der unvernünftigen Macht der Natur und befreit ihn von der Verwesung als einem „ihn entehrenden Tun“, „damit auch sein letztes Sein, dies allgemeine Sein, nicht allein der Natur angehöre und etwas Unvernünftiges bleibe, sondern daß es ein getanes, und das Recht des Bewußtseins in ihm [sc. im Toten] behauptet sei.“3 Die Arbeit der Familie macht den Tod zu einem Tun, zu einem Werk des Bewußtseins. So macht sie aus dem Toten einen Quasi-Lebenden: „Die Blutsverwandtschaft ergänzt also die abstrakte natürliche Bewegung dadurch, daß sie die Bewegung des Bewußtseins hinzufügt, das Werk der Natur unterbricht, und den Blutsverwandten der Zerstörung entreißt …“4. Die Bestattung als eine „Bewegung des Bewußtseins“ setzt dem Tod den Schein des Lebens entgegen. Das Bewußtsein überlebt gleichsam den Tod.
3 Hegel 1988, 295. 4 Ebd., 296 f.
7
Heideggers Todesanalyse
137
Heideggers Phänomenologie des Todes, so der offensichtliche Befund, hilft nicht weiter in Bezug auf die existenziale Analyse des Todes. Am Tod des Anderen wird uns zwar objektiv zugänglich, wie das Dasein endet. Aber wie der sterbende Andere selbst den Tod erleidet, entzieht sich der Beobachtung: „Wir erfahren nicht im geringsten Sinne das Sterben der Anderen, sondern sind höchstens immer nur ‚dabei‘“ (239). Für Heidegger ist dies offensichtlich ein phänomenaler Beleg für die von ihm vertretene These, daß der Tod „unvertretbar“ sei: „Das Sterben muß jedes Dasein jeweilig selbst auf sich nehmen. Der Tod ist, sofern er ‚ist‘, wesensmäßig je der meine“ (240). Unmöglich ist das „Sterben für …“. Einer kann zwar für den anderen in den Tod gehen, aber solches Sterben für … kann „nie bedeuten, daß dem Anderen damit sein Tod im geringsten abgenommen sei“ (ebd.).
7.2 Unvertretbarkeit des Todes Die These von der Unvertretbarkeit des Todes wird von Heidegger im strengsten Sinn verstanden: Der Tod unterscheidet sich von allen anderen Seinsmöglichkeiten darin, daß er allein unvertretbar ist. Zu den vom „Besorgen“ bestimmten Seinsmöglichkeiten dagegen gehört die Vertretbarkeit: „Jedes Hingehen zu …, jedes Beibringen von … ist im Umkreis der nächstbesorgten ‚Umwelt‘ vertretbar. […] Bezüglich dieses Seins, des alltäglichen Miteinanderaufgehens bei der besorgten ‚Welt‘, ist Vertretbarkeit nicht nur überhaupt möglich, sie gehört sogar als Konstitutivum zum Miteinander. Hier kann und muß sogar das eine Dasein in gewissen Grenzen das andere ‚sein‘“ (239 f.). Für den Tod dagegen gilt dies nicht. „Keiner kann“, wie Heidegger in Anlehnung an ein bekanntes Luther-Wort sagt,5 „dem Anderen sein Sterben abnehmen. Jemand kann wohl ‚für einen Anderen in den Tod gehen‘. Das besagt jedoch immer: für den Anderen sich opfern ‚in einer bestimmten Sache‘“(240). Aber trifft diese These der Unvertretbarkeit zu? Heidegger berücksichtigt hier nicht, daß nicht jede Seinsmöglichkeit des alltäglichen Mitseins vertretbar ist. Nicht „jedes Hingehen zu …“ kann der Andere übernehmen. Ein Anderer kann zwar an meiner Stelle in die Buchhandlung gehen, um ein Buch zu kaufen. Aber niemand kann für mich zum Arzt gehen, um
5 Vgl. Luther 1906, 1: Keiner kann „für den andern sterben. Sonder ein yglicher in eygner person für sich mit dem todt kempffen.“
138
Anton Hügli / Byung-Chul Han
sich für mich behandeln zu lassen. „Keiner kann“, wie schon Sartre zu Recht hervorhebt, „für mich lieben, wenn man darunter versteht, die Eide leisten, die meine Eide sind, die Emotionen finden (wie banal sie auch sein mögen), die meine Emotionen sind“ (Sartre 1991, 918 f.). Es gibt im Grunde wenig Seinsmöglichkeiten, bei denen ich wirklich vertretbar wäre. Insofern ist die These, daß keiner mir das Sterben abnehmen kann, in bestimmter Hinsicht recht banal. Nicht nur im Tod geht es dem Dasein um sich selbst. Was ist dann überhaupt das besondere der Unvertretbarkeit des Todes, um die es Heidegger geht? Sartre vertritt gegen Heidegger die These, daß nicht der Tod als solcher schon die „unersetzbare Selbstheit“ nach sich zieht: „Ganz im Gegenteil, er [sc. der Tod ] wird mein Tod nur dann, wenn ich mich schon in die Perspektive der Subjektivität begebe; meine Subjektivität, definiert durch das ‚präreflexive Cogito‘, macht aus meinem Tod ein unersetzbares Subjektives, und nicht der Tod ist es, der meinem Für-sich die unersetzbare Selbstheit gibt“ (ebd., 920). Das „präreflexive Cogito“ ist aber, dies wäre gegen Sartres Einwand zu vermerken, nicht schon jene Emphase des Selbst, die den Tod zu meinem Tod macht. Das „präreflexive Cogito“ ist bereits in jenem alltäglichen Besorgen am Werk, von dem Heidegger gerade die durch meinen Tod zu ermöglichende eigentliche Existenz abhebt. Im alltäglichen Besorgen geht es dem Dasein immer schon um sich selbst. „Man“ besorgt sich zum Beispiel etwas um seiner selbst willen. In diesem unausdrücklichen Um-meiner-selbst-Willen, dessen man sich oft nicht „bewußt“ ist, ist bereits ein präreflexiver Selbstbezug am Werk. Mein Tod dagegen geht mit einem ausdrücklichen Sich-Ergreifen einher, nämlich mit dem emphatischen Selbstbezug, der „mehr“ ist als das „präreflexive Cogito“. Niemand kann für mich spazieren gehen. Lächerlich wäre es aber, mit Emphase von meinem Spaziergang zu sprechen. Dieses „mein“ ließe sich nicht zu einem emphatischen „mein“ wie in mein Tod dramatisieren. In meinem Tod geht es gänzlich und in jeder Hinsicht um mich, nämlich um mein Sein und nicht bloß um eine bestimmte Seinsmöglichkeit des Besorgens.
7.3 Die existenzial-ontologische Struktur des Todes Der Tod ist zunächst das Ende des Seins bzw. des Lebens. Das Dasein verhält sich aber, solange es „ist“, zu diesem Ende. Es ist, solange es ‚ist‘, zum Tode. Heidegger nennt dieses Sein zum Tode einfach auch Tod. Damit identifiziert er aber das Sein zum Tod nicht mit dem Tod. Für den Tod im Sinne des Endes vom Leben reserviert Heidegger den Ausdruck
7
Heideggers Todesanalyse
139
„Ableben“. So stirbt, das heißt ist das Dasein zum Tod nur vor dem Ableben: „Seiend zu seinem Tode, stirbt es faktisch und zwar ständig, solange es nicht zu seinem Ableben gekommen ist“ (259). Der Tote wäre unsterblich, das heißt er kann nicht zum Tod sein. Das „Enden“ definiert Heidegger entsprechend. Das „Enden“ ist ein Sein zum Ende. Das Dasein kann enden, das heißt zum Ende sein, nur solange es nicht „zu Ende“ gekommen ist: „Der Tod ist als Ende des Daseins im Sein dieses Seienden zu seinem Ende“ (259). Heideggers Interesse gilt nicht primär jenem Tod, der das ‚Leben‘ beendet. Vielmehr lenkt er den Blick auf das Sein zum Tod. Er fragt, wie der Tod sich innerhalb des Seins artikuliert. So gesehen ist der Tod ein „Phänomen des Lebens“ (246). Er ist kein bloßes Ereignis, das dem Leben das Ende bereitet. Vielmehr ist er innerhalb des Seins bzw. des Lebens „am Werk“. Das eigentliche Thema Heideggers ist, so kann man daher mit Recht sagen, im Grunde nicht der „Tod“, sondern die Sterblichkeit des Menschen. Hinsichtlich des traditionellen Todesdenkens (vgl. Hügli 1999a) hat Heideggers Todesanalyse darum auch einen besonderen Stellenwert. Der Tod ist bei Heidegger ein dem „Leben“ innewohnendes Phänomen, im Gegensatz etwa zu all jenen Todesauffassungen, die – gleichsam von einem jenseitigen Leben her blickend – den Tod in Analogie zu den Phänomenen der Verwandlung und des Vergehens 6 als ein objektivierbares Geschehen auffassen. Heidegger selbst sucht vor allem in der christlichen Tradition eine Bestätigung seiner Todesauffassung. So habe die christliche Anthropologie von Paulus an bis zu Calvins Meditatio futurae vitae bei der Interpretation des ‚Lebens‘ den Tod „mitgesehen“.7 Heidegger weist ferner auf Dilthey und Simmel als seine Gewährsmänner hin (249 Anm.). Nach Simmels Lehre ist der Tod das jedem Einzelnen innewohnende apriorische 6 Zu diesem klassischen Deutungsmuster gehört die Auffassung vom Tod als Ortsveränderung, als qualitative oder quantitative Veränderung, als Eingehen ins Alleine (vgl. dazu Hügli 1973, 3 ff.). 7 Auch in der das gesamte Mittelalter bestimmenden Todesauffassung bleibt der Tod innerhalb des Lebens bedeutsam (vgl. Fischer 1954, 132–142). Mit dem Tod entscheidet sich endgültig, ob der Mensch das ewige Leben erreicht oder der Verdammnis anheimfällt. Die Mahnung, noch heute den Grund zum ewigen Leben zu legen und sich täglich zum Sterben zu bereiten (Thomas von Kempen 1987, 93: „Glücklich, wer die Stunde seines Hinscheidens immer vor Augen hat und sich täglich auf das Sterben vorbereitet!“), wird in der Folge, vor allem im späten Mittelalter, zur Botschaft des Contemptus Mundi, des Memento Mori und der Totentänze. Die ständige Erinnerung an den jederzeit bevorstehenden Tod, der „als Lehrmeister des Ernstes“ den Menschen dazu anhält, „sich selbst aufzusuchen“ (Kierkegaard 1964, 178), bleibt darüber hinaus ein Grundmotiv der erbaulichen Literatur (vgl. 235 Anm.). Zu dieser Tradition im Ganzen vgl. Hügli 1999 b.
140
Anton Hügli / Byung-Chul Han
und formgebende Moment (Simmel 1910/11, 57 ff.). Als innere Form sei der Tod nicht in dem Sinne eine Grenze, „in dem der unorganische Körper dadurch räumlich zu Ende ist, daß ein anderer sich gegen ihn schiebt und ihm seine Form – als Aufhören seines Seins – bestimmt“, er trete nicht erst, im Sinne der gängigen „Parzen-Vorstellung“, in einem bestimmten Zeitpunkt der Lebensbahn auf, sondern sei mit dem Leben schon im keimenden Samen verbunden (ebd., S. 58 f.). Simmel spricht dabei – ähnlich wie Rilke – von einem Wachsen und Reifen des Todes im Leben des einzelnen (Simmel 1919, 90). Simmel unterscheidet aber, wie Heidegger richtig bemerkt, nicht zwischen der biologisch-ontischen und der ontologischexistenzialen Dimension des Todes. Der Tod, der im Leben „am Werk“ ist, ist für Heidegger weder biologisches noch ontisches bzw. objektiv feststellbares Phänomen. Er ist zunächst, dies setzt Heidegger stillschweigend voraus, das Ende des Lebens. Das Dasein verhält sich aber ständig zu diesem Ende. Das Sein bestimmt sich also vom Ende her. „Sterben“ ist Sein zum Tod. Im folgenden soll erläutert werden, wie der Tod das Leben bestimmt, und zwar ausgehend von der Interpretation der Strukturmomente des Todes. Nach Heidegger kennzeichnen fünf Strukturmomente den Tod: „Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des Daseins“ (258 f.).
7.3.1 Der Tod ist die „eigenste“ Möglichkeit Der Tod erschließt dem Dasein sein „eigenstes Seinkönnen“ (263). Dies setzt Heidegger der Seinsweise des „Man“ entgegen. Das „Man“ handelt nach den Entscheidungs- und Verstehensmustern der „öffentlichen Ausgelegtheit“. Angesichts des Todes erwacht ein emphatisches Selbst-seinKönnen. Das Dasein ergreift sich selbst eigens, statt sich der „Öffentlichkeit“ zu überlassen. Die Unvertretbarkeit des Todes, meines Todes wird in die Unvertretbarkeit meines Seins übersetzt. Angesichts des Todes, der auch das Ende des „mein“, des Selbst bedeutet, zieht sich das Dasein auf sich selbst zurück. Die Emphase des Selbst bzw. die Entschlossenheit zum eigensten Selbst ließe sich als eine Re-Aktion auf jenen Tod deuten, der das Ende des Selbst wäre. Das Sein zum Tod ist ein „Vorlaufen in die Möglichkeit“ (262). Damit ist kein bloßes „Denken an den Tod“ gemeint, der irgendwann „Wirklichkeit“ werden wird, das heißt noch eine „Möglichkeit“ ist. Die „Möglichkeit“, in die das Dasein vorläuft, bezeichnet vielmehr eine Seinsmöglichkeit, näm-
7
Heideggers Todesanalyse
141
lich die Möglichkeit, eigentlich bzw. Selbst zu sein. Das heißt die „Möglichkeit“ des „Todes“, der das Ende des Seins wäre, wird übersetzt in die „Möglichkeit des eigensten äußersten Seinkönnens“, das heißt des Selbstsein-könnens: „Das Vorlaufen erweist sich … als Möglichkeit eigentlicher Existenz“ (263).
7.3.2 Der Tod ist die „unbezügliche“ Möglichkeit Der Tod „beansprucht“ das Dasein „als einzelnes“. Er „vereinzelt das Dasein auf es selbst“ (263). Es ist wiederum die angesichts des Todes erwachende Emphase des „mein“, die zur Vereinzelung des Daseins führt. Angesichts des Todes verlieren alle innerweltlichen Bezüge ihre Verbindlichkeit. Übrig bleibt nur das nackte „mein“ bzw. Selbst. Dieses bildet die Schwerkraft des Seins. Die Unbezüglichkeit geht mit einem emphatischen Selbstbezug einher. Aufgrund dieser Unbezüglichkeit des Todes „versagt“ auch „jedes Mitsein mit Anderen“.
7.3.3 Der Tod ist die „unüberholbare“ Möglichkeit Zur Unüberholbarkeit des Todes schreibt Heidegger: „Die eigenste, unbezügliche Möglichkeit ist unüberholbar. Das Sein zu ihr läßt das Dasein verstehen, daß ihm als äußerste Möglichkeit der Existenz bevorsteht, sich selbst aufzugeben“ (264). Zu klären sind hier zwei Begriffe, nämlich „Möglichkeit“ und „Bevorstand“. Heideggers Gebrauch des Begriffes „Möglichkeit“ ist doppeldeutig. Der Tod ist zunächst die „äußerste Möglichkeit der Existenz“, „sich selbst aufzugeben“. Die Selbstaufgabe im Tod ist möglich, weil sie noch nicht Wirklichkeit geworden ist. „Irgendwann“ wird das Dasein aufhören, zu „existieren“. Heidegger versteht die Möglichkeit auch von diesem Noch-nicht her. Aber das Dasein ist zugleich dieses Nochnicht. Das heißt das Dasein ist zum „noch nicht“ eingetretenen Tod bzw. Ableben. So ist der Tod nicht bloß das „Mögliche“, das „später“ eintreffen wird, und zwar als ein Ereignis, das das Sein bzw. das Selbst aufhebt. Solange das Dasein dieses Noch-nicht immer schon ist, ist der Tod nicht bloß die „Möglichkeit“ des Nicht-mehr-sein-Könnens, sondern eine „Seinsmöglichkeit“. Er wird als die Möglichkeit des Selbst-sein-Könnens interpretiert, nämlich als Seinsmöglichkeit, „eigentlich“ zu existieren. Heidegger spricht zwar von der „Geworfenheit in den Tod“. Aber der Tod bzw. das Sterben bleibt für ihn weitgehend ein „Akt“ oder ein „Voll-
142
Anton Hügli / Byung-Chul Han
zug“. Auch der Tod als „äußerste Möglichkeit der Existenz, sich selbst aufzugeben“ ist aktivistisch verstanden. Und der Tod ist eine vom Dasein zu übernehmende Seinsmöglichkeit. Gegen diesen Aspekt der Heideggerschen Todesdeutung richtet sich Sartres Kritik. Der Tod ist für Sartre eine „jederzeit mögliche Nichtung meiner Möglichkeiten, die außerhalb meiner Möglichkeiten liegt“ (Sartre 1991, 923). Er ist ein kontingentes Faktum, der Freiheit des Für-sich-Seins völlig entzogen und darum sinnlos, absurd, „ein reines Faktum wie die Geburt; er geschieht uns von draußen und verwandelt uns in Draußen“ (Sartre 1991, 937). Man kann ihn weder gedanklich erfassen noch erwarten noch sich gegen ihn wappnen; es gibt ihm gegenüber weder eine eigentliche noch eine uneigentliche Haltung (Sartre 1991, 920 ff.). Der Tod steht dem Dasein gewiß bevor. Dies wird Heidegger nicht bestreiten: „Das Ende steht dem Dasein bevor“ (250). Aber der Tod als „Bevorstand“ bedeutet nicht nur, daß der Tod irgendwann kommen wird. Der bevorstehende Tod wird vielmehr ins Sein übersetzt. Angesichts des „bevorstehenden“ Todes steht das Dasein vor der Seins-möglichkeit des eigensten Sein-Könnens, nämlich des Selbst-sein-Könnens. Sonst machte die folgende Formulierung Heideggers nicht viel Sinn: „Der Tod ist eine Seinsmöglichkeit, die je das Dasein selbst zu übernehmen hat. Mit dem Tod steht sich das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkönnen bevor“ (250). Heidegger spricht in bezug auf den Tod vom „übernehmen“. Eine Arbeit oder eine Aufgabe kann man übernehmen. Aber man kann den Tod als Ende des Seins nicht so übernehmen wie man eine Arbeit übernimmt. Man „stirbt“ ja ohne jedes eigene Hinzutun. Die Rede vom „übernehmen“ ist nur dann sinnvoll, wenn der „Gegenstand“ des Übernehmens das vom Ende her bestimmte Sein selbst ist. Übernommen wird vom Dasein nicht der Tod als Ende des Seins. Vielmehr übernimmt das Dasein jenes „eigenste Seinkönnen“. Mit der Übernahme des eigensten Seinkönnens wird man gleichsam dem Anspruch des Todes gerecht.8 Das eigenste Seinkönnen, das heißt das Selbst-sein-Können ist eine zu übernehmende Aufgabe, vor die der Tod das Dasein stellt. Das Sein zum Tod als emphatisches SelbstSein ist aber nicht das einzig mögliche Verhältnis zum Tod. Denkbar ist eine Erfahrung des Todes, die gerade den gesteigerten Selbstbezug in Frage stellt. Sie zöge nicht die „Entschlossenheit“, sondern eine Gelassenheit nach sich (vgl. dazu Han 1998, 70–73).
8 „Der Tod ‚gehört‘ nicht indifferent nur dem eigenen Dasein zu, sondern er beansprucht dieses als einzelnes“ (263).
7
Heideggers Todesanalyse
143
Angesicht des Todes sind „alle Bezüge zu anderem Dasein gelöst“ (250). Da das Dasein aber immer ein Mitsein ist, müssen die Beziehungen zu anderem Dasein wiederaufgenommen werden. Das Versagen des Mitseins angesichts des Todes bedeutet also nicht, daß das Dasein kein Mitsein mehr ist, daß es angesichts des Todes in der Isolierzelle des Ich verharren muß: „Das Versagen des Besorgens und der Fürsorge bedeutet jedoch keineswegs eine Abschnürung dieser Weisen des Daseins vom eigentlichen Selbstsein. Als wesenhafte Strukturen der Daseinsverfassung gehören sie mit zur Bedingung der Möglichkeit von Existenz überhaupt. Das Dasein ist eigentlich es selbst nur, sofern es sich als besorgendes Sein bei … und fürsorgendes Sein mit … primär auf sein eigenstes Seinkönnen, nicht aber auf die Möglichkeit des Man-selbst entwirft“ (263). Das Sein zum Tod zieht also kein totales Versagen des Mitseins nach sich, sondern modifiziert dies. Sehr vage ist jedoch Heideggers Beschreibung des vom Tod modifizierten Mitseins. Inwiefern verändert das Selbst-sein, zu dem das eigentliche Sein zum Tod führt, das Sein zum Anderen? Im Zusammenhang mit der Unüberholbarkeit des Todes schreibt Heidegger: „Frei für die eigensten, vom Ende her bestimmten, das heißt als endliche verstandenen Möglichkeiten, bannt das Dasein die Gefahr, aus seinem endlichen Existenzverständnis her die es überholenden Existenzmöglichkeiten der Anderen zu verkennen oder aber sie mißdeutend auf die eigene zurückzuzwingen – um sich so der eigensten faktischen Existenz zu begeben. Als unbezügliche Möglichkeit vereinzelt der Tod aber nur, um als unüberholbare das Dasein als Mitsein verstehend zu machen für das Seinkönnen der Anderen“ (264). Das Dasein wird angesichts der unüberholbaren Möglichkeit des Todes der Endlichkeit seines Seins, seiner Seinsmöglichkeiten gewahr. Es verzichtet darauf, die sein endliches Sein überholenden Seinsmöglichkeiten des Anderen zu überholen, das heißt diese auf seine eigene Seinsmöglichkeit „zurückzuzwingen“. So wird die in die Endlichkeit meines Seinkönnens übersetzte Unüberholbarkeit des Todes interpretiert als die Unüberholbarkeit der Seinsmöglichkeiten des Anderen. Dieses Sein zum Anderen ist weitgehend identisch mit jenem eigentlichen Miteinander, das darin besteht, „die mitseienden Anderen ‚sein‘ zu lassen in ihrem eigensten Seinkönnen“ (298). Die Unüberholbarkeit des Todes wirkt sich aber vor allem auf den Umgang mit den eigenen Seinsmöglichkeiten aus: „Das Vorlaufen erschließt der Existenz als äußerste Möglichkeit die Selbstaufgabe und zerbricht so jede Versteifung auf die je erreichte Existenz“ (264). Die Unüberholbarkeit des Todes wird übersetzt ins Sein, das heißt, sie wird erfahren als Endlichkeit meines Seins. Zur Endlichkeitserfahrung gehört die Endlichkeit der je erreichten Existenz, die hier der „Versteifung“ entgegengesetzt wird.
144
Anton Hügli / Byung-Chul Han
7.3.4 Der Tod ist die „gewisse“ Möglichkeit Die Gewißheit des Todes bedeutet nicht bloß, daß der Tod „gewiß“ kommt.9 Wie jedes Strukturmoment des Todes wird auch die Gewißheit des Todes ins Sein übersetzt. Angesichts der Gewißheit des Todes vergewissert sich das Dasein seines Seins. So wird das Dasein angesichts des Todes „des In-derWelt-seins gewiß“ (265). Heidegger schreibt: „Im Vorlaufen kann sich das Dasein erst seines eigensten Seins in seiner unüberholbaren Ganzheit vergewissern“ (265). Die Gewißheit des Todes wird so zur „Daseinsgewißheit“ (256). Angesichts des Todes vergewissert, versichert sich das Dasein seines Seins. Dies läßt sich als eine bestimmte Reaktion des Daseins auf den Tod verstehen, der gerade sein Sein aufhebt.
7.3.5 Der Tod ist die „als solche unbestimmte“ Möglichkeit Man weiß nicht, wann man stirbt. Heidegger geht zunächst von der Unbestimmtheit dieses Wann aus: „Wie entwirft sich das vorlaufende Verstehen auf ein gewisses Seinkönnen, das ständig möglich ist, so zwar, daß das Wann, in dem die schlechthinnige Unmöglichkeit der Existenz möglich wird, ständig unbestimmt bleibt?“ (265) Im Zusammenhang mit der Ungewißheit des Todes spricht Heidegger von „Bedrohung“ und „Angst“. Das Wovor der Angst ist jedoch nicht das „bevorstehende“ Ende des Lebens, sondern das „eigenste Seinkönnen“: „Die Angst vor dem Tod ist Angst „vor“ dem eigensten, unbezüglichen und unüberholbaren Seinkönnen. Das Wovor dieser Angst ist das In-der-Welt-sein selbst. Das Worum dieser Angst ist das Sein-können des Daseins schlechthin. Mit einer Furcht vor dem Ableben darf die Angst vor dem Tod nicht zusammengeworfen werden“10 (251). In der Analyse der Angst war vom Tod überhaupt nicht die Rede (vgl. § 40). Zur Angst heißt es: „Die ‚Welt‘ vermag nichts mehr zu bieten, ebensowenig das Mitsein Anderer. Die Angst benimmt so dem Dasein die 9 Eine Frage, die Heidegger offen läßt, ist die nach dem Ursprung unserer Todesgewißheit. Scheler hat sie als einer der ersten explizit aufgeworfen (Scheler 1986, 16 ff.). Das Wissen vom Tod ist nicht ein Ergebnis der äußeren, auf Beobachtung und Induktion beruhenden Erfahrung vom Sterben der anderen Menschen, sondern eine Gewißheit ganz anderer Art. 10 Im Gegensatz zur Furcht bezieht sich die Angst nicht auf ein bestimmtes Objekt, sondern aufs Sein selbst. Sie ist eine Stimmung, die Heidegger in Anlehnung an Kierkegaard vom Gefühl unterscheidet. Die Intentionalität des Gefühls, zum Beispiel Furcht, setzt ein konkretes Objekt voraus. Vgl. Han 1996, S. 20–32.
7
Heideggers Todesanalyse
145
Möglichkeit, verfallend sich aus der ,Welt‘ und der öffentlichen Ausgelegtheit zu verstehen. Sie wirft das Dasein auf das zurück, worum es sich ängstet, sein eigentliches In-der-Welt-sein-können. Die Angst vereinzelt das Dasein auf sein eigenstes In-der-Welt-sein, das als verstehendes wesenhaft auf Möglichkeiten sich entwirft“ (187). „Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für die Freiheit des Sich-selbst-wählens und -ergreifens“ (188). Mit der Angst verbindet Heidegger also all die Phänomene, die gerade mit dem Tod im Zusammenhang stehen. Ist die Angst also, die „latent das In-der-Welt-sein immer schon bestimmt“ (189), mit der Angst vor dem Tod identisch? Diese Identität würde die Angst auf die Angst vor dem Tod reduzieren, die nichts anderes ist als die vor dem eigensten Seinkönnen. Unbestimmt bzw. ungewiß ist nicht bloß das Wann des Todes. Die Unbestimmtheit wird wiederum ins Sein übersetzt. So wird das Dasein angesichts des Todes der „Unbestimmtheit“, der „Unheimlichkeit“ des Seins selbst gewahr, „die jedes faktisch-geworfene Seinkönnen des Daseins charakterisiert“ (vgl. 298). Während das „Man“ sich in der „Idee eines regelbaren Geschäftsganges“ (294) aufhält, die Gewißheiten produziert, hält das in den Tod vorlaufende Dasein die Unbestimmtheit des Seins aus: „Die Unbestimmtheit des eigenen, obzwar im Entschluß je gewiß gewordenen Seinkönnens offenbart sich aber erst ganz im Sein zum Tode“ (308). Die Ungewißheit, die sich angesichts des Todes offenbart, ist letzten Endes die des „Un-zuhause“ (189), die das „Man“ verdeckt hält.
Abschließende Bemerkungen Die Emphase des „mein“ bzw. des Selbst geht bei Heidegger mit der Emphase der „Ganzheit“ bzw. des „Ganzseinkönnens“ einher. Die Ganzheit ist ein wichtiges Anliegen des Heideggerschen Denkens selbst. Schon früh heißt es: „Aus dem ‚Im Ganzen‘ philosophieren!“11 Hegels Devise: „Das Wahre ist das Ganze“ gälte auch für Heideggers Denken. Angesichts des Todes versucht das Dasein, sich seiner „Ganzheit“ und „Einheit“ zu versichern: „Die ergriffene Endlichkeit der Existenz reißt aus der endlosen Mannigfaltigkeit der sich anbietenden nächsten Möglichkeiten des Behagens, Leichtnehmens, Sichdrückens zurück und bringt das Dasein in die Einfachheit seines Schicksals“ (384). Die „Einfachheit des Schicksals“ verspricht eine unumstößliche Identität. Das Dasein muß sich nicht erst nachträglich eine 11 Vgl. Unbenutzte Vorarbeiten zur Vorlesung vom Wintersemester 1929/30 (Heidegger 1991, 6).
146
Anton Hügli / Byung-Chul Han
zusammenhangstiftende Geschichte erzählen, um sich eine Identität zu konstruieren. Es ist das „Man“, das erst nachträglich seine Identität, Ganzheit und Einheit zu konstruieren sucht: „Aus dem Besorgten errechnet sich das uneigentlich existierende Dasein erst seine Geschichte. Und weil es dabei, umgetrieben von seinen ‚Geschäften‘, aus der Zerstreuung und dem Unzusammenhang des gerade ‚Passierten‘ sich erst zusammenholen muß, so es zu ihm selbst kommen will, erwächst überhaupt nur erst aus dem Verständnishorizont der uneigentlichen Geschichtlichkeit die Frage nach einem zu stiftenden ‚Zusammenhang‘ des Daseins im Sinne der ‚auch‘ vorhandenen Erlebnisse des Subjektes. Die Möglichkeit der Herrschaft dieses Fragehorizontes gründet in der Unentschlossenheit, die das Wesen der Un-ständigkeit des Selbst ausmacht“ (390). Das schicksalhaft existierende Dasein hat dagegen bereits eine „erstreckte Ständigkeit“ des Selbst, eine erstreckte Ganzheit, die alle Seinsmöglichkeiten im voraus erfaßt: „Weil das Vorlaufen in die unüberholbare Möglichkeit alle ihr vorgelagerten Möglichkeiten mit erschließt, liegt in ihm die Möglichkeit eines existenziellen Vorwegnehmens des ganzen Daseins, das heißt die Möglichkeit, als ganzes Seinkönnen zu existieren“ (264). Ohne die Ständigkeit des Selbst bliebe das Dasein für Heidegger fragil und fragmentarisch (vgl. Han 1999, 41 u. 60). Ihm fehlte das „Schicksal“. Das Ganz-sein ist identisch mit dem Selbst-sein. Angesichts des Todes erwacht ein „Ich bin“, das alle Seinsmöglichkeiten im voraus durchdringen soll. Hier spricht das Rest-Subjekt, das Heidegger zum Zeitpunkt von Sein und Zeit nicht abzustreifen vermochte. Ein „Ich bin“ muß als ein Ganzes jede der der äußersten Möglichkeit der Daseinsunmöglichkeit, nämlich dem Tod, „vorgelagerten“ Seinsmöglichkeiten begleiten können: „Mit dem Tode, der jeweilig nur als mein Sterben ist, steht mir mein eigenstes Sein, mein jeden Augenblick Seinkönnen, bevor. Das Sein, das ich im ‚Zuletzt‘ meines Daseins sein werde, das ich jeden Augenblick sein kann, diese Möglichkeit ist die meines eigensten ‚Ich bin‘, das heißt ich werde mein eigenstes Ich sein. Diese Möglichkeit – der Tod als mein Tod – bin ich selbst“ (GA 20, 433). Der Tod ist bei Heidegger als ein Können des Ich verstanden. Er ist „mein jeden Augenblick Seinkönnen“. „Ich kann jeden Augenblick sterben“ – diese an sich banale Tatsache wird übersetzt in „Ich kann jeden Augenblick mein eigenstes Ich sein“. So wird der Tod als ein emphatisches Können des Ichs begriffen. Der Tod bzw. das „Ableben“ ist ein Ereignis, das sowohl jedes Können als auch jedes Ich aufhebt. Unter dem Aspekt des Todes als endgültigem Ende des Seins und des Selbst schließen das Können und der Tod einander aus. Lévinas macht diesen Aspekt des Todes gegen Heidegger geltend: „Was entscheidend ist im Nahen des Todes, ist dies,
7
Heideggers Todesanalyse
147
daß wir von einem bestimmten Moment an nicht mehr können können, genau darin verliert das Subjekt seine eigentliche Herrschaft als Subjekt.“ (Lévinas 1984, 47). Der Tod wird also nicht im Heroismus des Selbst, sondern in der Passivität des „kindlichen Schütteln des Schluchzens“ erfahren: „Meine Herrschaft, meine Mannhaftigkeit, mein Heroismus des Subjekts kann in bezug auf den Tod weder Mannhaftigkeit noch Heroismus sein. Im Leiden, innerhalb dessen wir diese Nachbarschaft des Todes erfaßt haben – und noch auf der Ebene des Phänomens –, gibt es diese Umkehrung der Aktivität des Subjekts in Passivität“ (Ebd. 45). Heideggers „Dasein“ ist heroisch. Angesichts des Todes ergreift das Dasein emphatisch sich selbst. Es ist das „Man“, das sich vor dem Tod fürchtet und zittert: „Das Man läßt den Mut zur Angst vor dem Tode nicht aufkommen“ (254). Der „Mut“ bezieht sich nicht bloß aufs Ende des Lebens. Er ist vielmehr der Mut zum „eigensten Seinkönnen“, zu jenem „Unzuhause“, das sich einstellt nach dem Wegfall der von der „Öffentlichkeit“ suggerierten Gewißheiten und Vertrautheiten. Die Furcht des „Man“ vor dem Tod geht mit der Flucht vor ihm einher: „Die öffentliche Daseinsauslegung sagt: ‚man stirbt‘, weil damit jeder andere und man selbst sich einreden kann: je nicht gerade ich; denn dieses Man ist das Niemand“ (253). „Man stirbt“ heißt also „Niemand stirbt“. „Man“ stirbt, aber nicht „ich“. So hat das Sein zum Ende den „Modus des umdeutenden, uneigentlich verstehenden und verhüllenden Ausweichens vor ihm“ (254). In einer Fußnote (254) weist Heidegger darauf hin, daß Tolstoi in seiner Erzählung „Der Tod des Iwan Iljitsch“ das Phänomen der Erschütterung und des Zusammenbruchs des „man stirbt“ dargestellt habe. Die Erschütterung des beruhigenden „man stirbt“ ist jedoch nicht die letzte Botschaft von Tolstoi (vgl. Han 1998, 44 f.). Heidegger liest die Erzählung nicht bis zum Ende. Gepredigt wird ebensowenig, daß man angesichts des Todes sich selbst, das „mein“, das „ich bin“ eigens ergreifen müsse. Angesichts des Todes erwacht vielmehr eine emphatische Liebe zum Anderen, in der der Tod hinter sich gelassen wird. Nicht das eigentliche Sein zum Tod, nicht die Emphase des mein, sondern das „Ende des Todes“ ist die letzte Botschaft von „Der Tod des Iwan Iljitsch“. Die letzten Worte der Erzählung lauten: „Und der Tod? Wo ist er? Er suchte seine frühere gewohnte Angst vor dem Tode und fand sie nicht mehr. Wo war der Tod? Es war keine Furcht mehr vorhanden, weil auch der Tod nicht mehr vorhanden war. […] ‚Der Tod ist zu Ende‘, sagte er sich. ‚Er ist nicht mehr da‘“ (Tolstoi 1961, 401 f.). Das „Ende des Todes“ ist jedoch kein Rückfall ins „Man“. Es zieht eine Liebe nach sich, die weder ins „eigentliche“, noch ins „uneigentliche“ Miteinander hineingehört. Sie ist innerhalb von Sein und Zeit abwesend.
148
Anton Hügli / Byung-Chul Han
Literatur Birkenstock, E. 1997: Heißt philosophieren sterben lernen? Antworten der Existenzphilosophie: Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Rosenzweig, Freiburg/München Demske, J. M. 1963: Sein, Mensch und Tod. Das Todesproblem bei Martin Heidegger, Freiburg/München Ebeling, H. 1997: Vom Ursprung der Philosophie. Der Tod, das Nichts und das Eine, Würzburg Epikur 1982, Brief an Menoikeus, in: Briefe, Sprüche, Werkfragmente 41–51, Stuttgart Fink, E. 1969: Metaphysik und Tod, Stuttgart Fischer, J. A. 1954: Studien zum Todesgedanken in der Alten Kirche. Die Beurteilung des natürlichen Todes in der kirchlichen Literatur der ersten drei Jahrhunderte, München Han, B.-Ch. 1996: Heideggers Herz. Zum Begriff der Stimmung bei Martin Heidegger, München Han, B.-Ch. 1998: Todesarten. Philosophische Untersuchungen zum Tod, München Han, B.-Ch. 1999: Martin Heidegger. Eine Einführung, München Hegel, G. W. F. 1988: Phänomenologie des Geistes, hg. v. H.-F. Wessels u. H. Clairmont, Hamburg Hügli, A. 1973: Zur Geschichte der Todesdeutung. Versuch einer Typologie, in: Studia Philosophica 32, 1–28 Hügli, A. 1999 a: Artikel „Tod“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, Sp. 1227–1242, Basel Hügli, A. 1999 b: Artikel „Sterben lernen“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, Sp. 129–134, Basel Jaspers, K. 1932: Philosophie, Bd. 2, Heidelberg Kierkegaard, S. 1964: An einem Grabe (1845), in: Erbauliche Reden (1844/45), G. W. 13/14, 173–205, Düsseldorf Knörzer, G. 1990: Tod ist Sein? Eine Studie zu Genese und Struktur des Begriffs „Tod“ im Frühwerk Martin Heideggers, Frankfurt a. M. Lévinas, E. 1984: Die Zeit und der Andere, Hamburg Lévinas, E. 1995: „Sterben für …“, in: Zwischen uns, 239–251, München Lévinas, E. 1996: Gott, der Tod und die Zeit, Wien Losurdo, D. 1995: Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und die Kriegsideologie, Stuttgart/Weimar Luther, M. 1906: Weimarer Ausgabe, ND 1966, Bd. 10, Abt. 3,1 (Predigten des Jahres 1522: Acht Sermone, Predigt 190: Dominica Invocavit) Marcel, G. 1959: Présence et Immortalité, Paris Rentsch, Th. 1989: Martin Heidegger. Das Sein und der Tod: Eine kritische Einführung, München/Zürich Sartre, J.-P. 1991: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Hamburg Scheler, M. 1986: Tod und Fortleben. Schriften aus dem Nachlaß, Bd. 1 (1957) Bern, 3. Aufl. Simmel, G. 1910/11: Zur Metaphysik des Todes, in: Logos 1, 57 ff. Simmel, G. 1919: Rembrandt, Leipzig, 2. Aufl. Sternberger, D. 1977: Der verstandene Tod. Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existentialontologie, in: Über den Tod, Schriften, 112–125, Frankfurt a. M. Thomas von Kempen 1987: Die Nachfolge Christi, Kevelaer Tolstoi, L. N. 1961, Der Tod des Iwan Iljitsch, in: ders., Volkserzählungen. Jugenderinnerungen, 333–402, München
8 Andreas Luckner
Wie es ist, selbst zu sein. Zum Begriff der Eigentlichkeit (§§ 54–60)
Vorbemerkung Im folgenden wird versucht, Heideggers Sein und Zeit für eine der Ethik im weiteren Sinne zuzurechnende Fragestellung fruchtbar zu machen: die nach der Konstitution der moralischen Persönlichkeit.1 Eine solche pragmatisch-anthropologische Fragestellung fristet unter den Bedingungen moderner Moralphilosophie, die sich vornehmlich um Fragen der Normenbegründung kümmert, ein eher kärgliches Dasein. Das Gute aber, was immer es auch sei, wird durch Personen realisiert, durch ihre Haltungen und Handlungen. Aus einer im weitesten Sinne ethischen, d. h. die selbständige Handlungsorientierung befördernden Perspektive ist weniger die metaphysische Frage, was eine Person überhaupt ist, als vielmehr die phänomenologische Frage, wie es ist, eine Person zu sein, von Belang. Die sogenannte „Daseinsanalyse“ in Heideggers Sein und Zeit stellt für die Klärung dieser Frage ein überaus großzügiges Angebot dar. Nach allgemeinen Vorüberlegungen zum Thema Heidegger und Ethik (1) soll daher diese Analyse für unsere Zwecke knapp rekonstruiert und vorsichtig aus dem Projekt der Fundamentalontologie herausgelöst werden (2). Unter dem Titel „Eigentlichkeit“ – Heideggers Begriff der Authentizität – wird dabei eine besondere Weise des personalen Selbstbezugs ausgewiesen, die konstitutiv ist für die moralische Persönlichkeit, die sich ethisch-mora1 Rentsch 1990, 144 verfolgt Ähnliches durch seine „Destruktion der Existenzialen Analytik Heideggers“; allerdings unter völligem Verzicht auf das unter Solipsismusverdacht stehende Eigentlichkeitskonzept, das im folgenden – freilich unsolipsistisch gedacht – gerade im Vordergrund stehen wird.
150
Andreas Luckner
lischen Geltungsansprüchen zu unterstellen bereit ist (3). Das Verhältnis zur „Uneigentlichkeit“ kann dabei nicht, wie ein existentialistisches Vorurteil immer wieder behauptet, als das einer wählbaren Alternative konstruiert werden, sondern kann und muß, wie eine ausführliche Analyse des für die Thematik des Selbstseins zentralen Komplexes von Gewissen, Schuld und Verantwortungsübernahme in den §§ 54 –60 von Sein und Zeit zeigen kann (4), als deren Modifikation (qua „Aneignung“) aufgefaßt werden. Eine abschließende kurze Betrachtung soll noch einmal mögliche Anknüpfungspunkte an ethische Überlegungen herausstellen (5).
8.1 Heidegger und die Ethik Es gibt gewisse Passagen in Heideggers Sein und Zeit, die selbst moralphilosophisch weniger empfindliche Ohren aufhorchen lassen und dazu einladen, in ihnen mehr oder minder versteckte Antworten auf ethische Fragen zu suchen. Dies dürfte vor allem daran liegen, daß Heidegger die für das moderne Denken charakteristische Trennung von Sein und Sollen, Tatsachen und Werten, Beschreibungen und Vorschriften systematisch unterläuft und daher die von ihm benutzten Ausdrücke starke normative Assoziationen auslösen. In keinem anderen Kapitel ist dies so auffällig wie im sogenannten „Gewissenskapitel“ (267–301). Die Versuchung ist groß, wegen der darin vorkommenden Ausdrücke wie „Gewissen“, „Schuld“ und „Entschlossenheit“, hier so etwas wie eine „Ethik der Authentizität“ 2 aus dem Heideggerschen Text zu rekonstruieren. Ein solches Unterfangen stünde allerdings in auffälligem Widerspruch zu den expliziten Aussagen Heideggers über eine ethische Anschlußfähigkeit seines Denkens. Er selbst hat es diesbezüglich – vor allem nach 1927, dem Erscheinungsjahr von Sein und Zeit – an deutlichen Absagen nicht mangeln lassen: Für Heidegger stellte „Ethik“ nur ein Begleitprojekt zur universalen Inbesitznahme aller Lebensbereiche durch das technische Denken dar, das bloße Surrogat eines verlorengegangenen êthos.3 Aber auch schon in Sein und Zeit selbst behauptet Heidegger immer wieder, daß Ausdrücke wie „Gerede“, „Uneigentlichkeit“ oder „Verfallen“ nicht in wertender Absicht gebraucht sind. Tatsächlich wird auch nirgends der
2 Vgl. etwa Macann 1992. 3 Vgl. GA 9, 353 ff.
8
Wie es ist, selbst zu sein
151
Versuch unternommen, zu sagen oder gar zu begründen, wie man sein oder was man tun soll, muß oder darf, was moralisch geboten, verboten oder erlaubt ist, ja noch nicht einmal, was in einem ethischen Sinne lobens- oder tadelnswert wäre. Und es wird auch nicht zur Eigentlichkeit und Authentizität aufgerufen, wie man vielleicht annehmen könnte. Die meisten Leser und Kommentatoren von Sein und Zeit nehmen dessen Autor nun allerdings in den Beteuerungen seiner Ethikabstinenz nicht so ganz ernst. Dies ist verständlich; andererseits aber dürfte es auch Heidegger nicht entgangen sein, daß sein eigentümliches Vokabular mit Wertungen geradezu vollgesogen ist. Nehmen wir nur einmal die schon genannten Ausdrücke „Gerede“ und „Verfallenheit“ als Charakteristika des „uneigentlichen“ Daseins: Wie könnte man sie anders als pejorativ verstehen? Die Frage ist, was Heidegger damit meint, wenn er sagt, daß diese Ausdrücke „nicht in einer herabziehenden Bedeutung gebraucht werden“ (167) sollen.4 Nun scheint es einen Unterschied zu geben zwischen „Wertungen vornehmen“ bzw. werten und mit Wertprädikaten beschreiben. Man muß sich hierbei vor Augen halten, daß gerade der Phänomenologe – und Heidegger läßt an seiner Zugehörigkeit zur Schule nicht den geringsten Zweifel (vgl. 34 ff.) – versuchen muß, die Dinge so zu beschreiben, wie sie sich im Bewußtsein resp. im „Dasein“ zeigen. So ist beispielweise der Ausdruck „Gerede“ für ritualisierte, jargonartige Artikulationen von Sachverhalten deskriptiv in dem Sinne, daß mit ihm die allgemeine Erscheinungsweise öffentlicher Rede für die sich in der Öffentlichkeit bewegenden Personen beschrieben wird.5 Wenn nun tatsächlich schon allein mit dem Gebrauch des Ausdrucks „Gerede“ eine Wertung bestehender Verhältnisse im Sinne einer Kulturkritik beabsichtigt wäre, stünde dies mindestens in einem starken Spannungsverhältnis zu einer der zentralen Aussagen von Sein und Zeit, nämlich der, daß die Öffentlichkeit ( das „Man“) ein „Existenzial“ ist, das heißt etwas, was gar nicht vermieden oder gar überwunden werden kann, weil es zur Struktur des Daseins selbst gehört.6 Kurzum: Heidegger hat – aus guten Gründen7 – keine Ethik geschrieben. 4 Ein anderes Beispiel wäre: „Die Uneigentlichkeit des Daseins bedeutet aber nicht etwa […] einen ‚niedrigeren‘ Seinsgrad“ (43). 5 Eine ganz andere Frage ist freilich, ob die Beschreibung adäquat ist. 6 Das heißt im übrigen, daß auch nach Heidegger öffentlich vorgetragene Eigentlichkeitsbzw. Authentizitätsideale gar nichts anderes als „Jargon“ sein können. Von daher hatte Adorno zwar Recht mit seiner Kritik, aber er geht zumindest an dieser Pointe der heideggerschen Existenzialanalyse völlig vorbei (vgl. Adorno 1964). 7 Einige nennt Brandner 1992.
152
Andreas Luckner
Er versuchte in Sein und Zeit nicht viel geringeres, als die gesamte abendländische Philosophie auf eine neue Basis zu stellen. „Fundamentalontologie“ war der Name für dieses Projekt und es ging ihr im wesentlichen darum, in einer „Genealogie der verschiedenen möglichen Weisen des Seins“ (9) die Herkunft bestimmter ontologischer Auffassungen zu klären. Man könnte nun sagen, daß der ganze Sinn der Fundamentalontologie ein ethischer ist, weil es ihr letztlich um die Restitution des verlorengegangenen êthos des Menschen – des „Ort[es] des Wohnens“8 – ging, sprich: um die Restitution eines teleologischen Rahmens, innerhalb dessen sich allererst (ethische) „Bestimmungen des Menschen“ formulieren ließen. Dieser ethische Sinn des fundamentalontologischen Projektes als ganzem wird deutlicher, wenn wir seine Stoßrichtung näher ins Auge fassen: Jedwede physikalische, evolutionsbiologische, in einem gewissen Sinne anthropologische (s. u.), psychologische, soziologische oder auch theologische Verkürzungen dessen, was ist (also „des Seienden“) auf eine einzige Weise des Seins, vornehmlich derjenigen der bloßen „Vorhandenheit“ (88), soll abgewehrt werden im Interesse der Wieder- und Neuerschließung von Seinsmöglichkeiten und damit der Freiheit.9 Die Existenzialanalyse ist nun allerdings erst „unterwegs zur Seinsfrage“ und kann daher nicht in irgendeiner Weise „teleologisch“ argumentieren, so als wenn es allgemeingültige gehaltvolle Handlungs- oder gar Lebensziele gäbe. Gerade das aber macht die heideggersche Analyse des Daseins interessant für die Frage nach der Selbstorientierung von Personen.
8.2 Wie ist es, eine Person zu sein? Aber wie analysiert man eine „Seinsweise“, also wie (nicht: was) etwas ist? Wer nicht weiß, wie Kaffee schmeckt oder wie Zahnweh sich anfühlt, dem kann man es auch durch eine Beschreibung nicht sehr viel näher bringen; was Kaffee oder Zahnweh ist, kann man immerhin unter Rekurs auf botanische bzw. physiologische Klassifikationen erklären. Analog dazu können wir nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus oder eine Pflanze oder gar ein Stein zu sein. Die einzige Seinsweise, die methodisch gesehen überhaupt einer Analyse im Sinne der Fundamentalontologie zugänglich ist, ist dem-
8 GA 9, 356. 9 Vgl. auch Figal 1988, 26 et passim.
8
Wie es ist, selbst zu sein
153
nach „unsere eigene“ Existenz, nämlich diejenige personalen Daseins. Wir können nur wissen – und dementsprechend dieses Wissen und seine Konstituentien analysieren – wie es ist, eine Person zu sein, weil und insofern wir Personen sind. Wenn hier nun nicht von vorneherein metaphysische Konstruktionen und damit phänomenfremde Vorstellungen die Analyse des Personseins leiten sollen (etwa mit Begriffen wie „Seele“, „Subjekt“, „rationaler Entscheider“ usw.), muß der Fundamentalontologe mit einer sauberen Phänomenologie des personalen Daseins anfangen. So kommt es, daß der weitaus größte Teil des Buchtorsos Sein und Zeit, nämlich der gesamte erste Abschnitt (die sog. „vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins“) sowie zweieinhalb Kapitel des zweiten Abschnitts, die die Möglichkeit der Integrität der Personen („Ganzseinkönnen des Daseins“) thematisieren, aus einer solchen Phänomenologie des Personseins besteht. Sie findet ihren Abschluß in der uns hier interessierenden Frage danach, wie eine Person überhaupt dazu kommt, sich in ihrer Autonomie und „Selbst-ständigkeit“ (322) zu erfassen und in eine Form persönlicher Existenz umzusetzen. Man kann die existenziale Analyse daher mit Figal als „Phänomenologie der Freiheit“10 bezeichnen, die jedweden moralphilosophischen Überlegungen, welche eine solche Freiheit schon als prinzipiell gegebene voraussetzen müssen, vorgängig ist. Hier wird nun ein kleiner methodischer Exkurs bezüglich des Personenbegriffs notwendig. Figal weist schon die bloße Analogie von „Person“ und „Dasein“ in Anschluß an v. Herrman (1985) mit dem Argument zurück, man würde die Pointe der Heideggerschen Philosophie verfehlen, wenn man sie auf eine „Regionalontologie“ (nämlich die der Person) beschränken würde. Hierzu ist zu sagen, daß auch der Ausdruck „Dasein“ ein besonderes Seiendes bezeichnet, wie schon die Stelle, an der der Begriff des „Daseins“ eingeführt wird, belegt: „Wissenschaften haben als Verhaltungen des Menschen die Seinsart dieses Seienden (Mensch). Dieses Seiende [also den Menschen] fassen wir terminologisch als Dasein“ (11). Die Analyse des Daseins ist daher selbst von vorneherein „regional“ und muß dies aus oben genannten Gründen sein, wenn sie auch nicht im klassischen Sinne ontologisch nach Wesensbestimmungen, sondern phänomenologisch nach der Seinsweise, der Existenz fragt. Die Kritik Figals an der Regionalisierung des Fragebereiches träfe also auch Heidegger selbst.
10 Vgl. Figal 1988, 23 f.
154
Andreas Luckner
Aber zudem ist die Kritik unberechtigt. Denn das anti-reduktionistische Argument gegen „Person“ als Übersetzung von „Dasein“ zieht nur, wenn man selbst einen reduzierten Personenbegriff unterstellt, wie offensichtlich Figal, wenn er sagt, daß ontologisch „Personen von anderen Lebewesen“11 unterschieden werden müßten (und eben meist nicht werden). Es ist aber gar nicht einzusehen, warum man Personen überhaupt als Vertreter der Gegenstandsklasse „Lebewesen“ auffassen sollte. Wenn man aufmerksam bleibt darauf, daß Personen nicht nur etwas anderes, sondern anders sind als die Vertreter der Gegenstandsklasse „Lebewesen“, steht der Übersetzung von „Dasein“ in „Person“ nichts im Wege. Heidegger selbst verwendete schließlich, wie er selber schreibt (47 ff.), den Begriff „Person“ deshalb nicht, weil er aus seiner Sicht besetzt war vom „Personalismus“ Husserls und Schelers, die in ihren Bestimmungsversuchen dessen, was eine Person ist – auch als sie sagten: „Eine Person ist kein Ding, keine Substanz, kein Gegenstand“ (47) – den „ganzen Menschen“ (48) wiederum verkürzten: „Sie stellen die Frage nach dem ‚Personsein’ selbst nicht mehr“ (ebd.). Genau dies aber ist die Frage von Heideggers Existenzialanalyse.12
8.3 Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit personaler Existenz Die beiden elementaren und grundlegenden Seinsmöglichkeiten einer Person sind nun nach Heidegger die Existenzformen der Eigentlichkeit und der Uneigentlichkeit. Was ist mit dieser elementaren Unterscheidung gemeint? Von der Eigentlichkeit einer Person – erstmals tritt dieser Begriff in 42 f. auf – kann immer dann gesprochen werden, wenn sie „sich zueigen“ (42) ist, und das heißt von sich aus bzw. „selbstbestimmt“ ihre „faktischen“ (das heißt nicht nur prinzipiellen, sondern jeweils zu Gebote stehenden) Möglichkeiten des Handelns ergreift. Gemeint ist damit nicht etwa eine exklusive und im Sinne einer Option wählbare Form des Lebens selbst, so, als wenn es „mein“ eigentliches Leben irgendwo als einen vorgezeichneten Entwurf schon gäbe, sondern vielmehr eine bestimmte Weise des Existierens. Eigentlichkeit hat also weniger mit dem zu tun, was eine Person unternimmt, als vielmehr damit, 11 Figal 1988, 25. 12 Deshalb ist sie, und hier ist die Allergie Figals und v. Herrmanns berechtigt, keine Subjektbzw. Transzendentalphilosophie, wie Heidegger selbst deutlich formuliert: „Der ontologische Begriff des Subjekts charakterisiert nicht die Selbstheit des Ich qua Selbst, sondern die Selbigkeit und Beständigkeit eines immer schon Vorhandenen“ (320).
8
Wie es ist, selbst zu sein
155
wie, auf welche Weise sie dies unternimmt. Sie existiert eigentlich, wenn ihr Leben einen „Sinn“ hat, eine Richtung aufweist und dies aus einer Selbstbestimmung und „Selbständigkeit“ (303) heraus. Das heißt nicht, daß es für eine selbstbestimmte Person nicht möglich wäre, ihr Leben in Einklang mit den Regeln und Normen einer Gesellschaft zu führen. „Eigentlichkeit“ ist ein rein formales Konzept,13 das von den jeweiligen Personen völlig verschieden – für den einzelnen allerdings nicht in beliebiger Weise! (s. u.) – inhaltlich bestimmt werden kann. Von Uneigentlichkeit personalen Daseins kann immer dort gesprochen werden, wo eine Person sich in ihrem Handeln auf das verläßt, was gemäß Regeln, Sitten und Gebräuchen üblich oder auch geboten bzw. verboten ist; hier haben wir es also mit Unselbständigkeit und Konformität kurz: dem Normalzustand des alltäglichen Daseins zu tun. In diesem Zusammenhang nun kann man sich eine bei näherem Hinschauen ausgesprochen merkwürdige Angelegenheit auffallen lassen und dies getan zu haben ist Heideggers genuines Verdienst: Die anderen Personen begegnen uns im Alltag zumeist unpersönlich und anonym. Dieses Phänomen scheint zunächst das Normalste und Langweiligste von der Welt zu sein, aber aus der Sicht des Philosophen bzw. des Daseinsanalytikers kommt man angesichts der Frage, wie dies überhaupt möglich ist, aus dem Staunen nicht heraus. Denn es ist ja nicht so, daß unsere Personalität verschwunden wäre, wenn wir „unpersönlich“ sind, weil es schließlich Personen und nur Personen sind, die überhaupt unpersönlich sein können. Die Uneigentlichkeit des alltäglichen personalen Daseins ist das eigentlich tiefe philosophische Problem, das man immer schon übersprungen hat, wenn man wie in der Ethik mit rationalen Entscheidern‚ autonomen Individuen oder sonstwie schon fertigen Handlungssubjekten rechnet. Wenn man nun die beiden Grundmöglichkeiten personaler Existenz wie zwei wählbare Optionen nebeneinander hält, scheint man schnurstracks bei einer „Ethik der Eigentlichkeit“ zu landen, nach der man, platt gesagt, eigentlich oder authentisch existieren soll und uneigentlich existieren nicht soll, oder noch platter gesagt: nach der „eigentlich“ gut und „uneigentlich“ schlecht wäre. Genau dies will ich das existentialistische Mißverständnis der Leser Heideggers nennen.14 13 Vgl. auch Seel 1989, der in der extremen Formalität des Eigentlichkeitskonzeptes ebenfalls dessen Modernität sieht. Die Frage nach der Eigentlichkeit ist damit die Frage danach, wie jemand überhaupt dazu kommt, einen Willen auszubilden. 14 Mit diesem Mißverständnis befindet man sich in durchaus guter Gesellschaft: Was die diesen angeblichen Gedanken Heideggers affirmierende Seite betrifft, etwa in derjenigen von Sartre und Camus, was die Ablehnung dieses Gedankens angeht zum Beispiel in derjenigen von Adorno und Jaspers.
156
Andreas Luckner
Oft kann man hören oder lesen, daß die beiden grundlegenden Existenzformen von Personen, Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, bei Heidegger auf geradezu manichäische Weise gegeneinander gesetzt seien: Das in seine Welt geworfene und an sie verfallene Dasein könne, so das Gerücht, sich nur wie bei den Gnostikern durch den (angestrengten) Rückzug aus der Welt zu seiner eigentlichen Daseinsbestimmung durchkämpfen. Der Text sagt durchaus etwas anderes und an ihn werde ich mich im folgenden halten. Zunächst: Eigentlichkeit ist kein bloßer Gegensatz zu Uneigentlichkeit und damit Option einer Alternative – so wie die zwischen Vanille- und Schokoladeneis oder, wenn dieses Beispiel zu billig sein sollte, so wie die zwischen Karriere oder Familie. Zumindest bezüglich der „Uneigentlichkeit“ ist es ganz evident, daß sie niemals eine gewählte sein kann. Wenn es jemanden gäbe, der, sagen wir, sich in einer sog. „existentiellen Entscheidung“ dazu entschlösse, künftig ein ausschließliches Leben vor dem Fernseher oder für ein Leben nach den strengen Regeln einer Sekte zu führen (so etwas ist ja immerhin denkbar), dann würde er gerade durch diesen Entschluß – wenn es denn einer wäre – einen Akt vollziehen, durch den er als Person sich „zu eigen“ wird. Es ist daher pragmatisch unmöglich, sich dafür zu entschließen, uneigentlich zu existieren, weil „uneigentlich existieren“ gerade bedeutet: sich nicht entschließen können (auch nicht müssen!) zu irgendetwas. Gilt dann umgekehrt, daß wir nur dann „eigentlich“ existieren, wenn und insofern wir uns (zu irgendetwas) entschließen? Und käme es dabei also nur darauf an, daß wir, aber nicht welche Entscheidungen wir treffen? Der bekannte Witz, der unter Heideggers Marburger Seminaristen kursierte, nämlich: „Wir sind ja alle so entschlossen, wir wissen nur noch nicht, wozu“ ist ein guter Witz, weil er das existentialistische Mißverständnis Heideggers sehr gut trifft. Im Text heißt es in der Tat über das „Wozu der Entschlossenheit“ (298), daß eine Antwort erst im und mit dem Entschluß überhaupt gegeben wird. Aber dies bedeutet gerade: Wenn eine Person sich „entschlossen“, also einen Entschluß gefaßt hat, weiß sie, wozu: sonst hätte sie sich nicht entschlossen. Daß in einer Analyse der Formen der Existenz nicht auch noch inhaltliche Empfehlungen vorkommen, ist ihm noch nicht als Manko anzurechnen, im Gegenteil. Nur wer von vornherein unter „Eigentlichkeit“ ein ethisches Ideal versteht, kann von der Formalität dieses Begriffes enttäuscht sein, die es einerseits offensichtlich nicht verhindern kann, Nazi-Rektor, andererseits auch erlaubt, Resistance-Kämpfer zu werden. „Eigentlichkeit“ hat aber nicht selbst schon moralische Qualitäten, sehr wohl aber moralphilosophische Relevanz, weil erst in ihrer eigentlichen Existenzform eine Person mit
8
Wie es ist, selbst zu sein
157
ihrer Freiheit zum Guten wie zum Bösen, was immer dies näherhin auch sein mag, Bekanntschaft macht. Entschlossenheit und Entschluß können allerdings auch immer nur vor dem Hintergrund der institutionalisierten Welt- und Sinnbezüge stattfinden: Es handelt sich daher bei der Eigentlichkeit des Daseins und seiner Entschlossenheit also gerade nicht um den unterstellten Heroismus des einsamen, kämpferischen Daseins, wie zum Beispiel folgende Stelle deutlich zeigt: „Auch der Entschluß bleibt auf das Man und seine Welt angewiesen […]. In der Entschlossenheit geht es dem Dasein um sein eigenstes Seinkönnen, das als geworfenes nur auf bestimmte faktische Möglichkeiten sich entwerfen kann. Der Entschluß entzieht sich nicht der ‚Wirklichkeit‘ sondern entdeckt erst das faktisch Mögliche, so zwar, daß er es dergestalt, wie es als eigenstes Seinkönnen im Man möglich ist, ergreift“ (299). Das bedeutet: Weil wir als Personen angewiesen sind auf die Institutionen, die uns einander koordinieren, besteht die Eigentlichkeit unserer Existenz nicht darin, daß wir aus der institutionalisierten Welt aussteigen, sondern sie uns auf eine bestimmte Weise, nämlich als unseren Lebensraum aneignen. Letztlich bedeutet dies für jeden einzelnen, einen Umgang mit Institutionen zu finden, wodurch allein sich so etwas wie eine (dann auch unverwechselbare) Persönlichkeit bilden kann. Dazu muß eine Person sich – und das eben heißt „Entschlossenheit“ – als in einer Situation stehend begreifen und in der Lage sein, in selbstbestimmter Weise (frei) zu handeln. In aller „Entschlossenheit“ zu irgendwas sind wir immer auch entschlossen dazu, wir selbst zu sein. Was dies allerdings heißen mag, ist in der Tat noch gar nicht ausgemacht. Es gibt aber immerhin die Möglichkeit, zu analysieren, wie eine Person zu ihren jeweiligen (Lebens-)Inhalten kommt. Die hier weiterführende Fragestellung ist also: Wie vollzieht eine Person ihre Selbstaneignung? Wie wird man „eigentlich“?
8.4 Wie man eigentlich wird: Selbstwahl, Gewissen, Verantwortung, Entschlossenheit Im zweiten Kapitel des zweiten Abschnittes von Sein und Zeit – der Titel: „Die daseinsmäßige Bezeugung eines eigentlichen Seinkönnens und die Entschlossenheit“ (267) – wird beschrieben, wie und aufgrund welcher Voraussetzungen die Person in ihrem weltlichen Dasein aus der Uneigentlichkeit ihrer Existenz zu ihrer Eigentlichkeit gelangen kann. Es handelt sich hierbei zunächst um eine Art Wahl, die Selbstwahl (a).
158
Andreas Luckner
8.4.1 Selbstwahl Steht hinter der Eigentlichkeit also eine Art Dezisionismus? Nein. Denn die „Wahl des eigenen Selbst“, wenn man sie so nennen will, unterscheidet sich systematisch von einer Wahl zwischen Optionen. Der Beliebigkeits- bzw. Dezisionismusvorwurf greift aber überhaupt nur bei Optionswahlen, wo wir es mit mehreren Möglichkeiten zu tun haben, zwischen denen eine Entscheidung auch nach Maßgabe eines (vernünftigen) Kriteriums getroffen werden könnte. Wo dies gar nicht der Fall ist, ist ein Dezisionismusvorwurf von vornherein falsch adressiert. Nun kann „Uneigentlichkeit“, wie wir sahen, gar kein Gegenstand einer Wahl sein. Eine Optionswahl zwischen den zwei Grundmöglichkeiten der Existenz, nämlich „eigentlich“ oder „uneigentlich“ selbst zu sein, scheidet daher aus. Dennoch spricht Heidegger im Zusammenhang mit der Eigentlichkeit personalen Daseins dennoch von einer „Wahl“ (vgl. 268). Handelt es sich beim eigentlichen Selbstsein also um eine Wahl ohne Alternative? So ist es. Die Semantik des Begriffs „Wahl“ läßt eine solche Alternativlosigkeit – im Unterschied zu derjenigen von „Entscheidung“ – durchaus zu, etwa dann, wenn wir davon sprechen, „keine andere Wahl“ gehabt zu haben, wenn wir uns zu einem bestimmten Handeln entschließen. Bei einer sogenannten „Gewissensentscheidung“ handelt es sich zum Beispiel um eine Wahl, bei der an sich mehrere Möglichkeiten offenstehen, von denen aber manche für mich überhaupt nicht in Frage kommen, keine realen Optionen sind. „Ich kann das nicht tun“ wäre ein Satz, der bei einer Beratung über solche „Entscheidungen“ vorkommen mag. Das heißt nicht einfach, daß wir solche Möglichkeiten im Verhältnis nur einfach ganz besonders schwach präferieren bzw. abstoßend finden, nein, sie sind von vornherein als Möglichkeiten ausgeschlossen.15 Bei einer Entschlußfassung ist mit „keine Wahl haben“ also nicht gemeint: „im Prinzip (aufgrund Unfreiheit) nicht anders handeln können“, sondern gerade: „faktisch (aufgrund der Freiheit, selbst zu sein) nicht anders handeln können.“ Deswegen sagt Heidegger, daß es im eigentlichen Existieren einer Person um die Aneignung der faktischen (nicht der prinzipiellen, für alle gleichermaßen gegebenen) Seinsmöglichkeiten geht.
15 Es handelt sich also um eines von vielen Phänomenen im Zusammenhang mit Wahl und Entscheidung, die sich im Paradigma einer rationalen Entscheidungstheorie nicht phänomenadäquat beschreiben lassen.
8
Wie es ist, selbst zu sein
159
Die Formel der Selbstwahl wäre also: „Take it or leave it!“ Denn damit ist ja nicht gemeint: Wähle zwischen den Optionen „Nehmen“ und „Lassen“, sondern vielmehr: „Wähle!“ oder „Laß’ es (das Wählen) sein!“. Es sieht zwar zunächst so aus, als handle es sich hierbei ebenfalls um eine Alternative, aber sie ist abstrakt, eine Alternative für niemanden. „Lassen“ heißt hier: unentschieden bleiben, das heißt nicht wählen, und nicht etwa: wählen, das eigene Leben nicht anzunehmen. Diese Wahl ist daher gar keine „Entscheidung“ im strengen begrifflichen Sinne und der Ausdruck „existentielle Entscheidung“ wäre in diesem Kontext strenggenommen unsinnig. Was hier mit „Wahl“ gemeint ist, ist ein höherstufiges Wählen, das Heidegger mit Kierkegaard „Wählen der Wahl“ (268) nennt, wodurch sich das personale Dasein „allererst sein eigentliches Seinkönnen“ (ebd.) ermöglicht. Beim Nicht-wählen der Wahl handelt es sich umgekehrt um ein Unterlassen der Wahl und ein Verharren in Unentschiedenheit. Aber ist es nicht immer auch möglich, sich gegen sein Gewissen zu entscheiden? Das wäre ja in der Tat noch ein anderer Fall, als einfach derjenige, unentschieden zu bleiben. Wir hätten es dann doch mit einer anderen Option zu tun: denn wir könnten dann einerseits tun, was unser Gewissen uns sagt, und wir könnten andererseits das tun, wovon uns unser Gewissen gerade abrät. Dieses Argument beruht allerdings auf einem bestimmten Gewissensbegriff, den Heidegger gerade als phänomeninadäquat bezeichnet. Das Gewissen als ursprüngliches Phänomen ist eben nicht einfach nur die berühmte „innere Stimme“, die uns sagt, was wir zu tun hätten; es muß sich hierbei vielmehr um ein abkünftiges, das heißt ein Oberflächen-Phänomen handeln, weil sonst unerklärlich bliebe, warum ein solches innerliches Reden uns überhaupt etwas angehen sollte. Wenn es sich daher beim Gewissen tatsächlich um eine fremde Stimme in uns handeln würde (etwa diejenige Gottes, diejenige der Gesellschaft oder diejenige unserer Erziehungsberechtigten), die eine Aufforderung, einen Befehl oder ähnliche Präskriptivitäten von sich gäbe, dann würde sich sofort die Frage stellen: Mein Gewissen spricht so, ich möchte aber gerne anders – wem soll ich also folgen? Und dann hätten wir es in der Tat wieder mit einer Optionswahl zu tun und die Geschichte der solche Gewissenskonzeptionen voraussetzenden Moraltheologie und –philosophie ist voll davon, Entscheidungskriterien für solcherart „Gewissenskonflikte“ zu bieten. Aber wer sollte nun wiederum diese Entscheidung und auf welcher Grundlage treffen? Hier scheinen immer weitere Entscheidungsinstanzen hinter dem Gewissen aufzutauchen. Dies steht aber in einem Mißverhält-
160
Andreas Luckner
nis zum Phänomen des Gewissens, das oftmals mit der Vorstellung eines inneren letztinstanzlichen Gerichtshofes (forum internum) ohne weitere Berufungsmöglichkeit veranschaulicht wird. Um die Selbstaneignung einer Person beschreiben zu können, benötigen wir daher eine genauere Phänomenologie des Gewissens.
8.4.2 Der Ruf des Gewissens Personsein, eigentlich oder uneigentlich, bedeutet nach der Heideggerschen Existenzialanalyse in Kurzfassung: in (fremdbestimmten) Verhältnissen sich mit anderen vorfindend („Faktizität“) und auf diese angewiesen („Verfallen“) auf bestimmte Daseinsmöglichkeiten hin sich entwerfen („Existenzialität“). Heidegger nennt diese formale und fundamentale reflexive Struktur personalen Daseins kurz: „Sorge“ (193). Das eigentliche Selbstbzw. Personsein kann aufgrund der strukturellen (das heißt nicht-kontingenten) Verankerung von Institutionalität in der Sorgestruktur nicht darin bestehen, sich dem Verfallen an die Welt per Entschluß zu entziehen; es beruht nicht, wie Heidegger an einer anderen Stelle sehr deutlich sagt, „auf einem vom Man abgelösten Ausnahmezustand des Subjekts, sondern ist die existenzielle Modifikation des Man als eines wesenhaften Existenzials“ (130). Gerade wenn ich meine Seinsmöglichkeiten wie Optionen auffasse, zwischen denen ich nach gusto oder sogar ganz beliebig wählen kann, verharre ich in der Uneigentlichkeit, weil es sich dabei nicht um Möglichkeiten handelt, die ich mir durch eine solche existenzielle Modifikation zueigen gemacht habe. Worin aber besteht die Modifikation? Nun, in nichts anderem als dem eben hinlänglich besprochenen „Wählen der Wahl“. Zunächst: Eine Modifikation von etwas ist nicht etwas grundsätzlich anderes als das, wovon es eine Modifikation ist. So kann man zum Beispiel eine Garage zu einer Werkstatt modifizieren und ändert dabei nicht so sehr die äußere Form, als vielmehr ihre Funktion: Modifizieren heißt soviel wie „umfunktionieren“, das heißt die Weise des Gebrauches ändern. So verhält es sich auch hier: die Eigentlichkeit als existenzielle Modifikation der Uneigentlichkeit personalen Daseins besteht primär in einem gewissen (souveränen) Umgang mit Regeln bzw. Institutionen, das heißt nicht nur in einer Regelbefolgungs-, sondern auch in einer Regelsetzungskompetenz. Hierbei ist wichtig, daß die Institutionalität (das „Verfallen“) der Personen offensichtlich notwendige Voraussetzung auch für deren mögliches Selbstsein ist.
8
Wie es ist, selbst zu sein
161
Was ist nun der Anlaß zu einer solchen „existenziellen Modifikation“? Hier tritt nun das Gewissen auf den Plan, das eine Person zu ihrem Selbstsein auffordert. Dies geschieht aber nicht in der Form eines inneren Sprechens im Sinne institutionalisierter Rede (also das was Heidegger das „Gerede“ nennt), etwa über das, was man tun darf bzw. nicht darf – so als wenn irgendwo ein Radio eingeschaltet würde und man plötzlich einen Nachrichtensprecher hört, der Sollenssätze von sich gibt. Durch das Gewissen werden nicht Handlungs- oder Willensmaximen mitgeteilt, also Regeln, die eine Person sich zueigen machen soll. Wäre dem so, dann wäre uns damit nichts weniger als „die Möglichkeit zu handeln“ (294), das heißt die Freiheit unserer Existenz als Personen zu realisieren, versagt. Was teilt uns das Gewissen aber dann mit? Es teilt uns überhaupt nichts im Sinne eines propositionalen Gehaltes mit, zu dem wir im Prinzip jederzeit eine Kontra-Position einnehmen könnten. Das Gewissen hat vielmehr „Rufcharakter“ (272). So wie ein Rufen auf der Straße den Angerufenen in eine bestimmte Aufmerksamkeit versetzt (und er aufhorcht, stehenbleibt, sich umdreht), so verhält es sich auch beim „Gewissensruf“: er versetzt eine Person in eine Aufmerksamkeit gegenüber sich selbst und ihrem Leben. Die durch ihr Gewissen angerufene Person steht, wenn sie den Ruf versteht, vor der Möglichkeit, als ganze sie selbst zu sein, das heißt vor ihrem „eigensten Seinkönnen“ (279), dessen Bezeugung das Gewissen ist. Wegen des Fehlens von irgendwelchen Verlautbarungen im Gewissensruf erfolgt er „schweigend“ (vgl. 273). Der Punkt dabei ist, daß der Ruf des Gewissens eben nicht eine allgemeine Selbstseinsforderung aufstellt, wie sie an grammatikalisch dritte Personen, also an irgendjemand (an ein „Manselbst“) erginge, sondern die Person in der ersten bzw. zweiten Person anspricht – oder besser: anschweigt – und damit, als Modus eigentlicher Rede, das uneigentliche „Gerede“ über das, was man tun und lassen soll oder nicht soll, was angebracht oder klüger oder geschickter, strategisch gut und taktisch schlecht ist, unterbricht. Dabei ist beim Gewissen, anders als beim Ruf auf der Straße, unmißverständlich klar, wer gemeint ist. Aus diesem Grund greifen die theologischen, soziologischen und psychologischen Über-Ich-Interpretationen zu kurz. Denn sie können nicht erklären, wie aus den „internalisierten“ institutionellen Regeln, die für beliebige Personen gelten, solche persönlichen Ansprüche werden, die keinen Zweifel daran lassen, daß jeweils ich gemeint bin und nicht irgendjemand. Der Gewissensruf durchbricht ja gerade jedwede Institutionalität und eine „Gewissensentscheidung“ ist gerade eine solche, die im Prinzip gegen alle Institution gerichtet sein kann, wie
162
Andreas Luckner
etwa das „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ Luthers vor dem Wormser Reichstag.16 Er ist genau deswegen ein Modus „eigentlicher“ Rede, das heißt eine Weise des Entdeckens und die Artikulation dessen, was das Ganze des Lebens einer Person „überhaupt soll“. Wenn über das Ganze des Lebens eine Klarheit erforderlich ist, meldet sich das Gewissen. Deswegen kann Heidegger sagen, daß es die Sorge, also die reflexive Grundstruktur der Person selbst ist, die sich im Gewissenruf artikuliert. „Gewissen“ kann also nur so adäquat beschrieben werden, wenn es die Person selbst ist, die sich dort ruft. Aber – wenn es die Person selbst ist, die sich dort im Gewissen ruft, wie ist dann die Unberechenbarkeit des Gewissensphänomens zu erklären, denn offenbar liegt es nicht in unserer Hand, wann das Gewissen sich meldet? „Der Ruf wird ja gerade nicht und nie von uns selbst weder geplant, noch vorbereitet, noch willentlich vollzogen. ‚Es‘ ruft, wider Erwarten und gar wider Willen. Andererseits kommt der Ruf zweifellos nicht von einem Anderen, der mit mir in der Welt ist. Der Ruf kommt aus mir und doch über mich“ (275). Gerade, wenn äußerlich alle Bedingungen der Regelkonformität erfüllt sind, kann das Gewissen sich melden. Auch dies ist ein Zeichen seiner Nicht-Institutionalität, das heißt des nicht einer Regel unterliegenden Charakters der Stimme des Gewissens. Sie wird prima facie gerade deswegen immer so gedeutet, als wenn sie von einer jenseits jeglicher Institutionalität angesiedelten Instanz ausgeht. Heidegger hat nun mit der Unterscheidung von eigentlichem und uneigentlichem personalen Dasein eine schlagend einfache Erklärung für die Herkunft des Gewissensrufes: Die uneigentlich, das heißt in den institutionalisierten Weltbezügen zu den anderen existierende Person wird aufgrund der auf Seinsmöglichkeiten hingeordneten Struktur seines eigenen personalen Daseins, seiner „Sorge“, plötzlich gewahr, daß es „doch noch etwas anderes geben muß“, eben ein „eigentliches Sein“, das „wahre Leben“ usw. Der Gewissenruf ist daher nichts anderes als „Ruf der Sorge“ (286).
16 Überhaupt dürfte für den ganzen hier zu besprechenden Abschnitt von Sein und Zeit – neben der aristotelischen phronesis-Lehre, s. u. – Luther mit seiner Lehre von der innerlichen Freiheit eines Christenmenschen Pate gestanden haben. Auch Luther sagt schließlich von Geboten und Gesetzen (des Alten Testamentes), daß sie dafür da sind, dem Menschen seine Endlichkeit zu zeigen, damit er sich als durch und durch sündhaft erkennt. In dieser Demut – dem entspräche die „Entschlossenheit“– ist er allererst erreichbar für das göttliche Wort der Zusage der dermaleinstigen Erlösung von seiner Sündhaftigkeit. Von Hermann Mörchen wissen wir, daß in Heideggers Marburger Studierzimmer die Erlanger Luther-Ausgabe „am griffbereitesten“ (Mörchen 1990, 75) über seinem Schreibtisch stand. Über den Protestantismus Heideggers schon in Freiburg vgl. Rentsch 1989, 74.
8
Wie es ist, selbst zu sein
163
Das Verstehen dieser Rede, das Hören auf den Gewissenruf macht die Person bekannt mit ihrem möglichen eigentlichen Selbst, das nicht in den Institutionen aufgeht, sondern diese vielmehr (zumindest für das eigene Leben) einzurichten imstande ist. Von öffentlichen Rechtfertigungen etwa per Begründung und Argumentation unterscheidet sich eine Berufung aufs Gewissen daher auch signifikant: Hier kann nicht weiter gefragt bzw. Rechtfertigung verlangt werden à la: „Und warum sagt Dir das Dein Gewissen“? Zwar kann die Berufung aufs Gewissen selbst institutionalisiert, ja sogar ritualisiert sein, nicht aber das, was das Gewissen „sagt“, denn dies ist nicht in öffentliche Rede („Gerede“) übersetz- oder gar diskutierbar. Der Gewissensruf gibt vielmehr zu verstehen, daß jeweils ich hier und jetzt, da er erfolgt, im Sinne meiner Selbstbestimmung zu handeln habe.
8.4.3 Schuld Der Ruf des Gewissens kann als eine Aufforderung zum Selbstsein verstanden werden. Worin sich nun die meisten Erklärungen des Phänomens einig zu sein scheinen, ist ja wohl, daß das Gewissen eine Schuld zu verstehen gibt. Heidegger dekliniert nun in Sein und Zeit 282 f. die verschiedenen Intuitionen durch, die sich mit dem Schuldbegriff verbinden („jemanden etwas schulden“, „schuld sein an etwas“ im Sinne von „Ursache sein“, „sich schuldig machen“ usw.). Diese Bestimmungen haben mehr oder weniger mit Eingriffen in eine (oder gar Verletzungen der) Ordnung zu tun und sind daher nicht „ursprünglich“, sondern in Abhängigkeit von diesen Ordnungen gedacht: Aber damit „wird das ‚schuldig‘ wieder in den Bezirk des Besorgens im Sinne des ausgleichenden Verrechnens von Ansprüchen abgedrängt“ (283). Die leitende Gewissensvorstellung dabei ist diejenige des „schlechten Gewissens“, das demgemäß die Differenz von Anspruch (einem Sollen) und Wirklichkeit (dem Sein der Person) als „Bekundung des Böseseins“ (290) im Sinne einer Wach- und Kontrollinstanz zu verstehen gibt. Dies kann nicht das ursprüngliche Gewissen sein, denn es ist abhängig von einem Schuldbegriff, der wesentlich als Mangel bestimmt ist, „als Fehlen von etwas, was sein soll und kann“ (283). Das bedeutet aber, daß hier von vorneherein die Person unter der Seinsweise der Vorhandenheit betrachtet wird: „Fehlen besagt Nichtvorhandensein“ (ebd.), im Falle des schlechten Gewissens eben einer erforderten (oder „gesollten“) Handlungsweise oder Qualität. In dieser moralischen Mangelwirtschaft wird entsprechend die „eigentliche“, idealische Person als schon (irgendwo) vorhandene vorgestellt, so
164
Andreas Luckner
wie ein Idol, demgegenüber die reale Person immer unvollkommen sein wird. Die Person steht so immer im Soll: Sie existiert eben dadurch uneigentlich, das heißt nicht selbständig. Sie begreift sich so nur als Adressat des Schuld zu verstehen gebenden Gewissensrufes, und nicht selbst als die eigentliche Person, die der Grund dafür ist, daß er ergeht. Die „eigentliche Existenz“ einer Person ist daher diejenige Konstitutionsleistung (eben: Modifikation qua Aneignung), zu der zwar durch den Gewissensruf Veranlassung gegeben ist, die aber durch ihn nicht schon selbst erbracht ist. Wie es ist, eigentlich selbst zu sein und was dies jeweils für eine Person konkret bedeutet, ist damit für sie selbst und für andere völlig offen. Was das Gewissen daher als Schuld zu verstehen gibt, muß als Idee „abgelöst werden von dem Bezug auf ein Sollen und Gesetz, wogegen verfehlend jemand Schuld auf sich lädt“ (283). Gesucht ist dagegen ein existenzialer, das heißt die Seinsweise von Personen immer schon betreffender und die Bedingungen der Möglichkeit faktischer Schuld mitumfassender Schuldbegriff. Heidegger findet ihn in der Formulierung: „Grundsein einer Nichtigkeit“ (ebd.). Personen sind immer schon „schuldig“, weil sie als bestimmte Personen jeweils bestimmte Möglichkeiten in ihrem Leben realisieren und andere dadurch ausschließen. Diese Nichtigkeit oder auch „Endlichkeit“17 – bei Hegel hieß derlei „Negativität“ – ist charakteristisch für die gesamte Existenzweise von Personen. Sie sind so; das heißt ohne in diesem Sinne ausschließend bzw. nichtig zu sein, wären sie gar nicht. Weil das so ist, ist die Nichtigkeit der Existenz als Konstituens der Personalität nichts zu Beklagendes, Unvollkommenes oder zu Kompensierendes, sondern im Sinne eines Anerkennens der eigenen Schuldfähigkeit etwas, wovon eine Person eigentlich lebt. Solange man allerdings an der Vorhandenheitsontologie im Blick auf personales Dasein festhält, kann man nicht klären, warum das Gewissen, indem es zum Selbstsein aufruft, ineins damit ganz bestimmte faktische Möglichkeiten als die seinigen auszuzeichnen und dadurch bestimmte andere Seinsmöglichkeiten auszuschließen auffordert. Die Person soll, so die Aufforderung ihres Gewissens, ihre Endlichkeit als Ganzseinkönnen, als personale Integrität be- und ergreifen. So anerkennt sie „Verantwortlichkeit“ (127) für ihre Person, von der sie in der Sphäre des Man „entlastet“ (ebd.) ist. Wenn dagegen Endlichkeit lediglich als Unvollkommenheit und zu kompensierende Mangelhaftigkeit aufgefaßt wird – das Grundtheorem der
17 Vgl. etwa in Heidegger 1973, 222.
8
Wie es ist, selbst zu sein
165
philosophischen Anthropologie – hält man andererseits an einem abstrakten Begriff der Person als einem idealen „Subjekt“ (heutzutage eher: ein rationaler Entscheider) fest, das (bzw. der) im Prinzip und idealerweise über alle wählbaren Optionen verfügt: ein Hauptcharakteristikum gerade des uneigentlichen personalen Daseins. Die eigentliche Existenz einer Person wäre aber gerade eine solche, die aus ihrer Freiheit heraus sich auf ihre ureigensten Möglichkeiten beschränkt und sich, indem sie sich an bestimmte Projekte und Personen bindet, zu ihrem eigentlichen Selbstsein individuiert.
8.4.4 Noch einmal: Entschlossenheit Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine Person dann „eigentlich existiert“, wenn sie institutionell gegebene – nicht etwa nur gegenwärtig sich anbietende, sondern auch und gerade geschichtlich „wiederholbare“ (vgl. 382 ff.) – Handlungsregeln (oder: „Maximen“) in einer „existenziellen Modifikation“ sich so aneignet, daß sie nicht nur ihnen gemäß, sondern gleichsam aus ihnen heraus handelt. Erst dann kann man auch von einer moralischen Persönlichkeit sprechen – was bedeutet, daß eine Person sich selbst Ansprüchen unterstellt, an denen sie gemessen werden will. Das heißt „Entschlossenheit“ bzw. „Gewissen-haben-wollen“. Wenn es demnach heißt, das Gewissen rufe zum Schuldigsein auf, beinhaltet dies umgekehrt nicht etwa einen „Aufruf zur Bosheit“ (287), sondern vielmehr die Aufforderung, keine weitere Entschuldigungen für sein Handeln zu suchen, sondern „entschlossen“, das heißt frei zu ihnen zu stehen. Dieser Aufforderung ihres Gewissens kann eine Person jederzeit entsprechen, und wenn sie dies tut, wählt sie sich selbst. Beim Ausdruck „Entschlossenheit“ sollte man daher eher an „Aufgeschlossenheit“ und „Offenheit“ gegenüber der noch unbestimmten individuellen Lebensgestalt als an Rigorismus und aufgepflanzte Bajonette denken.18 Heidegger selbst schreibt, daß zur Entschlossenheit einer Person wesentlich ihre „Unbestimmtheit“ (298) gehört, die erst im Ergreifen eines andere Optionen ausschließenden Entschlusses zu einer Bestimmtheit modifiziert wird. In ihrer eigentlichen Existenz tun die Leute daher in der Tat‚ 18 Obwohl Heidegger dies durch seine expressionistische Diktion schier unmöglich macht. Ich denke dennoch, daß der systematische Aufbau der Struktur, zusammen mit der Übersetzung aus dem Althochmartialischen ins Neuniederpragmatische, kaum eine andere Deutungsmöglichkeit zuläßt.
166
Andreas Luckner
was sie wollen. Aber was sie wollen ist nicht in irgendeinem Sinne „beliebig“ und beruht auch nicht auf einem wahllosen „Dezisionismus“, wenn auch andererseits das Tunliche bzw. Gewollte je individuell verschieden sein mag.
8.5 Ethik und Heidegger Abschließend will ich thesenhaft und ausblicksartig drei Themenfelder anreißen, die sich an diese Überlegungen möglicherweise fruchtbar anschließen könnten. Das erste betrifft Versuche einer Ethik der Authentizität, wie sie etwa Taylor (ohne Bezug auf Heidegger) im Interesse einer „Anerkennung von Unterschieden“ anstrengt. Taylor weist zurecht darauf hin, daß Authentizität, sofern sie existentialistisch-dezisionistisch allein auf einem Akt der Selbstwahl beruhend angesehen wird, ein nichtssagendes Konzept wird, weil die Entschlüsse nicht mehr nach ihrer Bedeutsamkeit unterschieden werden könnten. Wichtig aber ist gemeinhin das, worum gestritten wird: „Dabei liegt es nicht an mir, zu bestimmen, welche Streitfragen bedeutsam sind. Läge es doch an mir, wäre gar keine Frage bedeutsam.“19 Daher würde ein Authentizitätsstreben, welches institutionelle Bedeutungshorizonte einerseits, die dialogische Selbstdefinitionen von Personen andererseits ausblendet, seine eigenen Grundlagen zerstören. Während die Institutionalität als Bedingung von Authentizität bei Heidegger in diesem Beitrag wohl breit genug herausgestellt worden ist – und sich hier also starke Berührungs- und Anknüpfungspunkte ergeben –, scheint der zweite Punkt Taylors, die im Dialog sich vollziehende Selbstdefinition der Personen, bei Heidegger unterbelichtet zu sein. Dies bringt mich zum zweiten Themenfeld: der Frage nach einem „eigentlichen Mitsein“. Daß Personen immer schon auf andere Personen bezogen sind, daß „Mitsein“ also ein Existenzial ist, klärt Heidegger unmißverständlich im § 26, nach dem eine personale Existenz nur „wesenhaft umwillen anderer“ (123) geführt werden kann. Die von Karl Löwith schon früh aufgebrachte und seitdem ständig wiederholte These, daß Heidegger aber nur ein uneigentliches, zweideutiges Mitsein qua Öffentlichkeit kenne,20 trifft zwar sicherlich einen charakteristischen Zug von Heideggers persönlichem Denken, nicht aber seine Philosophie bzw. die Systematik der 19 Taylor 1995, 49 f. 20 Vgl. Löwith 1928, 76 ff.
8
Wie es ist, selbst zu sein
167
existenzialen Analyse. Auf Grundlage der voranstehenden Rekonstruktion dessen, was „Eigentlichkeit“ heißt, ist ganz klar auch die Möglichkeit eines „eigentlichen Mitseins“ gegeben, auch wenn Heidegger sich – uninteressiert an ethischen Fragen – hierüber kaum den Kopf zerbricht. Auch hier würde es sich um eine existenzielle Modifikation des uneigentlichen personalen Mitseins handeln. Auf dem Höhepunkt der Analyse eigentlichen Daseins heißt es: „Die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbstsein das Dasein nicht von seiner Welt ab“ – gegen alle „gnostischen“ Interpretationsversuche –, sondern „stößt es in das fürsorgende Mitsein mit den Anderen“ (298). Heidegger beschreibt viel früher im Text zwei Formen dieses fürsorgenden Mitseins: 1. die „einspringend-beherrschende“ Fürsorge, die der anderen Person deren „Sorge“ gleichsam abnehmen möchte (122) und daher dazu tendiert, die anderen zu entmündigen, und 2. die „vorspringend-befreiende“ Fürsorge, die wesentlich die Existenz des anderen betrifft und ihm allererst dazu verhilft, „in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden“ (ebd.). Hier, in dieser zweiten Form, ist also durchaus ein Ansatz für transpersonale Fragen personaler Selbstbestimmung zu finden. Der dritte Themenbereich betrifft die „Wiederholung“ der aristotelischen Ethik im nichtteleologischen Rahmen der Existenzialanalyse.21 Der jungforsche Heidegger erregte schon in den frühen zwanziger Jahren mit der These Aufmerksamkeit, daß die aristotelische phrónêsis dem entspräche, was die christliche Tradition „Gewissen“ nennt.22 In der Marburger Vorlesung des Wintersemesters von 1924/25 über Platons Sophistês – dessen Interpretation eine Analyse der dianoetischen Tugenden bei Aristoteles vorangestellt ist – heißt es explizit: „Die phrónêsis ist nichts anderes als das in Bewegung gesetzte Gewissen, das eine Handlung durchsichtig macht“ (GA 19, 54) und damit die konkreten einzelnen Seinsmöglichkeiten aufdeckt (vgl. ebd., 138 ff.). In dieser Vorlesung wird auch deutlich, daß „eigentliches Dasein“ ein anderer Name für eudaimonia ist, in deren Interesse die phrónêsis bei Aristoteles ja letztlich arbeitet. Eudaimonia ist nämlich, so die Übersetzung Heideggers des energeia psychês kat’aretai23 „die reine Gegenwart des Lebenden hinsichtlich seiner zu Ende gebrachten Seinsmöglichkeit“ (ebd. 173). Auch läßt sich das von der phrónêsis Gewußte – ein untechnisches Wissen um die Realisierungsbedingungen 21 Hierzu gibt es erhellende Vorarbeiten etwa von Gadamer 1987 und Volpi 1989. 22 Vgl. Gadamer 1983, 32. 23 Vgl. Aristoteles 1985, 1098a15; eine herkömmliche Übersetzung wäre etwa: „Glückseligkeit ist die Tätigkeit der Seele gemäß den Tugenden“.
168
Andreas Luckner
gelingender Praxis – nicht vergessen, anders als etwa das Wissen der epistêmê. Unter anderem wegen dieser „Unvergeßlichkeit“ meinte Heidegger, daß Aristoteles in der phrónêsis das ursprüngliche Phänomen des Gewissens gefunden hätte. Obwohl diese These etymologisch unhaltbar und ideengeschichtlich zumindest problematisch scheint, ist sie doch von großem systematischen Interesse für die aktuelle Frage einer Rehabilitation der Tugendethiken. Ein Rekurs auf die aristotelische Phronesis-Lehre im nichtteleologischen Rahmen der Heideggerschen Existenzialanalyse scheint hierfür vielversprechend zu sein.
Literatur Adorno, Th. W. 1964: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Frankfurt a. M. Aristoteles 1985: Nikomachische Ethik, übers. V. Rolfes/G. Bien, 4. durchges. Aufl., Hamburg Brandner, R. 1992: Warum Heidegger keine Ethik geschrieben hat, Wien Figal, G. 1988: Martin Heidegger: Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt a. M. (Sonderausgabe 1991) Gadamer, H.-G. 1983: Heideggers Wege, Tübingen Gadamer, H.-G. 1987: „Heidegger und die Ethik“, in: Gesammelte Werke, Bd. 3, Tübingen, 333–374 Herrmann, F. W. v. 1985: Subjekt und Dasein. Interpretationen zu Sein und Zeit, Frankfurt a. M., 2. Aufl. Löwith, K., Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, München 1928 Luckner, A. 1997: Martin Heidegger: Sein und Zeit. Ein einführender Kommentar Paderborn/ München/Wien/Zürich. Zweite, überarbeitete Aufl. 2001 Luckner, A. 1998: „Heideggers ethische Differenz“, in: Waldenfels, B., Därmann, I. (Hg.), Der Anspruch des Anderen, München, 65–86 Macann, Chr. 1992: „Who is Dasein? Towards an ethics of authenticity“, in: Macann, Chr. (ed.), Martin Heidegger. Critical Assessments IV, London/New York, 214–246 Mörchen, H. 1990: „Heidegger und die Marburger Theologie“, in: Kemper, P. (Hg.), Martin Heidegger – Faszination und Erschrecken. Die politische Dimension einer Philosophie, Frankfurt a. M., 72–85 Rentsch, Th. 1989: Martin Heidegger. Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung, München Rentsch, Th. 1990, 21999: Die Konstitution der Moralität: Transzendentale Anthropologie und Praktische Philosophie, Frankfurt a. M. Seel, M. 1989: „Heidegger und die Ethik des Spiels“, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Martin Heidegger: Innen- und Außenansichten, Frankfurt a. M., 244–272 Taylor, Ch. 1995: The Malaise of Modernity, Ontario 1991; dt.: Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt a. M. Volpi, Fr. 1989: ‚Sein und Zeit‘: Homologien zur ‚Nikomachischen Ethik‘ in: Philosophisches Jahrbuch 96, 225–240
9 Marion Heinz
Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins und die Zeitlichkeit als der ontologische Sinn der Sorge (§§ 61–66)
9.1 Aufbau der Zeituntersuchungen Das hier zu behandelnde dritte Kapitel von Sein und Zeit schlägt die Brücke von der Analyse des Seins des Daseins zur Freilegung seines Sinnes, der Zeitlichkeit. Zur Einordnung dieses Kapitels in den Gesamtplan von Sein und Zeit empfiehlt sich zunächst eine kurze Skizze des Aufbaus der Zeituntersuchungen insgesamt. Heidegger steht vor dem komplexen Problem, daß er bei der Entwicklung seiner leitenden These, der Sinn von Sein sei die Zeit (18), von dem Boden des einzig seinsverstehenden Seins – des Daseins – ausgehen will, jedoch die von diesem selbst gebrauchten traditionellen Begriffe von „Sein“ wie von „Zeit“ für diese Aufgabe durchaus unzulänglich erscheinen, da in diesen umgekehrt die Zeit schon als etwas Seiendes vorverstanden ist. Daher ist er gezwungen, die grundlegenden Strukturen der „Zeitlichkeit“ (17) von Grund auf neu zu bestimmen, indem er, von den tatsächlichen Vollzügen des „Daseins“ ausgehend (114, 133), dasselbe einer phänomenologisch-hermeneutischen Analyse unterzieht. Hierbei weist er zunächst in einer „Grundfreilegung“ die bereits vom Dasein selbst vorverstandenen Strukturen auf, um diese hernach einer sie allererst bewährenden „Reinterpretation“ zu unterziehen (vgl. Gethmann 1974, 259 f.). Diese inhaltlichen und methodischen Vorgaben zeichnen das Aufbauschema vor, dem Heideggers Zeitanalysen folgen: ausgehend von dem eigentlich vollzogenen Sein des Daseins, der vorlaufenden Entschlossenheit (§ 63), wird die Zeitlichkeit als Einheitsgrund der Sorge freigelegt (§ 65). Die zeitliche Reinterpretation des In-Seins bewährt die Zeitlichkeit als Grund der Sorge im Modus der Alltäglichkeit (§ 68). Die reichere Verfassung des Daseins
170
Marion Heinz
als In-der-Welt-sein wird hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfaßtheit in § 69 aufgewiesen. Aufbauend auf dieser Strukturanalyse will Heidegger die zeitliche Verfaßtheit des Daseins umfassend erhellen – in Bezug auf das „Selbst“ wie auf die „Geschichtlichkeit“ (§§ 72–76 und 78–81) –, um so schließlich die Zeitlichkeit als die vom vulgären Zeitverständnis lediglich verdeckte „ursprüngliche Zeit“ (405) freizulegen und zu bewähren.1 Die Fundamentalontologie kommt also mit den §§ 61–66 an ein wichtiges Ziel: der zeitliche Sinn der Sorge und die Grundstrukturen der Zeitlichkeit des Daseins werden entwickelt. Dieser Abschnitt bildet zugleich ein Scharnier zwischen Seins- und Sinnebene. Der vergleichsweise hohe Anteil expliziter Methodenreflexion ist ein Indiz für die Schwierigkeit dieses Übergangs. Sowohl der Aufweis der ursprünglichen Gestalt des Seins des Daseins (§ 62) als auch die Bestimmung seines Sinnes (§ 65) bedürfen ausführlicher methodischer Vorklärungen. Für den Leser besteht die Schwierigkeit dieses Abschnitts darin, daß dieses Scharnierstück zugleich eine Art Drehpunkt für einen notwendigen Perspektivenwechsel ist: zum einen ist von den bis dahin gewonnenen Resultaten der Seinsanalyse auszugehen, um zu der Dimension des zeitlichen Sinnes als Grund des Seins fortzugehen; zum anderen aber verlangt die hermeneutische Ausgangssituation bereits eine Antizipation dieser Zeitlichkeitsebene. Es handelt sich nicht um eine lineare Bewegung vom Begründeten zu dessen Grund im herkömmlichen Sinne, vielmehr ist eine Art Umschlag, Perspektivenwechsel schon erforderlich, um den Grund als solchen vor Augen zu bringen. Plakativ wäre dieser Perspektivenwechsel als Aufgeben einer im weitesten Sinne platonistischen Sicht zugunsten der neuen Optik der temporal-geschichtlichen Ontologie zu charakterisieren. Um die Zeitlichkeit als Sinn und Grund des Daseins in den Blick und zu Begriff bringen zu können, muß die hermeneutische Situation selbst bereits als wesenhaft geschichtliche erfahren und begriffen werden. Betrachtet man das Kapitel unter diesem Gesichtspunkt, verliert sich der zunächst vorherrschende Eindruck völliger Disparatheit der Themen und Fragestellungen: In den §§ 61 und 62 wird herausgearbeitet, daß die existenziale Analyse zur Bestimmung der Einheit des Seins des Daseins auf 1 Die in § 69c erfolgte Analyse der Transzendenz der Welt und der horizontalen Schemata der Zeitlichkeit war vermutlich als Grundlegung des geplanten dritten Abschnittes des ersten Teiles von Sein und Zeit gedacht (siehe GA 24; vgl. von Hermann 1991b sowie Kisiel in diesem Band).
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
171
das jemeinige endliche Seinkönnen verwiesen ist; in § 63 wird die Eigenart dieser Wissenschaft hinsichtlich ihres endlich-geschichtlichen Selbstverständnisses profiliert; die in § 64 erfolgende Destruktion der Subjektphilosophie leuchtet nur von diesem Ansatz her ein, das heißt ist nur zu verstehen als von dem geschichtlichen Selbstverständnis her notwendige und bestimmte Auseinandersetzung mit der Tradition, durch die sich die eigene geschichtliche Auffassung zu bewähren hat. Erst in § 65 wird der begriffliche Rahmen für diese Weisen existenziellen und existenzialen geschichtlichen Verstehens entwickelt.
9.2 Der Zusammenhang von Entschlossenheit und Vorlaufen zum Tod Zu klären ist zunächst, wie Heidegger den Übergang von der Seinsbestimmung des Daseins zur Freilegung seines Sinnes konzipiert, welche der hierzu notwendigen Voraussetzungen bereits erfüllt sind und welche Schritte noch zu tun sind. Den Übergang von der Seinsbestimmung des Daseins zur Zeitlichkeit vorzubereiten, heißt zunächst, den hierfür erforderlichen phänomenalen Boden bereitzustellen. Grundsätzlich ist für eine auf den Sinn als letzten Grund des Verstehens von Sein zurückgehende Untersuchung zu verlangen, daß das Verstehen selbst als ursprüngliches und ganzes Verstehen von Sein in Ansatz zu bringen ist (vgl. 301). Das alltägliche, Sein verschließende Existieren genügt dieser Forderung nicht. Diese Aufgabe verschränkt sich aber mit dem Versuch der Rechtfertigung des existenzialontologischen Begriffs der Sorge. Sofern nämlich existenziale Begriffe grundsätzlich der existenziellen Bewährung bedürfen, ist auch für den existenzialen Begriff des Seins des Daseins – Sorge – eine existenzielle Bestätigung zu verlangen. Wenn als adäquater phänomenaler Boden für die Sinnfreilegung nur derjenige existenzielle Seinsvollzug in Frage kommt, in dem sich das Dasein in seinem Sein unverdeckt erschlossen ist, muß durch dieses vorontologische Seinsverstehen zugleich der ontologische Begriff der Sorge „verifiziert“ werden können. Wie noch genauer zu zeigen ist, schließt sich mit diesen Erörterungen der Zirkel von vorontologischem und ontologischem Verstehen auf einer ersten Stufe: wegen der dem Dasein wesenhaften Verdeckungstendenz bedarf es des ontologischen Seinsbegriffs, um den unverstellten existenziellen Seinsvollzug überhaupt in den Blick bringen zu können. Weil aber ontologische Begriffe nichts als ausgezeichnete Auslegungen des vorontologischen Verstehens sind, rechtfertigt sich der Sorgebegriff durch das Zeugnis der unverstellten existenziellen Weise des Seinsvollzugs.
172
Marion Heinz
In der Absicht, der Bestimmung des Seinssinnes des Daseins einen adäquaten phänomenalen Boden zu verschaffen, wurden bereits zwei entscheidende Ergebnisse erzielt: 1. Mit der existenzialen Analyse des Vorlaufens zum Tod ist das eigentliche und ursprüngliche Ganzseinkönnen des Daseins zu Begriff gebracht. 2. Das im Gewissen bezeugte Phänomen der Entschlossenheit wurde als existenzieller Modus eigentlicher Existenz existenzial interpretiert (vgl. 301 f.). Die erste Problemstellung des hier behandelten Kapitels zielt auf die Klärung des Zusammenhangs von Vorlaufen zum Tod und Entschlossenheit. Zu fragen ist, warum es überhaupt notwendig ist, einen solchen Zusammenhang herzustellen, wovon Heidegger als selbstverständlich ausgeht, wenn er von vornherein nur die Art der Zusammengehörigkeit problematisiert. Die Notwendigkeit, das Vorlaufen zum Tod mit der Entschlossenheit zusammenzudenken, ergibt sich aus der angesetzten Existenzidee. Der Begriff der Sorge als Begriff des Seins des Daseins enthält eine Mannigfaltigkeit von Momenten; Existenzialität, Faktizität, Verfallen und Sein-bei werden darin als unabdingbar zusammengehörige, gleich-ursprüngliche Momente gedacht. Der Terminus „Gleichursprünglichkeit“ impliziert sowohl den Gedanken, daß vieles gleichermaßen ursprünglich ist, das heißt weder auseinander begründbar noch aufeinander reduzierbar ist, als auch den Gedanken, daß dieses Viele den gleichen Ursprung hat. Das im Gewissensruf bezeugte existenzielle Seinkönnen, das existenzial als Entschlossenheit interpretiert wurde, liefert die geforderte existenzielle Bestätigung dafür, daß sich das Dasein in der Mannigfaltigkeit der Strukturmomente seines Seins erschlossen ist. Denn Entschlossenheit ist das verschwiegene, angstbereite Verstehen des eigenen Schuldigseins, das sich zu bestimmten Möglichkeiten der Fürsorge und des Besorgens entschließt. Unklar ist jedoch, um welche Art der Einheit oder Ganzheit es sich dabei genau handelt. Mit der Analyse des Todes wurde aber bereits ein existenzialer Begriff von Ganzheit entwickelt. Methodisch gefordert ist wiederum dessen existenzielle Bezeugung. Die Intention, das Vorlaufen in den Tod mit der Entschlossenheit zusammenzudenken, soll also einem doppelten Mangel abhelfen: Die Art der Einheit der Strukturmannigfaltigkeit der Entschlossenheit zu begreifen und das existenzial entworfene Ganzsein existenziell zu belegen. Prima facie hat die Frage nach der Einheit einer Mannigfaltigkeit von Seinsmomenten freilich nichts damit zu tun, daß sich das Dasein im Sein zu seinem Ende als ganzes Seinkönnen im Sinne des jemeinigen endlichen
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
173
Entwurfsspielraums konstituiert. Handelt es sich im ersten Fall darum, die für jedes Dasein geltenden und in diesem Sinne allgemeinen Seinsstrukturen hinsichtlich ihrer Art der Einheit zu bestimmen, so geht es im zweiten Fall darum, die Einheit und Ganzheit des jemeinigen, also – traditionell gesprochen – individuellen Seinkönnens als kollektive Einheit von Vollzügen zu Begriff zu bringen. Was – so ist zu fragen – hat die als allgemein zu denkende Einheit von mannigfaltigen Seinsmomenten mit dem individuell zu vollziehenden jemeinigen ganzen Seinkönnen zu tun? Wie der Zusammenhang von Entschlossenheit und Vorlaufen aufzuzeigen ist, untersucht Heidegger in § 61. Ausgeschlossen wird zunächst eine unphänomenologische Konstruktion, „ein äußerliches Zusammenbinden beider Phänomene“ (302). Positiven Anhalt für die Lösung dieses Problems kann nur die leitende Idee von Existenz bieten: „Das bedeutet für die Frage nach dem möglichen Zusammenhang zwischen Vorlaufen und Entschlossenheit nichts weniger als die Forderung, diese existenzialen Phänomene auf die in ihnen vorgezeichneten existenziellen Möglichkeiten zu entwerfen und diese existenzial ‚zu Ende zu denken‘. Dadurch verliert die Herausarbeitung der vorlaufenden Entschlossenheit als eines existenziell möglichen eigentlichen Ganzseinkönnens den Charakter einer willkürlichen Konstruktion. Sie wird zur interpretierenden Befreiung des Daseins für seine äußerste Existenzmöglichkeit“ (302 f.). Versucht man diese komplexe methodische Anweisung zunächst in abstracto nachzuvollziehen, ergibt sich folgendes: Auszugehen ist von dem existenziell bezeugten, existenzial interpretierten Phänomen der Entschlossenheit. Existenziale Phänomene sind formal und lassen als in diesem Sinne allgemeine Bestimmungen existenzielle Konkretisierungen zu, die hier jedoch nicht vorgegeben sind, sondern von dem Exegeten des Daseins vorgezeichnet werden. Diese nun ihrerseits existenzial „zu Ende zu denken“, heißt zunächst, sie konsequent als existenziales Phänomen zu begreifen. Wenn nun Heidegger beansprucht, durch dieses Verfahren verliere die Herausarbeitung der vorlaufenden Entschlossenheit den Charakter einer willkürlichen Konstruktion und werde zur interpretierenden Befreiung des Daseins für seine äußerste Existenzmöglichkeit, dann sind „existenziales Zu-Ende-Denken“ und „Freigabe des Daseins für sein Sein zum Tod“ derart verbunden, daß die existenzial begriffene existenzielle Möglichkeit als solche zum existenziellen Möglichsein wird. Wenn dem so ist, dann ist der Begriff existenzieller Vollzugsweisen kein interesseloses, bloß theoretisches Erfassen des ontischen, existenziellen Phänomens, das für das Dasein gleichgültig bleibt. Eine radikale Interpretation des Existierens ist ihrem eigenen Sinn nach vielmehr darauf angelegt, in die Existenz
174
Marion Heinz
selbst zurückzuschlagen, um für diese selbst existenziell relevant zu werden. Ihre Wahrheit besteht also nicht primär in der Angemessenheit an ein schon zutage liegendes Phänomen, sondern in ihrer „Potentialität“, das Dasein zu einer Wahl zu provozieren, in der es sich zu diesem Sein entscheiden kann. Zufolge dieser Wirksamkeit im Sinne der „interpretierenden Befreiung“ kann Heidegger beanspruchen, mit den Existenzialien einen Typus von Begriffen entwickelt zu haben, der der Seinsart dieses Seienden, anders als kategoriale Bestimmungen, nicht nur hinsichtlich seines Inhalts adäquat zu sein beansprucht, sondern dieser Seinsart zudem in seinem Charakter als Begriff entspricht. Das Seinkönnen zu Begriff zu bringen, heißt zugleich, dem Seinkönnen durch den Begriff so zu entsprechen, daß dieser ein Seinkönnen vorzeichnet. In diesem Sinne sind Existenzialien formale Anzeigen. Anders gewendet: die Theorie ist selbst von der Seinsart ihres Gegenstandes, des existierenden Daseins und kein eigengesetzliches Erfassen oder Bestimmen.2 Die sprachliche Parallelisierung von „zu Ende denken“ und „zu Ende sein“ legt den Gedanken nahe, die konsequente Durchführung der existenzialen Interpretation eigentlichen Schuldigseins weise eine inhaltliche Übereinstimmung mit der Befreiung des Daseins zu seinem Sein zum Tod auf; das telos der Interpretation sei also inhaltlich mit dem existenziellen Sein zum Ende verbunden. Zwei Aspekte sind hier relevant: Erstens führt die konsequente und adäquate Interpretation des Daseins notwendig auf das Sein zum Tod als existenziellem Ganzsein, als dessen Bestimmungen oder Momente die Seinscharaktere zu denken sind. Zweitens aber bringt diese strikte Durchführung des existenzialen Ansatzes zugleich diese Wissenschaft zu dem ihr angemessenen Selbstverständnis als temporal-geschichtlicher Wissenschaft. Und dieses geschichtliche Selbstverständnis besagt eben nichts anderes, als daß dieses „Wissen“ ist, indem es in das geschichtliche Leben zurückschlägt, aus dem es entspringt, um dieses existenziell zu seiner Geschichtlichkeit und Endlichkeit zu befreien. M. a. W.: Das Begreifen des Schuldigseins erfordert den Bezug auf das Sein zum Tode und führt ineins zur Einsicht in die Endlichkeit der Wissenschaft des Endlichen, die eben darin besteht, das endliche Seiende zu sich selbst zu bringen bzw. das existenzielle Selbstverständnis der Endlichkeit zu ermöglichen. Philosophie hat es nicht mehr wie bei Husserl mit der Sphäre des Idealen im Unterschied zum realen, geschichtlichen Leben zu tun. 2 Zweifellos folgt Heidegger hier dem Laskschen Ansatz, demzufolge die Form als Form einer bestimmten Materie durch diese affiziert ist.
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
175
Wie wird nun diese methodische Anweisung in concreto durchgeführt? Das existenziale Phänomen der Entschlossenheit im Sinne des angstbereiten Sichentwerfens auf das eigenste Schuldigsein wird hinsichtlich seiner ausgezeichneten existenziellen Möglichkeit wie folgt weiterentwickelt: „Die existenzielle Übernahme dieser ‚Schuld‘ in der Entschlossenheit wird demnach nur dann eigentlich vollzogen, wenn sich die Entschlossenheit in ihrem Erschließen des Daseins so durchsichtig geworden ist, daß sie das Schuldigsein als ständiges versteht“ (305). Die Kennzeichnung des Schuldigseins durch den Begriff „ständig“ wird zunächst durch Zeitangaben wie „solange es ist“, nicht „zuweilen und dann wieder nicht schuldig“, erläutert, so daß es scheint, gemeint sei eine bleibende, nicht wechselnde Eigenschaft. Auch die Weiterführung des Gedankens nimmt zunächst diese innerzeitige Perspektive auf, so jedoch, daß diese Blickrichtung gewendet wird, indem die existenzielle Möglichkeit wie folgt „existenzial zu Ende“ gedacht wird: „Dieses Verstehen aber ermöglicht sich nur dergestalt, daß sich das Dasein das Seinkönnen ‚bis zu seinem Ende‘ erschließt. Das Zu-Ende-sein des Daseins besagt jedoch existenzial: Sein zum Ende“ (305). Zwei Behauptungen sind hier verknüpft: Nur unter der Bedingung existenziellen Sicherschließens „bis zum Ende“ ist das Schuldigsein als ständiges möglich und dieses existenzielle Phänomen ist existenzial als Zu-Ende-sein im Sinne des Vorlaufens in den Tod zu begreifen. Während die erste Behauptung zunächst scheinbar so zu verstehen ist, daß die Ständigkeit des Schuldigseins verlangt, das ganze Existieren im Sinne eines endlichen Dauerns zu antizipieren, macht die zweite Behauptung klar, daß ein anderer Sinn von Sein als Voraussetzung eigentlicher Übernahme des Schuldigseins zu reklamieren ist, nämlich Ganzsein als im Vorlaufen in den Tod je selbst ermöglichter jemeiniger Entwurfsspielraum. Die konsequente Durchführung der Existenzialontologie verlangt also als Folge der Zurückweisung der Ding- bzw. Substanzontologie eine neue Interpretation des zeitlichen Sinnes von „wesenhaft“ zu erarbeiten, derzufolge nicht mehr auf den zeitlichen Sinn von „ständig“ im Sinne von „dauernd“ zu rekurrieren ist. Wenn Sein konsequent im Sinne von Möglichsein verstanden wird, sind wesenhafte Seinsweisen dadurch charakterisiert, daß sich das Dasein in ihnen unaufhebbar bevorsteht und das heißt zugleich, daß es sich eigentlich oder uneigentlich in ihnen versteht. Diese das Sein des Daseins konstituierenden Weisen des Sich-zu-sich-verhaltens sind nun aber dahingehend unterschieden, daß der eigentliche Modus sich erstens durch Identität von Erschließen und Erschlossenem auszeichnet, so daß das Dasein ist, was es ist, und zweitens ist der eigentliche Modus dadurch charakterisiert, daß dieses Sein von dem Dasein selbst
176
Marion Heinz
ermöglicht ist, so daß das Dasein selbst sein Sein ist und so existenziell eigentlich ist. Im existenzialen Sinne ständig oder wesenhaft schuldig zu sein, muß unter Berücksichtigung dieser Aspekte verstanden werden als die ausgezeichnete Weise des Sich-zu-sich-verhaltens, in der das Dasein als Seiendes sich in den sein Sein bestimmenden Momenten vollzieht, so daß es selbst dieses Sein ist und dementsprechend selbst-ständig, das heißt als ein Selbst Stand erlangend existieren kann. Wie ist nun im einzelnen einsichtig zu machen, daß das Vorlaufen in den Tod Voraussetzung ständigen Schuldigseins in diesem Sinne ist? Hierzu ist kurz die Auszeichnung dieses Seinsmodus in Erinnerung zu rufen: Erstens versteht das Dasein erst im Vorlaufen zum Tod unzweideutig seine Seinsart als Seinkönnen. Zweitens ermöglicht es sich diese Möglichkeit selbst als je einzelnes und versteht sein Seinkönnen als jemeiniges (vgl. 262 ff.). Drittens versteht das Dasein im Vorlaufen zum Tode als der unüberholbaren Möglichkeit alle vorgelagerten Möglichkeiten mit, so daß es sich in seinem Ganzseinkönnen im Sinne des je eigenen endlichen Entwurfsspielraums versteht (vgl. 264). Diese Besonderheit des Vorlaufens zum Tode macht plausibel, warum das Verstehen des wesenhaften Schuldigseins nur durch dieses zu erreichen ist: das Sein des Schuldigseins als Können zu verstehen, setzt die Erschlossenheit des Möglichseins überhaupt voraus. Und indem das radikale Verstehen des Seinkönnens als Vorlaufen zum Tode den ganzen endlichen Entwurfsspielraum als je und je selbst zu vollziehenden konstituiert, kann das Schuldigseinkönnen selbst dadurch erst wesentlich werden: einerseits als das je und je zu vollziehende, also als in diesem Sinne ständig zu leistender Vollzug, andererseits als ein Vollzugsmodus, der für die kontingenten, nicht ständigen Vollzüge bestimmend, qualifizierend ist. Damit ist der sprachlich nahegelegte Zusammenhang von „zu Ende Denken“ und „Sein zum Ende“ von der Sache her begründet: wenn sich das Dasein existenziell seine Seinsart als Seinkönnen nur im Vorlaufen zum Tode paradigmatisch zu verstehen geben kann, dann verlangt die existenziale Auslegung von Seinsweisen ihrerseits grundsätzlich den Rekurs auf das Sein zum Ende als ihr letztes existenzielles Fundament. Entscheidend aber ist folgendes: indem das Vorlaufen zum Tode den ganzen endlichen jemeinigen Entwurfsspielraum konstituiert, erweisen sich Seinsbestimmungen als die je und je vom Dasein selbst zu leistenden Vollzüge, in denen es sich unaufhebbar bevorsteht. Das Sein des Daseins konsequent zu interpretieren heißt also, seine Seinsbestimmungen als konstitutive Momente des durch das Vorlaufen in den Tod selbst ermöglichten Entwurfsbereichs zu begreifen. Damit wird zugleich deutlich, daß
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
177
der zeitliche Sinn des Seins des Daseins nicht im Sinne von Dauern zu fassen ist. Die Ständigkeit seiner Seinsbestimmungen muß vielmehr im Blick auf das Selbstseinkönnen dieses Seienden definiert werden, indem erstens berücksichtigt wird, daß sich das Dasein im Vorlaufen zum Tode sein Seinkönnen überhaupt erst selbst ermöglicht, sich zu ihm befreit, und indem zweitens berücksichtigt wird, daß jede der im Begriff der Sorge gefaßten Seinsbestimmungen für sich den Charakter eines unaufhebbar zu leistenden Vollzugs hat, derart, daß sich diese Unaufhebbarkeit auf den durch das Vorlaufen zum Tode konstituierten endlichen Entwurfsspielraum beziehen muß. Wie stellt sich nun die vorlaufende Entschlossenheit phänomenal dar? Die für das Vorlaufen zum Tode charakteristische Identität von Erschließen und Erschlossenem – das Dasein versteht sich in seinem Verstehen – geht einher mit dem Verstehen der Unbestimmtheit der Existenz. Alle eigentlichen Erschließungsweisen entfernen das Dasein von den immer schon eingenommenen, bestimmten Verhaltensweisen des Fürsorgens und Besorgens. In dieser Distanz tritt die wesenhafte Unbestimmtheit seines Seins zutage, die sich hinsichtlich der Faktizität in der Unverfügbarkeit des Grundes seines Seins manifestiert, derzufolge es sein pures „Daß“ zu übernehmen hat (vgl. 276). Hinsichtlich der Existenzialität stellt sie sich als jeden Augenblick mögliche, unberechenbare Unmöglichkeit seines Existierens dar. Sich als nichtiger Grund seines nichtigen Möglichseins durchsichtig zu sein heißt zugleich, die Notwendigkeit, sich in endlicher Freiheit und Verantwortung selbst bestimmen zu müssen, anzuerkennen. Das Dasein bestimmt sich selbst in dem doppelten Sinne, daß es sich überhaupt sein Existieren als nichtiger Grund von Möglichkeiten ermöglicht und, darin sein Angewiesensein auf innerweltlich Seiendes als Zeug und Mitdasein verstehend, bestimmte Möglichkeiten des Besorgens und der Fürsorge ergreift. Kennzeichnend für das existenziell eigentliche Dasein ist diese Hierarchie von Selbstwahl und Wahl bestimmter inhaltlicher Möglichkeiten: Frei für den eigenen Tod, ist dem Dasein „das Ziel schlechthin“ (384) gegeben, indem sich hierin der Hinblick auf das eigene, vereinzelte Seinkönnen eröffnet, von dem her sich überhaupt seine Möglichkeiten als die je eigenen finden lassen. Diese Stufung von Entschlüssen ist indessen eine methodische Abstraktion; faktisch existiert jedes Dasein unaufhebbar in konkreten Bezügen zu anderen und zu Dingen. Sofern diese faktisch bestimmte Existenz in der vorlaufend zum Tod gewonnenen endlichen Freiheit gründet, begreift Heidegger diese als „Situation“ (vgl. 299). Einerseits gewinnt das Dasein als vorlaufend entschlossene Existenz erst ein nüchternes Verständnis seiner faktischen Möglichkeiten und be-
178
Marion Heinz
freit sich von idealistischen Zumutungen und Illusionen des Man; das heißt es verendlicht sich auch dergestalt, daß es die Kontingenz und Beschränktheit des ihm Möglichen realisiert. Andererseits kommt das Dasein als existenziell eigentliches zugleich in ein freies Verhältnis auch zu den von ihm selbst mit aller Entschiedenheit gewählten faktischen Möglichkeiten; es hält sich frei für die mögliche und je faktisch notwendige Zurücknahme des Entschlusses und kann so der Gefahr des Rückfalls in die Unentschlossenheit entgehen (vgl. 302, 264, 307 ff.). Nüchterne Entschiedenheit für das faktisch Mögliche und Freiheit für die Revision seiner Entwürfe sind aber nur zwei Seiten derselben Sache, nämlich einer sich selbst in ihrer Endlichkeit begreifenden Freiheit: Sich als Grund zu verstehen, ermöglicht dem Dasein, sich nicht auf die einmal gewählten Entwürfe zu versteifen, nicht durch sich selbst hinter sich als Freiheit zurückzufallen, d. i. frei zu sein für die Restitution seiner selbst. Diese Freiheit als endliche zu vollziehen heißt eben, sowohl die vorgegebenen Bedingungen als solche zu erkennen als auch die Endlichkeit der eigenen Entwürfe im Sinne einer notwendigen Vorläufigkeit im Blick zu haben. Gegen Heideggers Konzeption der vorlaufenden Entschlossenheit sind im Verlauf der Rezeptionsgeschichte von Sein und Zeit massive Einwände erhoben worden, die wenigstens skizzenhaft zu resümieren sind. 1. Bei Licht besehen erweist sich Heideggers Konzeption der vorlaufenden Entschlossenheit als die Ontologisierung eines der Zeit des Zusammenbruchs traditioneller Werte und Orientierungen nach dem ersten Weltkrieg entstammenden pathetisch-heroischen Ideals des Einzelkämpfers oder Frontsoldaten. An nichts gebunden, zu nichts verpflichtet, ist, sich der Möglichkeit des eigenen Todes auszusetzen, die einzig verbleibende Form, dem männlichen Bedürfnis nach Härte und Schwere Rechnung zu tragen. Ein solchermaßen zeitgebundenes Stereotyp, dessen fragwürdiger Heroismus und Solipsismus ebenso schal geworden ist wie sein expressives Pathos, kann vor allem in Anbetracht der naiven Blindheit gegenüber den eigenen Bedingtheiten nicht mehr überzeugen (vgl. hierzu: Franzen 1988; Losurdo 1995; Rentsch 1989, 144 f.; Schulz 1969, 115; dagegen nimmt Figal 1982 Stellung). 2. Die Konzeption der vorlaufenden Entschlossenheit erweist sich als ein blinder Dezisionismus (vgl. von Krockow 1958), indem es dem Belieben des einzelnen, seiner Willkür anheimgestellt ist, wozu er sich entschließt. Dieses Fehlen von Maßstäben für die Gestaltung des Existierens impliziert, daß im Rahmen der Fundamentalontologie keine Ethik zu begründen ist (vgl. dazu Grondin 1991, 169). Dem entspricht, daß das Sein der Anderen für das eigentliche Existieren im Grunde belanglos ist (vgl. Theunissen 1965, Peperzak 1988). Weder spielt die gemeinsame Welt
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
179
des Handelns eine Rolle, noch ist die Intersubjektivität der Sphäre des Denkens für das eigentliche Existieren von Bedeutung. Wird die durch den Bezug auf eine geteilte Welt des Handelns und Denkens mögliche Orientierung aber gänzlich mißachtet, fehlt auch eine Instanz des Korrektivs eigener Entwürfe. Heideggers politische Verstrickung in den Nationalsozialismus ist daher nicht eine bloß biographisch zu erklärende Verfehlung, sondern Folge einer Philosophie, die sich aller Maßstäbe des Guten und Gerechten entledigt (vgl. Tugendhat 1979), so daß die Mitwelt nur unter der Maßgabe der Eröffnung eigener Existenzmöglichkeiten in den Blick kommt (siehe Theunissen 1965, dazu Blust 1987). Diese gravierenden Einwände würden eine ausführlichere Auseinandersetzung verlangen, in diesem Kontext ist nur eine kurze Stellungnahme möglich. Aus Heideggers Sicht bewegen sich beide Einwände im Rahmen einer platonistischen Metaphysik, die eben durch eine temporale Ontologie überwunden werden soll. Daß diese temporale Ontologie ihrem eigenen Selbstverständnis nach geschichtlich ist, das heißt auf ihrer ersten Stufe als Hermeneutik der Existenz nicht nur das geschichtliche Dasein zum Gegenstand hat, sondern zufolge ihrer „Verwurzelung“ im existenziellen Verstehen sich selbst als geschichtlich definieren muß, erörtert Heidegger in § 63. Hier wird unmißverständlich deutlich, daß das die Existenzialanalyse leitende eigentliche Sein zum Tode als ontisches Existenzideal zu verstehen ist. Daß mit diesem Zugeständnis der zuerst genannte Einwand keineswegs entkräftet ist, liegt auf der Hand: wenn auch die Relevanz des Seins zum Tode im Kontext des Heideggerschen Projektes einer konsequenten Erfassung des Menschen in der Immanenz seines endlich-geschichtlichen Existierens plausibel gemacht werden kann, so stellt sich die grundlegendere Frage, ob dieses Programm als solches angesichts seiner Voraussetzungen und seiner Folgen akzeptabel ist. Der Verzicht auf allgemeinverbindliche, universale Maßstäbe des Guten und Gerechten ist nämlich Folge der antiplatonistischen Zielsetzung Heideggers. Anders als Tugendhat bin ich nicht der Auffassung, das Defizit moralischer Prinzipien sei im Rahmen der Heideggerschen Programmatik ohne weiteres zu beheben (vgl. Tugendhat 1979).
9.3 Reflexion auf die hermeneutische Situation Im Anschluß an die Interpretation der vorlaufenden Entschlossenheit gilt es, Heideggers Reflexion auf „die für die Interpretation des Seinssinnes der Sorge gewonnene hermeneutische Situation“ und auf den „methodische(n)
180
Marion Heinz
Charakter der existenzialen Analytik überhaupt“ nachzuvollziehen (§ 63). Es ist kein Zufall, daß sich diese Reflexion auf das Ganze der „Voraussetzungen“ einer fundamentalontologischen Auslegung des Seins des Daseins, das Heidegger mit dem Terminus „hermeneutische Situation“ faßt, an die Darstellung der „Situation“ als die Weise, in der das Dasein ursprünglich und eigentlich als faktisches existiert, anschließt. Nachdem das Dasein als existenzielles Phänomen hinsichtlich der in ihm liegenden vorontologischen Voraussetzungen für seine konkreten faktischen Entwürfe in den Blick gebracht ist, können die Voraussetzungen der ontologischen Interpretation dieses Seienden als solche thematisiert werden. Zu Beginn des mit „Dasein und Zeitlichkeit“ betitelten zweiten Abschnitts des ersten Teils von Sein und Zeit wurden die an eine ursprüngliche hermeneutische Situation zu stellenden Anforderungen formuliert: Zu verlangen ist erstens, daß das Ganze des thematischen Seienden in die Vorhabe gebracht ist. Zweitens ist zu fordern, daß „die Vor-sicht auf das Sein […] dieses […] hinsichtlich der Einheit der zugehörigen und möglichen Strukturmomente“ trifft (23). Vorhabe und Vorsicht zeichnen die dem Sein adäquate Begrifflichkeit (Vorgriff) vor. Diese Anforderungen sind durch die Analyse der vorlaufenden Entschlossenheit in folgenden Punkten erfüllt: 1. „Das Dasein ist ursprünglich, das heißt hinsichtlich seines eigentlichen Ganzseinkönnens in die Vorhabe gestellt“ (311). Heidegger betont, die Frage nach dem Ganzseinkönnen habe sich im Verlauf der Untersuchung gewandelt; der anfängliche Charakter einer theoretisch-methodischen Frage der Daseinsanalytik sei abgestreift, erwiesen sei ihr existenzieller Charakter, demzufolge das Dasein sie als entschlossenes beantworte (vgl. 309). Diese Akzentuierung verweist darauf, daß eine Ontologie, die um die vollständige Gegebenheit ihres Gegenstandes bemüht ist, selbst dem Vorurteil aufsitzt, Theorie setze die adäquate Anschauung ihres Gegenstandes voraus. Und dieses Vorurteil impliziert das weitere, der Gegenstand sei als Ganzer in irgendeiner Weise vorhanden, so daß er als solcher anschaulich präsent sein können müsse. Wenn aber die Frage des Ganzseins eine faktisch-existenzielle ist, dann ist das Ganzsein etwas je und je zu leistendes, das hinsichtlich der Bedingungen seiner Möglichkeit aufzuklären ist. Dies ist offensichtlich gegen Husserl gerichtet: Die Theorie bzw. Phänomenologie ist als Hermeneutik zuerst den Vorgaben des sein Sein verstehenden existierenden Daseins verpflichtet, von daher hat sich ihre „Logik“ zu bestimmen, nicht aber ist aus der Eigengesetzlichkeit von Theorie als solcher etwas über die Art der Gegebenheit der Sache zu erschließen. Was aber besagt diese Betonung des existenziellen Charak-
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
181
ters des Ganzseinkönnens in Heideggers eigener Perspektive? Zur Frage stand die Art der Einheit einer Mannigfaltigkeit von Seinsmomenten, die im Begriff der Sorge gefaßt waren. Was ist in Hinblick auf diese Aufgabenstellung erreicht, wenn mit der vorlaufenden Entschlossenheit ein existenzielles Phänomen aufgewiesen ist, das den existenzial entworfenen Begriff des Ganzseins qua Sein zum Tode bezeugt? Wenn der Begriff der Sorge mit dem Aufweis der vorlaufenden Entschlossenheit bewährt, das heißt existenziell bezeugt ist und wenn dem existenzialen Begriff des Ganzseins damit ebenfalls ein existenzielles Fundament verschafft ist, dann hat sich die Frage nach der Art der Einheit der Seinscharaktere des Daseins an dieses Phänomen zu halten. Anders gesagt: Das Problem der ontologischen Bestimmung der Einheit einer Mannigfaltigkeit von Seinsweisen ist nur unter Rekurs auf das existenzielle Phänomen einheitlichen und ganzen Existierens zu lösen. 2. In seiner „methodische[n] Besinnung“ (310) diskutiert Heidegger selbst die mit diesem Ansatz verknüpften Probleme, die sich insbesondere aus der Verflechtung der existenzialen und der existenziellen Ebene ergeben. Die Forderung, den existenziellen Phänomenen zu folgen, verlangt, den Status dieser Phänomene zu klären und das heißt vor allem ihre Abhängigkeit von ontischen und ontologischen Vorgaben transparent zu machen. Zugestanden wird, daß der Konzeption der eigentlichen Existenz eine bestimmte ontische Auffassung von eigentlicher Existenz, „ein faktisches Ideal des Daseins“ zugrundeliegt (vgl. 310). Die Fundamentalontologie hat mithin ein ontisches Fundament nicht nur in dem Sinne, daß Ontologie als Auslegung des vorontologischen Seinsverständnisses überhaupt das Seiende dieser Seinsart voraussetzt, sondern des weiteren in dem Sinne, daß die ontologische Interpretation von bestimmten ontischen Möglichkeiten ausgehen muß, um diese auf ihre ontologische Möglichkeit zu entwerfen. Diese Notwendigkeit rechtfertigt Heidegger dadurch, daß sich das Dasein ontologisch das Fernste ist, das heißt daß es sich zunächst und zumeist nicht in seinem Sein durchsichtig ist. Aus diesem Grund sei die „gewaltsame“ Vorgabe von Möglichkeiten methodisch gefordert. Diese Vorgabe sei nicht nur unbedenklich, sofern sich damit kein Machtspruch über existenzielle Möglichkeiten und Verbindlichkeiten verbinde, sondern im Gegenteil werde sie zur Freigabe des Daseins in seinem unverstellten Bestand. Das heißt, es liegt nicht in der Intention einer existenzialen Interpretation, Sollenssätze zu formulieren; ihre Intention ist es vielmehr, das Dasein zu einer Stellungnahme oder Entscheidung zu provozieren (vgl. 314 f.). Es geht aber auch nicht um theoretische Feststellungen über das Sein eines Seienden, sondern darum, ein Seinkönnen zu indizieren und zu evozieren.
182
Marion Heinz
Darin besteht die von Heidegger in Sein und Zeit nicht thematisierte, eigenartige Funktion der formalanzeigenden Begriffe der Existenzialanalyse, daß sie, wie Heidegger in seiner lebensphilosophischen Phase sagt, selbst im Leben leben, das heißt selbst zum Leben führen, im Leben wirksam werden und nicht das Leben stillstellen.3 Analog verhält es sich hier: existenzialontologische Begriffe, die das Dasein in seinem Freisein für seine eigensten Möglichkeiten zu fassen beanspruchen, sind nur dann adäquat verstanden, wenn sie das Dasein vor sein Freisein bringen, wozu auch gehört, sich für oder gegen die vorgelegte Konzeption seines Seins zu entscheiden. Auf die selbstgestellte Frage, ob sich die methodisch geforderte Vorgabe von Möglichkeiten dem freien Belieben entziehen könne bzw. wodurch die Inanspruchnahme bestimmter existenzieller Möglichkeiten zu rechtfertigen sei, antwortet Heidegger im Sinne des zuvor explizierten Selbstverständnisses existenzialer Ontologie konsequent bloß mit rhetorischen Fragen wie zum Beispiel „Wenn die Analytik als existenziell eigentliches Seinkönnen die vorlaufende Entschlossenheit zugrundelegt, zu welcher Möglichkeit das Dasein selbst aufruft und gar aus dem Grunde seiner Existenz, ist diese Möglichkeit dann eine beliebige“ (313)?4 Diese Erörterung zur Klärung der hermeneutischen Situation der Fundamentalontologie hinsichtlich der geforderten Vorhabe des thematischen Seienden in seiner Ganzheit haben ansatzweise deutlich gemacht, daß eine Ontologie des faktischen Existierens sich in ihrem Selbstverständnis nach dem Sein des thematischen Seienden richtet: Sie versteht sich hinsichtlich ihrer Faktizität, das heißt in ihrer Bedingtheit durch ontische Vorgaben und der Endlichkeit ihres Wahrheitsanspruchs, derart, daß sie auch bezüglich der Verifikation ihrer Resultate auf den ontischen Vollzug verwiesen ist. Als Vorgabe so oder so zu beantwortender Möglichkeiten entspricht sie dem Existenzcharakter des Daseins. Bezüglich des zweiten konstitutiven Elementes der hermeneutischen Situation, der Vorsicht, stellt Heidegger fest: „die leitende Vor-sicht, die Idee der Existenz, hat durch die Klärung des eigensten Seinkönnens ihre Bestimmtheit gewonnen; mit der konkret ausgearbeiteten Seinsstruktur des Daseins ist seine ontologische Eigenart gegenüber allem Vorhandenen
3 Vgl. vor allem die Vorlesung vom Kriegsnotsemester 1919 (GA 56/57). 4 Daß dieser Rückverweis nicht recht zu überzeugen vermag, deutet eine Randbemerkung Heideggers in seinem Hüttenexemplar hierzu an: „Das wohl nicht; aber, nicht beliebig heißt noch nicht: notwendig und verbindlich“ (445).
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
183
[…] deutlich geworden“ (311). Von der ursprünglich geforderten Vorsicht auf die Einheit der Strukturmomente der Sorge ist noch nicht die Rede, denn davon handeln erst die folgenden §§ 64 und 65. Hinsichtlich der die Untersuchung insgesamt leitenden Idee von Existenz stellt sich analog zur Vorgabe existenzieller Möglichkeiten für die Interpretation der eigentlichen Existenz die Frage: „Woher nimmt sie ihr Recht“ (313)? Anders gefragt: wird nicht mit der Idee der Existenz eine unausgewiesene Voraussetzung gemacht, aus der alle weiteren Explikationen folgen? Diese Frage wird in zwei Schritten beantwortet: Zunächst verweist Heidegger auf das vorontologische Seinsverständnis als Ursprung dieser Idee und auf das Dasein als Instanz, die darüber entscheidet, „ob es als dieses Seiende die Seinsverfassung hergibt, auf welche es im Entwurf formalanzeigend erschlossen wurde“ (315). In einem zweiten Schritt reflektiert Heidegger auf die ontologische Voraussetzung der Existenzidee: sie setzt ebenso wie die von dieser unterschiedene Idee von Realität eine Idee von Sein überhaupt voraus (vgl. 314). Herausgearbeitet werden mithin zwei ineinander verflochtene Zirkelstrukturen: der Zirkel von vorontologischem Seinsverständnis und ontologischer Explikation und der Zirkel innerhalb der ontologischen Sphäre selbst von der Idee des Seins des Daseins zur Idee des Seins überhaupt, um von daher auf das Sein des Daseins zurückzukommen. Die positive Notwendigkeit dieses zirkelhaften Ganges der Ontologie begründet Heidegger damit, daß die methodische Bewegung der Forschung der Bewegtheit ihres Gegenstandes entspricht, denn Sein qua Sorge heißt, als in das Sein geworfenes Seiendes sich vorweg zu sein, so daß sich das Dasein in seinem Sein übernehmen und sich sein Sein zueignen kann. Ontologie versteht sich als eine solche Explikation des in sich zirkulären Geschehens des Seinsverständnisses, die der in diesem liegenden Verdeckungstendenz entgegenarbeitet und demzufolge den Charakter der Gewaltsamkeit hat und die, anders als das ontische Seinsverständnis, auf die Herstellung der systematischen Ordnung der Weisen des Verstehens von Sein zielt, derart daß die bestimmten Weisen des Verstehens von Sein als fundiert in einem Verstehen des Seins als solchem zu erweisen sind. Bezüglich des dritten die hermeneutische Situation konstituierenden Moments als Vorgriff bemerkt Heidegger lediglich, durch die konkrete Ausarbeitung der Idee der Existenz sei seine ontologische Eigenart gegenüber allem Vorhandenen so deutlich geworden, daß der Vorgriff auf die Existenzialität eine genügende Artikulation besitze, um die begriffliche Ausarbeitung der Existenzialien sicher zu leiten (vgl. 311). Auffällig ist, daß sich in Sein und Zeit keine explizite Reflexion auf die Eigenart der Existen-
184
Marion Heinz
zialien als formalanzeigender Begriffe findet. Das Spezifische dieser Art von Begriffsbildung wird in Sein und Zeit unkommentiert vorausgesetzt, genauere Orientierung über diese „methodische Geheimwaffe“ des frühen Heidegger bieten die frühen Freiburger Vorlesungen Heideggers (vgl. Kisiel 1997; Gethmann 1986/87; van Buren 1995). Die Unterscheidung zwischen Generalisierung und Formalisierung aus Husserls Phänomenologie (vgl. Husserl 1992, § 13) nimmt Heidegger auf und entwickelt sie zunächst zu Instrumenten einer Philosophie des Lebens weiter. Während Generalisierung sich auf bestimmte Regionen des Objektartigen bezieht, beanspruchen die formal-anzeigenden Begriffe das Leben selbst in seinem Grundzug des Ausweltens in bestimmte Erlebniswelten in seiner höchsten Potentialität zu fassen; sie indizieren m. a. W. das reine „auf-zu“ oder „hin-zu“ der ursprünglichen Intentionalität des Lebens.5 Wenn Heidegger nun in seiner „methodischen Besinnung“ die angesetzte Existenzidee als „die existenziell unverbindliche Vorzeichnung der formalen Struktur des Daseinsverständnisses überhaupt“ (313) charakterisiert, handelt es sich dabei zwar um eine inhaltliche Neubestimmung dessen, was angezeigt wird, aber die Art der Begriffsbildung qua formale Anzeige ist dieselbe wie in den frühen Vorlesungen. Die Interpretation der Zeitlichkeit als Einheitsgrund des Daseins ist nicht nur einer das „Selbst“ substanzontologisch missverstehenden Psychologie, sondern auch der in Kants Transzendentalphilosophie bereits vorliegenden dynamischen Transformation des „Ich“ radikal entgegengesetzt. Indem Heidegger Kants logischer Fassung des Ich im Sinne der „ursprünglich synthetischen Einheit der Apperzeption“ das Erklärungsziel einer adäquaten Erfassung des im alltäglichen Ich-sagen gegebenen phänomenalen Bestandes unterschiebt, hat er mit der Kritik daran leichtes Spiel und kann ebenso leicht geltend machen, diesem Ziel in dem von ihm alternativ vorgeschlagenen „Ich besorge“ (322) wesentlich näher zu kommen. Diese Umdeutung Kants unterschlägt allerdings genau diejenigen erkenntniskritischen Einsichten, die bei jenem die Grundlage der Kritik der rationalen Psychologie ausmachen: Der Unterschied zwischen realem und logischem Gebrauch der Kategorien, der für die Lehre von den Paralogismen zentral ist, ist für Heidegger schlicht irrelevant. Den von Kant als notwendig erachteten Gebrauch der Kategorien zur Bestimmung des logischen Subjektes wertet Heidegger als Rückfall in die als inadäquat erwiesene Ontologie des Vorhandenen. Er diagnostiziert als Ursache für Kants ontologische Verkennung des Selbst eine bei Kant fehlende Analyse der Welt, 5 Vgl. Vorlesung aus dem Kriegsnotsemester 1919 (GA 56/57).
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
185
welche er wiederum aus einer vermeintlichen Missachtung der Intentionalität herausliest. Wenn Kant nämlich „die ,Vorstellungen‘ vom apriorischen Gehalt des ,Ich denke‘ fernhält“, wird der Seinssinn vollziehender Subjektivität „wieder auf ein isoliertes Subjekt … zurückgedrängt“ (321). Auch wenn diese Kritik Kant kaum gerecht wird, treibt erst sie Heidegger zu einer Bestimmung des Selbst, welche die Bezogenheit auf Welt explizit aufnimmt, sowie zur Erfassung des letztlich transzendentalen Charakters der „Welt“ als der „innerweltlich Seiendes“ allererst ermöglichenden Seinsidee.
9.4 Zeitlichkeit als Sinn der Sorge Die Funktion des destruktiv verfahrenden § 64 besteht im wesentlichen darin sicherzustellen, daß sich die noch ausstehende Klärung der Einheit des Strukturganzen der Sorge an das Phänomen der vorlaufenden Entschlossenheit zu halten hat. Bevor die Frage nach der Einheit des Daseins als des zwischen Geburt und Tod existierenden Seienden positiv beantwortet werden kann, ist der Sinn des Seins als Sorge zu entfalten, denn mit dem Sinn ist erst der Grund der Einheit der Daseinsstrukturen gewonnen. Was mit dem Sinn gesucht ist und wie sich der Sinn des Seins des Daseins aufweisen läßt, reflektiert Heidegger zu Beginn des § 65. „Streng genommen bedeutet Sinn das Woraufhin des primären Entwurfs des Verstehens von Sein“ (324). Das heißt, Sinn ist ein Strukturmoment desjenigen Verstehens, das Sein versteht oder entwirft. Wenn Sinn als Woraufhin des Verstehens von Sein angesetzt ist, so heißt das erstens, daß Sinn die Verstandenheit des Entworfenen ermöglicht, dergemäß dieses als etwas ausgelegt werden kann; Sinn ist der Grund des Verstandenen als solchen. Gemeint ist aber zweitens, daß der Sinn in Bezug auf das Verstehen selbst als dessen „Richtungsinstanz“ fungiert, so daß das Verstehen selbst zufolge des Sinnes orientiert und bestimmt ist. Diese Bedeutung ist umgangssprachlich erhalten im Wort „Uhrzeigersinn“. Sinn ist also m. a. W. Grund des Verstehens als Vollzug und Grund des Verstandenen als solchen. Mit dieser Explikation des Sinnbegriffs ist klar, daß sich Ontologie für Heidegger nicht als Transzendentalphilosophie Husserlschen Typs durch Aufweis der gegenstandskonstituierenden Leistungen des Subjekts begründen läßt. Das „Subjekt“, das Dasein als vorlaufende Entschlossenheit, ist selbst von vornherein als etwas Konstituiertes angesetzt, dessen Konstitution sich einem ihm selbst unverfügbaren Grund verdankt, der sich als Zeitigung der Zeitlichkeit erweisen wird.
186
Marion Heinz
Die konstitutiven Momente der vorlaufenden Entschlossenheit gründen räumlich nach Heidegger in der Zeitlichkeit: „das Sein zum eigensten ausgezeichneten Seinkönnen […] ist nur so möglich, daß das Dasein überhaupt in seiner eigensten Möglichkeit auf sich zukommen kann und die Möglichkeit in diesem Sich-auf-sich-zukommenlassen als Möglichkeit aushält, das heißt existiert. Das die ausgezeichnete Möglichkeit aushaltende, in ihr sich auf sich Zukommen-lassen ist das ursprüngliche Phänomen der Zukunft“ (325). Diese Explikation erweckt zweifellos den Anschein eines nichtssagenden, weil redundanten Spiels mit Worten. Einerseits ist Zukunft beansprucht als Verstehensgrund des Seins zu Möglichkeiten, aber andererseits wird Zukunft selbst in ihrem Gehalt nur vom Sein zu Möglichkeiten her verstehbar. Das eine ist also Verstehensgrund des anderen und vice versa (vgl. 304). Was also ist durch die Geltendmachung der Zukunft bzw. der Zeitlichkeit als Seinssinn des Daseins gewonnen? Welcher zuvor unthematische, unausdrückliche Aspekt des Verstandenen als Sein des Daseins wird damit vor Augen und zu Begriff gebracht? Hält man sich an die räumliche Metaphorik, so ist eine Form der Bewegtheit indiziert, die nicht als in der Zeit geschehende, sondern als solche der Zeit selbst vorgestellt wird. Der Sache nach beansprucht Heidegger also Zeit als dem Dasein unverfügbares Konstitutionsgeschehen, das bloß durch die Metapher einer räumlichen Bewegung zu fassen zu sein scheint. Negativ ist klar, daß Sein zu Möglichkeiten als Zukunft in diesem Sinne interpretiert nicht besagt, daß das Sein zu Möglichkeiten im Sinne der Projektion von Zwecken als noch nicht wirklicher, aber wirklich werden könnender Selbstentwürfe zu verstehen ist. Wenn das Dasein sich auf sich zukommen läßt, so ist damit Differenz und Identität in einem dynamischen Selbstverhältnis zu Begriff gebracht: Wenn das Dasein sich erst auf sich zukommen läßt, so ist es nicht in einfacher, unvermittelter Identität bloß es selbst, sondern es wird in einer unabgeschlossenen Bewegung mit sich identisch; und es reflektiert auch nicht bloß darauf, wie und als was es schon ist. Sofern es jedoch sich auf sich zukommen läßt, ist es als das Zukommende mit dem, worauf es zukommt, identisch. Vergleicht man diese Dynamik der Selbstidentifikation mit der Struktur des „Sich auf sich Entwerfens“, so fällt auf, daß an die Stelle eines Tuns ein Lassen tritt; auch scheint die Richtung der Bewegtheit verschieden akzentuiert: Während das Entwerfen oder Sein zu Möglichkeiten eher die Richtung auf die Möglichkeit hin betont, hebt das „Sich auf sich zukommen lassen“ die Bewegtheit von der Möglichkeit zum Dasein hervor, wodurch der Gedanke des Sich-erstreckens der Zukunft in die Gewesenheit vorbereitet wird. Folgt man dem in der Leibniz-Vorlesung ge-
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
187
gebenen Strukturschema der Zukunft, so sind im Moment des Zukünftigseins beide Momente integriert: „Das Fragezeichen bedeutet den offenbleibenden Horizont“ (GA 26, 266):
?
Das zweite Moment der vorlaufenden Entschlossenheit, das Verstehen des wesentlichen Schuldigseins, setzt Gewesenheit voraus. Der Terminus Gewesenheit grenzt das ekstatische Zeitphänomen von der Vergangenheit im gewöhnlichen Sinne als Nicht-mehr-gegenwärtig-sein ab. Heidegger betont, daß das Dasein ist, was es war. Sofern Sein hier konsequent als Existieren verstanden ist, setzt Gewesensein Zukunft voraus. Gewesensein heißt, aus einer Möglichkeit seiner selbst zurückkommen auf sich. Um sich in dem, was es je schon war, übernehmen zu können, oder um auf sich zurückkommen zu können, muß dieses Worauf des Zurückkommens als ein „schon-sein“ erschlossen sein. Die Situation als das Ganze der zu bestimmten Möglichkeiten des Besorgens und Fürsorgens entschlossenen faktischen Existenz gründet nach Heidegger in der Gegenwart. Dieses Zeitphänomen hat den Charakter des Begegnenlassens von innerweltlich Seiendem (vgl. 328). Um nun des Weiteren Heideggers These, die Zeitlichkeit sei der Einheitsgrund des Strukturganzen der vorlaufenden Entschlossenheit bzw. der Sorge überhaupt, einsichtig werden zu lassen, bedarf es zunächst einer genaueren Bestimmung der Zeitlichkeit. Die ursprüngliche Zeitlichkeit ist nach Heidegger nicht als eindimensionales Kontinuum im Bilde der Linie vorzustellen, sondern als dreidimensionale Erstrecktheit. Die „Dimensionen“ der Zeitlichkeit: Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart sind ekstatisch-horizontal verfaßt, sie „sind“ in der Weise gleichursprünglicher Zeitigung. Der Terminus „Ekstase“ kennzeichnet die Zeitphänomene formal als genuin verschiedene Weisen des Hinausstehens, der Entrückung zu einem Wohin (vgl. Heidegger 1973, 114). In der Sache ist damit die Zeitlichkeit als verschieden gerichtetes Offensein für … gefaßt. „Jede Entrückung ist in sich selbst offen. Zur Ekstase gehört eine eigentümliche Offenheit“ (GA 24, 378). Dieses Offensein wird als sich selbst Eröffnendes und nicht als schon Vorliegendes gedacht: „das Heraustreten aus sich (ekstasij) ist gewisser-
188
Marion Heinz
maßen ein raptus, das besagt: Das Dasein wird nicht erst nach und nach ein gewärtigendes dadurch, daß es der Reihe nach das Seiende, das ihm faktisch als Zukünftiges zukommt, durchläuft, sondern dieses Durchlaufen läuft nur nach und nach durch die offene Gasse, die der raptus der Zeitlichkeit selbst geschlagen hat“ (GA 26, 265). Durch den Begriff der Erstrecktheit wird das in der ekstatischen Entrückung gebildete Offene genauer als lückenlose, bruchlose Gespanntheit bestimmt (vgl. 390, 409; GA 26, 267), so daß die Zeitlichkeit eine „erstreckte Ständigkeit“ bildet (390). Mit der Horizontstruktur ist das ekstatische Offensein für … erst hinreichend charakterisiert. Die Ekstasen der Zeitlichkeit sind „nicht einfach Entrückungen zu …, nicht Entrückungen gleichsam in das Nichts, sondern sie haben als Entrückungen zu … aufgrund ihres jeweiligen ekstatischen Charakters einen aus dem Modus der Entrückung, das heißt aus dem Modus der Zukunft, der Gewesenheit und der Gegenwart vorgezeichneten und zur Ekstase selbst gehörigen Horizont“ (GA 24, 428). Durch die Horizontstruktur sind die Ekstasen als begrenzte, bestimmte Weisen des Offenseins gekennzeichnet derart, daß die Horizonte als die selbst unthematisch bleibenden Grenzen der ekstatischen Entrückung die in ihnen möglichen Weisen der Erschlossenheit von Sein und Seiendem vorzeichnen. Diesen Vorbildcharakter des Wozu der zeithaften Entrückungen faßt Heidegger im Ausgang von seinen Kant-Deutungen auch mit dem Begriff Schema (vgl. Köhler 1993; vgl. Heidegger 1973, § 22, § 24; Sein und Zeit, § 69c). Dieser Begriff soll zum Ausdruck bringen, daß zu den Ekstasen allgemeine Vorprägungen dessen, wie etwas sich in den primär ekstatisch fundierten Weisen des Entbergens zeigt, gehören. Den drei Ekstasen entsprechend werden folgende horizontale Schemata angesetzt: „Das Schema, in dem das Dasein zukünftig, ob eigentlich oder uneigentlich, auf sich zukommt, ist das Umwillen seiner. Das Schema, in dem das Dasein ihm selbst als geworfenes in der Befindlichkeit erschlossen ist, fassen wir als Wovor der Geworfenheit bzw. als Woran der Überlassenheit. Es kennzeichnet die horizontale Struktur der Gewesenheit. […] Das horizontale Schema der Gegenwart wird bestimmt durch das Um-zu“ (365). Anders als das alltägliche und traditionelle Verstehen, das der Zeit den Charakter der Unendlichkeit zuspricht, behauptet Heidegger: die ursprüngliche Zeit ist endlich (vgl. 329). Dieser phänomenale Charakter der Zeitlichkeit zeigt sich primär im Vorlaufen in den Tod: Wenn das Dasein sich darin in seiner äußersten und eigensten Möglichkeit erschlossen ist, so kann auch gesagt werden, dieses ursprüngliche Zukünftigsein „schließt das Seinkön-
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
189
nen“ in dem Sinne, daß das Dasein sich überhaupt als der von dieser äußersten Möglichkeit her definierte endliche Entwurfsspielraum versteht. Das „Sein“ der Zeitlichkeit ist die gleichursprüngliche Zeitigung (vgl. 329). Diese tautologische Formulierung soll negativ zum Ausdruck bringen, daß die Zeitlichkeit nicht als ein Seiendes aufgefaßt wird, das von anderem her bestimmbar wäre. Abgewiesen werden damit die möglichen Vorstellungen, die Zeitlichkeitsmomente seien zusammen vorhanden, entstünden nacheinander oder seien aufeinander reduzierbar. Positiv ist diese Einheit als das „Geschehen“ der Eröffnung des Offenen, der Lichtung, charakterisiert derart, daß dieses Geschehen als die „Bewegtheit“ des von einer Ekstase ausgehenden Sicherstreckens der Ekstasen ineinander und zu ihren Horizonten vorzustellen ist (350).6 Zeitlichkeit, die im Begriff der Zeitigung als sich selbst einigende Einheit gedacht ist, fungiert als „das primäre Regulativ der möglichen Einheit aller wesenhaften existenzialen Strukturen des Daseins“ (350). Die gleichursprüngliche Zeitigung der drei jeweils für ein Sorgemoment primär konstitutiven Ekstasen ermöglicht die Einheit der Sorge als unreduzierbare Ganzheit von Momenten. Das besagt: Jeder Vollzug der Existenz ist Sorge, das heißt gleichursprünglich durch Verstehen, Befindlichkeit, Rede und Sein-bei konstituiert. Je nachdem aus welcher Ekstase sich die Zeitlichkeit primär zeitigt, steht die Sorge insgesamt im Modus des Verstehens, der Befindlichkeit, der Rede usw. Das Verhältnis dieser Modi zu der Sorge als solcher ist kein Verhältnis von Art und Gattung. Die Vielheit der Modi verhalten sich zur Einheit der Sorge nicht so, daß die Modi durch zusätzliche Bestimmungen von der Einheit unterschieden wären, vielmehr differiert der „Fokus“ innerhalb des Strukturgefüges, je nachdem welche Ekstase innerhalb der Zeitigung den Primat hat. Die Differenzen der Modi sind nur Verlagerungen des „Aspekts“ innerhalb der ansonsten identischen Mannigfaltigkeit der Momente. Die Zuordnung von Ekstasen und Momenten der Sorge bzw. des In-Seins zeigt folgende Übersicht: Zeitlichkeit
Sorge
In-sein
Zukunft
Sich-vorweg
Verstehen (Rede)
Gewesenheit
Schon-sein-bei
Befindlichkeit
Gegenwart
Sein-bei (Verfallen)
Besorgen (Rede)
6 Das Verhältnis von Ekstasen und Horizonten faßt Heidegger auch als Selbstentwurf oder Selbstaffektion der Zeitlichkeit (vgl. dazu Heinz 1982).
190
Marion Heinz
Ob es Heidegger tatsächlich gelungen ist, die Zeitlichkeit als das primäre Regulativ der möglichen Einheit aller wesenhaften existenzialen Strukturen des Daseins zu erweisen, ist im folgenden zu diskutieren. Es ist kritisiert worden, daß eine Inkongruenz zwischen Zeitlichkeitsund Sorgemomenten besteht derart, daß die Rede als dritte Weise der Erschlossenheit im Gefüge der Zeitlichkeit keinen Ort habe (vgl. MüllerLauter 1967, 81 ff.). Ihr ist nicht wie den anderen Weisen der Erschlossenheit eine eigene Ekstase zugeordnet. Wenn auch offensichtlich der insgesamt viergliedrigen Seinsstruktur eine nur dreigliedrige Zeitstruktur entspricht, so bedeutet das nicht, der Rede fehle überhaupt eine Begründung in der Zeitlichkeit. Der zeitliche Sinn der Rede als der in Verstehen (Zukunft), Befindlichkeit (Gewesenheit) und Verhalten zu Seiendem (Gegenwart) geschehenden Artikulation des Sinnes von Sein überhaupt ist nichts anderes als die Zeitigung der ganzen Zeitlichkeit. Das Schema der Rede ist das „Als“ (vgl. § 69b), das sich je nach Zeitigungsweise zum apophantischen oder hermeneutischen modifiziert. Das „Als“ ist ein Schema, insofern es die aus dem spezifischen Zusammenhang der Ekstasen bestimmten möglichen Begegnisweisen und Bezüge des Seienden vorzeichnet. Faktisch existiert das Dasein aber nicht in den Grundmodi Verstehen überhaupt, Befindlichkeit überhaupt usw., sondern zum Beispiel in der Weise der Furcht, der Angst, der fahlen Ungestimmtheit. In welchem Verhältnis steht die Vielheit dieser Modi zur Einheit der Sorge und wie ist ihre zeitliche Ermöglichung zu denken? Diese Modi werden zeitlich interpretiert aus der Modifizierbarkeit jeder Ekstase als solcher (vgl. Rosales 1970, 214). So modifiziert sich die Gewesenheit im Modus der Furcht etwa zum „verwirrten Vergessen“, die Ausgangsekstase modifiziert ihrerseits die übrigen, so daß sich eine Entsprechung der Ekstasen zum Beispiel hinsichtlich ihrer Verwirrtheit bildet (vgl. 341 f.). Diese Modi, wie Furcht, Neugier usw. sind gegenüber den Grundmodi wie Verstehen, Befindlichkeit spezifischere, durch zusätzliche Bestimmtheiten gekennzeichnete Phänomene, Furcht zum Beispiel ist eine Art Befindlichkeit. Strittig ist in der Heidegger-Literatur auch das Verhältnis von Verfallen und Sein-bei bzw. von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit (vgl. zum Beispiel Tugendhat 1967, 316). Zu fragen ist: Wie wird aus der Zeitlichkeit verstehbar, daß das Verfallen in jedem Sorgemodus mit erschlossen ist, ohne daß das Dasein unausweichlich verfallend existiert? Muß ein eigentliches von einem uneigentlichen Verfallen unterschieden werden? Wie ist es vereinbar, daß das Dasein existenziell erst auf dem Umweg über die Uneigentlichkeit zur Eigentlichkeit gelangt, daß aber auf der Ebene der
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
191
Zeitlichkeit die uneigentliche Zeitigung der ursprünglichen und eigentlichen nachgeordnet ist? Folgt daraus nicht auch auf der existenziellen Ebene die Vorgängigkeit des eigentlichen Existierens? Grundsätzlich zeitigt sich der eigentliche Existenzvollzug aus der Zukunft, der uneigentliche aus der Gegenwart. Für die eigentliche Zeitlichkeit ist folgende Ordnung der Ekstasen konstitutiv: „Die ursprüngliche und eigentliche Zeitlichkeit zeitigt sich aus der Zukunft, so zwar, daß sie zukünftig gewesen allererst die Gegenwart weckt.“ Das Verhältnis von Zukunft und Gewesenheit ist genauer so zu denken, daß sich aus der Zukunft bestimmt, als was das Dasein gewesen ist. Das „Gewesen ‚ist‘ nur je nach der Weise der Zeitigung der Zukunft und nur in dieser“ (GA 26, 267). Die Zukunft erstreckt sich unmittelbar und bruchlos in das Gewesensein (vgl. ebda.). Der Vorrang der Zukunft und deren bestimmendes Sicherstrecken auf das Ganze des Gewesenseins stellen die zeitliche Begründung der Möglichkeit eines Seienden in der Seinsart des Existierens dar. Wenn nämlich das Auszeichnende dieses Seienden darin besteht, daß alle Bestimmungen seines Seins Möglichkeiten seiner selbst sind, dann muß alles, was das Dasein schon war, ganz in das Möglichsein einbezogen sein und kann nicht schon im vorhinein in seiner sachhaltigen Bestimmtheit festliegen. In der eigentlichen Zeitigung der Zeitlichkeit ist die Gegenwart „eingeschlossen“ in Zukunft und Gewesenheit (vgl. 328). Dies ist zunächst so zu verstehen, daß Gegenwart als Begegnenlassen von innerweltlich Seiendem im Horizont des Um-zu schon Zukunft und Gewesenheit voraussetzt, aus denen das Dasein als das „Für“ des Begegnenlassens primär erschlossen ist. Das Dasein erschließt als schon Seiendes aus einem Umwillen ein Um-zu. Als Erschließung des Seins von Seiendem, das das Dasein selbst nicht ist, ist die Gegenwart als solche uneigentlich, das heißt für das Sein des Daseins verschließend (vgl. 347 f.). „Eingeschlossenheit“ bzw. „Gehaltenheit“ der Gegenwart in der eigentlichen Zeitigung bedeutet, daß die Tendenz der Gegenwart als solcher, das Sein des Daseins zu verschließen, aufgehalten ist. Inhaltlich ist dies so zu verstehen, daß das Dasein selbst sich aus seinem eigensten faktischen Seinkönnen die Möglichkeiten des Fürsorgens und Besorgens ermöglicht und nicht umgekehrt sein Seinkönnen von diesen her bestimmen läßt. Terminologisch wird die eigentliche Gegenwart als Augenblick gefaßt. Der Augenblick „bringt die Existenz in die Situation und erschließt das eigentliche ‚Da‘“ (347).7
7 Zum Augenblick vgl. Pöggeler 1963, 209 f.; Wohlfart 1982; von Herrmann 1972, 198 ff.
192
Marion Heinz
Für die Klärung der genannten Probleme ist die Unterscheidung von Wahrheit und Gewißheit zu berücksichtigen. Das Dasein existiert eigentlich, wenn es sich in der Wahrheit seines Seins hält; existenzielle Eigentlichkeit ist ein Modus des Gewißseins, des Für-wahr-haltens. Erst wenn das Dasein sich das verstehend Erschlossene, sich als Seiendes aus diesem Sein auslegend, ausdrücklich zueignet, existiert es als Seiendes eigentlich. Zeitlich interpretiert stellt sich die Auslegung eines Seienden in seinem Sein als Umkehrung des primären verstehenden Erschließens dar: die Gegenwart mißt sich dem in Zukunft und Gewesenheit erschlossenen Sein an und bringt so das Seiende als etwas, das heißt in seinem Sein in die Sicht (vgl. 359 f.). Demnach ist es möglich, daß das Dasein eigentlich erschlossen ist, existenziell sich aber nicht darin hält, im Modus der Uneigentlichkeit existiert. In der Angst zum Beispiel ist das eigene nichtige Seinkönnen so erschlossen, daß sich das Dasein als Seiendes zunächst nicht in diesem Sein hält, sich nicht darin zu eigen wird, sondern vor diesem fliehend sich in der gegenwärtigend enthüllten Angewiesenheit auf das Seiende verliert (vgl. 186, 348). Es ist also nicht nur kein Widerspruch, daß der Vorrang der Eigentlichkeit auf der Ebene der Zeitlichkeit mit der Vorgängigkeit von Uneigentlichkeit auf der existenziellen Ebene zusammen besteht, sondern so wird überhaupt erst das Verfallen an die Welt als Fluchtbewegung in seinem Sinn verstehbar. Im Horizont der Gegenwart qua Um-zu ist das Sein von innerweltlich Seiendem erschlossen. Weil mithin in der Gegenwart das Sein des Daseins nur hinsichtlich seiner Angewiesenheit auf Seiendes dieser Seinsart erschlossen ist, ist die für die Auslegung des Daseins als Seiendem in seinem Sein geforderte Anmessung der Gegenwart an das in Zukunft und Gewesenheit erschlossene ursprüngliche Sein des Daseins prinzipiell irritiert. Der Gegenwart eignet die Tendenz, zu „entspringen“ und das heißt, sich aus sich selbst zu zeitigen, so daß das in ihr erschlossene Sein zum beherrschenden Sinn von Seiendem wird (vgl. 338 ff.). In jedem Zeitigungsmodus ist die Gegenwart als Bedingung der Möglichkeit des Verfallens anzusehen. Nur wenn sich die Zeitlichkeit aus der Gegenwart zeitigt, werden durch deren Uneigentlichkeit alle Ekstasen in den uneigentlichen Modus versetzt, so daß das Verfallen nicht als Moment, sondern als ganze Sorgeeinheit erscheint. Die Gehaltenheit der Gegenwart in der eigentlichen Zeitlichkeit bedeutet mithin nur die Gegenbewegung im Sinne des Aufhaltens dieses Entspringens. Für die Frage nach dem kontrovers diskutierten Verhältnis von ursprünglicher und eigentlicher Zeitlichkeit (vgl. Fleischer 1991; Blattner
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
193
1992; Dahlstrom 1995) ergibt sich daraus: die eigentliche Zeitlichkeit ist die ursprüngliche Zeitlichkeit, auch insofern sie als Grund der uneigentlichen Zeitigungsweise in Anspruch genommen ist.8 Das Verhältnis von eigentlicher und uneigentlicher Zeitlichkeit ist selbst als zirkuläre „Bewegtheit“ angesetzt: „Der Wurf des Geworfenseins in die Welt wird zunächst vom Dasein nicht eigentlich aufgefangen; die in ihm liegende ‚Bewegtheit‘ kommt nicht schon zum ‚Stehen‘ dadurch, daß das Dasein nun ‚da ist‘. Das Dasein wird in der Geworfenheit mitgerissen, das heißt, als in die ‚Welt‘ Geworfenes verliert es sich an die Welt in der faktischen Angewiesenheit auf das zu Besorgende“ (348). Erst über den Umweg der aus der Gewesenheit motivierten uneigentlichen Gegenwart kann sich das Dasein durch das Vorlaufen zum Tod in sein immer schon mögliches eigentliches Seinkönnen versetzen (vgl. 347), so daß es dergestalt zukünftig auf sich zurückkommen kann. Und sofern in der Gegenwart die Angewiesenheit auf innerweltlich Seiendes erschlossen ist, bleibt auch in der eigentlichen Zeitlichkeit die Tendenz des Entspringens der Gegenwart erhalten. Die „Bewegtheit“ von eigentlicher und uneigentlicher Zeitigung der Zeitlichkeit ist mithin für das Sein des Daseins konstitutiv. Weil die Zeitlichkeit selbst faktisch ist, indem sie das Sein des Seienden als Dasein konstituiert, ist sie als die je und je zirkuläre „Bewegtheit“ eigentlicher und uneigentlicher Zeitlichkeit. Existenzialontologisch ist lediglich die allgemeine formale Struktur der Zeitlichkeit überhaupt als hinsichtlich Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit neutraler Begriff herauszuheben (vgl. Dahlstrom 1995). Würde man eine hinsichtlich der Modi indifferente ursprüngliche Zeitlichkeit als „Prinzip“ oder Fundament der Modifikationen ansetzen (vgl. Fleischer 1991), geriete Heideggers Fundamentalontologie in der Tat zu stark in die Nähe transzendentalphilosophischer Ansätze. Den zeitlichen Sinn des Daseins herauszuarbeiten, heißt nicht nur, das Apriori des faktischen Subjekts zu bestimmen (vgl. 229), sondern auch, die Faktizität des apriorischen Prinzips selbst zu denken. Indem die Zeitlichkeit das Sein des Daseins konstituiert, ist sie selbst als Konstitutionsgrund in den Modi des Konstituierten, der Sorge erschlossen. Das heißt im Klartext: die Zeitlichkeit ist selbst faktisch, das Ur-Faktum, wie es in den Notizen Heideggers zu Sein und Zeit heißt (vgl. Heidegger 1998). Versucht man abschließend, die Resultate der Zeitlichkeitsanalyse unter der leitenden Fragestellung nach der Einheit der Sorgemomente in 8 Die neuere Arbeit von Blattner Heidegger’s Temporal Idealism (Blattner 1999), die hier nicht mehr detailliert ausgewertet werden konnte, verteidigt die Auffassung, ursprüngliche und eigentliche Zeitlichkeit seien zu unterscheiden.
194
Marion Heinz
ihrem Verhältnis zum eigentlichen Ganzseinkönnen des Daseins zusammenzufassen, ergibt sich folgendes: Die ontologische Frage nach der Einheit der Sorgemomente kann nur im Ausgang von dem existenziellen Phänomen eigentlichen und ganzen Existierens geklärt werden, in dem sich das Dasein selbst ontisch in allen Aspekten seines Seins so erschlossen ist, daß es diese Vielheit selbst ist. Voraussetzung für die adäquate ontologische Bestimmung des Seins des Daseins ist mithin die für die vorlaufende Entschlossenheit spezifische Weise der Identität von Erschließen und Erschlossenem, der gemäß das Dasein diese Identität sich selbst ermöglicht hat, so daß es sich existenziell in ihr hält. Entscheidend für die ontologische Bestimmung der Einheit seines Seins als Zeitlichkeit wird aber die in der vorlaufenden Entschlossenheit zutage tretende Endlichkeit des Seins. Sich als ein Selbst zu verstehen oder als Selbst zu existieren, heißt eben für Heidegger nicht, sich als Individuum in den allgemeinen Strukturen seiner Vollzugsweisen aufzufassen, sondern sich als jemeiniger, je eigener Vollzug so zu konstituieren, daß sich ein je und je auszutragender und offen zu haltender, begrenzter Entwurfsspielraum bildet. Weil sich mithin aus der Analyse der vorlaufenden Entschlossenheit ergibt, daß das Dasein sein Sein gar nicht im Sinne allgemeiner Strukturen oder Bestimmungen versteht, hat die ontologische Bestimmung des Seins des Daseins dem Rechnung zu tragen. Dies beansprucht Heidegger durch den Aufweis der endlichen Zeitlichkeit als Regulativ der Einheit aller grundlegenden Strukturen des Daseins zu leisten. Durch diesen Grund soll einsichtig gemacht werden, daß sich Seinsverstehen als jeweiliger, endlicher Vollzug und durch ihn ermöglichter je eigener, also letztlich geschichtlicher Entwurfsspielraum konstituiert. Daß die Zeitlichkeit genau in diesem Sinne als Grund in Anspruch genommen wird, zeigt sich in aller Klarheit erst in der Analyse der eigentlichen Geschichtlichkeit des Daseins. Hier wird aufgewiesen, daß das eigentliche Erschlossensein des Daseins ineins die Konstitution seines Lebenszusammenhangs zwischen Geburt und Tod ist (vgl. § 74). In der vorlaufenden Entschlossenheit erstreckt sich das Dasein in alle Dimensionen der Zeitlichkeit, so daß es sich zufolge des Selbstentwurfs der Ekstasen auf ihre Horizonte unverdeckt in den Momenten seines Seins erschlossen ist, und sich ineins als der je und je selbst zu vollziehende, je eigene Entwurfsbereich konstituiert. Anders gesagt: ursprüngliches und eigentliches Seinsverstehen geschieht als Konstitution endlichen Selbstseins als geschichtlicher Lebenszusammenhang. Der Zirkel von Grund und Begründetem ist damit geschlossen: die Zeitlichkeit ist als ontologischer Grund der Sorge bewährt, indem ihre existenzielle Ausgelegtheit im Selbstverständnis des existierenden Daseins aufgewiesen ist.
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
195
Literatur Bernet, R. 1987/88: Die Frage nach dem Ursprung der Zeit bei Husserl und Heidegger, in: Heidegger Studies 3/4, 89–104 Blattner, W. D. 1992: Existential Temporality in ‘Being and Time’. (Why Heidegger is not a Pragmatist), in: H. Dreyfus/H. Hall (eds.), Heidegger: A Critical Reader, Cambridge, 99–129 Blattner, W. D. 1999: Heidegger’s Temporal Idealism, Cambridge Blust, F.-K. 1987: Selbstheit und Zeitlichkeit. Heideggers neuer Denkansatz zur Seinsbestimmung des Ich, Würzburg Van Buren, J. 1995: The Ethics of Formale Anzeige in Heidegger, in: American Catholic Philosophical Quarterly 69, 2, 157–170 Dahlstrom, D. O. 1995: Heidegger’s Concept of Temporality: Reflections on a Recent Criticism, in: Review of Metaphysics 49, 95–115 Dastur, F. 1990 : Heidegger et la question du temps, Paris Dastur, F. 1992: The Ekstatico-Horizontal Constitution of Temporality, in: C. Macann (ed.), Martin Heidegger. Critical Assessments, Vol. I: Philosophy, London, 170–182 Dastur, F. 1994 : Dire le temps. Esquisse d’une chrono-logie phénoménologique, Paris Dostal, R. J. 1993: Time and Phenomenology in Husserl and Heidegger, in: Ch. B. Guignon (ed.), The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge, 141–169 Figal, G. 1982: Selbstverstehen in instabiler Freiheit. Die hermeneutische Position Martin Heideggers, in: H. Birus (Hg.), Hermeneutische Positionen: Schleiermacher – Dilthey – Heidegger – Gadamer, Göttingen, 89–119 Fleischer, M. 1991: Die Zeitanalysen in Heideggers Sein und Zeit. Aporien, Probleme und ein Ausblick, Würzburg Franzen, W. 1988: Die Sehnsucht nach Härte und Schwere. Über ein zum NS-Engagement disponierendes Motiv in Heideggers Vorlesung ‚Die Grundbegriffe der Metaphysik‘ von 1929/30, in: A. Gethmann-Siefert und O. Pöggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt/Main, 78–92 Gäbe, L. 1954: Die Paralogismen der reinen Vernunft in der ersten und in der zweiten Auflage von Kants Kritik, Diss. Marburg (Masch.) Gadamer, H.-G. 1983: Heideggers Wege. Studien zum Spätwerk, Tübingen Gethmann, C. F. 1974: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers, Bonn Gethmann, C. F. 1986/87: Philosophie als Vollzug und als Begriff. Heideggers Identitätsphilosophie des Lebens in der Vorlesung zum Wintersemester 1921/22 und ihr Verhältnis zu Sein und Zeit, in: Dilthey-Jahrbuch 4, 27–53 Grondin, J. 1990: Die Hermeneutik der Faktizität als ontologische Destruktion und Ideologiekritik, in: D. Papenfuß/O. Pöggeler (Hg.), Zur philosophischen Aktualität Heideggers, Frankfurt/Main, 163–178 Grondin, J. 1991: Das junghegelianische und ethische Motiv in Heideggers Hermeneutik der Faktizität, in: I. M. Fehér (Hg.), Wege und Irrwege des neueren Umgangs mit Heideggers Werk, Berlin, 141–150 Großheim, M. 1991: Von Georg Simmel zu Martin Heidegger. Philosophie zwischen Leben und Existenz, Bonn/Berlin Heinz, M. 1982: Zeitlichkeit und Temporalität im Frühwerk Martin Heideggers, Würzburg/ Amsterdam Heinz, M. 1986: The Concept of Time in Heidegger’s Early Works, in: J. J. Kockelmans (ed.), A Companion to Martin Heidegger’s „Being and Time“. Current Continental Research 550, Washington D.C., 183–207
196
Marion Heinz
Held, K. 1966: Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik, Den Haag Held, K. 1988: Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie, in: A. Gethmann-Siefert und O. Pöggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt/Main, 111–139 Herrmann, F.-W. von 1972: Zeitlichkeit des Daseins und Zeitlichkeit des Seins. Grundsätzliches zur Interpretation von Heideggers Zeit-Analysen, in: Philosophische Perspektiven 4, 198–210 Herrmann, F.-W. von 1991a: Der Zeitbegriff Heideggers, in: Mesotes, Zs. f. philos. Ost-WestDialog 1, Suppl., 22–34 Herrmann, F.-W. von 1991b: Heideggers Grundprobleme der Phänomenologie. Zur „Zweiten Hälfte“ von Sein und Zeit, Frankfurt a. M. Husserl, E. 1928: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, hg. v. Martin Heidegger, in: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 9, 367–496 Husserl, E. 1966: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893–1917). Husserliana X, Den Haag Husserl, E. 1992: Ideen zu einer reinen Phänomenologie. Gesammelte Schriften Bd. 5, hg. v. E. Ströker, Hamburg Kant, I. 1968: Kritik der reinen Vernunft, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt a. M. Kisiel, Th. 1983: Der Zeitbegriff beim frühen Heidegger (um 1925), in: Phänomenologische Forschungen 14, 192–211 Kisiel, Th. 1993: The Genesis of Heidegger’s Being & Time, Berkeley/Los Angeles/London Kisiel, Th. 1997: Die formale Anzeige. Die methodische Geheimwaffe des frühen Heidegger, in: M. Happel (Hg.), Heidegger – neu gelesen, Würzburg Köhler, D. 1993: Martin Heidegger. Die Schematisierung des Seinssinnes als Thematik des dritten Abschnitts von Sein und Zeit, Bonn Krockow, Ch. Graf v. 1958: Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Stuttgart Losurdo, D. 1995: Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und die Kriegsideologie, Stuttgart/Weimar Meyer, R. W. 1982: Bergson in Deutschland. Unter besonderer Berücksichtigung seiner Zeitauffassung, in: Phänomenologische Forschungen 13 Müller-Lauter, W. 1960: Möglichkeit und Wirklichkeit bei Martin Heidegger, Berlin Peperzak, A. 1988: Einige Thesen zur Heidegger-Kritik von Emanuel Lévinas, in: A. Gethmann-Siefert/O. Pöggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt a. M., 373–389 Pöggeler, O. 1963: Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen Pöggeler, O. 1982: Heidegger und das Problem der Zeit, in: L’Heritage de Kant. Mélanges Philosophiques offerts au P. Marcel Régnier, Paris, 287–307 Pöggeler, O. 1983: Zeit und Sein bei Heidegger, in: Phänomenologische Forschungen 14, 152–191 Pöggeler, O. 1988: Bergson und die Phänomenologie der Zeit, in: B. Adams, H.-K. Boehlke, K. Gründer und H.-A. Koch (Hg.), Aratro corona messoria: Beiträge zur europäischen Wissensüberlieferung. Festgabe für Günther Pflug zum 20. April 1988, Bonn, 153–169 Pöggeler, O. 1989: Temporale Interpretation und hermeneutische Philosophie, in: Revue Internationale de Philosophie 43, 5–32 Pöggeler, O./Hogeman, F. 1982: M. Heidegger: Zeit und Sein, in: J. Speck (Hg.), Grundprobleme der großen Philosophen, Bd. 5: Philosophie der Gegenwart, Göttingen, 48–86 Rentsch, Th. 1989: Martin Heidegger. Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung, München/Zürich
9 Das eigentliche Ganzseinkönnen des Daseins
197
Richardson, W. J. 1963: Heidegger: Through Phenomenology to Thought, The Hague Rosales, A. 1970: Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger, Den Haag Schulz, W. 1969: Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers, in: O. Pöggeler (Hg.), Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werks, Köln, 95–139 Sinn, D. 1967: Heideggers Spätphilosophie, in: Philosophische Rundschau 14, 8 ff. Theunissen, M. 1965: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin Tugendhat, E. 1967: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin Tugendhat, E. 1979: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt a. M. Wohlfart, G. 1982: Der Augenblick. Zum Begriff der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit bei Heidegger, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 7, 27–55 Wood, D. 1993: Reiterating the Temporal. Toward a Rethinking of Heidegger on Time, in: J. Sallis (ed.), Reading Heidegger. Commemorations, Bloomington, 136 –159
10 Thomas Rentsch
Zeitlichkeit und Alltäglichkeit (§§ 67–71)
In diesem Kapitel nimmt Heidegger zentrale Analysen des ersten Abschnitts von Sein und Zeit ein zweites Mal durch, um seine leitende Fundierungsthese zu verifizieren: die These, daß die Zeitlichkeit die Bedingung der Möglichkeit des sorgenden In-der-Welt-seins des Daseins ist.1 Jeweils werden die bereits freigelegten existenziellen Strukturen auf die sie fundierende, ermöglichende Zeitlichkeit hin erneut analysiert. Die Wiederholung ist auch als eigentlicher ekstatischer Modus des Verstehens in § 68a thematisch: „Das eigentliche Gewesensein nennen wir die Wiederholung“ (339). Insofern entspricht das nochmalige Durcharbeiten der eigenen Analysen Heideggers methodologischer Konzeption des hermeneutischen Zirkels. Es geht in der methodischen Selbstreflexion und Selbsterkenntnis der Daseinsanalyse um eine möglichst explizite, bewußte Aneignung derjenigen Phänomene, die für unser Lebens- und Weltverständnis grundlegend sind. Die philosophische Analyse selbst muß ein eigentliches Selbstverständnis freilegen und ermöglichen. Meine Interpretation des Kapitels „Zeitlichkeit und Alltäglichkeit“ soll bei der Kommentierung der Einzelanalysen folgende Leitfragen und Probleme im Blick behalten: 1. Das Problem der Fundierungsordnung: Wie läßt sich die These von der Fundierung der Sorge (und der Erschlossenheit des Da überhaupt) in der Zeitlichkeit näherhin verstehen, präzisieren und begründen? 2. Das Problem der Gleichursprünglichkeit: Wie läßt sich das „Ineinander“ der Zeitekstasen präzise fassen? 1 Zu diesem Zweck wiederholt § 68a den § 31, § 68b den § 29, § 68c den § 38, § 68d den § 34, § 69 den § 28, § 69a die §§ 15 und 12, § 69b den § 44, § 69c den § 18, § 70 die §§ 22–24, § 71 den § 9.
200
Thomas Rentsch
3. Das Problem der Transzendenz der Welt: Wie verhalten sich Ontologie, Transzendentalphilosophie, Phänomenologie und Existenzialanalyse in Sein und Zeit methodisch zueinander? Wird dieses Verhältnis durch die Verzeitlichung der Analysen systematisch transparenter? § 67 betont zunächst kritisch, daß der bereits erfolgte Aufweis einer „ursprüngliche[n] Ganzheit der Daseinsverfassung“ nicht zur „Einfachheit und Einzigkeit eines letzten Aufbauelements“ geführt hat (334). Vielmehr impliziert ursprüngliche Ganzheit im Heideggerschen Sinne gerade „Mannigfaltigkeit“ und eine komplexe Binnengliederung der Daseinsphänomene. Ferner ist die anvisierte „Alltäglichkeit“ nicht eine Ebene banaler „Selbstverständlichkeiten“, die jedem schlicht und einfach zugänglich wäre. Denn gerade die uns im Lebensvollzug besonders „nahen“ und ständig vertrauten Phänomene sind in ihrer Konstitution begrifflich besonders schwer freizulegen.2 Die Zeitlichkeit der Erschlossenheit wird im folgenden gemäß den Strukturmomenten Verstehen (§ 68a), Befindlichkeit (§ 68b), Verfallen (§ 68c) und Rede (§ 68d) analysiert.
10.1 Die Zeitlichkeit der Erschlossenheit (§ 68a–d) 10.1.1 Das Verstehen Das erste Konstituens der Erschlossenheit des Daseins ist nach § 31 das Verstehen. Negativ-kritisch grenzt Heidegger das Verstehen vom Erkennen und vom Wissen ab. Es ist ein „entwerfend-sein zu einem Sein können, worumwillen je das Dasein existiert“ (336). Verstehen ist eine praktische Lebensmöglichkeit und Lebenstätigkeit. Die sich anschließende zeitanalytische These besagt: Die Zukünftigkeit fundiert und ermöglicht das verstehende Existieren. Heidegger strebt im vorliegenden Kapitel des weiteren die Absicht eines Reflexivwerdens der gesamten Analyse: 1. durch die Voranstellung des Verstehens vor die Befindlichkeit,3 2. durch die zeitanalytisch vertieften Analysen zu Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, 3. durch die Herausarbeitung der Sonderstellung der Rede als Artikulationsmodus der gesamten Erschlossenheit (§ 68d) an. Mit diesen Weichenstellungen ist die Tendenz zu einer bewußtmachenden, aufklärenden Darstellung der Strukturen des Daseins verbunden. 2 „Das Dasein ist zwar ontisch nicht nur nahe oder gar das nächste – wir sind es sogar je selbst. Trotzdem oder gerade deshalb ist es ontologisch das Fernste“ (15). 3 Im ersten Abschnitt steht die Analyse der Befindlichkeit (§§ 29 f.) vor der Analyse des Verstehens (§§ 31 f.).
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
201
Verstehen ist primär zukunftsorientiert. Aus zukünftigen, entworfenen Möglichkeiten unserer selbst kommen wir jeweils auf unsere gegenwärtige Lebens- und Verstehenssituation zurück. Diese praktische, verstehende Zukunftsorientiertheit kann eigentlich sein im „Vorlaufen“, „zunächst und zumeist“ ist sie als an Objekte verfallendes sorgendes Seinkönnen in der „durchschnittlichen Alltäglichkeit“ uneigentlich „gewärtigend“. Drei eng miteinander verknüpfte systematische Aspekte sind bei den hier erneut und vertieft durchgeführten Sinnexplikationen von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit aufschlußreich und weiterführend: Erstens wird zwischen diesen existenzialen Grundmöglichkeiten eine „formal indifferente“ Struktur der Zukünftigkeit angesetzt, das Sich-vorweg des ersten Strukturmoments der Sorge (337). Gerade mit diesem Ansatz wird der strukturell-modellhafte und idealtypische Status der existenzialen Analytik deutlich. Zweitens kennt Heidegger im Fortgang der Analyse graduelle Übergänge zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit: „Je uneigentlicher die Gegenwart ist (…), um so mehr flieht es [sc. das Gegenwärtigen, Th. R.] verschließend vor einem bestimmten Seinkönnen, um so weniger kann aber dann die Zukunft auf das geworfene Seiende zurückkommen“ (347). Mit diesem Gradualismus ist das Denken eines Kontinuums von mehr uneigentlichen bis zu mehr eigentlichen Existenzmodi ermöglicht. Ein solcher polar-konträrer Gradualismus stünde, würde er differenziert entwickelt, gegen dualistische und dezisionistische Konzeptionen von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit im Sinne eines Entweder-Oder bzw. einer bloßen Ja/Nein-Entscheidung. Drittens werden Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit in ihrem Sinn durchgängig wechselseitig aneinander erläutert. Es gibt diese Modi mithin nicht isoliert, nicht für sich. Faktisch gibt es ein eigentliches Selbstverständnis also nur inmitten und auf dem Grund des normalen Alltags. Ein eigentliches Selbstverständnis des endlichen Menschenlebens muß in der durchschnittlichen Alltäglichkeit, gegen sie und gegen die Verlorenheit an die unbegriffenen Deutungsroutinen des „Man“ erst aktiv gewonnen werden: Der Terminus Vorlaufen „zeigt an, daß das Dasein, eigentlich existierend, sich als eigenstes Seinkönnen auf sich zukommen läßt, daß sich die Zukunft erst selbst gewinnen muß, nicht aus einer Gegenwart, sondern aus der uneigentlichen Zukunft“ (336 f., hervorgeh. von mir, Th. R.). Ein eigentliches Selbstverständnis setzt das uneigentlich-durchschnittliche, besorgende Gewärtigen voraus. Letzteres ist „ständig“ zur Lebensbewältigung nötig, ersteres ist nur „unständig“ möglich, wenn je ein Dasein gegen seine Verfallenstendenz sein unvertretbares Selbstseinkönnen bewußt und aktiv absetzt und ausgestaltet (337).
202
Thomas Rentsch
Mit dem uneigentlichen Verstehen geht im Kontext vergangenen Lebens („Gewesenheit“) ein Vergessen einher, das auch ein sorgendes Erinnern und Behalten mit ermöglicht. Dem steht die eigentliche Wiederholung gegenüber (339).4 Die uneigentliche Gegenwart beschreibt Heidegger als „Gegenwärtigen“, die eigentliche mit Kierkegaard als Augenblick (338).5 Somit ergibt sich folgende schematische Übersicht: Zeitekstasen
uneigentliches Verstehen
eigentliches Verstehen
Zukunft
Gewärtigen
Vorlaufen
Gegenwart
Gegenwärtigen
Augenblick
Gewesenheit
Vergessen/Erinnern/Behalten Wiederholung
Die mit einer künstlichen Terminologie unterschiedenen, formal aufgewiesenen Zeitmodi fungieren gleichsam als Überschriften über einem komplexen Bereich von Lebensphänomenen. Nach den bisherigen Ausführungen läßt sich nun ein eigentliches Verstehen folgendermaßen von einem uneigentlichen Verstehen unterscheiden: Entweder werden wir im sorgenden Gewärtigen von der Alltäglichkeit, von den Routinen und Habitualitäten („das Besorgbare, Tunliche, Dringliche, Unumgängliche der Geschäfte der alltäglichen Beschäftigung“, 337) absorbiert, „benommen“ und müssen „vergessen“, oder wir verstehen das Ganze unseres Lebensvollzuges aus den Möglichkeiten eines bewußten Selbstseinkönnens. Ethisch könnte man von unvertretbarer Verantwortlichkeit für die ganze bewußte Lebenszeit sprechen. Daß Heidegger sich auf diese Ebene nicht begibt, kann zumindest aus methodologischen Gründen als berechtigt erscheinen: Denn weder haben seine Analysen den Status einer zu seiner Zeit verbreiteten „materialen Wertethik“ im Sinne Schelers, noch haben sie den Status eines formalen Sollens-Präskriptivismus Kantscher Prägung. Sie haben vielmehr den Status transzendental-anthropologischer Konstitutionsanalysen der begrifflichen Grundlagen unseres theoretischen wie praktischen Welt- und Selbstverständnisses.6 4 Man beachte auch den indirekten Bezug auf die platonische Anamnesis und den Begriff der Wiederholung in der Psychoanalyse S. Freuds. 5 Die Fußnote zu Kierkegaard auf S. 338 wird dessen Vorarbeit zum Augenblicksbegriff wohl nicht voll gerecht. 6 Man könnte diese Analysen daher auch als Proto-Ethik bezeichnen. Das aber rückt sie wiederum in die Nähe von Kants transzendentaler Fragestellung. Vgl. dazu meine Analysen in Rentsch 1999.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
203
10.1.2 Die Befindlichkeit Zweites Konstituens der Erschlossenheit ist die Befindlichkeit. Heidegger ist zeitanalytisch bestrebt, mit Bezug auf dieses Strukturmoment die qualifizierende Dominanz der Vergangenheit, terminologisch der Ekstase der Gewesenheit, deutlich zu machen. Die leitende These ist zunächst unabhängig von der Zeitanalyse: Verstehen ist immer schon „gestimmt“, das heißt in unseren Lebenssituationen herrscht immer auch eine affektive, emotionale „Färbung“ vor, die unsere sonstigen Entwürfe begleitet und qualifiziert. Sie ist Heidegger zufolge mit der Faktizität als der „Geworfenheit“ unweigerlich gegeben, in deren Ekstase, der Gewesenheit, sie gründet. Gerade an dieser Stelle forcierter Zeitanalyse könnte man kritisch einhaken und monieren, daß die Gestimmtheit/Befindlichkeit mit unserem leiblichen Fühlen und Empfinden eng verbunden ist, daß das leibliche, eben lebendige In-der-Welt-sein – sicherlich „gleichursprünglich“ mit der genuin existenziellen Zeitlichkeit unseres Lebens – auch eine wesentliche Basis unserer Stimmungen ist. Die lebendige Leiblichkeit „fundiert“ im Kontext unseres In-derWelt-seins unsere Gestimmtheit ebenfalls. Heideggers programmatische These lautet: „Es gilt (…), den Nachweis zu führen, daß die Stimmungen in dem, was sie und wie sie existenziell ,bedeuten‘, nicht möglich sind, es sei denn auf dem Grunde der Zeitlichkeit“ (341). Sie sind sicher auch ohne leiblich-sinnliche Strukturen der existenziellen Faktizität nicht möglich. Auch ohne Einbettung in soziale, kommunikative Strukturen des Mitseins mit Anderen scheinen die kulturell voraussetzungsreichen, variantenreichen Stimmungen sich in einer jeweiligen Lebenspraxis nicht konstituieren zu können. Es stellt sich also die Frage, ob die von Heidegger systematisch forcierte Dominanz der Zeitigung der Zeitlichkeit für die Formen lebensweltlicher Sinnkonstitution tatsächlich phänomenal ausgewiesen ist. Ferner stellt sich die Frage nach der methodischen Bedeutung der internen Gleichursprünglichkeit der Zeitekstasen angesichts der jeweiligen Dominanz einer „primären“ Ekstase bei einem konkreten Lebensphänomen. Und es stellt sich die Frage nach der Bedeutung der externen Gleichursprünglichkeit von Existenzialität und Faktizität im Blick auf das Verhältnis von existenzieller Leiblichkeit, Räumlichkeit und Zeitlichkeit. Wohl gemerkt: Diese kritischen Fragen berühren nicht den von Heidegger reklamierten methodologischen Status seiner Analysen, der nicht ontisch-psychologisch, empirisch ist, sondern ontologisch-existenzial (340). Es handelt sich um begriffliche, „grammatische“ Konstitutionsanalysen, um die kritische Reflexion auf
204
Thomas Rentsch
den Status derjenigen Grundbegriffe und Sätze, mit denen wir über uns selbst und unser Selbstverständnis sprechen.7 In zeitanalytischer Vertiefung setzt Heidegger im folgenden die Sinnexplikation der Phänomene der Furcht und der Angst aus den §§ 30 und 40 fort. Er knüpft an die Analysen der Furcht in Aristoteles’ Rhetorik an. Wird dort die Furcht als bedrückende Verwirrung bestimmt, so gründet diese Verwirrung nach Heidegger in einem Vergessen als einem Ausweichen vor dem Bedrohlichen. Und dieses Vergessen ist ein Modus der Ekstase der Gewesenheit auf dem Grund der Geworfenheit, der existenzialen Vergangenheit (342). Ist diese Zuordnung der Furcht zum Gewesenen als der sie primär modifizierenden Ekstase fraglos nachvollziehbar? Ist diese qualifizierende Dominanz nicht forciert, da doch auch zukünftig Bedrohliches – zum Beispiel Einbrecher, befürchtete Krankheiten und Krankheitsverläufe, drohende Verluste – gefürchtet wird? Versucht Heidegger nicht, die Phänomene in ein eher zu starr, zu statisch konzipiertes Gefüge der Ekstasen der Zeitigung der Zeitlichkeit zu pressen? Die Qualität von Heideggers Argumentation sieht man nicht zuletzt daran, daß er sich diesen Einwand selber macht (341). Er setzt seine dezidierte These dagegen, „daß das Gewärtigen der Furcht das Bedrohliche auf das faktisch besorgende Seinkönnen zurückkommen läßt“ (341). Die zeitlich gedachte Faktizität als Gewesenheit läßt sich zweifellos als notwendige Möglichkeitsbedingung der Stimmung Furcht ansetzen, als conditio sine qua non; ob sie allerdings auch hinreichende Möglichkeitsbedingung dieser Stimmung ist, scheint mir fraglich. Würden auch alle gleichursprünglichen Ekstasen der Zeitigung der Zeitlichkeit zusammen diese hinreichende Bedingung nicht bilden, dann würde auch die generelle These von der transzendentalen, ontologischen bzw. existenzialen Fundierung der Sorge und des In-der-Welt-Seins des Daseins in der Zeitlichkeit davon nicht unberührt bleiben. Auch bei der Analyse der Zeitlichkeit der Angst gilt die Präponderanz der Gewesenheit für die Befindlichkeit, aber in eigentlichkeitsermöglichender Modifikation. Sie eröffnet die Möglichkeit eines eigentlichen Selbstseinkönnens. Es gibt in dieser Stimmung, so wie sie Heidegger modellhaft-typologisch konzipiert, keine Ausflucht- und Ausweichmöglichkeiten mehr, weder in ein Vergessen, noch in ein Erinnern, noch in ein gewärtigendes Besorgen von innerweltlichen Orientierungszusammenhängen (343). Vielmehr enthüllt die Angst die „Unheimlichkeit“ des nackten Daß des Daseins in der „leeren Erbarmungslosigkeit“ des „Nichts der Welt“ (342 f.). Solche Passagen mit ihrem suggestiven sprachlichen Duk7 Vgl. zum Status solcher Analysen: Methode und Selbsterkenntnis, in: Rentsch 1999, I-L.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
205
tus konnten, existenziell-ontisch und isoliert gelesen, eine existenzialistische Lesart von Sein und Zeit nahelegen – ersichtlich ein Mißverständnis, denn diese Passagen gehören eindeutig zur Beispielebene mit Erläuterungsfunktion. Existenzialistische Verständnisse im Sinne eines proklamierten Existenzideals werden somit dem grundsätzlichen methodischen Aufbau von Sein und Zeit nicht gerecht. Methodologische Zwischenbemerkung An dieser Stelle scheint es mir sinnvoll, die methodischen Ebenen von Sein und Zeit in eigener systematischer Rekonstruktion wie folgt zu differenzieren: (1) die ontisch-existenzielle, paradigmatische Explikationsebene der phänomenologischen Einzelanalyse zum Beispiel von Lebensphänomenen wie der Furcht und der Angst; (2) die ontologisch-existenziale, begriffliche Rekonstruktionsebene der paradigmatischen Explikationsebene (1). Diese Ebene legt insbesondere die strukturelle Verfassung (Konstitution), die „Strukturmomente“ der ontisch-existenziellen Phänomene, frei. Ihre Begriffe sind zum Beispiel „Erschlossenheit“, „Sorge“, „In-der-Welt-sein“, „Sich-vorweg-sein“ etc.; (3) die Ebene der metasprachlichen Terminologiebildung zur begrifflichen Thematisierung der Ebene (2) – mit Termini wie zum Beispiel „Existenzial“, „Kategorie“, „Ekstase“, „Schema“, „Strukturmoment“; (4) die Ebene der methodologischen Reflexion auf das Verhältnis der Ebenen (1), (2) und (3) mit Termini wie „Gleichursprünglichkeit“, „ist fundiert in“, „konstituiert“, „transzendental“, „ist verwurzelt“, „vorgängig“ etc. Heidegger reflektiert die Differenz dieser Ebenen selbst immer nur ansatzweise, niemals im Zusammenhang. Insbesondere die Ebenen (3) und (4) werden kaum explizit thematisiert. Dennoch müssen sie bei genauerem Hinsehen systematisch sowohl auseinandergehalten als auch in ihrem Verhältnis zueinander bestimmt werden. Dazu würde es gehören, das Verhältnis von (Fundamental-) Ontologie, Transzendentalphilosophie und Phänomenologie in der Methode von Sein und Zeit präzise aufzuklären; das hieße auch, die relevanten Rezeptionsschichten aus den Werken von Aristoteles, Kant und Husserl in ihrem Verhältnis zu bestimmen.8 Insbesondere müßte der systematische Zusammenhang von „Konstitution“ und „Ursprung“ aufgehellt werden. 8 Vgl. dazu Rentsch 1989a, 108 ff.
206
Thomas Rentsch
Wenden wir uns wieder der Angstanalyse zu, die zu Ebene (1) gehört. Die zeitanalytische Fassung der eigentlichkeitskonstitutiven Bedeutung des Angstphänomens hebt darauf ab, daß Angst vor die „mögliche Wiederholbarkeit“ des Gewesenen bringe: „Vor die Wiederholbarkeit bringen ist der spezifische ekstatische Modus der die Befindlichkeit der Angst konstituierenden Gewesenheit“ (343). Diese durch die Angst eröffnete existenzielle Möglichkeit der Wiederholung vergangener Lebensentwürfe zeigt im übrigen ebenso wie der methodische Status der Analyse, daß ihr Verständnis im Sinne eines existenzialistischen Nihilismus verfehlt ist. Die Erfahrung des „nackten Daß“ im „Nichts der Welt“ ist nur als (auch) ein entwicklungsgeschichtliches, modern gesprochen: identitätskonstitutives Durchgangsstadium auf dem Weg zu einem geklärten Selbstverständnis konzipiert. Eigentliche Angst und uneigentliche Furcht werden wechselseitig durchund aneinander erläutert. Das strukturell einfachste Unterscheidungsmerkmal läßt sich so fassen: Während die Furcht besorgend auf innerweltlich Seiendes bezogen ist und bleibt, an solches Seiende „verfallen“ ist, ist die Angst objektlos auf das menschliche In-der-Welt-sein im ganzen bezogen. Deswegen ist ihr „wovor“ zugleich ihr „worum“ – das In-der-Welt-sein selbst, außerhalb dessen es (in gewissem Sinne) „nichts“ gibt (343). Angst entspringt so „der Zukunft der Entschlossenheit“, „die Furcht aus der verlorenen Gegenwart“ (344 f.). Im folgenden streift Heidegger die Zeitlichkeit anderer Stimmungen. Die Zentralthese von der Präponderanz der ekstatischen Gewesenheit für die Befindlichkeiten/Stimmungen wird auch im Blick auf die Hoffnung durchgehalten. Auch sie gründet in der Gewesenheit, im geworfenen Grund seiner selbst. Sie gründet im Lastcharakter (der Schwere) der Existenz, die im Hoffen „erleichtert“ wird, weswegen man auch von gehobenen, „besser hebende[n] Stimmungen spricht“ (345).9 Demgegenüber prägen „Gleichgültigkeit“ und die „Macht des Vergessens“ die Stimmungen des alltäglichen Besorgens. Eine aufschlußreiche Kurzbemerkung Heideggers betrifft das Problem der Affektion. Diese „setzt ontologisch das Gegenwärtigen voraus, so zwar, daß in ihm das Dasein auf sich als Gewesenes zurückgebracht werden kann“ (346). Die Affektion, wie sie Kant konzipierte, setzt mithin bereits die ekstatische Zeitigung der Zeitlichkeit voraus.10 Abschließend fragt Heidegger nach der Seinsart der tierischen Sinnlichkeit und Zeitlichkeit: Wie könnten sie angesichts der Vorstruktur unseres Verstehens wohl thematisiert werden? 9 Zur Kritik an dieser existenzialen Hoffnungsanalyse vgl. Greisch 1994, 335 f. 10 Vgl. Heidegger 1973, v. a. 165–197 sowie GA 25.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
207
10.1.3 Das Verfallen Untersucht wird nun die Zeitlichkeit des dritten Konstituens der Erschlossenheit: des Verfallens. Wiederum wird die primäre, dominierende Ekstase von der mit ihr gleichursprünglichen ganzen ekstatischen Zeitlichkeit unterschieden (346). Die Zeitlichkeit des Verfallens wird am materialen Beispiel der Neugier untersucht. Sie erhält eine durchweg pejorative Charakterisierung durch Definitionsmerkmale wie „Gier“, „ungehaltenes Gegenwärtigen“, „Entlaufen“, „Wegsehen“, Unverweilen“, „Nachspringen“, „Zerstreuung“ und „Aufenthaltslosigkeit“ (347). Die Vollstufe der Uneigentlichkeit ist erreicht, wenn ein Verfallen an gegenwärtig innerweltlich Seiendes die Zukunft als Noch-nicht-Gegenwart, die Vergangenheit als Nicht-mehr-Gegenwart und die Gegenwart als bloße Zerstreuung, Ablenkung, als Springen von dem einen uneigentlichen Gegenwärtigen zum nächsten erscheinen läßt. Man kann diese Analyse konventionell reformulieren: Ein geklärtes und reflektiertes Lebensverständnis verfehlt derjenige, der immer wieder nur von momentanen, kurzfristigen Sensationen, Aufgeregtheiten und Ablenkungen gefangengenommen wird, der seine Handlungen und Projekte nicht gründlich durchreflektiert, sondern ohne „Linie“, konzeptionslos von sich gerade anbietenden, beliebigen Gelegenheiten bestimmen läßt. Man kann diese Analyse mit der Kulturkritik an der Unterhaltungsindustrie assoziieren: So könnte in unserer gegenwärtigen Alltagswelt zum Beispiel das Phänomen des „Zapping“ von Fernsehkanal zu Fernsehkanal, das „Berieseltwerden“ von standardisierter Unterhaltungsmusik im Supermarkt oder die stereotype Abfolge von Videoclips mit hektischer Bildersequenz mit den von Heidegger beschriebenen Verfallsphänomenen in Verbindung gebracht werden. Dennoch sieht man, daß das alltagssprachliche Bedeutungsspektrum von „Neugier“ in seiner terminologischen Fassung pejorativ enggeführt wird. Es schwingt etwas von der sündentheologisch motivierten Polemik des Augustinus gegen die weltverfallene curiositas in Heideggers Darstellung mit. Im Blick auf die onto- und phylogenetische menschliche Identitäts- und Kulturkonstitution ist eine solche pejorative Zurechtstellung des Phänomens der Neugier wohl kaum haltbar – denn ohne Wissensdrang, Forschungstrieb und die schöpferischen Tätigkeiten, die mit Neugier und Entdeckungsfreude verbunden sind, wäre weder eine individuelle noch eine gesellschaftliche Höher- und Weiterentwicklung des Menschen möglich gewesen. Die Untersuchungen von Hans Blumenberg zum Prozeß der theoretischen Neugierde und ihrer positiven Bedeutung sind denn auch als Gegen-
208
Thomas Rentsch
entwurf zu Heideggers Analyse lesbar.11 Festhalten können wir kritisch, daß die Aufteilung auf die Modi der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit bei der phänomenologischen Charakterisierung von Lebensphänomen wie zum Beispiel der Neugier (und der Hoffnung, s. u.) nicht selten zu terminologischen Bedeutungsverengungen und definitorisch eigenwilligen Bedeutungsfestlegungen führt. Durch schematische Zurechtstellungen tendiert die Analyse bei aller phänomenologischen Reichhaltigkeit mitunter dazu, die Komplexität und interne Differenziertheit der menschlichen Lebenswirklichkeit unterzubestimmen. Warum soll es nicht eine eigentliche Neugier oder eine uneigentliche Angst geben?12 Mit der Verwendung von „uneigentlich“ im Komparativ („Je uneigentlicher die Gegenwart ist […], um so weniger kann […] die Zukunft auf das geworfene Seiende zurückkommen“ (347)) eröffnet sich Heidegger die wertvolle systematische Möglichkeit von Übergängen und einer gradualistischen Konzeption von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Aber er nutzt sie kaum. Eine aufschlußreiche Passage der Analyse der Zeitlichkeit des Verfallens thematisiert das systematische Kernproblem des „,Entspringens‘ der Gegenwart“. In der Heideggerschen Neugier-Konzeption mit ihren Aspekten Versuchung, Beruhigung, Entfremdung und Sichverfangen (347) wird ein gesteigertes Verfallen an gegenwärtige Objekte gedacht, angesichts dessen Zukunft und Gewesenheit tendenziell abgeblendet werden. Somit reduziert und konzentriert sich die gesamte Lebensbewegung auf das oberflächlich sorgende Gegenwärtigen, das sich auf diese Weise „seiner ekstatischen Tendenz nach aus ihm selbst zu zeitigen sucht“ (348). Woher „entspringt“, woher „kommt“ nun, so könnte man fragen, diese verbleibende Gegenwart, an die das Dasein immerfort verfallen kann? Heidegger gibt eine dezidierte, allerdings schwer verständliche Antwort: „Der Zeitigungsmodus des ,Entspringens‘ der Gegenwart gründet im Wesen der Zeitlichkeit, die endlich ist (…). Die Gegenwart entspringt ihrer eigentlichen Zukunft und Gewesenheit, um erst auf dem Umweg über sich das Dasein zur eigentlichen Existenz kommen zu lassen. Der Ursprung des ,Entspringens‘ der Gegenwart, das heißt des Verfallens in die Verlorenheit, ist die ursprüngliche, eigentliche Zeitlichkeit selbst, die das geworfene Sein zum Tode ermöglicht“ (348).
11 Blumenberg 1973. 12 Vgl. dazu auch Greisch 1994, 335.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
209
Daß die Zeitlichkeit endlich ist, kann mit Blick auf die existenzielle wie geschichtliche Lebenswirklichkeit problemlos nachvollzogen werden. Im Fortgang der Textpassage erfolgt jedoch die sprachliche Schöpfung einer quasi-subjekthaft konzipierten eigentlichen, endlichen „Zeitlichkeit selbst“. Es ergibt sich ein systematisches Problem: Die Verzeitlichung der existenzialen Analytik hatte kritisch zur Destruktion der Vorhandenheitsontologie des Subjekt-Objekt-Dualismus geführt. Die präsentisch an gegenwärtig innerweltlich Seiendes verfallene Metaphysik des erkennenden, denkenden „Ich“ bzw. des „Bewußtseins“ in der Tradition von Descartes bis zu Kant und noch Husserl konnte so als phänomenologisch und hermeneutisch unangemessen für die tatsächlichen pragmatischen und existenzialen Konstitutionsbedingungen des menschlichen In-der-Welt-seins erwiesen werden. In den uns vorliegenden, genuin zeitanalytischen Passagen scheint es aber oft so, als kehre die destruierte Substanzontologie in der Gestalt einer Substantialisierung der Zeitlichkeit durch die Hintertür wieder. Denn wird nicht über die Zeitigung der Zeitlichkeit wie über ein handelndes Quasi-Subjekt gesprochen? Es gilt jedenfalls, den logischen und methodischen Status der Rede von der „ursprüngliche[n], eigentliche[n] Zeitlichkeit selbst“ als dem „Ursprung des ,Entspringens‘ der Gegenwart“ (348) begriffskritisch im Auge zu behalten und zu klären. Diese Rede von der aktiv handelnd vorgestellten Zeitigung der Zeitlichkeit gerät sonst in die Nähe mythischer Rede von einem endlichen waltenden Gott, Chronos und Kairos in einem. Im vorliegenden Text sieht Heidegger die Zeitlichkeit des Verfallens im Zusammenhang mit der „Verschlossenheit“ des Daseins vor seinem „ontischen Woher und Wie“ (348). Diese Verschlossenheit vor sich selbst ist kein bloßes „Nichtwissen, sondern konstituiert die Faktizität des Daseins. Sie bestimmt mit den ekstatischen Charakter der Überlassenheit der Existenz an den nichtigen Grund ihrer selbst“ (348). Die „Bewegtheit“ des Daseins verbleibt in der Nichtigkeit der Verlorenheit an die zu besorgende Welt, es sei denn, Dasein holt sich „entschlossen“ aus ihr zurück, „um als gehaltener Augenblick die jeweilige Situation und in eins damit die ursprüngliche ,Grenzsituation‘ des Seins zum Tode zu erschließen“ (349). Heidegger knüpft mit diesen Bemerkungen an seine frühe „Hermeneutik der Faktizität“ und seine Analysen zu den „Bewegtheitscharakteren des faktischen Lebens“ von 1923 an.13 Die Verschlossenheit hieß dort Undurchsichtigkeit bzw. Verdeckungstendenz, ihre zeitlichen Modi waren Larvanz/Opazität und Ruinanz. 13 Vgl. GA 63.
210
Thomas Rentsch
10.1.4 Eigentliche Gegenwart: Augenblick und Rede Angesichts der bisherigen Zeitanalysen wird häufig die Frage nach der Möglichkeit einer eigentlichen Gegenwart jenseits des gegenwärtigenden Verfallens gestellt. Insbesondere Hans Jonas hat in der Kritik an seinem Lehrer geglaubt, gnostische Züge in Sein und Zeit nachweisen zu können.14 Er stellt fest, es gebe für Heidegger keine „,eigentliche‘ Gegenwart“ „als unabhängige Dimension eigenen Rechts“, da die „Gegenwart der ,Situation‘“ für ihn „ganz durch das Verhältnis zur Zukunft und Vergangenheit konstituiert“ sei. Der „Augenblick“ der „Entscheidung“, „nicht Dauer“ sei „der temporale Modus dieser ,Gegenwart‘ „. Für sich allein bezeichne „bloße ,Gegenwart‘ gerade Versäumnis eigentlicher Zukunfts-Vergangenheits-Relation im ,Verfallensein‘ an Gerede, Neugier und das Man: ein Versagen der Spannung echter Existenz, eine Art Erschlaffung des Seins“. „Da ist keine Gegenwart, worin zu verweilen wäre, nur die Krisis zwischen Gewesen und Zukünftig, der zugespitzte Augenblick auf der Messerschneide der Entscheidung, die vorwärts stößt.“ Die Kritik von Jonas übersieht zunächst die von mir hervorgehobene und von Heidegger explizit eröffnete Möglichkeit eines gradualistisch abgestuften Verständnisses der modellhaften Idealtypen „Eigentlichkeit“ und „Uneigentlichkeit“. Sie übersieht sodann den methodischen Status der Analysen Heideggers: Diese Analysen sind Konstitutionsanalysen der sprachlichen und existenziellen Möglichkeitsbedingungen unseres Selbst- und Weltverständnisses, nicht jedoch Proklamation oder Verkündigung eines Existenzideals im Sinne des von Jonas nahegelegten existenzialistischen Dezisionismus. Trotzdem können die sinnkriterialen Analysen natürlich falsch bzw. unangemessen oder einseitig sein – zum Beispiel einen Aspekt der Konstitution verzerrend übergewichten. Wie wir sahen, könnte dies im Falle der Zeit durchaus so sein. Außerdem vermitteln manche Textpassagen mit ihrem expressionistischen Pathos und ihrer suggestiven Rhetorik, liest man sie isoliert, in der Tat den von Jonas herausgestellten, gleichwohl falschen Eindruck. Aber man darf die paradigmatischen Einzelanalysen zum Beispiel der Angst oder des Todes weder isolieren noch als Existenzideal verstehen und vereinseitigen. Anders gesagt: Man braucht dies nicht zu tun – selbst wenn Heidegger es intendiert haben sollte. Schließlich impliziert auch die Charakterisierung des Augenblicks als eigentlicher Gegenwart durch das Merkmal der in der Entschlossenheit „gehaltenen Entrückung“ des Daseins (338) sowie durch die Feststellung, 14 Gnosis, Existentialismus und Nihilismus, in Jonas 1963, 1987, 21 f.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
211
der eigentliche Augenblick lasse Zeit allererst „werden“ (ebd.), keineswegs eine bloße Krisis, den „zugespitzte[n] Augenblick auf der Messerschneide der Entscheidung“. Vielmehr läßt sich diese Charakterisierung, etwas schlichter und konventioneller reformuliert, als die Beschreibung der bewußten Herausbildung eines geklärten menschlichen Selbstverständnisses verstehen. Zu einer solchen Herausbildung gehören sicher ein überlegendes Innehalten und ein Abstand von ablenkenden Okkupationen. Auf diese Weise gelangt derjenige, der sich ernsthaft um Klärung seiner Lebenssituation bemüht, eben durch die sich einstellende „gehaltene Entrückung“ zu einer gewissen Unabhängigkeit von seinen sonstigen Sorgen und Bekümmerungen. Und so gewinnt er erst eigentlich wertvolle, qualitativ reiche, wirklich sinnvoll lebbare Lebenszeit. So läßt der Augenblick vernünftiger Einsicht und Besinnung allererst „Zeit werden“. Die existenzialistisch-dezisionistische Lesart von Jonas ist auch deswegen unberechtigt, da Heidegger stets die unverzichtbare Zeitigung aller Zeitekstasen bei der Konstitution der Lebensphänomene hervorhebt. Das uneigentliche Verstehen manifestiert sich so als vergessend-gegenwärtigendes Gewärtigen, das eigentliche Verstehen als wiederholend-augenblickliches Vorlaufen. Eben durch die (identitätskonstitutive) Ganzheitlichkeit der ekstatischen Konstitution wird also die eigentliche, gehaltene Entrückung im Augenblick in einem notwendigen Zusammenhang mit geklärter, durchgearbeiteter Vergangenheit (Wiederholung) und der eigenen Endlichkeit bewußter Zukunftsorientierung (Vorlaufen) gesehen. Systematisch noch weitreichender im Blick auf die Frage nach einer eigentlichen Gegenwart ist die in § 68d analysierte Zeitlichkeit der Rede, die in der Kritik von Jonas nicht berücksichtigt wird. Dieses vierte Strukturmoment der Erschlossenheit steht gleichsam quer zur „verfallenden“ Sorgestruktur und wird nicht einer primären Zeitekstase zugeordnet, wie das beim Verstehen (Zukunft), bei der Befindlichkeit (Vergangenheit) und beim Verfallen (Gegenwart) geschieht. Durch die Rede „erhält“ die „volle, durch Verstehen, Befindlichkeit und Verfallen konstituierte Erschlossenheit des Da (…) die Artikulation“ (349). Der Rede ließe sich somit in der Konsequenz dieser sprachphilosophisch fundamentalen Feststellung eine ähnlich weitreichende Funktion gegenüber allen anderen Existenzialien zuweisen, wie sie Heidegger in § 17 (79) dem Zeichen gegenüber anderen Arten von „Zeug“ zuerkennt. Wie das „Zeichen“ ermöglicht nämlich die Rede in der jeweiligen Gegenwartssituation, von der Vergangenheit her und auf die Zukunft hin, eine Übersicht und gedankliche Gesamtorientierung. Ohne eine solche, größere Kontexte gedanklich einbegreifende Gesamtorientierung ist ein überlegtes, geklärtes („eigentliches“) Welt- und
212
Thomas Rentsch
Selbstverständnis in der Tat undenkbar. Eine solche, die Zeitekstasen einbegreifende Gesamtorientierung wird durch die für sie konstitutiven, in den Sprachgebrauch eingearbeiteten Bedeutsamkeitsbezüge vermittelt, durch die uns unsere Situationen jeweils „erschlossen“ sind. Somit ist die Rede eine menschliche Möglichkeit der Artikulation der gleichwohl vorgängigen ekstatischen Einheit des zeitlichen In-der-Welt-seins. Das entspricht früheren sprachphilosophischen Feststellungen Heideggers: „Das in der redenden Artikulation Gegliederte als solches nennen wir das Bedeutungsganze“ (§ 34, 161). „Die Sprache als die Ausgesprochenheit birgt eine Ausgelegtheit des Daseinsverständnisses in sich“ (§ 35, 167). Die Rede kann zwar zum „Gerede“ werden und dadurch ein Verständnis des Daseins gerade verschließen (vgl. § 35). Sie ist aber in der systematischen Konsequenz der sprachphilosophischen Ausführungen Heideggers zugleich nicht nur konstitutiv für das Verstehen und die Erschlossenheit des Daseins insgesamt, sondern auch Ort der Selbstreflexivität und reflektierten Weltorientierung, des vernünftigen Begreifens dessen, was gewöhnlich, im uneigentlichen „Gerede“ unthematisch und damit „verdeckt“ bleibt. Schließlich: Wenn Heidegger auch nicht explizit methodologischsprachkritisch den Status der eigenen Ausführungen erörtert – sie ist und bleibt doch entscheidende Möglichkeitsbedingung philosophischer Reflexion selbst. Sie ist, kurz gesagt, Möglichkeitsbedingung der expliziten Freilegung des Sinnes von Sein auf dem Niveau philosophischer Analyse wie auch in aller Alltäglichkeit. Dem „Verfallen“ als uneigentlichem Modus der Gegenwart sowie dem emphatisch ausgezeichneten „Augenblick“ als gewissermaßen pleromatischem Eigentlichkeitsmodus kann so die Rede als – zumindest potentiell – „normaler“ eigentlicher Erschlossenheitsmodus der Gegenwart zur Seite gestellt werden.15 Diese Deutung wird gestützt durch Heideggers Aussage, für die Rede habe „das Gegenwärtigen eine bevorzugte konstitutive Funktion“ (349). Die Rede „spricht“ Heidegger zufolge allerdings „zunächst in der Weise des besorgend-beredenden Ansprechens der ,Umwelt‘“ (349). Und das „Gegenwärtigen“ wurde bereits als „uneigentliche Gegenwart“ bezeichnet (338). Diese Thesen könnten die Rede wiederum in die Nähe des „uneigentlichen Verstehens“ (337) rücken. Die in Sein und Zeit ausgeführten sprachphilosophischen Analysen und Bemerkungen sind zu knapp, um eine klare Entscheidung in der Frage nach dem seinserschließenden Status der Rede/Sprache zu ermöglichen. Das sagt Heidegger
15 So auch Luckner 1997, 147 f.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
213
selbst, wenn er programmatisch darauf verweist, daß „die Analyse der zeitlichen Konstitution der Rede (…) erst in Angriff genommen werden [kann], wenn das Problem des grundsätzlichen Zusammenhangs von Sein und Wahrheit aus der Problematik der Zeitlichkeit aufgerollt ist“ (349).16 Dieser Verweis auf den unausgeführten dritten Abschnitt des Werkes zeigt einerseits Heideggers klares Bewußtsein der offenen Fragen, andererseits auch sein Festhalten an der leitenden Vorentscheidung für die monoprinzipiell als transzendental-konstitutiv ausgezeichnete Zeitlichkeit. Erst aus der „Zeitlichkeit der Rede“ kann, so Heidegger, „die ,Entstehung‘ der ,Bedeutung‘ aufgeklärt und die Möglichkeit einer Begriffsbildung ontologisch verständlich gemacht werden“ (349). Daß „Rede (…) an ihr selbst zeitlich [ist]“ (ebd.), das könnte möglicherweise auch sprachpragmatisch im Sinne einer Wittgensteinschen Gebrauchskonzeption sprachlicher Bedeutung weiter entfaltet werden.17 Zu einer solchen Aufklärung der Bedeutung kommt es in Sein und Zeit nicht mehr. Die Zuordnung der Rede zur eigentlichen Gegenwart läßt sich möglicherweise auch durch den besonderen Zusammenhang stützen, den Heidegger in den §§ 55 ff. zwischen der „Rede“ und dem „Ruf des Gewissens“ herstellt.18 Hier heißt es allerdings auch: „Was ruft das Gewissen dem Angerufenen zu? Streng genommen – nichts. Der Ruf sagt nichts aus“. „Das Gewissen redet einzig und ständig im Modus des Schweigens.“ und es zwinge „das an- und aufgerufene Dasein in die Verschwiegenheit seiner selbst“ (273). Es handelt sich gerade hier also gewissermaßen um Rede im Modus der Negativität, um das Schweigen als äußerste Grenze der Rede. Metasprachlich-methodologisch gilt aber gleichermaßen: Zur Sinnexplikation – also zum intersubjektiven Verstehen überhaupt – des Gewissensphänomens auch und gerade im Heideggerschen Sinne gehört unverzichtbar die sprachlich-allgemeinverständliche Analyse und Erläuterung. Bloßes, wenn auch noch so „bedeutsames“ Schweigen würde hier nicht weiterführen.19
16 Vgl. dazu insbesondere auch: Heidegger 1947, sowie 1959a, 61979. 17 Eine Gebrauchskonzeption der Bedeutung deutete sich auch in § 17 bereits an. 18 Diesen Zusammenhang mit dem Gewissen stellt auch Luckner 1997, 148, Fußnote 66 her, allerdings mit dem Vorbehalt, daß Heidegger selbst „sich vehement dagegen wehren würde.“ 19 Auch das emphatisch mit absolutem Sinn unterfütterte „Schweigen“ im Tractatus Wittgensteins hätte ohne die religiöse, mystische und theologische Sinntradition und reflektierte Kommunikationsgeschichte nur einen privatistischen, zweifelhaften oder ganz unverständlichen Status.
214
Thomas Rentsch
Der abschließende Ausblick des § 68 bündelt die Fundierungsthese. Erschlossenheit wie auch Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit „sind in der Zeitlichkeit fundiert“ (350). „Die Zeitlichkeit zeitigt sich in jeder Ekstase ganz, das heißt in der ekstatischen Einheit der jeweiligen vollen Zeitigung der Zeitlichkeit gründet die Ganzheit des Strukturganzen von Existenz, Faktizität und Verfallen, das ist die Einheit der Sorgestruktur“ (ebd.). Bei dieser abschließenden, von Heidegger kursivierten Feststellung kann man fragen, wie sich die formalen Termini der Ganzheit („in jeder Ekstase ganz“, „die Ganzheit des Strukturganzen“), der Einheit („die Einheit der Sorgestruktur“) und des Vollen („in der ekstatischen Einheit der jeweiligen vollen Zeitigung der Zeitlichkeit“) zueinander verhalten. Daß die Zeitigung „kein ,Nacheinander‘ der Ekstasen“ bedeutet, die Zukunft „nicht später“ als die Gewesenheit und diese „nicht früher“ als die Gegenwart ist (350), sind nur negative Bestimmungen. Sie tendieren zu einer Art „negativen Theologie der Zeit“.20 Dieser Befund entspricht den affirmativen Zeitprädikationen der Einheit, der Ganzheit und der Fülle (des Vollen) im Sinne einer formalisierten positiven Theologie.21 In letzter Konsequenz und im Blick auf die in der Todesanalyse radikalisierte Philosophie der menschlichen Endlichkeit und Nichtigkeit kann man das Diktum von Wilhelm Schapp zumindest verstehen, Kant habe nach seiner Kritik der Metaphysik noch Gott, Freiheit und Unsterblichkeit im ethischen Kontext postuliert, und von alledem sei bei Heidegger nur noch der Tod übriggeblieben.
10.2 Die Zeitlichkeit des In-der-Welt-Seins und das Problem der Transzendenz der Welt (§ 69a–c) Heidegger wiederholt die Kernthese seiner Fundierungskonzeption: Die ekstatische Einheit der Zeitlichkeit „ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß ein Seiendes sein kann, das als sein ,Da‘ existiert“ (350). Sie ist, wohlgemerkt, in dieser Konzeption nicht eine, sondern die Bedingung. Es ist die zunächst nicht anders als formal gedachte Einheitsstiftung, für die die Zeitlichkeit funktional eingesetzt wird. Ist es argumentativ begründbar und phänomenologisch ausgewiesen, die lebensformbezogene Einheitsstiftung so isoliert anzusetzen? Welche Bedeutung hat demgegenüber dann zum 20 M. Theunissens Untersuchungen zu einer solchen Theologie knüpfen auch an Heidegger an; vgl. Theunissen 1991. 21 Vgl. zur Betrachtung von Sein und Zeit als säkularisierter, formalisierter Theologie auch Rentsch 1989a, 137–157, v. a. 150.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
215
Beispiel der menschliche Leib, der seit Platon als principium individuationis angesehen wurde? Leiblichkeit und naturale Getragenheit im für Menschen konstitutiven Selbstwerdungsprozeß wurden bezeichnenderweise gerade im Umfeld der unmittelbaren Heidegger-Schule grundsätzlich thematisiert: so im Ansatz der „Para-Existentialien“ und mit der Unterscheidung von „Dasein“ und „Dawesen“ bei Oskar Becker22, in Gerhard Krügers Reflexion der menschlichen Leibgebundenheit23, in Karl Löwiths Rekurs auf die immer gleiche, zyklische Natur24, in Hannah Arendts Ersetzung der „Geworfenheit“ durch die „Geborenheit“ (Natalität)25, schließlich sehr wirksam in Hans Jonas’ Ansätzen zu einer philosophischen Biologie in Organismus und Freiheit sowie in seinen späteren Hauptwerken zum Zusammenhang von Metaphysik, Ökologie und Ethik mit der Entwicklung des Prinzips Verantwortung26. In der an Husserl anknüpfenden Schule der Phänomenologie und in der Neuen Phänomenologie rückten Leiblichkeit und Sinnlichkeit ins Zentrum der Analysen.27 Eine weitere Bedingung der Möglichkeit, sein „Da“ sein zu können, ist sicherlich neben der Jemeinigkeit das Mitsein mit Anderen.28 Denn die Einheits- und Identitätskonstitution im Werden des Einzelnen zu sich selbst ist unvorstellbar ohne die konstitutiven Modi der sozialen Interaktion. In der Sexualität und Natalität durchdringen sich unser kommunikatives Wesen und unser naturaler Grund; erst in der interexistenziellen Differenz vermag sich auch so etwas wie ein – uneigentliches wie eigentliches – Selbstverständnis zu konstituieren – und dies nicht nur im empirisch-genetischen Sinne.29 Die These von der monoprinzipiellen transzendentalen Vorgängigkeit des zeitlichen Konstitutionsgrundes im Sinne eines ontologischen Ursprungs wäre dann im Sinne einer polyprinzipiellen Konstitutionsanalyse zu modifizieren. Und: Heideggers eigene Existenzialanalysen geben dafür sogar selbst viele systematische Anschlußmöglichkeiten, wenn die Fundierungsordnung komplexer und weniger schematisch-hierarchisch gedacht wird. Die „Einheitsstiftung“ geschieht sprachlich, zeitlich, räumlich, sozial, leiblich und natürlich „zugleich“.30 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Becker 1963. Krüger 1958. Löwith 1984. Arendt 1958. Jonas 1973 und 1979. Exemplarisch zu nennen sind v. a. Merleau-Ponty 1945 sowie Schmitz 1964 und 1990. So schon grundlegend Löwith 1928. Vgl. dazu meine Analysen in Rentsch 1999. Vgl. dazu Rentsch 1985.
216
Thomas Rentsch
In den einleitenden Passagen des § 69 begegnet auch bereits ein Grundwort der späteren Philosophie (bzw. des „Seinsdenkens“) Heideggers: das Wort „Lichtung“ (bereits § 28, 133). Das nicht „ontisch vorhandene“ Licht dieser Gelichtetheit wird zunächst „als Sorge bestimmt“ (350). Da aber gemäß der Fundierungsthese die Sorge ihren ermöglichenden Grund in der Zeitlichkeit hat, gilt: „Die ekstatische Zeitlichkeit lichtet das Da ursprünglich“ (351). (Bereits hier deutet sich mithin die spätere Lichtmetaphorik der Seinsgeschichte an.) Neben der Lichtmetaphorik für die ontologische bzw. transzendental-existenziale Ursprungsebene verwendet Heidegger auch die Metapher der „Verwurzelung des Da-seins in der Zeitlichkeit“ (351). Im „Hintergrund“ leitend bei der Fundierungskonzeption war und ist die „Frage nach dem Grunde der möglichen Einheit […] des In-der-Welt-seins“, die gegen die „verhängnisvollsten Zersplitterungstendenzen“ geschützt werden soll (351). Die vorblickende programmatische Entfaltung von § 69 nennt die Themen der Zeitlichkeit des Besorgens (§ 69a), der existenzialen Genese der Wissenschaft (§ 69b) und die Frage nach der Möglichkeit einer Welt überhaupt in Einheit mit dem Dasein – die Frage nach der Transzendenz der Welt (§ 69c).
10.2.1 Die Zeitlichkeit des Besorgens Im Blick auf das umsichtige Besorgen entfaltet Heidegger zunächst einen primären Holismus: Weder aus dem Zuhandenen, noch aus dem Besorgen, noch aus beiden als „zusammen vorhanden“ läßt sich das Sein bei Zuhandenem „ontisch erklären“ (352). Es gibt kein einzelnes Zeug, sondern immer einen „Zeugzusammenhang“. Der Zeitlichkeit des umsichtigen Besorgens nähert sich Heidegger über das Bewendenlassen. Denn der Zeugzusammenhang einer „erschlossenen Werkwelt“ bildet eine „Bewandtnisganzheit“. Denken wir zum Beispiel an eine Autowerkstatt, an ein großes „Werk“, zum Beispiel ein Stahlwerk oder ein Atomkraftwerk: Jeweils sind kleinere und kleinste Funktionseinheiten (Schlüssel, Hebevorrichtungen, Kühlaggregate, Schalter und Lichtsignale) in die Bewandtnisganzheit des Gesamtprojekts funktional einbezogen. Pragmatisch denkt Heidegger das umsichtig-entdeckende Sein-bei des Besorgens als ein „verstehendes Entwerfen von Bewandtnis“ (353). Die Handhabung eines Werkzeugs hat ein Wozu, ein Wobei und ein Womit; so zum Beispiel der Gebrauch einer Brille oder eines Schreibgeräts. Der Gebrauch geschieht unauffällig und unthematisch. Das Zutunhaben mit Instrumenten, das Funktionierenlassen
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
217
der Werkzeuge im tätigen Handhaben hat die zeitliche Struktur des „gewärtig-behaltenden Gegenwärtigens“. Sie geht mit einer Selbstvergessenheit des Hantierenden einher. Diese Analyse könnte man als zu konkretistisch und subjektivistisch auffassen. Denn der Gebrauch großer Anlagen und Werke in der gesellschaftlich verfaßten Praxis ist schon aus strukturellen institutionellen und rechtlichen Gründen „selbstvergessen“ nicht möglich. Auch ein kleiner Handwerksbetrieb kann ohne Überlegung, Planung und eine die Einzeltätigkeiten übergreifende Konzeption nicht funktionieren. Der Sinn der Bewandtnisganzheiten und des Holismus endet nicht bei technisch-instrumentellen Zusammenhängen, sondern ist tief eingearbeitet in die Zusammenhänge menschlicher Zwecksetzungen, sozialer Sinnentwürfe und konkreter Sittlichkeiten. Sie lassen sich letztlich vor- und außerethisch nicht denken. Insofern stellt die Fundierung in der endlichen Zeitlichkeit eine formalistische Engführung der existenzialen Analytik dar. Das ontologische Interesse an einer vorgängigen „Einheit“ saugt in Form der Zeitanalyse die inhaltlicheren Bestimmungen einer menschlichen Praxis in sich auf. Auf dem Hintergrund der Zeitanalysen des umsichtigen Besorgens, die an die §§ 14–18 anknüpfen, charakterisiert Heidegger kurz einige Störphänomene des funktionierenden Bewendenlassens: Vermissen, Überraschtwerden, Vergessen, „Unbehalten“, Ungeeignetheit und Widerständigkeit (355 f.). Die gesamte Analyse läßt sich konstitutionstheoretisch als „Existenzialpragmatik“ bezeichnen, sie läßt sich in die Nähe der Gebrauchsanalysen des späten Wittgenstein zur Bedeutungskonstitution rücken.31 In den Analysen Heideggers zum Hantieren, zum Zuhandenen und Vorhandenen ist indirekt immer auch von der lebendigen, menschlichen Hand die Rede.32 Die menschliche Leiblichkeit wird in den Analysen aber ausgeklammert.
10.2.2 Das wissenschaftliche Weltverhältnis Der Abschnitt 69b enthält in nuce Heideggers spätere Theorie des (natur) wissenschaftlichen Weltverhältnisses. Man sieht hier wieder, wie Heidegger die Frage nach dem Ursprung der Theorie, der „ontologischen
31 Siehe dazu meinen Entwurf einer existenzialen Grammatik in Rentsch 1985, 254–321. 32 Siehe Franck 1986; vgl. dazu: Rentsch 1989b, dort 278 f.
218
Thomas Rentsch
Genesis“, mit der Frage nach der transzendentalen Konstitution der Theorie, nach den „in der Seinsverfassung des Daseins liegenden, existenzial notwendigen Bedingungen der Möglichkeit dafür, daß das Dasein in der Weise wissenschaftlicher Forschung existieren kann“ (357), kontaminiert. Ein Stück weit läßt sich seine Analyse allerdings präzise rekonstruieren.33 Zunächst wendet sich Heidegger gegen übliche Vorstellungen des Verhältnisses von „Theorie“ und „Praxis“. Gemäß ihnen wurde seit der Antike eine bloß betrachtende, kontemplative Theorie als Privation und „Verschwinden der Praxis“ (357) aufgefaßt. Das ist viel zu einfach gedacht: Für das vermeintlich „bloße Sehen“ und Betrachten der Wissenschaften sind nämlich in Wahrheit eine Vielzahl von Tätigkeiten erforderlich und charakteristisch. So zum Beispiel das Ablesen von Meßergebnissen eines Experiments, das aktive, konzentrierte Beobachten von Präparaten unter dem Mikroskop, archäologische Ausgrabungen, bereits das Hantieren mit Schreibzeug (358). Systematisch subtil ist Heideggers spezifische Strategie der Destruktion eines „theoretizistischen“ Wissenschaftsverständnisses. Er geht nämlich zum Schein bewußt auf die ontologische Prämisse vom Primat des „Sehens“, der Anschauung bzw. des intuitus ein, wie sie seit der Antike und über Kant bis zu Husserl für die Erkenntnistheorie leitend und systembildend war (358). Diesem theoriekonstitutiven „Sehen“ liegt aber gemäß Heideggers vorangegangenen Analysen die Umsicht zugrunde, „die das ,praktische‘ Besorgen führt“ (358). Das heißt: Gerade das Sehen ist in alltäglichen Kontexten bereits ein verstehendes Auslegen von „Bewandtnisbezügen des zuhandenen Zeugzusammenhangs“ (359). Ich sehe zum Beispiel die Größe eines Schriftstücks, das ich auf die Post geben will. Dementsprechend hole ich einen dafür geeigneten Umschlag. An diesem instrumentellen Handlungszusammenhang lassen sich die von Heidegger erläuterten Aspekte der Umsicht, der Übersicht, der Näherung, Überlegung und (pragmatischen) Gegenwärtigung aufweisen. Den Kern der existenzialen, temporalen und transzendentalpragmatischen Konstitutionsanalyse bildet die These: „Das Schema ,etwas als etwas‘ ist schon in der Struktur des vorprädikativen Verstehens vorgezeichnet“ (359). Wie ist nun die „Modifikation“ bzw. der „Umschlag“ von der besorgenden Umsicht des „Zuhandenen“ zum theoretischen Entdecken des „Vorhandenen“ genauer zu denken? Heideggers bisherige Antwort lautete: Die ontologische Genesis (und damit die spezifische Sinnkonstitution der „Theorie“ genannten Sonder33 Vgl. zum folgenden Gethmann 1993, 169–206.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
219
praxis des besorgenden In-der-Welt-seins) vollzieht sich durch Störungen. Ein beabsichtigter Gebrauch wird gestört, wenn das Werkzeug „kaputt“ ist (§§ 15–17: „Auffälligkeit“), wenn es „weg“ ist oder vermißt wird (§§ 15– 17: „Aufdringlichkeit“, „ratloses Davorstehen“) bzw. wenn es gewissermaßen „aktiv“ stört – wenn zum Beispiel der Füller kleckst oder der Schuh drückt (§§ 15–17: „Aufsässigkeit“). Auch im vorliegenden Text geschieht der „Umschlag“ vom „hermeneutischen Als“ der verstehenden Auslegung zum „apophantischen Als“ der Prädikation durch eine die Aufmerksamkeit wachrufende Störung. Zunächst wird ein Hammer fraglos gebraucht. Es stellt sich heraus: Der Hammer ist zu schwer – ungeeignet für den Gebrauch. Damit wird der Übergang zur prädikativen Aussage: „Der Hammer ist schwer“ möglich. „Das Seinsverständnis (…) hat umgeschlagen“. Denn der Hammer wird nun „neu“ angesehen „als Vorhandenes“ (361). Die Prädikation ist abkünftig vom vorprädikativen „als“ des Gebrauchsverstehens, welches selbst wiederum im „Gegenwärtigen“ der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit gründet (360). Mit dieser prädikativen Herauslösung des zuhandenen Zeugs aus dem für es im Gebrauch zunächst sinnkonstitutiven Bewandtniszusammenhangs verliert das Zeug seinen „Platz“ und wird doch neu verortet: In der Konsequenz kann der spezifische Seinsentwurf der „mathematischen Physik“ die „Natur selbst“ als „All des Vorhandenen“ entdecken (362). Erst im Kontext dieses ganz speziellen, aus der Sorge abkünftigen, derivativen Entwurfs entsteht überhaupt so etwas wie eine wissenschaftliche „Tatsache“. Das wissenschaftskritische und auch philosophiekritische Potential dieser Konstitutionsanalyse liegt auf der Hand: Weder ist die „Objektivität“ der mathematischen Naturwissenschaften so etwas wie ein privilegierter Zugang zu einer „Wirklichkeit an sich“; sie ist vielmehr eine reduktive (reduktionistische) Sonderpraxis, die Seiende jeweils aus ihren Kontexten und Bewandtnisganzheiten herauslöst, objektivierend meßbar macht und so „nivelliert“. Noch ist die in Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit von Descartes über Kant bis zu Husserl vertretene Grundauffassung vom Primat der Wahrnehmung für die Fundierung von Erkenntnis und Wissenschaft aufrechtzuerhalten; die existentialpragmatische Analyse der ontologischen Genesis des Sehens eines bloß Vorhandenen zeigt vielmehr: „Wahrnehmung“ ist ein spätes Konstrukt, und die Fundierungsordnung muß gleichsam umgekehrt, vom Kopf (Wahrnehmung eines einzelnen Körperdings durch ein isoliertes Einzelsubjekt im luftleeren Raum reinen Erkennens) auf die Füße (pragmatische Sinnkonstitution im tätigen Gebrauch im Licht der öffentlichen Erschlossenheit eines Bewandtniszusammenhangs) gestellt werden.
220
Thomas Rentsch
10.2.3 Die Transzendenz der Welt Die Analysen von § 69b hatten die Prädikation als abkünftig vom vorprädikativen Verstehen erwiesen; die (hermeneutische) Als-Struktur wurde in der Zeitlichkeit gegründet. Aus dem transzendentalen Schematismus der Kritik der reinen Vernunft Kants entwickelt Heidegger einen existenzialzeitlich fundierten Verstehens- und Sprachschematismus der Bedeutsamkeit der Weltlichkeit der Welt. Mit dieser systematischen Entwicklung sind Fragen, Probleme und Aporien verbunden, die im § 69c besonders eindrücklich zutage treten. Denn einerseits wurde permanent auf der Zeitlichkeit als dem letzten Fundierungsgrund insistiert; zum anderen wird nun die Frage nach der ontologischen Möglichkeitsbedingung der Welt explizit gestellt: „Wie ist so etwas wie Welt in seiner Einheit mit dem Dasein ontologisch möglich? In welcher Weise muß Welt sein, damit das Dasein als In-der-Welt-sein existieren kann?“ (364). Zunächst könnten Heideggers Feststellungen als Rückkehr zu Grundauffassungen einer transzendentalen Subjektphilosophie verstanden werden. Das, worin Dasein ist – die Welt –, „das ist mit seiner faktischen Existenz ,da‘“. Dieses „Worinnen (…) hat die Seinsart des Daseins. Dieses ist existierend seine Welt“ (364). Und bewußt affirmiert Heidegger zum Schluß des § 69c die Assoziation des Lesers, das transzendentale Subjekt der Tradition erlebe hier eine Auferstehung: Denn, „wenn das ,Subjekt‘ (…) als (…) Dasein begriffen wird, dann muß gesagt werden: Welt ist ,subjektiv‘“ (366). Heidegger beteuert allerdings umgehend, diese „subjektive“ Welt sei „als zeitlichtranszendente ,objektiver‘ als jedes mögliche ,Objekt‘“. Ich kann nicht erkennen, wie diese rhetorischen Überbietungsformeln den konstatierten Subjektivismus sollen entproblematisieren können. Das Dasein ist existierend seine Welt – damit wird die existenziale Jemeinigkeit vorangegangener Analysen auf den Weltbegriff ausgedehnt. Die Jemeinigkeit läßt sich noch als eine „intersubjektive“ Variante des klassischen Solipsismus verstehen – nicht unähnlich der Leibnizschen Monadologie.34 Zwar ist jedes einzelne Dasein „seine“ Welt – aber dies gilt für alle Existierende, die ihr Da sind und zu sein haben. Wie aber verhält sich diese existenzial-transzendentale „Subjektivität“ zur „intersubjektiven“, öffentlichen Erschlossenheit der
34 Auch Wittgenstein lehrt: „Die Welt und das Leben sind eins.“ „Ich bin meine Welt.“ (Tractatus 5.621 und 5.63), „Was der Solipsismus nämlich meint, ist ganz richtig, nur läßt es sich nicht sagen, sondern es zeigt sich.“ (Tractatus 5.62). Vgl. zu einem „intersubjektiven Solipsismus“ bei Heidegger und auch beim späten Wittgenstein meine Analysen, in: Rentsch 1985, 233 ff.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
221
Lebenssituationen zum Beispiel durch Verstehen und Rede? Eine primär gemeinsame, öffentliche, vorgängig gesellschaftlich-geschichtliche, interagierende und kulturell konstituierte Welt, schlicht gesagt: die Welt, scheint für „meine“ Welt „fundierend“ zu fungieren. Ohne solche Überlegungen an dieser Stelle einzubeziehen, hält Heidegger vielmehr daran fest, die gleichsam anonyme Zeitigung der Zeitlichkeit gründe und konstituiere allererst die Sorge, das Dasein und dessen In-derWelt-sein. Der Kern seiner systematischen Argumentation besteht nun darin, den dreifaltigen Zeitekstasen ihnen entsprechende horizontale Schemata der Welt zuzuordnen. Die ekstatische Einheit der Zeitlichkeit hat „so etwas wie einen Horizont“ (365). Bereits bei Kant hatte der transzendentale Schematismus die Funktion der Vermittlung von Verstand und Sinnlichkeit: die reinen Kategorien werden durch die transzendentalen Schemata zu anwendbaren kategorialen Regeln. Einerseits ist jedes Schema als Regel eine rein logische, apriorische Relation; andererseits hat es als zeitliche Struktur ebenso eine Anwendung auf die Sinnlichkeit. So versucht Kant erkenntniskritisch, die gemeinsame Denkbarkeit von Subjekt und Welt, Bewußtsein und Materie zu rekonstruieren.35 Heideggers analoger Versuch ordnet zunächst jeder Zeitekstase ein „horizontales Schema“ zu: Ekstasen
Schemata
Zukünftig(keit)
Umwillen seiner
Gewesenheit
Wovor / Woran
Gegenwart
Um-zu
Die horizontalen Schemata werden auch als „,Wohin‘ der Entrückung“ der Ekstasen bezeichnet (365). Kritisch kann gefragt werden, welcher Status den Schemata über den zeitlichen Orientierungskontext aller Lebensvollzüge hinaus zukommt. Wirken sie nicht wie quasi-räumliche („Horizont“) Verdopplungen der Zeitekstasen? Es gilt: „auf dem Grunde der horizontalen Verfassung der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit gehört zum Seienden, das je sein Da ist, so etwas wie erschlossene Welt. […] Sofern Dasein sich zeitigt, ist auch eine Welt […] Die Welt ist weder vorhanden noch zuhanden, sondern zeitigt sich in der Zeitlichkeit“ (365). So hat es
35 Heidegger bezieht sich bereits zu Beginn von Sein und Zeit programmatisch auf die Schematismuslehre Kants; vgl. 23 f. Vgl. zum Thema auch Köhler 1993.
222
Thomas Rentsch
den Anschein, als würde die Welt – nicht nur je meine (subjektive) Perspektive auf sie! – zu einer Verdopplung der daseins-ermöglichenden ekstatischen Zeitigung der Zeitlichkeit. Die existenziale Zeitlichkeit des je einzelnen Daseins scheint so alles übrige für eine menschliche Welt ebenfalls Konstitutive (das Mitsein, die Sprache/Rede, die Leiblichkeit, die Räumlichkeit, die „Natur“) in sich aufzusaugen – wie ein zur ganzen Welt ausgeweiteter existenzialer Solipsismus. Umgekehrt könnte man – mit Wittgenstein und/oder mit ethnologischen Befunden – dafür argumentieren, daß auch unsere jeweiligen Zeitvorstellungen sich der pragmatisch-kommunikativen Konstitution in einer gemeinsamen, gesellschaftlich-geschichtlichen Lebenspraxis verdanken. Heidegger aber konstatiert: „Wenn kein Dasein existiert, ist auch keine Welt ,da‘“ (365). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren: Hier erfolgt eine Art Metasubjektivierung als Temporalisierung, die an einen zeitlich-existenzialisierten Fichteanismus bzw. an einen temporalisierten und damit formalistisch entleerten Hypercartesianismus erinnert.36 Läßt sich dennoch ein systematisch tragfähiges Verständnis der vorliegenden Passagen gewinnen? Während Kants Konstitutionsanalyse die ermöglichende Form der verstandesmäßigen Erkenntnis von Gegenständen überhaupt durch das Erkenntnissubjekt betrifft, setzt Heidegger das vorgängige In-der-Welt-sein an. Während in Heideggers Sicht die Kantschen Schemata Strukturen sind, die zwischen den ansonsten als ontologisch selbständig gedachten „Subjekt“ und „Gegenstand“ allererst vermitteln, sind „Dasein“ und „Welt“ bei Heidegger von vornherein „gleichursprünglich“ konzipiert. Die „Transzendenz“ der Welt und ineins die „Transzendenz“ des Daseins in der Zeitlichkeit zu gründen, könnte weniger „subjektivistisch“ verstanden werden, wenn wir den Sinn der Rede von der Zeitigung der Zeitlichkeit deutlich in Richtung der auch praktisch für eine menschliche Welt konstitutiven Endlichkeit interpretieren: „Der Zeitigungsmodus des ,Entspringens‘ der Gegenwart gründet im Wesen der Zeitlichkeit, die endlich ist“ (348). Daß wir es in allen menschlichen Handlungs- und Orientierungszusammenhängen mit endlichen Vollzügen zu tun haben, läßt sich pragmatisch, erkenntnis- und sinnkritisch als Voraussetzung wie auch als Notwendigkeit des jeweiligen Überschreitens, des „Transzendierens“ aller uns möglicher – selbst endlicher –
36 Vgl. zu dieser Kritik: Rentsch 2000, 33–45. Vgl. zur kritischen Würdigung von Heideggers Zeitanalysen: Fleischer 1991. Auch Fleischer problematisiert treffend sowohl die Fundierung der Sorge in der Zeit als auch die schematische Handhabung der Ekstasen zur Interpretation lebensweltlicher Phänomene. Vgl. zur Kritik an Heideggers temporalisiertem Idealismus in der Tradition von Plotin, Leibniz und Kant nunmehr ferner Blattner 1999.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
223
Handlungen, Erkenntnisse und Orientierungen verstehen. Alles Überschreiten ist selbst nur endlich möglich. Nicht „die Zeitigung der Zeitlichkeit“ als gleichsam anonyme, aktivistisch beschriebene Instanz eigenen Rechts wäre Kern und Wahrheit der Zeitanalysen Heideggers, sondern die sinnkonstitutive Endlichkeit allen menschlichen Handelns und Erkennens. Noch kürzer: Nicht die menschliche Zeitlichkeit und die mit ihr möglich werdende Weltkonstitution ist „subjektiv“, sondern alle Subjektivität und jedes mögliche Selbst- und Weltverhältnis sind im Kern und im Wesen endlich.
10.3 Die Zeitlichkeit der daseinsmäßigen Räumlichkeit (§ 70) Bereits D. Franck hat Heideggers Versuch, die Räumlichkeit des Daseins auf die existenziale Zeitlichkeit zurückzuführen, als aporetisch kritisiert.37 In Zeit und Sein hat Heidegger selbst den § 70 von Sein und Zeit als „unhaltbar“ revoziert: Dem Raum könne nicht primär ein zeitlicher Sinn zugewiesen werden.38 Im vorliegenden Text erwägt Heidegger durchaus eine naheliegende „Nebenordnung“ von Zeit und Raum (367). Außerdem wehrt er die systematische Tendenz ab, „den Raum aus der Zeit zu deduzieren, bzw. in pure Zeit aufzulösen“ (ebd.). Er grenzt sich auch explizit gegen Kant ab, der ja den konstitutionstheoretischen Primat der Zeit als der Form des inneren (und damit auch äußeren) Sinnes vor dem Raum als Form des äußeren Sinnes vertreten hatte. Dem gegenüber gilt, daß Dasein „nie (…) im Raum vorhanden“ ist, sondern existierend „je schon einen Spielraum eingeräumt“ hat (368).39 Daß Menschen in ihrem Im-Raum-sein völlig verschieden sind von vorhandenen Gegenständen und „ausgedehnten Körperding(en)“ (ebd.), scheint intuitiv klar zu sein. Aber worin gründet diese Verschiedenheit? Heidegger unternimmt erste Schritte zu einer phänomenologischen Erfassung der existenzialen Räumlichkeit, des „Sicheinräumens“ des Daseins, wenn er den lebensweltlichen Orientierungsraum mit den spezifischen Erstreckungsmodi der Gegend und des Sich-Näherns als „Ent-fernen“ beschreibt.
37 Vgl. Anm. 32. 38 Zeit und Sein, in Heidegger 1969, 1–25 und das aufschlußreiche Seminar-Protokoll, ebd., 27–60. 39 Das spätere Denken Heideggers knüpft hier – den Raum aufwertend – an, wenn vom „ZeitSpiel-Raum“ des „Ereignisses“ die Rede ist; vgl. GA 65, 371–388.
224
Thomas Rentsch
Und dennoch behauptet der vorliegende Text im Sinne der zeitlichen Fundierungsordnung: „Nur auf dem Grund der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit ist der Einbruch des Daseins in den Raum möglich. Die Welt ist nicht im Raum vorhanden“ (369). Es war Francks kritische These, daß bereits der in Sein und Zeit beschriebene Raum der zuhandenen und vorhandenen Zeugzusammenhänge bzw. Dinge einen anderen Raum voraussetzt: denjenigen der Hand selbst, und mithin den lebendigen Leib. Die Konstitution der Hand und des lebendigen Leibes, auf die die Zuhandenheit zurückverweist, kann aber keinen primär zeitlichen Sinn haben. Der Grund für die Unhaltbarkeit der Räumlichkeitsanalysen von § 70 besteht darin, daß der leiblich erschlossene lebensweltliche Orientierungsraum allen anderen Räumlichkeiten pragmatisch und methodisch vorausliegt. Demgegenüber erhält man in Sein und Zeit den Eindruck: Das in den Tod vorlaufende Dasein hat keinen Leib, sondern besteht aus Zeit.
10.4 Der zeitliche Sinn der Alltäglichkeit des Daseins (§ 71) „Alltäglichkeit“ war einer der ersten innovativen Grundbegriffe, die Heidegger als Existenzial einführte (§ 9). Die Ebene des „zunächst und zumeist“ Üblichen, Bekannten, Vertrauten und so „Selbstverständlichen“ wurde methodisch bewußt als Ausgangspunkt der Analyse gewählt. Die Zeitlichkeit der Alltäglichkeit ist die zeitliche Form des geregelten Gangs der Dinge, der Erwartbarkeiten und Gewohnheiten. Heidegger weist auf die Rätselhaftigkeit des Sinns dieser zeitlichen „Erstreckung“ des alltäglichen Daseins hin. Die Fundierungsordnung wird nochmals akzentuiert, denn „mit dem Titel Alltäglichkeit (ist) im Grunde nichts anderes gemeint (…) als die Zeitlichkeit“, die „das Sein des Daseins ermöglicht“ (371 f.). Systematisches Fazit und Ausblick Betrachten wir die anfangs gestellten drei Leitfragen nach der Fundierungsordnung, nach der Gleichursprünglichkeit und nach der Transzendenz der Welt kurz im Rückblick auf unsere Kommentierung.40 40 Daß diese systematischen Anschlußprobleme sich Heidegger nach der Veröffentlichung von Sein und Zeit in der Tat stellten, zeigt der Beitrag von Th. Kisiel in diesem Band detailliert auf. Vgl. auch die Hinweise bei Fleischer 1991, 7 ff.
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
225
Das Problem der Fundierungsordnung verweist auf das ungeklärte Verhältnis von (transzendentalphilosophisch oder phänomenologisch gedachter) „Konstitution“ versus ontisch-ontologisch konzipiertem „Ursprung“. Es verweist so auch auf die in Sein und Zeit nicht explizit reflektierte Struktur des methodischen Aufbaus der Analysen. Wir hatten den Aufbau im Ansatz vierstufig rekonstruiert. Die wiederkehrenden metaphorisch-methodologischen Aussagen bzw. Feststellungen Heideggers, die existenzial-ontologische Analytik sei letztlich existentiell-ontisch „verwurzelt“, scheinen mir in ihrer Ungenauigkeit der Wahrheit näherzukommen als die oft verwendeten, scheinbar ausgewiesenen Fundierungsbehauptungen der Art: die Sorge „gründe“ in der „ursprünglichen“ Zeitlichkeit, die Zeitlichkeit sei „ursprünglicher“ als die Weltlichkeit, die Räumlichkeit oder die Rede. Die präzisen Konstitutionsfeststellungen haben etwas Ungedecktes, während die „ungenaue“ hermeneutische Zirkularitätsaussage insbesondere im Verbund mit der reflektierten Rede von der Gleichursprünglichkeit wie auch mit der in § 71 noch einmal gedanklich umkreisten, rätselhaft bleibenden, obstinaten Omnipräsenz der durchschnittlichen Alltäglichkeit einen Weg aus der methodischen Aporetik weist, der anders ist, als Heideggers spätere Wege und anders als die losen Enden von Sein und Zeit. Je stärker Heidegger die von ihm gesetzte Fundierungsordnung akzentuiert, ohne sie selbst näher zu begründen, desto mehr kommt es in seinen Analysen unter der Hand zu einer Wiederkehr des Verdrängten: zu einer Auferstehung der transzendentalen Subjektivität als einer Art Ursprung der Welt in § 69c und zu einer Substantialisierung der Zeitlichkeit bzw. der ekstatischen Zeitigung der Zeitlichkeit, die wie ein handelndes QuasiSubjekt beschrieben wird. Der methodologische Monoprinzipialismus der Fundierungsordnung schlägt vor dem Abbruch von Sein und Zeit somit tendenziell in ein ontologisches Ursprungsdenken um. Die monoprinzipielle Auszeichnung der Zeitlichkeitsanalysen wirkt sich auf die gesamte Existenzialanalyse aus. Ihr formal-strukturelles Gepräge ist dazu geeignet, inhaltliche, konkrete und materiale Aspekte der Konstitution des menschlichen In-der-Welt-seins auszublenden. Wir sahen dies am Fall der Leiblichkeit bzw. der „lebendigen Hand“ (Franck 1986). Heidegger hat die ursprungstheoretische Monoprinzipialität seiner Zeitanalysen indirekt selbst kritisiert, indem er seine Ableitung der Räumlichkeit aus der ursprünglichen Zeitlichkeit später zurückwies. Die Stärke noch des Scheiterns bzw. des aporetischen Abbruchs von Sein und Zeit besteht darin, überall in Form loser Enden Anknüpfungsmöglichkeiten offen zu lassen, die gegen die Engführungen der Analyse produk-
226
Thomas Rentsch
tiv gewendet und weitergeführt werden können. Da ist der Ansatz des Reflexivwerdens der gesamten Analyse selbst durch die Thematisierung des Verstehens; da ist die Einführung des systematischen Aspekts der Gleichursprünglichkeit, der viel eher ein Nebeneinander komplexer Konstitutionsaspekte, eine bewegliche Ordnung denn ein starres Ableitungs- und Fundierungsgefüge gestattet hätte. Da ist der Ansatz eines Gradualismus zum Beispiel im Blick auf Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, der befreiend in die Richtung einer Überwindung dualistischer (und damit subjektivistisch-dezisionistische Deutungen begünstigender) Vorstellungen von der Weltkonstitution weist. Da ist die Auszeichnung der Rede als des Ortes der Artikulation und damit der Selbstreflexivität des In-derWelt-seins, die es gestattet hätte, schon in der durchschnittlichen Alltäglichkeit auch die Formen des entwerfenden Sich-zu-sich-Verhaltens als selbstbewußte Modi der Distanz, Thematisierung und Infragestellung der Strukturen der Faktizität anzusetzen. Von diesen systematisch weiterführenden, in Sein und Zeit nicht ausbuchstabierten Ansätzen aus fiele ein Licht auch auf weitere Probleme der kommentierten Abschnitte. Sie lassen sich in abschließenden Fragen so formulieren: Wie ist das „Ineinander“ der Zeitekstasen näherhin zu denken? Wie läßt sich das „Ineinander“ der Zeitlichkeit des Verstehens, der Befindlichkeit und des Verfallens präzisieren (§ 68b)? Ferner: Wie ist eigentliche Gegenwart zu denken? Wie verhält sich der „Augenblick“ zum Beispiel zum Mitsein, und wie zu den eigentlichkeitskonstitutiven Aspekten der Rede, die wir herausgestellt haben (§ 68d)? Eine weitere kritische Nachfrage betrifft das Verhältnis der Existenzialanalyse der Zeitlichkeit zur Ontologie der Welt. Auf den „Hypercartesianismus“ des § 69c wurde hingewiesen. Der konstitutionsanalytische Primat der Zeitlichkeit führt nicht nur zu einer Unterbestimmung der Räumlichkeit und der Leiblichkeit, sondern auch zum Problem des zeitanalytischen Zugangs zur Transzendenz der Welt. Angesichts dieser monoprinzipialistischen Engführung der Analyse und ihrer Aporien drängt sich als systematischer Ausweg eine Verbreiterung von deren Basis geradezu auf. Im Verbund mit den existenzialanalytisch thematisierten Konstitutionsaspekten des Mitseins, der Räumlichkeit und der Rede sowie der methodisch durchaus gegen ursprungsontologische Vorstellungen geltend zu machenden Gleichursprünglichkeit verdient daher gerade der § 71 mit seinem kryptischen, fragenden Duktus noch einmal besondere Aufmerksamkeit. Die Frage nach dem „zeitlichen Sinn der Alltäglichkeit des Daseins“ führt hier einerseits zur Frage nach dem „ontologischen Sinn der Alltäglichkeit als solcher“ (371). Andererseits wird Heidegger zufolge „mit dem Titel All-
10 Zeitlichkeit und Alltäglichkeit
227
täglichkeit im Grunde nichts anderes gemeint […] als die Zeitlichkeit“ (371 f.). Da „diese aber das Sein des Daseins ermöglicht, kann die zureichende begriffliche Umgrenzung der Alltäglichkeit erst im Rahmen der grundsätzlichen Erörterung des Sinnes von Sein überhaupt und seiner möglichen Abhandlungen gelingen“ (372). Heidegger selbst hat in der späteren Entwicklung seines Denkens dem „Ereignis“ des Seins und der Sprache eine ausgezeichnete Bedeutung eingeräumt. Das in Sein und Zeit letztlich offen bleibende Verhältnis von Alltäglichkeit und Zeitlichkeit verweist ebenso wie der ungeklärte Status der Analysen im Spannungsfeld von „Konstitution“ und „Ursprung“ auch auf die Möglichkeit, die Ansätze von Sein und Zeit in Richtung auf eine kritische Hermeneutik unserer Alltagssprache und der damit verbundenen Lebenspraxis weiterzuführen. Im Sinne der nach meinem Urteil konstitutiven Gleichursprünglichkeit von Dasein und Mitsein, Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Leiblichkeit, Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit sowie der ausgezeichneten Bedeutung der Rede und der sprachlichen Erschlossenheit gelangte man so zu einer Konstitutionsanalyse, die der ganzen Komplexität unseres In-der-Welt-Seins gerecht werden könnte, deren paradigmatische Analysen eher im Verhältnis eines Nebeneinander als im Verhältnis von Über- oder Unterordnung stünden und die ihrer konstitutiven Selbstreflexivität methodisch ebenso Rechnung trüge wie ihren normativpraktischen, ethischen Implikationen, unter Absehung von denen sich kein „Sinn von Sein“ wird explizieren lassen.
228
Thomas Rentsch
Literatur Arendt, H. 1958: The human condition, Chicago (dt: Vita activa oder vom tätigen Leben, Stuttgart 1960) Becker, O. 1963: Dasein und Dawesen. Gesammelte philosophische Aufsätze, Pfullingen Blattner, W. D. 1999: Heidegger’s Temporal Idealism, Cambridge Blumenberg, H. 1973: Der Prozeß der theoretischen Neugierde, Frankfurt a. M. Fleischer, M. 1991: Die Zeitanalysen in Heideggers „Sein und Zeit“. Aporien, Probleme und ein Ausblick, Würzburg Franck, D. 1986: Heidegger et le problème de l’espace, Paris Gethmann, C.-F. 1993: Der existenziale Begriff der Wissenschaft. Zu Sein und Zeit, § 69b, in ders.: Dasein: Erkennen und Handeln. Heidegger im phänomenologischen Kontext, Berlin/ New York, 169–206 Greisch, J. 1994: Ontologie et temporalité, Paris Jonas, H. 1963: Gnosis, Existentialismus und Nihilismus, in ders.: Zwischen Nichts und Ewigkeit. Zur Lehre vom Menschen, Göttingen 21987 Jonas, H. 1973: Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Göttingen Jonas, H. 1979: Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a. M. Köhler, D. 1993: Martin Heidegger. Die Schematisierung des Seinssinnes als Thematik des dritten Abschnittes von „Sein und Zeit“, Bonn Krüger, G. 1958: Grundfragen der Philosophie. Geschichte, Wahrheit, Wissenschaft, Frankfurt a. M. 21965 Löwith, K. 1928: Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Ein Beitrag zur anthropologischen Grundlegung der ethischen Probleme, München Löwith, K. 1984: Zu Heideggers Seinsfrage: Die Natur des Menschen und die Welt der Natur (1969), in ders.: Heidegger – Denker in dürftiger Zeit. Zur Stellung der Philosophie im 20. Jahrhundert (Sämtliche Schriften Bd. 8), Stuttgart, 276 –289 Luckner, A. 1997: Martin Heidegger: „Sein und Zeit“. Ein einführender Kommentar, Paderborn u. a. Merleau-Ponty, M. 1945: Phénoménologie de la perception, Paris (dt. Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966) Rentsch, Th. 1985: Heidegger und Wittgenstein. Existential- und Sprachanalysen zu den Grundlagen philosophischer Anthropologie, Stuttgart Rentsch, Th. 1989a: Martin Heidegger – Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung, München Rentsch, Th. 1989b: Martin Heideggers 100. Geburtstag: Profile der internationalen Diskussion, in: Philos. Rundschau (36), 257–290 Rentsch, Th. 1999: Die Konstitution der Moralität. Transzendentale Anthropologie und praktische Philosophie, Frankfurt a. M., 2. Aufl. Schmitz, H. 1964: : System der Philosophie, 5 Bde, Bonn 1964 –1980 Schmitz, H. 1990: Der unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge der Philosophie, Bonn
11 Hans-Helmuth Gander
Existenzialontologie und Geschichtlichkeit (§§ 72–83) Andreas und Beatrice Graf von Kornis in Freundschaft zugeeignet
11.1 Exposition des Problems der Geschichtlichkeit Im Aufweis der Geschichtlichkeit gelangt die Untersuchung der Zeitlichkeit ins Ziel, so daß sich erst jetzt die Analyse der ontologischen Struktur des Daseins rundet. Damit schließt die Geschichtlichkeitsthematik positiv an das Phänomen der Selbstheit an. Heidegger verdeutlicht das zu Beginn des § 72 in der für Kapitelanfänge üblichen Manier, den Gedankengang so zu rekapitulieren, daß aus dem Ergebnisstand jener Punkt freigelegt wird, der der weiteren Untersuchung die Richtung anzeigt. In diesem Sinne findet der Aufweis der Geschichtlichkeit Einsatz und Leitfaden in der „vollzogene[n] Interpretation des eigentlichen Ganzseinkönnens des Daseins“ (376), das sich als der „in der Sorge verwurzelte, gleichursprüngliche Zusammenhang von Tod, Schuld und Gewissen“ (372) enthüllt und die Eigentlichkeit der Existenz im vorlaufenden Sichentwerfen auf die unüberholbare Möglichkeit des Todes verbürgt. Um dem Verständnis der Geschichtlichkeit vorzuarbeiten, exponiert Heidegger das Problem mittels eines Selbsteinwandes, indem er sich fragt, ob bislang „das Ganze des Daseins hinsichtlich seines eigentlichen Ganzseins in die Vorhabe der existenzialen Analyse gebracht [worden sei]“ (372). Bevor die Frage inhaltlich entfaltet wird, soll die methodologische Funktion des Selbsteinwandes erhellt werden, um zusätzliches Licht in die Architektonik des Kapitels zu bringen. Auffällig ist, daß die Strategie des in der Dramaturgie Heideggerscher Schriften oft genutzten Instruments des Selbsteinwandes keine Revokation in eigener Sache initiiert. Kunstvoll als retardierendes Moment eingesetzt, dient das Stilmittel zur Schärfung des Problembewußtseins, indem etwas
230
Hans-Helmuth Gander
implizit Mitgeführtes, aber in der ontologischen Struktur noch nicht hinreichend präzise Entfaltetes eigens in den Blick tritt. Insofern motiviert der Selbsteinwand in der Art eines methodisch gewählten Zweifels eine den Gedankengang weiterführende Explikation, in der die Komplexität des Sachverhaltes angereichert wird. Allerdings ist dieses methodische Spiel eines à deux mains. Denn die Möglichkeit zur Selbstklärung verknüpft in der Regel eine Außenperspektive, wie sie sich unter den Vorzeichen traditioneller Positionen oder auf der Basis semantischer Verknüpfung in alltäglichen Vorstellungen einstellt, mit der Option einer Bekräftigung des Einwandes. Vorderhand lädt Heidegger deren kritisches Potential in Richtung Plausibilität positiv auf, um sie in ihrem Recht anzuerkennen, dies aber nur „in ihren eigenen Grenzen“ (377). Hinter dieser Einschränkung steht die Absicht, alltägliche wie traditionelle Meinungen einer ontologischen Tiefenschicht zuzuführen. Aus diesem Ansatz her wird der fundamentalontologischen Position eine Überlegenheit gesichert, die sich gegenüber kritischen Einwänden von vornherein immunisiert. Bestenfalls werden diese in ihren ontisch existenziell bezeugten Sinngehalten als Indikatoren gefaßt, die ohne es selbst zu durchschauen auf existenziale Strukturen verweisen können.1 Ein in Frage Stellen des Erreichten, wie sie der Selbsteinwand evoziert, ist bei Heidegger demnach nur in Gestalt einer Autorevision möglich. Man darf daher Heideggers Selbstbescheidungsrhetorik nicht zu wörtlich nehmen. Zwar heißt es , daß es „einzig darum [gehe], die der heutigen Generation erst noch bevorstehende Aneignung der Forschungen Diltheys an ihrem Teil vorbereitend zu fördern“ (377) bzw. er die Absicht habe, durch die existenzial-zeitliche Analyse des Daseins „den Geist des Grafen Yorck zu pflegen, um dem Werke Diltheys zu dienen“ (404). Ohne Zweifel hat der frühe Heidegger von Dilthey starke Impulse erhalten (vgl. Gander 2001), aber auf der Ebene von Sein und Zeit ist eine vorbehaltlos positive
1 Für Ricoeur zeigt das die Sein und Zeit auszeichnende „sprachliche Arbeit“ (Ricoeur 1991,100). Allerdings verstrickt sich Heidegger in eigentümliche Schwierigkeiten. Denn indem er den existenzialen Sachverhalten zur Sprache verhelfen möchte, muß er sich entscheiden, entweder neue Begriffe zu bilden oder gar überhaupt neue Worte zu erfinden, um den Preis, im diskursiven Sinne kaum mehr verstanden zu werden. Weitere Heideggersche Optionen bestehen darin, „semantische Verwandtschaften aus[zu]nützen, die zwar im alltäglichen Gebrauch in Vergessenheit geraten, aber noch im Wortschatz der deutschen Sprache bewahrt sind, oder […] die alten Bedeutungen dieser Worte auf[zu]frischen, ja in einem Maße [zu] etymologisieren, daß dabei de facto neue Bedeutungen herauskommen, diesmal auf die Gefahr hin, daß die Worte nicht mehr in eine andere Sprache übersetzbar sind, ja nicht einmal mehr in die gewöhnliche deutsche Sprache“ (ebd.).
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
231
Anbindung an Dilthey, wie er es suggeriert, nicht mehr gegeben. ‚Sich in Dienst stellen‘ vollzieht in Wahrheit eine fundamentalontologische Indienstnahme, und zwar in den §§ 75–77 vornehmlich mit dem Ziel, die Historie der Geschichtlichkeit nach- und unterzuordnen. Was für Dilthey gilt, gilt auch für Nietzsche oder Hegel, die in den Schlußkapiteln gleichfalls eine exponierte Stellung einnehmen. Heidegger liest deren Gedanken, wie § 76 und § 82 verdeutlichen, im Lichte seiner eigenen Position, also im Sinne jener frei zugestandenen Gewaltsamkeit, die für ihn im Unterschied zur philosophiehistorischen Forschung das ebenbürtige Verhältnis zwischen Denkern als ein „Zwiegespräch unter anderen Gesetzen“ (GA 3, XVII) erfährt, wobei die Prämissen solcher Gesetzesannahmen durchweg aus der eigenen Perspektive formuliert werden. Das heißt, er liest die anderen so, daß, wie der Hegel-Paragraph bis in die Auswahl der Zitate hinein zeigt, gesehen nur wird, was er schon weiß, ja wissen zu wollen beabsichtigt. Trägt der Referenzbezug hinsichtlich der genannten Autoren im Ansatz der Heideggerschen Zuwendung bereits deren fundamentalontologische Überbietung in sich, so läßt sich über die Sachhaltigkeit der Auseinandersetzung mit Hegel, Nietzsche, Dilthey oder Yorck erst auf der Basis einer vorgängigen Klärung der existenzialontologischen Verfassung der Geschichtlichkeit entscheiden.2 Um deren Profilierung geht es nun im folgenden.
11.2 Geschichtlichkeit im Blick auf das vulgäre Geschichtsverständnis Den Aufweis der Geschichtlichkeit, der die Aussage ‚das Dasein ist geschichtlich‘ als „existenzial-ontologische Fundamentalaussage“ (332) bewährt, entwickelt der § 72 im Ausgang des genannten Selbsteinwandes. Heidegger registriert selbstkritisch, daß die Analytik, indem sie im Blick auf das „existierende Ganzsein“ (373) das Sein zum Tode präferierte, das Dasein darauf fixierte, „wie es gleichsam ‚nach vorne‘ existiert und alles Gewesene ‚hinter sich‘ läßt“ (373), obzwar vom Ganzsein nur die Rede sein
2 Durch die gebotene Selbstbeschränkung wird der vorliegende Beitrag auf eine differenzierende Auseinandersetzung mit Heideggers Lesarten der genannten Autoren weitgehend verzichten müssen. Auch wird die Untersuchung insgesamt wie bei einem Netz eher auf die entscheidenden Knotenpunkte achten als die lineare Entwicklung der Gedankenführung ausbreiten können. Zur Orientierung über die Schrittfolge der Paragraphen vgl. Luckner 1997, 157–181.
232
Hans-Helmuth Gander
kann, wenn der ‚Anfang‘, die Geburt mitbedacht wird. So gilt es, das Ganzsein hinsichtlich „der Erstreckung des Daseins zwischen Geburt und Tod“ (373) aufzuklären. Auf eine Formel gebracht heißt es: „Das faktische Dasein existiert gebürtig, und gebürtig stirbt es auch schon im Sinne des Seins zum Tode“ (374). Damit wird das Zwischen-Geburt-und-Tod als die Einheit des Lebenszusammenhangs, die Heidegger terminologisch als Geschehen faßt,3 sinnkonstitutiv in die „Verfassungsganzheit der Sorge“ (374) gegründet, was bedeutet, daß das ontologische Verständnis der Geschichtlichkeit als existenzialer Struktur des Daseins aus der eigentlichen Zeitlichkeit her gewonnen werden muß (vgl. Heinz 1982, 138–163). Mit dieser Zuspitzung konturiert sich der „Ort des Problems der Geschichte“ (375). Er läßt sich weder in der herkömmlichen Vorstellung von Historie noch in der Rückführung auf deren erkenntnis- oder wissenschaftstheoretische Grundlagen finden, da sie Geschichte nur als Objekt einer Wissenschaft begreifen und d. h. die ihr vorausspringende „Seinsart des Geschichtlichen aus der Geschichtlichkeit und ihrer Verwurzelung in der Zeitlichkeit“ (375) übersehen. Diese ontologische Tiefenschicht erschließt sich methodisch in der „existenziale[n] Konstruktion der Geschichte“ (376). Ihre Einsatzstelle findet sie im Durchgang durch die Verdeckungen und Verstellungen des vulgären Geschichtsverständnisses, und zwar als die Konkretisierung der im Vollzug der phänomenologischen Destruktion offen gelegten Geschichtlichkeit, in der ihrerseits das Geschehen der, wie Heidegger sagen wird, Welt-Geschichte als „das innerweltliche ‚Geschehen‘ des Zuhandenen und Vorhandenen“ (389) gründet. Wichtig ist, daß unbesehen des Umstandes, daß hier erstmals von der „phänomenologischen Konstruktion“ (375) gesprochen wird, diese Methode nicht erst und einzig im Blick auf die Geschichtlichkeit in Anwendung kommt (vgl. Blust 1987, 314). Auf der Vollzugsebene ist sie – wenngleich begrifflich nicht expliziert – in den Zeitlichkeitsanalysen bereits im Einsatz. Mit anderen Worten ist die phänomenologische Konstruktion so mit der Destruktion verzahnt, daß sich beide wechselseitig fordern (vgl. GA 24, 29–32). Das zeigt sich daran, daß Heidegger bei der Suche nach der geeigneten „Einsatzstelle für die ursprüngliche Frage nach dem Wesen der Geschichte, das heißt für die existenziale Konstruktion der Geschicht-
3 In dieser Wortwahl zeigt sich Heideggers glückliche Hand für Begriffsbildungen, in denen er zur Charakterisierung eines existenzialen Phänomens Anklänge im überkommenen Wortsinn nuancenreich ineinander spielen läßt. Denn nach seiner verbalen Seite deutet ‚Geschehen‘ auf ein Zeitigen hin, während die substantivische Bedeutung eine Nähe zum Wort ‚Geschichte‘ aufweist.
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
233
lichkeit“ (378) im nächsten Schritt das, was sonst mit den Worten ‚Geschichte‘ und ‚geschichtlich‘ intendiert wird, einer destruierenden Betrachtung unterzieht. Den Einstieg wählt er so, daß die Bedeutung von Geschichte als Historie zunächst ausgeklammert bleibt und statt dessen Geschichte als „,geschichtliche Wirklichkeit‘“ (378) ins Blickfeld rückt. Zu beachten ist, daß er zwar die Bahnen des herkömmlichen Verständnisses von Geschichte ausschreitet, aber dies so, daß deren Ausdeutung im Blick auf die ‚geschichtliche Wirklichkeit‘ ihren Bezugspunkt hat in dem in vollem Umfang bereits eingesehenen und im § 74 explizierten existenzial-ontologischen Begriff der Geschichtlichkeit des Daseins. Das erklärt den grob rasternden Zuschnitt, mit dem Heidegger das Netz der geschichtlichen Wirklichkeit auf die Spannung zwischen vulgärem Verständnis von Geschichte und dem Geschehen des Daseins zuzieht. In diesem Sinne erscheint Geschichte für das gewöhnliche Verständnis zunächst als das Vergangene, dem Heidegger den „merkwürdigen Doppelsinn“ (378) abgewinnt, zum einen im Blick auf die Vergangenheit unwiederbringlich „damaligen Ereignissen“ (378) zuzugehören und als „Reste eines griechischen Tempels“ (378) noch vorhanden zu sein und somit ein Stück Vergangenheit mitgegenwärtig zu halten. Daneben bezeichnet Geschichte im vulgären Verständnis „Herkunft“ (378). Sie bestimmt sich als „Ereignis- und ‚Wirkungszusammenhang‘, der sich durch ‚Vergangenheit‘, ‚Gegenwart‘ und ‚Zukunft‘ hindurchzieht“ (378 f.). In einer Nähe hierzu hält sich die Bedeutung, wonach Geschichte „das Überlieferte als solches“ (379) bezeichnet. Weiterhin macht Heidegger für die vulgäre Auffassung geltend, daß Geschichte „die Region des Seienden [bezeichnet], die man mit Rücksicht auf die wesentliche Bestimmung der Existenz des Menschen durch ‚Geist‘ und ‚Kultur‘ von der Natur unterscheidet“ (379).4 Als Grundzug des gewöhnlichen Geschichtsverständnisses heißt es zusammenfassend: „Geschichte ist das in der Zeit sich begebende spezifische Geschehen des existierenden Daseins, so zwar, daß das im Miteinandersein ‚vergangene‘ und zugleich ‚überlieferte‘ und fortwirkende Geschehen im betonten Sinne als Geschichte gilt“ (379) und in ihren Bedeutungsvarianten sich dadurch auszeichnet, daß sie sich „auf den Menschen als das 4 Der Hinweis, daß es dabei nicht schon um eine Frage der Seinsart geht, läßt ex negativo im Hintergrund das hier noch unausgeschöpfte kritische Potential ahnen, das im Ansatz des Daseins die tradierte Unterscheidung von Natur und Geist als eine kategoriale Mißdeutung des phänomenalen Sachverhaltes des In-der-Welt-seins unterläuft (vgl. Brandner 1994,133 f.).
234
Hans-Helmuth Gander
‚Subjekt‘ der Ereignisse“ (379) beziehen. Im Bezugspunkt Mensch findet Heidegger die Einsatzstelle, von der aus er im Vollzug der phänomenologischen Destruktion der vulgären Daseinsauslegung und ihrer Geschichtsdeutungen die existenziale Konstruktion der Geschichtlichkeit leisten will.5 Das ist nur möglich, wenn die vulgäre Daseinsauslegung Geschichte nicht schlechterdings verfehlt, sondern sich eine Spur der Zugänglichkeit zu Geschichte und Geschichtlichkeit bewahrt, die es im archäologischen Abbau der Verdeckungen aufzufinden gilt. Diese Spur sieht Heidegger im Umstand „des merkwürdigen Vorrangs der ‚Vergangenheit‘ im Begriff der Geschichte“ (379). Heidegger schließt an die im gewöhnlichen Geschichtsverständnis erst genannte Bedeutung des Vergangenen an, wonach etwas im Sinne eines historischen Gegenstandes (Erbstück, alter Hausrat) in seinem Vorhandensein ein Stück Vergangenheit mitvergegenwärtigt. Mit Bezug auf seinen geschichtlichen Charakter ist es unerheblich, ob das Objekt von historischem Interesse ist, im Museum steht oder noch benutzt wird. Entscheidend ist, daß „es an ihm selbst irgendwie geschichtlich ist“ (380), wobei dieses irgendwie als „der spezifische Vergangenheitscharakter, der es zu etwas Geschichtlichem macht“ (380), darin liegt, daß „die Welt [vergangen ist], innerhalb deren sie [die Erbstücke im Hausrat], zu einem Zeugzusammenhang gehörig, als Zuhandenes begegneten und von einem besorgenden, in-der-Welt-seienden Dasein gebraucht wurden“ (380). Von daher bringt Heidegger den Befund der Analyse auf den Punkt: „Die Welt ist nicht mehr. Das vormals Innerweltliche jener Welt aber ist noch vorhanden“ (380). So, wie die Analyse angelegt ist, besitzt sie in der Komposition der Gedankenführung eine Überleitungsfunktion, d. h. sie soll „die Exposition der Grundverfassung der Geschichtlichkeit vorbereiten“ (379). Das wird deutlich, wenn der nächste Schritt das Nicht-mehr-sein der Welt expliziert, indem er darauf rekurriert, daß Welt als ontologischer Strukturbegriff einzig „in der Weise des existierenden Daseins [ist], das als In-derWelt-sein faktisch ist“ (380) und gemäß der ekstatischen Zeitlichkeit auch nie vergangen, sondern immer nur da-gewesen ist. Von daher haben in entsprechender Passung die „noch vorhandenen Altertümer […] einen
5 Figal macht hier auf konzeptionelle Schwierigkeiten aufmerksam, da die Analyse zu Geschichte und Geschichtlichkeit ansetzt, ohne daß die vollständige Konzeption der Zeit bereits ausgearbeitet vorliegt, weshalb für ihn das 5. Kapitel kompositorisch eher „unglücklich plaziert“ (Figal 2000, 313) erscheint. Zum sachlich-historischen Kontext der Schlusskapitel vgl. Heidegger/Jaspers 1990, dazu v. Herrmann 1991a.
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
235
‚Vergangenheits‘- und Geschichtscharakter auf Grund ihrer zeughaften Zugehörigkeit zu und Herkunft aus einer gewesenen Welt eines da-gewesenen Daseins“ (380 f.). In dieser methodisch forcierten Zurichtung auf das Dasein wird leicht übersehen, daß Heideggers Versuch, am Zeugcharakter das Problem der Geschichtlichkeit zu exponieren, in der Analyse so überzeugend gar nicht ist. Denn ist im strengen Sinne wirklich im Zeugcharakter, also in der ontologischen Funktion seiner Dienlichkeit die Struktur des an ihm selbst Geschichtlichen auszumachen? Im Charakter als Zeug, in seiner Zuhandenheit läßt sich schwerlich ein triftiger Unterschied ausmachen zwischen dem mehr als zweihundert Jahre alten Schreibtisch, an dem ich zu Hause arbeite, und dem 30 Jahre alten, den ich in der Universität nutze. Gleichwohl gibt es diesen Unterschied, dieses an ihm selbst Geschichtliche, das Seiendes zum historischen Gegenstand macht und worauf der Hinweis auf das Nicht-mehr-sein der Welt abzielt. Dabei handelt es sich nicht um den Zeugcharakter i. e. S., sondern um den im Zeug mit begegnenden Verweisungszusammenhang im ontologischen Charakter seiner Bedeutsamkeit, der die „Weltzugehörigkeit“ (381) des nichtmenschlich Seienden konstituiert. Historische Gegenstände, die Heidegger aufgrund ihrer Weltzugehörigkeit terminologisch als das „Welt-geschichtliche“ (381) anspricht, begegnen innerweltlich anders bedeutsam als nicht historische, sofern, selbst wenn sie in Gebrauch sind, ihre Bedeutsamkeit für mich auf der synchronen Achse ihrer Funktionalität immer schon vertikal durchkreuzt ist von der Diachronie ihrer vormals gewesenen, aber darin nun entzogenen Bedeutsamkeit für Andere. Sie konstituiert in der manifesten Präsenz der Dinge eine Latenzschicht, die uns so etwas wie die geschichtliche Erfahrung eines Weltentzugs ermöglicht und historischen Gegenständen in der ihnen so eingeschriebenen sinnbezüglichen Doppeldatierung den Rang von Zeugnissen verleiht. Aus der spezifischen Bedeutsamkeit der historischen Gegenstände her gestalten sich das Verhalten zu ihnen und mithin die Weisen, wie ich mich daraus selbst verstehe, sofern ich – und das ist die Voraussetzung – darum weiß. Das bedeutet, daß das an ihm selbst Geschichtlichsein der Dinge in seiner Zugänglichkeit konstitutiv an ein geschichtliches Wissen gebunden ist, das somit ontologische Funktion des Historischseins i. S. des spezifischen Vergangenheitscharakters der Dinge als welt-geschichtliche ist.6 Bestätigt das zuletzt nicht, was traditionell philosophisches wie vulgäres Geschichts-
6 Vgl. Figal 2000, 314 ff. und Brandner 1994, 130–134.
236
Hans-Helmuth Gander
verständnis erkannt haben, daß nämlich der Mensch das primäre Subjekt der Geschichte sei? Wie unterscheidet sich davon Heideggers These vom Dasein als dem primär Geschichtlichen? Auf diesen existenzial-ontologisch zu bestimmenden Unterschied kommt es an, der sich über das „ontische Faktum“ (382) des Geschichtlichseins des Daseins hinaus für Heidegger in der Lösung des konstitutionstheoretischen Problems formuliert, das er am Ende der Exposition in die zum Herzstück seiner Analyse überleitende Frage faßt: „inwiefern und auf Grund welcher ontologischen Bedingungen gehört zur Subjektivität des ‚geschichtlichen‘ Subjekts die Geschichtlichkeit als Wesensverfassung?“ (382).
11.3 Die Wesensverfassung der Geschichtlichkeit Um die Frage zu beantworten, ist es nötig, den „ontologischen Ort des Problems der Geschichtlichkeit“ (377) zu konturieren. Das tut Heidegger, wenn er bezüglich des in der Frage intendierten Konstitutionsproblems die Zeitlichkeit in ihrem als apriorischen Seinssinn der Sorge erwiesenen transzendentalen, d. i. „geltungsbegründenden Sinne“ (Gethmann 1974, 312) in den Blick rückt, um die Geschichtlichkeit als „eine konkretere Ausarbeitung der Zeitlichkeit“ (382) aufzuweisen, was der Geschichtlichkeit eine transzendentale Funktion zumißt, sofern die „Erstreckung des Daseins zwischen Geburt und Tod“ (373) qua ‚Geschehen des Daseins‘ im ganzen als transzendentaler und d. i. konstituierender Prozeß fungiert (Gethmann 1974, 316 f.). Dabei ist das Geschehen des Daseins von vornherein auf seine mögliche Ganzheit hin zu begreifen, das sich verbürgt als das „vorlaufende Sichentwerfen auf die unüberholbare Möglichkeit der Existenz, den Tod“ (383). Vor dem Hintergrund dieser existenzial-transzendentalen Anlage verdeutlicht sich Heideggers Absicht, „das ontologische Problem der Geschichte als existenziales“ (382) fundieren zu wollen, welchem Ziel die an den § 73 anschließenden Untersuchungen zur Welt-Geschichte im § 75 vorarbeiten. Die terminologische Neukodierung des Begriffes ‚Welt-Geschichte‘ rekurriert in der ontologischen Valenz darauf, daß mit „der Existenz des geschichtlichen In-der-Welt-seins […] Zuhandenes und Vorhandenes je schon in die Geschichte der Welt einbezogen ist“ (388). Die daraus sich ergebende Doppelbedeutung von ‚Welt-Geschichte‘ faßt zum einen „das Geschehen von Welt in der existenzialen Ganzheit des Daseins“ (389) und deutet zum zweiten darauf, daß eine geschichtliche Welt nur als Welt des innerweltlich Seienden ist, das sich an ihm selbst auch als ‚Welt-
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
237
Geschichtliches‘ ansprechen läßt und d. h. nicht erst aufgrund einer historischen Objektivierung als geschichtlich gilt. In dieser Grundausrichtung ist es stimmig, aber keineswegs unproblematisch, wenn Heidegger im Ansatz seiner Analysen, die im § 75 auf die Unterscheidung von ‚eigentlicher Geschichtlichkeit‘ und ‚uneigentlicher Welt-Geschichte‘ aufbauen, von vornherein tradierte Auffassungen hinsichtlich der Möglichkeit, in der Geschichte ein genuines Phänomen des Öffentlichen zu begreifen, unterläuft. Bezüglich Heideggers Primat der Geschichtlichkeit des je einzelnen Daseins gibt Ricoeur zu bedenken, daß sich von hier aus eine Antwort auf die Frage, wie man „von der Geschichte jedes einzelnen zur Geschichte aller gelangen [soll]“ (Ricoeur 1991, 119), notgedrungen schwierig gestaltet. Ehe Heideggers mit Hilfe der existenzialen Strukturen von Schicksal und Geschick unternommener Lösungsversuch betrachtet werden soll, muß ein für die Stringenz der Gedankenführung bedeutsames Faktum thematisiert werden, nämlich daß er in bezug auf die Zeitigung als Geschehnischarakter der Zeitlichkeit den für ein Verständnis der Geschichtlichkeit spezifischen Bezug zur existenzialen Gewesenheit profiliert. Den Ansatz dafür bietet, daß das Sichentwerfen auf eigene Möglichkeiten i. S. des entschlossenen Vorlaufens ein Zurückkommen auf das eigene faktische Daß ist. Mit der Faktizität lenkt Heidegger den Blick darauf, daß die Möglichkeiten, auf die der Einzelne sich verstehend entwirft, geschöpft werden aus dem mit der Geworfenheit ihm Mitgegebenen, und dies so, daß erst im entwerfenden Verstehen das faktisch Mitübernommene seinerseits aufgeschlossen wird (vgl. Volkmann-Schluck 1996, 75). Mit anderen Worten gibt es kein entschlossenes Vorlaufen in das im Sein zum Tode zu ergreifende Selbstsein, kein auf sich Zukommen, das nicht zugleich ein Zurückkommen auf sich selbst ist, wobei „die Entschlossenheit, in der das Dasein auf sich selbst zurückkommt […] die jeweiligen faktischen Möglichkeiten eigentlichen Existierens aus dem Erbe [erschließt], das sie als geworfene übernimmt“ (383). Das in diesem Übernehmen sich vollziehende Zurückkommen faßt er in seinem Geschehnischarakter als das „Sichüberliefern überkommener [d. i. ererbter] Möglichkeiten“ (383). Im existenzialen Begriff des Erbes, in dem sich die Aspekte des Empfangenen und des zu Übernehmenden in ihrer Zusammengehörigkeit erweisen, fixiert er den Ursprung der Existenzmöglichkeiten in der Geworfenheit. Dasein findet sich als geworfener Entwurf versetzt in ein Selbst- wie Weltverhältnis vorgängig konfigurierendes Erschlossensein, das den Existenzvollzug mit Blick auf die identitätsstiftenden Optionen daseinsmäßiger Entwürfe ebenso individuell (u. a. Leiblichkeit) wie auch transsubjektiv
238
Hans-Helmuth Gander
(kulturell, historisch) vorzeichnet und so verendlicht. Dasein übernimmt sich im Entwurf seiner Möglichkeiten im Horizont vorgängiger Ausgelegtheit so, daß es diese im Vollzug seiner ererbten Existenzmöglichkeiten ausdrücklich oder unausdrücklich mit realisiert. Darin böte sich Gelegenheit, Geschichte und Geschichtlichkeit i. S. des Geschehens des In-derWelt-seins im Ausgang und Ansatz vom ‚synchronen Mitgeschehen mit Anderen‘ oder ‚diachronen Überlieferungsgeschehen‘ (vgl. Brandner 1994, 134) zu konzipieren – nicht so für Heidegger, für den im Blick auf die Authentizität des Existenzvollzuges entscheidend bleibt, daß die Übernahme des Erbes im Lichte der eigensten Möglichkeit des Daseins geschieht, also aus der vorlaufenden Entschlossenheit als dem „Freisein für den Tod“ (384). Denn in ihm erschließt sich das Dasein als „Ziel schlechthin“ (384) sein eigentliches Selbstsein. Nun markiert das Sein zum Tode die „Endlichkeit der Zeitlichkeit“ (386), die in ihrem Strukturzusammenhang knapp vergegenwärtigt Heideggers Grundannahme unterstreicht, daß nur „Seiendes, das als zukünftiges gleichursprünglich gewesend ist, […] die eigene Geworfenheit übernehmen und augenblicklich sein [kann] für ‚seine Zeit‘“ (386). Damit fügt sich die Geschichtlichkeit i. S. der „konkreteren Ausarbeitung der Zeitlichkeit“ (382) deren dreigliedriger Struktur, wobei das Auf-sich-zurückkommen jetzt die Bedeutung des Sichüberlieferns annimmt, in dem sich das Dasein zeitigend zur eigenen Geschichte verhält. Mit der in der Freiheit zum Tode „ergriffene[n] Endlichkeit der Existenz“ (384) bildet sich das Kriterium aus, hinsichtlich der zu übernehmenden ererbten Möglichkeit alles bloß Kontingente auszuscheiden, um als Dasein „in die Einfachheit seines Schicksals “ (384) zu gelangen. Wie Heidegger den Begriff Schicksal einführt, bezeichnet er keine von außen Handlungsspielräume negierende bzw. determinierende Macht. Das Dasein ist sich qua Entschlossenheit selbst sein Schicksal, das als solches das Wesen der endlichen Freiheit bestimmt. Schicksal ist Heideggers „Nachfolgebegriff für Autonomie“ (Brandner 1994, 139), in dem das Dasein „sich frei für den Tod ihm selbst in einer ererbten, aber gleichwohl gewählten Möglichkeit überliefert“ (384). Das geschichtliche Sichüberliefern überkommener Möglichkeiten schließt kein explizites Wissen um deren Herkunft ein. Wohl aber besitzt das Dasein die Möglichkeit, „das existenziale Seinkönnen, darauf es sich entwirft, ausdrücklich aus dem überlieferten Daseinsverständnis zu holen“ (385), aber nicht, um es als ehemals Wirkliches wiederzubeleben. Vielmehr handelt es sich bei dem entschlossenen Sichüberliefern ererbter Möglichkeiten um eine verwandelnde Aneignung. Sie faßt Heidegger als Erwide-
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
239
rung, die vollzogen wird in Betracht der gewesenen Existenzmöglichkeit aus einem immer schon mitlaufenden zeitkritischen Bezug zur eigenen uneigentlichen Gegenwart. Das Erwidern ist insofern zugleich ein „Widerruf dessen, was im Heute sich als ‚Vergangenheit‘ auswirkt“ (386), den er als „Entgegenwärtigung des Heute und […] Entwöhnung von den Üblichkeiten des Man“ (391) faßt. Terminologisch wird das mit Wissen vollzogene ausdrückliche Sichüberliefern einer dagewesenen Existenzmöglichkeit mit dem von Kierkegaard inspirierten Begriff als Wiederholung fixiert.7 Sie bezeichnet „den Modus der sich überliefernden Entschlossenheit, durch den das Dasein ausdrücklich als Schicksal existiert“ (386) und qua endlicher Freiheit sich von der Verfallenheit an das Man löst und in der vorlaufenden Entschlossenheit sein eigentliches Selbstsein, d. h. die „Treue der Existenz zum eigenen Selbst“ (391) konstituiert.
11.4 Der Ansatz der Geschichte und die Frage nach der Historie Wenn Schicksal und Wiederholung die eigentliche Geschichtlichkeit des Menschen konstituieren, kann die eigentliche Geschichte ihre wesentliche Orientierung weder in der Vergangenheit noch in dem aus der Bindung an Vergangenes bestimmten Heute haben. Geschichte gewinnt ihre Grundorientierung entsprechend dem Primat der Zukunft (§ 65) aus dem Vollzug des entschlossenen Auf-sich-zukommens. Denn die vorlaufende Entschlossenheit ist es, welche frei macht für die Wiederholung dagewesener Existenzmöglichkeiten. Sie leitet den Blick in die Geschichte, so daß das im vormals Wirklichen verborgene Mögliche in einer produktiven Weise erwidernd zum Aufweis gelangt. Einzig über die existenziale Zukunft erschließt sich das Dasein den Zugang zur existenzialen Vergangenheit und also die eigentliche Geschichte als Geschehen des Daseins. In diesem Sinne erweist sich die eigentliche Zeitlichkeit als Bedingung der Möglichkeit der eigentlichen Geschichtlichkeit, und dies so, „daß der Tod […] die vorlaufende Existenz auf ihre faktische Geworfenheit zurückwirft und so erst der Gewesenheit ihren eigentümlichen Vorrang im Geschichtlichen verleiht“ (386). 7 Ricoeur sieht die methodologische Funktion des Begriffs der Wiederholung darin, „die Waage, die durch den Gedanken des überlieferten Erbes zur Gewesenheit hin ausschlug, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, daß heißt den Primat der vorlaufenden Entschlossenheit noch im Herzen […] des Vergangenen […] wiederaufzurichten“ (1991, 122 f.). Zur Wiederholung vgl. weiterhin Figal 2000, 321–325.
240
Hans-Helmuth Gander
Mit anderen Worten ist das „eigentliche Sein zum Tode, das heißt die Endlichkeit der Zeitlichkeit, […] der verborgene Grund der Geschichtlichkeit“ (386), weshalb nur, „wenn im Sein eines Seienden Tod, Schuld, Gewissen, Freiheit und Endlichkeit dergestalt gleichursprünglich zusammenwohnen wie in der Sorge, […] es im Modus des Schicksals existieren, das heißt im Grunde seiner Existenz geschichtlich sein [kann]“ (385). Das bedeutet, daß Geschichte aufgrund der von Schicksal und Wiederholung konstituierten eigentlichen Geschichtlichkeit in den Entwurfsraum des Daseins einrückt und als solche eigentlich nur vollzogen wird von jenen, die in den Tod vorlaufen. Denn nur sie sind im Austrag der endlichen Freiheit fähig zum „vorlaufend sich überliefernden Wiederholen des Erbes von Möglichkeiten“ (390). Maß für die Zueignung der Geschichte ist die Eigentlichkeit der Existenz. Das zeigt sich im Blick auf das uneigentliche Existieren, das, sofern Geschichtlichkeit zum Sein des Daseins gehört, ebenfalls geschichtlich sein muß. Allerdings ist hier der Zugang zur Geschichtlichkeit verstellt aufgrund dessen, was Heidegger die „ontologische Rückstrahlung des Weltverhältnisses auf die Daseinsauslegung“ (16) nennt, mit der Folge, daß derjenige, der nicht im existenzial-ontologischen Sinne geschichtlich zu denken vermag, die Historie als Wissenschaft nicht aus ihrer ontologischen Herkunft aus der Geschichtlichkeit des Daseins fassen kann. Daher beabsichtigen §§ 76–77, die Historie unter die Maßgabe des existenzialontologischen Begriffs von Geschichtlichkeit und Geschichte zu bringen, indem nach „der ontologischen Möglichkeit des Ursprungs der Wissenschaften aus der Seinsverfassung des Daseins“ (392) gefragt wird. Heidegger liefert hier seinen Beitrag zur Debatte um den theoretischen Status der Geisteswissenschaften, der nach Ricoeur allerdings eher eine Verabschiedung der Geisteswissenschaften betreibt und folglich kaum „Licht auf das [gegenüber der Unterordnung der Historie unter die eigentliche Geschichtlichkeit] umgekehrte Problem des Übergangs von der Gewesenheit zur historischen Vergangenheit werfen“ (Ricoeur 1991, 128) kann. Worum es Heidegger geht, erhellt sein Rekurs auf Nietzsches Unterscheidung einer antiquarischen, monumentalen und kritischen Geschichte, die er positiv würdigt, da die Dreiteilung „in der Geschichtlichkeit des Daseins vorgezeichnet“ (396) sei. Für ihn läßt dies die Vermutung zu, daß Nietzsche „mehr verstand, als er kundgab“ (396), sofern die eigentliche Geschichtlichkeit „das Fundament der möglichen Einheit der drei Weisen der Historie“ (397) abgibt. Zu einer klaren Erkenntnis kam es für Heidegger bei Nietzsche noch nicht, da der Grund des Fundamentes einer eigentlichen Historie sich erst im Aufweis der Zeitlichkeit als existenzialem
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
241
Seinssinn der Sorge zeigt. Eine Ahnung dieser Zusammenhänge billigt er auch Dilthey zu, dessen Briefwechsel mit Yorck der § 77 im Exzerpt bietet. Die eigene Position findet Heidegger mehr durch Yorck bestätigt (vgl. Gadamer 1987, 420 f.), insbesondere durch dessen „Herausarbeitung der ‚generischen Differenz zwischen Ontischem und Historischem‘“ (403), die ihn zu der Forderung führt, im Sinne einer den Wissenschaften vorausspringenden und sie leitenden Logik „positiv und radikal die verschiedene kategoriale Struktur des Seienden, das Natur, und des Seienden, das Geschichte ist (des Daseins) herauszuarbeiten“ (399). Wie immer Anlehnungen und Abgrenzungen zu gewichten sind, unzweifelhaft ist, daß die in den §§ 72 und 75–77 vorgelegten Analysen darauf zielen, sowohl die Epistemologie der Geisteswissenschaften wie auch das alltägliche Verständnis von Geschichte im Blick auf ihre sachangemessene kategoriale Selbstausbildung unter die Führung der existenzialen Analytik des Daseins zu stellen. Denn das Geschehen der Geschichte ist eines des In-der-Welt-seins, d. h. die „These von der Geschichtlichkeit des Daseins sagt nicht, das weltlose Subjekt sei geschichtlich, sondern das Seiende, das als In-der-Welt-sein existiert“ (388), wozu konstitutiv gehört, daß „das schicksalhafte Dasein als In-der-Welt-sein wesenhaft im Mitsein mit Anderen existiert“ (384). Im gegebenen Zusammenhang heißt das, daß das Geschehen des Daseins in diesem Sinne ein ‚Mitgeschehen‘ ist, das terminologisch als „Geschick“ (384) bestimmt wird und „das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes“ (384) bezeichnet.
11.5 Geschick – Gemeinschaft – Volk Der abrupte Übergang vom schicksalhaften Geschehen des Daseins zum Geschehen der Gemeinschaft scheint die Ansicht zu bestätigen, daß „Heideggers Fragen nach der Gemeinschaft zum Unbefriedigendsten seines Werkes gehört […] [und] gewiß nicht durch den Handstreich einer unvermittelten Einführung des Volksbegriffes zu lösen“ (Pöggeler 1990, 420) ist. Aber beschränkt Heidegger sich wirklich darauf, „den Gedanken einer Homologie zwischen gemeinschaftlichem Geschick und individuellem Schicksal nahezulegen“ (Ricoeur 1991, 121)? Ohne Frage sind die gemeinschaftliches Geschehen erläuternden Begriffe nicht wirklich eingeführt, so daß dem Gedankengang konzeptionelle Plausibilität zu mangeln scheint. So ist z. B. das Geschick umstandslos als Phänomen der Eigentlichkeitssphäre angesetzt, was die Analyse des Mitseins, die im Man verstärkt Verfallsformen aufweist, nicht gerade nahelegt. Auch im Kontext der exi-
242
Hans-Helmuth Gander
stenzial gefaßten Geschichtlichkeit gewinnt Gemeinschaft ihre positive Kontur unmittelbar nur in der Absetzung gegenüber Positionen der Intersubjektivitätstheorie. Und ist nicht in der Zentrierung der Analyse auf die vorlaufende Entschlossenheit der ursprüngliche Ansatz von Geschichtlichkeit und Geschichte mit dem Tod auf jenes Phänomen zugespitzt, das als „unbezügliche Möglichkeit“ (250) das Dasein aus allen Beziehungen zu Anderen herauslöst? Wohl trifft das zu, allerdings nur insofern, als in der Seinsmöglichkeit des Todes einzig jene Bezüge zum Mitdasein gelöst sind, die dieses eigenste unüberholbare Seinkönnen des Menschen auf Vorstellungen der öffentlichen Ausgelegtheit des Man ausrichten (vgl. Dallmayr 1980). Damit ist noch nicht das Mitsein als solches aufgehoben, denn die Entschlossenheit zu sich selbst ist nur als In-der-Welt-sein eigentlich und darf also in der unbezüglichen Möglichkeit des Todes nicht als freischwebendes Ich aufgefaßt werden (§ 60). Daher betont Heidegger, daß als „unbezügliche Möglichkeit […] der Tod [zwar vereinzelt], aber nur, um als unüberholbare das Dasein als Mitsein verstehend zu machen für das Seinkönnen der Anderen“ (264), was heißt, „die mitseienden Anderen ‚sein‘ zu lassen in ihrem eigensten Seinkönnen und dieses in der vorspringend-befreienden Fürsorge mitzuerschließen“ (298). Damit ist die Gemeinschaft der Menschen in ihrem entschiedensten Füreinander aus der Sterblichkeit her gedacht. Insofern ist der Übergang vom Einzelnen zur Gemeinschaft im § 74 in der Binnenführung des Heideggerschen Gedankenganges schlüssig – ob er nur so sinnvoll und möglich ist, ist damit keineswegs ausgemacht. Um hier klarer zu sehen, muß der Ansatz der Gemeinschaft deutlicher werden. Im § 34 wird das „existenziale Offensein des Daseins als Mitsein für den Anderen“ (163) als ein Hören-auf bestimmt, wobei in der so gestifteten Gemeinschaft dieses Hören „die primäre und eigentliche Offenheit des Daseins für sein eigenstes Seinkönnen“ (163) konstituiert, und zwar als „Hören auf die Stimme des Freundes, den jedes Dasein bei sich trägt“ (163; vgl. Michalski 1997, 222–226). Der Relativsatz liest sich als Hinweis, daß der interexistenzielle Bezug des Ich zum Du in der als schicksalhaft erfahrenen Gemeinschaft des Freundes keineswegs die fundamentale Vereinzelung überschreitet bzw. aufhebt, wenngleich mein bzw. sein Sich-zusich-verhalten bedingt ist durch unser mithaft geteiltes In-der-Welt-sein, weshalb Dasein gleichursprünglich Mitsein ist. Im Zusammenhang von Geschichtlichkeit und Mitsein mit Anderen sind folgende Aspekte genauer zu beachten. Das Mitsein qua existenzial-apriorischer Struktur der Koexistenzialität ist im ontisch existenziellen Vollzug realisiert in dem unumgänglichen Faktum, daß Dasein immer schon Mit-
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
243
dasein mit Anderen ist, was im Blick auf die Koexistenzialität heißt, daß sie ihre Wirklichkeit als existenzial-apriorische Interexistenzialität hat. Existiert Dasein qua Mitsein als Mitdasein, dann konjungiert sich das existenzial-ontologische ipse nicht länger mehr in der Weise des traditionellen ego. Und wo kein Platz mehr für das im ego gedachte Subjekt ist, gibt es nach Esposito (1997, 553 f.) auch keinen Platz für einen als alter ego verstandenen Anderen. Insofern darf Ko- qua Interexistenzialität nicht verwechselt werden mit der traditionellen Intersubjektivität. Heideggers Ansatz fordert im Blick auf die in der Koexistenzialität formulierte Bedingung der Möglichkeit dafür, daß der Mensch als Mitdasein nur in einer Welt des Mitseins auf sein eigenes In-der-Welt-sein freigegeben wird, von sich her für eine Aufklärung der mitmenschlichen Lebensverhältnisse und ihrer Konstitutionsbedingungen eine hermeneutische Ontologie der Interexistenzialität. Ihren ontologischen Rang qualifiziert er im Verhältnis zur Fundamentalontologie als Metontologie (vgl. GA 26, 199–202). Metontologien legen als existenzial ausgearbeitete regionale Ontologien z. B. die Strukturen, wie sie soziale Praxis konstituieren, frei und bearbeiten u. a. Themenbereiche von Anthropologie, Soziologie oder Psychologie. Mit anderen Worten bietet der fundamentalontologische Ansatz der Koexistenzialität durchaus eine konstruktive Möglichkeit zur Ausbildung einer Metontologie des sozialen Lebens, die Heidegger in Sein und Zeit aber nicht allein aus Gründen der Selbstbeschränkung unterbietet. Nach Rentsch liegen die Ursachen, die Sein und Zeit an einer phänomenal zureichenden Konstitutionsanalyse der Interexistenzialität und d. h. am strukturellen Aufweis des „kommunikativen Horizont[es] apriorischer Interexistentialität“ (Rentsch 1991, 149) scheitern läßt, tiefer. So hat Heidegger u. a. kein positiv konnotiertes Verständnis von Öffentlichkeit. Nahezu durchgehend wird sie vom Man, also der Uneigentlichkeit her gefaßt. Aus dieser Engführung kann sich kein konstruktives Verständnis für politische Zusammenhänge und die Strukturierung gesellschaftlicher Prozesse ausbilden, was einen bemerkenswerten Rückfall hinter Möglichkeiten seiner frühen Lebensweltphänomenologie signalisiert (vgl. Gander 2001). Gegenüber dem im deprivativen Modus des uneigentlichen Man vollzogenen öffentlichen Miteinandersein faßt Heidegger das aus dem Schicksal gedachte „Geschehen des Daseins im Mitsein mit Anderen“ (386) terminologisch als Volk (vgl. Vetter 1991). Die Zugehörigkeit zum als Volk gedachten Geschick bestimmt sich so, daß aus ihm „die Schicksale im vorhinein schon geleitet“ (384) sind, sofern sie aufgrund der im Mitsein (Koexistenzialität) ursprünglich gestifteten Seinsmöglichkeit des Miteinander (Interexistenzialität) ihr mithaftes In-der-Welt-sein als den Möglich-
244
Hans-Helmuth Gander
keitsraum des überlieferten Erbes teilen. So übernimmt der Einzelne seine geschickhafte Zugehörigkeit zum Volk i. S. eines darin faktischen geschichtlichen Erbes als die ihm vorgegebene Bedingtheit seiner Geworfenheit. In der Wiederholung vermag er „hinsichtlich seiner Verhaftung an das überkommene Erbe“ (386) dieses und also mithin die eigene Zugehörigkeit zum Geschick, das im Volk seine Konkretion ins Eigentliche erfährt, ausdrücklich zu erschließen. Da im Geschick als ursprünglicher Versammlung der Schicksale die ausdrückliche Zueignung je schon mithaft ist, bestimmt Heidegger eine der beiden Weisen, in der die Macht des Geschicks und also Erbes freigesetzt wird, als Mitteilung (384). Als Artikulation der aus dem Erbe überlieferten geschichtlichen Existenzmöglichkeiten verweist sie den Einzelnen in den Umkreis seiner Generation, die im Diltheyschen Sinne eines zwischen der kalendarischen äußeren Zeit und der inneren Zeit des psychischen Lebens Vermittelnden den Spielraum der Verständigung untereinander öffnet und durch biologische wie soziale Zugehörigkeit zur selben Generation in einer Generationenfolge auch regelt. Was sich hier als Möglichkeit einer Kommunikation abzeichnet, und zwar im Übergang von der endlich-eigentlichen Zeitlichkeit zu einer öffentlichen Geschichtlichkeit, deren Öffentlichkeitscharakter nicht mehr vom Man her gefaßt wird, verbleibt bei Heidegger im Rahmen dieser Andeutung. Daneben etabliert er als zweite Weise den Kampf. Dieser von Jaspers inspirierte Begriff formuliert die entschlossene Haltung des Einzelnen, in der er im ‚Modus des Schicksals‘ existierend sein ihm überliefertes Erbe aus dem Geschick freisetzt und darin eigentliches Selbstsein und Volk konstitutiv ineinander verbindet. Was in Sein und Zeit nur knappe Erwähnung findet, hat Heidegger im Sommer 1934 einer weiterführenden Analyse unterzogen. An einer zentralen Stelle heißt es: „Wie das Wir jeweils ist, ist abhängig von unserer Entscheidung [die Heidegger aus der Entschlossenheit her denkt], gesetzt, daß wir uns entscheiden. In dem Augenblick, in dem wir das Wir als entscheidungshaftes begriffen haben, ist auch die Entscheidung über unser Selbstsein gefallen. […] Wer sind wir selbst? Antwort: das Volk“ (GA 38, 59). Wie die Vorlesung zeigt, hat Heideggers Begriff des Volkes nichts mit der rassistisch-völkischen Weltanschauung der Nationalsozialisten gemein. Und doch erhellt die Weise, wie hier das geschichtliche Sein des Volkes bestimmt wird, weshalb er „das Risiko einer Vergeistigung des Nazismus auf sich genommen hat“ (Derrida 1988a, 48; s. a. Pöggeler 1991) und nach Löwiths Erinnerung noch 1936 betonte, daß er in der Geschichtlichkeit die Grundlage für seinen politischen Einsatz gesehen habe (Löwith 1986,
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
245
57). Um einen zentralen Aspekt herauszugreifen: In der Bestimmung des Volkes, d. h. seines Grundverhältnisses als Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit wird für Heidegger das neuzeitliche Subjektsein gesprengt, in dessen Konstitutionsphase sich eine Neuordnung innerhalb der sozialen Orientierung des Menschen ereignete, die Gestalt und Charakter der Gesellschaft annahm (vgl. GA 38, § 28). Von daher kann Heidegger die ursprüngliche Gemeinschaft, in der sich das geschichtliche Sein des Volkes ausprägt, nicht in einem positiven Begriff von Gesellschaft bzw. gesellschaftlichem Zusammenleben artikulieren. Im Blick auf seine eigentliche Konkretion deutet er das geschichtliche Sein des Volkes als Staat, der für ihn keine ‚Organisationsform einer Gesellschaft‘ ist. Da einzig Mensch, Volk, Staat ein geschichtliches Wesensverhältnis konstituieren, sieht er im Staat „das Wesensgesetz des geschichtlichen Seins, kraft dessen Fügung erst das Volk geschichtliche Dauer, d. h. die Bewahrung seiner Sendung und den Kampf um seinen Auftrag sich sichert […] Der Staat ist nur, sofern und solange die Durchsetzung des Herrschaftswillens geschieht, der aus Sendung und Auftrag entspringt und umgekehrt zu Arbeit und Werk wird“ (GA 38, 165). Für den Einzelnen heißt das, daß die Freiheit des geschichtlichen Selbstseins „in sich Ermächtigung des Staates als des Wesensgefüges einer geschichtlichen Sendung [ist]“ (GA 38, 164), die als ‚Kunde der Geschichte‘ dem zuteil wird, der in der Entschlossenheit zu sich selbst steht, denn „nur er kann und darf die Unumgänglichkeit des geschichtlichen Seins wissen“ (GA 38, 161). Aus dieser dezionistischen Grundhaltung gewinnt Heideggers politische Option ihre treibende Kraft. Ihre Motivation bezieht sie philosophisch aus der existenzialen Struktur, daß sich Dasein in seinem Schicksal je schon auf das Geschick bezieht, was in den Vollzugsmodi von Mitteilung und Kampf das geschichtliche Geschehen des Daseins in Generation und Volk als übergreifende ursprüngliche Gemeinschaftsformen konstituiert. Hier ergibt sich ein Problem. Es fragt sich, wie der Einzelne sich in die ihn übergreifenden Zusammenhänge einstellt. Eine Lösung bietet Heidegger in Sein und Zeit nicht. Es bleibt „eine Leerstelle, die auf unterschiedliche Weise ausgefüllt werden konnte“ (Pöggeler 1991, 336). Die Form, wie Heidegger dies tat, zeigt, daß er für sich die Lücke einer politischen Philosophie konzeptionell nicht zu schließen vermochte.8 Denn das Sicheinstellen in übergreifende Gemeinschaften fordert die Ausbildung von Sozialformen und -praktiken, die sich in Prinzipien des Rechts formatieren 8 Daß sein eigenes Unvermögen nicht notwendig die Konzeption der Existenzialontologie für diesen Phänomenkomplex diskreditiert, zeigen u. a. H. Arendts Arbeiten.
246
Hans-Helmuth Gander
und in gesellschaftlichen Institutionen bewähren müssen. Eine in diesem Sinne differenziert ausgearbeitete Phänomenologie des sozialen als gesellschaftlichen Lebens sucht man bei Heidegger vergeblich. Ein entscheidender Grund für dieses materiale Defizit liegt strukturell in der „thanatologischen Engführung“ (Rentsch 1991, 145) seiner Analysen, selbst dort, wo es primär um Gemeinschaft geht.9 Traditionell wird der Bereich interaktionsorientierter Lebensformen (Familie, Gesellschaft, Staat), auf die sich politische Philosophie bezieht, im Begriff des Geistes gefaßt und bekanntlich so bei Hegel als Sphäre der Sittlichkeit abgehandelt. Wo aber in „Sein und Zeit“ Hegel thematisiert wird (§ 82), erscheint er als Protagonist der uneigentlichen Geschichtlichkeit. Aus ihrem Bezug auf innerweltlich Seiendes konstituiert sich WeltGeschichte als innerzeitiges Geschehen, in dem „die ursprüngliche Erstrecktheit des Schicksals verborgen“ (391) ist. Nach Heidegger kennzeichnet dies Hegels Position. Denn für ihn setzt Hegel in seiner Bestimmung der geschichtlichen Verwirklichung des Geistes Zeit i. S. „der schlechthin nivellierten Weltzeit“ (435) an. Daraus schließt er, daß bei Hegel diese wie ein Vorhandenes dem Geist gegenübersteht mit der Folge, daß im Verhältnis beider die „Zeit […] den Geist gleichsam aufnehmen können [muß]“ (428). Diese Annahme, wonach Zeit und Geist als zwei getrennte Regionen vorgestellt werden müssen, erweist sich bei näherer Betrachtung der Kontexte, aus denen die Hegel-Zitate herausgeschnitten sind, eher als eine Heideggersche Konstruktion (s. Luckner 1997, 176–179) mit Konsequenzen für die Interpretation des zentralen Sachverhalts von § 82. Denn für Heidegger folgt aus dieser Gegenstellung, daß „der Geist allererst in ‚die Zeit‘ fallen muß“ (435). Wohl erkennt er, daß Hegels Denken „aus der Anstrengung und dem Kampf um ein Begreifen der ‚Konkretion‘ des Geistes“ (435) seine innere Führung erhält. Aber er sieht nicht, daß das in die Zeit Fallen eine Bewegung des sich Vermittelns mit und in der Welt ist, demzufolge Geist für Hegel in einer funktionalen Entsprechung zu dem steht, was Heidegger als „ursprüngliche Zeitigung“ (436) denkt und dessen Zeitigungsweise Hegel im Begriff als „sich begreifende Begriffenheit des Selbst“ (433) faßt. Was im gegebenen Kontext von Hegel als Zeit angesprochen wird, meint nicht, wie Heidegger suggeriert, dessen eigenen
9 Anschaulich wird dies, wenn Heidegger in prononciertem Gegenhalt zu Gesellschaftsmodellen, die auf Vertrag und Verabredung basieren, als Paradigma der ursprünglichen Gemeinschaft die durch die Nähe zum Tod konstitutierte „Kameradschaft der Frontsoldaten“ wählt (vgl. GA 39, 72 f.).
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
247
philosophischen Zeitbegriff. Wie der Zusammenhang der zitierten HegelStellen zeigt, bedeutet Zeit hier Naturzeit. Und wo sich bei Hegel Zeit auf die ‚abstrakte Subjektivität‘ bezieht, bezeichnet sie als Phänomen das, was von Heidegger her sich als „vulgäres Zeitverständnis“ bestimmen ließe, gegen deren Macht sich auch Hegel im Sinne seiner als Geist gedachten Zeitigung wendet, die qua Auslegung des Geistes als Geschichte in die Zeit fällt.
11.6 Die Charaktere der Weltzeit und ihre Fundierung in der Zeitlichkeit Für Heidegger bleibt Hegels Zeitbegriff „die radikalste […] Ausformung des vulgären Zeitverständnisses“ (428), das er von Aristoteles sich herschreiben sieht.10 Der vulgäre Zeitbegriff schließt an die Vorstellung von der „Zeit als einer endlosen, vergehenden, nicht umkehrbaren Jetztfolge“ (426) an. Sie auf den Begriff gebracht zu haben, ist die Leistung der traditionellen Zeittheorien, für die Heidegger keine Möglichkeit sieht, Anschluß an die horizontal ekstatische Zeitlichkeit zu gewinnen. Daß deshalb die gewöhnliche Zeitvorstellung keineswegs ohne Bezug zur Zeitlichkeit bleibt, verdeutlichen die Analysen des 6. Kapitels, das weit mehr die Untersuchung des 4. als des 5. Kapitel fortschreibt, was sich durch die Vorlesung des Sommers 1927 bestätigt (GA 24, vgl. v. Herrmann 1991b). Für die die Untersuchung abschließenden Überlegungen heißt das, daß die Gedankengänge des Schlußkapitels nur insoweit thematisch werden, als sie Antwort bieten auf das, was im Umfeld von Geschichtlichkeit und Geschichte mit Blick auf die Zeit als Innerzeitigkeit bereits angezeigt wurde. Im § 72 hatte Heidegger den Weg der Ableitung der Geschichtlichkeit aus der ursprünglichen Zeitlichkeit dadurch gerechtfertigt, daß es nur so gelänge, „der vulgären Charakteristik des Geschichtlichen mit Hilfe der Zeit der Innerzeitigkeit die scheinbare Selbstverständlichkeit und Aus-
10 Zur Aristoteles-Hegel-Linie vgl. Derrida 1988b, 53–84. Auf die historische Ausfaltung der behaupteten Genesis kann nicht näher eingegangen werden. Dies forderte u. a. eine detaillierte Auseinandersetzung mit Heideggers origineller Aristoteles-Zueignung. Zudem müßte die Konzeption der ‚vulgären Zeit‘ als Jetzt-Zeit, wie er sie für Philosophie und Wissenschaft als verbindlich ausgibt, mit Blick auf ihren Geltungsanspruch gespiegelt werden im Gang der Entwicklungen und Tendenzen, die die Zeit-Theorie seither genommen hat. Daß sich dabei von phänomenologischer wie hermeneutischer Seite hinsichtlich Heideggers Festschreibungen Diskussionsbedarf ergibt, belegen u. a. Ricoeurs (1991, 139–156) Ausführungen.
248
Hans-Helmuth Gander
schließlichkeit zu nehmen“ (377). Hauptadressat der Kritik ist der Ausschließlichkeitsanspruch, was darauf deutet, daß es einen Ansatzpunkt geben könnte, von dem aus die gewöhnliche Auslegung des zeitlichen Charakters der Geschichte innerhalb ihrer Grenzen zu ihrem Recht gelangt. Ihn freizulegen gelingt, wenn „Geschichtlichkeit und Innerzeitigkeit als gleichursprünglich“ (377) aufgewiesen werden, d. h. der Nachweis erfolgt, wie Zeit als Innerzeitigkeit aus der Zeitlichkeit entspringt. Hierfür muß gezeigt werden, „wie das Dasein als Zeitlichkeit ein Verhalten zeitigt, das sich in der Weise zur Zeit verhält, daß es ihr Rechnung trägt“ (405). Auf dieses „elementare Rechnen mit der Zeit“ (404), das der expliziten Zeitrechnung vorausgeht, konzentriert sich die Erörterung, sofern mit dem Aufweis des spezifischen Charakters des Zeitverhaltens der Ursprung des Besorgens der Zeit aus der Zeitlichkeit aufzuweisen möglich ist, und zudem sich damit die Tendenz seiner Nivellierung in Richtung des vulgären Zeitbegriffs anzeigt, der nicht mit dem natürlichen Zeitverhalten identisch ist. Da zum umsichtigen Besorgen als Sein-bei im existenzialen Sinne Welt gehört, bestimmt er die besorgte Zeit terminologisch als Weltzeit (404). Ihre Merkmale sind im Blick auf das in seiner Zeitlichkeit als ‚gewärtigendbehaltendes Gegenwärtigen‘ (§ 69) bestimmte umsichtige Besorgen Datierbarkeit, Spanne und Öffentlichkeit. Das natürliche Zeitverhalten, in dem sich das Dasein in seinen Verhaltungen bewegt, läßt sich als „unthematisches Vollzugsverständnis“ (v. Herrmann 1991b, 26) charakterisieren. Es spricht sich aus im ‚dann‘, ‚damals‘ oder ‚jetzt‘. Zu beachten ist, daß im natürlichen Zeitverhalten diese Charaktere nicht i. S. des vulgären Zeitbegriffs als Abfolge von Jetzt-Punkten verstanden werden. Es handelt sich vielmehr um ein ‚dann, wann‘, ein ‚damals, als‘ und ‚jetzt, da‘. Im ‚Rechnen mit der Zeit‘ als besorgendem Verhalten zur Zeit ist der Bezugscharakter „die Datierbarkeit“ (407). Wie die Analyse des ‚Uhrzeuggebrauchs‘ (§ 80) zeigt, geht diese ursprüngliche Datierung dem kalendarischen Datum voraus. Dabei erweist sich im umsichtigen Besorgen das ‚dann, wann‘, das ‚damals, als‘ oder ‚heute, da‘ als eine Zeit zu. Dasein datiert „die Zeit, die es sich nehmen muß, aus dem, was im Horizont der Überlassenheit an die Welt innerhalb dieser begegnet als etwas, womit es für das umsichtige In-der-Welt-sein-können eine ausgezeichnete Bewandtnis hat“ (412). Die Struktur der Datierbarkeit als Zeitangabe des alltäglichen Zeitverhaltens i. S. der Zeit-zu wird „zum elementarsten Beweis für die Herkunft des Ausgelegten aus der sich auslegenden Zeitlichkeit“ (408). Denn Dasein verhält sich zum bewandtnisbestimmten Seienden, wie die Zeitlichkeitsanalysen zeigten, aufgrund der Verfaßtheit als ‚gegenwärtigend behaltendes Gegenwärtigen‘ so, daß im
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
249
Jetzt-Sagen je schon, wenngleich unthematisch, „das Dasein ihm selbst als In-der-Welt-sein erschlossen und ineins damit innerweltlich Seiendes entdeckt ist“ (408). Mit anderen Worten hat aufgrund des ekstatischen Charakters der Gegenwart die Datierbarkeit ihren ursprünglichen Bezug aus dem in der Erschlossenheit des Welthorizontes begegnenden Seienden als z. B. ‚jetzt, da – ich dies schreibe‘. Entsprechendes gilt für ‚dann‘ und ‚damals‘. Dieser Bedeutsamkeitsbezug ist es, der vom vulgären Zeitbegriff, den § 81 in seiner Genesis nachzeichnet, übersprungen wird zugunsten des reinen Jetzt-Punktes. Darin erkennt Heidegger eine Nivellierung der aus der Zeitlichkeit entfalteten vollen Struktur der Weltzeit. Insofern gehört die vulgäre Zeitvorstellung zur alltäglichen Seinsart des verfallenden Daseins. Das bedeutet, daß auch der vulgäre Zeitbegriff als diese nivellierende Verdeckung ihren Rechtsgrund aus der Zeitlichkeit gewinnt. Anschluß hält der vulgäre Zeitbegriff und seine theoretische Reflexion (s. Augustinus) vor allem an den zweiten Strukturcharakter der Weltzeit, d. i. ihre Gespanntheit, die in konstitutiver Verknüpfung mit der Datierbarkeit als Zeitspanne (‚während‘, ‚bis dahin‘, ‚seitdem‘) erscheint. Wenngleich im Horizont des besorgenden Verhaltens angesprochen und also unerkannt, zeigt sich darin „die ekstatische Erstrecktheit der geschichtlichen Zeitlichkeit“ (409). Sofern Dasein nur als Mitsein existiert, heißt das für das natürliche Zeitverhalten des umsichtigen Besorgens, daß das ‚jetzt‘, ‚damals‘, ‚dann‘ der Weltzeit von vornherein im Miteinander-in-der-Welt geteilte Zeit ist. Diesen ursprünglichen Strukturcharakter nennt Heidegger Öffentlichkeit, insofern die „ausgelegte, ausgesprochene Zeit des jeweiligen Daseins […] als solche auf dem Grunde seines ekstatischen In-der-Welt-seins je auch schon veröffentlicht [ist]“ (411). So erweist sich die öffentliche Zeit als diejenige, ‚in der‘ innerweltlich Vor- und Zuhandenes begegnet, was ihn dazu veranlaßt, dieses nichtdaseinsmäßige Seiende terminologisch „innerzeitiges“ (412) zu nennen. In einer Auslegung der aus der Weltzeit konstituierten Innerzeitigkeit des Zu- und Vorhandenen sieht er die Möglichkeit, ein ursprünglicheres Verständnis des Wesens der öffentlichen Zeit zu gewinnen. Die folgenden leicht nachvollziehbaren Analysen zur Zeitmessung als „ausdrückliche Veröffentlichung der besorgten Zeit“ (415; vgl. Figal 2000, 295–307) führen ihn zu der Einsicht, daß das alltägliche sich Zeit nehmende und gebende Besorgen „,die Zeit‘ am innerweltlich Seienden, das ‚in der Zeit‘ begegnet“ (420), findet. Damit ist die Spur zum vulgären Zeitbegriff gelegt, zu dem die Analyse mit dem nächsten Paragraph übergeht. Unter den gegebenen Vorzeichen ist dieser Weg stimmig. Dennoch bleibt ein Problem hinsichtlich der gemachten Voraussetzungen ungelöst. Es stellt sich nämlich die Frage, ob
250
Hans-Helmuth Gander
die Öffentlichkeitsstruktur der Weltzeit allein anhand der besorgten Zeit aufgewiesen werden sollte. Umreißt das, was Heidegger mit Datierbarkeit, Gespanntheit und Öffentlichkeit als zur so strukturierten Welt selbst gehörig im Sinne eines a priori fungierenden existenzialen Strukturzusammenhangs faßt und für die Weltzeit qua besorgter Zeit entfaltet, schon das Ganze des aus dem Seins- und Weltverständnis der Existenz her zu erhellenden natürlichen Zeitverhalten? Müßte ein aus dem Mitsein her gedachtes interexistenziales Verhalten wirklich das Strukturmoment der Öffentlichkeit im Ansatz bereits einzig i. S. der „öffentlichen durchschnittlichen Verständlichkeit“ (410) in Blick nehmen? Hier zeigen sich ähnliche Probleme, wie sie im 5. Kapitel begegneten. Sie erweisen sich im Binnenhorizont der Heideggerschen Konzeption zumindest auf der Ebene ihrer Durchführung als ungelöst. Ein dadurch inspiriertes Weiterfragen wird in der Relektüre des in Sein und Zeit vorgelegten Programmentwurfes weder hagiographisch noch inquisitorisch, sondern getreu dem alten Sapere aude! nüchtern sich in kritischer Analyse um Korrektur und Ergänzung mühen. Sie betriebe mithin noch immer das, was Heidegger am Schluß von Sein und Zeit (§ 83) für seine philosophische Konzeption im ganzen geltend macht: daß phänomenologische Ontologie auszugehen hat „von der Hermeneutik des Daseins, die als Analytik der Existenz das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragens dort festgemacht hat, woraus es entspringt und wohin es zurückschlägt“ (436).
11 Existenzialontologie und Geschichtlichkeit
251
Literatur Barash, Jeffey Andrew 1999: Heidegger und der Historismus. Sinn der Geschichte und Geschichtlichkeit des Sinns, Würzburg Blust, Franz-Karl 1987: Selbstheit und Zeitlichkeit. Heideggers neuer Denkansatz zur Seinsbestimmung des Ich, Würzburg Brandner, Rudolf 1994: Heideggers Begriff der Geschichte und das neuzeitliche Geschichtsdenken, Wien Dallmayr, Fred R. 1980: Heidegger on Intersubjectivity. In: Human Studies 3, 221–246 Derrida, Jacques 1988a: Vom Geist. Heidegger und die Frage, Frankfurt/M. Derrida, Jacques 1988b: Ousia und gramme. Notiz über eine Fußnote in „Sein und Zeit“, in: ders.: Randgänge der Philosophie, hrsg. von P. Engelmann, Wien Esposito, Roberto 1997: Die ursprüngliche Gemeinschaft, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45. Jg., H. 4, 551–558 Figal, Günter 2000: Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit, 3. Aufl., Weinheim Figal, Günter 2003: Martin Heidegger zur Einführung, 4. Aufl., Hamburg Gadamer, Hans-Georg 1987: Der eine Weg Martin Heideggers, in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. 3, Tübingen, 417–430 Gander, Hans-Helmuth 2001: Selbstverständnis und Lebenswelt. Grundzüge einer phänomenologischen Hermeneutik im Ausgang von Husserl und Heidegger, Frankfurt a. M.; 2. Aufl. 2006 Gethmann, Carl Friedrich 1974: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers, Bonn Heinz, Marion 1982: Zeitlichkeit und Temporalität. Die Konstitution der Existenz und die Grundlegung einer temporalen Ontologie im Frühwerk Martin Heideggers, WürzburgAmsterdam Herrmann, Friedrich Wilhelm von 1991a: Heideggers „Grundprobleme der Phänomenologie“. Zur „Zweiten Hälfte“ von „Sein und Zeit“, Frankfurt a. M. Herrmann, Friedrich Wilhelm von 1991b: Der Zeitbegriff Heideggers. In: Mesotes. Supplementband: Martin Heidegger, 22–34 Löwith, Karl 1986: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, Stuttgart. Luckner, Andreas 1997: Martin Heidegger: „Sein und Zeit“. Ein einführender Kommentar, Paderborn-München-Wien-Zürich Michalski, Mark 1997: Fremdwahrnehmung und Mitsein. Zur Grundlegung der Sozialphilosophie im Denken Max Schelers und Martin Heideggers, Bonn Pöggeler, Otto 1990: Der Denkweg Martin Heideggers, 3. erw. Aufl., Pfullingen Pöggeler, Otto 1991: Heidegger und die politische Philosophie. In: Zur philosophischen Aktualität Martin Heideggers, hrsg. von D. Papenfuss/O. Pöggeler, Frankfurt a. M., Band. 1, 328–350 Rentsch, Thomas 1991: Interexistenzialität. Zur Destruktion der existenzialen Analytik, in: R. Margreiter/K. Leidlmair (Hg.): Heidegger. Technik-Ethik-Politik, Würzburg, 143–152 Ricoeur, Paul 1991: Zeit und Erzählung, Bd III: Die erzählte Zeit, München Vetter, Helmuth 1991: Anmerkungen zum Begriff des Volkes bei Heidegger in: R. Margreiter/ K. Leidlmair (Hg.): Heidegger. Technik-Ethik-Politik, Würzburg, 239–248 Volkmann-Schluck, Karl-Heinz 1996: Die Philosophie Martin Heideggers. Eine Einführung in sein Denken, hrsg. von B. Heimbüchel, Würzburg Weiß, Johannes (Hg.) 2001: Die Jemeinigkeit des Mitseins. Die Daseinsanalyse Martin Heideggers und die Kritik der soziologischen Vernunft, Konstanz.
12 Theodore Kisiel
Das Versagen von Sein und Zeit: 1927–1930
Als wohl das wichtigste Buch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts bleibt Sein und Zeit dennoch ein Fragment. „Dieser erstaunliche Torso“ (so Herbert Spiegelberg) wird vom Autor selbst als ein unreifer, vorzeitiger Denkweg beurteilt. „Vielleicht ist es der Grundmangel des Buches Sein und Zeit, daß ich mich zu früh zu weit vorgewagt habe“ (Heidegger 1959a, 93). Diese Bemerkung spielt auf die Hastigkeit der Veröffentlichung des Buches an. Der Sache nach schon im Kriegsnotsemester 1919 angefangen, 1923– 1924 als langen (nie erschienenen) Zeitschriftenartikel über den Zeitbegriff niedergeschrieben (Heidegger 1989b), seinen ersten Abschnitt strukturell in der Vorlesung vom Sommersemester 1925 über die „Geschichte des Zeitbegriffs“ (GA 20) vorgelegt, hat Heidegger das Buch in der endgültigen Fassung seiner ersten beiden Abschnitte erst 1926 in einigen Monaten unter großem akademischem Publikationsdruck fertiggestellt (vgl. Kisiel 1993, v. a. 477– 489). Sein und Zeit. Erste Hälfte erschien als Separatausgabe im April 1927 und einen Monat später gemeinsam mit nur einem weiteren Text (Mathematische Existenz von Oskar Becker) im Husserlschen Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Aber warum ist dessen „Zweite Hälfte“ nie erschienen? Warum wurde der in einem Aufriß als vollständig skizzierte Text (39 f.) des geplanten zweibändigen Buches im Verlauf der Abfassung schon vor dem Erscheinen des ersten Bandes abgebrochen? Heidegger hat in den nächsten Jahrzehnten die Geschichte dieses Abbruchs mehrmals erzählt und sich in diesem Zusammenhang normalerweise auf die unterschiedlichen Mißdeutungen von Sein und Zeit als Anthropologie, Ontologie des Menschen und Existenzphilosophie bezogen. Die Verkennung seiner fundamentalontologischen Absicht hätte wohl mit dem rechtzeitigen Erscheinen des fehlenden
254
Theodore Kisiel
dritten Abschnitts verhindert bzw. verringert werden können. Wir zitieren die bekannteste Erzählung (GA 49, 39 f.) mit einigen wichtigen Ergänzungen, um einige anekdotische Hinweise auf den Inhalt des fehlenden Abschnitts zu erhalten: „Außerdem wird das Verständnis des in ‚Sein und Zeit‘ gebrauchten ‚Existenzbegriffes‘ dadurch erschwert, daß der ‚Sein und Zeit‘ gemäße existenziale Existenzbegriff“ [„das Selbstsein des Menschen, sofern es sich […] auf das Sein und den Bezug zum Sein bezieht“ (GA 49, 39 oben)] „erst voll entwickelt war in dem Abschnitt, der infolge des Abbruchs der Veröffentlichung nicht mitgeteilt wurde; denn der dritte Abschnitt des 1. Teils ‚Zeit und Sein‘ erwies sich während der Drucklegung als unzureichend“ [„und äußere Umstände (das Anschwellen des Jahrbuchbandes) verhinderten zugleich glücklicherweise die Veröffentlichung dieses Stückes“ (GA 66, 413)]. „Der Entschluß zum Abbruch wurde gefaßt“ [in den ersten Januartagen 1927 – Korrektur T. K.] „während eines Aufenthaltes in Heidelberg bei K. Jaspers, wo mir aus lebhaften freundschaftlichen Auseinandersetzungen an Hand der Korrekturbogen von ‚Sein und Zeit‘ klar wurde, daß die bis dahin erreichte Ausarbeitung dieses wichtigsten Abschnittes (I, 3) unverständlich bleiben müsse. Der Entschluß zum Abbruch der Veröffentlichung wurde gefaßt an dem Tage, als uns die Nachricht vom Tode R. M. Rilkes traf.“ [„Ein Gespräch über diesen Dichter am selben Tag macht mir die unvereinbare Verschiedenheit der Grundstellung von ‚Sein und Zeit‘, sowohl im Verhältnis zu Rilke als auch im Verhältnis zu Jaspers, besonders deutlich“ (Zur Erläuterung von SZ 1941)]. [„Der Versuch“ in der ersten Ausführung, (T. K.) „ist vernichtet, aber sogleich auf mehr geschichtlichem Wege ein neuer Anlauf gemacht in der Vorlesung vom S. S. 1927“ (GA 66, 413 f.)]. „Allerdings war ich damals der Meinung, übers Jahr schon alles deutlicher sagen zu können. Das war eine Täuschung. So kam es in den folgenden Jahren zu einigen Veröffentlichungen, die auf Umwegen zu der eigentlichen Frage hinführen sollten“ (GA 49, 40). [„,Sein und Zeit‘ 1927 […] entstand […] als ein erster Weg möglichst von Grund aus und zugleich in wirklicher Durchführung die Seinsfrage sichtbar zu machen in der Gestalt, die wesentlich über alle bisherige Fragestellung hinaus und doch zugleich in die Auseinandersetzung mit den Griechen und der abendländischen Philosophie zurück führt“ (GA 66, 413). „Gerade weil die Fragestellung nach dem Sinn des Seins (nach der Entwurfswahrheit des Seins – nicht des Seienden) gegenüber der ganzen bisherigen Metaphysik eine andere ist, hätte dieses Fragen – obzwar im Mitgeteilten oft gesagt ist was es will – doch gezeigt werden können, was es leistet; denn das Ungenügende des zurückgehaltenen Stückes war nicht
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
255
eine Unsicherheit der Fragerichtung und ihres Bereiches, sondern nur die der rechten Ausarbeitung“ (GA 66, 414)]. Laut Aufriß sollte der endgültige „systematische“ dritte Abschnitt über Zeit und Sein „die Explikation der Zeit als des transzendentalen Horizontes der Frage nach dem Sein“ (39) durchführen. Man hätte erwarten können, daß dieser letzte Abschnitt des ersten Teils von Sein und Zeit zumindest in dem Übergang zum „historischen“ zweiten Teil über eine „phänomenologische Destruktion der Geschichte der Ontologie“ von neuem die ganz andere Gestalt seiner Seinsfrage „gegenüber der ganzen bisherigen Metaphysik“ unterstreichen würde. Sicher in der revolutionären Fragerichtung, aber unzureichend in der rechten Ausarbeitung bis zur Unverständlichkeit für Köpfe wie Rilke und Jaspers: Wo genau liegt das Ungenügende des dritten Abschnittes, der nach wiederholten Versuchen ihn abzufassen, nie erscheinen wird? Heideggers Erklärung im Brief über den Humanismus kommt uns wie ein endgültiges Fazit dieser Versuche vor. In diesem Zusammenhang versucht Heidegger der Mißdeutung des „Entwurfs“ des Seinsverständnisses als Leistung der Subjektivität vorzubeugen. Das Seinsverständnis sei kein vorstellendes Setzen, keine Leistung der Subjektivität. Es könne nur als der ekstatische Bezug zur Lichtung des Seins gedacht werden: „Der zureichende Nach- und Mit-vollzug dieses anderen, die Subjektivität verlassenden Denkens ist allerdings dadurch erschwert, daß bei der Veröffentlichung von ‚Sein und Zeit‘ der dritte Abschnitt des ersten Teiles, ‚Zeit und Sein‘ zurückgehalten wurde (vgl. ‚Sein und Zeit‘ S. 39). Hier kehrt sich das Ganze um. Der fragliche Abschnitt wurde zurückgehalten, weil das Denken im zureichenden Sagen dieser Kehre versagte und mit der Hilfe der Sprache der Metaphysik nicht durchkam. Der Vortrag ‚Vom Wesen der Wahrheit‘, der 1930 gedacht und mitgeteilt, aber erst 1943 gedruckt wurde, gibt einen gewissen Einblick in das Denken der Kehre von ‚Sein und Zeit‘ zu ‚Zeit und Sein‘. Dieser Kehre ist nicht eine Änderung des Standpunkts von ‚Sein und Zeit‘, sondern in ihr gelangt das versuchte Denken erst in die Ortschaft der Dimension, aus der ‚Sein und Zeit‘ erfahren ist, und zwar erfahren in der Grunderfahrung der Seinsvergessenheit“ (GA 9, 327 f.). Das Unzureichende des zurückgehaltenen Abschnittes liegt in seinem Sagen der Kehre. Es versagt bei dem Versuch, diese Kehre mit Hilfe der Sprache der Metaphysik durchzuführen, das heißt der Sprache von Subjekt und Objekt, welche die Grammatik der abendländischen Sprachen durchherrscht. Der spätere Heidegger sucht deshalb nach einer Verwandlung des Wesens der Sprache; er wartet auf eine „Sprache des Seins“, die das uns
256
Theodore Kisiel
unverfügbare Ereignis von „Seyn“ und „Zeyt“ anzeigen wird. Schon der jüngere Heidegger war sich dieses Problems der abendländischen Sprache bewußt. Kurz vor dem Aufriß des Gesamtplans von Sein und Zeit bemerkt er: „Für die […] Aufgabe, [Seiendes in seinem Sein zu fassen – T. K.], fehlen nicht nur meist die Worte, sondern vor allem die ‚Grammatik‘“ (39). Von dem Rezensionsartikel Neuere Forschungen über Logik (1912) bis zur Habilitationsschrift über scotistische Kategorien- und Bedeutungslehre (1915/16, vgl. GA 1) dreht sich das Interesse des jungen Heidegger um eine Logik der Philosophie (so auch der Titel eines Buches von Emil Lask), welche eigentümliche Phänomene am Rand der herrschenden Grammatik der Subjekt-Prädikat-Relation wie Existentialsätze und impersonale Urteile in Betracht zieht. Die Logik der philosophischen Begriffsbildung, die für den Neukantianer Lask eine transzendentale Logik ist, wird von Heidegger zu einer phänomenologischen (das heißt hermeneutisch-ontologischen) Logik ausgebildet. Schon im Kriegsnotsemester (= KNS) 1919 ersetzt er den bekannten neukantianischen Ausdruck für die transzendentale Differenz, „Es ‚ist‘ nicht, sondern Es gilt (oder allgemeiner: ‚Es wertet‘)“, durch neugeprägte Impersonalsätze, die nun eigentlich eine ontologische Differenz ausdrücken sollen: „Es ‚ist‘ nicht, sondern Es weltet, Es er-eignet sich“ (vgl. Kisiel 1992). Daher finden wir in Sein und Zeit (328) existentialontologische Sätze wie „sie [die Zeitlichkeit – T. K.] ist nicht, sondern zeitigt sich“ (auch in GA 26, 264); und über den Horizont dieser Zeitlichkeit heißt es: „Er ‚ist‘ überhaupt nicht, sondern er zeitigt sich“ (GA 26, 269). Heideggers Suche nach einer nichtobjektivierenden Sprache des Seins im Rahmen einer phänomenologischen Logik der philosophischen Begriffsbildung wird insbesondere in den dramatischen Schlußstunden des KNS 1919 deutlich (GA 56/57, 107–117). Es geht ihm darum, den methodischen Hauptbegriff der Phänomenologie, denjenigen der Intentionalität, in seiner Anwendung auf das Ur-etwas (das Leben an und für sich, das Erleben) von allen Spuren einer formallogischen Mißdeutung als starrer Dualität vom Subjekt gegenüber dem Objekt zu befreien. Einer Mißdeutung, die durch Objektivierung und theoretische Antastung zu einer Entlebung, Entgeschichtlichung, Entdeutung und Entweltlichung des Lebens führt. Intentionalität in ihrer rein phänomenologischen Formalität ist schlicht ein Sich-richten-auf. Sie wird als das Verhalten als solches in seinem reinen Moment des formalen Auf-zu angezeigt, das als das Herz, die Mitte, der Ursprung, die verborgene Quelle des Lebens und das innerliche Geschehen seines Seins betrachtet wird. Das Worauf dieses Verhaltens wird zunächst als ein einheitlicher intentionaler Bezug vom Motiv zur
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
257
Tendenz und zurück in einer intentionalen Kreisbewegung der „motivierten Tendenz bzw. tendierenden Motivation“ (GA 56/57, 117) beschrieben. In Sein und Zeit (324, 152) heißt „das Woraufhin des primären Entwurfs“ der Sinn des Daseins qua Zeitlichkeit, dessen Kreisbewegung als geworfenes Entwerfen umschrieben wird. Die formale Anzeige wird daher zur „methodischen Geheimwaffe“ (vgl. Kisiel 1997) in Heideggers Logik der philosophischen Begriffsbildung. Im veröffentlichten Bruchstück von Sein und Zeit wird sie etwa ein halbes Dutzend mal ohne weitere Erklärung erwähnt (53, 114, 116 f., 179, 231, 313–315; aber auch: „vorläufige Anzeige“, 14, 16, 41). Die formale Anzeige als der echt methodisch-phänomenologische Leitbegriff der Phänomenologie des Phänomens in einem ausgezeichneten Sinne (35), müßte in ihrer hermeneutischen Logik eigentlich ein nun zu erläuterndes Hauptthema des dritten Abschnittes werden. Unterwegs zu Sein und Zeit geht Heidegger durch eine Reihe von formalen Anzeigen, aber jede ist als eine formelle Vertiefung der Praestruktion der Intentionalität anzusehen, die als reines Sich-richten-auf verstanden wird: Als eine dreidimensionale Intentionalität nach ihrem Bezugssinn, Gehaltssinn und Vollzugssinn (1920–22) und mit einem zusammenfassenden Zeitigungssinn erst 1922 ergänzt; als Da-sein (1923), In-der-Welt-sein (1924), Zu-sein (1925), Ex-sistenz (1926) und als Transzendenz (1927–29). Daher ist die reine Formel für die Struktur der Sorge in Sein und Zeit, „Sich-vorweg-schon-sein-in-(der Welt)“ als „Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden)“, in einem weiteren (das heißt vortheoretischen) Sinne klar intentional (192). Der „neue Anlauf auf mehr geschichtlichem Wege“ zum dritten Abschnitt im SS 1927 gelangt daher zu folgender Schlußreihe über die Reihe von formalen Anzeigen: „Die Intentionalität ist die ratio cognoscendi der Transzendenz. Diese ist die ratio essendi der Intentionalität in ihren verschiedenen Weisen“ (GA 24, 91); kantisch ausgedrückt wird die Transzendenz die Bedingung der Möglichkeit der Intentionalität (vgl. GA 24, 447). Als Grundbestimmung der ontologischen Struktur des Daseins gehört die Transzendenz zur Existenzialität der Existenz (vgl. GA 24, 230). „Auf mehr geschichtlichem Wege“ merkt man, wie stark die Verhältnisse der formalen Anzeigen in einer traditionellen „metaphysischen Sprache“ ausgedrückt werden. Schließlich wird sich zeigen, daß die ganze Reihe von formalen Anzeigen „die Bedingung ihrer Möglichkeit in der Zeitlichkeit und ihrem ekstatisch-horizontalen Charakter“ hat (GA 24, 379). Intentionalität, Transzendenz, Existenz: Im Grunde genommen zeigen sie jeweils ihre Zeitstruktur an. Was könnte im faktischen Leben formaler sein als die Zeit? Und in Bezug auf die anzeigende Funktion: Was könnte im faktischen Leben
258
Theodore Kisiel
konkreter und unmittelbarer, uns näher sein als die Zeit? Die ekstatische Zeit ist die letzte Formalität des Lebens (Seins) und zugleich die unmittelbarste Nähe des Daseins, die Faktizität als solche. In einer Notiz, die in den Umkreis der neuen Anläufe zum dritten Abschnitt gehört, bemerkt Heidegger: „Zeitlichkeit: Sie ist nicht nur ein Faktum, sondern selbst mit dem Wesen des Faktums: Faktizität. Das Faktum der Faktizität (hier die Wurzel der „Umkehrung der Ontologie“). Kann man fragen: ‚wie entsteht die Zeit?‘ […] Mit der Zeit je erst Möglichkeit des Entstehens. […] Was heißt aber dann die Unmöglichkeit des Problems einer Entstehung der Zeit?!“ (Heidegger Studies 7, 1991, 9).
12.1 Zur Rekonstruktion des fehlenden Abschnitts „Daß und wie die Intentionalität des ‚Bewußtseins‘ in der ekstatischen Zeitlichkeit des Daseins gründet, wird der folgende Abschnitt zeigen“ (363 Anm.). Dieser ausdrückliche Hinweis auf den dritten Abschnitt in Sein und Zeit ist eine weitere Bestätigung dafür, daß der dritte Abschnitt als ein methodisches Hauptstück über den Richtungssinn einer formal anzeigenden Hermeneutik eingeordnet worden wäre. In demselben § 69 von Sein und Zeit findet sich ein gleichgerichteter Hinweis. Dieser verweist aber nicht nur auf die noch zu entwickelnde „Idee der Phänomenologie im Unterschied zum einleitend angezeigten Vorbegriff [§ 7]“, sondern auch auf den dazugehörigen „existenzialen Begriff der Wissenschaft“ und dessen Sinn „der ontologischen Genesis der theoretischen Verhaltung“: „Die vollzureichende existenziale Interpretation der Wissenschaft läßt sich jedoch erst dann durchführen, wenn der Sinn von Sein und der ‚Zusammenhang‘ zwischen Sein und Wahrheit aus der Zeitlichkeit der Existenz aufgeklärt sind“ (357). Und jene Aufklärung ist die „zentrale Problematik“ (357) des dritten Abschnittes. Zur Vorbereitung für diese Aufgaben des folgenden Abschnittes entfaltet § 69c (364 ff.) „Das zeitliche Problem der Transzendenz der Welt“, das heißt das Problem, wie die Welt sich als das Woraufhin der zeitlichen Ekstasen in eine horizontale Einheit nach den „horizontalen Schemata“, nach dem jeweiligen „Wohin“ der Ekstasen, zeitigt. Damit ist die zeitliche Transzendenz der Welt ekstatisch-horizontal fundiert. Die ekstatische Einheit der Zeitlichkeit wird am Anfang des § 69 (vgl. 350 f.) auch als gelichtete Lichtung des Daseins bezeichnet, welche die Erschlossenheit des Da begründet. Die Aufklärung des Zusammenhangs zwischen Sein und Wahrheit fängt daher mit dem Dasein an, dessen Grundcharakter das Seinsverständnis ist. Das Seinsverständnis wird wiederum durch Er-
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
259
schlossenheit, das heißt befindliches Verstehen, dynamisch verstanden als geworfenes Entwerfen, ermöglicht (vgl. § 44c, 230). Der geworfene Entwurf, der Dasein in seiner Ek-sistenz ist, gründet endlich in der ekstatischen Zeitlichkeit, in der gelichteten Lichtung des Da. Die Zeit wird auf diese Weise als „Vorname“ für die Wahrheit verwendet, die nun als Erschlossenheit, Lichtung und Unverborgenheit verstanden wird. „Sein [als Zeit entworfene – T. K.] und Wahrheit ‚sind‘ gleichursprünglich“ (230).
12.2 Grundprobleme der Phänomenologie (SS 1927) Die Vorlesung vom SS 1927, die Heidegger entwicklungsgeschichtlich als eine „neue Ausarbeitung des 3. Abschnitts des I. Teiles von ‚Sein und Zeit‘“ (GA 24, 1 Anm.) versteht, geht nur ein Stück des in Sein und Zeit angezeigten Weges zum Zusammenhang von Sein und Wahrheit, welcher das angestrebte Ziel der Vorlesung war (vgl. GA 24, 24 f, 33), ehe sie wegen des großen Umweges durch die Geschichte der Ontologie abgebrochen wurde. Die „Anfangs-, End- und Grundfrage“ einer phänomenologischen Wissenschaft vom Sein lautet: „Wie ist Seinsverständnis überhaupt möglich?“ (GA 24, 19). Ausdrücklicher gefragt: „Von wo aus, das heißt: aus welchem vorgegebenen Horizont her verstehen wir dergleichen wie Sein?“ (GA 24, 21). Die vorausgesetzte Analytik des Daseins gibt eine erste Antwort: „Der Horizont, aus dem her dergleichen wie Sein überhaupt verständlich wird, ist die Zeit. Wir interpretieren das Sein aus der Zeit (tempus). Die Interpretation ist eine temporale. Die Grundproblematik der Ontologie […] ist die der Temporalität“ (GA 24, 22). Ontologie ist nicht nur eine kritische und transzendentale (vgl. GA 24, 23), sie ist auch eine temporale Wissenschaft (vgl. GA 24, 324), die deswegen ganz anders als alle anderen, die sogenannten positiven Wissenschaften, ist. Aber wie eine positive Wissenschaft das vorliegende Seiende auf den latenten Horizont seines jeweiligen Seins,1 auf das Wohin „des Entwurfs der Seinsverfassung [seines Was- und Wieseins – T. K.] eines Gebietes von Seiendem“ (GA 24, 457), vergegenständlicht, so muß die Ontologie das Sein selbst „auf den Horizont
1 Heidegger spricht nie von einem Horizont des Seins; das Wort wird in diesem Zusammenhang für einen Horizont der Zeit bzw. Welt reserviert. Aber eine horizontale Zeitlichkeit wird in Sein und Zeit zum allerersten Mal in Bezug auf das horizontale Schema der Als-Struktur erwähnt, das Schema des „wenn-so“ (359), das heißt das Was und Wie des Seins eines Seienden, nach dem die Genesis des theoretischen Verhaltens durch Modifikation des Seinverständnisses geschieht (vgl. 360).
260
Theodore Kisiel
seiner Verstehbarkeit“ (GA 24, 459), auf die Temporalität, vergegenständlichen. Ontologie wird eine temporale Wissenschaft, „weil der temporale Entwurf eine Vergegenständlichung des Seins ermöglicht und eine Begreifbarkeit sichert, das heißt die Ontologie überhaupt als Wissenschaft konstituiert“ (GA 24, 459 f). Der Grundakt, durch den sich die Ontologie als Wissenschaft konstituiert, vollzieht sich in der Vergegenständlichung des Seins als solchem (vgl. GA 24, 398). Der Grundakt der Vergegenständlichung hat „die Funktion, das Vorgegebene ausdrücklich auf das zu entwerfen, woraufhin es im vorwissenschaftlichen Erfahren bzw. Verstehen schon entworfen“ und enthüllt wird (GA 24, 399). Die ausdrückende Vergegenständlichung „thematisiert“ (GA 24, 398) und „die Thematisierung objektiviert“ (363). Mit dieser grundbegrifflichen Artikulation bzw. ausdrücklichen Interpretation des führenden Seinsverständnisses einer Wissenschaft bestimmen sich u. a. die jeweilige Struktur ihrer Begrifflichkeit, die zugehörige Möglichkeit der Wahrheit und die Art der Mitteilung ihrer wahren Sätze (vgl. 362 f.). Die wahren Sätze der wissenschaftlichen Ontologie sind apriorische, transzendentale und temporale (vgl. GA 24, 460 f.). Die phänomenologische Sprache des Seins als solchem ist die Sprache der Temporalität, die eigentlich „der transzendentale Horizont der Frage nach dem Sein“ ist (vgl. GA 24, 460 f.). Damit ist das ausdrückliche Ziel des dritten Abschnittes, das Ziel „der Explikation der Zeit“ als eines solchen „Horizontes“, erreicht (39). Temporalität ist der transzendentale Horizont des Seinsverständnisses, insbesondere des fraglich-fragwürdigen. Die Temporalität ist die in der existenzialen Analytik ausgelegte Zeitlichkeit, wenn sie in ihrer Funktion thematisiert wird als Bedingung der Möglichkeit des vorontologischen wie des ontologischen Seinsverständnisses und daher der Ontologie als solcher (vgl. GA 24, 324, 388). In dieser Funktion ist die Temporalität „die ursprünglichste Zeitigung der Zeitlichkeit als solcher“ (GA 24, 429). Die Temporalität als die ursprünglichste Zeitlichkeit ist die radikalste Zeitlichkeit, die grundfaktische Zeitlichkeit bis zum Abgrund, das heißt, „das Er-eignis“, wenn wir es mit dem Lieblingswort des späteren Heidegger ausdrücken dürfen. Aber 1927 zögert Heidegger, in die verborgene Tiefe der Zeitlichkeit „vor allem hinsichtlich ihrer Temporalität“ vorzudringen und auch „auf das Problem der Endlichkeit der Zeit“ einzugehen (GA 24, 437). „Inwiefern liegt in der Temporalität überhaupt und zugleich in der Zeitlichkeit ein Negatives, ein Nicht? Oder gar: Inwiefern ist die Zeit selbst die Bedingung der Möglichkeit von Nichtigkeit überhaupt? […] Eine nähere Betrachtung zeigt, daß auch das Nicht bzw. das Wesen des Nicht, die Nichtigkeit, ebenfalls aus dem Wesen der Zeit interpretiert werden kann und daß von hier aus erst die Möglich-
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
261
keit der Modifikation, zum Beispiel der Anwesenheit zur Abwesenheit, aufzuklären ist. […] Wir sind nicht vorbereitet genug, um in dieses Dunkel vorzudringen“ (GA 24, 443). Ein Grund dafür liegt in der Unvollständigkeit der Analysen der Temporalität im ganzen als „Zeitlichkeit mit Rücksicht auf die Einheit der ihr zugehörigen horizontalen Schemata“ (GA 24, 436). Der Horizont der ekstatischen Zeitlichkeit wird genauer als das horizontale Schema der entsprechenden Ekstase verstanden. Denn jede Ekstase als Entrückung-zu hat in sich zugleich eine Vorzeichnung der formalen Struktur des Wozu der Entrückung, die nie eine unbestimmte Entrückung in das Nichts ist. Dieses vorgezeichnete Wohin der Ekstase ist das ihr zugehörige horizontale Schema (vgl. GA 24, 428 f). In Sein und Zeit (365) werden die horizontalen Schemata präpositional, das heißt sinnhaft ausgedrückt, nach dem Muster des Sinnes als des vor-strukturierten Woraufhin (152): das Umwillen seiner (der Ekstase der Zu-kunft), das Wovor der Geworfenheit bzw. das Woran der Überlassenheit (Ge-wesenheit), das Um-zu (Gegen-wart). Aber im SS 1927 hat Heidegger vor, die horizontalen Schemata mit den lateinischen Ausdrücken für die „Tempora“ der Zeit zu bezeichnen. „Wir gebrauchen jetzt in der Dimension der Interpretation des Seins aus der Zeit für alle Zeitbestimmungen absichtlich lateinische Ausdrücke, um sie von den Zeitbestimmungen der Zeitlichkeit in dem bisher charakterisierten Sinne schon terminologisch zu unterscheiden“ (GA 24, 433). Präsenz wird statt Gegenwart gebraucht, und Präsenz heißt nun das horizontale Schema der Gegenwart. Genauer soll die Präsenz (statt des Um-zu) ausdrücklich „die Bedingung der Möglichkeit des Verstehens von Zuhandenheit als solcher ausmachen“ (GA 24, 434). „Als die Bedingung der Möglichkeit des ‚über sich hinaus‘ hat sie [die Praesenz – T. K.] in sich selbst eine schematische Vorzeichnung dessen, wo hinaus dieses ‚über sich hinaus‘ ist. […] Präsenz ist nicht identisch mit Gegenwart, sondern als Grundbestimmung des horizontalen Schemas dieser Ekstase macht sie die volle Zeitstruktur der Gegenwart mit aus. Das Entsprechende gilt von den beiden anderen Ekstasen, Zukunft und Gewesenheit (Wiederholung, Vergessen, Behalten)“ (GA 24, 435). Aber Heidegger behandelt nur die Ekstase der Gegenwart mit Rücksicht auf Präsenz und sagt gar nichts über die anderen Ekstasen mit Rücksicht auf ihre vermutlich latinisierten Tempora und Schemata, wohl das Futurum und das Präteritum. Jedoch ist insbesondere die Präsenz nicht selbständig, sie steht in einem inneren temporalen Zusammenhang mit den anderen temporalen Schemata. „Je nach der Zeitigungsart der Zeitlichkeit, die sich immer in der Einheit ihrer Ekstasen zeitigt, so daß der
262
Theodore Kisiel
Vorrang einer Ekstase jeweils die anderen mitmodifiziert, variieren auch die inneren temporalen Zusammenhänge der horizontalen Schemata der Zeit“ (GA 24, 436). Schon in einer Zusammenfassung des präpositionellen Nexus von Sein und Zeit hat Heidegger betont, daß die Bezüge des Um-zu nur verstanden sind, „wenn das Dasein so etwas wie das Umwillen seiner selbst versteht“ (GA 24, 418). Ein Um-zu wird enthüllbar nur, sofern das Umwillen eines Seinkönnens verstanden wird. Aber das Futurum als Bedingung der Möglichkeit des Verstehens des Selbst des Daseins ist überhaupt nicht in Betracht gezogen, es sei denn in seinem inneren Zusammenhang mit der Präsenz. Mit der alleinigen Behandlung der Präsenz gibt Heidegger anscheinend den Spielraum für die Herrschaft einer Metaphysik der ständigen Anwesenheit frei, die das Sein des Seienden nur „im Horizont des herstellend-anschauenden Verhaltens“ (GA 24, 165) versteht und bis zu ihrem epochalen Schluß in dem gegenwärtigen Weltalter der Technik interpretiert wird. Den genialsten Einsichten der Daseinsanalytik, zum Beispiel in den existenzialen Vorrang der Zukunft und in die Geschichtlichkeit des Daseins, wird in dieser Weise nicht bis zum Grundhorizont der radikalsten Zeitlichkeit weiter gefolgt. Der Bruch mit der platonischen Anamnesis-These, der in der Verwandlung des Pindarschen Spruches von „werde, was du [immer schon] bist“ zu „Werde, was du zu sein hast“ in Sein und Zeit jeweils als „Sei, was du wirst“ (vgl. 145), „Werde, was du selbst noch gar nicht bist“ (vgl. 243), „Werde, was du sein kannst“ (vgl. die Ausführungen zur „Entschlossenheit“, 305 f.) angedeutet wird, wird nicht in den äußersten temporalen Horizont weitergeführt und in seinen abgründigen Implikationen ergründet. Die Schichten der Geschichtlichkeit des Daseins – zum Beispiel, wie das Plusquamperfekt des dagewesenen Daseins sich in der entschlossenen Wiederholung des Geschicks des Generationswechsels mit dem futurischen Perfekt einer Gemeinschaft gestaltet –, bleiben in ihren Seinsweisen temporal unerforscht. Daher wird die historisch-praktische Wissenschaft der christlichen Theologie, die das überlieferte und wiederholte Offenbarungsgeschehen der Gemeinden des Glaubens vergegenständlicht, von philosophischen Begriffen nur formal anzeigend korrigiert und nicht mehr wissenschaftsphilosophisch, das heißt temporal, verstanden (vgl. den 1927/28 gehaltenen Vortrag Phänomenologie und Theologie, GA 9, 45–78). Mit dem Verzicht auf das Sprachspiel der Temporalität wird auch der Traum der Philosophie als temporaler Wissenschaft, das heißt der Vergegenständlichung des Seins selbst auf den Horizont der Zeit, ausgeträumt. Daß Philosophie überhaupt keine Wissenschaft sein kann, wird damit das Hauptthema der Vorlesung vom WS 1928/29.
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
263
12.3 Metaphysische Anfangsgründe der Logik (SS 1928) Aber schon im Laufe der letzten Marburger Vorlesung über die Leibnizsche Logik und den Satz vom Grunde wird Heidegger allmählich klar, daß die Philosophie selbst durch ihre Radikalisierung auf Grund der ursprünglichen Zeitlichkeit in ihrer Logik und Ontologie ursprünglicher und deshalb ganz anders als jede Wissenschaft ist (vgl. GA 26, 231, 285). Mit ihrer erneuten Herausarbeitung der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit als „nihil originarium“ (vgl. GA 26, 252, 272) könnte man die Vorlesung aus dem SS 1928 als zweiten (und letzten) „Anlauf auf mehr geschichtlichem Wege“ in Bezug auf „das in ‚Sein und Zeit‘ angezeigte Problem von Sein und Zeit“ (vgl. GA 26, 268) ansehen. Heidegger spricht aber nicht mehr von dem dritten Abschnitt, sondern von dem noch nicht veröffentlichten „zweiten Teil“ (GA 26, 215) von Sein und Zeit als der Stelle, an der die entworfenen Aufgaben des § 69, insbesondere die der radikalen Umwendung von der Intentionalität zur Transzendenz, ausgeführt werden. Denn „auf mehr geschichtlichem Wege“ haben die Aufgaben sich nun in Umfang und Reichweite vermehrt. Zur Analytik der Temporalität des Seins gehört jetzt nach dem SS 1927 die temporale Exposition des Seinsproblems, das heißt die Auseinanderlegung der in der Seinsfrage beschlossenen Grundprobleme der phänomenologischen Ontologie: 1. der ontologischen Differenz; 2. der Regionalität des Seins und der Einheit der Idee des Seins; 3. der Grundartikulation und 4. des veritativen Charakters des Seins (vgl. GA 26, 196, 201, 192–194). Die temporale Analytik, die mit der Analytik des Daseins und seiner Zeitlichkeit die Fundamentalontologie ausmacht, wird aber in ihrem Vollzug „zugleich die Kehre, in der die Ontologie selbst in die metaphysische Ontik, in der sie unausdrücklich immer steht, ausdrücklich zurückläuft“ (GA 26, 201). Dieser Umschlag bezieht sich auf die unentrinnbare ontische Fundierung der Ontologie, die Aristoteles mit seinem ´ Doppelbegriff der Ontologie als prwth filosofía und qeología schon erkannt hatte (vgl. GA 26, 202, 229; GA 24, 26). In Anlehnung an Max Schelers Begriff der Metaszienzen wie zum Beispiel Metanthropologie bezeichnet Heidegger die metaphysische Ontik als Metontologie. Der Doppelbegriff der Philosophie als Fundamentalontologie und Metontologie „ist nur die jeweilige Konkretion der ontologischen Differenz, das heißt die Konkretion des Vollzuges des Seinsverständnisses. Mit anderen Worten: Philosophie ist die zentrale und totale Konkretion des metaphysischen Wesens der Existenz“ (GA 26, 202). Aufgrund der Fundamentalontologie stellt die Metontologie die ontisch-existenziellen Grundfragen des konkreten Daseins in seiner jeweiligen Welt inmitten des Seien-
264
Theodore Kisiel
den im Ganzen, wie in der kantischen metaphysica specialis „nach dem Weltbegriffe“ (GA 26, 229): Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die Metontologie thematisiert als eine Metaphysik des ontischen Urphänomens der menschlichen Existenz in ihrer Sonderstellung im Kosmos nicht nur die globalen Fragen von „Lebensführung“ und „Weltanschauung“ in der Ethik, Politik, Praktik, Technik und dem Glauben (vgl. GA 26, 199), sondern auch die regionalen Fragen ihrer Unterscheidung vom nichtdaseinsmäßigen Seienden wie dem „weltlosen“ Stein und „weltarmen“ Tier (so in einer Vorlesung im WS 1929–30; vgl. GA 29/ 30, 261 f.), Sonderfragen des Daseins wie seine „faktische Zerstreuung in die Leiblichkeit und damit in die Geschlechtlichkeit“ (GA 26, 173) und geschichtliche Fragen wie eine Metaphysik des Mythos (GA 26, 270), und dazu auch die Metaphysik anderer Weltanschauungen (vgl. GA 27). Inwiefern weist die erneute Herausarbeitung der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit im SS 1928, in der die Temporalität immerhin niemals erwähnt wird, auf diese Kehre der temporalen Analytik in die neue Aufgabe einer Metontologie hin? Gegenüber der Darstellung vom SS 1927 ist die ursprüngliche Zeitlichkeit von dem ekstatischen Zu-sich-sein in der Weise des Umwillen-seiner beherrscht (vgl. GA 26, 276). „Dieses im Vorweg liegende Auf-sich-zu aus der eigenen Möglichkeit ist der primäre, ekstatische Begriff der Zukunft“ (GA 26, 266). Das Umwillen ist so das Auszeichnende des Daseins, „daß es diesem Seienden in seinem Sein in einer spezifischen Weise um dieses selbst geht. Das Sein und Seinkönnen des Daseins ist es, umwillen dessen es existiert. […] zum Wesen des Daseins gehört es, daß es ihm in seinem Sein um dieses [Sein] selbst geht“ (GA 26, 239). Das Umwillen-seiner bestimmt formal einen das Seiende transzendierenden Seinsumgang des „Zirkels“ (GA 26, 278) des Sichverstehens, der Freiheit, der Selbstheit und ihrer Verbindlichkeiten. „Freiheit gibt sich zu verstehen, sie ist das Urverstehen, das heißt der Urentwurf dessen, was sie selbst ermöglicht“ (GA 26, 247). Aber was ermöglicht sie? Die Welt, „die Ganzheit des Seienden in der Totalität seiner Möglichkeiten“ (GA 26, 231), die ihre spezifisch transzendentale Organisationsform durch das jeweilige Umwillen erhält (vgl. GA 26, 238). Die Welt zeitigt sich primär aus dem Umwillen, aus der Ekstase der Zukunft, und gründet in der ekstatischen Einheit und Ganzheit des gezeitigten Horizontes (vgl. GA 26, 275, 273). Heidegger spricht jetzt von einer „ekstematischen“ Einheit des Horizontes, also einer systematischen Einheit, die von der Einheit der Ekstasen gezeitigt wird (vgl. GA 26, 269). Diese zukunftsbetonte horizontale Einheit ist die „zeitliche Bedingung der Möglichkeit der Welt“ (GA 26, 269). Weil er kein Seiendes ist, kann dieser Horizont
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
265
nirgendwo lokalisiert werden. Er zeigt sich nur in und mit der Ekstase als ihr Ekstema. Er ist „gar nicht primär auf Blicken und Anschauen bezogen, sondern besagt einfach an sich das Eingrenzende, Umschließende, den Umschluß. […] Er ‚ist‘ überhaupt nicht, sondern er zeitigt sich“ (GA 26, 269). Oder besser: „Es weltet!“ – um eine Wendung zu gebrauchen, die Heidegger als Wortprägung aus dem KNS 1919 wiederbelebt (vgl. GA 26, 219–221). Mit dieser Formulierung möchte Heidegger zum Ausdruck bringen, daß die Welt kein Seiendes ist, sondern ein zeitliches Wie des Seins. Die Welt, die Einheit des Zeithorizontes, ist „nichts Seiendes und gleichwohl etwas, was es gibt. Das ‚es‘, das da dieses Nicht-Seiende gibt, ist selbst nicht seiend, sondern ist die sich zeitigende Zeitlichkeit. Und was diese als ekstatische Einheit zeitigt, ist die Einheit ihres Horizontes: die Welt […], das in und mit der Zeitigung Entspringende schlechthin – wir nennen sie daher das nihil originarium“ (GA 26, 272). Es weltet, es gibt, es zeitigt sich: Dies sind die Impersonalien der Faktizität schlechthin. „Daß es überhaupt so etwas wie Zeitlichkeit gibt, ist das Urfaktum im metaphysischen Sinne“ (GA 26, 270). Die Faktizität schlechthin ist das nihil originarium, und das Produkt der „eigentümlichen inneren Produktivität“ dieser Zeitlichkeit ist „gerade ein eigentümliches Nichts: die Welt“ (GA 26, 272). Das Urfaktum der Zeitlichkeit ist daher überhaupt kein factum brutum, sondern „die Urgeschichte schlechthin“ (GA 26, 270), „das Urereignis“ (GA 26, 274). Der Impersonalsatz „Es er-eignet sich“ tritt schon im KNS 1919 als principium individuationis auf, das heißt als Prinzip der Faktizität als solcher (vgl. GA 26, 270). Aber im Zusammenhang mit der Vorlesung über metaphysische Anfangsgründe der Logik vom SS 1928 betont Heidegger das ontische Fazit des „Geschehens der Transzendenz“, in dem „auch schon Seiendes entdeckt ist“ (GA 26, 281). Die metaphysische Urgeschichte des Daseins als Zeitlichkeit dokumentiert auch die „völlig rätselhafte“ Tendenz, das Seiende als Inner-, Außer- und Überzeitliches zu verstehen (vgl. GA 26, 274). „Das Ereignis des Welteingangs des Seienden“ geschieht zwar nur, wenn geschichtliches Dasein existiert, das als In-der-Welt-sein dem Seienden die Gelegenheit des Welteingangs gibt. „Und nur wenn dieses [In-der-Welt-sein] existent ist, ist auch schon Vorhandenes in Welt je eingegangen, das heißt Innerweltliches geworden“ (GA 26, 251). „Mit dem Geschehen von Welteingang gibt es Zeit im vulgären Sinne, und nur sofern Welteingang geschieht und sonach innerweltliches Seiendes für Dasein offenbar wird, gibt es auch innerzeitiges Seiendes, solches, das ‚in der Zeit‘ verläuft“ (GA 26, 272). Die ausführliche Herausarbeitung des Welteingangs ist zum Teil Heideggers Antwort auf das metaphysische Grundproblem der Seinsbeziehung zwi-
266
Theodore Kisiel
schen Realismus und Idealismus (Sein und Zeit, §§ 43, 44c) in seiner Auseinandersetzung mit Max Scheler (GA 26, 164 f.), die er anläßlich dessen Todes in die Vorlesung im SS 1928 einschiebt. Innerweltlichkeit und Innerzeitigkeit gehören nicht zum Wesen des Vorhandenen an ihm selbst, das wohl das Seiende ist als welches und was es ist, „auch wenn es nicht gerade Innerweltliches wird, auch wenn nicht Welteingang mit ihm geschieht“ (GA 26, 251). Das Geschehen des Welteingangs von Seiendem ist nur die transzendentale Bedingung der Möglichkeit dafür, daß Vorhandenes in seinem Ansich sich offenbart, und daher „daß das Vorhandene sich gerade bekundet in seiner Unbedürftigkeit des Welteingangs bezüglich seines eigenen Seins“ (GA 26, 251; 194 f.). Daß wir zum Seinlassen des Seienden in seinem Was- und Wiesein aufgefordert sind, ist noch ein Zeichen der Faktizität und Geworfenheit des zeitlichen Daseins, dessen Ohnmacht gegenüber dem Seienden in der Transzendenz und im Weltgang sich erschließt (vgl. GA 26, 279). Die Freiheit der Transzendenz ist zugleich die Verbindlichkeit des Grundes. Um das oben Gesagte zeitlich zusammenzufassen: „Das Ekstematische zeitigt sich schwingend als ein Welten; nur sofern dergleichen wie ekstatische Schwingung als je eine Zeitlichkeit sich zeitigte, geschieht Welteingang. […] Der Welteingang von Seiendem ist die Urgeschichte schlechthin“ (GA 26, 270). Die Erörterung der schwingenden Vektoren des Welteingangs ist nicht ganz neu bei Heidegger. In einem entscheidenden Schlußsatz im KNS 1919 sagte er: „Dabei liegt aber doch in dem Sinn des Etwas als dem Erlebbaren das Moment des ‚Auf zu‘, der ‚Richtung auf‘, des ‚In eine (bestimmte) Welt hinein‘ – und zwar in seiner ungeschwächten ‚Lebensschwungkraft‘“ (GA 56/57, 115). Die schwebende Rhythmik des Ur-sprungs des Lebens in seiner motivierten Tendenz bzw. tendierenden Motivation ist in dem Schwung der Zeit zu finden (vgl. GA 56/57, 117, 95–8, 60 f.). Im SS 1928 erkennt Heidegger Bergsons ontische Sprache des „élan“ der Zeit als Quelle ontologisch gerichteter Ausdrücke wie zum Beispiel „[das Sein der Ekstasen – T. K.] liegt gerade im freien ekstatischen Schwung. […] Die Zeitigung ist die freie Schwingung der ursprünglichen ganzen Zeitlichkeit; Zeit erschwingt und verschwingt sich selbst. (Und nur weil Schwung, deshalb Wurf, Faktizität, Geworfenheit; nur weil Schwingung, deshalb Entwurf)“ (GA 26, 268). Geworfener Entwurf statt der motivierten Tendenz ist nun die Grundbewegung des Daseins. Der Grundentwurf von Transzendenz, die ihre Möglichkeit in der Einheit des ekstatischen Schwingens findet, wird nun als „der Überschwung, gesehen auf alles mögliche Seiende, was da faktisch in eine Welt eingehen kann“ (GA 26, 270). Welteingang ist zuerst ein ekstatisches
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
267
Geschehen des Weltens, das heißt des einheitlichen Schwingens der Entrückung (raptus) der Ekstasen in einen einheitlichen Horizont. Aus der ekstatischen Einheit der Zeit schwingend ist der Horizont keine Vergegenständlichung, er darf nicht als „irgendein Dinglicher, Vorhandener“ (vgl. GA 26, 268) vorgestellt werden. Die Transzendenz des Daseins ist ein Überschwung in die Möglichkeiten der Welt, die selbst „der freie übertrifftige Widerhalt des Worumwillens“ ist (GA 26, 248). Transzendenz ist das Überspringen des je faktisch und tatsächlich Seienden zu „einem Überschuß an Möglichkeiten, darin sich das Dasein als freier Entwurf schon immer hält“ (GA 26, 248). Dasein ist immer „weiter“ als jegliches faktische Seiende. In seinem „Bereich“ des Seinsverständnisses liegt die innere Möglichkeit der Bereicherung, „es hat immer den Charakter des Reicher-seins-als, des Über-schwunges“ (GA 26, 273). Es ist in seiner ursprünglichen Zeitigung ein überschwenglicher Überschwang an Möglichkeiten. Die Transzendenz ist nach Platon ein ´ ´ ´ ousíaz: ´ epekeina thz „Das Umwillen aber (die Transzendenz) ist nicht das Sein selbst, sondern was es überschreitet, und zwar indem es das Seiende an Würde und Macht überschwingt“ (GA 26, 284: Heideggers Übersetzung aus Platons Staat). „Die Freiheit zum Grunde ist das Schwingen im Überschwung, in dem, was uns entrückt und die Ferne gibt“ (GA 26, 285). Demgegenüber muß man auch die Unfreiheit der endlichen Transzendenz unterstreichen: „Aufgrund dieses Überschwunges ist das Dasein jeweils dem Seienden über, […] aber freilich gerade so, daß es das Seiende in dem Widerstand allererst erfährt als das, wogegen das transzendierende Dasein ohnmächtig ist“ (GA 26, 279).
12.4 Der Abbruch beginnt: Einleitung in die Philosophie (WS 1928/29) Seit dem KNS 1919, in welchem Heidegger die Philosophie als vortheoretische Urwissenschaft des Ursprungslebens bezeichnet hatte, gibt er eine schwankende Antwort auf die Frage, ob die phänomenologische Philosophie eine Urwissenschaft oder gar keine Wissenschaft sein soll. Denn die Philosophie ist als Urwissenschaft wie keine andere Wissenschaft, weil sie eine über- bzw. vortheoretische Urwissenschaft sein soll; eine nichttheoretische Wissenschaft, was gleichsam ein hölzernes Eisen zu sein scheint. Schon im WS 1919/20 bemerkt Heidegger, Philosophie als „Ursprungswissenschaft“ sei gar keine Wissenschaft „im eigentlichen Sinne“, da mit jeder Philosophie mehr als bloße Wissenschaft prätendiert sei. Und im
268
Theodore Kisiel
nächsten Semester führt er dieses „Mehr“ auf das ursprüngliche Motiv des Philosophierens, das heißt auf die Beunruhigung des Lebens selbst, zurück. Dieses vor- und überwissenschaftliche Mehr wird im WS 1928/29, am Ende des phänomenologischen Jahrzehnts (1919–1929) von Heideggers Entwicklung, erneut „thematisiert“. Als Nachfolger Husserls nimmt Heidegger in dieser ersten der späteren Freiburger Vorlesungen, welche den Titel Einleitung in die Philosophie trägt, das Thema der Wissenschaftlichkeit der Philosophie erneut auf: Philosophie sei keine Wissenschaft unter anderen, sie sei ursprünglicher als jede Wissenschaft. „Philosophie ist zwar Ursprung der Wissenschaft, aber gerade deshalb nicht Wissenschaft, – auch nicht Ur-wissenschaft“ (GA 27, 18). Weil sie der Wissenschaft ihre Möglichkeit gibt, ist die Philosophie etwas mehr, etwas anderes, Höheres und Ursprünglicheres. Dieses andere hängt mit dem Transzendieren zusammen, dessen die Wissenschaft als solche nicht mächtig ist. Oder besser: Philosophie ist etwas tieferes, radikaleres und wesentlicheres, weil Philosophieren „ein Existieren aus dem Wesensgrunde des Daseins, [das heißt] wesentlich werden in der Transzendenz“ (GA 27, 218; GA 26, 285) ist. Sie sei überhaupt keine Wissenschaft, nicht aus Mangel, sondern aus Überfluß, weil sie durch das Seinsverständnis eine ständige innere Freundschaft (philia) mit den Dingen ist, und dadurch sachlicher und „wissenschaftlicher als je eine Wissenschaft nur sein kann“ (GA 27, 219). Deswegen sei der Ausdruck „wissenschaftliche Philosophie“ nicht nur überflüssig, gleich der Bezeichnung „rundlicher Kreis“, sondern auch ein irreführendes Mißverständnis (vgl. GA 27, 16, 22, 219, 221). Philosophieren als ausdrückliches Transzendieren, als das ausdrückliche Geschehenlassen der Transzendenz, gründet in dem „Urfaktum“ (GA 27, 223, 205) des Seinsverständnisses, des geworfenen Entwurfs des Seins. Transzendieren ist zuerst der Überstieg vom Seienden, der wissenschaftlich mit dem vorgängigen, ungegenständlichen, feldabsteckend-begründenden Entwurf der Seinsverfassung des Seienden geschieht, aufgrund dessen Seiendes an ihm selbst als offenbar Vorliegendes (positum) zum Vorschein und zu Wort kommt. „Auf dem Hintergrund [das heißt Horizont!] des im Entwurf entworfenen Seins bekommt das so bestimmte Seiende erst Relief“ (GA 27, 196). Aber das Sein selbst bleibt in diesem Entwurf von den positiven wissenschaftlichen Grundbegriffen unbegriffen, zunächst sogar unbegreifbar. Das Seinsverständnis ist jedoch „nichts anderes als die Möglichkeit des Vollzugs des Unterscheidens von Seiendem und Sein oder kurz gesagt die Möglichkeit der ontologischen Differenz“ (GA 27, 223). Es besteht die radikale Möglichkeit, das Seinsverständnis
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
269
zu einem Begreifen des Seins auszubilden, das heißt zu einer Frage nach dem, was das Sein selbst sei und wie so etwas wie Seinsverständnis und Transzendenz möglich werden. Dieser sich artikulierende Übergang vom vorbegrifflichen Verstehen des Seins zum fraglichen Begreifenwollen ist das ausdrückliche Transzendieren des Philosophierens. Philosophie ist nun von der Wissenschaft, die eine Erkenntnis von Seiendem als positum in einem abgesteckten Gebiet ist, scharf abgegrenzt. „Weder das Sein als solches noch das Seiende im Ganzen als solches, noch der innere Zusammenhang zwischen Sein und Seiendem [in der Transzendenz – T. K.] ist je einer Wissenschaft […] zugänglich“ (GA 27, 224). „Die Transzendenz ist nichts, was vorliegen könnte wie ein Gegenstand der Wissenschaft“ (GA 27, 395). Das Sein selbst ist kein positum, sondern wie ein Nichts, und zunächst das Nicht-Seiende der Welt und der Freiheit. Was ist dann die Sprache des Seins, onto-logos (GA 27, 200 f.), wenn es keine wissenschaftliche ist? Denn die Satzwahrheit der Wissenschaft gründet „in etwas Ursprünglicherem, was nicht Aussagecharakter hat“ (GA 27, 68). Philosophie als Onto-logie, „das thematische Erfassen und Begreifen des Seins selbst“ (GA 27, 200), wird in ihrem Wesen zum Problem, das nicht gelöst wird, bis es gelingt, „die volle innere Richtung des Wesens des Philosophierens enthüllen [zu] lassen“ (GA 27, 217). Bedeutend in der Ausgabe der Vorlesung aus dem WS 1928/29 ist ein einziger Absatz über die Zeit als den transzendentalen Horizont der Seinsfrage, das heißt über die schematisch-phänomenologische Konstruktion des Begriffs des Seins durch die Zeit im Kern des 3. Abschnitts. Dieser Absatz wurde, wie die Herausgeber anmerken, in der Vorlesung nicht vorgetragen (GA 27, 218 Anm.).2 Sogar die Rede von der „Konstruktion des Seinsproblems“ bzw. der „Konstruktion der Transzendenz“ (vgl. GA 27, 394, 396, 400), die gelegentlich in dem Vorlesungsmanuskript auftaucht, ist in den ausführlicheren Studentenmitschriften der Vorlesung nicht zu finden. Stattdessen wird Philosophieren als Fragen nach dem Begriff des Seins zu einer immerwährenden, immer wieder scheiternden, nie zu erschöpfenden Aufgabe. Eine Aufgabe, die „immer wieder in Lagen führt, aus denen es keinen Ausweg zu geben scheint“ (GA 27, 216). Und die Seinsfrage, die „von neuem in Abgründe führt“ (GA 27, 205), ist
2 Auch die beiden Sätze über einen „transzendentalen Horizont“ vor dem genannten Absatz wurden nicht vorgetragen. Ich habe die Edition von GA 27 mit einer viel ausführlicheren Nachschrift von Simon Moser verglichen und an manchen Stellen meine Zitate aus der edierten Fassung um erläuternde Ausdrücke aus der angeführten Nachschrift (= SM) ergänzt und verbessert.
270
Theodore Kisiel
nur ein Weg zum Philosophieren, der Weg über die Wissenschaft. Dieser aber muß, um den vollen Begriff der Philosophie zum Verständnis zu bringen, um zwei weitere Wege ergänzt werden: den Weg über die Weltanschauung und den über die Geschichte. Wichtig für uns ist ein gemeinsames Ziel beider Wege. Schon Sein und Zeit hat die Transzendenz des In-der-Welt-seins zum Ausdruck gebracht und damit die Transzendenz der Welt (vgl. § 69c). „Wenn Transzendieren heißt: In-der-Welt-sein und dieses je ist Sichhalten in solchem, Weltanschauung, dann ist ausdrückliches Transzendieren, das heißt Philosophieren ein ausdrückliches Ausbilden von Weltanschauung“ (GA 27, 354 f.). Philosophie als Weltanauung ist Haltung im ausgezeichneten Sinne dessen, was die Griechen »qoj genannt haben (vgl. GA 27, 379) und was der spätere Heidegger mit dem hermeneutischen Bezug des Menschseins als „Brauch“ des Wohnens in der Welt identifizieren wird. „Philosophie ist nicht eine Weltanschauung unter anderen, nicht eine Haltung unter anderen, sondern die Haltung der Transzendenz aus ihrem Grunde, die Grundhaltung schlechthin“ (SM 678; vgl. GA 27, 397). Im Philosophieren als ausdrücklichem Geschehenlassen der Transzendenz des Daseins aus ihrem Grunde geschieht die ursprünglichste mögliche Haltung (GA 27, 396). „Erst im ausdrücklichen Geschehenlassen der Transzendenz, im Aufbrechen der inneren Weite und Ursprünglichkeit derselben öffnen sich die konkreten Möglichkeiten der [konkreten] Haltung [des faktischen Existierens]. Diese konkreten Möglichkeiten der Haltung [der faktischen Weltanschauungen] bestimmen sich aber nicht auf dem Wege der Philosophie, sondern [jeweils] aus dem [so und so bestimmten] jeweiligen Dasein selbst“ (GA 27, 397; dazu SM 679). Es ist nicht die Aufgabe der Philosophie als Grund-haltung, die die Möglichkeitsbedingungen und Voraussetzungen der Urhandlung des Sichhaltens in der Welt, das heißt die „Form“ ihres Vollzugs (vgl. GA 27, 390) ausdrückt, eine bestimmte Haltung auszubilden und diese als maßgebend zu verkünden. Am meisten und am besten kann die Philosophie „Veranlassung“ für den je faktisch existierenden Menschen sein, daß ihm die Möglichkeiten einer Haltung in ihren Grundzügen frei und unverbindlich aufbrechen und damit sein eigenes ZurHaltung-kommen und Haltung-gewinnen im freien Wählen und Entscheiden verschärft (SM 679 = GA 27, 397; auch 381). Je ursprünglicher die Grundhaltung des philosophierenden Daseins, um so freier und unverbindlicher ist das Mitgeschehenlassen je einer Haltung im Dasein des anderen. Und je unverbindlicher die Grundhaltung geschieht, um so erweckender für das Geschehen der Haltung im anderen kann sie sein.
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
271
Die Philosophie als Erweckungsruf und Veranlassung für freie Entscheidung und Interpretation: Dies ist die auffordernde Funktion der Philosophie, die schon Aristoteles als Protreptik bezeichnet hat. Diese Funktion der Philosophie hängt mit zwei zeitlich bestimmten und miteinander verwobenen Eigentümlichkeiten der Transzendenz des Daseins zusammen: mit seiner Freiheit und seiner geschichtlichen Jeweiligkeit. Philosophieren, das Geschehenlassen der Transzendenz aus ihrem Grunde „heißt gerade Ausbilden derjenigen Transzendenz des Daseins, die wir Freiheit nennen. […] Das Wesen des Philosophierens besteht darin, daß es den Einbruchsspielraum ausbildet für das konkrete geschichtliche, jeweils durch eine bestimmte Haltung geführte Dasein. Dadurch, daß die Philosophie den Spielraum [= die Freiheit] ausbildet für die jeweilige Gewinnung der Haltung, ist gesagt, daß das Philosophieren seinem Wesen nach auf die Zukunft bezogen ist. So wie der Mythos für die Philosophie eine wesentliche und notwendige Erinnerung ist, so ist die Zukunft ihres Fragens ihre eigentliche Kraft. Die Gegenwart aber verschwindet, denn die Gegenwart ist immer nur die Spitze des Augenblickes, der seine Macht und seinen Reichtum aus zukünftiger Erinnerung nimmt. […] Mit dem zukünftigen Sicherinnern ist ein Hinweis gegeben auf die eigentümliche geschichtliche Stellung, die das metaphysische Wesen der Philosophie selbst in sich trägt“ (SM 680 f.; vgl. GA 27, 398). Philosophie ist die Befreiung des jeweiligen Daseins (GA 27, 401). Philosophieren als Geschehenlassen des jeweiligen Spielraums des Augenblicks der Entscheidung und der darin sich zeitigenden Möglichkeiten ist selbst die Urhandlung des Seinlassens (vgl. GA 27, 205), der Gelassenheit, „eine Urhandlung der Freiheit des Daseins, ja, das Geschehen des Freiheitsraumes des Daseins selbst“ (GA 27, 214), „ein ‚Tun‘ der höchsten und ursprünglichen Art und nur möglich auf dem Grunde unseres innersten Wesens der Existenz, der Freiheit“ (GA 27, 103). „Im Geschehenlassen der Transzendenz als Philosophieren liegt die ursprüngliche Gelassenheit des Daseins, das Vertrauen des Menschen zum Da-sein in ihm und zu dessen Möglichkeiten“ (GA 27, 401). „Dieses Seiende [das heißt] Da-sein […] läßt in und durch sein Sein dergleichen wie ein ‚Da‘ [das heißt ein Umkreis von Offenbarkeit und Erschlossenheit] erst sein“ (GA 27, 136). Und dieses Da ist immer jeweilig, je meines, je unseres, und das heißt jeweils geschichtlich. Das Dasein existiert überhaupt nie im allgemeinen und aus diesem Grunde „passiert das Philosophieren nicht so überhaupt im allgemeinen irgendwo unbestimmt in einem Dasein oder an sich“ (SM 682 = GA 27, 399). „Das Dasein existiert aber nie so im allgemeinen,
272
Theodore Kisiel
sondern als konkretes existiert es in einer bestimmten Lage und verschafft sich selbst je nachdem wesentliche und unwesentliche Situationen [des Handelns]“ (GA 27, 227; vgl. dazu SM 407). Der ausdrückliche und entscheidende Sprung in die Weltanschauung als Haltung ist notwendig der Sprung in die eigene Geschichtlichkeit, in die konkrete geschichtliche Lage, in die spezifische Geschichtlichkeit des eigenen Fragens aus dem Ganzen der eigenen geschichtlichen Situation (vgl. GA 27, 400). Philosophie in einem radikalen Sinne springt in die Geschichtlichkeit ihres faktischen Daseins hinein, damit sie Ursprünglichkeit und Kraft gewinnen und das Wesentliche sein soll (vgl. SM, 682 f.). Daß das Wesentliche und Ursprüngliche nur in der geschichtlichen Konkretion offenbar wird, ist eine Schwierigkeit, die auf dem dritten Wege zum vollen Wesen der Philosophie behandelt wird. Diese Schwierigkeit ist nichts anderes als das Problem des Wesens der philosophischen Wahrheit gegenüber der wissenschaftlichen Wahrheit und damit des Wesens der Wahrheit überhaupt. Dieses Wahrheitsproblem gehört mit dem Seinsproblem des ersten Weges und dem Weltproblem des zweiten mit in die Architektonik der Philosophie. Genauer gesprochen macht jedes dieser Probleme das Ganze der Philosophie aus (vgl. SM, 683). In dieser ersten der späten Freiburger Vorlesungen im WS 1928/29 bricht Heidegger einige alte Richtungen seines Denkweges ab. Die Vorlesung ist aber zugleich bahnbrechend für neue Richtungen, denen Heideggers Entwicklung im nächsten Jahrzehnt folgen wird: 1. Zuerst dokumentiert diese Vorlesung die ersten Zeichen des manchmal schleppenden und sogar stillschweigenden Abbruches der Begriffskonstellation „Horizont-Transzendenz-Temporalität“, welche den ursprünglichen Kern des entworfenen dritten Abschnittes von Sein und Zeit ausgemacht hatte. Heidegger beginnt im Dezember 1928 zögernd und unschlüssig, sich von dem Buch Sein und Zeit abzubringen und dessen Denkweg zum Holzweg zu erklären. Ohne den dritten Abschnitt ausdrücklich zu erwähnen, spricht er in dem im Oktober 1928 (etwa um die Zeit der ersten Fassung des Vorlesungsmanuskripts für WS 1928/29) verfassten Festschrift-Artikel Von Wesen des Grundes von der „einzig leitenden Absicht […] des ganzen Zuges und des Ziels der Problementwicklung, […] daß das bisher Veröffentlichte aus den Untersuchungen über ‚Sein und Zeit‘ nichts anderes zur Aufgabe hat, als […] den ‚transzendentalen Horizont der Frage nach dem Sein‘ [aus der Zeit – T. K.] zu gewinnen“ (GA 9, 162 Anm. 59). Aber er betont ebenfalls: „Die temporale Interpretation der Transzendenz bleibt in der vorliegenden Betrachtung durchgängig und absichtlich bei-
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
273
seite“ (GA 9, 166 Anm. 60). Dies, obwohl Heideggers Handexemplar der Ausgabe von 1929 zwei handschriftliche Marginalien einschließt, welche die Temporalität noch als Möglichkeitsbedingung der Zeitlichkeit erkennen: „das Wesen des ‚Geschehens‘ – Zeitigung der Temporalität als Vorname für die Wahrheit des Seyns“ (GA 9, 159 Anm. a; vgl. ebd., 171 Anm. a). In der Schrift Beiträge zur Philosophie (1936–38) wird die Temporalität, das heißt „die ursprüngliche Einheit der sich lichtend-verbergenden Entrückung“ (GA 65, 234), als der erstanfängliche Übergang zur Gründung des Zeit-Spiel-Raums der Augenblicks-Stätte verstanden (vgl. GA 65, 18, 29, 294). Um den Übergang zu vollziehen, galt es „vor allem eine Vergegenständlichung des Seyns zu vermeiden, einmal durch das Zurückhalten der ‚temporalen‘ Auslegung des Seyns und zugleich durch den Versuch, die Wahrheit des Seyns unabhängig davon ‚sichtbar‘ zu machen (Freiheit zum Grunde in ‚Vom Wesen des Grundes‘ […])“ (GA 65, 451). Im SS 1930 zum Beispiel wird die Freiheit und nicht der einheitliche Horizont der Temporalität als „die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins von Seiendem, des Seinsverständnisses“ (GA 31, 303) bezeichnet. Dennoch könnte man die Freiheit und die Temporalität durch vermittelnde Begriffe wie „Möglichkeit“ immer noch „identifizieren“. Wie bereits vermerkt, wird im WS 1928/29 die vergegenständlichende Sprache des „transzendentalen Horizontes der Zeit“ zumeist zurückgehalten. In seine phänomenologische Wesensauslegung der radikalen Langeweile im WS 1929/30 setzt Heidegger die längst bekannte „platte Selbstverständlichkeit“ (GA 29/30, 219) von dem einen und zugleich dreifachen „Horizont“ der Zeit nicht ohne kritische Fragen und Vorbehalte ein, nämlich die Selbstverständlichkeit, wonach wir eben, wenn wir alles Seiende zumal in allen drei Sichten der Hinsicht (Gegenwart), Rücksicht (Gewesenheit) und Absicht (Zukunft), „den Sichten für jedes Tun und Lassen des Daseins“ (GA 29/30, 218), in eins zusammenfassen wollen, hierzu einen ursprünglichen einigenden und vollerschlossenen Horizont der Zeit einführen und annehmen. „Geben wir einmal zu […], der volle Zeithorizont sei die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seienden im Ganzen, […] was heißt hier: die Zeit ist Horizont? […] und doch ist es schwer zu sagen, was hier Horizont heißt, wie das – als Horizont zu fungieren – aus dem Wesen der Zeit möglich ist. […] Der Zeithorizont ist mit im Spiel jeweils bei jedem Offenbarwerden des Seienden im Ganzen […] Darin liegt aber dann, daß der Zeithorizont auf mannigfache Art, die uns noch gänzlich unbekannt ist, ins Spiel kommen kann, daß wir die Abgründe des Wesens der Zeit nicht einmal ahnen. […] Wie kommt die Zeit dazu, einen Horizont zu haben? Stößt
274
Theodore Kisiel
sie daran, wie an eine ihr übergestülpte Schale, oder gehört der Horizont zur Zeit selbst? Aber wofür denn dieses die Zeit selbst Umgrenzende (or…zein)? Wie und wofür gibt sie sich und bildet sie sich eine solche Grenze? Und wenn der Horizont nicht fest ist, woran hält er sich in seinem Wandel? Das sind zentrale Fragen …“ (GA 29/30, 219 f.). Die Annahme eines Zeithorizonts wird in der Grunderfahrung der radikalsten Langeweile noch weiter fraglich werden. Die Stimmung der radikalen Langeweile ist gerade das Schwingen zwischen der leeren Weite des Zeithorizontes und der Spitze des Augenblicks. Der Augenblick ist der scharfe Blick der Entschlossenheit des Daseins zum Da-sein, das je ist als Existierendes in der vollergriffenen Situation der Handlung, als dieses je einmalige und einzige (vgl. GA 29/30, 251, 224). „Der Augenblick bricht den Bann der Zeit, kann ihn brechen, sofern er eine eigene Möglichkeit der Zeit selbst ist. Er ist nicht etwa ein Jetztpunkt, […] sondern der Blick des Daseins in den drei [zeitlichen – T. K.] Richtungen der Sicht […]“ (GA 29/ 30, 226). Der Zeitbann ist gebrochen, und kann nur gebrochen werden durch die Zeit selbst, durch den der Zeitlichkeit gehörigen Augenblick. Damit ist die Zeit selbst uns jetzt noch rätselhafter geworden, „wenn wir an den Horizont der Zeit, dessen Weite, seine horizontale Funktion – unter anderem als Bann – und schließlich an den Zusammenhang dieses Horizontes mit dem, was wir Augenblick nennen, denken“ (GA 29/30, 228). „Woher und warum diese Notwendigkeit des Bezugs von Weite und Spitze – Horizont und Augenblick – Welt und Vereinzelung? Was ist das für ein ‚Und‘, das zwischen diesen beiden steht? Warum muß am Ende jene Weite des bannenden Horizontes gebrochen werden durch den Augenblick, und warum kann sie nur durch diesen gebrochen werden, so daß das Dasein gerade in dieser Gebrochenheit zur eigentlichen Existenz kommt? Ist am Ende das Wesen der Einheit und Fügung beider ein Bruch? Was meint diese Gebrochenheit des Daseins in sich selbst? Wir nennen sie die Endlichkeit des Daseins und fragen: Was heißt Endlichkeit?“ (GA 29/30, 252). Diese Fragen reichen in ihrem Ursprung zurück bis zur Frage nach dem Wesen der Zeit (vgl. GA 29/30, 253). Als Grundfrage der Metaphysik ist es die Frage nach dem Sein und der Zeit. Ist die Zeit selbst endlich, und ist ein Sein, das im Grunde und Wesen endlich ist, noch eine Frage der Metaphysik? Eine Anmerkung etwa um die Zeit der Beiträge (1936–38), die Heidegger zu seinem Hüttenexemplar an der Stelle des „Aufriß der Abhandlung“ von Sein und Zeit (39) hinzufügte, verleiht dem dritten Abschnitt über „Zeit und Sein“ eine neue Richtung. Danach müssen drei aufgelistete Aufgaben bezüglich der „transzendenzhaften Differenz“ durchgeführt werden: „Die Überwindung des Horizonts als sol-
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
275
chen. Die Umkehr in die Herkunft. Das Anwesen aus dieser Herkunft“. Man mußte aber bis zu dem Band Feldweg-Gespräche (1944/45, GA 77) warten, bevor Heidegger eine ausführliche Überwindung und Destruktion der transzendental-horizontalen Konstruktion der Metaphysik durchführt: Über den Horizont hinaus und die ihm entgegenstehenden Gegenstände, die er umfaßt, kommt uns die freie Weite eines uns umgebenden Offenen entgegen, eine Gegend bzw. „gegnende Gegnet“, in deren Weile die Dinge zum Verweilen kommen anstatt als Gegenstände zu erscheinen (vgl. Heidegger 1959b, 39 ff.). 2. Philosophie ist keine Wissenschaft, sondern eine anweisende, auffordernde Protreptik. Das wird im WS 1929/30 von einer eigentümlichen Seite durch Heideggers allerletzte Behandlung der formalen Anzeige betont. Im Unterschied zu wissenschaftlichen Begriffen sind alle philosophischen Begriffe formal anzeigend. „Der Bedeutungsgehalt dieser Begriffe meint und sagt nicht direkt das, worauf er sich bezieht, er gibt nur eine Anzeige, einen Hinweis darauf, daß der Verstehende von diesem Begriffszusammenhang aufgefordert ist, eine Verwandlung seiner selbst in das Dasein [in das Da-sein in ihm – T. K.] zu vollziehen“ (GA 29/30, 430, vgl. auch 428). Solche Begriffe enthalten „nur die Anweisung zu einer eigentümlichen Aufgabe“ (GA 29/30, 425) – über den Tod, die Entschlossenheit, die Geschichte, usw. – ohne direkt auszusagen, worauf sie sich beziehen. Weil sie immer nur den Anspruch einer Verwandlung ansprechen lassen, aber nie selbst die Verwandlung verursachen können, sind die Begriffe anzeigend. Sie zeigen immer in das Dasein hinein, das heißt in mein Da-sein, unser Da-sein. „Weil sie bei dieser Anzeige zwar ihrem Wesen nach je in eine Konkretion des einzelnen Daseins im Menschen hineinzeigen, diese aber nie in ihrem Gehalt schon mitbringen, sind sie formal anzeigend“ (GA 29/30, 429). Wenn aber die Begriffe generisch und abstrakt und nicht jeweilig und je nachdem zu interpretieren sind, „dann ist der Interpretation die bodenständige Kraft genommen, weil der Verstehende der Anweisung nicht Folge gibt, die in jedem philosophischem Begriff liegt“ (GA 29/30, 431). Jene Interpretation je nach der eigenen Faktizität ist zwar keine „nachträgliche sogenannte ethische Anwendung des Begriffenen, sondern […] vorgängiges Aufschließen der Dimension des Begreifbaren“ (GA 29/30, 428 f.). Die Begriffe und Fragen des Philosophierens sind der Wissenschaft gegenüber eigener Art. Diese begrifflichen Fragen dienen dem, was dem Philosophieren aufgegeben ist: nicht den Menschen und seine Welt zu beschreiben oder zu erklären, „sondern das Dasein im Menschen zu beschwören“ (GA 29/30, 258).
276
Theodore Kisiel
Unter Heideggers noch nicht veröffentlichten „Nachträgen zu Sein und Zeit“ findet man eine Mitte des Jahres 1930 verfasste Vorrede zur 3. Auflage von Sein und Zeit, die eine völlig neue Durcharbeitung der ersten Hälfte von Sein und Zeit und dazu eine zweite Hälfte, die nur den dritten Abschnitt von Teil I umfassen sollte, ankündigt. Aber die 3. Auflage der I. Hälfte erscheint 1931 unverändert. Das Buchprojekt mit dem Titel Sein und Zeit ist nun endgültig gescheitert, obwohl Heidegger nur einigen Vertrauten in persönlichen Briefwechseln die Entscheidung über den definitiven Abbruch mitteilt: 14. November 1931, Heidegger an Rudolf Bultmann: „Die eigenen Versuche, und gar inmitten dieser bodenlosen Zeit, werden dann noch kleiner als sie schon sind. Inzwischen gehe ich unter der Maske dessen, der ‚den zweiten Band schreibt‘. Hinter diesem Schild kann ich tun, wozu ich Lust, das heißt innere Notwendigkeit habe.“ 18. September 1932, Heidegger an Elisabeth Blochmann: „Man denkt und redet schon darüber, daß ich nun SZ II schreibe. Das ist gut so. Aber da SZ I einmal für mich ein Weg war, der mich irgendwohin führte, dieser Weg aber jetzt nicht mehr begangen u. schon verwachsen ist, kann ich SZ II gar nicht mehr schreiben. Ich schreibe überhaupt kein Buch.“ 16. Dezember 1932, Heidegger an Bultmann: „Über meine eigenen Bemühungen kann ich schwer etwas sagen. Die innere Haltung ist noch viel antiker geworden, je deutlicher mir die in SZ gestellte Aufgabe der Auseinandersetzung mit der antiken Seinsfrage mit den Jahren vor Augen steht.“ Ein verwachsener Weg, der nicht mehr begangen werden kann, dennoch ein notwendiger Weg voll von Aufgaben, die einem Weiterdenken gestellt werden. „Der Weg durch SZ [ist] ein zwar unumgänglicher und doch ein Holzweg – ein Weg, der plötzlich aufhört. […] SZ – nur ein Übergang, der unentschieden zwischen ‚Metaphysik‘ und Ereignis [steht]“ (unveröffentlichtes Typoskript: Der Weg. Der Gang durch SZ, 1945). Mit den Beiträgen (1936–38) beginnt Heidegger, die Veröffentlichung Sein und Zeit immer wieder einer gründlichen Kritik bzw. „Destruktion“ zu unterwerfen. Dementsprechend konnte er 1941 schreiben: „Wir nehmen ‚Sein und Zeit‘ als den Namen für eine Besinnung, deren Notwendigkeit weit hinausliegt über das Tun eines einzelnen, der dieses Notwendige nicht ‚erfinden‘, aber auch nicht bewältigen kann. Wir unterscheiden daher die mit dem Namen ‚Sein und Zeit‘ bezeichnete Notwendigkeit und das so betitelte ‚Buch‘. (‚Sein und Zeit‘ als Name für ein Ereignis im Seyn selbst. ‚Sein und Zeit‘ als Formel für eine Besinnung innerhalb der Geschichte des Denkens. ‚Sein und Zeit‘ als Titel einer Abhandlung, die einen Vollzug dieses Denkens versucht.)“ (GA 49, 27)
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
277
Zusatz: Die Hinweise auf die allererste Fassung des dritten Abschnitts 1. Hinweise im Text. In den ersten Editionen von Sein und Zeit (bis zur sechsten Auflage) findet man eine Fußnote zu § 68d über „Die Zeitlichkeit der Rede“ (349), die uns einen Einblick in den Aufriß der allerersten Fassung des dritten Abschnittes gibt, das heißt der „systematischen“ Fassung, die für Geister wie Rilke und Jaspers überhaupt nicht verständlich gewesen wäre. Es heißt „Vgl. Abschnitt III, Kap. 2 dieser Abhandlung“. Die Anmerkung bezieht sich auf Probleme, die zum Teil auch in § 69 als inhaltliche Themen für die Behandlung im dritten Abschnitt schon bezeichnet sind, wie die Aufrollung des Problems des grundsätzlichen Zusammenhangs von Sein und Wahrheit aus der Problematik der Zeitlichkeit. Aber in § 68d wird nun die Herausarbeitung dieses Grundproblems der Phänomenologie die Voraussetzung für „die Analyse der zeitlichen Konstitution der Rede und die Explikation der zeitlichen Charaktere der Sprachgebilde“. Zentral für eine ontologische Explikation ist die weit gestreute Grammatik des Verbums „Sein“ in der Eingliederung der Abwandlungen seiner Konjugation. Denn die Rede zeitigt sich nicht primär in einer bestimmten Ekstase. Das Zeitwort gründet sich in dem Ganzen der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit. Ferner sind die drei Tempora mit den „übrigen zeitlichen Phänomene(n) der Sprache, ‚Aktionsarten‘ und ‚Zeitstufen‘“, verwickelt. Insbesondere kann die heutige Sprachwissenschaft, die ihre Analysen mit Hilfe des vulgären Zeitbegriffes notgedrungen durchführt, „das Problem der existenzial-zeitlichen Struktur der Aktionsarten“ nicht einmal stellen (349). Die verbale Aktion ist grammatikalisch nach drei Grundarten eingeteilt: 1) momentan, augenblicklich, iterativ; 2) kontinuierlich, fortlaufend, andauernd, imperfekt; 3) perfektiv, vollendend, vervollkommnend. Wir sind oben schon einer erfahrungsmäßigen Variante dieser Einteilung in die drei Arten von Langeweile begegnet, die sich entsprechend auf eine begrenzte stehende Zeit, eine zögernd-fließende Zeit, und die als ein Horizont gebannte Zeit des Daseins im Ganzen gründet. Denn die horizontale Zeit als Temporalität ist ein ontologisches, transzendentales oder apriorisches Perfekt, „das die Seinsart des Daseins charakterisiert“ (85 sowie die Anm. in GA 2). „Zu jeder Ekstase als solcher gehört ein durch sie bestimmter und ihre eigene Struktur allererst vollendender Horizont“ (GA 24, 435). Der offenbleibende Horizont, an dem jede Ekstase ihr Ende hat, ist ein perfektives Zeichen der Endlichkeit der Zeitlichkeit, da „dieses Ende nichts anderes als der Anfang und Ausgang für die Möglichkeit alles
278
Theodore Kisiel
Entwerfens ist“ (GA 24, 437). Die Ermöglichung des transzendentalen Perfekts hat den Charakter des vorgängigen Seinlassens (85), oder besser, der Gelassenheit, wo die perfektive Nachsilbe zugleich aktiv und passiv in der Zweideutigkeit der vox media ist; es heißt zugleich das je-schon-gelassen-sein und das sein-lassen. Deswegen haben wir eine Reihe von perfektiven Existenzialien in Sein und Zeit: Geworfenheit, Befindlichkeit, Erschlossenheit, Entdecktheit, Verfallenheit, Entschlossenheit, usw. Das Perfektum drückt eine irgendwie definitiv gewordene Handlung aus, die immer noch und weiter im Werden ist. Perfektgebrauch findet statt nur, wenn an der Sache die Wirkung früheren Tuns noch zugegen ist. Heidegger bemerkt zum Beispiel, daß in der Wahrnehmung intentional verstanden das Zentrale weder das Wahrnehmen noch das Wahrgenommene ist; vielmehr ist die Wahrgenommenheit die ermöglichende Mitte der Intentionalität von Wahrnehmung, ihr intentionaler Richtungssinn, der weder subjektiv noch objektiv ist und als Ermöglichendes endlich nur aus dem Wesen der Zeit verstanden werden kann (GA 24, 95 ff.). 2. Archivarischer Hinweis. Mit dem Autograph der Vorlesung vom WS 1925–26 im Heidegger-Archiv in Marbach gibt es ein Konvolut von etwa 200 Blättern in einem Umschlagblatt mit dem Titel „I. 3“. Eine Auswahl von etwa 30 Blättern aus dem Konvolut ist erschienen (Heidegger Studies 14, 1998), unter ihnen aber keines der vielen Blätter – und dazu auch ein ganzes Faszikel –, die mit der Nummer „69“ versehen sind. Denn das ganze Konvolut ist eine Sammlung von Notizen, die auf die Themen und sogar auf bestimmte Kapitel des unveröffentlichten dritten Abschnittes hinweisen und die wohl in den Jahren 1926–1927 niedergeschrieben wurden. Eine Zusammenfassung der Gruppierung der Notizen deutet auf eine Einteilung von etwa sechs Kapiteln in dem fehlenden Abschnitt hin. Kapitel 1 hätte wohl einen Titel wie „Phänomenologie und die positiven Wissenschaften“ getragen und die Methode der ontologischen (gegenüber der ontischen) Thematisierung behandelt. „Zeitlichkeit und Weltlichkeit“ ist der ausdrückliche Titel von Kapitel 4, das seine Themen zumeist aus § 69c von Sein und Zeit genommen hätte. Man findet auch durchaus Bemerkungen, Ausdrücke und Redewendungen, die nicht in Heideggers bekannten Vorlesungen und Veröffentlichungen auftreten, wie zum Beispiel die Teilung des Gewärtigens in „expectativ – praesentativ – perfektiv“, „Existenzmomente“ wie „das formal Futurische“ und „das formal Perfektische“; „Zeit ist ein Selbstentwurf auf sich selbst (ihr Horizontales, ihr Ekstatisches)“. Ein ausführliches Studium des ganzen Konvolutes kann unser Wissen um den Richtungs- und Vollzugssinn des fehlenden dritten Abschnittes vertiefen, und den Versuch, ihn zu rekonstruieren, bereichern (vgl. dazu Köhler 1991).
12 Das Versagen von SEIN UND ZEIT
279
Literatur Kisiel, Th. 1992: „Das Kriegsnotsemester 1919: Heideggers Durchbruch zur hermeneutischen Phänomenologie“, Philosophisches Jahrbuch 99, 105–122 Kisiel, Th. 1993: The Genesis of Heidegger’s Being and Time. Berkeley: University of California Press Kisiel, Th. 1997: „Die formale Anzeige. Die methodische Geheimwaffe des frühen Heidegger“. Markus Happel (Hg.), Heidegger – neu gelesen, Würzburg, 22– 40 Köhler, D. 1991: Die Schematisierung des Seinssinnes als Thematik des dritten Abschnittes von Sein und Zeit, Bonn
13 Dieter Thomä
Sein und Zeit im Rückblick. Heideggers Selbstkritik
Im Jahr 1941 erklärte Martin Heidegger: „Daß dieses Buch“ – gemeint ist Sein und Zeit – „seine Mängel hat, davon glaube ich selbst einiges zu wissen. Es ist hier wie bei einer Besteigung eines unbestiegenen Berges. Weil er steil und unbekannt zugleich ist, gerät, wer hier geht, bisweilen ins Stürzen. Der Wanderer hat sich plötzlich verstiegen. Zuweilen stürzt er auch ab, ohne daß der Leser das merkt“ (GA 49, 27). Folgt man dieser Aussage, ergeben sich bei der Erörterung von Heideggers „Selbstkritik“1 vier Aufgaben. Zum ersten kommt es demnach darauf an, die Stellen in Sein und Zeit aufzufinden, an denen der Autor gemäß eigener späterer Einschätzung „Irrgänge“ (GA 66, 411), „Um- und Rückwege“ (Arendt/Heidegger 1998, 104; GA 49, 40) unternommen hat oder gar abgestürzt ist. Diese Abstürze müssen freilich nicht fatal sein; der späte Heidegger meint, daß er sich in Sein und Zeit jeweils wieder aufgerafft und den weiteren Aufstieg teilweise bewältigt habe. Gleichwohl hat er sich am Ende der Arbeit an Sein und Zeit, also am Ende seiner „halben Versuche“ (Heidegger 1969, 47) verstiegen: Bekanntlich blieb dieses Werk unabgeschlossen; insbesondere der Dritte Abschnitt des Ersten Teils, der nach Auskunft aus dem Jahr 1928
1 Als „Selbstkritik“ bezeichnet Heidegger seine Schrift zur „Auseinandersetzung mit ‚Sein und Zeit‘“ aus den Jahren 1935/36, die in Band 82 der Gesamtausgabe erscheinen soll und mir nicht zugänglich war (vgl. GA 66, 420). Heideggers „Kritik“ muß in einem neutralen Sinn verstanden werden, also als Versuch der abgrenzenden Klärung. Zu den klassischen Texten mit Selbstdeutungen, u. a. dem Brief „Über den ,Humanismus‘“ (in Heidegger 1967, vgl. GA 9), dem Brief an Richardson (Heidegger 1963) und dem Vortrag Zeit und Sein (in Heidegger 1969), sind inzwischen detaillierte Kommentare in GA 49 und GA 66 hinzugekommen.
282
Dieter Thomä
eine „Kehre“ (GA 26, 201) beschreiben sollte, fehlt. „Der Versuch mißlang unterwegs“, bemerkt Heidegger (1970, 5; Auskünfte über diesen Dritten Abschnitt finden sich in GA 49, 39 f. und GA 66, 413 f.; vgl. auch Kisiels Beitrag in diesem Band). Dieses Mißlingen kreidet er jedoch nicht der Grundrichtung von Sein und Zeit selbst an, sondern der noch unzureichenden Umsicht des Autors (oder Bergsteigers). Dieser wußte seinerzeit nicht mehr weiter – aber nicht, weil es gar keinen Weg gegeben hätte, sondern weil er ihn nicht sah und gewissermaßen zum „Blindgänger“ wurde. Der zweite Punkt bildet ein Pendant zum ersten. Als Gegenfigur zu jenem von Rückschlägen heimgesuchten Bergsteiger läßt sich nämlich jemand vorstellen, der Abstürze zu meiden weiß und auf dem rechten Weg ist. Eine solche Figur meint Heidegger im Zuge eines Prozesses finden zu können, in dem er „immanente Kritik“ in Form einer „Reinigung“ von Sein und Zeit übt (Heidegger 1969, 61; GA 65, 221). Der eigentlich richtige Weg, „die eine Bahn“ (GA 66, 411) soll aus Sein und Zeit herausgearbeitet werden. Die Frage ist, wie diese direttissima aus der Sicht des späten Heidegger genau zu verlaufen hätte. Diese Frage führt sogleich zu dem dritten Problem, das in dem eingangs gegebenen Zitat verborgen ist. Man stelle sich jenen idealen Weg, den Heidegger im nachhinein zeichnet, als eine isolierte Linie im Raum vor. Ob es sich tatsächlich um einen philosophischen „Königsweg“ handelt, hängt von dem Gelände ab, auf den er passen soll. Es wäre z. B. ungeschickt, in der Ebene Spitzkehren zu machen. So drängt sich die Frage auf, welche Art von „Berg“ Heidegger nachträglich der Expedition von Sein und Zeit zuschreibt (oder unterschiebt). Nur wenn dieser „Berg“ tatsächlich der Vorgabe entspricht, die er sich damals gemacht hat, kann das, was später als Irrgang oder Absturz beklagt wird, schon als Unzulänglichkeit gemäß der inneren Logik von Sein und Zeit gelten. Umgekehrt könnte das, was Heidegger gemäß späterer Revision als bereinigte Bewegung durchs Gelände vorschwebt, aus seiner eigenen früheren Sicht, in einer anderen Landschaft als Weg erscheinen, auf dem man sich verrennt, den Boden unter den Füßen verliert oder auf Granit stößt. In diesem dritten Punkt geht es also, allgemein gesagt, um die Frage, ob das, was Heidegger im Rückblick über Sein und Zeit sagt, als „immanente Kritik“ gelten darf oder ob er aus der Fremde über sein frühes Hauptwerk herfällt und ein verzerrtes Bild von ihm zeichnet. Es kommt zu einer Doppelung in zwei Perspektiven – eine frühe und eine späte –, deren Verhältnis erst noch der Klärung bedarf. Neben seine internen Klärungs- und Abgrenzungsversuche treten schließlich viertens Heideggers Bemühungen, Sein und Zeit in Schutz zu nehmen
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
283
vor Angriffen von außen, gegen einen „Wust von Mißdeutung“ (GA 69, 9). Zu der von ihm betriebenen Selbstkritik gesellt sich die Kritik an der Fremdkritik, an bestimmten Interpretationen, die sich aus seiner Sicht auf irreführende Weise mit Sein und Zeit befassen, die also – um im Rahmen unserer Metapher zu bleiben – dessen Autor auf eine Fährte setzen, an der ihn nichts lockt. Mit diesen vier Punkten ist der Rahmen abgesteckt, den ich in den folgenden vier Abschnitten ausschreiten will. Vorausgeschickt sei nur eine Bemerkung: Ob die späten Texte Heideggers im Vergleich zu Sein und Zeit als gereinigte, freiere Entfaltung seines Denkens oder als Rückschritt anzusehen sei – auf diese Frage mag es eine entschiedene Antwort geben; sie zu liefern ist aber nicht Sache dieses Kommentars, in dem es vielmehr darum geht, anhand von Heideggers „Selbstkritik“ eine möglichst klare Beschreibung des Verhältnisses zwischen Sein und Zeit und seinen späteren Schriften zu geben.
13.1 Was Heidegger im Rückblick „mißlich“ (Heidegger 1967, 209) findet, sind zuallererst die Titel, unter die er sein frühes Unternehmen gestellt hat. Er sieht es als unvermeidlich an, daß er zunächst noch „in den Bahnen“ zu denken hat, „aus denen er sich losmacht. Daher gebraucht er Begriffe wie ‚Phänomenologe‘, wie ‚Metaphysik‘ des Daseins (Kantbuch), wie ‚Fundamentalontologie‘“ (GA 49, 28). Demnach liegt eine Schwäche von Sein und Zeit darin, daß das Gewand, in das seine Philosophie sich dort gekleidet hat, noch aus altem Stoff bestand: Auf der einen Seite wurde in Sein und Zeit „metaphysisch gesprochen und dargestellt“, auf der anderen Seite „doch anders gedacht“ (GA 66, 321). In dieser Unterscheidung liegt die These, daß das Traditionelle dem Denken von Sein und Zeit äußerlich blieb, es also abgeschüttelt werden kann, auf daß das „andere Denken“ nur um so reiner hervortritt. Daß er sich am Anfang noch schwertat, verbürgt freilich die Authentizität, mit der er an der Ladung der Vergangenheit laborierte; deren Löschung erfolgte nicht leichtfertig (vgl. Heidegger 1969, 32; GA 65, 351). Warum aber werden die Titel verworfen, unter die das frühe Unternehmen gestellt war? Am ausführlichsten erläutert Heidegger dies im Hinblick auf die „Fundamentalontologie“, die ihm nun als etwas „Übergängliche[s]“ erscheint (GA 65, 305). Sein Bezugspunkt ist hier ein Satz aus der Einleitung von Sein und Zeit: „Daher muß die Fundamentalontologie
284
Dieter Thomä
[…] in der existenzialen Analytik des Daseins gesucht werden“ (13; vgl. Heidegger 1969, 34; Heidegger 1967, 209). Der späte Heidegger weist die Idee ab, mittels einer solchen existenzialen Analytik lasse sich das „Fundament für die noch fehlende, aber darauf aufbauende Ontologie“ errichten (Heidegger, 1969, 33 f.). Diese Idee erscheint ihm irreführend, weil er in jener Analytik das Sein selbst schon im Spiel sieht, also nichts übrigbleibt, was noch darauf aufzubauen hätte. Die Analytik der inneren Verfassung des Daseins geht demnach nicht der Ontologie voraus, sondern soll schon nichts anderes sein als das Denken des Seins. In einer Randbemerkung seines Handexemplars von Sein und Zeit bemängelt Heidegger deshalb, seine frühere Darstellung bleibe „mißverständlich, vor allem bezüglich der Rolle des Daseins“ (439). In dem Maße, wie der „Verstehenshorizont des Daseins“ sich selbst schon dem Sein verdankt, „verträgt“ er – so heißt es jetzt – „kein Aufbauen darauf“, das dann erst die Thematisierung des vom Dasein verstandenen Seins des Seienden beinhaltete; dieser Horizont taugt nicht als dessen „Bedingung“ oder „Fundament“ (Heidegger 1969, 34), weshalb Heidegger später in einer Randbemerkung die „Überwindung des Horizonts als solchen“ anstrebt (440) und sich die Verwendung dieses Wortes kurzerhand „verbietet“ (vgl. Picht in Neske 1977, 204). Die frühe Definition des „Horizonts“ ist gebunden an denjenigen, der sich entwirft und auf etwas hinausblickt, und nicht an dasjenige, das etwa diesen Blick seinerseits ermöglicht. Deshalb heißt es später: „Die in Sein und Zeit gekennzeichnete ekstatisch-horizontale Zeitlichkeit ist keineswegs schon das der Seinsfrage entsprechende gesuchte Eigenste der Zeit“ (Heidegger 1963, XIII). Heidegger sieht sich in Sein und Zeit auf der Suche nach einer Brücke zwischen zwei Fragen: der Frage nach der Zeitlichkeit des Daseins und der Frage nach der Wahrheit. In dem Maße nämlich, wie das Dasein seine zeitliche Verfassung „aushält“ oder sich in sie hinein „versetzen“ kann (vgl. 325, 445), soll das Seiende in seiner Unverborgenheit, das heißt „Wahrheit“ zugänglich werden; es wird „gelichtet“. Genau diesen Übergang von der Zeitlichkeit zur Wahrheit (vgl. Grondin 1987, 32 ff.) habe er, wie Heidegger im Rückblick erklärt, in Sein und Zeit „geahnt, aber nicht bewältigt“ (GA 69, 94; vgl. GA 66, 300; GA 65, 351). Gemäß dem im nachhinein unterstellten Vorsatz sollte die Selbstfindung des Daseins in Sein und Zeit einhergehen mit der Eröffnung oder Lichtung einer Welt, in der das Seiende in seinem Sein in Erscheinung tritt für das Dasein, das ja selbst „weltzugehörig“ (65) oder gar, wie in einer Randbemerkung ergänzt wird, „welthörig“ ist (441). Diese Verknüpfung kam zunächst jedoch, folgt man der späteren Selbstkritik, nicht angemessen
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
285
zum Ausdruck. Den Grund hierfür sieht Heidegger, kurz gesagt, in einer subjektivistischen Verunreinigung von Sein und Zeit. Dies macht er an verschiedenen Beispielen fest, und drei dieser heiklen Punkte seien hier kurz erörtert: sie haben zu tun mit dem Raum, der Sprache und dem Ich. Im ersten Beispiel geht es um den Raum. Lapidar bemerkt Heidegger im Jahr 1962: „Der Versuch in ‚Sein und Zeit‘ § 70, die Räumlichkeit auf die Zeitlichkeit zurückzuführen, läßt sich nicht halten“ (Heidegger 1969, 24). Diese Selbstkritik – kaum sonst so unverhohlen wie hier – richtet sich gegen die These aus Sein und Zeit, die Zeit habe eine „fundierende Funktion für die Räumlichkeit“ (368). Damals hieß es, „so etwas wie Gegend“, also „Raum“ ergebe sich erst dank des zeitlich gedachten Daseins, des „sichausrichtende[n] Entdecken[s]“, erst also „auf dem Grunde der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit“ (368 f.). An diesen früheren Bestimmungen kann Heidegger genau das nicht tilgen, was ihm den Zugang zu jener „Gegend“ zu verstellen scheint: das eigenständige Vorgehen des Daseins, dem eine eigene zeitliche Dimension zukommt. Interessant an dieser Selbstkritik ist nun, daß es Heidegger auch später keineswegs darum geht, den Raum strikt von der Zeit zu trennen. Gemäß seiner späteren These obliegt es weiterhin der Zeit als dem „lichtende[n] Einander-sich-reichen von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart […], Raum ein[zu]räumen, das heißt [zu] geben“ (Heidegger 1969, 15). Auch hier wird der Raum also aus der Zeit abgeleitet. Sie ist freilich nicht mehr dem Dasein als „geworfenem Entwurf“ zugeordnet, sondern tritt als Nachfolger jener „Temporalität des Seins“ auf, von der Heidegger in Sein und Zeit und auch in der Vorlesung vom Sommersemester 1927 gesprochen hat (19 u. 39; GA 24, 324). Seinerzeit wurde behauptet, diese „Temporalität“ sei eine (nur umge,kehrte‘) Ansicht der Zeitlichkeit des Daseins. Das Scheitern dieses Junktims wird nun indirekt dadurch bezeugt, daß Heidegger in seiner späteren Selbstkritik die Ableitung des Raums aus der Zeitlichkeit des Daseins verwirft und ihn stattdessen auf die Zeit als Bewegung im „Ereignis“ zurückführt. Damit bricht er die Zeitlichkeit des Daseins und die Temporalität des Seins auseinander – entgegen dem Programm von Sein und Zeit. Das Scheitern daran, diese zwei Seiten zu vereinbaren, ist nichts anderes als das Scheitern an der Vollendung von Sein und Zeit. Die hartnäckige Selbständigkeit des Daseins macht sich auch an einem zweiten heiklen Punkt bemerkbar: dem Begriff der Sprache, der in Sein und Zeit im Anschluß an das Konzept der „Bewandtnis“ eingeführt wird. Dort hieß es, daß das „Sein des innerweltlichen Seienden“, mit dem das Dasein zu tun habe, in dessen „Bewandtnis“ für das Dasein bestehe, genauer im
286
Dieter Thomä
„Wozu der Dienlichkeit“ und „Wofür der Verwendbarkeit“ (84). Mit dieser „Bewandtnis“ ging die „Bedeutung“ einher, die ein Seiendes erhielt. Das Dasein war „vertraut“ mit der Welt als einer „Bedeutsamkeit“, und die Bedeutungen, die ihm hierbei erschlossen waren, „fundier[t]en“, so sagte Heidegger, „ihrerseits wieder das mögliche Sein von Wort und Sprache“ (86 f.). An dieser Stelle notiert er nun am Rande seines Handexemplars: „Unwahr. Sprache ist nicht aufgestockt, sondern ist das ursprüngliche Wesen der Wahrheit als Da“ (442). Die Verwobenheit in pragmatische Bezüge, von der die Analyse der Welt geprägt war, verstellt, dem späteren Urteil zufolge, die Ursprünglichkeit der Sprache, die allem Tun und Lassen vorausgeht. (Mit der Frage, ob diese Ursprünglichkeit als Bodenständigkeit oder strukturelle Vorgängigkeit aufgefaßt wird, öffnet sich übrigens dann die ganze Bandbreite der Heidegger-Interpretationen zwischen „Schwarzwald“ und Michel Foucault.) Jene Verwobenheit der Sprache mit Handlungen war aber Ausdruck der Eigenständigkeit des Daseins, die später als Rest-Subjektivismus verworfen wird. Denselben Rest-Subjektivismus sieht Heidegger nun – dies ist der dritte heikle Punkt – in der Rede vom „Ich“ selbst am Werk. Die Prozedur, in der das Dasein zu sich selbst kam, wurde in Sein und Zeit als Vorlaufen zum Tode beschrieben, mit dem es auf sich zurückgeworfen und erst in die Lage versetzt wurde, es selbst zu sein. Zu diesem Selbstsein gehörte das „,Ichsagen‘“: „Mit ,Ich‘ meint dieses Seiende sich selbst“ (318). Heidegger operierte in diesen Sätzen zwar schon vorsichtig mit Anführungszeichen, gleichwohl muß ihm später dieses „Ich“ als Ablenkung von jenem „Selbst“ erscheinen, das „sich nicht auf das seiende Selbst, sondern auf das Sein und den Bezug zum Sein bezieht“ (GA 49, 39). 1934 sagt er: „Es ist gerade die Sprengung der Ichheit und der Subjektivität durch die Zeitlichkeit, die das Dasein gleichsam von sich weg dem Sein übereignet und es so zum Selbstsein nötigt“ (GA 38, 163; vgl. GA 39, 101). In einer Randbemerkung zu Sein und Zeit wird moniert: „schärfer klären: Ich-sagen und Selbst-sein“ (445). Heideggers Resümee lautet, daß der in Sein und Zeit „eingeschlagene Weg und Versuch wider seinen Willen in die Gefahr kommt, erneut nur eine Verfestigung der Subjektivität zu werden, daß er selbst die entscheidenden Schritte, das heißt deren zureichende Darstellung im Wesensvollzug, verhindert“ (Heidegger 1961, Band II, 194) habe. Im Rückblick sieht er seine frühere Konzeption in der Gefahr eines „Absturz(es) nach der Seite eines nur modifizierten Subjektivismus“ (Arendt/Heidegger 1998, 104). Die Frage ist nun, wie er von Sein und Zeit her einen Weg beschreibt, der geradlinig auf das spätere Denken hinführt.
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
287
13.2 Heidegger mag in Sein und Zeit Elemente erkennen, die die Überwindung der Subjektivität, die er sich zur Aufgabe macht, erschweren. Dies sind die „Irrgänge“ oder „Abstürze“, von denen er im Rückblick spricht. Zugleich wehrt er sich vehement gegen die Deutung, sein frühes Hauptwerk sei geradewegs der Theorie der Subjektivität zuzuschlagen. So apodiktisch, daß es wie eine Trotzreaktion auf seine eigene Kritik am Rest-Subjektivismus seines frühen Hauptwerks erscheint, erklärt er 1941: „In Sein und Zeit bestimmt sich das Wesen der Selbstheit des Menschen nicht aus der Ichheit, nicht als Personhaftigkeit und überhaupt nicht als ‚Subjektivität‘ eines Subjekts“ (GA 49, 60). Allgemeiner heißt es dann im Jahr 1949: „Es“ – nämlich die Substanz von Sein und Zeit – „bleibt geltend“ (zit. nach Munier 1983, 154). Aber worin besteht diese Substanz, oder genauer: Was wird nachträglich als die Substanz definiert, die als verbesserte, bereinigte Version von Sein und Zeit gelten darf? Mit subtilen begrifflichen Verschiebungen versucht Heidegger das, was er als dessen sachlichen Kern ansieht, vor Mißverständnissen zu bewahren und von Unzulänglichkeiten zu befreien. Im Zentrum dieser Verschiebungen steht nichts anderes als der Zentralbegriff von Sein und Zeit, „Dasein“. Zu dem Satz „Weil zu Dasein wesenhaft das In-der-Welt-sein gehört, ist sein Sein zur Welt wesenhaft Besorgen“ (57) heißt es in einer Randbemerkung: „Mensch-sein und Da-sein hier gleichgesetzt“ (441), und diese Feststellung ist nichts als ein Selbstvorwurf. Er drängt sich Heidegger im Zuge seiner Selbstkritik deshalb auf, weil er die handelnde Eigensinnigkeit des Daseins als Menschen überwinden will. Gegen diese Gleichsetzung erwägt er in einer weiteren Randbemerkung die Formulierung vom „Da-sein, worin der Mensch west“ (442). Die sich hier andeutende Umdeutung und letztlich Abschaffung des Begriffs des Daseins erfolgt in mehreren Schritten. Der erste Schritt erfolgt am Ende von Kant und das Problem der Metaphysik mit der Rede vom „Dasein im Menschen“ (GA 3, 234). Damit wird das Dasein von einer Instanz, die gestaltend auftritt, zu einer Instanz, auf die der Mensch sich bezieht. Diese Differenz wird in einem zweiten Schritt, der Mitte der dreißiger Jahre erfolgt, verschärft. Nun ist es der Mensch, der, indem er sich auf sein Dasein einläßt, zugleich in die Welt als Spiel des Seins eintritt. Heidegger behauptet, daß gar schon in Sein und Zeit das „Wesen der Selbstheit des Menschen“ bestimmt worden sei „aus der Inständigkeit im Seinsentwurf, das heißt aus dem Da-sein“ (GA 49, 60; vgl. GA 66, 144 f.). Soll das heißen, daß dieses „Da-sein“ identisch sei mit dem Dasein von Sein und Zeit? Das wäre
288
Dieter Thomä
abwegig. Während nämlich das „alte“ Dasein in sich die Ambivalenz auszutragen hatte, im Modus der Uneigentlichkeit wie auch der Eigentlichkeit existieren zu können, tritt dagegen hier ein „neues“ Da-sein auf, eine „Stätte“ (Heidegger 1959a, 156; GA 65, 242), an die sich der Mensch versetzen oder in der er „innestehen“ kann (GA 49, 50 u. 54; vgl. GA 69, 57). Die spätere Deutung vom Da-sein kann nur Sinn machen, wenn dieses „neue“ Da-sein reserviert wird für eine bestimmte (eigentliche) Form des „alten“ Daseins. Letzteres erhält im Zuge dieser Revision umgekehrt eine anspruchslose Bezeichnung: Es ist nichts als der „Mensch“, der „im [neuen; D. Th.] Da-sein inständig“ werden kann (GA 49, 61) oder aber seinsvergessen bleibt. „Deshalb bleibt es mißverständlich“, so heißt es im Jahre 1941, „wenn in ,Sein und Zeit‘ vom ,menschlichen Dasein‘ die Rede ist. Der Name Da-sein muß schlechthin gebraucht werden, weil er solches nennt, was mit dem Mensch-sein sich nie deckt, sondern ‚höheren‘ Wesens ist als der Mensch“ (GA 49, 62). Die schärfste Zuspitzung erfährt diese neue Differenz zwischen Mensch und Dasein in Heideggers Bemerkung, sein „Denken“ sei „un-menschlich“ in dem Sinne, daß es „sich nicht an Maßstäbe und Ziele und Antriebe des bisherigen Menschentums“ anlehne, und er fügt hinzu: „Solches Denken ist – das Da-sein“ (GA 69, 24). Man könnte sagen, daß in dieser Spannung zwischen Mensch und Dasein die alte Alternative zwischen Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit wiederkehrt. Während es freilich nach Sein und Zeit, ontologisch gesehen, belanglos war, welche speziellen Individuen zur Eigentlichkeit gelangten, wird diese Freistellung nun widerrufen. Die jeweilige Ferne oder Nähe zum Da-sein und damit zum Sein wird, so heißt es nun, „durch das Sein selbst bestimmt“ (GA 49, 62 f.): „Nicht jedes geschichtliche Menschentum ist der Inständigkeit des Da-seins eigens zugewiesen; in der bisherigen Geschichte überhaupt noch keines zufolge der seinsgeschicklich zu denkenden Seinsvergessenheit“ (GA 49, 61). Umgekehrt meint Heidegger nun hören zu können, wenn im Sinne jener Seinsnähe „die Stunde unserer Geschichte […] geschlagen hat“ (GA 39, 294). (Freilich verhört er sich dabei gelegentlich, zum Beispiel 1933.) Mit der Abspaltung vom Menschen wird der Begriff des Daseins als unterschieden vom Sein überflüssig, und im Zuge dieses dritten Schritts verschwindet es aus dem Spätwerk. Es genügt nun, „das Auszeichnende des Menschen“ darin zu sehen, daß er, „offen dem Sein, vor dieses gestellt ist, auf das Sein bezogen bleibt und ihm so entspricht“ (Heidegger 1957a, 22). Die Rede ist nun vom „Zusammengehören von Sein und Mensch“ (Heidegger 1969, 45), doch weil diese Doppelung noch den Schein der „Vergegenständlichung des Seyns“ (GA 65, 451) mit sich bringt und den irre-
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
289
führenden Eindruck erweckt, hier müsse zweierlei zusammengebracht werden, wird jenes Begriffspaar schließlich aufgegeben; diesen letzten Schritt hin zu „Ereignis“ und „Geviert“, in die der Mensch schon einbezogen ist, möchte ich, um mich nicht von Sein und Zeit zu entfernen, hier unerläutert lassen. Ungeachtet dieser einschneidenden Neubeschreibungen beharrt Heidegger darauf, daß er seinem ersten Unternehmen Sein und Zeit – von den hier im ersten Abschnitt diskutierten Verunreinigungen abgesehen – die Treue halte. Im folgenden Abschnitt wird es nun um die Frage gehen, ob seine retrospektive Deutung immanent bleibt, ob also die Aufgabe, die er Sein und Zeit rückwirkend stellt, mit der zusammenfällt, an der er seinerzeit laboriert hat. Folgt man der Metapher, die Heidegger selbst (s. o.) für sein Unternehmen verwendet hat, lautet die Frage also nun: Ist der „Berg“, den er in Sein und Zeit bestiegen hat, tatsächlich derselbe wie derjenige, den er seinem im nachhinein beschriebenen Weg unterlegt?
13.3 Heidegger schlägt bei seiner Selbstkritik von Sein und Zeit eine Doppelstrategie ein: Er scheidet bestimmte subjektivistische Verirrungen aus (s. o. 13.1), um durch dieses Werk einen Weg zu bahnen, der geradewegs ins späte Denken führt (s. o. 13.2). Dies wirft natürlich die Frage auf, ob er mit dieser Auftrennung in störendes Beiwerk und positiven Kernbestand seinem frühen Hauptwerk gerecht wird. Erörtern möchte ich diese Frage um der Faßlichkeit willen im Ausgang von einer einzigen kurzen Passage. Sie lautet: „Die in der eigentlichen Zeitlichkeit gehaltene, mithin eigentliche Gegenwart nennen wir den Augenblick. Dieser Terminus muß im aktiven Sinne als Ekstase verstanden werden. Er meint die entschlossene, aber in der Entschlossenheit gehaltene Entrückung des Daseins an das, was in der Situation an besorgbaren Möglichkeiten, Umständen begegnet“ (338). Zunächst sei der Kontext dieser Passage in Sein und Zeit kurz erläutert. Der „Augenblick“ wurde dort eingeführt als „eigentliche Gegenwart“. Die „Gegenwart“ wiederum wurde allgemein dem „Verfallen“ als einer der Strukturformen der „Erschlossenheit“ zugeordnet (334 f. u. 346). Dieses „Verfallen“ gelangte zu der „eigentlichen“ Gestalt des „Augenblicks“, sofern sich die Gegenwart nicht auf Kosten der anderen Zeitdimensionen, des Zukünftigen und Gewesenen verselbständigte. Deshalb genau sollte die „Entrückung“ in der „Entschlossenheit“ gehalten werden (s. o.), also auf die zeitliche Ganzheit des Daseins bezogen bleiben (vgl. 298 u. 305).
290
Dieter Thomä
Auf die Gefahr hin, penibel zu wirken, möchte ich nun den Deutungen nachgehen, denen die oben zitierte Passage als „Testfall“ aus Sein und Zeit im Zuge von Heideggers weiterer Entwicklung ausgesetzt ist; dabei halte ich mich vor allem an die Wendung von der „in der Entschlossenheit gehaltene[n] Entrückung des Daseins“ und frage, was den beiden in ihr gegeneinandergesetzten Begriffen widerfährt. Erste Erläuterungen zur Entrückung finden sich in der Vorlesung vom Sommer 1928. Demnach meint sie ein „Heraustreten aus sich“, den „Überschwung“, die „Ekstase“, der die „Transzendenz“ des Daseins zugeordnet ist (GA 26, 265 ff.; Heidegger 1967, 34). Die Entrückung als Ekstase wird zum Charakteristikum der „Ek-sistenz“ erklärt. Dessen „Hinausstehen“ sei nun aber, so sagt Heidegger 1941, schon „im Umkreis des Fragens von Sein und Zeit als „Innestehen“ oder „Inständigkeit“ gedacht worden (GA 49, 53 f. u. 76). Diese Umkehrung der Perspektive wird 1949 resümiert: „Die Stasis des Ekstatischen beruht, so seltsam es klingen mag, im Innestehen im ‚Aus‘ und ‚Da‘ der Unverborgenheit, als welche das Sein selbst west. Das, was im Namen ‚Existenz‘ zu denken ist, […] könnte das Wort ‚Inständigkeit‘ am schönsten nennen“ (Heidegger 1967, 203). Faßt man dieses terminologische Wechselspiel zusammen, so entpuppt sich der erste hier zu erörternde Begriff, die „Entrückung“ nämlich, als Inständigkeit – dies wohlgemerkt nicht aufgrund nachträglicher Revision, sondern in vermeintlich treuer Auslegung von Sein und Zeit. Und was widerfährt dem zweiten Begriff, der Entschlossenheit? Ungeachtet von deren martialischem Unterton will Heidegger gerade an ihr die Konsistenz seines Werkes aufweisen. Die neue Schreibweise als „Entschlossenheit“ (Heidegger 1967, 93 f.) macht deutlich, daß es darin um ein Aufschließen seiner selbst, also ein „Sich-öffnen“ oder „Offenhalten“ gehen soll. Als Wendung gegen die Uneigentlichkeit wurde dies in Sein und Zeit verstanden als ein Offensein für sich selbst, für das eigene Sein; zu dieser „Entschlossenheit zu sich selbst“ (298) gehörte durchaus auch Tatkraft und Tatendurst, wie in Sein und Zeit und den Texten um 1933 deutlich wird. In den Jahren danach stellt Heidegger die „Entschlossenheit“ gegen die „decidierte Aktion eines Subjekts“ und deutet sie als „die Eröffnung des Daseins aus der Befangenheit im Seienden zur Offenheit des Seins“ (Heidegger 1950, 55). Die „Entschlossenheit“ wird zwar als „Wille“ bestimmt (Heidegger 1953, 16 f.); sich selbst zu wollen ist aber nichts anderes als ein Jasagen zu dem, was man ist, und weil dieses eigene Sein schon eingelassen ist in die Welt, will man, wenn man sich selbst will, doch nichts als das Sein (vgl. Heidegger 1961, Band I, 63 u. 161). Damit wird die „Entschlossenheit“ explizit mit der „Inständigkeit“ identifiziert, in die sich auch schon –
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
291
wie dargestellt – die „Entrückung“ verwandelt hatte: „Das Wesentliche der Entschlossenheit liegt […] in der […] Offenheit zur Wahrheit des Seins als solchen […]. Sie ist die Inständigkeit in der Ausgesetztheit zum Da: das Da-sein“ (GA 66, 144 f.; vgl. GA 38, 162 f.; Heidegger 1959b, 61). So kann in den Beiträgen zur Philosophie vom „Willen zum Ereignis“ und von der „Inständigkeit im Ereignis“ (GA 65, 58 u. 72) als dem Selben die Rede sein. Auch der zweite hier zu erörternde Begriff, die „Entschlossenheit“, entpuppt sich also am Ende von Heideggers Explikation als Inständigkeit. Wenn man sich nun von dieser späten Einsicht zurücktreiben läßt zu der Passage, die ich eingangs dieses Abschnitts als „Testfall“ zitiert habe, dann ergibt sich ein verstörendes Resultat. Hieß es in Sein und Zeit vom „Augenblick“, er meine „die entschlossene, aber in der Entschlossenheit gehaltene Entrückung des Daseins“, dann ergibt sich aufgrund Heideggers späterer Deutung nun die These, der Augenblick sei „die inständige, aber in der Inständigkeit gehaltene Inständigkeit des Daseins“. Das ist leider ziemlich unsinnig. Während in Sein und Zeit das „aber“ die Entschlossenheit (zum eigenen Selbst) der Entrückung (an die Welt) entgegenstellte, wird dieser Gegensatz nun mit der allseits entwickelten „Inständigkeit“ zum Einsturz gebracht – und damit bricht der Sinn jenes Satzes in sich zusammen. Man mag jene Gegenüberstellung von Entschlossenheit und Entrückung in Sein und Zeit fragwürdig finden oder nicht – das bleibt hier unerheblich. Entscheidend ist: Heidegger erhebt ausdrücklich den Anspruch, mit seinen späteren Deutungen dem eigentlichen Anliegen von Sein und Zeit treu zu bleiben; meinem „Testfall“ zufolge ist dieser Anspruch unhaltbar. An dem hier diskutierten Satz scheitert die Strategie, Verunreinigungen zu beseitigen und einen wahren Kern aufrechtzuerhalten. Heidegger wird dem, was in Sein und Zeit verhandelt wird, nicht gerecht, versucht es vielmehr neu so zuzurichten, daß es in sein spätes Denken paßt. Entgegen eigenen Bekundens übt er nicht „immanente Kritik“ an Sein und Zeit (s. o. Einl.), sondern tritt vielmehr aus der Immanenz jenes Werkes heraus. Was bei der späteren Fehldeutung von Sein und Zeit verlorengeht, ist die eigenständige Dimension, in der das Dasein mit sich selbst zu tun hatte. In ihr war der Mensch zu einer Befassung mit sich selbst aufgefordert. Noch in der Vorlesung vom Sommer 1928 ist zu lesen: „Zu-sich-selbst-sein ist gerade das Existieren“ (GA 26, 244; vgl. Sein und Zeit 325; Heidegger 1961, Band I, 63). Demnach sollte der „Begriff der Subjektivität und des Subjektiven von Grund aus verwandelt“, also in anderer Form beibehalten werden (GA 26, 252). Diese Subjektivität ist tiefer in Sein und Zeit verankert, als Heidegger dies später wahrhaben will – so tief, daß sie nicht als Verunreinigung ausscheidbar ist.
292
Dieter Thomä
Die nachträgliche Lesart, wonach in Sein und Zeit das Subjekt doch schon „überwunden“ worden sei (Heidegger 1950, 104 u. 1967, 159; GA 49, 50 u. 60), gewinnt eine gewisse Plausibilität, wenn man von einem Begriff des Subjekts ausgeht, wie er in Heideggers eigener Kritik der Metaphysik exponiert wird. Das Subjekt ist demnach getrieben davon, sich selbst zu setzen und die Welt zu beherrschen. Dieser Machtphantasie erliegt das Dasein aus Sein und Zeit trotz all seines „Verfügens“ über Seiendes freilich nicht; es existiert auf einem Grund, den es nicht selbst gesetzt hat. Dies ermutigt den späten Heidegger zu der Behauptung, das Dasein stünde im Grunde doch schon dem Subjekt fern. So wirkt die späte Frage, ob das Dasein aus Sein und Zeit noch der Philosophie des Subjekts zuzuschlagen sei, rein rhetorisch: „Wie soll, was gerade nicht aus einer Subjektivität entspringt, jemals ,subjektiv‘ sein“ (GA 49, 50)? Das Problem ist nur: Diese Frage ist gar nicht rhetorisch, sondern irreführend. Natürlich muß das, was „subjektiv“ ist, nicht auch „einer Subjektivität entspring[en]“. Es gehört vielmehr zur Grundstruktur der Subjektivität, sich in einer Selbstbeziehung zu erfahren, über deren Herkunft sich keine hinreichende Auskunft geben läßt. Wenn dieses Subjekt sich nicht zum Ursprung seiner selbst macht, hört es doch nicht auf, Subjekt zu sein. Aus der Geschichte der neueren Philosophie ist, von Descartes und Montaigne bis zu Kant, Rousseau und Schelling, das Problem geläufig, daß das Subjekt in seine Selbstbezüglichkeit und Selbstbestimmung auf unvordenkliche Weise hineingeraten ist. Dies ist keineswegs etwas, was es aus sich „entspringen“ läßt. Man mag diese Struktur der Subjektivität der Kritik unterziehen; Heidegger aber zieht es vor, vom Subjekt ein Zerrbild der Selbstverfügung zu liefern, und so fällt es ihm leicht, das Dasein von Sein und Zeit aus diesem Zerrbild herauszunehmen.2
2 Heideggers Zerrbild hat mehrere unerquickliche Folgen: Diejenigen, die von Heidegger aus in dekonstruktivistischen Bahnen weiterdenken, übernehmen dessen späte Subjektkritik allzu leichtfertig und geraten damit in das geschilderte irreführende Schema hinein. Unter umgekehrten Vorzeichen beherrscht dieses Schema auch diejenigen, die gegen Heidegger den Einwand vorbringen, er habe das Subjekt in seiner Autonomie und Vernünftigkeit zur Strecke gebracht; damit lenken sie von den hausgemachten Schwierigkeiten ab, mit denen dieses Subjekt doch zu kämpfen hat. – Eine weitere problematische Folge von Heideggers Zerrbild des Subjekts zeigt sich an der Deutung seines NS-Engagements: Es wird im Rückblick als Irrweg gedeutet, in dem sich der Subjektivismus als die ‚schlechte Seite‘ von Sein und Zeit verselbständigt hat; doch steht es als eine Version des „Willens zum Ereignis“ (s. o.) Heideggers Gegenfigur zum sogenannten Subjekt durchaus nahe. So gehört zum Kontext von Heideggers Auseinandersetzung mit Sein und Zeit auch seine konfuse Deutung des Nationalsozialismus.
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
293
Dieses Dasein gehört jedoch mit dem Problem der Selbstbeziehung in den Rahmen einer Theorie der Subjektivität, die diesseits der Idee vom machtbesessenen Subjekt ihr Recht behält. Dieses Problem, das in Heideggers späterer Lesart unbeachtet bleibt, kann man nicht als eine bloße Verunreinigung von Sein und Zeit auffassen. Es gehört vielmehr zum eigenständigen systematischen Kern dieses Buches, welcher unkenntlich wird in dem nachträglichen Versuch, das frühe Hauptwerk so auszurichten, daß es als noch unbeholfener Aufstieg auf den „Berg“ des Seins erscheint. Unhaltbar ist deshalb Heideggers Junktim, wonach das späte Denken nur von Sein und Zeit her „zugänglich“ werde, letzteres aber als im späten Denken „enthalten“ verstanden werden müsse (Heidegger 1963, XXIII). Hier trifft ein schöner Satz, der ursprünglich auf Karl Marx gemünzt war: „Fundamentale und flagrante Widersprüche unterlaufen zweitrangigen Autoren selten; in den Schriften großer Autoren führen sie in den Mittelpunkt ihres Werkes“ (Arendt 1967, 95). In Sein und Zeit wurde mit der Gegenüberstellung von „Entschlossenheit“ und „Entrückung“ die Kluft zwischen Selbst und Welt, Sein des Daseins und Sein überhaupt thematisch – eine Trennung, die Heidegger daran hinderte, innerhalb der Logik von Sein und Zeit eben die in sich geschlossene Bewegung im „Selben“ zu vollführen, die er später unter den Titel „Kehre“ stellt (vgl. Grondin 1987, Sheehan 2001, Thomä 1990, 444 – 465). Nachdem die Vollendung von Sein und Zeit gescheitert ist, muß Heidegger zunächst die geschilderte Kluft zum Verschwinden bringen, um dann von einer neuen, fingierten Ausgangsposition aus zur „Kehre“ anzusetzen. Damit aber geht „Sein und Zeit“ als faktischer Ausgangspunkt verloren, Heideggers Werk bricht auseinander. Es stellt nicht die Bezugspunkte bereit, die strikt unter dem Titel „Kehre“ aufeinander bezogen werden könnten. Dieser Begriff stiftet Verwirrung, weil er die Immanenz, die Geschlossenheit einer sich in sich selbst wendenden, auf sich zurückkommenden Bewegung unterstellt, die es so doch nicht gegeben hat. Hinsichtlich der Schwierigkeiten mit dieser „Kehre“ ist die Passage aus Sein und Zeit, von der ich mich in diesem Abschnitt als „Testfall“ habe leiten lassen, auf zweierlei Weise erhellend. Zum ersten gibt sie, wie gesehen, Auskunft darüber, daß in Sein und Zeit noch ein „Bezug“ des Menschen vorgesehen war, der nicht geradewegs dem „Sein“ galt, sondern einerseits dem eigenen Selbstsein, andererseits der Welt. Zum zweiten gibt sie, wie noch zu zeigen ist, Auskunft darüber, daß das, worauf sich der Mensch da bezieht, in Sein und Zeit anders gefaßt wird als später. „Entrückt“ war das Dasein „an das, was in der Situation an besorgbaren Möglichkeiten, Umständen begegnet“ (338, s. o.). Diese pragmatische
294
Dieter Thomä
Wendung zum „Besorgbaren“ würde fremd wirken, wenn man versuchte, sie in den späten Kontext der „Inständigkeit“ zu übertragen. Im Hintergrund dieser Schwierigkeit steht ein Begriff, der nun – wie dessen Pendant, das Dasein (s. o. 13.2) – Umdeutungen ausgesetzt ist: nämlich die „Welt“. Wie das Dasein in Sein und Zeit als „entschlossenes“ handlungsfähig wurde, so hatte auch die Welt, an die es „entrückt“ war, pragmatische Züge; in ihr spiegelte sich die Art, wie das Dasein dort aufgefaßt wurde. So muß später, zugleich mit ihm, auch dessen „Welt“ zur Disposition gestellt werden. Heidegger schreibt deshalb, die „Umweltanalyse“, also die §§ 14 –24 von Sein und Zeit, seien „im Ganzen und auf das leitende Ziel hin angesehen von untergeordneter Bedeutung“ (Heidegger 1967, 52). Umgekehrt führt er als neuen Begriff die „Erde“ ein, in die „das Dasein als geschichtliches schon geworfen“ sei (Heidegger 1950, 62; vgl. GA 39, 88); in Sein und Zeit wäre genau dies noch die „Welt“ gewesen, über den hier erfolgten Partnertausch gibt Heidegger jedoch keine nähere Auskunft. Tritt man einen Schritt zurück und stellt den späten neben den frühen Heidegger, so tut sich folgende Alternative auf. Wendet man sich an Sein und Zeit, so hält man an dem Problem fest, wie ein in seine Belange verstricktes Dasein so zu sich selbst findet, daß es damit in ein freies Verhältnis zur Welt eintritt, daß sich ihm, anders gesagt, die Welt öffnet. Offenbar fehlt in Sein und Zeit jedoch eine befriedigende Lösung für dieses Problem. Die weit auseinanderstrebenden Interpretationen, die in Heidegger einerseits den Dezisionisten, andererseits den Kontextualisten entdecken, sind dafür nur ein Symptom. Hält man sich dagegen an die späten Texte, bringt man jenes Problem brüsk zum Erliegen: „Entschlossenheit“ einerseits, „Entrückung“ andererseits verwandeln sich in dieselbe „Inständigkeit“. Wie man sich angesichts dieser Alternative entscheidet, darüber ist im Rahmen dieses Kommentars nicht zu befinden. So oder so aber läßt sich Sein und Zeit nicht unter dem Dach einer sich langsam reinigenden und klärenden „eigentlichen und einzigen Frage“ (Heidegger 1967, 207) unterbringen. Heideggers Anspruch, sein frühes Hauptwerk einerseits nur zu reinigen (s. o. 13.1), andererseits nur auszulegen (s. o. 13.2), ist irreführend; im Zuge seiner Deutung wendet er sich von ihm ab.
13.4 Heideggers Versuch, aus Sein und Zeit den Kern herauszuschälen, der den Keim für sein weiteres Denken enthält, wird begleitet von den Bemühungen, sein frühes Hauptwerk vor den Deutungen in Schutz zu nehmen, die
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
295
sich statt an jenen Kern an die Schale, also an Äußerlichkeiten halten. Seine Selbstkritik ist deshalb begleitet von einer Verteidigung gegen Kritik von außen, gegebenenfalls auch gegen falsche Freunde (wie etwa gegen Jaspers, dessen Existenzphilosophie als „ödeste Nivellierung“ seines Denkens gebrandmarkt wird; GA 69, 9). Zwei Mißverständnisse sind es vor allem, die Heidegger aufgreift und angreift: Das erste führt zur Anthropologisierung, das zweite zur Ethisierung von Sein und Zeit. Mit beiden möchte ich mich kurz befassen. Daß die „Abgrenzung gegen jede Art von philosophischer Anthropologie“ (GA 49, 33) aus Heideggers Sicht für das rechte Verständnis von Sein und Zeit entscheidend ist, liegt auf der Hand: Mit dem In-der-Weltsein des Daseins erledigt sich die Spezialbehandlung des Menschen, bei der dessen Wesenszüge untersucht werden. Genau diese Isolierung hält er für verhängnisvoll. Wenn Heidegger sich etwa gegen eine Anthropologie vom Typ Arnold Gehlens abzugrenzen hätte, würde er sagen: Das menschliche Leben ist nicht schon mit Eigenschaften ausgestattet, die seine Ambitionen bezüglich der Umwelt, in die es dann hineingerät, festlegen. Müßte er sich gegen einen Pragmatismus vom Typ John Deweys abgrenzen (dem implizit eine gegen Gehlen gerichtete Anthropologie zugrundeliegt), würde er sagen: Die Welt geht nicht auf in den Erfahrungen, die das menschliche Leben in seinem Umgang mit ihr macht. Heideggers Vorbehalt gegen die Anthropologie ist leicht nachvollziehbar: Es geht ihm letztlich gar nicht um den Menschen – oder allenfalls nur insoweit, als dieser für das Sein aufgeschlossen ist. Dies bleibt freilich in Sein und Zeit deshalb undeutlich, weil die „Welt“, in die das Dasein entrückt ist, noch nicht die Eigenständigkeit hat, die ihr später im Windschatten der „Erde“ zugesprochen wird, wenn etwa der Mensch zum Mitspieler in einem „Geviert der Welt“ (Heidegger 1969, 45), einem „Welt-Spiel“ (Heidegger 1959a, 214) erklärt wird. Insofern hat Heideggers Kritik an der Anthropologisierung von Sein und Zeit etwas Irritierendes. Zwar wehrt er sich gegen eine Sonderbehandlung des Menschen, dies hindert ihn jedoch nicht daran, in dem Rahmen, den er einrichtet, Aussagen über den Menschen zu machen: über die Strukturen von dessen alltäglichem Leben, über die Verfassung von dessen In-der-Welt-sein etc. Man könnte sagen, daß die Kritik an der isolierten Behandlung menschlicher Eigenarten selbst eine anthropologische Aussage über die Weltlichkeit oder Kontextgebundenheit des menschlichen Lebens enthält. Diese Aussage nimmt Heidegger nun in einem zweiten Schritt gegen eine ethisierende Deutung in Schutz. Das entscheidende Stichwort in seinen Deutungen nach 1927 ist das von der „Neutralität“ der Analytik des
296
Dieter Thomä
Daseins (Heidegger 1967, 54, GA 26, 171 ff.; vgl. Greisch 1994, 499 ff.). Demnach sollen in ihr Prioritäten und Neigungen, wie sie mit den ethischen Fragen des Sollens oder Wollens verbunden sind, ebensowenig eine Rolle spielen wie „Prophetie und weltanschauliche Verkündigung“ (GA 26, 172; vgl. Heidegger 1967, 163; GA 66, 144 f.). Im Hintergrund dieser Abwehr von Moral und Ethik, die sich schon in Heideggers frühesten Texten findet, steht eine von Nietzsche inspirierte Kritik an lebensfernen „Werten“. Kein Einwand gegen Sein und Zeit hat es zu solcher Popularität gebracht wie derjenige, daß Heidegger hier eine Sonderwelt skizziert habe, die „nicht jedermanns Sache“ sei. Im Anschluß an diesen Einwand stellt sich die Frage, was denn dafür spreche, „so wie das Dasein“ zu leben, warum man denn „so“ leben solle oder wolle. Nichts hat umgekehrt Heideggers polemische Verve so angeregt wie jener Einwand von der Sonderwelt. Ermutigt wurde er zu dieser Polemik dadurch, daß die Bilder, die von seinen Idiosynkrasien gezeichnet wurden, so unterschiedlich waren, daß sie leicht als Zerrbilder zu brandmarken waren. So sah er sich etwa in der NSZeit dem Vorwurf ausgesetzt, in Sein und Zeit dem „Einfluß“ einer „‚großstädtische[n]‘ Auffassung“ des Lebens erlegen zu sein (GA 66, 327). Umgekehrt belustigte ihn der Vorwurf, für ihn bestehe „die Welt nur aus Kochtöpfen, Mistgabeln und Lampenschirmen“, er habe „zur ‚höheren Kultur‘ […] kein Verhältnis und zur ‚Natur‘ schon gar nicht“, denn all dies komme „ja in ‚Sein und Zeit‘ nicht vor“. Den „eigentliche[n] Grund“ für solche „Mißdeutung[en]“ sah Heidegger „darin, daß man als selbstverständlich dem Verfasser unterstellt, er wolle hier ein ‚System der Welt‘ aufstellen, während doch etwas ganz anderes gefragt ist“ (GA 49, 44). Sowenig er den Vorwurf gelten läßt, die von ihm beschriebene Welt sei einseitig, sowenig gibt es nach Heidegger dann auch eine Voreingenommenheit des Daseins bei seiner Art der Welterschließung. Er setzt sich gegen den Vorwurf des „Spießbürgers“ zur Wehr, „das menschliche Dasein dürfte nicht so trübsinnig ausschließlich als Sorge ausgegeben werden“ (zit. bei Farías 1991, 112), weil damit „Verdüsterung und Gram“ befördert würden (GA 69, 213; vgl. GA 69, 57 u. GA 3, 236). Zweierlei könnte Heidegger im Sinn haben, wenn er von der „Neutralität“ seiner Analytik des Daseins spricht. Auf der eine Seite könnte es ihm darum gehen, eine Verfassung des Daseins aufzuweisen, die all dessen Verhaltungen zugrundeliegt und derer man sich im Modus der Eigentlichkeit vergewissert. Insoweit wäre das, was man tut, nicht präjudiziert, sondern nur die Art modifiziert, wie man zu diesem Tun kommt und steht. Dieser Lesart zufolge favorisiert die
13 SEIN UND ZEIT im Rückblick
297
„eigentliche“ Existenz in Sein und Zeit ebensowenig eine partikulare Lebensart wie etwa das „Verfallen“ abschätzig gemeint ist (Heidegger 1967, 163). Besonders massiv tritt dieses Argument in dem Anspruch zutage, daß das Dasein trotz seiner gern geschmähten „Sächlichkeit“ erst „die innere Möglichkeit für die faktische Zerstreuung in die Leiblichkeit und damit in die Geschlechtlichkeit“ eröffne (GA 26, 173). Auf der anderen Seite könnte Heidegger mit seiner Analytik bei all ihrer „Neutralität“ durchaus einen verändernden Anspruch verbinden. „Neutral“ wäre sie dann nicht deshalb, weil sie diverse Extravaganzen zuließe, sondern weil die Begründung für das „eigentliche“ Dasein nicht tendenziös festgelegt oder positiv gesetzt ist. Demnach wird in Sein und Zeit sehr wohl eine bestimmte Lebensform herausgestellt, sie entspringt aber keinem ethischen, nicht-neutralen Tendenzbeschluß, sondern liegt diesseits des Sollens und Wollens. Sie erschließt sich in der Einsicht in die Verfassung des Daseins, der nur entsprochen wird. In seinen späteren Schriften folgt Heidegger der zweiten der hier genannten Varianten. Aufgrund der von ihm nun strikt gezogenen Unterscheidung zwischen Dasein und Mensch sieht er letzteren einer „Irre“ ausgesetzt, der erst im Zuge von dessen „Verwandlung“ ein Ende gesetzt werden kann (vgl. GA 65, 84 u. 230; Heidegger 1950, 53 f.). Im Jahr 1946 wiederholt er seine Kritik an der „Ethik“ als haltloser Konstruktion, er erklärt jedoch zugleich, eine „verbindliche Anweisung“, wie der Mensch „leben soll“ (Heidegger 1967, 183), sei in einer „ursprüngliche[n] Ethik“ zu suchen, die „den Aufenthalt des Menschen bedenkt“, wie er sich aus der „Zugehörigkeit zum Sein bestimmt“ (Heidegger 1967, 187 f.). Daraus sollen sich „Weisungen“, „Gesetz und Regel“ in einem neuen Sinn ergeben (Heidegger 1967, 191; vgl. Thomä 1994). Die Frage nach dem guten Leben ist hier ersetzt durch die Frage nach dem seinsgemäßen Leben – und dies ist ein Grundzug seines Denkens, der sich bei Heidegger in der Tat schon von den frühesten Texten an findet. Solche Beständigkeit will Heidegger bei seiner Auslegung von Sein und Zeit durchweg für sich beanspruchen. Bei der Durchsicht seiner „Selbstkritik“ hat sich jedoch gezeigt, daß der Versuch, Sein und Zeit als ersten, noch unsicheren Schritt auf einem dann weiter beschrittenen Weg darzustellen, Verzerrungen und Verwirrungen nach sich zieht. Erstaunlich ist dies freilich nicht; es ist bekannt, daß Autoren nicht dazu prädestiniert sind, die fähigsten Interpreten ihrer selbst zu sein. Heidegger hat gelegentlich gelitten an den Unzulänglichkeiten, die beim Anlegen seiner späten Maßstäbe an Sein und Zeit auftraten. Angesichts der Mißverständnisse, die er dadurch ausgelöst sah, gelangte er zu der Schluß-
298
Dieter Thomä
folgerung, es „wäre […] gut, man ließe endlich Sein und Zeit, das Buch und die Sache, für eine unbestimmbare Zukunft auf sich beruhen“ (GA 49, 34). Sofern darin die Empfehlung liegt, sich stattdessen nur noch an das weniger „mißverständliche“ späte Denken Heideggers zu halten, sollte man ihr nicht folgen.
Literatur Arendt, H. 1967: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München/Zürich Arendt, H. /M. Heidegger 1998: Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse (Hg. U. Ludz), Frankfurt a. M. Greisch, J. 1994: Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de ,Sein und Zeit‘, Paris Grondin, J. 1987: Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, Paris. Marten, R. 1991: Heidegger lesen, München Munier, R. 1983: „Todtnauberg 1949“, in: M. Haar (Hg.): Heidegger, Paris, 151–155 Neske, G. (Hg.) 1977: Erinnerung an Martin Heidegger, Pfullingen Sheehan, Th. 2001: „Kehre“ and „Ereignis“: A Prolegomenon to „Introduction to Metaphysics“, in: Richard Polt/Charles G. Fried (eds.): A Commentary to Heidegger’s „Introduction to Metaphysics“, New Haven/London Thomä, D. 1990: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers 1910–1976, Frankfurt a. M. Thomä, D. 1994: „Existenz“, in: Heiner Hastedt/Ekkehard Martens (Hg.): Ethik. Ein Grundkurs, Reinbek, 251–269
299
Auswahlbibliographie
erstellt von Christoph Henning
1. Texte von Heidegger 1.1 Sein und Zeit – Sein und Zeit, Tübingen 141977 mit den Randbemerkungen des Autors, seitdem weitere unveränderte Nachdrucke. – Erstausgabe im Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung Band VIII, Halle 1927. – Gesamtausgabe Band 2, hrsg. von F.-W. von Hermann, Frankfurt a. M. 1977.
1.2 Gesamtausgabe (GA) bei Klostermann, Frankfurt am Main – GA 1: Frühe Schriften (1912–1916), 1978 – GA 60: Phänomenologie des religiösen Lebens (Freiburger Vorlesung 1918/19, 1920/21, 1921), 1995 – GA 56/57: Zur Bestimmung der Philosophie (Freiburger Vorlesung 1919),1987, 21999 – GA 61: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung (Freiburger Vorlesung Wintersemester 1921/22), 1985 – GA 63: Ontologie, Hermeneutik der Faktizität (Marburger Vorlesung 1923), 1988,21995 – GA 17: Einführung in die phänomenologische Forschung (Marburger Vorlesung Wintersemester 1923/24), 1994 – bislang unveröffentlicht GA 64: Der Begriff der Zeit (1924) – GA 19: Platon: Sophistes (Marburger Vorlesung Wintersemester 1924/25), 1992 – GA 20: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Marburger Vorlesung Sommersemester 1925), 1979, 21988 – GA 21: Logik. Die Frage nach der Wahrheit (Marburger Vorlesung Wintersemester 1925/ 26), 1976, 21995 – GA 22: Grundbegriffe der antiken Philosophie (Marburger Vorlesung Sommersemester 1926), 1993 – GA 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie (Marburger Vorlesung Sommersemester 1927), 1975, 21989, 31997 – GA 25: Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft (Marburger Vorlesung Wintersemester 1927/28), 1977, 31995 – GA 26: Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz (Marburger Vorlesung Sommersemester 1928), 1978, 21990 – GA 27: Einleitung in die Philosophie (Freiburger Vorlesung Wintersemester 1928/29), 1996 – GA 28: Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart (Marburger Vorlesung Sommersemester 1929), 1997
300
Auswahlbibliographie
– GA 3: Kant und das Problem der Metaphysik (1929), 1991 – GA 29/30: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Freiburger Vorlesung Wintersemester 1929/30), 1983, 21992 – GA 31: Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie (Freiburger Vorlesung Sommersemester 1930), 1982, 21994 – GA 33: Aristoteles, Metaphysik Q1–3. Wesen und Wirklichkeit der Kraft (Freiburger Vorlesung Sommersemester 1931), 1981, 21990 – GA 38: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache (Sommersemester 1934), 1998 – GA 39: Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“ (Wintersemester 1934/35), 1980 – GA 65: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis, 1936–1938), 1989, 21994 – GA 66, Besinnung (1938/39), 1997 – GA 69: Die Geschichte des Seyns (1938–1940), 1998 – GA 49: Die Metaphysik des deutschen Idealismus (Freiburger Vorlesungen 1941), 1991 – GA 77: Feldweg-Gespräche (1944/45), 1995 – GA 9: Wegmarken (1919–1961), 1976, 21996
1.3 Texte Heideggers außerhalb der Gesamtausgabe – 1927: Brief an Edmund Husserl vom 22. 10. 1927, in Husserl, E.: Phänomenologische Psychologie (Husserliana Band IX), Den Haag 1962, 600–602 – 1929: Vom Wesen des Grundes, Frankfurt a. M. 1973 – 1947: Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den Humanismus, Bern – 1950: Holzwege, Frankfurt a. M. (auch als GA 5) – 1953: Einführung in die Metaphysik, Tübingen (auch als GA 40) – 1954: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 61990 (auch als GA 7) – 1957: Identität und Differenz, Pfullingen – 1959a : Unterwegs zur Sprache, Pfullingen – 1959b: Gelassenheit, Pfullingen – 1961: Nietzsche, 2 Bände, Pfullingen (auch als GA 6.1/6.2) – 1962: Die Technik und die Kehre, Pfullingen – 1963: Vorwort, in: Richardson, W. J.: Heidegger: Through Phenomenology to Thought, Den Haag 1963 – 1967: Wegmarken, Frankfurt a. M. (auch als GA 9) – 1969, 21976: Zur Sache des Denkens, Tübingen (auch als GA 14) – 1970: Brief an Jan Aller im November 1970, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 18 (1973) – 1971: Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit, Tübingen: Niemeyer – 1973: Kant und das Problem der Metaphysik (1929), Studienausgabe (auch als GA 3) – 1983: Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat 1933/34, Frankfurt a. M. – 1989a: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation), in: Dilthey-Jahrbuch (6), 237–238 – 1989b: Der Begriff der Zeit (1924), Tübingen – 1991: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Unbenutzte Vorarbeiten zur Vorlesung vom Sommersemester 1929/30), in: Heideggerstudien (7), 5–12
Auswahlbibliographie
301
– 1998: Aufzeichnungen zur Temporalität (aus den Jahren 1925–1927), in: Heideggerstudien (14),11–23 Heidegger, M./Arendt, H. 1998: Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse, hrsg. v. U. Ludz, Frankfurt a. M. Heidegger, M./Blochmann, E. 1989: Briefwechsel 1918–1969, Marbach am Neckar Heidegger, M./Jaspers, K. 1990: Briefwechsel, hrsg. von W. Biemel/H. Saner, FrankfurtMünchen-Zürich
2. Hilfsmittel 2.1 Indices Bast, R. A./Delfosse, H. P.: Handbuch zum Textstudium von Martin Heideggers Sein und Zeit, Band 1: Stellenindizes, Philologisch- kritischer Apparat, Stuttgart-Bad Cannstadt 1979 Feick, H.: Index zu Heideggers Sein und Zeit, Tübingen 41991 Petkovsek, R.: Heidegger Index (1919–1927), Ljubljana 1998 Schöffer, E.: Die Sprache Heideggers, Pfullingen 1962
2.2 Kommentare Courtine, J.-F. (Hg.): Heidegger 1919–1929: De l’herméneutique de la facticité à la métaphysique du ,Dasein‘, Paris 1996 Dreyfus, H. L.: Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division 1, Cambridge/Massachusetts 1991 Gelven, M.: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, New York 1970, revised Edition: Dekalb 21989 Greisch, J.: Ontologie et temporalité. Esquisse d’ une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994 Griffiths, D. B.: The Keywords of Martin Heidegger. A philosophical-lexical Analysis of Sein und Zeit, Lewiston, N. Y. 2006 Herrmann, F.-W. von: Subjekt und Dasein. Interpretationen zu Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1974, 21985 Herrmann, F.-W. von: Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Eine Erläuterung von Sein und Zeit, Band 1: Einleitung: Die Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein, Frankfurt a. M. 1987 Kaelin, E. F.: Heidegger’s Being and Time. A Reading for Readers, Florida 1988 Kockelmans, J. J. (Hg.): A Companion to Martin Heidegger’s Being and Time, Washington 1986 Kockelmans, J. J.: Heidegger’s Being and Time. The Analysis of Dasein as Fundamental Ontology, Washington 1989 Luckner, A.: Martin Heidegger: Sein und Zeit. Ein einführender Kommentar, Paderborn 22001 (utb 1975) Mulhall, St.: Heidegger and Being and Time, Routledge Philosophy Guidebook, London 1996 Prauss, G.: Erkennen und Handeln in Heideggers Sein und Zeit, Freiburg/München 1977, 21996
302
Auswahlbibliographie
Taminiaux, J.: Lectures de l’ontologie fondamentale. Essais sur Heidegger, Grenoble 1989, englisch: Heidegger and the Project of Fundamental Ontology, Albany 1992
2.3 Bibliographien Gabel, G. U.: Heidegger. Ein internationales Verzeichnis der Hochschulschriften 1930 –1990, Hamburg 1993 Lübbe, H.: Bibliographie der Heidegger-Literatur, 1917–1955, Meisenheim 1957 Nordquist, J. (Hg.): Martin Heidegger: A Bibliography, Santa Cruz 1990 Saß, H.-M.: Heidegger-Bibliographie, Meisenheim 1968 Saß, H.-M.: Materialien zur Heidegger-Bibliographie 1917–1972, Meisenheim 1975 Saß, H.-M.: Martin Heidegger: Bibliography and Glossary, Bowling Green 1982 Schneeberger, G.: Ergänzungen zu einer Heidegger-Bibliographie, Bern (gedrucktes Manuskript) 1960 Sheehan, Th. (Hg.): Martin Heidegger: The Man and the Thinker, Chicago 1981 (enthält Bibliographie) Universitätsbibliothek Freiburg: umfassender Onlinekatalog der Bücher und Aufsätze von 1929–2000
3. Sekundärliteratur 3.1 Allgemeine Literatur zu Heidegger und zu Sein und Zeit Beaufret, J.: Dialogue avec Heidegger I–III, Paris 1973-1974, dt.: Wege zu Heidegger, Frankfurt a. M. 1976 Biemel, W.: Martin Heidegger in Selbstzeugnissen und Briefdokumenten, Reinbek 1973 Buren, J. van: The young Heidegger. Rumor of the hidden King, Bloomington 1994 Brandner, R.: Heidegger: Sein und Wissen. Eine Einführung in sein Denken, Wien 1993 Brandom, R.: Heideggers Categories in „Sein und Zeit“, in ders., Tales of the Mighty Dead. Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality, Cambridge, Mass. 2002, 298–323 Brandom, R.: Dasein, the Being that Thematizes, in: ders., Tales of the Mighty Dead. Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality, Cambridge, Mass. 2002, 324–347 Cardorff, M.: Martin Heidegger, Frankfurt a. M./New York 1991 Cometti, J. P./Janicaud, D. (Hg.): Être et Temps de Martin Heidegger. Questions de méthode et voices de recherche, Marseille 1989 Dreyfus, H. L./Hall, H. (Hg.): Heidegger: A Critical Reader, Oxford 1992 Elliston, F. (Hg.): Heidegger’s Existential Analytic, Den Haag/Paris/New York 1978 Figal, G.: Martin Heidegger zur Einführung, Hamburg 1992, 42003 Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.): Martin Heidegger: Innen- und Außenansichten, Frankfurt a. M. 1989 Franzen, W.: Von der Existentialontologie zur Seinsgeschichte. Eine Untersuchung über die Entwicklung der Philosophie Martin Heideggers, Meisenheim 1975 Franzen, W.: Martin Heidegger, Stuttgart 1976
Auswahlbibliographie
303
Frings, M. S. (Hg.): Heidegger and the Quest for Truth, Chicago 1968 Gethmann, C. F.: Dasein: Erkennen und Handeln. Heidegger im phänomenologischen Kontext, Berlin/New York 1993 Guignon, Ch. (Hg.): The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge 1993 Gudopp, W.-D.: Der junge Heidegger. Realität und Wahrheit in der Vorgeschichte von Sein und Zeit, Berlin 1983, zugleich Frankfurt a. M. (Marxistische Blätter) 1983 Guzzoni, U. (Hg.): Nachdenken über Heidegger, Hildesheim 1980 Han, B.-C.: Martin Heidegger. Eine Einführung, München 1999 Happel, M. (Hg.): Heidegger – neu gelesen, Würzburg 1997 Heidegger-Studien: seit 1985 in Berlin erscheinendes Periodikum, bringt u. a. Aufsätze zur Edition Herrmann, F.-W.: Heideggers ‚Grundprobleme der Phänomenologie‘. Zur zweiten Hälfte von Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1991 Inwood, M. J.: Heidegger, Freiburg i. Br. 2001 Jaspers K.: Martin Heidegger/Karl Jaspers – Briefwechsel, München 1990 Kisiel, Th.: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley 21995 Kempf, H.-D.: Martin Heideggers Sorge: warum hat der Denker den 2. Teil von Sein und Zeit nicht geschrieben? Bonn und Brüssel 1979 Macann, Ch. (Hg.): Martin Heidegger – Critical Assessments, 4 Volumes, London 1994 Macann, Ch. (Hg.): Critical Heidegger, London 1996 MacDonald, P. J. T.: Daseinsanalytik und Grundfrage: zur Einheit und Ganzheit von Heideggers Sein und Zeit, Würzburg 1997 Martin Heidegger. Fragen an sein Werk, Ein Symposium, Stuttgart 1977 Mehta, J. L.: The philosophy of Martin Heidegger, New York 1971 Murray, M. (Hg.): Heidegger and Modern Philosophy, New Haven/London 1978 Ott, H.: Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt a. M. und New York 1988 Pöggeler, O.: Der Denkweg Martin Heideggers (1963), Pfullingen 21983 Pöggeler, O. (Hg.): Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werkes, Köln/Berlin 1969, ergänzte Auflage: Weinheim 31994 Pöggeler, O./Papenfuss, D.: Die philosophische Aktualität Martin Heideggers, 3 Bände, Frankfurt a. M. 1990 f. Richardson, W. J.: Heidegger: Through Phenomenology to Thought, Den Haag 1963 Rentsch, Th.: Martin Heidegger – Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung, München 1989 Safranski, G.: Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München 1994 und Frankfurt a. M. 1997 Sallis, J. (Hg.): Heidegger and the Path of Thinking, Pittsburgh 1970 Schmitt, R.: Martin Heidegger on Being Human. An Introduction to Sein und Zeit, New York 1969 Sheehan, T. (Hg.): Heidegger. The Man und the Thinker, Chicago 1981 Steiner, H.: Martin Heidegger, Harmondsworth/New York 31980, dt. München/Wien 1989 Thomä, D.: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers 1910–1976, Frankfurt a. M. 1990 Thomä, D. (Hg.): Heidegger-Handbuch, Stuttgart/Weimar 2003 Vetter, H. (Hg.): Siebzig Jahre Sein und Zeit: Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997, Frankfurt a. M. 1999 Volkmann-Schluck, K.-H./Heimbüchel, B. (Hg.): Die Philosophie Martin Heideggers: eine Einführung in sein Denken, Würzburg 1996 Volpi, F. (et al.): Heidegger et l’ idee de la phenomenologie, Dordrecht 1988
304
Auswahlbibliographie
Volpi, F.: Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnia, Nichilismo, Rom 1997
3.2 Rezensionen und Reaktionen der Zeitgenossen auf Sein und Zeit Balthasar, H. U. von: Heideggers Philosophie vom Standpunkt des Katholizismus, in: Stimmen der Zeit 82 (1940), 1–8 Beck, M.: Referat und Kritik von Martin Heidegger: Sein und Zeit, in: Philosophische Hefte 1. 1 (1928), 5–44 Buber, M.: Die Verwirklichung des Menschen. Zur Anthropologie Martin Heideggers, in: Philosophia 1, Belgrad 1938, 289–308 Bultmann, R.: Artikel „Martin Heidegger“, im Lexikon: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 21928, Band II, Spalte 1687 f. Carnap, R.: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, Erkenntnis 2 (1931), 219–241 Hofmann, P.: Metaphysik oder verstehende Sinn-Wissenschaft? Gedanken zur Neubegründung der Philosophie im Hinblick auf Heideggers Sein und Zeit, Kant-Studien Ergänzungsheft 64, Berlin 1929; Vaduz/Liechtenstein 21978 Husserl, E.: Randbemerkungen zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das Problem der Metaphysik, in: Husserl Studies 11 (1994), hrsg. von R. Breeur, 3–63 Gadamer, H.-G.: Philosophische Lehrjahre. Eine Rückschau, Frankfurt a. M. 1977 Kraft, J.: Von Husserl zu Heidegger. Zur Kritik der phänomenologischen Philosophie, Leipzig 1932, Hamburg 21977 Krüger, G.: Sein und Zeit. Zu Martin Heideggers gleichnamigem Buch, in: Theologische Blätter 8 (1929), Sp. 57–64 Jaspers, K.: Notizen zu Martin Heidegger, hrsg. von Hans Saner, München/Zürich 1987 Lehmann, G.: Die Ontologie der Gegenwart in ihren Grundgestalten, Halle 1933 Lévinas, E.: M. Heidegger et l’ontologie, in: Revue philosophique de la France et de l’Estranger 57 (1932), 395–431 Lukács, G.: Zerstörung der Vernunft, Berlin 1954 Marcuse, H.: Beiträge zu einer Phänomenologie des historischen Materialismus, in: Philosophische Hefte 1 (1928), 45–68, jetzt in: Schriften, Band 1, Frankfurt a. M. 21981 Misch, G.: Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Diltheyschen Richtung mit Heidegger und Husserl, Bonn 1930, Darmstadt 31967 Ryle, G.: Rezension von Sein und Zeit, in: Mind 38 (1929), 355–370, Murray 21978 (vgl. 3.1). Scheler, M.: Das emotionale Realitätsproblem, Aus kleineren Manuskripten zu Sein und Zeit und Rand- und Textbemerkungen in Sein und Zeit, in: Gesammelte Werke 9: Späte Schriften, hrsg. von M. S. Frings, Bern/München 1976, 254–340
3.3 Zeitlichkeit/Geschichtlichkeit Barash, A.: Heidegger und der Historismus: Sinn der Geschichte und der Geschichtlichkeit des Sinns, Würzburg 1999 Blattner, W. D: Heideggers Temporal Idealism, Cambridge 1999 Bleyendaal, H. L. K.: Heidegger en Lévinas over de tijd, Amsterdam 1984
Auswahlbibliographie
305
Blust, F. K.: Selbstheit und Zeitlichkeit. Heideggers neuer Denkansatz zur Seinsbestimmung des Ich, Würzburg 1987 Brandner; R.: Heideggers Begriff der Geschichte und das neuzeitliche Geschichtsdenken, Wien 1989 Dastur, F.: Heidegger et la question du temps, Paris 1990 Heinz, M.: Zeitlichkeit und Temporalität: Die Konstitution der Existenz und die Grundlegung einer temporalen Ontologie im Frühwerk Martin Heideggers, Würzburg/Amsterdam 1982 Iber, Ch.: Sein und Zeit oder Zeitlichkeit und Dasein: Probleme von Heideggers Zeitphilosophie, in: ders./R. Pocai (Hg.): Selbstbesinnung der philosophischen Moderne: Beiträge zur kritischen Hermeneutik ihrer Grundbegriffe, Cuxhaven/Dartford 1998, 119–143 Fleischer, M.: Die Zeitanalysen in Heideggers Sein und Zeit. Aporien, Probleme und ein Ausblick, Würzburg 1991 Fynsk, Ch.: Heidegger: Thought and Historicity, Ithaca 1986 Oberthür, J.: Seinsentzug und Zeiterfahrung. Die Bedeutung der Zeit für die Entzugskonzeption in Heideggers Denken, Würzburg 2002 Orth, E.-W. (Hg.): Zeit und Zeitlichkeit bei Husserl und Heidegger, Freiburg/München 1983 Sherover, Ch. M.: Heidegger, Kant & Time, Bloomington/London 1971
3.4 Sprache/Hermeneutik Anz, W.: Die Stellung der Sprache bei Heidegger, in: H.-G. Gadamer (Hg.): Das Problem der Sprache, München 1977, 469–481 Apel, K.-O.: Transformation der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt a. M. 1973 Chibueze Uzondu, C.: Die Fundierung des Erkennens im Verstehen in Heideggers Sein und Zeit und danach, Frankfurt a. M. 2006 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, jetzt als Gesammelte Werke Band 1, Tübingen 1999 Gethmann, C. F.: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers, Bonn 1974 Grondin, J.: Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik, Darmstadt 2001 Herrmann, F.-W. von: Hermeneutik und Reflexion. Der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl, Frankfurt a. M. 2000 Kockelmans, J. J. (Hg.): On Heidegger and Language, Evanston 1972 Kogge, W.: Verstehen und Fremdheit in der philosophischen Hermeneutik. Heidegger und Gadamer, Hildesheim 2001 Kusch, M.: Language as calculus vs. language as universal medium. A study in Husserl, Heidegger and Gadamer, Dordrecht 1989 Lafont, C.: Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers, Frankfurt a. M. 1994 Lohmann, J.: Martin Heideggers ‚Ontologische Differenz‘ und die Sprache, Lexis 1 (1948), 49–106 Pöggeler, O.: Heidegger und die hermeneutische Philosophie, Freiburg/München 1983 Stassen, M.: Heideggers Philosophie der Sprache in Sein und Zeit und ihre philosophischtheologischen Wurzeln, Bonn 1973 Tugendhat, E.: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin 1970
306
Auswahlbibliographie
Wilson, Th. J.: Sein als Text. Vom Textmodell als Martin Heideggers Denkmodell: eine funktionalistische Interpretation, Freiburg/München 1981
3.5 Metaphysik und Theologie Bucher, A. J.: Martin Heidegger. Metaphysikkritik als Begriffsproblematik, Bonn 1972. Bonsor, J. A.: Rahner, Heidegger, and Truth, Lanham 1987 Caputo, J. D.: The Mystical Element in Heidegger’s Thought, Athens 1978 Graeser, A.: Philosophie in Sein und Zeit: kritische Erwägungen zu Heidegger, Sankt Augustin 1994 Greenier, D. L.: Being, Meaning and Time in Heidegger’s Being and Time, London 1997 Gethmann-Siefert, A.: Das Verhältnis von Philosophie und Theologie im Denken Martin Heideggers, Freiburg/München 1974 Großmann, A.: Zwischen Phänomenologie und Theologie: Heideggers ‚Marburger Religionsgespräch‘ mit Rudolf Bultmann, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 95 (1998), 37– 62 Haeffner, G.: Heideggers Begriff der Metaphysik, München (Pullacher philosophische Forschungen) 1974 Helting, H.: Heidegger und Meister Eckehart. Vorbereitende Überlegungen zu ihrem Gottesdenken, Berlin 1997 Jaeger, A.: Gott. Nochmals Martin Heidegger, Tübingen 1978 Jaeger, P.: Heideggers Ansatz zur Verwindung der Metaphysik in der Epoche von Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1976 Malisardi, F.: Carattere intenzionale e statuto della „Seinsfrage“. Martin Heidegger, dai „Prolegomena“ a „Sein und Zeit“, Rom 2007 Maquirre, J.: An Existentialist Theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann, New York 1955 Marx, W.: Heidegger und die Tradition. Eine problemgeschichtliche Einführung in die Grundbestimmungen des Seins, Stuttgart 1961 Murnsky, M.: Heideggers Aneignung der Kantischen Grundlegung der Metaphysik im Zusammenhang mit der Konzeption von Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 2002 Ott, H./Penzo, G. (Hg.): Heidegger e la teologia: Atti del convegno tenuto a Trento l’8–9 febbraio 1990, Religione e cultura 7, Brescia 1995 Thomas, E.: Der Weltbegriff in Heideggers Sein und Zeit. Kritik der „existenzialen“ Weltbestimmung, Frankfurt a. M. 2005 Trawny, P.: Martin Heideggers Phänomenologie der Welt, Freiburg 1997 Thurnher, R.: Wandlungen der Seinsfrage: Zur Krisis im Denken Heideggers nach Sein und Zeit, Tübingen 1997 Wetz, F. J.: Das nackte Daß. Zur Frage der Faktizität, 1990
3.6 Ethik Brandner, R.: Warum Heidegger keine Ethik geschrieben hat, Wien 1992 Figal, G.: Martin Heidegger - Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt a. M. 1988 Gethmann-Siefert, A./Pöggeler, O. (Hg.): Heidegger und die praktische Philosophie, Frankfurt a. M. 1988
Auswahlbibliographie
307
Gould, C. C.: Authenticity and being-with others: a critique of Heidegger’s Sein und Zeit, New Haven 1972 Grondin, J.: Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt 1994 Hodge, J.: Heidegger and Ethics, London 1995 Kente, M. G.: Conditions of Freedom and Authenticity. Phenomenological and Existential Studies, Würzburg 1996 Kreiml, J.: Zwei Auffassungen des Ethischen bei Heidegger: ein Vergleich von Sein und Zeit mit dem ‚Brief über den Humanismus‘, Regensburg 1987 Lettow, S.: Die Macht der Sorge. Die philosophische Artikulation von Geschlechterverhältnissen in Heideggers „Sein und Zeit“, Tübingen 2001 Schmidt, M.: Ekstatische Transzendenz: Ludwig Biswangers Phänomenologie der Liebe und die Aufdeckung der sozialontologischen Defizite in Heideggers „Sein und Zeit“, Epistemata: Reihe Philosophie, Würzburg 2005 Schürmann, R.: Le Principe d’Anarchie. Heidegger et la Question de l’Agir, Paris 1982, auch als: Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy, translated by Ch.-M. Glos, Bloomington 1987 Scott, Ch. E.: The question of ethics: Nietzsche, Foucault, Heidegger, Bloomington 1991 Vogel, L.: The fragile ‘We’. Ethical implications of Heidegger’s Being and Time, Illinois 1994 Zimmerman, M.: The Eclipse of the Self. The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity, Athens/London 1981
3.7 Politik Adorno, Th. W.: Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideologie (1964), Frankfurt a. M. 61971, jetzt in: Gesammelte Schriften 6, hg. von R. Tiedemann, Frankfurt a. M. 41990 Altwegg, J. (Hg.): Die Heidegger Kontroverse, Frankfurt a. M. 1988 Blitz, M.: Heidegger’s Being and Time and the Possibility of Political Philosophy, Ithaca 1981 Bourdieu, P.: Die politische Ontologie Martin Heideggers, Frankfurt a. M. 1976, 21985 Carrillo Canán, A.: Heideggers Sein und Zeit oder die ontologische Fundierung des politischen Partikularismus, Berlin 1994 Ebeling, H.: Martin Heidegger: Philosophie und Ideologie, Reinbek 1991 Farías, V.: Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1989 Gebert, S.: Negative Politik. Zur Grundlegung der politischen Philosophie aus der Daseinsanalytik und ihrer Bewährung in den politischen Schriften Heideggers von 1933/34, Berlin 1992 Kemper, P. (Hg.): Martin Heidegger – Faszination und Erschrecken. Die politische Dimension einer Philosophie, Frankfurt a. M. 1990 Köchler, H.: Politik und Theologie bei Heidegger. Politischer Aktionismus und theologische Mystik nach Sein und Zeit, Innsbruck 1991 Kockelmans, J. J.: Heidegger and Science, Washington 1985 Krockow, Ch. Graf von: Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Stuttgart 1958, Frankfurt a. M. 21990 Leaman, G.: Heidegger im Kontext. Gesamtüberblick zum NS-Engagement der Universitätsphilosophen, Hamburg (Argument Sonderband) 1993 Losurdo, D.: Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland. Heidegger und die ‚Kriegsideologie‘, Stuttgart/Weimar 1995 Löwith, K.: Heidegger – Denker in dürftiger Zeit (1953), Sämtliche Schriften 8, Stuttgart 1984
308
Auswahlbibliographie
Löwith, K.: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 (1940), Stuttgart 1986 Marten, R.: Heidegger lesen, München 1991 Martin, B. (Hg.): Martin Heidegger und das ‚Dritte Reich‘, Darmstadt 1989 Rockmore, Th./Margolis, J. (Hg.): The Heidegger Case: Philosophy and Politics, Philadelphia 1992 Schwan, A.: Politische Philosophie im Denken Martin Heideggers (1965), Opladen 21989 Schneeberger, G.: Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken, Bern 1962 Sluga, H. D.: Heidegger’s Crisis. Philosophy and Politics in Nazi Germany, Cambridge 1993 Wolin, R.: The Politics of Being. The political Thought of Martin Heidegger, New York 1990, dt.: Seinspolitik. Das politische Denken Martin Heideggers, Wien 1991 Wolin, R. (Hg.): The Heidegger Controversy: A Critical Reader, New York 1991 Young, J.: Heidegger, Philosophy, Nazism, Cambridge 1997
3.8 Heidegger und Sein und Zeit im weiteren Kontext der Philosophie Alexos, K.: Einführung in ein künftiges Denken. Über Marx und Heidegger, Tübingen 1966 Apel, K.-O.: Sinnkonstitution und Geltungsrechtfertigung: Heidegger und das Problem der Transzendentalphilosophie, in ders.: Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, Frankfurt a. M. 1998, 459–503 Apel, K.-O.: Wittgenstein und Heidegger: Kritische Wiederholung und Ergänzung eines Vergleichs, a. a. O., 505–569 Bast, R. A.: Der Wissenschaftsbegriff Martin Heideggers im Zusammenhang seiner Philosophie, Stuttgart/Bad Canstatt 1986 Caputo, J. D.: Heidegger and Aquinas. An essay on overcoming metaphysics, New York 1982 Cobben, P.: Das endliche Selbst: Identität (und Differenz) zwischen Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘ und Heideggers Sein und Zeit, Würzburg 1999 Dallmayr, F. R.: Heidegger and Marxism, in: Praxis International 7 (Oktober 1987), 207–224 Denker, A./Figal, G./Volpi, F./Zaborowski, H. (Hg.) 2007: Heidegger und Aristoteles, Freiburg/München Descombes, V.: Das Selbe und das Andere. Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich 1933–1978, Frankfurt a. M 1981 Dittus, S.: Heidegger und das Paradox des Subjekts, Würzburg 2001 Dreyfus, H. L.: Being and power: Heidegger and Foucault, in: International journal of philosophical studies 4 (1996), 1–16 Due, M.: Ontologie und Psychoanalyse. Metapsychologische Untersuchung über den Begriff der Angst in den Schriften Sigmund Freuds und Martin Heideggers, Frankfurt a. M. 1986 Düttmann, A. G.: Das Gedächtnis des Denkens. Versuch über Heidegger und Adorno, Frankfurt a. M. 1991 Fell, Joseph P.: Heidegger and Sartre: An Essay on Being and Place, New York 1979 Gander, H.-H. (Hg.): Von Heidegger her: Wirkungen in Philosophie – Kunst – Medizin. Meßkircher Vorträge, Frankfurt a. M. 1991 Goldmann, L.: Lukacs et Heidegger, Paris (Denoel/Gonthier) 1973, dt. Lukács und Heidegger. Nachgelassene Fragmente. Texteinrichtung und Einleitung von Youssef Ishagpour, Darmstadt 1975 Großheim, M.: Von Georg Simmel zu Martin Heidegger. Philosophie zwischen Leben und Existenz, Bonn 1991
Auswahlbibliographie
309
Hackenesch, Chr.: Selbst und Welt. Zur Metaphysik des Selbst bei Heidegger und Cassirer, Hamburg 2001 Hrachovec, H.: Vorbei. Heidegger, Frege, Wittgenstein, Basel/Frankfurt a. M. 1981 Huizing, K.: Das Sein und der Andere. Lévinas’ Auseinandersetzung mit Heidegger, Frankfurt a. M. 1988 Jacob, E.: Martin Heidegger und Hans Jonas. Die Metaphysik der Subjektivität und die Krise der technologischen Zivilisation, Basel 1996 Krell, D. F.: Heidegger and Life-Philosophy, Bloomington 1992 Kunz, H.: Martin Heidegger und Ludwig Klages. Daseinsanalytik und Metaphysik, München 1976 Lembeck, K.-H.: Platon in Marburg. Platonrezeption und Philosophiegeschichtsphilosophie bei Cohen und Natorp, Würzburg 1994 Lotz, J. B.: Martin Heidegger und Thomas von Aquin. Mensch – Zeit – Sein, Pfullingen 1975 Merker, B.: Selbsttäuschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phänomenologie Husserls, Frankfurt a. M. 1988 Michel, A.: Die französische Heidegger-Rezeption und ihre sprachlichen Konsequenzen, Heidelberg 2000 Mörchen, H.: Adorno und Heidegger. Untersuchung einer philosophischen Kommmunikationsverweigerung, Stuttgart 1981 Mulhall, S.: On Being in the World: Heidegger and Wittgenstein on seeing Aspects, London 1990 Pocai, R.: Heideggers Theorie der Befindlichkeit. Sein Denken zwischen 1927 und 1933, Freiburg/München 1996 Rapaport, H.: Heidegger and Derrida: Reflections on Time and Language, Lincoln 1989 Rentsch, Th.: Heidegger und Wittgenstein. Existential- und Sprachanalysen zu den Grundlagen philosophischer Anthropologie, Stuttgart 1985, Neuauflage mit neuem Vorwort 2003 Rockmore, T.: Heidegger and French Philosophy: Humanism, Antihumanism, and Being, London 1995, dt. Heidegger und die französische Philosophie, Lüneburg 2000 Rosen, S.: The Question of Being. A reversal of Heidegger, New Haven/London 2001 Schalow, F.: The Renewal of the Heidegger-Kant Dialogue – Action, Thought, and Responsibility, New York 1992 Schmidt, D. J.: The Ubiquity of the finite: Hegel, Heidegger and the Entitlements of Philosophy, Cambridge, Mass. 1988 Sefler, G.: Language and World. A methodological-structural Synthesis within the Writings of Martin Heidegger and Ludwig Wittgenstein, Atlantic Highlands 1974 Standish, P.: Beyond the Self. Wittgenstein, Heidegger and the Limits of Language, Aldershot 1992 Vattimo, G.: Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger el’ ermeneutica, Milano 1981, dt.: Jenseits vom Subjekt. Nietzsche, Heidegger und die Hermeneutik, übers. von Sonja P. Riekmann, Graz 1986 Volpi, F.: Heidegger e Aristotele, Padua 1984 Wachterhauser, B. R.: Beyond being: Gadamer and Heidegger, in: ders.: Beyond being: Gadamer’s post-platonic hermeneutical ontology, Evanston 1999, 166–199 Waldenfels, B.: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt a. M. 1983 Weiß, J. (Hg.): Die Jemeinigkeit des Daseins. Die Daseinsanalytik Martin Heideggers und die Kritik der soziologischen Vernunft, Konstanz 2001 Wolf, H. G.: Plato and Heidegger. In search of Selfhood, Lewisburg 1981 Wyschogrod, M.: Kierkegaard and Heidegger. The Ontology of Existence (1954), New York 1969
311
Personenverzeichnis
Kursiv gesetzte Zeichen verweisen auf Fußnoten. Adorno, Th. W. 151, 155 Angehrn, E. IX Apel, K.-O. VIII, 106, 108 Arendt, H. VII, 215, 245, 281, 286, 293 Aristoteles IX, 1, 2 ff., 8, 13 f., 17, 19, 31 ff., 108, 162, 167 f., 204 f., 247, 263, 271 Augustinus 25, 31, 43, 108, 207, 249 Becker, O. IX, 215, 253 Bergson, H. 266 Binswanger, L. VIII Blattner, W. D. 192, 193, 222 Blochmann, E. 276 Blumenberg, H. 124, 207, 208 Blust, F.-K. 179, 232 Bobrow, D. G. 81 Bollnow, O. F. 101 Boss, M. VIII Brandner, R. 151, 233, 235, 238 Brandom, R. 55, 125 Brentano, F. 32 f., 101 Bultmann, R. VII, 276 Buren, J. van 184 Calvin, J. 139 Camus, A. 155 Dahlstrom, D. O. 193 Dallmayr, F. R. 242 Davidson, D. 112 Demmerling, C. 111 Derrida, J. VIII f., 244, 247 Descartes, R. 1, 21, 69 f., 77 ff., 82 ff., 89, 91 ff., 102, 127, 209, 219, 222, 226, 292 Dewey, J. 295 Dilthey, W. 20, 30, 90 f., 102, 127, 139, 230 f., 241, 244 Dreyfus, H. 72, 80, 83, 93, 96, 105 Dreyfus, S. 83 Epikur 134 Esposito, R. 243
Farías, V. 296 Fichte, J. G. 13, 222 Figal, G. 152, 153 f., 178, 234 f., 239, 249 Fink, E. 96, 135 Fischer, J. A. 139 Fleischer, M. 192 f., 222, 224 Flores, T. 82 Foucault, M. VIII, 95, 286 Franck, D. 217, 223 ff. Franzen, W. 178 Freud, S. 202 Gadamer, H.-G. VII, 19, 20, 46, 94, 96, 100, 167, 241 Gander, H.-H. 230, 243 Gehlen, A. 295 Gethmann, C. F. 55, 91, 103, 184, 218, 236 Goldmann, L. 92 Graeser, A. 106 Greisch, J. 206, 208, 296 Grondin, J. 19, 24 f., 96, 178, 284, 293 Habermas, J. VIII Han, B.-C. 136, 142, 144, 146 f. Haugeland, J. 69 Hegel, G. W. F. VIII, 4, 14, 136, 145, 164, 231, 246 f. Heinz, M. 189, 232 Herrmann, F.-W. von 1, 13 f., 18 f., 23 f., 153, 154, 170, 191, 234, 247 f. Hügli, A. 139 Husserl, E. 8, 14, 22 f., 29, 33 f., 36 f., 40, 51, 69, 77, 78, 80, 91, 100, 103, 120, 122, 131, 154, 174, 180, 184 f., 205, 209, 215, 218 f., 253, 268 Hyginus 118, 123 Jaspers, K. 9, 12, 30, 134, 155, 234, 244, 254 f., 277, 295 Jonas, H. VII, 210 f., 215 Kamlah, W. IX Kant, I. IX, 1, 13, 18, 21, 46, 48, 103, 120, 184 f., 188, 202, 205 f., 209, 214, 218 ff., 264, 283, 287, 292
312
Personenverzeichnis
Kierkegaard, S. VII, 63, 134, 139, 144, 159, 202, 239 Kisiel, T. 19, 105 f., 170, 184, 224, 253, 256 f., 282 Köhler, D. 188, 221, 278 Krockow, Ch. Graf v. 178 Krüger, G. 215 Lacan, J. VIII Lafont, C. 59, 106, 108 Lanz, P. 127 Lask, E. 174, 256 Leibniz, G. W. 186, 220, 222, 263 Lévinas, E. IX, 96, 134, 135, 146 f. Lorenz, K. 105 Lorenzen, P. IX Losurdo, D. 178 Löwith, K. VII, 12, 96, 166, 215, 244 Luckner, A. 96, 113, 212 f., 231, 246 Lukács, G. 92 Luther, M. 31, 108, 137, 162 Lyotard, J. F. IX Macann, Chr. 150 Marcel, G. 134 Marcuse, H. VII f. Marx, K. VIII, 293 Merker, B. 119 f., 122 Merleau-Ponty, M. VII, 215 Michalski, M. 242 Mittelstraß, J. 105 Montaigne, M. de 292 Mörchen, H. 162 Moser, S. 269 Müller-Lauter, W. 190 Munier, R. 287 Nagl-Docekal, H. 96 Natorp, P. 25 Neske, G. 284 Newell, A. 69 Newton, I. 128 Nietzsche, F. VII f., 231, 240, 296 Pauer-Studer, H. 96 Paulus 31, 139 Peperzak, A. 178 Picht, G. 284 Pindar IX, 262
Platon IX, 3, 8, 13, 167, 170, 179, 202, 215, 262, 267 Plotin 222 Pocai, R. 52, 57, 99, 102 Pöggeler, O. 191, 241, 244 f. Prauss, G. 91 Rahner, K. VII Rentsch, Th. 93, 96, 122, 149, 162, 178, 202, 204 f., 214 f., 217, 220, 222, 243, 246 Richardson, W. J. 281 Rickert, H. 22, 102 Ricoeur, P. VII, 230, 237, 239, 240 f., 247 Rilke, R. M. 140, 254 f., 277 Ritter, J. 56 Rorty, R. IX Rosales, A. 19, 190 Rousseau, J. J. 292 Ryle, G. IX, 92 f. Sartre, J.-P. VII, 96, 138, 142, 155 Schäfer, T. 95 Schapp, W. 214 Scheler, M. 30, 127, 144, 154, 202, 263, 266 Schelling, F. W. 292 Schmitz, H. 215 Schneider, M. VIII Schulz, W. 178 Schürmann, R. 96 Seel, M. 155 Sheehan, Th. 293 Simmel, G. 30, 139 f. Simon, H. 69 Spiegelberg, H. 22 f., 253 Stassen, M. 108 Sternberger, D. 135 Taylor, Ch. 166 Theunissen, M. IX, 96, 178 f., 214 Thomä, D. 10, 293, 297 Thomas v. Aquin 4, 14 Thomas v. Kempen 139 Tietz, U. 112 Tolstoi, L. N. 147 Tugendhat, E. 96, 101, 104 f., 119, 179, 190 Vattimo, G. IX Vetter, H. 243
Personenverzeichnis
313
Vogel, L. 96 Volkmann-Schluck, K.-H. 237 Volpi, F. 167
Wittgenstein, L. IX, 92 f., 213, 217, 220, 222 Wohlfart, G. 191 Wolf, U. 101
Windelband, W. 102 Winograd, T. 81 f.
Yorck v. Wartenburg, P. Graf 230 f., 241
315
Sachverzeichnis
Ableben 139 Affektion 206 Als-Struktur (des Verstehens) 105 Angst 64–66, 121, 122, 144, 204–206 Anthropologie 295 Aufdringlichkeit 57–58 Auffälligkeit 57–58 Aufsässigkeit 57–58 Augenblick 191, 202, 210–211, 289 Auslegung 104–106 Aussage 34–35, 130–131 Authentizität 149, 166 Bedeutsamkeit 62–63, 78, 80, 83, 85, 235 Befindlichkeit 43, 45, 98–101, 203 Besorgen 55, 216 Bevorstand 142 Bewandtnis 60 Bewandtnisganzheit 61, 216 Da 215–216 Dasein 6, 15, 42, 92 f., 98, 153–154, 287– 288, 291–292, 294–297 Daseinsanalytik 125–126 Datierbarkeit 248–249 Destruktion 19–22, 32, 232 eigenstes Seinkönnen 140 Eigentlichkeit 154–158, 160, 165, 190–192, 201 Ekstase/n 187–188, 190, 202, 221, 290 Ende 139 Entdecken 128–129 Entdecktheit 129 Entschlossenheit 47, 156–157, 165, 167, 172–173, 175, 290–291 –, vorlaufende 177–178, 186, 194 Entwurf 102–103 Erbe 237–238 Erde 294 Ereignis 260, 265 Erschlossenheit 98, 129–130, 212 Erstrecktheit 188 Erwiderung 238 f.
Ethik 96, 150–151, 296–297 Existenz 11–12 Existenzial 173–174 existenzial 11–12, 181 existenziale Analytik 29, 32, 41 Existenzialontologie 175 existenziell 11–12, 181 Faktizität 99, 237 formale Anzeige 257, 275 Fundamentalontologie 98, 152–153, 181– 182, 283–284 Furcht 100, 204, 206 Fürsorge 96–97, 136 Ganzheit 146 Gegenwart 187, 191, 202, 208–211, 213, 261, 289 Geist 246 Gelassenheit 271 Gemeinschaft 242 Gerede 112, 212 Geschehen 232 Geschichte 232–233, 240–241 Geschichtlichkeit 235–240, 248 Geschick 241 Gespanntheit 249 Gewesenheit 187, 191, 202–204, 261 Gewissen 46, 159, 161–164, 167, 213–214 – Gewissen-haben-wollen 165 –, Ruf des 161–162, 164 Gewißheit 192 Geworfenheit 99, 114 Hermeneutik 24–26, 90 – der Alltäglichkeit 91 hermeneutische Situation 180 Historie 240–241 Horizont 221, 272–274 Innerzeitigkeit 248 Inständigkeit 290–291 Interexistentialität 243 Jemeinigkeit
41, 47
316
Sachverzeichnis
Kampf 244 Kehre 255, 293 Konstruktion 232–233 Langeweile 273–274 Leiblichkeit 203, 215, 224, 225 Lichtung 216 Man 94–95 Metontologie 243, 263–264 Mitdasein 93–94 Mitsein 134, 143–144, 166–167, 215, 242– 243 Mitteilung 244 Methodologie 205 Nationalsozialismus 244 Natur 56, 70–73, 75–76 Neugier 207–208 Nichts 66 Öffentlichkeit 243, 249 ontisch 5–6, 9 ontologisch 6, 8 Phänomenologie 22–25 Philosophie 8, 267–271, 275 Präsenz 261–262 Raum 223–224 Räumlichkeit 285 Rede 110–111, 190, 211–214 Schema 188, 221–222, 261 Schicksal 238 Schuld 163–164 Schuldigsein 175–176 Seinsfrage 4, 7, 9, 12–13 Seinsverständnis 125 Sein zum Tode 138–140, 142–143 Sinn 185 – von Sein 7 Sorge 40, 123–124, 162, 189, 190, 194 Sprache 108–109, 286 Staat 245 Subjekt 92–93, 114, 292 Subjektivismus 286 Temporalität 18, 259–262, 273, 285 Tod 133–135, 140–142, 144–147 – des Anderen 134–136
–, Unvertretbarkeit des 137–138 –, Vorlaufen zum 172, 176 Transzendenz 66, 257–258, 267–270, 272, 290 Umsicht 56, 218 Unbestimmtheit 145 Uneigentlichkeit, uneigentlich 119, 154– 158, 160, 165, 190–192, 201 Unzuhause 64 Verdeckung 129–130 Verfallen 15, 112–113, 119–121, 130, 190, 207–209 Vergangene 233–234 Verschließen, Verschlossenheit 129, 209 Verstehen 44 –45, 101–106, 200–202 Verweisung 60 Verweisungszusammenhang 83 Volk 243–245 Vorhandenheit, vorhanden, Vorhandenes 37, 57, 75 Wahrheit 33–35, 128–131, 192, 258–259, 284 Welt 51, 53–54, 58, 61–64, 69, 75, 79–80, 220–221, 226, 234, 264–267, 294 Welt-Geschichte 236 Weltlichkeit 53–54, 76, 83 Weltzeit 248–249 Wiederholung 239 Wissenschaft 8–9, 73, 85, 217–219, 268, 275 Worumwillen 47, 61 Zeichen 59, 211–212 Zeit 16–17, 169 Zeitigung 189, 265 Zeitlichkeit 11, 17–18, 169, 186–190, 192– 194, 199, 203, 206, 209, 211, 214–216, 220, 222–223, 225–227, 238–240, 258– 261, 284–285 Zeitverständnis, vulgäres 247–249 Zeug 55, 79–80, 235 Zeugganzheit 56, 78, 85 Zeugzusammenhang 58–59 Zirkel, hermeneutischer 106–107 Zuhandenheit, zuhanden, Zuhandenes 37– 38, 55–57, 71, 75, 77–79 Zukunft 186, 191, 201–202, 261 Zu-sein 41
317
Hinweise zu den Autoren
Christoph Demmerling, geb. 1963, Studium der Philosophie, Literaturwissenschaft und Linguistik in Konstanz und Florenz. Promotion 1992 in Konstanz und Habilitation 1998 in Dresden. Derzeit Privatdozent für Philosophie und Oberassistent an der Technischen Universität Dresden. Veröffentlichungen: Hg.: Vernunftkritik nach Hegel (mit F. Kambartel) (1992). Sprache und Verdinglichung (1994). Hg.: Die Gegenwart der Gerechtigkeit (mit Th. Rentsch) (1995). Hg.: Vernunft und Lebenspraxis (mit G. Gabriel und Th. Rentsch) (1995). Grundprobleme der analytischen Sprachphilosophie (1998, gemeinsam mit Th. Blume). Aufsätze und Artikel zu Sprachphilosophie, Hermeneutik, zur Moral- und Sozialphilosophie. Hubert Dreyfus, Professor für Philosophie in der Graduate School an der University of California, Berkeley. Promotion an der Harvard University, Lehrtätigkeit an der Brandeis University und am MIT. Veröffentlichungen u. a.: What Computers (Still) Can’t Do, 3rd edition, MIT Press, (übersetzt in zehn Sprachen); Being-in-the-World: A Commentary on Division I of Being and Time; (mit Paul Rabinow) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics; (mit Stuart Dreyfus) Mind over Machine; (mit Charles Spinosa und Fernando Flores) Disclosing New Worlds: Entrepreneurship, Democratic Action, and the Cultivation of Solidarity. Dreyfus arbeitet zur Zeit an der zweiten Auflage seines Buches „Beingin-the-World“, in der er seinen Heidegger-Kommentar auf den zweiten Abschnitt von „Sein und Zeit“ausdehnen wird. Hans-Helmuth Gander, Professor für Philosophie und Direktor des Husserl-Archivs an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Forschungsschwerpunkte in der Phänomenologie, Hermeneutik, Politischen Philosophie und philosophischen Anthropologie. Veröffentlichte u. a. Positivismus und Metaphysik. Voraussetzungen und Grundstrukturen von Diltheys Grundlegung der Geisteswissenschaften (1988); (Hg.) Von Heidegger her. Wirkungen in der Kunst – Philosophie – Medizin; (Hg.) „Verwechselt mich vor allem nicht!“. Heidegger und Nietzsche (1994, japanisch 1998); Selbstverständnis und Lebenswelt. Grundzüge einer phänomenologischen Hermeneutik im Ausgang von Husserl und Heidegger (2001, 2. Aufl. 2006); (Hg.) Anerkennung. Zu einer Kategorie
318
Hinweise zu den Autoren
gesellschaftlicher Praxis (2004); (Mithg.) Heidegger und die Anfänge seines Denkens (2004); (Mithg.) Dimensionen des Hermeneutischen. Heidegger und Gadamer (2005); (Mithg.) Ethik des Strafens (2007); (Hg.) Menschenrechte. Philosophische und juristische Positionen (2007). Jean Grondin, Professor für Philosophie an der Université de Montréal. Bücher (u. a.): Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff HansGeorg Gadamers (1982; 2. A. 1994); Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger (1987); Kant et le problème de la philosophie: l’a priori (1989); Einführung in die philosophische Hermeneutik (1991); L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine (1993); Der Sinn für Hermeneutik (1994); Kant zur Einführung (1994); Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie (1999). Byung Chul Han, geb. 1959, studierte Philosophie, Germanistik und Katholische Theologie in Freiburg i. Br. und München. Lehrt gegenwärtig am Philosophischen Seminar der Universität Basel. Veröffentlichungen u. a.: Heideggers Herz (1996), Todesarten (1998), Martin Heidegger. Eine Einführung (1999). Marion Heinz geb. 1951. Promotion 1980 („Zeitlichkeit und Temporalität. Die Konstitution der Existenz und die Grundlegung der Ontologie im Frühwerk Martin Heideggers“, 1982). Habilitation 1991 („Sensualistischer Idealismus. Untersuchungen zur Erkenntnistheorie und Metaphysik des jungen Herder (1763–1778)“, 1994). 1995 o. Prof. in Duisburg, seit 1998 in Siegen. Schwerpunktthemen: Phänomenologie und Hermeneutik, die Philosophie Martin Heideggers, Philosophie der Aufklärung und des Deutschen Idealismus, Feministische Philosophie, Antike Philosophie. Anton Hügli, geb. 1939, Professor für Philosophie an der Universität Basel. Wichtigste Veröffentlichungen: Die Erkenntnis der Subjektivität und die Objektivität des Erkennens bei Sören Kierkegaard, (1973); Philosophie und Pädagogik, (1999); Herausgeber und Mitherausgeber: Philosophielexikon, (1991, 21998); Philosophie im 20. Jahrhundert, 2 Bde. Bd. 1: Phänomenologie, Existenzphilosophie und Kritische Theorie, 1992. Bd. 2: Wissenschaftstheorie und Analytische Philosophie, 1993; Historisches Wörterbuch der Philosophie, (seit Bd. 7, 1989); Zahlreiche Artikel zur Praktischen Philosophie und Lehrerbildung. Theodore Kisiel, Presidential Research Professor für Philosophie an der Northern Illinois University in DeKalb, Illinois. Wichtigste Veröffent-
Hinweise zu den Autoren
319
lichungen: Phenomenology and the Natural Sciences (mit Joseph Kokkelmans, 1970), The Genesis of Heidegger’s BEING AND TIME (1993). Herausgeber: Reading Heidegger from the Start (1994). Übersetzer von Heidegger GA-Bd. 20: Heidegger, History of the Concept of Time (1985). Zahlreiche Artikel zu Heidegger, zur hermeneutischen Phänomenologie und Hermeneutik der Naturwissenschaften. Andreas Luckner, geb. 1962, Studium der Philosophie, Musikwissenschaft und Germanistik in Freiburg i. Brsg. und Berlin. Dr. phil. 1992 (TU Berlin). 1992–1998 Assistent am Institut für Philosophie der Universität Leipzig. Seit 1999 Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit einem Projekt zum Verhältnis lebenspraktischer Orientierung und Ethik („Klugheit und provisorische Moral“). Wichtigste Veröffentlichungen: Genealogie der Zeit. Zu Herkunft und Umfang eines Rätsels, dargestellt an Hegels Phänomenologie des Geistes (1994), (Hg.), Dissens und Freiheit. Kolloquium Politische Philosophie (1995), Martin Heidegger: Sein und Zeit. Ein einführender Kommentar (1997, 22001). Aufsätze zur Ethik, Anthropologie, Politischen Philosophie, zu Kant, Hegel und Heidegger. Barbara Merker, studierte Philosophie, Germanistik und Geschichte in Münster. Promotion 1984, Habilitation 1994. Seit 1997 Professorin für Philosophie (Sprachphilosophie, Ethik, Ästhetik) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. Bücher: Selbsttäuschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phänomenologie Husserls (1988), Angemessenheit. Zur Rehabilitierung einer philosophischen Metapher (1999) (Mitherausgeberin); Artikel zu Problemen der Ethik, Heidegger, Adorno, Person, Glück, Lust, Bedürfnisse, Autonomie, Werte. Romano Pocai, geb. 1961, Studium der Philosophie, Germanistik und Italianistik in Heidelberg und Berlin. Promotion 1994; 1994–2000 wiss. Assistent am Institut für Philosophie der FU Berlin; 2001–2004 wiss. Mitarbeiter im DFG-Projekt „Zum Verständnis von Philosophie und Kunst im Ausgang von Begriff und Praxis der Kunstkritik“. Arbeitet zur Zeit an einer Abhandlung zum Kunstbezug der philosophischen Moderne. Monographie: Heideggers Theorie der Befindlichkeit. Sein Denken zwischen 1927 und 1933 (1996); Herausgeber: Erfahrungen der Negativität (mit M. Hattstein u. a.) (1992), Selbstbesinnung der philosophischen Moderne (mit Ch. Iber) (1998), Der Sinn der Zeit (mit E. Angehrn u. a.) (2002). Aufsätze zur Metaphysik, Anthropologie, Ästhetik. .
320
Hinweise zu den Autoren
Thomas Rentsch, geb. 1954, Professor für Philosophie an der Technischen Universität Dresden. Studium in Konstanz, Münster, Tübingen und Zürich; Promotion 1982; Habilitation 1988; Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1992 Berufung zum Gründungsprofessor am Institut für Philosophie der TU Dresden. Veröffentlichungen: Heidegger und Wittgenstein (1985, 22003); Martin Heidegger – Das Sein und der Tod (1989); Die Konstitution der Moralität (1990, 21999); Negativität und praktische Vernunft (2000); Gott (2005). Mitherausgeber des Historischen Wörterbuchs der Philosophie und der Wittgenstein Studies. – Aufsätze und Lexikonartikel zur praktischen Philosophie, zur Metaphysikkritik, zur Ästhetik und Religionsphilosophie. Dieter Thomä, geb. 1959; Studium in Freiburg und Berlin; Volontariat an der Henri-Nannen-Journalistenschule, Hamburg; Redakteur beim Sender Freies Berlin; Promotion 1989; wiss. Assistent für Philosophie an den Universitäten Paderborn (1990–1993) und Rostock (seit 1993); Habilitation 1997; Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der New School for Social Research, New York (1997–1999). Seit dem Wintersemester 2000/01 unterrichtet er als Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. Veröffentlichte u. a.: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers 1910 –1976 (1990); Eltern. Kleine Philosophie einer riskanten Lebensform (1992); Erzähle dich selbst. Lebensgeschichte als philosophisches Problem (1998). Franco Volpi, ehemaliger Humboldt-Stipendiat, seit 1987 Professor für Philosophie in Padua, 1991–1997 in Witten/Herdecke, Gastprofessor an verschiedenen europäischen und amerikanischen Universitäten. 1989 Montecchio-Literaturpreis, 2000 Nietzsche-Preis. Er schreibt für „La Repubblica“. Veröffentlichungen: Heidegger e Brentano (1976), Heidegger e Aristotele (1984), Il nichilismo (1996), Großes Werklexikon der Philosophie (Hg., 2 Bde., 1999; span. Ausgabe, 3 Bde., 2005), Storia della filosofia (2 Bde., 2007, mit E. Berti), L’ultimo sciamano. Conversazioni su Heidegger (2006, mit A. Gnoli). Volpi betreut die italienische Ausgabe der Werke Heideggers beim Mailänder Verlag Adelphi und hat eine neue italienische Übersetzung von „Sein und Zeit“ mit einem umfangreichen philologischen Apparat besorgt.
![Martin Heidegger: Sein und Zeit [3rd revised edition]
9783110379396, 9783110377170](https://dokumen.pub/img/200x200/martin-heidegger-sein-und-zeit-3rd-revised-edition-9783110379396-9783110377170.jpg)

![Der Mut zum Sein [2. bearb. Aufl.]
9783110407266, 9783110374322](https://dokumen.pub/img/200x200/der-mut-zum-sein-2-bearb-aufl-9783110407266-9783110374322-v-5489415.jpg)
![Der Mut zum Sein [2. bearb. Aufl.]
9783110407266, 9783110374322](https://dokumen.pub/img/200x200/der-mut-zum-sein-2-bearb-aufl-9783110407266-9783110374322.jpg)



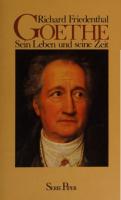


![Martin Heidegger: Sein und Zeit [2., bearb. Aufl.]
9783050050171](https://dokumen.pub/img/200x200/martin-heidegger-sein-und-zeit-2-bearb-aufl-9783050050171.jpg)