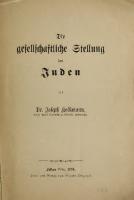Körperkreativitäten: Gesellschaftliche Aushandlungen mit dem menschlichen Körper 9783839454275
Die Körperbezogenheit unserer Gesellschaft gestaltet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen vergegenwärtigendem Wahr
161 58 18MB
German Pages 306 Year 2020
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
KörperKreativitäten
Körper-Politiken und symbolische Kommunikation
Entblößter und verhüllter Leib
Das Zittern der Macht
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
Körper, Ästhetisierung, Regulierung
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Grauzonen: Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Snapchatdysmorphophobie – Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern
Körperlichkeit und kulturelle Praktiken
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
»Oh look, bionic people!«
Neue Körper, Grenzen, Entgrenzungen
Gelebte Verflechtungen
Reformierte Körper
Körperliche Christen
Autorinnen und Autoren
Citation preview
Angela Treiber, Rainer Wenrich (Hg.) Körperkreativitäten
K'Universale – Interdisziplinäre Diskurse zu Fragen der Zeit | Band 9
Editorial Die Reihe wird herausgegeben von Gabriele Gien, Ulrich Kropac, Thomas Pittrof und Bernhard Sill.
Angela Treiber (Dr. Phil.), geb. 1962, ist Professorin für Europäische Ethnologie/ Volkskunde an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie beschäftigt sich mit empirischer Religionsforschung, Theorie- und Wissenschaftsgeschichte sowie Alltags- und Sozialgeschichte. Rainer Wenrich (Dr. phil.), geb. 1964, ist Professor für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Schwerpunkte seiner Forschungen sind Kunstpädagogik und Kunstdidaktik, Design- und Kostümgeschichte sowie Modetheorie.
Angela Treiber, Rainer Wenrich (Hg.)
Körperkreativitäten Gesellschaftliche Aushandlungen mit dem menschlichen Körper
Autor/-innen und Herausgeber/-innen haben sich bemüht, alle Bildrechte zu klären. Sollte dies im Einzelfall nicht oder nicht zutreffend gelungen sein, wird um Nachricht an den Verlag gebeten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 transcript Verlag, Bielefeld Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Alexander Krivitskiy Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-5427-1 PDF-ISBN 978-3-8394-5427-5 https://doi.org/10.14361/9783839454275 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
KörperKreativitäten Gesellschaftliche Aushandlungen mit dem menschlichen Körper Angela Treiber und Rainer Wenrich ........................................................ 7
Körper-Politiken und symbolische Kommunikation Entblößter und verhüllter Leib Inszenierungen von weiblicher Körperlichkeit in der mittelalterlichen Literatur Martina Feichtenschlager.................................................................. 31
Das Zittern der Macht Zur Aktualität politischer Körpermetaphorik Rainer Guldin ............................................................................ 45
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik Historische und soziologische Perspektiven auf Körper und Geschlecht Imke Schmincke .......................................................................... 71
Körper, Ästhetisierung, Regulierung Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge Martin Dinges ............................................................................. 91
Grauzonen: Alter/n als Form kulturellen Unbehagens Rüdiger Kunow .......................................................................... 123
Snapchatdysmorphophobie – Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern Ada Borkenhagen ....................................................................... 143
Körperlichkeit und kulturelle Praktiken Neukombinatoriken des menschlichen Körpers Sophie Schmidt/Rainer Wenrich ......................................................... 153
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten Theoretische Positionen und die Methode der Teilnehmenden Beobachtung Barbara Sieferle ......................................................................... 177
»Oh look, bionic people!« Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf prothetisierte Körper Carolin Ruther .......................................................................... 203
Neue Körper, Grenzen, Entgrenzungen Gelebte Verflechtungen In-Vitro-Techologien, Körper, Körperpolitik Nurhak Polat ............................................................................ 225
Reformierte Körper Über Transhumanismus, Christentum und somatoforme Kreativität Mathias Wirth ........................................................................... 257
Körperliche Christen Christoph Asmuth ....................................................................... 279
Autorinnen und Autoren .......................................................... 303
KörperKreativitäten Gesellschaftliche Aushandlungen mit dem menschlichen Körper Angela Treiber und Rainer Wenrich
Perspektiven Die Körperbezogenheit unserer Gesellschaft gestaltet sich in einem dynamischen Spannungsverhältnis zwischen vergegenwärtigendem Wahrnehmen und Erleben im und durch den menschlichen Körper sowie dem Herstellen, Gestalten, Darstellen und Deuten von Körper. Dieses Verhältnis gewann seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zusätzlich an Dynamik mit der Eventisierung und Ästhetisierung des Alltags, der Globalisierung von Massenmedien und der Entwicklung von Social Media, mit rasanten technologischen Entwicklungen wie Virtual und Augmented Reality, gen- und biotechnologischen Innovationen wie Reproduktionstechnologien, Bionic und Body Contouring und biopolitischen Strategien in der alternden Gesellschaft oder mit der Ausbreitung von Epidemien und Pandemien. In der interdisziplinären Körperforschung gilt der menschliche Körper als »Seismograph« für gesellschaftliche Prozesse.1 Er rückt als Produzent, Instrument, Medium, Gestaltungs- und Projektionsraum, als Produkt soziokultureller Praktiken, als ›Ort‹ des privaten oder öffentlichen Aushandelns gesellschaftlicher Wirklichkeiten in den Blick.2 Dies geschieht über mannigfache Kreativitäten als wechselseitige, körperliche Fertigkeiten der Formung der materiellen Umwelt, der Herstellung und Hervorbringung von Dingen, ihren Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen wie auch der Formung von Subjekten.
1 2
Reuter, Julia: Geschlecht und Körper. Studien zur Materialität und Inszenierung gesellschaftlicher Wirklichkeit, Bielefeld 2011. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2015, 9. Zum einen sei der Körper Produkt von Gesellschaft, zum anderen Produzent von Gesellschaft.
8
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Kreativitäten Kreativität in ihren unterschiedlichen wissenschaftlichen wie alltäglichen Perspektivierungen als Phänomen und Zuschreibung lässt sich kaum fassen. Für den deutschsprachigen Raum scheint Kreativität seit den 1970er Jahren ein eigenartiges Dasein zwischen undurchschaubarer Genieästhetik und massentauglichem Gestaltungswollen zu fristen. Eine Vorreiterrolle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kreativität nahm früh die psychologische Kreativitätsforschung des angloamerikanischen Raumes ein. Die berühmte Antrittsrede von Joy Paul Guilford als Präsident der American Psychological Association (APA) im Jahr 19503 gilt als eine Initialzündung für die Forschung zur Kreativität. Stefan Bornemann rechnet vor allem Guilford zu, als einer der ersten Wissenschaftler Persönlichkeitsmerkmale der kreativen Persönlichkeit erkannt zu haben.4 Seine Erkenntnisse sorgten dafür, dass in der Psychologie das schöpferische Potenzial des Individuums untersucht wird u.a. mithilfe psychometrischer Messungen5 , um Befunde zu einem innovativen, originellen Ideenreichtum zu erlangen. Letzteres zeichnet sich durch divergente Lösungen aus, also solche, die bisher nicht dagewesene und jenseits gültiger Konventionen präsentierte Phänomene zeigen. Guilford etablierte divergentes Denken, Handeln und Gestalten als innovative Form der Problemlösung. Infolge dessen lässt sich eine Fülle von Forschungsansätzen, Studien und Tests anführen, die eine Antwort auf die Frage nach Kreativität des Individuums geben wollten. Die Aufmerksamkeit der prominenten Beispiele von Kreativitätsforschung richtete sich auf die Persönlichkeit, das Talent. Sozialpsychologische Zugänge wie diejenigen von Theresa M. Amabile betonen darüber hinaus bedingende Konstellationen von persönlichen Charakteristika, kognitiven Fähigkeiten und sozialem Umfeld, gesellschaftlicher Akzeptanz oder Ablehnung dessen, was unter Kreativität verstanden wird. Allerdings stehen auch hier das gestalterische, begabte Individuum und das kreative Produkt im Fokus.6 Wie verhält es sich nun in Bezug auf einen kreativen Umgang mit dem Körper? Folgt man den Erkenntnissen der Kreativitätsforschung, dann muss zumindest von einem förderlichen Umfeld ausgegangen werden, in dem es dem Individuum ermöglicht wird, sich frei und selbstbestimmt entfalten zu können und darin einem 3 4 5 6
Guilford, J. P.: Creativity, American Psychologist 5 (1950) 444-450. Bornemann, Stefan: Kreativität als Problem der Forschung. In: Ders.: Kooperation und Kollaboration. Das Kreative Feld als Weg zu innovativer Teamarbeit. Wiesbaden 2012, 17-24. Vgl. zur Kreativitätsforschung ausführlich: Krampen, Günther: Psychologie der Kreativität, Göttingen 2019. Vgl.: Amabile, Teresa M.: Creativity in Context. Update to The Social Psychology of Creativity, Oxford 1996, 3, 5ff., 33. Kreative Performanzen werden von gewöhnlichen Performanzen unterschieden.
KörperKreativitäten
Bestreben zu folgen, das persönliche Körperbild optimierend, provozierend oder attrahierend auszudifferenzieren und das »leibliche Selbstverhältnis zu stiften«7 . Der vorliegende Titel KörperKreativitäten versteht sich hierzu als eine konzeptionelle Rahmung, die gesellschafts- und kulturwissenschaftlich orientiert auch alltägliche Lösungen von Aufgaben und Problemen, Strategien zur Lebensbewältigung8 , zur Routine gewordene Technologien des Selbst9 , habitualisiertes generatives Verhalten als performative, gestaltende, produktive wie zerstörende Akte einschließt und in deren Zusammenhang der menschliche Körper immer mehr zur symbolischen Form10 in unserer Gesellschaft avancierte. Die kreativen Körperakte sind bezogen auf die durch das Selbst motivierten und vielfältigen Modifikation des eigenen Körpers und ebenso auf die Rezeption des alternierten Körpers durch ein Gegenüber, das die KörperKreativitäten erkennen, interpretieren und auf diese reagieren kann. An den eingangs skizzierten Prozessen in Feldern des Körperlichen zeichnet sich Kreativität im besonderen Maße als Idee ab.11 Andreas Reckwitz beschreibt diese Prozesse als Motor eines Regimes des ästhetisch Neuen im Rahmen der »Kulturalisierung der Gesellschaft« in der Spät-/Postmoderne. Kreativität wird hier greifbar als strukturelles Merkmal von Praktiken, Interaktionen und Hervorbringungen, die sinnliche und affektive, emotionale Erregung durch das Neue auszeichnen.12 Sie sind ausgerichtet auf den umfassenden körperlichen Genuss des eigenen Tuns.13 Eine ständige Suche »nach immer intensiveren Formen der Verkörperlichung« stellt auch Winfried Fluck für westliche Gesellschaften fest. Über sie könne »die eigene Interiorität immer unmittelbarer und vermeintlich authentischer artikuliert werden«. Die »Gefühle von Körperentgrenzung« lösten sich von
7 8 9 10
11
12 13
Elberfeld, Rolf : Bewegungskulturen und multimoderne Tanzentwicklung. In: Brandstetter G./Wulf C. (Hg.): Tanz als Anthropologie. München 2007, 221. Löfgren, Orvar: »Celebrating Creativity: On the Slanting of Concept«. In: Liep, John (Hg.): Locating Cultural Creativity, London/Sterling, Virginia 2011, 81-90. Foucault Michel: Technologien des Selbst. In: Ders./Martin, Rux/Martin, Luther H./Paden, William E. u.a (Hg.), Technologien des Selbst, Frankfurt a.M. 1993, 24-62, hier 27. Die Modifikation des Körpers als aufwendiger und komplexer Vorgang etabliert den Körper an sich zur symbolischen Form und zu einem visuellen Marker in einer bildgeprägten Zeit. Vgl. dazu: Bourdieu, Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a.M. 1974, 63. Reckwitz spricht von einem dynamischen Kreativitätsdispositiv, dessen Wirkung im Laufe des 20. Jahrhunderts und intensiviert seit den 1970er Jahren in den westlichen Gesellschaften in einem Prozess der Ästhetisierung sichtbar werde. Reckwitz, Andreas: Die Erfindung der Kreativität: zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin 6 2019, 21. Reckwitz, Andreas: Das Kreativitätsdispositiv und die sozialen Regime des Neuen. In: Rammert, Werner et al. (Hg.): Innovationsgesellschaft heute, Wiesbaden 2016, 136. Maase, Kaspar: Einleitung: Zur ästhetischen Erfahrung in der Gegenwart. In: Maase, Kaspar: Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart, Frankfurt a.M. – New York 2008, 10.
9
10
Angela Treiber und Rainer Wenrich
den Bedeutungszusammenhängen, die sinnlichen Erfahrungen würden mit leiblich körperlichem Erleben belohnt.14
Ästhetisierungen Der Prozess der Alltagsästhetisierung ist, wie Kaspar Maase aufzeigt, mit dem »Aufstieg der Massenkultur«, der populären Künste und Vergnügungen bereits an der Schwelle zum 20. Jahrhundert zu beobachten und steht vor allem in den vergangenen drei Jahrzehnten im Mittelpunkt eines anhaltenden Diskurses.15 Maase diagnostiziert eine »Zunahme der öffentlichen Inszenierungen, die mit allen Mitteln die Intensität sinnlich grundierter gemeinsamer Erfahrung zu steigern suchen« und kennzeichnet die hierin wirksame Kreativität als »Streben nach sinnlich eindrucksvoller Formung der materiellen Umwelt wie des Selbst.«16 Die künstlerischen Avantgarden einer pulsierenden ästhetischen Moderne begannen unterdessen ästhetische Erfahrungen über Körperbewegungen und Körperveränderungen zu reflektieren. Der Kreis der Dadaisten im Züricher Cabaret Voltaire um Hugo Ball oder Künstler wie Oskar Schlemmer mit dem Triadischen Ballett substituierten die Anmutung von ästhetisch-harmonischen Körpersilhouetten durch die Modifikation der Körper mithilfe von Kleidung als zweiter Haut, Körperarchitekturen und irritierenden Bewegungsabläufen. Sie skalierten damit neuartige Vorstellungen von Körpern in Relation zu den sie umgebenden Räumen. Generell scheint den künstlerischen Avantgarden »das Spiel mit dem Unbewussten gemeinsam, dem sie Visionen von zerstückelten und wieder zusammengesetzten Kunstkörpern entnehmen.«17 Körperlichkeit gewinnt in nahezu allen künstlerischen Strömungen ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die eine oder andere Weise im Ge-
14
15
16 17
Fluck, Winfried: Ästhetische Erfahrung und Identität. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 49 (2004), 22. Fluck, Winfried: California Blue. Amerikanisierung als Selbst-Amerikanisierung. In: Bechdolf, Ute/Johler, Reinhard/Tonn, Horst (Hg.): Amerikanisierung – Globalisierung. Transnationale Prozesse im europäischen Alltag, Trier 2007, 25. Maase, Kaspar: Populärkulturforschung: Eine Einführung, Bielefeld 2019, 132f. Vgl. dazu: Bubner, Rüdiger: Ästhetische Erfahrung, Frankfurt a.M. 1989. Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a.M. 1992. Welsch, Wolfgang (Hg.): Die Aktualität des Ästhetischen, München 1993. Maase, Zur ästhetischen Erfahrung, 10. Puff, Melanie: Postmoderne & Hybridkultur, Wien 2004, 24. Vgl. hierzu Sigmund Freuds Psychoanalyse, er verortet das Unbewusste im Grenzbereich von Körper und Repräsentation »Das ich ist vor allen Dingen ein körperliches, es ist nicht ist nicht nur, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche.« (Freud, Sigmund: Das Ich und das Es. [1923] In: Gesammelte Werke XIII, London 1952, 253).
KörperKreativitäten
staltungsprozess Relevanz und Bedeutung.18 Insbesondere die performativen Gestaltungsformen reflektieren über körperliche Praxis das Verhältnis von Körper, Ästhetik und Gesellschaft und vermitteln diese über das Feld des Künstlerischen hinaus in die Gesellschaft zurück. Die »Aktualität des Ästhetischen« (Wolfgang Welsch)19 im Alltag ist weiterhin ungebrochen. Auch heutige Körperinszenierungen, die den Körper als Träger vielfältiger Zeichen in realer leiblicher und virtueller Präsenz begreifen und sehen, rekurrieren auf jene ästhetischen Hervorbringungen. Der künstlerisch-gestalterische Prozess referiert dabei eine Körperlichkeit, die als künstlerische erkenntnispraktische Strategie aufscheint und dabei Körper und Geist wieder zusammendenkt. Denn seit mit René Descartes die Einheit von »Kopf und Körper« folgenreich auseinanderfiel, existiert ein anhaltendes Verlangen, entgegen dieser westlichen Vorstellung körperliche Ganzheit wiederzuerlangen. Die experimentellen Versuche der Künstler/-innen verweisen auf ein Bewusstwerden der Zusammenhänge von Wahrnehmung und Erkenntnisvermögen von Körper und Welt.
Verkörperungen Die Rolle des Körpers für das sinnliche und körperliche Erkenntnisvermögen wurde über das »methodologische Paradigma« des Embodiment (Thomas Csordas) in den Kultur- und Sozialwissenschaften seit den 1990er Jahren neu bestimmt.20 Insbesondere das Verständnis vom Körper als Zugang des Menschen zur Welt und zu seinem Selbst, das leibliche »Zur-Welt-Sein« in Anknüpfung an den Philosophen und Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty21 , initiierte die erneute Auseinandersetzung mit dem tradierten christlichen Leib- Seele- wie auch cartesianischen Körper-Geist-Dualismus und deren Überwindung. Parallel gingen von Künsten, Theater, Tanz, Musik und Musiktheater mit ihren körperlichen Aufführungs- und Inszenierungspraktiken in den 1960er und 1970er
18
19 20
21
Das Phänomen der Körperlichkeit in der Kunst zeigt sich u.a. in einem körperbetonten Gestaltungsprozess des Abstrakten Expressionismus, z.B. Jackson Pollock, der 1950er Jahre. Die Phänomene Happening und Performance bringen nicht nur die gestalterische Kraft von Künstlerinnen zum Vorschein, sondern lassen auch keinen Zweifel daran, dass der Körper als Motiv, die Körperlichkeit im Gestaltungsprozess und der Körper als Gestaltungsergebnis zu einer künstlerischen Konstante avanciert. Welsch, Wolfgang (Hg.): Aktualität des Ästhetischen, München 1993. Csordas, Thomas: Introduction: The Body as Representation and Being-in-the-world. In: Csordas, Thomas (Hg.): Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge u.a. 1994. Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, 10.
11
12
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Jahren die wegweisenden Impulse aus, welche in neuen Formen wie Body-Art, Happening und Performance mit dem Körper experimentierten. Diese reichten von spontanen Prozessen und extremen Situationen in physische Grenzbereiche bis hin zu einem Überschreiten des natürlichen Überlebensschutzes. An dieser Stelle waren es überwiegend Künstlerinnen, die in dieser Form der gestalterischen Artikulation Aktionen der Befreiung von den überkommenen Einschränkungen des patriarchalisch geprägten Kunstschaffens erkannten. Sie verhandelten künstlerisch das Konzept des Performativen. Ein gesellschaftlich-kultureller Wandel vollzieht sich dann Kraft des Vollzugs von körperlichen Akten des Sprechens, der Gesten, der Körperhaltung und des Rituellen. Als symbolische Handlungen werden über sie kulturelle und soziale Ordnungen hervorgebracht, eingerichtet oder bekräftigt. Die initiierende und leitende Idee von Happening und Performance, Leben und Kunst miteinander zu verbinden, veränderte über die Körperpraxis den Blick auf die Beziehungen von Alltagsrealität und Inszenierung. Mit dem »Performative Turn« können nun alle Praktiken, auch die des Alltags, als Aufführung und Inszenierung, in ihrer Theatralität betrachtet und diskutiert werden.22
Machtverhältnisse Die Konzepte des Embodiment und des Performativen verweisen in diesen Zusammenhängen auf eine »strategisch-produktive« Macht (Foucault)23 der Körper, leibhaftig wie symbolisch, in ihrer Funktion bei der Infragestellung von hegemonialen Verhältnissen und deren Veränderung bzw. der Legitimierung und Etablierung. Ihre Bedeutsamkeit zeigt sich nicht zuletzt in den wirkungsvollen und wirklichkeitsmächtigen metaphorisch eingesetzten Körperbildern des »politischen Körpers«.24 Materiell-physisch manifestieren sich gesellschaftliche Machtverhältnisse im sozialisierten, ›disziplinierten‹ Körper über Normierungen, Kontrolle und Sanktionen vielfältig in Körperhaltung, Verhaltensweisen, körperlichen Gefühlslagen wie Scham- und Peinlichkeitsempfindungen oder Schuldgefühlen, als Zeichen »symbolischer Gewalt« oder »Zwang durch den Körper« (Bourdieu) deutbar.25 Sichtbar wird dies in physischer und psychischer Verfasstheit, in leib-körperlichen Spuren, die gouvernementale ›Zwangsmaßnahmen‹ wie räumliche und soziale Isolation 22 23 24
25
Fischer-Nichte, Erica: Die Attraktivität als Modell in den Kulturwissenschaften, Tübingen 2004. Foucault, Michel, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Bd.1, Frankfurt a.M 1983 [1976], 93.106. Koschorke, Albrecht/Frank, Thomas/Matala de Mazza, Ethel/Lüdemann, Susanne (Hg.): Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a.M. 2007. Bourdieu, Pierre: Die männliche Herrschaft. In: Dölling, Irene/Krais, Beate (Hg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis, Frankfurt a.M. 1997, 158.
KörperKreativitäten
hinterlassen, sei es im Strafvollzug als Disziplinierungsinstrument, das auf Verhaltensänderung und Resozialisierung ausgerichtet ist, oder dem gesellschaftlich und administrativ verordneten »social distancing« unter veränderten Kräfteverhältnissen in der gegenwärtigen Pandemie. Auch die Arbeit am eigenen Körper über die maßregelnden Kategorien von Fitness, Gesundheit und des ›Ästhetischen‹ lässt sich dahingehend verstehen. In ihr werden die Ansprüche der gegenwärtigen individualisierten Gesellschaft an die Einzelnen zur Selbstführung und zur Selbstoptimierung greifbar, die den Bestrebungen freier Selbstentfaltung und -verwirklichung einschränkend gegenüberstehen.26 Die divers diskutierten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit in den Lebenswissenschaften oder den Bio- und Gentechnologien entfalten ebenfalls ambivalente Wirkung: Auf der einen Seite erzeugen sie Möglichkeitsräume biosozialer Selbstbestimmung, auf der anderen Seite wird der menschliche Körper zum Manipulationsobjekt und biologisch argumentierende Ausschlussverfahren von Körpern dienen, machtpolitisch instrumentalisiert, der Legitimierung von Ausgrenzungsstrategien und -praktiken, von Rassismus.
Präsenzen Der Einsatz des Körpers als Werkzeug und seine Fähigkeit Artefakte als körperlichen Ersatz und zur Entlastung zu gestalten, beginnt mit den Techniken des Transports von materiellen Dingen. Die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wie z.B. Telegrafie, Telefon, Radio und Fernsehen bedeuteten eine Überwindung der körperlich gesetzten natürlichen Grenzen des Menschen, des »geographischen territorial bestimmten Körpers«. Die Übertragungstechnologien als »körperlose Prothesen und Organe« deutend, diagnostizierte der Philosoph und Medienkritiker Paul Virilio in den 1980er Jahren mit den digitalen Medien das Ende der realen Präsenz und das Verschwinden des Körpers, den Verlust der natürlichen Wahrnehmungsfähigkeit des »Eigenkörpers«.27 Virilio folgend begebe sich der Körper dabei in der Flüchtigkeit der Begegnungen im rasenden Stillstand in die Weiten der virtuellen Welt hinaus.28
26
27 28
Meuser, Michael: Macht. In: Gugutzer, Robert/Klein, Gabriele/Meuser, Michael (Hg): Handbuch Körpersoziologie: Band 1: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven, Wiesbaden 2017, 6773. Virilio, Paul: Der negative Horizont. Bewegung – Geschwindigkeit – Beschleunigung (1984), München 1989, 50. Virilio, Paul: Der rasende Stillstand, Frankfurt a.M. 1997.
13
14
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Natürlich bleibt der Leibkörper als solcher auch im Zustand des körperlichvirtuellen Fluxus präsent. Entgegen diesen pessimistischen Voraussagen vom »Verschwinden des Körpers« offenbart der fokussierende lebensnahe Blick auf die Menschen, dass es der umfassenden Einbeziehung des handelnden, agierenden Körpers bedarf, um in die virtuelle Welt einzutauchen und dort Immersion zu erleben, z.B. beim Computerspiel, das mit Elementen der Cockpitausstattung über Design und Funktion sensomotorische Körpertechniken verlangt, oder beim Datenhandschuh oder -anzug, der die Bewegungen im Raum und die Gesten erfasst.29 Von der analogen Körper-Lebensrealität diffundieren die von Menschen generierten Bilder in das digitale Dispositiv der global sichtbaren und instantan verfügbaren Social Media und machen jeden einzelnen, unterstützt von einer Vielzahl den Körper modifizierenden Applikationen, zu einem ›Körper-Prosumer‹. Digitalität erweitert fließende Übergänge zwischen verschiedenen Identitäten, wenn der Körper mit Prothetik auch über eine medizinische Indikation hinaus ausgestattet wird, bekleidet mit der ›zweiten Haut”30 und Körperextensionen als wearables in immersiven Räume als ›dritte Haut‹ und der erweiterten, virtuellen Realität31 . Die Frage, was Wirklichkeit ist und was bloßes Abbild, wird obsolet: Bild sein und Bilder von sich machen, »vor allem mentale [Bilder, RW], als Imagination und Fantasie« sind auch hier nicht vom Körper trennbar. Doris Schumacher-Chilla sieht in den Bildern ähnlich wie in der Sprache »die Doppelstruktur des Körpers, der Bilder sieht und Bilder erzeugt. Repräsentationsfragen müssen beim menschlichen Körper ansetzen, der immer auch Erscheinungskörper ist. Eines seiner Hauptmerkmale liegt in seiner performativen Repräsentation und gilt als die erste Bedingung körperlicher Präsenz in der Welt«.32 Anders formuliert, die global kursierenden Bilder gewinnen erst im körperlichen performativen Nachvollzug ihre Wirkung und erhalten mit dieser Aneignung ihren neuen ›Sitz im Leben‹.
29 30
31
32
Maase, Kaspar: Populärkulturforschung. Eine Einführung, Bielefeld 2019, 109. Die Frage nach einer Optimierung als Ästhetisierung des Körpers rekurriert auch auf Gestaltungsfelder wie z.B. Kleidung und Mode. Dieser Aspekt findet sich im Sinne von Körpermodifikation, Körperextension etc. bei Hussein Chalayan, Ines van Herpen. Kröner, Magdalena: Digital Bodies. Virtuelle Körper, politisches Embodiment und alternative Körperphantasmen. In: Kunstforum International Bd. 265 Digital. Virtuell. Posthuman? Neue Körper in der Kunst, 2019. https://www.kunstforum.de/artikel/digital-bodies/ (Letzter Zugriff: 31.05.2020) Schuhmacher-Chilla, Doris: Körper – Leiblichkeit. (2013/2012) In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE: https://www.kubi-online.de/artikel/koerper-leiblichkeit (Letzter Zugriff: 31.05.2020)
KörperKreativitäten
Enhancements Die technologische Optimierung von Körpern über Körperimitate und -surrogate, innovative und hochtechnisierte Prothesen, Exoskelette oder schließlich Maschinen und Roboter als Auslagerung von menschlichen Kompetenzen sind Ergebnisse von Fortschrittsvisionen, die besagen, das Leben könnte lebenswerter zu gestalten sein, wenn es gelänge, den Menschen, seinen Körper und dessen Funktionen oder zumindest Teile davon zu kompensieren oder mit Technologie zu amalgamieren. Dies trifft auf das private Lebensumfeld ebenso zu wie auf bestimmte Lebensbereiche wie die Arbeitswelt, lassen doch gerade die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Arbeit 4.0 zu, die mithilfe der Technologie geschaffenen Freiräume für die Optimierung des menschlichen Zusammenlebens effektiv zu erschließen. Hierauf zielen auch Konzepte wie das des »Postdigitalen«. Ob über einen Cross Platform Approach vor dem Hintergrund von Virtual/Augmented Reality und künstlich intelligenten Algorithmen oder über die Koppelung von digitalen Geräten und physischen Körpern im »Internet der Dinge«, die Ausrichtung und ihre Einbildung von digitalen Medien auf die Lebenswirklichkeit der Menschen und ihre Einbindung in die Dinge des täglichen Lebens stehen im Fokus der Frage nach den leib-körperlichen Praktiken des Umgangs mit diesen Technologien, etwa wenn mit der sozial wahrgenommenen Maschine, dem Subjekt »simulierenden« Unterhaltungsroboter interagiert wird.33 Das Paradigma in Hirnforschung und Kognitionswissenschaft heißt daher seit einiger Zeit Embodiment mit der Ausgangsthese, dass sich der Geist nur vom Organismus her denken lasse. Embodiment meint hier vor allem »verkörperter Geist« (Shaun Galagher)34 als Produkt von Interaktion zwischen dem Körper und der Umwelt. Körperutopien in der KI-Forschung von verkörperter Roboterintelligenz schließen hier an. Der aus menschenähnlichem Material bestehende Computer entwickelt über interaktive Bewegungen mit der Umwelt intelligente Muster von Verhaltensweisen (Rolf Pfeifer).35 Die von Donna Haraway vor mehr als dreißig Jahren begründete Metapher des cybernetic organism gehört heute zur Alltagswirklichkeit des 21. Jahrhunderts.36 Der Cyborg, der mit technologischen Artefakten verwobene Organismus, verwischt die 33
34 35 36
Scholtz, Christopher P.: Alltag mit künstlichen Wesen. Theologische Implikationen eines Lebens mit subjektsimulierenden Maschinen am Beispiel des Unterhaltungsroboters Aiibo, Göttingen 2008. Gallagher, Shaun: How the body shapes the mind, Oxford 2005. Pfeifer, Rolf/Bongard, Josh: How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence, Cambridge MA 2006. Haraway, Donna: Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980's. In: Socialist Review 80 (1985) 65-108.
15
16
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Grenzen zwischen den Menschen und den von ihnen verwendeten Werkzeugen, zwischen Physischem und nicht Physischem, auch zwischen Mensch und Tier. Der Cyborg war Teil eines Konzeptes mit dem subversiven Potenzial des Infragestellens von Differenzkonstruktionen wie Race, Sex oder Gender, über die in biologistischen Diskursen soziale Ein- und Ausgrenzungen legitimiert werden und die alltagsweltliche Relevanz für Zuweisungen nationaler, ethnischer und kultureller Zugehörigkeiten gewinnen.37 Inzwischen hat die Biologin Haraway weitere »Cyborgs für irdisches Überleben« entwickelt, darunter das »Anthropozän«. Mit ihren Mischwesen ruft sie zum Aufbau von »multispecies Assemblagen« auf, die auch Menschen einschließen als politisch-aktivistische Strategien gegen Klimawandel, Umweltverschmutzung, Migration, Ausbeutung und postkoloniale Unterdrückung.38 Die technischen Eingriffe in den Körper und Naturkreisläufe, die menschlichen Hinterlassenschaften körperlichen Stoffwechsels, vor allem Emissionen exzessiven Konsums, bilden eine Faktenlage, die erkennbar werden lässt, dass der Mensch sich in Bezug auf seine weitere Existenz auf einem dünnen Grat seines eigenen Fortbestands bewegt. Inmitten dieser Gratwanderung wirkt der Mensch fundamental auf seinen Körper ein, führt diesen an seine Grenzen und sieht vielfältige Notwendigkeit, denselben in seinem naturgegebenen Bestand zu erproben. Eine Beschäftigung mit dem Körper und seinen mannigfachen gesellschaftlichen, oft konflikthaften Aushandlungen durch Menschen kann also die soeben skizzierten Umstände nicht außer Acht lassen, denn KörperKreativitäten im Titel verweist auf die Gestaltfähigkeit des Menschen im Umgang mit seinem Körper und damit zugleich auf die sozialen Beziehungen zu seinem unmittelbaren Umfeld und auf das Verhältnis zu seiner Umwelt.
Konzeption Die Beiträge des vorliegenden Bandes dokumentieren die interdisziplinäre Vortragsreihe »KörperKreativitäten. Zum gesellschaftlichen Umgang mit dem menschlichen Körper«, welche im Wintersemester 2019/2020 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Rahmen des Forum K‹ Universale stattgefunden hat. Im Zuge der redaktionellen Arbeiten wurde das Themenspektrum der Vorträge mit weiteren Beiträgen ergänzt. Die geschichts-, sozial- und kulturwissenschaftlichen sowie theologischen Artikel geben Einblicke in gegenwärtige und
37 38
Haraway, Donna: »Monströse Versprechen. Die Gender- und Technologie-Essays« Aus dem Englischen von Michael Haupt u.a., Hamburg 2017. Haraway, Donna: Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. In: Environmental Humanities (2015) 159-165 https://environmentalhumanities.org/arch/ vol6/6.7.pdf
KörperKreativitäten
historische gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse um und mit dem menschlichen Körper. Zentrale interdisziplinäre wissenschaftliche Diskurse aufnehmend und dabei ganz unterschiedlichen theoretischen Rahmungen und methodischen Zugängen verpflichtet, diskutieren sie in kritischer Auseinandersetzung Kreativität und Produktivität von Körperbezogenheit unter den Aspekten »Körper-Politiken und symbolische Kommunikation«, »Körper, Ästhetisierung, Regulierung«, »Körperlichkeit kultureller Praktiken« sowie »Neue Körper, Grenzen, Entgrenzungen«. Sie verdeutlichen dabei eine anhaltende dynamische Wandelbarkeit des menschlichen Körpers wie der vielfältigen Auffassungen über ihn – und lassen diese als machtumkämpfte gesellschaftliche Selbstauslegungen verstehen. Als Herausgeber/-innen sind wir uns der Verwendung einer gendersensiblen Sprache sehr bewusst. Gleichzeitg haben wir uns dazu entschlossen, nicht in die Diktion unserer Beiträge einzugreifen, um deren Charakteristik nicht zu verfälschen. Wir danken wir an dieser Stelle allen Mitwirkenden für ihre Beiträge. Ganz besonders sind wir Michael Graßl und Michael Winklmann zu Dank verpflichtet, die beide unsere Vortragsreihe und die redaktionelle Arbeit an der vorliegenden Publikation von Beginn an professionell und mit großem Engagement begleiteten.
Körper-Politiken und symbolische Kommunikation Körpersprache, Mimik, Gesten und Rituale verweisen augenfällig auf die anthropologische Dimension des Körpers als unmittelbares Medium symbolischer Kommunikation. Über performative Praktiken werden soziale Ordnungen, Normen und Regeln erzeugt, bestätigt oder bekämpft. Für die alltäglich praktizierten Handlungsstrategien, die ›Politiken des Alltags‹, spielen der Einsatz von Körperlichkeit und die sinngebenden Bedeutungszuschreibungen eine zentrale Rolle. Im Rahmen politischer Bewegungen verspricht öffentlich inszenierter Körpereinsatz eine motivierende und mobilisierende Wirkung. Dabei kann auf ein breites symbolisches Repertoire zurückgegriffen werden. Der Bezug auf Körpererfahrung macht beispielsweise geschlechterbezogene Auffassungen von Körperlichkeit zum Gegenstand von gesellschaftspolitischen Praktiken und Diskursen, den Körper zum Gegenstand von Politik. Mit der Body Politic des »politischen Körpers« werden Herrschafts- und Staatsformen, Gesellschaftsordnungen und die durch sie zugewiesenen sozialen Positionen und Handlungsspielräume erklärt, legitimiert oder in Frage gestellt.39 39
Koschorke, Albrecht/Frank, Thomas/Matala de Mazza, Ethel/Lüdemann, Susanne (Hg.): Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a.M. 2007.
17
18
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Die Wirkmächtigkeit ihrer Körpermetaphoriken zeigt sich bis heute in brisanten Übertragungen vom körperlichen Erscheinungsbild und Gesundheitszustand von Staatsoberhäuptern auf die »Lage der Nation« in der täglichen medialen Berichterstattung. Die Vielschichtigkeit symbolischer Kommunikation durch den weiblichen Körper in der Darstellung des höfischen Romans und der Minnedichtung legt Martina Feichtenschlager in ihrem Beitrag »Entblößter und verhüllter Leib. Inszenierungen von weiblicher Körperlichkeit in der mittelalterlichen Literatur« dar. Über den semantischen Zusammenhang von ›Hülle‹ und ›Haut‹ des Körpers mit dem ›Hemd‹ oder ›Kleid‹ arbeitet sie heraus, wie in den Erzählungen Selbstdestruktion durch Entblößung, durch Zerschneiden des Hemdes, durch Zerreißen der Kleider in Trauer und Schmerz gestisch und szenisch inszeniert in den Erzählungen dargestellt wird. Der weibliche entblößte Körper wird als Medium konventionalisierter Darstellung von Trauer und prekärer Leidenschaft sichtbar bzw. lesbar. Die Analyse der mehrfachen innertextlichen Perspektiven auf den entblößten weiblichen Körper, dessen Subjekt die Blicke nicht bemerkt, stärkt Feichtenschlagers Hypothese, dass die Darstellung des entblößten nackten Frauenkörpers durch den Kunstgriff der verdeckten Position des Text-Ichs den unverstellten Blick, das unverhohlene Begehren medial erst ermöglicht oder zulässt. Der sprach-, text- und bildanalytische Zugang über prominente literarische Beispiele legt die Deutung nahe, dass die Darstellung des weiblichen nackten Körpers als Objekt heteronormierter männlicher Begierde im Erfahrungsspektrum und Erwartungshorizonts der mittelalterlichen Autoren und männlichen Leser lag. Und er ein Bildobjekt ist, das in zahllosen Gestaltungen über das Feld der Kunst hinaus bis heute Wiederholung findet. Rainer Guldins Beitrag über »Das Zittern der Macht. Zur Aktualität politischer Körpermetaphorik« zeigt mit seinem ideengeschichtlichen, historischen Rückblick die longue durée der Body Politic des »politischen Körpers« seit der Antike. Die Kraft der Unmittelbarkeit und Eindrücklichkeit symbolischer Analogiebildung von Körper und Herrschafts- und Machtformen ließ ihre inhärenten Deutungsmuster überdauern – entgegen anderen Diagnosen in bürgerlichen Demokratien, allerdings in Anpassung an die politischen Verhältnisse in gewandelter Form. Die Verfasstheit des Staatsoberhauptes, des oder der Politikers/-in, die Unversehrtheit und Gesundheit seines/ihres Körpers und dessen Zerfall und Krankheit gewinnen bis heute in ihrer Deutung und Übertragung auf die politische Situation und den Zustand des Landes oder der Nation massenmedial vermittelt an Aktualität. An zahlreichen Beispielen zeigt Guldin auf, dass derlei körpermetaphorische Deutungen macht(de)stabilisierende Wirkungen zur Folge haben können, über Wohl und Abstieg nationaler Identifikation entscheiden. Imke Schmincke geht unter dem Titel »Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik. Historische und soziologische Perspektiven auf Körper und Geschlecht« den Zielen und Strategien der Frauenbewegung nach, die in Ausein-
KörperKreativitäten
andersetzung mit der seit dem späten 19. Jahrhundert sich manifestierenden Verknüpfung von Materialität des Körperlichen mit Geschlecht entwickelt wurden. Am Fallbeispiel zeigt sie, wie über die wissenschaftliche Konstruktion physiologisch begründeter geschlechtlicher Andersartigkeit, in Beziehung gesetzt zu Leistungsfähigkeit und intellektueller Reichweite, Frauen eine gesellschaftlich-politisch inferiore Stellung zugewiesen und manifestiert wurde. Hier knüpften die Politisierung der Körper und feministische Standortbestimmungen der späten 1960er und 1970er Jahre an. Erst mit einem Bewusstwerden körperlicher Individualität, einem, so Schmincke, Reflexiv-Werden von Körper und Geschlecht, stellt sich eine diskursive Körperbetrachtung ein. Diese lässt es zu, die patriarchalischen Strukturen zu hinterfragen öffentlich zu diskutieren. Hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung von Körper und Geschlecht diagnostiziert sie aber eine »paradoxe Gleichzeitigkeit« der Auflösung von naturalisierenden stereotypen Geschlechtervorstellungen und tradierten Rollenzuschreibungen einerseits und einer radikalisierten Körper-Politik andererseits, die Gleichstellungspolitiken, sexuelle Selbstbestimmung und Gender-Forschung als »Gender Ideologie« bekämpft.
Körper, Ästhetisierung, Regulierung Die alltagskulturelle Betonung und Aufwertung der sinnlichen Wahrnehmung des eigenen Körpers und Körpererlebens ist gegenwärtig in westlichen Gesellschaften unübersehbar. Sie wird u.a. greif- und sichtbar an der »Arbeit am Körper«40 , den »Technologien des Selbst« (Foucault), Konzepten der beständigen Selbstoptimierung wie Bewegungs- und Ernährungsprogrammen oder Body Indices und deren praktischen Umsetzungen in computergenerierten Morphing, kosmetischen Anwendungen, invasiven Körpermodifikationen und pharmakogenetischer Medikation, mit der Vision den durch das Altern bedingten körperlichen Verfall aufzuhalten. Konzepte und Umsetzungen basieren auf normativen Verständnissen von ästhetisch schönen und idealen Körpern als Resultate beständiger Kategorisierungen von Körpern in männlich/weiblich, jung/alt, gesund/krank, schön/hässlich. Sie werden erlebt als Befreiung, Erfüllung, Überforderung oder Zwang. Über derartige Kategorisierungen konstituieren sich soziale und kulturelle Körperordnungen und Rollenzuweisungen. Der Blick auf die Praktiken und Diskurse, die über diverse Medien und mediale Vermittlungsformen wie Werbung entworfenen und vermittel-
40
Thomas, Tanja/Maier, Tanja: Körper. In: Hepp, Andreas/Krotz, Friedrich/Lingenberg, Swantje/Wimmer, Jeffrey (Hg.): Handbuch Cultural Studies und Medienanalyse, Wiesbaden 2015, 285-295, 286.
19
20
Angela Treiber und Rainer Wenrich
ten Körperbilder eröffnet Fragen nach ihrem Potenzial für soziale gesellschaftliche Regulierungen eines ›legitimen‹ Körpers. In kritischer Auseinandersetzung mit dem Konzept der »Hegemonialen Männlichkeit« und der Frage nach den physisch-psychischen Folgen männlicher Rollenkonditionierung beginnt Martin Dinges seinen Beitrag zu »Körper und Gesundheit von Männern. Zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge.« Denn entgegen oder ergänzend zum gängigen, langlebigen Ideal vom »starken Geschlecht«, das die gesellschaftliche Dominanz von Männern gegenüber Frauen stützt, herrscht gegenwärtig ein Defizitdiskurs, der ein Rollenbild konstituiert, das scheinbar vorgegebene Vermeidungsstrategien von Männern sich ihres Körpers bewusst zu sein, zum Thema hat. Die Zuweisung stereotyper körperlicher Befindlichkeiten dient auch hier der Stabilisierung von Geschlechtergrenzen. Dinges deutet dies als gesellschaftlichen Disziplinierungsversuch. Über eine Rekonstruktion geschlechterspezifischer ›Körperverhältnisse‹ auf der Grundlage wesentlicher, sozial- und medizinhistorisch relevanter statistischer Daten seit dem 18. Jahrhundert wird deutlich, dass das geschlechterstereotype Narrativ von der mangelnden Selbstsorge der Männer für ihre Körper und ihre Gesundheit in der praktischen Wirklichkeit empirisch zunehmend nicht belegbar ist. Mit der Angleichung der gesellschaftlichen Anforderungen an Frauen und Männer im Beruf wie im privaten Umfeld ist in den letzten drei Jahrzehnten beispielsweise eine nachholende Medikalisierung und damit Teilhabe an der medizinischen Versorgung bei Männern festzustellen, dies allerdings mit deutlichen sozialen Unterschieden. Alte bzw. alternde Körper und deren sichtbare Oberflächen, die »Grauzonen«, nimmt Rüdiger Kunow zum Ausgangspunkt, sich »Alter/n als Form kulturellen Unbehagens« in der spätmodernen Gesellschaft anzunähern. Über Zuschreibungen differenzierter Körperlichkeit im Sinne der Cultural Studies verfolgt er, wie Vorstellungen von Alter und dem Prozess des Alterns soziale Ordnungsvorstellungen ausbilden und über welche Praktiken und Techniken sie sich organisiert manifestieren. Er zeigt Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung und Bewertung des Prozesses physiologischen (körperlichen) Alterns als »Defizitmodus menschlicher Existenz«, als Störfaktor, »Verlust freier Selbstbestimmung« auf und kulturelle Gegenstrategien dazu bis hin zum molekularbiologisch optimierten Altern. Er verweist auf Identitätszuschreibungen über die Projektionsfläche des alten Körpers und Mechanismen »passiver Gruppierung« bis hin zu Diskriminierung. Wünsche einer das Alter ignorierenden Körperoptimierung und die Folgen einer Normalisierung von normierten Vorstellungen beschwerdeloser körperlicher Befindlichkeit werden kritisch hinterfragt, insbesondere mit Bezug auf molekularbiologisch optimiertes Altern und dessen soziale Sprengkraft. Angesichts des demografischen Wandels, des Diskurses um Langlebigkeitsrevolution und Überalterung der Gesellschaft eröffnet der kulturwissenschaftli-
KörperKreativitäten
che Blick auf den alten Körper somit eine wesentlich erscheinende gesellschaftlich-ethische und moralische Diskussion darüber, was Menschen für ein gutes, erstrebenswertes, gesellschaftlich akzeptiertes (Zusammen)Leben im Angesicht ihrer körperlichen und damit auch endlichen Verfasstheit halten. Ada Borkenhagen setzt sich in ihrem Beitrag »Snapchatdysmorphophobie – Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern« kritisch mit der Anwendung von Filter- und Bearbeitungstools insbesondere des Morphing im Rahmen der Selbstinszenierungspraxis mit Selbst-Fotos in den sozialen Netzwerken auseinander. Sie verweist auf psychische Folgen einer gestörten Wahrnehmung des eigenen Körpers als missgestaltet. Die in den Netzwerken sichtbare Flut optimierter Selbst-Fotos affiziere das Selbst- und Körperideal. Die in diesem Prozess entstehende Diskrepanz zwischen Ich, eigener Wirklichkeit des idealen Selbstbildes und der gegebenen Wirklichkeit verspricht der angebotene schönheitsmedizinische Eingriff zu überwinden. Eine mit der Annäherung des realen Körperbildes an das »Ich-Ideal« evozierte Steigerung des Selbstwertgefühls deutet Ada Borckenhagen als »narzisstischen Triumph« und erkennt darin fließende Grenzen zum Pathologischen.
Körperlichkeit und kulturelle Praktiken Menschen erleben sich nicht nur im unmittelbaren körperlichen Vollzug, sondern sie erleben auch mittelbar, wie andere erleben. Die so geschaffenen Beziehungen und Bezüge gewähren Orientierung über Bedeutungszuweisungen und Wertsetzungen, spezifische symbolische Figurationen. Diese vermitteln wiederum körperleibliche Erfahrung über Geschlechterdifferenzen, Fitnessdefinitionen, religiöse Normierungen etc. strukturieren das leib-körperliche Selbsterleben in einer »vermittelten Unmittelbarkeit« (Plessner)41 . Diese Beobachtung, dass unterschiedliche Weltzugänge eine unterschiedliche Gewichtung von Sinnesbereichen und körperlicher Erfahrung hervorbringen, dass selbst das eigene »leibliche« Dasein nicht überall auf den Körper bezogen wird, den man hat42 , lässt die Frage nach der Rolle körperlicher Erfahrung für kulturelle Praktiken sozialer Wirklichkeit in den Mittelpunkt treten. Und vice versa die kulturellen Praktiken, nicht zuletzt aus dem Feld der Kunst, nach ihrer Bedeutung für gesellschaftliche Gefühls- und Erlebenslagen befragen.
41 42
Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin, New York 1975 [1928], 321ff. Hauser-Schäublin, Brigitta (Hg.): Kulturelle Räume – räumliche Kultur: Zur Neubestimmung des Verhältnisses zweier fundamentaler Kategorien menschlicher Praxis, (Göttinger Studien zur Ethnologie; 10), Münster 2003.
21
22
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Barbara Sieferle nimmt in ihrem Aufsatz »Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten. Theoretische Positionen und die Methode der Teilnehmenden Beobachtung« die prominenten theoretischen Konzepte des »impliziten Wissens«, der »Körpertechniken« und des »Habitus« (Polanyi, Mauss, Bourdieu) zum Ausgangspunkt, um die körperliche Dimension sozialkultureller Handlungsvollzüge und die Rolle leibkörperlicher Erfahrungen von Welt aufzuzeigen. Der Methodologie für einen Zugang auf die nicht-sprachlich verfasste Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten kommt dabei besondere Aufmerksamkeit zu. Die theoretische Rahmung ihres qualitativ-empirischen Vorgehens führt zur Modifikation der Teilnehmenden Beobachtung, zur Dichten Teilnahme bzw. Teilnehmenden Erfahrung, die die Aneignung körperlicher Handlungs- und Erfahrungsmuster als Voraussetzung eines kulturwissenschaftlichen Verstehensprozesses erst ermöglicht. An zwei ganz unterschiedlichen Beispielen gesellschaftlicher Räume, einem Gefängnis für männlichen Strafvollzug und einer Pilgerwanderung, zeigt sie in einer dichten Beschreibung, wie einhergehende Annäherung an die feldspezifischen körperlichen Dimensionen, vor allem die nicht-sprachlich verfassten, wie das Unaussprechliche des Körpers in Beziehung zu im Feld geltenden Normen und Regeln steht. Gegenwärtig steuert der menschliche Körper unaufhaltsam auf einen Höhepunkt seiner Erweiterung mithilfe technischer Innovationen zu und befindet sich damit gleichzeitig an der Schwelle seines Ersatzes durch letzthin Maschinen, die den Platz des Körpers einnehmen und sich seiner entledigen können. Der Körper existiert somit in einem ambivalenten Zustand zwischen historischer Rückbesinnung und zukunftsweisendem Optimierungsbegehren, im dauernden Spannungsfeld von Anwesenheit und Abwesenheit. Der Beitrag von Sophie Schmidt und Rainer Wenrich erhält mit seiner Überschrift »Neukombinatoriken des menschlichen Körpers« einen programmatischen Titel, der die Klammer für das gestalterische Vorgehen der Künstlerin Sophie Schmidt beschreibt. In Form eines Gesprächs mit der Künstlerin wird ihr Zugang zum und Umgang mit dem Körper nachgezeichnet. In einer Zeit, in der der Körper um seine Präsenz inmitten der digitalen Transformation kämpft, indem er in unaufhörlichen Versuchen, analog, medial und vor allem digital seine Daseinsberechtigung propagiert, entwickelt Sophie Schmidt Prothesen, die auf die vorhandenen Defizite des Emotional-, Empathisch-, Weich- und Zartseins verweisen. Schmidts Körperdiagnose beschreibt ein zwischenmenschliches Dilemma, das es mithilfe künstlerisch-prothetischer Eingriffe und deren innovativer Kombinatoriken und Aktivierungen durch die Künstlerin zu beheben gilt. Unter der Überschrift »Oh look, bionic people!« präsentiert Carolin Ruther in ihrem Beitrag zur interdisziplinären Körper- und Gesundheitsforschung »kulturwissenschaftliche Perspektiven auf prothetisierte Körper«. An deren Inszenierung in der medialen Berichterstattung und Werbung als Human Enhancement verdeutlicht sie einen grundlegenden Vorstellungswandel vom Ersatzstück
KörperKreativitäten
Prothese als Mittel der Defizitkompensation hin zum hybriden Technofakt der Körperoptimierung und Körperleistungssteigerung und damit ein verändertes Verständnis von Körperlichkeit. Ihr ethnografischer Zugang auf alltägliche Körperpraxis und soziale Praxis der Prothesenanpassung verdeutlicht eine andere Wirklichkeit; er vermittelt die komplexen Verschränkungen und Beziehungen von leib-körperlicher Selbstwahrnehmung, gegebenem physischem Körper und medizintechnischem Artefakt. Neound leibphänomenologische Ansätze aufgreifend, kann Ruther »Formen leiblichen Verstehens« oder »Spüren der Verständigung« (Gugutzer) zwischen Prothesenträger/-in und vermittelnden/r Orthopädietechniker/-in als eine grundlegende Voraussetzung körperlich leiblicher Integration der Prothese, als Technogenes Embodiment beschreiben.
Neue Körper, Grenzen, Entgrenzungen Der anhaltende Fortgang von körperbezogenen konzeptionellen und technologischen Entwicklungen ist eng mit der Vorstellung von funktionaler Optimierung und Regenerierung des Körpers für ein besseres Leben mittels biologischer-technischer Körper-Fusion verbunden. Die materiell hergestellte Welt bedingt wiederum die Möglichkeitsräume jener selbstthematisierenden Vorstellungen (MeyerDrawe).43 So bedingen die tiefen, hochtechnisierten Eingriffe in den menschlichen Körper über Reproduktionsmedizinische Maßnahmen, Microchips, Microbots, oder Gentechniken bedingen auch neuartige liminale Beziehungen der Beteiligten zum Körper wie der Forschenden zu ihrem Gegenstand. Programme von Neuformungen oder Reformierungen des Körpers und auch von seiner Erweiterung, die über die Körperextensionen hinausreichen, bis hin zur Entledigung seiner selbst verweisen auf ein Bewusstsein, welches die Selbstauslegung Humanum überschreitet. Die inhaltlich-methodologische Perspektive in die Vergangenheit macht in der Distanz zum eigenen sinnlich praktischen, körperlichen Erleben und zu den Wissensbeständen der Anderen zu ihren Körpern erkennbar: »Der Körper ist das, was sich in der jeweiligen Situation als Körper zeigt« (Asmuth). In diesem Zusammenhang greift Nurhak Polat in ihrem Beitrag »Gelebte Verflechtungen: In-Vitro-Technologien, Körper, Körperpolitik« den Reproduktionskörper im Kontext eines medizinisch-technologischen Vorgangs auf. Sie stellt dabei mit praxisorientierter Perspektive die Veränderungen des Umgangs der Beteiligten, der behandelten Paare, der Mediziner/-innen und Pfleger/-innen, mit den Reproduktionskörpern in den Mittelpunkt. Am Beispiel von Fertilitätskliniken der 43
Meyer-Drawe, Käte: Leiblichkeit und Sozialität, München 1984.
23
24
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Türkei nimmt sie heterogene, dynamische Konfigurationen in den Blick. Sie zeichnet darin nach, wie die »gelebten« Körper (als ›Substanzen‹ und ›sites‹) in unterschiedlichen Stadien der reproduktionstechnischen Verfahren und des medizinischen Prozederes hervorgebracht, gemacht, wahrgenommen und erlebt werden. Dies geschieht im Zusammenhang mit tradierten Vorstellungen und in Abhängigkeit zu (bio)politischen Regulierungen, ethischen, säkularen wie religiös bestimmten Normierungen und Ideologien. Nurhak kann auf diese Weise einen Prozess gesellschaftlich-politischen Wandels beschreiben, in dem die manipulativ-invasive Reproduktion, als Artikulation einer künstlichen Körperpraxis zum Politikum erhoben, als ein Gemisch aus »populistisch-autoritären Pronatalismen, biopolitischer Gouvernementalität und neoliberaler Globalisierung« zu neuen KörperWirklichkeiten führt. Mathias Wirth eröffnet mit der metaphorischen Aussage »Körper sind keine Käfige?! Transhumanismus und ethische Fragen« die Diskussion um körperbezogene Konzepte und deren Korrelationen bzw. Parallelen zu christlicher Theologie und Ethik insbesondere des reformierten Christentums. Er greift dafür die transhumanistischen Entwürfe von Ray Kurzweil und Max Mose heraus, die technologisches Enhancement als »transitional human«, als quasi ›reformierte‹ Erweiterung körperlicher und kognitiver Grenzen des Menschen, als Überwindung bestehender biologischer (Körper)Grenzen projektieren. In der Verknüpfung von »somatoformen Kreativitäten« als Vorgängen der Selbstgestaltung mit fassbarer »Emanzipationshoffnung« (Reckwitz) oder Zukunftsfragen konturiert, erkennt Wirth Verknüpfungspunkte/Schnittstellen von christlich theologischen, ethisch-moralischen und körpertechnologischen Fragestellungen eines »futurologischen, bzw. eschatologischen Körperpositivismus«. Letztlich und gleichermaßen geht es um die Überwindung von Materialität als Zukunftshoffnung. Unter dem Titel »Körperliche Christen« korrigiert Christoph Asmuth die gängige, generalisierende Vorstellung vom körperfeindlichen Christentum. Mit Tertullians Konzept der körperlichen Seele als materielles Komplement des Körpers verweist er auf ein antikes, frühchristliches Körperbild, das hier argumentativ verdichtet auch in den zeitgenössischen Märtyrerberichten Polykarps, Pionius’ und Perpetuas in einem narrativen »körperlichen Horizont« aufscheint. Verletzlichkeit und Zerstörung des Körpers, Tod, Auferstehung und Erhöhung der Märtyrer und Märtyrerin vollziehen sich nicht über »körperlose Geistigkeit«, sondern über körperlichen Wandel, Verjüngung. »Hier werden Körper…«, wie Asmuth eingangs formuliert, »…konkret und kreativ.« Jenseits internalisierter Dichotomien von Leib und Seele, Körper und Geist vermittelt Asmuth auf diese Weise die situative Bedingtheit des Phänomens Körper. Vor dem historischen Hintergrund zeigt er, dass das Anknüpfen an die Unmittelbarkeit des Leiblichen nicht zwingend eine kritische, emanzipative und humane Auffassung des Menschen herstellt und im Gegenschluss nicht
KörperKreativitäten
unbedingt eine intellektuelle Metaphysik zur Verachtung und Herabwürdigung alles Körperlichen führt.
Literatur Amabile, Teresa M.: Creativity in Context. Update to The Social Psychology of Creativity, Oxford 1996. Bornemann, Stefan: Kooperation und Kollaboration. Das Kreative Feld als Weg zu innovativer Teamarbeit. Wiesbaden 2012. Bourdieu, Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a.M. 1974. Bourdieu, Pierre: Die männliche Herrschaft. In: Dölling, Irene/Krais, Beate (Hg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis.1997 Frankfurt a.M., 153-217. Bubner, Rüdiger: Ästhetische Erfahrung, Frankfurt a.M. 1989. Csordas, Thomas: Introduction: the Body as Representation and Being-in-the-world. In: Csordas, Thomas (Hg.): Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge u.a. 1994. Fischer-Nichte, Erica: Die Attraktivität als Modell in den Kulturwissenschaften, Tübingen 2004. Fluck, Winfried: Ästhetische Erfahrung und Identität. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 49 (2004) 9-28. Fluck, Winfried: California Blue. Amerikanisierung als Selbst-Amerikanisierung. In: Bechdolf, Ute/Johler, Reinhard/Tonn, Horst (Hg.): Amerikanisierung – Globalisierung. Transnationale Prozesse im europäischen Alltag, Trier 2007, 9-30. Freud, Sigmund: Das Ich und das Es. [1923] In: Gesammelte Werke XIII, London 1952, 246-255. Gallagher, Shaun: How the body shapes the mind. Oxford 2005. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2015. Guilford, J. P.: Creativity, American Psychologist 5 (1950) 444-450. Haraway, Donna: »Monströse Versprechen. Die Gender- und Technologie-Essays« Aus dem Englischen von Michael Haupt u.a., Hamburg 2017. Haraway, Donna: Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. In: Environmental Humanities 6 (2015) 159-165 https:// environmentalhumanities.org/arch/vol6/6.7.pdf (Letzter Zugriff: 31.07.2020) Haraway, Donna: Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980’s. In: Socialist Review 80 (1985) 65-108. Hauser-Schäublin, Brigitta (Hg.): Kulturelle Räume – räumliche Kultur: Zur Neubestimmung des Verhältnisses zweier fundamentaler Kategorien menschlicher Praxis, (Göttinger Studien zur Ethnologie 10), Münster 2003.
25
26
Angela Treiber und Rainer Wenrich
Koschorke, Albrecht/Frank, Thomas/Matala de Mazza, Ethel/Lüdemann, Susanne (Hg.): Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a.M. 2007. Krampen, Günther: Psychologie der Kreativität, Göttingen 2019. Kröner, Magdalena: Digital Bodies. Virtuelle Körper, politisches Embodiment und alternative Körperphantasmen. In: Kunstforum International Bd. 265 Digital. Virtuell. Posthuman? Neue Körper in der Kunst, 2019. https://www. kunstforum.de/artikel/digital-bodies/ (Letzter Zugriff: 31.07.2020) Löfgren, Orvar: »Celebrating Creativity: On the Slanting of Concept«. In: Liep, John (Hg.): Locating Cultural Creativity, London/Sterling, Virginia 2011, 81-90. Maase, Kaspar: Einleitung: Zur ästhetischen Erfahrung in der Gegenwart. In: Maase, Kaspar: Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart, Frankfurt a.M. – New York 2008, 9-26. Maase, Kaspar: Populärkulturforschung. Eine Einführung, Bielefeld 2019. Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, 10. Petrovic-Ziemer, Ljubinka: Mit Leib und Körper. Zur Korporalität in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik, Bielefeld 2011. Pfeifer, Rolf/Bongard, Josh: How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence, Cambridge MA 2006. Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin – New York 1928/1975. Puff, Melanie: Postmoderne & Hybridkultur, Wien 2004. Reckwitz, Andreas: Das Kreativitätsdispositiv und die sozialen Regime des Neuen. In: Rammert, Werner et al. (Hg.): Innovationsgesellschaft heute, Wiesbaden 2016, 133-153. Reckwitz, Andreas: Die Erfindung der Kreativität: zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin 6 2019. Reuter, Julia: Geschlecht und Körper. Studien zur Materialität und Inszenierung gesellschaftlicher Wirklichkeit, Bielefeld 2011. Scholtz, Christopher P.: Alltag mit künstlichen Wesen. Theologische Implikationen eines Lebensmittelsubjekts simulieren den Maschinen am Beispiel des Unterhaltungsroboters Aiibo, Göttingen 2008. Schuhmacher-Chilla, Doris: Körper – Leiblichkeit. (2013/2012) In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE: https://www.kubi-online.de/artikel/koerper-leiblichkeit (Letzter Zugriff: 31.07.2020) Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a.M. 1992. Shusterman, Richard: Leibliche Erfahrungen in Kunst und Lebensstil, Berlin 2005. Shusterman, Richard: Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art, Second Edition, Boston 1992.
KörperKreativitäten
Thomas, Tanja/Maier, Tanja: Körper. In: Hepp, Andreas/Krotz, Friedrich/Lingenberg, Swantje/Wimmer, Jeffrey (Hg.): Handbuch Cultural Studies und Medienanalyse, Wiesbaden 2015, 285-295. Virilio, Paul: Der negative Horizont. Bewegung – Geschwindigkeit – Beschleunigung (1984), München 1989. Virilio, Paul: Der rasende Stillstand, Frankfurt a.M. 1997. Welsch, Wolfgang: »Aktualität des Ästhetischen«, München 1993.
27
Körper-Politiken und symbolische Kommunikation
Entblößter und verhüllter Leib Inszenierungen von weiblicher Körperlichkeit in der mittelalterlichen Literatur Martina Feichtenschlager
1.
Der Körper in der mittelalterlichen Literatur
Die weltliche mittelalterliche Literatur bezieht sich aus der Sicht der Stände auf Vertreter des Adels, und zwar sowohl als Produzierende als auch als Rezipierende. Sie ist eine elitäre Kunstform. In der Literatur wie in der Kunst1 gilt: Die höfische Kultur des Mittelalters ist eine auf Repräsentation ausgelegte Kultur2 . Es geht also um Darstellungsformen und Repräsentationsmodi des mittelalterlichen Menschen – und hier wiederum genauer um die Inszenierung seines Körpers. Der folgende Beitrag widmet sich ausschließlich der Frage nach der Darstellung des weiblichen Körpers in der mittelalterlichen Literatur – und das hat nachvollziehbare Gründe: Zwar gibt es durchaus auch Beispiele für die detaillierte literarische Beschreibung von Männerkörpern, aber diejenige von Frauen ist weitaus häufiger, d.h. es gibt eine größere Vergleichsbasis. Die mittelalterliche Literatur ist heteronormativ ausgerichtet und wird von einem System getragen, das haupt-
1 2
Vgl. Eco, Umberto: Die Geschichte der Schönheit, München 2012. Ich verweise auf die Arbeiten des Historikers Gerd Althoff: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997. Ders.: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003. Vgl. einführend zum Thema außerdem: Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1997. Brunner, Karl: Kleine Kulturgeschichte des Mittelalters, München 2012, 13-55. Roloff, Hans-Gert: Der menschliche Körper in der älteren deutschen Literatur. In: Caemmerer, Christiane u.a. (Hg.): Hans-Gert Roloff. Kleine Schriften zur Literatur des 16. Jahrhunderts. Festgabe zum 70. Geburtstag. Chloe. Beihefte zum Daphnis, Amsterdam 2003, 11-28. Vgl. ferner: Bolens, Guillemette: The Style of Gestures. Embodiment and Cognition in Literary Narrative, Baltimore 2012. Ackermann, Christiane: Im Spannungsfeld von Ich und Körper. Subjektivität im Parzival Wolframs von Eschenbach und im Frauendienst Ulrichs von Liechtenstein, Köln 2009.
32
Martina Feichtenschlager
sächlich männliche Produzenten vorsieht. Der vornehmlich männliche Blick richtet sich also auf die Frau, und zwar als Objekt der heteronormativen Begierde3 . Aus kulturgeschichtlicher Perspektive lässt sich relativ eindeutig sagen, dass jene Konstellationen, die das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau behandeln, künstlerische Produkte sind, d.h. sie spiegeln keinesfalls direkt die mittelalterliche historische Realität wider. Aber: Sowohl auf das Selbstverständnis des höfischen Publikums als auch auf seine Erfahrungswerte sowie Erwartungshorizonte lässt sich schließen, denn sonst hätte diese Form der Literatur überhaupt keinen Anklang gefunden. Dass sie aber funktioniert hat, zeigen uns die vielfach überlieferten literarischen Zeugnisse. Die mittelalterliche Literatur wählt bei der Körperdarstellung sehr häufig das rhetorische Stilmittel der sogenannten descriptio a capite ad calcem4 : Der Beschreibung des Körpers von oben nach unten, also meist vom Kopfhaar ausgehend bis zu den Füßen. Außerdem werden bei der literarischen Körperdarstellung, vor allem der Inszenierung des weiblichen Leibs, meist einschlägige Motive und Topoi verwendet, wie etwa das Motiv der roten Lippen oder der weißen Haut. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass der weibliche Körper in der mittelalterlichen Kunst bekleidet ist. Dafür genügt ein Blick in prominente mittelalterliche Liederhandschriften – wie etwa den Codex Manesse. Die Miniaturen in dieser Handschrift zeigen häufig höfische Begegnungen zwischen Mann und Frau, wobei die Bekleidung und der Kopfputz recht dezidiert die gesellschaftliche Stellung und das soziale Prestige der dargestellten Figuren indizieren5 . Aber nicht nur Kleidung hat mit einer körperlichen Hülle zu tun, sondern auch Nacktheit – denn sie bedeutet in der mittelalterlichen Literatur das Zeigen des weiblichen Körpers im weißen Hemdchen6 . Die sprachlich-künstlerische Verknüpfung von Körper und Kleid bzw. von Haut und Hemd hat auch einen etymologischen Zusammenhang: Das althochdeutsche Wort hamo bedeutet so viel wie »Haut, Hülle und Bedeckung«, im Mittelhochdeutschen übersetzt man ham entsprechend mit »Haut, Hülle, Kleid«7 . Man muss also festhalten, dass es einen signifikanten 3 4
5
6 7
Vgl. dazu: Brunner: Kulturgeschichte, 50f. Art. descriptio, Sp. II, 549-553. In: Ueding, Gert (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik [=HWR]. Vgl. außerdem: Brüggen, Elke: swie ez ie kom, ir munt was rôt. Zur Handhabung der descriptio weiblicher Körperschönheit im Parzival Wolframs von Eschenbach. In: Andersen, Elizabeth/Bauschke-Hartung, Ricarda/Reuvekamp, Silvia (Hg.): Literarischer Stil. Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation, Berlin 2015, 391-411. Ich verweise exemplarisch auf die Darstellung Herrn Heinrichs von Stretlingen im Codex Manesse, cpg 848, fol. 70v. Online abrufbar unter: Online abrufbar unter: https://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/cpg848/0136/image. »Nur mit einem Hemd und ohne standesgemäße (Ober-)Kleidung galt man als ›nackt‹«. Brunner: Kulturgeschichte, 32. Art. ham. In: Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch [=Lexer] Bd. I, 1162; vgl. außerdem Art. hut. In: Lexer Bd. I, 1408-1409.
Entblößter und verhüllter Leib
sprachlichen Zusammenhang zwischen der Hülle des Körpers, der Haut, und seiner eigentlichen Bedeckung, dem Hemd oder Kleid, gibt8 .
2.
Körperperspektiven – Beispiele
Hartmann von Aue zählt zu den prominentesten Dichtern des Mittelalters und er war wohl ein Ministeriale9 , d.h. ständisch gesehen niederer Adel. Er begegnet uns nur in seinen erhaltenen dichterischen Zeugnissen, denn biografische Dokumente oder Urkunden sind nicht erhalten. Das ist für die mittelalterliche Literatur kein Einzelfall, sondern die Regel. Bekannt ist Hartmann von Aue vor allem für seine Artusromane Erec und Iwein10 : Beide begründen diese Gattung im deutschsprachigen Raum nach einem französischen Vorbild, nämlich Chrétiens de Troyes Erec et Enide und Yvain. Daneben sind uns aber noch andere dichterische Zeugnisse Hartmanns bekannt. Zu nennen sind neben der stets als Jugendwerk betitelten Klage auch der Arme Heinrich und die Legendenerzählung Gregorius. Außerdem ist Hartmann auch Minnesänger und daher Verfasser von Lyrik. Gerade aber seine erzählenden Werke haben Literaturgeschichte geschrieben, unter anderem deshalb, weil man literarhistorisch annehmen könnte, dass mit dem ersten Artusroman in deutscher Sprache (Erec, um 1180) auch die Fiktionalität in die volkssprachige Literatur eingezogen ist.11
2.1
Hartmanns maget im Armen Heinrich
Mein erstes Beispiel ist die Erzählung Der Arme Heinrich, die wohl um 1190 entstanden ist. Der Arme Heinrich ist in mehrerlei Hinsicht relevant für die Forschung: Er stellt z.B. einen der wenigen (und besonders frühen) Texte der Gattung ›Versnovelle‹ bzw. ›Versmaere‹ dar. Über die Quelle für die Erzählung, also woher der Stoff für den Armen Heinrich stammt, ist wenig bekannt und darüber ist daher viel spekuliert worden. Auch wenn man keine konkrete französische oder lateinische Quelle ausmachen kann, so lässt sich dennoch sagen, dass der Stoff biblische Anleihen nimmt, und zwar u.a. beim Buch Hiob. Außerdem trägt die Erzählung legendenhafte Züge, denn es geht um einen armen Sünder, der vom Aussatz geheilt wird.
8 9 10 11
Vgl. hierzu auch: Feichtenschlager, Martina: Entblößung und Verhüllung. Inszenierungen weiblicher Fragilität und Verletzbarkeit in der mittelalterlichen Literatur, Göttingen 2016. Cormeau, Christoph: Art. Hartmann von Aue. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon [=VL], Bd. 3, 500-520. Vgl. Pérennec, René/Schmid, Elisabeth (Hg.): Höfischer Roman in Vers und Prosa, Berlin – New York 2010. Vgl. Haug, Walter: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt 1985.
33
34
Martina Feichtenschlager
D.h. die Erzählung verschränkt geistliche und weltliche Themen, sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen profan ausgerichtetem höfischen Roman und geistlich motivierter Legendenerzählung, was die oben erwähnten Rezeptionserwartungen durchaus mitsteuert. Zum besseren Verständnis meines Beispiels möchte ich den Inhalt paraphrasieren: Heinrich ist ein junger Adeliger, der über materiellen Wohlstand und soziales Ansehen verfügt und alle ritterlichen Tugenden verkörpert bis er von Gott mit Aussatz gestraft wird. Er bereist alle medizinischen Zentren der Zeit, aber das einzige, was ihm helfen kann, so ein Arzt in Salerno, sei das Herzblut einer Jungfrau im heiratsfähigen Alter, die sich freiwillig für ihn opfere. Das Remedium scheint in weiter Ferne – mutlos kehrt er in die Heimat zurück. Dort erweist sich die Gesellschaft erbarmungslos und er wird vom sozialen Leben ausgeschlossen. In einem ihm gehörenden Meierhof findet er schließlich einen Rückzugsort. Die blutjunge Bauerstochter, die während der gesamten Geschichte namenlos bleibt, wird die Vertraute und Freundin Heinrichs. Ihr erzählt er auch vom einzigen Heilmittel, woraufhin sie bereit ist, sich für ihn zu opfern, und zwar um Gotteslohn. Beide reisen nach Salerno, wo in einer grausigen Operation das Herz des Mädchens entnommen werden soll. Heinrich bekehrt sich im letzten Moment und rettet das Mädchen so vor dem Tod, die sich allerdings um ihr ewiges Seelenheil betrogen fühlt, das sie durch das Opfer erlangt hätte. Die Erzählung endet schließlich mit der wundersamen Heilung Heinrichs auf der Rückreise und der anschließenden Heirat der beiden Protagonisten. Nun möchte ich besonders auf eine Szene gegen Ende des Versmaeres eingehen, in der das Mädchen in Salerno geopfert werden soll. Der Arzt und das Mädchen befinden sich allein in einem abgetrennten und eigens mit einem Operationstisch eingerichteten Raum. Der Arzt gibt konkrete Anweisungen zur Vorbereitung: er hiez die maget alzehant/abe ziehen diu cleit;/des was si vrô und gemeit,/si zarte diu cleider in der nât,/schiere stuont si âne wât/und wart nacket unde blôz;/si enschamte sich niht eins hâres grôz12 (Armer Heinrich, V 1190-1196). Zunächst möchte ich auf den Vorgang des Entkleidens verweisen, der eine Selbstentblößung ist. Das Mädchen zieht sich selbst aus bzw. vielmehr schält sie sich selbst aus ihrer Kleidung heraus. Abe ziehen, das bedeutet ›abziehen, herunterreißen‹, und es hat damit zu tun, dass das Mädchen in seine Kleidung eingenäht ist. Dem Akt haftet etwas Destruktives und Gewaltsames an, auch wenn das Mädchen nicht erschrickt: Sie ist froh und glücklich über den Vorgang und steht bald nacket unde blôz dar, wie es der Erzähler tautologisch ausdrückt. Die zweite zentrale
12
Text hier und im Folgenden zitiert nach: Hartmann von Aue: Gregorius. Der arme Heinrich. Iwein. Hg. u. übers. v. Volker Mertens, Frankfurt a.M. 2008. Der Herausgeber Volker Mertens übersetzt die Stelle wie folgt: [Er] ließ […] das Mädchen sogleich/die Kleider ausziehen;/darüber war sie froh und glücklich:/Sie riß die Kleider in der Naht auf,/gleich stand sie hüllenlos da,/nackt und bloß;/sie schämte sich nicht ein bißchen.
Entblößter und verhüllter Leib
Beobachtung betrifft die erzählerische Schilderung: Das Mädchen ist sich offenbar seiner Nacktheit bewusst, aber schämt sich eben dezidiert nicht dafür. Das Opfer, das sie zu geben bereit ist, bedeutet viel mehr als die Scham über die Nacktheit, die sich angesichts des Lohnes gar nicht auszubreiten vermag. Der Erzähler beschreibt weder Angst noch Scham des Opfers und stellt so die Opferbereitschaft und den unbedingten Willen des Mädchens heraus. Ich spreche übrigens von Mädchen, weil der Text die Frau als maget apostrophiert, was zwar etymologisch mit der neuhochdeutschen ›Magd‹ korrespondiert, aber als ›Mädchen‹ zu übersetzen ist. Damit stellt der Text auf lexikalischer Ebene die Jugend und Jungfräulichkeit der jungen Frau heraus. Der destruktive Akt des Kleiderzerreißens nimmt symbolisch die Öffnung des Leibes vorweg. So wie der Arzt gleich die ›Nähte‹ des Körpers, nämlich die Haut, aufreißen und öffnen wird, so behandelt das Mädchen die Hülle ihres Leibes, nämlich ihre Kleider. Es ist eine symbolische Engführung von Kleidung und Körper, die dem Text seine erotisch-destruktive Brisanz gibt. Von erotischer Nacktheit lässt sich in mehrfacher Hinsicht sprechen: Erstens wird das Mädchen zur sponsa christi, und zwar durch ihr Martyrium und die anschließende Vermählung mit Christus. Zweitens aber kodieren sowohl Heinrichs als auch die Aussagen des Arztes die Nacktheit des Mädchens durchaus erotisch: Der Arzt nennt sie gleich nachdem er sie vollständig entblößt erblickt hat, das schönste Wesen auf der Erde (V 1197-1200) und Heinrich bezeichnet sie als vil minneclich (V 1233). Obwohl der Arzt Mitleid bekommt (V 1201), steht dennoch die ärztliche Pflichterfüllung offenbar an oberster Stelle. Er lässt sie auf den Tisch steigen und bindet sie an, danach überprüft er das Operationsbesteck und stellt fest, dass das Messer nicht scharf genug ist für eine ›sanfte‹ Tötung. Als Rezipierende der Geschichte muss man mit dem Mädchen warten: Darauf, dass der Arzt einen Wetzstein zur Hand nimmt und damit sein offenbar stumpfes Tötungsinstrument ausgiebig zu schleifen beginnt. Draußen vor der Tür steht aber Heinrich und vernimmt das grausige Geräusch. Sofort hat auch er Erbarmen (aber eben offenbar erst nachdem er das Wetzgeräusch hört) und beschließt einzuschreiten. Er sucht ein Guckloch in der Wand, wodurch er das Mädchen nacket und gebunden auf dem Tisch erblickt, was eine Läuterung seines Selbst bewirkt. Er bekehrt sich und stellt fest, dass er ein falsches Ziel verfolgt hat. An die Tür schlagend will er Einlass und den Abbruch der Operation, was dann auch geschieht. Das Mädchen wird losgebunden und begreift, dass es nicht geopfert und somit auch keinen Märtyrertod sterben wird. Um den ersehnten Gotteslohn betrogen, beginnt sie gegen sich selbst zu wüten: si brach ir zuht und ir site,/si hete leides genuoc/zuo den brüsten si sich sluoc,/si zarte unde roufte sich./ir gebaerde wart sô jaemerlich,/daz si niemen haete gesehen,/im waere ze weinenne geschehen (Armer Heinrich, V 12884-1288, ergänzt in der zitierten Ausgabe durch Verse aus Hs. D). Die Darstellung, die für neuzeitliche Rezipierende befremdlich wirken mag, bleibt durchaus im konventionalisierten Bereich der mittel-
35
36
Martina Feichtenschlager
alterlichen weiblichen Trauergebärden13 . Das Leid der Frau wird vor allem in der Selbstdestruktion gestisch-szenisch realisiert. Vor allem die weibliche Brust, auf die eingeschlagen wird, steht öfters im Zentrum der Aggression. Auf lexikalischer Ebene zitiert die Szene wortwörtlich die vorhergehende Entkleidungsszene, indem sie die konjugierte Form (zarte) des schwachen Verbs zerren sowohl zur Beschreibung der aggressiven Entledigung des Kleides in der ersten besprochenen Szene als auch zur Darstellung der selbstdestruktiven Trauer in der zweiten Szene herangezogen wird. Darüber wird auch eine symbolische Verweisebene aufgemacht: Wie die aufgerissene Kleidung der ersten Szene die Öffnung des Leibes metaphorisch vorwegnimmt, so spielt die aggressiv-destruktive Behandlung des entblößten Körpers auf den gerade doch nicht zerstörten und geöffneten weiblichen Leib an. Auf einer Metaebene ließe sich von einem Musterfall der Übertragung sprechen: Die Perspektive des Protagonisten Heinrich, der geradezu teichoskopisch14 durch ein Loch in der Wand auf die entblößte Jungfrau blicken kann, wird verschoben und auch zur Perspektive des Publikums. Die Rezipierenden werden mit Heinrich zu den Augenzeugen der bevorstehenden Behandlung. Fast prophetisch nimmt Hartmann von Aue hier das Geschehen in den frühen ›Sektiones‹ des Andreas Vesal15 vorweg: Dieser gilt als Erfinder der Anatomie und hat in seinen öffentlichen ›Sektiones‹ Kapital aus dem Voyeurismus und der Neugier der Zuschauenden geschlagen, und zwar indem er Eintritt verlangte, um bei einer Leichenöffnung dabei zu sein. Natürlich sind diese viel späteren Ereignisse Anachronismen und für Hartmanns Zeit sind solche Leichenöffnungen nicht belegt. Dennoch zeugt die perspektivische Anlage der Szene vom Augensinn und der Augenlust des mittelalterlichen Publikums.
13
14
15
Vgl. Küsters, Urban: Klagefiguren. Vom höfischen Umgang mit der Trauer. In: Kaiser, Gert (Hg.): An den Grenzen höfischer Kultur. Anfechtungen der Lebensordnung in der deutschen Erzähldichtung des Mittelalters, München 1991, 9-75. Selbstverständlich ist der Begriff Teichoskopie in seiner Anwendung auf einen mittelalterlichen Text zu präzisieren und zu spezifizieren, weil er eigentlich in Zusammenhang mit dem Drama steht und dort eine besondere formale wie inhaltliche Bedeutung hat. Ich möchte den Begriff dennoch an dieser Stelle verwenden, weil er sich auf eine Schau bezieht, die durch eine Wand oder Mauer geschieht. Im Drama ist er häufig mit Anagnorisis und Peripetie verbunden: Beides, Erkenntnis und Umschlag der Handlung – wenn auch nicht der dramatischen –, stellt sich hier ebenfalls ein. Vgl. einführend: Kemp, Martin: Vesalius’s veracity. In: Nature 393 (1998) 421. Shotwell, R. Allen: Animals, Pictures, and Skeletons: Andreas Vesalius’s Reinvention of the Public Anatomy Lesson. In: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 71 (2006) 1-18. Toledo-Pereyra, Luis H.: De Humani Corporis Fabrica Surgical Revolution. In: Journal of Investigative Surgery 21 (2008) 232-236.
Entblößter und verhüllter Leib
2.2
Laudines Entblößung
Ob der Iwein Hartmanns von Aue kurz vor oder kurz nach dem Armen Heinrich entstanden ist, darüber gibt es in der Forschung keine Einigkeit. Im Moment gilt der Konsens, dass der Arme Heinrich kurz vor Hartmanns zweitem Artusroman Iwein entstanden ist. Besonders prägnant ist allerdings, dass sich beide Texte in zeitlicher Nähe zueinander befinden, weil das den Blick öffnet für die spezifische Form der Körperrepräsentation bei Hartmann von Aue – oder vielleicht noch viel genereller innerhalb von zentralen Texten, die ziemlich am Anfang des mittelalterlichen, deutschsprachigen Literaturkanons stehen. Der Protagonist Iwein hört, ich paraphrasiere die Geschichte, vom sogenannten Brunnenabenteuer seines Vetters Kalogrenant. Dieser erzählt, dass er durch das Begießen eines magischen Steins mit Wasser aus einer Quelle ein schweres Unwetter ausgelöst hat und zugleich den Zorn des Quellenbeschützers König Askalon auf sich gezogen hat. Er kann den Kampf nicht gewinnen und muss geschlagen, und zwar ohne Pferd und ohne Rüstung (also unehrenhaft) an den Artushof zurückkehren. Iwein beschließt sofort auszuziehen und das Abenteuer zu bestehen, zumal er dem Artushof zuvorkommen will (der ebenfalls auf der Suche nach aventiure dorthin will), um seinen Vetter zu rächen. Iwein findet alles so vor, wie es ihm Kalogrenant geschildert hat. Anders als sein Verwandter besteht er das Abenteuer allerdings und er verfolgt den schwer verwundeten Askalon in seine Heimatburg. Den Brunnenkönig erschlägt er und Iwein wird gefangen gesetzt. Durch die Hilfe der Kammerzofe Lunete kann er aber vor dem sicheren Tod gerettet werden. Er trifft dort auch auf die gerade durch ihn zur Witwe gewordene Laudine, in die er sich sofort verliebt und die mithilfe von Lunete auch seine Frau wird. Nach der Hochzeit bleibt Iwein allerdings nicht lange untätig und will auf Aventiurefahrt gehen. Laudine gewährt ihm eine bestimmte Frist, die Iwein glatt um mehrere Wochen versäumt. Als er sein Versäumnis bemerkt, kommt schon die Dienerin Lunete an, die ihn öffentlich schmäht und ihm den Ring Laudines abnimmt. Er ist höfisch geächtet und verfällt dem Wahnsinn. Um den Verstand gebracht und nackt hält er sich fortan im Wald auf, wo er durch die Gräfin von Narison mittels einer Zaubersalbe geheilt werden kann. Er hilft ihr gegen einen aufdringlichen Verehrer und wird zum ›Löwenritter‹. Inkognito, aber in Begleitung eines Löwen bestreitet Iwein fortan verschiedene gefährliche Abenteuer, die ihn schließlich wieder in Laudines Nähe führen. Er kann als Löwenritter erneut ihre Gunst gewinnen und der Text endet mit einer Versöhnung der Eheleute. Mein Beispiel bezieht sich auf den ersten Teil der Handlung, und zwar auf eine Situation, in der Iwein Laudine heimlich beobachtet. Es ist dies ein Schlüsselmoment, denn Iwein verliebt sich spontan in die Witwe seines Rivalen. Der Protagonist erblickt aus einem abgetrennten Raum heraus die Burgherrin, wie sie in einer Trauerprozession ihrem aufgebahrten Mann folgt:
37
38
Martina Feichtenschlager
Er sach zuo im gebâret tragen/den wirt den er dâ het erslagen./unde nâch der bâre gienc ein wîp,/daz er nie wîbes lîp/alsô schoenen gesach./vor jâmer si zebrach/ir hâr unde diu cleider./wan ezn dorfte nie wîbe leider/ze dirre werlde geschehen:/wande si muose tôten sehen/den aller liebesten man/den wîp ze liebe ie gewan/[…]/ez erzeigten ir gebaerde/ir herzen beswaerde/an dem lîbe unde an der stimme./von ir jâmers grimme/sô viel si ofte in unmaht:/der liehte tac wart ir ein naht./unde sô si wider ûf gesach/unde weder gehôrte unde ensprach,/sône sparten ir die hende/daz hâr noch daz gebende. (Iwein, V 1305-1330).16 Die Situation wird erzählt aus der Perspektive des Erzählers, der sich allerdings Iweins Blick bedient, was allein schon dadurch erkennbar wird, dass die Bahre Iwein entgegengetragen wird, d.h. in jene Richtung, in der sich der Protagonist befindet. Dahinter läuft Laudine, die für Iwein die schönste Frau ist, die er je erblickt hat. Die trauernde Laudine rauft sich die Haare, ein deutliches Trauersignal, das typisch für die höfische Epik ist und wahrscheinlich aus der zeitgenössischen Heldenepik stammt17 . Die Emotion der Trauer wird körperlich-szenisch ausagiert, sie wird am Leib der Figur sichtbar, weil sie inszeniert wird.18 Gerade an dieser Stelle erscheint mir der Begriff der Inszenierung besonders treffend, weil er das In-Szene-Setzen meint, in diesem Fall dasjenige einer Emotion. Die auf Repräsentation ausgelegte höfische Kultur des Mittelalters braucht einen szenischen Rahmen, um performativ ausverhandelt zu werden: Hier ist es das Agieren vor innertextlichem Publikum, vor der Trauergemeinde und schließlich auch vor den (heimlichen) Blicken Iweins. Über Laudines Gefühle für Askalon besteht kein Zweifel: Sie spielt nicht nur seine trauernde Witwe, sondern sie ist es auch. Der Erzähler bestätigt uns das. Aber – und das erscheint mir besonders prägnant – vor allem ihre Gebärden zeigen es: Sie sind Ausdruck der Trauer, jenes elementaren Gefühls, das Laudine auch szenisch-performativ ausagiert. Explizit erwähnt werden Körper und Stimme der Witwe, die zu emotionalen Ausdrucksflächen werden. Recht typisch für trauernde Frauen im Mittelalter ist, dass sie im Angesicht 16
17 18
Text hier und im Folgenden zitiert nach: Hartmann von Aue: Gregorius. Der arme Heinrich. Iwein. Hg. u. übers. v. Volker Mertens. Frankfurt a.M. 2008. Volker Mertens übersetzt wie folgt: Er sah, wie zu ihm her auf der Bahre/der Burgherr getragen wurde, den er erschlagen hatte./Hinter der Bahre ging eine Frau,/so schön, wie er/noch nie eine gesehen hatte./Vor Jammer zerraufte sie/ihr Haar und die Kleider./Keiner Frau konnte/Schlimmeres auf dieser Welt geschehen,/denn sie mußte/den allerliebsten Mann auf der Totenbahre sehen,/den eine Frau je geliebt hatte./[…]/Gebärden und Stimme/offenbarten deutlich/ihre Herzensqual./Vor schrecklichem Jammer/fiel sie wieder und wieder in Ohnmacht:/der helle Tag wurde ihr zur Nacht./Als sie wieder die Augen aufschlug/und nichts hörte oder sprach,/da verschonten ihre Hände/weder ihr Haar noch den Kopfputz. Vgl. Küsters: Trauergebären, 13. Vgl. Eming, Jutta: Emotion und Expression. Untersuchungen zu deutschen und französischen Liebes- und Abenteuerromanen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Berlin – New York 2006.
Entblößter und verhüllter Leib
des Todes ihres z.B. Ehemanns das Bewusstsein verlieren, so wie das Laudine auch hier geschieht. Sehr oft fällt sie in eine Ohnmacht, wenn sie erwacht, kann sie weder hören noch sehen – ist also taub und blind gegenüber den Wahrnehmungen des anwesenden Publikums. Sie rauft sich das Haar, reißt am Gebände bevor der Blick Iweins – und auch des Publikums – auf ihren entblößten Körper fällt: swâ ir der lîp blôzer schein,/dâ ersach si der herre Îwein:/dâ was ir hâr unde ir lîch/sô gar dem wunsche gelîch/daz im ir minne/verkêrten die sinne,/daz er sîn selbes vergaz/unde daz vil kûme versaz/sô si sich roufte unde sluoc (Iwein, V 1331-1339)19 . Dort, wo sie sich entblößt hat, wird ihr Körper sichtbar – für Iwein und das anwesende Publikum. Und diese zur Schau gestellten Stellen sind so hinreißend, dass Iwein sofort in eine Art Liebeswahn verfällt, die ihm wortwörtlich ›die Sinne verdrehen‹ und ihn sinngemäß selbstvergessen werden lassen. Liebe durch den Anblick der schönen Frau zu empfinden, das ist in der mittelalterlichen Literatur öfters der Fall. Es ist ein Motiv, das vor Hartmann von Aue auch z.B. im Eneasroman Heinrichs von Veldeke auftaucht. Auch das Auslösen eines Liebeswahns durch den Anblick des schönen Körpers ist konventionalisiert, ich komme später noch einmal darauf zurück. Ich möchte einige Punkte hervorheben: zunächst die Überlagerung von Gefühlswelten. Laudine wird von ihrer Trauer überwältigt20 und Iwein durch die Minne zu ihr, beides sind existenzielle menschliche Emotion, die durchaus nachvollziehbar sind21 . Etwas befremdlich, aber durchaus typisch für den höfischen Roman (es gibt genügend Beispiele: Herzeloyde im Parzival u.a.) ist das öffentliche zur Schau stellen und Sichtbarmachen von Gefühlen vor höfischem Publikum. Die Trauergesten Laudines sind Konvention und für den höfischen Roman durchaus typisch. Auch die Entstehung und der Ursprung von Iweins Liebesgefühlen – ja, auch die Unbedingtheit und Unabwendbarkeit dieser durchaus prekären Leidenschaft – ist konventionalisiert. Ich möchte außerdem die sehr spezifische Konstellation der heimlichen Schau herausstellen. Der männliche Blick fällt auf den weiblichen, entblößten Leib, der in diesem Moment zur Schaufläche wird. Die Situation ist ähnlich codiert wie im Armen Heinrich: Der nackte Frauenleib löst eine starke (und existenzielle) Empfindung aus (z.B. Liebe, Mitleid, Begehren) und führt zum Handlungsfortgang. Iwein möchte am liebsten sofort eingreifen und die Dame vor der weiteren Selbstverletzung schützen, genauso wie Heinrich seine Freundin vor der weiteren Behandlung (und damit eben auch vor dem Tod) schützen will. Die
19
20 21
Herr Iwein sah,/daß ihr bloßer Körper sichtbar wurde:/so vollkommen schön,/daß ihm die Reize/den Kopf verdrehten,/so daß er selbstvergessen/kaum sitzenbleiben konnte,/als sie sich raufte und schlug. Vgl. hierzu: Koch, Elke: Trauer und Identität. Inszenierungen von Emotionen in der deutschen Literatur des Mittelalters. Berlin – New York 2006. Vgl. Kasten, Ingrid/Jaeger, Stephen C. (Hg.): Codierungen von Emotionen im Mittelalter. Berlin – New York 2003.
39
40
Martina Feichtenschlager
Handlungsweise der dargestellten Frauenfiguren ist ähnlich: Beide agieren Emotionen am eigenen Leib aus, der noch dazu entblößt ist. Er wird zur Ausstellungsund Repräsentationsfläche, zur Möglichkeit der Inszenierung in einem performativen Setting, das die öffentliche Darstellung und Repräsentation fordert. Das Mittelalter, so lässt sich festhalten, ist drastisch und eindrücklich in seinen bildlichen Darstellungsverfahren. Lexikalisch lässt die Beschreibung keinen Zweifel zu, dass es sich um eine Entblößung handelt (vgl. nacket unde blôz, blôzer lîp usw.). Man kann aber festhalten, dass es ein spezifisches Muster gibt, jedenfalls bei Hartmann von Aue, wonach der weibliche entblößte Körper aus der männlichen Perspektive geschildert wird, was genderspezifische Implikationen aufweist. Beide Darstellungen lösen auch auf ihre Weise Begehren im Betrachter aus (und ich verwende hier absichtlich die männliche Form).
3.
Ausblick und Schluss
Ich möchte schließlich gerne noch einen Blick auf die Darstellung und Inszenierung der kaum bekleideten oder unverhüllten Frau in der mittelalterlichen Lyrik werfen. Hierzu habe ich ein Beispiel aus dem Oeuvre eines der bekanntesten mittelhochdeutschen Minnesänger ausgewählt. Es handelt sich um das Lied Si wunder wol gemachet wîp Walthers von der Vogelweide. Das Lied ist ein Frauenpreis und handelt in fünf Strophen von der Verehrung einer Dame. Ich möchte hier nur die dritte (nach anderen Überlieferungen die fünfte) Strophe behandeln, weil sie die adelige Dame in einer Badesituation zeigt: Ir kel, ir hende, ietweder fuoz,/daz ist ze wunsche wol getân./ob ich dâ enzwischen loben muoz,/ich waene, ich mê beschowet hân./ich hete ungerne »decke blôz!«/geruofet, dô ich si nackent sach./si sach mich niht, swie si mich schôz,/daz mich noch stichet als ez stach,/swanne ich der lieben stat/gedenke, dâ si reine ûz einem bade trat.22 Abermals handelt es sich innertextlich um eine Situation heimlicher Schau. Die Frau bemerkt ihren Beobachter nicht, als sie aus dem Bad heraussteigt. Doch von vorne: Der Sänger, das Ich im Text, fängt seine Beschreibung beim Hals (ir kel) an 22
Zitiert nach: Walther von der Vogelweide: Werke. Bd. 2: Liedlyrik. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hg., übers.u. komm. v. Günther Schweikle, Stuttgart 2006. Ich übernehme die Übersetzung von Günther Schweikle: Ihr Hals, ihre Hände, jeder Fuß,/das alles ist vollkommen wohlgeschaffen./Wenn ich dazwischen etwas loben soll, – ich glaube, daß ich mehr erblickt habe./Ich hätte ungern »bedecke die Blöße!«/gerufen, als ich sie nackt sah./Sie sah mich nicht, wiewohl sie mich anschoß,/daß es mich noch heute sticht – wie es damals stach –,/wann immer ich an die liebe Stätte/denke, wo sie rein aus dem Bade trat.
Entblößter und verhüllter Leib
und blickt dann abwärts auf die Hände und Füße – alles sei ganz und gar schön anzusehen. Die Beschreibung folgt damit dem Muster der oben bereits erwähnten descriptio a capite ad calcem, also der rhetorischen Körperbeschreibung vom Kopf bis zu den Füßen, von oben nach unten. Auch das, was sich zwischen diesen Körperbereichen bzw. zwischen Händen und Füßen als Extremitäten befindet, sei lobenswert, aber das Ich spare eine genaue Beschreibung davon aus. Fast wie im Traum spricht er davon, dass er mê beschowet habe, also mehr als diese erwähnten Körperteile gesehen habe. Die Situation der heimlichen Schau auf die unverdeckte Nacktheit der Figur bereitet dem Ich Vergnügen: Es wird der Frau niemals zugerufen, dass sie sich (anstandshalber) bedecken solle. Der Anstand ist insofern gewahrt als die Dame ja nichts von ihrem heimlichen Beobachter weiß, si sach mich niht, heißt es im Text. Nach mittelalterlicher Vorstellung entsteht die Liebe, indem sie wie ein Pfeil ins Auge des Betrachters geht und vom Auge direkt zum Herzen (als Sitz der Gefühle) führt23 . Dies nimmt natürlich Anleihen bei der antiken Vorstellung Amors oder Cupidos, der mit Pfeilen bewaffnet Liebesgefühle auslösen kann. Dieses Innere ist es auch, was das Text-Ich quält, immer noch denke er an den Ort zurück, wo er seine Angebetete nackt aus dem Bad steigen sah. Ein Gefühl, das immer noch nachwirkt. Die heimliche Schau ist gepaart mit unverhohlenen erotischen Absichten. Die Augenlust wird zur Augenliebe, weil das Subjekt durch die Schau zum Liebenden wird, und zwar über die Metapher der Verwundung durch das geliebte Objekt. Der Frau, die eigentlich passiv ist, weil sie ein angeschautes Objekt ist, wird eine aktive Rolle zugestanden, indem sie für die Entstehung der Liebe des Sängers verantwortlich erscheint. Das Beispiel stellt keine rudimentäre Beschreibung von körperlicher Schönheit dar, sondern suggeriert ein ›Näheverhältnis‹. Der Sänger erscheint als lustvoll Blickender, der aus seiner Position heraus einen exklusiven Blick auf die exponierte nackte Schönheit der Frau bekommt. Die Intimität und Nähe zwischen Sänger und Dame invertiert das Distanzverhältnis zur geliebten frouwe im sogenannten hohen sanc, wo eine solche Situation undenkbar und unangemessen erscheint. Ich versuche ein kurzes Resümee meiner Analyse, um möglicherweise eine übergreifende These zu forcieren: Meine Textbeispiele sind solche, die den unverhüllten, eben nackten weiblichen Leib zeigen. Lexikalisch wird das ausgedrückt durch die Verwendung des Adjektivs nacket oder blôz, die durchaus als Synonyme eingesetzt werden. Der männliche Betrachter, der den nackten weiblichen Leib erblickt, ist in einer versteckten und verdeckten Position: Er sieht die Dame heimlich
23
Vgl. hierzu z.B. bildliche Darstellungen in den Liederhandschriften des Mittelalters, die zugleich Rezeptionszeugnisse dieses Minneentstehungsmodells sind, etwa das Autorenporträt von Herrn Wachsmut von Mühlhausen im Codex Manesse (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/ diglit/cpg848/0362/scroll).
41
42
Martina Feichtenschlager
an. Meine Überlegungen gehen dahin, dass die Inszenierung der weiblichen Nacktheit einzig durch den Moment der heimlichen Schau gerechtfertigt werden kann oder jedenfalls dann, wenn emotionale, erotische Implikationen mit der Schau verbunden sind. Der männliche Blick ist keiner, der emotionslos oder teilnahmslos auf das weibliche Objekt blickte, sondern er ist ein begehrender, ein übergreifender Blick, der auch Dominanz ausübt, nämlich jener des Text-Ichs über die weibliche Figur. Das weibliche Objekt ist blind und taub (wie es im Iwein heißt) bzw. wird dem nicht gewahr, dass es zum angeschauten und begehrten Objekt wird (wie im Armen Heinrich oder Walthers Minnelied). Nacktheit, so scheint es, ist auch in der mittelalterlichen Darstellung von erotisch-amourösen Begehrlichkeiten überlagert. Damit ist das Mittelalter eine Epoche des unverstellten Zeigens und unverhohlenen Begehrens, der Augenlust und der Augenliebe.
Literatur Primärliteratur Hartmann von Aue: Gregorius. Der arme Heinrich. Iwein. Hg. u. übers. v. Volker Mertens, Frankfurt a.M. 2008. Walther von der Vogelweide: Werke. Bd. 2: Liedlyrik. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hg., übers.u. komm. v. Günther Schweikle, Stuttgart 2006.
Forschungsliteratur Ackermann, Christiane: Im Spannungsfeld von Ich und Körper. Subjektivität im Parzival Wolframs von Eschenbach und im Frauendienst Ulrichs von Liechtenstein, Köln 2009. Althoff, Gerd: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997. Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003. Bolens, Guillemette: The Style of Gestures. Embodiment and Cognition in Literary Narrative, Baltimore 2012. Brüggen, Elke: swie ez ie kom, ir munt was rôt. Zur Handhabung der descriptio weiblicher Körperschönheit im Parzival Wolframs von Eschenbach. In: Andersen, Elizabeth/Bauschke-Hartung, Ricarda/Reuvekamp, Silvia (Hg.): Literarischer Stil. Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation, Berlin 2015, 391-411. Brunner, Karl: Kleine Kulturgeschichte des Mittelalters, München 2012. Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1997. Eco, Umberto: Die Geschichte der Schönheit, München 2012.
Entblößter und verhüllter Leib
Eming, Jutta: Emotion und Expression. Untersuchungen zu deutschen und französischen Liebes- und Abenteuerromanen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Berlin – New York 2006. Feichtenschlager, Martina: Entblößung und Verhüllung. Inszenierungen weiblicher Fragilität und Verletzbarkeit in der mittelalterlichen Literatur, Göttingen 2016. Haug, Walter: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt 1985. Kasten, Ingrid/Jaeger, Stephen C. (Hg.): Codierungen von Emotionen im Mittelalter. Berlin – New York 2003. Kemp, Martin: Vesalius’s veracity. In: Nature 393 (1998) 421. Koch, Elke: Trauer und Identität. Inszenierungen von Emotionen in der deutschen Literatur des Mittelalters. Berlin – New York 2006. Küsters, Urban: Klagefiguren. Vom höfischen Umgang mit der Trauer. In: Kaiser, Gert (Hg.): An den Grenzen höfischer Kultur. Anfechtungen der Lebensordnung in der deutschen Erzähldichtung des Mittelalters, München 1991, 9-75. Pérennec, René/Schmid, Elisabeth (Hg.): Höfischer Roman in Vers und Prosa, Berlin – New York 2010. Roloff, Hans-Gert: Der menschliche Körper in der älteren deutschen Literatur. In: Caemmerer, Christiane u.a. (Hg.): Hans-Gert Roloff. Kleine Schriften zur Literatur des 16. Jahrhunderts. Festgabe zum 70. Geburtstag. Chloe. Beihefte zum Daphnis, Amsterdam 2003, 11-28. Shotwell, R. Allen: Animals, Pictures, and Skeletons: Andreas Vesalius’s Reinvention of the Public Anatomy Lesson. In: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 71 (2006) 1-18. Toledo-Pereyra, Luis H.: De Humani Corporis Fabrica Surgical Revolution. In: Journal of Investigative Surgery 21 (2008) 232-236.
Lexika Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch [=Lexer], zugleich als Supplement und alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke. 3 Bände, Leipzig 1872-1878. Die deutsche Literatur des Mittelalters [=Verfasserlexikon]. Hg. u. begr. von Wolfgang Stammler. 2., völlig neu bearbeitete Auflage, hg. von Gundolf Keil, Kurt Ruh, Werner Schröder, Burghart Wachinger und Franz Josef Worstbrock. 14 Bde, Berlin – New York 2010. Ueding, Gert (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik [=HWR], 10 Bde, Berlin 2012.
43
44
Martina Feichtenschlager
Digitalisat Codex Manesse Universitätsbibliothek Heidelberg, online abrufbar unter: https:// digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.
Das Zittern der Macht Zur Aktualität politischer Körpermetaphorik Rainer Guldin
Im Sommer 2019 hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei öffentlichen Auftritten drei aufsehenerregende Zitterattacken. Am 18. Juni bei einem offiziellen Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenski in Deutschland, beginnt Merkel, während die deutsche Nationalhymne gespielt wird, über fast zwanzig Sekunden hinweg zu zittern. Als erste Erklärung gibt sie an, sie habe wohl zu wenig Wasser getrunken. Am Morgen des 27. Juni, während der Vereidigung der neuen Bundesjustizministerin Christina Lambrecht in Berlin, passiert es erneut. Der Regierungssprecher sagt kurz darauf, der Kanzlerin gehe es gut. Am 10. Juli beim Empfang von Finnlands neuem Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin geschieht es zum dritten Mal. Merkels mehrfaches Zittern führte zu verschiedenen Spekulationen und Erklärungsversuchen in den Medien, vor allem weil das ganzkörperliche Phänomen kein einmaliges Ereignis und weitgehend rätselhaft blieb. Eine Woche vor dem dritten Anfall publizierte Hans-Ulrich Jörges in einer Kolumne des Sterns einen Kommentar unter dem prägnanten Titel »Das Zittern der Macht«. »Die Kanzlerin ist krank«, schrieb er dort. »Seit dem zweiten überaus verstörenden Zitteranfall binnen weniger Tage muss angenommen werden: Da ist etwas. Mehr als sie zugeben möchte. Ernst jedenfalls, womöglich von Dauer und vorerst rätselhaft. Das ändert alles, Angela Merkels persönliche Lage wie die Perspektiven der ohnehin torkelnden Koalition. Und damit Europa und die Weltpolitik. Merkels Zittern ist auch ein Zittern der Macht, ein dickes rotes Ausrufezeichen hinter den Krisenberichten aus der deutschen Hauptstadt.«1 Jörges’ Diagnose erweitert die destabilisierenden Auswirkungen, die Merkels Zittern wellenartig auszulösen scheint, von ihrer persönlichen Situation, über die schwankende und wankende Berliner Koalition und die zerstrittene Europäische Union bis hin zur gesamten Weltpolitik. Gerade in Zeiten der Wirrnis und allgemeinen Zerrüttung sowohl in der deutschen als auch der amerikanischen und damit der internationalen politischen Szene muss Merkels plötzliches körperliches Versagen verunsichern. 1
Jörges, Hans-Ulrich: Das Zittern der Macht. In: Stern, 3.7.2019.
46
Rainer Guldin
Merkels Zittern ist umso beunruhigender als sie über Jahre hinweg in der medialen Öffentlichkeit für Stabilität und Ausgewogenheit einstehen musste. Auch in diesem Zusammenhang spielte ihr Körper eine Rolle. Die Merkel-Raute bezeichnet eine Haltung, bei der Daumen und Zeigefinger der vor den Bauch gehaltenen Hände sich an den Spitzen berühren und dabei eine Rhomben ähnliche Form annehmen. Die Merkel-Raute »soll Besonnenheit ausdrücken und die Fähigkeit, die Dinge zusammenzuführen.«2 In den Medien ist die Merkel-Raute vor allem im Bereich der non-verbalen Kommunikation diskutiert worden. Als in sich geschlossene kreisförmige Geste der Vermittlung und Versöhnung artikuliert die Raute implizit aber auch ein unausgesprochenes politisches Versprechen von Ausgleich und Stabilität. Merkel hat die symbolische Bedeutung dieser Haltung, vielleicht auch mit Absicht, heruntergespielt und darauf verwiesen, dass die Wuppertaler Fotografin Claudia Kempf ihr diese Handhaltung bei einem Fotoshooting für das Magazin Stern vor der Bundestagswahl 2002 empfohlen habe. Wenn man davon ausgeht, dass ein Staatsoberhaupt nicht nur einen privaten, sondern immer auch einen öffentlichen Körper besitzt, den man metaphorisch mit demjenigen des Staates eines bestimmten Landes gleichsetzen kann, nehmen sowohl Merkels Zittern als auch der Einsatz der Raute eine kollektive Dimension an. Jörges’ Gespür für die Symbolik des unheilbringenden geheimnisvollen Zitterns geht eindeutig in diese Richtung.3 Im Folgenden möchte ich einen kurzen Überblick über die europäische4 Tradition des politischen Körpers geben, der einen anderen Blick auf Merkels Raute und ihr Zittern ermöglicht. Ich möchte dabei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Aspekte der Körpermetapher in politischen Diskursen diskutieren und zeigen, wie frühe Konzeptionen des politischen Körpers aus der griechischen, römischen und jüdisch-christlichen Tradition, über das Mittelalter, die frühe Neuzeit und die Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart hineinreichen. In dieser Tradition geht es auch immer wieder um Gefahren und Bedrohungen, denen der politische Köper stets ausgesetzt ist: Pluralisierung, Zerrüttung der inneren Struktur, das Unabhängigkeitsstreben einzelner Körperteile, und die Subversion der Körperhierarchie. Mit der französischen Revolution verschwindet zwar die Metapher des politischen Körpers weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein, nimmt dabei
2 3
4
Jungholt, Thorsten: Wo die Merkel-Raute den Tod bringt. In: Die Welt, 15.09.2013. Vgl. dazu Bebermeier, Johannes: Die zwei Körper der Angela Merkel. In: t-online.de, 10.7.2019, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_86074988/angelamerkels-dritter-zitteranfall-die-zwei-koerper-der-kanzlerin.html. Bebermeier geht explizit auf diesen Zusammenhang ein. Zu einem vergleichbaren metaphorischen Gebrauch des politischen Körpers im antiken China vergleiche Chun-chieh Huang: The ›body politic‹ in ancient China. In: Acta Orientalia Vilnensia 8 (2007) H. 2, 36-40.
Das Zittern der Macht
aber bloß andere, verwandte Formen an, zum Beispiel in der Topographie europäischer Parlamente, die an den symbolischen Gegensatz von Kopf und Körper erinnert. Anhand einiger Beispiele aus der Gegenwart möchte ich zum Schluss zeigen, dass die Metapher noch aktiv ist, auch wenn sie oft nur noch implizit mitgedacht oder in verkürzter Form verwendet wird. So kommt dem Aussehen und Gesundheitszustand des privaten Körpers eines Staatsoberhaupts noch immer politische Bedeutung zu.5 Darüber hinaus findet die Tradition der königlichen Effigies, welche zusammen mit der Leiche des Königs zu Grabe getragen wurde, ihre Weiterführung in Madame Tussauds Wachfiguren Kabinett, das lebende und verstorbene Politiker neben anderen Berühmtheiten aus dem öffentlichen Leben auftreten lässt. Kollektive Metaphern, besonders solche mit einer jahrhundertelangen vielschichten Tradition, haben es in sich. Sie wirken weiter, auch wenn sie nicht mehr als solche bewusst wahrgenommen werden. Unter Umständen wird ihre Wirkung dadurch vielleicht sogar noch verstärkt. Politische Bewusstseinsbildung beinhaltet, meiner Meinung nach auch immer eine kritische Aufarbeitung unbewusster Denkmuster, die sich oft mit Vorliebe in der bildhaften Sprache der Metaphern verstecken und unsere Wahrnehmung der Realität insgeheim steuern.
1.
Körpermetaphern
Metaphern kommen meist dann zum Einsatz, wenn ein Realitätsausschnitt aufgrund seiner Komplexität schwer erfassbar und einem Verständnis nicht unmittelbar zugänglich ist. Gesellschaft, Staat und Nation sind äußerst komplexe und vielschichtige Gebilde, die sich einem auf Anschaulichkeit basierenden Zugang verschließen und durch eine rein begriffliche Beschreibung nicht zufriedenstellend erfasst werden können. In diesem Zusammenhang bietet sich die Metapher des Körpers als mögliches Interpretationsmodell an.6 Wie Ulrich Haltern festhält, liegt
5
6
In der europäischen Tradition des politischen Körpers ist immer der gesunde, wohlfunktionierende Leib das Vorbild. Es wäre zu untersuchen, inwiefern auch der schwache gepeinigte Körper kollektive politische Bedeutung annehmen kann, beispielsweise der gelähmte Wolfgang Schäuble, der 1990 bei einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen wurde und seither auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Für diesen Hinweis danke ich Michael Winklmann. Vgl. dazu Guldin, Rainer: Körpermetaphern. Zum Verhältnis von Politik und Medizin, Würzburg 2000 und Koschorke, Albrecht, Frank, Thomas, Matala de Mazza, Ethel u.a.: Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a.M. 2007 und Matala de Mazza, Ethel: Der verfasste Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft in der Politischen Romantik, Freiburg i.Br. 1999.
47
48
Rainer Guldin
»ein guter Teil der Beharrlichkeit der Körpermetapher […] in ihrer unübersetzbaren Anschaulichkeit.«7 Metaphern sind nicht bloßes Ornament, wie es eine rhetorische Tradition will, die auf Aristoteles und Quintillian zurückgeht. Im Anschluss an das Werk von Max Black8 und die Schriften von George Lakoff und Mark Johnson9 kann man Metaphern als Modelle und Sinnprojektionen verstehen. In Fall von Körpermetaphern wird der menschliche Körper als Ganzes und/oder in seinen einzelnen Bestandteilen und Attributen auf den Staat und dessen Komponenten übertragen. Bei diesem Vorgang werden immer gewisse Aspekte besonders hervorgehoben und andere verborgen. In diesem Sinne haben Metaphern erkenntnistheoretisch betrachtet sowohl Vorteile als auch Nachteile. Körpermetaphern definieren in vielfacher Hinsicht unsere Wahrnehmung der Welt. Man findet sie in den verschiedensten Zusammenhängen. So spricht man zum Beispiel von einem Stuhlbein oder der Mündung eines Flusses. Körpermetaphern werden dabei nicht nur wegen ihres Modellcharakters eingesetzt, sondern vor allem auch, weil Körpern eine Natürlichkeit zugesprochen wird, die auf täglicher Erfahrungen beruht. Wir leben in und mit unserem Körper und glauben daher die metaphorische Verwendung eines Körpers unmittelbar nachvollziehen zu können. Diese angebliche Natürlichkeit des menschlichen Körpers verleiht der Metapher Legitimität und Glaubwürdigkeit, verhindert aber zugleich die Wahrnehmung ihrer Konstruiertheit. Die falsche Evidenz des Natürlichen und Unmittelbaren von Körpermetaphern stellt eine Gefahr dar, besonders wenn das Bild des Körpers für politischen Zwecke missbraucht wird. Politische Körpermetaphern tendieren dazu, soziale Gegebenheiten als naturgegeben darzustellen. Jede und jeder hat im politischen Körper einen einzigen ihm/ihr zugeordneten Platz. In diesem Sinne haben politische Körpermetaphern meistens eine ideologische machtkonservierende Funktion. Bei politischen Körpermetaphern werden verschiedene Aspekte eines Körpers auf entsprechende Momente einer Gesellschaft projiziert. Der Unterschied zwischen Kopf, Herz und Unterleib kann zum Beispiel zur Erklärung einer hierarchischen Gesellschaft herangezogen werden, oder der Blutkreislauf zur Beschreibung der Kommunikationswege einer Stadt. Körpermetaphern finden sich in den verschiedensten kulturellen und historischen Zusammenhängen. Dabei ist es im Grunde genommen aber nie einfach der Körper, sondern immer eine ganz bestimmte kulturelle und historisch kodierte Vorstellung, von dem was ein Körper eigentlich ist oder sein soll, die auf ein gesellschaftliches Gebilde übertragen wird. Der Blutkreislauf wurde zum Beispiel erst im frühen 17. Jahrhundert von William Har-
7 8 9
Haltern, Ulrich: Obamas politischer Körper, Berlin 2009, 37. Black, Max: Models and Metaphors, Ithaca (N.Y) 1962. Lakoff George und Johnson, Mark: Metaphors we Live by, Chicago 2003.
Das Zittern der Macht
vey beschrieben und spielte deswegen in der frühen Verwendung der politischen Körpermetapher keine Rolle. Wie Lakoff und Johnson festhalten, ist die Erfahrung mit greifbaren und manipulierbaren physischen Gegenständen neben der Vorstellung von Verkörperung eine weitere wichtige Grundlage für die Wahrnehmung der Welt. Ontologische Metaphern greifen auf dieses Moment zurück und führen dazu, Erfahrungen im Sinne von Entitäten und Substanzen wahrzunehmen, als »discrete entities or substances of a uniform kind.« Diese kommen auch dann zur Anwendung, wenn die zu beschreibenden Realitätsausschnitte sich einer einfachen Kategorisierung und eindeutigen Festlegung widersetzen. »When things are not clearly discrete or bounded, we still categorize them as such […].«10 Dies gilt nicht nur für Staaten und Nationen, sondern auch für Sprachen, deren Grenzen sich in der Regel nicht eindeutig und unmissverständlich definieren lassen.11 Als Sinncontainer betonen ontologische Metaphern vor allem Ganzheit und Begrenztheit. Dies gilt auch für die Metapher des menschlichen Körpers. Die imaginäre ideologische Ganzheitsstiftung, die durch die politische Körpermetapher zustande gebracht wird ist dabei besonders wirkungsmächtig. Dies ist aber, wie noch zu zeigen sein wird, nur eine mögliche Anwendung der Metapher. Politische Körpermetaphern sind prinzipiell mehrdeutig. So zeigen die folgenden Beispiele, dass sie den unterschiedlichsten politischen Programmen dienen können. Sie können sowohl soziale und politische Ungleichheiten legitimieren, als auch ein utopisches Ideal der allgemeinen Versöhnung artikulieren oder eine soziale und politische Gegenwelt versinnbildlichen.
2.
Die europäische Tradition des politischen Körpers
In der Politeia (IV: 434cf.) entwirft Plato ein organisches Modell der polis, das im Timaios (68d-72e) sein körperliches Fundament erhält.12 Die hierarchische Aufteilung der Seele bringt eine ebenso gestaltete Aufteilung des Körpers hervor. So wie die Seele despotisch über den Körper herrscht, herrschen die oberen Körperteile und die damit verbundenen sozialen Klassen über die unteren. Platos Isomorphie von Körper, Individuum und Staat begründet dabei eine Anthropologie der Differenz, die dem höheren, gebildeten Teil der Gesellschaft die Macht über die subalternen, ungebildeten Teile zuspricht.
10 11 12
Lakoff , und Johnson: Metaphors, 25. Vgl. dazu Guldin, Rainer: Metaphors of Multilingualism. Changing Attitudes towards Language Diversity in Literature, Linguistics and Philosophy, New York – London 2020. Vgl. dazu auch Guldin: Körpermetaphern, 46-48.
49
50
Rainer Guldin
Die Vierteilung der polis verbindet die Herrscher und Philosophen mit der Vernunft, der Weisheit und der Tugend, deren Sitz im Gehirn ist. Der Hals trennt den sterblichen vom unsterblichen Teil der Seele und die Vernunft von den irrationalen Teilen der Sinneswahrnehmung, die im Herz ihren Sitz haben. Durch den Hals kann die Vernunft kühlend auf die kriegerische Hitze der Brustregion einwirken. Hier sind die Krieger und Wächter angesiedelt, deren Mut und Tapferkeit für das Überleben des gesamten politischen Körpers sorgen. Der oberste Teil leitet den Staat durch Einsicht und Erkenntnis, der mittlere verteidigt ihn durch Furchtlosigkeit und Kühnheit. Das Herz wacht über den inneren Frieden und wirkt mahnend auf den Rest des Körpers ein. Durch die Blutgefäße kann es seinen Einfluss auf alle anderen Teile des Körpers ausdehnen und dadurch die einzelnen Körperfunktionen miteinander versöhnen, damit die Ordnung wieder hergestellt wird, wenn sie durch Aufstände des untersten animalischen Teils der Seele aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Das Diaphragma trennt den oberen männlichen vom unteren weiblichen Teil des Körpers, zu dem auch die Sklaven gehören. Oberhalb des Nabels wird der Sitz der dritten Seele angenommen, die den Bauern, Handwerkern, und Kaufleute, dem Begehren und der Unvernunft entspricht. Unterhalb des Nabels, dem heilenden Einfluss der Vernunft entzogen, wird ein vierter Seelenteil angenommen, welcher der Sitz von Lust und Sexualität ist. Im Gegensatz zum platonischen Modell wird im nächsten Beispiel, das aus der römischen Historiographie stammt, nicht der Kopf, sondern der Magen als Machtzentrum des politischen Körpers bestimmt. Dieser steht nicht für das Begehren des dritten Seelenteils, sondern für die herrschende Klasse selbst, die sich dem Vorwurf des Parasitismus stellen muss. 1494 vor Christus verließen die Plebejer Rom und zogen auf den Mons Sacer, um gegen ihre ungerechte Behandlung durch die Patrizier zu protestieren. Der Senat schickte den Konsul Agrippa Menenius Lanatus aus, um sie zu überzeugen, wieder zurückzukehren. Dies gelang ihm, so Titus Livius in Ab urbe condita (2, 32-33), dadurch dass er eine Parabel erzählte. In Wirklichkeit wurde der Streik abgebrochen, weil man den Plebejern deutliche politische Zugeständnisse gemacht hatte.13 Die verschiedenen Körperteile waren darüber empört, »dass alles durch ihre Sorge, ihre Mühe und ihren Dienst für den Magen zusammengesucht werde, der Magen aber in der Mitte ruhig nichts anderes als die gegebenen Freuden genieße. Darauf hätten sie sich verschworen, dass die Hände nicht die Speisen zum Mund führen und weder der Mund das gegebene annehme noch die Zähne es zerkauten. Während sie den Magen […] zähmen wollten, litten die Glieder selbst zusammen mit den Magen und der ganze Körper […] unter der äußersten Entkräftung. Deshalb sei deutlich geworden, dass die Tätigkeit auch des Magens nicht träge sei und 13
Vgl. Hale, David G.: Intestine sedition: the fable of the belly. In: Comparative Literary Studies 5 (1968) 377-388.
Das Zittern der Macht
er nicht mehr ernährt werde, als dieser sich selbst ernähre, wobei er in alle Teile des Körpers das Blut, von dem wir leben und stark werden, das gleichmäßig in Adern verteilt sei und dass mit vertrauter Speise angereichert sei, als Gegenleistung abgebe.«14 Das dritte Beispiel, stammt aus dem Neuen Testament und eröffnet eine ganz andere, utopische Dimension der politischen Körpermetapher. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther (1.Kor 12,12-31) werden die grundlegende Einheit der Christengemeinde und die gleichzeitige Differenz der einzelnen Mitglieder in der Metapher des Körpers und seiner Glieder dargestellt.15 Es gibt verschiedene Gaben und Ämter, aber immer nur einen Geist und einen Herrn, der alles durchwirkt. Einer besitzt Weisheit, ein anderer hat die Gabe, gesund zu machen, und wieder ein anderer tut Wunder. »Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper! Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht; oder andersherum betrachtet: Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle […] sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen, und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem.« In dieser Vision, ist jeder einzelne Teil wichtig, auch weil alle einem einzigen Oberhaupt untergeordnet sind. Anders als bei Platon und Titus Livius steht die Vielfalt und Verschiedenheit der Gaben für ebenso viele individuelle Talente, die letztlich alle Christus unterworfen sind. Paulus’ Beschreibung verbindet mit den einzelnen Körperteilen deshalb auch keine klar umrissenen sozialen Gruppierungen. Diese umfassende egalitäre Vision hat auch im Denken Abraham Lincolns und Barack Obamas, auf die ich noch zu sprechen komme, ihre Spuren hinterlassen. »Wenn das Ohr behaupten würde: Weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper! würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn?« Im Gegensatz zum Platonischen Modell, welches zwischen Griechen und Sklaven, Männern und Frauen in einem klar hierarchischen Sinne unterscheidet, umfasst der Leib der christlichen Gemeinde »Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie«, die alle gleichberechtigt nebeneinander agieren. »Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen; vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit, und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude.« Der wohl einflussreichste Text in der historiographischen Diskussion des politischen Körpers in der europäischen Tradition ist Ernst Kantorowicz’, Die zwei
14 15
Titus Livius: Römische Geschichte, München und Zürich 1987, 233f. Vgl. dazu auch Matala de Mazza: Der verfasste Körper, 193-203.
51
52
Rainer Guldin
Körper des Königs16 . Wie Kristin Marek treffend festhält, eröffnete dieses Werk ein neues ideengeschichtliches Paradigma.17 Die zentrale Passage, die Kantorowicz zu Beginn zitiert und im Laufe des Buches in einer »kreisförmigen Denkbewegung, vom 16. Jahrhundert in die Zeit um 1100 gehend und wieder ins 16. Jahrhundert zurückkommend«18 auf ihre Ursprünge und Auswirkungen untersucht, stammt vom Londoner Tudor Juristen Edmund Plowden.19 Dieser formulierte um die Mitte des 16. Jahrhunderts die folgenträchtige Vision der »doppelten Verfasstheit des Königskörpers«20 . Liest man diese Passage in Hinblick auf Angela Merkels Zittern nimmt sie eine erstaunliche Aktualität an. »Denn der König hat in sich zwei Körper, nämlich den natürlichen (body natural) und den politischen (body politic). Sein natürlicher Körper ist für sich betrachtet ein sterblicher Körper, der allen Anfechtungen ausgesetzt ist, die sich aus der Natur oder aus Unfällen ergeben, dem Schwachsinn der frühen Kindheit oder des Alters oder ähnlichen Defekten, die in den natürlichen Körpern anderen Menschen vorkommen. Dagegen ist der politische Körper ein Körper, den man nicht sehen oder anfassen kann. Er besteht aus Politik und Regierung, er ist für die Lenkung des Volkes und das öffentliche Wohl da. Dieser Körper ist völlig frei von Krankheit und Alter, ebenso von den anderen Mängeln und Schwächen, denen der natürliche Körper unterliegt. Aus diesem Grunde kann nichts, was der König in seiner politische Leiblichkeit tut, durch einen Defekt seines natürlichen Leibes ungültig gemacht werden […].«21 . In einem kürzlich erschienenen Buch hat Kristin Marek den zwei repräsentativen, öffentlich wirksamen Körpern des Königs aus Kantorowicz’ Buch, dem politischen und dem natürlichen, einen dritten, heiligen zur Seite gestellt.22 Ihr Ausgangspunkt ist dabei die Effigies23 , die vom frühen 14. bis zum frühen 17. Jahrhundert, zuerst in England und dann ab 1422 auch in Frankreich in der königlichen Funeralzeremonie verwendet wurde. Zum ersten Mal wurde diese Ende Dezember 1327 bei der Beerdigung des abgesetzten und ermordeten englischen Königs Eduard II. eingesetzt. Die Effigies wurde mit dem Leichnam des Königs zu Grabe getragen, zuerst auf dessen Sarg, dann getrennt davon. Es handelte sich dabei um
16 17 18 19 20 21 22 23
Kantorowicz, Ernst H.: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, München 1990. Siehe auch Marin, Louis: Le portrait du roi, Paris 1981. Marek, Kristin: Die Körper des Königs, München 2009, 99. Vgl. dazu auch 99-133. Ebd., 104. Ebd., 103. Ebd., 104. Zitiert nach Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs, 31. Marek: Die Körper des Königs, 17. Kantorowicz hatte die Effigies im Sinne der beiden Körper des Königs gedeutet. Als Materialisation, welche die Idee einer »doppelten somatischen Verfasstheit der Monarchie« bestätigte (ebd., 76). An dieser Interpretation des Effigiengebrauchs wurde an fast allen darauffolgenden Publikationen festgehalten.
Das Zittern der Macht
eine ganzkörperliche, puppenartige Figur, die detailgenau, lebensgroß und mit königlichen Gewändern bekleidet wurde. Die spätmittelalterliche Einführung der Effigies ins englische Totenzeremoniell koinzidierte zeitlich mit der von Marc Bloch24 untersuchten Bestimmung des Königs als wundertätiger Heiler.25 Die Beisetzung war »Teil eines machstrategischen Überschreibungsprojekts, welcher das Bild des Königs als schlechten Regenten negierte und statt dessen den abgesetzten König als national verehrter Heiligen etablierte.« Es »wurde ein dritter repräsentativer Körper des Königs, der heilige Körper des Königs ausgespielt […].«26
3.
Inneres Zerwürfnis, Zerstückelung, Hinrichtung
Die Einheit und Einheitlichkeit des politischen Körpers ist verschiedenen zersetzenden Gefahren ausgesetzt. Einzelne Körperteile können zugleich die Herrschaft anstreben, sich zum Schaden des Ganzen vervielfältigen oder von innen her die Ordnung subvertieren. Zugleich kann die körperliche Fragmentierung in eine neue Ordnung überführen, dadurch dass sie einen anderen politischen Körper ins Leben ruft. Wie der Französische Historiker Jacques Le Goff27 ausführt, wurde das Körpermodell der Antike, das primär auf der Triade Kopf/Bauch/Glieder beruhte, im Mittelalter durch das Oppositionspaar Kopf/Herz abgelöst. Wie zuvor schon hervorgehoben, ging es auch in der christlichen Version des politischen Körpers vor allem um den Gegensatz von Kopf und Körper. Innerhalb dieses Deutungsrahmens wurde der Papst als Oberhaupt der Kirche und Vertreter Christi auf Erden konsequenterweise als Kopf des politischen Körpers verstanden. Da zwei Köpfe eine Unmöglichkeit und grundsätzliche Gefahr darstellen, entwickelten, im Laufe der Auseinandersetzungen zwischen den kaiserlichen und kirchlichen Kräften, die Partisanen des Königs eine elegante Lösung, die die Einheit des politischen Körpers nicht bedrohte oder gar sprengte, sondern eine Kohabitation zweier leiblicher Prinzipien zuließ. Die Rolle des Papstes als Kopf des politischen Körpers wurde nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern durch ein zweites, lebensnotwendiges Zentrum ergänzt. Diesem wurde aber in einem zweiten Moment die Vorherrschaft zugesprochen.
24 25 26 27
Vgl. Bloch, Marc: Die wundertätigen Könige, München 1998. Marek: Die Körper des Königs, 145-9. Ebd.,131. Vgl. dazu Le Goff, Jacques: Head or Heart? The Political Use of Body Metaphors in the Middle Ages, in: Feher, Michel/Naddaff Ramona/Tazi, Nadia (Hg.): Fragments for a History of the Human Body (Part Three), New York 1990, 13-26.
53
54
Rainer Guldin
Le Goff erwähnt in diesem Zusammenhang den anonymen Traktat Rex Pacificus aus dem Jahr 1302.28 Der Mikrokosmos der Gesellschaft verfügt über zwei Hauptorgane, den Kopf und das Herz. Der Papst ist der Kopf, der den Gliedern den richtigen Glauben vermittelt. Dieser gelangt vom Kopf ausgehend durch die einzelnen Nervenbahnen – die hierarchische Struktur der Kirche – in den gesamten Körper. Der Prinz hingegen ist das Herz, von dem Gesetze und Anordnungen, d.h. die Gerechtigkeit ausgehen. Diese ist das Blut des politischen Körpers, das vom Herzen ausgehend von den Venen in alle Teile des Leibes transportiert wird. Der angebliche Parallelismus von Nerven und Venen, Glauben und Gerechtigkeit wird zum Schluss aufgegeben. Das Blut ist das Lebenselement per excellence, deshalb sind die Venen letztlich wertvoller als die Nerven und damit auch der König dem Papst überlegen. Die Tatsache, dass sich im Fötus das Herz vor dem Gehirn entwickelte, wird als ein weiterer Beleg für die Vorherrschaft des Königs gedeutet. Eine Gefahr für die angestrebte Ganzheitlichkeit des politischen Körpers ist die Pluralisierung eines spezifischen Körperteils. In der Regel ist es der Kopf, wobei vielköpfige, schlangenähnliche Ungeheuer der griechischen Mythologie wie die Hydra oder imaginäre mehrköpfige Drachen wohl eine Rolle gespielt haben müssen. Der wohlgeformte politische Körper besitzt nur ein einziges zentrales Kommandosystem. Wenn sich die führende Funktion des Hauptes plötzlich aufspaltet und die einzelnen Köpfe miteinander in Konflikt geraten, weil jeder etwas anderes und sich gegen alle anderen durchsetzen will, versinkt die Gesellschaft im Chaos. Zwei Beispiele aus dem 17. Jahrhundert sollen dies verdeutlichen. Auf einem niederländischen Kupferstich aus dem Jahr 1618, das den Titel Warminiaen trägt, ist ein Körper abgebildet, der insgesamt fünf Köpfe besitzt, die einem überdimensioniert langen, schlangenartigen Halsfortsatz aufsitzen (Abb. 1). Der mittlere Kopf schaut nicht geradeaus, wie zu erwarten wäre. Das Gesicht ist abgewandt und auf dem Hinterkopf ist eine Maske angebracht. Hinzu kommen zwei Tierköpfe, der eines Hundes und eines Schweines. Das multiple zusammengesetzte Wesen tritt die Unschuld, den Frieden und die Justiz mit den Füßen. Der kräftige Körper des eigenartigen, mehrköpfigen Wesens verbirgt die zwei Beine eines Vogels. Möglicherwiese ist es ein kopfloser Strauß, der ja gemäß der Redensart bei Bedrohung den Kopf in den Sand steckt. So stellt die Allegorie zugleich ein Zuviel und ein Zuwenig dar. Zerstrittenheit und Kopflosigkeit. In diesem Falle diente die Körpermetapher der satirischen Verunglimpfung einer feindlichen religiösen Faktion.29 Ein vergleichbares fast zeitgleiches Beispiel ist ein englischer
28 29
Ebd., 21. Die Warminiaer sind Adepten des reformierten Theologen Jacobus Arminius (1560-1609), der Begründer des Arminianismus. Diese religiöse Bewegung geriet zu Beginn des 17. Jahrhunderts in eine Auseinandersetzung mit den Calvinisten, die sich am Ende durchsetzten.
Das Zittern der Macht
Abbildung 1: Warminiaen, anonym (1618)
Rijksmuseum Amsterdam, public domain
Holzschnitt aus dem Jahr 1643, auf dem sich drei Schlangenhälse in die Höhe recken. Daran hängen traubenartig unzählige kleine Köpfe. Auf der linken Seite sind es papistische Unruhestifter und auf der rechten bösartige Verschwörer. Es ist dies der puritanische Albtraum eines konspirativen papistischen Komplotts, der von der Spitze her den politischen Körper zersetzt (Abb. 2). Der politische Körper ist dauernd der Möglichkeit innerer Subversion ausgesetzt. Aus diesem Grund sind die höheren Seelenanteile des platonischen Staates aufgerufen, über die anarchischen Kräfte der subalternen Körperteile zu wachen. Diese hierarchische Vision unterschlägt allerdings die Tatsache, dass das Aufbe-
55
56
Rainer Guldin
Abbildung 2: Papist Conspirators, London (1643)
Science Photo Library/British Library
gehren der unteren Leibesregionen auch als eine politisch und sozial legitime Gegenstrategie betrachtet werden kann, wie die nächsten beiden Beispiele aufzeigen. Der russische Literaturwissenschaftler und Kunsttheoretiker Michail Bachtin30 entwirft eine Körpervision, welche die hier skizzierte Tradition des politischen Körpers in Frage stellt und auf vielfache Art und Weise durchkreuzt. Dadurch skizziert er das Bild einer utopischen unhierarchischen Gemeinschaft. Der kollektive groteske Körper des Karnevals ist nicht ein in sich geschlossener wohlorganisierter Leib, sondern ein doppelter und sich ständig erneuernder, auf der Grenze von Leben und Tod, dessen Leben sich vor allem an den Körpergrenzen abspielt. Dieser Körper ist von zentrifugalen Kräften belebt, die sich gegen den zentripetalen Druck der oberen Körperbereiche wenden. Die einzelnen Körperteile versuchen immer wieder ihren angestammten Platz zu verlassen und über die Grenzen des Leibes hinauszugelangen. Dadurch dass die oberen und die unteren Organe ihren Platz austauschen, wird die Hierarchie des politischen Körpers subvertiert. Im grotesken Körper des Karnevals ist weder der Kopf noch das Herz das Zentrum, sondern der Bauch und die Gedärme, Sitz der subalternen Klassen im platonischen Modell.
30
Bachtin, Michail: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt a.M. 1995.
Das Zittern der Macht
Diese sind nun das Zentrum der Körpertopographie und »der Ort, wo oben und unten ineinander übergehen.«31 Bachtin weist auf die grundsätzliche Ambivalenz der körperlichen Zerstückelung hin, die in der dynamischen Welt des Karnevals der steten Erneuerung und Wiederbelebung des kollektiven Körpers dient.32 Ein treffendes Beispiel dafür findet sich in einer anonymen Broschüre, die am 23. April 1789 im Vorfeld der Französischen Revolution und aus deren politischen Perspektive einer radikalen sozialen Erneuerung verfasst wurde.33 Darin wird die Geschichte eines sanftmütigen Riesen erzählt. Fort-par-les-bras, was so viel heißt wie, der mit den starken Armen, und seine beiden Brüder, der tapfere Paladin und der betörende Enchanteur sind dem fruchtbaren Schoß Frankreichs entsprungen. Die drei Brüder stellen den dritten Stand, beziehungsweise den Adel und den Klerus dar. Fort-par-les-bras besitzt zwar einen gesunden und kräftigen Köper, aber sein Kopf ist außerordentlich klein, was auf seine intellektuelle Begrenztheit hinweisen soll. Es dauert nicht lange, bis zwischen ihm und seinen beiden Brüdern ein erbarmungsloser Kampf entbrennt. In dessen Verlauf wachsen die Köpfe von Paladin und Enchanteur zusammen und bilden ein monströses Doppelhaupt. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, zerteilt Fort-par-les-bras die widernatürlichen siamesischen Zwillinge bis zur Taille in zwei Hälften und schneidet die immer noch ineinander verschlungenen Oberkörper vom unteren Teil des Körpers ab. Während der Doppelkopf wie ein Heißluftballon davonschwebt, zerfallen die zwei zurückbleibenden unteren Körperhälften in ein loses Bündel von winzigen, männlichen und weiblichen Riesen, die völlig nackt und hilflos sind, als wären sie noch Kinder.34 Nacktheit und kindliche Hilflosigkeit stehen hier für die politische Widergeburt und den radikalen Bruch mit der Vergangenheit. Die unzähligen Wesen öffnen die Augen und strecken Fort-par-les-bras ihre kleinen Arme entgegen, als wollten sie ihn küssen und mit ihm zu einem einzigen Körper verschmelzen. Der zertrennende Schlag hat sie endlich zum Leben erweckt und von der Herrschaft des oberen Körperteils befreit. 31 32
33 34
Ebd. 203. Zur Ambivalenz von körperlicher Zerstückelung vgl. Wenner, Stefanie: Ganzer oder zerstückelter Körper. Über die Reversibilität von Körperbildern. In: Benthien, Claudia/Wulf, Christoph (Hg.): Körperteile. Eine Kulturelle Anatomie, Hamburg 2001, 361-380. Zur politischen Dimension von Körperzerstückelung siehe Guldin, Rainer: The Dis-membered Body: Bodily Fragmentation as a Metaphor of Political Renewal. In : Physis. Revista de Saúde Coletiva 12 (2002) H. 2, 221-234. Vgl. De Baecque, Antoine : Le corps de l’histoire. Métaphores et Politique (1770-1800), Paris 1993. »Ces deux parties étaient composées d’un faisceau de petits géants, mâles et femelles, tous nus, tous maigres, tous bambins, presque sans force et sans mouvement. Et peu à peu il vit leurs paupières s’entrouvrir, leu cœur palpiter, leurs petits pieds affermir; et ils étendaient leurs petits bras vers lui, comme pour l’embrasser et ne plus former avec lui qu’une seule et unique réunion« (ebd., 132-134).
57
58
Rainer Guldin
Der letzte Abschnitt der Geschichte ist eine zutreffende Illustration des Prinzips der repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Fort-par-les-bras, immer noch verblüfft über den unerwarteten Erfolg seiner militärischen Fähigkeiten, wird auf wundersame Weise von einer Vision erfüllt, die spontan in seinem Gehirn auftaucht. Er wendet sich dem Stimmengewirr zu und weiß nun plötzlich, dass es seine Aufgabe sein wird zum Sprachrohr ihrer aller zu werden. Die vielen zappelnden kleinen Riesen werden fortan durch seinen Mund sprechen. Überwältigt von diesem Gefühl nimmt sie der gutmütige Riese alle in seine Arme und drückt sie zärtlich an sein Herz. Die zahllosen kleinen Körper sind nicht mehr gefügige Teile eines hierarchisch organisierten Ganzen, sondern gleichberechtigte Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft, die alle danach streben, mit ihrem größeren Gegenüber und Befreier eins zu werden. Das Frontispiz von Hobbes Leviathan, auf das ich im Folgenden noch näher zu sprechen komme35 , könnte möglicherweise als Vorbild gedient haben. Hier findet man dieselbe Kombination aus einem einzigen größeren umfassenden Körper, der eine Vielzahl kleinerer Körper in sich enthält, die sich ihm alle zuwenden. Die ursprüngliche Dreiteilung ist zwar durch eine Vision der Gleichheit und Einheitlichkeit überwunden worden, aber der Gegensatz zwischen dem Kompositkörper der vielen kleinen Riesen und dem vereinheitlichenden Körper von Fort-par-les-bras, der zu ihrem Sprachrohr wird, bleibt bestehen. Dieser signifikante Unterschied spielt, wie ich in den folgenden Überlegungen noch zeigen möchte, eine wichtige Rolle, gerade in Hinblick auf verborgene Kontinuitäten zwischen dem politischen Körper des Ancien Régime und den neuen demokratischen Parlamenten. Krankheiten und innere Wirren können den politischen Körper schwächen und destabilisieren, dafür gibt es aber passende Heilmittel. Selbst das Ableben des Souveräns und die immer wieder drohende Gefahr eines königsglosen Interregnums wurden durch die hochritualisierten zeremoniellen Abfolgen seiner Beerdigung und die Vorstellung eines doppelten und dreifachen Königskörpers aufgefangen. Viel gefährlicher für die behauptete Einheit des politischen Körpers ist das Spektakel der öffentlichen Enthauptung des Königs, wie es 1649 bei Karl I. und 1793 bei Ludwig XIV. der Fall war. Im Gegensatz zur Situation in England, wo der Monarch auch nach der Enthauptung ein Symbol für den Kopf der organischen Körpereinheit des body politic lieferte, galt im vorrevolutionären Frankreich der natürliche und der politische Körper als eine untrennbare Einheit. Die öffentliche Hinrichtung des Französischen Königs stellte deshalb einen weitaus radikaleren Bruch mit der Vergangenheit dar. Der Tod des Königs hinterließ hier ein Vakuum, das nach einer völlig neuen symbolischen Ergänzung verlangte. Diese Rolle übernahm die Idee der Nation, die als
35
Vgl. dazu Marek: Die Körper des Königs, 83-87.
Das Zittern der Macht
Körper und noch allgemeiner als Organismus wahrgenommen wurde. Damit einher ging auch der Wille, fortan auf Bilder, vor allem auf traditionellen Körpermetaphern zu verzichten. Moderne politische Theorien und Philosophien sind gegen jegliche Verkörperungsmechanismen gerichtet. Mit der Liquidierung des absoluten Monarchen und seiner öffentlichen Enthauptung durch die Guillotine, war die Vorstellung eines absoluten Monarchen obsolet geworden. »Es gibt keinen Körper der Republik«, schreibt Michel Foucault«, »nie funktioniert sie wie der Körper des Königs unter der Monarchie.«36 Wie ich im Folgenden aber zeigen möchte, bedeutete das Aufkommen der bürgerlichen Demokratie nicht die ultimative Entkörperung der Macht und das Ende aller Verkörperungsmechanismen.
4.
Nachleben
Wie Philip Manow37 festhält, ist der Körper des Politischen auch in den modernen Demokratien noch nicht erledigt. Die vorschnelle These, dass die Demokratie keine Bilder kenne oder brauche, muss daher zurückgewiesen werden. Manow spricht von »Erinnerungsspuren der Monarchie« und wie Kristin Marek38 von einem »Nachleben«39 der Vorstellung des politischen Körpers. Die behauptete Unmöglichkeit symbolischer Repräsentation und Bilderlosigkeit demokratischer Institutionen ist nicht nur falsch, sondern verbirgt auch die Tatsache, dass die Symbolisierungen der früheren Herrschaftsform weiterwirken und die verleugnete Idee des politischen Körpers, wenn auch in abgewandelter Form, überlebt hat. Wie Manow überzeugend nachweist, stehen die neuen demokratischen Parlamente »in einer unmittelbaren legitimatorischen Kontinuitätslinie zu dem gerade abgelösten Herrschaftsregime.« In diesem Sinne wird das »vorhandene Reservoir an Symbolen, Ideen, Metaphern«40 weiterhin genutzt und in die neue politische Situation übertragen. Der Übergang von der königlichen Macht auf das Parlament – der eigentliche Legitimitätstransfer – vollzieht sich schon mit Thomas Hobbes’ Leviathan (Abb. 3).41 Die Trennung in einen unsterblichen, stofflosen und einen zeitlichen, stofflichen Körper des Königs, wie sie Plowden formulierte hatte, legte zugleich auch die Grundlage für die Möglichkeit, gegen monarchische Macht aufzubegehren, um
36 37 38 39 40 41
Foucault, Michel: Macht und Körper. In: Dits et Écrits. Schriften, 4 Bde. Frankfurt a.M. 2002, 933. Manow, Philip: Im Schatten des Königs: Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation, Frankfurt a.M. 2008. Marek: Die Körper des Königs, 269. Manow: Im Schatten des Königs, 56. Ebd., 55. Ebd., 37-41.
59
60
Rainer Guldin
Abbildung 3: Frontispiz des Leviathan (1651)
gemeinfrei
das durch ihn repräsentierte Prinzip zu schützen. »To fight the king to defend the king«, war dabei die Devise. Der durch die Enthauptung von Karl I. eingeleitete Bruch führte Hobbes dazu, einen neuen unversehrten zusammengesetzten politischen Körper zu imaginieren, der sich auf die frühere Anordnung der ständischen Parlamente bezog. Der Zusammenhang zwischen dem Körper des Leviathans und der parlamentarischen Repräsentation politischer Herrschaft besteht in einer Reihe von Ent-
Das Zittern der Macht
sprechungen. Das Schwert und der Bischofsstab, der commonwealth civil bzw. der commonwealth ecclesiastical, welche die überdimensionierte Figur auf dem Frontispiz in den Händen hält, entsprechen im unteren Teil der militärischen Festung auf der rechten Seite, und der Kirche auf der linken. Der Kopf und die beiden Arme der Figur werden durch einen dritten Teil ergänzt. Die Stadt am unteren Bildrand, der »Rumpf des Hobbesschen Leviathans zwischen Festung und Kirche […] ermöglicht es, das Bild auch als Versinnbildlichung jenes dreigliedringen PriesterKrieger-Bürger-Gesellschaftsbaus des Mittelalters zu lesen, der neben dem Klerus und dem zu militärischen Diensten verpflichteten Adel eben auch das in den Städten lebende Bürgertum kannte.«42 In der parlamentarischen Sitzanordnung demokratischer Parlamente widerspiegelt sich ein zutiefst körperliches Konzept, das von der früheren Dualität von Kopf und Körper ausgeht, die prägend für die Vorstellung des body politic war. Das dominante ständische Muster parlamentarischer Repräsentation vor 1789 war ein Rechteck, in dem sich der Monarch an der Stirnseite befand. Links und rechts davon, als ob es die Arme und Beine eines Körpers wären, saßen die Vertreter des Adels und der Kirche. Eine Darstellung43 aus dem Jahr 1458 zeigt, dass sich neben den Repräsentanten des Adels und des Klerus, die sich im Innern einer viereckigen Umklammerung befinden, an deren Stirnseite Karl VII. thront, noch eine weitere Gruppe versammelt hat. Es ist der dritte Stand, dem jedoch kein Zugang zum inneren Entscheidungskreis gewährt worden ist. Dieser entspricht im Leviathan der Stadt am unteren Bildrand außerhalb des Körperbereiches der zentralen alles überragende Figur. In diesem Sinne kann der »Kompositkörper« des Leviathans auch als »Parlamentsverkörperung«44 interpretiert werden. Der König als figurehead des ständischen Parlamentes wird ergänzt durch die anderen Glieder als joints und members des politischen Körpers. Im demokratischen Parlament wird »der König als Kopf des politischen Gemeinwesens […] durch ein Podium« ersetzt und »anstelle der in der parlamentarischen Sitzordnung versinnbildlichten gesellschaftlichen Gliederung« findet man »einen homogenen Volkskörper, der von einer breiten Basis aus verjüngend zur Spitze hin drängt.«45 Damit ist zugleich ein weiteres wesentliches Detail angesprochen, das auf die bürgerlichen Parlamente des 19. Jahrhunderts hinweist. Die vielen kleinen identischen Figuren, die sich innerhalb des Oberkörpers des Leviathans versammeln, konstituieren eine homogene Menge, die sich dem Redner als dessen Haupt entgegen drängt. Diese Vorstellung ist mit der Geschichte von den vielen kleinen Riesen aus dem zuvor diskutierten anonymen Pamphlet aus der Zeit der
42 43 44 45
Ebd., 41. Vgl. dazu Abbildung 6, Charles VII. auf einem lit de justice, ebd., 42. Ebd., 42. Ebd., 43.
61
62
Rainer Guldin
Französischen Revolution verwandt und spielt, wie wir noch sehen werden, auch im Zusammenhang mit dem politischen Körper Barack Obamas eine zentrale Rolle. Manow diskutiert zwei parlamentarische Grundformen, die sich im europäischen Raum im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgesetzte haben: das englische House of Commons und die französische Assemblée Nationale. Beide Formen können als politische Körper gedeutet werden. Das House of Commons besteht aus zwei sich gegenüber liegenden Bankreihen und einem Präsidium an der Stirnseite, wo sich der parlamentarische Speaker befindet: die beiden Seiten bzw. der Kopf der Versammlung. Die Assemblée Nationale hingegen ist ein Halbkreis, der um ein Rednerpult angeordnet ist. In der auf den Kopf zulaufenden Abgeordnetenversammlung der Assemblée Nationale – der neue geheiligte politische Körper demokratischer Nationen – entspricht das Haupt der Rednerplattform und der Rumpf des politischen Körpers dem Plenum der Volksvertreter. Die Trennung in ein rechtes und linkes Spektrum, die typisch für die heutigen kontinentalen Parlamente ist, wurde erst in der Zeit der Restauration eingeführt. »Der königliche Körper wurde abgelöst durch den ›großen Körper der Bürger und die Abgeordnetenversammlung, den Doppelkörper moderner politischer Repräsentation‹«.46 Der Königskörper und dessen Unsterblichkeit werden dadurch auf das neue nationale Kollektiv des Körpers der Volksversammlung übertragen: Ein »unsterblicher Volkskörper«47 , der genauso unantastbar ist wie zuvor derjenige des Königs. Damit hat ein »Souveränitäts- und Sakraltransfer«48 vom König auf das Volk stattgefunden. Die britische und französische Regelung stehen sich diametral gegenüber. Steht im englischen Modell die Parlamentssouveränität im Vordergrund, so ist es im französischen die Volksouveränität. Der Speaker of the House wird als Mund des Unterhauses betrachtet, da er sozusagen außerhalb Kampfarena steht, wo sich die beiden Parteien konfrontieren. Dies erklärt auch die zentrale Rolle, die John Bercow 2019 in den Brexit-Verhandlungen gespielt hat. Im Gegensatz dazu verlor in der französischen Assemblée Nationale der Parlamentspräsident im Laufe des 19. und 20 Jahrhunderts zusehend an Statur und Macht.49 Zum Schluss möchte 46 47 48 49
Ebd., 65. Ebd., 66. Ebd., 74. Neben den neuen demokratischen Parlamenten gibt es noch eine weitere ontologische Körpermetapher, die sich jedoch nicht auf den Staat, sondern die damit verbundene verwandte Vorstellung der Nation bezieht. Es handelt sich dabei um den Gebrauch von vorwiegend weiblichen Personifikationen zur Darstellung von Ländern und Nationen, der weit in die vornationale Vergangenheit zurückreicht. Ein Beispiel, das den body politic des Herrschers mit dem body geographic der Nation verbindet, ist das »Ditchley portrait« von Marcus Gerards dem Jüngeren, das um 1592 entstand und Elizabeth I. von England abbildet, die mit beiden Füßen auf dem Herzen Englands steht. Weitere Beispiel sind Delacroix’, La liberté guidant le peuple (1830) sowie die zahlreichen weiblichen Personifikationen, aus dem 19. Jahrhundert: Germa-
Das Zittern der Macht
ich nun noch auf eine Reihe von Beispielen aus der unmittelbaren Gegenwart eingehen, die zeigen, wie die Tradition des zweifachen politischen Körpers, zu der auch der dritte Körper der Effigies gehört, weitergewirkt haben.
5.
Obamas politischer Körper
Ein besonders spannender Versuch, das Nachleben des politischen Körpers in der Gegenwart aufzuspüren ist Halterns Versuch, Barack Obamas durchschlagenden politischen Erfolg anhand von politischen Verkörperungsmechanismen zu erklären.50 Der Titel des Buches thematisiert zweierlei: »Obamas Körper, der politische Bedeutung besitzt, und die Vorstellung, die Obama vom politischen Körper – dem body politic – der amerikanischen Nation hat. … dem ›natürlichen‹ Körper von Obama, der in das Politische investiert ist … [und] andererseits dem ›mystischem‹ Körper der USA, so wie er von Obama konzipiert wird und dem amerikanischen Volk als Glaubensinhalt angetragen wird.«51 Der Buchumschlag (Abb. 4) zeigt Obama in der Rolle des Leviathans, mit erhobenen Armen, dem Schwert in der einen und dem Bischofsstab in der anderen Hand. Sein Blick fällt auf die unter ihm liegende Landschaft und die Stadt am unteren Bildrand. Als eine Art kommentierenden Paratext hat Haltern eine Reihe von Schwarzweiß-Fotos seinem Text vorangestellt, die bewusst zwischen einem eher privaten, natürlichen und einem kollektiven, symbolischen Körper oszillieren. Die ersten Fotos zeigen Barack Obamas eher privaten, schlanken und doch muskulösen, durchtrainierten Körper. Halter vergleicht das Bild, das ihn am Strand mit nacktem Oberkörper zeigt, mit der Schaumgeburt der Venus52 , und stellt zum zweiten Fotos, das zeigt, wie er behänd, in T-Shirt und weißen Tennisschuhen, aus
50 51 52
nia. Italia, Austria und Helvetia (vgl. Guldin, Rainer: Bedrohte Grenzen: Zur geschlechtlichen Dimension des politischen Körpers, Penetrating the Body Politic: Studies in Pre-Modern Metaphorology//Penetrationen des Politischen Körpers: Studien zu einer Metaphorologie des Politischen in der Vormoderne, Bielefeld, ZiF, 9-11 Juni 2011, unveröffentlichter Vortrag). Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Nationen an die nationalen Landschaften gekoppelt, die, wie die weiblichen Personifikationen, mit ideologischen Vorstellungen von Natürlichkeit verbunden wurden. Dass der vormoderne politische Körper in der Regel ein männlicher ist und die Personifikationen des 19. Jahrhunderts auf weibliche Figuren zurückgreifen, könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass der männliche Körper in der vormodernen Medizin das eigentliche Interpretationsmodell darstellte (vgl. Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt a.M. – New York 1992). In diesem Sinne ist der politische Körper in der Regel implizit immer auch ein männlicher Leib. Haltern: Obamas politischer Körper. Ebd., 35. Ebd., 6.
63
64
Rainer Guldin
Abbildung 4: Obamas politischer Körper
© Berlin University Press
dem Auto steigt, kurz vor der Berliner Rede vom 24. Juli 2008 am Potsdamer Platz, eine Frage, die sein Auftreten ins Symbolische verlagert: »Ist Obama ein Hirte mit Pastoralmacht oder doch nur ein eitler Fitnessclubbesucher?«53 Die nächsten Fotos betonen die metaphorische und zugleich metonymische Verbindung zwischen Obamas Körper und den Insignien der Nation: Obamas Amtseinführung am 18.
53
Ebd., 7.
Das Zittern der Macht
Januar 2009 vor dem Lincoln Memorial in Washington DC fand unter dem Titel statt, »We are one: The Obama inaugural Celebration at the Lincoln Memorial«. Auch in diesem Fall formen die zwei politischen Körper, der eine realpräsent und redend und der andere in symbolischer Form im Hintergrund und höhergestellt, zusammen eine Einheit. Ein weiteres Foto verbindet Obamas Körper, der hier dadurch entindividualisiert wird, dass man ihn von hinten sieht, mit der ontologischen Metapher der amerikanischen Flagge, die hier stellvertretend für das amerikanische Volk und dessen Geschichte steht. Sowohl Obamas Leib als auch die Flagge wirken dabei als symbolische Container einer gemeinsamen emotionalen Vergangenheit.54 Das erste Schöpfungs- und Gründungsmodell der amerikanischen Verfassungsgeschichte bestimmte die Bürger als Teilnehmer einer politischen Konstruktion und als Produkt der Landesverfassung. Das von Obama verwendete Bewahrungsmodell definiert die Bürger zudem als Erben einer überkommenen Ordnung, die sich ihren Körpern eingeschrieben hat. Auch Abraham Lincoln, mit dem sich Obama in zahllosen öffentlichen symbolischen Handlungen verglichen hat – zum Beispiel durch die Ablegung des Eides auf der Lincoln-Bibel und die Kranzniederlegung am Lincoln Memorial zu dessen 200. Geburtstag am 12 Februar 2009 – setzte ebenfalls auf das Bewahrungs- und Organismusmodell. Ideen allein ermöglichen keinen Staat. Dieser schreibt sich direkt auf die Körper der Revolutionäre ein. Lincolns berühmte Gettysburg Address vom 19. November 1863, anlässlich der Einweihung eines Soldatenfriedhofs auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, fasst das demokratische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten zusammen: Die Toten sind nicht umsonst gestorben. Auch Obama »konzipiert den individuellen Körper als Teil des großen Körpers der politischen Gemeinschaft. Dies mag uns aufgrund des Mystisch-Mythischen, das sich darum rankt befremdlich erscheinen. Für Amerikaner ist es nicht befremdlich, sondern einsichtig.«55 Obama präsentiert sich »als glaubwürdigen Vertreter des amerikanischen Volkes, ja mehr noch: als körperlich identifizierbare Transsubstantiation des Volkssouveräns.«56 Das letzte Foto muss in Zusammenhang mit dem Frontispiz von Hobbes’ Leviathan in eins gesehen werden. Die zahllosen menschlichen Figuren auf der linken Seite sind in den Kollektivkörper des Staates eingebunden. Obama steht rechts auf einem fast leeren Podium und grüßt die Mengen mit erhobenem Arm. Wie bei Hobbes drängen sich die einzelnen Figuren dicht an dicht und blicken alle in dieselbe Richtung. Trotz kleinerer Unterschiede in der Kleidung sehen sie sich aus der Ferne sehr ähnlich. Es kommt ihnen daher keine klare Funktion zu außer der Tatsache, dass sie alle Teil eines größeren Ganzen sind.
54 55 56
Ebd., 8. Ebd., 38. Ebd., 82.
65
66
Rainer Guldin
6.
Von der Effigies zu Madame Tussauds
Marek sucht nach Spuren der Effigies in der Aktualität, das »ferne Nachleben ihrer vergangenen Ausstrahlung von Heiligkeit.«57 War zu Beginn ihre Verwendung ein königliches Privileg, so kam es nach dem Aussetzen des Rituals Anfang des 17. Jahrhunderts zu einer Lockerung und Funktionsverschiebung. Noch vor dem Hinscheiden der Porträtierten wurden nun glamouröse, prächtig ausgestattete und fein gearbeitete Effigies in Auftrag gegeben, die nicht mehr am Leichenzug teilnahmen und nach der Bestattung in Schaukästen gezeigt wurden.58 Wie ihre Vorgänger bekleidete man diese Schauobjekte mit den einst getragenen Kleidern der Porträtierten. Die Schaueffigies, die unmittelbar im Anschluss an die Aufgabe des königlichen Brauches der Funeraleffigien aufkamen, hatten zwar keine zeremonielle Bedeutung und Funktion mehr, den Zusammenhang mit dem Tod aber noch nicht ganz verloren. Das letzte Königszeremoniell, das eine Effigie einsetzte, fand 1610 in Frankreich für Heinrich IV. statt, für den gleich drei verschiedene Effigies erstellt wurden. Nur eine davon wurde benutzt, die zwei anderen gingen auf eine Wanderschau durch das ganze Land. In der Folge verselbständigte sich diese Gepflogenheit und verbreitete sich durch ganz Europa. Um 1800 kamen Wachsfigurenkabinette in Mode und als Madame Tussaud 1803 nach England auswanderte, nahm sie ihren Grundstock an Wachsfiguren mit.59 Die Figuren im heutigen Londoner Wachfigurenkabinett haben geöffnete Augen und gaukeln dank perfektem Verismus eine täuschende Lebensnähe vor. Noch lebende und schon verstorbene bekannte Persönlichkeiten begegnen sich im gleichen Raum. Auch die Konservierung und Zurschaustellung von Lenins und Maos präparierten Leichen in staatlichen Mausoleen ist Teil »eines noch heute bestehenden Herrscherkults, der nicht ohne die Verehrung eines verbleibenden Körpers auskommt«60 und für die Fortdauer des Leninismus und Maoismus einsteht. Die Endlichkeit des natürlichen Körpers des Herrschenden und dessen gleichzeitige symbolische Dauer über den Tod hinweg als Garant staatlich-politischer Kontinuität unterhalten komplexe Beziehungen zueinander. Auch Jassir Arafats Körper wurde von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Sein maschinell kontrolliertes Sterben fand in einem französischen Krankenhaus statt. Dort wurde er künstlich am Leben erhalten, um Zeit zu gewinnen für die Neuorganisation des palästinensischen Staates. Wie das Wachsfigurenkabinett können diese Riten auf die Tradition der Effigies und das königliche Double zurückgeführt werden. »Den im gläsernen Sarg liegenden, durch und durch mit Chemikalien getränkten Körper [Lenins] bekleidet be57 58 59 60
Marek: Die Körper des Königs, 274. Ebd., 58-60. Es handelte sich vor allem um Figuren von französischen Revolutionären. Das Wachsfigurenkabinett verfolgte zu Beginn eine anti-revolutionäre Argumentation (ebd., 278). Ebd., 270.
Das Zittern der Macht
reits der zehnte Anzug. Äußerlich unterscheidet ihn darum nur wenig von seiner Wachsfigur im berühmten Londoner Kabinett Madame Tussauds.«61 Die Doppelkörper-Rituale der Monarchie haben sich in abgewandelter Form bis in die Gegenwart hinein erhalten.62 Als der amerikanische Präsident George W. Bush im November 2003 in London auf Staatsbesuch war, wurden mehrere baugleiche Cadillacs eingesetzt, so dass es unklar blieb, in welcher sich der Präsident befand. Dies sollte der Sicherheit im Falle eines Attentats dienen. Im Falle despotischer Herrschaftspersonalisierung dient die Verdoppelung des Körpers des Diktators anderen Zwecken. Saddam Hussein setzte eine unbekannte Anzahl von Doppelgängern und »optischen Zwillingen«63 ein, die seinen physischen Körper schützen sollten. Darüber hinaus suggerierten sie, dass der Despot überall und nirgends zugleich sein konnte. »Nach seiner Gefangennahme reagierte die amerikanische Besatzungsmacht mit der bewusst inszenierten, bildlichen Dekonstruktion des Diktators, die ihn vom staatlichen Repräsentanten zum medizinischen Fall degradierte.«64 »In der öffentlichen Inszenierung der modernen Vertretungsrepräsentation benutzen Demokratien noch Symbolelemente der körperlichen Identitätspräsentation – denn auf den Körper, die physische Person, sind sie letztlich immer wieder zurückgeworfen.«65 So verschwand 2003 auf das Jahresende hin Silvio Berlusconi für längere Zeit aus der Öffentlichkeit, um sich einer Haartransplantation zu unterziehen, die in nicht nur jünger, sondern auch männlicher und potenter aussehen lassen sollte. Wegen der vielen chirurgischen Eingriffe haftete Berlusconis Aussehen immer etwas Wächsernes an. »Das Interesse an der Körperlichkeit des Herrschers und das Interesse des Herrschers an seinem Körper sollten nicht auf pure Eitelkeit oder persönliche Marotten reduziert werden.« Auch in der Demokratie ist der Körper des Herrschers »kein normaler Körper. Er ist bigger than life oder soll uns doch zumindest so erscheinen.«66 Wichtig ist dabei, wie schon im zu Beginn erwähnten Fall Angela Merkels, dass »der leibliche Körper des Herrschers […] seinem politischen Körper nicht in die Quere« kommt. Körperliche Schwächen, Unzulänglichkeiten und Verfall irritieren, »weil sie uns an die Brüchigkeit der Fiktion vom übernatürlichen, ewigen Herrschaftskörper
61 62 63 64 65 66
Ebd., 271. Manow: Im Schatten des Königs, 120f. Marek: Die Körper des Königs, 269. Es ging dabei um die Überprüfung der Identität durch Abnahme von genetischem Material. (vgl. ebd., 269). Manow: Im Schatten des Königs, 139. Ebd., 140.
67
68
Rainer Guldin
erinnern. Dadurch erhalten ausgesprochen banale Ereignisse eine große politische Bedeutung.«67 Abschließen möchte ich mit einer Meldung aus der Washington Post vom 17. November 2019, die ein weiteres Schlaglicht auf die Aktualität der hier diskutierten Tradition des body politic wirft. Es ging dabei um eine geheim gehaltene, außergewöhnliche Arztvisite Donald Trumps, die Anlass zu verschiedenen Spekulationen war. »White House press secretary Stephanie Grisham said it is ›absolutely not‹ true that President Donald Trump’s visit to a doctor Saturday was anything other than a routine physical exam, maintaining that he is ›healthy as can be.‹ ›Oh, the rumors are always flying,‹ Grisham said Saturday when asked during an interview with Fox News Channel host Jeanine Pirro whether there was any truth to the speculation that the visit was out of the ordinary. ›Absolutely not. He is healthy as can be. I put a statement out about that. He’s got more energy than anybody in the White House. That man works from 6 a.m. until, you know, very, very late at night. He’s doing just fine.‹« In »USA Today« erschien daraufhin noch am selben Tag ein weiterer, diesmal kritischer Artikel, der ebenfalls mit der Ambivalenz der beiden Körper operiert und dies zum Anlass nimmt auch über Trumps Präsidentschaft insgesamt nachzudenken. »Good genes?«, so der Titel, gefolgt von der zweifelnden Frage: »How can Trump eat a lot of fast food, exercise little and be healthy?«
Literatur Bachtin, Michail: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt a.M. 1995. Black, Max: Models and Metaphors, Ithaca (N.Y) 1962. Bloch, Marc: Die wundertätigen Könige, München 1998. De Baecque, Antoine: Le corps de l’histoire. Métaphores et Politique (1770-1800), Paris 1993. Foucault, Michel: Macht und Körper. In: Dits et Écrits. Schriften, 4 Bde. Frankfurt a.M. 2002. Guldin, Rainer: Körpermetaphern. Zum Verhältnis von Politik und Medizin, Würzburg 2000. Guldin, Rainer: The Dis-membered Body: Bodily Fragmentation as a Metaphor of Political Renewal. In: Physis. Revista de Saúde Coletiva, 12 (2002) H. 2, 221-234.
67
Ebd., 141. Manow erwähnt auch Fidel Castros Stolpern, Jimmy Carters Schwächeanfall beim Joggen und George W. Bushs kurzen Ohnmachtsanfall nach dem Verschlucken einer Brezel im Januar 2002.
Das Zittern der Macht
Guldin, Rainer: Bedrohte Grenzen: Zur geschlechtlichen Dimension des politischen Körpers, Penetrating the Body Politic: Studies in Pre-Modern Metaphorology//Penetrationen des Politischen Körpers: Studien zu einer Metaphorologie des Politischen in der Vormoderne, Bielefeld, ZiF, 9-11 Juni 2011, unveröffentlichter Vortrag. Guldin, Rainer: Metaphors of Multilingualism. Changing Attitudes towards Language Diversity in Literature, Linguistics and Philosophy, New York and London 2020. Hale, David G.: Intestine sedition: the fable of the belly. In: Comparative Literary Studies 5 (1968) 377-388. Haltern, Ulrich: Obamas politischer Körper, Berlin 2009. Jörges, Hans-Ulrich: Das Zittern der Macht. In: Stern, 3.7.2019. Jungholt, Thorsten: Wo die Merkel-Raute den Tod bringt. In: Die Welt, 15.09.2013. Koschorke, Albrecht, Frank, Thomas, Matala de Mazza, Ethel u.a.: Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a.M. 2007. Lakoff George und Johnson, Mark: Metaphors we Live by, Chicago 2003. Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt a.M. – New York 1992. Le Goff, Jacques: Head or Heart? The Political Use of Body Metaphors in the Middle Ages. In: Feher Michel/Naddaff, Ramona/Tazi, Nadia (Hg.): Fragments for a History of the Human Body (Part Three), New York 1990, 13-26. Titus Livius, Römische Geschichte, München und Zürich 1987. Kantorowicz, Ernst, H.: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, München 1990. Manow, Philip: Im Schatten des Königs: Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation, Frankfurt a.M. 2008. Marin, Louis: Le portrait du roi, Paris 1981. Marek, Kristin: Die Körper des Königs, München 2009. Matala de Mazza, Ethel: Der verfasste Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft in der Politischen Romantik, Freiburg i.Br. 1999. Wenner, Stefanie: Ganzer oder zerstückelter Körper. Über die Reversibilität von Körperbildern. In: Benthien, Claudia/Wulf, Christoph (Hg.): Körperteile. Eine Kulturelle Anatomie, Hamburg 2001, 361-380.
69
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik Historische und soziologische Perspektiven auf Körper und Geschlecht Imke Schmincke
Gesellschaften bestehen nicht nur aus Bewusstsein oder rational handelnden Akteur/-innen, Normen und Institutionen, sie sind immer auch verkörpert. Diese Einsicht begründete die seit den 1980er Jahren sich entwickelnden sozial- und geisteswissenschaftlichen Perspektiven auf den menschlichen Körper, seine Gestalt, Bewegungen, Empfindungen, Affekte, seine Praxis und seine Bedeutungen. Unsere Körper, unser Aussehen, unsere ›innere Haltung‹, unsere Bewegungen sind von der Gesellschaft geprägt: von gesellschaftlichen Normen (z.B. Schönheitsideale) wie auch von den sozialen, politischen und materiellen Bedingungen unserer Existenz (z.B. Herkunft, Erziehung, Bildung, Beruf, Ressourcen, Rechte). Wir sehen also: Gesellschaft wirkt auf die Körper ein, prägt und gestaltet diese. Das funktioniert mal mehr oder weniger freiwillig, mal mehr oder weniger zwangsweise. In jedem Fall wird im Ergebnis der soziale Ursprung dieser Prägung häufig unsichtbar: Es findet eine Naturalisierung statt; es wird Körper (und damit ›Natur‹ und vermeintlich unveränderbar), was vorher sozial war. Der Körper wird aber auch noch auf eine andere Weise für die Soziologie interessant: Der Körper ist auch ein mehr oder weniger eigenständiger Akteur des Sozialen und produziert damit seinerseits sozialen Sinn und soziale Ordnung. Im Körper, in seinen Bewegungen, speichern sich Routinen ab, was uns einen vergleichsweise reibungslosen Alltag ermöglicht. Daher hat Robert Gugutzer in diesem Zusammenhang das Verhältnis von Körper und Gesellschaft als Wechselverhältnis beschrieben: Zum einen sei der Körper Produkt der Gesellschaft, zum anderen Produzent von Gesellschaft. Er schreibt: »Die Soziologie beschäftigt sich mit der wechselvollen Durchdringung von Körper und Gesellschaft.«1 Als Produkt und Produzent von Gesellschaft unterliegt der Körper natürlich auch sozialem Wandel. Und es waren insbesondere körperhistorische Arbeiten, 1
Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2015, 9.
72
Imke Schmincke
die darauf hingewiesen haben, dass sich diese Körperkonzepte und Erlebnisweisen historisch entwickelt haben. In den meisten Gesellschaften sind Körper immer (zwei)geschlechtlich markiert, sie werden in das System Zweigeschlechtlichkeit eingepasst, die für die Identität und deren Verkörperung eine zentrale Rolle spielt. »Nichts verbürgt das Geschlecht, das man ist, mehr als der Körper, den man hat«, so der Soziologe Michael Meuser.2 Er fügt hinzu, dies gelte zumindest für die moderne, durch die Dominanz des naturwissenschaftlichen Paradigmas geprägte Gesellschaft. Die Festlegung auf ein Geschlecht geschieht zumeist darüber, dass entweder beim Fötus mithilfe Ultraschall (mittlerweile auch qua Bluttest) oder direkt nach der Geburt am Körper ›abgelesen‹ wird, welchem Geschlecht das Kind zuzuordnen ist. Wobei bei dieser Geschlechtsbestimmung die primären Geschlechtsorgane, im vorgeburtlichen Fall allein der Penis, für die Bestimmung ausschlaggebend sind – abgesehen von Fällen, in denen die Zuordnung aufgrund der Genitalien nicht erfolgen kann, weil diese uneindeutig sind. In der Regel werden die Kinder dann entsprechend ihrer Zuordnung sozialisiert, d.h. sie werden als Mädchen oder Junge adressiert und lernen sich selbst als solche zu identifizieren. Und sie lernen dabei auch, weibliche oder männliche Eigenschaften zu ›verkörpern‹. Denn auch wenn der Körper das Geschlecht verbürgt, so sind es vor allem gesellschaftliche Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen sein sollen, die die Materialität des Körperlichen mit der entsprechend vergeschlechtlichten Bedeutung aufladen. Körper und Geschlecht sind somit eng miteinander verwoben, wie nicht nur die naturwissenschaftliche, sondern auch die sozial- und geisteswissenschaftliche Betrachtung verdeutlicht, auch wenn letztere andere Akzente setzt und andere Schlüsse zieht. Für sie stehen Prozesse der Naturalisierung im Vordergrund und damit die Frage, wie Gesellschaftliches verkörpert wird, wie Kultur Natur wird. Der vorliegende Beitrag möchte diese Verwobenheit von Körper und Geschlecht etwas genauer ausleuchten. Dafür werde ich im Folgenden zunächst bei der Politisierung der Körper durch den Feminismus, konkreter die zweite Frauenbewegung ansetzen und zeigen, dass die Kritik der Ungleichheit der Geschlechter und der mit ihr verbundenen Unfreiheit und Benachteiligung viel mit Körper und Sexualität zu tun hatte und daher dort ansetzte. Im Anschluss sollen die zentralen Einsichten der geschichtswissenschaftlichen und soziologischen Studien zu Körper und Geschlecht zusammengetragen werden. Schließlich geht es in einem letzten Abschnitt um die Frage, welche Rolle Körperpolitik für feministischen Protest aktuell noch spielt und welche weiteren Entwicklungen sich hinsichtlich der Verbindung
2
Meuser, Michael: Frauenkörper – Männerkörper. Somatische Kulturen der Geschlechterdifferenz. In: Schroer, Markus (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M. 2005, 271-294, 271; vgl. umfassend zum Verhältnis von Körper und Geschlecht auch Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper, Opladen 2 2001.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
von Körper und Geschlecht abzeichnen (Stichwort: Wandel von Männlichkeit, Bedeutung von Social Media etc.). Anhand ausgewählter Beispiele soll verdeutlicht werden, dass wir es mit einer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Phänomene zu tun haben: geschlechtlich konnotierte Unterschiede bleiben wichtig und auch die damit verbundenen Unterschiede; sie werden aber in mancherlei Hinsicht auch irrelevanter, in Verbindung mit dem Reflexiv-Werden von Körper und Geschlecht. Für Männer wie Frauen stellt sich in der spätmodernen Gesellschaft verstärkt die Anforderung, den Körper als ein Kapital zu betrachten, in das investiert werden sollte.
1.
Feminismus und die Politisierung von Körper
Die Frauenbewegungen in Nordamerika und Westeuropa entstanden im 19. Jahrhundert in Gefolge der politischen Revolutionen, welche die Idee universaler Gleichheit in die Welt getragen hatten.3 Für diese sogenannte erste Welle stand vor allem die Forderung nach gleichen Rechten im Vordergrund, ganz zentral das Wahlrecht. Aber es ging den Frauenrechtlerinnen damals auch um das Recht auf (Aus-)Bildung und Erwerbsmöglichkeiten, von denen die bürgerlichen Frauen damals noch ausgeschlossen waren, auf die sie aber aufgrund schwindender Versorgungsmöglichkeiten zunehmend angewiesen waren.4 Der Ausschluss von Frauen (und anderen Gruppen) war zunehmend begründungsbedürftig geworden. Im Zuge der Hegemonie naturwissenschaftlicher Begründungszusammenhänge wurde der Ausschluss über (pseudo-)wissenschaftliche Argumente nun verstärkt mit der physiologischen Andersartigkeit, und auf diese Weise mit der ›Natur der Frau‹ begründet.5 Die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm setzte sich mit diesen 3
4
5
Vgl. Offen, Karen M.: European Feminisms. 1700-1950. A Political History, Stanford 2000; für die deutsche Frauenbewegung Gerhard, Ute: Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Reinbek 1990. Diese ›Probleme‹ hatten die proletarischen Frauen selbstverständlich nicht; sie durften nicht nur, sie mussten erwerbstätig sein und dies unter extrem harten Bedingungen. Die bürgerlichen und die proletarischen Frauen hatten teilweise sehr unterschiedliche Ziele, aber es waren dann auch politische Gründe, weshalb sich die beiden Bewegungen getrennt voneinander entwickelten, vgl. zum Verhältnis von bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung z.B. Gerhard, Ute: Unerhört, 178-201. Lieselotte Steinbrügge hat sich mit Argumenten zur ›Natur der Frau‹ in Texten französischer Aufklärer auseinandergesetzt. Sie schreibt: »Das 18. Jahrhundert ist das Zeitalter der Herausbildung und Dissoziation von Geschlechtscharakteren, es ist die Epoche, in der die ideologischen und institutionellen Weichen gestellt wurden für den Ausschluß der Frau von den Bürgerrechten, aus den höheren Bildungseinrichtungen, kurz: aus dem öffentlichen Leben. Es ist das Zeitalter, in dem ein Bild von der weiblichen Natur entsteht, das eben diese Ausgrenzungen als ›natürlich‹ denkbar werden läßt.« Steinbrügge, Lieselotte: Das moralische Ge-
73
74
Imke Schmincke
Argumenten kritisch auseinander. In ihrem Text Der Frauen Natur und Recht von 1876, in welchem sie sich mit den widersprüchlichen Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden, auseinandersetzt argumentiert sie, dass diese Eigenschaften mehr mit gesellschaftlichen Erwartungen bzw. Anpassungsleistungen als mit einer körperlich-naturhaften Andersartigkeit zu tun haben. Sie schreibt: »Die Frauen sind nicht oberflächlich und trivial von Natur, sondern die Erziehung behaftet sie mit diesem Makel, indem sie ihnen diejenigen Beschäftigungen, diejenigen Studien und Gebiete der Thätigkeit vorenthält, an denen selbständiges Denken sich entwickelt.«6 In einem späteren Text, Die Antifeministen, setzt sie sich explizit mit den pseudowissenschaftlichen Argumenten auseinander, die von namhaften Wissenschaftlern angeführt werden, um zu begründen, weshalb Frauen nicht studieren sollten. Berühmt geworden ist z.B. die Abhandlung Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes von Paul Julius Möbius. Der Neurologe und Psychiater Möbius begründete darin die geistige Minderwertigkeit von Frauen damit, dass ihre Gehirne, »die Windungen des Stirn- und des Schläfenlappens«7 schlechter entwickelt seien als bei Männern. Eine Folge sei, dass ›das Weib‹ daher stärker instinktgeleitet und damit tierähnlicher sei. Mit dieser Schrift intervenierte Möbius in die Debatte um die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium. Anders als Männer werden Frauen seit jener Zeit sehr stark auf ihre körperliche Andersartigkeit reduziert und damit auf Körperliches und auf ihr Geschlecht – Männer hatten sich ja von beiden emanzipiert. Die ›Natur der Frau‹ war in gewisser Weise gerade erst in dieser Zeit entdeckt worden, nicht zuletzt objektiviert in Gestalt der Eierstöcke und in Gestalt wirkmächtiger wissenschaftlicher Paradigmen wie den Naturwissenschaften.8 Nachdem Dohm sich spöttisch mit den Widersprüchlichkeiten und Inkonsistenzen in Möbius’ Argumentation auseinandergesetzt hat,
6 7
8
schlecht. Theorien und Entwürfe über die Natur der Frau in der französischen Aufklärung, Weinheim – Basel 1987, 11. Dohm, Hedwig: Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen, Berlin 1876, Reprint Bern 1986, 51. Möbius, Paul Julius: Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1900. Der Text findet sich online unter https://de.wikisource.org/wiki/ %C3 %9Cber_den_physiologischen_ Schwachsinn_des_Weibes (Letzter Zugriff am 27.2.2020). Deuber-Mankowsky schreibt in ihrem Überblicksartikel zum Verhältnis von Natur und Kultur und dessen vergeschlechtlichter Codierung: »Tatsächlich entstand das moderne Verständnis der Natur im 17. Jahrhundert im Kontext der modernen Wissenschaften von der Natur. Wie die feministische Wissenschaftsforschung zeigte, knüpften die Naturwissenschaften in der Verwendung sexueller Metaphern zur Benennung der Natur und in der Konnotation des Naturverständnisses mit den Kategorien ›männlich‹ und ›weiblich‹ jedoch an Vorstellungen und einen Wissensapparat an, der bis in die griechische Antike zurückgeht.« (Deuber-Mankowsky, Astrid: Natur – Kultur: ein Dualismus als Schibboleth der Gender- und Queer Studies? In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 13-22, 15f.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
fasst sie zusammen: »Wenn die Antifeministen der Frau die Fähigkeit für höhere kulturelle Leistungen absprechen, so berufen sie sich dabei einmütig auf die Natur des Weibes.«9 Die Festlegung des Weiblichen auf ›die‹ Natur sollte folgenreich sein: Über viele Jahre war ein verbreitetes Argumentationsmuster, Frauen den Zutritt zu gesellschaftlichen Bereichen darüber zu versagen, dass man auf ihre unterschiedliche (minderwertige) körperliche Beschaffenheit verwies und dass man sie auf ihre reproduktiven Fähigkeiten reduzierte – welche gleichwohl nicht annährend so viel gesellschaftliche Anerkennung genossen wie die ›produktiven‹ und öffentlichen. Die starke Verklammerung von Weiblichkeit und Körperlichkeit war insofern auch folgenreich, als sie unsere Wahrnehmung (auch: Selbstwahrnehmung) bis heute bestimmt. Dass diese Verklammerung nicht schon ewig und auch nicht von Natur aus so festgelegt worden war, konnte erst thematisiert werden, als traditionelle Bezüge und Bindungen zunehmend ins Wanken kamen, in der reflexiven Modernisierung10 . Mit diesem Begriff wird in der Soziologie die spätmoderne oder spätkapitalistische Gesellschaft (zweite Hälfte 20. Jahrhundert) bezeichnet, in welcher Individualisierung und Globalisierung weiter fortgeschritten sind und sich das Zusammenleben der Menschen verändert. Dass in dieser Zeit viele Selbstverständlichkeiten hinterfragt werden und sich traditionelle Werte und Muster aufgelöst haben, ist auch ein Ergebnis sozialer Kämpfe. Fragen der körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung waren nur für eine Minderheit innerhalb der ersten organisierten Frauenbewegung ein wichtiges Ziel, in der Mehrheit zielten die Forderungen nach Gleichheit und Teilhabe auf andere Bereiche wie vor allem auf die Teilhabe an Ausbildung und Beruf.11 Sehr viel zentraler sollten diese Themen dann für die zweite oder neue Frauenbewegung werden, die sich in Nordamerika und Westeuropa in Folge der Entwicklungen des Jahres 1968 bildete. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist nicht so, dass die neue Frauenbewegung in Nordamerika und Westeuropa sich ausschließlich mit dem Thema Körper beschäftigte. Gerade für Westdeutschland gilt als ein Gründungsereignis die Rede, die Helke Sander für den Aktionsrat zur Befreiung der Frau beim SDS Delegierten Kongress des Jahres 1968 hielt und in der es vor allem um Fragen der (heute würde man sagen:) Vereinbarkeit ging und darum, dass Kindererziehung kollektiv organisiert werden sollte und bereits als Teil revolutionärer Politik begriffen werden müsse. Seit den 1970er Jahren kämpften Frauen um die Anerkennung von Hausarbeit, um gleiche Löhne, gleiche Rechte, Mitbestimmung 9 10 11
Dohm, Hedwig: Die Antifeministen. Ein Buch der Verteidigung, Berlin 1902, wiederabgedruckt in Ariadne Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte 71 (2017) 38-45, 43. Vgl. Beck, Ulrich/Giddens, Anthony/Lash, Scott: Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt a.M. 1996. Vgl. zur sogenannten Sittlichkeitsbewegung innerhalb der ersten Frauenbewegung Schaser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848-1933, Darmstadt 2006, 69-76.
75
76
Imke Schmincke
und Gleichberechtigung in Wissenschaft, Kultur, Politik.12 Aber zu einer Bewegung wurde der feministische Protest – in Westdeutschland Anfang der 1970er Jahre – vor allem durch die Kampagne zur Abschaffung (bzw. Reform) des §218 und damit durch den Kampf darum, dass Frauen selbst entscheiden können, ob sie eine Schwangerschaft austragen wollen oder nicht. In Nordamerika und Westeuropa entstanden in diesem Zuge die feministischen body politics, die Körperpolitik. Wie wurde der Körper hier zum Politikum? In dem zentralen Slogan dieser Bewegung – Das Private ist politisch – wurde deutlich, worum es ging: Die Trennung zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre (deren geschlechtliche Aufladung bzw. die jeweilige Zuweisung) und ihre hierarchische Entgegensetzung hatte dazu beigetragen, dass es Frauen bisher unmöglich war, Ungleichheit im Bereich des Privaten zu politisieren. Es musste daher darum gehen, diese Trennung selbst als politischen Akt zu deuten und zu fordern, dass die bisher aus dem Politischen ausgeschlossenen Bereiche und Themen ebenfalls als politische erkannt werden sollten. Und das bedeutete, diese Themen (Körper, Sexualität, das intime Verhältnis der Geschlechter, Kinder, überhaupt der ganze Bereich, den man heute mit Care umfasst) zu einem Gegenstand öffentlicher und kollektiver Auseinandersetzungen zu machen. Es ging somit um nichts weniger als darum, das Verständnis von Politik selbst zu verändern, es zu erweitern um die ins Private geschobenen, dennoch hochpolitischen Fragen. Die neue Frauenbewegung erweiterte aber nicht nur das Verständnis des Politischen, sie erprobte auch neue Wege der Politisierung. Das zentrale Stichwort hierfür war das der Erfahrung bzw. Selbsterfahrung. Die eigene, persönliche Erfahrung wurde zum Ausgang genommen für die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und aus der Analyse sollten Impulse zur Veränderung des Alltags und der Gesellschaft folgen. In feministischen Kreisen in den USA entstanden im Jahr 1968 die sog. CR-Gruppen (Consciousness Raising), die alsbald auch in der BRD auftauchten. Nach klaren Regeln aber ohne feste Anleitung trafen sich Frauen in kleinen Gruppen, teilten ihre Erfahrungen und analysierten dann das Gemeinsame/Strukturelle dieser Erfahrungen und führten sie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse (im besonderen des Patriarchats) zurück. Die einzelne fand Gehör und Entlastung im Teilen der eigenen leidvollen Erfahrungen. Dabei blieb es nicht beim Erfahrungsaustausch, vielmehr sollte derselbe die einzelnen befähigen, ihre Situation zu verändern. In manchen dieser Gruppen fanden auch körperliche Selbstuntersuchungen statt, kollektiv und mit Hilfe eines Spekulums betrachteten Frauen gemeinsam ihre Geschlechtsorgane. Ein weiteres zentrales Stichwort war das der Selbsthilfe.
12
Zur Geschichte der neuen Frauenbewegung in Westdeutschland vgl. Schulz, Kristina: Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und Frankreich 19681976, Frankfurt a.M. – New York: 2003. Lenz, Ilse: Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, Wiesbaden 2008.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
Ziel der autonomen Organisierung von Frauen (d.h. ohne Männer) war es sich gegenseitig zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die Themen Sexualität, Gesundheit, Gewalt erhielten hier eine zentrale Bedeutung. Frauen der neuen Frauenbewegung setzten sich in verschiedener Weise mit dem Thema Sexualität auseinander und forderten das Recht, sexuell autonome Wesen sein zu können. Dies taten sie in Hinblick auf Verhütung und Abtreibung, im Kampf gegen den §218, indem sie Fahrten in Kliniken im benachbarten liberalen Holland organisierten, sie Beratungsmöglichkeiten für schwangere Frauen schufen und Listen mit Ärzten und Ärztinnen erstellten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten. Sexualität wurde auch dadurch zum Thema, dass sich Frauen kritisch mit konventionellen sexuellen Praxen sowie mit den Ansprüchen und neuen Normen auseinandersetzten, die aus der sog. sexuellen Revolution folgten. So wurde problematisiert, dass in Aussagen von Befürworter/-innen der sexuellen Revolution immer viel zu sehr die Lust des Mannes in den Mittelpunkt gestellt wurde. Ein anderes Thema war die Kritik der konventionellen Medizin. Frauen thematisierten ihre Unkenntnis bezüglich des eigenen Körpers und die Ohnmachtsgefühle gegenüber der zumeist männlichen Ärzteschaft. Aus dieser Situation heraus entstanden Anfang der 1970er Jahre verschiedene Frauengesundheitshandbücher. Das bekannteste ist Our bodies, ourselves, das vom Boston Women’s Health Collective verfasst wurde, bis heute zirkuliert, viele Neuauflagen und Aktualisierungen und vor allem viele »global adaptions« erfahren hat (bisher in 31 Sprachen übersetzt wurde).13 Dieses Buch thematisierte viele Aspekte weiblicher Sexualität, medizinisches Wissen, gesundheitliche Fragen, gab Hinweise zu Verhütung, lesbischer Liebe, Gewalt, Geschlechtskrankheiten und Abtreibung. Daneben gab es Handbücher wie das Frauenhandbuch Nr. 1 (erschienen 1972) oder das 1975 erschienene Handbuch Hexengeflüster, die von feministischen Gruppen in Westdeutschland verfasst wurden. Frauen praktizierten außerdem Selbsthilfe dadurch, dass sie feministische Gesundheitszentren gründeten, in welchen Beratungen oder Kurse stattfanden. Häusliche und/oder sexualisierte Gewalt, ein bisher gesellschaftlich tabuisierter Themenbereich, wurde auf die Tagesordnung gebracht. Im Jahr 1976 eröffnete in Berlin das erste Frauenhaus, das misshandelten Frauen Schutz bot, bald folgten weitere in anderen Städten. Es lässt sich an dieser Stelle resümieren, dass sich feministischen body politics um drei Aspekte drehten: Erstens ging es darum, persönliche und körperliche Erfahrungen zum Ausgang von Politik zu nehmen. Zweitens sollte dabei deutlich werden, dass die Erfahrungen überindividuell waren, dass sich in ihnen gesellschaftliche (Geschlechter-)Verhältnisse vermittelten. Dies implizierte die Erkenntnis, dass
13
Vgl. Boston Women’s Health Book Collective: Our bodies, ourselves. A healthy book by and for women, New York: Simon and Schuster 1975.; vgl. zur Geschichte des Handbuchs Davis, Kathy: The Making of Our Bodies, Ourselves. How Feminism Travels across Borders, Durham 2007.
77
78
Imke Schmincke
(staatliche) Politik Körpererfahrungen prägt, z.B. durch Kontrolle über Reproduktion. Und zum dritten zeichnete sich eine Transformation des Politischen ab, die in der Kritik einer Trennung in privat und öffentlich vormals private Fragen als politische und damit als gesellschaftlich verhandelbare begriffen wurden. Ilse Lenz argumentiert, dass es kein Zufall gewesen ist, dass die neue Frauenbewegung in ihrer Anfangszeit die Selbstbestimmung über Sexualität zu einer »Schlüsselfrage« machte.14 Sie schreibt: »Diese Werte- und Wissensrevolution, so lautet die These, schloss an die universalen kulturellen Werte der Moderne von Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit an, die der weiblichen geschlossenen Genusgruppe (s.u.) in der ersten Phase eben dieser Moderne verweigert worden war.«15 Diese Werte waren den Frauen nicht nur verweigert worden, sondern die Dualität und Hierarchisierung der Geschlechtscharaktere waren in gewisser Weise in die Moderne eingelassen. Die Frauen wurden zum Anderen des sich emanzipierenden männlichen Subjekts, wie Simone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht 1949 schrieb.16 Erst in Folge der neuen Frauenbewegung sollte sich mit der Frauen- (später Geschlechter-)Forschung ein Forschungsbereich entwickeln, der systematisch die sich als allgemeine verstehende männliche Perspektive dezentrierte. Und diese Forschungen haben viel zu unserem aktuellen Verständnis von Körper und Geschlecht beigetragen.
2.
Geschlecht und Körper aus historischer und soziologischer Perspektive
Es waren insbesondere wissenschaftshistorische Arbeiten, die herausgestellt haben, dass sich das Geschlechterverhältnis, so wie es uns alltagsweltlich gegeben erscheint, erst mit der modernen Gesellschaft herausgebildet hat. Die ›Natur der Frau‹ wurde gewissermaßen im 19. Jahrhundert entdeckt – in der unterschiedlichen Beschaffenheit ihres Körpers, ihrer Eierstöcke, ihres weichen Gewebes oder ihres (vermeintlich) kleinen Gehirnes. Diese am Körper festgemachte Unterschiedlichkeit diente dann der Legitimation des Ausschlusses von Frauen aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. Wie der Wissenschaftshistoriker Thomas Laqueur in
14 15 16
Lenz: Die Neue Frauenbewegung, 99. Ebd., 100. Beauvoir schreibt: »Sie wird mit Bezug auf den Mann determiniert und differenziert, er aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche gegenüber dem Wesentlichen. Er ist Subjekt, er ist das Absolute: sie ist das Andere.« Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Reinbek 1992, 12. Allerdings sieht Beauvoir diese Bestimmung nicht als Merkmal modernen Denkens, in ihrer Rekonstruktion findet sie Belege für die Hierarchisierung des Geschlechts bis in die Antike.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
seiner Studie Making Sex (1990, zu Deutsch Auf den Leib geschrieben) feststellt, wurden die geschlechtlichen Unterschiede bis in die Renaissance hinein primär sozial definiert und sekundär biologisch.17 Dieses Verhältnis drehte sich mit der Moderne um und die geschlechtlichen Unterschiede wurde wesentlich in den Körper verlagert und die sozialen ›ergaben‹ sich dann quasi aus diesen. Auch wenn die These mittlerweile als zu schematisch kritisiert wurde, so ist sie zumindest weiterhin historisch interessant: Laqueur zeichnet nach, wie sich von der Antike bis zur Moderne das Ein-Geschlechter-Modell in ein Zwei-Geschlechter-Modell wandelte. D.h. bis zur Moderne nahm man an, dass der männliche und weibliche Körper von ihrem Aufbau her gleich wären, dass beispielsweise die Geschlechtsorgane nur einmal nach außen und einmal nach innen gestülpt seien. Erst mit der Weiterentwicklung der Anatomie und der Herausbildung der Gynäkologie bildete sich immer genauer die Annahme einer fundamentalen Verschiedenheit der Geschlechter heraus. Die Soziologin Claudia Honegger hat sich mit dieser historischen Übergangsphase zu unserem modernen Verständnis von Körper und Geschlecht beschäftigt. Sie argumentiert anhand historischer Quellen, dass die Geschlechterdifferenz für die Schaffung des modernen Menschen insofern relevant gemacht wurde, als sich zeitlich mit der Herausbildung der Auffassung des modernen Menschen auch die Sonderanthropologie der Frau, die Gynäkologie, herausbildete. Während also ›der Mensch‹ das Thema der neuen Humanwissenschaften sein sollte, wird ›die Frau‹ als das Besondere in eine Spezialwissenschaft ›abgeschoben‹. Honegger hält dazu fest: »Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts tritt also der Mensch auf den Plan; kurz drauf aber folgt ihm das Weib und damit das vertrackte Problem mit dem Geschlecht.«18 Weiblichkeit wurde seither nicht nur als vor allem körperlich determiniert aufgefasst, sondern als Geschlecht, wohingegen Männer ein Geschlecht hatten und weniger selbst Geschlecht waren. Die Argumentation lautete zumeist, dass Frauen für die Reproduktion der Gattung zuständig seien aufgrund von Eierstöcken und Gebärmutter, dass sie damit auch naturnäher seien, während den Männern die Arbeit (im körperlichen aber auch geistigen Sinne) vorbehalten war und damit vor allem Tätigkeiten in der öffentlichen Sphäre. Die neuen Frauenbewegungen zielten mit ihrem Kampf für sexuelle und körperliche Selbstbestimmung, gegen (sexualisierte) Gewalt und für Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Bereichen somit genau gegen diese Naturalisierung des Geschlechterverhältnisses und forderten Autonomie auch in Bezug auf das Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Sexualität, was bisher stärker dem männ-
17 18
Vgl. Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, München 1996, 20f. Honegger, Claudia: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib 1750-1850, Frankfurt a.M. 1991, 6.
79
80
Imke Schmincke
lichen Geschlecht vorbehalten war.19 Die neuen Bewegungen hatten vor allem auf die politische Dimension des Geschlechterverhältnisses aufmerksam gemacht. Die sich in den 1970er Jahren entwickelnde Frauenforschung argumentierte, dass die Frauen zugeschriebenen Eigenschaften in erster Linie sozialer Natur seien und nicht aus dem körperlichen Geschlecht resultierten, dass also Männer und Frauen bei aller körperlichen Verschiedenheit, doch gleiche Rechte und Freiheiten haben müssten und dass die Unterschiede vielmehr mit der Erziehung und der Aufrechterhaltung männlicher Privilegien zu tun hätten. Für diese Auffassung bot sich die aus dem Englischen stammende Unterscheidung in sex und gender an, mit der das biologische Geschlecht (sex) auch begrifflich vom sozialen Geschlecht oder der Geschlechtsidentität (gender) getrennt werden konnte.20 In den 1990er Jahren geriet diese Trennung zunehmend in die Kritik, weil mittlerweile nicht nur der Status des Geschlechtlichen sondern auch dessen biologische Verankerung in Frage gestellt wurden. Die Kritik kam aus unterschiedlichen Richtungen: Historische Studien wie die erwähnte von Laqueur aber auch körpergeschichtliche Untersuchungen wie die von Barbara Duden machten deutlich, dass sich sowohl Konzepte und Modelle von Körper wie auch die Wahrnehmungs- und Erlebnisweisen des Körperlichen durch die Epochen hin unterschieden, dass somit der Körper – und damit auch der vergeschlechtlichte Körper – eine Geschichte hatte und sozialem Wandel unterlag.21 Ethnologische Forschungen hatten wiederum darauf aufmerksam gemacht, dass die als dichotom und unveränderlich angenommene Zweigeschlechtlichkeit keineswegs eine so universale Kategorie war,
19
20
21
An dieser Stelle sei nur kurz angemerkt, dass weder die erste noch die zweite Frauenbewegung eine einheitliche Bewegung waren. Vielmehr fanden sich in beiden sehr unterschiedliche Strömungen zusammen. Eine große inhaltliche Trennlinie bestand zwischen dem sogenannten Gleichheitsfeminismus und dem Differenzfeminismus. Während ersterer argumentiert, dass Frauen die gleichen Rechte, Freiheiten und Möglichkeiten wie Männer haben sollten und beide im Prinzip gleich seien, geht letzterer davon aus, dass Frauen und Männer fundamental verschieden seien, dass bisher das männliche Prinzip geherrscht habe und dass es darum gehen müsse, dem weiblichen Prinzip zu seinem Recht zu verhelfen und Weiblichkeit aufzuwerten. Diese Trennung geht auf die Sexualwissenschaftler und Psychologen John Money und Robert Stoller zurück, die in der Arbeit mit inter-, bzw. transsexuellen Menschen auf diese Weise zwischen dem bei Geburt zugeschriebenen und dem Wunschgeschlecht der Betroffenen unterscheiden wollten. Vgl. Duden, Barbara: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987; vgl. zur Körpergeschichte auch Lorenz, Maren: Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte, Tübingen 2000. Stoff, Heiko: Diskurse und Erfahrungen. Ein Rückblick auf die Körpergeschichte der 90er Jahre. In: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 14 (1999) 142-160. Eitler, Pascal/Scheer, Monique: Emotionengeschichte als Körpergeschichte: Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009) 282-313.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
wie im abendländischen Denken angenommen. Die vor allem mit dem Namen Judith Butler verknüpfte diskurstheoretische poststrukturalistische Geschlechterforschung argumentierte wiederum, dass Geschlecht zum einen stark mit Begehren und sexueller Orientierung verknüpft sei, dass zum anderen beide Produkt von Diskursen und damit auch Ausdruck sozialer Normierungen sind. Und nicht zuletzt wiesen soziologische Studien zum Interaktionsgeschehen darauf hin, wie sehr Geschlecht immer auch eine Frage der ›adäquaten‹ Zuschreibung und Darstellung ist. Harold Garfinkel hatte in seiner Studie zu der transsexuellen Frau Agnes von 1967 beschrieben, dass die geschlechtliche Zuordnung zwar aufgrund der primären Geschlechtsmerkmale geschieht, diese für die Alltagswelt aber gar nicht ausschlaggebend sind, weil sie meist verborgen sind. Vielmehr sorgen von daher eher sekundäre Merkmale (Gestik, Mimik, Stimme, Haare etc.) dafür, dass Menschen geschlechtlich meist eindeutig identifiziert werden können.22 Was bei Agnes überdeutlich war – das neu Erlernen geschlechtskonformen Verhaltens – gilt in abgeschwächter Form für alle Individuen, die in eine Gesellschaft hineingeboren werden, welche von ihnen eine klare geschlechtliche Identifizierung erwartet. Stefan Hirschauer und Gesa Lindemann schlossen an diese Forschung an, indem sie ihrerseits durch Interviews mit transsexuellen Menschen das doing gender und seine körperliche Dimension untersuchten.23 Lindemann arbeitete mit einer zeichentheoretischen und einer leibtheoretischen Perspektive und konnte aus dieser heraus verdeutlichen, dass und wie die Bedeutung von Körperregionen und Gefühlen sozial gerahmt, aber auch individuell empfunden und insofern verkörpert bzw. verleiblicht werden kann. Wie Paula-Irene Villa in ihrer soziologischen Perspektive auf Geschlecht zusammenfasst, wird Geschlecht/die Geschlechterdifferenz auf mehreren Ebenen naturalisiert: »Die Naturalisierung (Konstruktion der Natürlichkeit) der Geschlechterdifferenz umfasst also Prozesse der Darstellung (Hirschauer), der diskursiven Konfiguration (Butler) und der leiblichen Empfindung (Lindemann). Diese verschiedenen Dimensionen tragen alle dazu bei, dass die Geschlechterdifferenz alltagsweltlich als natürliche Tatsache wahrgenommen wird.«24 Wesentlich hierfür ist die körperlich-leibliche Verankerung des Geschlechts. Aus dem bisher Aufgeführten sollte deutlich geworden sein, dass die für uns alltagsweltlich relevante Zweigeschlechtlichkeit zwar körperlich basiert ist, aber dennoch sozialem Einfluss und damit auch Wandel unterliegt und vielfach Ergebnis
22 23
24
Vgl. Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs: 1967. Vgl. Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin und den Geschlechtswandel, Frankfurt a.M. 1993. Lindemann, Gesa: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl. Frankfurt a.M. 1993. Der Begriff des doing gender geht zurück auf West, Candace/Zimmermann, Don: Doing Gender. In: Gender & Society 1 (1987). Villa: Sexy Bodies, 228.
81
82
Imke Schmincke
der sozial und kulturell hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und ihrer hierarchischen Anordnung ist, die sich nicht nur in Normen und Diskursen realisiert, sondern auch in Institutionen und Organisationen materialisiert. Nun stellt sich aber auch die Frage, auf welche Weise die durch die Frauenbewegung angeschobene Politisierung Veränderungen hinsichtlich der Relevanz von Geschlecht und seiner körperlichen Verankerung bewirkt hat. Um diese Veränderungen soll es im Folgenden gehen, wenn ein – zugegeben sehr kursorischer und daher unvollständiger – Blick auf aktuelle Phänomene feministischer Körperpolitik geworfen wird.
3.
Aktuell zu Körper und Geschlecht
Nach wie vor gibt es Anlass für feministischen Protest und nach wie vor hängt dieser häufig mit zwei Themen zusammen, die auch zu Beginn der neuen Frauenbewegungen zentral waren: die Frage der sexuellen Selbstbestimmung in Verbindung mit den rechtlichen Regelungen von Schwangerschaftsabbrüchen und die Thematik (sexualisierte) Gewalt gegen Frauen. Letztere ist in jüngster Zeit vor allem durch die mit #metoo verknüpften Proteste gegen sexualisierte Gewalt in eine breite Öffentlichkeit getragen worden und hat weltweit eine enorme Resonanz erfahren. Auch wenn Jungen und Männer ebenfalls Opfer von (auch sexualisierter) Gewalt (auch durch Frauen) werden, so ist doch nach wie vor eine Mehrheit der Opfer weiblich.25 Die #metoo Kampagne machte auf den Zusammenhang von Macht und sexualisierter Gewalt vor allem im Kulturbereich aufmerksam. In Zuge der Debatten wurden aber auch Sexismus und sexualisierte Gewalt im Alltag von (zumeist aber eben nicht ausschließlich) Frauen skandalisiert. Die Gründe für die Gewalt gegen Frauen sind vielschichtig, sie haben auch mit Geschlechternormen zu tun und Vorstellungen darüber, dass Frauen Männern verfügbar sein müssten, dass Frauen stärker als Objekte sexueller Fantasien betrachtet werden und dass in den Normen hegemonialer Männlichkeit nach wie vor Macht mit Sexualität verknüpft werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen, für die es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regelungen gibt, vom absoluten Verbot bis zu einer liberalen Fristenregelung, nach welcher der
25
Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 25.11.2019, die sich auf die BKA Statistik zu Partnerschaftsgewalt im Jahr 2018 bezieht, sind 81,3 % der Opfer weiblich, bei Delikten hinsichtlich sexualisierter Gewalt sind es 98,4 % und 122 Frauen wurden in diesem Jahr von ihren (Ex-)Partnern getötet. Vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/gewalt-gegen-frauen---zahlen-weiterhinhoch-ministerin-giffey-startet-initiative--staerker-als-gewalt-/141688 (Letzter Zugriff am 27.2.2020).
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft straffrei ist. Das Thema Abtreibung ist in fast allen Ländern umkämpft und moralisch und emotional extrem aufgeladen. In jüngster Zeit entflammte in der BRD wieder die Debatte um den gesellschaftlichen Umgang mit Abtreibung, dieses Mal ging es um den § 219a, der die Werbung, aber damit eben auch einfach nur die Information über Schwangerschaftsabbruch als Angebot gynäkologischer Praxen kriminalisiert. Auch hier argumentierten die Gegner/-innen des § 219a mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ein drittes Thema, das gerade medial immer wieder einen großen Platz einnimmt, betrifft Fragen von Attraktivität, Schönheit und Geschlecht. Mehr denn je spielen das Aussehen und die Orientierung an gesellschaftlichen Schönheitsnormen für die Individuen eine große Rolle, besonders bei Frauen und Mädchen. Die Unzufriedenheit mit der eigenen Figur führt häufig zu Essstörungen und zu dem Wunsch nach körperlichen Veränderungen mit Hilfe plastischer Chirurgie. Frauen führen hier die Statistiken an.26 Das bedeutet, der Druck, einen attraktiven Körper zu haben, ist stärker mit weiblicher Identität verknüpft als mit männlicher. Trotzdem lässt sich beobachten, dass zunehmend auch Jungen und Männer dem Druck ausgesetzt sind, den eigenen Körper präsentieren und inszenieren zu müssen oder zu wollen und sich an Schönheitsnormen zu orientieren. Michael Meuser stellt in diesem Zusammenhang fest: »Den Zumutungen eines perfekten Körpers zu unterliegen ist nicht länger ein durchaus zweifelhaftes ›Privileg‹ der Frauen; die Männer beginnen, daran zu partizipieren.«27 Dies zeigt sich nach Meuser daran, dass der männliche Körper in vielerlei Hinsicht neue Aufmerksamkeit erhält: sei es in der Medizin, in der Werbung oder in Männermagazinen. Meuser deutet diese neue Aufmerksamkeit für den männlichen Körper als Ausdruck für den Wandel von Geschlechterverhältnissen (und damit im positiven Sinn sicher auch für das Aufbrechen starrer Geschlechternormen); aber auch als Ausdruck eines grundsätzlichen Wandels von Körperverhältnissen. Die enorme Bedeutung von Social Media in der Alltagswelt verschärft den Druck, einen ›präsentablen‹ Körper besitzen zu müssen. Denn zunehmend sind Bilder die Währung der Internet-Kommunikation und dabei kommt der Sichtbarkeit von Körpern eine große Relevanz zu. Körperbilder werden inszeniert, geteilt, bewertet, getauscht und auch manipuliert. Die Wirkungen und Möglichkeiten der Visualität von vergeschlechtlichten Körpern durch Social Media ist als ambivalent zu bewerten. So lässt sich zum einen zeigen, dass Geschlechterstereotype durch 26
27
Nach einer Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie aus dem Jahr 2016 sind 86,6 % der Patient/-innen weiblich. Der am meisten nachgefragte Eingriff ist die Brustvergrößerung, gefolgt von Augenlidkorrektur und Fettabsaugung, vgl. https://www.dgaepc.de/geschlechterverteilung-in-der-aesthetisch-plastischen-chirurgie/. (Letzter Zugriff am 27.2.2020). Meuser: Frauenkörper – Männerkörper, 288.
83
84
Imke Schmincke
Social Media stark reproduziert werden, wie beispielsweise in der MaLisa-Studie zur Darstellung von Männern und Frauen auf Plattformen wie Youtube und Instagram sowie in Musikvideos deutlich geworden ist.28 Auf den 100 beliebtesten Kanälen bzw. Musikvideos bzw. bei den Top 100 Instagramer/-innen sind doppelt so viele Männer wie Frauen präsent. Außerdem sind Männer in vielseitigeren Kontexten inszeniert, während Frauen sich fast ausschließlich im Bereich Beauty wiederfinden. Auch die Selbstdarstellungen insbesondere bei Influencerinnen auf Instagram sind extrem einheitlich: Es herrscht ein stereotypes Frauenideal (weiß, schlank, lange Haare), Frauen inszenieren sich vor allem als sexy und passiv. Problematisch sind die Inszenierungen auf Social Media insofern, als dort teilweise suggeriert wird, dass ›ganz normale Leute‹ ›ganz normale Bilder‹ von sich posten, auch wenn selbstverständlich alle Fotos inszeniert und manche extrem bearbeitet sind. Das erhöht den Druck auf die Konsument/-innen, die immer stärker danach streben ähnlich attraktiv zu sein wie ihre Idole. Zum anderen bietet Social Media jedoch auch viele Möglichkeiten der Kritik und Vernetzung all jener, die Normierung und Stereotypisierung bezogen auf geschlechtliche Identität und Körper als problematisch erleben. So gibt es auf Social Media, in Form von Blogs, auf Twitter, Instagram etc. auch eine Vielfalt von Körperbildern, hier werden unkonventionelle Körperbilder gezeigt und die User/-innen ermächtigen sich auf diese Weise und bilden eine Community. Ein aktuelles Beispiel für eine Gegenbewegung wäre die Body Positivity Bewegung, bei der Leute mit Hilfe von Bildern zu #bodypositivity für Körperakzeptanz werben und ›andere‹ Körper jenseits der Norm zeigen und aufzuwerten versuchen. Je nachdem welchen Hashtag man wählt, kann man Teil von sehr unterschiedlichen Communities werden und die Vielfalt weiblicher und anderer Körper thematisieren und sich über den Austausch von Bildern und Erfahrungen mit anderen solidarisieren. Die genannten Beispiele sind keineswegs repräsentativ, um abschließend beurteilen zu können, inwiefern sich Geschlechter- und Körperverhältnisse grundlegend verändert haben. Aber sie geben meines Erachtens Aufschluss darüber, dass wir es mit der Gleichzeitigkeit von durchaus widersprüchlichen Phänomenen zu tun haben. So spricht nach wie vor eine Reihe von Indizien dafür, dass Frauen mehr als Männern zugeschrieben wird, körperlich und geschlechtlich determinierte Wesen zu sein (sei es in Hinblick auf die Reduktion auf physische Attraktivität oder auf die Funktion zur Reproduktion). Daneben gibt es aber auch eine Angleichung der Geschlechter, in zweierlei Richtung. Zum einen wird Frauen eine weitaus größere Autonomie über ihren Körper und ihre Sexualität zugestanden als zu Beginn der neuen Frauenbewegung vor 50 Jahren. Zum anderen wird auch für Männer die Sorge um den eigenen Körper und vor allem um dessen Attraktivität entsprechend 28
Vgl. Ergebnisse der Studie online unter: https://malisastiftung.org/geschlechterdarstellungneue-medien/ (Letzter Zugriff am 27.2.2020).
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
gesellschaftlicher Schönheitsnormen immer wichtiger. Dies ist nicht unbedingt als Akt der Emanzipation zu begreifen, wenn man sich vor Augen führt, wieviel Leid entsteht, wenn der eigene Körper in Passung gebracht werden muss mit gesellschaftlichen Normen. Die letzteren Phänomene sind Ausdruck einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderung, die im Zuge der sich etablierenden geistesund sozialwissenschaftlichen Körperforschung schon seit vielen Jahren thematisiert wird: In einer zunehmend von Individualisierungsideologien durchdrungenen Gesellschaft, in der traditionelle Bindungen und Bezüge porös werden, verändert sich auch das Verhältnis von Selbst und Körper.29 Das Auseinandertreten von beidem ist selbst ein Kennzeichen der Moderne, in der Spätmoderne bekommt aber das Verfügbarmachen und Gestalten des eigenen Körpers eine neue Funktion: die der Selbstvergewisserung. Körper und auch Geschlecht werden zunehmend reflexiv und damit – ob vermeintlich oder tatsächlich – zu etwas, das als Ressource zur Identitätsstabilisierung genutzt kann.
4.
Fazit: Reflexivierung von Körper und Geschlecht
Und so komme ich am Schluss zu einer Ausgangsthese der Körpersoziologie zurück. Die Soziologie begann sich ab den 1980er/90er Jahren nicht nur deshalb mit dem Körper zu beschäftigen, weil sie diesen jahrelang ›vernachlässigt‹ hatte. Sie beschäftigte sich ja auch mit ihm, weil dieser in jener Zeit gesellschaftlich neu aufgewertet wurde. Mit dem Stichwort vom »Körperboom« ist das gestiegene Interesse am eigenen Körper gemeint, der Boom von Fitness und Sport allgemein, neue Bewegungs- und Gesundheitstrends, in den letzten Jahren vor allem die zunehmende Bedeutung von Ernährung.30 In der Spätmoderne sind Identität und Körper beide zu reflexiven Projekten geworden, deren Einheit von den Individuen unter Bedingungen des globalisierten Wandels selbst gestaltet werden muss. Der Körper kann nun gestaltet werden, aber er muss es auch. Und gleichzeitig bietet die Beschäftigung mit dem eigenen Körper Orientierung in einer Welt, deren Verfügbarkeit und Gestaltbarkeit weniger denkbar denn je wird. Markus Schroer bezeichnet den Körper daher auch als »rettenden Anker im Meer der Kontingenzen.«31 Damit ist gemeint, dass in einer Welt der permanenten Beschleunigung und
29
30 31
Vgl. Meuser, Michael: Zwischen »Leibvergessenheit« und »Körperboom«. Die Soziologie und der Körper. In: Sport und Gesellschaft 1 (2004) 197-218. Schroer, Markus: Einleitung. Zur Soziologie des Körpers. In: Ders. (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M.: 2005, 7-47. Villa, Paula-Irene (Hg.): Schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst, Bielefeld 2008. Vgl. Meuser, Zwischen »Leibvergessenheit. Schroer, Einleitung, 22.
85
86
Imke Schmincke
Veränderung der Körper in seiner Schwerfälligkeit, Eigenwilligkeit und Unmittelbarkeit dem Individuum ein Gefühl der Sicherheit und Verlässlichkeit vermitteln kann. In diesem Rahmen gleichen sich Männer- und Frauenkörper insofern an, als sie jeweils als gestaltbar angenommen werden. Je weniger selbstverständlich und ›natürlich‹ die Geschlechtlichkeit erscheint, desto mehr sind Frauen und Männer auch für ihre Gender-Performance ›verantwortlich‹. Wir erleben aktuell eine paradoxe Gleichzeitigkeit hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung von Körper und Geschlecht: Einerseits lösen sich stereotype Geschlechtervorstellungen auf, die Zweigeschlechtlichkeit als Norm verliert ihre kulturelle Hegemonie (Stichwort: drittes Geschlecht); Körper und Geschlecht sind zunehmend reflexiv, werden bearbeitet und gestaltet. Und gleichzeitig lässt sich der Wunsch nach Vereindeutigung erkennen aufgrund von Unsicherheiten, die das Prekärwerden traditioneller Rollen auslöst. Hierauf reagieren dann vor allem rechtspolitische Gruppen mit einer Politik der Angst (Stichwort »Genderideologie«), und bieten als Heilmittel eine binäre und hierarchische Ordnung. Die bisherigen inter- und transdisziplinären Forschungsergebnisse zeigen die Wichtigkeit an anzuerkennen, dass Geschlecht eine zutiefst körperlich verankerte Gegebenheit ist (d.h. keine Frage des Bewusstseins und noch viel weniger eine der subjektiven Wahl); dass gleichzeitig aber auch anerkannt werden muss, dass die Verkörperung von Geschlecht durch soziale und kulturelle Normen geleitet wird, die durchaus veränderbar sind und es auch schon immer waren.
Literatur Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Reinbek 1992. Beck, Ulrich/Giddens, Anthony/Lash, Scott: Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt a.M. 1996. Boston Women’s Health Book Collective: Our Bodies, Ourselves. A Healthy Book by and for Women, New York: Simon and Schuster 1975. Davis, Kathy: The Making of Our Bodies, Ourselves. How Feminism Travels across Borders, Durham 2007. Deuber-Mankowsky, Astrid: Natur – Kultur: ein Dualismus als Schibboleth der Gender- und Queer Studies? In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 13-22. Dohm, Hedwig: Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen, Berlin 1876, Reprint Bern 1986. Dohm, Hedwig: Die Antifeministen. Ein Buch der Verteidigung, Berlin 1902, wiederabgedruckt in Ariadne Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte 71 (2017) 38-45, 43.
Von der ›Natur der Frau‹ zur feministischen Körperpolitik
Duden, Barbara: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987. Eitler, Pascal/Scheer, Monique: Emotionengeschichte als Körpergeschichte: Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009) 282-313. Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs 1967. Gerhard, Ute: Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Reinbek 1990. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2015. Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin und den Geschlechtswandel, Frankfurt a.M. 1993. Honegger, Claudia: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib 1750-1850, Frankfurt a.M. 1991. Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, München 1996. Lenz, Ilse: Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, Wiesbaden 2008. Lindemann, Gesa: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl, Frankfurt a.M. 1993. Lorenz, Maren: Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte, Tübingen 2000. Möbius, Paul Julius: Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1900. Stoff, Heiko: Diskurse und Erfahrungen. Ein Rückblick auf die Körpergeschichte der 90er Jahre. In: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 14 (1999) 142-160. Meuser, Michael: Frauenkörper – Männerkörper. Somatische Kulturen der Geschlechterdifferenz. In: Schroer, Markus (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M. 2005, 271-294. Meuser, Michael: Zwischen »Leibvergessenheit« und »Körperboom«. Die Soziologie und der Körper. In: Sport und Gesellschaft 1 (2004) 197-218. Offen, Karen M.: European Feminisms. 1700-1950 A Political History, Stanford 2000. Schaser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848-1933, Darmstadt 2006. Schroer, Markus: Einleitung. Zur Soziologie des Körpers. In: Ders. (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M.: 2005, 7-47 Schulz, Kristina: Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und Frankreich 1968-1976, Frankfurt a.M. – New York: 2003 Steinbrügge, Lieselotte: Das moralische Geschlecht. Theorien und Entwürfe über die Natur der Frau in der französischen Aufklärung, Weinheim – Basel 1987. Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper, Opladen 2 2001.
87
88
Imke Schmincke
Villa, Paula-Irene (Hg.): Schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst, Bielefeld 2008. West, Candace/Zimmermann, Don: Doing Gender. In: Gender & Society 1 (1987).
Körper, Ästhetisierung, Regulierung
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge Martin Dinges
1.
Das Konzept Hegemoniale Männlichkeit
Das Konzept Hegemoniale Männlichkeit ist immer noch global das Leitkonzept der soziologischen Männlichkeitsforschung, weshalb es hier kurz vorgestellt werden soll. Es stammt vom australischen Soziologen Robert Connell, der es 1995 unter dem Titel »Masculinities« veröffentlichte. Im deutschsprachigen Raum wurde es unter dem Titel »Der gemachte Mann« 1999 publiziert.1 Zentral in seinem Werk ist der Hegemoniebegriff. Mit ihm versuchte der italienische Sozialtheoretiker Antonio Gramsci in den 1930er Jahren zu erklären, warum sich bei der italienischen Einigung und später beim Aufstieg des Faschismus immer wieder Klasseninteressen durchgesetzt haben, die nicht den materiellen Interessen der Mehrheit entsprachen. Die Erklärung sah er in der kulturellen Vorherrschaft des Bürgertums, dem es gelang, dem Rest der Bevölkerung seine eigenen Präferenzen nahezubringen, obwohl sie nicht der Mehrheit dienten.2 Connell wendet das Hegemoniekonzept auf das männliche Geschlecht an, das ebenfalls privilegiert sei. Das belegt er mit den bekannten Fakten zu höherer gesellschaftlicher und politischer Entscheidungsmacht, höheren Einkommen und ggf. der patriarchalischen Verfügung über die Arbeitskraft von Frauen und Kindern. Privilegien seien aber immer rechtfertigungsbedürftig. Insofern impliziert der Hegemoniebegriff eine defensive Lage, in der die angegriffenen Vorrechte verteidigt werden müssen.
1
2
Connell, Robert W.: Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten, Opladen 1999. Für eine ausführlichere Darstellung des Konzepts s. zuletzt Dinges, Martin: »Hegemoniale Männlichkeit« – Nutzen und Grenzen eines Konzepts. In: Becher, Matthias (Hg.): Transkulturelle Annäherungen an Phänomene von Macht und Herrschaft. Geschlechterdimensionen und Spannungsfelder, Göttingen 2020 i.E. Für eine gründliche Auseinandersetzung s. Dinges, Martin (Hg.): Männer – Macht – Körper. Hegemoniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt 2005. https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturelle_Hegemonie (Letzter Zugriff am 22.05.2020).
92
Martin Dinges
Das geschehe anhand eines Leitbildes hegemonialer Männlichkeit, zu der die Insignien der Verfügungsmacht sowie notfalls Gewalt gehören. Es handelt sich um ein Leitbild, an dem sich alle orientieren. Dabei besteht durchaus eine interne Differenzierung unter den Männern: Wenige sind besonders erfolgreich und erfüllen das Leitbild vollständig, andere sind nur kleine Angestellte oder arbeitslos. Sie profitieren aber alle von der Tatsache, Männer zu sein.3 Das bezeichnet Connell als komplizenhafte Männlichkeit. Einige Männer werden ausgegrenzt, insbesondere Homosexuelle. Sie gelten – ähnlich wie nicht weiße – als marginalisierte Männer. Sie haben nur sehr wenig davon, ein Mann zu sein. Connell entwirft historisch unterschiedliche Konstellationen, aber seiner Ansicht nach bleibt Männlichkeit immer hegemonial gegenüber Weiblichkeit. Diese in Stein gemeißelte Dauer des Patriarchats ist eine theoretische Erbschaft des damaligen Feminismus.4 Der Körper ist bei Connells »gemachtem Mann« ein Instrument männlicher Herrschaft, das durch Training und Sport zugerichtet und ggf. schönheitschirurgisch verbessert wird.5 Heterosexuelle Penetration wird als Unterwerfung von Frauen konzeptualisiert.6 Sexuelle Bedürftigkeit von Männern werde ggf. durch Prostitution oder Gewalt befriedigt. Unsicherheiten oder Schwierigkeiten beim Sex würden allerdings auch im Dialog mit Partnerinnen oder reflexiv bewältigt.7 Häufig wird von gewalttätigen Vätern berichtet, deren Beitrag zur Sozialisation Prügel seien und die Abwertung von Frauen.8 Zugewandte Väter sucht man vergeblich. Die Homophobie sei konstitutiv für die zwangsheterosexuelle hegemoniale Männlichkeit.9 Insgesamt ist das ein instrumentell verkürztes, weitgehend auf beeindruckende Performanz und Sexualität reduziertes Körperverständnis.10 Erst in dem späteren Werk »Gender« (2013) wird der Körper stärker als Instrument der Nähe zu anderen und der Sinnerfahrung thematisiert. Aspekte wie Schwäche und Krankheit, Behinderung oder das Problem der Selbstabwertung wegen der ungenügenden Erfüllung von gesellschaftlichen Standards fehlen weiterhin.11 Das Körperverständnis im Konzept der hegemonialen Männlichkeit muss al-
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vgl. Connell: Mann, 97-103. Möglichkeiten eines gewissen Wandels hat sie in einem späteren Buch »Gender« etwas ausgearbeitet in Connell, Raewyn: Gender, Wiesbaden 2013 [2009], 105ff., 126ff. Vgl. Connell: Mann, 70, 74f., 83. Vgl. Ebd., 105. Vgl. Ebd., 80f., 154, 196. Vgl. Ebd., 122, 187. Vgl. Ebd., 83, 99, 195. Vgl. Ebd., 78f. Möglicherweise bildete dieses instrumentelle Verständnis auch einen Hintergrund für seine spätere Geschlechtsumwandlung zu Raewyn Connell. Ein kurzer Hinweis auf das Altern Connell: Mann, 77.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
so als unterkomplex bezeichnet werden.12 Die dominant herrschaftssoziologische Rahmung leuchtet lediglich Aspekte von Dominanz im Geschlechterverhältnis aus. Unzureichend ausgearbeitet sind die physischen und insbesondere die psychischen Kosten der Konditionierung von Männern für ihre Rolle.
2.
Bilder von Männern und ihrem Umgang mit dem Körper
Sehen wir uns nun anhand einiger Bilder das Thema »Männer« im aktuellen Mediendiskurs an. Statt der Werbebilder von Idealkörpern bevorzuge ich Darstellungen zum Zusammenhang von Männern und Gesundheit, da dieser mehr über ihr Verhältnis zum eigenen Körper aussagt. Letzteres bietet häufig Anlass für Karikaturen, wie man auf einer Werbekarte der Stiftung Männergesundheit in Berlin sehen kann.13 Da machen zwei wohlbeleibte Herren kritische Kommentare über einen Dritten, der am Joggen ist. Das Laufen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes halten sie offenbar für unmännlich. Die Kritiker selbst sind reichlich übergewichtig, einer raucht, beide haben eine Alkoholflasche in Griffweite. Damit weisen sie alle Marker traditioneller Männlichkeit auf: Sie sind wohlgenährt, konsumieren schon am hellen Tag Alkohol und rauchen. Mit dieser Karikatur wird gleichzeitig ein für die Gesundheit riskantes Verhalten von Männern kritisiert: Rauchen schädigt nachhaltig die Gesundheit. Übermäßiger Alkoholkonsum greift nicht nur die Leber an, alkoholisierte Personen können auch Verkehrs- und Arbeitsunfälle verursachen. Schließlich gilt die Flucht in den Alkoholkonsum als männertypischer Versuch, Probleme zu bewältigen. Ein anderer, weit verbreiteter Zugang zum Thema sind die alle Jahre wieder in den Medien kolportierten Berichte zu »Männerschnupfen« bzw. »Männergrippe«. Im Kern geht es darum, dass sich Männer bei dieser häufigen Befindlichkeitsstörung angeblich unverhältnismäßig schnell und viel beschweren, während sie ernsthafte Verletzungen oder Krankheiten stoisch ertragen und schweigsam bleiben.14 12
13 14
Man könnte Connells Körperkonzepte aber anhand des Hegemoniebegriffs weiterentwickeln. Erinnert sei an die feministische Kritik am »raumgreifenden Verhalten« von Männern, der Durchsetzungsfähigkeit ihrer Stimme, auch von Einschüchterungspraktiken von Männern. Hinsichtlich der Sozialisation z.B. mit dem Habituskonzept entlang der »ernsten Spiele des Wettbewerbs« zur Herstellung von Hegemonie s. Meuser, Michael: Männerwelten. Zur kollektiven Konstruktion hegemonialer Männlichkeit. Schriften des Essener Kollegs für Geschlechterforschung. Hg. von Janshen, Doris/Meuser, Michael, Essen 2001, auch digital als https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ekfg/michael_meuser_maennerwelten.pdf (Letzter Zugriff am 04.02.2020). Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Männergesundheit. Z. B. Herzog, Anna/Hutzenlaub, Lucinde: Männergrippe. Husten, Schnupfen, Heiserkeit und andere für Kerle lebensbedrohliche Zustände, Berlin 2018.
93
94
Martin Dinges
Abbildung 1: »Gesunde Männer«?
Bereits bei leicht erhöhter Körpertemperatur halten sie sich angeblich für lebensgefährlich bedroht. Ihre Fähigkeit, Beschwerden auszuhalten, sei bei Erkältungen lächerlich gering. Sie benähmen sich wie Schwächlinge. Der eigentliche »Witz« beim Männerschnupfen besteht darin, dass Männer, die als stark imaginiert werden, sich als besonders schwach erweisen. Es macht männlichen wie weiblichen Beobachtern offenbar Angst, dass Erwachsene in eine Kinderrolle zurückfallen könnten. Im öffentlichen Diskurs lehnt man solche Schwächen bei Männern massiv ab: Stattdessen sollen die Leser glauben, Männer müssten – möglichst immer – Stärke zeigen, um so dem erwünschten Bild von Männlichkeit zu entsprechen. Im Grund versuchen diese Bilder, Männer symbolisch auf Stärke festzulegen – eine Abweichung davon wird mit Lächerlichkeit abgestraft. Männer haben weit über den Schnupfen hinaus beim Thema Gesundheit einen schlechten Ruf. Das betrifft ihre angebliche Neigung, viel zu spät zum Arzt zu gehen: Dazu müssen sie offenbar, selbst bei schweren Schmerzen, erst von ihren klugen Partnerinnen überredet werden, wie das folgende Foto aus der Frankfurter Neuen Presse zeigt:15 Der schwer leidende Mann weiß sich nicht selbst zu helfen. Da weist ihm seine Partnerin mit dem Zeigefinger den Weg in die Arztpraxis. Da sie »die Vernunft« auf ihrer Seite hat, darf der Fingerzeig auch die wichtige Bildmitte einnehmen. 15
https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/usingen-ort893437/maennergesundheit-vorsorgegehen-intelligent-10438132.html (Letzter Zugriff am 04.02.2020).
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Abbildung 2: Originalbildunterschrift: »Viele Männer lassen sich erst untersuchen, wenn sie schon richtig krank sind. Aber regelmäßige Arztbesuche allein reichen nicht.«
Dieser Mann wird offenbar verspottet, weil er einem unrealistischen Selbstbild als Mann nachjagt. Er möchte um jeden Preis Schmerzen aushalten – auch auf die Gefahr hin, sich gesundheitlich zu schädigen. In Gesundheitsangelegenheiten ist er gänzlich unfähig. Hilfe will er nicht einmal vom Arzt als Fachmann – vielleicht, weil er alles selbst lösen möchte, also auf seiner Autonomie besteht. In seinem Zustand ist das allerdings irrational. Abschließend möchte ich noch kurz einen Blick auf das Thema gesunde Ernährung werfen, das heute in aller Munde ist. Auch hier gelten Männer als problematisch: Sie essen unregelmäßig, zu wenig Gemüse und Obst, zu unausgewogen und zu fett. Ein Bild »Bauch – Beine – Po für Männer« des Künstlers Steve Wildi zeigt die entsprechenden fetten Bratenstücke, die knusprig auf Tellern serviert sind. Es deutet gleichzeitig an, warum Frauen sich anders verhalten: Schlankheit ist für viele ein wichtiges Attraktivitätsziel. Ganz nebenbei nutzt das oft auch ihrer Gesundheit. Wenn Männer versuchen, sich – etwa im Krankheitsfall – selbst zu versorgen, dann machen sie nach Ansicht mancher »Witzbolde« ebenfalls alles falsch: Sie grillen, weil sie offenbar nur diese Zubereitungstechnik beherrschen, und sind offenbar so fleischsüchtig, dass sie auch vor Selbstverstümmelungen nicht Halt machen: Auf einem entsprechenden Cartoon hat sich der Mann am Grill den eigenen Arm abgehackt, um ihn zu rösten und winkt glücklich mit dem Stummel. Ein stär-
95
96
Martin Dinges
ker instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper kann man sich kaum vorstellen….
3.
Zur genderpolitischen Funktion dieser Diskurse
Ein derartiger Argumentationsstil, Männer als Gesundheitsidioten lächerlich zu machen, ist heutzutage weit verbreitet. Man kann diesen Defizitdiskurs auch in der sogenannten Qualitätspresse finden – etwas weniger zugespitzt. Beim »Spiegel« mag die Zugehörigkeit zur Qualitätspresse vielleicht schon 2003 fragwürdig gewesen sein. Er titelte jedenfalls am 15. 9. 2003 »Eine Krankheit namens Mann«.16 Die FAZ gilt als Musterbeispiel für soliden Journalismus, karikierte Männer aber anlässlich der Veröffentlichung eines neuen Manuals des amerikanischen Psychologenverbandes (APA) für die »Psychological Practice with Boys and Men« ebenfalls. Die Psycholog/-innen seien nun gerüstet, wenn »ein richtiger Mann, der samstags im verschwitzten Unterhemd zum Baumarkt fährt und dort einen Profibohrhammer kauft«, vor ihrer Tür stehen sollte.17 Damit genug des Männerbashings! Ich werde jetzt nicht im Einzelnen dem Wahrheitsgehalt dieser Aussagen nachgehen. Die folgende Graphik rückt zumindest einige Fakten zurecht. Man sieht daran, dass das sogenannte »starke Geschlecht« noch nicht ganz so verloren ist, wie es etwa der »Spiegel« herbeischrieb. Bei der gesunden Ernährung ist der Abstand zwischen Männern und Frauen gar nicht so groß – gut zwei Fünftel der Männer und die Hälfte der Frauen kümmern sich darum – aber drei Fünftel der Männer und die Hälfte der Frauen finden das nicht so wichtig. Auch bei Impfungen und beim Händewaschen liegen die Männer nur knapp hinter den Frauen. Tatsächlich gehen vier Fünftel der Frauen ohne akuten Krankheitsanlass zum Arzt, immerhin auch zwei Drittel der Männer. Der Unterschied dürfte sich großenteils aus den gynäkologischen Routineuntersuchungen ergeben. Hier ist die Feststellung wichtiger, dass diese Schwarz-Weiß-Bilder entlang der Geschlechtergrenze nur funktionieren, weil man erstens undifferenziert die Frauen den Männern gegenüberstellt und zweitens die Unterschiede betont. Das gilt für einen Großteil des Diskurses zu »den Geschlechtern«. Die dargestellten Zahlenangaben lassen aber nur die Feststellung zu, dass sich etwas mehr Frauen gesund ernähren als Männer. Erst dann beginnen die wirklich interessanten Fragen: Welche Männer ernähren sich weniger gesund und warum? Sind es vielleicht diejenigen mit den aufreibenden Jobs wie die Paketboten, die meistens sehr jung und sehr selten zu Hause sind und deshalb zwischendurch an 16 17
www.spiegel.de/spiegel/print/d-28591080.html (Letzter Zugriff am 04.02.2020). FAZ Nr. 19, 23.1.2019, 9.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Abbildung 3: Unterschiede im Gesundheitsverhalten sind wenig dramatisch
den Schnellimbiss gehen? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass immer noch fast 90 % der Männer Ganztagstätigkeiten nachgehen, aber über 90 % der Halbtagsjobs von Frauen ausgeübt werden– und diese dadurch eher Zeit zum Kochen haben? Bekommen Jungen vielleicht weiterhin von ihren Müttern vermittelt, dass sie in der Küche nicht so viel zu suchen haben wie ihre Schwestern und meinen deshalb, Mahlzeiten zuzubereiten und sich mit Lebensmitteln auszukennen, sei eher »Frauensache«? Sollten Jungen mit ihrem Körperbild vielleicht zufriedener sein, wenn sie »groß und stark« aussehen und deshalb kräftig beim Fleisch zulangen, während Mädchen häufig mit ihrem Körperbild hadern und sich deshalb auf Schlankheit trimmen? Die oben vorgeführten angeblich geschlechterspezifischen Verhaltensweisen im Umgang mit dem Körper und der Gesundheit haben viel mit dem Lebensalter,
97
98
Martin Dinges
der Rolle innerhalb der Familie und der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung zu tun. Tatsächlich teilen Männer und Frauen viele Eigenschaften und Verhaltensweisen. Sie sind viel ähnlicher als man es oft darstellt.18 Offenbar sollen mit den vorgeführten verbalen und bildlichen Diskursen die Geschlechtergrenzen stabilisiert werden, die viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als zu verwischt einschätzen. Das ist die erste genderpolitische Funktion.19 Die Botschaft ist jedenfalls klar: Männer sollen hart sein, also nicht wehleidig; ernährungskompetent; gesundheitskompetent, wenn es z.B. um die Einschätzung eigener Leiden und der Notwendigkeit von Arztbesuchen geht, also autonom. Dieser Körperdiskurs ist auch funktional für eine gewisse männlich geprägte Arbeitswelt.
4.
Der Körperdiskurs ist funktional für eine besondere, männlich geprägte Arbeitswelt
Körper sind gleichermaßen »Gegenstand sozialer Praxis als auch Handelnde in der sozialen Praxis«.20 Körper agieren zwischen den alltäglichen Prozessen und den gesellschaftlichen Strukturen. Connell nennt das »soziale Verkörperung. Vom Standpunkt des Körpers ließe es sich als ›körperreflexive Praxis‹ bezeichnen, das heißt menschliches Sozialverhalten, in dem Körper sowohl Handelnde als auch Objekte sind«21 – also weder biologisch noch gesellschaftlich vollständig determiniert, vielmehr besteht ein Wechselverhältnis zwischen Körpern und Umwelt. Die Forderung nach Härte passt gesellschaftlich gut zu einer Arbeitswelt, in der viele Männer, etwa als Industriearbeiter, ihre Gesundheit investieren. Körperlich schwere Arbeit gilt als klassische Männerarbeit. 93,6 % der tödlich Verunglückten bei Arbeitsunfällen sind Männer.22 Mit Schwerarbeit einhergehende gesundheitsschädigende Verhaltensweisen wie hoher Alkoholkonsum mochten eine gewisse »Rationalität« aufweisen, wenn man davon ausgehen musste, dass das Leben eh kurz und anstrengend war. Das Motto »kurz, aber intensiv leben« machte dann vielleicht Sinn.
18 19
20 21 22
Connell: Gender, 94-98. Die Dramatisierung von Geschlechterdifferenz kann ganz unterschiedlichen Zwecken dienen, s. Theunert, Markus: Co-Feminismus: wie Männer Emanzipation sabotieren – und was Frauen davon haben, Bern 2013, bes. 125. Connell: Gender, 98f. Connell: Gender, 99. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/ toedliche-arbeitsunfaelle.html (Letzter Zugriff am 04.02.2020), bei den nicht tödlichen 2,6 mal so viel wie Frauen.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Allerdings wird der Mittel- und Oberschicht zugeschrieben, dass sie nicht ihre Gesundheit investiert, sondern in ihre Gesundheit investiert – zum Beispiel, um mehr vom Leben und der längeren Lebenserwartung zu haben. Dazu passen dann die »moderneren« Anforderungen von Ernährungs- und Gesundheitskompetenz. Auf beide Zielgruppen trifft die Forderung zu, durchzuhalten und nicht wehleidig zu sein. Es ist auch kein Zufall, dass sich diese Diskurse und die Fitnesserwartungen so vorrangig an Männer richten, obwohl auch viele Frauen anstrengende, belastende, schlecht bezahlte und repetitive Tätigkeiten ausüben.23 Der erwünschte harte Umgang mit dem eigenen Körper und eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegenüber psychischen Belastungen entsprechen genau der männerbündischen Struktur unserer Arbeitswelt.24 Deren grundlegendes Muster ist die bedingungslose Einsatzbereitschaft für die Ziele der Organisation. So stellt die Mehrheit aller Männer tatsächlich immer noch die Arbeit über ihre Gesundheit.25 2008 waren es 56 % der Männer.26 Gefordert sind außerdem dauernde Präsenz, bei Bedarf Überstunden. Männer machen sie doppelt so häufig wie Frauen – meistens werden sie vom Unternehmen angeordnet oder gehen auf ein zu hohes Arbeitspensum zurück.27 Männer machen auch zwei Drittel der seit 1996 zunehmenden Nacht- und Wochenendarbeit.28 Die dabei selten thematisierte, aber selbstverständlich angenommene Voraussetzung ist, dass eine »Frau dem Mann den Rücken freihält«, also ein traditionelles Geschlechterarrangement, bei dem Frauen auf Erwerbsarbeit und Rentenansprüche verzichten. Damit sind zwei wichtige Effekte hegemonialer Männlichkeit benannt: Zunächst die bessere Bezahlung gleichwertiger Arbeit von Männern. Allein die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht garantiert tatsächlich in vielen Bereichen eine bessere pekuniäre Anerkennung. Jedenfalls zeigt sich das, wenn man 23 24
25
26
27 28
Schon seit dem 19. Jh., s. Martschukat, Jürgen: Das Zeitalter der Fitness. Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde, Frankfurt 2019, 111-115, 123-126 und passim. Höyng, Stephan/Schwerma, Klaus: Gender Mainstreaming – Möglichkeiten und Grenzen aus der Perspektive von Männern. In: Nohr, Barbara/Veth, Silke (Hg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexionen einer neuen Strategie, Berlin 2002, 56-63. Höyng, Stephan/Puchert, Ralf: Die Verhinderung der beruflichen Gleichstellung: männliche Verhaltensweisen und männerbündische Kultur, Bielefeld 1998, 159ff., 169f., 237f., 259. So schon 1978, s. die Diskussion bei Lehner, Erich: »Männer stellen Arbeit über ihre Gesundheit«. Männliche Lebensinszenierungen und Wunschrollenbilder. In: Altgeld, Thomas (Hg.): Männergesundheit: neue Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention, Weinheim/Bergstr. 2003, 53. Volz, Rainer/Zulehner, Paul M.: Männer in Bewegung: zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland, Baden-Baden 2009, 149. besonders die »teiltraditionellen« (66 %) und »balancierenden« (68 %). Das waren etwas weniger als die 59 % von 1998. Bei den Frauen war der Wandel stärker von 64 % zu 52 %! https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-10/arbeitszeitbefragung-deutschland-arbeitnehmerueberstunden-durchschnitt (Letzter Zugriff am 04.02.2020). https://www.boeckler.de/46021.htm(Letzter Zugriff am 04.02.2020).
99
100
Martin Dinges
auch die psychisch-soziale Belastung, die Kenntnisse und die Verantwortung für andere bei der Arbeitsbewertung einbezieht.29 Mit Connell könnte man das als »patriarchale Dividende« des männlichen Geschlechts bezeichnen.30 Der zweite Effekt ist die Verlagerung der unbezahlten oder schlecht bezahlten Sorgearbeit auf Frauen: Wir haben es hier mit geschlechtlicher Markierung von Arbeitssorten zu tun.31 Tatsächlich spitzen sich die Anforderungen durch weitere Veränderungen in der Arbeitswelt noch zu. Stichworte sind: Erstens die Prekarisierung, also zeitlich begrenzte und (unfreiwillige) Teilzeitarbeit statt Dauerarbeitsverhältnissen; ständig neue Zusammensetzung von Projektteams statt stabiler Abteilungen; außerdem zunehmender Druck durch Arbeitsverdichtung.32 Zweitens die Entgrenzung der Arbeit durch dauernde Abrufbarkeit per E-Mail und externen Zugriff auf Unternehmensdaten; weiterhin digital kontrollierte Arbeitsabläufe – besonders in der Finanz- und Versicherungsbranche; Robotereinsatz in 14 % der Betriebe. Insgesamt führt das zu Ängsten um Arbeitsplatzverluste trotz der aktuell sehr hohen Beschäftigungsquote. Wenig erstaunlich wird denn auch eine Zunahme der diagnostizierten psychischen Belastungen gemeldet. Das mag genügen, um zu belegen, dass disziplinierende Anrufungen an Männer, gefälligst alles auszuhalten, nicht wehleidig zu sein und sich gesundheits- und ernährungskompetent fit zu halten, auch gesellschaftlich ausgesprochen funktional sind.
5.
Zur Sozialisation geschlechterspezifisch unterschiedlicher Verhältnisse zum Körper
Das derzeitige Verhältnis von Männern zu ihrem Körper ist auch Ergebnis langfristiger historischer Prägungen. So war ein wesentliches Ziel der Erziehung von Jungen zur Härte seit der Einführung der »allgemeinen« Wehrpflicht im 19. Jh. über
29
30
31
32
Klammer, Ute/Klenner, Christina/Lillemeier, Sarah: »COMPARABLE WORTH« Arbeitsbewertungen als blinder Fleck in der Ursachenanalyse des Gender Pay Gaps? In: STUDY Nr. 014, Juni 2018, Hans-Böckler-Stiftung, 30, 35, 43f., 71. https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_studies_14_ 2018.pdf Connell: Mann, 100 – als ökonomischer Vorteil neben Herrschaft im gesellschaftlichen und politischen Raum und einem Geschlechterarrangement, das ihren libidinösen Besetzungen entspreche. En passant sei bemerkt, dass das gesellschaftlich immer weniger klappt, weshalb manche Soziologen von einer Krise der Reproduktion sprechen. Zu den komplexen Veränderungen und ihrer Wahrnehmung durch die Betroffenen s. König, Tomke: Familie heißt Arbeit teilen: Transformationen der symbolischen Geschlechterordnung, Konstanz 2012, bes. 47-50, 214f. Report 2019 – Arbeiten am Limit, DGB-Index gute Arbeit. https://index-gute-arbeit.dgb.de (Letzter Zugriff am 04.02.2020)
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Generationen hinweg die Wehrfähigkeit.33 Diesem Ziel diente auch der Schulsport, der nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg verstärkt gefordert wurde.34 Der Gipfel der Militarisierung von Männlichkeit war das Leitbild des nationalsozialistischen Soldaten. Der sollte gegen sich selbst gnadenlos hart sein, um es auch gegenüber den Feinden sein zu können.35 Der Wiederaufbau Deutschlands nach dem Krieg profitierte von der eintrainierten Einsatzbereitschaft. Transgenerational wurde der Härteimperativ noch lange weiter gegeben.36 Eine stärkere Sportorientierung von Jungen und Männern, mit Präferenzen für Konkurrenzsportarten und hartes Training im Fitnessstudio, erinnern daran.37 Teilweise geht das mit der männertypischen Tendenz zum Exzess und zur Sucht (Dopen im Studio) einher.38 Jedenfalls wird der Körper als Herausforderung erlebt. Er muss nach Connell auf Funktionsfähigkeit getrimmt und ggf. »gestählt« werden. Empirische Forschungen zum Umgang von Männern mit ihrem Körper sind immer noch selten, kommen aber zu deutlich differenzierteren Ergebnissen.39 Zwar werde das Ziel eines sportlich muskulösen Körpers von Männern unterschiedlichen Alters geteilt, Training und Sport blieben aber häufig eher eine Idee, als dass sie in die Tat umgesetzt würden – so das Ergebnis einer österreichischen nicht repräsentativen Befragung.40 Die lange Zeit von Männern dominierte Fitnessbewegung zeigt aber eine verbreitete Bereitschaft, den Körper zu trainieren.41 Solche Praktiken würden dem Lebensalter angepasst, wie auch das Körperselbstbild.42 Da der Körper als Leistungssymbol gelte, werde Altern negativ
33
34 35 36 37 38 39 40
41 42
»Allgemein« konnte die Wehrpflicht heißen, obwohl sie nur Männer betraf. Die folgende Darstellung der Sozialisation hebt etwas schematisch einige Aspekte hervor. Individuelle Aneignungen waren immer möglich, vgl. zur Kritik am Sozialisationskonzept Connell: Gender, 134ff. Dinges, Martin: Die Gesundheit von Jungen und männlichen Jugendlichen in historischer Perspektive (1780-2010). In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 29 (2011) 97-121. Frank, Werner: "Hart müssen wir hier draußen sein" Soldatische Männlichkeit im Vernichtungskrieg. In: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008) 5-40. Stärker psychologische Akzentsetzungen bei der historischen Entstehung von »Männlichkeit« bei Theunert: Co-Feminismus, 145-147. Vgl. Connell: Gender, 99. Kläber, Mischa: Doping im Fitness-Studio: die Sucht nach dem perfekten Körper, Bielefeld 2010. Ausführlich zu einigen Gründen Hofstadler, Beate/Buchinger, Birgit: KörperNormen – KörperFormen: Männer über Körper, Geschlecht und Sexualität, Wien 2001, 19-38. Hofstadler/Buchinger: KörperNormen, 130, 132, 135-139. Posch, Waltraud: Projekt Körper: wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt, Frankfurt a.M. 2009, 162 zur Bedeutung von Muskeln im männlichen Körperleitbild in einer Repräsentativbefragung. Martschukat, Zeitalter, 212. Hofstadler/Buchinger: KörperNormen, 143f.
101
102
Martin Dinges
wahrgenommen. Krankheit werde häufig als Gegenstand von Kampf, den man bestehen muss, gedeutet.43 Wenn es auch vielen Männern schwerfalle, für ihre Sexualität eine Sprache zu finden, weil sie im Reden eine mögliche Gefährdung ihrer Männlichkeit befürchten, so zeigten sich durchaus Wünsche nach Nähe sowie Transzendenz – und Verunsicherungen.44 Viagra erlaubt den Nutzern, sich wieder uneingeschränkt männlich potent zu fühlen, allerdings mit dem Wissen, dass es nur mit dem »Medikament« geht.45 Für das angeblich instrumentelle Verhältnis zum eigenen Körper spielt die behauptete Zunahme von Schönheitsoperationen bei Männern eine große Rolle. Tatsächlich bleibt deren Anteil weiterhin unter zehn Prozent aller OPs; außerdem sind diese häufiger ärztlich indiziert.46 Man wird also schon für die Jugendphase nicht von einer durchgehenden Fixierung auf Stählung des Körpers durch Sport etc. ausgehen können und müsste viel stärker Veränderungen des Körperverhältnisses im Lebenslauf einbeziehen. Jedenfalls wären solche Praktiken Spielarten des Erwerbs eines geschlechterspezifischen Körperhabitus, also einer gesellschaftlich akzeptierten Form des Umgangs mit dem Körper, bei dem die gängigen Verhaltenserwartungen inkorporiert werden. Schließlich ist Voraussetzung der derzeitig aktuellen Männlichkeitsleitbilder in der Konsumgesellschaft, dass ein Mann gut verdient. Für bessere Chancen auf den Arbeitsmärkten und für Chancen auf den Partnerschaftsmärkten ist der Körper zum Kapital geworden – das gilt für Männer wie für Frauen. Mädchen und junge Frauen erlernen einen anderen Körperhabitus. Der Körper ist hier ebenfalls eine Herausforderung, vor allem für Attraktivitätsziele, deren Verfolgung bis zur Magersucht führen kann. Spätestens ab der Menstruation kann Natur monatlich als ambivalent erlebt werden. Frauen hätten wegen der zyklischen Körpererfahrungen ein engeres, dialogisches Verhältnis zum Körper, meint die Soziologin Cornelia Helfferich.47 Dies fördere eine größere Körperaufmerksamkeit und die Einübung von Körperpflege. Hinzu kommt der regelmäßige Arztbesuch, der ab der Jugendphase zur Routine wird, auch weil den Frauen die Verantwortung für die Verhütung zugeschoben wird. Zwar müssen sich Frauen ebenfalls den Zwängen der (Arbeits-)Umwelt stellen. Andererseits erlernen sie aber früh, dass es gesellschaftlich legitim ist, sich
43 44 45 46 47
Vgl. Engelbrecht, Martin/Rosowski, Martin: Was Männern Sinn gibt: Leben zwischen Welt und Gegenwelt, Stuttgart 2007, 106ff. Hofstadler/Buchinger: KörperNormen, 184, 191f., 200ff. Martschukat, Zeitalter, 170. Posch: Projekt, 158. Helfferich, Cornelia: Das unterschiedliche »Schweigen der Organe« bei Frauen und Männern – subjektive Gesundheitskonzepte und »objektive« Gesundheitsdefinitionen. In Franke, Alexa/Broda, Michael (Hg.): Psychosomatische Gesundheit: Versuch einer Abkehr vom Pathogenese-Konzept, Tübingen 1993, 35-65, 53f.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
mit Verweis auf eine »Unpässlichkeit« zu entschuldigen – sich zum Beispiel vom Sportunterricht abzumelden oder später im Leben sich von gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entbinden. Die Vorstellung dessen, was ›Natur‹ sei, ist für Frauen also viel eher als bei Männern neben einem Zwang auch eine akzeptierte Ressource, um sich zu schonen. Helfferich hat deshalb vorgeschlagen, zwischen einem bipolaren weiblichen und einem monopolaren männlichen Körperverhältnis zu unterscheiden.48
6.
Zur historischen Entstehung der geschlechterspezifischen Verhältnisse zum Körper
Die genannten Verhaltensweisen sind Ergebnis von Geschlechterleitbildern. Die Anthropologie der Aufklärung spitzte ältere Geschlechterzuschreibungen zu und deutete Biologie als die Grundlage der Persönlichkeit. Geschlechtercharaktere wurden nun viel mehr als früher dichotomisch konstruiert49 : In der Folge galten Frauen von der Natur und dem Leib bestimmt und dementsprechend als schwach, wohingegen Männer als verstandesgesteuert und stark imaginiert wurden. Auch Lebensvorgänge wie Geburt und Menstruation wurden medizinisch umgedeutet. Das war ein erster, enger »wissenschaftlicher« Aspekt der Medikalisierung – hier besonders auf den Frauenkörper bezogen. Da auch Hygiene oder Ansteckungen von Ärzten nun medizinisch erklärt wurden, spielten Mediziner eine größere Rolle als vorher – ein zweiter Aspekt der Medikalisierung. Sie berieten maßgeblich die Obrigkeiten, die ein großes Interesse an gesunden Soldaten, Arbeitern und Steuerzahlern hatten. Gesundheit wurde zur Staatsangelegenheit (Biopolitik). Dazu waren in erster Linie die Geburtshygiene, -begleitung und die nachgeburtliche Versorgung zu verbessern, was Hebammen und nachrangig die ärztlichen Geburtshelfer leisten sollten. Wegen der hohen Säuglingssterblichkeit blieben Frauen die Hauptadressaten all dieser Bemühungen bis zum Ersten Weltkrieg. Für den Gründungsvater der obrigkeitlichen »Medicinalpolicey« Johann Peter Frank, war schon um 1800 klar: Frauen sollten die Hygiene im Haushalt gewährleisten, um damit Krankheit und Ansteckung zu vermeiden. Eine der Folgen war dieser Adressierungen war, dass Frauen (graue Balken) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur überwiegenden Klientel in den Arzt48 49
Selbstverständlich ist hier nicht die psychiatrische Konnotation von »bipolar« gemeint. Honegger, Claudia: Die Ordnung der Geschlechter: die Wissenschaften vom Menschen und das Weib (1750-1850), Frankfurt a.M. 1991. Stolberg, Michael: A Woman Down to Her Bones: The Anatomy of Sexual Difference in the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. In: Isis 94 (2003) 274-299. Schnell, Rüdiger: Haben Gefühle eine Geschichte? Aporien einer »History of emotions«, 2 Bände, Göttingen 2015.
103
104
Martin Dinges
praxen wurden – und das mit 60 % bis zum heutigen Tag weiterhin sind. Im 18. Jahrhundert waren dort meist noch mehr Männer als Frauen.50
Diagramm 1: Männer und Frauen in Arztpraxen ab 860 Patienten (1750-2007, in Prozent)
© Martin Dinges, Stuttgart
Das ist eine erstaunlich langlebige Konstante! Berücksichtigt man den höheren Frauenanteil in der Bevölkerung und ihren »gynäkologischen Zusatzbedarf«,
50
Quellen des Stabdiagramms in Dinges, Martin: Immer schon 60 % Frauen in den Arztpraxen? Zur geschlechtsspezifischen Inanspruchnahme des medizinischen Angebotes (1600-2000). In: Dinges, Martin (Hg.): Männlichkeit und Gesundheit im historischen Wandel ca. 1800- ca. 2000, Stuttgart 2007, 295-322, 306; und Baschin, Marion/Dietrich-Daum, Elisabeth/Ritzmann, Iris: Doctors and Their Patients in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. In: Dinges, Martin/K.-P. Jankrift/S. Schlegelmilch/M. Stolberg (Hg.): Medical Practice, 1600-1900. Physicians and Their Patients, Leiden – Boston 2016, 48.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
reduziert sich der Vorsprung von 20 % auf ca. 12 %.51 Der geschlechterspezifische Arzneimittelkonsum folgt zeitlich ziemlich genau der Inanspruchnahme von Arztpraxen: Auch hier liegen die Frauen ab 1853 durchgehend vorn.52 Schließlich hat die öffentliche Gesundheitsfürsorge auch in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg bevorzugt Frauen adressiert – in beiden deutschen Staaten.53 In den 1970er Jahren stellt die staatliche Gesundheitsfürsorge und -vorsorge in ihrem Bildmedien weiterhin Frauen als gesundheitskompetent, Männer allenfalls als beratungs- und anleitungsbedürftig dar. Ein sprechendes Beispiel ist die Comic-Serie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 1972 mit dem »Titelhelden« Herrn Schlapp-Schlapp… und seinem unsinnigen Verhalten zu Beginn des Urlaubs, das in diesem Stil weiter geschildert wird…54
Abbildung 4: »Gesundheitsaufklärung«?
Diese negative Stereotypisierung der Männer dürfte deren Interesse am Thema Gesundheit nicht befördert haben. Die sogenannte staatliche Gesundheitsaufklä-
51 52 53
54
Dinges: Immer schon, 296. Hoffmann, Annika: Arzneimittelkonsum und Geschlecht: eine historische Analyse zum 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2014, 197. Linek, Jenny: Gesundheitsvorsorge in der DDR zwischen Propaganda und Praxis, Stuttgart 2016, 69f.. Linek, Jenny/Pfütsch, Pierre: Geschlechterbilder in der Gesundheitsaufklärung im deutsch-deutschen Vergleich (1949-1990). In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte: MedGG 34 (2016) 73-110. Pfütsch, Pierre: Das Geschlecht des »präventiven Selbst«: Prävention und Gesundheitsförderung in der Bundesrepublik Deutschland aus geschlechterspezifischer Perspektive (1949-2010), Stuttgart 2017, 86. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Die Ferien des Herrn Schlapp-Schlapp, Köln 1972. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der BZgA.
105
106
Martin Dinges
rung hat also wenig dazu beigetragen, dass Männer aus ihrer – angeblich – selbst verschuldeten Unmündigkeit ausgehen konnten.55 Zweihundert Jahre Medikalisierung zielten vorrangig auf Frauen – die Männer und ihr Körper kamen selten, allenfalls bei der Musterung oder bei Geschlechtskrankheiten in den Blick.56 Für die Medikalisierung der Frauen war das von den Medizinern entwickelte Konzept weiblicher Schwäche grundlegend. Schon den Anthropologen der Aufklärungszeit galten die von ihrem Körper bestimmten Frauen als schwach und anfällig für Leidenschaften und Krankheiten. Dazu passte die Ausarbeitung der Depression als weibliche Krankheit. Tabelle 1: Depression als weiblich markierte Krankheit: Denkvoraussetzungen aus dem 19 Jahrhundert Allgemeine anthropologische Kategorien…
…markieren Depression weiblich
Geschlechterdichotomie zugespitzt
Affektivität mit Feminität verbunden
Mann vernunftbestimmt/Frau körperbestimmt
weiblicher Zyklus wird psychiatrisiert
symbolische Männlichkeit: gesund, stark, autonom, ungebrochen
symbolische Weiblichkeit: krank, schwach, abhängig, gebrochen
© Martin Dinges, Stuttgart
In den 1880er und 1890er Jahren klassifizierte der Psychiater Emil Kraepelin die psychischen Krankheiten neu und ersetzte die alte Melancholie, die man Mönchen, Künstlern und Literaten zugestand, durch die Depression. Umfasste das Melancholie-Konzept noch schöpferische Elemente, so hatte sie, umdefiniert zur Depression, nun nur noch Krankheitswert – und wurde von Kraepelin passend als weibliche Krankheit konstruiert.57 Mediziner arbeiteten die Geschlechterdichotomie im Menschenbild des 19. Jahrhunderts weiter bis zur These des »physiologischen Schwachsinns des Weibes« aus, wie ein bezeichnender Buchtitel des Nervenarztes Paul Julius Möbius von 1900 hieß. Dieser weibliche »Schwachsinn« diente nach seiner Ansicht der Arterhaltung des Menschen und sei die natürliche Folge der Evolution.58 55 56
57 58
Kant, Immanuel: Was ist Aufklärung?, Dezember-Nummer der Berlinischen Monatsschrift, 1784. Dinges, Martin: Die späte Entdeckung der Männer als Adressaten der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und -förderung in Deutschland. In: Schmiedebach, Heinz-Peter (Hg.): Medizin und öffentliche Gesundheit, Berlin 2018, 131-151. Abschließend in Kraepelin, Emil: Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 6. Auflage, Leipzig 1899. Möbius, Paul Julius: Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1900. 5., veränd. Aufl. Halle 1903, bereits von 26 auf 140 Seiten, 1912 auf 160 Seiten erweitert.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Diese kontrastiven Geschlechterbilder sind wichtig, weil sie sich noch heute in der Gesundheitsversorgung auswirken. Wie anders könnte man das folgende Paradox bei der Diagnose psychischer Krankheiten erklären? Frauen erhalten doppelt so oft wie Männer die Diagnose Depression; Männer bringen sich aber dreimal häufiger um – und das obwohl den meisten Suiziden depressive Phasen vorausgehen. Der dreifache Vorsprung der Männer bei den Selbsttötungen besteht schon seit Jahrzehnten. Gesellschaftlich scheint es wenig zu beunruhigen, dass sich derzeit in Deutschland jedes Jahr etwa 7400 Männer selbst töten, über 20 am Tag, fast jede Stunde einer.59 Die Suizide hängen zwar durchaus mit dem Wunsch vieler Männer zusammen, Schwäche nicht einzugestehen; Schwierigkeiten lieber autonom und notfalls radikal zu lösen – indem sie zusammen mit ihren Problemen gleich sich selbst beseitigen. Allerdings gestattet es ihr geschlechtsspezifischer Habitus Männern weniger, Niedergeschlagenheit zu zeigen. Wer Schwäche ungern eingesteht, fordert auch weniger leicht Hilfe aus dem Umfeld oder von Fachpersonal an. Aber auch das medizinische Personal verkennt häufig Depressionen von Männern, denn die Behandler haben ebenfalls kontrastive Geschlechterbilder im Hinterkopf – wie der Rest der Gesellschaft. So lehnten die damals fast ausschließlich männlichen Ärzte in England bis in die 1980er Jahre das Thema psychische Schwäche bei ihren männlichen Patienten ab, weil eine solche Diagnose nicht zu ihrem Männlichkeitsselbstbild passte. Noch in den 1990er Jahren diagnostizierten sie stattdessen nervös bedingte Magenschleimhautentzündungen, also etwas Organisches. Aufgrund ihrer organzentrierten Ausbildung denken Ärzte – und heute auch Ärztinnen – bei Männern immer noch viel zu selten an psychische Krankheiten. Immerhin wird mittlerweile eine männliche Form der Depression diskutiert, die sich, anders als bei Frauen, auch in aggressiven Symptomen, äußern kann. Jedenfalls können historisch überholte geschlechterspezifische Vorannahmen dazu führen, dass psychiatrische Bedarfe von Männern übersehen werden.60 Die Erwartungen an männliche Stärke sind insgesamt wenig angetan, Selbstsorge zu fördern. Körpersensibilität wurde Männern gründlich abgewöhnt, Gesundheitskompetenz wurde ihnen nicht vermittelt, sondern abgesprochen und durch dichotome Geschlechterbilder in den Köpfen der Zugang zu angemessener
59
60
www.gbe-bund.de 2015 verursachten die 10.078 Suizide mehr Sterbefälle als Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen (7397). 2017: 9241 Suizide; Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen: 4996 Sterbefälle. https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/depression-in-verschiedenen-facetten/suizidalitaet (Letzter Zugriff am 22.05.2020) Möller-Leimkühler, Anne Maria: Psychische Gesundheit von Männern: Bedeutung, Ziele, Handlungsbedarf. In: Lothar Weissbach, Matthias Stiehler (Hg.): Männergesundheitsbericht 2013. Im Fokus: Psychische Gesundheit, Bern 2013, 63-82, 69.
107
108
Martin Dinges
Gesundheitsversorgung behindert. So verwundert es wenig, dass die Lebenserwartung bei der Geburt seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland stark zunahm, sich allerdings geschlechterspezifisch sehr unterschiedlich entwickelt hat.
Diagramm 2: Lebenserwartung in Deutschland seit 1850
© Martin Dinges, Stuttgart
Diagramm 3: Lebenserwartungsdifferential in Deutschland seit 1850
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Jahr
1850
1871/ 1881
1901/ 1910
1950
1980
2000
2013
mehr Lebensjahre
0,4
2,9
3,5
4
6,6
6,1
4,9
© Martin Dinges, Stuttgart
Bessere Ernährung, Bildung und sanitäre Verhältnisse waren bis in die 1960er Jahre Hauptgründe der gesteigerten Lebenserwartung. Davon profitierten die Frauen (graue Linie) viel stärker. Danach wirkte sich vor allem das seit dem Ersten Weltkrieg immer mehr verbreitete Rauchen mit einer Verzögerung von einigen Jahrzehnten ungünstig auf die Lebenserwartung der Männer aus. Am Höhepunkt betrug der Unterschied bei der Lebenserwartung in den 1980er Jahren 6,7 Jahre. Durchgehend wirkte sich auch die stärkere Exposition von Männern gegenüber Gesundheitsgefahren, z.B. in gefährlichen Arbeitsfeldern aus. Lediglich etwa ein Jahr Unterschied kann ein biologischer Vorsprung sein, der Rest ist soziokulturell bedingt.61 Im 19. Jh. spielte noch die höhere Sterblichkeit männlicher Säuglinge eine große Rolle. Gleichzeitig wirkte sich die häufigere Exposition der Männer gegenüber Gesundheitsgefahren an den Arbeitsplätzen in Industrie und Bergbau aus. Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung verschaffte demgegenüber Frauen, z.B. als Hauspersonal, häufig weniger gefährliche Jobs und eine sicherere Nahrungsversorgung. Bis zum Ersten Weltkrieg, senkte die Sterblichkeit im Kindbett die durchschnittliche Lebenserwartung übrigens nur um ein halbes Jahr dann ging sie sehr stark zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkt sich europaweit massiv aus, dass Männer viel mehr rauchen. Zum eingangs zitierten Konzept »hegemonialer Männlichkeit« bleibt also festzustellen, dass diese Hegemonie keineswegs zu einem längeren Leben führte!62
7.
Nachholende Medikalisierung als Selbstsorge von Männern
Vor dem Hintergrund des Mediendiskurses und der historischen Genese des männerspezifischen Körperverhältnisses sind die Entwicklungen der letzten dreißig 61
62
Luy, Marc: The impact of biological factors on sex differences in life expectancy: insights from a natural experiment. In: Dinges, Martin/Weigl, Andreas (Hg.): Gender-specific life expectancy in Europe 1850-2010, Stuttgart 2016, 17-46. Dinges, Martin: Veränderungen der Männergesundheit als Krisenindikator? Deutschland 1850-2006. In: L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 19 (2008) 107123. Die aktuellsten Daten bietet Nowossadeck, E./von der Lippe, E./Lampert, T.: Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland – Aktuelle Trends. In: Journal of Health Monitoring 4 (2019) 41-48.
109
110
Martin Dinges
Jahre dann vielleicht doch vielleicht unerwartet, jedenfalls höchst interessant. Ich nehme als Beispiel die Gesundheitssorge und möchte die These plausibel machen, dass Männer in diesem Feld während der letzten Generation aufgeholt haben. Ich bezeichne diesen Vorgang in Anlehnung an die dargestellte Medikalisierung als nachholende Medikalisierung. Anhand der Daten der Gesundheitsberichterstattung des Bundes lässt sich erstens eine Verringerung der schädlichen Verhaltensweisen beobachten: Männer rauchen immer weniger! Sie fangen insgesamt nicht mehr so häufig an wie in meiner Nachkriegs-Generation, in der fast alle rauchten. Rauchen ist kein Männlichkeitsmarker mehr. Das zeigen die Raucherquoten bei Jugendlichen sehr gut. Abbildung 5: Raucherquoten bei Jugendlichen (12-18 Jahre, in Prozent)
Jahr
männliche Jugendliche
weibliche Jugendliche
1979
33,4
26,8
2011
11,1
12,4
1979-2011
-22,3
-14,4
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: gbe bund
Männer begannen bereits seit den 1990er Jahren seltener als weibliche Jugendliche zu rauchen. Derzeit sind beide Geschlechter bei den wenigen Jugendlichen,
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
die noch rauchen, etwa gleichauf.63 Zudem haben immer mehr Männer in den letzten dreißig Jahren, spätestens in ihrer Lebensmitte, aufgehört zu rauchen. Beide Trends bilden die Raucherquoten gut ab. Tabelle 2: Raucherquoten (in Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre)64 Jahr
Männer
Frauen
Gesamt
1992
36,8
21,5
28,8
1995
35,6
21,5
28,3
1999
34,7
22,2
28,3
2003
33,2
22,1
27,4
2005
32,2
22,4
27,2
2009
30,5
21,2
25,7
2013
29,0
20,3
24,5
2017
26,4
18,6
22,4
1992-2017
-10,4
-2,9
-6,4
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: gbe bund
Die letzte Zeile der Tabelle Raucherquoten zeigt: Ausgehend von einem viel höheren Raucheranteil, lässt sich ein klarer Wandel zu einem weniger gesundheitsschädlichen Verhalten bei Männern feststellen! Bei den Frauen ist der Trend sehr viel schwächer, wohl aus Sorge um »die Linie«, also Attraktivität.65 Auch der riskante Alkoholkonsum sank bei 18-59jährigen Männern von 1995 bis 2012 massiv.66 Männer hatten ursprünglich bei beiden gesundheitsschädlichen Praktiken ein hohes Ausgangsniveau. Beide gingen sehr stark zurück. Männer nahmen Gesundheitsbotschaften also so ernst, dass sie sogar ihr Verhalten änderten.
63
65 66
Rauchen wurde immer mehr zum Unterschichtmarker: Hauptschüler rauchen häufiger als Realschüler und die mehr als Gymnasiasten. Das setzt sich im späteren Leben schichtspezifisch fort. Die Geschlechterspezifik dieser gesundheitsschädlichen Praktik hat sich also innerhalb einer einzigen Generation so stark verändert, dass sie weitgehend verschwand. Robert Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland, Berlin 2015, 224. Der Anteil alkoholbedingter Todesfälle stieg bei Frauen schneller als bei Männern: gesundheitsziele.de: Kooperationsverbund zur Weiterentwicklung des nationalen Gesundheitszieleprozesses (2015) Nationales Gesundheitsziel »Alkoholkonsum reduzieren«, http://gesundheitsziele.de/ (Letzter Zugriff am 22.05.2020)
111
112
Martin Dinges
Diagramm 4: Riskanter Alkoholkonsum bei 18- 59Jährigen (in Prozent)
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: RKI
Jahr 1995
Männer
Frauen
26,8
15,3
2012
16,0
13,9
1995-2012
-10,8
-1,4
© Martin Dinges, Stuttgart
Demgegenüber lassen sich beim Aufbau von Gesundheitsressourcen wenig Fortschritte feststellen: Bei der körperlichen Bewegung sind die Frauen stärker vorangekommen. Tabelle 3: Entwicklung sämtlicher sportlicher Aktivitäten der (18-79-jährigen) Befragten (in Prozent)67 Jahr
Männer
Frauen
1998
56,0
50,3
2003
61,4
60,3
2009
64,6
65,4
Veränderung 1998/2009
+ 8,6 %
+ 15,1 %
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Bei der viel diskutierten Ernährung nahm die Anzahl adipöser und übergewichtiger Männer und Frauen noch zu.68 Für die Medikalisierung gilt die Integration in die medizinische Versorgung als ein wichtiger Indikator. So ist es beachtlich, dass Männer ärztlichen Rat bei psychiatrischen Indikationen immer häufiger in Anspruch nehmen. Das ist für den Umgang von Männern mit Schwäche aufschlussreich – einem Kernbereich von zugeschriebener »hegemonialer Männlichkeit«. Daten zu den von der Person selbst bestimmten Behandlungen beim Psychotherapeuten sind besonders aussagekräftig, da sie zumeist auf freiwillige Entscheidungen zurückgehen. Tabelle 4: Inanspruchnahme niedergelassener Psychotherapeuten in den letzten zwölf Monaten (18-79 Jährige, in Prozent der Bevölkerung)69 Jahr
Gesamt
Frauen
Männer
Höhere Inanspruchnahme durch Frauen
1998
2,6
3,4
1,8
88,9
2010
4,3
5,3
3,2
65,6
Tabelle 5: Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Versorgung bei niedergelassenen Psychiatern in den letzten zwölf Monaten (18-79 Jährige, in Prozent)70 Jahr
Gesamt
Frauen
Männer
Höhere Inanspruchnahme durch Frauen
1998
5,7
6,8
4,6
47,8
2010
8,2
9,6
6,8
41,2
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: DEGS1, RKI
Zunächst fällt auf, dass 2010 immer mehr Personen Psychologen und Psychologinnen, Psychiater und Psychiaterinnen sowie Neurologen in Anspruch nahmen. Das verweist auf eine Entstigmatisierung psychischer Krankheit.71 Zweitens verändert sich langsam die Geschlechterverteilung: Gingen 1998 3,4 % aller Frauen zum Psychologen, so war es zwölf Jahre später fast der gleiche Bevölkerungsanteil bei den Männern: 3,2 %. Bei der Inanspruchnahme der Psychiater bzw. Neurologen
68 71
Dazu ausführlich Dinges, Martin: Die Bedeutung der Kategorie Gender für Gesundheitschancen (1980-2018). In: MedGG 38 (2020) i.E. Dass das tatsächlich auf eine Zunahme psychischer Erkrankungen hinweisen soll, ist sehr umstritten; wahrscheinlich handelt es sich lediglich um eine zutreffendere Diagnostizierung von Symptomen, die früher als körperliche Symptome verbucht wurden, so z.B. »Rückenschmerzen«, gerne bei Männern.
113
114
Martin Dinges
wiederholt sich dieses Bild noch genauer: 6,8 % der weiblichen Bevölkerung suchten sie 1998 auf, 2010 waren es 6,8 % der Männer. Schon dies legt den Schluss auf eine nachholende Medikalisierung der Männer nahe. Allerdings gingen zwischenzeitlich noch mehr Frauen zu diesen Behandlern. Deshalb wird das Verhältnis zwischen den Inanspruchnahmedaten von Männern und Frauen wichtig: Gegenüber dem Ausgangsjahr 1998 verringerte sich der Vorsprung der Frauen bei beiden Spezialisten, besonders bei den zumeist freiwillig aufgesuchten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen (schwarze Linie).
Diagramm 5: Höhere Inanspruchnahme von niedergelassenen Psychotherapeuten und Psychiatern durch Frauen sinkt
© Martin Dinges, Stuttgart
Das spricht dafür, dass die Entstigmatisierung psychischer Krankheit bei den Männern angekommen ist: Das hat besonders ihnen den Weg zum Behandler erleichtert. Man könnte das auch als Lackmustest für die Veränderung von Männlichkeits(selbst-)bildern deuten: Die traditionell weiblich markierte Vorstellung psychischer Krankheit, die mit Schwäche assoziiert ist, wird nun auch von Männern akzeptiert. Außerdem erkennen Mediziner offenbar bei Männern diese Krankheiten mittlerweile etwas häufiger. Es wundert nicht, dass im Gefolge solcher Behandlungen bei der Verschreibung von Psychopharmaka ein ähnlicher Trend zu beobachten ist.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Tabelle 6: Verordnungen von Psychopharmaka72 Jahr
Tagesdosen
für Frauen
für Männer
Mehrverschreibung für Frauen
1995
1,120 Mrd.
keine Angabe
keine Angabe
»etwa doppelte Menge« = ca. 100 %
2005
1,157 Mrd.
21,3
12,6
70 %
2013
1,929 Mrd.
35,7
23,2
54 %
2015
2,200
37,1
24,2
53 %
2016
2,200
37,0
23,8
55 %
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: Arzneiverordnungsreports
Erhielten Frauen Mitte der 1990er Jahre noch »etwa die doppelte Menge« Psychopharmaka wie die Männer, waren es 2013 nur noch 54 % mehr. Dort pendelt sich der Wert seit einigen Jahren ein.73 Sehen wir uns abschließend sämtliche Arzneiverschreibungen für die gesetzlich-Versicherten unter geschlechterspezifischen Gesichtspunkten an. Auch hier bestätigt sich diese Tendenz, sogar für einen noch längeren Zeitraum.
73
Die Frage einer Hypermedikalisierung der Jungen mit einer ADHS-Diagnose wäre ein Spezialvortrag. Vgl. Abbas, Sascha/Ihle, Peter/Adler, Jürgen-Bernhard u.a.: PsychopharmakaVerordnungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesweite Auswertung von über 4 Millionen gesetzlich Versicherten von 2004 bis 2012. In: Deutsches Ärzteblatt Int. 113 (2016) 396-403. S.a. Abbas, Sascha/Ihle, Peter u.a.: Antipsychotika bei Kindern in Deutschland. In: Klauber, Jürgen/Günster, Christian/Gerste, Bettina u.a. (Hg.): Versorgungsreport 2015/2016. Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche, Stuttgart 2016, 117-135.
115
116
Martin Dinges
Tabelle 6: Arzneiverschreibungen für GKV-Versicherte (in definierten Tagesdosen = DDD, nur erstattungsfähige Medikamente)74 Jahr
durchschnittl. DDD
Männer
Frauen
Mehrverschreibung für Frauen
1987
358
276
429
56 %
1992
422
327
505
54 %
1995
430
355
496
40 %
2005
403
361
439
22 %
2013
549
501
592
18 %
2016
575
522
621
19 %
© Martin Dinges, Stuttgart, Quellen: Arzneiverordnungsreports
Diagramm 6: Sinkende Mehrverordnungen von Psychopharmaka für Frauen (Versicherte der GKV)
© Martin Dinges, Stuttgart
Die Mehrverschreibung für Frauen lag im Jahre 1987 bei 56 %, sank seither auf derzeit noch 19 %. Männer bekommen mittlerweile von Ärzten nicht mehr so viel weniger Arzneien verschrieben wie noch vor einem Vierteljahrhun-
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Diagramm 7: Sinkende Mehrverordnungen von Arzneimitteln für Frauen (Versicherte der GKV)
© Martin Dinges, Stuttgart
dert.75 Möglicherweise wurde auch hier in der Dekade ab 2005 mit knapp 20 % Mehrverschreibung für Frauen ein Sockel erreicht. Während der letzten 30 Jahre lässt sich einerseits eine fortgesetzte parallele Medikalisierung beobachten: Die Inanspruchnahme des medizinischen Systems stieg 75
Die besonders starke Annäherung zwischen 1995 und 2005 erklärt sich teilweise durch das Ausscheiden vieler Mittel aus der Erstattungsfähigkeit der GKV, was die Frauen besonders betraf. Alle Aussagen beziehen sich auf die Mengen, nicht die Preise. Inwieweit sich hier auch die Alterung der Bevölkerung auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Alte Menschen bekommen insgesamt mehr Arzneimittel verschrieben. Die Anzahl der Hochbetagten stagnierte zwischen 1990 und 2000, stieg aber zwischen 2000 und 2010 in der Gesamtbevölkerung erheblich von 3,8 % auf 5,2 % (4,2 Mio). www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/ sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII1d. pdf (Letzter Zugriff am 12.12.2019). Das kann einen Teil der Mehrverschreibung erklären. Wegen der Übersterblichkeit der Männer sind derzeit (2011) doppelt so viele hochbetagte Frauen (2,92 Mio.) in der Gesamtbevölkerung wie Männer (1,48 Mio.) (Die Angaben zu 2011 dort fälschlich verzehnfacht) Roloff, Juliane: Hochbetagte Frauen und Männer in Deutschland – ein statistischer Vergleich: https://www.dasgleichstellungswissen.de/hochbetagte-frauenund-m %C3 %A4nner-in %C2 %A0deutschland-ein-statistischer-vergleich-teil-1.html?wa= IPGLB18 (Letzter Zugriff am 12.12.2019).
117
118
Martin Dinges
bei beiden Geschlechtern; Männer und Frauen treiben mehr Sport, letztere haben diese Gesundheitsressource sogar schneller weiterentwickelt als Männer. Eine nachholende Medikalisierung der Männer zeigt sich vor allem bei der Reduzierung gesundheitsschädlicher Praktiken wie dem Rauchen und dem riskanten Alkoholkonsum. Außerdem suchten sie vermehrt aktiv Hilfe bei psychischen Problemen nach.76 Im Rahmen der sich ändernden Geschlechterverhältnisse haben demnach offenbar viel mehr Männer das Thema Gesundheit für sich entdeckt, als das bisher im Defizitdiskurs der Medien wahrgenommen wird.77 Allerdings muss dabei sozial stark differenziert werden, denn die nachholende Medikalisierung der Männer ist bisher in der Unterschicht noch (fast) nicht angekommen.78 Das zeigt sich bei den immer noch geringeren Gesundheitsressourcen, beim Übergewicht und der Adipositas, schon bei Kindern, bei gesundheitsschädlichen Praktiken, bei der geringeren Inanspruchnahme des psychologisch-psychiatrischen Versorgungsangebots, bei der höheren Suizidrate und insbesondere beim Rauchen, das vom Männlichkeitsmarker mittlerweile zum Unterschichtmarker geworden ist.79 Der gängige Differenzdiskurs – hier gesundheitsidiotische Männer, dort gesundheitskompetente Frauen – wird der gesellschaftlichen Wirklichkeit immer weniger gerecht – also der beschleunigten Angleichung gesellschaftlicher Erwartun-
76
77
78
79
Dort scheint seit einigen Jahren ein Sockel erreicht zu sein. Wie groß demgegenüber die Bedeutung des schnell wachsenden zweiten Gesundheitsmarkts mit Wellness, Gesundheitsprodukten, Schönheitsoperationen etc. ist, in dem fast ausschließlich Frauen adressiert werden, steht dahin. Dessen Umsatz entspricht mittlerweile fast einem Viertel des gesamten Gesundheitsmarktes: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-gesundheitsbranche-floriert14917294.html (Letzter Zugriff am 12.12.2019). Statt männliches Geschlecht essentialistisch zum Gesundheitsrisiko zu erklären, wäre eine stärkere Beachtung von geschlechterspezifischen Gesundheitslebensstilen wünschenswert, s. Hoffmann, Susanne: Gesunder Alltag im 20. Jahrhundert? Geschlechterspezifische Diskurse und gesundheitsrelevante Verhaltensstile in deutschsprachigen Ländern, Stuttgart 2010, 398-406. Zuletzt: Lampert, T./Kroll, L.E./Müters, S. u.a.: Soziale Ungleichheit, Arbeit und Gesundheit, in Badura, Bernhard/Ducki, Antje/Schröder, Helmut u.a. (Hg.): Fehlzeiten-Report 2017: Krise und Gesundheit, Ursachen, Prävention, Bewältigung; Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft, Berlin 2017, 23-35. Robert-Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland, Berlin 2 2007, 83-90, 84. Robert-Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland: Gesundheitsberichterstattung des Bundes gemeinsam getragen von RKI und Destatis, Berlin 2015, 148-156. Ähnliche Daten zu Österreich: Klotz, Johannes/Doblhammer, Gabriele: Trends in educational mortality differentials in Austria between 1981/82 and 2001/2002: A study based on a linkage of census data and death certificates. In: Demographic Research 19 (2008) 1759-1780, 1775. www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/51/ (Letzter Zugriff am 12.12.2019). Klotz, Johannes/Asamer, Eva-Maria: Bildungsspezifische Sterbetafeln 2006/2007 sowie 2011/2012. In: Statistische Nachrichten 3 (2014) 209-214, 213.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
gen an Männer und Frauen und den ähnlicher werdenden Anforderungen in Arbeitswelt und Familie. Es wird Zeit, dass Ärzte und Ärztinnen, Öffentlichkeit und selbst Journalisten und Journalistinnen endlich bemerken, dass Männer mit der Selbstsorge für ihren Körper und ihre Gesundheit weiter sind, als sie bisher dachten.
Literatur Abbas, Sascha/Ihle, Peter u.a.: Antipsychotika bei Kindern in Deutschland. In: Klauber, Jürgen/Günster, Christian/Gerste, Bettina u.a. (Hg.): Versorgungsreport 2015/2016. Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche, Stuttgart 2016, 117-135. Abbas, Sascha/Ihle, Peter/Adler, Jürgen-Bernhard u.a.: Psychopharmaka-Verordnungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesweite Auswertung von über 4 Millionen gesetzlich Versicherten von 2004 bis 2012. In: Deutsches Ärzteblatt Int. 113 (2016) 396-403. Baschin, Marion/Dietrich-Daum, Elisabeth/Ritzmann, Iris: Doctors and Their Patients in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. In: Dinges, Martin/K.-P. Jankrift/S. Schlegelmilch/M. Stolberg (Hg.): Medical Practice, 1600-1900. Physicians and Their Patients. Leiden – Boston 2016. Connell, Raewyn: Gender, Wiesbaden 2013. Connell, Robert W.: Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten, Opladen 1999. Dinges, Martin (Hg.): Männer – Macht – Körper. Hegemoniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt 2005. Dinges, Martin: »Hegemoniale Männlichkeit« – Nutzen und Grenzen eines Konzepts. In: Becher, Matthias (Hg.): Transkulturelle Annäherungen an Phänomene von Macht und Herrschaft. Geschlechterdimensionen und Spannungsfelder, Göttingen 2020 i.E. Dinges, Martin: Die Bedeutung der Kategorie Gender für Gesundheitschancen (1980-2018). In: MedGG 38 (2020) i.E. Dinges, Martin: Die Gesundheit von Jungen und männlichen Jugendlichen in historischer Perspektive (1780-2010). In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 29 (2011), 97-121. Dinges, Martin: Die späte Entdeckung der Männer als Adressaten der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und -förderung in Deutschland. In: Schmiedebach, HeinzPeter (Hg.): Medizin und öffentliche Gesundheit, Berlin 2018, 131-151. Dinges, Martin: Immer schon 60 % Frauen in den Arztpraxen? Zur geschlechtsspezifischen Inanspruchnahme des medizinischen Angebotes (1600-2000). In: Dinges, Martin (Hg.): Männlichkeit und Gesundheit im historischen Wandel ca. 1800- ca. 2000, Stuttgart 2007, 295-322.
119
120
Martin Dinges
Dinges, Martin: Veränderungen der Männergesundheit als Krisenindikator? Deutschland 1850-2006. In: L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 19 (2008) 107-123. Engelbrecht, Martin/Rosowski, Martin: Was Männern Sinn gibt: Leben zwischen Welt und Gegenwelt, Stuttgart 2007. Frank, Werner: »Hart müssen wir hier draußen sein« Soldatische Männlichkeit im Vernichtungskrieg. In: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008), 5-40. Helfferich, Cornelia: Das unterschiedliche »Schweigen der Organe« bei Frauen und Männern – subjektive Gesundheitskonzepte und »objektive« Gesundheitsdefinitionen. In Franke, Alexa/Broda, Michael (Hg.): Psychosomatische Gesundheit: Versuch einer Abkehr vom Pathogenese-Konzept, Tübingen 1993. Herzog, Anna/Hutzenlaub, Lucinde: Männergrippe. Husten, Schnupfen, Heiserkeit und andere für Kerle lebensbedrohliche Zustände, Berlin 2018. Hoffmann, Annika: Arzneimittelkonsum und Geschlecht: eine historische Analyse zum 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2014. Hofstadler, Beate/Buchinger, Birgit: KörperNormen – KörperFormen: Männer über Körper, Geschlecht und Sexualität, Wien 2001. Honegger, Claudia: Die Ordnung der Geschlechter: die Wissenschaften vom Menschen und das Weib (1750-1850), Frankfurt a.M. 1991. Höyng, Stephan/Puchert, Ralf: Die Verhinderung der beruflichen Gleichstellung: männliche Verhaltensweisen und männerbündische Kultur, Bielefeld 1998. Höyng, Stephan/Schwerma, Klaus: Gender Mainstreaming – Möglichkeiten und Grenzen aus der Perspektive von Männern. In: Nohr, Barbara/Veth, Silke (Hg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexionen einer neuen Strategie, Berlin, 2002. Kant, Immanuel: Was ist Aufklärung?, Dezember-Nummer der Berlinischen Monatsschrift, 1784. Kläber, Mischa: Doping im Fitness-Studio: die Sucht nach dem perfekten Körper, Bielefeld 2010. Klammer, Ute/Klenner, Christina/Lillemeier, Sarah: »COMPARABLE WORTH« Arbeitsbewertungen als blinder Fleck in der Ursachenanalyse des Gender Pay Gaps? In: STUDY Nr. 014, Juni 2018, Hans-Böckler-Stiftung, online unter: https://www. boeckler.de/pdf/p_wsi_studies_14_2018.pdf. Klotz, Johannes/Asamer, Eva-Maria: Bildungsspezifische Sterbetafeln 2006/2007 sowie 2011/2012. In: Statistische Nachrichten 3 (2014) 209-214. Klotz, Johannes/Doblhammer, Gabriele: Trends in educational mortality differentials in Austria between 1981/82 and 2001/2002: A study based on a linkage of census data and death certificates. In: Demographic Research 19 (2008) 1759-1780. König, Tomke: Familie heißt Arbeit teilen: Transformationen der symbolischen Geschlechterordnung, Konstanz 2012. Kraepelin, Emil: Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 6. Auflage, Leipzig 1899.
Körper und Gesundheit von Männern zwischen hegemonialer Männlichkeit und Selbstsorge
Lampert, T./Kroll, L.E./Müters, S. u.a.: Soziale Ungleichheit, Arbeit und Gesundheit. In: Badura, Bernhard/Ducki, Antje/Schröder, Helmut u.a. (Hg.): Fehlzeiten-Report 2017: Krise und Gesundheit, Ursachen, Prävention, Bewältigung; Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft, Berlin 2017, 23-35. Lampert, Thomas/Mensink, Gert/Müters, Stephan: Körperlich-sportliche Aktivität bei Erwachsenen in Deutschland, Bundesgesundheitsblatt 55 (2012) 102-110. Lehner, Erich: »Männer stellen Arbeit über ihre Gesundheit«. Männliche Lebensinszenierungen und Wunschrollenbilder. In: Altgeld, Thomas (Hg.): Männergesundheit: neue Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention, Weinheim/Bergstr. 2003. Linek, Jenny/Pfütsch, Pierre: Geschlechterbilder in der Gesundheitsaufklärung im deutsch-deutschen Vergleich (1949-1990). In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte: MedGG 34 (2016) 73-110. Linek, Jenny: Gesundheitsvorsorge in der DDR zwischen Propaganda und Praxis, Stuttgart 2016. Luy, Marc: The impact of biological factors on sex differences in life expectancy: insights from a natural experiment. In: Dinges, Martin/Weigl, Andreas (Hg.): Gender-specific life expectancy in Europe 1850-2010, Stuttgart 2016, 17-46. Martschukat, Jürgen: Das Zeitalter der Fitness. Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde, Frankfurt 2019. Meuser, Michael: Männerwelten. Zur kollektiven Konstruktion hegemonialer Männlichkeit. Schriften des Essener Kollegs für Geschlechterforschung. Hg. von Janshen, Doris/Meuser, Michael, Essen 2001, auch digital als https://www.unidue.de/imperia/md/content/ekfg/michael_meuser_maennerwelten.pdf (Abruf 04.02.2020) Möbius, Paul Julius: Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1900; 5., veränd. Aufl. Halle 1903. Möller-Leimkühler, Anne Maria: Psychische Gesundheit von Männern: Bedeutung, Ziele, Handlungsbedarf. In: Weissbach, Lothar/Stiehler, Matthias (Hg.): Männergesundheitsbericht 2013. Im Fokus: Psychische Gesundheit, Bern 2013, 63-82. Nowossadeck, E./von der Lippe, E./Lampert, T.: Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland – Aktuelle Trends. Journal of Health Monitoring 4 (2019) 41-48. Pfütsch, Pierre: Das Geschlecht des »präventiven Selbst«: Prävention und Gesundheitsförderung in der Bundesrepublik Deutschland aus geschlechterspezifischer Perspektive (1949-2010), Stuttgart 2017. Posch, Waltraud: Projekt Körper: wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt, Frankfurt a.M. 2009. Rattay, Petra/Butschalowsky, Hans-Georg/Rommel, Alexander u.a.: Inanspruchnahme der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Deutschland. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). In: Bundesgesundheitsblatt56 (2013) 832-844.
121
122
Martin Dinges
Robert Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland, Berlin 2015. Robert-Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland, Berlin 2 2007. Robert-Koch-Institut (Hg.): Gesundheit in Deutschland: Gesundheitsberichterstattung des Bundes gemeinsam getragen von RKI und Destatis, Berlin 2015. Schnell, Rüdiger: Haben Gefühle eine Geschichte? Aporien einer »History of emotions«, 2 Bände, Göttingen 2015. Schwabe, Ulrich/Anlauf, Manfred: Arzneiverordnungs-Report ‘96, Stuttgart 1996. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report 2006, Berlin, 2007. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report 2014, Berlin 2014. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report 2016, Berlin 2016. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report ‘88, Stuttgart 1988. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report ‘93, Stuttgart 1993. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report ‘96, Stuttgart 1996. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report 2006, Heidelberg 2007. Schwabe, Ulrich/Paffrath, Dieter/Ludwig, Wolf-Dieter (Hg.): Arzneiverordnungs-Report 2017, Berlin. Stolberg, Michael: A Woman Down to Her Bones: The Anatomy of Sexual Difference in the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. In: Isis 94 (2003) 274-299. Theunert, Markus: Co-Feminismus: wie Männer Emanzipation sabotieren – und was Frauen davon haben, Bern 2013. Volz, Rainer/Zulehner, Paul M.: Männer in Bewegung: zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland, Baden-Baden 2009.
Grauzonen: Alter/n als Form kulturellen Unbehagens Rüdiger Kunow »Altern heisst, sich über sich selbst klarzuwerden.« (Simone de Beauvoir) »Zyniker oder Realist? Älter geworden.« (Kalenderblatt)
Alter/n ist eine unhintergehbare Grundbefindlichkeit menschlichen Lebens: Alle Menschen werden, wenn sie nicht vorher sterben, eines Tages alt. Zugleich aber löst die Begegnung mit dem Alter oder den Alten ein weitverbreitetes Unbehagen aus, bei den Betroffenen ebenso wie bei Angehörigen, aber auch Fremden. Auch wenn die meisten Menschen sich wünschen alt zu werden, ist Alter/n als Lebensabschnitt nicht sonderlich beliebt und schlägt auf alte Menschen selbst zurück, so dass Alter/n auch eine Form vielfältigen sozialen wie kulturellen Leidens (nach Honneth) sein kann.1 Deswegen sind Formen späten Lebens nicht nur ein Gegenstand geronotologischer Betrachtung, sondern auch ein Thema für die Kulturwissenschaften. Aus deren Perspektive markiert Alter/n zunächst einmal eine konzeptionelle und erfahrungsmässige Grauzone. Dies geschieht in mehr als einem Sinne, denn was eigentlich Alter ist, dafür gibt es endlos viele Deutungen. Die meisten der dabei diskutierten Aspekte fasst diese Handbuch-Definition konzis zusammen: »With the passage of time, organisms undergo progressive physiological deterioration that results in increased vulnerability to stress and an increased probability of death. This phenomenon is commonly referred to as aging […] the deteriorative cascade of physiological changes that we characterize as [aging] does not become readily apparent until well into or beyond the reproductive period.«2
1
2
Ich greife hier Reflexionen Axel Honneths über »Formen sozialen Unbehagens und Leidens« auf, die er im Zusammenhang seiner Analyse von Selbstverwirklichungsansprüchen und deren Scheitern in modernen kapitalistischen Gesellschaften angestellt hat. Cristofalo, Vincent J. et al., »Biological Theories of Senescence.« In: Bengtson, Vern L./Schaie, K. Warner (Hg.), Handbook of Theories of Aging, New York 1999, 98.101.
124
Rüdiger Kunow
Alter ist demnach ganz elementar eine Folge, vielleicht Folgelast von Zeit. Der alte Körper lässt dies auch erkennen; er zeigt seine Zeit, er besitzt, wenn man so will, einen Zeitindex. Alter/n geschieht nicht einfach so, es hinterlässt seine Zeichen, Zeichen der Zeit, die auch nach aussen sichtbar sind, »the rotten handwriting of time«3 , wie die britische Autorin Grace Paley es einmal ausdrückte. In den westlichen Kulturen hat sich ein ganzer Katalog relevanter äußerer körperlicher Merkmale des Alter/ns gebildet, etwa um die Leitfarbe »grau«, die in ihrer überwiegenden Mehrheit negativ konnotiert sind, auf altersbedingte Einschränkungen, auf unfreiwillige Verzichte verweisen. Hinzu kommen persönliche Verhaltensweisen, Bekleidungsstile oder sprachliche Ausdrucksformen, die als antiquiert angesehen werden bzw. nicht mehr konsensfähig sind. Dies und noch Vieles mehr prägt die Grauzonen menschlichen Lebens in seiner Spätphase. Es ist richtig, hier von Zonen zu sprechen, denn spätes Leben ist kein Fixum; es ist ein weites Feld von Erfahrungsweisen und Erfahrungswelten, von Zuschreibungen und Unterstellungen. Virginia Woolf hat von der »sea of old age« gesprochen, the »land without children«, ein Raum, dessen Geographie mehr durch das Fehlen von etwas als durch Errungenschaften und Möglichkeiten gekennzeichnet ist. Solche Sichtweisen sind beileibe kein Einzelfall. Wer immer sich mit dem Thema »Alter/n« beschäftigt, wird auf einen konzeptuellen Graubereich stoßen, eine merk- und denkwürdige Spannung zwischen der synthetisierenden Kraft des abstrakten Begriffs »Alter« und den vieldeutigen Formen, in denen er gelebt wird. Alter/n ist nachgerade ein Paradebeispiel für die von Adorno beklagte verdinglichende Gewalt des Begriffs; durch ihn wird »das Besondere wie von einem Folterinstrument zusammengepresst«4 . Das Besondere des Alter/ns gegen seine Verallgemeinerungen und Schablonisierungen zu verteidigen, ist deshalb auch ein zentrales Anliegen der folgenden Erörterungen. Menschen altern alle, aber sie tun dies auf ganz verschiedene Weise und unter oft nicht vergleichbaren Umständen. Insofern stellt in vielen Kontexten das Wort »Alter/n« eine unzulässige Verallgemeinerung dar. Es gibt nicht das Alter/n an und für sich, sondern unendlich viele und immer neue Formen und Praktiken, in denen sich der »Herbst des Lebens« manifestiert. Zugleich aber geschieht auch dies: »Alter/n« als soziale wie kulturelle Begrifflichkeit stiftet Gemeinsamkeiten; es bringt, zwingt Menschen zusammen unter einen Hut, zumeist gegen deren Willen: mit 65 gilt man offiziell als alt, ganz egal, in welcher körperlicher Verfassung man sich befindet oder wie man sich fühlt. Es ist letztlich die Magie der Sprache, die uns dazu befähigt und verleitet, über die Verschiedenheiten des Alter/ns hinwegzusehen bzw. zu gehen und von dem Alter zu sprechen. 3 4
Paley, Grace, Here. Here and Somewhere Else: Stories and Poems, New York 2007, 9. Adorno, Theodor W., Negative Dialektik, Frankfurt a.M. 1966, 339.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Für diese Schematisierungen fungiert, allen Verschiedenheiten zum Trotz der sichtbare alte Körper im alltäglichen Umgang als Grundlage, als Identifikationsfigur, aber in einem ganz anderen als dem üblichen Sinne; er lädt nicht zur Nähe, zur Nachahmung ein. Der alte Körper und das, wofür er steht, markieren vielmehr einen Ort kulturellen Unbehagens und dies nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen. Und dieses Unbehagen hat viel zu tun mit der Unausweichlichkeit des Verlaufs menschlichen Lebens. Wenn es ums »Alter« geht, hat die Zukunft immer schon begonnen. Biologen haben festgestellt, dass erste zunächst unmerkliche Anzeichen körperlichen Alterns schon ab dem 19. Lebensjahr zu beobachten sind. Und in der Tat scannen viele Menschen ihren Körper auf das, was man so gerne die Zeichen der Zeit nennt, und besonders intensiv tun dies Menschen im mittleren Lebensabschnitt. Man könnte dieses Phänomen als »Midlife Angst« bezeichnen (in Analogie zur Midlife Krise). Es ist diese oftmals diffuse Furcht vor der Zukunft Alter; davor, dass der Weg ins Grau ein Weg ins Grauen (materiell wie symbolisch) werden könnte, die beispielsweise Menschen in Silicon Valley dazu veranlasste, von einem Startup mit dem bezeichnenden Namen Ambrosia für $ 8,000 pro Portion Frischblutinjektionen zu kaufen, um damit länger jung sowie geistig und körperlich fit zu bleiben – in der Jugendkultur Kaliforniens und der Welt von Amazon, Google und Apple ein nur allzu nachvollziehbares Anliegen. Zwar hat die Aufsichtsbehörde FDA diese Praktiken verboten, es gibt aber schon eine neue Firma, Ivyplasma, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt.5 Solche Verhaltensweisen zeigen: Alter/n ist, auch dort, wo man ihm zu entkommen sucht, eine »Determinante menschlicher Existenz«. Der von Hannah Arendt in einem anderen Kontext eingeführte Begriff der Determinante ist für unsere Zwecke nützlich, weil er den Blick lenkt auf die vielfältige und immer wiederkehrende Art und Weise, durch die »Alter« - was immer im Einzelnen damit gemeint sein mag, zu einer Projektionsfläche und auch einem Kristallisationspunkt oft zwanghafter sozialer wie kultureller Identitätszuschreibungen wird: »Keiner wächst auf mit diesem Attribut, aber alle werden irgendwann darauf angesprochen.«6 Und es ist empirisch belegbar, dass die meisten dieser Zuschreibungen negativer Natur sind, dass sie Unbehagen auslösen, daher der Titel dieses Beitrags. Kein Wunder also, dass Alter/n gemeinhin als Defizitmodus menschlicher Existenz gilt, bestimmt durch das, was nicht mehr geht, was fehlt, und nicht durch das, was dieser Lebensabschnitt an möglichen positiven Erfahrungen mit sich bringen könnte.7 Das war übrigens schon immer so. Ciceros Schrift über das Alter, Cato Maior de 5 6 7
Vgl. https://www.gq.com/story/silicon-valley-young-blood Saake, Irmhild, Theorien über das Alter: Perspektiven einer konstruktivistischen Alternsforschung, Opladen 1998, 234. Einer der Gründe hierfür mag in der Ursprungsgeschichte moderner wissenschaftlicher Alter/nsforschung liegen. Jean-Martin Charcot, leitender Arzt am Hospital Salpêtrière in Paris, unternahm in der Mitte des 19. Jahrhunderts als erster den Versuch, die Erscheinungen des
125
126
Rüdiger Kunow
senenctute (44 v.d.Z.), eine der ersten systematischen Beschäftigungen mit diesem Thema in der westlichen Kultur, listet eine ganze Reihe von körperlichen, sozialen und kulturellen Verlusten auf, die mit Eintritt in die letzte Lebensphase einhergehen. Auf jüngste Veränderungen dieser Sichtweise werde ich noch zu sprechen kommen. Einstweilen gilt für Alter/n, was Freud in seiner Schrift Das Unbehagen in der Kultur (1930) feststellte, nämlich, dass der menschliche Körper eine Quelle von Unlust und daraus resultierend, von Aggression und Frustration ist, die sich auch gegen den eigenen Körper richten oder zu Vermeidungsstrategien führen kann. Wie also kann man, soll man, über Alter/n, über den menschlichen Körper in seiner Spätphase reden und dabei die affektive Dynamik, die der Begriff auslöst, nicht vergessen? Dies gestaltet sich schon deshalb schwierig, weil der alte Körper uns stets in zweierlei Gestalt gegeben ist, als biologisches Phänomen wie als kulturelle Praxis. Man kann sogar sagen: Im alten Körper nehmen biologische Prozesse eine dezidiert andersartige soziale wie kulturelle Qualität an, individuell wie kollektiv. Und das bedeutet, dass sich im Reden über das Alter/n Körper und Geist, Somatik und Semantik, Natur und Kultur, also die bekannten cartesianischen Gegensätze in vielfältiger und meiner Meinung nach unauflöslicher Weise verschränken. Der Alter/nsbegriff würde semantisch verkümmern bzw. analytisch vage werden, wenn man sich für eine der beiden Pole entscheiden wollte. Natürlich könnte man sich aus diesem Dilemma befreien, indem man der aktuellen poststrukturalistischen Methode folgend den alten Körper einfach als Konstrukt8 , als linguistisches Gebilde, als Text und das Reden über Alter/n als Diskursfeld versteht, wie dies etwa Irmhild Saake in ihrer ansonsten wegweisenden Studie tut. Aus Gründen, die noch ausführlicher zu diskutieren sein werden, habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Ich möchte auf den folgenden Seiten eine Reihe von Entwürfen präsentieren, die jeweils von einer Ausgangshypothese aus-
8
Alterns im menschlichen Körper systematisch zu erfassen. Sein Sample bildeten dabei die bis zu 6.000 Insassen des Salpêtrière, Arme und oft als geisteskrank diagnostizierte Patienten, die meisten davon Frauen. Ihre Körper wurden auf markante Zeichen für pathologische Fehlentwicklungen untersucht, die, wenn sie häufig genug vorkamen, von Charcot als typisch für den Prozess des Alterns ansah. Hierzu gehörten besonders Veränderungen der Epidermis, des Skelettaufbaus sowie des Zahnstatus. Mit dieser im folgenden verfeinerten Methodik wurde der Blick der sich entwickelnden gerontologischen wie geriatrischen Forschung auf körperliche Defizite, auf die prinzipielle und sich im Verlauf der Lebenszeit steigernde Abweichung alter Körper von einem angenommenen Normalmaß gelenkt. Vgl. dazu den Überblick bei Katz, Stephen, Growing Older Without Aging? Positive Aging, Anti-Ageism, and Anti-Aging. In: Generations 25.4 (2001) 27-32. Dies ist die Grundprämisse etwa der Arbeit von Irmhild Saake. Vgl. dazu auch die zutreffende Kritik in Süwolto, Leonie: Altern in einer alterslosen Gesellschaft. Literarische und filmische Imaginationen, Paderborn 2016, bes. 46-72.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
gehend den alten Körper in unterschiedlichen Konstellationen betrachten und sich von daher dem Phänomen Alter/n in unterschiedlicher Weise nähern.
Entwurf 1: Alter/n ist – anders Alte Menschen erscheinen als vertraut und doch irgendwie anders–eine gern genutzte Gelegenheit, um in der Begegnung mit ihnen weitere Unterscheidungen aufzurufen. Vorstellungen von Alter/n sind zumeist eingebunden in ein System binärer Gegensätze wie jung/alt, aktuell/überholt, nützlich/überflüssig, attraktiv/abstoßend, interessant/uninteressant und – man beachte die Umkehrung der Polarität – gut situiert (weil alt) vs. bedürftig, machtbesessen vs. Machtlos, wie die Jugend. Im Rahmen dieses bi-polaren Systems von Gegensätzen ist in unserer kommunikativen Alltagspraxis wie auch in wissenschaftlichen Diskursen (Gerontologie, Geriatrie) Alter/n eine »beobachtungsleitende Differenz«. Der Begriff »beobachtungsleitende Differenz« entstammt dem Kontext von Niklas Luhmanns Systemtheorie.9 Er verweist darauf, dass schon bloße Wahrnehmungsakte Interpretationen und Zuschreibungen auslösen und auf dieser Basis unser Verhalten zu Mitmenschen präformieren und kanalisieren können. Der im Wortsinn alternde Blick, die altmachende Hinwendung ist der vom Feminismus herausgearbeiteten Dynamik des »male gaze« verwandt, stiftet er doch bereits auf der Ebene von face to faceBeziehungen (ab)wertende Urteile und Verhaltensweisen. Der alternde Blick erinnert daran, wie bereits oberflächliche Begegnungen die Grundlage bilden für das Beziehungsdrama, das wir Alter/n nennen. Niemand altert für sich allein; vielmehr ist der alte Körper Ausgangs- und Zielpunkt für kollektiv geteilte und vermittelte Bilder, durch die der einzelne alte bzw. alternde Mensch als solcher überhaupt erst sichtbar wird, oft auf dramatische Weise, denn die Folgen dieser Blickkontakte sind zumeist gravierend. Sie trennen die so Bezeichneten von den Jungen, Gesunden, »Normalen«, und dies gründlich und für alle Zeit – denn wer einmal als alt bezeichnet wird, wird diese Charakterisierung kaum je wieder los. Darüber hinaus hat im Besonderen die feministische Alterswissenschaft gezeigt, dass die suggestive Kraft von »interaktionistisch erzeugte[n] Altersbilder[n] …«10 auf die alten Menschen selbst zurückwirkt, dass sie die altersbezogenen Fremdbilder verinnerlichen und sie zur Grundlage ihres eigenen Selbstbildes machen. Und hierzu gehört auch, dem altmachenden Blick dadurch zu entkommen
9 10
Vgl. Luhmann, Niklas, Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1984, 19. Saake, Irmhild, Theorien über das Alter: Perspektiven einer konstruktivistischen Alternsforschung, Opladen 1998, 180.
127
128
Rüdiger Kunow
versuchen, dass man sich als besonders jung gibt, wie dies bei Personen des öffentlichen Lebens oft zu beobachten ist. Unabhängig vom Erfolg solcher Bemühungen bleibt die Zuschreibung »Alter/n« die Grundlage für eine weitgehend ohne das aktive Zutun der betroffenen alten Menschen gebildete soziale, politische und natürlich kulturelle Gruppierung, eine »passive Gruppierung« im Sinne Sartres.11 Niemand wird gefragt, ob er oder sie als »alt« gelten möchte. Das tun politische und soziale Akteure – oft mit den besten Absichten – und das tun die lieben Mitmenschen. Das erklärt übrigens auch, warum die Suche nach einer als solche erkennbaren Alter/nskultur ins Leere laufen muss. Jung sein wollen eigentlich alle, darum gibt es die Jugendkultur, aber alt sein? Menschen werden selbstverständlich nicht alt geboren, sie werden alt gemacht, um hier ein bekanntes bon mot von Simone de Beauvoir zu bemühen. Ein Beispiel hierfür ist ein weitverbreitetes Gesellschaftsspiel, wobei der Begriff »Spiel« hier in doppelte Anführungszeichen zu setzen wäre, denn wenn man dieses Spiel verliert, sind die Folgen oft dramatisch. Ich rede vom sog. Altersraten mit der Frage: wie alt ist jemand, wobei oft noch ein »wirklich?« hinzukommt. Altersraten ist ein beliebtes Thema in der sogenannten Yellow Press, wie etwa beispielhaft der Artikel von Anjelica Oswald im Lifestyle-Magazin insider.com zeigt. Unter dem Titel »Here are 43 celebrities who are actually older than they look« präsentiert Oswald eine Reihe von Prominenten, zumeist aus Hollywood bzw. dem Umfeld, die jünger erscheinen, als ihr chronologisches Alter vermuten ließe.12 Zu den hier als beispielhaft und vorbildlich Vorgestellten gehören neben Jennifer Lopez (49) Selma Hayek (52), Halle Barry (51) und—unter den Männern Keanu Reeves (54). Über den Erkenntniswert dieser Publikation mag man geteilter Meinung sein, ebenso die Auswahl von gerade mal 50-Jährigen als »role models« für erfolgreiches (Nicht-)Alter/n, aber die Verfasserin stellt schon die richtigen alltäglichen Fragen: »wie alt ist er/sie eigentlich wirklich?« »Er/sie sieht jünger aus«; »ist er/sie wirklich erst soundso alt oder wird da gemogelt?« Und noch die zynische Variante: »Hoffentlich wird er einmal so alt, wie er jetzt schon aussieht« etc. Wir alle kennen dieses Spiel und spielen es immer wieder – die Pharma- und Kosmetikindustrie mit ihren Anti-Aging Produkten dürfte es freuen. Diese Produktlinien sind ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten »silbernen Markts«, und der Umsatz auf diesem Gebiet beläuft sich allein in Deutschland auf ca. € 1,5 Mrd. pro Jahr. Führend auf diesem Gebiet ist übrigens die Volksrepublik China mit einem jährigen Umsatz von $ 5,4 Mrd., gefolgt von den USA mit $ 3,8 Mrd.13
11
12 13
Eine auch für die Alter/nsforschung interessante Diskussion von Sartres Konzept bietet Young, Iris Marion, Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective. In: Signs 19 (1994) bes. 713,733-738. https://www.insider.com/celebrities-ages-older-than-they-look-2017-8 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/anti-aging-market
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Die Basis und zugleich das Objekt dieser oft entwürdigenden Praxis ist der alte bzw. alternde Körper, zumeist eigentlich nur dessen sichtbare Oberfläche, der hier gewissermaßen als Grauzone zum Ausgangspunkt einer Vermeidungsstrategie wird. In den letzten Jahrzehnten ist der Blick aufs Alter/n von der sichtbaren Oberfläche des Körpers in die Tiefe gewandert und hat nicht sichtbare Bereiche und Mechanismen erfasst. Ein – bei weitem nicht der einzige – Beleg hierfür ist die immer häufiger anzutreffende und wiederum pauschale Gleichsetzung der 2. Lebenshälfte mit kognitiven Defiziten wie dem dementiellen Syndrom, wie sie bei dem inzwischen populären Gebrauch des Wortes in der Jugendsprache vorliegt: bin ich Alzheimer? Die in den USA als »Alzheimerization of Aging« bezeichnete Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen darauf, wie die/der einzelne alte bzw. alternde Mensch als solcher überhaupt im öffentlichen Raum präsent sein kann. Sie verstärkt die latent vorhandene Furcht vor dem Alter, indem sie ein »worst case« Szenario dafür liefert, wie der letzte Abschnitt menschlichen Lebens (auch) verlaufen kann.14 . Es liegt eine tiefe Ironie darin, dass unter dem Signum »Alzheimer«, das Thema »Alter/n« zwar nicht länger verdrängt, ihm eine gewisse Sichtbarkeit geschaffen wird, während gleichzeitig die krankheitsbedingten kognitiven Einschränkungen den Verlust jeglicher sozialer Teilhabe mit sich bringen und die Betroffenen damit erneut unsichtbar machen. Insgesamt gesehen bietet der menschliche Körper viele Anlässe und ebenso viele Möglichkeiten, bestimmte Menschen von (allen) zu unterscheiden, meist unter negativen Vorzeichen, wie die Forschung im Bereich »gender« oder »race« gezeigt hat. Alter/n ist ganz gewiss auch eine solche, häufig übersehene, kulturell aber beglaubigte Möglichkeit für abwertende Unterscheidungen, wie wir eben gesehen haben. Das hat Folgen auch für eine kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema. Ein um den Differenzbegriff organisierte Vorstellung von Alter/n hat daher viele Vorteile für die Analyse, nicht zuletzt deshalb, weil sie auf in den Cultural Studies eingeübte Methoden, wie mit differentieller Körperlichkeit umzugehen sei, zurückgreifen kann. Dies ermöglicht den Dialog mit anderen Leitdifferenzen wie Gender, »Rasse« und sexuelle Orientierung – Intersektionalität wäre ein Konzept, das sich hier anböte. Zugleich aber hinterlässt uns diese Vorstellung aber mit einem Dilemma. Alter/n ist eine körperbasierte Differenz wie »Rasse« oder Geschlecht, das ist ohne Zweifel richtig. Anders als bei diesen Differenzen handelt es sich hier aber um eine, unter die prinzipiell alle Menschen eines Tages fallen werden. Das wirft die Frage auf: Ist Alter/n eine Differenz wie die genannten, oder
14
Vgl. Gullette, Margaret Morganroth, Agewise: Fighting the New Ageism in America, Chicago 2011, 178f., 191.
129
130
Rüdiger Kunow
so etwas wie eine Meta-Differenz oder müssen wir vielleicht eine andere Vorstellung von körperbasierten Differenzen entwickeln? In diesem Zusammenhang mag es hilfreich sein, auf ähnliche Überlegungen im Bereich der Disability Studies hinzuweisen. Hier hat man das Konzept des »temporarily able«, des »noch körperlich Uneingeschränkten« entwickelt; vielleicht ließe sich diese Idee auf das Phänomen des Alter/ns übertragen, etwa in dem Sinne, dass junge und mittelalte Menschen als nur »noch nicht alt« zu bezeichnen wären? Welche Realisierungschancen in der kommunikativen Alltagspraxis derartige Konstrukte haben dürften, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Entwurf 2: Alter/n ist – ein Ärgernis Alt werden wollen viele, alt sein weniger, und alt sind sowieso immer die anderen. In gerontologischen Texten finden sich viele Belege dafür, dass Menschen die physiologischen Veränderungen ihres Körpers als ärgerlichen Verlust an fragloser Selbstbestimmung empfinden. Diese Klage über körperliches Altern ist selbst alt, so alt wie die historische Überlieferung, wie dieses unlängst(2014) entdeckte wunderschöne Textfragment der griechischen Lyrikerin Sappho von Lesbos (ca. 630/612 -570 v.d.Z.) zeigt: [Ergriffen hat mir (?)] die einst[zarte] Haut das Alter schon, [weiss] geworden sind die Haare aus schwarzen; schwer ist mir das Herz gemacht worden, die Knie tragen nicht, die doch einst leicht waren zu tanzen, jungen Rehen gleich. Das beseufze ich oft. Aber was kann ich machen? Alterslos kann man nicht werden, wenn man ein Mensch ist. Denn sagte man auch über Tithonos, dass einst die rosenarmige Eos ihn aus Liebesverlangen [?] zum Ende der Erde getragen habe, den schönen und jungen, aber dennoch ergriff ihn mit der Zeit das graue Alter, obwohl er doch eine unsterbliche Gattin hatte.[…]15 Ganz im Gegensatz zu dieser melancholisch-resignativen Note stehen die Reflexionen von Jean Améry. Seine Monographie Über das Altern: Revolte und Resignation (1968) ist einer der ersten Texte in deutscher Sprache, die sich systematisch dem Thema Alter/n zuwenden.16 Die darin vorgetragene Sichtweise ist kompromisslos, ja bedrückend negativ:
15 16
https://www.uni-frankfurt.de/44031198/sappho_Forschung_Frankfurt.pdf Noch vor Améry sind erschienen beispielsweise die gerontologische Arbeit von Paul Matzdorff, Grundlagen zur Erforschung des Alters, Frankfurt a.M. 1948 sowie Helmut Schelskys soziologische Studie Paradoxien des Alters in der modernen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1959.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Gibt es so etwas wie eine Grundbefindlichkeit des Alterns, so lässt sich diese annähernd konzentrieren in Wörtern wie Mühsal und Drangsal. […] [Der [sic!] Alternde erfährt] wieder und wieder, dass aus dem Körper, der ihn und sich selbst trug, ein corpus wird, das in ihm lastet und sich Last ist. […] Der Alternde, dem sein Körper die Welt verbietet und ihn hämisch zwingt, sich mit ihm […] zu befassen […] muss unweigerlich die ›sterbliche Hülle‹, die ihn umkleidet und von innen auskleidet, als ein Aussen verspüren […].17 Für den Überlebenden der Shoah, den Häftling in Auschwitz, Buchenwald und Bergen Belsen, war das »tragische Ungemach des Alterns«18 so unerträglich, dass er sich schließlich das Leben nahm. Diese beiden Beispiele aus der schier unendlichen Reihe von Zeugnissen19 , in denen der alternde Körper zum Ausgang von oft sehr grundsätzlichen Reflexionen wird, sollen hier zeigen, dass das Unbehagen am Alter/n zu Fragen führt, die über den engeren Bereich von Körper und Zeit hinausgehen und in ethische Grundsatzfragen führen. Hierauf werde ich am Ende dieser Überlegungen noch einmal zu sprechen kommen. An dieser Stelle sei nur kurz darauf eingegangen, wie dieses Unbehagen im öffentlichen Raum unserer Gesellschaft ausgetragen wird. Viele Menschen assoziieren mit Alter/n, fast automatisch, intuitiv, die Vergangenheit. Das ist nicht (mehr) richtig. Alter hat Zukunft20 : Die Alten, wir Alten werden immer mehr. Die sogenannte »Langlebigkeitsrevolution« im zurückliegenden Jahrhundert21 hat dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen, nicht nur im globalen Norden, immer länger leben, auch und gerade bei in Deutschland. Lag durchschnittliche Lebenserwartung hier im Jahre 1950 noch bei 66 Jahren, so sind es im Jahre 2015 82 Jahre (78,4 bei Männern, 83,4 bei Frauen). Dadurch leben immer mehr alte Menschen in diesem Lande, und nicht nur hier. Schon jetzt ist Europa im weltweiten Vergleich der »älteste« Kontinent und Deutschland eines der Län-
17 18 19 20 21
Améry, Jean, Über das Altern: Revolte und Resignation.1968, München 1991, 54f. Ebd., 12. Eine informative und nuancierte Übersicht über literarische Texte sowie zum Thema liefert Süwolto im zweiten Teil ihrer Arbeit (103-380). Dies war auch der Titel einer Initiative der Bundesregierung aus dem Jahre 2011. Der vielbesprochene demographische Wandel ist Ergebnis des Erfolgs einer Reihe von Fortschritten und Maßnahmen auf unterschiedlichen Gebieten, wie bessere medizinische Versorgung auch für weniger Wohlhabende, die Entwicklung von Medikamenten im Bereich Herz-/Kreislauferkrankungen und das Zurückdrängen von ansteckenden, epidemisch verlaufenden Krankheiten; in der Folge hat sich die Lebenserwartung der Menschen, stärker verlängert als in jeder anderen Epoche der Menschheitsgeschichte zuvor (https://www.swisslife. com/en/home/hub/langlebigkeitsrevolution.html).
131
132
Rüdiger Kunow
der mit dem größten Anteil an Seniorinnen und Senioren (17.5 Mio. = 21 %).22 Diese Entwicklung, mitsamt ihren sozialen wie kulturellen Folgen, freut nicht alle, nicht die Sozialpolitiker und besonders nicht die Jungen, weil sie die »asymmetrische Bürde des Generationenvertrags« noch schwerer werden lässt.23 In diesem Zusammenhang und besonders aus kulturkritischer Perspektive ist es angezeigt, auf eine Eigentümlichkeit unseres Sprachgebrauchs und damit unserer kulturellen Alltagspraxis hingewiesen: Für die große Zahl junger Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er und 1960er Jahren geboren wurden, hat sich das Wort von den »baby boomers« eingeprägt. »Boom« bedeutet Entwicklung, Steigerung, Zukunft. Nun, da die »boomers« alt geworden sind, findet sich kein ähnlich wohlwollender Begriff. Es gibt auch keinen »politisch korrekten« sprachlichen Weichspüler zum Thema »Alter/n«. In den USA hat man es mit »chronologically gifted« versucht, aber diese Wortschöpfung hat sich nicht durchsetzen können und im Deutschen auch keine Entsprechung gefunden. Hier ist eher die Rede von einer »Altenschwemme« (analog zum Butterberg oder dem Milchsee der EU) oder von einem »Silber tsunami«. Andernorts verglich man gar die Gesellschaften des globalen Nordens, also USA, Canada, Europa, mit der Titanic, die auf einen gigantischen Eisberg zusteuere, nur dass diesmal der Eisberg aus zu vielen Alten besteht (dazu ausführlicher Peterson). Wie immer man zu solchen Bildern, von Vergreisung als Vereisung, stehen mag: Die Langlebigkeitsrevolution sowie der vielbeschworene demographische Wandel haben nicht nur die Demographie verändert, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen ihr Alter/n und das ihrer Mitmenschen erleben (können bzw. wollen). So gibt es immer mehr Senioren, die immer länger ein beschwerdefreies Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe führen können. Das ist eine Errungenschaft, die auf keinen Fall gering geschätzt werden sollte. Emblem dieser Entwicklung und zugleich Zielscheibe für eine intensiver werdende sozio-kulturelle Diffamierung sind die sogenannten »Neuen Alten« oder »Jungen Alten«; im angelsächsischen Sprachraum oft »silver agers« oder »best agers« genannt. Sie leben in gesicherten, mitunter üppig anmutenden materiellen Umständen24 , scheinbar unberührt von körperlichen Gebrechen und sozialen Problemen früherer Senioren. Die hierin liegenden Möglichkeiten zeichnet Brigitte Donicht-Fluck, ehemals Mitarbeiterin am Berliner Alterszentrum, wie folgt nach:
22 23 24
Hierzu allgemein Kaufmann, Franz-Xaver, Schrumpfende Gesellschaft: Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen, Frankfurt a.M. 2005. Vgl. Habermas, Jürgen, Zwischen Naturalismus und Religion: Philosophische Aufsätze, Frankfurt a.M. 2005, 144. Marketing für Senioren: https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/ generation-50-die-wahre-werberelevante-zielgruppe/.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Die Anzeichen eines radikalen Wertewandels hin zu einer Sichtweise von Ruhestand und Alter als einer neuen emanzipatorischen Phase menschlicher Entwicklung, [die] eine Lebensphase einleitet mit einer neuen Identität und neuen Handlungsmöglichkeiten, sind … unübersehbar… Ins Positive gewendet heißt das, dass die Chancen und Spielräume des Einzelnen, sich auch im allerhöchsten Lebensalter noch weiter zu entwickeln, ungleich größer geworden sind […] Das Alter kann so zu einer zweiten Chance werden.25 Und doch oder vielleicht gerade deshalb ist es gerade diese Gruppe der »jungen Alten«, die ein weitverbreitetes Unbehagen stiftet, natürlich bei der heranwachsenden Generation. Das ist eigentlich kaum etwas Neues. Alt gegen Jung, das ist eine beliebte Paarung, die immer neu ausgefochten wird, z.B. in Frank Schirrmachers Polemik in seinem Buch, Das Methusalem Komplott (2004). Aktuell erleben wir eine neue Runde im Generationenkonflikt. Beispielhaft für das Anliegen und auch die zugrundliegende Polemik sind Texte wie Madeleine Hofmanns aktuell vieldiskutiertes Buch Macht Platz! Über die Jugend von heute und die Alten, die überall dick drin sitzen und über fehlenden Nachwuchs schimpfen (2018) oder Wolfgang Gründingers Alte Säcke Politik: Wie wir unsere Zukunft verspielen (2016). Die Argumente sind ähnlich und immer wieder die gleichen: sie zielen neben der als überbordend empfundenen materiellen Privilegierung alter Menschen – von Altersarmut ist hier nie die Rede – grundsätzlicher darauf, wie ganz besonders alte weiße Männer – solche Exemplare wie der Verfasser dieser Zeilen – Politik und Gesellschaft dominieren und notwendigen Wandel hintertreiben. Alternativ dazu suchen Hofmann wie Gründinger und suchen viele andere die Bedingungen auszuloten, unter denen eine andere, zukunftsorientierte, dabei aber auch generationenübergreifende Politik ohne die Alten gestaltet werden kann. Wie sehr solche Anliegen wie auch die zugrundeliegende Kritik an der Präponderanz der Alten – mit den üblichen Verdächtigen: Donald Trump, laut TIME Magazine »the revenge of old white men«, der Brexit, der Aufstieg der Populisten etc. – in die Mitte, besser die junge Mitte der Gesellschaft ausstrahlen, zeigt ein Beitrag in juna, der Zeitschrift des Bayerischen Jugendrings. Garniert mit einem Bild von kaffeetrinkenden Alten—wie im bekannten Hetzlied von Udo Jürgens »Aber bitte mit Sahne”—findet sich in juna eine Betrachtung von Walter Gründinger zum Thema »Die Übermacht der Alten«26 . Hierin beklagt Gründinger, selbsterklärter »Zukunftslobbyist und Generationenerklärer«, wie die große Zahl alter Wähler regelmäßig fortschrittliche Politikansätze niederstimmen
25
26
Donicht-Fluck, Brigitte, Alter und Altenbildung in den U.S.A. – Kulturelle Konzepte im Wandel. In: Becker, Susanne/Veelken, Ludger/Wallraven, Klaus Peter (Hg.), Handbuch Altenbildung: Theorien und Konzepte für Gegenwart und Zukunft, Opladen 2000, 153-66, 156. https://www.bjr.de/service/juna/die-uebermacht-der-alten.html
133
134
Rüdiger Kunow
und zudem dafür sorgen würde, dass die Anliegen der jungen Generation im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht mehr vorkämen. »Je älter, desto Ego«, so könnte man den Tenor von Gründingers »Plädoyer für mehr Jugendgerechtigkeit« charakterisieren. Diese Diskussion hier nachzuzeichnen, würde das Format dieses Beitrags, in dem es weniger um die Berechtigung solcher Klagen als um die dadurch geprägte kulturelle Präsenz alter Menschen geht, bei weitem sprengen. Wichtig ist allerdings noch der kurze Hinweis, dass der Generationenkonflikt, der lange Zeit um politische Macht und die Verteilung sozialer Ressourcen ausgefochten wurde und bei Gründinger auch noch ausgefochten wird, in jüngster Zeit eine Akzentverlagerung erfahren hat hin zu ökologischen Fragen, exemplarisch vertreten durch die »Fridays for Future«-Bewegung. Angesichts der Dringlichkeit des von ihr vertretenen Anliegens dürfte dies auch das Feld sein, auf dem in naher Zukunft neue Formen intergenerationeller Begegnungen und Kooperation entstehen werden.
Entwurf 3: Alter/n ist (k)ein Konstrukt Eingangs war bereits davon die Rede, dass der alte Körper für alle Menschen, auch die noch nicht alten, ein unerschöpfliches Thema und eine Quelle des Sorge ist. Nun liegt es in einer Zeit, in der ein Großteil zeitgenössischer Kulturkritik an die universelle Konstruiertheit unseres Lebens, ja der Welt insgesamt glaubt, nahe, auch den alten Körper auf eben diesen Konstruktcharakter hin zu betrachten. In einem weiteren Schritt könnte man dann, in Analogie zu »Rasse«, Gender, Behinderung oder Krankheit, auch Alter/n als Konstrukt konzipieren. So leicht möchte ich es mir allerdings nicht machen. Als ein materialistischer Kulturkritiker teile ich die in den letzten Jahren immer lauter gewordene Kritik an der semiologischen Umformulierung jeglicher gesellschaftlicher und kultureller Praxis und damit auch des Alter/ns in ein prinzipiell end- und zielloses Spiel von sprachlichen Signifikanten. Und gerade das Nachdenken über den alten Körper ist ein strategischer Ort, an dem sich die Grenzen konstruktivistischer Verfahren bemerkbar machen, wie neben vielen anderen Diana Coole und Samantha Frost unlängst festgestellt haben: »the importance of bodies in situating empirical actors within a material environment of nature, other bodies, and the socioeconomic structures that dictate where and how they find sustenance […] such material dimensions have recently been marginalized by fashionable constructivist approaches and identity politics.«27
27
Coole, Diana/Frost, Samantha, Introducing the New Materialisms. New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Durham 2010, 19.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass ausgerechnet Judith Butler, auf die sich Konstruktivismen aller Couleur allzu gerne berufen, schon früh in ihren ersten Texten wiederholt auf die Grenzen einer Methode hingewiesen hat, welche den Körper zur bedingungs- und problemlosen Verfügungsmasse sprachlicher Operationen macht: »Although the body depends on language to be known, the body also exceeds every possible linguistic effort at capture. […] The body escapes its linguistic grasp […]«28 . An anderer Stelle bezeichnet Butler den menschlichen Körper als blinden Fleck der Sprache (»blindspot of speech«)29 . Natürlich ist der Wert solcher Einzelzitate begrenzt, aber sie wecken einen, wie ich finde, produktiven Zweifel daran, dass auch in Butlers Sicht der menschliche Körper, und damit auch der alte Körper, eben nicht bruchlos in unserer sprachlichen Alltagspraxis aufgeht oder von den Archiven unserer Kommunikationsmittel vollständig beherrscht werden kann. Ich möchte daher einen anderen Weg vorschlagen, der sich an der Materialität des Körpers orientiert. Es ist, so behaupte ich, eben diese Materialität, die Physis des Körpers, die sich, wie Butler bemerkt, dem sprachlichen Zugriff entzieht – »escapes« –, die Möglichkeiten der Sprache überschreitet – »excess«. Und was hier über den menschlichen Körper allgemein gesagt wurde, gilt selbstverständlich erst recht für den alten Körper, der seine Präsenz außersprachlich und in oft dringlicher Weise geltend macht. Natürlich ist die Existenz des menschlichen Körpers ontologisch nicht zu belegen, da wir über keinen archimedischen Punkt außerhalb unserer Gedankenwelt verfügen, von dem aus sich entscheiden ließe, ob es einen Körper, einen alten Körper an und für sich gibt. Darin hat Butler, darin haben die Konstruktivismen aller Couleur recht. Aber das ist auch nicht das Problem. Worum es vielmehr geht, ist die Art und Weise, in welcher der menschliche Körper sich bemerkbar macht. Und dies geschieht weniger in onto-kritischen Reflexionen als dann, wenn er sich unseren Plänen und unseren Wünschen entgegenstellt. So wie man eine Glaswand erst bemerkt, wenn man dagegen läuft, so werden Menschen sich ihres Körpers oft erst dann bewusst, wenn sie nicht mehr tun können wie sie wollen, wenn der Körper nicht mehr problemlos funktioniert, und solche Momente körperlichen Widerstandes häufen sich in der Spätphase menschlichen Lebens. Dann merken Menschen auf schmerzhafte Weise, dass sie einen Körper haben30 . Und solche Momente, in denen sich der Körper intensiv zu Worte meldet, sind oft zugleich Augenblicke, in
28 29 30
Butler, Judith, How Can I Deny That These Hands and This Body Are Mine? In: Qui Parle 11 (1997) 1-20, 2. Vgl. Butler, Judith, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York 1997, 11. Diese Hinwendung zur immer schon gegebenen Existentialität im Körper ist ein Kernpunkt der phänomenologischen Anthropologie von Helmuth Plessner (vgl. dessen »Lachen und Weinen«, Gesammelte Schriften, Bd. VII. Frankfurt a.M. 2003, 201-387).
135
136
Rüdiger Kunow
denen uns die Worte fehlen, Grenzsituationen sprachlicher Kommunikation(sfähigkeit). Man muss dazu nicht an Goethes berühmten Spruch »Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt […]« (Torquato Tasso V,v) denken. Schon in den frühen Stadien westlicher Kultur hat die Intensität negativer Körperempfindungen die Kunst zu experimentellen Strukturen gedrängt. Ein Beispiel wäre Philoktets Klage in der gleichnamigen Tragödie des Sophocles (409 v.d.Z.), eine Klage, in der unter dem unerträglichen körperlichen Schmerz des alternden Philoktet seine Artikulationsfähigkeit zusammenbricht und sein Sprechen buchstäblich zu einem »blabla« wird, ausgedrückt in der immer wiederholen Buchstabenfolge βαβαβα. Näher auf die Erfahrungen unserer Tage bezogen ist das Transkript eines Dialogs mit ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter Lil in Elinor Fuchs’s autobiographischem Text Making an Exit (2005): ELINOR: How are you, Mother? LIL: Oh, in a fast muff, getting out of the wet ditches. ELINOR: Wet ditches, well, that’s interesting. LIL: Oh, I’m in a dedeford, they’re, they’re having a beurz. I mean, they’re having a cressit. And would be considered hijardi. Would be picking dependent stuff. I mean they’re showing up prepays and other things. ELINOR: That’s good.31
Entwurf 4 – FOLIE: Alter/n ist – nicht mehr Alter/n, eine Form des menschlichen Lebens in der Zeit, aber über diese Zeit können Menschen nicht frei verfügen. Der Lauf der Zeit, der die Menschen altert, lässt sich nicht durch keine Tat, durch keinen Willensakt und auch kein Sprachspiel umkehren. Und so bleibt, sagte der Philosoph Hans Blumenberg einmal, letztlich nur »die Unstimmigkeit des Lebens mit [der Zeit] […]« Und weil die Zeit in ihrem unerbittlichen Fortgang das Maß menschlichen Lebens immer schon überschreitet - »das Leben geht weiter«, sagt der Volksmund - spricht Blumenberg von einem grundsätzlichen »Unbehagen am Zeitlauf«32 . Gerade im Alter/n macht sich dieses Unbehagen besonders bemerkbar. Doch Rettung scheint in Sicht, und zwar in Gestalt von Genetik und Biotechnologie. Seit der Jahrtausendwende sind die genetischen Grundlagen des menschlichen Erbguts weitgehend entschlüsselt. Die molekulare Humangenetik, also »die
31 32
Fuchs, Elinor, Making an Exit: A Mother-Daughter Drama with Alzheimer’s, New York 2005, o.S. Blumenberg, Hans, Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt a.M. 1986, 26f.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Klinische Diagnostik und Differentialdiagnostik genetisch bedingter Erkrankungen unter Berücksichtigung labordiagnostischer Möglichkeiten sowie die Risikoermittlung und genetische Beratung der Patienten und deren Familien«33 hat seitdem eine rasante Entwicklung genommen und besonders der »biotech gold rush in medicine« (Elliott) bietet immer schneller und immer mehr Möglichkeiten der Korrektur genetischer Fehlbildungen, etwa bei Erbkrankheiten oder einigen Krebsformen.34 Ich bin weder Mediziner noch Biologie und kann somit die Entwicklungen nur von außen, von ihrem sozialen und kulturellen Widerhall aus betrachten. Der allerdings ist erheblich. Die Genetik hat längst das Labor hinter sich gelassen und ist zum allgemeinen Spekulationsobjekt in mehr als einem Sinne geworden. Gentechnik stellt nicht nur eine Zukunftsindustrie im globalen Wettbewerb dar; wie aktuell das »100 000 Genome« – Projekt in China beweist.35 Gentechnik befeuert aber zugleich auch die Phantasien von einem besseren, möglichst perfekten Körper, Basis für ein Leben ohne Krankheit, ohne Alter, ohne Tod. So gesehen, bietet die Humangenetik jenseits ihrer engeren therapeutischen Anwendungen eine grandiose, möglicherweise die ultimative Utopie von Menschen, eine Utopie, die auch die Unabdingbarkeiten von körperlichem Alter/n hinter sich lässt. Aktuell basieren gentherapeutische Verfahren darauf, dass dem Körper blutbildende Zellen entnommen und diese dann gentechnisch verändert werden – CRISPERcas9 ist das Stichwort hier. Die gentechnisch optimierten Zellen werden dann wieder in den Körper eingebracht und korrigieren pathologische Fehlentwicklungen. Der Schwerpunkt solcher Gentherapien lag bislang im Bereich pränataler Diagnostik, doch auch die zweite Lebenshälfte ist zunehmend in den Blick der Forschung geraten. So haben Tierversuche am Stammzelleninstitut der Harvard Universität gezeigt, dass Proteine wie GDF 11, in die Blutbahn eingebracht, altersbedingte Verdickungen des Herzmuskels zurückbilden und überdies auch bei Gehirnleistungen einen Verjüngungseffekt haben können.36 33 34
35 36
Sächsische Ärztekammer; https://www.slaek.de/de/05/aufgaben/weiterbildung/Papierkorb/ zusgene.php?lastpage=zur %20Ergebnisliste Fünf Gentherapien sind gegenwärtig (Januar 2020) in Europa zugelassen, davon drei seit 2018. Strimvelis als Therapie für angeborene Immunschwäche; Luxturna lindert angeborene Blindheit, ohne sie allerdings zu heilen bei Kosten in Höhe von 850 000 US-Dollar für beide Auge; Zynteglo wird angewandt bei ß-Thalassämie (Erkrankungen der roten Blutkörperchen, bei denen durch einen Gendefekt das Hämoglobin nicht ausreichend gebildet wird); Kymriah und Yescarta bekämpfen eine Form des aggressiven Blutkrebses. Kymriah und Yescarta setzen CAR-T-Zellen gegen aggressive Leukämien und Lymphome ein. Mehr zu Therapien und den dabei aufkommenden ethischen Fragen bei Mukherjee, Siddartha, The Gene, New York 2016, 426f. 491f. https://www.tagesspiegel.de/politik/genforschung-in-china-peking-zoegert-nicht-anethischen-grenzen/23683958.html. https://hsci.harvard.edu/aging-and-gdf11-what-we-know
137
138
Rüdiger Kunow
Auch wenn das immer wieder durch die Medien geisternde »Altersgen« vermutlich nicht existiert: Bereits jetzt bzw. in absehbarer Zukunft wird es gentherapeutisch möglich werden, schon in einem sehr frühen Lebensalter die individuelle Disposition eines Menschen für spätere, altersassoziierte Erkrankungen wie Arteriosklerose, Osteoporose, Morbus Alzheimer und auch Formen des Karzinoms zu ermitteln und diese durch Intervention auszuschließen. Jenseits solcher Experimente sind seriöse Gentherapien gegen körperliches Alter/nserscheinungen generell einstweilen noch nicht in Sicht, doch existieren bereits Verfahren, die eines vielleicht nicht mehr allzu fernen Tages weitere Möglichkeiten eröffnen werden, die erwähnten degenerativen Prozesse körperlichen Alter/ns aufzuhalten, vielleicht sogar zu unterbinden. Hinzu kommt, dass Gentherapien, im Kindesalter vorgenommen, auch ein besseres Alter, wenn nicht überhaupt erst das Erreichen des Alters ermöglichen werden. Durch diesen Kaskadeneffekt erscheint eine zweite Langlebigkeitsrevolution möglich, die die erwartete Überalterung der Gesellschaft mittelfristig dadurch neugestaltet, dass sie ein Alter ohne Altern, ohne körperbedingte Einschränkungen und die daraus erwachsenen Beschwerden und Probleme, möglich macht. Es wird mehr »Junge Alte« geben.37 Die Aktivisten vom Bayerischen Jugendring wird es freuen. Diese Entwicklung ist auch ein Thema für die Kulturwissenschaften, nicht nur deshalb, weil mögliche Schattenseiten der schönen neuen Welt der Gentechnik im Bereich der Kultur bereits kontrovers diskutiert werden. Zu denken wäre hier an Kazuo Ishigurus verfilmten Roman Alles was wir geben mussten (2005), in dem lebende Menschen als Ersatzteillager für Wohlhabende dienen, oder Filme wie Gattaca (1997), in dem Genetik, die genetische Ausstattung eines Menschen zu dessen eigentlichen Biographie wird. Wichtiger noch ist etwas anderes: Gentherapien verändern unsere Vorstellung vom menschlichen Körper, und zwar nachhaltig. Ihre Tendenz ist, den menschlichen Körper zu »normalisieren«, ihn so zu verändern, dass er dem statistischen, »gesunden« Durchschnitt entspricht. Das Normale ist hier das Wünschenswerte, wie die aktuelle Diskussion um Trisomie 21, das sog. Down Syndrom zeigt, wobei die Befürchtungen, dass durch pränatale Interventionen diese und möglicherweise andere Gendefekte gänzlich abgeschafft werden, komplexe ethische Fragen aufwerfen. Manche der in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente lassen sich mutatis mutandis auch auf den alten Körper übertragen: In dem Maße, in dem Gentechnik Anomalien des Körpers beseitigen hilft, hilft sie tendenziell auch, das Alter/s als erkennbare, eigenständige Lebensphase zum Verschwinden zu bringen. Nach den Designer Babies nun die Designer Alten? Ob wir das wollen, wollen sollen, ist vielleicht die wichtigste Frage für die Zukunft des Alter/ns in unserer Gesellschaft. 37
Darum ist die Idee einer alterslosen Gesellschaft (Süwolto) falsch.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Niemand kann voraussehen, welche konkreten Ergebnisse die rasante Entwicklung in diesem Bereich noch hervorbringen wird. Was bereits jetzt sicher ist: Gentherapeutische Verfahren haben ihren Preis – und zwar sowohl im ursprünglichen wie im metaphorischen Sinn. Aktuell kosten solche Verfahren, beispielsweise gegen spinale Muskelatrophie zwischen $375,000 und $875.000; gegen lymphatische Leukämie $ 240.00038 , und welchen finanziellen Aufwand die sicher komplexeren Verfahren der Zukunft erfordern werden, kann niemand sagen. Allerdings zeichnet sich schon jetzt die Möglichkeit von einer Entwicklung ab, die ich »gentechnisch basierte Apartheid« nennen möchte, einer Trennung zwischen den vermutlich nicht allzu zahlreichen Menschen, die sich ein molekularbiologisch optimiertes Alter/n werden leisten können und allen anderen.
Coda: »Alter/n« Körper im öffentlichen Raum Schon seit Beginn menschlichen Zusammenlebens war Alter/n nicht nur eine Zeitbestimmung, sondern auch eine soziokulturelle – heute würden wir sagen, zivilgesellschaftliche Verständigung über den Platz und die Rolle der verschiedenen Lebensalter im öffentlichen Raum, eine Form des »bio-citizenship«, wie sie für den Wohlfahrtsstaat seit dem Zweiten Weltkrieg charakteristisch ist bzw. war. Sowohl die Formen eines neuen Alter/ns im Stile der »Jungen Alten« wie auch die antiaging Genetik, die helfen kann, sie herbeiführen, stellen diese Verständigung vor neue Herausforderungen. Und dies wirft die Frage auf, welchen weiteren Preis, jenseits der finanziellen Aspekte alter/nsbezogene Gentechnik noch fordern mag. Die Biologie des genetisch erschlossenen Subjekts ist neben ihren therapeutischen Optionen auch ein Paradebeispiel für die immer stärker »in den Alltag einwandernde«39 Objektivierung menschlicher Lebensverläufe. An die Stelle sozialpolitischer Normierung des Alter/ns (Rente, Renteneintrittsalter) ist in neoliberalen kapitalistischen Gesellschaften ein Zwang zur kontinuierlichen Arbeit am eigenen Körper getreten. Der seit einiger Zeit von verschiedenen Perspektiven her beschriebene Prozess ständig »gestiegener Eigenleistungen des Subjekts«40 macht auch vor dem Alter/n nicht halt. Und so dürfte mit der Verfügbarkeit gentechnischer Optimierungen auch der Druck auf die Betroffenen steigen, die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen.
38
39 40
Treating a child with smaller than usual bodily growth with a Human Growth Hormone (HGH) will cost approximately $ 150,000 (Designer Genes, orionmagazine.com, Orion Magazine, 15 Feb. 2015. Habermas, Jürgen, Zwischen Naturalismus und Religion, 148. Honneth, Axel, Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung. In: Menke, Christoph/Rebentisch, Juliane (Hg.), Kreation und Depression, Berlin 2010, 63-80, 64.
139
140
Rüdiger Kunow
Schon jetzt tragen, jedenfalls in den USA, viele ältere, ja auch alte Menschen Geräte wie Smartwatches oder Fitnesstracker und schon jetzt haben Umfragen dort eine deutliche Bereitschaft von Senioren erkennen lassen, pharmakogenetische Medikationen wie auch gentechnische Interventionen zu nutzen, um anderen nicht zur Last zu fallen. Das Stichwort ist »enhancement« und ein Zustand des Körpers, der als »better than well« (Elliot) gelten kann. Vor dem Hintergrund des immer intensiver betriebenen Abbaus des Sozialstaates weltweit sollte es niemanden verwundern, dass dies so ist, dass alte Menschen so lange fit bleiben möchten und müssen, wie es irgendwie geht, mit welchen Mitteln auch immer. An dieser Stelle wird etwas deutlich, dass bereits zu Beginn meiner Argumentation anklang: Die Frage nach dem alten Körper ist umfassender – und wichtiger – als die Beschäftigung mit den jeweiligen Lebensumständen von Menschen in ihrer 2. Lebenshälfte. Vielmehr entfaltet unser Nachdenken über menschliches Leben in seiner Spätphase ein kritisches Potential, wirft ethische Fragen auf darüber, was wir für ein gutes, erstrebenswertes, gesellschaftlich akzeptiertes Leben halten und welche Chancen, welchen Platz wir denen einräumen, deren Körper die gängigen Normen oder Ideale verfehlen. Dazu gehören alte Menschen ganz unmittelbar. Und so gilt für die Frage nach dem letzten Lebensabschnitt und wie Menschen ihn gestalten (können), dass sich erst im Umgang mit dem menschlichen Körper in allen seinen Stadien eine humane Gesellschaft verwirklichen lässt.
Literatur Adorno, Theodor W, Negative Dialektik, Frankfurt a.M. 1966. Améry, Jean, Über das Altern: Revolte und Resignation.1968, München 1991. Blumenberg, Hans, Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt a.M. 1986. Butler, Judith, How Can I Deny That These Hands and This Body Are Mine? Qui Parle 11 (1997) 1-20. Butler, Judith, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York 1997. Coole, Diana/Frost, Samantha, Introducing the New Materialisms. New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Durham 2010. Cristofalo, Vincent J./Tresini, Maria/Francis, Mary Kay/Volker, Craig, Biological Theories of Senescence. In: Bengtson, Vern. L./Warner Schaie, K. (Hg.), Handbook of Theories of Aging, New York 1999, 98-112. Donicht-Fluck, Brigitte, Alter und Altenbildung in den U.S.A. – Kulturelle Konzepte im Wandel. In: Becker, Susanne/Veelken, Ludger/Wallraven, Klaus Peter (Hg.), Handbuch Altenbildung: Theorien und Konzepte für Gegenwart und Zukunft, Opladen 2000, 153-66. Elliott, Carl, Better Than Well: American Medicine Meets the American Dream, New York 2003.
Alter/n als Form kulturellen Unbehagens
Fuchs, Elinor, Making an Exit: A Mother-Daughter Drama with Alzheimer’s, New York 2005. Gullette, Margaret Morganroth, Agewise: Fighting the New Ageism in America, Chicago 2011. Habermas, Jürgen, Zwischen Naturalismus und Religion: Philosophische Aufsätze, Frankfurt a.M. 2005. Honneth, Axel, Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung. In: Menke, Christoph/Rebentisch, Juliane (Hg.), Kreation und Depression, Berlin 2010, 63-80. Kunow, Rüdiger, Material Bodies: Biology and Culture in the United States, Heidelberg 2018. Kunow, Rüdiger, Ins Graue: Zur kulturellen Konstruktion von Altern und Alter. In: Hartung, Heike (Hg.), Alter und Geschlecht, Bielefeld 2015, 21-44. Kunow, Rüdiger, Postcolonial Theory and Old Age: An Explorative Essay. In: Journal of Aging Studies 39 (2016) 101-08. Luhmann, Niklas, Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1984. Mukherjee, Siddartha, The Gene. An Intimate History, New York 2016. Paley, Grace, Here. Here and Somewhere Else: Stories and Poems, New York 2007. Peterson, Pete, Gray Dawn: How the Coming Generation Will Transform America—and the World, New York 2000. Saake, Irmhild, Theorien über das Alter: Perspektiven einer konstruktivistischen Alternsforschung, Opladen 1998. Süwolto, Leonie, Altern in einer alterslosen Gesellschaft. Literarische und filmische Imaginationen, Paderborn 2016. Young, Iris Marion, Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective. In: Signs 19 (1994) 713-38.
141
Snapchatdysmorphophobie – Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern Ada Borkenhagen
Körper erleben: Selfitis Am 31. März 2014 erschien auf der Adobo Chronicles Website die Nachricht die American Psychiatric Association (APA) habe Selfitis als neue psychische Krankheit anerkannt.1 Personen mit Selfitis litten unter dem beständigen Drang, von sich selbst Fotos zu machen, diese in sozialen Medien zu posten, um das eigene Selbstwerterleben zu stabilisieren und einen Mangel an Intimität zu kompensieren. In der Nachricht wurde auch eine Klassifikation vorgestellt, mit der sich die drei unterschiedlichen Schweregrade der neuen Störung diagnostizieren lassen sollten. Bei leichter Selfitis werden mindestens dreimal täglich Selfies aufgenommen, jedoch nicht in Sozialen Medien gepostet. Bei der akuten Selfitis werden ebenfalls mindestens dreimal täglich Selfies gemacht, wobei jedes der aufgenommenen Selbstportraits auch gepostet wird. Eine chronische Selfitis liegt vor, wenn ein unkontrollierbarer Drang besteht, beständig Selfies aufzunehmen und diese mehr als sechsmal täglich auch zu posten.2 Obwohl es sich bei der Adobo Chronicles Website um eine ausgewiesene Satireund Fake News-Seite handelt, wurde die Nachricht von seriösen Medien begierig aufgegriffen. Die breite Resonanz, die einer solchen Fake News zu Teil werden konnte, belegt die hohe Plausibilität der Nachricht vom krankmachenden Potential des Selfiekults. Mit dem Aufkommen fotobasierter sozialer Medien wie Instagram oder Snapchat sind Selfies allgegenwärtig und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unserer Alltagskommunikation. Und längst sind Selfies das gängigste und
1
2
Vgl. Vincent, J.: American Psychiatric Association makes it official: ›Selfie‹ a mental disorder. Adobo Chronicles, March 31 2014. Retrieved September 6, 2017, from: https://adobochronicles.com/2014/03/31/american-psychiatric-association-makes-it-official-selfie-a-mentaldisorder/. Online abgerufen: 07.08.2020. Vgl. ebd.
144
Ada Borkenhagen
das am häufigsten ausgetauschte Bildformat.3 So ist es heute normal geworden, in jeder Minute und jeder Lebenssituation – ob beim Besuch im Schwimmbad oder Fitnessstudio, im grellen Licht des U-Bahntunnels oder bei der Shoppingtour – sich selbst zu fotografieren und dieses Selfie auch zu versenden. Wer ein Selfie macht, stellt sich zur Schau und macht sich zum Bild.4 Dem trägt neuerdings auch die deutsche Sprache Rechnung. So ist das »Posen« – ein Begriff, der bis vor kurzem im deutschen Sprachgebrauch gänzlich unbekannt war – allgegenwärtig. Das Ausmaß dieser globalen Selfiemania lässt sich ermessen, wenn man sich klar macht, dass in Deutschland täglich über eine Millionen Selfies gepostet und wahrscheinlich dreimal so viele aufgenommen werden, wobei rund 95 Millionen Fotos und Videos pro Tag allein bei Instagram hochgeladen werden. Leben in der Selfiekultur bedeutet, sich permanent zum Bild zu machen, aber auch dauernd mit dem eigenen Bild konfrontiert zu sein. Haben sich Menschen bis vor ein paar Jahren noch durchschnittlich zwei bis dreimal täglich im Spiegel gesehen, so hat sich dies mit dem Aufstieg von Selfies um ein Vielfaches erhöht. Neben dem morgendlichen Blick in den Spiegel oder dem flüchtig im Schaufenster erhaschten Konterfei sehen wir uns nun zusätzlich mehrmals täglich im Spiegel der Handykamera. Und im Gegensatz zum flüchtigen Spiegelbild konservieren wir das Selfie und machen es zum Mittel der Kommunikation, in dem wir es mit anderen teilen. Dass die Folgen des Selfiekults zunehmend kontrovers diskutiert werden, zeigt nicht zuletzt die weltweite Beachtung, die der vermeintlich neuen Krankheit »Selfitis« zu Teil wurde. Besonders in der Kritik stehen dabei die von Instagram, Snapchat und Meitu, dass chinesische Pendant, bereitgestellten Filter und Bearbeitungstools, mit denen sich das Selfie den eigenen Wünschen anpassen lässt. Nur wenige Klicks und schon sind die eigenen Lippen voller, die Augen größer und die Zähne weißer. Ursprünglich zur Korrektur technisch bedingter Proportionsverzerrungen von Selfies angeboten, haben sich Filter- und Morphingtools längst zu eigenständigen Programmen entwickelt. So hat sich das Programm Facetune, mit dem sich praktisch alles am eigenen Bild verändern lässt, millionenfach verkauft. Die Firma Meitu, Inc. ist inzwischen über 6 Milliarden US-Dollar wert. Und Snapchat wurde ein ungeahnter Erfolg, weil die App nicht nur digitale Blumenkränze oder Katzen- und Hundeohren auf das eigene Selfie zaubert, sondern dem Selfie auch ein idealschönes Aussehen verleiht. Waren früher retuschierte Fotos Models und Schauspierlern vorbehalten, so sind sie heute auf jedem gängigen Smartphone
3
4
Vgl. Hu, Yuheng/Manikonda, Lydia/Kambhampati, Subbarao: What we instagram: A first analysis of instagram photo content and user types. In: Proceedings of the Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014, 595-598. Vgl. Ullrich, Wolfgang: Selfies, Berlin 2019.
Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern
verfügbar und längst für Jedermann bzw. -frau ein Muss.5 Die neuen Filter- und Morphingtechniken haben dabei weltweit die Schönheitsideale und -Normen verändert. Da Selfies in der Regel aus einer geringen Entfernung (etwa einer Armlänge) aufgenommen werden, erscheint die Nase im Verhältnis zum Gesicht um etwa 30 Prozent breiter und die Nasenspitze wirkt um sieben Prozent größer als in der Realität. Bearbeitungstools wie Facetune sind willkommene Hilfsmittel, um der eigenen Nase nicht nur wieder zum gewohnten Aussehen zu verhelfen, sondern sie auch gleich noch dem gängigen Schönheitsideal anzupassen. Niemals zuvor haben wir so viele Bilder von geschönten Gesichtern gesehen und internalisiert wie heute. Daraus bildet sich ein durchschnittliches Idealbild, ein Prototyp von Schönheit, in das mehr und mehr manipulierte Bilder eingehen. Mit dem Siegeszug von Filtern und Bildbearbeitungstools hat sich das sogenannte Instagram Face als neues Schönheitsideal herausgebildet. Es handelt sich um eine Extremversion des aus der Attraktivitätsforschung bekannten sog. Durchschnittsschönheitsideals zu dem bei Frauen große Augen, ein makelloser Teint, eine sehr schmale und kleine Nase und volle Lippen zählen, bei Männern ist eine ebenmäßige Nase und ein ausgeprägtes Kinn gefragt. Digital kreierte Gesichter, die in der Realität gar nicht existieren, sind Vorbild für das eigene Socialmediagesicht. Mit unseren neuen elektronischen Spiegeln – Instagram und Co – können wir uns so darstellen, wie wir sein wollen. Sie erfüllen unsere Wünsche, in dem sie uns einen künstlichen Idealkörper zeigen. Das gefilterte und am Instagram-Face optimierte Selbstporträt verhilft seinem Schöpfer bzw. Nutzer nach dem Posten zu einer Vielzahl von Likes. Die Flut optimierter Selbstfotos bleibt aber nicht folgenlos, sondern affiziert das eigene Selbst- und Körperbild. Wer ständig geschönte Bilder von sich sieht, wird seinem realen Aussehen gegenüber kritischer. Dass haben Studien an jungen Mädchen gezeigt: So gehen retuschierte Selfies mit einer größeren Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper einher.6 Die Nutzer von Instagram- bzw. Snapchatfiltern überschätzten zudem signifikant ihr Körpergewicht bzw. weisen eine verzerrte Wahrnehmung bestimmter Körperpartien auf.
Normiertes Bedürfnis: Der schöne Körper In der Studie von McLean et al. (2015) zeigte sich auch, dass Personen, die stark unzufrieden mit dem eigenen Aussehen sind, häufig soziale Medien als elektronische 5
6
Vgl. Brucculieri Julia: Snapchat dysmorphia points to a troubling new trend in plastic surgery. Huffington Post. February 22, 2018. https://www.huffingtonpost.com/entry/snapchat-dysmorphia_us_5a8d8168e4b0273053a680f6. Online abgerufen: 27 Februar 2018. Vgl. McLean, Siân A./Paxton, Susan J./Wertheim, Eleanor H./Masters, Jennifer: Photoshopping the selfie: self photo editing and photo investment are associated with body dissatisfaction in adolescent girls. In: International Journal of Eating Disorder 48 (2015) 1132-1140.
145
146
Ada Borkenhagen
Spiegel nutzen, um sich ihrer Attraktivität zu versichern.7 Die allgegenwärtige Präsenz eines geschönten Selbstbildes suggeriert seine Erreichbarkeit. Für manche ist es dann nur ein kleiner Schritt vom Filter zur Schönheitsoperation. Nicht von ungefähr lautete im Juni 2019 die Schlagzeile, die sogar Eingang in die stündlichen Nachrichten des Deutschlandfunks fand: »Generation Selfie« ist beim Schönheitschirurgen angekommen.8 Und der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) machte die Selfiemania für die wachsende Nachfrage nach Schönheitsoperationen verantwortlich. Denn seit dem Aufstieg der Selfies legen mehr und mehr Menschen nicht nur ihre Nase unters Messer. So berichten Schönheitschirurgen zunehmend von Patienten, die so aussehen möchten wie ihr mit Filtern optimiertes Selfie.9 In einer Befragung der American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) im Jahr 2017 gaben 5 % der Plastischen Chirurgen an Patienten zu behandeln, die ihr reales Aussehen der gefilterten Selfieversion anpassen wollten. Die Plastischen Chirurgen berichten von einem Anstieg von 42 % gegenüber 2015. Die Studie zeigte auch, dass eine wachsende Zahl von Patienten nach einem schönheitsmedizinischen Eingriff ein Nachherselfie von sich postet, gleichsam um sich im Netz der Likes der Community und der neuen Identität zu versichern. In einer aktuellen Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) vom Juni 2019 gab knapp 60 % der befragten Plastischen Chirurgen an, dass bereits vereinzelt Patienten mit dem eigenen, über ein Bildbearbeitungsprogramm veränderten Selfie als Vorlage für eine Behandlung in ihre Praxis gekommen sind, wobei knapp jeder zehnte Plastische Chirurg mit diesem Phänomen sogar sehr häufig konfrontiert war.10 Und rund 86 Prozent der Plastischen Chirurgen glauben, dass dieses Phänomen in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird. Ebenso Viele sind der Ansicht, dass die gefilterten Bilder der sozialen Netzwerke zunehmend die Ansprüche ihrer User an den eigenen Körper verändern werden.11 Unter dem Schlagwort »Snapchat Dysmorphia« fand das Phänomen, dass Menschen sich einem schönheitsmedizinischen Eingriff unterziehen, um ihren realen Körper dem idealschönen Selfie anzupassen, Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs.
7 8
9
10 11
Vgl. ebd. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC): Presseerklärung der DGÄPC vom 25.06.2019. https://www.dgaepc.de/presse/pressemitteilungen/. Online abgerufen: 30. Juni 2020. Rajanala, Susruthi/Maymone, Mayra B. C./Vashi, Neelam A.: Selfies – Living in the Era of Filtered Photographs. JAMA Facial Plastic Surgery Published online August 2, 2018. doi:10.1001/jamafacial.2018.0486. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC): Presseerklärung der DGÄPC vom 25.06.2019. Vgl. ebd.
Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern
Und Parsa et al. konnten zeigen, dass die digitale Bearbeitung der eigenen Selfies tatsächlich die Inanspruchnahme plastisch-chirurgischer Maßnahmen erhöht.12 Auch Alesja hat ihre Nase operieren lassen, um auf Selfies schöner auszusehen und erzählt darüber in einem Podcast des Deutschlandfunks Nova: »Ich hatte ja nen Hügel, genau hier auf dem Nasenrücken und das hat mich halt selber vom rechten Profilbild sehr gestört, mich selber…Na ja, ist ja auch wenn ich mich von vorne ankucke, vorm Spiegel fertig mache und ein bisschen nach links kucke dann, mich hat’s einfach gestört, ich denk halt man selber sieht es halt extremer als andere, und man achtet dann nur auf den Makel da an der Nase. Und ich hatte ja auch ’ne Kuhle hier in der Nasenspitze, so’ne Rille und das hat mich auch sehr gestört.«13 Und über das gelungene Operationsergebnis sagt sie: »… es gefällt mir sehr gut, ich hab sogar als ich das erste Mal die Schiene abbekommen habe, Tränen in den Augen gehabt.«14 Der Trend, dass Menschen wie gefilterte Versionen von sich selbst aussehen möchten, zeigt, dass der Körper nicht länger Schicksal ist, sondern Objekt der eigenen ästhetischen Gestaltung. Mehr und mehr Menschen reicht die Virtualität der digitalen Medien nicht mehr aus und sie suchen den Körper mittels Schönheitsmedizin in ein idealschönes Bild von sich selbst zu verwandeln. Dafür sprechen auch die Zahlen: 2018 wurden von den in der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) organisierten Plastischen Chirurgen 23.266.374 schönheitsmedizinische Eingriffe durchgeführt. Und nach Angaben der American Society of Plastic Surgeons (ASPS) haben deren Mitglieder 2019 mit 18.160.785 Millionen fast eine Viertelmillion mehr schönheitsmedizinische Eingriffe durchgeführt als das Jahr zuvor, was einem Anstieg um 169 % innerhalb der letzten 20 Jahre entspricht.
Schönheitsmedizin als Therapie? Der schönheitsmedizinische Eingriff verspricht den Abstand zwischen dem Ich und seinem idealen Körperbild in der Realität und nicht nur virtuell zu verringern.
12
13 14
Parsa, Keon M./Prasad, Navin/Clark Christine M./Wang Haijun/Reilly Michael J.: Digital Appearance Manipulation Increases Consideration of Cosmetic Surgery: A Prospective Cohort Study. In: JAMA Facial Plastic Surgery. Published online, Jun 5, 2020. https://doi.org/10.1089/fpsam. 2020.0156 . Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Selfie. Alesja hat sich ihre Nase operieren lassen (2018). https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/nasen-op-fuer-schoenere-selfies. Ebd.
147
148
Ada Borkenhagen
Und immer öfter kann Schönheitsmedizin dieses Versprechen sogar halten. Nämlich immer dann, wenn der Abstand zwischen dem Ich und seinem idealen Körperbild nicht zu groß ist. Wenn also das Ich ein einigermaßen realistisches ideales Körperbild hat, das mittels Schönheitsmedizin auch erreicht werden kann. Die Annäherung bzw. das Zusammenfallen des realen Körperbilds mit dem Ichideal entspricht einem narzisstischen Triumph und geht mit einer Steigerung des Selbstwerterleben einher. Daher das durchgehend gute Outcome schönheitsmedizinischer Eingriffe, sofern sie handwerklich gut gemacht sind und es keine größeren Komplikationen gegeben hat.15 Sind die Nutzer bzw. Nutzerinnen von Schönheitsmedizin in der Lage, die aus der Körperlichkeit des Menschen resultierende Tatsache, das sich immer wieder erneut eine Kluft zwischen dem realen Körper und dem Idealkörper aufwerfen wird, zu ertragen, droht auch keine Sucht nach immer neuen schönheitschirurgischen Eingriffen. Immer dann jedoch, wenn der Körper zur Projektionsfläche eines unrealistischen Körperideals wird, sind die Grenzen zum Pathologischen fließend. Digitale Filter nähren jedoch gerade die Illusion das eigene Idealbild auch in der Realität spielend leicht zu erreichen und damit die Kluft zwischen Ideal und Realität dauerhaft zu überwinden. Das macht ihre unkritische Verwendung so gefährlich und hat zu einer Verharmlosung der Risiken geführt, die mit plastisch-medizinischen Eingriffen verbunden sind. Instagram hat darauf reagiert und besonders extreme Filter wie »Plastica« und »Fix Me« verboten, die sich rasant verbreitetet hatten. Unsere neuen digitalen Spiegel – Facetune und Co – sind weitere Agenten im Prozess der technogenen Veränderungen menschlicher Körper und den zu bewältigenden Folgen.
Literatur American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery: Retrieved from https:// www.prnewswire.com/news-releases/newsurvey-finds-social-media-isa-major-influence-on-electivesurgery-191992411.html (2013). (Letzter Zugriff am 12. 04.2019. American Society of Plastic Surgeons (ASPS): www.asps.org/ (2018). (Letzter Zugriff am 30.06.2020). Borkenhagen, Ada: »Visualize The New You«. Die digitale Transformation des Körpers am Beispiel der Schönheitsmedizin. In: Psychoanalyse im Widerspruch 55 (2016) 51-61. Brucculieri Julia: Snapchat dysmorphia points to a troubling new trend in plastic surgery. Huffington Post. February 22, 2018. https://www.huffingtonpost. 15
Borkenhagen, Ada: »Visualize The New You«. Die digitale Transformation des Körpers am Beispiel der Schönheitsmedizin. In: Psychoanalyse im Widerspruch 55 (2016) 51-61.
Wie digitale Medien die Wahrnehmung unseres Körpers verändern
com/entry/snapchat-dysmorphia_us_5a8d8168e4b0273053a680f6. (Letzter Zugriff am 27.02.2018). Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC): Presseerklärung der DGÄPC vom 25.06.2019. https://www.dgaepc.de/presse/pressemitteilungen/. (Letzter Zugriff am 30.06 2020). Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Selfie. Alesja hat sich ihre Nase operieren lassen (2018). https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/nasen-opfuer-schoenere-selfies. Hu, Yuheng/Manikonda, Lydia/Kambhampati, Subbarao: What we instagram: A first analysis of instagram photo content and user types. In: Proceedings of the Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014, 595-598. International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS): www.isaps.org/. (Letzter Zugriff am 30.06.2020). McLean, Siân A./Paxton, Susan J./Wertheim, Eleanor H./Masters, Jennifer: Photoshopping the selfie: self photo editing and photo investment are associated with body dissatisfaction in adolescent girls. In: International Journal of Eating Disorder 48 (2015) 1132-1140. Parsa, Keon M./Prasad, Navin/Clark Christine M./Wang Haijun/Reilly Michael J.: Digital Appearance Manipulation Increases Consideration of Cosmetic Surgery: A Prospective Cohort Study. In: JAMA Facial Plastic Surgery. Published online, Jun 5, 2020. https://doi.org/10.1089/fpsam.2020.0156 . Rajanala, Susruthi/Maymone, Mayra B. C./Vashi, Neelam A.: Selfies – Living in the Era of Filtered Photographs. JAMA Facial Plastic Surgery Published online August 2, 2018. doi:10.1001/jamafacial.2018.0486. Sorice, Sarah C./Li, Alexander Y./Gilstrap, Jarom/Canales, Francisco L./Furnas, Heather J.: Social media and the plastic surgery patient. Plastic and Reconstructive Surgery, 140 (2017) 1047-1056. https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000003769. Ullrich, Wolfgang: Selfies, Berlin 2019. Vincent, J.: American Psychiatric Association makes it official: ›Selfie‹ a mental disorder. Adobo Chronicles, March 31 2014. Retrieved September 6, 2017, from: https://adobochronicles.com/2014/03/31/american-psychiatric-associationmakes-it-official-selfie-a-mental-disorder/. (Letzter Zugriff am 07.08.2020).
149
Körperlichkeit und kulturelle Praktiken
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers1 Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
Sophie Schmidt: Die Themen unseres Gesprächs sind Körper und Körperlichkeit und wir sprechen darüber, welche Rolle diese in meiner künstlerischen Arbeit spielen. Nach meiner Performance im Rahmen des Symposiums »Menschen_Bildung im Dispositiv des Digitalen« an der Münchner Kunstakademie haben Sie mich angesprochen und gefragt, ob ich einen Beitrag für die Publikation »KörperKreativitäten« beisteuern möchte. Ich habe mich sehr gefreut, weil die Auseinandersetzung mit dem Körper ganz zentral in meiner Arbeit ist. Wir haben uns dann für die Form eines Gesprächs entschieden und finden uns jetzt vor zwei Bildschirmen wieder. Rainer Wenrich: Wir hatten vor, unser Gespräch mit physischer Präsenz zu führen. Nun haben wir uns aufgrund der aktuellen Gegebenheiten aufgrund der Covid 19Pandemie zu einer digitalen Variante entschlossen. Lassen Sie uns damit beginnen, dass Sie kurz beschreiben, welche Kernthemen Sie in Ihrer künstlerischen Arbeit leiten. Sophie Schmidt: In meiner künstlerischen Arbeit beschäftige ich mich mit dem Körper – ich verhandle ihn im Sinne einer Neukombinatorik und Weitung. Die Neukombinatorik löst den Körper aus der Festlegung sowie der Funktion einzelner Organe und Körperteile, und kombiniert diese neu. Das erfolgt in meiner Arbeit in der Verbindung des Körpers mit der Prothese. Denn wenn wir Gliedmaßen verlieren, wachsen sie uns ja nicht nach, wie dem Molch – nein, wir
1
Der Begriff Neukombinatorik stammt von Sophie Schmidt. In ihrer künstlerischen Arbeit hat er eine zentrale Bedeutung und findet sich, als Schlüsselbegriff, in allen Medien wieder. Die Neukombinatorik des Körpers bedeutet für Sophie Schmidt, den menschlichen Körper zu öffnen für neue Verbindungen und andere Seinsformen, wie zum Beispiel die »Mückewerdung«. Dabei muss der Körper allerdings aus seiner bisherigen Form und Funktionalität gelöst werden, die Organe müssen neu kombiniert und zusammengestellt werden. Für die Neukombinatorik des Körpers bedarf es der Prothese, die durch eine Organumstülpung zur Neukombinatorik verhilft. In Text und Bild werden diese körperlichen Neukombinatoriken ausprobiert und zugleich bei Performances, in Installationen und mit selbst gebauten Prothesen eingeübt.
154
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
schaffen uns für den Verlust von Gliedmaßen Prothesen. Wir stellen also unseren künstlichen Körperersatz selbst her und entwickeln ihn im Laufe der Geschichte immer weiter. Mit der Prothese als technologischem Produkt geht es vorrangig um Körperveränderung am Mängelwesen Mensch in Richtung Optimierung. Denn die Prothese ersetzt im Verlauf ihrer Geschichte nicht nur fehlende Körperteile und Organe, sondern sie kann auch als Erweiterung des Menschen verstanden werden. Diese Entwicklung zeigt sich vor allem im Phänomen des heutigen Cyborgs. Die Erweiterung des Körpers über die Grenzen seiner Haut hinaus könnte aber auch eine Verwicklung, Verbindung und Einfühlung sein im Sinne von Körperweitung, was mir ein Anliegen ist. Ich spreche dabei bewusst von Körperweitung anstelle des üblichen Begriffs der Körpererweiterung. Mit der Prothese geht es mir vorrangig um Bewusstseinsveränderungen am Mängelwesen Mensch in Richtung Verbindung. Dementsprechend sind meine Prothesen auch keine technologischen Produkte, sondern vielmehr utopische Gebilde. Meine Trennungsüberwindungsprothesen, wie ich sie nenne, wollen sich immer verbinden, verbinden mit anderen Lebensformen, anderen Körpern, mit Pflanze, Tier, Anorganischem und Organischem. Ein Dasein mit der Prothese bedeutet für mich ein Mitsein. Dieses Mitsein fordert auch ein Nahwerden. Der Fühler, der durch Nähe die Welt erfährt, ersetzt in meinen Prothesen das Auge, das durch Distanz erkennt. Mit meinen Prothesen entstehen in gewisser Weise Hybride, das war auch ein Stichwort von Ihnen, Herr Wenrich, für die Vorbereitung unseres Gesprächs. Aber es ist nicht der Cyborg2 , an welchen meine Prothesen konzeptionell anknüpfen, sondern sie greifen viel eher die Cyborg3 auf, die Donna Haraway in ihrem Cyborg-Manifest entwirft. Meine Prothesen sind eher weiblich und auf jeden Fall ein Gegenentwurf zum Optimierungsmodell, welches es in erster Linie auf Leistung ausgerichtet ist. Meine Mückengymnastik ist keine Kraftgymnastik, sie macht zärtlich und klein. Meine Prothesen stolpern, verlangsamen und verkomplizieren. Sie sind freundlich, aber
2
3
Der Begriff Cyborg erlangte Prominenz in einem Aufsatz des Mediziners Nathan S. Kline und des Wissenschaftlers Manfred Clynes, bekannt für seine Forschungen im Bereich der Musik und der Neurophysiologie. Darin wird die Anpassung des Menschen an seine Umwelt als evolutionäre Weiterführung der technischen Anpassung gesehen, die das Überleben im Weltraum ermöglicht. Biochemische, physiologische und elektronische Modifikationen erweitern den Menschen zum selbstregulativen Mensch-Maschine-System. Clynes und Kline verorten den Cyborg also im Weltraum, als Anpassungsleistung, die dem Menschen das Verlassen seines »natürlichen« Lebensraumes erlaubt. Siehe: Clynes, Manfred E./Kline, Nathan S.: Der Cyborg und der Weltraum. In: Bruns, Karin/Reichert, Ramon (Hg.): Reader Neue Medien. Texte zur digitalen Kultur und Kommunikation, Bielefeld 2007, 467-475. Donna Haraway entwickelt in ihrem Cyborg-Manifest die feministische Erzählfigur: »die Cyborg«. Haraway, Donna: Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. In: Hammer, Carmen/Steiß, Immanuel (Hg.): Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt – Berlin 1995, 33-72.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
auch widerständig. Sie sind zart und hilflos, dann auch wieder groß und gewaltig. Und – sie präferieren einen Fühler anstelle eines Auges.
Abbildung 1: »Fuß-OP«, Installation und Performance mit Handschuhen, Spargel, Binden, Tampons, Küchensieb und Zigaretten, Akademie der Bildenden Künste München, 2014
Foto: Videostill, Sophie Schmidt
Rainer Wenrich: Sie haben ganz klar und in logischer Abfolge eine Definition für den Begriff der Prothese entwickelt, die nicht den gängigen Beschreibungen von Prothesen entspricht. Wenn wir den Begriff Prothese hören, dann assoziieren wir damit viel eher Defizite des Körperss. Gemeint ist damit, dass etwas verlorenge-
155
156
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
gangen ist und dann zumeist durch etwas Sichtbares, klar Erkennbares, das dieses Defizit am menschlichen Körper ausgleicht, ersetzt wird. Dadurch wird die Fehlstelle soweit es geht wieder zurückgeführt auf einen Normalzustand, z.B. durch eine Bein-, Arm- oder Handprothese. Oder weitestgehend auf den Normalzustand, weil wir wissen, dass der Einsatz dieser Prothese bei den betroffenen Menschen zunächst dazu führt, sich an dieses neue Stück Körper gewöhnen zu müssen. Gleichzeitig ist die Erkennbarkeit der Prothese bzw. ihr Verborgensein ein wichtiger Auftrag für die Entwicklung von Prothesen. Letztere haben sich, und das dürfen wir nicht vergessen, in den letzten Jahren technisch enorm weiterentwickelt. Sophie Schmidt: Ja, da haben Sie recht. Erstmal ist es gewiss eine extreme Leistung, die Prothese derart anzunehmen, sodass eine Anpassung an den Körper gelingt. Darüber schreibt Karin Harrasser in ihrem Buch »Prothesen. Figuren einer lädierten Moderne«4 sehr anschaulich. Ich habe mich im Zuge meiner Masterarbeit in Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste München bei Professor Stephan Dillemuth im vergangenen Herbst mit Karin Harrassers Arbeit zu Prothesen und Körpern auseinandergesetzt. Harrasser spricht von einem Gefälle zwischen Metaphorisierungen der Prothese. Damit meint sie die zirkulierenden medialen Bilder von Prothesenträgern, die durch die Prothese als leistungssteigernde Erweiterung zu Superhumans werden, und im Gegensatz dazu die Ausdrucksarmut derjenigen, die mit der Prothese leben müssen. Das finde ich eine sehr schöne und sensible Beobachtung von Harrasser. Außerdem zeigt sich in der Prothese eine Paradoxie, denn sie zeigt, indem sie verdeckt. Sie zeigt die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit des Körpers, indem sie diese gleichzeitig durch sich selbst verdeckt und durch technisches Können zu überwinden versucht. Und dieses Können wird zu mehr als nur einem bloßen Ersatz und einer Rückführung in einen Normalzustand. In ihrer Leistungssteigerung wird sie eine Erweiterung des Körpers, hier zeigt sich technischer Fortschritt. Rainer Wenrich: Auch dieser Aspekt wird in Ihren Ausführungen angedeutet. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis von der Rückführung zu einem Normalzustand hin zu einer Körperoptimierung und auch darüber hinaus. Dies ist das Konzept, mit dem wir es zu tun haben, wenn wir über Prothesen sprechen. Und blicken wir nochmals auf die technischen Entwicklungen, z.B. mit Hilfe von Digitalisierung, 3D Druck etc., dann ist dies auch ein Aspekt an dem Sie mit Ihrer künstlerischen Arbeit ansetzen. Sie führen das Konzept von diesem Höhepunkt der Körperoptimierung, die noch oben offen ist, da man immer je nach Bedarf weiter optimieren kann, zurück. Mein Verständnis davon, was Ihr Konzept betrifft
4
Harrasser, Karin: Prothesen. Figuren einer lädierten Moderne, Berlin 2016.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
und was Ihre künstlerische Arbeit ausmacht, ist, dass Sie von diesem Optimierungskonzept wieder zurück gehen und sich ganz stark darauf besinnen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Sie konzentrieren sich auf Möglichkeiten, die es geben könnte, in dieser umgekehrten Form. Die zentralen Fragen lauten dann: Was macht mich zart, was macht mich weich, was macht mich empathisch, was macht mich gefühlvoller, sensibler gegenüber den Einflüssen meiner Umwelt? Denn auch hier stellen wir ja Defizite fest. Wie kann ich diese Defizite ausgleichen? Mit einer dafür speziellen Vorrichtung, die dann auch eine Prothese sein kann? Aber diese besonderen Prothesen sehen anders aus und sie funktionieren auch anders. Das agens der Künstlerin zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese Prothesen kreiert und aktiviert. Beides gehört zum Repertoire Ihrer künstlerischen Arbeit, wird ständig weiterentwickelt und auch verfeinert. Ich weiß nicht, ob ich nun Dinge erwähnt habe, die gut nachvollziehbar sind, wenn man von Ihrer Arbeit einen Schritt zurücktritt? Als Beobachter begegnet man zwei Konzepten von Prothetik, die hier aufeinandertreffen und dabei ein ganz eigenes Spannungsfeld entwickeln. Sophie Schmidt: Ja, es handelt sich um zwei sehr unterschiedliche Konzepte von Prothetik. Sie haben das gerade sehr treffend ausgeführt, dass ich mit meinen Prothesen andere Defizite ausgleichen möchte, als ein rein technischer Bereich der Prothetik vorsieht. Hier distanziere ich mich bewusst von den konventionellen Leistungsvorhaben, Optimierungsstrategien und den Erweiterungseingriffen am und um den Körper. Im Mangel wird hier das Potential des Fortschritts gesehen. Damit schreibt sich eine modernistische Erzählung weiter, Prothesen werden zu Fortschrittsinstrumenten. Meine meistens sehr fragilen Gebilde, die ich Prothesen nenne, sind anderer Art. Die Nasenlochüberwindungsprothese als Beispiel, verbindet die Nasenlöcher, und so den getrennten Atem, in einem über der Nase liegendem Bauch. Dabei können sich auch die Ohren näherkommen, denn der Kopf, der trennt, wird klein. (Bild 2) Meine Prothesen sind Trennungsüberwindungsprothesen und setzen natürlich auch am Körper an, aber auch an der Körperhaltung, und damit auch an unserer Umwelt und den uns umgebenden Körpern. Es geht mir bei der Verwendung meiner Prothesen um so etwas wie Menschsein-Weitungen und neue Seinsformen, das haben Sie richtig erkannt. Die Prothesen öffnen meinen Körper und verschränken mich mit der Welt. Sie kommen dabei immer aus meinem Körper selbst und helfen mir bei den Transformationen in andere Daseinszustände. Wie etwa die Mückengymnastik. Durch Organumstülpung mithilfe der Nase-zu-Fuß-Beatmung verhilft sie mir zum Mücke-Werden. Ich strebe mit meinen Prothesen und durch die Neukombinatorik des Körpers also ein anderes In-der-Welt-Sein und eine neue Körperhaltung an. Denn die Körperhaltung ist ja auch eine Haltung zur Welt. Bei uns
157
158
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
Abbildung 2: »Trennungsüberwindungsprothese«, Installation und Performance mit Mistgabel, Stöcken, Gips, Regenschirm, Schläuchen und Tüten, Chalton Gallery, London, 2018
Foto: Xavier Calderon
heißt das: Kopf oben, Bauch unten. Beim Vampyroteuthis infernalis5 , dem Vampirtintenfisch, von dem Flusser schreibt, ist die Haltung polar zu unserer: Bauch oben, Kopf unten. Das ändert viel. Wir haben in unserer abendländischen Tradition ja den Kopf und damit die Ratio als oberste Maxime gesetzt und somit den Leib von der Seele getrennt. Wir haben ihn abgewertet und ihn dann aber als Körper funktionalisiert, optimiert und aufgewertet. Damit haben wir uns aber auch aus unserer leiblichen Verwicklung mit dem Leben gelöst, um uns rational fortzuentwickeln. Die abendländische Sicht auf den Körper als ein von der Seele getrenntes Ding, über das nach Belieben verfügt werden kann, schreibt sich auch in die Prothese ein und mit ihr fort. Die Prothese und ihre Technik produzieren einen Körper, der sich von seiner Umwelt und Mitwelt trennt. Dies führt zu den geläufigen Dualismen wie Leib – Seele, Subjekt – Objekt, Kultur – Natur, Mensch – Tier, Mann – Frau, und den damit verbundenen Hierarchien. Als rationales Fortschrittswesen werten wir weniger rationale Körper ab. Einen Fühler, der tastend und durch Nähe seine Umwelt begreift, bewerten wir
5
Flusser, Vilém/Bec, Louis : Vampyroteuth infernalis. Eine Abhandlung samt Befund des Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste, Göttingen 2 1993.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Abbildung 3: »One last glory of the legs, Tryptichon«, Ölkreide, Pastellkreide und Wandfarbe auf Gipskarton, 200 x 245 cm, 2018
Foto: Thomas Splett
weniger fortschrittlich als ein Auge, das aus Distanz erkennt. Und diese Sichtweise führt meines Erachtens zu Vielem, was ich auch in meiner Oper »Über die Tragik des menschlichen Körpers«,6 an der ich gerade arbeite und die bald als Buch erscheinen wird, thematisiere. Diese Tragik besteht für mich eben in diesem Verhältnis zum Körper, und darin, dass wir uns dadurch in Vereinzelungen und Trennungen erleben, denn wir konstruieren uns mit dieser Setzung als autonome Individuen, und nicht als abhängiges, verbundenese Wesen. Und so sind wir in dieser Autonomie auch immer einzeln und getrennt voneinander, wobei wir doch grundlegend immer in Beziehung sind, immer in einem Mitsein, denn wir sind als Menschen ja immer abhängig. Wir leben in Formen des In-Beziehung-Seins, das wird aber oft negativ bewertet, denn das bedeutet Abhängigkeit. Aber das sehe ich anders. Im Verbunden-Sein, auch im Verletzlich-Sein liegt doch das Schöne unseres Menschseins. Darauf kommt es mir an, denn das ist eigentlich viel wesensnäher. Meine Prothesen zeigen diese Verletzlichkeit, und auch die Interaktion mit der Prothese
6
Schmidt, Sophie: Über die Tragik des menschlichen Körpers – eine Oper in fünf Akten, München 2020.
159
160
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
führt weniger zu einer gemeinsamen Stabilität als vielmehr zu einem sehr fragilen hybriden Zustand aus Anorganischem und Organischem, der von kurzer Dauer ist. Rainer Wenrich: Für einige Ihrer Überlegungen lassen sich auch Referenzen in der geisteswissenschaftlichen Tradition auffinden. Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, berühren Ihre Ideen unterschiedliche Positionen in der Philosophie, die uns passende Stichworte liefern. Ich würde beispielhaft Arnold Gehlens7 Konzept der Unvollkommenheit des Menschen heranziehen. Gehlen bezeichnet den Menschen als unfertiges Mängelwesen, das gegenüber den Einflüssen seiner Umwelt schutzlos ist. Mit Gehlen lässt sich zwar keine direkte Verbindung zu einer technisch innovativen Prothetik herstellen, zumindest aber fordert Gehlens philosophische Anthropologie den Menschen auf, sein Umfeld technisch zu ertüchtigen, um die vorhandenen Defizite zu kompensieren. Die postmodern philosophischen Überlegungen Paul Virilios8 sehen den Körper angesichts der technischen Entwicklungen einem Geschwindigkeitshöhepunkt ausgesetzt, der den Körper in seine Einzelteile auflöst. Am Beginn des 21. Jahrhunderts taucht der Körper schließlich regelrecht in die technischen manipulierten Räume ein und wird nahezu eins mit diesen. Das Prinzip der Immersion präsentiert sich dabei verheißungsvoll, fast wie ein digitales Arkadien, in dem wir unseren Körper im Spannungsfeld zwischen unserer analogen Leib-Präsenz und einer digital-spazialen Hülle mit allen Sinnen neu wahrnehmen. Donna Haraways9 Überlegungen in dem von Ihnen bereits angesprochenen Cyborg-Manifest aus den 1980er Jahren sieht die Mensch-Maschine-Identität in einem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess, der sich wesentlich näher an einem idealen Dasein orientiert, als in der hybriden Erscheinung die Bedrohung zu sehen. Daher möchte ich eine Frage an Sie als Künstlerin richten: Inwieweit sind die philosophischen Ideen, einer Betrachtung des Defizitären, in und an uns Menschen, eine Leitfigur für Ihre künstlerische Arbeit? Kann man sie als Bezugspunkte bezeichnen, an denen Sie sich als Künstlerin orientieren oder messen? Diskutieren Sie diese Ideen auch in Ihrer künstlerischen Arbeit? Sophie Schmidt: Ja, ich glaube, dass diese Konzepte für meine Arbeit sehr wichtig sind. Die Beschäftigung mit den philosophischen Betrachtungen und Texten verstärkte sich auch in meinem Lehramt-Studium, durch meine wissenschaftlichen Abschlussarbeiten und durch die Weite des Faches, was mir viele Einblicke ermöglichte. Das war für mich und meine künstlerische Arbeit sehr ausschlaggebend. Ich würde nicht sagen, dass ich diese Theorien direkt übersetze, weil ich denke,
7 8 9
Gehlen, Arnold: Der Mensch – seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 1978. Virilio, Paul: Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen zum überreizten Menschen, Frankfurt a.M. 1996. Vgl. dazu Fußnote 3
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
dass etwa ein »Gehstock mit Ei« oder die »Lungenflügel-Prothese« keinen direkten Bezug ermöglicht.
Abbildung 4 (links): »Gehstock mit Ei (II)«, rohes Ei, Stock, Topfdeckel, Farbrolle, Klebeband, Draht und Gips, 150 x 5 x 3 cm; Abbildung 5 (rechts): »Lungenflügel«, Installation und Performance mit Stöcken, Gips, Schläuchen, Plastiktüten und Küchensieb, Installationsansicht: »Gurkenfresserzahung vor der Urmuttermilchlegung«, Tanja Pol Galerie, München, 2017
Foto (li.): Nikolai Gümbel; Foto (re.): Mariella Maier
Aber mit Gehlen habe ich mich beschäftigt, auch mit Nietzsche und Vilém Flusser, vor allem mit Letzterem. Flusser hat als Medientheoretiker in seinem Buch »Vampyroteuthis infernalis« dem Menschen, den »Vampyroteuthis infernalis«, den Tintenfisch aus der Tiefe, gegenübergestellt und über den Körper des Vampyroteuthis als Medium eine andere Sicht, und eben eine andere Haltung zur Welt, beleuchtet. Dieses Buch, das mir meine Künstlerfreundin Sarah Lehnerer ans Herz gelegt hatte, war sehr ausschlaggebend für meine Überlegungen und Betrachtungen über den Körper, den Körper eben als Medium der Welterfahrung. Es hat mich fasziniert, vom Körper ausgehend gewisse Dinge umzudenken, anders zu denken und damit neue Perspektiven zu erschließen. Vielleicht habe ich begonnen, mit dem Körper zu denken. Außerdem liebe ich das Kapitel in Nietzsches »Zarathus-
161
162
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
tra«10 , in dem er das Ich und den Verstand zur kleinen Vernunft und den Leib zur großen Vernunft macht. Auch Deleuzes und Guattaris Texte aus Tausend Plateaus11 begeistern mich, denn auch meine Körper sind im Übergang, sie öffnen sich für Werdensprozesse, wollen Tier werden, wollen Schwärme und Intensitäten bilden. Der organlose Körper (ok)12 kommt meinem Körpervorhaben näher als das herkömmliche Konzept der Körperfunktionalität. All diese Gedanken und Texte sind sehr existentiell für mich, dafür, wie ich mich mit der Welt in Bezug setze. Ich behandle einerseits die Fragen des In- der- Welt- Seins mit meinen Prothesen selbst, indem ich sie an meine Körper baue, die Texte sind dabei aber ebenso wichtig, sie sind eine essentielle Nahrung für mich. Diese Formen der Auseinandersetzung greifen bei meiner Arbeit ineinander. In diesem Prozess gibt es verschiedene Phasen. Wenn ich viel lese, dann bin ich ganz darin versunken und brenne dafür, die Texte zu durchdringen, und danach kommen Monate, in denen ich nur baue und male, und ich glaube, das fließt so ineinander und befruchtet sich gegenseitig. Rainer Wenrich: In den vergangenen etwas mehr als 100 Jahren der Kunstentwicklung können wir unterschiedliche Strömungen ausmachen, die sich intensiv mit dem Körper befasst haben. Wenn wir also beispielhaft ansetzen, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und die Avantgarden der ästhetischen Moderne betrachten, dann setzt hier aus meiner Sicht auch eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Körper an. Denken Sie an die frühen performativen Darbietungen der Künstler/innen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hierbei wird der Körper sehr schnell in den Mittelpunkt gestellt. Verschiedenste Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens werden dabei am Körper und mit dem Körper thematisiert. Bis hin zu den Ausdrucksformen der Dadaisten oder den Darbietungen von Künstler/innen des Bauhauses. Wenn man diesen Gedanken weiterführt, dann erkennt man unterschiedliche Wellenbewegungen, das Aufflackern und die Wiederkehr des Körpers im künstlerischen Schaffen. In den späten 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts folgen Formen der Performance, von Happening und Aktionskunst, mit zum Teil extremen (Körper-)Ausdrucksformen, die uns bis heute beschäftigen und die den Körper in Gefahrsituationen bringen, bis hin, zumindest nimmt der Betrachter dies wahr, zu einem Überschreiten von Grenzen der menschlichen Existenz, der Bedrohungen des eigenen Körpers. Die Künstler/innen setzen sich einer 10 11 12
Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, Stuttgart 1975. Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 1992. Der oK ist befreit vom Organismus. Denn der Körper als Organismus ist eine Konstruktion, eine Form, die dem Körper aufgezwungen wird und den Organen bestimmte Funktionen zuweist. »Du wirst organisiert, du wirst zum Organismus, du musst deinen Körper gliedern – sonst bist du nur entartet.« (TP219). Die festen Funktionen, die der Organismus den Organen zuweist, werden aufgehoben. Im permanenten Werden, in der permanenten Transformation, können sie nicht bestehen.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
selbstgewählten Bedrohung aus, um einen bestimmten Aspekt des menschlichen Zusammenlebens aufzuzeigen. Nun könnte man die Frage stellen, warum setzen sich Künstler/innen dieser Gefahr aus? Gäbe es nicht andere Möglichkeiten auch, gewisse Missstände in der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen? Warum muss der eigene Körper, dieses hochsensible und äußerst empfindliche Netzwerk, bestehend aus ganz viel Wasser, Haut und Kapillaren, feinsten Muskelsträngen und Nerven, warum also muss ich das dem Körper antun? Müsste ich nicht eher dafür sorgen, dass ich den Körper schütze und ihn stabilisiere? Ich könnte mir eine Ausdrucksform suchen, mit der ich, trotz aller Kritik, die ich anbringen möchte, alles übermitteln könnte, ohne mir selbst Schaden zuzufügen? Es gibt ja auch Beispiele in der Kunst, die den Körper thematisiert haben, aber natürlich auch aus einer gewissen Distanz heraus, als Zeichnung, als Malerei, später als Film oder in Form einer Videoinstallation, in Verbindung mit Aktionen. Diese haben den Körper nicht auf die soeben beschriebene Weise in Mitleidenschaft gezogen. An dieser Stelle würde ich sehr gerne nochmals ansetzen, mit Blick auf die Frage nach den Spuren, nach der Tradition dieser künstlerischen Beschäftigung mit dem Körper in Ihrer künstlerischen Arbeit. Hier geht es um Referenzpunkte, nicht mit dem Blick auf die ganze Kunstgeschichte, hier gäbe es natürlich viele Stationen, die den Körper so deutlich in den Mittelpunkt stellen. Mein Ausgangspunkt war ja das späte 19. Jahrhundert und die frühe Avantgarde. (Bild 6) Sophie Schmidt: Ja, ich muss sagen, dass mich diese Referenzpunkte auch beeinflusst haben. Ein Jahr war ich für Erasmus in Wien an der Akademie der Bildenden Künste bei Hans Schierl und Carola Dertig, in Klassen, in denen die Performance viel Raum eingenommen hat. Auch von der Theoretikerin Sabeth Buchmann, die dort den Kunstgeschichte Lehrstuhl mit vertritt, habe ich viel gelernt. Dieses Erasmusjahr war wirklich sehr prägend für mich und meine Arbeit. Seither habe ich eine wahnsinnige Wien-Sehnsucht und möchte eigentlich dort auch noch mal leben für eine Zeit. Mich hat außerdem der Dadaismus immer schon fasziniert, Hugo Ball mit seinem »Cabaret Voltaire« hat mich begeistert. Vor zwei Monaten habe ich eine Oper mit meinem Opernkollektiv aufgeführt: »Über die Tragik des menschlichen Körpers«, daraus den ersten Akt, »Sans souci«13 im »fructa space« in München. Das Zusammenfließen verschiedener Kunstformen, wie beim »Cabaret Voltaire« eben, das hat sich durch meine erste Opernaufführung noch mal als ganz wichtig erwiesen. Die Erfahrung der kollektiven performativen Zusammenarbeit war aber so neu für mich und so schön, dass wir nun planen, auch die anderen Akte der Oper auf die Bühne zu bringen.
13
Dieser Akt ist in Kooperation mit Angela Stiegler, Samuel Fischer-Glaser, Quirin Brunnmeier, Nikolai Gü mbel und Sophie Schmidt entstanden.
163
164
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
Abbildung 6: »Fortbewegungsmaschine«, Installation und Performance mit rohen Eiern, Föhns, Granatäpfeln, Zigaretten, Schubkarren, Bürostühlen, Helmen, Spritzen, Zahnbürsten und Klebeband, IËrster Fortbewegungsversuch« Akademiegalerie, München, 2013
In meinem Jahr in Wien 2015 habe ich die starke Tradition der Performance richtig spüren können, auch weil ich mich in meiner performativen Arbeit plötzlich verstanden gefühlt habe. Ich kam aus München und hatte dort vor meinem Erasmusjahr mit Performance angefangen, aus dem Grund, weil mir immer alles Andere, ein Bild oder eine Skulptur, zu wenig nah war. Ich wollte da hineinkriechen und hatte angefangen, eine große Fortbewegungsmaschine zu bauen, die mich – als zweite Haut – beschützen sollte, die aber auch beengend und widerspenstig war und aus allen möglichen Materialien entstand. Diese Maschine sollte sich bewegen, sie sollte mir helfen, mich fortzubewegen. Ziemlich viel Zeug kam aus der Küche, aus meinem direkten Umfeld. Ich habe mich am Anfang nicht so wohl gefühlt in der Akademie und habe dann zu Hause mit den mir verfügbaren Materialien gearbeitet, also aus Küche und Bad. Und dann musste es schnell gehen beim Bauen. Ich hätte da nicht sehr lange an der perfekten Form herumprobieren oder in einer Werkstatt aus Metall etwas über einen längeren Zeitraum entstehen lassen können, sondern ich wusste, wenn dieses Gefühl da war, dann musste ich handeln und mir diese Maschine bauen und mich fortbewegen. So konnte es schnell gehen, die Sachen waren mir zur Hand. Ich bin in der Akademie herumgelaufen und habe mir aus den Gängen Staubsauger, Bretter, Rollstühle, Lampen, Metallstangen, Lei-
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Abbildung 7 und 8: 1. Akt, »Sans souci«, Installation und Oper, mit großem Käfer und Mücke und Angela Stiegler, Samuel Fischer-Glaser, Quirin Brunnmeier, Nikolai Gümbel und Sophie Schmidt, fructa space, München, 2020
Foto: Mathias Reitz-Zausinger
tern und Wägen und alles Mögliche besorgt und dann diese Maschinen gebaut – als zweite Häute, wo ich diese totale Nähe hatte, sodass sie aussahen wie ein Schutz für den Körper, mich aber auch verletzten, damit haben sie mich auch immer an eine Grenze gebracht. Ich habe angefangen, mir eine Motorrad-Ausrüstung anzulegen, um mich zu schützen, und war trotzdem zum Teil auch verletzt, weil die Maschinen im Moment des Fahrens auch eingebrochen sind. Diese Fortbewegungsmaschinen waren sehr große Gebilde, und ich habe mich in ihnen bewegt, sie hatten einen Stuhl mit zwei Rollen als Grundlage, durch die Bewegung fiel das fragile Gebilde auf mich und in sich zusammen und verletzte mich eben manchmal auch. Dieses Moment des Ausgesetzt-Seins, des Sich-nicht-schützen-Könnens und des Sich-verletzlich-Machens, das ist total wichtig für mich. Gleichzeitig ist das auch ein Kampf, in dem ich mich behaupte. Es ist ein Gefühl zwischen Kontrollverlust und Kontrolle. Einerseits setze ich mir einen Rahmen, ein Spielfeld, was dann die Freiheit, auch den Kontrollverlust bedingt, sonst ist es nicht möglich. Und innerhalb dieser Setzung ist dann alles möglich. Ich weiß nie, wie die Maschine reagiert. Ich probiere meine Maschinen und Prothesen auch nicht vorher aus. Ich baue sie zwar für meinen Körper und passe sie ihm an, in der Performance schaue ich dann
165
166
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
aber erst, wie sie auf mich reagieren. Dieses gegenseitige Reagieren ist etwas sehr Situatives und Momenthaftes und hat auch mit dem Publikum als Resonanzraum zu tun, das dann wie eine zweite Haut wird. Dabei entsteht das Gefühl dieser vollkommenen Verletzlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass sich dabei meine Haut wirklich weitet und ganz dünn und durchlässig ist. Das überträgt sich vielleicht auch auf das Publikum, mit dem ich in Kontakt bin, mich mit ihm verbinde und seine Resonanz spüre. Dort beim Publikum ist etwas, was man vielleicht Haut oder Membran nennt, die aber wahnsinnig zerbrechlich ist, bis dorthin geht dann meine Haut. Ich bin natürlich in dem Moment alles andere als stabil und auch alles andere als gefasst, weil die Grenze nach außen verschoben ist. Es dauert auch oft, je nach Performance und Intensität, bis zu Stunden, bis ich wieder zurückfinde, in eine klare Formierung von einem Ich und dem Gegenüber. In diesen Performances kommt es auf jeden Fall zu einer Auflösung der festen Grenzen. Diese verschieben sich, und ich weiß aber auch nicht, in welche Richtung sie sich verschieben. Das ist nicht planbar, und ich bin selbst verwirrt und irritiert, aber auch glücklich, so sehr überrascht zu werden und mich so hingeben zu können. Ich liebe dabei diese Hingabe und vielleicht auch eine gewisse Gefahr. Im Film wäre das etwas anderes, da könnte ich viel mehr kontrollieren, außerdem hätte ich die Grenzverschiebung durch das Publikum nicht. Es ist nur möglich, weil das Gegenüber als Kollektiv oder als ein Schwarm mir das gibt.
Abbildung 9 (links): »Orgasmusmaschine«, Installation und Performance, mit Milch, rohen Eiern, Rotwein, Tampons, Föhns und Stühlen, Akademie der Bildenden Künste, München, 2013; Abbildung10 (rechts): »Deine blauen Augen, Installation und Performance«, Performance und Installation mit Föhn, Zigaretten, Motorradanzug und Helmen, Akademie der Bildenden Künste München, 2013
Foto : Gisela Andras; Foto : Gisela Andras
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Rainer Wenrich: Damit ist die Unmittelbarkeit und Direktheit, die in Ihrer Arbeit so wichtig erscheint, bestmöglich beschrieben. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, ich würde eine Entwicklung herauslesen und zwar eine Entwicklung von Ihrem Konzept der Prothese zu einem Konzept der Maschine, aus dem sich ein Gegenüber ergibt von hier Mensch und dort Maschine. Ich entwickle jetzt eine Maschine und diese Maschine kümmert sich um den ganzen Katalog an Defiziten, die ich behandle. Für einen Moment hatte ich dieses Gefühl. Aber nun brachten Sie das Publikum wieder ins Spiel, das eigentlich partizipiert, denn wenn man das miterlebt, was Sie jetzt so plastisch beschrieben haben, mit Ihnen und Ihrem Körper, dann bin ich als Betrachter ein Mitwirkender und trete in eine Beziehung zu Ihrem Kunstwerk14 . Ihr künstlerisches Agieren überträgt sich auf mich. Auch das Publikum wird im mitgenommen. Das, was Sie machen, nimmt einen mit, das mit anzusehen, was Sie machen, was diese Prothesen auch mit Ihnen machen. Dann kommt es zu diesem Ausstoß an Adrenalin, der bei Ihnen verursacht, dass Sie Stunden brauchen, um wieder zu sich zurückzufinden. Das sind Momente, die man aus dem Sport kennt oder aus einer Vielzahl von künstlerischen Aufführungen, ob aus dem Schauspiel, dem Tanz oder der Musik. Menschen nehmen solche Situationen unterschiedlich wahr, dann brauchen sie einen Moment oder eine Stunde, um wieder zurückzukommen, zu einer inneren Ruhe zurückzufinden, nach dem, was sie da erlebt haben. Bei Ihnen treten noch weitere körperliche Einflussnahmen dazu, die man noch Tage später spürt und auch sieht. Weil das Material oder ein gebauter Gegenstand noch so stark auf Sie eingewirkt hat. Es gibt als bleibende Spuren dieser Performance. Zwischen Ihnen und den gebauten, prothesenartigen Dingen gibt es nicht die Distanz der Sicherheit, sondern es gibt diese Unmittelbarkeit. Nun könnten wir ein weiteres Mal in philosophische Richtungen voranschreiten. Die Unmittelbarkeit der Auseinandersetzung, die zu Betroffenheit und Verletzlichkeit und zu Momenten, die sich tief in das Gedächtnis eingraben, führt. Nach Monaten denkt man noch an diese Begebenheiten zurück, die bei Ihnen ganz stark verknüpft sind mit einer künstlerischen Erfahrung. Sie können dann genau nachempfinden, was diese Situation mit Ihnen gemacht hat, Sie können das noch nachempfinden. Kann man diese Nähe auch ausblenden? Oder ist es genau das, was immer wieder aufs Neue gesucht wird in der künstlerischen Auseinandersetzung? Sophie Schmidt: Nein, die Nähe kann man nicht ausblenden. Sie ist genau das, was ich suche. Eigentlich sind meine Prothesen und Maschinen auch eine Art Kommunikationsträger, sie fordern Nähe und Berührung. Vielleicht sind sie deshalb auch
14
Vgl. dazu den konzeptuellen Ansatz bei: Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon 2002.
167
168
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
utopische Kommunikationsgebilde. In meiner Arbeit geht es viel um Kommunikation. Wie wir kommunizieren und wie wir anders kommunizieren können, sind Fragen, die ich mir stelle. Sollen wir singen statt sprechen? Oder tanzen statt sprechen wie in Nietzsches »Zarathustra«? Auch die Frage der Kommunikation und Nähe hat für mich wieder viel mit der Frage unseres In- der- Welt- Seins zu tun. Ich habe darüber gerade eine Oper15 geschrieben. Diese Oper erzählt Geschichten in Bildern und Texten über den Körper. Sie erzählt aus dem Körper heraus, sie singt aus ihm. Alle Texte werden gesungen, als Arien, Duette, Chöre. Es treten Stimmungen, Körperteile, Organe, Fliegen, Käfer und Truthähne, Bäume und Architekturen ebenso und gleichrangig mit Personen auf und singen. Lyrische Texte, Notizen, Tagebuchaufzeichnungen und Briefwechsel bilden die Textgrundlage der Oper, auch die Prothese ist eingebunden und soll die Geschlossenheit einer klassischen Oper durch ihren Cyborg-Charakter aufheben. Ich möchte mit der Oper neue, andere Geschichten erzählen. Ich möchte unseren Körper wieder zu einem Leib werden lassen. Ein Leib, der sich verbindet mit der ihn umgebenden Welt, der Nähe sucht statt Distanz, der zusammen ist statt isoliert, der abhängig ist statt autonom. Ein Leib, der eben in Verbindungen existiert, der aus sich strömt, und damit in ständiger Partizipation ist, und das Subjekt aus seiner monadischen abgekapselten Position gegenüber der Welt und den Anderen löst. Diese Nähe ist manchmal in einer Performance sicher auch unangenehm und konfrontativ. Ich kenne auch Leute, die sind erschreckt, regelrecht derangiert nach meinen Performances und auch aufgelöst. Sie beschreiben es dann als etwas Körperliches und tragen ihre Spuren und ich trage auch meine Spuren über einen längeren Zeitraum. Also ich glaube, dass meine Performances nicht gemütlich sind, weder für mich noch für das Publikum. Sie wollen auch eine Geschlossenheit aufbrechen und auch für eine Verrückung und Unterbrechung sorgen. (11 und 12) Rainer Wenrich: Mithilfe der Kunst sind wir in der Lage Gegenmodelle zu Gesellschaft, auch im Hinblick auf feststellbare Defizite oder um Vorschläge für eine bessere Lebensführung machen zu können, zu erstellen. Viele Kunst, die wir heute erleben, nimmt sich dieser Vielfalt von Problematiken, die uns auf der ganzen Welt umgeben auch sehr stark an. Dabei kann die Kunst auch sehr kunstpädagogisch sein. Dabei geht es um ein kunstpädagogisches Hineinwirken in die Gesellschaft. Wie sehen Sie es aus Ihrem künstlerischen Schaffen heraus? Erkennen Sie in dieser stark körperlich geprägten Kunst etwas Essentielles für unsere Zeit? Sophie Schmidt: Ja, das glaube ich unbedingt. Alleine, dass ich in meiner Kunst vom Körper ausgehe, insbesondere vom weiblichen Körper, das trägt schon sehr viel gesellschaftliches Potential in sich, auch feministisches Potential. Über den 15
Vgl. »Über die Tragik des menschlichen Körpers«.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Abbildung 11 (links): »In der Gurkenfressermaschine«, Installation und Performance, mit Lampe, Sieb, Föhn, Zigaretten, Granatapfel, rohen Eiern etc. aus: »Gurkenfresserzahung vor der Urmuttermilchlegung«, Tanja Pol Galerie, München, 2017; Abbildung 12 (rechts): »In der Herzkammer«, Installation und Performance, mit Milch und Spaten etc. aus: »Gurkenfresserzahung vor der Urmuttermilchlegung«, Tanja Pol Galerie, München, 2017
Foto (li.) : Philip Rapp; Foto (re.) : Mariella Maier
Körper werden ja immer auch Rollenbilder verhandelt und zum Teil biologisch begründet. Viele Körperkonzepte haben dabei zu Hierarchien und Ausgrenzungen geführt. In und um den Körper lagert sich viel Historisches ab. Körper sind voraussetzungsvoll und eben gesellschaftlich konstruiert und sollen damit auch immer Funktionen und Leistungen in der Gesellschaft erfüllen. Über den Körper wird so auch Gesellschaft verhandelt. Wer kann auf welche Körper wie zugreifen, diese Fragen sind politisch-gesellschaftlicher Art und gründen oft in Körperkonzepten, die künstlerisch aufgegriffen und verhandelt werden müssen. Judith Butler spricht in ihrem Essayband »Gefährdetes Leben. Politische Essays.«16 sehr eindrücklich davon.
16
Butler, Judith: »Gewalt, Trauer, Politik«. In: Gefährdetes Leben: Politische Essays, Frankfurt a.M. 2005.
169
170
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
In der Kunst und ihrer Auseinandersetzung mit dem Körper sehe ich also wirklich viel gesellschaftliches Potential, aber auch in der Kunstpädagogik. Ich habe zum Thema Utopie und Kunst eine ganz fantastische Lehrerfortbildung bei Johannes Kirschenmann und Karin Hutflötz besucht. Daraus ist ein Unterrichtsprojekt entstanden, das ich in der Schule umgesetzt habe, auch hier war der Ausgangspunkt für die Arbeit der Körper. Ich glaube, dass gerade die Kunstpädagogik in ihrer Arbeit gesellschaftlich einwirken kann. Vielleicht ist Kunstpädagogik an sich auch schon immer ein utopisches Vorhaben. Für mich ist sie das jedenfalls, und das Unterrichten ist mir sehr wichtig. Zwischen meiner Arbeit als Künstlerin und meiner Arbeit als Lehrerin unterscheide ich nicht. Beide Arbeitsfelder sind sehr performativ und beide halte ich gesellschaftlich für sehr relevant. Rainer Wenrich: Nur ein Gedanke: Das was wir im Moment erleben, ist bei aller Dramatik des Umstands aus künstlerischer, soziologischer und psychologischer Sicht interessant, weil es uns verschiedenste Aspekte aufzeigt, welche Positionen wir in unserer Gesellschaft einnehmen und zeigt unser Verhalten diesem Umstand gegenüber. Wir erleben viele Menschen, die dieses Zurückgeworfensein aufgrund der Beschränkungen, die man uns auferlegt hat, als einen gewinnbringenden, nahezu angenehmen Zustand erleben, weil sie bei sich sind und mit sich beschäftigt sind. Und für sie Momente finden, die so vielleicht vorher nicht hatten oder auch gar nicht kannten. Das ist ein Extrem und das andere Extrem ist das Bewusstsein, in seiner ganzen Freiheit eingeschränkt zu werden. Es kommt eine Macht von außen, die mich in meinen persönlichen Freiheiten und die mir zustehen einschränkt und mich dazu zwingen, mich so zu verhalten, dass nicht auf die Straße gehe, oder nur Familienmitglieder treffe. In diesen Extremen bewegen, leben wir gerade. Das ist eine Frage, die nicht nur ich mir stelle: Was macht das mit uns? Was wird bleiben, wenn hoffentlich gut durch diese Situation kommen? Hier steht der Körper und die Tatsache, dass es hier einen Angriff auf unseren Körper gibt, durch einen Virus, von dem wir so wenig wissen, im Mittelpunkt. Der Körper reagiert ein weiteres Mal hochsensibel. Ein weiteres Mal stellen wir fest, dass wir diesem Angriff so wenig entgegenzusetzen haben. Sophie Schmidt: Ja, unsere Körper sind diesem Angriff ausgesetzt und auch hier geraten wieder Dualismen und Trennungen ins Wanken. Die Natur vermengt sich aufgrund des Virus mit der Kultur. Uns wird bewusst, inwieweit die Grenze zwischen Natur und Kultur eine Konstruktion darstellt. Die Natur ist nicht so passiv, wie wir glauben, sie ist nicht etwas, das wir einfach so gestalten können. Nun kommt die Natur in einer sehr aktiven Form auf uns zu und vermischt sich und greift unsere Körper an. Das Virus ist etwas Hybrides und versinnbildlicht die Verschmelzungen, von Dingen, die wir meinten, getrennt zu haben.
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Bild 13: »Seelenstapel mit Helm«, Töpfedrehscheibe mit Skizzenbüchern und zwei Skihelmen, ….2014
Foto: Sophie Schmidt
Rainer Wenrich: Im Moment mangelt es uns an Zeit, diese Umstände genauer zu reflektieren. Wir sind umgeben von den Berichterstattungen, die uns aus der ganzen Welt erreichen. Die Aspekte, die Sie ansprechen und die uns als Kunstund Augenmenschen dazu bringen, diesen Umstand auf andere Art zu reflektieren. Wir sind ja nicht Naturwissenschaftler, nicht Virologen. Wir haben einen künstlerischen, gestalterischen und auch empathischen Blick, der dadurch noch viele weitere Türen öffnet.
171
172
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
Abbildung 14: Aus der Serie »Lungenausstülperinnen«, Tinte, Acryl, und Kohle auf Papier, je 42 x 30 cm, 2015
Foto: Tanja Pol
Sophie Schmidt: Das stimmt, und ich bin gespannt, wie diese Zeit und Situation künstlerisch verhandelt werden wird. Auf jeden Fall wird uns allen, glaube ich, gerade unsere Zerbrechlichkeit bewusst. Ich glaube, wir fühlen uns kleiner und ohnmächtiger als davor. Wir Menschen fühlen uns ja manchmal so stark und greifen ständig in unsere Umwelt ein und beherrschen sie, wie wir gemeinhin meinen. Plötzlich kommt etwas Neues daher, das uns alle betrifft, dem wir alle ausgesetzt sind und das nun uns beherrscht. Dieses Neue ist sehr mächtig und gleichzeitig
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
unsichtbar und abstrakt. Ich finde es sehr paradox, dass man sich davor durch eine totale Isolation schützen kann. Einerseits entsteht durch diese Isolation ein stärkeres Mitgefühl auch für den Schutz anderer, und andererseits werden wir zurückgestutzt auf die kleinste Einheit, auf die Kernfamilie, und damit weit weg von einem schwarmhaften, gemeinsamen Sein. Das ist natürlich eine ganz andere Form des Miteinanders als das, von dem wir sprachen. Darunter leide ich als PerformanceKünstlerin gerade schon, und ich habe auch Angst. Aber ich erlebe auch mehr Achtsamkeit als sonst, und finde es auch erholsam, dass mein Leben nicht mehr durch so viele Termine getaktet ist. Jetzt ist so vieles ganz anders. Vielleicht bricht gerade eine andere Zeit an? (Bild 15)
Abbildung 15: »Nase-zu-Fuß-Beatmungsschuh«, Performance und Installation mit Schlauch, Plastiktüten, rohe Eier, Sieb, Zigaretten, Wattestäbchen, Klebeband, Verband, Gips, Schuhgröße 38, aus, open Studions Jan Van Eyck Academie, Maastricht, 2018
Foto: Romy Finke
Rainer Wenrich: Das ist ein ganz großes Fragezeichen. Sehen Sie sich in einer Situation wo Sie jetzt sehr stark darauf achten auf Ihre eigene, körperbezogene künstlerische Arbeit? Nehmen Sie die Einflüsse aus dieser Situation auf? Und Sie filtern heraus, was dies als Künstlerin mit Ihnen macht? Sophie Schmidt: Ich hätte jetzt, da einige Ausstellungen und Projekte abgesagt wurden, auch mehr Zeit für die Produktion im Atelier, aber es gab eine gewisse Störung. In meinen praktisch künstlerischen Phasen arbeite ich meistens ohne ei-
173
174
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
ne lange Vorbereitung, die Arbeiten ergeben sich wirklich aus dem Leben und aus dem, was mich gerade unmittelbar umgibt und bewegt. Ich lasse mich sehr gerne vom Leben auf den Straßen anstecken, ich liebe es, in Cafés zu zeichnen und zu lesen, es sind diese Stimmungen und spontanen Begegnungen – und das fließt dann ein, schwappt über. Eigentlich entstehen so auch immer meine kleineren Texte, die in den Zeichnungen. In meine Bauwerke fließen immer auch Gegenstände des vor Ort Gefundenen mit ein. Da plane ich im Vorfeld nicht so viel, sondern lasse mich eben erstmal auf den Raum und das Umfeld ein. Da die Zukunft unsicher ist und ich nicht weiß, ob und wann ich wieder eine Performance mit Menschen machen werde, gab es im Atelier »Gespenster«. Beim Malen hat’s gespukt in mir, ich habe gemerkt, ich kann nicht einfach so weitermachen. Meine Bilder waren so ein dunkler Strudel. Es war sehr emotional, und ich habe mich dann dazu entschlossen, hier in der Wohnung am Roecklplatz kleinere Sachen zu machen. Ich habe viele Postkarten bemalt, mit dem Aufknospen der Kastanien, das begeistert mich, wie die Knospenbäuche aufbrechen, zuerst noch wie zwei Hände im Gebet gefaltet, bricht die Knospe plötzlich auseinander. Das Aufbrechen ist auch brutal und gnadenlos. Ich suche gerade die Knospen und zeichne sie. Und ich bade jeden Tag in der Isar, etwas sehr Leibliches und Körperliches, das Wasser ist noch sehr kalt. Ich finde es sehr beruhigend, dass die Isar einfach weiterfließt, und sich das Leben auf diese Art weiter vollzieht. Nun habe ich gerade eine Quarantäne-Post gemacht, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen, nicht körperlich, nicht digital, sondern per Post. Jetzt arbeite ich an kleineren Formaten, ich schreibe und zeichne und mache meine Performances auf Papier in Form von Collagen, ich glaube schon, dass es dabei einen Verarbeitungsprozess gibt.
Abbildung 16 (links): »Das Isarland wurde weit und es ging tief«, Tine und Aquarell auf Papier, 60 x 80 cm 2018; Abbildung 17 (rechts): »Flüssigwerdung mit Tendenz zum Krater dannach«, Collage mit Fotos, Aquarell und Tinte, …., 2020
Foto (li.): Thomas Splett; Foto (re.): Nikolai Gümbel
Neukombinatoriken des menschlichen Körpers
Rainer Wenrich: Ich höre daraus, dass der Verarbeitungsprozess ohnehin im Gang ist, d.h. Sie nehmen Ihre Umwelt hochsensibel wahr und achten sehr genau auf Ihre Umwelt. Und es gibt Verbindungen zu Ihren künstlerischen Ideen, zur Körperlichkeit. Nun sind es die Pflanzen, und es gibt Parallelen zur eigenen Verfasstheit. Wir versuchen alle unsere Sprachebenen zu finden, wie wir mit der Situation umgehen. Gerade haben Sie beschrieben wie Sie in der Isar baden gehen, Sie verbinden Innen- und Außenwelt, verspüren diese und nehmen sie wahr. Ich gehe fest davon aus, dass dies wieder Momente sein werden in Ihrem Gedächtnis, Körpergedächtnis, auf die Sie wieder zurückgreifen werden. Sophie Schmidt: Ja, dazu fällt mir noch etwas ein, von dem ich Ihnen auch schon vorher erzählt hatte. Ich lerne meine 150 Schüler auch ohne Schule gerade sehr intensiv kennen. Die Gespräche mit ihnen am Telefon fließen dann auch in meine Bilder ein und vermischen sich mit Ihnen. Da erinnere ich mich an die Erzählung eines Mädchens, die den Schreibwarenladen ihrer Mutter putzte, weil dieser geschlossen werden musste. Mit so großer Hingabe hat sie erzählt, wie schön es war, jedes Fach auszuwischen und dann alles neu einzuräumen, zusammen mit ihrer Mutter. Danach macht sie Katzengymnastikschule mit ihrer Katze, mit der sie gerade immer zusammen zu Hause ist. Ein anderer Schüler erzählte mir, wie die Knoblauchpflanzen wachsen, er beobachtet das genau, und erzählte mir eine Stunde über die Wachstumsprozesse. Das interessiert mich natürlich auch, gerade die biologischen Aspekte. Wie entsteht Leben und wie entfaltet es sich? Er hat mir dann auch unterschiedliche Blattformen beschrieben, ein so wundervolles Gespräch, das dann gleich in ein Bild geschwappt ist. Also es gibt doch noch viel Kommunikation und Berührungen.
175
176
Sophie Schmidt/Rainer Wenrich
Abbildung 18: »Paguro, Paguro, Paguro mio«, Installation und Performance, mit Schubkarre, Prothesenschuh und Käfer aus »A Quest For Lasting Values«, Galerie Tobias Naehring, Leipzig, DE, 2020
Foto: Tobias Neahring
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten Theoretische Positionen und die Methode der Teilnehmenden Beobachtung Barbara Sieferle
1.
Einleitung
»Wir wissen mehr als wir zu sagen wissen«1 , stellt der Philosoph Michael Polanyi treffend fest. Am Beispiel des Fahrradfahrens verdeutlicht er, dass wir alle über sogenanntes implizites Wissen verfügen.2 Dieses Wissen ist als eine Art Können, als körperliche Fertigkeit, zu verstehen, die wir uns durch Handlungsroutinen aneignen. Auf abstrakter Ebene fällt es uns meist schwer, dieses Wissen zu artikulieren. Oftmals ist es überhaupt nicht in Sprache zu übersetzen. Das Fahrradfahren in der Theorie zu beschreiben und zu erlernen ist geradezu unmöglich. Wir müssen es körperlich erlernen und vollziehen. Ganz ähnlich spricht der Ethnologe Marcel Mauss vom Schwimmen und Gehen als Körpertechniken, die wir ausführen, ohne unser Tun in Worte fassen zu können.3 Er stellt heraus, dass diese scheinbar natürlichen Tätigkeiten grundlegend sozial und kulturell bedingt sind. Und der Soziologe Pierre Bourdieu macht mit seinem Konzept des Habitus darauf aufmerksam, dass soziale und kulturelle Handlungs-, Denk- und Wahrnehmungsmuster körperlich fundiert sind. Bourdieu spricht von der Inkorporierung dieser Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster.4 Sie zeigen sich beispielsweise in der Art und Weise, wie wir uns kleiden, wie und was wir essen, wie wir uns bewegen. Inkorporierte Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster lassen uns wissen, wie wir uns in spezifischen sozialen Situationen zu bewegen haben. Dieses habitualisierte, inkorporierte Wissen ist jedoch kein explizit benennbares. Es erscheint uns
1 2 3
4
Polanyi, Michael: Implizites Wissen, Frankfurt a.M. 1985, 14. Polanyi, Michael: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, London 1998 [1958], 49-50. Mauss, Marcel: Die Techniken des Körpers. In: Ders.: Soziologie und Anthropologie. Band 2, München 1975 [1934], 199-220 (vorgetragen vor der Société de Psychologie am 17.5.1934; zuerst erschienen in: Journal de Psychologie Normale et Patholoque 32 (1935) 271-293). Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. 1987, 102.
178
Barbara Sieferle
als selbstverständlich und natürlich – wir denken nicht darüber nach; wir tun es einfach. Und auch wenn wir uns dessen oftmals nicht bewusst sind, so haben wir uns diese habituellen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster durch unsere gesellschaftliche und kulturelle Einbettung im Prozess der Sozialisation und in unserem täglichen Handeln angeeignet. Alle drei Autoren lassen dem Körper eine Schlüsselfunktion in der Herstellung und Aufrechterhaltung gesellschaftlichen Zusammenlebens zukommen. Bourdieus Habitus, Mauss’ Körpertechniken und Polanyis implizites Wissen weisen auf die körperliche Dimension soziokultureller Handlungsvollzüge und Erfahrungsweisen der Welt hin. Sie verdeutlichen, dass soziale Wirklichkeiten grundlegend körperlich konstituiert sind, dass soziale Wirklichkeiten durch und mit dem Körper (re-)produziert werden.5 Sie fordern damit soziologische Handlungstheorien heraus, in denen die körperliche Dimension sozialen Handelns (beinahe) keine Aufmerksamkeit erfährt. Der Soziologe Michael Meuser konstatiert gar eine Leibvergessenheit 6 der Handlungstheorien. Wenn der Körper zum Thema wird, dann lediglich als Basis sozialen Handelns und nicht als Agens der Herstellung von sozialer Wirklichkeit. Doch aus körpertheoretischer Perspektive ist der Körper »Produzent von Gesellschaft […] in der Hinsicht, dass das Zusammenleben von Menschen und damit soziale Ordnung entscheidend von der Körperlichkeit sozial handelnder Individuen beeinflusst sind: Da soziale Wirklichkeit aus sozialem Handeln resultiert und soziales Handeln immer körperliches Handeln ist, tragen körperliche Handlungen und Interaktionen zur Konstitution sozialer Wirklichkeit bei.«7 Aus körpertheoretischer Perspektive sind Sinnzuschreibungen an soziales Handeln keine reflexiven, intentionalen Vorgänge. Der Sinn sozialen Handelns ist vielmehr im Handeln selbst zu verorten; als praktischer, impliziter Sinn. Dieser beruht nicht auf einer analytischen, reflexiven Leistung. Vielmehr ist der praktische Sinn inkorporiert und habitualisiert.8 Er ist leibliche Intentionalität.9 Innerhalb der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Körperforschung stellen die Konzepte des impliziten Wissens, der Körpertechniken und des Habitus prominente Bezugspunkte dar, um sich der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
5 6
7 8 9
Petersen, Katrin: Beobachten. Überlegungen zur Systematisierung einer ›alltäglichen Kompetenz‹. In: Vokus. Volkskundlich-kulturwissenschaftliche Schriften 17 (2007) 61-79. Meuser, Michael: Körper und Sozialität. Zur handlungstheoretischen Fundierung einer Soziologie des Körpers. In: Hahn, Kornelia/Meuser, Michael (Hg.): Körperrepräsentationen. Die Ordnung des Sozialen und der Körper, Konstanz 2002, 19-44, 20. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2015, 8f. Keller, Reiner/Meuser, Michael: Wissen des Körpers – Wissen vom Körper. Körper- und Wissenssoziologische Erkundungen. In: Dies. (Hg.): Körperwissen, Wiesbaden 2011, 9-27, 16. Ebd., vgl. außerdem Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie und Wahrnehmung. Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe von 1966, Berlin 2008 [1945], 164.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
theoretisch anzunähern. Gleichzeitig verdeutlichen die Konzepte, dass wir körperliche Handlungsvollzüge meist so selbstverständlich ausführen, dass wir nicht weiter darüber nachdenken. Und sie verdeutlichen, dass Sinnsetzungen oftmals implizit von statten gehen, ohne dass wir diese explizit benennen können. Ein Nachdenken über die Beteiligung des Körpers an sozialem Handeln würde viele Tätigkeiten sogar erschweren oder gar behindern. Wer denkt in seinem Alltag beispielsweise darüber nach, wie genau er/sie zu Fuß geht oder Auto fährt? Der Philosoph Drew Leder spricht daher von dem im Alltag abwesenden Körper 10 , obwohl soziale Wirklichkeiten, das Handeln von Menschen und die damit einhergehenden Sinnsetzungen grundlegend körperlich verfasst sind.11 Gerade die Selbstverständlichkeit und die damit einhergehende Abwesenheit des Körpers im Alltag stellt kulturund gesellschaftswissenschaftliche Forscher/-innen vor eine methodische Herausforderung: Wie können Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler/-innen die körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten einfangen? Wie können sie sich implizitem, körperlichem Wissen und praktischen Sinnzuschreibungen annähern, wenn die Forschungsakteurinnen und -akteure sich der körperlichen Dimension ihrer Handlungen und Erfahrungen gar nicht bewusst sind? Wie können sie einen methodischen Zugang zu denjenigen Teilen sozialer Wirklichkeit finden, die nicht in Sprache verfasst sind? Die Schweigsamkeit des Sozialen12 und die Grenzen des Erzählbaren13 müssen im methodischen Zugang zur Körperlichkeit von Kultur und Gesellschaft grundlegend mitbedacht werden. Daher erachte ich es als ungenügend, sich in der qualitativen Sozialforschung allein auf die Erhebung verbal-sprachlichen Materials zu stützen. Denn soziale Wirklichkeiten dürfen nicht auf Sprache reduziert werden.14 In meinen eigenen Forschungen zeigte und zeigt sich dies immer wieder. Als Europäische Ethnologin möchte ich die alltäglichen Lebenswelten von Menschen verstehen. Und als Körperforscherin gehe ich davon aus, dass diese Lebenswelten zu großen Teilen körperlich verfasst sind. Ich stütze mich in meinen Forschungsprojekten auf die Methode der Teilnehmenden Beobachtung. Für mich ist sie ein Schlüssel für den Zugang zu den körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten.
10 11
12 13
14
Leder, Drew: The absent body, Chicago 1990. Ebd., vgl. außerdem Crossley, Nick: Research Embodiment by Way of ›body technique‹. In: Shilling, Chris (Hg.): Embodying Sociology. Retrospect, Progress and Prospects, Malden 2007, 80-94. Hirschauer, Stefan: Ethnographisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen. Zu einer Methodologie der Beschreibung. In: Zeitschrift für Soziologie 30 (2001) 429-451. Schmidt-Lauber, Brigitta: Grenzen der Narratologie. Alltagskultur(forschung) jenseits des Erzählens. In: Hengartner, Thomas/Schmidt-Lauber, Brigitta (Hg.): Leben – Erzählen. Beiträge zur Erzähl- und Biographieforschung, Hamburg 2005, 145-162. Bloch, Maurice: Language, Anthropology, and Cognitive Science. In: Man, New Series 26 (1991) 183-198.
179
180
Barbara Sieferle
In zwei vollkommen unterschiedlichen sozialen Kontexten konnte ich auf diese Weise einmal den körperlichen Dimensionen des Pilgerns und das andere Mal der Körperlichkeit des Gefängnislebens nachspüren.15 Es mag zunächst willkürlich erscheinen, diese so unterschiedlichen Forschungsfelder in einem Artikel zusammenzuführen. Doch genau dadurch wird das Potenzial der Methode der Teilnehmenden Beobachtung und die Bandbreite der heuristischen Vorteile verdeutlicht. In einem ersten Schritt werde ich kurze, ausschnitthafte Einblicke in meine Forschungsfelder geben. Diese bilden die empirische Basis meiner weiteren Ausführungen. In einem zweiten Schritt werde ich darlegen, was ich unter der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten verstehe. Drittens werde ich aufzeigen, was die Methode der Teilnehmende Beobachtung ausmacht und wie sich Forscher/-innen dieser Methode bedienen können, um den körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten näher zu kommen.
2.
Ethnographische Annäherungen
2.1
Im Gefängnis
An einem Freitagabend im Dezember durchlief ich die Sicherheitskontrollen des Gefängnisses, wurde von einem Vollzugsbeamten durch insgesamt 13 Türen geführt, die dieser vor mir auf und hinter mir wieder zuschloss, bis ich auf dem Stockwerk angekommen war, auf dem ich für einige Wochen täglich als kulturwissenschaftliche Forscherin präsent war. Als ich die Hauptzentrale des Gefängnisses betrat, schlug mir der ganz eigene Geruch der Justizvollzugsanstalt entgegen. Genauso nahm ich das neonröhrenfarbene Licht und die abendliche Geräuschkulisse wahr. Lautes Schlüsselgeklapper, auf- und zufallende Türen und Gesprächsfetzen aus den Stockwerksflügeln prasselten auf mich ein. Martin war bereits im Aufenthaltsraum des Stockwerks. Er ist einer von zehn inhaftierten Männern, die jeden Freitag – genau wie ich – an einer Freizeitgruppe teilnahmen. Martin rief mir ein Hallo zu und winkte mich freudestrahlend zu sich. Er zeigte mir einen großen
15
Vgl. Sieferle, Barbara: Zu Fuß nach Mariazell. Ethnographie über die Körperlichkeit des Pilgerns, Münster 2017. Ich führte die Forschung zur Körperlichkeit des Pilgerns von 20132017 durch. Der Körperlichkeit des Gefängnislebens gehe ich im Rahmen meines PostdocProjektes ›Leben nach der Haft‹ nach (vgl. Sieferle, Barbara: Alltag nach der Haft. Kulturanthropologische Annäherungen. In: Volkskunde in Rheinland-Pfalz 33 (2018) 38-53). Es stellt einen Teilbereich meiner aktuellen Forschung dar. Die ethnographische Materialerhebung läuft seit 2018 und ist noch nicht abgeschlossen. Die Namen der Forschungsakteur/-innen, ihre biographischen Daten und die sozialen und räumlichen Kontexte meiner Forschung sind zum Schutz ihrer Person anonymisiert.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Kochtopf, der auf dem Herd stand, hob den Deckel und fächelte mir den Dampf zu. Es duftete wunderbar! Martin hatte Rindergulasch zubereitet. Nach und nach kamen die anderen Männer, die an der Freizeitgruppe teilnahmen. Der Aufenthaltsraum füllte sich und wir nahmen um einen großen, extra hierfür in den Raum gestellten Tisch Platz. Auf dem Tisch standen Saft, Mineralwasser und Softdrinks; außerdem Schalen mit frischem Schnittlauch und Basilikum. Servietten unterstrichen die Besonderheit dieses Festmahls. Und Rindergulasch stellte etwas Besonderes für die inhaftierten Männer dar. Mit Genuss verspeisten wir gemeinsam diese Mahlzeit. Wir lobten Martin für seine Kochkünste. Mit leuchtenden Augen beschrieb er detailreich seinen Kochvorgang. Er hatte das Gulasch gestern in seiner Zelle angesetzt und dort war es über Nacht und für über 24 Stunden durchgezogen. Im Freizeitraum gab es zwar eine Kochmöglichkeit, doch diese durfte nur während der neunzigminütigen Freizeit einmal die Woche benutzt werden. Das Rindergulasch hätte Martin in dieser kurzen Zeit nicht zubereiten können. Die ganze Zelle und sogar das Stockwerk, so Martin, war die Nacht und den heutigen Tag über mit dem leckeren Geruch erfüllt gewesen. Werner nahm immer wieder Schnittlauch; dazu noch eine große Handvoll Basilikumblätter. Und Sascha aß gleich drei Teller Gulasch – weil es so lecker sei, meinte er. Das Essen stand für die Männer im Kontrast zu den Mahlzeiten, die sie von der Anstalt jeden Mittag zur Verfügung gestellt bekamen. Das Anstaltsessen sei ungenießbar. Es sei billige Massenverpflegung, so der Konsens unter den Männern, es gebe jeden Tag mehr oder weniger das gleiche und dieses noch in Plastikschüsseln serviert. Viele der Männer kochten daher selbst in ihren Zellen und nahmen das kostenlose Anstaltsessen nur unregelmäßig in Anspruch. Sie kauften von ihrem eigenen Geld Lebensmittel und kochten in Wasser- und Reiskochern in ihren Zellen – denn Herdplatten waren in der Justizvollzugsanstalt verboten. Einen Supermarkt gibt es im Gefängnis zwar nicht, doch die Männer können sich alle 14 Tage Lebensmittel in das Gefängnis liefern lassen. Das Angebot ist beschränkt und teurer als im Supermarkt draußen. Dazu kommt, dass inhaftierte Männer im Gefängnis nur wenig Geld zur freien Verfügung haben und daher genau kalkulieren müssen. Dass wir Rindergulasch mit Nudeln und Salat aßen war außergewöhnlich – eben auch, weil Rindfleisch für so viele Personen ein teures Gericht darstellte. Martin hatte uns dazu eingeladen. Er wollte mit uns seinen Geburtstag feiern. Doch auch an gewöhnlichen Abenden in der Freizeitgruppe standen immer Leckereien unterschiedlichster Art auf dem Tisch: Antipasti, Kuchen, Obst, Eis, Lebkuchen. Jede Woche brachte jemand anderes eine Leckerei für die Gruppe mit. Und diese verspeisten die Männer immer mit Genuss. Generell waren Essen und Kochen Dauerthemen unter den inhaftierten Männern und es verging keine Freizeit, während der wir nicht über Essen sprachen. Nach 90 Minuten ertönte ein lauter Gong durch das Gefängnis. Er zeigte uns an, dass die Freizeit nun vorüber war. Wir stapelten die Stühle an die Wand, wischten den Tisch sauber und verabschiedeten uns. In ein paar Minuten
181
182
Barbara Sieferle
war Zelleneinschluss. Und ich wurde vom gleichen Beamten, der mich eine Stunde und 30 Minuten zuvor auf das Stockwerk gebracht hatte, wieder zurück zur Hauptpforte und zum Ausgang der Justizvollzugsanstalt begleitet. Wieder gingen wir durch insgesamt 13 Türen. Und wieder wartete ich vor jeder Tür, bis der Beamte diese aufgeschlossen hatte, ging hindurch und wartete dann wieder, bis er diese zugeschlossen hatte. Draußen angekommen ging ich zur U-Bahn und fuhr nach Hause.
2.2
Während des Pilgerns
Am dritten Tag der Pilgerwanderung ging ich einen ganzen Nachmittag zusammen mit Peter, Cornelia und Anne in einer Kleingruppe. Die Pilgergruppe setzte sich aus insgesamt 15 Teilnehmer/-innen zusammen. Gemeinsam waren wir auf dem Weg nach Mariazell, Österreichs größtem und bedeutendstem katholischen Pilgerort. Wir hatten Kleingruppen gebildet – entsprechend unserer Gehgeschwindigkeiten. So ging ich also mit den Dreien auf einem Waldpfad. Es war ein schwüler Augustnachmittag, der Himmel war bewölkt. Ein warmer, leichter Wind wehte und wir hatten das Gefühl, es würde bald anfangen zu regnen. Nacheinander gingen wir den Bergpfad hinab. Jeder im Abstand von einigen Metern zum Vorder- und Hintermann. Immer wieder blickte sich Anne nach mir um. Sie wollte sichergehen, dass ich noch da war und sich mein Abstand zu ihr und den anderen nicht zu stark vergrößert hatte. Genauso machte ich es auch, denn hinter mir ging Cornelia. Außerdem hörten wir das Klappern der Wanderstöcke auf dem Boden, die Schritte und den Atem der anderen. Wir gingen im mehr oder weniger gleichen Abstand hintereinander. Vielfach setzten wir unsere Stöcke an den gleichen Stellen auf und nutzten die gleichen Pfade, um Hindernisse wie Baumstämme, Steine oder Unebenheiten des Weges zu überwinden. Auf breiten Forstwegen gingen wir nebeneinander, jeder in seiner eigenen Schrittlänge, die Geschwindigkeit an diejenige der anderen anpassend. Sobald einer von uns auf die (Wald-)Toilette musste, warteten die anderen in gebührendem Abstand. Sobald sich jemand die Jacke auszog, die Schuhe neu band oder eine Trinkpause einlegte, machten wir Halt. Bei kurzen Pausen am Wegesrand teilten wir Traubenzucker und Kekse. Nach einiger Zeit fing es an zu regnen. Es war selbstverständlich, dass ich Annes Regenmantel über ihren Rucksack zog und dass Peter meine Wanderstöcke hielt, während ich meine Regenhose überzog. Als wir zwei Stunden später – der Regen hatte mittlerweile aufgehört – an einer Eisdiele vorbeikamen, machten wir dort kurz halt. Die Wanderstöcke in der einen Hand und die Eiswaffel in der anderen Hand gingen wir die letzte Etappe zu unserer Herberge. Nach 35 Kilometer Wegstrecke war es eine Erleichterung, die Wanderschuhe auszuziehen, unsere Blasen und Wunden an den Füßen zu versorgen, uns den Schweiß unter der Dusche abzuwaschen, zu Abend
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
zu essen und vor allem früh zu Bett zu gehen. Wir wollten für den kommenden Tag ausgeruht und fit sein. Diese zwei einleitenden Situationsbeschreibungen liefern Hinweise auf die Bedeutung des Körpers für das Pilgern und das Gefängnisleben: Beim Pilgern vollzogen wir eine körperliche Aktivität. Wir gingen den Weg zu Fuß. Und im Gefängnis aßen wir gemeinsam Rindergulasch. Wir nahmen die Mahlzeit mit all unseren Sinnen wahr. Wir rochen, schmeckten und betrachteten sie. Und in den Situationsbeschreibungen finden sich Hinweise auf meine methodische Herangehensweise und meine Rolle als Forscherin für das Verstehen der körperlichen Dimensionen dieser Forschungsfelder: In beiden Situationen war ich als Forscherin aktiv involviert. Ich ging bei der Pilgerwanderung mit und ich nahm an der Freizeitgruppe im Gefängnis teil. Ich tat das, was die Forschungsakteur/-innen auch taten. Im Folgenden werde ich mich immer wieder auf diese zwei Situationen beziehen, um der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten nachzugehen und um die Methode der Teilnehmenden Beobachtung dem/der Leser/-in näher zu bringen.
3.
Über die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Seit den 1970er Jahren ist in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften eine zunehmende Hinwendung zu den körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten zu verzeichnen. Der Soziologe Robert Gugutzer spricht sogar von einem body turn16 in der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Theoriebildung; der Ethnologe Thomas Csordas vom kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Paradigma des embodiment.17
3.1
Der Körper als Objekt sozialer Wirklichkeit
Frühe Körperstudien fokussierten sich auf die kulturelle Formung des Körpers.18 Der Körper rückt dabei als Objekt in den analytischen Fokus, an dem sich Kultur
16 17 18
Gugutzer, Robert: body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports, Bielefeld 2006. Csordas, Thomas: Embodiment as a paradigm for anthropology. In: Ethos 18 (1990) 5-47, 1. Vgl. Binder, Beate/Göttsch, Silke/Kaschuba, Wolfgang/Vanja, Konrad (Hg.): Ort. Arbeit. Körper. Ethnografie Europäischer Modernen, Münster 2005, darin: die Aufsätze unter der Rubrik ›Körper‹; Brednich, Rolf/Schneider, Annette/Werner, Ute (Hg.): Natur – Kultur. Volkskundliche Perspektiven auf Menschen und Umwelt, Münster 2001, darin: die Aufsätze unter der Rubrik ›Zur kulturellen Konstruktion des Körpers‹; Jeggle, Utz/Korff, Gottfried/Scharfe, Martin/Warneken, Bernd Jürgen (Hg.): Volkskultur in der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung, Reinbeck bei Hamburg 1986, darin: die Rubrik ›Körperkultur‹; Matter, Max (Hg.): Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung, N.F. 31 (1996).
183
184
Barbara Sieferle
und Gesellschaft abspielt und symbolisch manifestiert. Er tritt als Bedeutungsträger und Ausdrucksmedium von Kultur und Gesellschaft auf. Die Ethnologin Mary Douglas ist eine der prominentesten Vertreter/-innen dieser Denkrichtung. Douglas unterscheidet zwischen physischem und sozialem Körper.19 Der physische Körper ist für Douglas zuallererst als natürliches und universales Objekt zu verstehen – entsprechend eines naturwissenschaftlichen Verständnisses vom Körper. Und der physische Körper ist darauf aufbauend für Douglas immer gesellschaftliches Symbol.20 Wie der physische Körper allerdings als Symbol genutzt wird ist kulturell verschieden. Dadurch bezeichnet ihn Douglas als sozialen Körper.21 Anders formuliert: Soziokulturelle Bedeutungen werden am physischen Körper dargestellt, wodurch dieser wiederum als Bedeutungsträger und damit als sozialer Körper in Erscheinung tritt. Der Körper ist für Douglas gleichzeitig Abbild und Kommunikationsmittel von Kultur und Gesellschaft.22 Denn die »Ideen, Ideologien, Glaubenssätze, Weltbilder, Wert- und Moralmaßstäbe, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die in einer Gesellschaft kursieren«23 manifestieren sich am physischen Körper; dieser wird dadurch zum sozialen Körper. Douglas betrachtet den physischen Körper als soziales Rohmaterial24 und arbeitet mit dem Dualismus von Körper und Geist. Sie geht davon aus, dass Kultur und Gesellschaft als getrennt und unabhängig vom Körper verstanden werden können.25 Eine Position, die jüngere körpertheoretische Ansätze kritisieren. Hierauf werde ich noch zurückkommen. Beim Pilgern spielte der Körper als Objekt eine Rolle, wenn sich die Teilnehmer/-innen am Ideal eines fitten, durchtrainierten, leistungsfähigen Körpers orientierten. Die Wegstrecken der Pilgerwanderungen waren mit 35 bis 40 Kilometern pro Tag so angelegt, dass jede/r mindestens einmal an seine körperlichen Leistungsgrenzen stieß. Erschöpfungszustände, Muskelverspannungen, Blasen und Wunden an den Füßen gehörten dazu. Einige Teilnehmer/-innen bereiteten sich bereits Wochen vor der eigentlichen Pilgerfahrt durch ausdauernde Wanderungen auf das Gehen zu Fuß vor.26 Sie formten und trainierten ihren Körper, damit dieser fit und leistungsfähig wurde. Die von soziologischen Studien für Deutschland des späten 20. Jahrhunderts diagnostizierte Leistungsgesellschaft 27 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Douglas, Mary: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur, Frankfurt a.M. 1986 [1970], 99-123. Vgl. ebd., 104. Vgl. ebd., 6. Vgl. ebd., 103. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2005, 93. Platz, Theresa: Anthropologie des Körpers. Vom Körper als Objekt zum Leib als Subjekt von Kultur, Berlin 2006, 31. Vgl. Douglas: Ritual, Tabu und Körpersymbolik, 32. Vgl. Sieferle: Zu Fuß nach Mariazell, 140-143. Neckel, Sighard: Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2004. Verheyen, Nina: Die Erfindung der Leistung, München 2018.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
manifestiert sich in den Körpern der Pilger/-innen. Ihre Körper fungierten für die Pilger/-innen als Symbole ihrer Leistungsfähigkeit. Im Gefängnis spielte der Körper inhaftierter Männer als Objekt externer Zwänge eine entscheidende Rolle. Freiheitsentzug setzt grundlegend am Körper an. Dieser wird in Gebäuden und Zellen eingeschlossen, durch Aktenführung von Justiz, Psychologie, Medizin, Sozialer Arbeit klassifiziert und kategorisiert. Er wird durch Leibesvisitationen, Urinkontrollen und Sicherheitsscanner im Gefängnis zu einem überwachten Körper und gleichermaßen zu einem gefährlichen Körper.28
3.2
Der Körper als Produzent sozialer Wirklichkeit
Seit den 1980er Jahren finden sich zunehmend körpertheoretische Perspektiven, die den Körper nicht lediglich als Produkt von Kultur und Gesellschaft betrachten. Diese Ansätze nehmen den Körper vielmehr als Produzent von Kultur und Gesellschaft in den analytischen Blick. Kultur- und gesellschaftstheoretische Bezugspunkte dieser Perspektive auf den Körper stellen die eingangs erwähnten Konzepte der Körpertechniken, des impliziten Wissens und des Habitus dar. Der Körper tritt dadurch als Ort und Ausgangspunkt der Wirklichkeitskonstitution in Erscheinung; als »Agens der Herstellung von Wirklichkeit«29 . In unserem körperlichen Handeln erzeugen, reproduzieren und verändern wir soziale Wirklichkeit. Eine solche Verständnisweise von Wirklichkeit wird als doing culture30 bezeichnet und vornehmlich in soziologischer Praxistheorie stark gemacht.31 Praxistheorie legt den Fokus auf den körperlichen Handlungsvollzug und dem diesem innewohnenden habitualisierten Sinn. Aus praxistheoretischer Perspektive sind Handlungen »routinierte Bewegungen und Tätigkeiten des Körpers«32 . Und dies gilt auch für scheinbar geistige Tätigkeiten wie beispielsweise Denken, Beten oder Fühlen. Der bei Mary Douglas zu findende cartesianische Dualismus von Körper und Geist greift nicht, wenn der Körper gleichwohl als Produzent von Kultur und Gesellschaft aufgefasst wird. Cogito ergo sum – Ich denke, also bin ich – wird abgelöst von einem Blick auf den Menschen als grundlegend körperlicher Akteur.
28 29 30 31
32
Chamberlen, Anastasia: Embodying Punishment. Emotions, Identities, and Lived Experiences in Women’s Prisons, Oxford 2018. Keller/Meuser: Wissen des Körpers – Wissen vom Körper, 15. Hörning, Karl/Reuter, Julia (Hg.): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis, Bielefeld 2004. Vgl. Hillebrandt, Frank: Soziologische Praxistheorien. Eine Einführung, Wiesbaden 2014. Schatzki, Theodor/Knorr Cretina, Karin/von Savigny, Eike (Hg.): The Practice Turn in Contemporary Theory, London 2001. Reckwitz, Andreas: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive. In: Zeitschrift für Soziologie 32 (2003) 282-301. Reckwitz: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken, 290.
185
186
Barbara Sieferle
Am Beispiel des Pilgerns wird dieser Blick auf den Körper als Agens der Herstellung sozialer Wirklichkeit gut nachvollziehbar: Das Pilgern stellt eine Körpertechnik33 dar, die Pilger/-innen auf ihrem Weg nach Mariazell vollzogen. Der Vollzug des Pilgerns zeichnete sich durch ausdauerndes Gehen zu Fuß aus, durch das Tragen des Rucksacks, durch gemeinsame Pausen am Wegesrand, das Teilen von Proviant, das Singen von Liedern und das Sprechen von Gebeten. Durch all diese körperlichen Tätigkeiten schufen die Teilnehmer/-innen das Pilgern überhaupt erst. Es wurde zur Wirklichkeit, indem die Pilger/-innen es vollzogen. Und in der Art und Weise, wie sie das Pilgern ausführten, finden sich Hinweise auf die praktischen Sinnzuschreibungen an das Pilgern: Die Teilnehmer/-innen der Pilgerwanderungen achteten beim Gehen auf ihre Mitpilger/-innen, sie halfen sich beim Überziehen der Regenmäntel, luden sich gegenseitig auf Eis und Getränke ein, übernachteten gemeinsam in Pilgerschlafsälen, nahmen ihr Abendessen gemeinsam ein und teilten ihren Proviant am Wegesrand. Dadurch vollzogen sie das Pilgern als eine Praktik der Zusammengehörigkeit. Dem körperlichen Vollzug des Pilgerns lag der praktische Sinn von Zusammengehörigkeit inne.34
3.3
Der Körper als Subjekt der Erfahrung sozialer Wirklichkeit
Zusätzlich zur Analyse des Körpers als Produkt und Produzent von Kultur und Gesellschaft findet sich seit den 1980er Jahren eine leibphänomenologisch orientierte Perspektive auf den Körper. Diese versteht den Körper als Ausgangspunkt der Wahrnehmung und Erfahrung von Wirklichkeit.35 Genau wie praxistheoretische Perspektiven wird der Körper als Agens der Wirklichkeitskonstitution verstanden. Doch anstatt Bewegungen und Tätigkeiten des Körpers stehen Wahrnehmungen und Erfahrungen der Welt durch den Körper im Zentrum der analytischen Aufmerksamkeit. Den Körper als Subjekt von Erfahrung zu konzipieren geht mit der 33
34 35
Körpertechniken sind nach Marcel Mauss »die Weisen, in der sich die Menschen in der einen wie in der anderen Gesellschaft traditionsgemäß ihres Körpers bedienen.« Es sind Tätigkeiten und Bewegungen des Körpers. Im Vollzug von Körpertechniken, so Mauss, formieren Akteur/-innen die Welt und damit kommt der Körper als Produzent sozialer Wirklichkeiten in den Blick. Vgl. Mauss: Die Techniken des Körpers, 199-201. Sieferle: Zu Fuß nach Mariazell, 186-199. Wahrnehmung wird von mir als soziokultureller Prozess der Orientierung und der Auseinandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit verstanden. Den Sinnen kommt dabei eine fundamentale Bedeutung zu, indem Wahrnehmung die soziokulturelle Umgangsweise und Konditionierung der fünf externen Sinne, der Propriozeption und der inneren Intuition und Empfindsamkeit umfasst (Csordas: Introduction, 5; Schwibbe: Wahrgenommen, 7). Erfahrung konzipiere ich als eine Hinwendung zu und Verdichtung von Erlebnissen, die zu einer Disposition, »die einem ›Gespür‹, einem gefühlten Wissen und Können gleichkommt« (Fuchs, Thomas: Was ist Erfahrung? In: Hauskeller, Michael (Hg.): Die Kunst der Wahrnehmung. Beiträge zu einer Philosophie der sinnlichen Erkenntnis, Zug/Schweig 2003, 69-87, 72), integriert werden.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Kritik an einem Körperverständnis einher, welches den Körper (entsprechend Mary Douglas) lediglich als Bedeutungsträger und Symbol von Kultur und Gesellschaft betrachtet. Der Ethnologe Michael Jackson konstatiert, dass Bedeutungen nicht auf Symbole zu reduzieren sind und nicht abseits von Handlungsvollzügen liegen: »Thus an understanding of a body movement does not invariably depend on an elucidation of what that movement ›stands for‹. (…) To treat bodily praxis as necessarily being an effect of semiotic causes is to treat the body as a diminished version of itself.«36 Dementsprechend argumentiert der Ethnologe Thomas Csordas, wenn er schreibt: »[T]o understand the body as the biological raw material on which culture operates has the effect of excluding the body from original (…) participation in the domain of culture, making the body in effect a ›precultural substrate‹.«37 Csordas und Jackson betrachten den Körper als »existential ground of life«38 . Sie betonen, dass Menschen nur mit und durch ihren Körper Erfahrungen machen können. Sie beziehen sich dabei auf den Leibphänomenologen Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty weist darauf hin, dass der Körper Ausgangspunkt jeglicher Wahrnehmung der Welt ist und dass das menschliche In-der-Welt-Sein, wie Merleau-Ponty es nennt, immer ein körperliches Sein ist.39 Er verwendet allerdings nicht den Begriff Körper, sondern spricht von Leib. Dieser eröffnet dem Menschen die Welt und verbindet ihn mit dieser.40 Erst durch die leibliche Zuwendung zur Welt entsteht die Möglichkeit zur Wahrnehmung des Körpers als Objekt.41 Indem der Mensch zu sich in Distanz tritt und sich als Objekt betrachtet, wird der Körper überhaupt erst zu einem solchen. Der Leib hingegen ist kein Objekt, er ist nicht als solcher wahrnehmbar. Er tritt vielmehr als leibliche Empfindung in Erscheinung.42 Der Leib spürt, während der Körper gespürt wird. Der Leib ist gelebter Leib, während der Körper erlebter Körper ist.43 Auch aus phänomenologisch orientierter Perspektive heraus ist die cartesianische Unterscheidung zwischen Körper/Leib und Geist nicht haltbar, da jedes scheinbar geistige Erkennen der Welt immer ein leibliches Erkennen ist.44
36 37
38 39 40 41 42 43 44
Jackson, Michael: Knowledge of the Body. In: Man 18 (1983) 327-345, 329. Csordas, Thomas: Introduction. The body as representation and being-in-the-word. In: Dies. (Hg.): Embodiment and experience. The existential ground of culture and self, Cambridge 2003 [1994] 1-24, 8. Csordas, Thomas: The Body’s Career in Anthropology. In: Moore, Henrietta (Hg.): Anthropological Theory Today Cambridge (2003) 172-205, 181. Merleau-Ponty: Phänomenologie und Wahrnehmung. 131 u. 243. Ebd., 243. Ebd., 96. Ebd., 234. Vgl. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 2004, 152-155. Platz: Anthropologie des Körpers, 44.
187
188
Barbara Sieferle
Damit ist allerdings kein universelles, biologisches Verständnis des Leibes gemeint. Vielmehr sind leibliche Erfahrungen immer soziokulturell.45 Die Körperhistorikerin Barbara Duden macht dies eindrücklich in ihrer Studie über den Eisenacher Arzt Johann Storch (1681-1751) deutlich.46 Sie rekonstruiert anhand der Aufzeichnungen zur Krankengeschichte seiner Patientinnen die zeitspezifischen Erfahrungen des Leibesinneren. Gerade durch diese historische Distanz zeigt sich die soziale und kulturelle Dimension leiblicher Erfahrungen.47 Der Soziologe und Praxistheoretiker Robert Schmidt kritisiert an leibphänomenologischen Ansätzen, dass diese sich zu sehr auf Wahrnehmungen und Erfahrungen der Welt durch den Körper fokussieren und zu wenig auf den körperlichen Handlungsvollzug achten.48 Ich nehme hier eine andere Position ein und sehe es als grundlegend wichtig an, beide Perspektiven zu vereinen. Denn körperliche Handlungsvollzüge gehen immer mit Erfahrungen einher.49 So betont auch der Ethnologe Edward Bruner, dass Handeln und Erfahren in wissenschaftlicher Analyse zusammen gedacht werden müssen.50 Dies zeigt sich gut an der von mir eingangs beschriebenen Gefängnissituation. Martin kochte für die ganze Gruppe. Die Männer hatten sich das Gericht selbst ausgesucht. Sie aßen von Keramiktellern und tranken aus Gläsern. Dies alles stellte etwas Besonderes in ihrem Gefängnisalltag dar. Es stand für sie in Kontrast zu den Mahlzeiten der Anstalt, die sie alleine in ihren Zellen einnahmen. Das gemeinsame Essen in der Freizeitgruppe nahmen die Männer als eine Auszeit von der Fremdkontrolle ihres täglichen Gefängnislebens wahr. Und diese Auszeit, verbunden mit einem Gefühl der Freiheit und Handlungsmacht, erfuhren die Männer körperlichleiblich. Sie nahmen diese Freiheit mit all ihren Sinnen wahr, wenn sie das Rindergulasch betrachteten, rochen und schmeckten; wenn sie es im Akt des Essens wortwörtlich in sich aufnahmen, wenn sie gemeinsam diese Mahlzeit um einen Tisch herum einnahmen, wenn sie sich gegenseitig körperlich-leiblich zuwandten, 45 46 47
48 49
50
Scheper-Hughes, Nancy/Lock, Margaret: The Mindful Body. A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. In: Medical Anthropology Quarterly 1 (1987) 6-41. Duden, Barbara: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1991 [1987]. Aus Gründen der Lesbarkeit verwende ich in diesem Artikel ausschließlich den Begriff Körper. Ich fasse hierunter sowohl die Objekthaftigkeit und Materialität (Körper) als auch das Moment der Empfindung und Subjekthaftigkeit von Erfahrungen (Leib). Schmidt, Robert: Soziologie der Praktiken. Konzeptionelle Studien und empirische Analysen, Berlin 2012, 61. Asad, Talal: Remarks on the anthropology of the body. In: Coakley, Sarah (Hg.): Religion and the body, Cambridge 1997, 42-53: 48. Scheer, Monique/Eitler, Pascal: Emotionengeschichte als Körpergeschichte. Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 35 (2012) 282-313, 298. Bruner, Edward: Experience and its expressions. In: Turner, Victor/Bruner, Edward (Hg.): The Anthropology of Experience, Chicago 1986, 3-30, 7.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
sich Getränke nachschenkten, Servietten reichten und auf den Teller nachschöpften, wenn sie sich zur Begrüßung und Verabschiedung kollegial auf die Schulter klopften. Dies waren alles körperlich-leibliche Handlungsvollzüge und gleichzeitig waren es auch körperlich-leibliche Wahrnehmungen und Erfahrungen von Freiheit und Handlungsmacht.
3.4
Körperlichkeit: eine begriffliche Zusammenfassung
Wenn ich im Folgenden von der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten spreche, dann vereine ich damit drei theoretische Positionen der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Körperforschung. Erstens umfasst dies eine phänomenologisch orientierte Perspektive auf den Körper als Ausgangspunkt und Subjekt von Wahrnehmung und Erfahrung. Erfahrungen der Welt werden als grundlegend körperliche Erfahrungen gedacht. Hieran schließt zweitens eine praxistheoretisch orientierte Perspektive an, die den Körper als Produzent von Kultur und Gesellschaft in den Blick nimmt und damit körperliches Handeln und den praktischen, impliziten Sinn des Handelns fokussiert. Sinnzuschreibungen erfolgen aus dieser Perspektive heraus im körperlichen Handlungsvollzug und sind nicht abseits dessen zu verorten. Und drittens beinhaltet der Begriff der Körperlichkeit die Perspektive auf den Körper als Produkt von Kultur und Gesellschaft. Hier wird der Körper als Symbol und Kommunikationsmittel soziokultureller Bedeutungen in den analytischen Blick genommen. Sinnzuschreibungen an den Körper werden aus dieser Perspektive heraus als reflexive Leistung verstanden, die abseits körperlicher Handlungsvollzüge liegen. Handlungsvollzügen kommt hier eine geringe Aufmerksamkeit zu, denn der Körper wird vornehmlich in seiner Objekthaftigkeit betrachtet. Je nach Forschungsschwerpunkt und Analyseausrichtung können unterschiedliche theoretische Positionen in kultur- und gesellschaftswissenschaftlicher Forschung eine stärkere Gewichtung erhalten. Grundlegend hängen die drei Perspektiven eng zusammen und sind immer in ihrer Wechselhaftigkeit zu verstehen.
4.
Über die Sprachlosigkeit der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Die Situation in der Freizeitgruppe im Gefängnis macht außerdem deutlich, dass die Männer ihre Handlungsvollzüge, ihre Erfahrungen und den damit einhergehenden Sinn nicht verbal-sprachlich artikulierten. Tätigkeiten werden vielfach unabhängig von Sprache ausgeführt. Der darin enthaltene implizite Sinn wird oftmals nicht artikuliert. Die Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit des körperlichen In-der-Welt-Seins führt dazu, dass die eigene Körperlichkeit von einer Thematisierung ausgeschlossen bleibt. Drew Leder drückt dies folgendermaßen aus: »I have a tacit command over my boy, accomplishing without the slightest difficulty
189
190
Barbara Sieferle
actions I could not begin to comprehend or carry out in a reflective fashion. If I attempted to walk by consciously manipulating all the proper muscles, I would soon find myself incapacitated.«51 Versuchen wir den Vollzug von Tätigkeiten in Worte zu fassen, zu beschreiben und zu erklären und fangen wir einmal an, darüber nachzudenken, wie wir etwas tun, so verlieren wir meist die Kompetenz dazu. Auch für Erfahrungen, die wir von der Welt machen, gilt, dass deren Grundlage immer der Körper darstellt, selbst wenn wir diese als geistige und körperlose Prozesse wahrnehmen.52 Die Aufmerksamkeit ist im Alltag eben nicht auf den eigenen Körper als Ausgangspunkt von Erfahrung gerichtet, sondern vielmehr auf die Wahrnehmung und Erfahrung von Dingen, Menschen oder Situationen.53 »I do bodily things and my doing consists in these bodily doings but both consciousness and action are directed at the world in which I am acting«, drückt es der Soziologe Nick Crossley treffend aus.54 Erst wenn der Körper sozialen Akteur/innen als Widerstand entgegentritt oder sie ihn absichtsvoll ästhetisieren und stilisieren, rückt er ins Zentrum der Aufmerksamkeit.55 Die Pilger/-innen thematisierten ihre eigene Körperlichkeit während Schmerz- und Erschöpfungszuständen und genauso, wenn sie sich als Pilger-/innen präsentieren wollten (in Abgrenzung zu Wanderern oder Tourist/-innen). Und für die inhaftierten Männer spielte ihr eigener Körper eine explizite Rolle, wenn sie die Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit im Gefängnis artikulierten. Und er rückte ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn sie durch Bodybuilding und Tattoos ihren Körper modellierten, um diesen als starken, männlichen Körper darzustellen und um damit wiederum der alltäglich erfahrenen Fremdkontrolle durch die Formung ihres eigenen Körpers selbstbestimmt entgegenzuwirken.56 Doch auch in Momenten, in denen der Körper ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, bleibt er oftmals von einer Thematisierung ausgeschlossen. Er bleibt unaussprechlich, unbeschreibbar oder stumm. Das Unaussprechliche des Körpers ist das, was durch soziokulturelle Normierung und Konventionen als nicht thematisierbar gilt. Es wäre zwar in Worte zu fassen, doch es ist das, ›worüber man nicht spricht‹.57 Beim Pilgern traf dies auf Schmerzen zu, die zu stark waren und Pilger/-innen vor die Entscheidung eines Abbruchs der Pilgerwanderung führten. Pilger/-innen erfuhren zu starke Schmerzen als Niederlage und Schwäche und verschwiegen diese daher oftmals vor den anderen Teilnehmer/-innen. Ganz ähnlich
51 52 53 54 55 56 57
Leder: The absent body, 20. Ebd., 1. Ebd., 18. Crossley: Research Embodiment by Way of ›body technique‹, 83. Abraham, Anke: Der Körper im biographischen Kontext. Ein Wissenssoziologischer Beitrag, Wiesbaden 2002, 12. Sloan, Jennifer A.: Masculinities and the Adult Male Prison Experience, London 2016, 46. Hirschauer: Ethnographisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen, 438.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
im Gefängnis. Gerade neu inhaftierte Männer verschwiegen ihre Unsicherheiten und Ängste in Bezug auf das Leben im Gefängnis. Sie wollten gegenüber ihren Mitinsassen und genauso gegenüber der Anstalt keine Schwäche zeigen. Dies hätte ihre Position in der Gefängnishierarchie negativ beeinflusst.58 Das Unbeschreibbare des Körpers bezieht sich auf fehlende Begrifflichkeiten, um körperliche Handlungsvollzüge und Erfahrungsmuster verbal-sprachlich auszudrücken.59 Vielfach fehlten den Pilger/-innen und auch mir als Forscherin die Worte, um unser Tun und unsere Erfahrungen adäquat auszudrücken. Pilger/innen wiesen zwar regelmäßig auf Erschöpfungszustände, Wadenkrämpfe oder das angenehme Gefühl nach einer Pause hin. Doch wie genau sich diese Zustände und Empfindungen körperlich anfühlten ließ sich nur schwer, wenn überhaupt, in Worte fassen. Genauso lobten die inhaftierten Männer und ich in der Freizeitgruppe den Geschmack des Rindergulaschs, doch beschreiben ließ sich der Geschmack nur schwer; genauso wenig der ganz eigene Geruch, die Geräuschkulisse und die Atmosphäre der Justizvollzugsanstalt, welche die Lebenswelt Gefängnis für die Männer prägte. Das Stumme des Körpers verweist auf die Rolle materieller Kultur für Handlungsvollzüge und Welt-Erfahrungen.60 Räumliche Settings, Dinge und Artefakte beeinflussten den (körperlichen) Vollzug und die (körperlichen) Erfahrungen des Pilgerns. So übten Wanderschuhe einen entscheidenden Einfluss auf die Pilgererfahrung aus. Ob und wie auf Asphaltstraßen, Forstwegen oder Wanderwegen gegangen wurde und wie die Pilger/-innen die Untergründe wahrnahmen und erfuhren war stark vom Schuhwerk abhängig. Wanderschuhe waren während des Pilgerns zwar regelmäßig Gesprächsthema, doch deren Rolle für den Vollzug und die Erfahrung des Pilgerns blieb unausgesprochen. Und im Kontext der Lebenswelt Gefängnis beeinflusste die Architektur der Justizvollzugsanstalt das tägliche Leben der inhaftierten Männer auf fundamentale Art und Weise. Die eigene, 12,5 Quadratmeter-Zelle, in der die Männer jeden Abend um 22 Uhr bis am nächsten Morgen um 6 Uhr eingeschlossen wurden, war sehr selten Gesprächsthema. Doch spielte diese im täglichen Leben der inhaftierten Männer eine bedeutende Rolle. Sie war Rückzugsort, Schlaf- und Wohnort, Lernzimmer, Besuchsraum und Toilette. Die eigene Zelle war höchst privat und gleichzeitig jederzeit durch Beamt/-innen zugänglich.
58
59 60
Vgl. Bereswill, Mechthild: Männlichkeit und Gewalt. Empirische Einsichten und theoretische Reflexionen über Gewalt zwischen Männern im Gefängnis. In: Feministische Studien 24 (2006) 242-255, 244. Abraham: Der Körper im biographischen Kontext, 18. Hirschauer: Ethnographisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen, 49.
191
192
Barbara Sieferle
5.
Feldforschung und Teilnehmende Beobachtung
Auf all diese Aspekte wurde ich nur aufmerksam, weil ich an den Aktivitäten in meinen Forschungsfeldern teilnahm. Ich verstand das Pilgern und das Leben im Gefängnis durch meine andauernde und langfristige Präsenz in diesen Feldern.
5.1
Verstehen durch Miterleben
Der empirische Kulturwissenschaftler Utz Jeggle weist darauf hin – und ich schließe mich ihm an –, dass das Verstehen sozialer Wirklichkeiten nur durch das Miterleben der Lebenswelten sozialer Akteur/-innen möglich ist.61 Und das Miterleben von Lebenswelten bildet den Kern ethnographischer Feldforschung. Feldforschung ist ein »Eintauchen und Vertrautwerden mit alltäglichen Lebenswelten der Untersuchten, die ein (nachvollziehendes) Verstehen«62 ermöglichen. Durch das Miterleben sozialer Situationen wird die Perspektive der Forschungsakteur/-innen, die sogenannte emische Perspektive, eingefangen und dadurch wird eine »sinnverstehende Deutung und Interpretation sozialen Handelns erlangt.«63 Im Rahmen meiner Feldforschungen zum Pilgern und zum Gefängnisleben begab ich mich als Forscherin in diese Felder und nahm am Alltagsleben der Menschen teil. Ich begleitete über zwei Sommer hinweg Pilger/-innen auf ihrem Weg nach Mariazell. Und ich nahm über einen Zeitraum von fünf Monaten am Alltagsleben inhaftierter Männer in einer deutschen Justizvollzugsanstalt teil. Auch die Europäische Ethnologin Brigitta Schmidt-Lauber begreift die Teilnahme im Forschungsfeld als Schlüsselmethode ethnographischer Feldforschung. Denn durch die »unmittelbare Partizipation der Forschenden am alltäglichen sozialen Leben im jeweiligen Untersuchungsfeld, »(…) [d]urch das Miterleben soll eine sinnverstehende Deutung und Interpretation sozialen Handelns erlangt werden, das in einem über-individuellen kulturellen Sinnzusammenhang eingeordnet wird«64 . Und die Kulturanthropologin Katharina Eisch-Angus verweist auf die Notwendigkeit des »konkrete[n], körperhafte[n] Da-Sein[s] der Forscherin«65 . Dieses körperliche Da-Sein versteht Eisch-Angus als ein empathisches Miterleben sozialer 61 62
63 64
65
Jeggle, Utz: Zur Geschichte der Feldforschung in der Volkskunde. In: Dies. (Hg.): Feldforschung. Qualitative Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, 11-46, 31. Schmidt-Lauber, Brigitta: Orte von Dauer. Der Feldforschungsbegriff der Europäischen Ethnologie in der Kritik. In: Windmüller, Sonja u.a. (Hg.): Kultur – Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissenschaft, Berlin 2009, 237-259, 251. Ebd., 251. Schmidt-Lauber, Brigitta: Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Göttsch, Silke/Lehmann, Albrecht (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie, Berlin 2 2007, 219-248, 220f. Eisch-Angus, Katharina: Erkundungen und Zugänge I. Feldforschung. Wie man zu Material kommt. In: Löffler, Klara (Hg.): Dazwischen. Zur Spezifik der Empirien in der Volkskunde.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Situationen.66 Es reicht dabei nicht aus, körperliche anwesend zu sein. Vielmehr muss sich aus der körperlichen Nähe eine soziale Nähe entwickeln. Der Aufbau sozialer Nähe ist ausschlaggebend, um die im Feld vollzogenen Handlungsvollzüge und Erfahrungsmuster zu erkennen und zu verstehen. Dies gilt insbesondere für Forschungen, deren Analysefokus auf der Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten liegt und die eben nicht vornehmlich auf die Artikulation von Sinn und Bedeutung in Interviews oder Gesprächen bauen können. Während des Pilgerns entwickelte sich zwischen mir und meinen Mitpilger/innen eine soziale Nähe durch das gemeinsame Gehen zu Fuß, das Teilen von Proviant am Wegesrand, das gemeinsamen Übernachten in Schlafsälen, durch gegenseitige Wundversorgungen und nicht zuletzt durch das Teilen einer gemeinsamen Gehrhythmik, durch die gemeinsame Überwindung von Erschöpfungszuständen und die gemeinsame Ankunft im Pilgerort. In meiner Forschung im Gefängnis war der Aufbau sozialer Nähe durch die Geschlossenheit dieser Institution weitaus schwieriger. Erst nach der offiziellen Genehmigung der Anstaltsleitung konnte ich am Gefängnisleben teilnehmen. Und dies auch nur in beschränktem Ausmaß. So durfte ich täglich nur wenige Stunden im Gefängnis sein. Einige Bereiche des Gefängnisses durfte ich nur in Begleitung eines/einer Beamt/-in betreten. Abends verließ ich das Gefängnis wieder (im Gegensatz zu den inhaftierten Männern). Gleichzeitig war ich – ähnlich zu der Lage der inhaftierten Männer – von der Anstalt abhängig. Ich konnte Türen nur durchqueren, wenn mir ein/e Beamt/-in diese auf- und hinter mir wieder zuschloss. Auch ich musste täglich Sicherheitskontrollen durchlaufen und war »den Launen der Beamten«, um in den Worten eines inhaftierten Mannes zu sprechen, ausgesetzt. Manchmal durfte ich mein Notizbuch mit hineinnehmen, an anderen Tagen nicht. Manchmal durfte ich an vorab vereinbarten Sitzungen oder Anstaltsaktivitäten teilnehmen. An anderen Tagen wurde mir meine Teilnahme verwehrt. Vorab genehmigte Besuchstermine wurden ohne weitere Begründung abgesagt. Das frustrierte mich und machte mich wütend. Ich fühlte mich in meiner Handlungsfreiheit stark eingeschränkt. Letztendlich waren es aber genau diese Erfahrungen, die dazu führten, dass ich eine soziale Nähe zu den inhaftierten Männern aufbaute. Immer wieder kommentierten die Männer: »Jetzt merkst du mal, wie es uns täglich geht.« Meine eigenen Erfahrungen der Restriktionen des Gefängnislebens waren es, die zwischen mir und den inhaftierten Männern zu Vertrautheit führten und mich in meinem kulturwissenschaftlichen Verstehensprozess weiterbrachten. Soziale Nähe und Vertrautheit bildeten die Voraussetzungen und die Basis meines Zugangs zu den körperlichen Dimensionen meiner Forschungsfelder.
66
Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Wien 1998, Wien 2001, 2746, 35. Ebd., 35.
193
194
Barbara Sieferle
5.2
Teilnahme als Prozess der Inkorporierung
Eine Vertrautheit mit dem Forschungsfeld und den dort agierenden Forschungsakteur/-innen zu entwickeln heißt auch, die im Feld geltenden kulturellen Normen, Handlungs- und Erfahrungsmuster kennenzulernen. Dies gelang durch meine langfristige Präsenz im Feld des Pilgerns sowie im Gefängnis und meiner Teilnahme an den Aktivitäten in meinen Forschungsfeldern. Dies ging einher mit einer Verstrickung in die Welt 67 und einer Auseinandersetzung »mit der Welt, den Dingen und Menschen in ihr.«68 Während der Teilnahme und insbesondere beim Eintritt in das Forschungsfeld wird der Forscher/-innenkörper auf das Feld »abgestimmt«.69 Dieser Prozess »implies a degree of solidification of the world incorporated, which will gradually make the fieldworker experience a reshaping of the body’s actual ability.«70 Mein eigener Körper diente mir als Forschungsinstrument, um der Körperlichkeit meiner Forschungsfelder näherzukommen. Im Feld des Pilgerns hieß dies, dass ich das tat, was meine Mitpilger/-innen auch taten. Ich vollzog die Körpertechnik des Gehens zu Fuß. Ich ging gemeinsam mit den Pilger/-innen den Weg nach Mariazell, übernachtete mit ihnen in Schlafsälen, legte gemeinsame Pausen am Wegesrand ein, kam mit ihnen im Pilgerort an, feierte mit ihnen den Pilgergottesdienst und fuhr gemeinsam mit ihnen wieder zurück nach Hause. Dadurch erlernte ich das Pilgern als eine Praxis der Zusammengehörigkeit zu vollziehen und zu erfahren. An die Handlungs- und Erfahrungsmuster des Gefängnislebens näherte ich mich an, indem ich mir die Umgangsweisen und auch die Restriktionen des Anstaltslebens von den inhaftierten Männern aneignete. So lernte ich von den Männern, geduldig vor verschlossenen Türen zu warten bis Beamt/-innen diese aufschlossen. Ich lernte von ihnen, wie ich die Sicherheitskontrollen möglichst schnell und emotionslos passieren konnte. Ich lernte von ihnen, schwierige Situationen mit Humor zu meistern. Ich lernte von ihnen, wie ich mich im Besuchsraum positionierte mussten, um dem überwachenden Blick der Beamt/-innen nicht allzu sehr ausgeliefert zu sein. Den Handlungs- und Erfahrungsmustern des Gefängnislebens näherte ich mich außerdem an, indem ich mit den inhaftierten Männern ihre Freizeit verbrachte, mit ihnen gemeinsam Mahlzeiten einnahm und indem ich mir die zeitlichen Routinen und räumlichen Arrangements des Gefängnisses einverleibte. Ich eignete mir so die Handlungs- und Erfahrungsmuster, die praktischen Sinnzuschreibungen des Pilgerns und des Gefängnislebens an – ich inkor67 68 69 70
Vgl. Förster, Till: Sehen und Beobachten. Ethnographie nach der Postmoderne. Sozialer Sinn 3 (2001) 459-485, 469. Ebd., 469. Goffman, Erving: Über Feldforschung. In: Knoblauch, Hubert: Kommunikative Lebenswelten. Zur Ethnographie einer geschwätzigen Gesellschaft, Konstanz 1997, 261-269, 263. Hastrup, Kirsten: Anthropological Knowledge Incorporated. In: Hastrup, Kirsten/Hervik, Peter: Social Experience and Anthropological Knowledge, London 1994, 224-240, 231.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
porierte sie.71 Das Pilgern und auch die täglichen Routinen im Gefängnis wurden mir zunehmend vertrauter. Was mir anfangs noch als fremd und unverständlich erschien wurde im Laufe meiner andauernden Präsenz und meiner Teilnahme an den Tätigkeiten in den Forschungsfeldern selbstverständlich und vertraut. Der Soziologe Loïc Wacquant schreibt über den methodischen Zugang zum Boxen, dass sich die Forscher/-innen in die Welt des Boxens hineinbegeben müssen, um das Boxen zu verstehen. Denn diese bestehe nicht »aus einer endlichen Summe versteckter Informationen, sprachlich vermittelbarer Begriffe und normativer Modelle, die unabhängig von ihrer Umsetzung existieren, sondern aus einem diffusen Komplex aus Haltungen und Gesten«.72 Und die Ethnologin Judith Okely zeigt in ihrer ethnographischen Studie über Naturwahrnehmungen in der Normandie, wie sich ihre Sehgewohnheiten durch die langfristige Präsenz im Feld änderten und sie nach und nach die dort üblichen Sehweisen übernahm.73 Erst dadurch verstand sie, wie die Forschungsakteur/-innen Natur als Landschaft wahrnahmen. Ich erachte es daher als zentral, sich die körperlichen Handlungs- und Erfahrungsmuster des Forschungsfeldes anzueignen; und zwar im Miterleben sozialer Situationen und indem man das tut, was die Forschungsakteur/-innen auch tun. Denn »(l)earning to sense, and make meanings as others do thus involves us not simply observing what they do, but learning how to use all our sense and to participate in their worlds, on the terms of their embodied understandings.«74 Nur durch meine Teilnahme an den gemeinsamen Essensrunden in der Freizeitgruppe im Gefängnis lernte ich zu verstehen, wie der Geschmack von Rindergulasch und das Teilen dieser Mahlzeit der Fremdkontrolle des Gefängnislebens entgegenstand und von den Männern als ein Ausbruch aus den Restriktionen ihres Gefängnisalltags erfahren wurde. Und nur durch meine Teilnahme an organisierten Gruppenpilgerwanderungen lernte ich verstehen, welche Bedeutung das gemeinsame Gehen für die Pilger/-innen hatte. Die Erfahrung von Zugehörigkeit und Gemeinschaft war untrennbar mit der Praktik des Gehens verbunden, dem gemeinsamen Übernachten in Schlafsälen, der gegenseitigen Wundversorgungen. Der Ethnologe Michael Jackson konstatiert in Bezug auf seine eigene Teilnahme im Forschungsfeld: »[T]o participate bodily in practical tasks was a creative technique which often helped me grasp a sense of an activity by using my body as others did. This technique also helped me break my habit of seeking truth at the level of disembodied concepts and decontextualized sayings. To recognize embodidness of 71
72 73 74
Vgl. Hastrup, Kirsten/Peter Hervik: Introduction. In: Dies.: Social Experience and Anthropological Knowledge, London 1994, 1-12: 7. Leder: The absent body, 34. Okely, Judith: Fieldwork Embodied. In: The Sociological Review 55 (2007) 65-79, 73. Wacquant, Loïc: Leben für den Ring. Boxen im amerikanischen Ghetto, Konstanz 2003, 62f. Okely, Judith: Visualism and Landscape. Looking and Seeing in Normandy. In: ethnos 66 (2001) 99-120. Pink, Sarah: Doing Sensory Ethnography, London 2009, 72.
195
196
Barbara Sieferle
our Being-in-the-World is to discover a common ground where self and other are one. For using one’s body in the same way as others in the same environment, one finds oneself informed by an understanding which may then be interpreted according to one’s own custom or bent, yet which remains grounded in a field of practical activity and thereby remains constant with the experiences of those among whom one has lived.«75 An den Aktivitäten im Feld teilzunehmen heißt für mich allerdings nicht, wie dies Jackson anlegt, dass eigene und fremde Erfahrungen dadurch identisch werden. Ich nähere mich den körperlichen Handlungs- und Erfahrungsmustern, den praktischen Sinnzuschreibungen des Pilgerns zwar an. Doch unterscheiden sich diese immer durch Sozialisation, biographische Lebensläufe und damit unterschiedliche körperlich-materielle Dispositionen.76 Im methodischen Zugang zu den körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten erachte ich das Moment der Teilnahme als weitaus wichtiger als das der Beobachtung. Ich verstehe Teilnahme als eine langfristige und aktive Teilnahme an den Aktivitäten im Forschungsfeld. Der Ethnologe Gerd Spittler spricht dementsprechend von dichter Teilnahme77 , die Ethnologin Judith Okely von teilnehmender Erfahrung.78 Das heißt aber nicht, dass Beobachtungen vollkommen unbedeutend im Prozess ethnographischer Feldforschung und für die Methode der Teilnehmenden Beobachtung sind. Doch Beobachtungen können erst gewinnbringend eingesetzt werden, wenn die Forscher/-innen mit dem Feld vertraut sind und ein Gespür für die habitualisierten Handlungs- und Erfahrungsmuster des Felder entwickelt haben. Während die Rolle des/der Teilnehmer/-in auf sozialer Nähe und Vertrautheit beruht, so geht die Rolle des/der Beobachter/-in mit einer distanzierten Haltung gegenüber sozialen Situationen einher. Beobachter/-innen positionieren sich abseits des Geschehens. Sie beobachten aus der Entfernung.79 Sie formen den Gegenstand, die Situation, die Menschen, auf denen ihre Aufmerksamkeit liegt, bereits vor. Dadurch erscheint Beobachtung »als bewusste Hinwendung zu einem schon auserwählten Gegenstand« und »schafft eine Perspektive, die vom
75 76 77 78
79
Jackson: Knowledge of the Body, 340f. Kesselring, Rita: Moments of Dislocation. Why the Body Matters in Ethnographic Research. In: Basel Papers on Political Transformations 8 (2015) 3-24, 17. Spittler, Gerd: Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme. In: Zeitschrift für Ethnologie 126 (2001) 1-25. Okely, Judith: Anthropology and Autobiography. Participatory Experience and Embodied Knowledge. In: Okely. Judith/Callaway, Helen: Anthropology and Autobiography, London 1992, 1-28. Förster: Sehen und Beobachten, 475.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Ethnographen angelegt wird und sein Privileg bleibt«.80 Des Weiteren bleiben Beobachtungen auf sichtbare Tätigkeiten und Bewegungsabläufe beschränkt. Sie erschließen allenfalls das äußere Verhalten von Akteur/-innen, allerdings nicht inkorporierten Sinn des Handelns.81 Der Ethnologe Clifford Geertz macht dies in seinem prominenten Beispiel des Augenzwinkerns deutlich: Ich kann zwar beobachten, dass das Lid eines Menschen zuckt, aber damit habe ich nicht erfasst, ob er/sie damit sein Gegenüber anblinzelt und ihm/ihr eine geheime Botschaft sendet oder ob das Anblinzeln vielleicht doch eher eine Parodie des Augenzwinkerns darstellen soll.82 So konnte ich beim Pilgern zwar beobachten, dass Pilger/-innen während Pausen am Wegesrand die Augen schlossen, doch erst nachdem ich ein Gespür für die Forschungsakteur/-innen, die sozialen Kontexte und Situationen entwickelt hatte, konnte ich verstehen, dass sie beteten, meditierten oder sich auch einfach nur ausruhten. Durch meine aktive, intensive und langfristige Teilnahme in meinen Forschungsfeldern kam ich den körperlichen Dimensionen dieser Felder näher. Das heißt aber nicht, dass verbal-sprachliches Material dabei vollkommen unbedeutend für meinen Verstehensprozess war. Gerade in Situationen, die die Forschungsakteur/-innen als Krise erlebten, kam die eigene Körperlichkeit zur Sprache. Etwa bei Beinkrämpfen während des Pilgerns oder bei einer gewaltvollen Auseinandersetzung mit Mithäftlingen. Und Narrationen deuten auf die Erfahrungsweisen sozialer Wirklichkeiten hin Die Art und Weise des Sprechens über soziale Wirklichkeiten weist auf die Art und Weise der Erfahrung dieser Wirklichkeiten hin.83 Dabei muss allerdings mitbedacht werden, dass ein Unterschied besteht zwischen körperlichen Handlungs- und Erfahrungsmustern und dem Sprechen über diese Handlungs- und Erfahrungsmuster. Die zeitliche Distanzierung führt immer zu Neukonstruktionen der gelebten Wirklichkeit. Diese werden zu erzählter Wirklichkeit.84 Für die kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Analyse der körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten sind Gespräche meines Erachtens nur nutzbar, wenn sie mit Teilnahme kombiniert werden. Allein durch Gespräche auf die körperlichen Dimensionen des Pilgerns zu schießen währe in meinem Feld unzureichend gewesen. Ich wäre auf zentrale körperliche Aspekte nie aufmerksam geworden. So
80 81 82
83
84
Ebd., 475. Ebd., 471. Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur. In: Ders.: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt a.M. 1983, 7-43, 11ff. Jackson, Michael: Introduction. Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique. In: Ders. (Hg.): Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology, Bloomington 1996, 1-50, 39. Schmidt-Lauber: Grenzen der Narratologie, 147.
197
198
Barbara Sieferle
waren Momente der Kompetitivität, welche sich durch alle von mir begleiteten Pilgerwanderungen zogen, nie Gesprächsthema.85 Und im Gefängnis war Essen und Nahrung zwar ein häufiges Gesprächsthema, allerdings wurde der implizite Sinn – das mit dem Kochen und Essen einhergehende Gefühl der Freiheit – nie explizit thematisiert. In Gesprächen, die ich mit inhaftierten Männern führte, war die soziale Nähe und Vertrautheit mit der Lebenswelt Gefängnis, die ich durch meine langfristige Präsenz im Forschungsfeld aufgebaut hatte, von entscheidender Bedeutung. Erst dadurch konnte ich die Erzählungen der Männer nachvollziehen, kontextualisieren und verstehen.86
6.
Körper, Sprache und Methode. Abschließende Bemerkungen
Um die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten kultur- und gesellschaftswissenschaftlich zu erfassen und zu verstehen, erachte ich die Methode der Teilnehmenden Beobachtung als zentral. Insbesondere, wenn diese als langfristige, aktive und intensive Teilnahme an den Tätigkeiten des Feldes vollzogen wird. Erst durch die Aneignung körperlicher Handlungs- und Erfahrungsmuster des Feldes und die damit einhergehende Annäherung an die feldspezifischen körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten kann der kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Verstehensprozess beginnen. Dies gilt insbesondere für die nichtsprachlich verfassten Dimensionen sozialer Wirklichkeiten. Es gilt jedoch genauso für Forschungen, die sich nicht auf Körperlichkeit fokussieren. Ich stimme den Ethnolog/-innen Kirsten Hastrup und Peter Hervik zu, die schreiben: »There is no way to substitute a phone call for fieldwork; most of the relevant information is non-verbal and cannot be ›called up‹, but has to be experienced as performed. (…) [L]anguage events, or the eliciting of ›information‹, are but a fraction of what constitutes the material. That is one reason for emphasizing experience rather than dialogue as the starting point for the route to anthropological knowledge.«87 85
86
87
Sieferle, Barbara: Hierarchie, Konflikt und Konkurrenz. Kulturanthropologische Einblicke in die Kompetitivität des Pilgerns. In: Bürkert, Karin u.a. (Hg.): Auf den Spuren der Konkurrenz. Kultur und sozialwissenschaftliche Perspektiven, Münster 2019, 117-129. Die empirische Materialerhebung, die durch die Methode der Teilnehmenden Beobachtung gewonnen wird, basiert auf dem Verfassen von sogenannten Feldnotizen (vgl. Emerson, Robert M./Fretz, Rachel I./Shaw, Linda L.: Writing Ethnographic Fieldnotes. Second Edition. Chicago 2011). Der/die Forscher/-in verfasst nach ihrer Teilnahme an Feldaktivitäten Teilnahmeprotokolle. Diese wiederum bilden die Basis der Materialauswertung. Für die Frage, wie anhand von Datenmaterial auf die körperlichen Dimensionen sozialer Wirklichkeiten geschlossen werden kann vgl. Sieferle, Barbara: Teilnehmen – Erfahren – Verstehen. Ein methodischer Zugang zur Körperlichkeit soziokultureller Wirklichkeiten. In: Zeitschrift für Volkskunde 115 (2019b) 27-49. Hastrup/Hervik: Introduction, 3, 6.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Literatur Abraham, Anke: Der Körper im biographischen Kontext. Ein Wissenssoziologischer Beitrag, Wiesbaden 2002. Asad, Talal: Remarks on the anthropology of the body. In: Coakley, Sarah (Hg.): Religion and the body, Cambridge 1997, 42-53. Bereswill, Mechthild: Männlichkeit und Gewalt. Empirische Einsichten und theoretische Reflexionen über Gewalt zwischen Männern im Gefängnis. In: Feministische Studien 24 (2006) 242-255. Binder, Beate/Göttsch, Silke/Kaschuba, Wolfgang/Vanja, Konrad (Hg.): Ort. Arbeit. Körper. Ethnografie Europäischer Modernen. Münster 2005. Bloch, Maurice: Language, Anthropology, and Cognitive Science. In: Man, New Series 26 (1991) 183198. Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. 1987. Brednich, Rolf/Schneider, Annette/Werner, Ute (Hg.): Natur – Kultur. Volkskundliche Perspektiven auf Menschen und Umwelt, Münster 2001. Bruner, Edward: Experience and its expressions. In: Turner, Victor/Bruner, Edward (Hg.): The Anthropology of Experience, Chicago 1986, 3-30. Chamberlen, Anastasia: Embodying Punishment. Emotions, Identities, and Lived Experiences in Women’s Prisons, Oxford 2018. Crossley, Nick: Research Embodiment by Way of ›body technique‹. In: Shilling, Chris (Hg.): Embodying Sociology. Retrospect, Progress and Prospects, Malden 2007, 80-94. Csordas, Thomas: Introduction. The body as representation and being-in-the-word. In: Dies. (Hg.): Embodiment and experience. The existential ground of culture and self, Cambridge 2003 [1994], 1-24. Csordas, Thomas: The Body’s Career in Anthropology. In: Moore, Henrietta (Hg.): Anthropological Theory Today Cambridge (2003) 172-205. Csordas, Thomas: Embodiment as a paradigm for anthropology. In: Ethos 18 (1990) 5-47, 1. Douglas, Mary: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur, Frankfurt a.M. 1986 [1970], 99-123. Duden, Barbara: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1991 [1987]. Eisch-Angus, Katharina: Erkundungen und Zugänge I. Feldforschung. Wie man zu Material kommt. In: Löffler, Klara (Hg.): Dazwischen. Zur Spezifik der Empirien in der Volkskunde. Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Wien 1998, Wien 2001, 27-46. Emerson, Robert M./Fretz, Rachel I./Shaw, Linda L.: Writing Ethnographic Fieldnotes. Second Edition, Chicago 2011.
199
200
Barbara Sieferle
Förster, Till: Sehen und Beobachten. Ethnographie nach der Postmoderne. Sozialer Sinn 3 (2001) 459-485. Fuchs, Thomas: Was ist Erfahrung? In: Hauskeller, Michael (Hg.): Die Kunst der Wahrnehmung. Beiträge zu einer Philosophie der sinnlichen Erkenntnis, Zug/Schweig 2003, 69-87. Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur. In: Ders.: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt a.M. 1983, 7-43. Goffman, Erving: Über Feldforschung. In: Knoblauch, Hubert: Kommunikative Lebenswelten. Zur Ethnographie einer geschwätzigen Gesellschaft, Konstanz 1997, 261-269. Gugutzer, Robert: body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports, Bielefeld 2006. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 5 2005. Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers, Bielefeld 2004. Hastrup, Kirsten: Anthropological Knowledge Incorporated. In: Hastrup, Kirsten/Hervik, Peter: Social Experience and Anthropological Knowledge, London 1994, 224-240. Hastrup, Kirsten/Hervik, Peter: Introduction. In: Dies.: Social Experience and Anthropological Knowledge, London 1994, 1-12. Hillebrandt, Frank: Soziologische Praxistheorien. Eine Einführung, Wiesbaden 2014. Hirschauer, Stefan: Ethnographisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen. Zu einer Methodologie der Beschreibung. In: Zeitschrift für Soziologie 30 (2001) 429-451. Hörning, Karl/Reuter, Julia (Hg.): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis, Bielefeld 2004. Jackson, Michael: Introduction. Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique. In: Dies. (Hg.): Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology, Bloomington 1996, 1-50. Jackson, Michael: Knowledge of the Body. In: Man 18 (1983) 327-345. Jeggle, Utz: Zur Geschichte der Feldforschung in der Volkskunde. In: Dies. (Hg.): Feldforschung. Qualitative Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, 1146. Jeggle, Utz/Korff, Gottfried/Scharfe, Martin/Warneken, Bernd Jürgen (Hg.): Volkskultur in der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung, Reinbeck bei Hamburg 1986. Keller, Reiner/Meuser, Michael: Wissen des Körpers – Wissen vom Körper. Körper- und Wissenssoziologische Erkundungen. In: Dies. (Hg.): Körperwissen, Wiesbaden 2011, 9-27. Kesselring, Rita: Moments of Dislocation. Why the Body Matters in Ethnographic Research. In: Basel Papers on Political Transformations 8 (2015) 3-24. Leder, Drew: The absent body, Chicago 1990.
Die Körperlichkeit sozialer Wirklichkeiten
Matter, Max (Hg.): Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung, N.F. 31 (1996). Mauss, Marcel: Die Techniken des Körpers. In: Ders.: Soziologie und Anthropologie. Bd. 2, München 1975 [1934], 199-220 (vorgetragen vor der Société de Psychologie am 17.5.1934; zuerst erschienen in: Journal de Psychologie Normale et Patholoque 32 (1935) 271-293). Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie und Wahrnehmung. Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe von 1966, Berlin 2008 [1945]. Meuser, Michael: Körper und Sozialität. Zur handlungstheoretischen Fundierung einer Soziologie des Körpers. In: Hahn, Kornelia/Meuser, Michael (Hg.): Körperrepräsentationen. Die Ordnung des Sozialen und der Körper, Konstanz 2002, 1944. Neckel, Sighard: Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2004. Okely, Judith: Fieldwork Embodied. In: The Sociological Review 55 (2007) 65-79. Okely, Judith: Visualism and Landscape. Looking and Seeing in Normandy. In: ethnos 66 (2001) 99-120. Okely, Judith: Anthropology and Autobiography. Participatory Experience and Embodied Knowledge. In: Okely. Judith/Callaway, Helen: Anthropology and Autobiography, London 1992, 1-28. Petersen, Katrin: Beobachten. Überlegungen zur Systematisierung einer »alltäglichen Kompetenz«. In: Vokus. Volkskundlich-kulturwissenschaftliche Schriften 17 (2007) 61-79. Pink, Sarah: Doing Sensory Ethnography, London 2009. Platz, Theresa: Anthropologie des Körpers. Vom Körper als Objekt zum Leib als Subjekt von Kultur, Berlin 2006. Polanyi, Michael: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, London 1998 [1958]. Polanyi, Michael: Implizites Wissen, Frankfurt a.M. 1985. Reckwitz, Andreas: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive. In: Zeitschrift für Soziologie 32 (2003) 282-301. Schatzki, Theodor/Knorr Cretina, Karin/von Savigny, Eike (Hg.): The Practice Turn in Contemporary Theory, London 2001. Scheer, Monique/Eitler, Pascal: Emotionengeschichte als Körpergeschichte. Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 35 (2012) 282-313. Scheper-Hughes, Nancy/Lock, Margaret: The Mindful Body. A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. In: Medical Anthropology Quarterly 1 (1987) 641. Schmidt, Robert: Soziologie der Praktiken. Konzeptionelle Studien und empirische Analysen, Berlin 2012.
201
202
Barbara Sieferle
Schmidt-Lauber, Brigitta: Orte von Dauer. Der Feldforschungsbegriff der Europäischen Ethnologie in der Kritik. In: Windmüller, Sonja u.a. (Hg.): Kultur – Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissenschaft, Berlin 2009, 237-259. Schmidt-Lauber, Brigitta: Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Göttsch, Silke/Lehmann, Albrecht (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie, Berlin 2 2007, 219-248. Schmidt-Lauber, Brigitta: Grenzen der Narratologie. Alltagskultur(forschung) jenseits des Erzählens. In: Hengartner, Thomas/Schmidt-Lauber, Brigitta (Hg.): Leben – Erzählen. Beiträge zur Erzähl- und Biographieforschung, Hamburg 2005. Schwibbe, Gudrun: Wahrgenommen. Die sinnliche Erfahrung der Stadt, Münster 2002. Sieferle, Barbara: Hierarchie, Konflikt und Konkurrenz. Kulturanthropologische Einblicke in die Kompetitivität des Pilgerns. In: Bürkert, Karin u.a. (Hg.): Auf den Spuren der Konkurrenz. Kultur und sozialwissenschaftliche Perspektiven, Münster 2019, 117-129. Sieferle, Barbara: Teilnehmen – Erfahren – Verstehen. Ein methodischer Zugang zur Körperlichkeit soziokultureller Wirklichkeiten. In: Zeitschrift für Volkskunde 115 (2019) 27-49. Sieferle, Barbara: Alltag nach der Haft. Kulturanthropologische Annäherungen. In: Volkskunde in Rheinland-Pfalz 33 (2018) 38-53. Sieferle, Barbara: Zu Fuß nach Mariazell. Ethnographie über die Körperlichkeit des Pilgerns, Münster 2017. Spittler, Gerd: Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme. In: Zeitschrift für Ethnologie 126 (2001) 1-25. Verheyen, Nina: Die Erfindung der Leistung, München 2018. Wacquant, Loïc: Leben für den Ring. Boxen im amerikanischen Ghetto, Konstanz 2003.
»Oh look, bionic people!« Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf prothetisierte Körper Carolin Ruther
1.
Einleitung
Seit einigen Jahren bestimmen Hochleistungssportler wie Markus Rehm oder Oscar Pistorius in der Öffentlichkeit das Bild, wenn von Beinprothesen und ihren Trägern bzw. Trägerinnen die Rede ist. Unter dem Stichwort human enhancement rückt dabei nicht die Einschränkung von Möglichkeiten zum selbstbestimmten Leben in den Fokus des Interesses, sondern die vermeintliche Optimierung der körperlichen Leistung durch technische Mittel.1 Postuliert wird die These, dass Mensch und Medizintechnik mithilfe hochmoderner Prothesen zunehmend miteinander verschmelzen und die fortschreitend technisierten, post-modernen Gesellschaften immer häufiger mit Grenzfällen des Menschlichen oder Posthumanen konfrontiert werden.2 Wie die österreichische Kulturwissenschaftlerin Karin Harrasser betont, geht damit ein Wandel der Ideen von Körperlichkeit einher, indem Eingriffe in und um den menschlichen Körper nicht länger als notwendige Kompensation von Defiziten begriffen werden, sondern als wünschenswerte Optimierung und Steigerung.3 Ebenso wandelt sich damit verbunden das bisher verbreitete kulturelle Konzept der Prothese, die sich von einem technischen Ersatzstück für fehlende Körperteile
1
2 3
Vgl. Cöln, Christoph: Mit der Prothese in den Kampf der Maschinen. In: Die Welt, 06.09.2014, online unter: https://www.welt.de/print/die_welt/sport/article131960614/Mit-der-Prothesein-den-Kampf-der-Maschinen.html (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Lewis, Tim: Is It Fair for Blade Runner Oscar Pistorius to Run in London Olympics? In: The Guardian, 31.07.2011, online unter: www.theguardian.com/sport/2011/jul/31/oscar-pistorius-should-he-compete (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Vgl. Schneider, Werner: Der Prothesen-Körper als gesellschaftliches Grenzproblem. In: Schroer, Markus (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M. 2005, 371-398, hier: 373. Vgl. Harrasser, Karin: Körper 2.0. Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen, Bielefeld 2013.
204
Carolin Ruther
zunehmend zum post-modernen Konzept eines hybriden Technofakts transformiert, in welchem sich die herkömmlichen grenzziehenden Unterscheidungen zwischen menschlich/nicht-menschlich und lebendig/nicht-lebendig verflüssigen.4 So schreibt die irische Philosophin Luna Dolezal beispielsweise: »Surpassing its meaning in a medical context of an artificial limb or implement that is attached to the body in order to restore or replace a bodily lack due to illness, defect, accident or disability, prosthesis has come to signify augmentation, enhancement, and a posthuman fascination with cyborg bodies.«5 Die Figur des Cyborg im Sinne eines Hybridwesens aus Mensch und Maschine wird bei gegenwärtigen Debatten um moderne Prothesen oftmals genannt und in einer genealogischen Perspektive als unausweichliche Konsequenz und Weiterentwicklung des Menschen dargestellt, die vor allem dank neuester Fortschritte im Bereich Prothetik als realisierbar erscheint.6 Die Inszenierung als Maschinen-Mensch bzw. Cyborg wird dabei besonders an verschiedenen Werbeaufnahmen des doppelseitig unterschenkelamputierten, südafrikanischen Paralympics-Athleten Oscar Pistorius deutlich, die während des Höhepunkts seiner Sportkarriere zwischen 2008 und 2012 entstanden sind. So beispielsweise in der Parfümwerbung A*Men von Thierry Mugler (Abb. 1, Abb. 2), wo er mit silbernen Sportprothesen, enganliegender silberner Hose und durchtrainiertem, nacktem Oberkörper abgebildet wird, unter anderem heroisch bzw. göttergleich auf einem Thron sitzend. Pistorius wird hier als futuristischer Superheld dargestellt, seine glänzenden Karbonfeder-Prothesen verleihen ihm etwas Übermenschliches, sie verweisen weniger auf die fehlenden Gliedmaßen als körperlichen Mangel, sondern vielmehr scheinen sie Pistorius’ Körper aufzurüsten.7 Pistorius wird vom Betrachter in diesen Werbeanzeigen nicht als körperbehindert wahrgenommen, sondern aufgrund seiner Prothesen als technisch modifizierter Übermensch. Das Superhelden-Motiv wurde in ähnlicher Weise auch bei Werbeaufnahmen für die 2012 in London stattfindenden Paralympics von dem britischen TV-Sender Channel 4 aufgegriffen (Abb. 3). Auf großen Werbebannern wurden mehrere Paralympics-Athletinnen und 4 5 6
7
Vgl. Schneider: Prothesen-Körper, 373. Dolezal, Luna: Representing Posthuman Embodiment: Considering Disability and the Case of Aimee Mullins. In: Women’s Studies 46 (2017) 60-75, 65. Vgl. Orland, Barbara: Wo hören Körper auf und fängt Technik an? Historische Anmerkungen zu posthumanistischen Problemen. In: Dies. (Hg.): Artifizielle Körper – Lebendige Technik. Technische Modellierungen des Körpers in historischer Perspektive, Zürich 2005, 9-43. Howe, P. David: Cyborg and supercrip: The Paralympics technology and the (dis)empowerment of disabled athletes. In: Sociology 45 (2011) 868-882. Vgl. Schneider, Eva: Die mediale Inszenierung von Oscar Pistorius als futuristischen Superhelden, 05.06.2014, online unter: https://www.anthropofakte.de/essays/die-mediale-inszenierung-von-oscar-pistorius-als-futuristischen-superhelden (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Tamari, Tomoko: Body Image and Prosthetic Aesthetics: Disability, Technology and Paralympic Culture. In: Body & Society 23(2) (2017) 25-56, 36f.
»Oh look, bionic people!«
Abbildung 1 und 2: Oscar Pistorius in der Parfümwerbung A*Men von Thierry Mugler, 2011, fotografiert von Ali Mahdavi.
Athleten mit unterschiedlichen Behinderungen und medizintechnischen Hilfsmitteln dargestellt, wobei die Sportler/-innen als eine Art Superheldengruppe inszeniert werden, die in der Darstellung vor allem an den US-amerikanischen Action- und Science-Fiction-Spielfilm The Avengers von Marvel erinnert (Abb.4).8 Die selbst beinamputierte US-Medienwissenschaftlerin Vivian Sobchack spricht angesichts derartiger medialer Darstellungen von einem gegenwärtig herrschenden Technofetischismus, der jedoch mit der Realität des tagtäglichen Lebens als Prothesenträger/-in nur wenig zu tun hat.9 Und tatsächlich sind der Großteil der Menschen, die von einer Amputation betroffen sind, nicht junge, durchtrainierte Athleten wie Oscar Pistorius oder Markus Rehm, sondern ältere Personen ab 60 Jahren, denen infolge von arteriellen Verschlüssen oder Diabetes Gliedmaßen amputiert werden müssen.10
8 9
10
Vgl. Harrasser: Körper 2.0, 35f. Vgl. Sobchack, Vivian: A Leg To Stand On: Prosthetics, Metaphor, and Materiality. In: Smith, Marquard (Hg.): The Prosthetic Impulse: From A Posthuman Present To A Biocultural Future, Cambridge 2006, 17-41, 21. Vgl. Mitterhuber, Thomas: Amputation und Prothese. Artikel auf der Homepage MyHandicap, 07/2012, online unter: www.myhandicap.de/prothese-amputation.html (Letzter Zugriff am 18.01.2020).
205
206
Carolin Ruther
Abbildung 3: Kampagne Meet the Superhumans des TV-Senders Channel 4 anlässlich der Paralympics 2012 in London.
Wie sich der Umgang mit einer Prothese für diese Personen gestaltet, soll im vorliegenden Beitrag näher beleuchtet werden. Dabei wird vor allem den beiden folgenden Fragen nachgegangen: Wie nehmen Menschen, die eine Gliedmaßenamputation erlebt haben, ihre neuen, veränderten und prothetisierten Körper selbst wahr? Und inwiefern beeinflussen gesellschaftlich verbreitete Vorstellungen von Behinderung einerseits und moderner Prothetik andererseits die tagtägliche Interaktion mit dem medizintechnischen Artefakt? Zentrale Datengrundlage liefern in diesem Zusammenhang qualitative Interviews mit Beinprothesenträgerinnen und –trägern unterschiedlichen Alters sowie Feld-forschungen bei drei Selbsthilfegruppen für Prothesenträger/-innen, in einer Rehaklinik und einem Orthopädietechnikzentrum, die ich zwischen 2013 und 2016 im Rahmen einer ethnographischen Studie durchgeführt habe.11 Bevor ich jedoch genauer auf die oben genannten Fragen und mein empirisches Material eingehe, soll zunächst dargelegt werden, wie sich prothetisierte Körper in theoretischer Hinsicht aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive analysieren lassen.
11
Vgl. Ruther, Carolin: Alltag mit Prothese. Zum Leben mit moderner Medizintechnologie nach einer Beinamputation, Bielefeld 2018.
»Oh look, bionic people!«
Abbildung 4: The Avengers von Marvel
2.
Körper, Leib und Prothese: Theoretische Perspektiven auf das Leben mit moderner Medizintechnologie
Nach einer Gliedmaßenamputation stehen Menschen vor der Herausforderung, mit der Prothese ein fremdes, medizintechnisches Artefakt in ihre körperliche Wahrnehmung zu integrieren, um diese im besten Fall als Teil von sich selbst empfinden zu können. Hierbei handelt es sich allerdings um einen komplexen Prozess, für den ich im Rahmen meiner ethnographischen Studie als theoretischanalytischen Überbegriff den Begriff technogenes Embodiment eingeführt habe.12 Der Begriff Embodiment stammt aus der kultur- bzw. sozialwissenschaftlichen Körperforschung, wird im Deutschen meist mit Verkörperung übersetzt und bezeichnet zwei Dimensionen menschlicher Existenz, die untrennbar miteinander verbunden sind: ihre Körperlichkeit und ihre Leiblichkeit. Mit Körperlichkeit ist dabei der in der Fremdwahrnehmung gegebene, sicht- und tastbare Körper eines Menschen in seiner materiellen Dimension gemeint, während sich Leiblichkeit auf den in der Selbstwahrnehmung gegebenen Körper, das Sich-Selbst-Spüren bezieht, aber auch auf das leiblich-affektive Betroffensein von etwas oder jemandem.13 Menschen verfügen in diesem Sinne nicht nur über einen äußerlich
12 13
Vgl. Ebd. Vgl. Gugutzer, Robert: Verkörperungen des Sozialen. Neophänomenologische Grundlagen und soziologische Analysen, Bielefeld 2012, 17f.
207
208
Carolin Ruther
sichtbaren Körper, über den soziale Differenzierungs- und Klassifizierungsprozesse ablaufen, sondern sie verfügen gleichermaßen über eine innere, leibliche Dimension, die das je individuelle Spüren und Empfinden des eigenen Körpers bzw. die Wahrnehmung von Welt betrifft. Wir sind in unserem Alltagsleben somit stets ein KörperLeib, wobei das leibliche Spüren das körperliche Tun beeinflusst und umgekehrt und das Verhältnis von Körper und Leib zueinander historischkulturell variabel ist.14 Embodiment als Überbegriff für die Dualität von Körper und Leib kann in diesem Sinne als theoretisch-analytisches Instrumentarium genutzt werden, um am Beispiel von Prothesenträgerinnen und –trägern sowohl die körperlichen als auch leiblichen Dimensionen eines Lebens mit Prothese in ihrer wechselseitigen Verschränkung sowie in ihrem Verhältnis zu soziokulturellen Rahmenbedingungen zu erfassen. Der von mir gewählte Zusatz technogen bezieht sich damit verbunden auf das komplexe Zusammenwirken von Körper, Leib und medizintechnischem Artefakt, das heißt die körperlich-leibliche Integration von Prothesen im Sinne technogenen Embodiments stellt einen dynamischen Prozess dar, weshalb auch eher von technogenem Embodying gesprochen werden sollte. Um diese Dynamik bzw. die praktische Herstellung von Mensch-MedizintechnikBeziehungen näher analysieren zu können, bietet es sich daher an, in theoretischer Hinsicht ergänzend zur Medizin- und Körperanthropologie auch auf praxistheoretische Konzepte aus dem Bereich der Science and Technology Studies sowie der Post- und Neophänomenologie zurückzugreifen. Sowohl Vertreter/-innen der Science and Technology Studies als auch der Post- und Neophänomenologie verstehen technische bzw. materielle Objekte nicht ausschließlich als passive Instrumente, die sich beliebig manipulieren und mit Bedeutung aufladen lassen, sondern vielmehr schreiben sie diesen ein aktives praktisches Wirken im Sinne von material agency zu.15 Materielle Objekte wie beispielsweise Prothesen werden als aktive Partizipanden des Tuns konzipiert, die zusammen mit Menschen an sozialen Interaktionen mitwirken.16 Auf diese Weise kann genauer analysiert werden, wie eine funktionierende Beziehung zwischen Mensch und medizintechnischem Artefakt hergestellt wird und wie Körper und Prothese insbesondere in ihrer materiellen Dimension miteinander interagieren. Mithilfe neo- bzw. leibphänomenologischer Ansätze wiederum lässt sich schließlich herausarbeiten, wie 14 15
16
Vgl. Ebd., 13. Vgl. Beck, Stefan/Niewöhner, Jörg/Sørensen, Estrid (Hg.): Science and Technology Studies. Eine sozialanthropologische Einführung, Bielefeld 2012. Rosenberger, Robert/Verbeek, Peter-Paul (Hg.): Postphenomenological Investigations. Essays on Human-Technology Relations, London 2015. Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen. Vgl. Beck/Niewöhner/Sørensen: Science and Technology Studies. Hirschauer, Stefan: Praktiken und ihre Körper. Über materielle Partizipanden des Tuns. In: Hörning, Karl H./Reuter, Julia (Hg.): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und Praxis, Bielefeld 2004, 73-92.
»Oh look, bionic people!«
das Tragen von Prothesen das leibliche Empfinden bzw. das leibliche Spüren der betreffenden Personen beeinflusst. Prothesen stellen medizintechnische Artefakte dar, die eng am Körper angebracht werden und somit den Körper selbst und die Beziehung, die man zu ihm hat, transformieren. Insbesondere die physisch-haptische Präsenz von Prothesen, das heißt deren sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten wie ihre Oberflächenbeschaffenheit, Geräusche oder Gerüche haben ebenfalls Einfluss auf technogenes Embodiment, also auf ihre körperlich-leibliche Integration durch die betreffenden Individuen. Daneben beeinflussen aber auch die Reaktionen nahestehender sowie fremder Personen oder soziokulturelle Faktoren wie verbreitete Vorstellungen von Behinderung die Beziehung, die Menschen nach einer Beinamputation zu ihrer Prothese eingehen. Besonders die theoretische Herangehensweise der Disablity Studies bietet sich in diesem Zusammenhang an, genauer zu analysieren, wie Prothesenträgerinnen und –träger mit dem Thema Behinderung in ihrem tagtäglichen Leben umgehen und wie dies wiederum die körperlich-leibliche Integration von Prothesen beeinflusst. Vertreter/-innen der Disability Studies kritisieren dabei vor allem das sogenannte medizinische Modell von Behinderung, welches diese in einem biologischen Sinne in erster Linie mit körperlicher/kognitiver Einschränkung gleichsetzt und als defizitären, leidvollen Zustand deutet.17 Demgegenüber wird betont, dass es sich bei Behinderung vielmehr um ein Produkt sozialer Organisation handle, das heißt »[…] Menschen werden nicht auf Grund gesundheitlicher Beeinträchtigung behindert, sondern durch das soziale System, das Barrieren gegen ihre Partizipation errichtet.«18 Behinderung als soziokulturelle Kategorie und gelebte, verkörperte Erfahrung zugleich unterliegt damit verbunden historischen Wandlungsprozessen und wird in Diskursen und Praktiken immer erst als solche hervorgebracht. Auch Prothesen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle bei der tagtäglichen Konstruktion bzw. Dekonstruktion von Behinderung, denn wie die beiden niederländischen Disability Forscherinnen Maartje Hoogsteyns und Hilje van der Horst betonen, sind »[…] technical aids […], in fact, interwined with people and their lives in many complex ways […]. They are part of the way people experience their body, the activities they can perform, the way they (can) deal with their social and material environment and the way they are looked at by themselves and others. Consequently, technical aids play an important part in the construction of what is to be (dis)abled and to related mechanisms of in- and exclusion.«19
17 18 19
Vgl. Waldschmidt, Anne: Disability Studies: individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? In: Psychologie und Gesellschaftskritik 29 (2005) 9-31. Ebd., 18. Hoogsteyns, Maartje/van der Horst, Hilje: Wearing the arm (or not): Reconceptualising notions of in- and exclusion in Disability Studies. In: Scandinavian Journal of Disability Research 15 (2013) 58-69, 59.
209
210
Carolin Ruther
Wie sich nun das Leben mit einer Prothese nach einer Beinamputation gestaltet und wie es den betreffenden Personen gelingt, das medizintechnische Artefakt im Sinne technogenen Embodiments in ihre körperlich-leibliche Wahrnehmung zu integrieren, soll in den nachfolgenden Kapiteln anhand einzelner empirischer Beispiele schließlich genauer dargestellt werden.
3.
Körper in der Krise: Amputationserfahrungen und prothetische Erstversorgung
Eine Amputation kann als krisenhaftes Erlebnis und Transformationserfahrung auf verschiedenen Ebenen verstanden werden. Durch dieses Ereignis werden die betreffenden Individuen nicht nur aus ihrem bisherigen Leben, aus ihrem gewohnten Alltag gerissen, sondern in den meisten Fällen tritt auch eine Entfremdung vom eigenen Körper ein, die durch das plötzliche Fehlen von Gliedmaßen bedingt wird. Die bloße Abwesenheit eines Körperteils führt bei den betreffenden Personen zur Infragestellung des eigenen Selbstbildes und der bisher gelebten Identität, zumal sie noch im Krankenhaus aufgrund ihrer veränderten körperlichen Erscheinung oftmals zum ersten Mal mit der Zuschreibung behindert konfrontiert werden. Deutlich wird dies exemplarisch an der Aussage eines 68-jährigen Oberschenkelprothesenträgers, der schildert: »Du wachst aus der Narkose auf und weißt, dass du behindert bist. Das merkst du daran, weil es dein Umfeld erkennt.«20 Als allgemein gültige, gesellschaftliche Normalitätsvorstellung gilt der unversehrte Gesundheitsund Leistungskörper.21 Der amputierte Körper weicht von dieser Vorstellung ab und wird dementsprechend als anormal, krank und/oder behindert klassifiziert. Speziell durch die Versorgung mit Prothesen soll Menschen nach einer Beinamputation nicht nur ein gewisses Maß an Mobilität zurückgegeben werden, sondern ebenso sollen deren Körper auf diese Weise wieder vollständiger, in visueller Hinsicht bzw. im gesellschaftlichen Verständnis normaler und somit letztlich weniger behindert gemacht werden. Dabei gestaltet sich der Umgang mit Prothesen nach einer Amputation jedoch alles andere als einfach und wird von den betroffenen Personen anfangs vor allem als schmerzhaftes Erlebnis bezeichnet, da Kunststoff auf die sensible Haut des Beinstumpfes trifft. Deutlich wird dies an der Aussage eines 52-jährigen Prothesenträgers, dem infolge eines Motorradunfalls der linke Oberschenkel amputiert werden musste und der sich an den Erstkontakt mit der Prothese nach der Amputation Folgendermaßen erinnert: »Ich hab‹ gedacht ›Da kannst nie laufen mit so nem Teil‹, das hat gedrückt und hat weh getan […]. Das
20 21
Gespräch während einer Prothesenanpassung im Orthopädietechnikzentrum, 18.02.2014. Vgl. Dederich, Markus: Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies, Bielefeld 2 2012, 66.
»Oh look, bionic people!«
war eher deprimierend […]. Es war zwar schön, dass wieder mal in der Senkrechten gestanden bist, […] das schon, aber ich hab‹ gedacht ›Da kannst nie laufen mit so nem Teil‹.«22 Um eine Prothese nicht nur nutzen, sondern auch mit dieser leben zu können, muss jedoch eine regelrecht intime Beziehung zwischen Mensch und Medizintechnik bzw. im Sinne Robert Gugutzers eine emotionale Ding-Person-Beziehung etabliert werden.23 Dies wird allerdings dadurch erschwert, dass die sogenannte Interimsprothese, mit der Personen nach einer Amputation für die ersten drei bis sechs Monate versorgt werden, nicht wie ein echtes Bein aussieht oder funktioniert, da zur besseren Einstellung meist auf eine hautfarbene Verkleidung verzichtet und die Interimsprothese oftmals mit steifen Gelenken ausgestattet wird, um Stürze zu verhindern. Darüber hinaus fehlt die sogenannte sensible Rückkopplung, das heißt Prothesenträger/-innen spüren nicht, wo im Raum oder auf welchem Untergrund sie mit ihrer Beinprothese stehen, das Gefühl endet am Beinstumpf. Sie müssen daher bei vorher selbstverständlichen Körperbewegungen wie Sitzen, Stehen, Gehen oder Treppensteigen konzentriert über jeden einzelnen Schritt, über jede Muskel-anspannung nachdenken. Der prothetisierte Körper rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wobei diese spezifische Wahrnehmung des Körpers im Sinne des US-Philosophen Drew Leder auch als dys-appearance bezeichnet werden kann.24 Damit ist gemeint, dass die meisten Menschen ihren Körper im Alltagsleben nicht bewusst als Körper wahrnehmen, er ist sozusagen abwesend und wird als selbstverständlich und funktionierend vorausgesetzt. Erst durch Faktoren wie Krankheit oder eben Amputation und Prothesengebrauch rückt er aufgrund seines Nichtfunktionierens in den Fokus der Aufmerksamkeit. Prothese-Tragen kann damit verbunden auch als Set an spezifischen KörperTechniken25 verstanden werden, die von Menschen nach einer Beinamputation erlernt und internalisiert werden müssen, damit sich Prothese-Tragen von einer körperlichen Aneignungsphase in ein verinnerlichtes Leibkönnen transformieren kann.26 Dies erfordert allerdings einen langwierigen Trainingsprozess, bei dem zunächst der amputierte Körper mittels spezifischer Beinstumpfgymnastik sowie Fitnessübungen zum Muskel- und Gleichgewichtsaufbau insbesondere in der Rehaklinik aktiv geformt, abgehärtet und auf diese Weise prothesenkompatibel gemacht
22 23 24 25 26
Interview vom 16.01.2015. Vgl. Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen, 129. Vgl. Leder, Drew: The Absent Body, Chicago 1990, 84. Ich verwende bewusst die Schreibweise KörperTechniken, um auf das komplexe Zusammenspiel von menschlichem Körper und medizintechnischem Artefakt zu verweisen. Vgl. auch Kubes, Tanja A.: Living fieldwork – Feeling hostess. Leibliche Wahrnehmung als Erkenntnisinstrument. In: Arantes, Lydia M./Rieger, Elisa (Hg.): Ethnographien der Sinne. Wahrnehmung und Methode in empirisch-kulturwissenschaftlichen Forschungen, Bielefeld 2014, 111-127, hier: 119.
211
212
Carolin Ruther
werden muss. Zugleich wird das medizintechnische Artefakt vom Orthopädietechniker oder der Orthopädietechnikerin individuell an den Körper der jeweiligen Person angepasst. Sowohl der menschliche Körper als auch die Prothese erfahren somit eine Transformation in ihrer materiellen Dimension und müssen aufeinander abgestimmt werden. Dabei hängt es vor allem vom handwerklichen Können des Orthopädietechnikers bzw. der Orthopädietechnikerin ab, ob eine Person nach der Amputation ihre Prothese gerne trägt und in körperlich-leiblicher Hinsicht als Teil von sich selbst akzeptieren kann. Der Prozess der orthopädietechnischen Prothesenanpassung bedingt damit verbunden maßgeblich die Möglichkeiten bzw. Grenzen von technisiert erfahrbarer Körperlichkeit und Leiblichkeit im Sinne technogenen Embodiments.
4.
Medizintechnische Verkörperungen: Prothesenanpassung im Orthopädietechnikzentrum
Regelmäßige Besuche im Orthopädietechnikzentrum sind aus dem Leben von Prothesenträgerinnen und -trägern nicht mehr wegzudenken. Orthopädietechniker/innen werden zu wichtigen Vertrauenspersonen, es entwickelt sich eine körpernahe Beziehung im wörtlichen Sinne. Die orthopädietechnische Anpassung von Beinprothesen gestaltet sich dabei insgesamt als komplexer und langwieriger Prozess, der meist mehrere Stunden dauert und sich in der Regel über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate erstreckt. Die Hauptschwierigkeit für Orthopädietechniker/-innen besteht vor allem darin, handwerklich einen möglichst gutsitzenden Prothesenschaft anzufertigen, an dem die übrigen, industriell gefertigten Passteile wie mechanische oder mikroprozessorgesteuerte Prothesenkniegelenke, Wadenteile und Prothesenfüße angebracht werden können. Der Schaft ist die wichtigste Komponente einer Prothese, denn er ist die eigentliche Schnittstelle zwischen Mensch und medizintechnischem Artefakt. Passt der Schaft nicht, dann nützt das teuerste Prothesenpassteil darunter nichts. Zu Beginn jeder Prothesenanpassung geht es für Orthopädietechniker/-innen in diesem Zusammenhang zunächst vor allem um die visuelle und haptisch-taktile Erkundung des Körpers von Prothesenträgern/-innen, um das sinnliche Generieren von Körperwissen27 , indem diese den jeweiligen Beinstumpf intensiv abtasten, betrachten, dessen Länge und Umfang messen sowie vorhandene Druckstellen mit Lippenstift oder Edding markieren. Wie ich in diesem Zusammenhang während
27
Den Begriff Körperwissen verstehe ich im Sinne von Wissen über den Körper, das heißt als Wissen über die physische Beschaffenheit des Beinstumpfes, über die Muskulatur oder Knochenstruktur. Vgl. Keller, Reiner/Meuser, Michael: Wissen des Körpers – Wissen vom Körper. Körperund wissenssoziologische Erkundungen. In: Dies. (Hg.): Körperwissen, Wiesbaden 2011, 9-31.
»Oh look, bionic people!«
meiner Feldforschung im Orthopädietechnikzentrum zudem beobachten konnte, überprüfen Orthopädietechniker/-innen oftmals auch mit ihrem Handrücken die Hauttemperatur am Beinstumpf der jeweiligen Person, um etwaige Überbelastungen zu erspüren und den neuen Schaft dementsprechend weiter oder enger zu machen. Orthopädietechniker/-innen treten mit Prothesenträgern/-innen somit nicht nur in körperlichen und sinnlichen, sondern vor allem auch in leiblichen Kontakt, denn je nachdem, was sie selbst leiblich am Körper ihrer Kundinnen und Kunden wahrnehmen bzw. erspüren, ob sie die Hauttemperatur am Beinstumpf als zu warm oder zu kalt empfinden, stellen sie die Prothesenkomponenten neu ein. Im Sinne Robert Gugutzers kann hierbei auch von einer spürenden Verständigung als einer Form leiblichen Verstehens zwischen Orthopädietechniker/-in und Prothesenträger/-in gesprochen werden, womit eine Interaktion unter Anwesenden gemeint ist, »[…] die durch deren wechselseitige spürende Wahrnehmung gesteuert wird. In der spürenden Verständigung orientieren die Interaktionspartner ihr Handeln an dem, was sie vom Anderen an sich selbst leiblich wahrnehmen […].«28 Nach dem genauen Abtasten des Beinstumpfes wird schließlich ein Gipsabdruck erstellt, auf Basis dessen dann ein neuer Schaft angefertigt werden kann, an dem wiederum die restlichen Prothesenpassteile angebracht werden. Dabei soll der Prothesenschaft idealerweise so sitzen, dass die betreffende Person beim Laufen, Sitzen, Stehen etc. so wenig wie möglich über das medizintechnische Artefakt nachdenken muss, wenn sie die Prothese vergessen kann. Die Prothese soll gewissermaßen transparent werden und sich der direkten Aufmerksamkeit entziehen. Deutlich wird dies exemplarisch an der Aussage einer 42-jährigen Prothesenträgerin, die meint, dass eine Prothese bzw. der Schaft so sitzen muss, »[…] dass du das Gefühl hast, es isʼ letzten Endes ein Übergang, also, dass du nicht das Gefühl hast, es ist ein […] Klotz am Bein, sagʼ ich mal, oder ein […] Gegenstand, was nicht zu dir gehört, sondern wenn es gescheit gebaut ISʼ, dann vergisst du, dass du dort ʼne Prothese hast.«29 Die Anpassung eines möglichst bequem sitzenden Prothesenschaftes gestaltet sich allerdings in der Hinsicht als schwierig, dass Prothesenträger/-innen häufig nicht explizit durch verbale Sprache erklären können, weshalb der Schaft nicht gut sitzt, sie spüren einfach, dass es nicht passt. Es handelt sich um ein spezifisches leibliches Wissen30 , das nun irgendwie dem Orthopädietechniker bzw. der Orthopädie-technikerin erläutert werden muss. Dabei stehen insbesondere NeuProthesenträger/-innen vor dem Problem, dass sie gar nicht wissen können, wie
28 29 30
Vgl. Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen, 65. Interview vom 12.05.2014. Mit leiblichem Wissen bezeichne ich eine Wissensform, die »[…] ohne ein Nachdenken im situativen körperlichen Tun aktualisiert wird.« Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen, 67.
213
214
Carolin Ruther
sich eine gut oder schlecht sitzende Prothese anfühlen soll. Orthopädietechniker/in und Prothesenträger/-in müssen somit erst eine gemeinsame Sprache finden, um eine gute Prothesen- bzw. Schaftpassform aushandeln zu können. In diesem Zusammenhang spielen insbesondere Körperpraktiken im Sinne von doing body eine bedeutende Rolle, das heißt der Körper als Agens fungiert als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Orthopädietechniker/-in und Prothesenträger/-in. So müssen Prothesenträger/-innen mit der neu angepassten Prothese permanent im Orthopädietechnikzentrum auf- und abgehen, wobei sie vom Orthopädietechniker bzw. der Orthopädietechnikerin genau beobachtet werden. Auf diese Weise wird anhand der Körperhaltung und des Gesichtsausdrucks der jeweiligen Person der Tragekomfort des medizintechnischen Artefakts visuell erfasst, darüber hinaus demonstrieren Orthopädietechniker/-innen teilweise aber auch selbst durch Auf- und Abgehen beispielsweise das richtige Abrollen über den Prothesenfuß. Dieser Prozess wird schließlich so lange wiederholt, bis Prothesenträger/innen das Gefühl haben, dass die Prothese bzw. der Schaft gut sitzt, bis sich im Sinne Robert Gugutzers eine spürbare Gewissheit als Form leiblicher Erkenntnis einstellt und die betreffenden Individuen beim Laufen nicht mehr großartig über das medizintechnische Artefakt nachdenken müssen.31 In diesem Moment kann bei Prothesenträgern/-innen auch das Empfinden entstehen, mit dem medizintechnischen Artefakt regelrecht verschmolzen zu sein. Die Prothese wird nicht mehr länger als Fremdkörper erlebt, sondern im Sinne technogenen Embodiments als körperlich-leiblicher Teil von sich selbst. So schildert eine 66-jährige Prothesenträgerin beispielsweise, »[…] wenn alles passt, dann fühlʼ ich einfach, als wenn die zu mir gehört, als […] wenn das meins isʼ.«32 Ähnlich wie es Robert Gugutzer aus neophänomenologischer Perspektive für die Interaktion von Trendsportlern/-innen mit ihrem Sportgerät beschrieben hat, wachsen in dieser Situation dabei nicht Körper und Prothese zusammen, sondern vielmehr sind es der Leib und die Prothese, die miteinander verschmelzen, denn die räumliche Ausgedehntheit des Körpers endet unmittelbar an der Hautoberfläche bzw. am Beinstumpf, während sich der leibliche Raum über den Körperlichen hinaus erstrecken kann.33 Prothesen können sich jedoch auch als gnadenloser Interaktionspartner erweisen, der bestimmte Ansprüche an den jeweiligen Prothesenträger bzw. die jeweilige Prothesenträgerin stellt, indem es von diesen verlangt, ihr körperliches Verhalten und ihre Wahrnehmung auf bestimmte Bewegungsabläufe hin auszurichten.34 Bringt die betreffende Person nicht das nötige Balancegefühl oder die erforderliche Muskelanspannung in die Interaktion mit ein, dann kann es passieren, dass sich
31 32 33 34
Vgl. Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen, 66. Interview vom 08.09.2014. Vgl. Gugutzer: Verkörperungen des Sozialen, 130. Vgl. Ebd., 129.
»Oh look, bionic people!«
das medizintechnische Artefakt gegenüber dem jeweiligen Nutzer bzw. der Nutzerin dahingehend als widerständig verhält, indem es beim Laufen blockiert, schleift, hin- und her schlenkert etc. Die betreffende Person muss daraufhin körperlich auf das medizintechnische Artefakt eingehen und beispielsweise ihre Beckenkippung oder Fußstellung ändern, gleichzeitig interagiert sie damit verbunden aber auch leiblich mit der Prothese, indem sie ihre Kraft spürbar dosieren oder ihr Gleichgewicht spürbar verlagern muss.35 Die Interaktion zwischen Mensch und medizintechnischem Artefakt spielt sich somit nicht allein auf der Ebene des von außen wahrnehmbaren Körpers ab, sondern vor allem auch auf der Ebene des leiblichen Empfindens. Generell ist die körperlich-leibliche Verbundenheit mit der Prothese im Sinne technogenen Embodiments jedoch höchst relational, situationsbedingt und nach aktuellem Stand der Prothesentechnik immer nur zeitlich begrenzt möglich. ProtheseTragen führt früher oder später zu Hautirritationen oder Druckschmerzen, zudem bedingt beispielsweise auch Hitze im Sommer starkes Schwitzen im Schaft, wodurch ein süßlich-säuerlicher Geruch entsteht, der von Prothesenträgern/-innen insbesondere bei Interaktionen mit anderen Personen als äußerst unangenehm und peinlich empfunden wird. Die Prothese in ihrer Materialität rückt in diesen Momenten wieder ins Zentrum der sinnlichen Aufmerksamkeit, sie wird zum unliebsamen Ding, zum Fremdkörper, sie löst Frustration und Ärger aus. Zufrieden mit einer Prothese zu leben hängt letztlich aber nicht allein vom Tragekomfort des medizintechnischen Artefakts ab, sondern ebenso wirken sich gesellschaftlich vorherrschende Vorstellungen von Behinderung darauf aus, inwiefern es Menschen nach einer Beinamputation gelingt, sich positiv mit ihrem veränderten Körper und der Prothese zu identifizieren.
5.
Ambivalente Körper: Prothesenträger/-innen und die (De-)Konstruktion von Behinderung
Von verschiedenen Interviewpartnern/-innen wurde mir im Verlauf meiner Forschung immer wieder berichtet, dass sie seit ihrer Amputation den Eindruck haben, von außenstehenden Personen oftmals nicht mehr als ganze Menschen oder vollwertige Gesellschaftsmitglieder wahrgenommen zu werden. Das bedeutet, die sichtbare Abwesenheit von Gliedmaßen ist verbunden mit dem Absprechen sozialer Kompetenzen, was nach Ansicht des US-amerikanischen Disability Forschers To-
35
Vgl. Gugutzer, Robert: Leibliche Interaktion mit Dingen, Sachen und Halbdingen. Zur Entgrenzung des Sozialen (nicht nur) im Sport. In: Prinz, Sophia/Göbel, Hanna Katharina (Hg.): Die Sinnlichkeit des Sozialen. Wahrnehmung und materielle Kultur, Bielefeld 2015, 105-123, hier: 113.
215
216
Carolin Ruther
bin Siebers vor allem mit einer gegenwärtig vorherrschenden »ideology of ability«36 zusammenhängt, die in erster Linie über den unversehrten Körper definiert wird. Als behindert kategorisierte Menschen werden damit verbunden häufig als Fremde in der eigenen Gesellschaft angesehen, ihre verkörperte Differenz wird weniger als selbstverständliche Diversitätsdimension verstanden, sondern vielmehr dazu benutzt, sie als tragische, von Leid geprägte Figuren zu stereotypisieren.37 Für alle meine Gesprächspartner/-innen war es in der ersten Zeit nach der Amputation daher wichtig, ihre Prothese immer zu tragen und diese unter langer Kleidung oder einer hautfarbenen Kosmetik zu verstecken, um von Außenstehenden nicht auf den ersten Blick als behindert identifiziert zu werden. So schildert ein heute 36-jähriger Prothesenträger, dem mit 20 Jahren infolge eines Motorradunfalls der linke Oberschenkel amputiert werden musste, »[…] also ich kuck halt, dass es möglichst so aussieht […] wie nʼ echtes Bein […], denn […] es [ist] nicht angenehm […], wegen was Negativem oder was nicht der Norm entspricht […] im Mittelpunkt zu stehen.«38 Das unsichtbare medizintechnische Artefakt Prothese ermöglicht ihren Trägern/-innen in diesem Sinne ein doing visible normality, indem sie anderen Personen dadurch auf zwei Beinen, auf Augenhöhe und somit gleichwertig gegenübertreten können.39 Seit einiger Zeit lässt sich jedoch der Trend beobachten, dass immer mehr Prothesenträger/-innen ihre Prothese nicht mehr verstecken, sondern diese offen und selbstbewusst zeigen, wobei oftmals auf ein ausgefallenes Prothesendesign zurückgegriffen wird. Auch Vertreter/-innen der Prothesenbauindustrie betonen in Interviews immer wieder, dass heute bereits viele Prothesenträger/-innen ihre Prothesen sichtbar und als Teil ihrer Identität tragen würden. Prof. Hans Georg Näder, Inhaber des deutschen Medizintechnikunternehmens Ottobock, das Weltmarktführer im Bereich Prothetik ist, verweist zudem darauf, dass Ottobock mit seinen Prothesenkonstruktionen den Blick auf Behinderung verändern möchte und zwar weg von der Mitleidsperspektive.40 Prothesen werden zunehmend als 36
37
38 39
40
Siebers, Tobin: Disability and the Theory of Complex Embodiment – For Identity Politics in a New Register, 2012, 274, online unter: https://www.academia.edu/2651226/Disability_and_ the_Theory_of_Complex_Embodiment--For_Identity_Politics_in_a_New_Register (Letzter Zugriff am 27.11.2019). Vgl. Wangui Murugami, Margaret: Disability and Identity. In: Disability Studies Quarterly 29 (2009) ohne Pagination, online unter: http://dsq-sds.org/article/view/979/1173 (Letzter Zugriff am 27.11.2019). Interview vom 22.07.2014. Vgl. Winance, Myriam/Marcellini, Anne/De Léséleuc, Éric: From repair to enhancement: the use of technical aids in the field of disability. In: Bateman, S./Gayon J./Allouche, S./Gofette, J./Marzano, M. (Hg.): Inquiring into human enhancement. Interdisciplinary and International Perspectives. Houndsmills, Basingsoke, New York 2015, 119-137, hier: 121. Vgl. Viering, Jonas: Weg vom Mitleid. In: DIE ZEIT, No. 12/2009, online unter: www.zeit.de/ 2009/12/SE-Bock (Letzter Zugriff am 27.11.2019).
»Oh look, bionic people!«
Lifestyle-Produkte und begehrenswerte Konsumgüter vermarktet, es wird die Botschaft transportiert, dass moderne Prothesen soziale Teilhabe ermöglichen und man sich eben nicht mehr zu verstecken braucht.41 Die US-Soziologin Cassandra Crawford spricht in diesem Zusammenhang auch von einem bewussten becoming public von Prothesenträgern/-innen im Sinne einer bewusst getroffenen Entscheidung, sich nicht länger dem gesellschaftlichen Zwang, so normal wie möglich auszusehen, zu unterwerfen.42 Durch das offene Zeigen des medizintechnischen Artefakts kann es jedoch passieren, dass Prothesenträger/-innen von außenstehenden Personen weiterhin als irgendwie unmenschlich wahrgenommen werden. Deutlich wird dies an der Erzählung einer 40-jährigen Oberschenkelprothesenträgerin, die ihre elektronisch gesteuerte Beinprothese ohne hautfarbene Kosmetik offen zeigt und im Urlaub von fremden Personen beispielsweise mit dem Ausspruch Oh look, bionic people konfrontiert wurde.43 Damit wurde sie von ihrer sozialen Umwelt zwar weniger als behindert im klassischen Sinne angesehen, stattdessen aber in die Nähe eines (geschlechtsneutralen) Maschinen-Menschen oder Cyborgs gerückt. Der australische Kulturanthropologe Jack-David Fletcher, der ähnliche Beobachtungen gemacht hat, schreibt im Hinblick auf den Gebrauch von Prothesen daher auch: »The hegemonic view that these technologies render the recipient as less than human places individuals – particularly those deemed disabled – in a […] no-win situation; even with the addition of prosthetic limbs which aim to restore the body to a state of hegemonic normalcy, these bodies still remind the ›abled‹ of what can go wrong, and are a firm embodiment of an ›impure‹ body. […], these bodies are further positioned as Other and, […] as nonhuman in the sense that they are somehow recognised as more machine than human; […].«44 Dennoch kann das bewusste Zeigen der Prothese auch als Anzeichen dafür gesehen werden, dass sich die betreffenden Personen trotz aller negativen Erfahrungen oder Zuschreibungen, positiv mit ihrem durch die Amputation veränderten Körper einerseits sowie dem medizintechnischen Artefakt andererseits identifizieren und akzeptieren, »[…] that the body that inhabits the present is never the same body that inhabited the past […].«45 In diesem Zusammenhang wurde von verschiedenen meiner Interviewpartner/-innen auch immer wieder der Wunsch geäußert,
41 42 43 44
45
Vgl. Harrasser: Körper 2.0, 115. Vgl. Crawford, Cassandra: Body Image, Prostheses, Phantom Limbs. In: Body & Society 21 (2015) 221-224, 234f. Gespräch mit einer Prothesenträgerin während eines von mir besuchten Selbsthilfegruppentreffens für Menschen mit Gliedmaßenamputation, 03.07.2013. Fletcher, Jack-David: Transhuman Perfection: The Eradiction of Disability Through Transhuman Technologies. In: Battaglia, F/Carnevale, A. (Hg.): Humana Mente. Journal of Philosophical Studies, Issue 26, May 2014, Reframing the Debate on Human Enhancement, 79-94, 85. Crawford: Body Image, 235.
217
218
Carolin Ruther
dass in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht offener und lockerer mit dem Thema Behinderung als verkörperter Differenz umgegangen werden sollte, denn »[…] es is‹ halt was ganz Normales, gehört halt irgendwie so zur Gesellschaft dazu […]«46 , wie es eine 29-jährige Oberschenkelprothesenträgerin formuliert. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Wunsch in naher Zukunft tatsächlich erfüllt und in die Tat umsetzen lässt.
6.
Fazit
Mit diesem Beitrag konnte lediglich ein kleiner Einblick in die Erfahrungswelten von Beinprothesenträgern/-innen gegeben werden. Dennoch sollte deutlich geworden sein, dass sich der Umgang mit und die körperlich-leibliche Aneignung von Prothesen alles andere als einfach gestaltet. Es handelt sich vielmehr um ein komplexes Zusammenwirken von Mensch und medizintechnischem Artefakt. Die betreffenden Personen müssen nach der Amputation eine neue Sensibilität für ihren veränderten Körper sowie die Prothese entwickeln, die zudem in ihren Bewegungsabläufen genau aufeinander abgestimmt werden müssen, damit sich eine funktionierende Beziehung zwischen Mensch und medizintechnischem Artefakt entwickeln kann. Eine bedeutende Rolle kommt hierbei dem Prozess der orthopädietechnischen Prothesenanpassung zu, wobei die wechselseitige Verschränkung von Körper, Leib und Prothese im Sinne technogenen Embodiments vor allem im aktiven, praktischen Tun erfolgt. Wesentlichen Einfluss auf die Beziehung, die Menschen zu ihrem durch die Amputation veränderten Körper und ihrer Prothese eingehen, haben darüber hinaus soziokulturelle Vorstellungen von Behinderung wie auch populärkulturell verbreitete Bilder von moderner Prothetik. Prothesenträger/-innen werden damit verbunden in ihrem täglichen Leben mit unterschiedlichen kulturellen Zuschreibungen konfrontiert, die reichen von behindert, (in-)kompetent, nicht-menschlich bis hin zu Maschinen-Mensch oder Cyborg. Vor allem die im einleitenden Kapitel erwähnten, gegenwärtigen medialen Inszenierungen von Prothesenträgern wie Oscar Pistorius als technisch modifizierte Superhelden vermitteln dabei den Anschein einer hybriden Zukunft, in der Mensch und Maschine mittels moderner High-Tech-Prothesen zunehmend miteinander verschmelzen. Der selbst eine Prothese tragende Psychologe Bertolt Meyer hält derartige SuperheldenDarstellungen allerdings für gefährlich, da sie in die Irre führen können und ein ganz spezifisches Bild von Prothesen vermitteln, das von Optimierungsbestrebungen und Selbstermächtigung geprägt ist.47 Der Großteil an Prothesenträger/-innen
46 47
Interview vom 18.10.2014. Kamp, Christian: Behindert oder übermenschlich? Interview mit Bertolt Meyer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.09.2016.
»Oh look, bionic people!«
strebt demgegenüber weniger nach technischer Aufrüstung des eigenen Körpers über ein normales Maß hinaus, sondern vielmehr geht es für die betreffenden Personen darum, ihr Leben nach der Amputation mit Prothese überhaupt wieder als Alltag leben zu können. Speziell eine kulturwissenschaftliche Betrachtung des Themas kann in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag für eine interdisziplinäre Körper- und Gesundheitsforschung leisten, da sie aufgrund ihrer spezifischen Herangehensweise einen tieferen Einblick in die gelebte Realität der betreffenden Personen selbst ermöglicht und sich insbesondere auf der Mikroebene genauer herausarbeiten lässt, was es heißt, mit moderner Medizintechnologie zu leben.
Literatur Beck, Stefan/Niewöhner, Jörg/Sørensen, Estrid (Hg.): Science and Technology Studies. Eine sozialanthropologische Einführung, Bielefeld 2012. Cöln, Christoph: Mit der Prothese in den Kampf der Maschinen. In: Die Welt, 06.09.2014, online unter: https://www.welt.de/print/die_welt/sport/ article131960614/Mit-der-Prothese-in-den-Kampf-der-Maschinen.html (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Crawford, Cassandra: Body Image, Prostheses, Phantom Limbs. In: Body & Society 21 (2015) 221 224. Dederich, Markus: Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies, Bielefeld 2 2012. Dolezal, Luna: Representing Posthuman Embodiment: Considering Disability and the Case of Aimee Mullins. In: Women’s Studies 46 (2017) 60-75. Fletcher, Jack-David: Transhuman Perfection: The Eradiction of Disability Through Transhuman Technologies. In: Battaglia, F/Carnevale, A. (Hg.): Humana Mente. Journal of Philosophical Studies, Issue 26, May 2014, Reframing the Debate on Human Enhancement, 79 94. Gugutzer, Robert: Verkörperungen des Sozialen. Neophänomenologische Grundlagen und soziologische Analysen, Bielefeld 2012. Gugutzer, Robert: Leibliche Interaktion mit Dingen, Sachen und Halbdingen. Zur Entgrenzung des Sozialen (nicht nur) im Sport. In: Prinz, Sophia/Göbel, Hanna Katharina (Hg.): Die Sinnlichkeit des Sozialen. Wahrnehmung und materielle Kultur, Bielefeld 2015, 105 123. Harrasser, Karin: Körper 2.0. Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen, Bielefeld 2013. Hirschauer, Stefan: Praktiken und ihre Körper. Über materielle Partizipanden des Tuns. In: Hörning, Karl H./Reuter, Julia (Hg.): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und Praxis, Bielefeld 2004, 73 92.
219
220
Carolin Ruther
Hoogsteyns, Maartje/van der Horst, Hilje: Wearing the arm (or not): Reconceptualising notions of in- and exclusion in Disability Studies. In: Scandinavian Journal of Disability Research 15 (2013) 58 69. Howe, P. David: Cyborg and supercrip: The Paralympics technology and the (dis)empowerment of disabled athletes. In: Sociology 45 (2011) 868 882. Kamp, Christian: Behindert oder übermenschlich? Interview mit Bertolt Meyer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.09.2016. Keller, Reiner/Meuser, Michael: Wissen des Körpers – Wissen vom Körper. Körper- und wissenssoziologische Erkundungen. In: Dies. (Hg.): Körperwissen, Wiesbaden 2011, 9 31. Kubes, Tanja A.: Living fieldwork – Feeling hostess. Leibliche Wahrnehmung als Erkenntnisinstrument. In: Arantes, Lydia M./Rieger, Elisa (Hg.): Ethnographien der Sinne. Wahrnehmung und Methode in empirisch-kulturwissenschaftlichen Forschungen, Bielefeld 2014, 111 127. Leder, Drew: The Absent Body, Chicago 1990. Lewis, Tim: Is It Fair for Blade Runner Oscar Pistorius to Run in London Olympics? In: The Guardian, 31.07.2011, online unter: www.theguardian.com/sport/2011/ jul/31/oscar-pistorius-should-he-compete (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Mitterhuber, Thomas: Amputation und Prothese. Artikel auf der Homepage MyHandicap, 07/2012, online unter: www.myhandicap.de/prothese-amputation.html (Letzter Zugriff am 18.01.2020). Orland, Barbara: Wo hören Körper auf und fängt Technik an? Historische Anmerkungen zu posthumanistischen Problemen. In: Dies. (Hg.): Artifizielle Körper – Lebendige Technik. Technische Modellierungen des Körpers in historischer Perspektive, Zürich 2005, 9 43. Rosenberger, Robert/Verbeek, Peter-Paul (Hg.): Postphenomenological Investigations. Essays on Human-Technology Relations, London 2015. Ruther, Carolin: Alltag mit Prothese. Zum Leben mit moderner Medizintechnologie nach einer Beinamputation, Bielefeld 2018. Schneider, Eva: Die mediale Inszenierung von Oscar Pistorius als futuristischen Superhelden, 05.06.2014, online unter: https://www.anthropofakte.de/essays/diemediale-inszenierung-von-oscar-pistorius-als-futuristischen-superhelden (Letzter Zugriff am 21.11.2019). Schneider, Werner: Der Prothesen-Körper als gesellschaftliches Grenzproblem. In: Schroer, Markus (Hg.): Soziologie des Körpers, Frankfurt a.M. 2005, 371 398. Siebers, Tobin: Disability and the Theory of Complex Embodiment – For Identity Politics in a New Register, 2012, 274, online unter: https://www.academia.edu/ 2651226/Disability_and_the_Theory_of_Complex_Embodiment–For_Identity_ Politics_in_a_New_Register (Letzter Zugriff am 27.11.2019).
»Oh look, bionic people!«
Sobchack, Vivian: A Leg To Stand On: Prosthetics, Metaphor, and Materiality. In: Smith, Marquard (Hg.): The Prosthetic Impulse: From A Posthuman Present To A Biocultural Future, Cambridge 2006, 17 41. Tamari, Tomoko: Body Image and Prosthetic Aesthetics: Disability, Technology and Paralympic Culture. In: Body & Society 23 (2017) 25 56. Viering, Jonas: Weg vom Mitleid. In: DIE ZEIT, No. 12/2009, online unter: www. zeit.de/2009/12/SE-Bock (Letzter Zugriff am 27.11.2019). Waldschmidt, Anne: Disability Studies: individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? In: Psychologie und Gesellschaftskritik 29 (2005) 9 31. Wangui Murugami, Margaret: Disability and Identity. In: Disability Studies Quarterly, 29 (2009), ohne Pagination, online unter: http://dsq-sds.org/article/view/ 979/1173 (Letzter Zugriff am 27.11.2019). Winance, Myriam/Marcellini, Anne/De Léséleuc, Éric: From repair to enhancement: the use of technical aids in the field of disability. In: Bateman, S./Gayon J./Allouche, S./Gofette, J./Marzano, M. (Hg.): Inquiring into human enhancement. Interdisciplinary and International Perspectives, Houndsmills – Basingsoke – New York 2015, 119 137.
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Oscar Pistorius in der Parfümwerbung A*Men von Thierry Mugler, https://www.huffingtonpost.fr/2012/07/04/double-ampute-oscar-pistorius-jolondres-2012_n_1650997.html (zuletzt abgerufen am 16.09.2020) Abbildung 2: Oscar Pistorius in der Parfümwerbung A*Men von Thierry Mugler, http://www.ali-mahdavi.com/#18 (zuletzt abgerufen am 16.09.2020) Abbildung 3: Kampagne Meet the Superhumans des TV-Senders Channel 4 anlässlich derParalympics 2012 in London, https://cargocollective.com/lgdi/Meetthe-Superhumans (zuletzt abgerufen am 16.09.2020) Abbildung 4: The Avengers von Marvel, © 2015 Marvel Entertainment
221
Neue Körper, Grenzen, Entgrenzungen
Gelebte Verflechtungen In-Vitro-Techologien, Körper, Körperpolitik Nurhak Polat »Sie produzieren außerhalb des Körpers und geben es dem Körper zurück. Es werden Substanzen von zwei verschiedenen Menschen entnommen und im Labor zusammengeführt, um ein anderes Leben zu erzeugen. In anderen Bereichen der Medizin wird Blut entnommen und weggeworfen. Es werden Urinproben entnommen und weggeworfen. Ich gebe immer diese Beispiele… Denn hier ist es etwas ganz anderes. Zum Beispiel wird ein Teil [aus dem Körper] entnommen und als etwas anderes wieder hinzugefügt [die Eizelle wird zum Embryo].« (Reproduktionsmediziner, Istanbul)
›Assistierte Reproduktion‹ änderte unsere Perspektive auf Körper. Sie bietet nicht nur eine Fülle an Möglichkeiten zur Erfüllung des Kinderwunsches. Seit ihrer Einführung im Jahr 1978 ist sie auch von der Vorstellung geprägt, dass sie nicht »Zuoder Unfälle[n]«1 zu überlassen gilt. Sozial- und Kulturanthropolog/-innen zufolge hat die Medikalisierung von Reproduktion »nach IVF« den Umgang mit (dem) reproduktiven Körper(n) verändert.2 Nichts hat so nachhaltig zu unseren Vorstel-
1
2
Hess, Sabine: Flexible Reproduktive Biografisierung. Zum Kinder-Machen im Zeitalter biopolitischer Möglichkeiten – von Zeugungsstreiks und Spielermentalitäten. In: Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Berlin 2007, 109-123, 117ff. Strathern, Marilyn: Reproducing the Future. Essays on Anthropology, Kinship and the New Reproductive Technologies, Manchester 1992. Becker, Gay: The Elusive Embryo: How Women and Men Approach New Reproductive Technologies, Berkeley – London 2000. Thompson, Charis: Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Cambridge –
226
Nurhak Polat
lungen von der »Intervenierbarkeit in Zellen und Prozesse(n) des Biologischen« und des Körperlichen beigetragen, schreibt beispielweise Franklin, wie das ikonenhafte Bild der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI). Bei dieser speziellen Methode der In-Vitro-Fertilisation (IVF), wird die Membran einer Eizelle mit einer Pipette zerstoßen und ein Spermium ins Innere der Zelle eingeführt.3 Diese Methoden – auch bekannt als »künstliche Befruchtung« – haben grundlegende Annahmen von »natürlichen« Fakten über den Körper, die Reproduktion und die Familie in Frage gestellt, indem sie eine Abkopplung der Reproduktion vom Sexualakt möglich machten. Trotz kontroverser Debatten darüber, was als »normal« gilt, erzeugten sie Prozesse ihrer eigenen Normalisierung. Wie ethnografische Studien in verschiedenen Kontexten aufgezeichnet haben, werden sie daher nicht als massive Eingriffe und »verkörperter Fortschritt«, sondern als »kleine Abweichungen«4 repräsentiert.5 Somit bleiben sie nach wie vor auf engste mit Vorstellungen von ›natürlicher Zeugung‹ und tradierten Praktiken von Geschlecht, Mutterschaft, Vaterschaft und Verwandtschaft verwoben. Vor allem prägen sie und sind sie geprägt von Geschlechts- und Verwandtschaftsarbeit um, an und in Körper(n), die individuell unterschiedlich und lokal situiert praktiziert sowie ausgehandelt werden und umkämpft sind.6 In dieser Hinsicht ist in den letzten Jahren eine prozessuale, praxisorientierte Perspektive auf Körper(teile) und Reproduktionstechnologien stärker in den ethnografischen Vordergrund gerückt, etwa wie diese in Kliniken und Laboren »miteinander verschaltet werden«7 und ihre Verschaltung kulturell, sozial, rechtlich, moralisch und institutionell situiert »choreographiert«8 wird. Im Mittelpunkt standen also die Fragen, wie sich das Verständnis von Körper(n), Reproduktion und Beziehungen ändert – vor allem im Bereich des Geschlechts, der Elternschaft und Verwandtschaft –, wie Menschen Körper erfahren und was Handlungen in spezifischen, kulturellen und nationalen Kontexten sowie unterschiedlichen medizinischen Settings darüber verraten.
3 4 5
6
7 8
Massachussetts – London 2005. Franklin, Sarah: Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship. Durham – London 2013. Franklin: Biological Relatives. Franklin, Sarah: Embodied Progress: A Cultural Account of Assisted Conception, London 1997. Vgl. de Jong, Willemijn/Tkach, Olga (Hg.): Making Bodies, Persons and Families: Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany, Münster 2009. Knecht, Michi/Klotz, Maren/Polat, Nurhak u.a.: Erweiterte Fallstudien zu Verwandtschaft und Reproduktionstechnologien. Potentiale einer Ethnographie von Normalisierungsprozessen. In: Zeitschrift für Volkskunde 107(1) (2011) 21-48. Thompson: Making Parents. Inhorn, Marcia C.: Local Babies, Global Science: Gender, Religion, and In Vitro Fertilization in Egypt. New York–London, 2003. Barnes, Liberty W.: Conceiving Masculinity: Male Infertility, Medicine, and Identity, Philadelphia 2014. Amelang, Katrin/Bergmann, Sven/Binder, Beate (Hg.): Körpertechnologien: Ethnografische und gendertheoretische Perspektiven. In: Berliner Blätter 70 (2016) 13. Thompson: Making Parents.
Gelebte Verflechtungen
Im vorliegenden Beitrag erkunde ich Körpervorstellungen und -praxen in der Türkei. In drei politisch durchaus unterschiedlich geführten Legislaturperioden hat die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) Reproduktionskörper – stärker denn je in der Geschichte der Republik – für eine Wende zum populistisch-islamistischen Autoritarismus instrumentalisiert. Während und seit meiner Feldforschung von 2008 bis 2013 lassen sich unter dem Regime der AKP dramatische Eingriffe in fast alle privaten und öffentlichen Lebensbereiche beobachten. Damit gehen tiefgreifende Veränderungen in der reproduktiven Gesundheits- und Genderpolitik einher, die sowohl auf diversen Techniken der Kontrolle, Überwachung und Regulierung des individuellen und kollektiven Körpers der Bürger/innen basieren, als auch auf molekularer Ebene von Zellen erfolgen. Nach wie vor stellt die biopolitische Regulierung der IVF/ICSI-Technologien hierfür ein Mittel dar.9 Mein Beitrag untersucht Körper(teile) assistierter Reproduktion basierend auf meiner Forschung in drei privaten Fertilitätskliniken in Istanbul – in Deutschland eher als »Kinderwunschpraxen« bekannt. Er stellt diese als »Orte der ›Verdichtung‹ von Gesellschaft«10 in Frage; als Orte des Aufeinandertreffens von sozial-politischen Ordnungen, Körpern, Wissen, Politiken und Ontologien. Empirisch beziehe ich mich auf meine Forschung mittels halbstrukturierter ethnografischer Interviews und »teilnehmender Beobachtung«, d.h. einem partiellen Integrieren von mir als Forscherin in die alltäglichen, klinisch-medizinischen Abläufe und Prozeduren. In den Kliniken konnte ich Hospitationen durchführen, bin über einen Zeitraum von circa drei Jahren jeweils mehrere Tage in den Wartebereichen und in den Laboren »herumgehangen«11 und habe Mediziner/-innen und Helfer/-innen bei den Behandlungsprozeduren begleitet. Ich habe an Beratungssituationen sowie an medizinischen Verfahren wie der Eizellentnahme, der Zellverarbeitung und dem endgültigen Embryonentransfer teilgenommen. Dadurch habe ich versucht, an die Handlungen von Einzelnen, und zwar in konkreten Situationen, heranzukommen. In die Untersuchung fließen auch halbstrukturierte Tiefeninterviews mit mehr als 40 behandelten Paaren, Ärzt/-innen (N-10) und Klinikpersonal, mit politischen Entscheidungsträger/-innen (N-4) und betroffenen Gruppenaktivist/-innen (N-7), in einigen Fällen periodische Folgeinterviews, ein. Die interviewten Paare gehörten überwiegend der wohlhabenden Istanbuler Mittelschicht an und waren sowohl Selbstzahler/-innen aus wohlhabenden Stadteilen, in denen sich die Kliniken befinden, als auch »Kassen-Patient/-innen« aus anderen Stadtteilen oder den
9 10 11
Polat, Nurhak: Umkämpfte Wege der Reproduktion: Kinderwunschökonomien, Aktivismus und sozialer Wandel in der Türkei, Bielefeld 2018. Knorr–Cetina, Karin: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der ›Verdichtung‹ von Gesellschaft. In: Zeitschrift für Soziologie 17(2) (1998) 85-101. Franklin, Sarah: Embryonic economies. The Double Reproductive Value of Stem Cells. In: BioSocieties 1(1) (2006) 71-90, 75.
227
228
Nurhak Polat
ländlichen Regionen des Landes. Sie sind nur teilweise repräsentativ für die demographische und sozio-politische Diversität des Türkei, die sich aus verschiedenen ethnischen Minderheiten, religiösen, sekulären und politischen Identitäten und Bürger/-innen mit unterschiedlichem sozio-ökonomischem Background zusammensetzt.12 Im Folgenden fokussiere ich mich anhand drei ethnografischer Vignetten auf die klinisch-technischen Prozesse und den Umgang mit Körpern und reproduktiven ›Fragmenten‹ (seien es Zellen, Substanzen und Embryonen). Ich möchte der Frage nachgehen, wie Körper(teile) in Relation zu natürlichen Fakten und tradierten Vorstellungen von Gender, Biologie, Mutterschaft, Vaterschaft und auch Verwandtschaft neu gedacht, fragmentiert und als solche begründet werden.
1.
Anthropologische Ansätze zur Choreographie der In-Vitro-Praxen und Körper(teile)
Ich beginne mit einer anthropologischen Perspektive, auf die ich mich beziehe. Sozial- und Kulturwissenschaftliche und ethnografische Forschungen zeichnen auf, wie im Umgang mit Reproduktionstechnologien die als schicksalhaft angesehenen Prozesse der Reproduktion umgedeutet und dadurch neue Körperverständnisse und -praktiken gestiftet werden – sowohl in euro-amerikanischen als auch anderen Ländern wie Ägypten, Indien, Israel, China, Ecuador und der Türkei.13 Besonders feministische Ansätze zu Biopolitik, Körper und Reproduktion 12
13
Meine Forschung war Teil einer vergleichenden Langzeitstudie des Projektes »Verwandtschaft als soziale Praxis und Repräsentation im Kontext gesellschaftlicher und reproduktionsmedizinischer Transformationen«. Dieses wurde im Sonderforschungsbereich (SFB) 640 »Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel. Intertemporale und interkulturelle Vergleiche« durchgeführt, der von 2004 bis 2013 an der Humboldt-Universität zu Berlin angesiedelt war und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde. Wir begleiteten mittels serieller Ethnografie und rekurrierender Interviews über 10 Jahre hinweg Familien und Verwandtschaftsbeziehungen, die für die Gründung oder Erweiterung ihrer Familien auf die Nutzung assistierender Reproduktionstechnologien und/oder Adoption in Deutschland, der Türkei, Großbritannien sowie in transnationalen Räumen zurückgegriffen hatten. Es ging um neue Praktiken des »Verwandtschaft-Machens« und der »Normalisierung« (vgl. Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Berlin 2007. Für Details zur Methode siehe Knecht/Klotz/Polat u.a.: Erweiterte Fallstudien zu Verwandtschaft und Reproduktionstechnologien). Vgl. Kahn, Susan M.: Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted Conception in Israel, Durham – London 2000. Bharadwaj, Aditya: Sacred Conceptions: Clinical Theodicies, Uncertain Science, and Technologies of Procreation in India. In: Culture, Medicine and Psychiatry 30(4) (2006) 451-465. Inhorn, Marcia C.: Local Babies, Global Science. Roberts, Elizabeth F.: God’s Laboratory: Religious Rationalities and Modernity in Ecuadorian in Vitro Fertilization. In: Cul-
Gelebte Verflechtungen
konstatieren neue Körperpraktiken und Zugriffe auf Körperteile, -substanzen und -prozesse. Der Körper wird, wie in anderen Bereichen, in »Grenzverläufen« (in Anlehnung an Barkhaus und Fleig)14 neu gedacht und erlebt, nicht nur an der Schnittstelle, sondern selbst als eine Schnittstelle zwischen biopolitischer Steuerung, sozialem Handeln und Gesellschaftskonzepten von Individualität, Subjektivität, Geschlechtlichkeit und Biosozialität.15 Dies betrifft generell Grenzüberschreitungen durch Biomedikalisierung16 und die Frage, wie körperbezogene Technologien in diesem Prozess »die Einzelnen und die Gesellschaft in ein neuartiges Verhältnis zueinander«17 setzen und neue Selbstverhältnisse und Bilder von Körperlichkeit hervorbringen. Im Einklang mit Donna Haraway’s Ideen – Körper und Organismen »are not born; they are made in world-changing technoscientific practices by particular collective actors in particular times and places«18 – wies die feministische Körperforschung darauf hin, dass androzentristisch-patriarchale Biotechnologien reproduktive Körper (besonders Frauenkörper) als Ressource und »reproducible fragments«19 konstituieren. In-Vitro-Fertilisation, biotechnologische Visualisierung und Extrahierung von Zellen tragen dazu bei. Individuen werden zu »Dividuen«, während Zellen und besonders Embryos individualisiert werden.20
14 15 16 17 18
19
20
ture, Medicine and Psychiatry 30(4) (2006) 507-536. Gürtin, Zeynep: Assisted Reproduction in Secular Turkey: Regulation, Retoric, and the Role of Religion. In: Inhorn, Marcia C./Tremayne, Soraya (Hg.): Islam and Assisted Reproductive Technologies: Sunni and Shia Perspective, New York–Oxford 2012, 285-311. Barkhaus, Annette/Fleig, Anne (Hg.): Grenzverläufe. Der Körper als Schnitt–Stelle, München 2002. Rabinow, Paul/Rose, Niklas: Biopower Today. In: BioSocieties 1(2) (2006) 195-217. Clarke, Adele E./Mamo, Laura/Fosket, Jennifer R. u.a.: Biomedicalization: Technoscience, Health, and Illness in the U.S., Durham– London 2010. Liebsch, Katharina/Manz, Ulrike (Hg.): Einleitung. Leben mit den Lebenswissenschaften: Wie wird biomedizinisches Wissen in Alltagspraxis übersetzt? Bielefeld 2010, 7-20, 7. Haraway, Donna: The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In: Grossberg, Lawrence/Cary Nelson/Paula A. Treichler (Hg.): Cultural Studies, New York 1992, 295-337, 297. Mies: 1988, zitiert von Gupta, Jyotsna Agnihotri/Richters Annemiek: Embodied Subjects and Fragmented Objects: Women’s Bodies, Assisted Reproduction Technologies and the Right to Self–Determination. In: Bioethical Inquiry 5 (2008) 239-249. Vgl. Braidotti, Rosi: Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, New York 2011. Einigen feministischen und sozial-und kulturanthropologischen Techno-Wissenschaft- und Körperforscher/-innen zufolge stellen Reproduktionstechnologien »das letzte Kapital in der langen Geschichte der »missappropriation« des Frauenkörpers durch die androzentristische und westliche Techno-Wissenschaft und Medizin dar (vgl. Lam, Carla: New Reproductive Technologies and Disembodiment. Feminist and Material Resolutions, London – New York 2016, 3). Hier geht es primär um die entstehenden globalen Bioökonomien, die die gegenwärtige Körper- und Biopolitik maßgeblich beeinflussen. Besonders wichtig sind die techno-medizinischen Eingriffe in den Körpern für die Herstellung, Aufbewahrung und Zirkulation von Körpersubstanzen, z.B. Eizellen, Spermien und Embryo-
229
230
Nurhak Polat
In den vergangenen Jahren dezentrierten praxeologische Ansätze Körper als solche. In Anlehnung an Anne-Marie Mol rückten Handlungen stärker ins Blickfeld, wodurch Körper in unterschiedlichen Momenten der Diagnose und Behandlung »hervorgebracht« sowie multipel wahrgenommen und erlebt wurden.21 Forschungen in diese Richtung haben vor allem danach gefragt, wie der Körper – je nach medizinischen und kulturellen Logiken, Praktiken und Körperpolitiken, die vorherrschen bzw. in den konkreten Situationen aktiviert werden – in einzelne Organe, Substanzen und Flüssigkeiten aufgesplittert wird und verschiedene Bedeutungen und Qualitäten annimmt. Sie haben die Praxis »zur grundlegenden Untersuchungseinheit«22 gemacht und dabei erforscht, wie Körper in einer spezifischen, lokal situierten Praxis gemacht und hervorgebracht werden.23 Statt eines Leib-Seele-Dualismus ging es zum einen darum, wie Körper jenseits von Mikro/Makro, Individual/Sozial, Natur/Kultur und Innen/Außen biomedizinisch und -politisch be- und ausgehandelt und auch erlebt werden. Zum anderen haben bisherige Studien die »drei Körper« (the three bodies) in den Blick genommen, wie Nancy Scheper-Hughes und Margaret Lock24 argumentieren: 1- das individuelle »Körper-Selbst«, das im Deutschen als Leib wahrgenommen wird 2- der soziale Körper, der Mary Douglas’ strukturalistischer Analyse folgend als Symbol für gesellschaftliche Ordnung interpretiert wird und schließlich 3- der politische Körper, der im Foucaultschen Sinne einer situierten »Körperpolitik« die Regulierung, Überwachung und Kontrolle bestimmter (individueller und kollektiver) Körper bedeutet.25 Lock und Farquhar haben dafür plädiert, statt »body proper« (als universales Modell) »lokale Körper« in gelebten, subjektiven und situierten Alltagen zu unter-
21 22
23
24 25
nen. Diese ermöglichen, dass Körpersubstanzen als »Biokapital« bzw. »lively capital« extrahiert und vermarktet werden (vgl. Rajan, Sunder K.: Biocapital. The Constitution of Postgenomic Life, Durham 2006.), wovon bestimmte Körper (der Frauen aus den ärmeren Verhältnissen, aus dem globalen Süden und post-sowjetischen Norden) betroffen sind. Mol, Anne–Marie: The Body Multiple. Ontology in Medical Practice, Durham 2002. Niewöhner, Jörg/Sorensen, Estrid/Beck, Stefan (Hg.): Einleitung: Science and Technology Studies – Wissenschafts- und Technikforschung aus sozial- und kulturanthropologischer Perspektive. In: Science and Technology Studies: Eine sozialannthropologische Einführung, Bielefeld 2012, 9-48, 21. Praxeografie beruht ähnlich wie Ethnografie auf teilnehmender Beobachtung, allerdings macht sie, wie Niewöhner, Sorensen und Beck argumentieren, grundsätzlich die Praxis zur Untersuchungseinheit. Dabei geht es um die Annahme, dass »nichts […] außerhalb von Praxis« besteht und dass soziale Phänomene »sich nicht durch ein stabiles, ihnen innewohnendes, quasi essentielles Wesen auszeichnen, das dann in sozialer Praxis interagiert«, sondern in der spezifischen Praxis ihrer Entstehung untersucht werden können. Scheper–Hughes, Nancy/Lock, Margaret: The Mindful Body. A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. In: Medical Anthropology Quarterly, 1(1) (1987) 6-41. Vgl. Beck, Stefan/Knecht, Michi: Einleitung: Körper – Körperpolitik – Biopolitik. In: Berliner Blätter 29 (2003), 7-14. Amelang/Bergmann/Binder: Körpertechnologien.
Gelebte Verflechtungen
suchen, die »als Assemblagen von Praktiken, Diskursen, Bildern, institutionellen Arrangements und spezifischen Orten und Projekten begriffen [werden]«.26 Eine der wichtigsten praxis-orientierten Perspektiven hat die amerikanische Anthropologin Charis Thompson mit ihrer Forschung in kalifornischen Kliniken Ende der 1990er bis in die frühen 2000er Jahre geliefert. In ihrem 2005 veröffentlichen Buch »Making Parents« beschreibt sie, wie dort technologische, rechtliche, moralische, verwandtschaftliche, geschlechtsspezifische, emotionale, politische und finanzielle Aspekte koordiniert und orchestriert werden und bezeichnet dies als »ontologische Choreographie«. Thompson hat verschiedene Handlungen und Deutungen in Bezug auf biologische, hormonelle, kryotechnische und biographische Zeitlichkeiten, Körper und Substanzen wie Keimzellen und Embryonen untersucht. Sie hat zugleich illustriert, wie diese in den konkreten Arbeitsabläufen, Logiken und Regelungen eingebettet und in komplexen und profitorientierten Behandlungsregimen aufeinander abgestimmt und miteinander synchronisiert werden. In dieser Hinsicht entkoppeln Reproduktionstechnologien nicht zwangsläufig den Körper, sondern steuern zu einer »ontologisch erweiterte(n) Choreographie der Empfängnis« und damit des Reproduktionskörpers bei. Diese Choreographie de- und re-kontextualisiert den Körper sowie seine Teile und Grenzen. Wie ethnografische Vignette in meinem Beitrag verdeutlichen, sie trägt dazu bei, dass biomedizinische Interventionen in den Körper und in seine Teile normalisiert, standardisiert und begründet werden – und zwar lokal unterschiedlich und von Zeit zu Zeit variierbar. Angelehnt an Michel Foucaults Überlegungen zur »Normalisierung«, »Disziplinierung« und »Regulierung« zeigt Thompson, wie Körper diszipliniert und reguliert werden, in dem sie diskursiv, materiell und individuell an Normen, Taktungen, Durchschnittswerte oder Gesundheitsvorstellungen angepasst werden.27 Auch spätere normalisierungstheoretische Ansätze betonen die Körperarbeit, etwa wie diese als solche reguliert, und durch ein sorgfältiges und ›antizipierendes‹ Management von Reproduktionsbiographien erlebt werden.28 Diese Choreographie wird in den Praktiken von Frauen und Männern hervorgebracht und durch nationale, kulturelle und institutionelle Interpretationen geprägt.29 Im Umgang mit dieser Choreographie entstehen neue Verständnisse vom Körper sowie zwischen dem/n individuellen Körper(n), Körperteile(n) und Fortpflanzung. Es geht um ein eng koordiniertes, sich veränderndes Amalgam 26 27 28 29
Lock, Margaret/Farquhar, Judith: Beyond the Body Proper. Reading the Anthropology of Material Life, Durham 2007, 1. Meine Übersetzung. Thompson: Making Parents. Vgl. de Jong/Tkach (Hg.): Making Bodies, Persons and Families. Knecht/Klotz/Polat u.a.: Erweiterte Fallstudien zu Verwandtschaft und Reproduktionstechnologien. Vgl. Thompson: Making Parents. Inhorn, Marcia C./Birenbaum-Carmeli, Daphna: Assisted Reproductive Technologies and Culture Change. In: Annual Review of Anthropology 37 (2008) 177196.
231
232
Nurhak Polat
von Gesetzen, medizinischen Techniken, Laborpraktiken, Zahlungsstrukturen, Verwandtschafts- und Genderbestimmungen, Emotionen, Ethiken und Politik innerhalb der Ökonomien des Kinderwunsches. Laut Thompson ist es ein Zusammenkommen, gar ein »aktives Gleichgewicht« von Dingen, die in der Regel als Teile verschiedener ontologischer Größen (ontological orders) – wie der Natur, des Selbst und der Gesellschaft – verstanden werden.30 Ihr zufolge werden Körper zugleich »von einem festen anatomischen Körper zu einem sich schnell wandelnden Beziehungskörper«31 verwandelt. Denn sie sind darauf ausgerichtet, »legitime Eltern, Kinder und alles, was für ihre Anerkennung nötig ist«32 ständig herzustellen.
2.
Mehrere Körper – Flexible Substanzen?
Vor diesem Hintergrund stellen IVF/ICSI eine »somatotechnique« dar, so MerleauPonty in ihrer Forschung in indischen und französischen Kliniken. Sie ändern Perspektiven auf den Körper gerade dadurch, dass sie eine auf Fortpflanzung und Resultat fokussierte ›Routine-Arbeit‹ »an der Schnittstelle zwischen Biologie, individueller Erfahrung, Substantivismus«33 leisten. Zwei Aspekte sind hierbei relevant. Erstens, diese Technologien involvieren mehrere Körper(teile) und produzieren (mehrere) neue Körper. Dieses Spezifikum verdeutlichte bereits das Eingangszitat aus einem Arzt Interview. Die »Befruchtung im Reagenzglas«, so Anthropologin Irma van der Ploeg, wird als eine »Gameten-Interaktion« von Samen und Eizelle konstituiert und performiert.34 Die Kategorie »Patient« erfährt dabei eine Unschärfe, denn Körper und Substanzen von Frauen und Männern werden miteinander vermischt, um ein neues Leben zu zeugen. Obwohl der Frauenkörper – unabhängig von weiblicher oder männlicher Unfruchtbarkeit – das größere Ausmaß an Eingriffen, z.B. die hormonelle Stimulation für Eizellproduktion, die Eizellenentnahme und den Embryotransfer, durchsteht, und der Männerkörper als ›unsichtbar‹ konstituiert wird35 , macht es die klinische Praxis »unklar, welche Selbst oder wessen Körper genau und in welchem Umfang beteiligt sind, oder sogar wie viele Selbst und
30 31 32 33 34 35
Thompson: Making Parents, 8. Lock/Farquhar: Beyond the Body Proper, 591. Thompson: Making Parents, 8. Merleau-Ponty, Noémi A.: In Vitro Fertilization in French and Indian Laboratories: a Somatotechnique? In: Ethnologie Francaise 167 (2017) 509-518. van der Ploeg, Irma: Only Angels Can Do Without Skin: On Reproductive Technology’s Hybrids and the Politics of Body Boundaries. In: Body & Society 10(2-3) (2004) 153-181. Inhorn, Marcia C./Tjørnhøj-Thomsen, Tine/Goldberg, Helene u.a. (Hg.): Reconceiving the Second Sex: Men, Masculinity, and Reproduction, New York – Oxford 2009. Barnes, Liberty W.: Conceiving Masculinity.
Gelebte Verflechtungen
Körper genau beteiligt sind«.36 Diese Praxis geht mit einer Abkopplung der Reproduktion vom Körper einher. Während Körper(teile) ›verschmelzen‹, verschwimmen ihre Grenzen. Es entstehen, so behauptet van der Ploeg, »Paarkörper« und »SamenEizelle-Embryo-Körper« als Hybride. Doch der Körper wird nach wie vor sowohl holistisch als ein Ganzes als auch in cartesianisch dualistischen Normen über die ›natürlichen‹, biologisch determinierten und gegenseitig exklusiven reproduktiven Rollen von Frauen und Männern konstituiert. Der männliche Körper wird als »ejakulierende Apparate zu ihren Partnerinnen choreografiert«37 , wobei der weibliche Körper zu einem Ort der choreographierten Geschlechter- und Verwandtschaftsarbeit wird. Zweitens, und damit verbunden, wird der Körper als ein Ort der Fortpflanzung und Empfängnis situativ vor- und hergestellt. Er wird zwar fragmentiert und im Labor vom individuellen Körper isoliert, jedoch, ohne unbedingt von ihm völlig abgekoppelt als ›beziehungslose Substanz‹ betrachtet zu werden. Das heißt, es geht nicht um eine Ab- und Entkopplung der Befruchtung von tatsächlichen Körpern, sondern um eine Neu-Kopplung – mit diversen Variablen. Es kommt also auf die jeweilige Praxis an, wie sozial- und kulturanthropologische Forschungen aufzeichnen, welche Bedeutung und Qualität Körper- und Zeugungssubstanzen zugeordnet wird. Einflussreich sind kulturelle Vorstellungen und symbolische Zuschreibungen, die die Gebärmutter als »ein Feld« bzw. als nährenden Boden konstituieren, in dem der »Samen des Mannes eingepflanzt wird«, wie Delaney ausgehend einer Forschung in der Türkei als Merkmal der herkömmlichen patriarchalen monogenetischen Theorie zur Fortpflanzung in monolithischen Religionen aufgezeichnet hat.38 Diese wirken in die medizinischen Situationen hinein. In Anlehnung an Janet Carsten schreibt Hauser-Schäublin, dass es wichtig ist zu hinterfragen, wie und inwiefern Körpersubstanzen und Flüssigkeiten abhängig von der jeweiligen Substanz und dem Kontext, in dem sie verwendet werden, gedeutet werden. Dies beeinflusst, inwieweit sie von den tatsächlichen Körpern entkoppelt oder an diese gekoppelt werden. Es geht darum, ob und in welchen Situationen und Kontexten »›Substanz‹ jeweils konstitutiv für Körper, Person, gender, und damit auch für ›Verwandtschaft‹« fungiert.39 Übertragen in die reproduktionsmedizinische Praxis hängt gerade die Gender- und Verwandtschaftsarbeit davon ab, wie Keimzellen und Substanzen ein- und zugeordnet werden. Keimzellen werden als Träger der 36 37 38 39
van der Ploeg: Only Angels Can Do Without Skin, 156. (Meine Übersetzung; HH im Original) Thompson: Making Parents, 128. Delaney, Carol: The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society, Berkeley 1991. Hauser–Schäublin, Brigitta: Manipulierte Substanzen, rekonfigurierte Verwandtschaften. Human-technologische Prozesse und ihre Bedeutung für Verwandtschaft zwischen Normativität und Flexibilität. In: Alber, Erdmute/Beer, Bettina/Pauli, Julia u.a. (Hg): Verwandtschaft heute. Positionen, Ergebnisse und Perspektiven, Berlin 2010, 249-277, 259.
233
234
Nurhak Polat
Erbinformationen konstituiert. Zugleich stehen sie für Weiblichkeit und Männlichkeit, wobei das Spermium als aktive und Eizelle als passive Empfängerzelle konstituiert werden.40 Die kulturellen und biomedizinischen Vorstellungen greifen sich ineinander. Es kommt also darauf an, welche Vorstellungen in das Labor hineinkommen bzw. aus dem Labor hinausgehen.41 Welche Körperteile und Substanzen werden zu medizinisch behandelbaren Problemen gemacht? Welche werden als ›Lebens-Substanzen‹, ›Keimzelle der Verwandtschaft‹ oder als »Körperchen« repräsentiert? Das letztere beschreibt Zehnder beispielsweise für das Spermium im Labor, das gerade durch die »Loslösung« vom tatsächlichen Körper/Leib zu »Körperchen« wird.42 Denn es repräsentiert nicht den Mann, sondern wird selbst zu einem »eigenen Körper – nicht zuletzt dadurch, dass es seine Funktion außerhalb des männlichen Körpers zu erfüllen hat« und »beinahe individualisiert wird«.43 In der Praxis werden Keimzellen im Labor durch Entkopplung und Quantifizierung als Körperchen verdinglicht, zugleich gewinnen sie gerade deshalb neue Bedeutungen für die flexible Gender- und Verwandtschaftsarbeit der Menschen. Die Neu-Kopplung hat eine Intensivierung dieser flexiblen Arbeit an, in und um Körper(teile) zufolge, wenn diese »nun mehr vom Körper isolierbar, lagerbar, (…) und zirkulationsfähig« werden.44 Sie stellen im Latourschen Vokabular Hybride und »Quasi-Objekte«45 , Mischwesen zwischen Natur und Kultur, dar. Dazu zählen insbesondere die Embryonen, die nicht transferiert und je nach Wunsch für die späteren Versuche im flüssigen Stickstoff bei 196 Grad Celsius in sogenannten »Tanken« eingefroren, wieder aufgetaut und mit einem beliebigen zeitlichen Abstand transferiert oder, wie mir in Istanbuler Laboren erzählt wurde, als »Überzählige« und »nicht brauchbare« Beiprodukte entwertet werden und schließlich »im Müll landen«. Relevant ist, wie solche Übergänge und Grenzziehungen reproduktionsmedizinisch, kulturell und im Einzelfall funktionieren.
40 41 42
43 44
45
Martin, Emily: The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male–Female Roles. In: Signs 16(3) (1991) 485-501. Vgl. Inhorn: Local Babies, Global Science, 20. Zehnder, Kathrin: Der Mann im Sperma. Zum Verhältnis von Männerkörpern und männlichen Keimzellen in der Reproduktionsmedizin. In: GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 6(1) (2014) 111-126. Ebd., 122. Schneider [ I/Graumann, S. (Hg.): Verkörperte Technik – Entkörperte Frau. Biopolitik und Geschlecht. Frankfurt a.M. – New York] 2003, 41, zitiert von Banihaschemi, Susan: Kontroverse Reproduktion: Zur Legitimierung der Samenspende im reproduktionsmedizinischen Diskurs, Bielefeld 2018, 10. Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt a.M. 2008.
Gelebte Verflechtungen
3.
Von der Normalisierung zu einer »sozio-technischen, patriarchalen Paradoxie«
In der Türkei, wie auch anderswo, sind diese Übergänge zum einen mit den (bio)politischen Veränderungen in den letzten zwei bis drei Dekaden im Land verwoben. Hinzu kommen die »gelebten Verflechtungen«46 von kulturellen Verständnissen, biopolitischen Regulierungen und Alltagspraktiken. Dabei treffen das Lokale und das Globale aufeinander, etwa globale Technologien, medizinische Verfahren und Bioethik der »globalisierten Reproduktionsregime« auf lokal-nationale Rechtund Moralvorstellungen, Verständnisse von Reproduktion, Körper und Selbst.47 Seit der Geburt des ersten türkischen IVF-Kindes im Jahr 1989 gilt IVF/ICSI auch in der Türkei als »helfende Hand« der Natur.48 In den letzten drei Jahrzehnten sind die Technologien zu einer gesellschaftlich weitgehend akzeptierten und konventionellen Unfruchtbarkeitsbehandlung avanciert, wobei sie dazu beigesteuert haben, Unfruchtbarkeit als ein medizinisch zu lösendes Problem zu rahmen. Sie haben sich in vielfältiger Weise auf Vorstellungen von gesellschaftlich und moralisch-ethisch »angemessenem« Handeln bezüglich Familiengründung und Kinderwunsch, Geschlecht, Sexualität und Körper ausgewirkt. Bisherige Forschungen haben auch gezeigt, dass die skizzierte Normalisierung der Reproduktionstechnologien unmittelbar mit den historischen und kulturellen Prägungen der Türkei zu tun haben, das bis vor kurzem ein säkular orientiertes, deshalb aber nicht weniger religiöses, sunnitisch-muslimisch geprägtes Land war.49 Die Türkei sei ein Land, so Soziologin Gürtin, das eine »westliche TechnoWissenschaft fetischisiert«50 und »Paradoxen und Hybride«51 in sich vereint, oszillierend zwischen Westen und Osten sowie Moderne, Säkularismus und Islam. In
46
47
48 49
50
51
Polat, Nurhak: Concerned Groups in the Field of Reproductive Technologies: A Turkish Case Study. In: Knecht, Michi/Klotz, Maren/Beck, Stefan (Hg.): Reproductive Technologies as Global Form. Ethnographies of Knowledge, Practices, and Transnational Encounter, Frankfurt a.M. – New York 2012, 197-226. Beck, Stefan: Globalisierte Reproduktionsregime. Anmerkungen zur Emergenz biopolitischer Handlungsräume. In: Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen, Berlin 2007, 124-151. Franklin: Embodied Progress. Mutlu, Burcu: Türkiye’de ›Üremeye Yardımcı‹ Teknolojiler: Kadınların Tüp Bebek Anlatıları. In: Özbay, Cenk/Terzioğlu, Ayşecan/Yasin, Yeşim (Hg.): Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik, İstanbul 2011, 73-93. Polat: Concerned Groups. Demircioğlu, Merve Göknar: Achieving Procreation: Childlessness and IVF in Turkey. New York–Oxford 2015. Gürtin: Assisted Reproduction in Secular Turkey. Gürtin: Patriarchal Pronatalism. Gürtin, Zeynep: Practitioners as Interface Agents between the Local and the Global: The Localization of IVF in Turkey. In: Knecht/Klotz/Beck (Hg.): Reproductive Technologies as Global Form, 81-110, 91. Gürtin: Assisted Reproduction in Secular Turkey, 286.
235
236
Nurhak Polat
dieser Hinsicht werden In-Vitro-Technologien in »einen hybriden Kontext« gestellt, in dem sich säkulare Gesetze und eine modernistische Perspektive auf die Medizin mit Sunni-Muslimischer Kultur und neo-konservativen Regierungspolitiken überschneiden.52 Betont wird vor all Dingen, dass die Fähigkeit und der Wunsch von Bürger/-innen nach Kindern, die seit der Nation-Bildung in den 1920er als Grundlage des türkischen Familienmodells, der sozialen Ordnung und des Wohlstands der Nation angesehen wurden, laut Gürtin zu einem »Fetischisieren« der westlichen Reproduktionstechnologien beigesteuert hätten. Auf diese Weise weist Gürtin der Türkei eine partikulare Position im Mittleren Osten zu, wobei dadurch der dichotomische Blickwinkel verschärft wird. Sozialund Kulturanthropolog/-innen weisen hingegen auf die Komplexität hin, gerade in dieser sozial, kulturell und technowissenschaftlich heterogenen Region. Sie zeigen die komplexen und widersprüchlichen Prozessen im Umgang mit Reproduktionstechnologien auf, statt auf die gängigen Bilder der kulturellen Verzerrungen zurückzugreifen.53 Darauf aufbauend geht es mir primär um konkrete Praktiken des Umgangs, die in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit im Alltag auftauchen und als solche ausgehandelt werden. Nach wie vor werden Reproduktionstechnologien zur Förderung der Fortpflanzung der Familie als »die heteronormative reproduktive Einheit«54 eingesetzt. Staatlich gefördert und reguliert gelten sie als ›Ehefrau-Ehemann-Behandlungen‹. Daher werden sie von der AKP – kurz nach ihrer Machtübernahme in 2002 bis in die Gegenwart – als Leistungen zur Herstellung der Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit von heterosexuell-verheirateten Paaren besonders stark gefördert. Seit 2005 werden sie als ›Behandlungen für Infertilität als Krankheit und reproduktionsgesundheitliche Einschränkung‹ eingestuft und vom Staat bis einschließlich zur dritten Behandlung finanziert. Zur Zeit meiner Forschung erfuhren die Behandlungen eine noch nie dagewesene Sichtbarkeit in der türkischen Öffentlichkeit. Fast täglich wurden sie in den nationalen Fernsehsendern und der Presse sowie auf unzähligen OnlinePlattformen oder auf Webseiten der Kliniken mit den Werbeslogans wie »Nicht aufschieben«, »Irgendwo wartet ein Kind auf Sie«, »Planen Sie ihren Kinderwunsch früh genug«, »Unfruchtbarkeit ist kein Schicksal« beworben. Damals wurde das Land mit einer enorm schnell wachsenden Zahl an Privatkliniken als 52 53
54
Gürtin: Patriarchal Pronatalism, 45. Vgl. Kahn: Reproducing Jews. Inhorn.: Local Babies, Global Science. Abbasi–Shavazi, Mohammad J./Inhorn, Marcia C./Razeghi–Nasrabad, Hajiieh B. u.a.: The Iranian ART Revolution: Infertility, Assisted Reproductive Technology, and Third–Party Donation in the Islamic Republic of Iran. In: Journal of Middle East Women’s Studies 4(2), (2008), 1-28. Clarke, Morgan: New Kinship, Islam, and the Liberal Tradition: Sexual Morality and New Reproductive Technology in Lebanon. In: Journal of the Royal Anthropological Institute 14(1) (2008) 153-169. Gürtin: Patriarchal Pronatalism, 40.
Gelebte Verflechtungen
»(tüp bebek) IVF-Paradies«55 dargestellt. Bis 2010 gab es flexible Regelungen bezüglich Behandlungs- und Befruchtungsverfahren, Embryotransfer und Selektion, Aufbewahrung und Vernichtung der Keimzellen und Embryonen. In der Türkei existierte keine vergleichbare Gesetzgebung wie das »Embryonenschutzgesetz« in Deutschland; Präimplantationsdiagnostik (PID), die Untersuchung von Zellen auf genetische Erkrankungen, war zum Beispiel erlaubt und wurde in den Istanbuler Kliniken auch häufig als behandlungsoptimierende Maßnahme eingesetzt. Die Zahl der Fachkliniken in der Türkei stieg von 120 im Jahr 2008 auf 148 im Jahr 2016. Schätzungen zufolge werden circa 40.000 Behandlungen pro Jahr durchgeführt.56 Zugleich nahm der Markt massiv an dem sogenannten globalen »Reproduktionstourismus« teil – im nahegelegenen Ausland, besonders auf Zypern, für ein »Outsourcing« der im Land untersagten Leistungen: die sog. »Donation«, d.h. Samen-, Eizell- und Embryospende, aber auch die sog. »Sex-Selektion«, Leihmutterschaft usw. Schätzungen zufolge gehen jährlich 5000 ungewollt kinderlose Paare und Individuen für eine Donation ins Ausland, wobei es sich hierbei laut den Klinikbetreiber/-innen und Expert/-innen primär um Eizellspenden handelt. Diese Entwicklungen sind über staatliche Regelungen legitimiert. Sie stehen im Einklang mit den Ansichten des Sunni-Islams. Dieser ist nicht nur mehrheitlich in der Gesellschaft vertreten, sondern trotz des laizistischen Rechtsstaats über ein Präsidium für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet İşleri Başkanlığı) auch in der Regulierung reproduktionspolitischer und bioethischer Angelegenheiten. Das Präsidium verhielt sich lange harmonisch mit dem bis vor kurzem dominanten Säkularismus in der Medizin-, Wissenschafts- und Technologiepolitik. Sunni-Islam betrachtet, ähnlich wie unterschiedliche Glaubensrichtungen und Schulen im Islam so Schiiten und Aleviten, die technologischen Eingriffe in den Körper nicht zwangsläufig als Verstoß gegen die natürliche, göttliche Ordnung oder gegen die Menschenwürde.57 Zu den Reproduktionstechnologien gibt es religiös motivierte Kontroversen und Debatten, aber diese beziehen sich kaum auf die Dichotomien
55 56
57
Ebd. Zum Zeitpunkt meiner Feldforschung befanden sich die Fertilitätskliniken größtenteils in den Großstädten wie Istanbul, Izmir und Ankara. Nun gibt es auch in mehreren Städten, auch in ländlich geprägten Kleinstädten (siehe www.tsrm.org.tr, Letzter Zugriff am 05.04.2020). Laut ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) existierten im Jahr 2015 in 38 europäischen Ländern 1343 Fertilitätskliniken und wurden 849,811 Zyklen pro Jahr durchgeführt. Aus der Türkei gibt es keine zuverlässigen und vergleichbaren Zahlen. Im Jahr 2008 meldete die Türkei die nationalen Zahlen bei ESHRE: 107 Kliniken und 43,928 Zyklen, davon 98 % mit der ICSI-Methode (https://www.eshre.eu/Data-collection-and-research/Consortia/EIM/Publications). Vgl. Eich, Thomas: Islam und Bioethik: eine kritische Analyse der modernen Diskussion im islamischen Recht, Wiesbaden 2005. Polat: Umkämpfte Wege der Reproduktion.
237
238
Nurhak Polat
von »Künstlich« und »Natürlich« – wie wir sie sonst aus euro-amerikanischen Kontexten kennen.58 In einem Interview sagte beispielsweise ein Vertreter des Ethikrates im Präsidium für Religiöse Angelegenheiten, dass das Präsidium grundsätzlich Medizin und Technologien fördere, die zum Wohl der Menschheit – besonders der Gläubigen – dienten. Dazu zählen, wie gerade erwähnt, das Einfrieren von Keimzellen und Embryonen genauso wie die bereits erwähnte Präimplantationsdiagnostik (PID) und Stammzellenforschung. Sie werden als eine Optimierung menschlicher und reproduktiver Kapazitäten angesehen und kaum kontrovers diskutiert. Der damalige Vertreter des Ethikrats im Diyanet İşleri Başkanlığı in Ankara begründete dies damit, dass der Islam »Technologien als Allahs Schöpfungen« betrachte, vorausgesetzt, dass die Keimzellen von Ehemann und Ehefrau verwendet werden und das gezeugte Kind aus miteinander »verehelichten« Personen stamme und seine Abstammung erkennbar sei. Wie in vielen islamischen Ländern gelten uneheliche Verfahren generell als »Vertauschung« oder »Verwirrung der Beziehungen«.59 Damit wird auf eine sexualisierte Moral der Reproduktion und Beziehungen zurückgegriffen, die im Islam verankert und im Alltag der praktizierenden Gläubigen handlungsrelevant ist. Die Praxis ›assistierter‹ Reproduktion ist gerade durch diese Moral geregelt. Sie stellt Familie und Verwandtschaft als biologischgenetische definierte Einheit in den Mittelpunkt. »Nesep« (Abstammung eines Kindes) und »soy bağı« (Verwandtschaft) verweisen auf die genetisch-biologische Bindung und Blutsverwandtschaft; Verwandtschaftsbeziehung wird einem unehelichen Kind verweigert. Die säkular-motivierten Akteur/-innen nennen diesbezüglich öfters »nationale Sensibilitäten« als akzeptable Grundlage für den regulativen Status quo. Die individuellen Ansichten sind heterogen. Auch während eines Behandlungszeitraumes bzw. langfristigen »Kinderwunschkämpfen« scheinen sie durchaus vom offenen zum konservativen Meinungsbild zu schwanken, miteinander im Widerstreit zu stehen und zu divergieren. In meiner Forschung habe ich viele Frauen und Männer, mehr als 40 im Alter zwischen 25 und 53 Jahren, sowie auch Mediziner/-innen und andere Akteure aus dem Bereich der Beratung, Bioethik und Religion hauptsächlich aus der Mittelschicht mit durchaus unterschiedlichem ethnisch-religiösem und politischem Hintergrund interviewt. Einige äußerten sich als konservative Sunni-Muslime ungeachtet der erheblichen Unterschiede in der alltäglichen Ausübung religiöser Praxen. Einige beschrieben sich als moderne, sekuläre, kemalistische Republikaner. Eine vergleichsweise kleine Anzahl waren Frauen und Männer aus politischen, religiösen und ethnischen Minderheiten im
58 59
Clarke, Morgan: Shiite Perspectives on Kinship and New Reproductive Technologies. In: Law and Ethics 17 (2006) 26-27. Inhorn: Local Babies, Global Science. Vgl. Clarke: Shiite Perspectives, 26. Inhorn: Local Babies, Global Science.
Gelebte Verflechtungen
Land – z.B. Feminist/-innen, Linke, Aleviten oder ethnisch nicht-türkische Staatsbürger/-innen. Alle hielten die konventionelle Behandlung mit eigenen Keimzellen für völlig normal. Sie befürworteten eine gesellschaftliche Normalisierung und staatliche Unterstützung. Staatliche Regulierungen und Richtlinien hielten viele für absolut notwendig, wobei einige von ihnen staatliche Überwachung in Kombination mit Verboten und Sanktionen als »Eingriff in die Privatsphäre« und als »religiös motiviert« kommentierten. Manchmal reagierten diejenigen, die sich als »modern-säkular« beschrieben und sich von »Rückständigkeit« und einer »nicht zeitgemäßen (çağdaş) Sicht« distanzieren wollten, viel konservativer auf meine Fragen als diejenigen, die sich selbst als konservativ (muhafazakar) definierten. Sie waren kritisch gegenüber der Tabuisierung und Untersagung der Eizell- und Samenspende. Es gibt Forschungen, die zu einem ähnlichen Schluss kommen. In einer quantitativen Untersuchung, die von Reproduktionsmediziner/-innen mittels Fragebögen in einer türkischen Großstadt durchgeführt wurde, sprach sich die Mehrheit der 400 befragten Frauen und Männer dafür aus, dass die Eizellspende akzeptiert und im Vergleich zur Adoption präferierbar sei und den Prinzipien des Islams kaum widerspreche.60 Da der Islam flexibel sei und von Situation zu Situation deute, was ethisch/unethisch und akzeptabel/unakzeptabel (caiz) sei, seien auch alternative Wege »willkommen«, wenn sie nicht »with the spirit of its primary sources« konfligieren und »zum Wohle der Menschheit gerichtet sind«.61 Die muslimische Perspektive ist als ein moralischer und regulativer Rahmen durchaus wichtig für die individuellen Praktiken. Wichtig zu betonen ist hier allerdings, dass viele Menschen »über die muslimische Moralität und Kultur informiert (sind), aber sie kümmern sich nicht immer darum oder folgen dieser nicht, oder sie verfügen überhaupt über kein akkurates Wissen von religiösen« Vorschriften.62 Auch für andere Bereiche, die auf moralisch-ethischen und individuellen Entscheidungen der Frauen und Männer basieren, gilt dies. Eine meiner Interviewpartner/-innen drückt das so aus: »Manchmal dehnen Menschen einfach jegliche Prinzipien aus, wenn es darum geht, Kinder zu kriegen… (dann ist es einfach egal), ob der Staat zustimmt und ob es religiös zulässig (dinen caiz) ist, ob am Ende das Kind genetisch verwandt, (dann ist es einfach egal, ob es) gesellschaftlich akzeptabel ist oder nicht…«. Eine der aktivistischen Befürwörter/-innen im Land sagte: »Die Leute werden weiterhin locker Kinder machen. Sie werden die Donation durchführen. Sie werden sowohl Eizellen kaufen, als auch Spermien. Ich meine… 60 61 62
Isikoglu, Mete u.a.: Public Opinion Regarding Oocyte Donation in Turkey: First Data from a Secular Population Among the Islamic World. In: Human Reproduction 21(1) (2005) 318-323. Ebd., 321. Gürtin–Broadbent, Zeynep: Banning Reproductive Travel: Turkey’s ART Legislation and Third–Party Assisted Reproduction. In: Reprod Biomed Online 23(5) (2011) 555-564, 559.
239
240
Nurhak Polat
setzt sich eine Person das in den Kopf, dann… [İnsanlar çatır çatır çocuk da yapacak, donasyon da yapıcak, yumurta da alıcak, sperm de alıcak yani. Ben… yeter ki bir insan karar vermesin]. Also, es ist ihre eigene Entscheidung… Wieso werden denn solche Sachen unter Druck gesetzt? Das hat natürlich auch ein wenig mit unserem Staat zu tun.« Als »modern (çağdaş)« wird die Nutzung der invasivsten Technologien gerahmt. Dennoch, nicht um des Modern-Sein-Willens, sondern gerade auch, »um den Weg zum Wunschkind zu verkürzen, das Leid und viele körperliche, seelische und finanzielle Belastungen zu ersparen«. Deshalb ist für viele »der Neueste auch oft der kürzeste Weg (en yenisi en kestirmesi demek)«. In den Beratungsgesprächen habe ich demnach auch eine »Erfolgs- und Zielorientiertheit« beobachtet. Oft haben Frauen und Männer gefragt, wie effektiv die Behandlung, die Methode und die Medikamentendosierung sei, die sie bekommen und ob »man diese erhöhen kann«. Um den Kinderwunsch zu realisieren, wären viele Familien bereit »vieles in Kauf zu nehmen«. Oft hieß es, »den Schritt zu Tüp Bebek zu wagen« gelte »nach wie vor als etwas sehr Außergewöhnliches«. Wenn man ihn gemacht hat, gehe es darum, »nichts unversucht zu lassen, um an das Ziel zu kommen«. Die Normalisierung beruht zwar auf heteronormativen Familien- und Genderkonzepten, ist aber – wie auch woanders – »keineswegs unvermeidlich, da sie mit Paradoxien, Hürden, Rückschlägen, Krisen, Unterlassungsanordnungen, Tabus, Grenzen und Vorbehalten behaftet ist«.63 In den letzten Jahren hat diese kontinuierlich zu der hochgradig politisierten und moralisierten Schnittstelle zwischen Reproduktionstechnologien, Körperpolitik und Macht beigetragen. Statt einer simplen Normalisierung habe ich die Veränderungen an dieser Schnittstelle als eine entstehende und qualitativ neuartige »sozio-technische, patriarchale Paradoxie« in der Türkei verstanden.64
4. Die Politisierung von Körpern Ich habe IVF/ICSI »als ein umkämpftes Feld« beschreiben können, in dem »die – sowohl historisch wie auch gegenwärtig – durch Staatsräson fundierten Biopolitiken auf säkulare wie religiöse Moralitäten und Regulationspolitiken treffen und diese mit individuell-familiären Reproduktionsbiografien verknüpfen«.65 Dieses Feld war Schauplatz – wie auch alle anderen Bereiche der Gesundheit, Sexualität,
63 64 65
Wahlberg, Ayo: Good Quality: The Routinization of Sperm Banking in China, Oakland 2018, 4. (Meine Übersetzung). Polat: Umkämpfte Wege der Reproduktion. Ebd., 11.
Gelebte Verflechtungen
Reproduktion und Familie – der Durch- und Umsetzung neokonservativen-neoliberalen Autoritarismus nach AKP. Während meiner Feldforschung und stärker nach 2010 – beginnend mit der dritten Regierungszeit der AKP – wurden sowohl die Reproduktionskörper als auch die »normalen Biographien« zu einem Mittel ideologischer und moralischer Machtkämpfe um die soziale Ordnung. Seit Jahrzehnten hat die AKP nicht nur pronatalistische Diskursverschiebungen wie den Grundsatz »drei Kinder pro Familie« oder »Abtreibung ist Mord« vorangetrieben. Auch die staatliche Überwachung, Kontrolle und Repression bezüglich reproduktiver Selbstbestimmung und Rechte – besonders der Frauen – wurde verschärft. So wurde eine freiwillige Abtreibung, die gesetzlich nach wie vor bis zur 10. Woche der Schwangerschaft legal ist, in etwa den letzten fünf Jahren praktisch unmöglich gemacht. Frauen und Frauenbewegung haben mit Parolen wie »Mein Körper, meine Entscheidung« dagegengehalten. Dennoch haben sich neue Modi eines konservativen »Familialismus«66 und »patriarchalen Pronatalismus«67 durchgesetzt, welche auf patriarchalen und populistischen Topoi beruhen. Frauen werden als Mütter der Nation aufgefordert, mehr Kinder zu gebären – unter Ausschluss von Alleinstehenden und LGBTQI-Personen, nicht-heterosexuellen Partnern, aber auch von ethnisch, religiösen Minderheiten wie Kurden und Armeniern.68 Korkut und EslenZiya argumentieren, die AKP versuche »ihre Kontrolle über das Geschlecht und über andere Identitäten durch ein Mikromanagement der Bedingungen für Geburt und Reproduktion im Allgemeinen zu erweitern«.69 Es geht also um eine Umgestaltung der Gesellschaft nach einer sunnitisch-islamischen »moralisch-kulturellen Ordnung«.70 Wie feministische Sozialwissenschaftlerinnen bereits mehrfach kritisiert haben, operiert diese Ordnung auf verschiedenen Ebenen des »nationalistischen, islamistischen und patriarchalischen moralischen Wahrheitsregimes«71 und fördert hegemoniale, geschlechtsspezifische Ideologien der Reproduktion und
66 67 68 69
70
71
Korkman, Zeynep K.: Politics of Intimacy in Turkey: Just a Distraction from ›Real‹ Politics?. In: Journal of Middle East Women’s Studies 12(1) (2016) 112-121. Gürtin: Patriarchal Pronatalism. Mutlu, Burcu/Şen, Neslihan/Erten, Nilay u.a.: Cinsellik, Üreme– Doğurganlık ve Sağlık Politikaları Üzerine Bir Sohbet. Feminist Yaklaşımlar, (34-45) (2019) 122-154. Korkut, Umut/Eslen–Ziya, Hande: The Discursive Governance of Population Politics: The Evolution of a Pro–Birth Regime in Turkey. In: Social Politics 26(1) (2016) 555-575, 558. (Meine Übersetzung). Acar, Feride/Altunok, Gülbanu: The ›politics of intimate‹ at the Intersection of Neo–liberalism and Neo–conservatism in Contemporary Turkey. In: Women’s Studies International Forum 41(1) (2013) 14-23, 18. Özgüler, Cevahir/Yarar, Betül: Neoliberal Body Politics: Feminist Resistance and the Abortion Law in Turkey. In: Harcourt, Wendy (Hg.): Bodies in Resistance: Gender and Sexual Politics in the Age of Neoliberalism, London 2017, 133-161, 144.
241
242
Nurhak Polat
der Reproduktionskörper als »neue nationale Werte«72 . Die »reproduktive Governance«73 wurde unter dem autoritären Regime der AKP zu einer ständigen autoritären Überwachung und Kontrolle gewendet. Sie hat die oben erwähnte sexualisierte Moral reproduktiver Körper und Verwandtschaftsbeziehungen als kulturellen Rahmen in den Debatten festgesetzt. In Bezug auf Drittspende wurde oft eine angebliche »Degeneration« der Gesellschafts- und Familienwerte angesprochen. Schließlich wurde bei einer Neu-Regulierung im Jahr 2010 ein Paragraph hinzugefügt, der nicht nur die Inanspruchnahme der Eizell- und Samenspende streng unter staatliche Überwachung stellt, sondern Sanktionen gegenüber Kliniken, die diese Behandlung vermitteln, und gegenüber Paaren, denen wegen der »Täuschung der Abstammung des Kindes« (Çocuğun soybağının karıştırılması) juristische Folgen drohen. Nicht selten werden solche Veränderungen in den öffentlichen wie akademischen Diskussionen als ein Bruch mit dem säkular-nationalistischen Regime im Land aufgefasst. Sie werden als ein Symbol der herrschenden religiösen Ideologie des Sunni-Islams angesehen und durch die angeblich kulturelle Verschiedenheit des Landes begründet. Vielmehr spiegeln sie allerdings die komplexe Verschmelzung von populistisch-autoritären Pronatalismen, biopolitischer Gouvernementalität und neoliberaler Globalisierung wider.74 Ethnografisch gilt es daher, den Fokus gleichzeitig auf staatliche Regulierungen, bioethische Normierungen, Ideologien sowie individuelle Strategien und Praktiken zu richten. In den folgenden Vignetten geht es um den »gelebten Körper«75 – und seine signifikanten, aber nicht statischen Grenzen.
5.
Gender- und Verwandtschaftsarbeit im Labor und in den Kliniken
»Vom Körper ins Labor und wieder vom Labor in den Körper« Es ist frühmorgens im Jahr 2009. Ich bin von zwei Laborassistentinnen für den Eintritt ins Labor vorbereitet worden, ausgestattet mit einem grünen Laborkittel, dazu Mundschutzmaske, Haube und Praxisschuhe. Lächelnd begleitet mich die Embryologin ins Labor, das aus zwei nebeneinanderliegenden Räumen besteht, die durch eine Tür miteinander verbunden sind. In einem werden operative Eingriffe, 72
73 74 75
Mutluer, Nil: The Intersectionality of Gender, Sexuality, and Religion: Novelties and Continuities in Turkey during the AKP Era. Southeast European and Black Sea Studies 19(1) (2019) 99-118, 113. Morgan, Lynn M./Roberts, Elizabeth F.: Reproductive Governance in Latin America. In: Anthropology & Medicine 19(2) (2012) 241-254. Özgüler/Yarar: Neoliberal Body Politics. Lock/Farquhar: Beyond the Body Proper, 1.
Gelebte Verflechtungen
die Eizellentnahme und der Embryotransfer durchgeführt. In dem anderen werden die entnommenen Zellen gereinigt, selektiert, manipuliert und später im Reagenzglas befruchtet. Mit der Eizellentnahme beginnt ein über mehrere Tage andauernder Prozess, der sich bis zum abschließenden Transfer der befruchteten Eizellen in den Uterus der Frau erstreckt. Ich stehe an der Türschwelle, als die Operation der Eizellentnahme beginnt. Auf dem Operationstisch liegt eine Frau, die ich Perrin nennen möchte, halb betäubt, d.h. sie kann den Arzt und die Psychologin noch hören – letztere sitzt neben ihr, um ihr moralische Unterstützung zu geben. Danach wird sie sich an nichts mehr erinnern. Die Eizellentnahme wird mit Hilfe einer dünnen Nadel durch die Scheide durchgeführt, per Ultraschall überwacht, wobei die zuvor medikamentös stimulierten Eizellen »gesammelt« werden. Drei Mal geht eine Petrischale mit Eizellen in den anderen Raum. Embryologin Pekel reinigt die Zellen und führt den ersten Check unter dem Mikroskop durch. Laut verkündet sie dem Team die Anzahl der Eizellen: »Fünf, sieht gut aus«, »zwei verwendbar«; noch eine Petrischale: »Sechs gut«, »es läuft sehr gut« ruft sie. Insgesamt werden 15 Eizellen entnommen. Auf die Tafeln und in das Laborheft werden sofort die exakten Informationen eingetragen: Der Name der Patientin, die Anzahl der entnommenen Eizellen und das dazugehörige Datum; mit farbigen Karten vermerkt, jeden Tag eine andere Farbe, um »die Zeit der Zellen seit der Entnahme zu verfolgen«. Zeitgleich soll der Mann von Perrin eine »frische Samenprobe« für das Spermiogramm, die Spermaanalyse, abgeben. Dies erfolgt durch Masturbation in dem sogenannten »Samenproberaum«. Während ich der Embryologin dabei zusehe, wie sie die entnommenen Zellen für die Befruchtung vorbereitet, ist die Laborassistentin genervt. Der Mann könne nicht und verweigere sich, die Embryologin solle mit ihm reden. Ich könne sie nicht begleiten, weil es eine zu intime Situation sei. Es sei normal, viele Männer würden »sich davor scheuen« und spürten einen Druck, als seien sie »auf die Probe gestellt mit ihrer Männlichkeit«. Beim Spermiogramm erst recht, sagt sie, weil es die Zeugungsfähigkeit des Mannes nach Kriterien wie Anzahl der Spermien im Ejakulat, deren Form und Beweglichkeit, Aussehen, Farbe und Geruch beurteilt. Bei Perrins’ Mann sehe es gut aus: »Normal«, »gutes Volumen«, »keine Anomalie zu sehen«, »schön bewegliche Spermien in typischer Schwimmkompetenz«, unterrichtet sie mich, »damit können wir arbeiten«. Hier liegen die Normwerte und Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugrunde. Bei dem Paar, wie bei vielen anderen, wird eine ICSI durchgeführt. Als die Embryologin es mir vorführt, erzählt sie: »Das Spermium wird mit einem Schlag durch eine Pinzette unbeweglich gemacht; es muss also nicht zwischen den vielen Millionen Spermien in das Innere der Eizelle gelangen«. Dem Spermium, das die Glashaut, eine das Ei umgebende Hülle, durch seine Beweglichkeit und Kraft penetrieren soll, werde diese Rolle nun genommen. Im Vergleich zu einer »spontanen Befruchtung«, ein Begriff, der in Kliniken oft sowohl für »Befruchtung im Körper« und »Befruchtungen in der Petrischale« benutzt wird, diene ICSI in verschiedener
243
244
Nurhak Polat
Weise zu einer »Umgehung einiger Schritte« und spare dem Klientel Zeit, Geld und Nerven. Unterschiedlichste Technologien und Praktiken der Selektion und der Überwachung werden dafür gezielt eingesetzt. »Befruchtung im Labor« wird als ein Prozess »vom Körper ins Labor und wieder vom Labor in den Körper« definiert und gehandhabt. Es gehe darum, die Beziehung zwischen verschiedenem biologischem Material, Körper und realen Personen zu koordinieren und »den Paaren schnellstmöglich zur Schwangerschaft zu verhelfen und Kinder zu haben«. Dabei sei es nötig »bestmögliche Technologien« anzuwenden, um eine »möglichst natur- und körpernahe Umwelt« im Labor zu schaffen. Ob diese als invasiv empfunden werden oder nicht, hängt oft mit dem medizinischen Blick auf Körper und Reproduktion zusammen. In einem Labor ausgerüstet mit Luftreinigern, Lichtoptimierern, sensiblen Filtern und Ultratiefkühlgeräten für Kryokonservierung, für das Einfrieren und Aufbewahren von eingefroren Ei- und Samenzellen unter enorm strikten hygienischen Maßnahmen, haben Mediziner/-innen oft einen anderen Blick auf das, was als invasiv gilt. Sie arbeiten und leben in einer Welt mikroskopischer Linsen, Nadeln und Skalpelle, wo sie den Körpern, Körperflüssigkeiten und Substanzen flexible Deutungen beimessen.76 Eine Embryologin drückte dies so aus: »Manchmal bedeutet eine Eizelle einer Frau viel, vor allem, wenn sie einem ihre Eizellen mit einem enorm dramatisch erlebten Wunsch nach einem Kind als Symbol ihrer Weiblichkeit und als zukünftige Kinder anvertraut, aber manchmal ist es alles was man entnimmt. Als würden sie einfach eine Substanz produzieren, ein Material, an dem sie ›arbeiten‹.« Dies gilt ebenso für Samen- und Eizellen wie für Embryonen, die »als Vorstufe des Lebens« oder als »potentielles Individuum« verstanden werden, »das niemals existieren würden, wenn man es der Natur überlassen würde«. Der Natur wird es nicht überlassen, sondern es werden durchaus flexible, zweckorientierte und hoch-technische Verfahren der Selektion und Überwachung eingesetzt. Als neueste Technologie gilt das Embryoscope: Ein Kultivierungs- und Dokumentationsgerät, das eine 24 stündige mikroskopische und digitalisierte Überwachung der Entwicklungsphasen der Embryonen ermöglicht. Früher sei das »(bloße) Auge«, wird mir erklärt, für die Beurteilung der Zellenteilung, das Tempo der Teilung und die Qualität des Embryos entscheidend gewesen. Nun sichere man damit »ungestörte Bedingungen für das Embryo«, fast natur- und körpernah eben. Denn Embryonen müssten nicht mehr für eine Untersuchung aus dem Brutschrank rausgeholt werden, wo sie den Risiken einer Kontamination ausgesetzt seien. Paare bekommen mittlerweile, wenn sie möchten, eine Kopie der Aufnahmen des Embryoscope. Sie
76
Vgl. Barnes: Conceiving Masculinity.
Gelebte Verflechtungen
werden mit Hilfe der Aufnahmen auch über den Verlauf der Behandlung unterrichtet, etwa darüber, wie sich die befruchtete Eizelle teilt; erst einmal in zwei Zellen, dann in vier, acht und schließlich nach fünf Tagen gut 100 Zellen, »wenn alles normal verläuft«. Während meinen Aufenthalten in den Kliniken höre ich von Paaren öfters, wie wichtig es für sie ist, dass »die besten Embryonen ausgewählt und eingesetzt werden, um die Chancen auf die erhoffte Schwangerschaft und Geburt zu erhöhen«. Meine zweite Vignette ist durchaus typisch für den Umgang mit körperbezogenen Technologien und Behandlungslogiken, die den Paaren geschlechtlich und körperlich völlig unterschiedliche Zumutungen auferlegen.
Körper als eine Ansammlung von Körperteilen 2010. In einer anderen Klinik. Ich treffe die Belcans, ein frisch verheiratetes, gebildetes, berufstätiges Ehepaar aus einem wohlhabenden Stadtteil Istanbuls. Sie mögen es, sowohl in ihrer »Paarbiographie«, als auch im Kinderwunschprozess und in ihrem Lebenstil alles vorauszuplanen. Wir sitzen in einem kleinen privaten Raum, in den die 32-jährige Ayse Belcan nach ihrem Embryotransfer gebracht wurde. Ihr Ehemann scheint beunruhigt und möchte das Gespräch schnell abwickeln. Sie aber will reden. Bei ihnen liegt der »männliche Faktor« vor: »geringere Spermienanzahl«. Daher entscheiden sie sich für eine schnelle und effiziente Behandlung: »Direkt IVF/ICSI«. Can, der Ehemann, bezeichnet sich als »Realist«, für ihn würden »wissenschaftliche Fakten« gelten, er halte sich an die Zahlen und die Erfolgsrate, die die Behandlungen versprechen. Ayse hingegen sei von Anfang an skeptisch gewesen. Denn das Problem sei die geringe Spermienzahl, bei ihr gäbe es kein Problem, keine Eizelle- oder Gebärmutteranomalien, die eine Schwangerschaft verhindern könnten. Es könne also durchaus »auf dem normalen Weg klappen«. ICSI »beschleunige« es nur. Dafür entscheidet sich das Paar schließlich, da ICSI – die direkte Spermieninjektion – ihnen der beste und effizienteste Weg zu sein scheint, besonders, weil sie hoffen, dass tatsächlich die beste Samenzelle ausgewählt und direkt mit der am besten geeigneten Eizelle befruchtet werden würde. »So ist es besser« sagt Can, Ayse korrigiert ihn mit dem Einwand, dass es für sie nicht so leicht gewesen sei. Sie wäre »mit einem Haufen Hormone vollgepumpt« worden; »bei der Eizellentnahme durch Fremdkörper aufgesaugt« und »beim Embryotransfer mit literweise Wasser vollgepumpt, bis ihre Blase fast platzte«. Sie mache sich zudem Sorgen über die Hormonbehandlung: »Den eigenen Körper dermaßen aufs Spiel zu setzen, ist, wenn man es bedenkt, wirklich etwas sehr Großes. Sie denken nur an das Baby, aber Sie spüren, was Sie erleben, Sie fragen sich, was noch kommen wird, ob es andere Spuren in Ihrem Körper hinterlassen wird?«
245
246
Nurhak Polat
Sie verwandle sich »von einer Frau zu einer Patientin«, und hätte sich täglich selbst »Spritzen in die Hüfte und dann in den Bauch verpassen« müssen. Der Aufwand sei für sie enorm gewesen; sie habe täglich einen halben Tag dafür einplanen müssen, geschweige denn die Fahrten in die Klinik, und halb schwerzhaft lachend meint sie, dass Can einfach »ausbüxen kann«. Ihr Ehemann habe zwar auch behandelt werden müssen, aber nur zu Beginn mit Medikamenten zur Stimulation der Spermienproduktion (mit einem Medikament namens Gonadotropine, Sexualhormone, die injiziert werden). »Stellen Sie sich vor, während ich unterwegs bin, irgendwohin; ich muss mir eine Spritze geben. An einem Ort wie Istanbul können Sie nichts machen. Das werde ich nie vergessen, ich bin (…) in ein Mc Donalds gegangen, ein mal in eine Tankstelle, hab mir in den Bauch gespritzt und die Spritze weggeschmissen. Als ich aus der Toilette rausgegangen bin, habe ich mich wie eine Heroinabhängige gefühlt«. Wie viele andere Paare, sehen sich auch die Belcans durch die geschlechtlich unterschiedlichen Behandlungen, die sie als durchaus »asymmetrisch« bezeichnen, heraus- und aufgefordert, eine Haltung zu den somatischen, körperlichen, leiblichen und seelischen Zumutungen zu entwickeln, die ihnen durch die Behandlungen auferlegt werden. Auf die kulturellen Erklärungsmuster greifen sie manchmal zurück, wie z.B. dass Gebärfähigkeit ein »natur- und gottgegebenes Privileg« der Frau sei, deren Körper als Feld (tarla), wie einige Interviewpartner/-innen bezeichneten, gerade bei reproduktionsmedizinischen Behandlungen eine absolut entscheidende Rolle bei der Befruchtung (döllenme) annehme, während Männern als »Samengeber« eher eine sekundäre Rolle darin zustünde. Die Körper- und Gender-Arbeit schließt vieles zusammen, sie fängt weder im Labor an, noch hört sie in den eigenen Körpern auf. Diese Arbeit ist mit dem verwoben, bzw. wird erst dadurch erzeugt, was der Soziologe Stefan Hirschauer kürzlich in Bezug auf Schwangerschaft als »paarbiografische Pfadabhängigkeiten« bezeichnet hat.77 Diese Abhängigkeiten stellen sich meistens als Herausforderungen und Spannungen dar, wie zum Beispiel bei dem Paar Belcan gerade dann, als das Paar von »Sex-nach-Rezept« auf eine viel komplexere Behandlung übergegangen ist. Die paarbiographischen Pfadabhängigkeiten beziehen sich im reproduktionsmedizinischen Kontext primär auf die »diskrepanten biographischen, hormonellen und kryotechnischen Temporalitäten« im Alltag der Paare, die »ihre körperliche, psychische und materielle Einbindung in die Behandlungszyklen antizipieren und verkörpern« müssen. Wichtig dabei ist, dass der Körper »als eine Ansammlung von Körperteilen«78 behandelt, empfunden und erlebt wird. 77 78
Hirschauer, Stefan: Mein Bauch gehört uns. Gynisierung und Symmetrisierung der Elternschaft bei schwangeren Paaren. In: Zeitschrift für Soziologie 48(1) (2019) 6-22. Becker: Elusive Embryo, 26.
Gelebte Verflechtungen
Wie Sarah Franklin es betont hat, »once inside this topsy-turvy world«, einmal in dieser verkehrten Welt der Medizin, sehen sich viele Paare »einem nicht leichten Prozess von Schritten gegenüber, die zu potenziellem Erfolg führen – es ist eine verwirrende und stressige Welt von unzusammenhängenden Zeitlichkeiten, verwirrenden Emotionen, schwierigen Entscheidungen, ungewohnten Verfahren, medizinischem Jargon und metabolischem Chaos«.79 Auch die folgende Vignette ist ein Beispiel dafür.
Ein weiterer Schritt in der »Technologie-Hierarchie« gegen die »Besessenheit für Gene« Auch das Paar Durmaz stand, wie viele Paare, mit denen ich in den Kliniken zu tun hatte, vor einer Herausforderung, »da es sich nicht nur um eine kleine technische Hilfe handelte«. Sie müssten eine gewisse Flexibilität aufbringen, während sie in den ersten fünf, sechs Behandlungen »festgefahren in den Denkmustern nach einem leiblichen, genetisch verwandten Kind« waren. Nach einem Vorlauf von zahlreichen Versuchen mit minimal-medizinischer Hilfe, hatte das Paar neun IVF/ICSI-Behandlungen innerhalb einer zwölf jährigen Ehe. Für Frau Durmaz hatte es unmittelbar mit ihrer Weiblichkeit zu tun. Denn oft fühlte sie sich damit konfrontiert, dass es ihre Eizellen, Eierstöcke und ihre Gebärmutter seien, die »nicht harmonisch funktionieren« und »scheitern«. Sie ging von einem Behandlungszyklus zum nächsten über und suchte nicht nur nach mehr Informationen und Wissen über ihren eigenen Körper, sondern für die Optimierung ihrer reproduktiven Funktionen auch nach den neuesten Methoden, die auf den Markt kamen – in der Hoffnung, dass diese ihr zum Ziel, nämlich zu einem leiblichen Kind verhelfen. Sie beklagt selbst- und medizinkritisch, dass sie »eine Zeitlang so paranoid« über sich selbst, über ihren eigenen Körper und die Medizin gewesen sei. Sie überwachte ihre wöchentlichen Hormonwerte, hielt diese in Excel-Tabellen fest, um die Hormonschwankungen zu verstehen, und auch andere Untersuchungsergebnisse wie die Anzahl der entnommenen, befruchteten und übertragenen Eizellen. Denn das Problem sei als »weiblicher Faktor« definiert worden, bei ihrem Ehemann seien die Werte nach einem Spermiogramm soweit gut. »Das Gebärmutterinnere ist sehr sauber«, auch »die Härchen an der Gebärmutter meiner Frau sind fantastisch«, erklärt Herr Durmaz. Da könne »der Embryo sich sehr gut einnisten und nähren«. Eine derartige Beschreibungsweise ist untypisch, besonders für Männer. Sie illustriert durchaus ein verändertes Verständnis vom reproduktiven Frauenkörper. Sie spiegelt zudem ganz gut den klinischen Blick auf männliche und weibliche Körper als Problem und Ort im Kontext von ›assistierter‹ Empfängnis wider. Die
79
Franklin: Biological Relatives, 7. (Meine Übersetzung).
247
248
Nurhak Polat
Weiblichkeit wird auf einer mikroskopischen und hormonellen Ebene ausgehandelt. Die »fantastischen Härchen« und die »saubere Gebärmutter« allein reichen allerdings nicht aus, der ganze Prozess verwandelt sich quasi in einen »Kampf um Eizellen«. Bereits im Jahr 1999 wurde dem Paar eine Eizellspende nahegelegt, damals von der Türkei aus nur in Belgien möglich. »Schlag dich doch nicht damit herum, mit schlechten Eizellen«, meinte der Arzt, »wohlwollend«, was beim Paar ein moralisches Dilemma auslöste, das sie jahrelang begleitete: »Wie weit können wir gehen?« Ihre Antworten änderten sich, jedes Mal wenn sie in der quasi ›TechnologieHierarchie‹ einen Schritt weitergingen und sich nicht wagten »einfach so aufzuhören«. Schließlich, »nach mehreren Fehlschlägen, einem investierten Vermögen und kaputten Nerven« kam es doch zu einem »allerletzten Versuch« vor der Adoption, einem Versuch mit den »gespendeten Eizellen einer anderen Frau«. Dabei habe sie »von 1999 bis schließlich 2007 daran festgehalten [ein genetisch-verwandtes Kind zu bekommen]. Ich war über die Jahre so beharrlich, um bloß nicht eine Spende nutzen zu müssen. Du kannst es halt nicht so einfach akzeptieren; du willst, dass es aus deinen Genen, aus deinem ›was weiß ich was‹ stammt«. Es war ein erheblicher Schritt für das Paar, aber vor allem für Pelin, die damit klarkommen müsse, falls es klappte, »das Kind einer anderen Frau auf die Welt zu bringen«. In ihrem Körper würde die »Eizelle einer Fremden mit dem Sperma deines Mannes eingepflanzt« werden. Interessant fand ich im Gespräch, dass sowohl die Eizelle einer anderen Frau als auch der Zeugungsvorgang zweckrationalisiert werden. Für sie galt, dass sie eine leibliche Bindung haben würde, weil sie das Kind austrage und ihr Mann genetisch mit dem Kind verwandt wäre. Hier operieren andere Bezüge auf die Eizelle als Zeugungssubstanz. Pelin selbst nahm einiges in Kauf, unter anderem, dass ihr Körper jahrelang mit einem »Haufen Hormone vollgepumpt wurde«, um eine einzige verwendbare Eizelle zu produzieren. Denn diese steht für ihre Weiblichkeit, genauso wie »verwandtschaftshaltig«80 für die gewünschte genetische-leibliche Bindung steht. Ihr sei nicht völlig egal, »wo die Eizelle herkommt«. Wichtiger erscheint ihr die Funktion, wenn sie sagt »dass die Eizelle, die ich nehme, ihre Funktion erfüllt«. Sie wünscht sich nur, dass »die Spenderin nur für mich Eizellen gibt« und »diese nicht bei einer anderen Frau eingesetzt werden«. Diese Haltung ist bei weitem nicht widersprüchlich. Die Kalkulationen zum besten Erfolg mit eigenen Zellen werden nicht außer Kraft gesetzt. Im Gegenteil, die bestmögliche Behandlung wird erzielt. Am Ende geht es ihr um, »ein leibliches Kind, das sie ja selbst auf die Welt bringt«. Auch dies führte nicht
80
Hauser–Schäublin: Manipulierte Substanzen.
Gelebte Verflechtungen
zur gewünschten Schwangerschaft, dennoch einen Schritt weiter im Wertehorizont. Auf der Suche nach einer Normalität und Rationalisierung reflektierte das Paar nun, durchaus unterschiedlich voneinander, anders als zuvor »über das jeweils eigene festgefahren sein« auf leiblich-genetischer Bindung mit dem Kind. Die gesetzliche und gesellschaftliche Priorisierung der genetischen Bindung und Abstammung verliert immer mehr an Bedeutung. Das Verbot der Ei- und Samenspende konnte das Paar nie richtig nachvollziehen, selbst wenn beide diese für sich nicht wünschen würden. »Woher kommt eine solche Besessenheit für Gene?«, beklagte sich Herr Durmaz. Besonders nach der Adoption blickt das berufstätige Paar aus der Istanbuler Mittelschicht völlig anders auf ihre Bemühungen um ein leibliches, genetisch verwandtes Kind. Die Ehepartner/-innen setzen sich auch mit den staatlichen Regelungen auseinander, gar mit diversen Verbotspolitiken sowie auch der gesetzlichen wie gesellschaftlichen Priorisierung der »genetischen Bindung« und »Abstammung«. Im Vergleich zu einigen meiner Interviewpartner/-innen, machten die Durmazs ihre Entscheidungen nicht von den religiösen Vorschriften abhängig. Das Paar führt sowieso eine interkonfessionelle Ehe; Serkan bezeichnet sich als Alewit, während Pelin der sunni-islamischen Glaubensrichtung angehört. Allerdings praktizieren beide kaum, weil sie eher säkular erzogen wurden. Oft versuchen sie nicht einmal, ihre Entscheidungen mit religiösen oder staatlichen Vorschriften zu vereinbaren. Viel mehr kommt in meinen Interviews mit ihnen die »flexible reproduktive Biografisierung im Zeitalter biopolitischer Möglichkeiten«81 zur Sprache. Flexibilität bedeutet nicht ein einfaches Abwägen zwischen technologischen Optionen, sondern eine immer wiederkehrende Konfrontation mit ihren multiplen Moralvorstellungen und einem einfachen Voranschreiten im Rahmen unterschiedlicher technologischer Optionen, wobei sie »situativ Grenzen des Gewollten – nicht des Möglichen – für sich formulieren«82 . Ihre reproduktionsbiographischen Praktiken und Erfahrungen passen sie mal an die normativen Vorstellungen der Herstellung von Geschlecht, Familie- und Verwandtschaft an, mal dezidiert dagegen.83 Die Durmazs verschweigen weder ihre »Donations-Geschichte« noch die Adoption in ihrem Umfeld. Bei unserem allerletzten Treffen im Jahr 2013 sagte Selin, dass »das Bild von einer glücklichen Familie vervollständigt« sei, wozu eben ein Kind gehöre, wofür sie »blind alles gemacht hat«, »und gegen den Staat gekämpft (hat) (…), der einen gezwungenermaßen außerhalb des (legalen) Systems (stößt). Schlussendlich habe sie diesen Kampf gewonnen«. Sie sagte: »denn es ist so als käme er aus meinem Körper. Also er kam nicht aus meinem Körper, aber es ist, als käme er aus meinem Körper. Ob mit Spende oder Adop81 82 83
Hess: Flexible Reproduktive Biografisierung. Ebd:, 119. Vgl. Strathern: Reproducing the Future. Becker: Elusive Embryo.
249
250
Nurhak Polat
tion, was zählt, sind nicht die Gene. Es ist die Erziehung und die Tatsache, dass es ja in unsere Kultur hineinwachsen wird. Wir werden ihn großziehen, solange wir es richtig tun, ist alles andere nebensächlich«. Dieses Beispiel zeigt, wie Paare unterschiedliche Kinderwunschwege einschlagen und wie sich dabei ihre Perspektive auf Fortpflanzung, Körper, Geschlecht und Familie ändert. Wie in den vorherigen Beispielen geht es auch hier um signifikante Verschiebungen, die im Umgang mit Biomedizin und durch vielfältige Kalkulationen und Zwänge, im Prozess entstehen können. Wie die individuell und gesellschaftlich ambivalent empfundenen Formen der Technologienutzung, ist auch die Familiengründung davon nicht ausgenommen. Selbst wenn bestimmte Wege und Familienkonstellationen in einer mehrheitlich sunnitisch-muslimischen und konservativ geprägten Gesellschaft wie der Türkei weitgehend diskreditiert werden und unter gesellschaftlicher und staatlicher Überwachung stehen, ist hier auch eine pluralisierende Wirkung festzustellen.
6.
Schluss
In dem vorliegen Beitrag habe ich heterogene, dynamische Konfigurationen in den Blick genommen, wie Reproduktionskörper – als holistisches Ganzes oder in Teilen – be- und verhandelt werden. Inspiriert von praxisorientierten Perspektiven auf Körper, habe ich untersucht, wie individuelle Umgangsweisen und Vorstellungen sich ändern und durch »intensive körperliche Eingebundenheit an einem halböffentlichen Prozess beteiligt (sind), in dessen Verlauf unter Hinzuziehung zahlreicher Experten ein Kind, legitime Eltern und zusätzliche Verwandtschaftsbeziehungen entstehen sollen«.84 Es ging weniger um ein einfaches Einbetten assistierter Reproduktion in den Alltag der Individuen, als vielmehr darum, wie Körper(teile) als Substanzen und Sites norm(alis)ierender, situativer und sich rekursiv aktualisierender Prozesse und Praktiken hervorgebracht und flexibel »de- und rekontextualisiert«85 werden. Hierbei war es mir wichtig an die »gelebten Körper« und ihre Teile heranzukommen. Etwa, wie Körper, ihre Teile und Grenzen hervorgebracht, in Relation zu natürlichen Fakten und tradierten Vorstellungen von Gender, Biologie, Mutterschaft, Vaterschaft und auch Verwandtschaft erlebt, neu gedacht und als solche begründet werden. Ich nahm eine anthropologische und praxeologisch orientierte Perspektive an und fragte danach, welche Verknüpfungen zwischen Kliniken, Alltagen und körperpolitischen Regimen im Umgang mit Reproduktionskörpern und -technologien operieren bzw. aktiviert werden. Um Lock und Farquhar noch 84 85
Knecht/Klotz/Polat u.a.: Erweiterte Fallstudien zu Verwandtschaft, 31. Lenz, Ilse/Mense, Lisa/Ullrich, Charlotte (Hg.): Reflexive Körper? Zur Modernisierung von Sexualität und Reproduktion, Wiesbaden 2004.
Gelebte Verflechtungen
einmal zu zitieren: Körper wurde in den Sozialwissenschaften bislang als »Einheit der Individualität« aufgefasst und als »eine hautgebundene, rechtetragende, kommunizierende, erfahrungssammelnde, biomechanische Einheit behandelt«.86 Wie viele Anthropolog/-innen bereits betont haben, verkompliziert das Aufeinandertreffen von Biotechnologien, lokal situierten Körperverständnissen, individuellen und institutionellen Praktiken die Perspektiven auf den Körper. Zum Schluss möchte ich zwei Aspekte unterstreichen, für die die dargestellten Vignetten bzw. die Wege zum Kind stehen. Erstens geht es beim Umgang mit Körpern und ihren Fragmenten nicht zwangsläufig um eine eskalierende Normalisierung der Interventionen in den Körper. Es handelt sich eher, um spezifische Momente und Praktiken, in denen auf die gesellschaftlich und medizinisch tradierten Vorstellungen von reproduktiven Frauen- und Männerkörpern zurückgegriffen wird bzw. in denen diese durch die Praktiken selbst stets aktualisiert werden. Ärzt/-innen sowie Patient/-innen/Konsument/-innen im türkischen Kontext argumentieren häufig, dass die »Befruchtung-im-Labor« weder als ein »Wunder« noch als ein moralisch problematischer Eingriff in die Natur zu betrachten sei. »Ich verändere nur die Wahrscheinlichkeiten«, sagte mir beispielsweise ein Arzt. Er führe »die Reproduktion zu einem Ende«, in dem er die Wahrscheinlichkeiten verändere. Dabei ginge es um die Optimierung reproduktiver Kapazitäten, die ihm durch die Körper, die Zellen und Substanzen zur Verfügung stünden. Betrachtet man die Praktiken Einzelner, geht es um Grenzziehungen zwischen Normal und Pathologisch sowie zwischen technologischen, körperlichen, leiblichen, sozialen, politischen, rechtlichen wie ethischen Aspekten, die mit der Nutzung dieser Technologien verwoben sind. Im Umgang mit ihnen entstehen auch neue Erklärungsweisen über das Nichterfüllen der Normen sowie über die als »Defizit« stigmatisierten und empfundenen biologischen Zustände der Infertilität. Auch die Zuschreibungen von reproduktiven Geschlechterrollen ändern sich. Männer wie Herr Durmaz passen ihre Perspektive an das medizinische Wissen über Reproduktion, Reproduktionskörper und seine Fragmente an. Die Erzählung über die fantastischen Härchen der Gebärmutter seiner Frau ist zwar untypisch, aber es gibt zahlreiche ähnliche Beispiele, wie Frauen und Männer jeweils eigene Definitionen von »Normal« und vom »funktionierenden Körper« produzieren, und dabei ihren eigenen reproduktiven Körper als Teil ihrer Geschlechts-, Familien- und Verwandtschaftswege empfinden sowie gestalten. Zweitens stellen die medizinischen Prozeduren nicht nur einen fragmentierten Reproduktionskörper oder diesen als eine Ansammlung von Körperteilen her. Vielmehr üben sie, so möchte ich argumentieren, eine Geschlechts- und Verwandtschaftsarbeit aus, die auf einer mikroskopischen und mikrobiologischen Ebene
86
Lock/Farquhar: Beyond the Body Proper, 2.
251
252
Nurhak Polat
stattfindet; d.h. an und in den Körpern, Zellen und Substanzen.87 Körper nehmen unterschiedliche Formen an, und zwar in den jeweiligen Situationen, während sie im Labor mikrobiologisch vermessen, nach repro-funktionalen und physiologischen Zuständen quantifiziert, in Messwerte übersetzt sowie als biologisches Material (wie die befruchtete Eizelle und das Embryo) »generiert« und visualisiert werden. Dabei greifen die Mediziner/-innen, Laborant/-innen und Frauen und Männer auf unterschiedliche Wissensordnungen zurück.
Literatur Abbasi–Shavazi, Mohammad J./Inhorn, Marcia C./Razeghi–Nasrabad, Hajiieh B. u.a.: The Iranian ART Revolution: Infertility, Assisted Reproductive Technology, and Third–Party Donation in the Islamic Republic of Iran. In: Journal of Middle East Women’s Studies 4(2) (2008) 1-28. Acar, Feride/Altunok, Gülbanu: The ›politics of intimate‹ at the Intersection of Neo–liberalism and Neo–conservatism in Contemporary Turkey. In: Women’s Studies International Forum 41(1) (2013) 14-23. Amelang, Katrin/Bergmann, Sven/Binder, Beate (Hg.): Körpertechnologien: Ethnografische und gendertheoretische Perspektiven. In: Berliner Blätter 70 (2016). Banihaschemi, Susan: Kontroverse Reproduktion: Zur Legitimierung der Samenspende im reproduktionsmedizinischen Diskurs, Bielefeld 2018. Barkhaus, Annette/Fleig, Anne (Hg.): Grenzverläufe. Der Körper als Schnitt–Stelle, München 2002. Barnes, Liberty W.: Conceiving Masculinity: Male Infertility, Medicine, and Identity, Philadelphia 2014. Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Berlin 2007. Beck, Stefan/Knecht, Michi: Einleitung: Körper – Körperpolitik – Biopolitik. In: Berliner Blätter 29 (2003) 7-14. Beck, Stefan: Globalisierte Reproduktionsregime. Anmerkungen zur Emergenz biopolitischer Handlungsräume. In: Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen, 124-151. Becker, Gay: The Elusive Embryo: How Women and Men Approach New Reproductive Technologies, Berkeley – London 2000. Bharadwaj, Aditya: Sacred Conceptions: Clinical Theodicies, Uncertain Science, and Technologies of Procreation in India. In: Culture, Medicine and Psychiatry 30(4) (2006) 451-465.
87
Vgl. Barnes: Conceiving Masculinity. Franklin: Biological Relatives.
Gelebte Verflechtungen
Braidotti, Rosi: Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, New York 2011. Clarke, Adele E./Mamo, Laura/Fosket, Jennifer R. u.a.: Biomedicalization: Technoscience, Health, and Illness in the U.S., Durham– London 2010. Clarke, Morgan: New Kinship, Islam, and the Liberal Tradition: Sexual Morality and New Reproductive Technology in Lebanon. In: Journal of the Royal Anthropological Institute 14(1) (2008) 153-169. Clarke, Morgan: Shiite Perspectives on Kinship and New Reproductive Technologies. In: Law and Ethics 17 (2006) 26 – 27. de Jong, Willemijn/Tkach, Olga (Hg.): Making Bodies, Persons and Families: Normalising Reproductive Technologies in Russia, Switzerland and Germany, Münster 2009. Delaney, Carol: The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society, Berkeley 1991. Demircioğlu, Merve Göknar: Achieving Procreation: Childlessness and IVF in Turkey, New York – Oxford 2015. Eich, Thomas: Islam und Bioethik: eine kritische Analyse der modernen Diskussion im islamischen Recht, Wiesbaden 2005. Franklin, Sarah: Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship, Durham – London 2013. Franklin, Sarah: Embodied Progress: A Cultural Account of Assisted Conception, London 1997. Franklin, Sarah: Embryonic Economies. The Double Reproductive Value of Stem Cells. In: BioSocieties 1(1) (2006) 71-90, 75. Gupta, Jyotsna Agnihotri/Richters Annemiek: Embodied Subjects and Fragmented Objects: Women’s Bodies, Assisted Reproduction Technologies and the Right to Self–Determination. In: Bioethical Inquiry 5 (2008) 239-249. Gürtin–Broadbent, Zeynep: Banning Reproductive Travel: Turkey’s ART Legislation and Third–Party Assisted Reproduction. In: Reprod Biomed Online 23(5) (2011) 555-564. Gürtin, Zeynep: Assisted Reproduction in Secular Turkey: Regulation, Retoric, and the Role of Religion. In: Inhorn, Marcia C./Tremayne, Soraya (Hg.): Islam and Assisted Reproductive Technologies: Sunni and Shia Perspective, New York–Oxford 2012, 285-311. Gürtin, Zeynep: Practitioners as Interface Agents between the Local and the Global: The Localization of IVF in Turkey. In: Knecht, Michi/Klotz, Maren/Beck, Stefan (Hg.): Reproductive Technologies as Global Form, Frankfurt a.M. 2012, 81-110. Haraway, Donna: The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In: Grossberg, Lawrence/Cary Nelson/Paula A. Treichler (Hg.): Cultural Studies, New York 1992, 295-337.
253
254
Nurhak Polat
Hauser–Schäublin, Brigitta: Manipulierte Substanzen, rekonfigurierte Verwandtschaften. Humantechnologische Prozesse und ihre Bedeutung für Verwandtschaft zwischen Normativität und Flexibilität. In: Alber, Erdmute/Beer, Bettina/Pauli, Julia u.a. (Hg): Verwandtschaft heute. Positionen, Ergebnisse und Perspektiven, Berlin 2010, 249-277. Hess, Sabine: Flexible Reproduktive Biografisierung. Zum Kinder-Machen im Zeitalter biopolitischer Möglichkeiten – von Zeugungsstreiks und Spielermentalitäten. In: Beck, Stefan/Çil, Nevim/Hess, Sabine u.a. (Hg.): Verwandtschaft Machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Berlin 2007, 109-123. Hirschauer, Stefan: Mein Bauch gehört uns. Gynisierung und Symmetrisierung der Elternschaft bei schwangeren Paaren. In: Zeitschrift für Soziologie 48(1) (2019) 6-22. Inhorn, Marcia C./Birenbaum–Carmeli, Daphna: Assisted Reproductive Technologies and Culture Change. In: Annual Review of Anthropology 37 (2008) 177-196. Inhorn, Marcia C.: Local Babies, Global Science: Gender, Religion, and In Vitro Fertilization in Egypt, New York – London 2003. Inhorn, Marcia C./Tjørnhøj-Thomsen, Tine/Goldberg, Helene u.a. (Hg.): Reconceiving the Second Sex: Men, Masculinity, and Reproduction, New York – Oxford 2009. Isikoglu, Mete u.a.: Public Opinion Regarding Oocyte Donation in Turkey: First Data from a Secular Population Among the Islamic World. In: Human Reproduction 21(1) (2005) 318-323. Kahn, Susan M.: Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted Conception in Israel, Durham – London 2000. Knecht, Michi/Klotz, Maren/Polat, Nurhak u.a.: Erweiterte Fallstudien zu Verwandtschaft und Reproduktionstechnologien. Potentiale einer Ethnographie von Normalisierungsprozessen. In: Zeitschrift für Volkskunde 107(1) (2011) 21-48. Knorr–Cetina, Karin: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der ›Verdichtung‹ von Gesellschaft. In: Zeitschrift für Soziologie 17(2) (1998) 85-101. Korkman, Zeynep K.: Politics of Intimacy in Turkey: Just a Distraction from ›Real‹ Politics?. In: Journal of Middle East Women’s Studies 12(1) (2016) 112-121. Korkut, Umut/Eslen–Ziya, Hande: The Discursive Governance of Population Politics: The Evolution of a Pro–Birth Regime in Turkey. In: Social Politics 26(1) (2016) 555-575, 558. Lam, Carla: New Reproductive Technologies and Disembodiment. Feminist and Material Resolutions, London – New York 2016. Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt a.M. 2008. Lenz, Ilse/Mense, Lisa/Ullrich, Charlotte (Hg.): Reflexive Körper? Zur Modernisierung von Sexualität und Reproduktion, Wiesbaden 2004.
Gelebte Verflechtungen
Liebsch, Katharina/Manz, Ulrike (Hg.): Einleitung. Leben mit den Lebenswissenschaften: Wie wird biomedizinisches Wissen in Alltagspraxis übersetzt? Bielefeld 2010, 7-20. Lock, Margaret/Farquhar, Judith: Beyond the Body Proper. Reading the Anthropology of Material Life, Durham 2007. Martin, Emily: The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male–Female Roles. In: Signs 16(3) (1991) 485-501. Merleau-Ponty, Noémi A.: In Vitro Fertilization in French and Indian Laboratories: a Somatotechnique? In: Ethnologie Francaise 167 (2017) 509-518. Mol, Anne-Marie: The Body Multiple. Ontology in Medical Practice, Durham 2002. Morgan, Lynn M./Roberts, Elizabeth F.: Reproductive Governance in Latin America. In: Anthropology & Medicine 19(2) (2012) 241-254. Mutlu, Burcu/Şen, Neslihan/Erten, Nilay u.a.: Cinsellik, Üreme – Doğurganlık ve Sağlık Politikaları Üzerine Bir Sohbet. Feminist Yaklaşımlar 34-45 (2019) 122154. Mutlu, Burcu: Türkiye’de ›Üremeye Yardımcı‹ Teknolojiler: Kadınların Tüp Bebek Anlatıları. In: Özbay, Cenk/Terzioğlu, Ayşecan/Yasin, Yeşim (Hg.): Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik, İstanbul 2011, 73-93. Mutluer, Nil: The Intersectionality of Gender, Sexuality, and Religion: Novelties and Continuities in Turkey during the AKP Era. Southeast European and Black Sea Studies 19(1) (2019) 99-118. Niewöhner, Jörg/Sorensen, Estrid/Beck, Stefan (Hg.): Einleitung: Science and Technology Studies – Wissenschafts- und Technikforschung aus sozial- und kulturanthropologischer Perspektive. In: Science and Technology Studies: Eine sozialannthropologische Einführung, Bielefeld 2012, 9-48. Özgüler, Cevahir/Yarar, Betül: Neoliberal Body Politics: Feminist Resistance and the Abortion Law in Turkey. In: Harcourt, Wendy (Hg.): Bodies in Resistance: Gender and Sexual Politics in the Age of Neoliberalism, London 2017, 133-161. Polat, Nurhak: Concerned Groups in the Field of Reproductive Technologies: A Turkish Case Study. In: Knecht, Michi/Maren, Klotz/Stefan, Beck (Hg.): Reproductive Technologies as Global Form. Ethnographies of Knowledge, Practices, and Transnational Encounter, Frankfurt a.M. – New York 2012, 197-226. Polat, Nurhak: Umkämpfte Wege der Reproduktion: Kinderwunschökonomien, Aktivismus und sozialer Wandel in der Türkei, Bielefeld 2018. Rabinow, Paul/Rose, Niklas: Biopower Today. In: BioSocieties 1(2) (2006) 195-217. Rajan, Sunder K.: Biocapital. The Constitution of Postgenomic Life, Durham 2006. Roberts, Elizabeth F.: God’s Laboratory: Religious Rationalities and Modernity in Ecuadorian in Vitro Fertilization. In: Culture, Medicine and Psychiatry 30(4) (2006) 507-536.
255
256
Nurhak Polat
Scheper–Hughes, Nancy/Lock, Margaret: The Mindful Body. A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. In: Medical Anthropology Quarterly 1(1) (1987) 6-41. Strathern, Marilyn: Reproducing the Future. Essays on Anthropology, Kinship and the New Reproductive Technologies, Manchester 1992. Thompson, Charis: Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies, Cambridge – London 2005. Van der Ploeg, Irma: Only Angels Can Do Without Skin: On Reproductive Technology’s Hybrids and the Politics of Body Boundaries. In: Body & Society 10(2-3) (2004) 153-181. Wahlberg, Ayo: Good Quality: The Routinization of Sperm Banking in China, Oakland 2018. Zehnder, Kathrin: Der Mann im Sperma. Zum Verhältnis von Männerkörpern und männlichen Keimzellen in der Reproduktionsmedizin. In: GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 6(1) (2014) 111-126.
Reformierte Körper Über Transhumanismus, Christentum und somatoforme Kreativität Mathias Wirth
Auch wenn der menschliche Körper in christlicher Rezeption oft lediglich mit Zurückhaltung respektiert wird, wenn er nicht durch eine bis heute kaum überall überwundene Auffahrung makabrer Praktiken der Verachtung exorziert wird, wenn der Körper als signifikanter Agent der miseria hominis gilt, verfehlen Hoffnungskonzeptionen, wenn sie nicht auch auf den Körper setzen, nichts weniger als den faktischen Menschen. Denn Existenz konkretisiert sich körperlich. Da menschliche Körper zugleich auf Aneignung warten, kann auf sie bezogene Kreativität und Transformation insofern als moralische Praxis behandelt werden, als ein individuelle Gutes entstehen kann. Die Frage nach einem ›reformierten Körper‹, der sich auf dieser Linie durch »need for change, reevaluating knowledge, recognition of multiple identities, and opposition to sharp classifications«1 auszeichnet, ist bisher noch nicht in einer nach Synthesen suchenden Analyse von Körperkonzepten in Transhumanismus und Christentum behandelt worden. Das ist deshalb verwunderlich, weil beide Sets von Überzeugungen auf »Körperkreativität« setzen,2 die den brachial-materialen Körper als Relevanzstruktur für die Zukunft des Menschen ausweisen,3 in dem sie somatoforme Novitäten anvisieren, die als Garant für solche Körper-Kontinuitäten konzipiert werden, ohne die sich eine Person nicht mehr als sie selbst bestimmen könnte.4 Multiple Faktoren animieren in dieser Optik ein Gespräch zwischen Transhumanismus und Christentum über
1
2 3 4
Vgl. More/Vita-More: Roots, 1. Dieses normative Set des Transhumanismus weist einen hohen Grad an Kompatibilität mit moralischen Modalitäten einer »Christian ethics in a Reformed key« auf, vgl. Brandt: All Things New, 137. Folgende Elemente stützen diese These: (1) »ethics of response«, (2) »comprehensive[ness], including in its scope all areas of human life«, (3) »open[ness] to […] nontheological sources of knowledge«, (4) »Aim[ing] at the transformation of society«, (5) »Part of an ongoing, developing tradition«, ebd. 139-140. Vgl. Brandt: All Things New, 117. Vgl. Cole-Turner: Transhumanism, 193 und Krüger: Virtualität, 94. Vgl. Cole-Turner: Von der Theologie, 294.
258
Mathias Wirth
den Körper.5 Besonders frappierend ist die Betonung von Inklusivität, Pluralität und der Notwendigkeit kontinuierlicher Infragestellung und Weiterentwicklung sowohl im Transhumanismus als auch in einem Christentum, bzw. einer sich anschließenden Theologie reformierter Prägung. Das Profil eines reformierten Christentums, das Parallelen mit anderen Traditionen des Christentums aufweist, auch mit dem Katholizismus, wie unten exemplarisch deutlich wird, soll hier, deutlicher als bisher, auf den Körper übertragen werden. Die Erzeugung eines überscharfen Kontrasts zwischen Transhumanismus und Christentum ist schon deshalb wenig plausibel, weil beide Systeme ähnliche Modalitäten der Offenheit für obligatorisch halten. Die bisher zitierten Maximen der Inklusivität, Offenheit und des »forever changing«6 sind transhumanen Entwürfen entnommen, lassen sich aber fast umstandslos auf das Proprium bestimmter christlicher und theologischer Traditionen beziehen, die sich von steilen Hierarchien und zu fixen Barrieren erstarrten religiösen Dogmen verabschieden.7 Die Bedeutung, die dabei »Körperkreativitäten« erhalten, soll im Gespräch mit den emblematischen somatoformen Kreativitäten des Transhumanismus erörtert werden, verbunden mit der Frage, was ein »forever changing« für den menschlichen Körper in reformierter Perspektive und für das Christentum insgesamt bedeuten könnte.8 Die ethische Suche und eschatologische Ausrichtung auf eine neue Form des Menschseins, die der Transhumanismus als »life beyond its current human form« pointiert,9 widerspricht jedenfalls der Vorstellung des menschlichen Körpers als einer TabuStruktur, die einen transformativen Umgang aus Verachtung oder Verklärung verbieten will. Komplexitätsreduzierungen im Umfeld des Körpers soll mit dieser Studie widersprochen werden, indem im Folgenden somatoforme Kreativität in transhumanistischen und theologischen Entwürfen sichtbar gemacht wird.
1.
Das Lebenssteigerungsphänomen Kreativität
Auf das ingenium setzen bedeutet einem ubiquitären Imperativ folgen,10 der sich aus der fast gänzlichen Disambiguierung der Kreativität ergibt.11 Denn es sind 5 6 7 8
9 10 11
Vgl. Wirth: Trans-Körper, 22-23. More/Vita-More: Roots, 1. Vgl. Brandt: All Things New, 142. Vgl. Ziegler: ›Those he also glorified‹, 166: »[…] Reformed Protestant theological accounts of human beings as creatures of God [are open] for radical transformation in virtue of the saving work of […] God.« More/Vita-More: Roots, 1. Vgl. Thumfahrt: Die Würde des Menschen, 436. Vgl. Dabrock: Kreativität, 18 und Reckwitz: Erfindung, 9. Im Anschluss an Michel Foucault spricht Andreas Reckwitz sogar von einem »Kreativitätsdispositiv« und meint damit eine Art normative Klammer, die »[…] Erziehung bis zum Konsum, vom Sport bis zum Beruf und zur
Reformierte Körper
kaum Umstände vorstellbar, außer zum Beispiel bei einer Fatique, in denen ausbleibende Kreativität irgendeine positive Bedeutung erlangt.12 Selbst andere pathologische Zustände können noch in einem kreativen Sinn zu etwas genutzt werden, zum Beispiel für vornehmlich um das Ich kreisende Achtsamkeitsübungen oder für das ganze Repertoire der Arbeits- und Beschäftigungstherapie.13 Unzählige Male wird die Tabu-Struktur, kreative Potentiale nicht zu nutzen, variiert14 und der Mensch als »Möglichkeitswesen« installiert.15 Der damit verbundene Imperativ und das skizzierte Tabu haben zwar etwas Prä-Hypnotisches, allein deshalb, weil in ihrem Licht benefit-risk-Kalkulationen einen eher schlechten Stand haben, er bezieht sich aber auf den unaufgebbar mit dem menschlichen Leben verbundenen Novitäts-Impetus. Denn würde man schöpferisches Handeln – um den theologischen Klang von Kreativität kurz aufzurufen16 – oder die zig Modale der »Selbsttransformationen«17 von einer Person distrahieren, bliebe von ihr womöglich nicht viel Persönliches über.18 An diesem Punkt setzt spätestens ethische Deliberation ein, denn was Andreas Reckwitz als »kreativen Ethos« bezeichnet,19 favorisiert Alterität, Emergenz und Synthese und wendet sich gegen die Gefahr des Reaktionären in jedem Standard und in jeder Nobilitierung des immer Gleichen.20 Positiv gewendet geht es einer auf Kreativität bezogenen Ethik um die positive Berücksichtigung des »Abweichenden« und der Anderen, wie Reckwitz betont.21 Was die Kreativität in dieser ethischen Perspektive bei Reckwitz schafft, ist nicht ein Ding neben dem Individuum, das es vor sich halten und bestaunen könnte, vielmehr sei
12
13
14 15 16 17 18 19 20 21
Sexualität« umfasst, vgl. ebd. 15. Zum Konzept des Dispositivs bei Foucault vgl. Gnosa, Tanja: Im Dispositiv. Zur reziproken Genese von Wissen, Macht und Medien, Bielefeld 2018, 96-104. Ruoff, Michael: Foucault-Lexikon. Entwicklung – Kernbegriffe – Zusammenhänge, Paderborn 2007, 101-102. Analog und nicht weniger einseitig kann auch von einer Disambiguierung der Destruktivität ausgegangen werden, die als das Gegenteil von Kreativität gefasst werden kann, vgl. Kurzweil: Progress, 451 und, zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch, eine fast ausschließlich negative Bedeutung hat, obwohl eine Destruktion einer ethischen Maxime folgen kann. Vgl. Schmiedebach, Heinz-Peter/Brinkschulte, Eva: Arbeit und Arbeitstherapie – historisch geleitete Assoziationen. In: Ankele, Monika/Brinkschulte, Eva (Hg.): Arbeitsrhythmus und Anstaltsalltag. Arbeit in der Psychiatrie vom frühen 19. Jahrhundert bis in die NS-Zeit, Stuttgart 2015, 21-28, 24. Das Verhältnis von Pathologie und Kreativität kann noch auf eine andere Weise verteidigt werden, denn immer wieder neuansetzende medizinische Forschung akkumuliert und variiert Kenntnis und schafft durch deren Applikation somatoforme Novitäten, vgl. als aktuelles Bespiel Rauschenbach: Spinal Cord Tumor Microenvironment, 97-99. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 9. Dalferth: Umsonst, 5. Vgl. Dalferth: Umsonst, 217 und Korsch: Wie kommt das Neue in die Welt, 80. Reckwitz: Erfindung, 9. Vgl. Benhabib: Selbst im Kontext, 185 und Steinmeier: Schöpfungsräume, 42. Reckwitz: Erfindung, 9. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 10 und weiter Weber: Die Produktion des Unerwarteten, 67. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 10.
259
260
Mathias Wirth
Skopus der Kreativität die vielleicht durch das neue Ding in der Hand ansetzende »kreative Gestaltung von Subjektivität«.22 Wer Kreativität mithin nicht primär als »self-creation« versteht,23 unterminiert die Wirkung, die das Kreative entfaltet und notorisch Neues hervorbringt;24 mal in einem emphatischen Sinne zur Verbesserung,25 mal in einem nicht-emphatischen Sinn zur Verschlechterung oder sogar Gefährdung des Lebens.26 Reckwitz assoziiert mit einer so verstandenen Kreativität nicht weniger als »Emanzipationshoffnung«,27 die in dieser Studie in der Perspektive des Transhumanismus und des Christentums in der Weise verfolgt wird, als nach Synthesen im Bereich von somatoformer Kreativität und ihren Potentialen für die Zukunft gefragt wird.28 Hier sind theologische Anschlusslinien möglich, auf die es dieser Studie ankommt, denn das aufgrund der »Materialitätsorientierung des kreativen Prozesses«29 zu bildende Trinär aus Kreativität, Körper und Freiheit weist ein hohes Grad 22
23 24 25
26
27 28
29
Reckwitz: Erfindung, 12. Als Beispiel für die Affizierung der betrachtenden Person durch Kunst nennt Reckwitz Minimal Arts, also Installationen und Plastiken, die so in einem Raum angeordnet werden, dass ein Objekt von allen Seiten umschritten werden kann, vgl. ebd. 106: »Der Rezipient wird dabei nicht als ein körperlich stillgestellter Beobachter, sondern als körperlich mobiles, sinnlich vielfältig ansprechbares Wesen in einem räumlich-dinglichen Kontext adressiert. Den industriellen Artefakten kommt die Aufgabe zu, sinnlich-affektive, räumliche Atmosphären hervorzurufen […].« Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt a.M. 1992, 162-164. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 16. Vgl. Graham: Philosophy, 1: »[…] by producing technologies that give human beings much greater control over their lives and prospects than prayers and rituals ever did, science has fundamentally altered the human condition.« Genau an diesem Punkt und mit Blick auf die eingangs in einem empirischen Sinn zitierte Disambiguierung der Kreativität kommt die Gefahr der umstandslosen Nobilitierung des Kreativen in den Blick, die mindestens aus diesen beiden Aspekten besteht: Erstens ist der Begriff der Kreativität faktisch ambivalent, denn einerseits verhilft er zum Ausagieren von menschlichen Freiheit, diese aber kann andererseits eben kreatives Böses hervorbringen, vgl. Thumfart: Die Würde des Menschen, 441. Zweitens steht die Kreativität in einer Spannung, nicht aber in einem Ausschlussverhältnis zu Praktiken der Kontemplation oder des Kontraktiven, vgl. Dabrock: Kreativität, 28-29 und besonders zur Metapher des Kontraktiven Wirth, Mathias: Von Anaximander bis Zimzum. Raumgabe als ethischer und religiöser Respons auf Verkörperung. In: Gruevska, Julia (Hg.): Körper und Räume, Wiesbaden 2019, 153-177, 154. Gemeint ist damit die Gefahr eines Interventionismus, der die Bedeutung der Passivität, des Rückzugs und der Schonung unterschlägt. Obwohl diese auch in einem positiven Verhältnis zur Kreativität stehen, ist weiter zu klären, inwiefern sie als Techniken des Kreativen korrumpiert würde. Reckwitz: Erfindung, 14 und weiter Benhabib: Selbst im Kontext, 256. Damit liefert diese Studie selbst ein Beispiel für Kreativität, denn die Suche nach Querverweisen, hier zwischen Transhumanismus und Christentum am Beispiel somatoformer Kreativität, zeigt einen Modus der Denkbarkeit von Kreativität, vgl. Korsch: Wie kommt das Neue in die Welt, 89. Reckwitz: Erfindung, 102.
Reformierte Körper
an Kompatibilität nicht nur mit christlichen, sondern auch mit transhumanen Anthropologien und Futurologien auf. Ein erster Beleg dafür kann auch in religiösen Kontexten nicht fremden peak experiences (Abraham Maslow) gefunden werden, die nicht obligatorisch, aber regelmäßig mit Erfahrungen des kreativen Selbst verbunden sind. Solche Erfahrungen werden auf eine ganz autochthone Art in der Elternschaft gemacht, aber auch in Erfahrungen der Liebe, inklusive der Sexualität, der Mystik, der Kunst, des Schreibens, des Sports, der Therapie etc.30 Hier kommt es zu lebensgeschichtlichen Erfahrung, deren Klimax in allen genannten Fällen nicht ohne den Körper auskommt, dessen Wandelbarkeit dabei ebenso imponiert wie die konstitutive Bedeutung des konkreten Körpers. Das Insistieren auf die Materialität des Körpers in solchen transhumanen Entwürfen, die nicht auf seine virtuelle Überwindung setzen,31 betont die nicht-substituierbare Bedeutung der genannten peak experiences für das Individuum.32 Auch das Setzen auf die Materialität des Körpers in solchen eschatologischen Entwürfen, die nicht auf seine virtuelle Überwindung setzen, zum Beispiel durch Konzepte einer unsterblichen Seele, betonen die nicht-substituierbare Bedeutung der genannten peak experiences für das Individuum. Anders gesagt: Bestimmte Varianten des Transhumanismus und das Gros theologischer Entwürfe zur Zukunft der Person wollen auch den Körper als »normative Erwartungsstruktur«33 nicht enttäuschen. Allerdings weist die Kreativität dort eine heikle Stelle auf, wo Theologien damit befasst sind, Menschen auf die Endlichkeit ihrer Verfügungen und auf die Gefahr einer Hybris zu verweisen, die einen gottgleichen Anspruch erhebt, ohne je dafür bürgen zu können.34 Bei Licht besehen ist die Inklination zur nicht selten infa30 31 32
33 34
Vgl. Maslow, Abraham Harold: Toward a Psychology of Being, New York 1968, 85 und dazu Reckwitz: Erfindung, 219. Vgl. Bath/Bauer/Bock von Wülfingen/Saupe/Weber: Materialität denken, 11. Genauer erörtert werden muss der Zusammenhang zum Problem des Substantialismus, das mit dem Lable der Postmoderne verbunden ist, die sich gegen »[…] alle substantialistischen Auffassungen vom menschlichen Wesen und Natur« richtet und den Menschen als »gesellschaftliches, geschichtliches oder sprachliches Artefakt […], für immer gefangen in einem Netz fiktiver Bedeutungen« sieht, Flax, Jane: Thinking Fragments. Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley 1990, 32. Aber selbst wenn man diesem starken Konstruktivismus folgt, insofern Artefakte bestehen und etwas mit fiktiven Netzen belegt wird, setzten doch beide eine Form von Materialität voraus, die nicht einfach zu dispensieren ist. Reckwitz: Erfindung, 314. Besonders der Protestantismus reformierter Prägung hat in seinen historischen Anfängen menschliche Kreativität im Bereich religiöser Kunst diskreditiert und dabei auf die Verwechslungsgefahr von Gott und Mensch, Kunst und Gott gepocht, vgl. Graham: Philosophy, 10. Um bei dieser reformiert-evangelischen Perspektive zu bleiben: Eine auf Friedrich Schleiermacher bezugnehmenden harschen Zurückweisung der anthropologischen Applikationsfähigkeit der Kreativität hat Dietrich Korsch in den Blick genommen, vgl. Korsch: Wie kommt das Neue in die Welt, 82: »Kreativ ist allein Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das
261
262
Mathias Wirth
men Überschätzung aber nicht einmal in Begriff der Kreativität angelegt, der also nicht erst dadurch theologisch goutierbar wird, wenn er zuvor von einer Megalomanie bereinigt würde. Denn, folgt man auch an diesem Punkt Andreas Reckwitz, bedeutet Kreativität ausdrücklich keine creatio ex nihilo, die man als Domäne des Divinen verstehen kann, wenn Kreativität als neuer Umgang mit dem verstanden wird, was vorgefunden wird.35 Solche Neuformationen werden durch Konfiguration, also alternative Arrangements im Raum, durch Reproduktion, also Zitation eines Ursprungs oder durch Selektion, also durch einen Zoom, möglich;36 wobei Parallelen zwischen der Kreativität der Kunst und der Medizin palpabel werden. Andere Einwände gegen die Kreativität machen auf die Dimension der Angst aufmerksam, die dann hervortritt, wenn kreatives Handeln als Bemächtigung erscheint, die das bedrohliche Andere nivelliert. Reckwitz ordnet die Überwindung von Chaos in diese Lesart ein, ohne dabei aber etwas Negatives ausmachen zu können.37 Kreativität kann auch, etwas weniger dramatisch, als Kritik des Bestehenden verstanden werden, die dann zur Undankbarkeit würde, zum Beispiele gegenüber einer divinen Instanz, wie eine religiöse Optik soufflieren kann, wenn Diskontinuitäten mehr Betonung fänden als Kontinuitäten. Kreativität kommt also mit dem Manko, sich womöglich nicht auf das Bestehende einlassen zu können, während sie »Steigerungsimperativen«38 folgt.39 Diesen kritischen Einstiegspunkten stehe
35 36 37 38 39
ist der Ausgangssatz der Theologie, insofern sie sich dem Phänomen der Kreativität stellen will.« Diese auf den ersten Blick wenig plausibel erscheinende Exklusivierung der Kreativität wird bei Korsch im Verlauf der Argumentation menschlichen Akteur*innen dann doch zugesprochen, aber nur in einem derivativen Sinn. »Unbedingt kreativ« sei nur Gott, menschliche Kreativität könne daran aber unter dieser Maßgabe partizipativ teilnehmen, wobei dabei nach Korsch eben ein qualitativer Unterschied besteht, vgl. ebd. 86. Insofern Gott den Menschen mit Freiheit ausgestattet habe, begegne in ihr, so Korsch weiter, der Anknüpfungspunkt für die Rede von einer »bedingten Kreativität« des Menschen, vgl. ebd. 87: »Insofern sind solche freien Handlungen [gemeint ist Spontaneität] per se ›kreativ‹, weil sie die Handelnden selbst ebenso wie ihre Umwelt vor Aufgaben stellen, die nicht vorherzusehen waren. […] Daher gilt, dass Spontaneität immer schone eine Eigenschaft real endlicher Freiheit, Ausdruck von Kreativität, ist.« Vgl. dazu auch Dalferth: Umsonst, 8. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 110 und weiter Dabrock: Kreativität, 28-30. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 111. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 221. Reckwitz: Erfindung, 341. Vgl. Reckwitz: Erfindung, 220. Vgl. dazu auch Dalferth: Umsonst, 7−8: »Dieses Werden [z.B. in kreativen Prozessen] kann nicht durchgängig als Machen verstanden werden, ohne eine entscheidende Dimension unseres Lebens und Selbsterlebens auszublenden.« Im Anschluss an diesen Befund schlägt Ingolf Dalferth eine »Kreativität menschlicher Passivität« vor, vgl. ebd. 232−233: »Die kreative Passivität des Menschen ist kein Kennzeichen ontologischen Mangels, sondern im Gegenteil besondere Begabung: Geschöpfsein heißt, von Gott begabt und beschenkt werden […].«
Reformierte Körper
wiederum das gravierendere Problem des »Affektmangels« gegenüber, das durch Kreativität kuriert werden soll, wie Reckwitz in historischer Rückblende betont.40
2.
Somatoforme Kreativität im Transhumanismus
Wer transhumane Konzepte über die Zukunft menschlicher Körper lediglich für einen säkularisierten Nachklang einer christlich-eschatologischen homo perfectusTrajektorie hält,41 wird über die expliziten religiösen und theologischen Bezugnahmen des Transhumanismus, auch in der gegenwärtigen Debatte, verwundert sein.42 In den Grundlegungen bei Ray Kurzweil und Max More, den beiden Vertretern des Transhumanismus, die als Gesprächspartner für diese Untersuchung gewählt wurden, weil sie die Kontinuität des Menschen, inklusive einer zu modifizierenden Materialität, betonen,43 werden religiöse Selbst-Anamnesen, bzw. kritische Bezugnahmen auf Religion vorgenommen.44 Insofern die gemachten Bezugnahmen relevant sind, legt sich wiederum die Option möglicher Synthesen nah.
2.1
Körper bei Ray Kurzweil
Ohne Verachtung bestimmt Kurzweil, ähnlich wie entsprechende Diktionen in schöpfungstheologischen Zusammenhängen, die Welt der Biologie als gut,
40 41 42 43
44
Vgl. Reckwitz: Erfindung, 314-315. Vgl. Mulsow: Der vollkommene Mensch, 752. Vgl. Krüger: Virtualität, 110-111. More: The Philosophy of Transhumanism, 8-9. Thweatt: Cyborg-Christus, 368-369 und Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 35-36. Vgl. Hughes: Transhumanism, 230 und More: The Philosophy of Transhumanism, 15: »A […] common misconception is that transhumanism loathe their biological bodies.« Kurzweil: Menschheit, 31: »Unsere Zivilisation bleibt menschlich – sie wird der Menschlichkeit sogar in vielerlei Hinsicht mehr Ehre machen als die heutige; der Menschheitsbegriff wird sich jedoch von seinen biologischen Wurzeln lösen.« Beiden Komponenten gegenüber ist offensichtlich Skepsis angebracht, denn einerseits neigen moralisch besonders großspurige Prognosen dazu, entweder doch den faktischen Menschen mitsamt seiner oder ihrer Probleme abzuschaffen, oder eine Art Diktatur zu entwerfen, in der ein bestimmtes erwünschtes Verhalten gewaltsam durchgesetzt werden kann. Beides gehört nicht zur Intention Kurzweils, der die Ambivalenz von Technik nicht ausblendet, vgl. Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 85 und Kurzweil: Progress, 451, aber es ist aufgrund seine Art davon zu reden als Missverständnis oder praktische Folge nicht auszuschließen. Auch die Rede von der Ablösung von der bisherigen biologischen Grundlage könnte eliminatorisch oder körpernegierend gelesen werden, wenn man nicht eine Art Kreativität einkalkuliert, die Materialität anders entwirft und weiterentwickelt. Zumindest scheint dies eine Möglichkeit zu sein, die Kurzweil hier im Blick hat. Vgl. More: Tranhumanism, 6.
263
264
Mathias Wirth
aber nicht optimal.45 Am Beginn der Überlegungen Kurzweils zu transhumanen Körpern steht die Diagnose über die »inhärente Einschränkung«, die mit allem Leben und dessen Grundbausteinen, den Aminosäuren, verbunden seien, die nur bestimmte Grade der Transformation zuließen.46 Der sich direkt anschließende Bezug Kurzweils auf die bei Transhumanist*innen viel zitierte Nanotechnologie und auf ihr liebstes Kind, die nanobots,47 also gedachte Maschinen, die so klein sind, dass sie auf zellulärer Ebene degenerative Prozesse verhindern oder zurücknehmen, grundiert ein kreatives Körperkontinuitätsmodell. Denn Kurzweils Hinweis auf die nach seiner Auffassung reduzierte Plastizität von Eiweißen hätte auch zu der Vorstellung einer Annihilation und dann Neukonzeption von Körpern animieren können. Stattdessen sollen nanobots für zunehmende Plastizität auf zellulärer Ebene sorgen.48 Körper werden bei Kurzweil also nicht als Objekt der Überwindung, sondern der Umgestaltung verstanden, wobei insbesondere ein technologisches Enhancement zu einer zunehmenden Verbindung von Körper und Maschine führen soll.49 Diese fällt in seiner Zukunftsvorstellung denkbar radikal aus: »Durch Nanotechnik wird es möglich, die physikalische Welt, einschließlich unserer Körper und Gehirne, neu zu gestalten, Molekül für Molekül […].«50 Auch wenn man lediglich bereit ist, Kurzweil an diesem Punkt als Literaten wahrzunehmen, der eine Art Science Fiction entwirft,51 die noch darauf wartet, zur Wissenschaftsprosa zu werden,52 deutet das prosperierende Feld der Nanotechnologie auf Optionen des Eingriffs in den Körper auf seinen untersten systemischen Ebenen hin. Unabhängig von den Modi der Realisierung dieser Transformation, charakterisiert Kurzweil den Körper als affines Gewebe für Veränderungen, die nicht nur auf auto- und alloplastische Transformationen auf der Ebene der Biologie abzielen, sondern auf der Ebene der Kreativität Körper »[…] umgestalten und völlig neu […] erfinden.«53
45 46 47 48 49 50 51 52
53
Vgl. Kurzweil: Menschheit, 227. Vgl. Kurzweil: Menschheit, 28 und weiter Weber: Die Produktion des Unerwarteten, 70. Vgl. Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 6. Zum Verhältnis von Transhumanismus, Nanotechnologie und Systematischer Theologie, vgl. Wirth: Doketisch, 153-155. Vgl. Kurzweil: Menschheit, 29. Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 87. Kurzweil: Menschheit, 227. Wobei dieses Genre als bedeutsam für die Entwicklung transhumaner Positionen angesehen wird, vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 12. Bereits jetzt steht fest, dass zumindest Kurzweils Prognose für die 2020er Dekade wohl nicht eintreffen wird. Er hatte angenommen, dass Nanotechnologien dazu in der Lage sein werden, wesentliche Prozesse auf zellulärer Ebene, zum Beispiel die Replikation von Zellen, zu steuern, vgl. Kurzweil: Menschheit, 233. Kritiker werfen Kurzweil daher vor, in seinem Transhumanismus solide naturwissenschaftliche und technologische Aspekte mit unhaltbaren Behauptungen zu vermischen, vgl. Grassie: Millenialism, 251 und Peters: Transhumanism, 153. Kurzweil: Menschheit, 228.
Reformierte Körper
Kurzweils Transhumanismus bezieht sich dabei nicht allein auf Technologien, die noch zu erfinden sind oder erst zur Reife gelangen müssen. Vielmehr sieht er eine »radikale Verbesserung der physischen und mentalen Systeme unseres Körpers«54 in statu nascendi. Im Blick sind dabei nicht nur präventionsmedizinische Erfolge in der Vermeidung von Expositionen mit Schadstoffen oder das Feld der Prothetik von Arm bis Zahn, in dem status-quo-Körper nicht nur von einer Pathologie befreit werden, sondern auch Verbesserungen im Sinne eines »radical upgrading of our body«55 anvisiert werden.56 Kurzweils »Körper 2.0« wird als ein Projekt der laufenden, das heißt nach vorne hin offenen »radikalen Aufbesserung« der somatischen und mentalen Konfiguration des Menschen verstanden.57 Dieses Vorhaben stellt Kurzweil nicht als eine Art Messianismus vor, der die Erreichung eines absoluten Zustand des Guten allein an menschliche Mittel bindet. Zwar gebe es durch Evolution und Technik eine Approximation in Richtung einer solchen Zukunft, die aber, wenn überhaupt, nur eine Gott-Instanz hervorbringen könne.58 Damit setzt Kurzweil einen unüberwindbaren qualitativen Unterschied zwischen Zukunft (futurum) und Hoffnung (adventus).59
2.2
Körper bei Max More
Mit der »Philosophy of Transhumanism« von Max More, einem weiteren Vordenker des Transhumanismus in der Gegenwart, kann man Ray Kurzweil gegen den Vorwurf eines Technik-Spleens verteidigen. Denn dem Transhumanismus käme es, so More, in erster Linie gar nicht auf die konkreten Modi der Umsetzung solcher Ziele, auch für den Körper an, um die es dem Transhumanismus, etwa bei Kurzweil, in erster Linien gehe: »Transhumanism per se says much about goals but nothing about specific means or schedules.«60 Genau an dieser nicht unbedeuten54 55 56 57 58
59
60
Kurzweil: Menschheit, 305. Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 3. Vgl. Kurzweil: Menschheit, 305-306. Zum Verhältnis von Prothetik und Ethik vgl. Wirth: Das Enjambement von Eigenem und Fremden, 338-340. Vgl. Kurzweil: Menschheit, 306. Vgl. Kurzweil: Menschheit, 400: »[…] Natürlich erreicht das beschleunigende Wachstum der Evolution niemals die Unendlichkeit, doch mit der exponentiellen Explosion [= Singularität] bewegt es sich schneller in diese Richtung. Evolution bewegt sich unaufhaltsam in Richtung des Gottesbegriffs, ohne dieses Ideal je ganz erreichen zu können.« Vgl. auch Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 86 und More: The Philosophy of Transhumanism, 9. Vgl. dazu Grassie: Millenialism, 264-265. Vgl. Moltmann: Das Kommen Gottes, 43−45 sowie Frettlöh: Theologie des Segens, 372 und mit Bezug auf »Futurology and Eschatology« im Transhumanismus, vgl. Peters: Transhumanism, 161 und Cole-Turner: Transhumanism, 198. More: The Philosophy of Transhumanism, 15. Insofern muss der Transhumanismus als »cultural movement«, bzw. als Philosophie verstanden werden, die allerdings auf emerging technologies verweist, vgl. More/Vita-More: Roots, 1.
265
266
Mathias Wirth
den Stelle kreuzen sich Transhumanismus und Theologie, indem sie angeben, wie eine wünschenswerte Zukunft bestimmt sein müsste, ohne die Mittel dazu selbst in der Hand zu haben. Indem sie aber auf sehr verschiedene Instanzen verweisen, die die Zukunft approximativ oder endgültig herbeiführen können, im ersten Fall durch Technik,61 im zweiten Fall durch Gottes Handeln,62 beabsichtigen sie nicht bloß Utopien. Auch bei More, wie oben bereits angeführt, geht es um eine transhumane Konzeption von Zukunft, die kein Interesse an einer Abtragung des menschlichen Körpers verfolgt: »[…] transhumanism doesn’t find the biological human body disgusting or frigthening.«63 Im Gegenteil, ganz auf einer Linie mit anderen transhumanistischen Visionen geht es um die Verbesserung und Erweiterungen der körperlichen und kognitiven Grenzen des Menschen, also um den Abbau degenerativer und pathologische Prozesse sowie um den Aufbau besserer Denk-, Emotions- und Moralleistungen.64 Das korreliert mit der oben vorgestellten Definition von Kreativität, die hier als somatoforme Kreativität erscheint, denn die gefundenen Elemente wie »self-creation« oder das, was als »Emanzipationshoffnung« gefasst wurde, begegnet hier im Sinne einer Befreiung von der Enge vorgefundener biologischer Grenzen. Mit anderen Worten: Die anvisierte somatoforme Praxis des Transhumanismus verfolgt gerade keine Annihilation des Körpers, wenn sie seine Modifikation erörtert, die nicht ein Leiden am, sondern ein Leiden durch bestimmte Körper einer starken Kritik aussetzt.65 An anderer Stelle äußert sich More ähnlich wie Kurzweil grundsätzlich positiv über die Biologie des Menschen, bzw. das, was theologisch Schöpfung heißt. Zwar sei die Evolution in den Händen von »Mother Nature« langsam, aber nicht ohne Intelligenz.66 Auch hier findet sich theologischer Nachklang, denn ähnlich wie bei More folgt auch aus theologischer relecture der Langsamkeit oder sogar des Schweigens der Schöpfung ein Imperativ zur Handlung.67 Vielleicht, so More, müsse das Tempo der Evolution als Auftrag verstanden werden, »[…] to take the next step ourselves.«68 Wie bei anderen transhumanen Vordenker*innen setzt auch More dabei auf emerging technologies. Denn das, was als Natur und sakrosankt behandelt werde, sei kein »end in itself« (Selbstzweck), weil Leiden, Altern und Tod impliziert sind, was aus der Perspektive des Individuums kaum tolerierbar scheint.69 Auch More plausibilisiert seine 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Vgl. Bostrom: In Defense of Posthuman Dignity, 55. Vgl. More: Transhumanism, 9. More: The Philosophy of Transhumanism, 15. Vgl. auch More: True Transhumanism, 143 und dazu Krüger: Virtualität, 96. Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 15 und weiter Bostrom: Why I Want to be a Posthuman, 32. Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 15. Vgl. More: A Letter to Mother Nature, 449. Vgl. Cole-Turner: Transhumanism, 201 und Wirth: Transition and Care, 134-135. Vgl. More: A Letter to Mother Nature, 449. Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 4.
Reformierte Körper
Annahmen über die Plastizität der physischen, psychischen und moralischen Konstitution des Menschen mit bereits etablierten Praktiken. So verweist er auf neue Mobilitäten im räumlichen und sozialen Sinn und erinnert an das Reisen und die zunehmende Einforderung von Individualität und Freiheit in Fragen der persönlichen Lebensführung und Familienplanung. Beides, so More, sei als transhumane Bewegungsrichtung diskutierbar.70 Bei solchen Analysen, wie der zentralen transhumanen Debatte über die Akzeleration technischer Entwicklung zur Verbesserung der Konstitution des Menschen, gehe es, so More, nicht um monokontextuelle Herausforderungen. Das werde besonders deutlich, wenn auch ethische Probleme differenziert zum Ausdruck kämen, wobei innerhalb der transhumanen community von einer Pluralität der ethischen Grundannahmen auszugehen sei.71 Sein eigenes Konzept der Extropie, also des unaufhaltsamen (technologischen) Fortschritts, an dessen Ende Krankheiten und Alterung überwunden und Moralität und Kognition gestärkt seien,72 sodass individuelles Glück besser erreichbar sei,73 kommt zum Beispiel mit einer wesentlichen Einschränkung. Diese ist ethisch relevant und erscheint, wie oben bei Kurzweil, als eine Art eschatologischer Vorbehalt und bannt die Gefahr, technische Ziele zu verabsolutieren: »Transhumanists seek not utopia, but perpetual progress – a never-ending movement toward the ever-distant goal of extropia.«74
3.
Somatoforme Kreativität im Christentum und das Beispiel autonomer Körperbezüge in der theologischen Ethik
Auch wenn es sich beim menschlichen Körper in religiösen und theologischen Bezugnahmen um ein regelmäßig aufgeregtes Feld handelt, weil er den einen als göttliche Schöpfung sakrosankt und unantastbar erscheint, den anderen aber als verletzbar und antastbar gilt, hat sich die Geschichte längst für die zweite Option entschieden, wie auch aus theologischer Sicht emphatisch pointiert werden kann: »Würden wir nicht permanent Unmögliches erkunden und bislang kaum Mögliches schaffen, wären wir schon längst nicht mehr wirklich.«75 Das Setzen auf
70 71 72 73
74 75
Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 11. Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 13. Vgl. More: Transhumanism, 9 und More: True Transhumanism, 137. 143. Vgl. dazu TiroshSamuelson: Engaging Transhumanism, 23. Vgl. Bostrom: Why I Want to be a Posthuman, 29. Sandberg: Morphological Freedom, 56-57 und Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 37. Kritisch dazu: Spreen/Flessner: Warum eine Kritik, 10. More: The Philosophy of Transhumanism, 14 und More: True Transhumanism, 140. Dalferth: Umsonst, 1.
267
268
Mathias Wirth
überempirische Akteure verbietet sich aus dieser Perspektive ebenso wie der reaktionäre Habitus der Neophobie. Zwar muss das Neue, weil es auch neue Übel geben kann, notwendig ambiguitiv dargestellt werden, dabei muss dem Neuen, auch in einem persönlichen und mithin materiellen Sinne die Chance eingeräumt werden, Akzeptabilitätsbedingungen gut oder besser zu entsprechen als ein Zustand ex ante. Modalitäten des Neuen müssen nicht erst auf Aneignung durch mutige Subjekte warten, sie sind längst Praxis, die als Novitätspotential theologisch zur Aufführung kommt: »Wir werden nicht nur, wozu andere oder wir selbst uns machen können, wir werden auch nicht nur, was wir werden können, weil wir sind, was wir wurden, sondern wir werden stets mehr und anderes als nur das, weil sich unableitbar Neues ereignet [= Novitätspotential] – neues Leben, wenn wir zu sein beginnen, und Neues im Leben, wenn uns Möglichkeiten zugespielt werden, die nicht aus unserem bisherigen Leben oder gegenwärtigen Tun oder Lassen abgeleitet werden könnten.«76 Solche Novitäten haben nicht selten Bedeutung für das Überleben des Lebens und es gibt keinen Grund, sie nur auf den Menschen als animal rationale zu beziehen. Der Inbegriff des Neuen, wie er theologisch konzipiert wird, begegnet vor allem in eschatologischer Perspektive.77 Aber es gibt, wie im Folgenden gezeigt wird, gute Gründe, Novität auch auf den Menschen als animal corporeum zu beziehen.78 Die Rede von der menschlichen Gottebenbildlichkeit (imago Dei) ist ein optisches Hilfsmittel, den Menschen, so Ingolf Dalferth, als homo creator zu würdigen.79 Denn das Theologumenon der Gottebenbildlichkeit bleibt unverständlich, wenn man damit, wie schon unzählige Male falsch vorgephrast, die Geschöpflichkeit des Menschen adressiert.80 Weil Gott gerade nicht Geschöpf ist, bietet sich dieser Aspekt beim besten Willen nicht als Analogat zwischen Gott und Mensch an. Vielmehr muss die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen als Nobilitierung seines abgeleiteten Schöpfer*inseins behandelt werden. Denn es ist nicht so, wie Dalferth weiter betont, dass alleine logos und ethos, sondern auch die dynamis den Menschen als Abbild Gottes ausweist.81 Die Gottebenbildlichkeit des Menschen konterkarieren also nicht die, die das Innovationspotential des Menschen, zum Beispiel in
76
77
78 79 80 81
Dalferth: Umsonst, 8. In Dalferths Optik erscheint der Mensch im Horizont des Neuen als einerseits passiv, weil es als ein Widerfahrnis geschildert wird, andererseits aber auch aktiv, insofern das Neue eine Aneignungsstruktur hat, vgl. ebd. 47. Vgl. Bostrom: Why I Want to be a Posthuman, 43: »Many people who hold religious beliefs are already accustomed to the prospect of an extremely radical transformation into a kind of posthuman being […].« Vgl. auch Thweatt: Cyborg-Christus, 373. Dalferth: Umsonst, 48. Vgl. auch Hefner: The Human Factor, 29. Vgl. Dalferth: Umsonst, 218. Vgl. Dalferth: Umsonst, 217−218.
Reformierte Körper
technischen Angelegenheiten loben, sondern die, die der technischen Veränderungen, auch des Körpers, mit dem in manchen religiösen Kreis als schick geltenden Gran der Verachtung begegnen. Denn mit der so verstandenen Rede von der imago Dei kommt der Mensch nicht nur als homo faber in der Blick, der oder die durch eigenes Handeln die Welt bearbeitet, sondern als homo creator transformieren sich Menschen selbst: »Die Gottebenbildlichkeit des Menschen besteht nicht in seinem Geschaffensein, sondern in seinem Schöpfersein, in der Kreativität des Menschen, der im Produzieren von Erkenntnis und in den Produkten seines Handelns seine Welt und sich selbst schafft.«82 Dalferths Konzept des Menschen als derivativem Schöpfer wäre eine Chimäre, wenn nicht auch das Quantum Freiheit mitkonzipiert wäre, das nötig ist, um überhaupt schöpferisch und kreativ zu sein,83 was jedenfalls durch ein vorgegebenes Design oder eine autoritäre Anweisung unmöglich wäre. Seinen freiheitsaffinen Begriff der Gottebenbildlichkeit, der den Menschen gerade nicht auf ein vorgefertigtes Bild verpflichtet, sondern dazu animiert, neue Bilder zu entwerfen (vita activa),84 hat Dalferth explizit auf Aspekte des Enhancement übertragen, die zu den idées fixes des Transhumanismus zählen. Zur »[…] Ersetzung von immer mehr Körperteilen durch Implantate, [zum] Einbau von Chips in den Körper, die immer mehr Funktionen der Körpersteuerung übernehmen, [zur] gezielte[n] Manipulation des Gehirns durch Neuroimplantate […]«85 verhält sich Dalferth nicht mit Komplexitätsreduzierungen; indem er weder nur die Gefahren (»Selbstabschaffung«) noch ausschließlich die kreativen Potentiale (»Umschaffung«) betont.86 Stattdessen weist er auf das Eigenständige und Heterodoxe hin, das der Kreativität inhäriert und ebenso eigensinnige wie vermeintlich heterodoxe Körper hervorbringt. Ihre grundsätzliche Abweisung verbietet sich aus theologischer Perspektive mit Rekurs auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen, die, positiv gewendet, Verantwortlichkeit impliziert.87
4.
Das Novitätspotential reformierter Körper – Ein theologisches Zwischenfazit
Es besteht für die Doppelperspektive dieser Studie kein Lokalisierungskonflikt bei der Auffindung ›reformierter Körper‹. Denn sowohl im Transhumanismus wie im Christentum gibt es zwar auch solche Positionen, die Zukunftshoffnungen an die Überwindung von Materialität binden, häufig gehört der menschlichen Körper 82 83 84 85 86 87
Dalferth: Umsonst, 218. Vgl. Dalferth: Umsonst, 219. Vgl. Thumfahrt: Die Würde des Menschen, 441. Dalferth: Umsonst, 220. Dalferth: Umsonst, 221. Vgl. Dalferth: Umsonst, 231.
269
270
Mathias Wirth
als Relevanzstruktur zu transhumanen Futurologien und christlichen Eschatologien.88 Somatoforme Kreativität, die Körperpraktiken im Transhumanismus, wie mutatis mutandis, Körperpraktiken im Christentum sichtbar macht, erlaubt das Zusammendenken von Transformation und Kontinuität, wenn transhumane Zukunft, bzw. christliche Hoffnung überhaupt Bedeutung für die haben soll, die nach ihr fragen. Der Transformations-Impetus impliziert dabei den Befund, nach dem bloße Kontinuität des Gewesenen oder Seienden keinen Grund für Zukunft und Hoffnung liefert. Der Kontinuitätsbefund, der sich sowohl im Transhumanismus wie im Christentum findet, impliziert den Befund, nach dem bloße Tilgung zu fraktalen Existenzen führt, die Zukunft und Hoffnung höchstens als durchschaute Fiktion aufrechterhalten könnten. Kritisch ist allerdings zu fragen, ob Kreativität nicht reduziert wird, wenn sie im Transhumanismus strikt auf technologischen oder pharmakologischen Fortschritt bezogen wird89 und im Christentum auf das Hoffnungsprärogativ Gottes. Die Beantwortung der letzten Anfrage wird wesentlich davon abhängen, wieviel divine Kontraktion (relinquishment)90 zugunsten von menschlicher Freiheit und Kreativität angenommen wird.91 Die erste Anfrage kann mit dem Hinweis auf die Arbeit von Natasha Vita-More kommentiert werden, die auf Verbindungslinien zwischen Kunst und Transhumanismus und die Kontinuität eines technikbasierten »altering of the human form« hinweist.92 Ihr eigener Kunstentwurf »Primo Posthuman«, der übrigens keine »disembodied entity« darstellt, zeigt Technik als offen für multiple Applikationen,93 sodass der Reduktionismusvorwurf gegen eine technikbasierte Modifikation des Menschen in der Gefahr steht, einem ebenfalls reduktionistischen, weil monolithischen Verständnis von Technik zu verfallen. Mit anderen Worten: Eine technikbasierte Aktualisierung von »[m]orphological freedom does not threaten diversity«,94 weil
88 89 90
91 92 93
94
Vgl. Wirth: Trostlose Eschatologie, 263 und Thweatt: Cyborg-Christus, 373. Vgl. Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 39 und weiter Spreen/Flessner: Warum eine Kritik, 13. Vgl. Peters: Transhumanism, 157-158. An die Frage der Kontraktion knüpft in ethischer Perspektive auch das Problem des Expansiven und Nicht-Kontraktiven des Enhancement an; wobei durchaus Formen des Enhancement denkbar sind, zum Beispiel im Sinne einer Eliminationsdiät, die durchaus kontraktive Elemente aufweisen, vgl. Cole-Turner: Transhumanism, 199: »For Christianity, the place to start is with self-emptying, not self-fulfillment. […] If Christians and transhumanists share similar hopes, they expressly do not share the same assumptions about the precondition of renunciation of the self. Christians will always suspect the transhumanists are essentially egocentric.« Vgl. Wirth: Von Anaximander bis Zimzum, 153-155. Vita-More: Bringing Arts, 70. Vita-More: Bringing Arts, 73. Vgl. auch Krüger: Virtualität, 136-137, der auf den Zusammenhang von Futurologie und Kunst hingewiesen hat und damit die Zukunft, auch des menschlichen Körpers, als einen genuinen Ort künstlerischen Schaffens ausweist. Sandberg: Morphological Freedom, 59.
Reformierte Körper
gerade Kunst, wie sie zum Beispiel Vita-More praktiziert wird, als »Vermittlungsund Verwirklichungsinstanz zwischen Wissenschaft, Technik und Kultur« figuriert.95 Somatoforme Kreativität im Gespräch zwischen Transhumanismus und Christentum lässt sich zunächst als »maximale Mobilität und Flexibilität«96 diskutieren, wenn darunter, wie bei Kurzweil, ein »[…] laufendes Projekt, das letztendlich zu einer radikalen Aufbesserung unseres physischen und mentalen Systems führen wird«, verstanden wird.97 Auch wenn diese Diktion für die theologische Diskussion ungewöhnlich ist, begegnen in ihr doch zwei Bekannte, die auch für die Kreativitätspotentiale des Christentums stehen: Erstens eine nach vorne hin offene Konzeption (»ongoing reformation«98 ), die besonders in der theologischen Tradition reformierter Prägung Ausdruck in der Zurückweisung von Absolutheitsanspruch und Dogma findet, was positiv gewendet auch eine hohe Schätzung der Kreativität bedeutet. Denn glaubensrelevante Inhalte können mit dem Fortschritt der Zeit nicht nur womöglich besser verstanden werden, auch substantiell Neues in der Beziehung zu den biblischen Texten kann entdeckt werden.99 Wenn auch deutlich abgeschwächter, so richtet ebenfalls die katholische Theologie die Kreativität auf das Dogma, wenn sie eine epistemiologische Entwicklung einkalkuliert. Aber auch eine Entwicklung des Verständnisses kommt nicht ohne Novitätspotential aus.100 Die zweite Bekannte ist die Zukunfts- bzw. Hoffnungsperspektive, die sich auch auf die Materialität des Menschen erstreckt und die Möglichkeit einer guten Zukunft einmal durch technologische Mittel oder durch die Intervention Gottes anstrebt, wobei sowohl im Immanentismus des Transhumanismus wie im transzendenzbezogenen Christentum jeweils eine Zäsur mitgedacht werden muss: Im Transhumanismus durch das, was als Singularität101 (abrupte Akzeleration der technischen Entwicklung durch Innovationen) und im Christentums durch das, was in der Spannung von Beginn und Vollendung, als Reich Gottes firmiert.
Krüger: Virtualität, 142. Kurzweil: Menschheit, 306. Kurzweil: Menschheit, 306. Brandt: All Things New, 95. Vgl. Calvin: Unterricht in der christlichen Religion, 582: »Und die menschliche Erkenntnis, derart durch das Licht des Heiligen Geistes erleuchtet, beginnt nun endlich und wahrhaftig jene Dinge wahrzunehmen, die zum Königreich Gottes gehören, die sie zuvor nicht einmal erahnen konnte […].« Vgl. auch Brandt: All Things New, 118 und Cole-Turner: Von der Theologie, 298 sowie weiter Dube, Musa W.: Boundaries and Bridges: Journeys of a Postcolonial Feminst in Biblical Studies. In: Journal of the European Society of Women in Theological Research 22 (2014) 139-156, 142-143. 100 Vgl. Schulz: Dogmatik, 38. 101 Vgl. Kurzweil: Menschheit, 504 und dazu Krüger: Virtualität, 277 und Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 23. 95 96 97 98 99
271
272
Mathias Wirth
Eine Möglichkeit, beide Systeme enger zu verbinden, als es bisher über die Momente der Kontinuität und der Zäsur geschehen ist, liegt in dem Angebot von Denkmitteln, die der Transhumanismus der Eschatologie macht, wenn sie menschliche Personalität nicht ohne Körper und Zukunft denken will. Die Absage an eine transmortale, körperlose Identität hat bisher zu einem obligatorischen Schweigen bezüglich des konkreten Körpers geführt; auch weil die Theologiegeschichte voller kruder Spekulationen über diese Art des Körpers ist. Jedenfalls bieten Transhumanisten im Gespräch mit den naturwissenschaftlichen Fächern Modelle, wie sowohl Kontinuität als auch Novität von Körpern zu denken wären. Ein Beispiel stammt wiederum von Kurzweil, der darauf hinweist, dass die Haut und das mit ihr empfundene sensorische Erleben enger mit der Person verbunden ist als ein Organ wie die Leber, die im besten Fall nie gespürt wird.102 Es würde dem eschatologischen Vorbehalt, als dem Prärogativ Gottes in der eschatischen Gestaltung widersprechen,103 dies zum Gehalt von eschatologischer Spekulation zu machen. Aber wenn es auf die Denkfähigkeit von ›Kontinuität und Novität zugleich‹ reduziert wird, kann es theologische Bedeutung erlangen, sowie Formen des Enhancement als Zeichen für die Neuwerdung im Reich Gottes verstanden werden können, wie Ron Cole-Turner vorgeschlagen hat.104 Obwohl gerade More die nicht-religiöse Bedeutung seiner Philosophie des Transhumanismus betont,105 weisen sein Entwurf des Transhumanismus und darin enthaltene Elemente der somatoformen Kreativität, auffallende Parallelen zu Bedeutungskernen insbesondere des reformierten Christentums auf. Diese sollen im Sinne des Anliegens dieser Studie abschließend exemplarisch ausgeführt werden, auch um der Polytonalität der Überschrift dieses Beitrags gerecht zu werden, der selbstverständlich nicht nur, aber eben auch auf eine Konfession anspielte, die als pars pro toto Bedeutung für das ganze Christentum hat. Folgende vier Aspekte bestimmen präzise, was im Transhumanismus mit somatoformer Kreativität gemeint sein kann.106 Gleichzeitig erzeugen diese Bezüge deutliche Anklänge an das theologisch-ethische Proprium eines reformierten Christentums: (1) More hat den Begriff »freedom of form« geprägt,107 der genauer als morphologische Freiheit verstanden, die sich in theologischer Perspektive auf den Körper richtet.108 Die Überzeugung »human nature is not fixed«109 prägt explizit den Transhumanismus 102 103 104 105 106 107 108 109
Vgl. Kurzweil: Menschheit, 312 und Kurzweil: The Ray Kurzweil Reader, 3. Vgl. Moltmann: Kommen Gottes, 158. Vgl. Cole-Turner: Von der Theologie, 303. Vgl. auch Ziegler: ›Those he also glorified‹, 175. Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 4. Vgl. Krüger: Virtualität, 97-98. More: The Philosophy of Transhumanism, 4. Vgl. Sandberg: Morphological Freedom, 56. Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 31. Vgl. auch Cole-Turner: Transhumanism, 193 und Clark: Re-Inventing Ourselves, 263: »[…] human minds and bodies are essentially open to episodes of deep and transformative restructuring.«
Reformierte Körper
und implizit das Christentum, indem es transformative Zukunftsvorstellungen auf den Menschen und seinen Körper richtet, die in der dialektischen Spannung von Schon und Noch-Nicht bereits heute relevant sind.110 (2) Auch transhumane Topoi wie »self-direction or rational thinking«111 lassen sich als theologische Gehalte ausweisen, insofern damit Repressionen gegen Individuen112 und Blindheit in Fragen des Glaubens ausgeschlossen werden sollen.113 Besonders Mores »questioning over dogma«114 trifft ein Grundanliegen des reformierten Christentums. Im Licht von Werten, die More dem Transhumanismus zuschreibt, wird eine mit dem reformierten Christentum verbundene Ethik deutlich; so sehr, dass die Bestimmungen fast austauschbar wären: »That principle [of an open society in transhumanism] recommends supporting social orders that foster freedom of communication, freedom of action, experimentation, innovation, questioning, and learning. Opposing authoritarian social control and unnecessary hierarchy and favoring the rule of law and decentralization of power and responsibility.«115 (3) Ein anti-absolutistischer Revisionismus gehört wie bereits angeklungen ebenfalls zum Inventar des Transhumanismus und des reformierten Christentums. Damit avanciert Kritik zu einer nicht aussetzbaren epistemiologischen und ethischen Aufgabe.116 (4) Schließlich geht es More ausdrücklich um eine Transformation im Sinne einer »reorder«117 und nicht um eine Zukunft, die mit der Überwindung der Lebensform des Menschen liebäugelt.118 Selbst dort, wo die Rede vom Posthumanismus ist, bleibt jedenfalls bei Kurzweil und More weiterhin ein Mensch im Visier,119 der als »transitional human«120 allerdings durch wünschenswerte Alterität geprägt ist.121 Die Vorstellung, nach der die jetzige physische, psychische und moralische Konfiguration des Menschen noch nicht das Ende einer Entwicklung ist,122 , rückt
Vgl. Peters: Transhumanism, 148-150. More: The Philosophy of Transhumanism, 5. Vgl. Brandt: All Things New, 92, der wiederum auf Schleiermacher Bezug nimmt und reformierte Ethik auch als Kritik von »coercive pressure« versteht. 113 Vgl. Brandt: All Things New, 93. 114 More: The Philosophy of Transhumanism, 5. 115 More: The Philosophy of Transhumanism, 5. Vgl. auch Brandt: All Things New, 94. 116 Vgl. More: The Philosophy of Transhumanism, 6. More: Transhumanism, 10 und More: True Transhumanism, 140. Vgl. auch Cole-Turner: Transhumanism, 194. 117 More: Transhumanism, 11. Vgl. auch Bostrom: In Defense of Posthuman Dignity, 57. In christlicher, bzw. reformierter Perspektive werden mit Bezug auf Friedrich Schleiermacher restaurative Erfolge, die in einem weiteren Sinn als Rücknahme degenerativer Prozesse ausgelegt werden können, sogar mit soteriologischen Perspektiven verbunden und als Erlösung beschrieben, vgl. Brandt: All Things New, 92. 118 Vgl. More: True Transhumanism, 137. 143. 119 Vgl. Bostrom: Why I Want to be a Posthuman, 28-29.49-50. 120 Vgl. Tirosh-Samuelson: Engaging Transhumanism, 26. 121 Vgl. Bostrom: In Defense of Posthuman Dignity, 56. 122 Vgl. Ziegler: ›Those he also glorified‹, 169. 110 111 112
273
274
Mathias Wirth
Transhumanismus und Christentum nicht nur, aber auch über den Konnektor der somatoformen Kreativität auf die ipsilaterale Seite eines futurologischen, bzw. eschatologischen Körperpositivismus.123 Dieser betrifft allerdings nur dann den faktischen Körper, wenn die im Transhumanismus und im Christentum erhoffte Zukunft das Gut, das schon ist, integriert, damit sie überhaupt Bedeutung für die Gegenwart des Körpers hat.
Literatur Bath, Corinna/Bauer, Yvonne/Bock von Wülfingen, Bettina/Saupe, Angelika/Wber, Jutta: Materialität denken: Positionen und Werkzeuge. In: Dies. (Hg.): Materialität denken. Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Bielefeld 2005, 9-29. Benhabib, Seyla: Selbst im Kontext. Kommunikative Ethik im Spannungsfeld von Feminismus, Kommunitarismus und Postmoderne, Frankfurt a.M. 1995. Bostrom, Nick: In Defense of Posthuman Dignity. In: Hansell, Gregory/Gassie, William (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 55-66. Bostrom, Nick: Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up. In: More, Max/VitaMore, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 28-53. Brandt, James M.: All Things New. Reform of Church and Society in Schleiermacher’s Christian Ethics, London 2001. Calvin, Johannes: Unterricht in der christlichen Religion [1559], Göttingen 3 2012. Clark, Andy: Re-Inventing Ourselves. The Plasticity of Embodiment, Sensing, and Mind. In: Journal of Medicine and Philosophy 32 (2007) 263-282. Cole-Turner, Ronald: Transhumanism and Transcendence: Christian Hope in an Age of Technological Enhancement, Washington 2011. Cole-Turner, Ronald: Von der Theologie zum Transhumanismus und zurück. In: Göcke, Benedikt Paul/Meier-Hamidi, Frank (Hg.): Designobjekt Mensch. Die Agenda des Transhumanismus auf dem Prüfstand, Freiburg i.Br. 2018, 293-307. Dabrock, Peter: Kreativität und der Wert des Rückzugs. Ein theologisch-ethischer Essay. In: Ders./Keil, Siegfried (Hg.): Kreativität verantworten. Theologischsozialethische Zugänge und Handlungsfelder im Umgang mit dem Neuen, Neukirchen-Vluyn 2011, 17-34. Dalferth, Ingolf: Umsonst. Eine Erinnerung an die kreative Passivität des Menschen, Tübingen 2011.
123
Vgl. Sandberg: Morphological Freedom, 63 und Ziegler: ›Those he also glorified‹, 175.
Reformierte Körper
Frettlöh, Magdalene L.: Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 4 2002. Graham, Gordon: Philosophy, Art, and Religion. Understanding Faith and Creativity, Cambridge 2017. Grassie, William: Millennialism at the Singularity: Reflections on the Limits of Ray Kurzweil’s Exponential Logic. In: Hansell, Gregory/Ders. (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 249-269. Hefner, Philip: The Human Factor: Evolution, Culture, Religion, Minneapolis 1993. Hughes, James: Transhumanism and Personal Identity. In: More, Max/Vita-More, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 227-233. Korsch, Dietrich: Wie kommt das Neue in die Welt? Eine kleine Kritik des Kreativitätsbegriffs. In: Dabrock, Peter/Keil, Siegfried (Hg.): Kreativität verantworten. Theologisch-sozialethische Zugänge und Handlungsfelder im Umgang mit dem Neuen, Neukirchen-Vluyn 2011, 80-90. Krüger, Oliver: Virtualität und Unsterblichkeit. Gott, Evolution und die Singularität im Post- und Transhumanismus, Freiburg i.Br. 2019. Kurzweil, Ray: Menschheit 2.0. Die Singularität naht, Berlin 2013. Kurzweil, Ray: Progress and Relinquishment. In: More, Max/Vita-More, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 451-453. Kurzweil, Ray: The Ray Kurzweil Reader. A collection of essays, https://www. kurzweilai.net/pdf/RayKurzweilReader.pdf (zuletzt besucht: 23.03.2020) Moltmann, Jürgen: Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, München 1995. More, Max: A Letter to Mother Nature. In: Ders./Vita-More, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 449-450. More, Max/Vita-More, Natasha: Roots and Core Themes. In: Dies (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 1-2. More, Max: The Philosophy of Transhumanism. In: Ders./Vita-More, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 3-17. More, Max: Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy. In: Extropy 6 (1990) 6-12. More, Max: True Transhumanism: A Reply to Don Ihde. In: Hansell, Gregory/Gassie, William (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 136-146. Mulsow, Martin: Der vollkommene Mensch. Zur Prähistorie des Posthumanen. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 51 (2003) 739-760.
275
276
Mathias Wirth
Peters, Ted: Transhumanism and the Posthuman Future: Will Technological Progress Get Us There? In: Hansell, Gregory/Gassie, William (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 147-175. Rauschenbach, Laurèl: Spinal Cord Tumor Microenvironment. In: Birbrair, Alexander (Hg.): Tumor Mircoenvironments in Organs. From the Brain to the Skin – Part A, Basel 2020, 97-109. Reckwitz, Andreas: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Frankfurt a.M. 6 2019. Sandberg, Anders: Morphological Freedom – Why We Not Just Want It, But Need it. In: More, Max/Vita-More, Natasha (Hg.): The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Oxford 2013, 56-64. Schulz, Michael: Dogmatik/Dogmengeschichte, Paderborn 2001. Spreen, Dierk/Flessner, Bernd: Warum eine Kritik des Transhumanismus. In: Dies. (Hg.): Kritik des Transhumanismus. Über eine Ideologie der Optimierungsgesellschaft, Bielefeld 2018, 7-14. Steinmeier, Anne: Schöpfungsräume. Auf dem Weg einer praktischen Theologie als Kunst der Hoffnung, Gütersloh 2003. Thumfart, Alexander: Die Würde des Menschen: Ginnazzo Manetti, Giovanni Pico della Mirandola, Albrecht Dürer und Avisahi Margalit. In: Zeitschrift für Politik 52 (2004) 434-455. Thweatt, Jennifer Jeanine: Cyborg-Christus: Transhumanismus und die Heiligkeit des Körpers. In: Göcke, Benedikt Paul/Meier-Hamidi, Frank (Hg.): Designobjekt Mensch. Die Agenda des Transhumanismus auf dem Prüfstand, Freiburg i.Br. 2018, 363-376. Tirosh-Samuelson, Hava: Engaging Transhumanism. In: Hansell, Gregory/Gassie, William (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 19-52. Vita-More, Natasha: Bringing Arts/Design into the Discussion of Transhumanism. In: Hansell, Gregory/Gassie, William (Hg.): H+. Transhumanism and its Critics, Philadelphia 2011, 70-83. Weber, Jutta: Die Produktion des Unerwarteten. Materialität und Körperpolitik in der Künstlichen Intelligenz. In: Bath, Corinna/Bauer, Yvonne/Bock von Wülfingen, Bettina/Saupe, Angelika/Dies. (Hg.): Materialität denken. Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Bielefeld 2005, 59-83. Wirth, Mathias: Das Enjabement von Eigenem und Fremden. Zur anthropologischen Vehemenz von Technikphilosophie und Transplantationsmedizin. In: Ethica 23 (2015) 337-363. Wirth, Mathias: Doketisch, pelagianisch, sarkisch? Transhumanismus und technologische Modifikationen des Körpers in theologischer Perspektive. In: Neue
Reformierte Körper
Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 60 (2018) 142167. Wirth, Mathias: Transition and Care. Theological Concepts of Dynamic Creation and the Ethics of Genome Editing. In: Braun, Matthias/Schickl, Hannah/Dabrock, Peter (Hg.): Between Moral Hazard and Legal Uncertainty. Ethical, Legal and Societal Challenges of Human Genome Editing, Wiesbaden 2018, 129-148. Wirth, Mathias: Trans-Körper. Theologie im Gespräch mit Transhumanismus und Transsexualität. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik 62 (2018) 10-30. Wirth, Mathias: Trostlose Eschatologie. Über eine unerledigte Kontroverse in der neueren Dogmatik. In: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 58 (2016) 259-284. Wirth, Mathias: Von Anaximander bis Zimzum. Raumgabe als ethischer und religiöser Respons auf Verkörperung. In: Gruevska, Julia (Hg.): Körper und Räume, Wiesbaden 2019, 153-177. Ziegler, Philip G.: ›Those he also glorified‹: Some Reformed Perspectives on Human Nature and Destiny. In: Studies in Christian Ethics 32 (2019) 165-176.
277
Körperliche Christen Christoph Asmuth
Die Tradition habe den Körper verachtet und erniedrigt. Sie habe ihn, wo irgend möglich, verdrängt, ins Abseits gestellt und ausgeschlossen von den lebensentscheidenden und todernsten Fragen und Problemen, jenen hehren Inhalten der Religion, der Philosophie, der Kunst, der Politik, die nur durch Geist und Seele allein aufgefasst und empfangen werden können sollten. Leiblichkeit, Materialität, Sexualität des Menschen seien rigoros entwertet worden bis hin zur völligen Erniedrigung, Verwerfung und Entwertung. Dieses Lied hört man allenthalben. Eine ganze Zunft von philosophischen Anthropologen, Kunstwissenschaftlern, Theologen betreibt die Rehabilitation des Verdrängten. Dafür haben sie gute Gründe. Die Geschichte der europäischen Kulturen ist voll von Material, das belegt, wie umfassend die Inkriminierung der Körperlichkeit ist. Im Detail stellt sich die Sachlage dagegen vielfach anders dar. Die Fokussierung auf den Körper wirft charakteristische Probleme auf. Man muss den Körper nicht verdrängen, um ihn zu verachten. Noch weniger muss man ihn gering schätzen, um die Sexualität grosso modo abzulehnen. Das Unkörperliche, Geistige, Intelligible hat vielleicht doch ein spezielles Eigenrecht, das sich gegenüber dem Körper begründen lässt. Gravierender noch: Es ist mehr oder minder unklar, was einzelne Autoren, seien sie antik oder modern, unter dem Begriff ›Körper‹ eigentlich verstehen, noch weitaus unklarer allerdings, wie sie sich ihren eigenen Körper und den ihrer Mitmenschen vorstellen. Erwartungen, mit der Ehrenrettung des verachteten Körpers käme eine Emanzipation oder gar Revolution zustande, die nun dem Körper endlich sein Eigenrecht zukommen lassen könnten, lösen sich schnell in ideologische Präsumtionen auf. Sie entstehen aus einer unbegründeten Arroganz, gespeist aus der Überzeugung, unser eigenes Körperverhältnis sei aufgeklärt und modern. Auch darin steckt vielleicht mehr als nur ein Funken Wahrheit. Aber diese Wahrheit soll hier nicht das Thema sein.1
1
Für die schnelle und kompetente Korrektur und die Einrichtung des vorliegenden Textes bin ich Frau Andrea Töcker (Augustana-Hochschule, Neuendettelsau) zu großem Dank verpflichtet.
280
Christoph Asmuth
Ich möchte mit meinem Beitrag zur moderaten Korrektur gängiger Vorstellungen über Körperverächter beitragen. Mein Ziel besteht genauer darin, das Körperbild bei Tertullian zu beleuchten. Seine Auffassung ist deswegen für mein Thema von großem Interesse, weil sich bei ihm eine philosophische Entwicklung findet, die einerseits gegen den Platonismus gerichtet ist, gleichzeitig aber – andererseits – mit den grellbunten Bildern vom Sterben der Märtyrer rhetorisch aufgeladen ist. Hier werden Körper konkret und kreativ. Das macht Tertullian zu einer guten Referenz für ein weithin ungelöstes philosophisches Problem. Schließlich möchte ich bekennen, dass Tertullian ein außergewöhnlicher Schriftsteller ist. Damit befinde ich mich in bester Gesellschaft. Erasmus las Tertullian mit großem Gewinn und schätzte dessen rhetorisches Geschick.2 Man muss Tertullian nicht zustimmen, um die Schärfe seiner Rhetorik zu schätzen. Ich möchte indes mit einem Abschnitt über Platon beginnen, der vielfach als erster Körperverächter gehandelt wird. Danach möchte ich ein paar Beispiele für das Märtyrertum liefern, Beispiele, in denen es nicht nur um die Zerstörung der Körper, sondern um deren Verwandlung geht. Die Berichte über den Tod der Blutzeugen machen ein antikes, genauer frühchristliches Körperbild konkret und narrativ nachvollziehbar. Mit Tertullian werde ich versuchen, die argumentative Verfestigung dieses Körperbildes nachzuvollziehen. Dazu gehört seine Auffassung von der Seele, die ein Komplement des Körpers ist.
1.
Platon: Ein Körperverächter?
Platon votiert in seinem Dialog Phaidon – vielleicht erstmals in der Geschichte der Philosophie – für eine klare und grundlegende Unterscheidung von Körper und Geist.3 Körper und Geist werden als gegensätzliche Pole vorgestellt.4 Das hat Platon den Ruf eines Körperverächters eingebracht, ja, vielleicht sogar den eines
2 3
4
Vgl.: Greenslade, Stanley L.: Erasmus and Tertullian. In: Studia Patristica, Vol. XIV, Part III, Elizabeth A. Livingstone (Hg.), Berlin 1976, 37-40. Zum Phaidon: Bostock, David: Plato’s Phaedo. Oxford 1986. Dorter, Kenneth: Plato’s Phaedo. An Interpretation, Toronto u.a. 1982. Frede, Dorothea: Platons ›Phaidon‹. Der Traum von der Unsterblichkeit der Seele, Darmstadt 2 2005. Menkhaus, Torsten: Eidos, Psyche und Unsterblichkeit. Ein Kommentar zu Platons Phaidon, Frankfurt a.M. 2003. Bordt, Michael: »Metaphysischer und anthropologischer Dualismus bei Platon«. In: Niederbacher, Bruno/Runggaldier, Edmund (Hg.): Die menschliche Seele. Brauchen wir den Dualismus?, Frankfurt a.M. u.a. 2006, 99-115. Müller, Jörn: »Leib-Seele-Dualismus? Zur Anthropologie beim späten Platon«. In: De Brasi, Diego/Föllinger, Sabine (Hg.): Anthropologie in Antike und Gegenwart. Biologische und philosophische Entwürfe vom Menschen, Freiburg – München 2015, 59-96.
Körperliche Christen
Erzvaters aller Körperverachtung.5 Im Zusammenhang des Dialogs kommt es zu dieser Unterscheidung, weil Platon – aus heutiger Sicht relativ unvermittelt – versucht, seine Ideenlehre zu etablieren: Die Ideenlehre wird im Phaidon eingeführt wie etwas bereits Bekanntes, so dass wir kaum genaue Einzelheiten darüber erfahren, wie die Ideenlehre im Detail konstruiert ist oder wie Platon die Ideen genau denkt. Andererseits ist der Phaidon der erste Text, zumindest soweit wir das wissen, der versucht, die Unsterblichkeit der Seele oder genauer: die Fortexistenz der Seele nach dem Tod des Körpers zu ›beweisen‹. Zumindest enthält der Phaidon vier Versuche, vier Argumentationsgänge, die für die Fortexistenz der Seele sprechen sollen. Gleichzeitig enthält der Phaidon scharfe und abschätzige Bemerkungen über den Körper: Der Körper sei der Kerker der Seele. Der Körper müsse absterben, damit die Seele rein werde. Philosophieren heiße sterben lernen, d.h. das Reinwerden der Seele vorzubereiten. Im Hintergrund liegt eine pythagoreisch gefärbte Gesprächssituation. Platon verweist durch die teilnehmenden Figuren selbst auf den Pythagoreismus hin. Der Gesprächsinhalt deutet ebenfalls auf ein pythagoreisches Themenfeld. Eine Lehre von der Seelenwanderung, mit welchen Details sie auch immer ausgestattet sein mag, setzt jedenfalls die Abtrennbarkeit der Seele vom Körper voraus. Platon kombiniert die Abtrennbarkeit der Seele mit Grundzügen seiner Ideenlehre. Auffällig ist, dass Platon hier von jener differenzierten Seelenlehre schweigt, die er beispielsweise prominent in der Politeia vorträgt. Er erwähnt keine Seelenteile mit unterschiedlichen emotiven, affektiven und intellektuellen Funktionen. Verheerende Leidenschaften werden im Phaidon schlechthin dem Körper zugewiesen. Die Seele setzt der Phaidon undifferenziert mit dem Denken gleich. Damit scheint Platon weit entfernt zu sein von der am Körper festgemachten Liebesphilosophie des Symposion, in dem der Körper und seine Schönheit zum Ausgangspunkt einer Aufstiegsbewegung zu den Ideen werden kann. Allerdings liest man im Phaidon selbst einige Passagen, die zu der Annahme führen können, dass es mit der dualistischen Trennung von Körper und Geist bei
5
König, Eugen: Körper – Wissen – Macht. Studien zur historischen Anthropologie des Körpers, Berlin 1989, 27: »Wurde im Höhlengleichnis die empirische Welt als Gefängnis der Menschen vorgestellt, so jetzt der Körper als ›Gefängnis der Seele‹, das wir, ›eingekerkert wie ein Schaltier, mit uns herumtragen‹. Der Körper ist das ›Übel‹, das ›uns tausenderlei zu schaffen‹ macht, und von dem die Seele, ›im Gemenge‹ mit ihm, ›übel zugerichtet‹ wird; er ›macht uns Unruhe und Störung und verwirrt uns‹ – daher ist er Platon ›zuwider‹. Der Mensch als Körper ist bei Platon also eine einzige Bedrohung für den Menschen als Seele. Der irdische Aufenthaltsort der Seele erweist sich als körperliches Gefängnis und ständiger Gefahrenherd für die seelische Ideenartigkeit und Gottähnlichkeit.«
281
282
Christoph Asmuth
Platon selbst nicht so weit her ist.6 Zu den Ideen zählt Sokrates neben den bekannten Ideen wie Gerechtigkeit, Schönheit und Gutheit nun auch Größe, Gesundheit und Stärke. Insbesondere die Idee der Gesundheit deutet an, dass es Platon nicht um die dogmatische Behauptung geht, die Seele und mit ihr die einzig ihr zugängliche Welt der Ideen sei strictu sensu von der Körperlichkeit abgetrennt. Vielmehr ist es umgekehrt: Die Ideen sind gerade als Ideen zwar das wesentliche Seiende schlechthin, aber genauso über den Ideaten, die sie ihrem Sein und Wesen nach begründen, als aber auch in ihnen. Diese doppelte Bewegung zeigt sich bei Platon auch im Höhlengleichnis. Der befreite Gefangene wird nicht nur – mit Gewalt – aus der Höhle herausgeschleppt; nach Einsicht in das wesentliche Sein muss er – jetzt freiwillig und mit Einsicht – wieder hinab in die Höhle, d.h. in die Welt der unwesentlichen Erscheinungen. Was das Höhlengleichnis noch unter den Vorzeichen einer didaktischen Grundsituation vorstellt, gilt in analoger Weise für die Ideenlehre. Einerseits kann man nach Platon die Ideen einzig rein für sich selbst mit dem Denken (diánoia) erkennen; gleichzeitig müssen sie aber mit der Wirklichkeit vermittelt sein, d.h. mit dem Bereich, der auch durch dóxa und pístis, durch begründete Meinung und dafürhaltenden Glauben, zugänglich ist. Für den Phaidon jedenfalls lässt sich festhalten: Die Abtrennbarkeit der Seele wird mit der neu etablierten Ideenlehre und durch diese Ideenlehre zu einem Problem, auf das der Dialog gerade eine Antwort sucht und dessen Schwierigkeiten gerade ausgeleuchtet werden. Die Ideenlehre aber ist als ein gewaltiger Schritt in der Entwicklung der abendländischen Rationalität zu werten: Erstmals wird nun der Bereich des Allgemeinen mit dem Notwendigen und dem des Apriorischen verkoppelt. Erstmals stehen für Platon daher Kriterien zur Verfügung, um Natur, Ethik und Logik (Dialektik) miteinander zu verkoppeln. Insgesamt scheint es daher nicht plausibel, Platon als genuinen Leibverächter darzustellen. Tatsächlich wird er aber bereits von den an seine Lehre anknüpfenden antiken Traditionen gerne dazu gemacht. Vielmehr bleibt Platon dem klassischgriechischen Ideal einer Harmonie von Leib und Seele, von Vernunft und Lust verhaftet, dies allerdings so, dass Vernunft und Seele Leitfunktionen bilden für den Körper und die Lüste. Es ging Platon, wie in der klassischen Antike häufig, um das richtige Maß. An eine Emanzipation des Körpers oder des Leibes hat er sicher nicht gedacht. Aber er verstand, dass in aller Wandelbarkeit, und das heißt zunächst: in aller Vergänglichkeit, das Wissen erhalten bleibt. Für Platon bestand dieses Wissen in Geometrie und Arithmetik, in Musik und Astronomie, in Ethik und Politik, insgesamt Wissen, von dem Platon überzeugt war, dass es Bestand hatte, auch dann, wenn die Wissenden der Vergänglichkeit preisgegeben waren. Er begriff, dass das 6
Vgl. dazu auch die Untersuchung über die Weltseele (Platon Leg. X 898e–899a), wo die Schwierigkeiten angesprochen werden, die das Verhältnis von Seele und Körper betreffen, insbesondere dann, wenn die Seele unkörperlich gedacht wird.
Körperliche Christen
Wissen ungleich stabiler war als der vergängliche Mensch. Platon konnte das Geistige für sich denken. Das ist eine enorme begriffliche Leistung. Dass der Körper, preisgegeben jeder Krankheit, Verletzung und kriegerischer Zerstörung, in Platons Gedankenwelt mit dem Geistigen nicht auf einer Stufe stehen konnte, erklärt sich daher von selbst.
2.
Der schöne Tod: Die Märtyrer
Gute fünfhundert Jahre später hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Das Christentum hatte sich etabliert, geriet aber verschiedentlich in Bedrängnis und musste manch prekäre Lage überstehen. Zu einer ersten allgemeinen Christenverfolgung kommt es erst im Jahr 249, als Decius von allen Bewohnern des Reiches den Kult für die traditionellen Götter verbindlich macht und über den Vollzug des Opfers Bescheinigungen ausstellen lässt. Ähnlich verfährt nach ihm Valerian, Ausdruck einer sich verschärfenden Krise des Reichs. Zuvor sind die Christenverfolgungen lokal begrenzt und dehnen sich nicht auf das ganze Reich aus. Erst über einhundert Jahren nach dem Tod Jesu werden die Christen überhaupt als eine vom Judentum unabhängige Religion aufgefasst.7 Als erstes Beispiel möchte ich hier das Martyrium des Polykarp im Jahre 155 vorstellen. Es zeigt eine charakteristische Seite der Leiblichkeit jener frühen Christen: »Als er [Polykarp, Ch. A.] das Amen hinaufgesandt und sein Gebet vollendet hatte, zündeten die dafür zuständigen Menschen das Feuer an. Mächtig loderte die Flamme empor; ein Wunder sahen wir, denen es gegeben war, es zu sehen, und uns war es vorbehalten, die Geschehnisse den Übrigen zu verkünden. Denn das Feuer nahm die Form einer Wölbung an, wie ein vom Winde aufgeblähtes Schiffssegel, und umhüllte ringsum (schützend) den Leib des Märtyrers. Er befand sich mittendrin, nicht wie Fleisch, das brät, sondern wie Brot, das gebacken wird, oder wie Gold und Silber, das im Schmelzofen gereinigt wird. Auch empfanden wir einen solchen Wohlgeruch wie von duftendem Weihrauch oder von irgendeinem anderen der kostbaren Rauchwerke. […] Als endlich die Gottlosen sahen, daß sein
7
Vgl. Fox, Robin Lane: Pagans and Christians. In the Mediterranean world from the second century AD to the conversion of Constantine, London 1986. Dodds, Eric R.: Pagan and Christian in an Age of Anxiety, London 1965. Chadwick, Henry: The Early Church (The Penguin History of the Church; 1) überarbeitete Auflage, London 1993. Harnack, Adolf von: Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, 2 Teile, Leipzig 1893-1904. Bardenhewer, Otto: Geschichte der altkirchlichen Literatur, 5 Bde., Freiburg 1913, Nachdruck Darmstadt 2007. Achelis, Hans: Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten, 2 Bde., Leipzig 1912. Benko, Stephen: Pagan Rome an the Early Christians, London 1985. Campenhausen, Hans Freiherr von: Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, Göttingen 2 1964.
283
284
Christoph Asmuth
Leib nicht vom Feuer verzehrt werden konnte, befahlen sie, daß der Vollstrecker zu ihm träte und den Dolch hineinstoße. Und als er dies tat, kam (eine Taube und) eine solche Menge Blut hervor, daß das Feuer erlosch und die ganze Menge sich verwunderte, welch ein Unterschied zwischen den Ungläubigen und den Auserwählten besteht.«8 Schließlich schaffen es die Christen sogar, die Gebeine des Heiligen Polykarp zu bergen, um sie für die Reliquienverehrung zu retten. Eingebettet in die Erzählung von der übermenschlichen Willens- und Charakterstärke des Polykarp, der allen Versuchungen, die sein Leiden abwenden oder verkürzen könnten, entsagt, findet sich der Bericht über sein Martyrium. Es ist voll von mirakulösen Ereignissen, Wandlungen des Leibes und heiligen Transformationen, Wandlungen voller Wunder. Schließlich war der Heilige Polykarp nicht irgendwer. Er war Bischof von Smyrna. Sein Urteil genoss höchste Autorität. So berichtet Irenäus von Lyon, der den Polykarp in seiner Jugend gehört haben will, dass dieser nicht nur von den Aposteln Jesu zum Bischof von Smyrna eingesetzt worden sei, sondern auch, dass er Umgang pflegte mit dem Evangelisten Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu.9 Polykarp ist nicht nur ein Blutzeuge, sondern ein Märtyrer ersten Ranges. Sein Martyrium ist nach dem Bild vom Leiden und Tod Jesu gezeichnet. Polykarp gibt Zeugnis ab im Sinne der Jüngerschaft und Nachfolge. Blicken wir auf ein weiteres Beispiel, das – folgt man den tradierten Legenden – eng mit Polykarp zusammenhängt: das Martyrium des Pionius in Smyrna am 12. März 250 unter Kaiser Decius.10 Die Pioniusakten berichten, dass Kaiser Decius befohlen hatte, dass jedermann an den Festtagen den Göttern zu opfern hätte. Pionius und zwei weitere Christen verweigern Huldigung und Opfer für die Götter, schließlich auch für den vergöttlichten Kaiser. Die Dramatik der Akten sieht vor, dass immer weitere Versuche unternommen werden, Pionius umzustimmen, Versuchungen, die der heilige Mann ausschlägt. Das Leiden mündet in eine Demonstration des aufrichtigen Glaubens. Pionius habe, so der Bericht, asketisch und ohne Sünde gelebt. Auch sein Martyrium besteht wie bei Polykarp in der Verbrennung bei lebendigem Leibe: »Das ist das Ende des seligen Pionius. […] alle, die das Mitleiden oder die Neugierde dorthin geführt hatte, sahen den Leib des Pionius so, als ob er neue Glieder bekommen hätte. Er hatte erhobene Ohren, schönere Haare, einen jung aufsprossenden Bart; alle seine Glieder waren so wohlgestaltet, daß 8
9 10
Zitiert nach der Übersetzung in: Das Martyrium des Polykarp. Übersetzt und erklärt von Gerd Buschmann (Kommentar zu den Apostolischen Vätern; 6), Göttingen 1998, 291.310. Vgl. ferner: Zwierlein, Otto: Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycarpianum, Berlin/Boston 2014. Vgl. Irenäus von Lyon, Contra haereses, 3.3.4. Robert, Louis : Le Martyre de Pionios, pretre de Smyrne, Washington 1994.
Körperliche Christen
man ihn für einen Jüngling hielt; das Feuer hatte seinen Leib gleichsam verjüngt, ihm zur Ehre und zum Beweise der Auferstehung. Aus seinem Angesichte lächelte eine wunderbare Anmut, und viele andere Zeichen englischen Glanzes leuchteten an ihm, so daß es den Christen Vertrauen, den Heiden aber Furcht machte.«11 Pionius wird im Martyrium ebenfalls verwandelt, verjüngt. Die Transformation des Pionius ist eine Darstellung der Auferstehung. Die Auferstehung wirkt wie ein Jungbrunnen. Sie führt zur Genesung des Körpers, nicht zu seiner Vernichtung und endgültigen Zerstörung, wie man es durch das Feuer erwarten sollte. Es handelt sich um eine Verklärung des Leibes, eine wundersame Wandlung zu Heil und Reinheit. Die Ähnlichkeiten mit dem Martyrium des Polykarp sind inszeniert. Eusebius von Caesarea konnte Pionius für einen Zeitgenossen des Polykarp halten. In der Mitte 4. Jahrhunderts hat ein unbekannter Schriftsteller sogar in der Rolle des Pionius über Polykarp, dessen Leben und Martyrium, geschrieben.12 Die Quellen zeigen die Macht des neuen Glaubens, die Stärke des Wissens, an der verheißenen Botschaft unter Einsatz des eigenen Leibes festzuhalten. Sie zeigen ein körperliches Christentum. Das Martyrium der heiligen Perpetua,13 das während der sporadischen Verfolgungen unter Septimus Severus wahrscheinlich um das Jahr 202 stattfand, also zeitlich zwischen den beiden Smyrnern, ist begleitet von Visionen, Gesichten,14 die Perpetua in ihrer Zeit vor ihrer Hinrichtung im Kerker hatte.15 Perpetua war eine gebildete und wohlhabende Frau aus Karthago und stand dem Kreis um Tertullian nahe. Sie ist verheiratet, hat ein Kind, das sie noch stillt. Die Familie, ihr Vater, 11 12 13
14 15
Übersetzung nach: Frühchristliche Apologeten Band II. Übersetzt von Gerhard Rauschen (Märtyrerakten) (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 14), München 1913, 365. Vgl. Zwierlein: Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii. Vgl. zur Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis: Habermehl, Peter: Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Versuch zur Passio sanctarum Perpetuae et Felicitas (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; 140), Berlin 1992. Kitzler, Petr: From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church (Arbeiten zur Kirchengeschichte; 127), Berlin – Boston 2015 (hier auch eine aktuelle Bibliographie). Heffernan, Thomas J.: The Passion of Perpetua and Felicity, New York 2012. La passione di Perpetua e Felicita. Prefazione di Eva Cantarella. Introduzione, traduzione e note di Marco Formisano, Milano 2008. Gold, Barbara K.: Perpetua. Athlete of God, New York, NY 2018. Bremmer, Jan N./Formisano, Marco: Perpetua’s Passions. Multidisciplinary Approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis, Oxford 2012. Gonzalez, Eliezer: The Fate of the Dead in Early Third Century North African Christianity. The Passion of Perpetua and Felicitas and Tertullian, Tübingen 2014. Butler, Rex D.: The new prophecy and new visions. Evidence of Montanism in The Passion of Perpetua and Felicitas, Washington, DC 2006. Vgl. Habermehl, Perpetua, 66. Zum Text, Entstehung, Sprache, Überlieferung: Bremmer, Jan N.: Perpetua and Her Diary. Autenticity, Family and Visions. In: Ameling, Walter (Hg.): Märtyrer und Märtyrerakten (Altertumswissenschaftliches Kolloquium; 6) Stuttgart 2002, 77-120.
285
286
Christoph Asmuth
das Kind, am Rande auch die Mutter, finden im Text Erwähnung. Der Ehemann hingegen nicht; er bleibt unsichtbar. Der Text unterstellt, dass Perpetua ihn selbst verfasst hat, während sie im Gefängnis saß. Das ist umstritten. Vielfach wird aber angenommen, dass zumindest Teile des Textes, eine Art Tagebuch aus dem Kerker, tatsächlich von Perpetua stammen, gerahmt und ergänzt durch andere Texte, zusammengestellt von mindestens einem Redaktor. Insofern ist es gerechtfertigt, in Perpetua eine frühe Schriftstellerin zu sehen.16 Wie weit allerdings die Authentizität ihrer Gedanken zu strapazieren ist, lässt sich nicht wirklich beziffern. Es wurde verschiedentlich vermutet, dass Tertullian der Verfasser dieses Berichts ist.17 Die Stilistik spricht dagegen. Aber Tertullian kannte offenbar den Bericht der Perpetua und ihrer Vision, auf die er in seiner Schrift De anima ausdrücklich hinweist.18 Perpetua war dazu verurteilt, im Amphitheater von wilden Tieren zerrissen zu werden. Der Bericht betont ihre christliche Gelassenheit angesichts des Todes, aber auch die metaphysische Grunddimension, in der sie ihr Martyrium sieht. »Am Tag vor unserem Kampf sehe ich in einem Gesicht folgendes: Der Diakon Pomponius war zum Gefängnistor gekommen und klopfte heftig. Und ich ging hinaus zu ihm und öffnete ihm; […] Und er sagte zu mir: ›Perpetua, wir warten auf Dich, komm.‹ […] er führte mich mitten in die Arena und sagte zu mir: ›Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und stehe dir zur Seite.‹ Und er ging fort. Und ich sehe eine ungeheure Menge in gespannter Erwartung, und weil ich wußte, daß ich zu den Tieren verurteilt war, wunderte ich mich, daß die Tiere nicht auf mich losgelassen wurden. Und heraus trat, als mein Gegner, ein Ägypter von abstoßendem Äußeren, samt seinen Leuten, um mit mir zu kämpfen. Auch zu mir kommen schöne junge Männer, meine Helfer und Anhänger. Und ich wurde ausgezogen und zum Mann, und meine Leute rieben mich mit Öl ein, wie es bei Wettkämpfen üblich ist. Den Ägypter hingegen sehe ich sich im Staub wälzen. Und heraus trat ein Mann von so wundersamer Größe, daß er sogar den First des Amphitheaters überragte; […] Und er gebot Ruhe und sagte: ›Siegt dieser Ägypter, wird er sie mit dem
16
17
18
Vgl. Cobb, L. Stephanie: Dying to Be Men: Gender and Language in Early Christian Martyr Texts, New York 2008. Wilson-Kastner, Patricia (Hg.): A Lost Tradition. Women Writers of the Early Church, Washington, D.C. 1981. Davon wusste bereits Leibniz. Vgl. Leibniz, Gottfried W.: Sämtliche Schriften und Briefe. Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Bd. 13: August 1696 – April 1697, hg. v. Utermöhlen, Gerda/Sellschop, Sabine, Berlin 1987, Nr. 259, an André Morel à Arnstat. 10.12.1696: 397. Leibniz hat die Faszination gespürt, die von diesem Text der frühen christlichen Gemeinden ausging. Er kennt die Auffassungen, die Tertullian die Verfasserschaft zuschreiben, steht dieser These aber sehr skeptisch gegenüber. Tertullian, De an. 55,4. Im Folgenden zitiere ich nach der Ausgabe: Tertullian: Über die Seele. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Jan H. Waszink (Bibliothek der alten Welt), Zürich – München 1980.
Körperliche Christen
Schwert töten. Besiegt sie ihn, wird sie diesen Zweig empfangen.‹ Und er trat zurück. Und wir gingen aufeinander los und begannen mit den Fäusten zu schlagen. Er suchte mich an den Füßen zu packen; ich trat ihm aber mit den Fersen ins Gesicht. Und ich wurde in die Luft gehoben und fing an, ihn so zu treten wie jemand, der den Boden nicht mehr berührt. Als ich aber eine Atempause eintreten sah, schloß ich die Hände ineinander, Finger in Finger verschränkt, und packte ihn am Kopf, und er stürzte aufs Gesicht, und ich trat ihm auf den Kopf. Und das Volk brach in Beifall aus und meine Anhänger begannen zu jubilieren. Und ich trat vor den Gladiatorenmeister und empfing den Zweig. Und er küßte mich und sagte zu mir: ›Tochter, der Friede sei mit dir.‹ Und in Herrlichkeit schritt ich zum Tor des Lebens. Und ich erwachte. Und ich erkannte, daß ich nicht mit den Tieren, sondern mit dem Teufel kämpfen werde; doch ich wußte, der Sieg werde mein sein. Das habe ich bis zum Tag vor den Spielen getan. Was aber bei den Spielen selbst geschehen ist, mag aufschreiben, wer immer willens ist.«19 Diese Vision verbindet die Geschichte von Perpetua mit derjenigen des Polykarp. Denn auch der greise Polykarp hat kurz vor seiner Verhaftung, die letztlich im Martyrium endet, eine Vision: Sein Kopfkissen wird ein Opfer der Flammen. Und Polykarp begreift sofort, dass er den Märtyrertod in Flammen erleiden wird.20 Die Vision der Perpetua ist voller geheimnisvoller Wendungen. Sie ist zu den Tieren verurteilt; in der Arena muss sie aber einen athletischen Zweikampf bestehen; sie wird in einen Pankration geschickt, die schwierigste und häufig tödlich endende Kampfsportart der Antike.21 Ungewöhnlich ist nicht nur die Verwandlung der Perpetua in einen Mann,22 sondern auch, dass die weibliche Identität erhalten bleibt. Der Kampfrichter spricht sie nach der Verwandlung und noch vor dem Kampf wiederum als Frau an. Ist der hässliche Ägypter besiegt, erkennt Perpetua unmittelbar, dass sie mit dem Teufel gekämpft und ihn besiegt hat. Dass das Böse hässlich ist, mag ein Topos sein, der bis in das 18. Jahrhundert Gültigkeit beanspruchen kann, aber warum ist der Teufel ausgerechnet ein Ägypter? Von Karthago aus mag für die Christen des beginnenden dritten Jahrhunderts Ägypten das Babylon sein, der Inbegriff der antichristlichen Unsittlichkeit, der von Grund auf falsche
19 20
21 22
Habermehl, Perpetua, 15-17. Vgl. Martyrium Polycarpi 5,2: »Und beim Gebet hatte er eine Vision, drei Tage vor seiner Gefangennahme; er sah, daß sein Kopfkissen vom Feuer verzehrt wurde. Er wandte ich um und sprach prophetisch zu denen, die bei ihm waren: ›Ich muß lebendig verbrannt werden‹« (Buschmann, Polykarp, 130.135-141). Zur Parallele zwischen der Passio Perpetuae und Martyrium Polycarpi: Habermehl, Perpetua, 67. Vgl. Gold: Perpetua. Vgl. ferner Gold, Barbara K.: »›And I Became a Man‹. Gender Fluidity and Closure in Perpetua’s Prison Narrative«. In: Lateiner, Donald G. u.a. (Hg.): Roman Literature, Gender, and Reception. Domina Illustris, New York 2013, 153-165.
287
288
Christoph Asmuth
Glaube, eine Verderbtheit, die in die Geschichte des jüdischen Volkes lange zurückreicht. Warum ist ein Ägypter schlimmer als jede Bestie? Perpetua jedenfalls ist es in ihrer Vision unmittelbar klar, dass sie mit einem Ägypter kämpfen wird und man erfährt nicht, woran sie das erkannt hat.23 Die drei Märtyrerberichte zeigen exemplarisch, dass das Leben der Christen von Visionen und Wundern geprägt war. Es macht wenig Sinn, in welcher Absicht auch immer, Wirklichkeit, d.h. Authentizität, und Fiktion trennen zu wollen. Das hätte etwas Anachronistisches an sich. Die Texte bieten keine bloßen Darstellungen von Ereignissen. Sie stellen das, was geschehen ist, in ein Weltbild. Oder umgekehrt: Nur in diesem Weltbild konnten sich die beschriebenen Geschehnisse ereignen. Die Aufklärung hat bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Glaubwürdigkeit der Berichte bezweifelt oder heruntergespielt und versucht, ein rationales Weltbild gegen die unaufgeklärte, die bilder- und wunderreiche Welt der spätantiken Christen auszuspielen. Dieses Weltbild erklärt nicht nur, was passiert ist, sondern transportiert eine Botschaft. Für das vorliegende Problem ist es wichtig, dass die Ereignisse in einem körperlichen Horizont stattfinden. Das Martyrium und sein Wunder geschehen auf körperlicher Weise. Die Umwandlungen sind körperlich. Tod und Auferstehung sind körperlich. Die Erhöhung der Person der Märtyrerin oder des Märtyrers vollzieht sich im Leib. Umgekehrt bedeutet das, dass die Sphäre körperloser Geistigkeit in den Berichten vollständig fehlt. Der Heilige Polykarp wird nicht durch die Flamme verzehrt, sondern verwandelt. Er wird nicht gebraten (zerstört), sondern gebacken, wie Brot. Der schreckliche Gestank verbrannten Fleisches verwandelt sich in edle Düfte ätherischer Öle. Brot und Blut, eine Verwandlung, die auf die Eucharistie anspielt. Polykarps Körper wird nicht vernichtet, sondern erhöht, verklärt, gereinigt. In der Vision der Perpetua findet sogar eine Verwandlung des Geschlechts statt. Perpetua wird von einer schwachen Frau zu einem starken Mann. Darin spiegelt sich nicht die Auffassung einer herausgehobenen Rolle der Frau; vielmehr zeigt der Bericht der Perpetua das Gegenteil: Die Frau ist schwach und bedarf einer übernatürlichen Männlichkeit, um den Kampf gegen den Teufel zu bestehen.24 Die Männlichkeit steht dabei nicht nur für Stärke, sondern auch für Reinheit, Keuschheit, Aufrichtigkeit. Am Körper der Märtyrer erfahren die Christen die Fragilität ihres eigenen Leibes; sie sehen in ihnen bereits den von Paulus angekündigten verklärten und erhöhten Leib. Das Fleisch, sarx, verwandelt sich und wird heilig, wird ein würdiges Gefäß für den Geist.
23 24
Vgl. Dölger, Franz Josef : Der Kampf mit dem Ägypter in der Perpetua-Vision. Das Martyrium als Kampf mit dem Teufel. In: Antike und Christentum 3 (1932), 177-188. Vgl. Habermehl, Perpetua, 109-119. Die Argumentation von Habermehl ist schlagend, insbesondere der Verweis auf Artemidor, Oneirocritica 5,45.
Körperliche Christen
3.
Tertullian und die körperliche Seele
Im Gegensatz zu philosophischen Schriften wird in den Märtyrerberichten nicht argumentiert. Es stehen keine Theorien in der Diskussion. Es gibt keine Argumente für oder wider die Fortexistenz der Seele. Noch weniger steht die Frage im Raum, was die Seele überhaupt ist. Mit einem Wort: Es gibt kein Konzept der Seele. Anders bei Tertullian! Eine Voraussetzung für Tertullians Überlegungen besteht in der durchgängigen Körperlichkeit der Welt und Gottes: »Alles, was existiert, ist körperlich in seiner besondern Art. Nichts ist unkörperlich, ausser was gar nicht existiert.«25 Sein Weltbild ist durch und durch körperlich. Die Idee einer von der Körperlichkeit des Menschen völlig befreiten Geistigkeit lässt sich in den vorgestellten Texten gar nicht feststellen, und wird, im Falle Tertullians, aggressiv bekämpft. Das ist auch nicht weiter erstaunlich und bedarf eigentlich nicht jenes Nachdrucks, den einige Autoren aufwenden, um scheinbar Staunenswürdiges über die antike Lebens- und Glaubenswelt zu verbreiten. Natürlich wird auch Gott körperlich gedacht,26 wenn ihm auch eine besondere Weise der Stofflichkeit zugesprochen wird, allein schon um die Distanz von Gott und Geschöpf zu wahren. Was vielmehr verwundert, ist das Fehlen vertrauter Unterscheidungen. Jene vertrauten Gegenbegriffe zum Körper, wie etwa die rein geistige Seele, der Intellekt, unkörperliche Vernünftigkeit, die Rationalität – es gibt sie nicht. Die ersten Christen kennen diese Konzepte nicht oder lehnen sie, wie Tertullian, ab. Folgt man der Körperverächter-Debatte, fehlt hier genau das, was über Jahrhunderte den Kern der philosophischen Vorstellungen von Gott und Mensch geprägt haben soll. Diese Fehlanzeige muss zu einer kritischen Reflexion auf Grund und historische Situierung der Körperverachtung führen. Tertullian ist der geistige Führer in Karthago um 200.27 Es handelt sich bei ihm offenkundig um einen äußerst gebildeten und rhetorisch geschulten Römer. Sein Vater war römischer Offizier; Tertullian wird 190 zum Christentum bekehrt. Tertullian war Rechtsanwalt. Er bereitet einer umfassenden Latinisierung des christlichen Glaubens den Weg. Deshalb wird er im Volksmund ›Vater des Kirchenlateins‹ genannt. Er kennt die verschiedenen Philosophenschulen genau. Er beherrscht das
25
26 27
Tertullian, De carne Christi, 11. – Zitiert nach : Über den Leib Christi (De carne Christi). In: Tertullians sämtliche Schriften. Aus dem Lateinischen übersetzt von Karl Adam Heinrich Kellner, Köln 1882, 397. Vgl. Markschies, Christoph: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike, München 2016. Osborn, Eric: Tertullian, first Theologian of the West, Cambridge 1997. Harnack, Adolf von: Tertullian in der Literatur der alten Kirche. In: Ders.: Kleine Schriften zur alten Kirche, Berlin 1980, 247-281. Karpp, Heinrich: Schrift und Geist bei Tertullian, Gütersloh 1955. Barnes, Timothy David: Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 1971. Dunn, Geoffrey D.: Tertullian, London 2004.
289
290
Christoph Asmuth
Griechische wie das Lateinische. Er kann Platon und Aristoteles zitieren. Er kennt die antiken Ärzteschulen ebenso wie die Schriften des Seneca, dem er sich in vielen Punkten annähert. Tertullian verfasste zahlreiche Streitschriften. Das Ringen um ein authentisches Christentum beginnt bereits vor seiner dogmatischen Fixierung. Tertullian erscheint uns Heutigen als ein Rigorist, ein Fundamentalist. Allerdings sind seine Schriften im Kontext seiner Zeit wohl eher als gemäßigt anzusehen. In den christlichen Kirchen ist Tertullian indes bis heute umstritten. Bei Tertullian verstärkt sich unterdessen ein asketischer Zug. Er schließt sich um 207 dem Montanismus an, einer in Kleinasien von Montanus gegründeten Bewegung, die neben einer radikalisierten Ethik in ekstatischem Ton vom nahen Weltende spricht. Die Ethik fordert das Verbot der ›zweiten Ehe‹, nach dem Tod des Ehepartners, fordert verschärfte Fastenvorschriften, das Verbot der Flucht in der Verfolgung, das Verbot der Vergebung von Todsünden und vieles mehr. Das öffentliche Erscheinen und Leben der Frauen muss eingeschränkt werden.28 Man erwartete das Herabsteigen des himmlischen Jerusalem und des 1000-jährigen Reiches. Der Druck auf die Christen dieser Zeit ist groß. Neben einer sich steigernden Debatte um den richtigen Glauben, die mit allerlei Schattierungen und Rationalisierungen aufwartet, ist der Erfolg des Christentums zugleich ein Problem für das Judentum, aus dem sich die Christen erkennbar ausgegrenzt hatten, und für die pagane Mehrheit im Reich. Die Staatsreligion, mit der Rom groß geworden ist, gilt nicht mehr unangefochten. Das römische Reich hat seinen Zenit überschritten. Tertullian ist ein glänzender Stilist. Er hinterlässt kein theologisches System, gleichwohl finden sich bei ihm Erörterungen zu nahezu jedem Thema der damaligen Theologie. Seine Urteile sind dezidiert und scharf. Dabei orientiert er sich an den überlieferten Schriften. Er kritisiert das Scheinwissen der Philosophie. Bei ihm finden sich erste Ansätze einer Hermeneutik. Er bindet die Glaubensinhalte zurück an Regeln und Tradition. Dabei ist klar: Tertullian kann sich den Einflüssen der philosophischen Rationalität nicht gänzlich entziehen. Selbst dort, wo er massive Kritik äußert und polemisch agiert, lebt er zugleich von der philosophischen Tradition. Das zeigt sich auch in der Seelenlehre. Ganz im Sinne der Stoa stellt er sich Gott und die Seele als besondere Körper vor. In der Menschwerdung des göttlichen Logos erkennt er die Durchdringung zweier beharrender Substanzen. Auch die göttliche Gnade wird zu einer wirkenden Substanz, sie ist keineswegs nur vergebende göttliche Güte.29
28 29
Vgl. Daniel-Hughes, Carly: The Salvation of the Flesh in Tertullian of Carthage. Dressing for the Resurrection, New York 2011. Vgl. zur Seelenlehre Tertullians: Tertullian. Über die Seele. Das Zeugnis der Seele. Vom Ursprung der Seele. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Jan H. Wasznik, Zürich 1980. Esser, Gerhard: Die Seelenlehre Tertullians, Paderborn 1893. Karpp, Heinrich: Probleme altchristlicher Anthropologie, Gütersloh 1951, 40-91.
Körperliche Christen
Tertullian ist Verfasser einer Schrift Über die Seele. Interessanterweise beginnt Tertullian mit einer Erinnerung an den Platonischen Phaidon. »Sogar im Kerker des Sokrates wurde über das Wesen der Seele gestritten. […] Denn welchen Gedanken hätte die Seele des Sokrates in ihrer damaligen Verfassung mit Klarheit erfassen können, […] als der Schierlingsbecher der Verurteilung schon ausgetrunken war und der Tod unmittelbar bevorstand? Sie war daher jedenfalls der Natur folgend erschüttert oder sogar außer sich, wenn ihre Erregung nicht naturgemäß war. Wenn seine Seele auch nach außen hin friedlich und ruhig war, so daß weder das Weinen seiner Frau, die gleich darauf Witwe, noch der Anblick seiner Kinder, die von jetzt an Waisen sein würden, sie durch das natürliche Gefühl der Liebe erweicht hatten, so war sie doch schon durch das Bestreben in Bewegtheit, sich nicht bewegen zu lassen, und erschüttert eben durch die Standhaftigkeit, die sich einer Erschütterung durch Unstandhaftigkeit widersetzte. Wofür aber hätte ein zu Unrecht verurteilter Mensch sonst noch Gedanken haben können als für etwas, was ihn für das Unrecht hatte trösten können, […].«30 Die Glaubwürdigkeit der Position des Sokrates wird hier subtil erschüttert. Ein Heide, ohne Vertrauen auf den richtigen Gott, zum Tode verurteilt, spricht am Rande der Panik über das Wesen der Seele. Wie sollten dabei glaubwürdige Resultate herauskommen? Tertullian ist der Auffassung, dass das Wesen der Seele ein äußerst schwer zu erkennender Gegenstand ist, um den sich Medizin und Philosophie oft vergeblich bemühten. Die antiken Philosophen seien keine adäquaten Auskunftgeber.31 Seine Erkenntnisquellen beziehen sich auf Phänomene ganz anderer Art. So verweist er beispielsweise auf eine Frau, die er aus seiner Gemeinde kennt. Sie habe von Gott die Fähigkeit erhalten, übernatürliche Visionen zu erfahren. Tertullian spricht von Verzückungen, in denen die Frau mit Engeln und sogar mit Gott selbst kommuniziert. Im Rahmen eines geistlichen Gesprächs über die Seele kommt es, dem Bericht Tertullians folgend, zu einer derartigen Vision, von der die Frau nachher folgendes berichtet: »›Unter anderem wurde mir die Seele gezeigt in körperlicher Gestalt. Sie erschien mir wie ein Hauch, aber nicht von leerer und hohler Beschaffenheit, sondern vielmehr so, daß sie sich sogar festhalten zu lassen versprach, zart leuchtend, luftfarbig, mit einer in jeder Hinsicht menschlichen Gestalt. Das ist die Vision.‹«32
30 31
32
De an. I, 2, 47. Vgl. Dörrie, Heinrich: Die andere Theologie. Wie stellten frühchristliche Theologen des 2.–4. Jahrhunderts ihren Lesern die »griechische Weisheit« dar? In: Theologie und Philosophie 56 (1981) l–46. Tertullian, De an. IX, 4-5, 64f.
291
292
Christoph Asmuth
Es bleibt nicht bei der Vision. Tertullian berichtet nicht nur, was er gehört hat. Er münzt das unerhörte Gehörte in die Währung der Theorie um. Nach Tertullian ist die Seele körperlich, genauer: feinstofflich, sie hat eine Form, sogar eine Farbe. Sie besitzt dingliche Qualitäten, Eigenschaften, die sich den verschiedenen Sinnen öffnen, Tastsinn, Gesichtssinn. Für Tertullian ist sie eingestaltig und einfach, damit zugleich verwandt mit Hauch und Odem. Die Seele ist der Hauch Gottes. Außerdem besitzt sie eine menschliche Gestalt (De an. IX, 7), und zwar die Gestalt, die der konkrete menschliche Körper hat, dem die Seele zugehört. Bei Homer ist die Seele Hauch. Dasselbe gilt für Tertullian, der sich dabei auf den Schöpfungsbericht stützt, aus dem Tertullian eine theoretische Überzeugung über das Wesen der Seele ableitet: »Als Gott dem Menschen den Hauch des Lebens in das Antlitz blies und der Mensch zu einer lebendigen Seele geworden war, selbstverständlich der ganze Mensch, da wurde sofort jener Hauch durch das Antlitz hindurch in sein Inneres hinübergeleitet; er ergoß sich durch sämtliche Räume des Körpers, und zugleich durch die göttliche Anhauchung verdichtet, wurde er durch jede Kontur des Innenraumes geprägt, den er (der Hauch) in seinem verdichteten Zustande ausgefüllt hatte; er erstarrte gleichsam in einer Form. So wurde also der Körper der Seele durch Verdichtung fest, ihre Form durch Prägung gebildet. Das muß der ›innere Mensch‹ sein, während der ›äußere Mensch‹ ein anderer ist, in beider Gestalt aber einer; auch er hatte seine Augen und Ohren, womit das Volk den Herrn hätte anhören und sehen müssen, hatte auch die anderen Glieder, deren er sich beim Denken bedient und wodurch er in Träumen wirkt.« (Tert., De an. IX, 7-8) Im Menschen steckt ein Mensch. Das ist in der Antike nichts Besonderes. Das ist eine Vorstellung, die man schon bei Homer finden kann. Die Seele ist ein Mensch im Menschen. Im Tod entweicht die Seele durch eine Öffnung des Körpers, eine Wunde, oder durch Mund und Nase wie ein Hauch. Bei Homer findet man schon die Vorstellung, dass die Seelen den Verstorbenen gleichen wie ein Schatten. In der Ilias etwa konnte Tertullian lesen, dass die einzelne Seele Ähnlichkeit besitzt mit dem verstorbenen Menschen, dessen Seele sie ist: »Jetzo kam die Seele (ψυχή) des jammervollen Pátroklos,/Ähnlich an Größe und Gestalt und lieblichen Augen ihm selber,/Auch an Stimm, und wie jener den Leib mit Gewanden umhüllet.«33 Im Menschen steckt ein Mensch, ›innerer‹ und ›äußerer‹ Mensch; Formulierungen, die auf Paulus zurückgehen. Sie weisen aber auch voraus auf anthropologische Spekulationen, die noch Ende des 18. Jahrhunderts gängige Münze waren. Bei Johann Caspar Lavater etwa, 1741 geboren, einem reformierten Pfarrer aus Zürich, 33
Homer: Ilias 23, 65-67.
Körperliche Christen
berühmt für seine Physiognomischen Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, finden sich Spekulationen, nach denen der Mensch einen ›Hülsencörper‹ besitzt, in den ein ›fein organisierter Cörper‹ eingelassen ist. Dies erst ist der unvergängliche Körper der Seele, der zur Auferstehung und ewigen Seligkeit tauglich ist.34 Bei Tertullian stammt das Vernünftige der Seele von Gott, das Unvernünftige aber vom Satan. Aus dem Unvernünftigen entspringen alle Verbrechen, die selbst als Verbrechen unvernünftig sind, und verderbliche Moral, Begierden, Zorn, ausgenommen der heilige Zorn, ein Zorn, der aus der Liebe zur Ordnung stammt.35 Die Sinneswahrnehmung ist für Tertullian von erheblicher Bedeutung. Ein Körper ohne Seele hat keine Sinneswahrnehmungen. Sinnestäuschungen haben spezielle Ursachen, die in der Bedeutung des Mediums liegen, wie z.B. das Wasser als Medium, in dem das Ruder gekrümmt erscheint.36 Mit der Körperlichkeit der Seele steht für Tertullian auch die Verlässlichkeit der Sinne auf dem Programm. Tertullian erscheint als Empirist, sogar als Sensualist. Er vertraut den Sinnen. Die Sinnlichkeit ist das primäre Erkenntnisorgan. So modern diese Hinwendung zu Körper und Sinnlichkeit zu sein scheint, ihr Motiv ist von heutigen Körpertheoretikern vollkommen verschieden. In seiner Theorie der Sinne kommt dasselbe Moment zum Vorschein, das auch schon seine Hochachtung und Hochschätzung der Visionen motivierte. »Verboten, verboten ist es uns, besagte Sinne in Zweifel zu ziehen, damit nicht auch für Christus ihre Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, damit nicht etwa gesagt werde, er habe nicht in Wirklichkeit den Satan aus dem Himmel stürzen sehen (Lk. 10,18), nicht in Wirklichkeit die Stimme seines Vaters ein Zeugnis über ihn abgeben gehört (Mt. 3,17), sich geirrt, als er die Schwiegermutter des Petrus berührte (Mt. 8,15), oder später einen anderen Duft an der Salbe wahrgenommen, die er sich zu seiner Beerdigung gefallen ließ (Mt. 26,7-12), und einen anderen Geschmack an dem Weine, den er zur Erinnerung an sein Blut weihte (Lk. 22,20, vgl. Mt. 26,27-29).«37 (Tert., De an. XVII, 13) Damit ist gleichzeitig eine Abwehr der eher intellektualistisch interpretierten Theorie Platons verbunden. Denn Platons Ideenlehre – so wie sie von Tertullian interpretiert wird – läuft darauf hinaus, die unzuverlässigen Sinne von der Vernunft zu scheiden. Aus diesem Grund lehnt Tertullian apriorische Ideen ab, welche die Seele vor der Geburt geschaut haben müsste.38 Die sensualistische Theorie, die Tertulli34 35 36 37 38
Lavater, Johann Caspar: Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Johann George Zimmermann. Erster Theil, Frankfurt am Mayn 1773, 84f. Vgl. Tertullian, De an. XVI, 6, 80. Vgl. Tertullian, De an XVII, 5-8, 82. Tertullian, De an. XVII, 13, 85. Tertullian, De an. XXIV, 3-4, 101.
293
294
Christoph Asmuth
an mit deutlich stoischen Implikationen vorträgt, ist keinesfalls von anti-religiösen Motiven getragen, wie im Sensualismus des 18. Jahrhunderts, etwa bei Helvetius. Im Gegenteil: Unter den Vorzeichen einer völlig in der Sinnlichkeit aufgegangenen Religion ist ein Sensualismus die traditionelle und konservative Lösung. Die Zeugen und Visionäre, die mit Engeln gesprochen und Wunder gesehen haben, können auf ihre Sinne vertrauen. Denn die Sinne täuschen nicht ununterbrochen, eigentlich nur dann, wenn klar umrissene Ursachen dafür vorliegen, nämlich im Medium. Mehr noch: Das Sinnenfällige ist das Wahre. Das ist nach unseren Kategorien antimetaphysisch gedacht. Engel, Seele, Gott, alles dies sind nicht jenseitige, übernatürliche Entitäten, sondern körperliche, stoffliche Gegenstände, die sich, je nach Gelegenheit, den offenen Seelenorganen darbieten. Wie auch in der heutigen Diskussion um eine Hinwendung zu Körperlichkeit und Sinnlichkeit steht auch schon bei Tertullian eine Polemik gegen eine Trennung von Wahrnehmung und Vernunft, Sinnlichkeit und Geistigkeit im Vordergrund: »Denn ist nicht Wahrnehmen ein Erkenntnisvorgang, so gut wie Erkennen ein Wahrnehmen? Oder was kann die Wahrnehmung sein, wenn nicht Erkenntnis jenes Dinges, das wahrgenommen wird? Was kann Erkenntnis sein, wenn nicht eine Wahrnehmung jenes Dinges, das erkannt wird? […] Wer kann mir einen Sinn aufzeigen, der nicht erkennt, was er wahrnimmt, oder eine Erkenntnis, die nicht wahrnimmt, was sie erkennt, so daß er beweisen könnte, daß das eine ohne das andere existieren kann? Wenn die körperlichen Gegenstände wahrgenommen, die unkörperlichen aber erkannt werden, so sind wohl die Arten der Dinge verschieden, nicht aber die Sitze der Sinnes- und Erkenntniskraft, d.h. nicht Seele und Vernunft.«39 Dementsprechend sucht Tertullian auch nicht bei den philosophischen Wissenschaften nach Argumenten für eine Theorie der Seele, sondern ganz empirisch bei Lebensanfang und Lebensende. Den Lebensanfang sieht er – entscheidend für alle Überlegungen der Folgezeit –, bereits bei der Befruchtung, oder wie es hier heißt, bei der Vermischung zweier Samen, zweier männlicher Samen wohlgemerkt, von denen der eine die Seele, der andere den Körper bildet. Wichtig ist für Tertullian die gleichzeitige Entstehung von Körper und Seele. Es handelt sich um zwei Substanzen, von denen keine der anderen der Zeit nach vorhergeht. Die Empfängnis ist nicht durch Nacheinander der Erschaffung von Körper und Seele bestimmt. Sie werden gemeinsam empfangen, ausgebildet, und schließlich geboren. Als Analogie verweist Tertullian auf den Tod, der von ihm mit großer Selbstverständlichkeit als die Trennung von Körper und Seele aufgefasst wird. Das Leben ist dann im Umkehrschluss, folgt man Tertullian, nichts anderes als die Verbindung von Körper und Seele. Ist eines nicht beim anderen, so bedeutet das den Tod. Folglich kann 39
Tertullian, De an. XVIII, 7-8, 88.
Körperliche Christen
es keinen Zeitpunkt in der Entwicklung des Embryos geben, in der er nicht schon beseelt wäre. »Wir lassen das Leben von der Empfängnis an gelten, weil wir die Existenz der Seele mit der Empfängnis anfangen lassen; das Leben beginnt in demselben Augenblick wie die Seele. Zur gleichen Zeit wird also für das Leben zusammengefügt, was zur gleichen Zeit beim Tod getrennt werden wird. Wenn wir nun aber dem einen die erste, dem anderen die zweite Stelle zuweisen, so muß man auch beim Samenausfluß entsprechend der Rangordnung einen zeitlichen Unterschied machen. Welchen Zeitpunkt werden wir für den körperlichen Samen, welchen für den seelischen festsetzen? […] Wenn wir auch zwei Samenarten anerkennen, den körperlichen und den seelischen Samen, so bestehen wir doch darauf, daß sie ungetrennt, deshalb gleichzeitig und im selben Augenblick entstanden sind. Schämen wir uns also nicht der notwendigen Erläuterung; die Natur verdient Verehrung, keine Schamesröte. Den Beischlaf hat Wollust, nicht seine Bestimmung zur Schande gemacht. Die Entartung, nicht der Beischlaf als solcher ist unkeusch. Die Übung des Beischlafes selbst gilt bei Gott als gesegnet, […] die Entartung aber ist verflucht: Ehebruch, Unzucht und Hurerei.«40 Darin spricht sich eine zeitgenössische Theorie über die Sexualität aus: Die Frau nimmt, wie der Ackerboden, den doppelten Samen auf, den körperlichen und den seelischen Samen. Im Geschlechtsakt sind Körper und Seele des Mannes gleichermaßen beteiligt, die Seele durch sexuelles Begehren und die Reize der Frau, der Körper des Mannes durch seine Aktivitäten. »Dadurch, daß beide mit einem einzigen Antrieb den ganzen Menschen in Erregung versetzen, tritt schäumend sein gesamter Samen hervor, der von der körperlichen Substanz die Feuchtigkeit, aus der seelischen die Wärme besitzt.«41 Den Berichten der Frauen zu vertrauen scheint Tertullian ungewohnt. Vertrauen in Bezug auf die Umstände der Mutterschaft ist ihm dabei noch gerade möglich, ist doch das Gebären etwas, das zu den eigentlichen Aufgaben der Frau gehört. Aber Tertullian ist medizinisch gebildet. Er weiß, dass Ärzte viel können und viel über die menschliche Natur wissen. Ihren Berichten und Untersuchungen entnimmt er, dass die Kinder bereits im Mutterleib leben. Damit widerspricht er vehement jenen Vorstellungen, welche die Seele erst durch den ersten Atemzug in den Körper gelangen lassen. Das Kind muss schon vor der Geburt gelebt haben; wenn es gelebt hat, bevor es geboren wurde, muss es beseelt gewesen sein. Tertullian scheut nicht davor zurück, drastisches Beweismaterial vorzulegen:
40 41
Tertullian, De an. XXVII, 1-5, 111f. a.a.O.
295
296
Christoph Asmuth
»Ja selbst noch in der Gebärmutter wird das Kind getötet – eine notwendige Grausamkeit, wenn es beim Ausgang quer liegt, die Geburt unmöglich macht und die Mutter töten würde, wenn es nicht selbst stürbe. Daher befindet sich unter den Geräten der Ärzte auch eines mit einer Vorrichtung, wodurch zunächst mit einer drehenden Bewegung die verborgenen Teile gezwungen werden, sich zu öffnen; mit einem sichelförmigen Messer werden in ängstlicher Willkür die Glieder im Innern zerschnitten, und mit einem stumpfen Haken wird dann die ganze Scheußlichkeit in gewaltsamer Entbindung herausgezogen. Es gibt auch einen ehernen Haken, mit dem die grausame Ermordung unmittelbar im Verborgenen ausgeführt wird, ›Embryoschlächter‹ nennt man ihn nach seiner Aufgabe, das Kind zu zerstückeln. Es muss also auf alle Fälle ein lebendiges Kind sein, das er tötet.«42 (Tert. De an. XXV, 4-5) Ähnlich der Tod; er besteht in der Trennung von Seele und Körper. Die körperliche Seele tritt aus dem Körper aus. Es kann kein Teil der Seele im Körper zurückbleiben, denn der Körper verfällt nach dem Tod vollständig (LI, 4). Das Sterben ist ein Prozess der allmählichen Entmischung der beiden Körper auseinander. Die entstandene, aber unsterbliche und feinstoffliche Seele entfernt sich aus dem geborenen und sterblichen Körper. Das Sterben ist in den Augen Tertullians ein vollständig körperlicher Prozess. Bis zum Tag des Gerichts, dem erwarteten und ersehnten Weltende, verbleibt die Seele in der Unterwelt. Für Tertullian ist das ein »wüster Raum in einem Schacht der Erde und in der Tiefe«. Dort werden die feinstofflichen Seelen durch Feuer gequält und gereinigt. Sie werden dort in aller Vorläufigkeit bestraft und erquickt, bis das endgültige Gericht kommt, um über die Seelen zu entscheiden. Insgesamt lebt Tertullian eine sinnliche Religion, deren Bestand über die Körperlichkeit nicht hinausgeht. Körper und Seele sind für ihn, wie auch Gott selbst, körperlich. Das gleiche gilt für die Auferstehung, die Auferweckung von den Toten. Das Martyrium und die Verfolgung zahlreicher Christen machen es notwendig, auch darüber nachzudenken, was mit den überlebenden Seelen der Verstorbenen geschieht. Auferstehung ist seit dieser Zeit für den Christen ein körperliches Geschehen. Leibfeindlichkeit und Körpervergessenheit scheinen daher für den Beginn des Christentums unzureichende Kategorien. Sie betonen vielmehr die Fragilität des Körpers, seine Vergänglichkeit und Korrumpierbarkeit. Der ganze Bereich der menschlichen Sexualität und Fortpflanzung gerät in das Fahrwasser einer düsteren Weltsicht, eine Sicht auf eine Welt, in welcher der Mensch weder beheimatet noch zu Hause ist. Im östlichen Christentum, in Kleinasien, beginnen sich zu dieser Zeit massive Bewegungen zu formieren, welche der Sexualität völlig entsagen,
42
Tertullian, De an. XXV, 4-5, 107.
Körperliche Christen
um damit aus dem verderblichen Geschäft von Fortpflanzung und Tod völlig ausscheiden wollen.43 Damit richten sie sich gegen das Reich, gegen die Familie, gegen die ewige Wiederkehr von Geburtsschmerz und Todeskampf. Ihr Augenmerk richtet sich auf die ersehnte und versprochene Ankunft eines neuen Reiches, das nicht von dieser Welt ist, ein Reich, von dem Paulus erzählte, dass es kommen werde, auf das man vorbereitet sein müsse, von dem an das Heilsein des Menschen beginnen würde. In diesem Licht konzentriert sich alles auf den fragilen Körper, einen Körper, um dessen Überhöhung es gerade zu tun ist. Zu den philosophisch-systematischen Erträgen, die sich aus der Beschäftigung mit der Entwicklung des Christentums um 200 und den Schriften Tertullians ergeben, gehört zweifelsohne eine erhebliche Beunruhigung: So kreativ uns diese Körper und ihre Wandlungen auch vorkommen, sie sind eingespannt zwischen Vergänglichkeit und Verherrlichung. Alles, was geschieht, geht im Körper und in körperlicher Weise vor sich. Die Seele ist körperlich, Gott ist körperlich, feinkörperlich, unteilbar und unvergänglich. Die zerschundenen, zerstückelten und verbrannten Körper der Märtyrer verwandeln sich in ätherische, wohlduftende, jugendlich-schöne Körper. Tertullian liefert die Theorie für dieses Weltbild. Schaut man darauf zurück mit dem Blick eines Heutigen, so sehen wir eine grausame Welt. Der Körper ist fragil. Er ist nicht der Ort der Emanzipation. Von ihm geht nichts Befreiendes aus. Dies geschieht erst in der Transformation, für die der Mensch jedoch sterben und gläubig sterben, für die er als Märtyrer, als Zeuge seines Glaubens sterben muss, eine Transformation, die letztlich ein Gnadenakt Gottes ist. Ein durchgängiger ›Materialismus‹ führt nicht zwangsläufig zu einer von Metaphysik befreiten Weltanschauung. Die durchgängig körperliche Weltanschauung des Tertullian garantiert keineswegs den liberalen Umgang mit dem Körper. Sexualität kann nur limitiert und normiert ausgeübt werden. Tertullians Christen sind durch und durch körperlich. Der Gedanke einer Emanzipation ihres Körpers durch freie Selbstgestaltung der Körperlichkeit ist ihnen völlig fremd. Für sie kommt die Befreiung nur durch den Tod. Tertullian konnte die Körperlichkeit als solche nicht verachten, ein unmöglicher Gedanke, denn selbst Gott war für ihn körperlich. Auch den Körper zu verachten ist sinnlos, denn er ist von Gott gemacht. Gleichwohl führt diese unhintergehbare Körperlichkeit der Welt nicht zu einer ›aufgeklärten‹ Position. Umgekehrt führt vielleicht auch die intellektualistische Metaphysik, wie Platon sie entworfen haben mag, nicht unbedingt und zwangsläufig zur Verachtung und Herabwürdigung alles Körperlichen. Jedenfalls führt – und das ist eine systematische philosophische Erkenntnis – die Berufung auf die Unmittelbarkeit des körperlichen Geschehens nicht gleich43
Vgl. Brown, Peter: Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit im frühen Christentum, München – Wien 1991.
297
298
Christoph Asmuth
zeitig zu einer emanzipativen Auffassung vom Menschen. Es scheint mir, dass an dieser Stelle der Überlegungen eher die Auffassung näherliegt, dass Körperauffassungen selbst gar keine Leitdifferenz bilden, an der man etwa entscheiden könnte, ob eine Theorie die Befreiung des Menschen, sei es aus erzwungener Knechtschaft, ungerechtfertigter Herrschaft oder selbstverschuldeter Unmündigkeit, fordert und fördert. Dieser Mangel beruht zunächst nicht darauf, dass wir Heutigen und Nachgeborenen, die wir durch die Dialektik der Aufklärung verstört und durch die Postmoderne desorientiert wurden, nicht mehr sagen können, wie die Aufklärung funktioniert und worauf sie zielt und ob sie nicht längst in ihr Gegenteil umgeschlagen ist. Die geschichtliche Situation der Märtyrer macht klar: Der Körper ist das, was sich in der jeweiligen Situation als Körper zeigt. Eine unmittelbare Identifikation mit dem Körper des Märtyrers oder mit der Sinnlichkeit der beobachtenden und mitteilenden Zeugen ist nicht möglich. Der Körper des Märtyrers oder die Seele des gestorbenen Christenmenschen unterliegt ganz anderen Gesetzen als unser Körper. In den Visionen, die keinesfalls durch unsere Kategorien als Träume oder Halluzinationen einer hysterischen Masse entmythologisiert werden können, zeigt sich ein Körperverständnis, das unserem völlig fremd und eingespannt ist in eine Welt, die sich ihrem Untergang entgegen neigt; – eine Welt, in der die Christen das Strafgericht Gottes erwarten; – eine Welt, in der man retten muss, was in der Welt, nicht von dieser Welt ist, das Reine, Unberührte, das, was Gott wohlgefällt. Dass dies nun nicht wiederum in eine Sphäre bloßer Geistigkeit fällt, ist der eigentliche Ertrag der Überlegungen. Das Anknüpfen an die Unmittelbarkeit des Leiblichen kann nicht garantieren, dass sich eine kritische, emanzipative und humane Auffassung des Menschen entwickelt. In einer völlig in der Sinnlichkeit und Körperlichkeit aufgehenden Weltsicht ist die Quälerei des Endlichen in eben dieser körperlichen Weise unmittelbar präsent. Ja, es ließe sich sogar vermuten, dass es der Mangel des Unkörperlich-Geistigen ist, der eine Kompensation, sei diese spiritueller, geistiger oder gesellschaftlicher Art, verhindert. Eine solche Kompensation ist in einem Weltbild wohl auch nicht angebracht, dessen Aufmerksamkeit ganz gefesselt ist vom Strudel des kommenden Strafgerichts, in dem die irdische Welt jenseitig und die jenseitige Welt irdisch wird.
Literatur Achelis, Hans: Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten, 2 Bde., Leipzig 1912. Bardenhewer, Otto: Geschichte der altkirchlichen Literatur, 5 Bde., Freiburg 1913, Nachdruck Darmstadt 2007. Barnes, Timothy David: Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 1971. Benko, Stephen: Pagan Rome an the Early Christians, London 1985.
Körperliche Christen
Bordt, Michael: »Metaphysischer und anthropologischer Dualismus bei Platon«. In: Niederbacher, Bruno/Runggaldier, Edmund (Hg.): Die menschliche Seele. Brauchen wir den Dualismus?, Frankfurt a.M. u.a. 2006, 99-115. Bostock, David: Plato’s Phaedo. Oxford 1986. Bremmer, Jan N./Formisano, Marco: Perpetua’s Passions. Multidisciplinary Approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis, Oxford 2012. Bremmer, Jan N.: Perpetua and Her Diary. Autenticity, Family and Visions. In: Ameling, Walter (Hg.): Märtyrer und Märtyrerakten (Altertumswissenschaftliches Kolloquium; 6) Stuttgart 2002, 77-120. Brown, Peter: Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit im frühen Christentum, München – Wien 1991. Butler, Rex D.: The new prophecy and new visions. Evidence of Montanism in The Passion of Perpetua and Felicitas, Washington DC 2006. Campenhausen, Hans Freiherr von: Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, Göttingen 2 1964. Chadwick, Henry: The Early Church (The Penguin History of the Church; 1) überarbeitete Auflage, London 1993 Cobb, L. Stephanie: Dying to Be Men: Gender and Language in Early Christian Martyr Texts, New York 2008. Daniel-Hughes, Carly: The Salvation of the Flesh in Tertullian of Carthage. Dressing for the Resurrection, New York 2011. Das Martyrium des Polykarp. Übersetzt und erklärt von Gerd Buschmann (Kommentar zu den Apostolischen Vätern; 6), Göttingen 1998. Dodds, Eric R.: Pagan and Christian in an Age of Anxiety, London 1965. Dölger, Franz Josef : Der Kampf mit dem Ägypter in der Perpetua-Vision. Das Martyrium als Kampf mit dem Teufel. In: Antike und Christentum 3 (1932) 177-188. Dörrie, Heinrich: Die andere Theologie. Wie stellten frühchristliche Theologen des 2.–4. Jahrhunderts ihren Lesern die »griechische Weisheit« dar? In: Theologie und Philosophie 56 (1981) l–46. Dorter, Kenneth: Plato’s Phaedo. An Interpretation, Toronto u.a. 1982. Dunn, Geoffrey D.: Tertullian, London 2004. Esser, Gerhard: Die Seelenlehre Tertullians, Paderborn 1893. Fox, Robin Lane: Pagans and Christians. In the Mediterranean world from the second century AD to the conversion of Constantine, London 1986. Frede, Dorothea: Platons ›Phaidon‹. Der Traum von der Unsterblichkeit der Seele, Darmstadt 2 2005. Frühchristliche Apologeten Bd. II. Übersetzt von Gerhard Rauschen (Märtyrerakten) (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Bd. 14), München 1913. Gold, Barbara K.: »›And I Became a Man‹. Gender Fluidity and Closure in Perpetua’s Prison Narrative«. In: Lateiner, Donald G. u.a. (Hg.): Roman Literature, Gender, and Reception. Domina Illustris, New York 2013, 153-165.
299
300
Christoph Asmuth
Gold, Barbara K.: Perpetua. Athlete of God, New York 2018. Gonzalez, Eliezer: The Fate of the Dead in Early Third Century North African Christianity. The Passion of Perpetua and Felicitas and Tertullian, Tübingen 2014. Greenslade, Stanley L.: Erasmus and Tertullian. In: Studia Patristica, Vol. XIV, Part III, Elizabeth A. Livingstone (Hg.), Berlin 1976, 37-40. Habermehl, Peter: Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Versuch zur Passio sanctarum Perpetuae et Felicitas (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; 140), Berlin 1992. Harnack, Adolf von: Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, 2 Teile, Leipzig 1893-1904. Harnack, Adolf von: Tertullian in der Literatur der alten Kirche. In: Ders.: Kleine Schriften zur alten Kirche, Berlin 1980, 247-281. Heffernan, Thomas J.: The Passion of Perpetua and Felicity, New York 2012. Irenäus von Lyon, Contra haereses. Karpp, Heinrich: Probleme altchristlicher Anthropologie, Gütersloh 1951. Karpp, Heinrich: Schrift und Geist bei Tertullian, Gütersloh 1955. Kitzler, Petr: From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church (Arbeiten zur Kirchengeschichte; 127), Berlin – Boston 2015. König, Eugen: Körper – Wissen – Macht. Studien zur historischen Anthropologie des Körpers, Berlin 1989. La passione di Perpetua e Felicita. Prefazione di Eva Cantarella. Introduzione, traduzione e note di Marco Formisano, Milano 2008. Lavater, Johann Caspar: Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Johann George Zimmermann. Erster Theil, Frankfurt am Mayn 1773. Leibniz, Gottfried W.: Sämtliche Schriften und Briefe. Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Bd. 13: August 1696 – April 1697, hg. v. Utermöhlen, Gerda/Sellschop, Sabine, Berlin 1987. Markschies, Christoph: Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike, München 2016. Menkhaus, Torsten: Eidos, Psyche und Unsterblichkeit. Ein Kommentar zu Platons Phaidon, Frankfurt a.M. 2003. Müller, Jörn: »Leib-Seele-Dualismus? Zur Anthropologie beim späten Platon«. In: De Brasi, Diego/Föllinger, Sabine (Hg.): Anthropologie in Antike und Gegenwart. Biologische und philosophische Entwürfe vom Menschen, Freiburg – München 2015, 59-96. Osborn, Eric: Tertullian, first Theologian of the West, Cambridge 1997. Robert, Louis: Le Martyre de Pionios, pretre de Smyrne, Washington 1994. Tertullian: Über die Seele. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Jan H. Waszink (Bibliothek der alten Welt), Zürich – München 1980.
Körperliche Christen
Tertullians sämtliche Schriften. Aus dem Lateinischen übersetzt von Karl Adam Heinrich Kellner, Köln 1882. Wilson-Kastner, Patricia (Hg.): A Lost Tradition. Women Writers of the Early Church, Washington D.C. 1981. Zwierlein, Otto: Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycarpianum, Berlin – Boston 2014.
301
Autorinnen und Autoren
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Asmuth, geb. 1962, ist Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau. Apl. Prof. Dr. Ada Borkenhagen ist Privatdozentin an der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und ist Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin in freier Praxis in Berlin. Apl. Prof. Dr. Martin Dinges, geb. 1953, war bis März 2019 stellv. Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart, ist seit 2000 apl. Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim. Dr. Martina Feichtenschlager, geb. 1986, ist seit 2017 Universitätsassistentin (PostDoc) für Ältere deutsche Sprache und Literatur an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Prof. Dr. Rainer Guldin, geb. 1954, ist Professor für deutsche Kultur und Sprache an der Kommunikationswissenschaftlichen und Ökonomischen Fakultät der Università della Svizzera Italiana in Lugano (Schweiz). Prof. Dr. Rüdiger Kunow, bis zu seiner Emeritierung Professor für Amerikanistik an der Universität Potsdam, ist Alter/nsforscher und Autor von Material Bodies: Biology and Culture in the United States (2018). Dr. Nurhak Polat ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (PostDoc) am Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft der Universität Bremen. Sie promovierte mit einer ethnographischen Studie zur Nutzung und den Implikationen von Reproduktionstechnologien in der Türkei am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt Universität zu Berlin.
304
KörperKreativitäten
Dr. Carolin Ruther, geb. 1986, ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und als persönliche Referentin des Direktors am Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München tätig. Sophie Schmidt, geb. 1986, studierte Philosophie und Neuere Deutsche Literatur an der LMU sowie freie Kunst und Kunsterziehung an der AdBK München. Sie ist durch zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland vertreten. Dr. Imke Schmincke, geb. 1972, ist akademische Rätin am Institut für Soziologie der LMU München. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschlechtersoziologie, Körpersoziologie, soziale Ungleichheit. Dr. Barbara Sieferle, geb. 1983, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg und Leiterin des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes ›Leben nach der Haft‹ (2020-2023). Prof. Dr. Angela Treiber, geb. 1962, ist Professorin für Europäische Ethnologie/Volkskunde an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie beschäftigt sich mit empirischer Religionsforschung, Theorie- und Wissenschaftsgeschichte sowie Alltags- und Sozialgeschichte. Prof. Dr. Rainer Wenrich, geb. 1964, ist Professor für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik und Dekan der Philosophisch-Pädagogischen Fakultät an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er arbeitet u.a. auf den Gebieten der empirischen Erforschung Ästhetischer Erfahrungssituationen im Kontext formaler und non-formaler Kunstvermittlung, der Modedidaktik und Modetheorie. Prof. Dr. Mathias Wirth, geb. 1984, ist Assistenzprofessor (mit tenure track) für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern.
Kulturwissenschaft Gabriele Dietze
Sexueller Exzeptionalismus Überlegenheitsnarrative in Migrationsabwehr und Rechtspopulismus 2019, 222 S., kart., Dispersionsbindung, 32 SW-Abbildungen 19,99 € (DE), 978-3-8376-4708-2 E-Book: 17,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4708-6
Gabriele Dietze, Julia Roth (eds.)
Right-Wing Populism and Gender European Perspectives and Beyond April 2020, 286 p., pb., ill. 35,00 € (DE), 978-3-8376-4980-2 E-Book: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4980-6
Stephan Günzel
Raum Eine kulturwissenschaftliche Einführung März 2020, 192 S., kart. 20,00 € (DE), 978-3-8376-5217-8 E-Book: 17,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5217-2
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Kulturwissenschaft María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan
Postkoloniale Theorie Eine kritische Einführung Februar 2020, 384 S., kart. 25,00 € (DE), 978-3-8376-5218-5 E-Book: 22,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5218-9
Thomas Hecken, Moritz Baßler, Elena Beregow, Robin Curtis, Heinz Drügh, Mascha Jacobs, Annekathrin Kohout, Nicolas Pethes, Miriam Zeh (Hg.)
POP Kultur & Kritik (Jg. 9, 1/2020) April 2020, 180 S., kart. 16,80 € (DE), 978-3-8376-4936-9 E-Book: 16,80 € (DE), ISBN 978-3-8394-4936-3
Birgit Althans, Kathrin Audehm (Hg.)
Kultur und Bildung – kulturelle Bildung? Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Heft 2/2019 2019, 144 S., kart. 14,99 € (DE), 978-3-8376-4463-0 E-Book: 14,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4463-4
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de

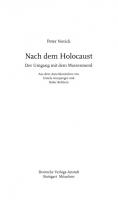


![Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? [Fourth ed.]
3518293443](https://dokumen.pub/img/200x200/die-zukunft-der-menschlichen-natur-auf-dem-weg-zu-einer-liberalen-eugenik-fourthnbsped-3518293443.jpg)
![Grenzen des Sozialen. Kommunikation mit nicht-menschlichen Akteuren in der Vormoderne [1. ed.]
9783835352353, 9783835349070](https://dokumen.pub/img/200x200/grenzen-des-sozialen-kommunikation-mit-nicht-menschlichen-akteuren-in-der-vormoderne-1nbsped-9783835352353-9783835349070.jpg)
![Gesellschaftliche Mißstände: Eine Blütenlese aus dem »Volkslehrer«. Neu hrsg., eingel. und mit Anmerkungen vers. von Gerhard Merk [1 ed.]
9783428467822, 9783428067824](https://dokumen.pub/img/200x200/gesellschaftliche-mistnde-eine-bltenlese-aus-dem-volkslehrer-neu-hrsg-eingel-und-mit-anmerkungen-vers-von-gerhard-merk-1nbsped-9783428467822-9783428067824.jpg)

![Gesellschaftliche Differenzierung [1. Aufl.]
9783839400067](https://dokumen.pub/img/200x200/gesellschaftliche-differenzierung-1-aufl-9783839400067.jpg)