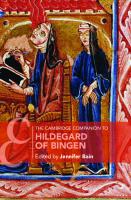Hildegard von Bingen, Hildegardis Scivias 9782503514758, 2503514758
Brepols Publishers Corpus Christianorum Corpus Christianorum Scholars Version (CCSV) Hildegardis Bingensis Scivias A. Fü
239 102 34MB
Latin Pages 987 Year 2003
Polecaj historie
Citation preview
CORPVS CHRISTIANORVM
HILDEGARDIS BINGENSIS
SC1VIAS
BREPOLS
CORPVS CHRISTIANORVM Continuatio M ediaeualis
XLIII
CORPVS CHRISTIANORVM Continuatio M ediaeualis
XLIII
HILDEGARDIS SCI VI AS
TVRNHOLTI TYPOGRAPHI BREPOLS EDITORES PONTIFICII MCMLX X V III
HILDEGARDIS S CI V IA S
E D ID IT
ADELGVNDIS FÜHRKÖTTER O.S.B. CO LLABO RAN TE
ANGELA CARLE VARI S O.S.B.
TVRNHOLTI TYPOGRAPHE BREPOLS EDITORES PONTIFICII M C M L X X VIII
SVM PTIBVS SVPPEDITANTE S v p r e m o B e l g a r v m M a g is t r a t v P V B LIC A E INSTITVTIONI atqve
O p t im is A r t ib v s P r a e p o s it o EDITVM
© Brepols 1978
No part of this work may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.
D.
M a r ia n n a e S c h r a d e r et
D.
Mavrae B öckeler
QVAE HVIVS EDITIONIS FVNDAMENTA IECERVNT IN MEMORIAM
S CI V IA S
VORWORT
Seit Jahrzehnten steht Hildegard von Bingen (1098-1179) im Blickfeld der Forschung. Von ihren Schriften wurde vor allem Sciuias durch die deutsche Übersetzung weiteren Krei sen bekannt : M a u r a B ö c k e l e r , Der heiligen Hildegard von Bingen Wisse die Wege. Sciuias. Nach dem Urtext des kleinen Hildegardiskodex ins Deutsche übertragen und bearbeitet, Augustinus Verlag, Berlin 1928. xxiv, 504 S., 35 Tafeln. Das Geleitwort (vii-xm) schrieb der Hildegardforscher I l d e f o n s H e r w e g e n , Abt von Maria Laach, der die Arbeit angeregt und stark gefördert hatte. Im Vorwort der bedeut samen Veröffentlichung wies M. B ö c k e l e r auf das Fehlen der kritischen Ausgabe hin (xv). Die Vorarbeiten zur kriti schen Edition hatte Louis B a i l l e t , Mönch der Abtei Oosterhout, um 1910 in Angriff genommen. Nach seinem Tod (21. i i . 1913) war die Edition von seinem Mitbruder J. H u i j b e n angekündigt worden (M. B ö c k e l e r , ebd. xv). Die Arbeit blieb unvollendet. Der wissenschaftliche Nachlaß kam nach dem 2. Weltkrieg über die Abtei Egmond (Holland) in die Abtei St. Hildegard, Eibingen. Man hegte wohl die Hoffnung, daß hier einmal die Ausgabe erarbeitet würde. Als der Plan konkrete Formen annahm, stellte sich nach Durchsicht des handgeschriebenen Materials vonL. B a i l l e t und seiner Mitar beiter heraus, daß die Mönche mit außergewöhnlicher Akribie gearbeitet hatten, die Arbeit über das Anfangsstadium jedoch nicht hinausgekommen war und neu begonnen werden mußte. Nach Abschluß der Edition, die infolge vieler Probleme sich länger hinzog als vorauszusehen war, ist es unseine angenehme Pflicht, den Fachleuten gebührend zu danken, die bei Aufhel lung schwieriger Fragen uns beraten und stets zur Weiterar beit ermutigt haben. Es seien genannt : Professor Dr. Bern hard Bischoff, München, Professor P. Dr. Friedrich Kempf SJ, Rom, Abt D. Eligius Dekkers, Steenbrugge, Professor Dr. Albert Derolez, Gent, Frau Dr. Elisabeth Darapsky, Mainz, Frau Dr. Christel Meier, Münster, Dr. Winfried Kurzschenkel, Kassel. Vor allem sei P. Dr. Rhabanus Haacke, Siegburg, für vielfältige Hilfe sowie für die Erarbeitung des hidex uerborum et elocutionum gedankt, der von den Herausgeberinnen für die Drucklegung fertiggestellt wurde. Durch seine Ver mittlung erhielten wir auch die meisten Fotokopien der
X
VORWORT
Handschriften, die Herr Dr. h.c. Reinold Hagen in groß zügiger Weise im Labor seiner Kautexwerke, Holzlar bei Bonn, hersteilen ließ. P. Dr. Angelus Häußling, Maria Laach, erwies seine stete Hilfsbereitschaft durch zahlreiche Auskünf te und das Ausleihen vieler Bände der Laacher Bibliothek, in der die Herausgeberinnen drei Monate arbeiten konnten. Der Druckerei Brepols danken wir für die sorgfältige Druck legung der Texte und die farbentreue Beigabe der Miniaturen. Durch die Zusammenarbeit von Brepols mit dem Otto Müller Verlag, Salzburg, der nach dem 2. Weltkrieg die Herausgabe von M. B ö c k e l e r , Wisse die Wege übernommen hatte und für 1975 die 6. Auflage des Werkes mit Einbeziehung der Minia turen plante, ist der vorliegende Vielfarbendruck ermöglicht worden. Unser verbindlichster Dank gebührt der Universitäts bibliothek Heidelberg, die in entgegenkommender Weise durch ihre Fachleute die Farbdias für den Offsetdruck hersteilen ließ und somit zur Hinzufügung der Miniaturen in dieser Edition wesentlich beigetragen hat. Ferner sei allen Bibliotheken, die uns nach Kräften durch Auskünfte und Ausleihen unter stützt haben, unser Dank ausgesprochen. Ihre Namen sind aus dem Sigelverzeichnis ersichtlich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gewährte den Bear beiterinnen dankenswerterweise drei freie Forschungsjahre. Eibingen, Abtei St. Hildegard, 21. März 1978
EINLEITUNG
1. Die Edition und der Stand der Forschung Der bisher allgemein greifbare Text des Liber Sciuias liegt vor in der Ausgabe von J.-P. M i g n e , Patrologia latina, T. i97(1). Sie gibt den Erstdruck von I a c o b v s F a b e r , Paris 1513, wieder(2). Die bekannten Handschriften des Sciuias weichen aber von der Textgestalt des Erstdrucks stark ab, abgesehen von einer Hs. des 16. Jh.s, die später gefertigt wurde als der Erst druck von F a b e r ; darauf kommen wir noch zurück(3). J.B. P itra gab im Jahre 1882 in den Analecta sacra, T. 8, die Noua S. Hildegardis opera heraus. Darin veröffentlichte er u.a. (nicht fehlerfrei) einen kleinen Teil von Hildegards Sciuias nach der in der Bibi. Apost. Vaticana liegenden Hs. Pal. lat. 3 1 1(4). Dieser Text zeigt erhebliche Abweichungen gegenüber der Textgestalt von F a b e r /Mi g n e . Erneut griff A. D a m o i s e a u auf diese Hs. der Bibi. Apost. Vaticana zurück. Von dem Werk, das in drei Teile (Partes) gegliedert ist, veröffentlichte er Teil I, der 6 Visionen und Teil II, der 7 Visionen enthält(5). Diese Edition, die nicht wenige Feh ler auf weist, wurde nicht zu Ende geführt : Teil III mit 13 Visionen kam nicht mehr heraus. Die in 3 Heften erschienene Ausgabe blieb beinahe unbekannt. So ist es verständlich, daß schon lange und immer dringli cher auf die Notwendigkeit einer kritischen Ausgabe der Hil degardwerke, besonders des Sciuias , hingewiesen wurde(6). Die grundlegenden Vorarbeiten, sozusagen die Prolego mena zur kritischen Edition, wurden 1956 veröffentlicht von M . S c h r a d e r /A . F ü h r k ö t t e r , Die Echtheit des Schrifttums der
(1) J.-P. M i gne , Patrologia latina, T. 197 : S. Hildegardis abbatissae opera omnia, Parisiis 1855, 1882, 1952. Sciuias : 383-738 (PL). (2) Iacobvs F aber , Liber trium uirorum et trium spiritualium uirginum, Parisiis 1513. Sciuias : f. 28r - 118V(/). (3) Es ist die Hs. I 330 (582) der Stadtbibliothek Mainz. Vgl. S. LIV ff. (4) J. B. Pitra , Analecta sacra 8, Noua S. Hildegardis opera, Monte Cassino 1882 (Nachdruck : Farnborough 1966). Sciuias Teiledition (nach der Hs. Pal. lat. 311) : p. 503-507. In der vorliegenden Einleitung beziehen sich die Angaben bei P itra stets auf Bd. 8 der Analecta sacra. (5) A. D amoiseau, [Sciuias] Nouae editionis operum omnium s. Hildegardis experimen tum, S. Petri Arenarii 1893. Ex Officina Hospitii Salesiani S. Vincentii. X V , 377 S. (6) Vgl. J. K o ch , Der heutige Stand der Hildegardforschung, in Hist. Zeitschr. 186, I958» 558-572. Es sei hier auf eine für die Forschung bedeutsame Publikation hingewiesen : W. L auter , Hildegard-Bibliographie. Wegweiser zur Hildegard-Li teratur, Alzey 1970, 83 S.
EINLEITUNG
X II
heiligen Hildegard von Bingen (78 ). Im Jahre 1969 wurde sodann das Liedgut Hildegards, das sie selbst als symphonia caelestium reuelationum{*) bezeichnet, herausgegeben : 77 Gesänge und das geistliche Singspiel Ordo Virtutum liegen in kritischer Edition
vor(9). In den quellenkritischen Untersuchungen von M. Schrader / A. F ührkötter wurde die Autorschaft Hildegards für die ihr zugeschriebenen Werke nachgewiesen. Der Echtheitsnachweis wurde von der Forschung durchweg anerkannt. Inzwischen ist eine wichtige Frage, nämlich das Problem der Mitarbeiter Hildegards, einer eingehenden Untersuchung unterzogen worden. Es war in den quellenkritischen Untersuchungen zwar erörtert(10), jedoch nicht an den einzelnen Hand schriften überprüft worden. A. D erolez hat sich mit die ser bedeutsamen Frage* befaßt und sie für die großen theolo gischen Werke ad fidem codicum gelöst^1). Seine Forschungs ergebnisse dürften auch für den Liber Sciuias gelten, wenn gleich hier noch eigene Fragen in die Waagschale fallen, die eigenen Untersuchungen Vorbehalten bleiben.
2. SGIVIAS - Grundlage für die späteren Werke Die drei theologisch-philosophischen Hauptwerke Hilde gards, Sciuias (Sc), Liber Vitae Meritorum (L V M )(12) und Liber Diuinorum Operum (LDO)(13), bilden trotz ihrer selb ständigen Thematik eine innere Einheit. Was sie miteinander verbindet, ist der visionäre, prophetische Stil und die sym bolische Ausdrucksweise. Durch diese Aussageform ist Hil degard einerseits mit ihren Zeitgenossen verbunden, anderer seits überragt sie diese durch ihre Eigenständigkeit und dich terische Gestaltungskraft. Ihr Weltbild ist offen und dennoch geschlossen, auf eine innere Mitte konzentriert. Mit recht erscheint Sciuias als erster Band der theologisch philosophischen Schriften. Denn in diesem Frühwerk Hilde gards gewannen der Reichtum der Gedanken und die Fülle des (7) M. Schrader /A. F ührkötter , Die Lchtheit des Schrifttums der heiligen Hilde gard von hingen. Quellenkritische Untersuchungen, Köln/Graz 1956, X, 208 S., 1 Bild u. 19 Schrifttafeln. A rch.f. Kulturgesch. Beiheft 6. (8) J. B. P i t r a , a. a. O. 7. (9) P. Barth /M. I. R itscher/J. Schmidt - G ö rg , Hildegard von Bingen,Lieder. Nach den ältesten Handschriften hrsg., Salzburg 1969, 328 S., 2 Faksimile-Tafeln. [Nebst] Ergänzungsheft : M. I. R itscher , Kritischer Bericht, Salzburg 1969, 62 S. (10) M. Schrader /A. F ührkötter , a. a. O. : öfter, besonders 180-184. (11) A. D erolez , The genesis of Hildegard of Bingen's ''Liber divinorum operum'. The codicological evidence, in Litterae Textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck 2, Amsterdam 1972, 23-33 ; ders., Deux notes concernant Hildegarde de Bingen, in Scrip torium, T. 27, 1973,291-295. (12) J. B. P i t r a , a. a. O., 1-244.
(13)
PL 197, 739-1038.
EINLEITUNG
X III
Geschauten die erste sprachliche Form. Bilder und Motive aus dem Sciuias wurden im Liber Vitae Meritorum, in der Symphonia, den Liedern, nochmals aufgegriffen. Die 13. Vision des III. Teiles vom Sciuias enthält 7 längere Texte, die Hilde gard als 14 Lieder auch vertont hat. Im Liber Diuinorum Ope rum nimmt Hildegard ausdrücklich Bezug auf das Weltbild ihres Sciuias. Die “ fünf Tiere” der 11. Vision des III. Teiles vom Sciuias, die die “ Weltzeiten” symbolisieren, kehren in der letzten Vision des LDO wieder(1415 ). 6 Auf Grund dieser Gegebenheiten muß dem Wissenschaftler, der sich mit Hildegards Werken befassen will, ein authenti scher Text zunächst vom Sciuias vorgelegt werden. Die Text gestalt von F a b e r /M i g n e ist jedoch, wie eingangs erwähnt, höchst fragwürdig, da sie sowohl von den zeitgenössischen als auch von den späteren Hss. des Sciuias erheblich, ja oft massiv abweicht.
3. Zum Titel SCIVIAS Der eigenartige aus zwei Wörtern bestehende Titel ist in allen Hildegard-Handschriften zusammengeschrieben. In ihrem Brief an den Mönch Wibert von Gembloux aus dem Jahre 1175 De modo uisionis suae(lb) spricht Hildegard aus führlich über ihre Visio. Eine in Brüssel liegende Hs., die die sen Brief enthält, hat u. a. auch einen Zusatz, der sich aus drücklich auf den Titel Sciuias bezieht. In uisione etiam uidi quod primus liber uisionum mearum Sciuias diceretur, quoniam per uiam luminis prolatus est, non de alia doctrinal). In dem Titel haben wir - über die Aussage dieses Briefes hin aus - die große Leitlinie zu sehen, die Hildegards Werk durch zieht und die ohne Zweifel von der Bibel inspiriert ist. Es ist der Weg, den Gott für den Menschen bestimmt hat, angefangen vom i. Buch des Alten Testamentes, wo die uia ligni uitae(17) von Keruben bewacht wird, durch alle Bücher der Heiligen Schrift bis zum letzten Buch des Neuen Testamentes, das den
(14) In der vorliegenden Edition ist im III. Teil an den entsprechenden Stellen auf diese und andere Parallelen hingewiesen. (15) Riesenkodex (R), Wiesbaden, Hess. LB, Hs. 2, f. 38orh-38ira, J.B. P i t r a , *.*.0 .331-334 . (16) Brüssel, Kgl. Bibi., Cod. 5527-3534; Analecta Bollandiana 1, Bruxelles 1882, 599. Hildegard gibt mit diesen Worten den Ursprung, nicht aber den Inhalt ihrer Visionen an. Wenn Elisabeth von Schönau ihr Werk, in dem sie den ver schiedenen Ständen den Weg zu Gott zeigt, Liber Viarum Dei nennt, so hat Hil degard ihren Titel nicht von Elisabeth entlehnt. Vgl. A. H a u c k , Kirchengesch. Deutschlands 4, 3.U. 4. (Doppel-)Aufl., Leipzig 1913, 421, Anm. 1 ; A. M. Z im mermann , in 2L ThK 3, 818 : Elisabeth v. Schönau ; F. W. E. R o th , Die Visionen der hl. Elisabeth von Schönau, Brünn 1884. Liber Viarum Dei : 88-138. (17) Gen. }, 24.
X IV
EINLEITUNG
Lobpreis und Dank des Mose noch einmal aufklingen läßt : I ustae et uerae sunt uiae tuae(18). Wenn Hildegard im Sciuias II, 3 dem Menschen nach dem
Empfang der Taufe die Verantwortung und Entscheidungssi tuation vor Augen stellt : ... respice duas semitas, unam ad orien tem et alteram ad aquilonem(19), so greift sie das uralte und immer wieder neue Zwei-Wege-Motiv auf. Es sei noch auf die Benediktusregel hingewiesen, durch die Hildegard in hohem Maße geistig geprägt und charakterlich geformt wurde. An zehn Stellen hebt die Regula die Bedeut samkeit des rechten Weges hervor. Die uia uitae, angusta uiat oboedientiae uia(20) ist der Lebensweg gemäß der Regula. Wir müssen noch weiter ausgreifen. Hildegard zeigt den Heilsweg Gottes für den Menschen vom Urbeginn der Schöp fung bis zum Letzten Tag, dem Tag der großen Offenbarung. Somit ist die Heilsgeschichte das große Thema, das Hildegard in Bildern voller Farbigkeit und Dynamik darstellt.
4. Die Quellen Bibel, Liturgie, Benediktusregel sowie die Schriften der Kir chenväter und mittelalterlichen Autoren waren die geistige Welt, in der Hildegard jahrzehntelang gelebt hatte, bevor sie ihr Erstlingswerk Sciuias verfaßte. Vor allem hat sie aus der Heiligen Schrift geschöpft. Die Bibelzitate lassen erkennen, daß sie für das Alte und Neue Testament eine von Alkuin ab hängige Bibelhandschrift benutzt hat. Hildegard, die im breiten Strom der mittelalterlichen Theologie steht, gehört zu den Autoren der Vorscholastik. Es findet sich in ihren Werken jedoch kein Zitat dieser Schriftsteller, aber sie war mit deren Gedankengut vertraut. Das zeigen die zahlreichen Elemente, die sie den Vätern und späteren ekklesiologischen Autoren entnommen und in ihren Werken frei verwendet hat. Vorstellungen und Bilder von Augustinus, Gregor d. Gr., Beda, Hrabanus Maurus, Rupert von Deutz und anderen Autoren begegnen uns im Sciuias. Teil III, in dem das Reich Gottes im Bild vom Heilsgebäude planvoll entwickelt wird, zeigt besonders in der 8. und 9. Vision Parallelen zum Hirten des Hermas. Wenn im vorliegenden Quellenapparat Anklänge an diese und andere Schriftsteller angeführt werden, so ist damit ledig lich auf den verwandten Vorstellungsraum hingewiesen. Es ist
(18) Apoc. 15,3. (19) Sciuias p. 135, 105 : vgl. 2L,ThK 10, 974-976 : Weg. (20) Benedicti Regula, ed. R. H anslik - CSEL 75, Vindobonae i96o(Bened.,Rég.) prol. 20 ; c.5 ,1 1 ; 71,2. Nach dieser Ausgabe zitieren wir.
EINLEITUNG
xv
nicht gesagt, daß Hildegard gerade diesen Autor gekannt und benutzt hat. Die Tatsache, daß in ihren Werken keine Zitate von mittelalterlichen Verfassern anzutreffen sind (abgesehen von einigen Versen aus Hymnen, die auch in der Liturgie verwendet wurden), ist nicht verwunderlich, wenn man ins Au ge faßt, daß es sich - was die literarische Gattung betrifft um V fsfowsschriften handelt. Die Aussagen stammen nicht von Menschen und aus der scientia humana, die Schriften wurden vielmehr im Auftrag Gottes verfaßt. Nam tu acumen huius profunditatis ab homine non capis, sed a superno et tremendo iudice illud desuper accipis, ubi praeclara luce haec serenitas inter lucentes fortiter lucebit{21), schreibt Hildegard. Es muß trotzdem angenommen werden, daß Hildegard die theologischen Schriften der Väter und mittelalterlichen Auto ren, wenngleich nicht vollständig, so doch in Exzerpten, zumal in den weitverbreiteten und viel gelesenen Auszügen, gekannt hat(22). In der Vita , die Teile ihrer Autobiographie aufgenom men hat, heißt es : in eadem uisione scripta prophetarum ...et aliorum sanctorum quorumdam philosophorum ... intellexi ac quaedam ex illis exposui(22a). Manches wird sie durch Unterricht oder anderweitigen mündlichen Austausch erfahren haben. Auch ist es selbstverständlich, daß sie von den Mönchen des Klosters Disibodenberg, das in der ersten Hälfte des 12. Jahr hunderts eine hohe Blüte erlebte(23), geistig viel empfangen hat. Beim Vergleich mit den Kirchenvätern und den Schriftstel lern des Mittelalters fällt auf, daß Hildegards Aussagen leben diger, ausdrucksstärker, ja oft hymnisch sind. In ihrer Bilder sprache ist sie nicht nur Träger der Tradition, sie bringt viel mehr das bekannte Glaubensgut in neugebundene Wendungen und bestimmte Sinnzusammenhänge. Diesem schöpferischen Phänomen ist in jüngster Zeit C h r i s t e l M e i e r in mehreren Untersuchungen mit Erfolg nachgegangen und hat die (21) Sciuias I, 1, p. 8, 41-43. (22) B. W idmer bemerkte in Heilsordnung u. Zeitgeschehen in der Mystik Hildegards von Bingen, Basler Beiträge Geschichtswiss. 52, 1955, S. 202, Anm. 437, daß Hildegard “ die Augustiner oder ihren Kirchenvater nirgends mit Namen nennt” . In ihrer Expositio Euangeliorum (R f. 434r~46iv) erwähnt Hildegard Gregorius, A m brosius, Augustinus, Hieronymus et alii similes : R f. 457vb ; J. B. P it r a , a. a. O. 306. H. D e L ubac weist darauf hin, daß seit Beda (PL 92, 304D) die vier großen lateinischen Kirchenväter formelhaft zitiert werden : H. D e L u b a c , Exégèse médiévale, Collection “ Théologie” 41, Paris 1959, p. 26. In der gleichen Aufeinanderfolge wie Hildegard führt Gotschalk von Limburg sie auf : H. D e L u b a c , ebd. 27.0rigenes wird von Hildegard in der Evangelienauslegung ebenfalls genannt : R f. 45 3rf‘ : Ori(g}enes ; J. B. P itra a. a. O. 293. (22») Wiesbaden, Hess. LB, Hs. 2 (R), f. 320™ ; PL 197, 104A. (23) Von der Schreibgewandtheit des Disibodenberger Skriptoriums zeugt die zum Kirchweihfest des Disibodenbergs 1143 gefertigte Handschrift, die das Martyrologium und die Benediktusregel enthält : Bern, Burger-Bibl., Cod. 226.
XVI
EINLEITUNG
eigenständige Gestaltungskraft Hildegards an einzelnen Wör tern und Wortkomplexen aufgezeigt(24). So ist die indocta dennoch eine docta, obgleich sich Hildegard gern als indocta und paupercula bezeichnet. Mit Vorliebe haben sich bedeutende Autoren klein und armselig genannt, so daß wir in diesen und ähnlichen Formulierungen einen literarischen Topos sehen dürfen. Hildegard, der nicht nur die Glaubenslehren, sondern auch die kirchlichen Rechtsbestimmungen bekannt sind, behandelt fast alle theologischen und philosophischen Fragen in ihren Schriften, jedoch ohne die gelehrte schulmäßige Systematik, wie sie z. B. Hugo von St. Viktor eigen ist. Es fehlen bei ihr die Hinweise auf die Quellen, die dieser Autor häufig nam haft macht : Dicit beatus Augustinus(25). Methodisch über nimmt sie, wenngleich nicht streng systematisch, den gern gebrauchten Frage-Antwort-Stil. Die im I. und II. Teil des Sciuias häufig vorkommenden Wendungen Quomodo ? oder Quid est hoc ? dürften auf diesen Stil hinweisen. Im III. Teil leitet Hildegard die Schriftauslegungen meistens ein mit Hoc taie est. Es sei noch kurz auf das oft eigenwillige Vokabular Hilde gards hingewiesen. So wird z. B. magnanimitas, die Hochher zigkeit, im Sinne von Aufgeblasenheit verwandt, wenn sie von der magnanimitas superbiae spricht (III, 4, 493sq.) ; auch das Adjektiv verwendet sie in ähnlicher Weise : ma gnanimes in peccatis (III, 4, 481). In Pars II, Visio 5 spricht Hildegard ausführlich über den Mönchsstand, ohne das Wort monachus oder abbas zu verwenden. Es wurde im Quellenappa rat (II, 5, 5i6sq.) bei der Formulierung uiuens odor (cf. II Cor. 2, 15. 16b) auf den monachus hingewiesen. Die Eigenart und die Entwicklung der Sprache bzw. der sprachlichen Formulie rungen bedürfen einer eigenen Untersuchung. Abschließend sei noch ein bedeutender Forscher erwähnt, H. L iebeschütz , der sich eingehend mit den Quellen befaßt hat, aus denen Hildegard geschöpft hat oder geschöpft haben könnte. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen hat er i. J. 1930 der Öffentlichkeit vorgelegt(26). Es muß vermerkt werden, (24) C h . M eier , Die Bedeutung der Darben im Werk Hildegards von Bingen,in Frührnittelalterl. Studien (FMSf) 6 , 1972, 245-355 ; dies., Das Problem der Qualitätenallegorese, in F M St 8, 1974, 385-435 ; dies., Vergessen, Erinnern, Gedächtnis im Gott-Mensch-Bes^ug, in Verbum et Signum 1, Festschr. f. F. Ohly, 1975, 143-194 (bes. 156-194). (25) Hugo de s. Vi ct., Quaestiones in Epist. Pauli - PL 175, 437C ; 442B ; 456D ; 464D u. ö. (26) H. L ieb eschütz , Das allegorische Weltbild, der heiligen Hildegard von Bingen, Leipzig 1930, XI, 179 S., 6 Tafeln. Studien der Bibi. Warburg 16. Unveränderter reprod. Nachdruck mit einem Nachwort zum Neudruck, Darmstadt, Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1964, XI, 188 S., 6 Tafeln, 1 Klappkarte.
EINLEITUNG
X V II
daß die Zwischen- oder Mittelglieder, die Hildegard benutzt haben könnte, von H. L i e b e s c h ü t z oft nicht nachgewiesen wurden. Die Publikation dieses Gelehrten erregte in der Hilde gardforschung Aufsehen und blieb lange unwidersprochen. Erst 1958 meldete sich eine Gegenstimme. Der Medizinhisto riker H. S c h i p p e r g e s trat den Ansichten des Forschers zwar gemäßigt, aber entschieden entgegen. Er äußerte, daß H. L i e b e s c h ü t z “ zu aufdringlich das Einwirken literarischer Vor lagen und Traditionskomplexe, vornehmlich orientalischer Provenienz, intendiert’J27). Das Werk erfuhr 1964 einen Nachdruck. Im Nachwort(28) dieser Auflage nimmt H. L i e b e s c h ü t z nochmals Stellung zu seinen Darlegungen, und sagt : “ Der Verfasser, der diese vor 35 Jahren abgeschlossene Schrift wieder vornimmt, findet darin vielerlei, was er einfacher, und vielleicht auch manches, was er heute mit der größeren Vorsicht des Alters ausdrücken würde’’(29). Die Einwände, die H. S c h i p p e r g e s 1962 in einer ge lehrten medizinhistorischen Untersuchung (30) gegen das Quellenmaterial erhebt, das Hildegard benutzt haben könnte, werden von H. L i e b e s c h ü t z nicht wiederlegt. H. S c h i p p e r g e s würdigte die “ ausgezeichnete historisch-kritische Analyse'J31) des Forschers, doch seine Grundthese-die Übernahme von Mo tiven, Vorstellungen, Bildern und Mythen aus dem nichthel lenistischen Orient durch Hildegard - zog er stark in Zweifel (32). Die Forschungen von H. S c h i p p e r g e s führten zu dem Ergeb nis, daß Hildegard nicht über Toledo oder Palermo Rezeptions gut übernommen und christlich verarbeitet hat. “ Gerade die naturkundlichen Schriften zeigen, bei aller Assimilation des zeitgenössischen Wissens, wie Hildegards Schrifttum in ge nialer Weise neu konzipiert und symbolisch durchinterpretiert wurde und im ganzen wohl die geschlossenste Mikrokosmos theorie und großartigste Anthropologie darstellt, die das frü he Abendland hervorgebracht hat’’(33). Was hier von den naturkundlichen Schriften Hildegards ge sagt wird, darf wohl für das Gesamt werk Hildegards gelten, zumal mitbedacht werden muß, daß H. S c h i p p e r g e s die natur kundlichen und heilkundlichen Schriften der Äbtissin vom
(27) H. Schipperges , Das Schöne in der Welt Hildegards von Bingen, in Jahrbuch fü r Ästhetik 4, 1958/59, 83-139. Zitat : 128. (28) H. L ieb es chü tz , a. a. O. 181-188. (29) Ders., a. a. O. 181 . (30) H. Schipperges , Rinflüsse arabischer Medizin auf die Mikrokosmosliteratur des 12. Jahrhunderts. Miscellanea Mediaevalia 1, 1962, 131-153. (31) Ders., ebd. 133. (32) Ders., ebd. 133-135. (33) Ders., ebd. 133.
EINLEITUNG
X V III
Rupertsberg stets im Zusammenhang mit den anderen Werken der Autorin zu erfassen sucht (34).
5. Der prophetische Charakter Hildegards Aussagen tragen einen visionären, prophetischen Charakter. Das kommt bereits durch das erste Wort ihres Sciuias zum Ausdruck. Das Werk beginnt mit E t . Schon Gregor d. Gr. weist in einer seiner Ezechiel-Homilien auf den Sinn und die Bedeutung dieses sermo coniunctionis bei den Propheten zu Beginn ihrer Verkündigung hin(35). Wie die Propheten des alten Bundes gibt Hildegard am Be ginn ihrer Werke den Zeitpunkt ihrer Sendung und damit den Anfang ihrer Niederschrift an. Es folgt das uidi et audiui. Im mer wieder begegnen wir den Wörtern quasi und uelut, die das Geheimnisvolle, schwer zu Beschreibende andeuten(36). Auch die similitudo der Propheten (373 ) greift die Seherin auf. Sie 8 ist wie geblendet von der Größe und Erhabenheit des Ge schauten und überwältigt von der Wucht der an sie er gangenen Sendung. Ja, Bild und Formulierung sind wört lich z. B. dem Propheten Daniel (8, 17. 18) entnommen, wenn Hildegard im Sciuias (II, 5, 160-161) schreibt : "... in terram c o r r u i ... splendor uelut manus tetig it m e\ Und wie Jeremia den Anruf uade et clama(3B) vernimmt, so hört sie die eindringlichen Worte Surge ergo, clama et dic(394 ). 0 Die alttestamentlichen Propheten werden gesandt, das abtrünnige Gottesvolk zur Umkehr aufzurufen und ihm den Strafzorn des Herrn anzudrohen. In ähnlicher Weise hat die prophetissa teutonica den Auftrag, dem Gottesvolk des Neuen Bundes, Laien, Priestern und Ordensleuten, die Gottverges senheit, die vielen Laster, die geheimen und öffentlich began genen Sünden und Verbrechen wie Mord, Raub, Simonie, Ehe bruch, Hurerei vor Augen zu stellen und den Anspruch Gottes an den Menschen aufzuzeigen. Hildegard hat das Erlösungswerk zu verkünden, damit die jenigen aufgerüttelt werden, die die Heilsbotschaft predigen müßten, dies aber unterlassen, weil sie lau und schwerfällig - tepidi et hebetes(*°) - sind. (34) Das zeigt seine Übersetzung und Interpretation von Hildegards heilkundlicher Schrift. H il de g a r d vo n B i n g e n , Heilkunde. Das Buch von dem Grund und Wesen und der Heilung von Krankheiten. Nach den Quellen übers, u. erläutert von H. S chi pp erg es , Salzburg 31974. (35) Greg., ln Hie%. 1 ,2 ,2 ,- CC 142, p. 17, 21-36. (36) Ez. 1, 24. 26. 27. (37) Ez. 2, i . (38) Jer. 2,2. (39)
S c I, 1,44.
(4 0 )
ü H 35-
EINLEITUNG
X IX
6. Aufriß des SCIVIAS Die Protestificatio In der Protestificatio(41) gibt Hildegard Zeugnis von der Entstehung ihres Werkes. Sie nennt den zeitlichen Beginn ihrer Sendung - es ist das Jahr 1141 - und ihr Lebensalter : cum quadraginta duorum annorum essem. Das Lebensalter wird in 3 Hss. genauer bestimmt durch den Zusatz septemque mensium, und zwar als Nachtrag in 2 zeitgenössischen Hss. : im Rupertsberger Prachtkodex, Hs. W (Wiesbaden, Hess. LB, Hs. 1), auf Rasur von Hand 3, dem zeitgenössischen Korrektor ; im Parker Sciuias, Hs. B, über der Linie von zeitgenössischer Hand. Im Riesenkodex, Hs. R (Wiesbaden, Hess. LB, Hs. 2, ca. 1180-1190), steht das septem que mensium im laufenden Text(42). Die zusätzliche Monats angabe kann natürlich nur von Hildegard persönlich stammen. In der Protestificatio teilt Hildegard mit, wie lange sie an ih rem Werk gearbeitet hat. Darüber berichtet sie außerdem zu Beginn ihres Liber Vitae Meritorum und schreibt, daß sie sich zehn Jahre am Sciuias abgemüht hat : " ... ueras uisiones in quibus per decennium insudaueram’ J43). Sie erwähnt in der Protestificatio ihres Sciuias auch ihre beiden Mitarbeiter, die sie nicht mit Namen bezeichnet : einen Mönch von gutem klösterlichen Wandel und ein adliges Mädchen. Diese Mitar beiter sind Volmar, Mönch vom Disibodenberg, der ihr bis 1173 zur Seite stand(44), und ihre Sekretärin Richardis von Stade, Nonne in Hildegards Kloster. Als Richardis zur Äbtissin von Stift Bassum bei Bremen gewählt worden war, verließ sie bald nach der Übersiedlung der Nonnen vom Disibodenberg in die Neugründung am Rupertsberg ihre Meisterin Hildegard(45). Ferner ist bemerkenswert, daß Hildegard in der Protestifi catio bedeutsame Aussagen über ihre uisiones macht. Zu Beginn der Protestificatio ist im Rupertsberger Pracht kodex, der 35 Miniaturen enthält, auf der 1. Miniatur die Ver(41) Die meisten Hss. führen die Bezeichnung Praetestificatio. Die besonders zu verlässig gefertigte Hs. Pal. lat. 311 (K )hat den Titel Protestificatio, der wir den Vorzug geben. Vgl. den Gebrauch von protestor in Sc II, 2, 70 und II, 3, 524. Die Hs. W führt an dieser Stelle keine Bezeichnung. (42) Auch das i. j. 1174 verfaßte Buch I der Hildegard-Vita enthält diesen Text des Sciu. mit septemque mensium : R. f. 317™, PL 197, 93B. Ebenfalls befin det er sich bei Gebeno (s. Hs. M unserer Edition). (43) J. B. P i t r a , a. a. O. 7. (44) Über Volmar s. M. Schrader /A. F ührkötter , a. a. O. 14, 27, I44ff., 181ff. ; A. F ührkötter , Das Leben der heiligen Hildegard \V ita S. Hildegardis auc toribus Godefrido et Theodorico monachis], hrsg., eingel. u. übers., Düsseldorf 1968. Über Volmar : 13810. (45) Über Richardis von Stade s. A. F ü h r k ö t t e r , Hildegard von Bingen, Brief wechsel, Salzburg 1965,93-100.
XX
EINLEITUNG
fasserin des Werkes dargestellt(46). Vgl. Tafel i : Hildegard sitzt und lauscht, die Wachstafel auf dem Schoß, den Griffel in der Hand. Von oben flammt das Feuer des Heiligen Geistes auf sie herab (vgl. Apg. 2, 3). Ihr Sekretär Volmar wird den Text auf Pergament übertragen(47).
Die drei Teile Das Werk umfaßt drei Teile (Partes). Jeder Teil ist in sich einheitlich gestaltet. Der große Leitgedanke - der Weg - wird bis zum Schluß des Werkes durchgeführt. Jeder Teil ist in Visionen gegliedert, jede Vision in Kapitel von unterschied licher Zahl und Länge. Hildegard beschreibt in jeder Vision zuerst das geschaute Bild, das dann von der ‘'göttlichen Stim me" erläutert und gedeutet wird. Die Texte der eigentlichen Visio werden häufig durch theologische oder anthropologische Abhandlungen unterbrochen oder besser : aufgelockert.
Teil I enthält 6 Visionen, in denen Hildegard ein Bild von Schöp fer und Schöpfung, von Gott, Welt und Mensch, entwirft. I, i
Gott und der Mensch
In der Eingangsvision wird in 6 Kapiteln die Grundhaltung des Menschen in der Begegnung mit Gott aufgezeigt. Der in unzugänglichem Licht thronende Gott gibt dem Menschen Anteil an seinem Leben, der in "Gottesfurcht" und "Armut des Geistes" vor ihm steht. Die zwei Gestalten sind darge stellt zu Füßen des Berges, der das Reich Gottes symbolisiert. Vgl. Tafel 2. I, 2
Urständ und Versagen der Schöpfung
Die 2. Vision stellt die Schöpfung in ihrem Urständ dar. Hildegard schaut die Engel, "die starkmütig in der Liebe Got tes verharren" und daher "in strahlender Schönheit leuchten". Vgl. Tafel 3 (oberes Feld). Luzifer hingegen, der sich gegen Gott empört, stürzt mit seinem Anhang in den Abgrund, die Hölle (unteres Feld). Die aus ihr auf steigenden finsteren Nebel (46) Beim Aufriß des Sciuias werden wir jeweils auf die Miniaturen dieser Hs. verweisen, die gleichsam ein Leitfaden sind. (47) Den Arbeitsvorgang bei der Abfassung der großen theologischen Werke (Niederschrift Hildegards auf der Wachstafel, Abschrift von der Wachstafel auf Pergament durch die Sekretäre, Korrekturen - durch Hildegard und ihre Helfer -) hat A. D erolez überzeugend aufgezeigt. Vgl. oben Anm. 1 1 .
EINLEITUNG
XXI
ziehen sich in ein lichtdurchstrahltes Land, das Paradies. Adam und die aus seiner Seite hervorgehende Wolke, Eva, die gleich leuchtenden Sternen alle Menschen in ihrem Schoße trägt, las sen sich von der Schlange verführen und übertreten Gottes Gebot. So verliert Adam das Gleichgewicht, und alle Elemente in ihm und um ihn geraten in Aufruhr. In der Vision, die 33 Ka pitel umfaßt, werden zahlreiche Ehefragen behandelt. I, 3
Gott, Kosmos und Mensch
In dieser Vision, die in 31 Kapitel gegliedert ist, wird das Weltall in der Urform des Eies dargestellt. Das Weltei ist in folgende Zonen gegliedert (vgl. Tafel 4) : Die äußerste Zone, das leuchtende Feuer, ist Sinnbild des allmächtigen Gottes, der alles durchdringt und zusammenhält. Die Sonne in ihr, die drei Leuchten über sich hat, symbolisiert Christus. Der Südwind nimmt von hier seinen Ausgang. Die 2. Zone, das düstere Feuer, weist hin auf den zelus Dei, der das Böse rächt und die Guten läutert. Der Nordwind hat hier seinen Ur sprung. Die 3. Zone, der reine Äther, stellt den Glauben dar, in dem die Kirche lebt und wirkt. Sinnbild der Kirche ist der Mond, der sein Licht von der Sonne, Christus, empfängt, es an die Gläubigen, die Sterne, austeilt, um dann aufs neue sein Licht an der Sonne zu entzünden. Von hier gehen die Ostwinde aus. Die sich anschließende Wasserzone mit den Westwinden ist Sinnbild der Taufe. Die 5. Zone, die weiße Haut, deutet auf die Unschuld der Christus verbundenen. Die Erde im Mittel punkt des Kosmos stellt den Menschen dar. Er wird von den Elementen getragen und beherrscht die Erde nach göttlicher Verfügung, denn “ Gott hat ihn mit großen, staunenswer ten Würden begabt” . - Hildegard hat das Weltbild in ihrem Spätwerk, dem Liber Diuinorum Operum (1163-1173) (48), wei ter ausgebaut, diesmal in Form eines Rades ; die Zonen werden durch Kreise wiedergegeben. Der Miniaturist der Weltei-Tafel hat den Text des Sciuias adäquat dargestellt. Die Winde werdeij von Köpfen ausge blasen. Im Liber Diuinorum Operum ist der Ausgang der Hauptwinde durch Köpfe von vier Tieren charakterisiert : Leopard, Wolf, Löwe, Bär(48a). Es ist anzunehmen daß die Weltei-Tafel zur Zeit der Abfassung des LDO gemalt worden ist. Denn in dieser Kosmosschrift hat Hildegard ihr Weltbild umfassend und sehr differenziert gestaltet. Auch nimmt sie eigens Bezug auf die Eiform im Sciuias (49). Sie begründet im Liber Diuinorum Operum die Eiform damit, daß durch diese Form die verschiedenen Schichten bildlich gut wiedergegeben (48) PL 197, 741-1038. ( 4 8 hbd. 752B. (49) Erwähnung der Eiform ebd. 75 iB.
XXII
EINLEITUNG
sind, während durch die rota mit ihren Kreisen die Maße genau angegeben werden(50). Zahlreiche Schriftsteller haben sich - schon Jahrhunderte vor Hildegard - in ihren Werken mehr oder weniger ausführlich mit dem Bild vom Weltei befaßt(51). I, 4
Der Mensch und sein Lebensweg
Hildegard behandelt in 32 Kapiteln das Leben des Men schen, angefangen von seiner Entstehung im Mutterleib bis zu seinem Tod. Sie begleitet ihn auf seinen schwierigen und gefahrvollen Wegen durch das Leben. Der Mensch sieht sich immer wieder vor die Wahl zwischen Gut und Böse und damit in die Entscheidung gestellt. Verstand und Wille, Denken und Fühlen, die Leibhaftigkeit und Geistigkeit befinden sich in einem ständigen Kräftespiel, das in Gleichnissen und Bil dern lebendig dargestellt wird. Vgl. Tafel 5, 6, 7(52). I, 5
Die Synagoge
In seiner Not- und Kampfsituation empfindet der Mensch die Erlösungsbedürftigkeit. Hildegard erblickt eine Frau, die in ein teils mattfarbenes, teils schwarzes Gewand ge kleidet ist. Vgl. Tafel 8. Die Frau stellt die Synagoge, die mater incarnationis, dar. Auf ihrer Brust und in ihrem Schoß trägt sie die großen Gestalten des Alten Bundes : Mose, Abraham und die alttestamentlichen Propheten, die die Sehnsucht nach dem Messias wachhielten und die Menschheit auf den Erlöser vorbereiteten. Die blutigroten Füße, die auf den Tod des Messias hin weisen, sind umgeben von einer strahlendhellen Wolke, da am Ende der Zeiten auch Israel das Heil erlangen wird (vgl. Röm. 11, 26). Die Vision umfaßt 8 Kapitel. I, 6
Die Chöre der Engel
Hildegard erhebt ihren Blick und schaut wie in einem Lichtmeer die neun Chöre der Engel. Vgl. Tafel 9. In kon(50) Ebd. 755D-756A. (51) Es sei verwiesen auf die Untersuchung von P. D r o n k e , Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism. With 3 plates. Mittellat. Studien 9, 1974, i -19 5. Auch Hildegards Weltbild wird kurz behandelt (S. 96-99). Aufschlußreich ist die tabellarische Übersicht der Schriftsteller vor Hildegard, unter Einbeziehung von bisher unveröffentlichten Texten : Appendix A, S. 154-161. Hildegards Welt bild : 161-163. Von besonderem Interesse ist die Untersuchung vonB. M a u r m a n n , Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalters. Hildegard von Ringen, Honorius Augustodunensis u. andere Autoren. Münstersehe Mittelalter-Schriften 33, München 1976,
220 S., 17 Abb. (52) Nach Auffassung von W. B raunfels ist die Miniatur von I, 4 (Tafel 7) die älteste Fegfeuer-Darstellung, in : Lexikon f . christl. Ikonographie II, 1970, Sp. 16.
EINLEITUNG
X X I II
zentrischen Kreisen sind sie zur Mitte hin geordnet und ste hen - das kommt auch in ihrer Gliederung zum Ausdruck in engem Bezug zum Menschen. Die äußerste Reihe wird von den Engeln eingenommen. Sie tragen Flügel, denn “ schnell wie der Gedanke dahinfliegt, drängt ihre Sehnsucht sie, den Willen Gottes zu erfüllen“ . Sie haben Antlitze wie Menschen: das deutet an, daß die Handlungen der Menschen von den Engeln zu Gott emporgetragen werden (vgl. Benediktusregel, Kap. 7, 13). Die zweite Reihe bilden die Erzengel. Auf ihrem Antlitz strahlt das Bild des Menschensohnes wider wie in einem Spiegel, da sie “ durch Botendienste dem Geheimnis der Menschwerdung den Weg bereiten durften“ . In den fünf wei teren Reihen schließen sich die Kräfte, Mächte, Fürstentümer, Herrschaften und Throne an. Die Throne “ haben nichts Menschenähnliches, sondern sie glühen wie das Morgenrot“ . Von den zwei folgenden Reihen sinnbilden die Kerube, die voller Augen sind, das “ Wissen Gottes“ , sie beflügeln die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Die Serafe in der inner sten Reihe “ brennen wie Feuer“ . - “ Alle diese Reihen tönen in jeglicher Art von Musik und künden in wunderbaren Harmonien die Wunder, die Gott in den Heiligen wirkt ein Hochgesang der Verherrlichung Gottes“ . Mit den 12 Kapiteln der 6. Vision schließt der I. Teil des Sciuias. Die gefallene Schöpfung harrt auf den Erlöser.
Teil II bringt in 7 Visionen das “ feurige Werk der Erlösung“ durch Christus und die Fortsetzung des Erlösungswerkes durch die Kirche zur Sprache. II, i
Der Erlöser
In der Eingangs vision erblickt Hildegard nochmals den Urständ der Schöpfung, die ihren Ausgang nimmt vom drei fältigen Gott. Vgl. Tafel 10 : Die Trinität (Silbergrund, saphirblaue Scheibe, rotgoldene Kreise) ; der Urständ der Schöpfung (großes Kreisrund in der Bildmitte, vom Minia turisten als Sechstagewerk durch 6 kleine Kreise wiederge geben) ; der Mensch, der das Gebot des “ leuchtenden Gehor sams“ zwar erkennt, aber nicht in die Tat umsetzt, gerät in Schuld. Der Kosmos verfällt der Finsternis, in der nach und nach Lichter aufscheinen : die Propheten des Alten Bundes (dargestellt durch Sterne), die nach dem Erlöser Ausschau halten. Nach Gottes Ratschluß erscheint der Messias im fleisch gewordenen Gottessohn, der durch Leiden, Tod und Auferste hung die Erlösung schenkt. In 17 Kapiteln wird das Heilsge heimnis dargestellt.
XXIV
EINLEITUNG
H ,2
Der dreieinige Gott
Der Urquell allen Seins und Lebens ist der dreieinige Gott. Diesem Glaubensgeheimnis wendet sich Hildegard in 9 Kapi teln zu und führt den Leser in das ihr eigene symbolträchtige Schauen. Vgl. Tafel 11 : das überaus helle Licht (symbolisiert durch die Silberkreise) ist Sinnbild des Vaters ; die Menschen gestalt in saphirblauer Farbe Bild des menschgewordenen Sohnes, im ewigen Heute im Schoße des Vaters gezeugt ; die rotgoldenen flammenden Kreise der alles durchdringende Heilige Geist. 11.3
Die Kirche die Mutter der Gläubigen
Anteil am dreifaltig-göttlichen Leben erhalten die Men schen durch das Sakrament der Taufe, dem Hildegard 37 Ka pitel widmet. Die Mutter Kirche, über deren Leib ein Fischer netz ausgespannt ist, nimmt sie in ihren Schoß, tut einen tiefen Atemzug - der Atem ist der Heilige Geist -, zieht sie hinauf in ihr Haupt und spricht die Taufformel. Wiederum erscheint das Symbol der Trinität (wie in II, 2). Vgl. Tafel 12 (rechts unten). Nun haben die Menschen Anteil am göttlichen Leben, sind hellstrahlend, bekleidet mit dem Lichtgewand der Christusähnlichkeit. Doch müssen sie dieses Leben in vol ler Verantwortung führen und sich immer wieder gegen die Finsternis, das Böse, und für das Licht, das Gute, entscheiden. 11.4
Mit Kraft gesalbt
Die Christen werden für ihre Aufgaben gestärkt durch das Sakrament der Firmung. Gegen Irrtümer und Nachstellungen ist die Kirche gefestigt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der als starker Turm hinter ihr steht. Vgl. Tafel 13. Nicht in allen kann sich die Gnade entfalten. Es gibt Menschen, die aus der Kirche ausbrechen. Die Vision umfaßt 14 Kapitel. 11.5
Die Stände der Kirche
Hildegard erblickt die Kirche von dreifachem Glanz um strahlt im Hinblick auf die drei Hauptstände der Kirche, die das eine Gottesvolk bilden. Vgl. Tafel 14. Das von hellem Licht umstrahlte Haupt symbolisiert die Apostel. Auf der von der Brust sich herabziehenden Lichtbahn erscheint die Virginitas, der "edelste Sproß des himmlischen Jerusalem". Sie ist "umgeben von ihren Kindern", den Bischöfen, Prie stern, Mönchen und Moniales. Durch eine blendendweiße Wol ke symbolisiert der untere verhüllte Teil den Laienstand, der "die Kirche ehrt und stützt von der Fülle sprossender Kraft
EINLEITUNG
XXV
bis zum Zeitenende, da die Zahl ihrer Kinder nicht mehr zu nehmen wird” . Die Vision umfaßt 60 Kapitel. 11,6
Das Opfer Christi und der Kirche
Das in der Taufe empfangene und durch die Firmung gefe stigte Christusleben wird weiterhin gestärkt durch die Teilnah me am eucharistischen Opfer in der Meßfeier und durch den Empfang des eucharistischen Mahles. Diesem Heilsgeheimnis wendet sich Hildegard in der 6. Vision zu. In 102 Kapiteln werden nicht nur zahlreiche Fragen behandelt, die sich auf das eucharistische Opfer beziehen, sondern auch viele Probleme, die speziell den Priester betreffen. Hauptgedanken der eigent lichen Vision (vgl. Tafel 15, oberes Feld) : Vom himmlischen Vater wird die Kirche unter dem Kreuz dem Sohne angetraut. Als Hochzeitsgabe empfängt sie das Blut ihres Herrn, von dem sie überströmt wird und das sie in einem Kelche auffängt. Im unteren Feld tritt sie an den Altar und bittet den Vater, er möge die Gaben von Brot und Wein wandeln in den Leib und das Blut Christi. Die Herrlichkeit des Vaters senkt sich herab und vollzieht im Heiligen Geist die Wandlung. Gleichzeitig erscheinen über dem Altar die Geburt Christi, das Leiden (am Kreuz), die Grablegung, die Auferstehung und die Himmel fahrt. Tafel 16 zeigt im oberen Feld den Priester am Altar. Im unteren Feld treten die Gläubigen zum Empfang der heili gen Eucharistie hinzu. Entsprechend ihrer inneren Verfassung werden sie mehr oder weniger von Licht überflutet oder von Finsternis überschattet. II, 7
Der Mensch in der Anfechtung
Als "wurmartiges Ungeheuer von verblüffender Größe und Länge” liegt die alte Schlange auf dem Weg des irdischen Lebens und sucht die Menschen zu verschlingen. Schaden kann das Untier nur denen, die sich ihm freiwillig nahen. Denn durch die Menschwerdung Gottes ist es mit einer gewaltigen Kette an den Abgrund gefessèlt. Vgl. Tafel 17. Die Heiligen treten es mit Füßen in der flammenden Glut der göttlichen Gerechtigkeit. Immer wieder versucht das Unge heuer, die Menschen in seinen Rachen zu locken. Vgl. Tafel 18. Oder der Widersacher tarnt sich als Handelsmann. Manche gehen um den Preis des guten Gewissens auf den Betrug ein. Andere streben unbeirrt den' ewigen Gütern zu. In 25 Kapi teln behandelt Hildegard dieses Thema.
Teil III umfaßt 13 Visionen. Nach der Eingangsvision (III, 1) er blickt Hildegard das Heilsgeschehen im Bild eines Gebäudes,
XXVI
EINLEITUNG
dessen Mauern und Gebäudeteile im Laufe der Zeit erstellt werden, bis der Bau am Letzten Tag vollendet ist. Das Ge bäude wird nicht von Gott allein errichtet, sondern der Mensch hat als Mitarbeiter Gottes (vgl. i Kor. 3, 9) die Aufgabe, am Heilswerk Gottes (auch opus Dei genannt) mitzu wirken. Hildegard nennt die Bauleute uirtutes und bringt mit diesem Wort beides zum Ausdruck : das Tun Gottes und die menschliche Mitarbeit. Nachdem in der 2. Vision der Bauplan dargelegt ist, wird von der 3. bis zur 10. Vision das Zusam menspiel der "K räfte” aufgezeigt. Die 11. Vision stellt die letzten Zeiten dar, die 12. Vision das Letzte Gericht als Tag der großen Offenbarung. Die 13. Vision ist ein Jubelgesang auf das Wirken Gottes in den Heiligen. III, i
Gott und der Mensch
Die i. Vision umfaßt 18 Kapitel. Hildegard sieht auf einer glänzendweißen Wolke einen Köningsthron und darauf Gott, den Lebendigen, leuchtend in der Fülle des Lichtes. Vgl. Tafel 19. Von ihm geht ein großer Lichtkreis aus, und aus dem Geheimnis des Leuchtenden gehen die Engel hervor. Hildegard führt den Leser nochmals zurück an den Beginn der Schöpfung. Sie schaut den dramatischen Sturz der stolzen Engel. Vgl. Tafel 20. Der Lichtglanz, mit dem Gott sie be kleidet hatte, kehrt zurück zu dem Leuchtenden und wird aufbewahrt für den dunklen Lehm im Herzen des Vaters : der Mensch nimmt die Stelle des gefallenen Engels ein. Zur Grundhaltung des Menschen gehören der timor Domini, sym bolisiert durch einen gewaltig großen Stein, die fides, dar gestellt durch den Königsthron, und die sapientia humana, die gleichsam der Fußschemel Gottes ist. III, 2-10
Grundriß des Gebäudes (53)
Außerhalb des Heilsgebäudes steht der Thron des Allherr schers. Das Gebäude selbst sieht Hildegard aufgerichtet auf einem hohen Felsen, im Lichtkreis der göttlichen Macht. Es ist im Viereck gebaut, die vier Winkel schauen nach den vier Himmelsrichtungen. Vgl. Tafel 21. Von Osten führt die leuch tende Mauer (lucida pars muri) zum Norden. An dieser Mauer steht der Turm des Ratschlusses {turris praecursus uoluntatis Dei : Visio 3) und zur Nordecke hin die Säule des Wortes Gottes (columna Verbi Dei : Visio 4). An der Nordecke befindet sich der Eifer Gottes (zelus Dei : Visio 3). Hier schließt sich die Steinmauer oder dreifache Mauer an (lapidea (53) Grundriß nach M. B ö c k e l e r , Hildegard von Bingen, Wisse die Wege, Sciuias, Berlin *1928, 230, Salzburg *1975, 226.
XXVII
EINLEITUNG Torrn a
aedificii
o
tu rri»\^ d esiac
pars muri : Visio 6), die vom Norden zum Westen führt. Die Westecke nimmt die Säule der Dreifaltigkeit ein {colum na Trinitatis : Visio 7). An dem sich anschließenden Teil
der noch unvollendeten Mauer (nur die Fundamente sind ge legt) befindet sich die Säule der Menschheit des Erlösers (1columna humanitatis saluatoris : Visio 8). Im Süden steht der Turm der Kirche (turris ecclesiae : Visio g). Die Stein mauer von Süden nach Osten ist ein in sich geschlossener Bau, nicht durch Türme und Säulen unterbrochen. In der Ost ecke steht, eingefügt in das Gebäude, der Thron des Men schensohnes (thronus F ilii hominis : Visio 10 ) , der als Eck stein die beiden Teile der Mauer verbindet.
Visio
X X V I II
EINLEITUNG
III, 2
Das Heilsgebäude
Die drei ersten Kapitel handeln vom Glauben als Grundlage des Heils. In den Kapiteln 4-28 erklärt Hildegard den Plan des viereckig angelegten Heilsgebäudes. Vgl. Tafel 21. In mehrfa cher Abwandlung werden in den Symbolen von Quadren und anguli, also den vier Himmelsrichtungen, die großen Gestalten des Alten Bundes - Adam, Noe, Abraham, Mose - in ihrer Zielrichtung auf Christus, den lapis angularis dargestellt. In Adam erscheint die creatio a Deo, in Noe erblickt Hildegard das Zeichen für die speculatiua scientia duarum causarum : gemeint ist die Erkenntnis von Gut und Böse (“ wie der Mensch in einem Spiegel sein Antlitz als schön oder häßlich erkennt” und die entsprechende Entscheidung trifft). Abra ham symbolisiert die Beschneidung, Mose das Gesetz. III, 3
Der Turm des Ratschlusses
Etwa in der Mitte der leuchtenden Mauer steht dieser Turm (iturris praecursus uoluntatis Dei). Vgl. Tafel 22 und 23. Die fünf Gotteskräfte in ihm wenden ihren Blick in bestimmte Richtungen : amor caelestis (ad orientem), disciplina (ad aquilonem) , iierecundia (ad septemtrionem), misericordia (ad columnam Verbi Dei), uictoria (ad turrim ecclesiae et ad dis currentes). Zwei Gotteskräfte stehen außerhalb des Turmes : patientia und gemitus. 13 Kapitel enthält diese Vision. 111,4
Die Säule des Wortes Gottes
Die columna Verbi Dei steht außerhalb der leuchtenden Mauer an der Nordkante. Vgl. Tafel 24. Auf der Miniatur ist die dreifache Oberfläche so auseinandergelegt, daß die drei Flächen sichtbar sind. Aus der östlichen Kante sprossen Äste hervor von der Wurzel bis zur Spitze : Abraham, Mose, Josua und die übrigen Patriarchen und Propheten sitzen auf ihnen. Voll Staunen blicken sie hinüber zur nächsten Flä che, die die Zeugen des Neuen Bundes aufleuchten läßt : die Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und andere Heilige. Die dritte Seite wird von den “ Lehrern der Kirche eingenom men, den tiefsinnigen Erforschern der Worte des Alten und Neuen Bundes” (sie sind auf der Miniatur nicht sichtbar). Über der Säule schwebt der Heilige Geist : denn unter seinem Wehen wird das Wort Gottes offenbar im Alten und im Neuen Bund. - Dem Worte Gottes ist das Erkennen Gottes (scientia Dei) zugeordnet. Diese Gotteskraft ist es, die das Geheimnis des Vaters im Alten wie im Neuen Bund kundtut. Die Men schen können das Erkennen Gottes ehrfürchtig annehmen oder es zurückweisen. Vgl. Tafel 25. Die Vision umfaßt 22 Kapitel.
EINLEITUNG III, 5
XXIX
Der Eifer Gottes
An der Nordecke des Gebäudes erscheint der zelus Dei als furchtbares Feuerhaupt. Vgl. Tafel 26. Er züchtigt mit dem Schlag seiner drei gewaltigen Schwingen die Region der Finsternis, von der alle Angriffe auf den lichten Plan der Er lösung kommen. Niemand soll, sagt Hildegard im letzten, 33. Kapitel, seine Sünde entschuldigen und gegen Gott murren. III, 6
Das steinerne Gesetz
Gott hat im Alten Bund als Zeichen des Glaubens von Abra ham und seinen Nachkommen die Beschneidung gefordert, von Mose und dem auserwählten Volk die Erfüllung des Ge setzes. So führt vom Norden zum Westen die Steinmauer des alttestamentlichen Gesetzes (lapidea pars muri). Vgl. Tafel 27. Durch dessen Erfüllung sollte das israelitische Volk am Heilsgebäude (dem opus bonitatis Patris) mitarbeiten. In 35 Kapiteln wird dieses Thema behandelt. Drei Gottes kräfte stehen am Anfang : abstinentia, largitas, pietas, drei am Ende : ueritas, pax , beatitudo. Zwei weitere, discretio, saluatio animarum, leiten zum Neuen Bund über. III, 7
Die Dreieinigkeit
Sub tempore quasi in occasu kam Christus und brachte Kun de vom dreifältigen Innenleben Gottes. Wer an dieses Ge heimnis glaubt, wird in die nun beginnende Mauer des Neuen Bundes eingebaut. Das wird in 11 Kapiteln aufgezeigt. Abge schnitten vom Leben werden die Ungläubigen : wie trockenes Stroh die abgefallenen Christen, wie leichte, in alle Winde verstreute Federchen die sich brüstenden Juden, wie faulendes Holz die Heiden. Vgl. Tafel 28.
III, 8
Die Mitarbeiter am Erlösungswerk
In der von Westen nach Osten aufzurichtenden Stein mauer, deren Fundamente kaum gelegt sind, steht die colum na humanitatis saluatoris. Vgl. Tafel 29. In 25 Kapiteln wird das Zusammenspiel von Gotteskraft und menschlicher Mit wirkung eindrucksvoll veranschaulicht. An der Säule steigen die uirtutes, Steine tragend, auf und nieder. Durch besondere Symbole sind sie gekennzeichnet. Auf der rechten Seite der Leiter : humilitas, caritas, timor Domini, oboedientia, auf der linken Seite : fides, spes, castitas. Hoch über allen schwebt, umleuchtet vom Glanz der Inkarnation, di e gratia Dei.
XXX
III, 9
EINLEITUNG Der Turm der Kirche
An der gleichen Steinmauer befindet sich - nach Süden zu, in der Glut des Heiligen Geistes - die turris ecclesiae als Boll werk gegen die Mächte der Finsternis. Der Turm ist - gleich der Säule der Menschheit des Erlösers - unvollendet. Vgl. Tafel 30. Die Apostel und ihre Nachfolger bauen daran. Menschen, die aus dem Heilsgebäude in die '‘Welt” zurück kehren, bekämpfen die Kirche. Doch sie bleibt stark und fest. Denn vor ihr steht auf einem Sockel mit sieben Säulen die sapientia, und drei Gotteskräfte sind Trägerinnen ihres Le bens : iustitia, fortitudo, sanctitas. 29 Kapitel umfaßt diese Vision. III, 10
Der Menschensohn
Das Gebäude wächst - vom Osten zum Norden über Wes ten und Süden zurück zum Osten - unaufhaltsam seiner Vollendung entgegen. Christus erscheint als der Eckstein, der Anfang und Ende des Gebäudes verbindet. Vgl. Tafel 31. Fünf Gotteskräfte vollenden seinen mystischen Leib : con stantia, caeleste desiderium, compunctio cordis, contemptus mundi, concordia. Die Vision ist in 32 Kapitel gegliedert. Ill, i i
Das Ende der Zeiten
Am Ende der Zeiten erscheint Christus, der Eckstein, in voller Gestalt. Vgl. Tafel 32. Sein mystischer Leib ist vollendet. Auf dem Schoße hat er die Lyra, das Symbol für den Hymnus der Liebe, den die ecclesia ihm singen wird. Fünf wilde Tiere versinnbilden die letzten Zeitläufte vor dem Auftreten des Antichrist, der aus dem Schoß der Kirche hervorgeht : ein feurig glühender Hund (Hildegards eigene Zeit, die sie an an deren Stellen “ weibisch” nennt), ein gelber Löwe (Kriegszei ten, die letztlich in Schwäche zerfallen), ein fahles Pferd (Friedenszeit mit Trägheit und Ausgelassenheit), ein schwar zes Schwein (Schwärze der Traurigkeit und Kot der Sittenlosigkeit), ein grauer Wolf (Raub- und Machtgier). Die Kirche er scheint in ihrer vollen Gestalt, wird jedoch hart bedrängt durch eine höllische Bestie, die die Menschen verführt, aber durch ihre letzten Leiden wird die Kirche in ihren Gliedern vollen det. In 42 Kapiteln werden diese Zeiten dargestellt, die Hilde gard auch im letzten Werk ihrer Visionstrilogie, dem Liber Diuinorum Operum, Visio 10, eingehend beschreibt(54). Nach dem Sturz des Antichrist erstrahlt die Kirche in leuchtender Schönheit (Kap. 40). (54) In der Edition wird auf die parallelen Stellen hingewiesen.
EINLEITUNG III, 12
XXXI
Der Tag der großen Offenbarung Der neue Himmel und die neue Erde
Welt und Zeit haben ihren Sinn erfüllt, ihren Lauf beendet. Vor ihrer Rückkehr zum Schöpfer wird die Schöpfung im Sturm des Weltuntergangs der letzten Reinigung unter zogen. Mächtige Orkane blasen aus den vier Himmels richtungen, die vier Elemente toben durcheinander. Alles Sterbliche haucht das Leben aus. Ein Engel stößt in die Posaune und ruft die Toten. Vgl. Tafel 33. Die Gebeine sammeln sich, die Toten stehen auf, die einen (signati) zur Herrlichkeit, die anderen (non signati) zur Verdammnis. Christus, umgeben von den Engeln, erscheint auf den Wolken des Himmels. Nach dem Gericht entsteht eine wunderbare Harmonie. Vgl. Tafel 34. Sonne und Mond leuchten wie Schmucksteine am Himmel, sie kreisen nicht mehr, es ist ewiger Tag : Christus, das Lamm, ist die Leuchte. Die uiae Domini enden im Schoß der Dreifaltigkeit. Die Vision umfaßt 16 Kapitel. III, 13
Lobpreis auf die Heiligen.
Aus der himmlischen Herrlichkeit hört Hildegard den Lob preis auf die Großtaten, die Gott in den Heiligen gewirkt hat. Es sind Hymnen an Maria, die Engel, die Propheten, die Apostel, die Märtyrer, die Bekenner, die Jungfrauen. Vgl. Ta fel 35. Die hymnischen Texte der ersten 7 Kapitel hat Hilde gard in 14 Liedern vertont, ebenso das Zusammenspiel der uirtutes mit der anima (Kap. 9) (55), das sie im Ordo Virtutum weiter ausbaut. Mit diesen Lobpreisungen beschließt Hilde gard in 16 Kapiteln ihr großes Werk.
(55) Über die Gesänge liegt die Studie vor : P. W a l t e r , Virgo filium dei por tasti. Maria in den Gesängen der heiligen Hildegard von Bingen, in Arch.f.mitte/rhein. Kircbengesch. 29, 1977, 75-96.
Handschriften und Drucke
Die überlieferten Hss. vom 12.-15. Jh., die den vollständi gen Text des Sciuias enthalten, weisen untereinander relativ geringfügige Varianten auf. Außerdem ist eine Überlieferung von Exzerpten vorhanden, die - vom Inhalt her - verschiedene Stränge aufweisen, hin sichtlich ihres Ursprungs aber in die Richtung der vollstän digen Hss. weisen. Eine Hs. aus dem 16. Jh. bildet eine Ausnahme : sie zeigt den Text vom Erstdruck des I acobvs F a b e r (1513). Die Varianten dieser Hs. I 330 (582) der Main zer Stadtbibliothek (m), die noch besprochen wird, werden nicht mit den Varianten der anderen Hss., sondern mit denen des Erstdrucks von F a b e r (/) aufgeführt. Zur Exzerpten-Überlieferung gehört auch die Zusammen fassung mehrerer Kapitel aus III, 11 in wenige Zeilen aus dem Ende des 12. Jh.s im süddeutschen Raum, auf die wir vor der Beschreibung der Mainzer Hs. zurückkommen.
I. Vollständige Handschriften W i e s b a d e n , Hess. Landesbibliothek, Hs. 1, um 1165, seit 1945 verschollen Bibi, der Abtei St. Hildegard, Fotokopie von W in Originalgröße aus dem Jahre 1927
E ib in g e n ,
Bibi, der Abtei St. Hildegard, handgefertigtes Pergament-Faksimile aus den Jahren 1927-1933
E ib in g e n ,
Die illuminierte Rupertsberger Prachthandschrift hat einen aus dem 16. Jh. stammenden Einband. Die von braunem Le der überzogenen Holzdeckel haben Messingbeschläge an den Ecken, ein Eckbeschlag ist entfernt. A. V an der L in de hat den Kodex ausführlich beschrieben(56). Er stellte an der Innenseite des Vorderdeckels den Eintrag fest l i b e r , s c i . r v p e r t i .a p v t .b i n g a (57), den L. BAiLLETdem 13. Jh. zuwies(58). Die Hs. ist von G . W itzel im Jahre 1554 bezeugt(59). Der Ei-
56) A. V an der L i n d e , Die Handschriften der Königlichen Landesbibliothek in Wiesrsden, Wiesbaden 1877, 22-28. t-'j Ebd. 25f. >>) L. B a il l e t , Ees miniatures du ‘ Sciuias* de Sainte Hildegarde. Monuments et Meme ires publiés par T Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, T. 19, Paris 1912, 49Datierung des Eintrags 502.