Geschichte in den Social Media: Nationalsozialismus und Holocaust in Erinnerungskulturen auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram [1 ed.] 9783737012515, 1205703732, 9783847112518
157 105 18MB
German Pages [665] Year 2021
Polecaj historie
Citation preview
Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik
Band 23
Herausgegeben im Auftrag der Konferenz für Geschichtsdidaktik vom Vorstand: Michele Barricelli, Martin Lücke, Monika Fenn, Markus Bernhardt und Christine Gundermann
Hannes Burkhardt
Geschichte in den Social Media Nationalsozialismus und Holocaust in Erinnerungskulturen auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram
Mit 69 Abbildungen
V&R unipress
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. Gefördert durch die Konferenz für Geschichtsdidaktik e.V. und mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zeitlehren. Als Dissertation genehmigt von der Philosophische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (eingereicht im Mai 2018). Originaltitel der Dissertation: Geschichte im Social Web. Historische Orte, Personen und Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram © 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Umschlagabbildung: Social-Media-Konzept, © scyther5, iStock-ID: 1205703732 Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2198-5391 ISBN 978-3-7370-1251-5
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1. Einleitung: Geschichte in den Social Media . . . . . . . . . . . . . . .
11
2. Zugänge und Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Theoretische Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Geschichtsdidaktik als Kulturwissenschaft . . . . . . . . . 2.1.2. Gedächtnistheorien und der Begriff der Erinnerungskulturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Medientheoretische und -begriffliche Grundlagen . . . . . 2.2. Methodische Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Der methodische Rahmen: Social-Media-Monitoring . . . 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN) . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
41 42 42
. . . .
49 63 95 95
.
99
3. Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust in den Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Das Auschwitz Memorial and Museum . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Transnationale Erinnerung an Auschwitz und den Holocaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Das Auschwitz Memorial and Museum in den Social Media . 3.1.2.1. Das Museum Auschwitz auf Facebook . . . . . . . . 3.1.2.2. Das Museum Auschwitz auf Twitter . . . . . . . . . 3.1.2.3. Das Museum Auschwitz auf Pinterest . . . . . . . . 3.1.2.4. Das Museum Auschwitz auf Instagram . . . . . . . . 3.1.3. Ergebnisse: Das Auschwitz Memorial and Museum in den Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Das Anne Frank Haus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Erinnerungsdiskurse: Anne Frank und der Holocaust . . . . 3.2.2. Das Anne Frank Haus in den Social Media . . . . . . . . . .
113 114 115 132 133 169 183 195 209 216 218 230
6
Inhalt
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
231 257 268 273 280 285
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
291 293 294 312 312 330 344 366 396 401 402 413 413 422 439 457 476 482
5. Historische Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus in den Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Die Novemberpogrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Die Novemberpogrome in deutschen Erinnerungskulturen 5.1.2. Die Novemberpogrome auf @9Nov38 . . . . . . . . . . . . 5.1.3. Ergebnisse: Die Novemberpogrome auf @9Nov38 . . . . . 5.2. »The Blitz« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. »The Blitz« in britischen Erinnerungskulturen . . . . . . . 5.2.2. »The Blitz« auf @RealTimeWWII . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3. Ergebnisse: »The Blitz« auf @RealTimeWWII . . . . . . . 5.3. Ergebnisse: Historische Ereignisse in den Social Media . . . . .
. . . . . . . . . .
487 488 489 500 518 522 523 529 546 549
3.2.2.1. Das Anne Frank Haus auf Facebook . . . . . . 3.2.2.2. Das Anne Frank Haus auf Twitter . . . . . . . 3.2.2.3. Das Anne Frank Haus auf Pinterest . . . . . . . 3.2.2.4. Das Anne Frank Haus auf Instagram . . . . . . 3.2.3. Ergebnisse: Das Anne Frank Haus in den Social Media 3.3. Ergebnisse: Erinnerungsorte in den Social Media . . . . . . . 4. Historische Personen der Zeit des Nationalsozialismus in den Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Claus Stauffenberg: Der Widerstandskämpfer . . . . . . . 4.1.1. Erinnerungsdiskurse zu Claus Stauffenberg . . . . 4.1.2. Claus Stauffenberg in den Social Media . . . . . . . 4.1.2.1. Claus Stauffenberg auf Facebook . . . . . . 4.1.2.2. Claus Stauffenberg auf Twitter . . . . . . . 4.1.2.3. Claus Stauffenberg auf Pinterest . . . . . . 4.1.2.4. Claus Stauffenberg auf Instagram . . . . . . 4.1.3. Ergebnisse: Claus Stauffenberg in den Social Media 4.2. Irma Grese: Die Täterin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Erinnerungsdiskurse zu Irma Grese seit 1945 . . . 4.2.2. Irma Grese in den Social Media . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Irma Grese auf Facebook . . . . . . . . . . 4.2.2.2. Irma Grese auf Twitter . . . . . . . . . . . . 4.2.2.3. Irma Grese auf Pinterest . . . . . . . . . . . 4.2.2.4. Irma Grese auf Instagram . . . . . . . . . . 4.2.3. Ergebnisse: Irma Grese in den Social Media . . . . 4.3. Ergebnisse: Historische Personen in den Social Media . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Inhalt
6. Schlussbetrachtung: Erinnerungskulturen in den Social Media . . . .
553
7. Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Quellen- und Literaturverzeichnis . . . 7.1.1. Untersuchte Social-Media-Seiten 7.1.2. Forschungsliteratur . . . . . . . . 7.1.3. Presseartikel . . . . . . . . . . . . 7.1.4. Spielfilme . . . . . . . . . . . . . 7.1.5. Ungedruckte Quellen . . . . . . . 7.2. Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . .
571 571 571 578 656 661 662 663
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Vorwort
Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die leicht überarbeitete Fassung des Textes, den ich im Mai 2018 unter dem Titel »Geschichte im Social Web. Historische Orte, Personen und Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram« als Dissertationsschrift bei der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) eingereicht habe. Die Disputation fand im Februar 2020 statt. Begutachtet wurde die Dissertation von Frau Prof. Dr. Charlotte Bühl-Gramer (Universität Erlangen-Nürnberg), Herrn Prof. Dr. Andreas Michler (Universität Passau) und Frau Prof. Dr. Astrid Schwabe (Universität Flensburg). Ich danke allen für ihre Mühen herzlich. Dank gilt auch dem Vorstand der »Konferenz für Geschichtsdidaktik. Verband der Geschichtsdidaktikerinnen und Geschichtsdidaktiker Deutschlands e. V.« für die Aufnahme der Schrift in die Reihe »Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik« und die damit einhergehende finanzielle Unterstützung der Drucklegung. Ebenfalls danke ich der »Stiftung Zeitlehren« für die finanzielle Förderung der Drucklegung. Besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Charlotte Bühl-Gramer. Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen, das sich stets in einem in vielerlei Hinsichten großzügig gewährten Freiraum zum Denken und Forschen ausgedrückt hat, für die jederzeit für mich buchstäblich offen stehende Tür, für die intensive Förderung, die freundliche Forderung und für die Unterstützung bei diesem Projekt sowie bei vielem darüber hinaus! Die Dissertation ist während meiner Tätigkeit am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte (FAU) als wissenschaftlicher Mitarbeiter entstanden. Ich bedanke mich für die großartige Unterstützung durch das Lehrstuhlteam bei Marlene Krause, Nadja Bennewitz, Dr. Gesa Büchert, Karin Weinzierl, Katja Zapf, Patrick Blos und Benedikt Ziegler. Auch Philipp Bernhard (Universität Augsburg) und Dr. Felix Eiffler (Universität Greifswald) danke ich für die Anregungen und Impulse. In meinem Freundeskreis fand ich ebenfalls vielfältige Unterstützung.
10
Vorwort
Ich bedanke mich in besonderem Maße bei Franz Diwischek, Bernd Albrecht und Sören Priebe. Das erfolgreiche Abschließen eines Promotionsprojektes kann nie ohne langjährige Unterstützung durch die Familie gelingen. Ich bedanke mich bei meinen Eltern Holger und Sabine, bei meinem Bruder Henry und seiner Familie, bei meiner Oma Ruth, bei Stefan Senior und Maria, bei Stefan Junior sowie in besonderer Weise bei Hanne und Helena. Hannes Burkhardt
Ueckermünde im Sommer 2020
1.
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Was auf irgendeinem Weg ins Internet gelangt ist, wird mit dem bloßen Verstreichen der Zeit nicht mehr dekomponiert und kann auch nicht mehr geschreddert werden. Es ist unbemerkt hinübergeglitten in das universale Online-Archiv der Menschheit, […].1
Das Internet ist das Massenmedium2 des 21. Jahrhunderts3 und unterscheidet sich als solches erheblich von anderen Massenmedien der Menschheitsgeschichte: Denn zum einen hat das Internet in maßgeblich größerem Umfang als vorherige Massenmedien als zentrales Charakteristikum eine erhebliche Speicherfunktion inne.4 Zum anderen handelt es sich beim Internet um ein »individualisiertes Massenmedium, das an den üblichen Institutionen der Veröffentlichung und Verbreitung vorbeigeht«5, wie es Aleida Assmann treffend beschreibt. Das neue am Internet ist, dass es die Differenz zwischen privaten und öffentlichen Räumen aufbricht und jeder6 Einzelne seine eigenen Öffentlichkeiten herstellen kann.7 Das Massenmedium Internet kann auch als ein unübersichtliches globales Speichersystem verstanden werden, das private und öffentliche, individuelle und kollektive Erinnerungen vernetzt, transportiert, 1 Assmann, Aleida: Formen des Vergessens. Göttingen 2016. S. 203. 2 Vgl. Schwabe, Astrid: Historisches Lernen im World Wide Web: Suchen, flanieren oder forschen? Fachdidaktisch-mediale Konzeption, praktische Umsetzung und empirische Evaluation der regionalhistorischen Website Vimu.info. Göttingen 2012. S. 88–91. 3 94 % (66,4 Mio.) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren (insgesamt 70,6 Mio.) nutzen das Internet zumindest gelegentlich. Vgl. Beisch, Natalie / Schäfer, Carmen: Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2020 Internetnutzung mit großer Dynamik: Medien, Kommunikation, Social Media. in: Media Perspektiven 25 (2020). Heft 9. S. 462–841, hier S. 463. URL: https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/0920_Beisch_Schaefer.pdf vom 01.11. 2020 (Zugriff am 05. 12. 2020). 4 Vgl. A. Assmann 2016, S. 203. 5 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006. S. 244. 6 Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen wird im Text insgesamt verzichtet. Jedes grammatikalische Genus bezieht bei konkreten oder allgemeinen Personenbezeichnungen immer alle biologischen und gesellschaftlichen Geschlechter ein. 7 Vgl. Assmann 2006, S 244.
12
Einleitung: Geschichte in den Social Media
präsentiert und speichert.8 Web 2.0.-Technologien und Social-Media-Angebote haben diese Charakteristika digitaler Online-Medien noch weiter potenziert und ausdifferenziert und zudem die Grenzen zwischen Produzent*innen und Rezipient*innen erheblich weiter aufgebrochen. Das Internet wird dabei auch zum Gedächtnis- und Erinnerungsmedium und etabliert neue Formen der kollektiven Erinnerung, wie neben Aleida Assmann v. a. Claus Leggewie9 und Erik Meyer10 wirksam und nachhaltig in die Forschungsdiskussion eingebracht haben. Erik Meyer prägte den Begriff der Erinnerungskultur 2.0, die sich dadurch auszeichne, dass eine prinzipiell unbegrenzte Anzahl personalisierender Darstellungen von Geschichte realisiert werden könnten, was eine starke Individualisierung, Fragmentierung und Subjektivierung von Geschichte zur Folge habe und Historiker*innen an Relevanz verlieren lasse.11 Claus Leggewie ergänzte, eine Erinnerungskultur 2.0 bedeute auch, dass zunehmend individuelle und auch inkommensurable und idiosynkratische Geschichten erzählt würden, die sich nur schwer unter ein stringentes historisches Paradigma subsumieren ließen.12 Auch Rosmarie Beier konstatiert, dass Erinnerung in den Neuen Medien subjektiv, ungeordnet und eigensinnig sei und äußerte die Befürchtung, dass die Geschichtswissenschaft als Fachdisziplin trotz ihres methodisch-analytischen Instrumentariums und ihres Anspruchs größtmöglicher Objektivität unter Einbeziehung möglichst aller zugänglichen historischen Quellen womöglich mit den Möglichkeiten des Erinnerns via neuer Technologien ihre Interpretations- und Darstellungsautorität verlieren könne.13 Dem muss man an dieser Stelle zuallererst entgegenhalten, dass die Geschichtswissenschaft durchaus in erheblichem Maß online mit innovativen Konzepten vertreten ist.14 Längst hat sich das Internet als Ort der Auseinan8 Worcman, Karen / Garde-Hansen, Joanne: Social memory technology. Theory, practice, action. New York 2016. S. 37; Vgl. Reading, Anna: The Globytal: Towards an Understanding of Globalised Memories in the Digital Age. in: Maj, Anna / Riha, Daniel (Hrsg.): Digital memories. Exploring critical issues. Oxford 2009. S. 31–40. 9 Vgl. Leggewie, Claus: Zur Einleitung: Von der Visualisierung zur Virtualisierung des Erinnerns. in: Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009. S. 9–28. 10 Vgl. Meyer, Erik: Erinnerungskultur 2.0? Zur Transformation kommemorativer Kommunikation in digitalen, interaktiven Medien. in: Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009c. S. 175–206. 11 Vgl. Meyer 2009c, S. 209. 12 Vgl. Leggewie 2009, S. 22. 13 Beier, Rosmarie: Geschichte, Erinnerung und Neue Medien. Überlegungen am Beispiel des Holocaust. in: Beier, Rosmarie (Hrsg.): Geschichtskultur in der zweiten Moderne. Frankfurt am Main 2000. S. 299–323, hier S. 315. 14 Vgl. Haber, Peter: Digital past. Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. München 2011. S. 123–150.
Einleitung: Geschichte in den Social Media
13
dersetzung mit Geschichte etabliert, an dem Forschungseinrichtungen, Museen und Gedenkstätten ihre Deutungsangebote publizieren und neben journalistischen und privaten Anbieter*innen ihre Beiträge an Erinnerungskulturen15 leisten. Insbesondere die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust wird online transnational breit und massenwirksam erzählt und vermittelt.16 Wolfram Dornik hat dies Mitte der 2000er Jahre für österreichische Websites des »Web 1.0« mit einem Ergebnis erforscht, das Meyer und Leggewie in vielem bestätigt: Die Ausdifferenzierung von Gedächtnis und Erinnerung in Form von Individualisierung, Subjektivierung, Heterogenisierung, Universalisierung und Hybridität waren zentrale Ergebnisse seiner Studie.17 Dörte Hein erforschte Ende der 2000er Jahre ebenfalls Websites des »Web 1.0« zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust18 im gesamten deutschsprachigen Raum und konnte nachweisen, dass sich online keine losgelösten Wege der Vermittlung der nationalsozialistischen Vergangenheit etablieren, sondern dass Erinnerungskulturen über die nationalsozialistische Vergangenheit im Internet Diskurse aus anderen Medien aufgreifen und ergänzen.19 Niemand wird heute bestreiten, dass digitale Online-Medien die Gegenwart der individuellen und gesellschaftlichen Kommunikation entscheidend prägen. Ebenso beeinflussen digitale Online-Medien heute zunehmend das Verständnis von Geschichte. Die Relevanz des Internets für die Vergegenwärtigung von Vergangenheit kann heute kaum überschätzt werden.
15 Eine Problematisierung des Begriffs aus geschichtsdidaktischer Perspektive in Hinblick auf das Konzept der Geschichtskultur erfolgt ausführlich im Kapitel 2.1.1. Geschichtsdidaktik als Kulturwissenschaft. 16 Vgl. Kansteiner, Wulf: Genocide memory, digital cultures, and the aesthetization of violence. in: Memory Studies 7 (2014). Heft 4. S. 403–408; ders.: Transnational Holocaust Memory, Digital Culture and the End of Reception Studies. in: Sindbæk Andersen, Tea / Törnquist Plewa, Barbara (Hrsg.): The twentieth century in European memory. Transcultural mediation and reception. Leiden, Boston 2017. S. 305–343; ders.: The Holocaust in the 21st Century: Digital Anxiety, transnational Cosmopolitanism, and Never Again Genocide Without Memory. in: Hoskins, Andrew (Hrsg.): Digital memory studies. Media pasts in transition. New York 2018. S. 110–140; Pfanzelter, Eva: At the crossroads with public history: mediating the Holocaust on the Internet. in: Holocaust Studies 21 (2015). Heft 4. S. 250–271. 17 Vgl. Dornik, Wolfram: Erinnerungskulturen im Cyberspace. Eine Bestandsaufnahme österreichischer Websites zu Nationalsozialismus und Holocaust. Berlin 2004; Dornik, Wolfram: Internet: Maschine des Vergessens oder globaler Gedächtnisspeicher? Der Holocaust in den digitalen Erinnerungskulturen zwischen 1990 und 2010. in: Paul, Gerhard / Schossig, Bernhard (Hrsg.): Öffentliche Erinnerung und Medialisierung des Nationalsozialismus. Eine Bilanz der letzten dreißig Jahre. Göttingen 2010. S. 79–97. 18 Hein, Dörte: Erinnerungskulturen online. Angebote, Kommunikatoren und Nutzer von Websites zu Nationalsozialismus und Holocaust. Konstanz 2009a. 19 Vgl. Hein 2009a, S. 254.
14
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Umso mehr verwundert es, dass die Geschichtsdidaktik die zentrale Rolle des Massenmediums Internet für wirkungsmächtige Geschichtsvorstellungen verhältnismäßig spät erkannt hat. Denn zur gleichen Zeit, als Meyer, Leggewie, Dornik und Hein bereits ihre wegbereitenden Studien vorlegten, war im Jahr 2009 auf der 18. Zweijahrestagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik in Bonn dieser erschreckende Befund zu hören: »Die moderne Geschichtsdidaktik nimmt die erinnerungskulturelle Bedeutung […] des Internets noch viel zu wenig wahr und ernst«20. Erst vier Jahre später gründete sich auf der 20. Zweijahrestagung im September 2013 der Arbeitskreis »Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik«.21 Die geschichtsdidaktische Forschung hat sich ohne Frage auf dem Forschungsfeld des historischen Lernens mit digitalen Medien sehr verdient gemacht, während bis heute allerdings nur sehr vereinzelt Forschungen zur geschichtsund erinnerungskulturellen Dimension des Mediums Internet vorlegt worden sind, die keine normative oder pragmatische Perspektive in Bezug auf historisches Lernen einnehmen, sondern eine rein empirisch-deskriptive Beschreibung versuchen, sodass hier ein erhebliches geschichtsdidaktisches Forschungsdesiderat zu konstatieren ist.22 Denn dass dem »World Wide Web […] eine immense geschichtskulturelle Bedeutung zuzuschreiben«23 ist, ist zwar im Fach erkannt worden, doch Studien, die Geschichts- oder Erinnerungskulturen im Internet ergründen, sind bis heute sehr dünn gesät, während geschichtsdidaktische Studien, die Geschichte in den Social Media wissenschaftlich analysieren, neben den eigenen Arbeiten24 kaum zu finden sind. Dies verwundert erst recht, wenn man 20 Paul, Gerhard: Einführung in die Sektion Zeitgeschichte in Film und Fernsehen. in: Popp, Susanne (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – historische Bildung. Göttingen 2010. S. 193–200, hier S. 194. 21 Vgl. Pallaske, Christoph: Der Arbeitskreis »Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik« startet mit 20 Mitgliedern | Bericht von der konstituierenden Sitzung in Göttingen, 27. 9. 2013. in: Blog Arbeitskreis Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik 2013. URL: http://dwgd.hypothese s.org/65 vom 28. 9. 2013 (Zugriff am 30. 08. 2017). 22 Ein ausführlicher Forschungsbericht folgt ab S. 22. 23 Schwabe 2012, S. 17. 24 Burkhardt, Hannes: Erinnerungskulturen Social Web. Auschwitz und der Europäische Holocaustgedenktag auf Twitter. in: Danker, Uwe (Hrsg.): Geschichtsunterricht – Geschichtsschulbücher – Geschichtskultur. Aktuelle geschichtsdidaktische Forschungen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mit einem Vorwort von Thomas Sandkühler. Göttingen 2017. S. 213–246; Burkhardt, Hannes: Irma Grese im Social Web. Genderspezifische Geschichtsnarrative auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram. in: Bennewitz, Nadja / Burkhardt, Hannes (Hrsg.): Gender in Geschichtsdidaktik und Geschichtsunterricht. Neue Beiträge zu Theorie und Praxis. Berlin u. a. 2016b. S. 235–260; Burkhardt, Hannes: Digitale Erinnerungskulturen im Social Web. Personen des »Dritten Reichs« auf Facebook am Beispiel von Claus Stauffenberg, Sophie Scholl und Erwin Rommel. in: Henke-Bockschatz, Gerhard (Hrsg.): Neue geschichtsdidaktische Forschungen. Aktuelle Projekte. Göttingen 2016a. S. 163–188; Burkhardt, Hannes: Geschichte im Social Web. Geschichtsnarrative und Erinnerungsdiskurse auf Facebook und Twitter mit dem kulturwissenschaftlichen Medien-
Einleitung: Geschichte in den Social Media
15
bedenkt, dass heute 46 % der 12- bis 19-Jährigen Instagram als liebstes digitales Angebot in der mobile Nutzung nennen.25 Jedoch wissen wir heute kaum etwas darüber, wie und von wem Geschichte in den Social Media erzählt wird, obwohl mit geschichtsvermittelnden Social-Media-Angeboten Millionen von Menschen täglich erreicht werden.26 Bevor wir im Fach aber sinnvoll darüber nachdenken können, wie man eine geschichtskulturelle Kompetenz als »Fähigkeit, sich mit wissenschaftlichen, rhetorischen, imaginativen, ästhetischen und diskursiven Formen gegenwärtiger Darstellung von Geschichte auseinanderzusetzen«27 in Bezug auf Social Media nachhaltig im Geschichtsunterricht fördern kann, müssen wir verstehen, wie und von wem Geschichte hier erzählt und vermittelt wird. Die vorliegende Arbeit möchte einen ersten Schritt zum Verständnis dieser Konstruktionsprozesse leisten und ist damit in den Bereich der geschichtsdidaktischen Grundlagenforschung einzuordnen und konnte sich daher sowohl theoretisch als auch methodisch und inhaltlich kaum auf die Schultern von »geschichtsdidaktischen Riesen« stellen. Diese Studie ist im besten Sinne eine geschichtsdidaktische. Nicht zuletzt deshalb, weil sie im Zentrum der wohl meist zitierten geschichtsdidaktischen Kernfrage verortet ist, die Karl-Ernst Jeismann 1977 formulierte und nach der die Geschichtsdidaktik nach »dem ständigen Um- und Aufbau historischer Vorstellungen, der stets sich erneuernden und verändernden Rekonstruktion des Wissens von der Vergangenheit«28 fragt. Jeismann hat hier grundlegend Fragestellungen und Forschungsfelder des Faches definiert, die bis heute nicht an Gültigkeit verloren haben. Jeismanns Grundgedanken folgend, ist die mediale Vermittlung von Geschichte spätestens seit Beginn der 1990er Jahre zu einem zentralen Aufgabenfeld der Geschichtsdidaktik geworden.29 Dies lässt sich auch
25 26 27 28
29
begriff »Medium des kollektiven Gedächtnisses« analysieren. in: Pallaske, Christoph (Hrsg.): Medien machen Geschichte. Neue Anforderungen an den geschichtsdidaktischen Medienbegriff im digitalen Wandel. Berlin 2015. S. 99–114; Burkhardt, Hannes: Anne Frank auf Facebook – Erinnerungskulturen im Social Web zwischen Trivialisierung und innovativer Erinnerungsarbeit. in: Seibert, Peter / Pieper, Jana / Meoli, Alfonso (Hrsg.): Anne Frank: Mediengeschichten. Berlin 2014a. S. 136–163. Vgl. Rathgeb, Thomas / Schmid, Thomas: Jim Studie 2019. Jugend, Information, Medien. Stuttgart 2020. S. 28. Alleine die Facebookseite @annefrankauthor erreicht über 2,5 Millionen Menschen. URL: https://www.facebook.com/annefrankauthor/ (Zugriff am 1. 9. 2017). Vgl. Pandel, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis. Schwalbach/ Ts. 2013. S. 237. Jeismann, Karl-Ernst: Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft von Zustand, Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverständnis der Gegenwart. in: Jeismann, Karl-Ernst / Rüsen, Jörn / Vierhaus, Rudolf / Kosthorst, Erich (Hrsg.): Geschichtswissenschaft. Didaktik – Forschung – Theorie. Göttingen 1977. S. 9–33, hier S. 12. Vgl. Sauer, Michael: Zeitgeschichte – Medien – Historische Bildung. Einführung in das Tagungsthema. in: Popp, Susanne (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – historische Bildung. Göttingen 2010. S. 25–38, hier S. 30.
16
Einleitung: Geschichte in den Social Media
an der theoretischen Ausformung des Begriffs der Geschichtskultur zu diesem Zeitpunkt festmachen, den zu allererst Jörn Rüsen30 prägte und der schnell zu einem »Leitbegriff der Disziplin«31 aufstieg.32 Michel Sauer hatte auf der Zweijahrestagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik 2009 zum Thema »Zeitgeschichte – Medien – Historische Bildung« vier Aufgabenfelder der geschichtsdidaktischen Forschung auf dem Feld der Geschichtskultur vorgeschlagen: erstens »die Analyse geschichtskultureller Phänomene und Diskurse in Vergangenheit und Gegenwart«, zweites die Untersuchung »geschichtskulturelle[r] Formate und Angebote« wie »einschlägige[n] mediale[n] Formate von der Fernsehdokumentation bis zum Computerspiel«, drittens die empirische Erforschung »einschlägige[r] Prozesse der Rezeption geschichtskultureller Angebote« und viertens die »Vermittlung von […] ˏgeschichtskultureller Kompetenzˊ«.33 Bezogen auf das Medium World Wide Web sieht es Astrid Schwabe im Bereich der Pragmatik als Aufgabe der Geschichtsdidaktik an, Konzepte zu entwickeln, die die Analyse von Angeboten im Web mit Bezug zu Themen des Geschichtsunterricht sinnvoll zur Kompetenzförderung einsetzen,34 während es ebenfalls Aufgabe der Geschichtsdidaktik sei, »aus ihrer Theorie und ihren empirischen und pragmatischen Erkenntnissen spezifisch geschichtsdidaktische Ansprüche an webbasierte geschichtskulturelle Angebote [zu] formulieren […].«35 Die hier vorliegende Studie verortet sich ausdrücklich weder im Bereich der pragmatischen noch der normativen Geschichtsdidaktik; weder sollen hier pragmatische Konzepte zur Förderung von geschichtskulturellen oder anderen Kompetenzen entwickelt, noch normative Vorgaben zur Gestaltung von Social Media formuliert werden. Diese Untersuchung verfolgt einen rein empirisch-deskriptiven Ansatz, der existierende Online-Angebote mit Bezug zu historischen Kontexten in Hinblick auf die präsentierten Geschichtsnarrationen und die medialen Produktionsumstände untersucht.36 Dabei wird 30 Vgl. Rüsen, Jörn: Geschichtsdidaktik heute – Was ist und zu welchem Ende betreiben wir sie (noch). in: Geschichte lernen (1991). Heft 21. S. 14–20; Rüsen, Jörn: Was ist Geschichtskultur? in: Füssmann, Klaus / Grütter, Heinrich Theodor / Rüsen, Jörn (Hrsg.): Historische Faszination. Geschichtskultur heute. Köln 1994. S. 3–26. 31 Vgl. Sauer 2010, S. 30. 32 Ausführliche Ausführungen dazu bei Schönemann, Bernd: Geschichtsdidaktik und Geschichtskultur. in: Mütter, Bernd / Schönemann, Bernd / Uffelmann, Uwe (Hrsg.): Geschichtskultur. Theorie-Empirie-Pragmatik. Weinheim 2000. S. 26–58. 33 Sauer 2010, S. 31–33. 34 Vgl. Schwabe 2012, S. 18. 35 Schwabe 2012, S. 19. 36 Vgl. Schwabe 2012, S. 18; Körber, Andreas: Neue Medien und Informationsgesellschaft als Problembereich geschichtsdidaktischer Forschung. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 1 (2002). S. 165–181, hier S. 171; Hardtwig, Wolfgang / Schug, Alexander: Einleitung. in: Hardtwig, Wolfgang / Schug, Alexander (Hrsg.): History sells! Stuttgart 2009. S. 9–17, hier S. 12; Schreiber, Waltraud: Geschichtskultur – eine Herausforderung für den Geschichtsun-
Erkenntnisinteresse und leitende Fragestellungen
17
weder der Produktions- noch der Rezeptionsprozess untersucht, sondern ausschließlich das medial angebotene Material analytisch durchleuchtet, sodass man diese Studie in den ersten beiden von Sauer definierten Arbeitsfeldern verorten kann.
Erkenntnisinteresse und leitende Fragestellungen Das diese Studie leitende Erkenntnissinteresse will konkrete Erinnerungskulturen in den Social Media zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust analytisch fassen und beschreiben. Dieses Erkenntnissinteresse spaltet sich in zwei voneinander zu trennende Aspekte und Fragestellungen auf: Erstens fragt diese Untersuchung nach Erinnerungsdiskursen, die spezifische Narrative ausgebildet haben und die sich in konkreten Narrationen in den Social Media manifestieren. Die konkrete Fragestellung lautet: Welche Diskurse, die sich seit 1945 innerhalb von wirkungsmächtigen und populären Erinnerungskulturen etabliert und einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis haben, sind in den Social Media innerhalb von Geschichtsnarrationen nachweisbar? Ebenso Teil dieses ersten zu erforschenden Aspektes ist die Frage nach den Transformationsprozessen auf der Ebene des Diskurses. Die zweite leitende Fragestellung geht in Anlehnung an Dörte Hein davon aus, dass die Kontextualisierung von Nationalsozialismus und Holocaust in den Social Media auch als ein kommunikativer Erinnerungsprozess verstanden werden muss: Um die sich in den Social Media etablierenden Erinnerungskulturen beschreiben zu können, müssen das Gedächtnismedium analysiert und die zugrundeliegenden Kommunikationsprozesse beschrieben werden.37 Hierbei müssen der Kommunikationsprozess und die diesen bestimmende Materialität des Mediums in zweifacher Hinsicht beachtet werden: Zum einen in Bezug auf den Kommunikationsprozess aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht und zum anderen aus gedächtnistheoretischer Sicht in Bezug auf den kollektiven Erinnerungsprozess. Eine Analyse muss daher die Medialität von Erinnerung sowie deren soziale Rahmung und die Materialität von Medien mit ihren Praktiken, Merkmalen und Funktionen berücksichtigen. Damit ist der zweite Teil der Fragestellung dieser Untersuchung aufgerissen: Welche medienspezifischen Einflüsse prägen in materiell-medialer und in sozial-kommunikativer Hinsicht terricht? in: Baumgärtner, Ulrich / Schreiber, Waltraud (Hrsg.): Geschichts-Erzählung und Geschichts-Kultur. Zwei geschichtsdidaktische Leitbegriffe in der Diskussion. München 2001. S. 99–136, hier S. 101–102. 37 Vgl. Hein, Dörte: Virtuelles Erinnern. in: Aus Politik und Zeitgeschichte (2010). Heft 25–26. S. 23–29, hier S. 29. URL: http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erin nerung/39866/virtuelles-erinnern vom 21. 6. 2010 (Zugriff am 28. 08. 2017).
18
Einleitung: Geschichte in den Social Media
die Geschichtsnarrationen und wie transformieren diese die beinhaltenden diskursiven Erinnerungsmuster und -praktiken? Beide Forschungsfragen stehen jedoch nicht gleichberechtig nebeneinander, sondern sind hierarchisch angeordnet. Ausgangspunkt der Analyse ist die Frage nach etablierten und wirkungsmächtigen Diskursen in den angebotenen Geschichtsnarrationen. Dem nachgeordnet ist die Frage nach der medialen Gestaltung der konkreten Geschichtsnarrationen in Folge der medienimmanenten Materialitäten und medientypischen Kommunikationsweisen. Diese Hierarchisierung ergibt sich aus der wissenschaftlichen Perspektive, die zwar in ihrer theoretischen und methodischen Grundlegung eine interdisziplinäre sein muss, aber dennoch aus dem Fach der Geschichtsdidaktik heraus entwickelt wird, deren Expertise stärker in der Identifizierung historischer Diskurse und der Analyse der konkreten Narrationen nach Aspekten der historischen und erinnerungskulturellen Verhaftung liegt. Die Studie folgt der Annahme, dass Erinnerungskulturen in den Social Media nur adäquat beschrieben werden können, wenn zum einen etablierte und wirkungsmächtige erinnerungskulturelle Diskurse offengelegt und zum anderen die transformativen Einflüsse des Gedächtnismediums auf die angebotenen Geschichtsnarrationen beschrieben werden.
Forschungsfeld Das Forschungsfeld dieser Studie sind Social Media. Dieses gilt es noch weiter auszudifferenzieren, in medialer Hinsicht in Bezug auf konkrete Plattformen und in historischer Hinsicht in Bezug auf konkrete historische Kontexte. Untersucht werden die vier Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram. Die Dimensionierung der historischen Kontexte unterteilt sich in die drei titelgebenden Kategorien: historische Orte, Personen und Ereignisse. Zugleich werden durch diese drei Kategorien auch verschiedene Akteur*innen in den Social Media fokussiert. Bei den analysierten Orten handelt es sich um Orte der Erinnerung an die Geschichte des Holocaust, an denen Institutionen des kollektiven Gedächtnisses situiert sind. Es wurden zwei für die transnationale Holocausterinnerung zentrale Erinnerungsorte ausgewählt: Das Auschwitz Memorial and Museum38 in Os´wie˛cim (Polen) und das Anne Frank Haus in Amsterdam (Niederlande). Bezogen auf die Social-Media-Kanäle sind hier professionelle, etablierte Institutionen des kulturellen Gedächtnisses die dominanten
38 Wird im Folgenden immer kurz Museum Auschwitz genannt werden.
Forschungsfeld
19
Akteur*innen, auch wenn Privatpersonen auf den Social-Media-Seiten der Institutionen ebenfalls rezeptiv und produktiv agieren. Ausschließlich Privatpersonen sind auf den untersuchten Social-Media-Seiten die Akteur*innen in der zweiten Dimension der untersuchten historischen Kontexte: Personen. Hierfür wurden ebenfalls zwei Fallbeispiele ausgewählt: Zum einen Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg39, der heute national und international als der prominenteste Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Deutschland gelten kann. Als zweite Person wurde eine historische Person ausgewählt, die einerseits Claus Stauffenberg sowohl in Funktion, Rolle und Verhalten im NS-Regime als auch was soziale Merkmale angeht (Schicht, Bildung, Geschlecht), entgegensetzt ist, die aber andererseits ebenfalls eine etablierte und populäre Geschichte der Erinnerung entwickelt hat. Die Wahl fiel auf Irma Grese, die als außerordentlich brutale deutsche KZAufseherin in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen zu den bekanntesten weiblichen Täterfiguren zählen dürfte und die ebenfalls eine populäre und differenzierte Rezeptionsgeschichte etabliert hat. Als dritte Dimension für historische Kontexte wurde die Kategorie Ereignisse ausgewählt. Zum einen wurde die Remedialisierung eines Ereignisses im Herbst 1938 in den Social Media analysiert, das als Beginn40 des Holocaust gilt: die Novemberpogrome. Als zweites Fallbeispiel für historische Ereignisse in den Social Media wurde bewusst eine andere Art von Ereignis bestimmt, das sich zum einen direkt an das Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg bindet und das zum anderen eine nichtdeutsche nationale Perspektive im kollektiven Erinnern einnimmt. Gewählt wurde die Bombardierung Londons von September 1940 bis Mai 1941, die im engeren Sinne als »The Blitz« bezeichnet wird. In beiden Fallbeispielen erscheinen wiederum auf der Anbieter*innenseite weitere Akteur*innen: professionelle Historiker*innen, die zwar als Vertreter*innen der historischen Forschung aber dennoch als Privatpersonen agieren, also ohne inhaltliche und konzeptionelle Rückbindung an Richtlinien eines Social-Media-Managements einer etablierten Institution der Geschichtskultur. Die Studie ist in medialer Hinsicht, bezogen auf konkrete Plattformen, in historischer Hinsicht, bezogen auf die gewählten historischen Kontexte, und im Hinblick auf die Akteur*innen sehr breit angelegt, was einen erheblichen Einfluss auf die Wahl der analytischen Methodik hatte.41 Der Datenkorpus umfasst 153 Social-Media-Seiten und 79.051 39 Wird im Folgenden immer kurz Claus Stauffenberg genannt werden. 40 Vgl. Benz, Wolfgang: Einleitende Bemerkungen. in: Benz, Wolfgang (Hrsg.): Der Novemberpogrom 1938 in der deutschen Erinnerungskultur. Themenheft der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 61 (2013). Heft 11. Berlin 2013. S. 885–887, hier S. 887. 41 Es wurde sich gegen eine (Online-)Inhaltsanalyse wie bei Kolpatzik 2017 zugunsten eines diskusanalytischen Zugriffs entschieden, um der Masse an Daten mit diesem im Vergleich zu inhaltsanalytischen offenen methodischen Verfahren zu begegnen; ausführlicher beschrieben
20
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Beiträge (exklusive Kommentare, Antworten, Teilungen), die – allerdings in unterschiedlich starkem Maße – in die Auswertung eingeflossen sind. Insgesamt wurden damit – gemessen an den Follower*innenzahlen – 1.464.380 Personen erreicht.
Aufbau der Studie Die eben erläuterten Fragestellungen und Forschungsfelder drücken sich unmittelbar im Aufbau dieser Studie aus. Auf dieses Kapitel 1. Einleitung: Geschichte in den Social Media folgt die systematische Darlegung der theoretischen und methodischen Zugänge zum Forschungsmaterial im Kapitel 2. Zugänge und Grundlagen. Der in dieser Arbeit zu entwerfende Begriff von Erinnerungskulturen in den Social Media ist eine Anlehnung und konsequente Fortsetzung der Begriffe der Erinnerungskulturen im Cyberspace42 von Wolfram Dornik, der Erinnerungskulturen online43 von Dörte Hein und der Erinnerungskultur 2.044 von Erik Meyer. Erinnerung wird hier als der Gebrauch des Gedächtnisses verstanden, als prozesshafte, dynamische Aneignung von Vergangenheit in kommunikativen, medialen Diskursen, in denen sich Erinnerungskulturen konstituieren. Nur diese Erinnerungskulturen lassen sich analytisch fassen. Die theoretischen Grundlagen dieser Untersuchung werden im Kapitel 2.1. Theoretische Zugänge offengelegt. Das Kapitel 2.1.1. Geschichtsdidaktik als Kulturwissenschaft zeigt, warum ausgehend vom Erkenntnissinteresse dieser Studie die Perspektive einer sich als Kulturwissenschaft verstehenden Geschichtsdidaktik gewählt wurde, die die kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien aufgenommen und rezipiert hat. Das Kapitel 2.1.2. Gedächtnistheorien und der Begriff der Erinnerungskulturen erläutert, warum u. a. Jan Assmanns Begriff des kulturellen Gedächtnisses, der Gedächtnis und Erinnerung als kulturelle Phänomene begreift, und die Konzeption von Erinnerungskulturen des Gießener Sonderforschungsbereichs 434, der eine differenzierte Theorie der Erinnerungskulturen entworfen hat, leitend für diese Studie sind. Um kollektive Erinnerungsprozesse in Erinnerungskulturen in den Social Media analytisch sichtbar und greifbar zu maim Kapitel 2.2. Methodische Zugänge. Vgl. Kolpatzik, Andrea: Zeitgeschichte wird gemacht. Geschichtskulturelle Analyse von Produktion, Vermittlung und Aneignung medialer Geschichtskonstruktionen im Web 2.0 am Beispiel von FAZ, Spiegel Online, ZDF. Schwalbach/ Ts. 2017. 42 Vgl. Dornik, Wolfram: Erinnerungskulturen im Cyberspace. Eine Bestandsaufnahme österreichischer Websites zu Nationalsozialismus und Holocaust. Berlin 2004. 43 Vgl. Hein, Dörte: Erinnerungskulturen online. Angebote, Kommunikatoren und Nutzer von Websites zu Nationalsozialismus und Holocaust. Konstanz 2009. 44 Vgl. Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009.
Aufbau der Studie
21
chen, braucht es einen Medienbegriff, der Medien von ihrer funktionalen Erinnerungsseite her definiert und beschreibt. Das Kapitel 2.1.3. Medientheoretische und -begriffliche Grundlagen erklärt u. a., warum Astrid Erlls Medienbegriff mit seinen verschiedenen Dimensionen und Komponenten dies leisten kann und deshalb sowohl in theoretischer als auch in methodisch-analytischer Hinsicht elementar für diese Studie ist. Außerdem werden für diese Studie grundlegende medientheoretische und -begriffliche Konzepte wie Web 2.0, Social Web, Social Media, Interaktivität oder Hypertextualität erläutert. Die konkreten in dieser Untersuchung zur Anwendung kommenden Forschungsmethoden beschreibt das Kapitel 2.2. Methodische Zugänge. An dem zu untersuchenden Gegenstand in medialer Hinsicht ausgerichtet ist die gewählte methodische Rahmung als SocialMedia-Monitoring des Fünf-Phasenmodells von Oliver Plauschinat und Florian Klaus, das im Kapitel 2.2.1. Der methodische Rahmen: Social-Media-Monitoring erläutert wird. Da ein Hauptziel dieser Studie die Identifizierung von historischen Erinnerungsmustern in Form diskursiver Strukturen ist, wurde das SocialMedia-Monitoring um eine diskursanalytische Methode erweitert, sodass im Kapitel 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN) der Einsatz der Diskursanalytischen Mehrebenenanalyse (DIMEAN) nach Ingo Warnke und Jürgen Spitzmüller erläutert wird. Auf die Offenlegung der theoretischen und methodischen Zugänge und Grundlagen folgt die Darstellung der Analyseergebnisse. Das Kapitel 3. Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust in den Social Media fokussiert die Social-Media-Angebote des Museums Auschwitz und des Anne Frank Haus, während das Kapitel 4. Historische Personen der Zeit des Nationalsozialismus in den Social Media Remedialisierungen von Claus Stauffenberg und von Irma Grese analysiert. Kapitel 5. Historische Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus in den Social Media setzt sich mit den digitalen Erzählungen der Novemberpogrome und von »The Blitz« auseinander. Der Aufbau der sechs Unterkapitel zu den eben genannten historischen Kontexten folgt jeweils dem gleichen Muster: Ausgehend von der diese Untersuchung leitenden Zielstellung – die Offenlegung etablierter und wirkungsmächtiger erinnerungskultureller Diskurse und der transformativen Einflüsse des Gedächtnismediums auf die angebotenen Geschichtsnarrationen – werden jeweils in einem ersten Unterkapitel die Diskurse zunächst benannt und beschrieben, die v. a. die geschichtswissenschaftliche Forschung zu Erinnerungskulturen der jeweiligen historischen Kontexte als die dominanten identifiziert und beschrieben hat. Erst darauf folgt in einem zweiten Schritt die Darstellung der Analyseergebnisse der einzelnen Social-Media-Seiten auf den genannten vier Plattformen. In einem dritten Schritt wird dann immer eine Zusammenfassung der Ergebnisse der jeweiligen Analysen geliefert, sodass bereits an diesen Punkten der Untersuchung jeweils zentrale Ergebnisse zu Erinnerungskulturen in den
22
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Social Media zum Vernichtungslager Auschwitz, zum Anne Frank Haus, zu Claus Stauffenberg, zu Irma Grese, zu den Novemberpogromen und zu »The Blitz« vorliegen. Die Breite dieser Studie entfaltet ihr volles Potenzial dann im abschließenden Kapitel 6. Schlussbetrachtung: Erinnerungskulturen in den Social Media, wenn quer zu den Dimensionen der historischen Kontexte, zu den verschiedenen Social-Media-Plattformen und zu den unterschiedlichen Akteur*innen Thesen definiert werden, wie Erinnerungskulturen in den Social Media aus geschichtsdidaktischer Perspektive zu beschreiben sind.
Forschungsbericht Diese Einführung schließt mit einem pointierten Überblick des weiten Forschungsfeldes »Geschichte und Internet«. Dabei dominiert eine deutsche geschichtsdidaktische Perspektive, die sich immer stärker hin zu Fragestellung und Forschungsfeld dieser Studie zuspitzt, um das zu schließende Forschungsdesiderat des Fachs präzise zu identifizieren. Nimmt man zunächst die geschichtswissenschaftliche fachinterne Rezeption als Gradmesser, dann nennt der Historiker Peter Haber das Jahr 1995 als Zäsur, da hier die Potenziale des Webs erstmals im Fach der Geschichtswissenschaft flächendeckend zur Kenntnis genommen worden waren, wenn auch nur als »untergeordnetes Recherchierinstrument«45. Die folgenden geschichtswissenschaftlichen Publikationen46 der zweiten Hälfte 1990er Jahre47 sind geprägt von vergleichsweise technokratischen Handlungshinweisen und Linksammlungen, denen man anmerkt, dass die Expertise der Geschichtswissenschaft nicht in Fragen der elektronischen Datenverarbeitung liegt, während man inhaltliche Diskussionen, analytische Beschreibungen, normative Vorgaben oder kriti45 Haber, Peter: Geschichtswissenschaften im digitalen Zeitalter: eine Zwischenbilanz. in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 56 (2006). Heft 2. S. 168–183, hier S. 172. 46 Ausführlicher Forschungsüberblick bei Danker, Uwe / Schwabe, Astrid: Einleitung. in: Danker, Uwe / Schwabe, Astrid (Hrsg.): Historisches Lernen im Internet. Geschichtsdidaktik und neue Medien. Schwalbach/Ts. 2008. S. 9–12; Schwabe 2012, S. 24–35. 47 Vgl. Eder, Franz X.: Internet für Historiker/innen. in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 45 (1995). Heft 1 (Teil 1) / 2 (Teil 2). S. 145–149 (Teil 1), S. 325–330 (Teil 2); Mittag, Jürgen / Sahle, Patrick: Geschichte und Computer im Internet. Informationsgewinnung zwischen Chaos und Ordnung. in: Historical Social Research 21 (1996). Heft 2. S. 126–132; Schröder, Thomas A.: Historisch relevante Ressourcen in Internet und WorldWideWeb. Angebot, Bewertung und Ausblick. in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 44 (1996). Heft 3. S. 465–477; Ditfurth, Christian von: Internet für Historiker. Frankfurt am Main, New York 1997; Jenks, Stuart: Das Internet und die universitäre Lehre: Spielzeug, Werkzeug oder Teufelszeug? Ein Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Dozenten und seiner Studenten. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 49 (1998). Heft 1. S. 30–34; Jenks, Stuart / Tiedemann, Paul: Internet für Historiker. Eine praxisorientierte Einführung. Darmstadt 2000.
Forschungsbericht
23
schen Auseinandersetzungen bezüglich der Online-Angebote zu historischen Kontexten vergeblich sucht.48 Ausnahmen bilden die Arbeiten von Peter Horvath49 und Christina Arbogast50, da hier zumindest im Ansatz Reflektionen der Rückwirkungseffekte des Mediums auf Geschichtswissenschaft und -schreibung erkennbar sind. Nach der Jahrtausendwende nahmen Forschungen und Debatten in den Reihen der Geschichtswissenschaft in Monografien51, Sammel-52, Tagungsbänden53 und Zeitschriften54 erheblich zu, die normative Standards für Online-Angebote zu historischen Kontexten entwickelten und die Chancen und Grenzen digitaler Medien für das Fach differenziert diskutierten. Erstmals wurde hier auch die Frage nach Effekten des Vermittlungsmediums auf die historischen Inhalte stärker in den Blick genommen. Massenwirksame populäre Geschichtsdarstellungen im Internet wurden aber immer noch nur am Rande thematisiert55 und meist negativ56 konnotiert. Eine 48 Vgl. Samida, Stefanie: Wissenschaftskommunikation im Internet. Neue Medien in der Archäologie. Baden-Baden 2009. S. 17–18; Schwabe 2012, S. 27. 49 Vgl. Horvath, Peter: Geschichte online. Neue Möglichkeiten für die historische Fachinformation. Köln 1997. 50 Vgl. Arbogast, Christine: Neue Wahrhaftigkeiten oder das endgültige Ende der Geschichte? Historika auf CD-ROM. in: Geschichte und Gesellschaft 24 (1998). Heft 4. S. 633–647. 51 Vgl. Grosch, Waldemar: Geschichte im Internet. Tipps, Tricks und Adressen. Schwalbach/ Ts. 2002. 52 Vgl. Institut für Europäische Regionalforschung (Hrsg.): Geschichtswissenschaft und »Neue Medien«. Siegen 2000; Jenks, Stuart / Marra, Stephanie (Hrsg.): Internet-Handbuch Geschichte. Bern 2001; Nentwich, Michael: Cyberscience. Research in the age of the internet. Vienna 2003. 53 Vgl. Haber, Peter (Hrsg.): Geschichte und Internet. »raumlose Orte – geschichtslose Zeit«. Histoire et internet. »espaces sans lieux – histoire sans temps«. Zürich 2002; Epple, Angelika / Haber, Peter / Jucker-Kupper, Patrick (Hrsg.): Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Zürich 2005; Literaturverzeichnis Albrecht, Christoph / Thaller, Manfred / Haber, Peter u. a. (Hrsg.): Geschichte und Neue Medien in Forschung, Archiven, Bibliotheken und Museen. Berlin 2005; Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007; Jucker-Kupper, Patrick / Koller, Christophe / Ritter, Gerold (Hrsg.): Digitales Gedächtnis. Archivierung und die Arbeit der Historiker der Zukunft. Zürich 2004. 54 Vgl. Mruck, Katja / Gersmann, Gudrun (Hrsg.): New Media in the Humanities. Electronic Publishing and Open Access: Current State and Future Perspectives. Historical Social Research 29 (2004). Heft 1. Special Issue; Schnettger, Matthias: Wohin führt der Weg? Historische Fachzeitschriften im elektronischen Zeitalter. zeitenblicke 2 (2003). Heft 2; URL: http://ww w.zeitenblicke.de/2003/02/schnettger.htm (Zugriff am 30. 08. 2017); Crivellari, Fabio / Sandl, Marcus: Die Medialität der Geschichte. Forschungsstand und Perspektiven einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Geschichts- und Medienwissenschaften. in: Historische Zeitschrift 277 (2003). Heft 3. S. 619–654. 55 Vgl. Epple, Angelika: Verlinkt, vernetzt, verführt – verloren? Innovative Kraft und Gefahren der Online-Historiographie. in: Epple, Angelika / Haber, Peter / Jucker-Kupper, Patrick (Hrsg.): Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Zürich 2005. S. 15–32; Marra, Stephanie: Geschichtsangebote im Internet: Populäre Rezeption und wissenschaftliche Vermittlung. in: Epple, Angelika / Haber, Peter / Jucker-Kupper, Patrick (Hrsg.):
24
Einleitung: Geschichte in den Social Media
differenzierte Auseinandersetzung mit dem digitalen Vermittlungsmedium für massenwirksamen Geschichtserzählungen und den Rückwirkungseffekten, Potenzialen und Grenzen findet man anfangs der 2000er Jahre in den Arbeiten57 der Archäologin Stefanie Samida.58 Zunehmend wurden auch Fragen der Hochschuldidaktik und des E-Learnings von der Geschichtswissenschaft beleuchtet.59 Vergleichsweise spät beginnt in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre im Fach eine differenzierte und systematische Betrachtung der Effekte des digitalen, multi- und hypermedialen Mediums auf die konkreten Geschichts-
56
57
58 59
Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Zürich 2005. S. 131– 138. Vgl. Gersmann, Gudrun: Neue Medien und Geschichtswissenschaft. Ein Zwischenbericht. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 50 (1999). Heft 4. S. 239–249; Gersmann, Gudrun: Schöne Welt der bunten Bilder. Kritische Anmerkungen zur Geschichtsdarstellung in den Neuen Medien. in: Gemmeke, Claudia / John, Hartmut / Krämer, Harald (Hrsg.): Euphorie digital? Aspekte der Wissensvermittlung in Kunst, Kultur und Technologie. Bielefeld 2001. S. 105–119. Vgl. Samida, Stefanie: Wissenschaftskommunikation und Wissensvermittlung. Neue Medien in der Archäologie. in: Archäologische Informationen 28 (2005). Heft 1/2. S. 239–245; Samida, Stefanie: Wissenschaftskommunikation im Internet. Neue Medien in der Archäologie. München 2006. Zu diesem Schluss kommt auch Schwabe 2012, S. 28. Vgl. Epple, Angelika / Haber, Peter / Jucker-Kupper, Patrick (Hrsg.): Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Zürich 2005; Haber, Peter / Hodel, Jan: Was sucht das Internet in der Geschichte? Integration von neuen Medien in den universitären Geschichtsunterricht. Erfahrungen am Historischen Seminar der Universität Basel. in: Historische Sozialkunde 5 (2005). Heft 3. S. 15–21; Frass, Monika: Didaktik und Altertumswissenschaften im Internet. in: Historical Social Research 31 (2006). Heft 3. S. 267–278; Pfanzelter Sausgruber, Eva: Neue Medien in der Krise? Von der Online-Veranstaltung zur Online-Lehre. in: Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007. Berlin. S. 461–482; Schmale, Wolfgang / Gasteiner, Martin / Krameritsch, Jakob / Romberg, Marion: E-Learning Geschichte. Wien 2007; Hodel, Jan: Historische Online-Kompetenz. Informations- und Kommunikationstechnologie in den Geschichtswissenschaften. in: Pöppinghege, Rainer (Hrsg.): Geschichte lehren an der Hochschule. Reformansätze, Methoden, Praxisbeispiele. Schwalbach/Ts. 2007. S. 194–210; Geldsetzer, Sabine / Strothmann, Meret: Blende(n)d Lernen in Bochum. Integration von ELearning in den BA/MA-Studiengang Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. in: Pöppinghege, Rainer (Hrsg.): Geschichte lehren an der Hochschule. Reformansätze, Methoden, Praxisbeispiele. Schwalbach/Ts. 2007. S. 181– 193; Dittler, Ullrich: Online-Communities als soziale Systeme. Wikis, Weblogs und SocialSoftware im E-Learning. Münster, München u. a. 2007; Cornelißen, Christoph: Geschichtswissenschaft und Internet. Anmerkungen aus der Praxis von historischer Lehre und Forschung. in: Hartung, Olaf / Köhr, Katja (Hrsg.): Geschichte und Geschichtsvermittlung. Festschrift für Karl Heinrich Pohl. Gütersloh 2008. S. 125–145; Haber, Peter: E-Learning in den Geschichtswissenschaften. Ein kurzer Blick zurück und nach vorne. in: Dittler, Ullrich / Krameritsch, Jakob / Nistor, Nicolae / Schwarz, Christine / Thillosen, Anne (Hrsg.): E-Learning: eine Zwischenbilanz. Kritischer Rückblick als Basis eines Aufbruchs. Münster u. a. 2009. S. 219–232.
Forschungsbericht
25
narrationen, wobei die richtungsweisenden Beiträge von Jakob Krameritsch60, Jan Hodel61 und Peter Haber62 auf diesem Feld explizit hervorgehoben werden müssen. Zudem wurde sich auch sehr stark der Plattform Wikipedia63 konkret
60 Vgl. Krameritsch, Jakob: Kollektive Hypertextproduktion. in: Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007. S. 364–386; Krameritsch, Jakob: Geschichte(n) im Hypertext. Von Prinzen, DJs und Dramaturgen. in: Epple, Angelika / Haber, Peter / Jucker-Kupper, Patrick (Hrsg.): Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis. Zürich 2005. S. 33–55; Krameritsch, Jakob: Herausforderung Hypertext. Heilserwartungen und Potenziale eines Mediums. in: zeitenblicke 5 (2006). Heft 3. URL: http://www.zeitenblicke.de/2006/3/Krameritsch vom 20. 12. 2006 (Zugriff am 06. 09. 2017); Krameritsch, Jakob: Geschichte(n) im Netzwerk. Hypertext und dessen Potenziale für die Produktion, Repräsentation und Rezeption der historischen Erzählung. Münster, München u. a. 2007; Krameritsch, Jakob: Hypertext und Hypertexten im schulischen Geschichtsunterricht. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 58 (2007). Heft 1. S. 20–35; Krameritsch, Jakob: Die fünf Typen des historischen Erzählens – im Zeitalter digitaler Medien. in: Popp, Susanne (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – historische Bildung. Göttingen 2010. S. 261–281. 61 Vgl. Hodel, Jan: Historische Narrationen im digitalen Zeitalter. in: Danker, Uwe (Hrsg.): Historisches Lernen im Internet. Geschichtsdidaktik und neue Medien. Schwalbach/Ts. 2008. S. 182–195; Hodel, Jan: A Historyblogosphere Of Fragments. Überlegungen zum fragmentarischen Charakter von Geschichte, von Blogs und von Geschichte in Blogs. in: Haber, Peter / Pfanzelter, Eva (Hrsg.): Historyblogosphere. Bloggen in den Geschichtswissenschaften. München 2013. S. 61–75; Hodel, Jan: Verkürzen und verknüpfen. Geschichte als Netz narrativer Fragmente: Wie Jugendliche digitale Netzmedien für die Erstellung von Referaten im Geschichtsunterricht verwenden. Bern 2013. 62 Vgl. Haber, Peter: Anmerkungen zur Narrativität und Medialität von Geschichte im digitalen Zeitalter. in: Danker, Uwe (Hrsg.): Historisches Lernen im Internet. Geschichtsdidaktik und neue Medien. Schwalbach/Ts. 2008. S. 196–204; Haber, Peter: Digital past. Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. München 2011. 63 Vgl. Conrad, Margaret: Conrad, Margaret: Public History and its Discontents or History in the Age of Wikipedia. in: Journal of the Canadian Historical Association 18 (2007). Heft 1. S. 1–26; Cyron, Marcus: Eine Archäolopedia? Archäologie in der Wikipedia. in: Archäologisches 17 (2009). Heft 4. S. 293–299; Cyron, Marcus: User generated history. Wikipedia als digitales Geschichtsschreibungsprojekt. in: Hardtwig, Wolfgang / Schug, Alexander (Hrsg.): History sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt. Stuttgart 2009. S. 256–263; Cyron, Marcus: Wiki Loves Monuments: Wikipedias Beitrag zum Kulturgüterschutz und zur Denkmaltopografie. in: Der Holznagel 40 (2014). Heft 6. S. 60–63; Dijk, Ziko van: Die Vermählung von Klio und Isidor. Geschichte und die Freie Enzyklopädie Wikipedia. in: Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften 1 (2012). S. 1–12; Haber, Peter: Weltbibliothek oder Diderots Erben? Traditionslinien von Wikipedia. in: Koschke, Rainer / Herzog, Otthein (Hrsg.): Informatik 2007: Informatik trifft Logistik. Beiträge der 37. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), 24. – 27. September 2007 in Bremen. Bonn 2007. S. 497–502; Haber, Peter: Wikipedia. Ein Web 2.0 Projekt, das eine Enzyklopädie sein möchte. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 63 (2012). Heft 5–6. S. 261–270; Haber, Peter / Hodel, Jan: Wikipedia und die Geschichtswissenschaft. Eine Forschungsskizze. in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 59 (2009). Heft 4. S. 455–461; Hoeres, Peter: Hierarchien in der Schwarmintelligenz. Geschichtsvermittlung auf Wikipedia. in: Wozniak, Thomas / Nemitz, Jürgen / Rohwedder, Uwe (Hrsg.): Wikipedia und Geschichtswissenschaft. Berlin/Boston 2015. S. 15–32; Lorenz, Maren: Zum Verhältnis von Struktur und Wirkungsmacht eines
26
Einleitung: Geschichte in den Social Media
und Wikis64 allgemein als Medien der Geschichtsschreibung zugewandt, wobei die Dissertation von Manuel Altenkirch65 zu Konstruktionsprozessen der Geschichte des Nationalsozialismus in der Wikipedia noch aussteht. Heute ist die Geschichtswissenschaft längst Teil der Digital Humanities,66 sodass eine Unterscheidung in digitale und analoge Geschichtswissenschaft67 als obsolet zu betrachten ist, da historische Forschung im 21. Jahrhundert ohne digitale Recherche und Hilfsmittel68 unmöglich erscheint und wohl schon heute nicht mehr praktiziert wird.
64
65
66 67 68
heimlichen Leitmediums. in: Werkstatt Geschichte 14 (2006). Heft 43. S. 84–95; Lorenz, Maren: Wikipedia als »Wissensspeicher« der Menschheit – genial, gefährlich oder banal? in: Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009. S. 207–236; Voß, Jakob: Gemeinschaftliche Schreibprozesse in der Wikipedia. in: Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007. S. 319–330; Wozniak, Thomas: Zehn Jahre Berührungsängste: Geschichtswissenschaft und Wikipedia. in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 60 (2012). Heft 3. S. 247–264; Wozniak, Thomas / Nemitz, Jürgen / Rohwedder, Uwe (Hrsg.): Wikipedia und Geschichtswissenschaft. Berlin/Boston 2015; Ausführliche Bibliographie bei: Wozniak, Thomas: Auswahlbibliographie zu Wikipedia und Wissenschaft. in: Wozniak, Thomas / Nemitz, Jürgen / Rohwedder, Uwe (Hrsg.): Wikipedia und Geschichtswissenschaft. Berlin/Boston 2015. S. 257–300. Vgl. Haber, Peter: Collaboraties. Das Schreiben der Geschichte im vernetzten Zeitalter. in: Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007. Berlin. S. 315–318; Haber, Peter / Hodel, Jan: Das kollaborative Schreiben von Geschichte als Lernprozess. Eigenheiten und Potenzial Wiki und Wikipedia. in: Merkt, Marianne / Mayrberger, Kerstin / Schulmeister, Rolf / Sommer, Angela / van den Berk, Ivo (Hrsg.): Studieren neu erfinden – Hochschule neu denken. Münster, New York, München, Berlin 2007; Krameritsch, Jakob: Kollektive Hypertextproduktion – Wenn sich Texte und Autoren/Innen einander annähern. in: Burckhardt, Daniel (Hrsg.): Geschichte im Netz. Praxis, Chancen, Visionen. Berlin 2007. Berlin. S. 364–386; Lohse, Tillmann / Buchholz, Caroline von: Kollaboratives Schreiben an wissenschaftlichen Texten. in: Merkt, Marianne / Mayrberger, Kerstin / Schulmeister, Rolf / Sommer, Angela / van den Berk, Ivo (Hrsg.): Studieren neu erfinden – Hochschule neu denken. Münster, New York, München, Berlin 2007. S. 76–84. Projektbeschreibung: https://www.ph-heidelberg.de/?id=9237 vom 30. November 2013 (Zugriff am 06. 09. 2017); Vgl. Altenkirch, Manuel: Geschichtsschreibung im digitalen Medium – Konstruktion von Geschichte in der »Wikipedia«. in: Arand, Tobias (Hrsg.): Neue Wege, neue Themen, neue Methoden? Ein Querschnitt aus der geschichtsdidaktischen Forschung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Göttingen 2014. S. 241–256; Altenkirch, Manuel: Situative Erinnerungskultur. in: Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin, München u. a. 2015. S. 59–76. Vgl. Haber, Peter: Zeitgeschichte und Digital Humanities. in: Docupedia-Zeitgeschichte (2012). URL: http://docupedia.de/zg/Digital_Humanities vom 24. 09. 2012 (Zugriff am 08. 09. 2017). Vgl. Schmale, Wolfgang: Digitale Geschichtswissenschaft. Wien, Köln, Weimar 2010. Vgl. Gantert, Klaus: Elektronische Informationsressourcen für Historiker. Berlin, Boston 2011; Gasteiner, Martin (Hrsg.): Digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien, Köln, Weimar 2010; Kühmstedt, Estella: Klug recherchiert: für Historiker. Göttingen 2013; Oehlmann, Doina: Erfolgreich recherchieren – Geschichte. Berlin u. a. 2012.
Forschungsbericht
27
Parallel zu diesen Entwicklungen wendete sich auch die geschichtsdidaktische Forschung69 seit den 1990er Jahren der Erforschung digitaler (Online-)Medien zu.70 Ausgangspunkt des Faches war eine zunächst sehr starke Fokussierung auf das Forschungsfeld der pragmatischen Geschichtsdidaktik, da bis in die 2000er Jahre fast ausschließlich die Nutzbarmachung digitaler Medien für schulische Geschichtsvermittlung71 und universitäre Lehre72 betrachtet worden war. Zur 69 Auch wenn hier eine Trennung in Geschichtswissenschaft und -didaktik angelegt wurde, so sind Geschichtsdidaktiker*innen naturgemäß immer auch Historiker*innen, sodass diese Trennung in der Praxis nur bedingt vollzogen werden konnte. 70 Ausführlicher Literaturbericht bei Schwabe 2012, S. 30–35; Danker / Schwabe 2008, S. 8–9; etwas einseitig aber aktuell auch bei Bernsen, Daniel / Kerber, Ulf: Einleitung. in: Bernsen, Daniel / Kerber, Ulf (Hrsg.): Praxishandbuch Historisches Lernen und Medienbildung im digitalen Zeitalter. Leverkusen 2017. S. 13–21, hier S. 14–18. 71 Vgl. Computer und Internet. Themenheft. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1998). Heft 1; Internet und Geschichtsunterricht. Themenheft. Praxis Geschichte 14 (2001). Heft 5; Neue Medien. Themenheft. Geschichte lernen 14 (2002). Heft 89; Wunderer, Hartmann: Computer im Geschichtsunterricht. Neue Chancen für historisches Lernen in der Informationsgesellschaft. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 46 (1996). Heft 9. S. 526–534. Busche, Klaus-Peter: Geschichte(n) schreiben im Internet. Ansätze für einen kommunikativen Geschichtsunterricht mit einem neuen Medium. in: Praxis Geschichte 10 (1997). Heft 2. S. 64–67; Berg, Günter: Hypermedien und Geschichtsunterricht. Ein Annäherungsversuch. in: Computer + Unterricht 6 (1997). Heft 28; Körber, Andreas: Neue Medien. Auch Surfen will gelernt sein. in: Dittmer, Lothar (Hrsg.): Spurensucher. Ein Praxisbuch für historische Projektarbeit. Weinheim, Basel 1997. S. 119–139; Bodarwe, Katrinette: 1848. Ein Geschichtsprojekt mit Nutzung des Internets. in: Seminar – Lehrerbildung und Schule (1998). Heft 2. S. 50–59; Horstkemper, Gregor / Gersmann, Gudrun / Erber, Robert: Geschichte digital? CD-ROMs mit historischem Schwerpunkt. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1998 (48). Heft 1. S. 48–68; Schröder, Thomas A.: Geschichte im Internet. Möglichkeiten für den Unterricht. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1998). Heft 1. S. 4–21; Horstkemper, Gregor: Geschichte lernen mit Hilfe der »Neuen Medien«. in: Schreiben, Waltraud (Hrsg.): Erste Begegnungen mit Geschichte. Grundlagen historischen Lernens. Neuried 1999. S. 545–560; Austin, Roger: Geschichtsexperten im virtuellen Cafe. in: Donath, Reinhard / Otto, Kerstin (Hrsg.): Das transatlantische Klassenzimmer. Tipps und Ideen für Online-Projekte in der Schule. Hamburg, Hamburg 2000. S. 357–374; Fieberg, Klaus: Wegweiser durch das Internet für den Geschichtsunterricht [CD-Rom]. Braunschweig 2001; Grosch, Waldemar: Das Schulbuch der Zukunft. in: Pandel, Hans-Jürgen / Schneider, Gerhard (Hrsg.): Wie weiter? Zur Zukunft des Geschichtsunterrichts. Schwalbach/Ts. 2001; Hartwig, Uta: Internet im Geschichtsunterricht. Stuttgart 2001; Grosch, Waldemar: Computerspiele im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2002; Oswalt, Vadim: Multimediale Programme im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2002; Oswalt, Vadim: Neue Medien als Herausforderung an den Geschichtsunterricht. in: Benz, Wigbert u. a. (Hrsg.): Neue Perspektiven des Geschichtsunterrichts? Informationen für den Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer. Schwalbach/Ts. 2003. S. 23–32. 72 Vgl. Baumann, Heidrun: Geschichte lernen am Computer? Ein Überblick. in: Lehner, Franz / Braungart, Georg / Hitzenberger, Ludwig (Hrsg.): Multimedia in Lehre und Forschung. Systeme – Erfahrungen – Perspektiven. Wiesbaden 1998. S. 3–24; Jenks, Stuart: Das Internet und die universitäre Lehre. Spielzeug, Werkzeug oder Teufelszeug? Ein Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Dozenten und seiner Studenten. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1998). Heft 1. S. 30–34.
28
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Jahrtausendwende war »die Diskussion um eine fachspezifische Didaktik multimedialer Lehr- und Lernformen in der Geschichtsvermittlung bislang noch kaum in Gang gekommen.«73 Wenn überhaupt selektive Kriterien für digitale Lernangebote benannt wurden, dann nicht qualitativer74, sondern formaler Art,75 sodass weit über die Jahrtausendwende hinaus eine »ausdrückliche Formulierung fachdidaktischer Bewertungskriterien […] ein Desiderat«76 bildete, das sich erst dank Astrid Schwabe und Uwe Danker77 zu schließen begann. Den genannten theoretischen Überlegungen der geschichtsdidaktischen Forschung seit Ende der 1990er Jahre folgten dann eine Dekade später ab dem Ende der 2000er Jahre die »digital affinen Praktiker«78 mit einer Reihe von Blogs79 mit v. a. sehr praxisnahen Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunter73 Brakensiek, Stefan / Gorrißen, Stefan / Krull, Regine: Multimedia in der Museumspraxis. in: Institut für Europäische Regionalforschung (Hrsg.): Geschichtswissenschaft und Neue Medien. Siegen 2000. 67–82; Vgl. auch Schwabe 2012, S. 30. 74 Frühe zarte Ansätze qualitativer Bewertungsmaßstäbe aus geschichtsdidaktischer Perspektive bei Amsbeck, Stefanie: »Wir dürfen an den Computer? – Klasse!«. Ein Werkstattbericht. in: Praxis Geschichte 8 (1996). Heft 2. S. 56–57; Pingel-Rollmann, Heinrich: Multimedia im Geschichtsunterricht? Fragen, Kriterien und vorläufige Ergebnisse eines CD-ROM-Projektes zur Geschichte der europäischen Industrialisierung. in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 24 (1997). Heft 3/4. S. 203–213; Erber, Robert: Medienkompetenz und Geschichtswissenschaft. Konsequenzen einer veränderten Medienwelt für wissenschaftliches Studium und fachdidaktische Ausbildung. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1998). Heft 1. S. 35–43; Riemann, Mario: Historisches Lernen mit Hypermedia. Methodische Grundüberlegungen. in: Schönemann, Bernd / Mütter, Bernd (Hrsg.): Geschichtsbewusstsein und Methoden historischen Lernens. Weinheim 1998. S. 120–136; Baumann, Heidrun / Schäfer, Christoph: Theoretische Überlegungen und praktische Erfahrungen beim Lernen mit Bildern im Unterricht anhand der Computeranwendung »Am Limes«. in: Lehner, Franz / Braungart, Georg / Hitzenberger, Ludwig (Hrsg.): Multimedia – Informationssysteme zwischen Bild und Sprache. Wiesbaden 1999. S. 55–66. 75 Vgl. Schwabe 2012, S. 31. 76 Schwabe 2012, S. 31. 77 Vgl. Danker, Uwe (Hrsg.): Historisches Lernen im Internet. Geschichtsdidaktik und neue Medien. Schwalbach/Ts. 2008; Schwabe 2012; Danker, Uwe / Schwabe, Astrid: Geschichte im Internet. Stuttgart 2017. 78 Begriff von Friedburg, Christopher: »Digital« vs. »Analog«? Eine Kritik an Grundbegriffen in der Diskussion um den »digitalen Wandel« in der Geschichtsdidaktik und ein Versuch der Synthese von »Altern« und »Neuem«. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 13 (2014). S. 117– 133, hier S. 117. 79 Vgl. König, Alexander: Geschichte und Neue Medien – History and new media. URL: www.ge schichte-und-neue-medien.de von 2008 bis 2010 (Zugriff am 15. 09. 2017); König, Alexander: »Brennpunkt Geschichte«. URL: http://www.brennpunkt-geschichte.de von 2010 bis 2013 (Zugriff am 15. 09. 2017); Bernsen, Daniel: Medien im Geschichtsunterricht. URL: https://ge schichtsunterricht.wordpress.com seit 2009 (Zugriff am 15. 09. 2017); Jung, Christian: Zeittaucher. URL: http://scienceblogs.de/zeittaucher von 2009 bis 2012 (Zugriff am 15. 09. 2017); Kerber, Ulf: GEO&GES. URL: http://geoges.ph-karlsruhe.de/wordpress seit 2012 (Zugriff am 15. 09. 2017); Pallaske, Christoph: Historisch denken | Geschichte machen. URL: http://histori schdenken.hypotheses.org seit 2012 (Zugriff am 15. 09. 2017); Aufzählung aus Bernsen / Kerber 2017, S. 16.
Forschungsbericht
29
richt und in Teilen auch schlaglichtartigen Betrachtungen zu geschichtskulturellen Phänomenen. Das Fach der Geschichtsdidaktik war am Ende der 2000er Jahre insgesamt – was den Bereich »Geschichte und Internet« angeht – sehr stark auf Geschichtslernen fokussiert.80 Anfang der 2010er Jahre wurde die geschichtsdidaktische Diskussion zunächst von der Frage geprägt, ob es in Folge des digital turns in den Geistes- und Kulturwissenschaften einer Etablierung einer eigenständigen »digitale[n] Geschichtsdidaktik«81 bedürfe, was im Fach tendenziell auf Ablehnung82 gestoßen war, auch wenn Konsens herrschte, dass sich das Fach zweifelsohne diesem Forschungsfeld weiterhin intensiv widmen müsse. Dass das Fach seit den 2010er Jahren auf diesem Feld seine Expertise erheblich weiterentwickeln konnte, ist neben Astrid Schwabe u. a. Marko Demantowsky, Christoph Pallaske und Jan Hodel zu verdanken, die in Folge der interaktiven Netztagung #gld13 | Geschichte Lernen digital83, die im März 2013 in München stattfand, im September 2013 den Arbeitskreis »Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik«84 gründeten und in den Folgejahren Tagungen 2014 in Köln #gld14 | Geschichtsdidaktische Medienverständnisse | Entwicklungen – Positionen – neue Herausforderungen85 und 2015 in Basel #gld15 | Wikipedia in der Praxis. Geschichtsdidaktische Perspektiven86 ausrichteten, die jeweils die Diskussion um einen differenzierten Medienbegriff vorantrieben und Potenziale und Grenzen der Wikipedia als Medium der Geschichtsschreibung und des -lernens beschrieben. Die analytische Fassung des Internets als Medium des kollektiven Gedächtnisses, der Geschichtskultur oder 80 Vgl. Alavi, Bettina (Hrsg.): Historisches Lernen im virtuellen Medium. Heidelberg 2010. 81 Vgl. Bernsen, Daniel / König, Alexander / Spahn, Thomas: Medien und historisches Lernen: Eine Verhältnisbestimmung und ein Plädoyer für eine digitale Geschichtsdidaktik. in: Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften 1 (2012). Heft 1. S. 1–27. 82 Vgl. Demantowsky, Marko: Interview. »Die bisherigen E-Learning-Konzepte sind überholt«. in: L.I.S.A (2011). URL: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/die_bisherigen_e_learning_kon zepte_sind_ueberholt?nav_id=1750 vom 05. 08. 2011 (Zugriff am 18. 09. 2017); Demantowsky, Marko: Die Geschichtsdidaktik und die digitale Welt. Eine Perspektive auf spezifische Chancen und Probleme. in: Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin, München u. a. 2015. S. 149–162; Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph: Geschichte lernen im digitalen Wandel. in: Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin, München u. a. 2015. S. VII–XVI; Berlin; München u. a. 2014. 83 Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin, München u. a. 2015. 84 Vgl. Pallaske, Christoph: Der Arbeitskreis »Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik« startet mit 20 Mitgliedern | Bericht von der konstituierenden Sitzung in Göttingen, 27. 9. 2013. in: Blog Arbeitskreis Digitaler Wandel und Geschichtsdidaktik 2013. URL: http://dwgd.hypothese s.org/65 vom 28. 9. 2013 (Zugriff am 30. 08. 2017). 85 Pallaske, Christoph (Hrsg.): Medien machen Geschichte. Neue Anforderungen an den geschichtsdidaktischen Medienbegriff im digitalen Wandel. Berlin 2015. 86 Hodel, Jan / Zerwas, Marco (Hrsg.): Wikipedia in der Praxis. URL: http://dwgd.hypotheses.org /390 vom 18. 4. 2016 (Zugriff am 18. 09. 2017).
30
Einleitung: Geschichte in den Social Media
als Ort von Geschichtsnarrationen und Erinnerungsdiskursen außerhalb der Wikipedia wurde hier allerdings ebenfalls kaum87 betrieben. Gleiches gilt für die 2013 in Salzburg stattfindende Tagung zum Thema Nutzung digitaler Medien im Geschichtsunterricht88, die ebenso wie die beiden Hefte von Geschichte Lernen89 und Praxis Geschichte90 oder Forschungsprojekte wie HISTOdigitaLE – Geschichtslernen anders denken91 oder wie das Praxishandbuch Historisches Lernen92 eine fast ausschließlich pragmatische Perspektive auf die Praxis des Geschichtslernen einnehmen und eine empirische Beschreibung des Webs als Erinnerungsmedium93 ebenfalls kaum versuchen. Das seit 2013 online aktive internationale geschichtsdidaktische Blogjournal Public History Weekly94 hat heute ohne Zweifel einen festen Platz im Fachdiskurs etabliert. Aufgrund der zurecht inhaltlich breiten Ausrichtung werden hier Themen zum Internet als Medium von Geschichts- oder Erinnerungskulturen ebenfalls nur sehr vereinzelt besprochen.95 87 Burkhardt 2015. 88 Buchberger, Wolfgang / Kühberger, Christoph / Stuhlberger, Christoph: Nutzung digitaler Medien im Geschichtsunterricht. Innsbruck 2015. 89 Historisches Lernen mit digitalen Medien. Themenheft. Geschichte lernen 27 (2014). Heft 3/4. 90 Historisches Lernen mit elektronischen Medien. Themenheft. Praxis Geschichte 23 (2009). Heft 4. 91 HISTOdigitaLE – Geschichtslernen anders denken. URL: http://home.uni-leipzig.de/histodi gitale/ (Zugriff am 18. 09. 2017). 92 Bernsen, Daniel / Kerber, Ulf (Hrsg.): Praxishandbuch Historisches Lernen und Medienbildung im digitalen Zeitalter. Leverkusen 2017. 93 Der Beitrag von Hanna Liever ignoriert die Forschungslage zu Online-Erinnerungskulturen völlig. Vgl. Liever, Hanna: Erinnerungskultur online. in: Bernsen, Daniel / Kerber, Ulf (Hrsg.): Praxishandbuch Historisches Lernen und Medienbildung im digitalen Zeitalter. Leverkusen 2017. S. 110–118. 94 Public History Weekly. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/ (Zugriff am 18. 09. 2017). 95 Vgl. Bühl-Gramer, Charlotte: Twitter – Medium der Geschichtskultur, z. B. @9Nov38 (Außenperspektive). in: Public History Weekly 1 (2013). URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-798 vom 28. 11. 2013 (Zugriff am 01. 05. 2017); Hoffmann, Moritz u. a.: Twitter – Medium der Geschichtskultur, z. B. @9Nov38 (Akteursperspektive). in: Public History Weekly 1 (2013). Heft 13. URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-779 vom 28. 11. 2013 (Zugriff am 01. 05. 2017); John, Anke: Wissen2go – Teacher-Centered Instruction on YouTube. in: Public History Weekly 5 (2017). Heft 25. URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-9584 vom 29. 6. 2017 (Zugriff am 18. 09. 2017); Lévesque, Stéphane: Breaking away from passive history in the digital age. in: Public History Weekly 3 (2015). Heft 30. URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4576 vom 15. 10. 2015 (Zugriff am 18. 09. 2017); Noiret, Serge: Public History with Tweets. in: Public History Weekly 4 (2016). Heft 11. URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-9568 vom 22. 6. 2017 (Zugriff am 18. 09. 2017); Anonymous: WhatsApp @ School – Where Does the Fun Stop? in: Public History Weekly 8 (2020). Heft 4. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/8-2020-4/what sapp-school-memes/ vom 9. 4. 2020 (Zugriff am 01. 07. 2020); Samida, Stefanie: Doing Selfies in Auschwitz? Public History Weekly 7 (2019). Heft 45. URL: https://public-history-weekly.de gruyter.com/7-2019-25/selfies-auschwitz/ vom 4. 7. 2019 (Zugriff am 01. 07. 2020); Siebörger, Rob: Fake News, Alternative Facts, History Education. in: Public History Weekly 5 (2017).
Forschungsbericht
31
Eindeutig ist der Befund, dass das Fach der Geschichtsdidaktik das Internet bisher kaum als Ort von Geschichts- oder Erinnerungskulturen oder als Gedächtnismedium beschrieben hat, auch wenn die normativ und pragmatisch ausgerichtete Geschichtsdidaktik in den letzten Jahrzehnten bezüglich des Forschungsgegenstands »Geschichte und Internet« einiges geleistet hat. Dies gilt aber eben nicht für den Teil des Faches mit einer stärker empirisch-deskriptiven ausgerichteten Perspektive. Denn Studien, die eine deskriptive Annäherung an massenwirksame geschichtsvermittelnde digitale (Online-)Medien96 in Form differenzierter Beschreibungen der diskursiven und narrativen Prozesse versuchen, ohne dies durch die Ausrichtung an normativen Kriterien bezogen auf kompetenzorientiertes Geschichtslernen einzuengen, sind sehr dünn gesät.97 Denn der überwiegende Teil der geschichtsdidaktischen Forschungen bleibt auch bei der Betrachtung massenwirksamer geschichtskultureller Angebote in einer überwiegend pragmatischen Perspektive verhaftet98 und fokussiert digitale Medien fast ausschließlich als Medien des historischen Lernens.99 Dies gilt auch für
96
97 98
99
Heft 8. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-8/fake-news-alternative-f acts-and-history-education/ vom 2. 3. 2017 (Zugriff am 01. 07. 2020). Vgl. Körber, Andreas: Neue Medien und Informationsgesellschaft als Problembereich geschichtsdidaktischer Forschung. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 1 (2002). S. 165–181; Körber, Andreas: Geschichte im Internet. Zwischen Orientierungshilfe und Orientierungsbedarf. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 3 (2004). S. 184–197. Die Studie von Kolpatzik 2017 kann als ein solcher Versuch beschrieben werden, der allerdings in weiten Teilen wegen inhaltlicher und methodischer Schwächen nicht überzeugt. Sehr gut zu erkennen z. B. bei Grosch 2002: Computerspiele im Geschichtsunterricht. Die Meinung von Bernsen / Kerber kann hier nicht geteilt werden, Grosch hätte hier »dem Fach im Bereich der Geschichtskultur ein neues Themenfeld erschloss[en]«. Bernsen / Kerber 2017, S. 15; auch die wichtigen Dissertationsschriften von Schwabe 2012 und Hodel 2013. Vgl. Bernsen, Daniel / Spahn, Thomas: Medien und historisches Lernen. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 14 (2015). S. 191–203; Baumgärtner, Ulrich: Wegweiser Geschichtsdidaktik. Historisches Lernen in der Schule. Paderborn 2015. S. 223–229; Grosch, Waldemar: Der Einsatz digitaler Medien in historischen Lernprozessen. in: Barricelli, Michele / Lücke, Martin (Hrsg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts. Schwalbach/Ts. 2017. S. 125–145; Günther-Arndt, Hilke: Geschichte und Computer. in: Günther-Arndt, Hilke (Hrsg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2014. S. 227–237; Rave, Josef: Computereinsatz. in: Pandel, Hans-Jürgen / Becher, Ursula A. J. (Hrsg.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2017. S. 623–650; Sauer, Michael: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Seelze-Velber 2015. S. 277–283; Digitale Online-Medien finden keine Erwähnung bei: Adamski, Peter / Mayer, Ulrich / Pandel, Hans-Jürgen / Schneider, Gerhard (Hrsg.): Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Klaus Bergmann zum Gedächtnis. Schwalbach/Ts. 2016; Brauch, Nicola: Geschichtsdidaktik. Berlin 2015; Günther-Arndt, Hilke / Handro, Saskia (Hrsg.): GeschichtsMethodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2015; Thünemann, Holger: Zwischen analogen Traditionen und digitalem Wandel Lernen und Lehren mit Geschichtsschulbüchern im 21. Jahrhundert. in: Kühberger, Christoph / Bernhard, Roland / Bramann, Christoph (Hrsg.): Das Geschichtsschulbuch. Lehren – Lernen – Forschen. Münster 2019. S. 81–96.
32
Einleitung: Geschichte in den Social Media
Untersuchungen, die sich verstärkt Web 2.0-Anwendungen wie Wikipedia100 und anderen Angeboten101 zuwenden. Auch die geschichtsdidaktische Thematisierung von Social Media bleibt häufig in einer Fokussierung auf die Praxis der Geschichtsvermittlung102 und auf Twitter verhaftet, das v. a. als Unterrichtswerkzeug103 betrachtet wird und nur sehr wenig Aufmerksamkeit als Medium der 100 Vgl. Fieberg, Klaus: Das Wikipedia-Dilemma. in: Praxis Geschichte 23 (2009). Heft 5. S. 16– 21. Hodel, Jan: Wikipedia und Geschichtslernen. in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 63 (2012). Heft 5/6. S. 271–284; Hodel, Jan: Wikipedia und Geschichtslernen – Ein Problem? in: bpb (2012). URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/wikipedia/145824/wi kipedia-und-geschichtslernen?p=all vom 10. 10. 2012 (Zugriff am 11. 09. 2017); Hodel 2013; Hodel, Jan / König, Alexander: Wikis im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II. in: Notari, Michele (Hrsg.): Der Wiki-Weg des Lernens. Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen mit digitalen Kollaborationswerkzeugen. Bern 2013. S. 107–116; König, Alexander: Wikis im Geschichtsunterricht. in: Lehrer online (2007). URL: http://www.lehrer-online .de/wiki-geschichte vom 3. 3. 2015 (Zugriff am 03. 03. 2015); Notari, Michele (Hrsg.): Der Wiki-Weg des Lernens. Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen mit digitalen Kollaborationswerkzeugen. Bern 2013; Ausnahmen bilden Altenkirch 2014; Altenkirch 2015; Klümper, Hiram: Zeitgeschichte und Wikipedia: von der Wissens(ver)schleuder(ung) zum Forschungsfeld. in: Popp, Susanne (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – historische Bildung. Göttingen 2010. S. 283–296. 101 Vgl. Hodel, Jan: Internet. Das Internet und die Zeitgeschichtsdidaktik. in: Furrer, Markus / Messmer, Kurt (Hrsg.): Handbuch Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht. Schwalbach/ Ts. 2013. S. 352–378; Näpel, Oliver: Historisches Lernen im Internet. Legitimation, Anspruch und Wirklichkeit geschichtsdidaktischer Normative für Geschichtsangebote im Cyberspace. in: Danker, Uwe (Hrsg.): Historisches Lernen im Internet. Geschichtsdidaktik und neue Medien. Schwalbach/Ts. 2008. S. 90–107; Pöppinghege, Rainer: »die echt konkrete seite«. LeMO als Lernort der Zeitgeschichte? in: Popp, Susanne (Hrsg.): Zeitgeschichte – Medien – historische Bildung. Göttingen 2010. S. 297–306; Spahn, Thomas: Geschichte und Geschichtslernen in Zeiten des Web 2.0. Das Webportal www.lernen-aus-der-geschichte.de. in: Hardtwig, Wolfgang / Schug, Alexander (Hrsg.): History sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt. Stuttgart 2009. S. 299–305. 102 Vgl. Haydn, Terry / Ribbens, Kees: Social Media, New Technologies and History Education. in: Carretero, Mario (Hrsg.): Palgrave handbook of research in historical culture and education. London 2017. S. 735–753; Burkhardt, Hannes: Social Media im Geschichtsunterricht. Gegenwarts- und lebensweltnahe kontroverse Geschichtsdeutungen auf Twitter, Instagram und Facebook. in: Barsch, Sebastian / Lutter, Andreas / Meyer-Heidemann, Christian (Hrsg.): Fake und Filter. Historisches und politisches Lernen in Zeiten der Digitalität. Frankfurt am Main 2019. S. 191–217; ders.: Social Media und Holocaust Education. Chancen und Grenzen historisch-politischer Bildung. in: Ballis, Anja / Gloe, Markus (Hrsg.): Holocaust Education Revisited. Wahrnehmung und Vermittlung, Fiktion und Fakten, Medialität und Digitalität. Wiesbaden 2020. S. 371–389. 103 Vgl. Aßmann, Sandra / Herzig, Bardo: Integrative Medienbildung in der Geschichtsdidaktik am Beispiel von TwHistory-Projekten. in: Pallaske, Christoph (Hrsg.): Medien machen Geschichte. Neue Anforderungen an den geschichtsdidaktischen Medienbegriff im digitalen Wandel. Berlin 2015. S. 67–84; Bernsen, Daniel: Rollenspiele mit Twitter. in: Stiftung Lesen (Hrsg.): Post + Schule. Klick dich fit! Medienkompetenz für die Klassen 9–12. Anregungen und Ideen für Lehrkräfte. Mainz 2010. S. 23; Bernsen, Daniel: Twitter + Geschichte = TwHistory. in: geschichte für heute 3 (2010). Heft 3. S. 57; Bernsen, Daniel: Virtuelles Reenactment mit Twitter im Geschichtsunterricht. in: Computer + Unterricht 19 (2010).
Forschungsbericht
33
Geschichtsschreibung104 im Fach und durch andere Fachdisziplinen105 erhalten hat. Der Band der Zeitschrift für Geschichtsdidaktik aus dem Jahr 2017 zum Thema Geschichtskultur widmet sich digitalen Erscheinungsformen dieser nicht. Zwar enthält der im Jahr 2018 erschienene Band Einführung in die Public History ein Unterkapitel »Digitale Medien«106, allerdings mit einem erheblichen Schwerpunkt auf Geschichte in Computerspielen, während Social Media als öffentlicher Ort der Erinnerung und der Geschichtserzählung nicht erwähnt werden. Die Erforschung von Erinnerungskulturen in den Social Media und im engeren Sinne von Social-Network-Diensten wie Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram sind – wie gerade gezeigt – innerhalb der Geschichtsdidaktik als erhebliches Forschungsdesiderat zu betrachten.107 Außerhalb der Geschichtsdi-
104
105
106 107
Heft 79. S. 58–59. Bieler, Ines / Henning, Urs / Heusinger, Monika u. a.: Digitale Medien für Unterricht, Lehrerjob und Schule. Die besten Ideen und Tipps aus dem Twitterchat #EDchatDE. Buch. Berlin 2017; Todzi, Kim Sebastian: twhistory.org oder: Geschichtsvermittlung mit Twitter. in: www.kim-todzi.de (2012). URL: https://todzi.wordpress.com/2012/06/25/t whistory-org/ vom 25. 6. 2012 (Zugriff am 20. 09. 2017); Nicht Twitter: Burkhardt, Hannes: Facebook im Geschichtsunterricht. in: Bits und Bytes in der Geschichtsdidaktik. LaG-Magazin 5 (2014). Heft 11. URL: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/con tent/12154 vom 17.12. 2014 (Zugriff am 23. 08. 2017). Bühl-Gramer, Charlotte: Twitter – Medium der Geschichtskultur, z. B. @9Nov38 (Außenperspektive). in: Public History Weekly 1 (2013). URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-798 vom 28. 11. 2013 (Zugriff am 01. 05. 2017); Hodel, Jan: Geschichte twittern? in: hist|net (2011). URL: http://weblog.hist.net/archives/6026 vom 28. 11. 2011 (Zugriff am 30. 05. 2017); Pallaske, Christoph: Nachgefragt | Vergangenheit im Liveticker – geht das? | @9nov38. in: Historisch denken | Geschichte machen (2013). URL: http://historischdenken.hypotheses.org/2196 vom 12. 11. 2013 (Zugriff am 01. 05. 2017); Burkhardt, Hannes: Mythosmaschine Twitter? Fakten und Fiktionen im Social Web zu Rudolf Heß und der Bombardierung Dresdens 1945. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 17 (2018). S. 42–56. McGuire, Meg: Commemoration in 140 characters: How Twitter is remediating how we commemorate resonant events. La Cruces 2013; McKenzie, Brian A.: Teaching Twitter: Reenacting the Paris Commune and the Battle of Stalingrad. in: The History Teacher 47 (2014). Heft 3. S. 355–372; Roiu, Cristina Ioana: Something Old, Something New: Engaging People in Making History with Twitter. in: Studii de biblioteconomie s,i s,tiint,ele comunica˘rii / Library and information Science Research 20 (2016). S. 85–90. URL: http://www.lisr.ro/en20-roiu.pdf (Zugriff am 30. 05. 2017); Thomas, Bronwen: Tales from the Timeline. Experiments with Narrative on Twitter. in: Comparative Critical Studies 13 (2016). Heft 3. S. 353–369. Lücke, Martin / Zündorf, Irmgard: Einführung in die Public History. Göttingen 2018. S. 107– 110. Als sehr vielversprechend erscheinen die Promotionsprojekte von Christopher Friedburg: Die Praxis der Geschichtskultur 2.0 – eine Untersuchung der von Nutzern eingebrachten Inhalte und Überzeugungen auf der Videoplattform YouTube. URL: https://www.uni-due.de /graduiertenkolleg_1919/friedburg_christopher.php (Zugriff am 19. 09. 2017) und von Jonathan Peter: Résistance et collaboration: Der Kampf der Erinnerungen im Web 2.0. URL: https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/geschichte/didaktik-der-geschichte/jonathan -peter/zur-person.html (Zugriff am 19. 09. 2017); Siehe dazu auch Friedburg, Christopher: Was heißt hier »Web 2.0«? Überlegungen zu einem Grundbegriff in der geschichtsdidakti-
34
Einleitung: Geschichte in den Social Media
daktik sind Überlegungen explizit zu Social Media als Medium des kollektiven Gedächtnisses bisher ebenfalls nur sehr vereinzelt und fragmentarisch aus sehr unterschiedlichen nationalen und disziplinären Perspektiven angestellt worden.108 Die Museumspädagogik hat sich zwar den Social Media zugewandt,109 schen Diskussion um den »digitalen Wandel«. in: Pallaske, Christoph (Hrsg.): Medien machen Geschichte. Neue Anforderungen an den geschichtsdidaktischen Medienbegriff im digitalen Wandel. Berlin 2015. S. 85–97; Peter, Jonathan: Collaboration und Résistance – der Kampf der Erinnerung im World Wide Web. in: Arand, Tobias (Hrsg.): Neue Wege, neue Themen, neue Methoden? Ein Querschnitt aus der geschichtsdidaktischen Forschung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Göttingen 2014. S. 257–268. 108 Bartoletti, Roberta: Memory and Social Media: New Forms of Remembering and Forgetting. in: Pirani, Bianca Maria (Hrsg.): Learning From Memory: Body, Memory and Technology in a Globalizing World. Cambridge 2011. S. 82–111; Bruyn, Dieter de: World War 2.0: Commemorating War and Holocaust in Poland Through Facebook. in: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 4 (2010). S. 45–62; Garde-Hansen, Joanne: MyMemories?: Personal Digital Archive Fever and Facebook. in: Garde-Hansen, Joanne / Hoskins, Andrew / Reading, Anna (Hrsg.): Save as– digital memories. Basingstoke, New York 2009. S. 135–150; Garde-Hansen, Joanne: Media and memory. Edinburgh 2011; Groot, Jerome de: Consuming history. Historians and heritage in contemporary popular culture. New York 2016. Abschnitt im Unterkapitel History online: Twitter and social media for historians. S. 97–98; Hopf, Courtney: Social Media Memory. in: Alluvium 1 (2012). Heft 6. URL: https://www.alluvium-journal.org/2012/11/01/social-media-memory/ vom 1. 11. 2012 (Zugriff am 20. 9. 2017); Le Han, Eileen: Micro-blogging memories. Weibo and collective remembering in contemporary China. Basingstoke 2016; Maj, Anna: Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media: Twittering and Globalhood. in: Maj, Anna / Riha, Daniel (Hrsg.): Digital memories. Exploring critical issues. Oxford 2009. S. 209–218; Nentwich, Michael / König, René: Cyberscience 2.0. Research in the age of digital social networks. Frankfurt am Main, New York 2012; Pentzold, Christian / Sommer, Vivien: Digital networked media and social memory. Theoretical foundations and implications. in: Aurora 10 (2011). S. 72–85; Puschmann, Cornelius / Heyd, Theresa: #narrative: Formen des persönlichen Erzählens bei Twitter. in: Nünning, Ansgar / Rupp, Jan / Hagelmoser, Rebecca (Hrsg.): Narrative Genres im Internet. Theoretische Bezugsrahmen, Mediengattungstypologie und Funktionen. Trier 2012. S. 171–195; Reading, Anna: Memory and Digital Media: Six Dynamics of the Globital Memory Field. in: Neiger, Mordechai / Meyers, Oren / Zandberg, Eyal (Hrsg.): On media memory. Collective memory in a new media age. Houndmills 2011. S. 241–252; Zhao, Hui / Liu, Jun: Social Media and Collective Remembrance. in: China perspectives 12 (2015). Heft 1. S. 41–48. 109 Vgl. Binder, Tanja: Web 2.0-Anwendungen im Marketing von Kunstmuseen. Eine kritische Auseinandersetzung. Wiesbaden 2012; Drotner, Kirsten: Museum Communication and Social Media. The Connected Museum. Florence 2014; Gesser, Susanne / Handschin, Martin / Jannelli, Angela / Lichtensteiger, Sibylle (Hrsg.): Das partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen. Bielefeld 2014; Groschek, Iris: KZ-Gedenkstätten und Social Media. in: Holst, Christian (Hrsg.): Kultur in Interaktion. Co-Creation Im Kultursektor. Wiesbaden 2020. S. 105–118; Hausmann, Andrea / Frenzel, Linda (Hrsg.): Kunstvermittlung 2.0. Neue Medien und ihre Potenziale. Wiesbaden 2014; Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hrsg.): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg 2011; Koontz, Christie / Mon, Lorri M.: Marketing and social media. A guide for libraries, archives, and museums. Lanham 2014; Scheurer, Hans (Hrsg.): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld 2010;
Forschungsbericht
35
allerdings dominieren auch hier die Forschung naturgemäß die Entwicklung und die empirische Überprüfung pragmatischer Konzepte der Vermittlung oder des Marketings.110 Insbesondere die Praxis, Selfies auf dem Gelände von Gedenkstätten zu produzieren, hat in der Forschung einige Aufmerksamkeit erhalten.111 Die ersten kulturwissenschaftlichen Versuche von Kirstin Frieden, sich Facebook als Medium der Holocausterinnerung anzunähern, unterschätzen auf fatale Weise die Komplexität der erinnerungskulturellen, medialen, narrativen und diskursiven Phänomene und bleiben in einer unsystematischen, naiven, oberflächlichen und viel zu stark explorativen Analytik verhaftet.112 Die erste Tagung der Memory Studies Association zum Thema »Thinking through the Future of Memory«113 2016 in Amsterdam hatte sich Social Media als Erinnerungsmedium nicht zugewandt. Auf der Tagung 2017 in Kopenhagen wurden Social Media hingegen in einigen Beiträgen durchaus sowohl allgemein als Medien des kol-
110 111
112
113
Scheurer, Hans / Spiller, Ralf (Hrsg.): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld 2015; Titze, Antonia: Hashtag KZ? KZGedenkstätten und Social Media. in: ComSoc 53 (2020). Heft 1. S. 97–108; Vogelsang, Axel / Minder, Bettina / Mohr, Seraina: Social Media für Museen. Ein Leitfaden zum Einstieg in die Nutzung von Blog, Facebook, Twitter & Co für die Museumsarbeit. Berlin 2011. Ausführlicher Überblick über den Stand der Forschung (S. 2–7) und aktuelle Konzepte (S. 115–199) bei Bocatius, Bianca: Museale Vermittlung mit Social Media. Theorie – Praxis – Perspektiven. Düsseldorf 2016. Vgl. Commane, Gemma / Potton, Rebekah: Instagram and Auschwitz. A critical assessment of the impact social media has on holocaust representation. in: Holocaust Studies 25 (2018). Heft 1–2. S. 158–181; Dalziel, Imogen: »Romantic Auschwitz«: examples and perceptions of contemporary visitor photography at the Auschwitz-Birkenau State Museum. in: Holocaust Studies 22 (2016). Heft 2–3. S. 185–207; Fagen, Erica: To Selfie or Not to Selfie: Photography and the Process of Memory-Making at Former Concentration Camps (2016). URL: https://www.academia.edu/22994754/To_Selfie_or_Not_to_Selfie_Photography_and_the_ Process_of_Memory-Making_at_Former_Concentration_Camps (Zugriff am 1. 5. 2018); Hodalska, Magdalena: Selfies at horror sites: Dark tourism, ghoulish souvenirs and digital narcissism. in: Zeszty Prasoznawcze 2017 (60). Heft 2. S. 405–423; Zalewska, Maria: Selfies from Auschwitz: Rethinking the relationship between spaces of memory and places of commemoration in the digital age. in: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 18 (2017). S. 95–116. Vgl. Frieden, Kirstin: Nach den Familiengeschichten. Wie die Postmemory-Generation den Holocaust medial neu verhandelt. in: Keitz, Ursula von / Weber, Thomas (Hrsg.): Mediale Transformationen des Holocausts. Berlin 2013. S. 275–299; Frieden, Kirstin: »Meine Freundin, Anne Frank« – Zur Medialisierung der Ikone Anne Frank. in: Seibert, Peter / Pieper, Jana / Meoli, Alfonso (Hrsg.): Anne Frank. Mediengeschichten. Berlin 2014. S. 117– 135; Frieden, Kirstin: Neuverhandlungen des Holocaust. Mediale Transformationen des Gedächtnisparadigmas. Bielefeld 2014; Frieden, Kirstin: Erinnerungskultur In den Neuen Medien. in: Fischer, Torben / Lorenz, Matthias N. (Hrsg.): Lexikon der »Vergangenheitsbewältigung« in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. Bielefeld 2015. S. 363–364. Tagungsprogramm »Thinking through the Future of Memory«. URL: https://www.memory studiesassociation.org/wp-content/uploads/2017/04/Conference-Program.pdf (Zugriff am 20. 9. 2017).
36
Einleitung: Geschichte in den Social Media
lektiven Gedächtnisses114, als auch konkret als Medien für Erinnerungskulturen und für – im weitesten Sinne – Geschichtserzählungen115 thematisiert. Die Tagung im Jahr 2019 hat Social Media ebenfalls als Erinnerungsmedien analysiert.116 Die schmale Studie Erinnern im Internet117 von Vivien Sommer bezieht als Online-Diskursanalyse zu John Demjanjuk Social Media nur marginal mit ein. Social Media als Erinnerungsmedien widmet sich etwas intensiver der medienwissenschaftlich-soziologisch ausgerichtete Band (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse118 mit einigen Beiträgen119. Allerdings werden Social Media 114 Gudmundsdottir, Gunnthorunn: Digitization, memory, and the family archive; Marschall, Sabine / Kadman, Noga / Jeries, Raneen: Pieces of a puzzle: Memory work among 2nd generation Palestinian refugees in Israel; Garde-Hansen, Joanne: Liquid Memory and water environ – ment activism; Troconis, Irina: Mapping the Invisible: Digging Out the Disappeared in the Digital Age; Pastor, Doreen: Consuming memories: visitor experiences at three German memorial sites; Vgl. Abstracts »The Memory Studies Association Conference 2017«. URL: https://www.memorystudiesassociation.org/wp-content/uploads/2017/12/Book-of-A bstracts.pdf (Zugriff am 1. 5. 2018). 115 Kattago, Siobhan: Between moral blindness and obsession: Spectators of suffering in a media age; Radchenko, Daria A.: »Women frying a crocodile«: the right to interpret monuments Zamponi; Lorenzo: #ioricordo beyond the G8: Social practices of memory work and the digital remembrance of contentious pasts in Italy; Morina, Christina: Subverting Populist Memory: The Politics of Grievances in German and Dutch Populism; Farrell-Banks, David: Finding Meaning in Magna Carta: Tweeting Memory and National Identity. Vgl. Abstracts »The Memory Studies Association Conference 2017«. URL: https://www.memorystudiesas sociation.org/wp-content/uploads/2017/12/Book-of-Abstracts.pdf (Zugriff am 1. 5. 2018). 116 Evans, Jennifer (Carleton University) Digital Activism or How to Use Social Media for Good; Menyhért, Anna: The Peregrination of Traumatic Memories on Social Media; Annabell,Taylor: ›Your Memories‹ and ›Your Stories Archive‹: The Shaping of Memory by Social Media Platforms; Hall, Kimberly A.: The Rhetoric of Memory in Social Media. URL: http s://335875-1033390-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/06/ MSA2019_FinalProgram_web.pdf (Zugriff am 1. 7. 2020). 117 Sommer, Vivien: Erinnern im Internet. Der Online-Diskurs um John Demjanjuk. Wiesbaden 2018; Vgl. auch Sommer, Vivien: Erinnern und Vergessen im Netz. Transnationale OnlineKommunikation über den Fall John Demjanjuk. in: Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.): Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010. Wiesbaden 2012. CD-ROM; Sommer, Vivien: The Online Discourse on the Demjanjuk Trial. New Memory Practices on the World Wide Web. in: ESSACHESS. Journal for Communication Studies 5 (2012). S. 133–151; Meier, Stefan / Sommer, Vivien: Der Fall Demjanjuk im Netz. Instrumentarien zur Analyse von Online-Diskursen am Beispiel einer erinnerungskulturellen Debatte. in: Viehöver, Willy (Hrsg.): Diskurs – Sprache – Wissen. Interdisziplinäre Beiträge zum Verhältnis von Sprache und Wissen in der Diskursforschung. Wiesbaden 2013. S. 119–143; Pentzold, Christian / Sommer, Vivien: Remembering John/Ivan Demjanjuk: Inclusive and exclusive frames in cosmopolitan holocaust discourse. in: International Communication Gazette (2020). S. 1– 23. 118 Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. 119 Vgl. Sebald, Gerd: (Digitale)Medien und Gedächtnis – aus der Perspektive einer Gedächtnissoziologie. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale
Forschungsbericht
37
hier kaum als Ort für Geschichtsnarrationen analysiert. Insbesondere seit 2018120 widmen sich die Holocaust Studies dem Forschungsfeld der Social Media aus verschiedensten Perspektiven.121 Wie bereits dargelegt, hatte die Geschichtsdidaktik digitale Online-Medien spät als Forschungsfeld erkannt und noch im Jahr 2009 nicht selbstverständlich dem Feld »Geschichte und Öffentlichkeit«122 zugeordnet, während sich außerhalb
Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 29–51; Sommer, Vivien: Mediatisierte Erinnerungen. Medienwissenschaftliche Perspektiven für eine Theoretisierung digitaler Erinnerungsprozesse. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 53–79; Jost, Christofer: Gedächtnisproduktion als webbasierte Aneignungspraxis. Populäre Songs und ihre Neuinterpretation auf Youtube. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 83–104; Vorberg, Laura: The Political Reality of the (Mass)Media? Twitter-Discourse on the Eighth Republican Presidential Primary Debate 2016 and the Effects on the Social and Public Memory. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 105–122; Zeitler, Anna: #MediatedMemories: Twitter und die Terroranschläge von Paris im kollektiven Gedächtnis. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 123–141; Heinrich, Horst-Alfred / Gilowsky, Julia: Wie wird kommunikatives zu kulturellem Gedächtnis? Aushandlungsprozesse auf den Wikipedia-Diskussionsseiten am Beispiel der Weißen Rose. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 142–167; Benkel, Thorsten: Gedächtnis – Medien – Rituale. Postmortale Erinnerungs(re)konstruktion im Internet. in: Sebald, Gerd / Döbler, Marie-Kristin (Hrsg.): (Digitale) Medien und soziale Gedächtnisse. Wiesbaden 2018. S. 169–196. 120 Diese Studien wurde im Mai 2018 eingereicht. 121 Vgl. u. a. Benzaquen-Gautier, Stéphanie: Romancing the Camp: Genres of Holocaust Memory on the Story-Sharing Website Wattpad. in: Dapim: Studies on the Holocaust 32 (2018). Heft 2. S. 75–92; Carter-White, Richard: Death camp heritage ›from below‹? Instagram and the (re)mediation of Holocaust heritage. in: Muzaini, Hamzah / Minca, Claudio (Hrsg.): After heritage. Critical perspectives on heritage from below. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2018. S. 86–106; Friesem, Lia: Holocaust Tweets as an Act of Resistance. in: Israel Studies Review 33 (2018). Heft 2. S. 85–104; Lundrigan, Meghan: Holocaust Memory and Visuality in the Age of Social Media. Ottawa 2019; Lundrigan, Meghan: #Holocaust #Auschwitz. in: Gigliotti, Simone / Earl, Hilary Camille (Hrsg.): The Wiley Blackwell companion to the Holocaust. Chichester 2020. S. 639–655; Manca, Stefania: Holocaust Memorialisation and Social Media: Investigating how Memorials of Former Concentration Camps use Facebook and Twitter. in: Popma, Wybe / Francis, Stuart (Hrsg.): Ecsm 2019 – proceedings of the 6th european conference on social media. Brighton 2019. S. 189–198; Shandler, Jeffrey: Holocaust memory in the digital age. Survivors’ stories and new media practices. Stanford, California 2017. Wight, Craig A.: Visitor perceptions of European Holocaust Heritage: A social media analysis. in: Tourism Management 81 (2020). S. 104–142. 122 Digitale Medien werden im Band außer in dem Beitrag von Köhler zu Computerspielen nicht untersucht, während Online-Medien nicht bearbeitet werden: Vgl. Köhler, Dieter: Historischer Realismus in Computerspielen. in: Horn, Sabine / Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen. Stuttgart 2009. S. 226–234.
38
Einleitung: Geschichte in den Social Media
des Faches mit den Arbeiten von Wolfram Dornik123, Dörte Hein124 und Erik Meyer125 zur gleichen Zeit bereits seit Jahren eine rege Erforschung von Erinnerungskulturen im Web etabliert hatte. Auch aus diesem Umstand ergibt sich die Tatsache, dass diese Studie – wie oben beschrieben – eine geschichtsdidaktische Perspektive in einer empirisch-deskriptiven Ausrichtung einnimmt, die sowohl an die gerade beschriebenen geschichtsdidaktischen Forschungen, als auch an die eingangs beschriebenen kultur- und medienwissenschaftlichen Studien u. a. von Dornik, Hein und Meyer anknüpft, und sich insgesamt als eine geschichtsdidaktische Studie im Bereich der deskriptiven Empirie mit einem kulturwissenschaftlichen Grundverständnis des Faches126 und einer interdisziplinären methodischen Ausrichtung127 versteht. Somit ergeben sich für diese Untersuchung v. a. zwei wissenschaftliche Ausgangspunkte: 1. Inhaltlich baut diese Studie auf die beschriebenen Ergebnisse der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung zu online Erinnerungskulturen (Web 1.0) zur Geschichte des Nationalsozialismus auf. 2. Erkenntnistheoretisch ist diese Untersuchung – wie aufgezeigt – zutiefst einem geschichtsdidaktischen Erkenntnisinteresse verpflichtet und knüpft dabei an die eben im Forschungsüberblick beschriebenen Entwicklungen, Fragestellungen, Konzepte und Desiderate des Faches der Geschichtsdidaktik an, wenn nach medialen Konstruktionsprozessen von Geschichtsnarrationen in den Social Media als Teil etablierter diskursiver Strukturen gefragt wird, um 123 Vgl. Dornik, Wolfram: Cyber-Memory: Eine unvollständige Übersicht zu Gedächtnis und Erinnerung im Internet. in: Historische Sozialkunde (2004). Heft 4. S. 17–21; Dornik 2004b; Dornik 2010. 124 Vgl. Hein, Dörte: Mediale Darstellungen des Holocaust. Zum World Wide Web und zu seiner Disposition als Gedächtnismedium. in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 7 (2005). S. 176–196; Hein, Dörte: »Seriöse Information« oder »schöne Bilder«? Kommemorative Kommunikation aus der Perspektive der Anbieter. in: Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009. S. 145–174; Hein 2009b. 125 Vgl. Leggewie, Claus / Meyer, Erik: Geschichtspolitik in der Mediengesellschaft. in: Oesterle, Günter (Hrsg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Göttingen 2005. S. 663–676; Meyer, Erik: Memory and Politics. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar / Young, Sara B. (Hrsg.): Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook. Berlin, New York 2008. S. 173–180; Meyer, Erik: Problematische Popularität? Erinnerungskultur, Medienwandel und Aufmerksamkeitsökonomie. in: Korte, Barbara / Paletschek, Sylvia (Hrsg.): History goes pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. Bielefeld 2009. S. 267–287; Meyer, Erik: Die Zukunft der Erinnerung ist digital. in: Kultur macht Geschichte (2009). URL: http://www.kultur-macht-geschichte.de/47.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news] =326&cHash=b625dff874 vom 03. 06. 2009 (Zugriff am 19. 09. 2017); Meyer 2009b. 126 Vgl. Kapitel 2.1.1. Geschichtsdidaktik als Kulturwissenschaft und 2.1.2. Gedächtnistheorien und der Begriff der Erinnerungskulturen. 127 Vgl. Kapitel 2.2.1. Der methodische Rahmen: Social-Media-Monitoring und 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN).
Forschungsbericht
39
diese in einem auf diese Studie folgenden Schritt sinnvoll für kompetenzorientiertes historisches Lernen nutzbar zu machen. Im Kern des Interesses dieser Untersuchung stehen aber ausdrücklich nicht die lernenden, Medien nutzenden oder medial erinnernden Subjekte, sondern Social Media als kollektive Erinnerungsmedien, als Objekte, in denen sich Erinnerungskulturen, -diskurse und -narrative als Teil von Geschichtsnarrationen analytisch fassen lassen.
2.
Zugänge und Grundlagen
Die theoretischen und methodischen Zugänge zum Forschungsmaterial werden auf den folgenden Seiten systematisch dargelegt.128 Dabei wird erläutert werden, warum diese Studie ausgehend vom Forschungsinteresse aus dem Fach der Geschichtsdidaktik eine kulturwissenschaftliche Perspektive einnimmt und kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien und den Begriff der Erinnerungskulturen als Schlüsselkonzepte adaptiert. Inhaltlich daran anknüpfend wird dargelegt, dass Astrid Erlls Medienbegriff Medium des kollektiven Gedächtnisses129 deshalb in theoretisch-konzeptioneller und methodisch-analytischer Hinsicht für diese Studie grundlegend ist, weil er es leisten kann, kollektive Erinnerungsprozesse in Erinnerungskulturen in den Social Media analytisch sichtbar und greifbar zu machen. Zudem werden die methodischen Zugänge dieser Untersuchung offengelegt und begründet. In medialer Hinsicht an dem zu untersuchenden Gegenstand ausgerichtet ist als methodische Rahmung das SocialMedia-Monitoring130 im Fünf-Phasenmodell von Oliver Plauschinat und Florian Klaus. Komplementiert wird dies methodisch mit dem diskursanalytischen
128 Teile der im Folgenden dargestellten methodischen und theoretische Zugänge sind bereits in publizierten Beiträgen – allerdings weitaus weniger umfänglich – umrissen worden: theoretische Konzepte in Burkhardt 2014, Burkhardt 2015 und Burkhardt 2016a; methodische Analysemodelle in Burkhardt 2017. Die Analysen der genannten Beiträge sind allerdings eigenständige (Vor-)Studien, die methodisch erheblich weniger differenziert sind, medial bedeutend weniger Daten zur Grundlage und inhaltlich teilweise andere Kontexte (Burkhardt 2016a) zum Gegenstand haben. Alle Social-Media-Monitorings, deren Ergebnisse in den Kapiteln drei, vier und fünf vorgestellt werden, sind ausschließlich für diese Studie durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden hier erstmals publiziert. 129 Erll, Astrid: Medium des kollektiven Gedächtnisses. Ein (erinnerungs-) kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004. S. 3–22. 130 Plauschinat, Oliver / Klaus, Florian: Web Monitoring – Methodik zur Beobachtung von Social Media für die Meinungsanalyse. in: Scherfer, Konrad / Volpers, Helmut (Hrsg.): Methoden der Webwissenschaft. Berlin 2013. S. 43–63.
42
Zugänge und Grundlagen
Verfahren der Diskursanalytischen Mehrebenenanalyse (DIMEAN)131 nach Ingo Warnke und Jürgen Spitzmüller, das sich methodisch an der Kernfragestellung dieser Studie ausrichtet, der Frage nach diskursiven Strukturen innerhalb der in den Social Media präsentierten Narrationen und nach den dabei transportierten Narrativen.
2.1. Theoretische Zugänge Die inner- und außerhalb des Faches der Geschichtsdidaktik geführten Debatten um die Begriffe Geschichts- und Erinnerungskultur sollen im Folgenden als Ausgangspunkt dienen, um die kulturwissenschaftliche Perspektive dieser geschichtsdidaktischen Studie zu begründen. Daran schließt sich die weitere Offenlegung der theoretischen Zugänge dieser Untersuchung an, die als die kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien, der Begriff der Erinnerungskulturen und Astrid Erlls Medium des kollektiven Gedächtnisses in der Nutzbarmachung für diese Studie differenziert erläutert und beschrieben werden.
2.1.1. Geschichtsdidaktik als Kulturwissenschaft Die Thesen von Friedrich Nietzsche und Ernest Renan am Ende des 19. Jahrhunderts und die Ansätze Sigmund Freuds und Aby Warburgs zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren wegbereitend für die Entwicklung einer kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie, da sie das Phänomen der Erinnerung aus dem Zuständigkeitsbereich der Philosophie und Psychologie herauslösten und für die Analyse geschichtswissenschaftlicher, sozialpolitischer, kulturtheoretischer und kunstgeschichtlicher Zusammenhänge heranzogen.132 Mit der Übertragung der Konzepte Gedächtnis und Erinnerung von der individuellen Psyche auf kulturelle Aspekte wurde eine grundsätzliche Voraussetzung dafür geschaffen, Gedächtnis und Erinnerung nicht mehr als individuelle Operationen eines einzelnen psychischen Systems zu verstehen, sondern als soziale und kollektive Phänomene zu begreifen.133 Dies löste eine kulturwissenschaftliche Wende als methodische und theoretische Neuorientierung in den Geistes- und Sozialwis131 Warnke, Ingo / Spitzmüller, Jürgen: Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik – Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. in: Warnke, Ingo / Spitzmüller, Jürgen (Hrsg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin, New York 2008. S. 3–54. 132 Vgl. Pethes, Nicolas: Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung. Hamburg 2013. S. 23–70. 133 Vgl. Pethes 2013, S. 51.
Theoretische Zugänge
43
senschaften aus, die sich in der Veränderung von Erkenntnisinteressen, Interpretationsmustern und wissenschaftlichen Gegenständen ausdrückte. Hierbei scheint ein spezifisches Verständnis von Sinn zentral zu sein, der nicht mehr attributiv der Wirklichkeit zugerechnet, sondern als Ergebnis von Deutungsmustern betrachtet wird und Ausdruck ist von vielfältigen, kulturell variablen Produktionsprozessen, in denen Wirklichkeiten erzeugt und hervorgebracht werden.134 Dabei stehen Diskurse, Kommunikationsprozesse, Rituale, Symbole und Medien im Zentrum des Interesses der Forschung und werden unter dem Gesichtspunkt von Selbst- und Fremdbeschreibungsdimensionen analysiert.135 Das Gemeinsame in den interdisziplinären neueren Forschungen ist das Interesse an der Kultur, die als »selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe«136 erscheint, das die vorhandene soziale, wirtschaftliche und politische Realität greifbar macht und konstituiert und Kultur als ein Ensemble operativer Bedingungen von Sinnbildungsprozessen thematisiert.137 Die Begriffe Gedächtnis und Erinnerung sind als kulturwissenschaftliche Kategorien in die jüngeren Forschungsdiskussionen eingeführt worden und haben sich als kulturwissenschaftliche Leitbegriffe deshalb fest etabliert,138 weil sie nicht nur ein spezifisch kulturwissenschaftliches Themenfeld abstecken, sondern eine konkrete methodisch-theoretische Ausrichtung ermöglicht haben. Die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung versucht Sinnbildung in seiner Prozesshaftigkeit und Dynamik sichtbar zu machen.139 Der Begriff der Erinnerung wird inner- und außerhalb des Faches der Geschichtsdidaktik auch kritisch gesehen. Volkhard Knigge hält ihn für »unproduktiv«140 und sieht in Erinnerung nur ein »Identität und Gemeinschaft stiftendes Erzählen von Vergangenheit jenseits methodisch reflektierten, begrifflich
134 Sandl, Marcus: Historizität der Erinnerung/Reflexivität des Historischen. Die Herausforderung der Geschichtswissenschaft durch die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung. in: Oesterle, Günter (Hrsg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Göttingen 2005. S. 89–120, hier S. 89–90. 135 Vgl. Reckwitz, Andreas: Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. mit einem Nachwort zur Studienausgabe 2006. Weilerswist 2006. S. 84– 92. 136 Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main 2003. S. 9. 137 Vgl. Geertz, 2003 S. 7–43. 138 Vgl. Assmann, Aleida: Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften. in: Musner, Lutz / Wunberg, Gotthart (Hrsg.): Kulturwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen. Wien 2002. S. 27–45. 139 Vgl. Sandl 2005, S. 92–93. 140 Knigge, Volkhard: Abschied von der Erinnerung. Zum notwendigen Wandel der Arbeit der KZ-Gedenkstätten in Deutschland. in: Gedenkstättenrundbrief 100 (2001). S. 136–143, hier S. 141.
44
Zugänge und Grundlagen
bedachten Durcharbeitens«141, womit er die Produktivität und Komplexität des kulturwissenschaftlichen Erinnerungsbegriffs unterschätzt. Aus dem Fach der Geschichtsdidaktik vertritt Hans-Jürgen Pandel in seinem Grundsatzaufsatz von 1987 Dimensionen des Geschichtsbewusstseins die These, »dass Geschichtsbewusstsein mit ›Erinnern‹ nichts zu tun hat.«142 Dabei sind die Überlappungen zwischen den u. a. von Karl-Ernst Jeismann und Jörn Rüsen seit den 1970er Jahren geprägten Begriffen Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur einerseits und den kulturwissenschaftlichen Begriffen Erinnern und Erinnerungskultur andererseits nicht zu übersehen.143 Zwar definiert Pandel die Geschichtsdidaktik durchaus als Kulturwissenschaft,144 kreiert dabei allerdings einen viel zu engen und von der kulturwissenschaftlichen Diskussion völlig abgelösten Begriff von Erinnerungskulturen.145 Bodo von Borries beklagt, dass die intensiven und breiten Diskurse über Kultur, Gedächtnis und Erinnerung nicht auf geschichtsdidaktische Theorie und Empirie zum Geschichtsbewusstsein Bezug genommen hätten.146 Auch Wolfgang Hasberg mahnt die »Blindheit der neueren Erinnerungsspezialisten für den geschichtsdidaktischen Diskurs der letzten 30 Jahre«147 an. Bernd Schönemann sieht das Konzept der Erinnerungskultur als Konkurrenzkonzept148 zur Geschichtskultur und qualifiziert es als »Scheinal-
141 Vgl. Knigge, Volkhard: Zur Zukunft der Erinnerung. in: Aus Politik und Zeitgeschichte (2010). Heft 25/26. S. 10–15, hier S. 12. 142 Pandel, Hans-Jürgen: Dimensionen des Geschichtsbewusstseins – Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen. in: Geschichtsdidaktik 12 (1987). Heft 2. S. 130–142. URL: https://www.sowi-online.de/node/774 vom 12. 06. 2012 (Zugriff am 3. 11. 2017). 143 Vgl. Kofzczal, Kornelia: Geschichtswissenschaft. in: Gudehus, Christian / Eichenberg, Ariane / Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2010. S. 249–260, hier S. 255. 144 Vgl. Pandel, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis. Schwalbach/ Ts. 2013. S. 39. 145 »Erinnerungskultur (besser im Plural als »Erinnerungskulturen«) bezeichnet den generationsspezifischen Umgang sozialer Gruppen mit ihren eigenen Erinnerungen. Erinnerungskulturen haben immer spezifische soziale Träger: Veteranenverbände, Heimatvertriebene, Flakhelfergeneration, Opferverbände etc., die (eifersüchtig) über ihre Erinnerungen wachen.« Pandel 2013, S. 162. 146 Vgl. Borries, Bodo von: Geschichtsbewußtsein als System von Gleichgewichten und Transformationen. in: Rüsen, Jörn (Hrsg.): Geschichtsbewußtsein. Psychologische Grundlagen, Entwicklungskonzepte, empirische Befunde. Köln 2001. S. 239–280, hier S. 239. 147 Hasberg, Wolfgang: Erinnerungs- oder Geschichtskultur? Überlegungen zu zwei (un-)vereinbaren Konzeptionen zum Umgang mit Gedächtnis und Geschichte. in: Hartung, Olaf (Hrsg.): Museum und Geschichtskultur. Ästhetik, Politik, Wissenschaft. Bielefeld 2006. S. 32–59, hier S. 57. 148 Vgl. Schönemann, Bernd: Geschichtskultur als Wiederholungsstruktur? in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 34 (2006). Heft 314. S. 182–191, hier S. 182.
Theoretische Zugänge
45
ternative«149 ab. Diese geschichtsdidaktische Rezeption des Begriffs der Erinnerungskultur bezieht sich bis heute häufig auf Christoph Cornelißen, der diesen 2003 in GWU definiert hatte.150 Dass Schönemann aufgrund Cornelißens knapper Definition zum Urteil der »terminologische[n] Unschärfe«151 kommt, erscheint weder verwunderlich, noch ist es überraschend, da Cornelißen selbst feststellte, dass der Begriff »in diesem weiten Sinn […] synonym mit dem Konzept der Geschichtskultur«152 sei. Der Begriff der Erinnerungskultur hat aber nicht zuletzt durch die zahlreichen Publikationen des Gießener Sonderforschungsbereichs (SFB) 434 Erinnerungskulturen153 und in besonderem Maße durch Astrid Erll154 und Mathias Berek155 eine erhebliche Differenzierung erhalten.156
149 Schönemann, Bernd: Erinnerungskultur oder Geschichtskultur? in: Kotte, Eugen (Hrsg.): Kulturwissenschaften und Geschichtsdidaktik. München 2011. S. 53–72, hier. S. 53. 150 »Es erscheint aus den genannten Gründen sinnvoll, »Erinnerungskultur« als einen formalen Oberbegriff für alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse zu verstehen, seien sie ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur. Der Begriff umschließt also neben Formen des ahistorischen oder sogar antihistorischen kollektiven Gedächtnisses alle anderen Repräsentationsmodi von Geschichte, darunter den geschichtswissenschaftlichen Diskurs sowie die nur »privaten« Erinnerungen, jedenfalls soweit sie in der Öffentlichkeit Spuren hinterlassen haben. Als Träger dieser Kultur treten Individuen, soziale Gruppen oder sogar Nationen und Staaten in Erscheinung, teilweise in Übereinstimmung, teilweise aber auch in einem konfliktreichen Gegeneinander«. Cornelißen, Christoph: Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. in: GWU 54 (2003). Heft 10. S. 548–563, hier S. 555. 151 Schönemann 2006, S. 60. 152 Cornelißen 2003, S. 555. 153 Vgl. Justus-Liebig-Universität Gießen. Sonderforschungsbereich (SFB) 434 »Erinnerungskulturen«. URL: http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/index.html vom Mai 2009 (Zugriff am 3. 11.2017). 154 Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. in: Nünning, Ansgar / Nünning, Vera (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen, Ansätze, Perspektiven. Stuttgart, Weimar 2003. S. 156–179; Erll, Astrid: Medium des kollektiven Gedächtnisses. Ein (erinnerungs-) kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004. S. 3–22; Erll, Astrid: Medien und Gedächtnis. Aspekte interdisziplinärer Forschung. in: Rippl, Gabriele / Frank, Michael C. / Assmann, Aleida (Hrsg.): Arbeit am Gedächtnis. Für Aleida Assmann. München 2007. S. 87–98; Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 2017; Erll, Astrid: Memory in culture. Houndmills 2011. Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004; Erll, Astrid / Nünning, Ansgar: A companion to cultural memory studies. Berlin, New York 2010; Erll, Astrid / Nünning, Ansgar / Young, Sara B.: Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook. Berlin, New York 2008. 155 Berek, Mathias: Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Erinnerungskulturen. Wiesbaden 2009. 156 Vgl. Kapitel 2.1.2 Gedächtnistheorien und der Begriff der Erinnerungskulturen.
46
Zugänge und Grundlagen
Aus dem Fach der Geschichtsdidaktik hört man allerdings nicht nur kritische Stimmen zum Konzept der Erinnerungskulturen. Wolfgang Hasberg zieht nach seinem Vergleich der Konzepte den Schluss, dass »Erinnerungskultur und Geschichtskultur […] keine per se unvereinbaren Konzepte«157 seien, warnt aber auch vor »vorbehaltlosen Rezeptionsversuchen«158 des Begriffs der Erinnerungskultur und macht sich dafür stark, an den »theoretisch überzeugenderen und durchaus heuristisch fruchtbaren Kategorien Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur festzuhalten«159. Jörn Rüsen widerspricht Pandel in seiner Ansicht, dass Geschichtsbewusstsein mit Erinnern nichts gemein habe, denn »Geschichtsbewusstsein hängt aufs Engste mit Erinnerung zusammen«160. Für Rüsen ist es die Erinnerung, die Vergangenheit vergegenwärtigt und als eine Erfahrung präsentiert, die gegenwärtige Lebensverhältnisse verständlich und Zukunft erwartbar macht.161 Rüsen beschreibt die Verbindung von Erinnerung, Geschichtsbewusstsein und kollektivem Gedächtnis wie folgt: Geschichtsbewusstsein ist eine komplexe Ausprägung von Erinnerung. In ihm wird der Erfahrungsbezug der Erinnerung deutlicher, kritikfähiger, erweiterbar. Eigentlich erinnert sich der Mensch wirklich nur an das, was ihm in der eigenen Lebensspanne widerfahren ist. Nur im übertragenen Sinne reicht die Erinnerung weiter. Wird die eigene Lebensspanne überschritten wie im kollektiven Gedächtnis, das die kulturelle Zusammengehörigkeit begründet und definiert, dann gewinnt der historische Charakter der Vergangenheit schärfere Konturen. Der Zeithorizont der menschlichen Weltund Selbstdeutung weitet sich. Je ferner die Vergangenheit zurückliegt, die zum besseren Verstehen der Gegenwart herangezogen wird, desto weiter reichen die handlungsleitenden Zukunftsperspektiven und desto komplexer wird die Zeitgestalt des eigenen Selbst – es dauert über die Grenzen des eigenen Lebens hinaus, beispielsweise im kulturellen Körper des eigenen Volkes, wie ihn das nationale Geschichtsbewusstsein als Überdauern des eigenen Selbst in einem umgreifenden sozialen Ganzen konzipiert hatte. Im Geschichtsbewusstsein treten Zukunft und Vergangenheit im Grenzbereich der Gegenwart am deutlichsten auseinander, um desto klarer und reflektierter aufeinander bezogen werden zu können.162
Später definiert Rüsen Geschichtsbewusstsein als »Inbegriff der mentalen (emotionalen und kognitiven, unbewußten und bewußten) Operationen, durch die die
157 Hasberg 2006, S. 48. 158 Vgl. Hasberg, Wolfgang: Erinnerungskultur – Geschichtskultur, Kulturelles Gedächtnis – Geschichtsbewusstsein. 10 Aphorismen zu begrifflichen Problemfeldern. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 3 (2004). S. 198–207, hier S. 205. 159 Vgl. Hasberg 2004, S. 205. 160 Vgl. Rüsen, Jörn / Jaeger, Friedrich: Erinnerungskultur. in: Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen. Bonn 2001. S. 398–428, hier S. 400. 161 Vgl. Rüsen/Jaeger 2001, S. 400. 162 Vgl. Rüsen/Jaeger 2001, S. 401.
Theoretische Zugänge
47
Erfahrung von Zeit im Medium der Erinnerung zu Orientierungen der Lebenspraxis verarbeitet werden.«163 Es ist vor allem die jüngere Geschichtsdidaktik, die sich den kulturwissenschaftlichen Erinnerungskonzepten zuwendet und in Teilen dafür plädiert, die Strategie der Abgrenzung und Konkurrenz zu verlassen. Andreas Heuer entwickelt einen Begriff von Geschichtsbewusstsein, der aber keine theoretische Neubegründung sein will,164 in dem explizit Assmanns »kulturelles Gedächtnis Teil eines Geschichtsbewusstseins ist«165. Die Verbindung zwischen Geschichtsbewusstsein und kulturellem Gedächtnis zieht Heuer wie folgt: In diesem Sinn schafft das kulturelle Gedächtnis Grundannahmen, Denkhorizonte, die eben nicht natürliche Annahmen sind, sondern aus einer bestimmten Entwicklung erwachsen und kulturell geprägt werden. Es ist diese Tiefe der Zeit, die Assmann im Blick hat, wenn er über das kulturelle Gedächtnis spricht. Die Welt ist dabei, ökonomisch und technisch zusammenzuwachsen. Die Menschen sind geprägt durch kulturelle Vorstellungen, die zusehends in den Blick kommen sollten, wenn es um die Bildung von Geschichtsbewusstsein geht.166
Der Ansatz von Marko Demantowsky in Bezug auf die Begriffe Geschichtskultur und Erinnerungskultur erscheint als richtig, nicht an »zu verfrühten Hoheitsansprüchen […] fest[zu]halten«, da »[b]eide Konzeptionen […] unabhängig von ihrer aktuellen begrifflichen Ausformung, spezifische Erkenntnis-Chancen [enthalten], die gewiss erst in einem offenen Wettbewerb optimal realisiert werden.«167 Auch die »digital affinen Praktiker«168 der digitalen Geschichtsdidaktik setzen auf eine Parallelität der Begriffe Geschichts- und Erinnerungskultur.169 Der Geschichtsdidaktiker Eugen Kotte schlägt ebenfalls vor, die Überschneidungen der an die Begriffe Erinnerungskultur und Geschichtskultur
163 Rüsen, Jörn: Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. 2. Auflage. Schwalbach/Ts. 2008. S. 14. 164 Vgl. Heuer, Andreas: Geschichtsbewusstsein. Entstehung und Auflösung zentraler Annahmen westlichen Geschichtsdenkens. Schwalbach/Ts. 2011. S. 12. 165 Heuer 2011, S. 14. 166 Heuer 2011, S. 96. 167 Demantowsky, Marko: Geschichtskultur und Erinnerungskultur – zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. Historischer Hintergrund und exemplarischer Vergleich. in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 33 (2005). Heft 1/2. S. 11–20, hier S. 18. 168 Friedburg, Christopher: »Digital« vs. »Analog«? Eine Kritik an Grundbegriffen in der Diskussion um den »digitalen Wandel« in der Geschichtsdidaktik und ein Versuch der Synthese von »Altern« und »Neuem«. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. 13 (2014). S. 117–133, hier S. 117. 169 Bernsen, Daniel / König, Alexander / Spahn, Thomas: Medien und historisches Lernen: Eine Verhältnisbestimmung und ein Plädoyer für eine digitale Geschichtsdidaktik. in: Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften 1 (2012). S. 1–27, hier S. 16.
48
Zugänge und Grundlagen
geknüpften Forschungsfelder produktiv zu nutzen.170 Kotte bewertet die Abgrenzungsstrategien zum Begriff der Erinnerungskultur als defizitär und unbefriedigend.171 Er macht sich dafür stark, kulturwissenschaftliche Impulse noch erheblich stärker als bisher in der Geschichtsdidaktik aufzunehmen und weiterzuentwickeln und die in der Geschichtsdidaktik noch nicht konsequent vollzogene kulturwissenschaftliche Wende zu vervollständigen.172 Dieser von Kotte eingeschlagene Weg erscheint der für diese Studie und für die Geschichtsdidaktik allgemein richtige Ansatz zu sein, um dem in höchstem Maße ungerechtfertigten Vorwurf des »Abstellgleis[es], auf dem sich die Geschichtsdidaktik im geschichtswissenschaftlichen Bahnhof«173 angeblich befinde, letztgültig abzustreifen und sich noch mehr als bisher zu einer interdisziplinär agierenden kulturwissenschaftlichen Disziplin weiterzuentwickeln, die ihre spezifischen Expertisen in internationale Forschungsdiskurse und -debatten einbringt. Die Erforschung der Erinnerungspraxis und deren Reflexion ist ein gesamtkulturelles, interdisziplinäres und internationales Phänomen. Als gesamtkulturelles Phänomen finden sich die Thematisierungen von Gedächtnis und Erinnerung in verschiedenen Bereichen der kulturellen Praxis. Als interdisziplinäres Phänomen ist Gedächtnis der Leitbegriff der Kulturwissenschaften.174 Dies geschieht nicht nur in Deutschland, sondern international. In Frankreich hat Pierre Nora175 sein einflussreiches Konzept der Erinnerungsorte entwickelt. Ein memory-boom176 in Gesellschaft und Wissenschaft ist in den USA, Israel, Großbritannien, den Niederlanden, Südafrika, Australien und Kanada zu beobachten.177 Es sind transnationale Erinnerungsorte, die offenbar werden lassen, dass es dabei nicht allein um das nationale Gedächtnis geht: Religion, Ideologie, 170 Eugen Kotte schlägt vor, die Untersuchung von Erinnerungskulturen in das Konzept der Geschichtskultur zu integrieren: Vgl. Kotte, Eugen: Cultural turns und Geschichtsdidaktik. Impulse der Neuen Kulturgeschichte zur Erschließung geschichtsdidaktischer Forschungsund Arbeitsfelder. in: Kotte, Eugen (Hrsg.): Kulturwissenschaften und Geschichtsdidaktik. München 2011. S. 15–52, hier S. 31. 171 Vgl. Kotte, Eugen: Einleitung. in: Kotte, Eugen (Hrsg.): Kulturwissenschaften und Geschichtsdidaktik. München 2011. S. 7–14, hier S. 11. 172 Vgl. Kotte 2011, S. 11. 173 Vgl. Jordan, Stefan: Die Entwicklung einer problematischen Disziplin. Zur Geschichte der Geschichtsdidaktik. in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 2 (2005). Heft 2. URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208416/default.aspx vom Mai 2005 (Zugriff am 01. 09. 2017). 174 Assmann, Aleida: Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften. in: Musner, Lutz / Wunberg, Gotthart (Hrsg.): Kulturwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen. Wien 2002. S. 27–45. 175 Nora, Pierre: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1998; Nora, Pierre: Erinnerungsorte Frankreichs. München 2005. 176 Huyssen, Andreas: Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia. New York 1995. S. 8–9. 177 Vgl. Erll 2017, S. 1–2.
Theoretische Zugänge
49
Ethnie, Generation und Geschlecht sind heute zentrale Koordinaten kollektiven Erinnerns.178 Als Grund für die transnationale gesellschaftliche und wissenschaftliche Aktualität der Begriffe Gedächtnis und Erinnerung sieht Erll neben historischen Transformationsprozessen179 den Wandel der Medientechnologien und die Wirkung der Medien. Es sind auch die Veränderungen der Medientechnologien, die die Präsenz des Gedächtnisthemas im internationalen Diskurs ausgelöst haben, da Computer völlig neue Möglichkeiten der Speicherung von Daten ermöglichen und das Internet als globales Mega-Archiv angesehen werden kann.180 Eine als Kulturwissenschaft verstandene Geschichtsdidaktik muss sich der kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien bedienen, wenn sich diese für das Erkenntnisinteresse und für den zu untersuchenden Gegenstand als produktiv, fruchtbar und anschlussfähig erweisen. Im Folgenden soll nun das Verständnis dieser Studie des Begriffs der Erinnerungskulturen vom Grundkonzept des kollektiven Gedächtnisses theoretisch hergeleitet werden, das Gedächtnis und Erinnerung in Anlehnung an Halbwachs und Assmann als soziale und kulturelle Phänomene begreift.
2.1.2. Gedächtnistheorien und der Begriff der Erinnerungskulturen Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses kann auf eine, wenn auch unvollständige, Tradition zurückgeführt werden. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs begründete mit seinen Schriften Les cadres sociaux de la mémoire (Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen)181 aus dem Jahr 1925 und La mémoire collective (Das kollektive Gedächtnis)182, posthum 1950 veröffentlicht, in den 1920er und 1930er Jahren den Begriff des kollektiven Gedächtnisses. 178 Vgl. Erll 2017, S. 2. 179 »Von internationaler Bedeutung ist das Schwinden derjenigen Generation, die Holocaust und Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. […] Zudem wurde durch das Ende des Kalten Krieges auch die binäre Struktur von östlicher und westlicher Erinnerungskultur aufgebrochen. Nach der Auflösung der Sowjetunion trat eine Vielzahl nationaler und ethnischer Gedächtnisse hervor. Mit dem Übergang von autoritären Regimes zur Demokratie in zahlreichen Ländern – wie etwa in Südafrika, Argentinien oder Chile – sind Wahrheits- und Versöhnungskommissionen zu einer zentralen Form gesellschaftlicher Erinnerungsarbeit geworden. Gerade aus britischer, französischer und USamerikanischer Perspektive kommt schließlich deutlich die zunehmende Multi(erinnerungs-)kulturalität westlicher Gesellschaften als Folge von Dekolonialisierung und Migrationsbewegungen in den Blick.« Erll 2017, S. 3. 180 Vgl. Erll 2017, S. 3. 181 Halbwachs, Maurice: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main 2008. 182 Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt am Main 1996.
50
Zugänge und Grundlagen
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die folgende Annahme von Halbwachs, der das kollektive Gedächtnis als ein soziales Phänomen auffasst: Es würde in diesem Sinne ein kollektives Gedächtnis und einen gesellschaftlichen Rahmen des Gedächtnisses geben, und unser individuelles Denken wäre in dem Maße fähig sich zu erinnern, wie es sich innerhalb dieses Bezugrahmens hält und an diesem Gedächtnis partizipiert.183
Bezüge zur Vergangenheit sind im Verständnis von Halbwachs gesellschaftlich gerahmt und kollektiv. Gruppen von Menschen definieren sich nach Halbwachs über ein mémoire collective184, also über ein »Gedächtnis der Gruppe oder der Gruppen, das sich verwirklicht und offenbart in den individuellen Gedächtnissen«185. Zentral für diese Studie ist die Annahme von Halbwachs, dass sich ein Gedächtnis in sozialen Netzwerken konstituiert, es also per Definition als ein soziales Phänomen zu begreifen ist. Halbwachs umschreibt, wenn auch nicht explizit, zwei grundlegende Konzepte eines kollektiven Gedächtnisses: zum einen das kollektive Gedächtnis als ein sozial konstituiertes und geprägtes individuelles Gedächtnis und zum anderen ein kollektives Gedächtnis, das sich durch Interaktion, Kommunikation, Medien und Institutionen innerhalb von sozialen Gruppen und Kulturgemeinschaften auf Vergangenes bezieht.186 Erinnerungen haben einen sozialen Bezugsrahmen. Der Mensch erinnert als soziales Wesen immer im Kontext bestimmter sozialer Umstände, wodurch kollektive Erinnerung aber immer auch perspektivisch ist. Erinnerung ist also soziogen und perspektivisch.187 Der Beitrag von Halbwachs für die gegenwärtige Gedächtnisforschung, dass Erinnerung weder hauptsächlich noch vollständig ein individueller Prozess ist, kann kaum überschätzt werden, da es nach den Arbeiten von Halbwachs nicht mehr möglich ist, anzunehmen, dass Erinnern in irgendeiner Weise nicht sozial oder kollektiv sei.188 Die Überlegungen von Halbwachs zum kollektiven Gedächtnis gehören längst zum anerkannten Wissenskanon.189 Gedächtnis ist, wie Bewusstsein, Sprache und Personalität, ein soziales Phäno-
183 Halbwachs, Maurice: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main 1985. S. 21. 184 Halbwachs 2008, S. 23. 185 Halbwachs 2008, S. 23. 186 Vgl. Erll 2017, S. 12. 187 Vgl. Hein, Dörte: Erinnerungskulturen online. Angebote, Kommunikatoren und Nutzer von Websites zu Nationalsozialismus und Holocaust. Konstanz 2009. S. 53. 188 Vgl. Olick, Jeffrey K.: Das soziale Gedächtnis. in: Gudehus, Christian / Eichenberg, Ariane / Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2010. 119–114, hier S. 111. 189 Vgl. Beier, Rosmarie: Geschichtskultur in der Zweiten Moderne. Eine Einführung. in: Beier, Rosmarie (Hrsg.): Geschichtskultur in der zweiten Moderne. Frankfurt am Main 2000. S. 11– 25, hier S. 16.
Theoretische Zugänge
51
men.190 Kritisch191 ist aber zu sehen, dass es Halbwachs nicht in ausreichendem Maße gelingt, den Aspekt der persönlichen Erinnerung von dem der Kommemoration innerhalb von Kollektiven analytisch eindeutig voneinander zu trennen.192 Die Leistung von Halbwachs liegt nach Jan Assmann vor allem darin, den Übergang von einem Verständnis von Kultur als Gedächtnisphänomen (wie noch bei Nietzsche, Freud und Warburg)193 zur Betrachtung des Gedächtnisses als Kulturphänomen vollzogen zu haben.194 Eine weitere von Halbwachs angenommene Eigenschaft des kollektiven Gedächtnisses ist für diese Untersuchung ebenfalls leitend: Das kollektive Gedächtnis ist konstruktiv.195 Das kollektive Gedächtnis kann von der Vergangenheit nur das bewahren, was die Gesellschaft in ihrem gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren kann, womit die Vergangenheit nicht statisch, sondern dynamisch ist, da sie aus der Gegenwart heraus konstruiert wird.196 Damit erfüllt das kollektive Gedächtnis aber auch noch eine andere Funktion: Es ist identitätsstiftend.197 Denn bei der Konstruktion der Vergangenheit ist ein gesellschaftlicher Fokus immer auch darauf gerichtet, Zusammengehörigkeit zu vermitteln und Identität zu stiften, wobei Einheit und Kontinuität Vorrang haben vor Brüchen, Diskontinuitäten und Differenzen.198 Das kollektive Gedächtnis erfüllt eine identitätsstiftende Funktion, indem es die gemeinsame Vergangenheit einer Gruppe vergegenwärtigt und durch kollektiv geteilte Deutungen und Interpretationen Zugehörigkeit vermittelt.199 Dass Halbwachs die gemeinsame Erinnerung einer Gruppe als alleinigen Indikator für den Zusammenhang dieser sieht, da Gruppenidentität nur durch Vergegenwärtigung von Vergangenheit konstruiert werden könne und die Gruppe nicht mehr existiere, wenn keine kollektive Erinnerung mehr bestehe,200 ist zu kritisieren,201 da für Gruppen mehr Konstitutionsbedingungen bestehen als die historische Identität.202 Das kollek190 Vgl. Assmann, Jan: Halbwachs, Maurice. in: Korte, Martin / Pethes, Nicolas: Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Reinbek bei Hamburg 2001. S. 247–249, hier S. 247. 191 Zur Kritik an der Theorie von Maurice Halbwachs siehe Heinz, Rudolf: Maurice Halbwachs’ Gedächtnisbegriff. in: Zeitschrift für philosophische Forschung 23 (1959). S. 73–85. 192 Vgl. Heinrich, Horst-Alfred: Kollektive Erinnerungen der Deutschen. Weinheim, München 2002. S. 26–27. 193 Vgl. Pethes 2013, S. 52. 194 Vgl. J. Assmann 2001, S. 248. 195 Vgl. Heinrich 2002, S. 26. 196 Vgl. Halbwachs 2008, S. 134. 197 Vgl. Pethes 2013, S. 57. 198 Vgl. Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt am Main 1996. S. 68–70. 199 Vgl. Heinrich 2002, S. 26. 200 Vgl. Halbwachs 1996, S. 68, S. 74–75. 201 Vgl. Heinrich 2002, S. 28–29. 202 Vgl. Hardin, Russell: One for all. The logic of group conflict. Princeton 1995.
52
Zugänge und Grundlagen
tive Gedächtnis dient aber in jedem Fall auch dem Zweck, die Identität einer Gruppe herzustellen und zu bewahren.203 Zusammenfassend ist folgendes Charakteristikum von Maurice Halbwachs’ mémoire collective für diese Studie zentral: Das kollektive Gedächtnis ist soziogen, perspektivisch, konstruktiv und identitätsstiftend. Diese Untersuchung folgt im Weiteren der auf Halbwachs aufbauenden, und dabei weiter gefassten Definition des kollektiven Gedächtnisses von Astrid Erll, die es definiert »als Gesamtheit all jener Vorgänge (organisch, medial und institutionell), denen Bedeutung bei der wechselseitigen Beeinflussung von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen Kontexten zukommt«204. Im folgenden Punkt kann Halbwachs in seinen Annahmen allerdings nicht mehr gefolgt werden: Während die Zeugnisse der Geschichte für Halbwachs tot und abgestorben sind und die materielle Umwelt für ihn stumm und unbeweglich ist, bestimmt er – wie bereits dargestellt – Traditionsbildung als eine interaktive, kommunikative und lebendig vermittelte Erinnerungskonstruktion.205 Erst wenn Menschen und deren Gedächtnisinhalte nicht mehr vorhanden sind und der mit ihnen verschwundene Teil der Vergangenheit nicht mehr erinnert werden kann, rekonstruiert nach Halbwachs die Geschichtsschreibung Vergangenheit.206 Er unterscheidet in diesem Zusammenhang ein kollektives und ein historisches Gedächtnis.207 Während das kollektive Gedächtnis an die Tradition in Form einer gelebten und mündlich überlieferten Geschichte gebunden sei, funktioniere das historische Gedächtnis über Verschriftlichung und setze erst ein, wenn keine Zeitzeug*innen mehr als Träger*innen von Erinnerungen lebten.208 Nach Halbwachs existiert also eine strikte Trennung in der Abfolge von Gedächtnis und Geschichte. In diesem Punkt ist diese Studie anderer Auffassung als Halbwachs, da weder Geschichtsschreibung objektiv und unparteiisch ist, noch Geschichte und Gedächtnis getrennt voneinander funktionieren, sondern multiple Überlappungen und Überschneidungen und ein sich bedingendes Wechselverhältnis und keine strikte Opposition von Geschichte und Gedächtnis existieren.209 Von Halbwachs übernimmt diese Untersuchung also die Annahme, dass das kollektive Gedächtnis soziogen, perspektivisch, konstruktiv und identitätsstiftend ist, nicht aber die These, dass zwischen Gedächtnis und Geschichte die 203 Vgl. Bosse, Hans / Mies, Thomas: Kollektive Erinnerung. Maurice Halbwachs und das Problem des kollektiven Gedächtnisses. in: Psychosozial 34 (2011). Heft 1. S. 63–83, hier. S. 67. 204 Vgl. Erll 2017, S. 98. 205 Vgl. Halbwachs 2008, S. 134. 206 Vgl. Halbwachs 2008, S. 135. 207 Vgl. Halbwachs 1996, S. 34–77. 208 Vgl. Halbwachs 1996, S. 66–68. 209 Vgl. Hein 2009, S. 54.
Theoretische Zugänge
53
Grenze dort verläuft, wo soziale Interaktion endet und objektivierte Kultur in Form von Texten, Bildern oder Bauwerken beginnt. Stattdessen wird an dieser Grenze der Externalisierung von Gedächtnisinhalten auf Medien mit Jan Assmanns Konzept des kulturellen Gedächtnisses weitergearbeitet, der »im Bereich der objektivierten Kultur und organisierten bzw. zeremonialisierten Kommunikation […] ähnliche Bindungen an Gruppen und Gruppenidentitäten […] wie im Alltagsgedächtnis«210 feststellt. Als Begründer des Begriffs des kulturellen Gedächtnisses können Jan und Aleida Assmann gelten, da sie es waren, die zu Beginn der 1980er Jahre die einflussreichen Arbeiten von Maurice Halbwachs erweiterten, indem sie das kulturelle Gedächtnis als eine Metakategorie bezeichneten, welche sowohl das kommunikative als auch das kollektive Gedächtnis umfasst.211 Jan Assmann definiert das kulturelle Gedächtnis als Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht.212
Die Assmanns folgen wesentlichen Grundannahmen von Halbwachs als dem »Entdecker des kommunikativen sozialen Gedächtnisses«213, beziehen aber in ihrem Ansatz des kollektiven Gedächtnisses die Aspekte »der Medien, der Zeitstrukturen und der unterschiedlichen Funktionen des sozialen Gedächtnisses«214 mit ein. Das Konzept des kulturellen Gedächtnisses ist für diese Studie deshalb so außerordentlich relevant, weil es neben dem sozialen Bezugsrahmen auch die Medien und ihre Materialität und damit die Art und Weise, wie diese Vergangenheitsbezüge beeinflussen, miteinschließt.215 Medien werden in der Konzeption der Assmanns als Gedächtnisstützen und Zeichenträger zu Trägern potenzieller Erinnerungsanlässe.216 Auf die konkreten Funktionsweisen von Medien im Allgemeinen und von Massenmedien, dem Internet, dem Web 2.0 und den Social
210 Vgl. Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. in: Assmann, Jan / Hölscher, Tonio (Hrsg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1988. S. 9–19, hier S. 11. 211 Vgl. Levy, Daniel: Das kulturelle Gedächtnis. in: Gudehus, Christian / Eichenberg, Ariane / Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2010. S. 93–101. 212 J. Assmann 1988, S. 9. 213 Assmann, Aleida / Assmann, Jan: Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis. in: Merten, Klaus / Schmidt, Siegfried J. / Weischenberg, Siegfried (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994. S. 114– 140, hier S. 119. 214 Assmann / Assmann 1996, S. 119. 215 Vgl. Hein 2009, S. 55. 216 Vgl. Assmann / Assmann 1996, S. 133–134.
54
Zugänge und Grundlagen
Media im Speziellen wird in Bezug auf kollektive Erinnerungsprozesse an späterer Stelle217 dieser Studie noch eingegangen werden. Jan Assmann übernimmt von Maurice Halbwachs die soziale Rahmung von Erinnerungsprozessen und verknüpft diese mit dem Begriff der Erinnerungskultur, die er als »universales Phänomen«218 definiert: Bei der Erinnerungskultur […] handelt es sich um die Einhaltung einer sozialen Verpflichtung. Sie ist auf die Gruppe bezogen. Hier geht es um die Frage: ˏWas dürfen wir nicht vergessen?ˊ Zu jeder Gruppe gehört, mehr oder weniger explizit, mehr oder weniger zentral, eine solche Frage. […] die Erinnerungskultur [ist] ein universales Phänomen. Es läßt sich schlechterdings keine soziale Gruppierung denken, in der sich nicht – in wie abgeschwächter Form auch immer – Formen von Erinnerungskultur nachweisen ließen.219
Durch Vergangenheitsbezüge wird in der Konzeption Jan Assmanns »in der Erinnerung Vergangenheit rekonstruiert«220. Gedächtnis und Erinnerung trennt Aleida Assmann terminologisch in der Art, dass Gedächtnis eine virtuelle Fähigkeit und ein organisches Substrat neben der Erinnerung als aktuellem Vorgang des Einprägens und Rückrufens spezifischer Inhalte, also die allgemeine Anlage und Disposition zum Erinnern, meint, während Erinnern sich auf konkrete und diskontinuierliche Akte bezieht.221 Gedächtnis ist aber nicht nur Voraussetzung für Erinnern, sondern auch Produkt und Sammelbegriff für Erinnerungen, die im Gedächtnis zusammengefasst und objektiviert werden, Gedächtnis wird also in dieser Bedeutung metaphorisch mit einem externen Datenspeicher gleichgesetzt, der Informationen aus ihrer Zeitlichkeit herausholt.222 Währenddessen ist Erinnern immer verkörpert und an ein lebendiges Bewusstsein gebunden und findet ausschließlich als gegenwärtiger Akt statt, der in diskontinuierliche Akte zerfällt.223 Gedächtnis und Erinnern unterscheiden sich also auch in ihrer Zeitstruktur. Daneben differenziert Jan Assmann grundsätzlich drei Dimensionen des Gedächtnisses, die miteinander interagieren: Das persönliche (individuelle) Gedächtnis, das mit dem Tod des Individuums oder bei Gedächtnisverlust ver-
217 Vgl. Kapitel 2.1.3. Medientheoretische und -begriffliche Grundlagen. 218 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 2013. S. 30. 219 J. Assmann 2013, S. 30. 220 J. Assmann 2013, S. 31. 221 Vgl. Assmann, Aleida: Zur Metaphorik der Erinnerung. in: Assmann, Aleida / Harth, Dietrich (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt am Main 1991. S. 13–34, hier S. 14. 222 Vgl. Assmann, Aleida: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin 2011. S. 182. 223 Vgl. A. Assmann 2011, S. 182.
Theoretische Zugänge
55
schwindet und zwei Formen eines kollektiven, sozialen Gedächtnisses,224 die für Jan Assmann zwei Modi des Erinnerns des kollektiven Gedächtnisses oder auch zwei Verfahren der Rekonstruktion von Vergangenheit darstellen: das kommunikative225 und das kulturelle226 Gedächtnis. Diese beiden Gedächtnisformen unterscheiden sich zum einen in ihrer »Partizipationsstruktur«227. Das kommunikative Gedächtnis ist zudem interaktiv,228 da Erinnerungen durch sprachliche Kommunikation229 mit Zeitgenossen geteilt werden.230 Das kommunikative Gedächtnis existiert in einer interaktiven Praxis im Spannungsfeld der Vergegenwärtigung von Vergangenem durch Individuen und Gruppen.231 Das auf unmittelbarer kommunikativer Interaktion beruhende kommunikative Gedächtnis ist aber keinesfalls auf vorschriftliche Kulturen beschränkt, sondern existiert vielmehr auch in modernen Medienkulturen weiter.232 Diese Fortexistenz und Neuentstehung mündlicher Überlieferungsformen in Schriftkulturen nennt Walter J. Ong »sekundäre Oralität«233. Das kulturelle Gedächtnis funktioniert aber durch Formen der symbolischen Kodierung und Institutionalisierung, indem »Medien der Speicherung und Formen der Überlieferung geschaffen werden, mittels derer lebenswichtiges und identitätsrelevantes Wissen über
224 Vgl. Assmann, Jan. Der Begriff des kulturellen Gedächtnisses. in: Kulturelles Gedächtnis im 21. Jahrhundert. Moderne Speichertechnologien, Aufbewahrungspraktiken und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Karlsruhe 2005. S. 21–29, hier S. 21. 225 J. Assmann, 2013, S. 53. 226 »Im Gegensatz zur diffusen Teilhabe der Gruppe am kommunikativen Gedächtnis ist die Teilhabe am kulturellen Gedächtnis immer differenziert. Das gilt auch für schriftlose und egalitäre Gesellschaften. […] Das kulturelle Gedächtnis hat immer seine speziellen Träger. In schriftlosen Gesellschaften hängt die Spezialisierung der Gedächtnisträger von den Anforderungen ab, die an das Gedächtnis gestellt werden. Als höchste Anforderungen gelten diejenigen, die auf wortlautgetreuer Überlieferung bestehen. Hier wird das menschliche Gedächtnis geradezu als ›Datenträger‹ im Sinne einer Vorform von Schriftlichkeit benutzt«. J. Assmann 2013, S. 53–54. 227 »Die Teilhabe […] am kommunikativen Gedächtnis ist diffus. […] es gibt keine Spezialisten und Experten […]. Das Wissen, um das es hier geht, wird zugleich mit dem Spracherwerb und der Alltagskommunikation erworben. Jeder gilt hier als gleich kompetent.« J. Assmann 2013, S. 53. 228 Vgl. Hein 2009, S. 56. 229 Vgl. Echterhoff, Gerald: Das kommunikative Gedächtnis. in: Gudehus, Christian / Eichenberg, Ariane / Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2010. S. 102–108. 230 J. Assmann 2013, S. 50. 231 Vgl. Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis und woraus es besteht. in: Rippl, Gabriele / Frank, Michael C. / Assmann, Aleida (Hrsg.): Arbeit am Gedächtnis. Für Aleida Assmann. München 2007. S. 47–62, hier. S. 48. 232 Vgl. Pethes 2013, S. 62. 233 Ong, Walter J. Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen 1987. S. 12.
56
Zugänge und Grundlagen
Generationen hinweg gesichert und vermittelt werden kann«234. Es ist die externe Speichermöglichkeit, die das Gedächtnis erweitert und entlastet.235 Moderne Industrienationen nutzen für Gedächtnispflege und Wissensvermittlung externe Datenspeicher und Institutionen, um Erfahrungen, Erinnerungen und Wissen auf materielle Datenträger auszulagern.236 Da das kulturelle Gedächtnis auf externe Datenspeicher ausgelagert wird, ist es mediengebunden. Hier kommt ein sehr weiter Medienbegriff zur Anwendung, der Medien als Gedächtnisstützen und Zeichenträger und als gegenständliche Träger potenzieller Erinnerungsanlässe beschreibt.237 Aufgrund dieser medialen und materiellen Beschaffenheit ist das kulturelle Gedächtnis offen für eine Vielzahl von Deutungen, dabei aber standpunkt- und zeitabhängig.238 Ein wichtiges Merkmal des kulturellen Gedächtnisses ist seine oben schon angedeutete Rekonstruktivität.239 Das kulturelle Gedächtnis ist aber nicht in derart rekonstruktiv, dass es wahrheitsorientiert, voraussetzungs- oder interesselos die Vergangenheit durchforscht, sondern es geht von einem aktuellen Identitätsbedürfnis aus, um durch Vergangenes Gegenwärtiges zu stabilisieren.240 Das kollektive Gedächtnis bietet daher keine Abbilder eines vergangenen Geschehens,241 sondern Rekonstruktionen. Das kulturelle Gedächtnis ist 234 Assmann, Aleida: Vier Formen des Gedächtnisses. in: Erwägen Wissen Ethik 13 (2000). Heft 2. S. 183–190, hier S. 189. 235 Vgl. Assmann, Aleida: Gedächtnis-Formen. in: bpb (2008). URL: http://www.bpb.de/gesch ichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39786/gedaechtnisformen vom 26. 8. 2008 (Zugriff am 03. 11. 2017). 236 Vgl. A. Assmann 2000, S. 189. 237 Vgl. Hein, Dörte: Mediale Darstellungen des Holocaust. Zum World Wide Web und zu seiner Disposition als Gedächtnismedium. in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 7 (2005). S. 176–196, hier S. 177. 238 »Unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses fassen wir den jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten zusammen, in deren »Pflege« sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) unserer Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit und Eigenart stützt.« J. Assmann 1988, S. 13. 239 »Das kulturelle Gedächtnis richtet sich auf Fixpunkte in der Vergangenheit. Auch in ihm vermag sich Vergangenheit nicht als solche erhalten. Vergangenheit gerinnt hier vielmehr zu symbolischen Figuren, an die sich die Erinnerung heftet«. J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. 2007. S. 52; »Es [das kulturelle Gedächtnis] ist zwar fixiert auf unverrückbare Erinnerungsfiguren und Wissensbestände, aber jede Gegenwart setzt sich dazu in aneignende, auseinandersetzende, bewahrende und verändernde Beziehung.« J. Assmann 1988, S. 13. 240 Vgl. Bering, Dietz: Kulturelles Gedächtnis. in: Korte, Martin / Pethes, Nicolas: Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Reinbek bei Hamburg 2001. S. 329–332, hier S. 330. 241 Vgl. Erll, Astrid: Medium des kollektiven Gedächtnisses. Ein (erinnerungs-) kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004. S. 3–22, hier S. 4.
Theoretische Zugänge
57
dabei auch identitätskonkret, da es den Wissensvorrat einer Gruppe bewahrt und dadurch das Bewusstsein der Einzigartigkeit eines Kollektivs erzeugt, erhält und konkretisiert, wodurch sich die Gegenstände des kulturellen Gedächtnisses »durch eine Art identifikatorische Besetztheit«242 auszeichnen, da »der im kulturellen Gedächtnis gepflegte Wissensvorrat gekennzeichnet ist durch eine scharfe Grenze, die das Zugehörige vom Nichtzugehörigen, d. h. das Eigene vom Fremden trennt«243. Mit Hilfe des kulturellen Gedächtnisses schaffen sich Institutionen und Körperschaften eigene Identitäten.244 Diese Inszenierung von kollektiver Identität ist Teil von sozialen und politischen Praktiken.245 Die kollektive Identität ist auch konstitutiv für individuelle personale Identitäten, die an die leiblichen Existenzen von Personen und deren spezifische soziokulturelle bzw. symbolische Formen und Praktiken gebunden ist.246 Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die gesellschaftlichen Träger des kulturellen Gedächtnisses sich durch ihre Spezialisierung auszeichnen. Das kulturelle Gedächtnis transportiert eine rekonstruierte Vergangenheit in externalisierten Medien, welche sich als feste Objektivationen in traditioneller symbolischer Kodierung und Inszenierung in Wort, Bild, Tanz usw. präsentieren. Dabei hat das kulturelle Gedächtnis einen identitätsstiftenden Charakter. Für diese Untersuchung gilt, dass Jan Assmanns Konzepte vom kommunikativen und kulturellen Gedächtnis als theoretischer Hintergrund und als analytischer Ausgangspunkt dienen sollen, von dem aus Erinnerungskulturen in den Social Media beschrieben werden. Entscheidend ist dabei, dass in kollektiven Erinnerungsprozessen eine rekonstruierte Vergangenheit als Geschichte in Medien externalisiert wird. Durch das Aufkommen der Schrift wuchs »überlieferter, in symbolische Formen ausgelagerter Sinn zu riesigen Archiven an«247. Von diesem archivierten Wissen wurde aber nur ein geringer Teil in der »gegebenen Gegenwart wirklich gebraucht, bewohnt und bewirtschaftet«248. Das kollektive Gedächtnis ist nicht direkt beobachtbar, sondern nur analysierbar, wenn es sich in Akten kollektiver Erinnerung in Erinnerungskulturen 242 J. Assmann 1988, S. 13. 243 J. Assmann 1988, S. 13. 244 Vgl. Assmann, Aleida: Kollektives Gedächtnis. in: Korte, Martin / Pethes, Nicolas: Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Reinbek bei Hamburg 2001. S. 308–310, hier S. 309. 245 Vgl. Assmann, Aleida / Friese, Heidrun: Einleitung. in: Assmann, Aleida / Friese, Heidrun (Hrsg.): Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität. Frankfurt am Main 1998. S. 11–23, hier S. 12. 246 Vgl. Straub, Jürgen: Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs. in: Assmann, Aleida / Friese, Heidrun (Hrsg.): Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität. Frankfurt am Main 1998. S. 73–104, hier S. 97. 247 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. in: Erwägen Wissen Ethik 13 (2002) Heft 2. S. 239– 247, hier S. 245. 248 J. Assmann 2002, S. 245.
58
Zugänge und Grundlagen
ausdrückt.249 An der Justus-Liebig-Universität Gießen wurden von 1997 bis 2008 Erinnerungskulturen mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Sonderforschungsbereich (SFB) 434 Erinnerungskulturen untersucht.250 Der SFB interessierte sich für die Inhalte und Formen kultureller Erinnerung von der Antike bis ins 21. Jahrhundert und es waren etwa 100 Wissenschaftler*innen aus elf kulturwissenschaftlichen Disziplinen beteiligt.251 Das Ziel des SFB Erinnerungskulturen war eine konsequente Historisierung der Kategorie der historischen Erinnerung, wobei dem überhistorischen Modell des kulturellen Gedächtnisses von Jan Assmann ein Konzept von Erinnerungskulturen gegenübergestellt wurde, das Dynamik, Kreativität, Prozesshaftigkeit und vor allem die Pluralität der kulturellen Erinnerung in den Vordergrund rückt.252 Hierbei wurde der Erinnerungsbegriff vor dem oftmals mit Speichermetaphern assoziierten Gedächtnisbegriff privilegiert und zudem wurde mit der Verwendung des Plurals Erinnerungskulturen die Vielfalt und historisch-kulturelle Variabilität von Erinnerungspraktiken und -konzepten ausgedrückt, da nicht nur in einem kumulativen, sondern auch in einem theoretisch reflektierten Sinn von Erinnerungskulturen im Plural gesprochen wird.253 Im Rahmen des SFB Erinnerungskulturen wurde ein Modell zur Beschreibung von kulturellen Erinnerungsprozessen entworfen, in dem es nicht »um eine Synthese oder die Einheit des Gegenstandes […], sondern um die Suche nach operativen Faktoren und transversalen Linien, die unterschiedliche Möglichkeiten der thematischen, methodischen und theoretischen Zurichtung des Themas eröffnen«254, geht. Im Konzept von Erinnerungskulturen des SFB 434 249 Vgl. Erll 2003. S. 156–179, hier S. 176. 250 Vgl. Könenkamp, Charlotte: Nach der maximalen Förderdauer von zwölf Jahren (vier Förderperioden) hat der Sonderforschungsbereich (SFB) 434 »Erinnerungskulturen« zum Jahresende 2008 seine Arbeit eingestellt. in: Sonderforschungsbereich (SFB) 434 »Erinnerungskulturen«. URL: http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/index.html (Zugriff am 16. 04. 2012). 251 Geschichte, Germanistik, Latinistik, Gräzistik, Kunstgeschichte, Romanistik, Anglistik, Orientalistik, Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie. 252 Vgl. Justus-Liebig-Universität Gießen. Sonderforschungsbereich (SFB) 434 »Erinnerungskulturen«. URL: http://www1.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/konzept.html vom Mai 2009 (Zugriff am 3.2017). 253 »Der Begriff [Erinnerungskulturen] verweist auf die Pluralität von Vergangenheitsbezügen, die sich nicht nur diachron in unterschiedlichen Ausgestaltungen des kulturellen Gedächtnisses manifestiert, sondern auch synchron in verschiedenartigen Modi der Konstitution der Erinnerung, die komplementäre ebenso wie konkurrierende, universale wie partikulare, auf Interaktion wie auf Distanz- und Speichermedien beruhende Entwürfe beinhalten können.« Sandl, Marcus: Historizität der Erinnerung/Reflexivität des Historischen. Die Herausforderung der Geschichtswissenschaft durch die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung. in: Oesterle, Günter (Hrsg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Göttingen 2005. S. 89–120, hier S. 100. 254 Sandl 2005, S. 108.
Theoretische Zugänge
59
wird zudem der Begriff der Erinnerung selbst historisiert. Ausgangspunkt dafür sind die Debatten um die Begriffe Gedächtnis und Erinnerung in den 1990er Jahren, an denen deutlich wird, dass im Begriff des Gedächtnisses viele Historiker*innen eine postmoderne Kritik an der Geschichtswissenschaft als historische Meistererzählungen sahen.255 Jan Assmann hatte aber herausgestellt, dass die »Gedächtnisgeschichte […] nicht im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft steht, sondern […] einen ihrer Zweige wie auch Ideengeschichte, Sozialgeschichte, Mentalitätsgeschichte oder Alltagsgeschichte«256 bildet, da bei Assmann Geschichte als Vergangenheit und Gedächtnis als deren Vergegenwärtigung zu komplementären Aspekten ein und desselben Untersuchungszusammenhangs gezählt werden.257 Die von Assmann definierte Komplementarität ist aber aus der Sicht Rüsens und anderer Geschichtstheoretiker problematisch, die Geschichte und Gedächtnis diachron differenzieren und als konkurrierende Formen des Umgangs mit der Vergangenheit begreifen, wonach Geschichte das Ergebnis eines Verwissenschaftlichungsprozesses ist, in dessen Folge sich die Geschichtsschreibung gegen die Dominanz lebensweltlich verankerter Erinnerung durchgesetzt hatte.258 Markus Sandl vertritt die These, dass die Geschichtswissenschaft um 1800 Teil eines Prozesses der historischen Ausdifferenzierung von Erinnerungskulturen war, in dessen Verlauf die Geschichtswissenschaft der Übermächtigkeit des Vergangenen über die Gegenwart seit Ende des 18. Jahrhunderts eine Absage erteilte und nun Gedächtnis und Geschichte nicht zwei Seiten einer Medaille waren, sondern konkurrierende Zugriffsweisen auf ein und denselben Gegenstand (Vergangenheit), die sich gegenseitig ausschlossen.259 Damit haben die »Gedächtniskritiker*innen« unter den Historiker*innen einen wichtigen Punkt angesprochen, jedoch heißt die Konkurrenz in der Zugriffsweise auf Vergangenheit nicht, dass beides nicht im Sinne einer Geschichte der Erinnerung miteinander in Verbindung gebracht werden kann, wozu es aber nötig ist, eine Konzeption des Begriffs der Erinnerung zu entwickeln, die eine konsequente Historisierung des Gegenstandes vollzieht, um Erinnerung als geschichtliches Phänomen zu fassen.260 Das Modell des SFB Erinnerungskulturen, das Erinnerung im eben beschriebenen Sinne historisiert, hat drei Ebenen: Die erste Ebene beschreibt die 255 Vgl. Niethammer, Lutz: Die postmoderne Herausforderung. Geschichte als Gedächtnis im Zeitalter der Wissenschaft. in: Rüsen, Jörn / Küttler, Wolfgang (Hrsg.): Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte. Frankfurt am Main 1993. S. 31–49. 256 Assmann, Jan: Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. Frankfurt am Main 2011. S. 26–27. 257 J. Assmann 2011, S. 27. 258 Vgl. Sandl 2005, S. 97. 259 Vgl. Sandl 2005, S. 97. 260 Vgl. Sandl 2005, S. 98–99.
60
Zugänge und Grundlagen
Rahmenbedingungen des Erinnerns und beinhaltet die Gesellschaftsinformation (Typus der Gesellschaft), Wissensordnung (im Sinne einer Diskursformation), das Zeitbewusstsein (subjektives Zeitempfinden von Gesellschaften) und die Herausforderungslage (Krisen von veralteten Erklärungs- und Interpretationsmustern angesichts gesellschaftlicher Umbrüche).261 Die vorliegende Studie wäre auf der zweiten Ebene des Modells zu verorten, die nach den Ausformungen spezifischer Erinnerungskulturen fragt. Diese zweite Ebene beinhaltet die Aspekte Erinnerungshoheit in einer Gesellschaft ( jeweilige Ausprägung entlang einer Skala mit den Polen hegemoniale Erinnerungskultur und Konkurrenz von Erinnerungskulturen), Erinnerungsinteressen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen (Konkurrenz und Koexistenz sind möglich), Erinnerungstechniken (mnemotechnische Strategien, Kommunikationsweisen und Gedächtnismedientechnologien einer Gesellschaft) und Erinnerungsgattungen (verschiedene Darstellungsformen von Vergangenheit wie Historienbild, Geschichtsfilm, historischer Roman oder Historiographie).262 Die dritte Ebene des Modells analysiert Äußerungsformen und Inszenierungsweisen des vergangenheitsbezogenen Sinns, bzw. das konkrete Erinnerungsgeschehen.263 Mathias Berek entwirft zudem eine differenzierte Theorie der Erinnerungskulturen. Berek definiert Kultur als »alle Gegenstände, Prozesse und Zustände, die auf das Wirken und Schaffen von Menschen zurückgehen und gleichzeitig an der Schaffung der menschlichen Lebenswelt beteiligt sind«264. Gedächtnis und Erinnerung grenzt Berek in der Art voneinander ab, dass Erinnerung das »gegenwärtige Reproduzieren vergangener Erfahrungen und Wahrnehmungen« ist, während Gedächtnis als Teilbereich des Wissensvorrats definiert wird, der die in der Gegenwart verfügbaren Repräsentationen der Vergangenheit bereithält.265 Die Grundlage für das kollektive Gedächtnis sind die Gedächtnisse der Individuen. Jede subjektive Wahrnehmung und Erinnerung ist von der sozialen Umwelt bestimmt, da Individuen nur wahrnehmen können, was sie in einer sozial geprägten Umwelt erleben, sodass auch die Strukturen und Inhalte ihres Gedächtnisses hochgradig sozial geformt sind.266 Es existiert also kein kollektives Gedächtnis aus sich selbst heraus, Grundlage sind immer individuelle Gedächtnisse, deren Inhalte im Verlauf der Sedimentierung in das kollektive übernommen werden.267 Das kollektive Gedächtnis ist damit das Ergebnis subjektiver Erinnerungen, die in eine objektive Struktur übernommen werden, die 261 262 263 264 265 266 267
Vgl. Erll 2017, S. 32. Vgl. Erll 2017, S. 32–33. Vgl. Erll 2017, S. 33. Berek 2009, S. 185. Vgl. Berek 2009, S. 185. Vgl. Berek 2009, S. 186–189. Vgl. Berek 2009, S. 188.
Theoretische Zugänge
61
auf die Gedächtnisse der individuellen Subjekte zurückwirkt, wobei es von den kollektiven Bedürfnissen und Zuständen in der Gegenwart, in der erinnert wird, abhängt, welche subjektiven Gedächtniselemente dabei in den kollektiven Vorrat von Vergangenheitsrepräsentationen übernommen werden, nicht aber von den Individuen oder den erinnerten Inhalten.268 Der Mensch ist ein kulturelles Wesen, das erinnert, also vergangene Erfahrungen im Zusammenhang gegenwärtiger Handlungsnotwendigkeiten reproduziert und dabei Wirklichkeit konstruiert. Dies findet in einer Vielzahl spezifischer Erinnerungskulturen statt. Erinnerungskultur ist für Berek »die Gesamtheit aller kollektiven Handlungen und Prozesse, die das kollektive Gedächtnis, seine Sinnstrukturen und seine materiellen Artefakte erhalten und ausbauen, indem mit ihnen Vergangenheit repräsentiert wird«269. Für Berek ist dabei ein entscheidender Faktor, dass »Erinnerungskultur nur medial im Sinne von öffentlich stattfinden kann«270, da sich im medialen Diskurs entscheidet, was Teil des kollektiven Gedächtnisses wird und was nicht.271 Auch im Analysemodell für Erinnerungskulturen des Gießener Sonderforschungsbereichs standen auf der zweiten Ebene (auf die sich Forschung und Publikationen des SFB stark konzentrierten)272 die Ausformung spezifischer Erinnerungskulturen und die konkreten Kommunikationsweisen und Gedächtnismedientechnologien einer Gesellschaft im Fokus. Dieses Konzept von Erinnerungskulturen des Gießener SFB und von Berek, dass erst medial vermittelte Erinnerung eines kollektiven Gedächtnisses eine Erinnerungskultur konstituiert, ist für diese Studie grundlegend, produktiv und anschlussfähig. Ausgehend von Halbwachs wurde erläutert, dass Erinnerung immer in einem sozialen Bezugsrahmen stattfindet. Der Mensch erinnert als soziales Wesen immer im Kontext bestimmter sozialer Umstände. Das kollektive Gedächtnis ist soziogen, perspektivisch, konstruktiv und identitätsstiftend. Es wurden die beiden Formen des kollektiven Gedächtnisses nach Jan Assmann erläutert: Das kommunikative Gedächtnis, das in interaktiven sprachlichen kommunikativen Prozessen Erinnerungen teilt, das vor allem Erfahrungen im Rahmen individueller Biografien transportiert und dabei informell und wenig geformt ist, das durch Interaktion im Alltag entsteht, das durch lebendige Erinnerung in organischen Gedächtnissen in Form von Erfahrungen und Hörensagen transportiert wird und das von einer unspezifischen Zeitzeugenschaft, einer Erinnerungsgemeinschaft, getragen wird. 268 269 270 271 272
Vgl. Berek 2009, S. 188. Berek 2009, S. 192. Berek 2009, S. 189. Vgl. Berek 2009, S. 189. Siehe dazu die Publikationen bei Vandenhoeck & Ruprecht seit 2000 erscheinende Reihe Formen der Erinnerung und die bei de Gruyter seit 2004 erscheinende Reihe Medien und kulturelle Erinnerung.
62
Zugänge und Grundlagen
Das kulturelle Gedächtnis transportiert eine rekonstruierte Vergangenheit in externalisierten Medien, welche sich als feste Objektivationen in traditioneller symbolischer Kodierung und Inszenierung in Wort und Bild etc. präsentieren. Es hat dabei einen identitätsstiftenden Charakter. Die gesellschaftlichen Träger des kulturellen Gedächtnisses zeichnen sich durch ihre Spezialisierung aus. Der Übergang aus dem kommunikativen Gedächtnis ins kulturelle Gedächtnis wird durch Medien gewährleistet. Für diese Untersuchung dienen Jan Assmanns Konzepte vom kommunikativen und kulturellen Gedächtnis als theoretischer Hintergrund und als analytischer Ausgangspunkt, von dem Erinnerungskulturen in den Social Media beschrieben werden sollen. Entscheidend ist dabei die Einsicht in die Rolle der Medien für kollektive Erinnerungsprozesse, in denen eine rekonstruierte Vergangenheit in Medien externalisiert wird. Es wurde definiert, dass das kollektive Gedächtnis selbst nicht beobachtbar oder empirisch analysierbar ist, sondern sich in Akten kollektiver Erinnerung und in Erinnerungskulturen ausdrückt. Dabei wird in dieser Untersuchung das Konzept der Erinnerungskultur des Gießener Sonderforschungsbereichs 434 Erinnerungskulturen verwendet, das die Dynamik, Kreativität, Prozesshaftigkeit und vor allem die Pluralität der kulturellen Erinnerung in den Vordergrund rückt und die Ausformung spezifischer Erinnerungskulturen und die konkreten Kommunikationsweisen und Gedächtnismedientechnologien einer Gesellschaft im Fokus hat. Ähnlich argumentiert Mathias Berek, der in seiner Theorie der Erinnerungskultur davon ausgeht, dass der Mensch als kulturelles Wesen zunächst individuell erinnert und dabei vergangene Erfahrungen im Zusammenhang gegenwärtiger Handlungsnotwendigkeiten reproduziert und Wirklichkeit konstruiert. Die Inhalte des individuellen Gedächtnisses werden als Ergebnis subjektiver Erinnerungen in ein kollektives Gedächtnis übernommen. Dabei hängt es von kollektiven Bedürfnissen und Zuständen in der Gegenwart ab, welche individuellen Gedächtniselemente in den kollektiven Vorrat von Vergangenheitsrepräsentationen übernommen werden. Dies findet medial vermittelt in einer Vielzahl spezifischer Erinnerungskulturen statt. Letztlich entscheidet der mediale Diskurs, was Teil des kollektiven Gedächtnisses wird und was nicht. Erinnerung wird also in dieser Studie als Gebrauch des Gedächtnisses verstanden, als prozesshafte dynamische Aneignung von Vergangenheit in kommunikativen, medialen Diskursen, in denen sich Erinnerungskulturen konstituieren. Damit liefern Aleida und Jan Assmanns Theorien in Verbindung mit dem Konzept der Erinnerungskulturen einen fundamentalen theoretischen Zugang, um Social Media als Medien des kollektiven Gedächtnisses zu beschreiben. Im folgenden Kapitel wird die für kollektive Erinnerungsprozesse entscheidende Funktion von Medien in kollektiven Erinnerungsprozessen weiter vertieft, wird der für diese Untersuchung leitende Medienbegriff definiert und es werden weitere medientheoretische und -begriffliche Grundlagen erläutert werden.
Theoretische Zugänge
63
2.1.3. Medientheoretische und -begriffliche Grundlagen Die geschichtsdidaktische Diskussion um Medienbegriffe hat sich v. a. in Bezug auf digitale Medien sehr stark auf Medien als Lern- und Unterrichtsmedien konzentriert,273 während der Fokus im Folgenden ausgehend vom Erkenntnisinteresse dieser Studie im Allgemeinen auf (digitale) Medien und im Speziellen auf Social Media als Träger kollektiver Gedächtnisprozesse gerichtet ist. Am Beginn dieses Abschnittes soll die Frage stehen, wie Medien in einem als soziales Phänomen verstandenem kollektiven Gedächtnis Erinnerungskulturen konstituieren. Allgemein haben Zeichenprozesse in Gesellschaften die Aufgabe, Wissen über Generationengrenzen hinweg zu transportieren, denn »intersubjektive Erfahrungsablagerungen können erst dann als gesellschaftlich bezeichnet werden, wenn ihre Objektivation mit Hilfe eines Zeichensystems vollzogen worden ist«274 und sie dadurch wiederholbar sind. Dabei sind Erinnerungen abhängig von der gesellschaftlichen Organisation ihrer Weitergabe und von den dabei genutzten Medien.275 Rekonstruktionen von Vergangenheit in sozialen und kulturellen Kontexten sind nur durch Medien möglich, da auf kollektiver Ebene Gedächtnis immer medial vermittelt ist.276 Medien sind Träger von Wissen, aber auch Auslöser von Erinnerungsakten. 273 Vgl. u. a. Bernsen, Daniel / König, Alexander / Spahn, Thomas: Medien und historisches Lernen: Eine Verhältnisbestimmung und ein Plädoyer für eine digitale Geschichtsdidaktik. in: Zeitschrift für digitale Geschichtswissenschaften 1 (2012). Heft 1. S. 1–27; Schwabe, Astrid: Historisches Lernen im World Wide Web: Suchen, flanieren oder forschen? Fachdidaktischmediale Konzeption, praktische Umsetzung und empirische Evaluation der regionalhistorischen Website Vimu.info. Göttingen 2012. S. 77–156; Hodel, Jan: Verkürzen und Verknüpfen. Geschichte als Netz narrativer Fragmente. Wie Jugendliche digitale Netzmedien für die Erstellung von Referaten im Geschichtsunterricht verwenden. Bern 2013. S. 82–126; Pallaske, Christoph: Sprachverwirrung. Was ist ein geschichtsdidaktisches Medium? in: Public History Weekly 2 (2014). URL: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2311 vom 10. 7. 2014 (Zugriff am 01. 02. 2018); Pallaske, Christoph: Die Vermessung der (digitalen) Welt. Geschichtslernen mit digitalen Medien. in: Demantowsky, Marko / Pallaske, Christoph (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin, München u. a. 2015. S. 135–147; Pallaske, Christoph (Hrsg.): Medien machen Geschichte. Neue Anforderungen an den geschichtsdidaktischen Medienbegriff im digitalen Wandel. Berlin 2015; Pandel, Hans-Jürgen / Becher, Ursula A. J. (Hrsg.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2017; Danker, Uwe / Schwabe, Astrid: Geschichte im Internet. Stuttgart 2017. S. 11–16; Bernsen, Daniel / Kerber, Ulf (Hrsg.): Praxishandbuch Historisches Lernen und Medienbildung im digitalen Zeitalter. Leverkusen 2017. 274 Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main 2009. S. 72. 275 Vgl. Burke, Peter: Geschichte als soziales Gedächtnis. in: Assmann, Aleida / Harth, Dietrich (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt am Main 1991. S. 289–304, hier S. 292. 276 Vgl. Erll, Astrid: Medium des kollektiven Gedächtnisses. Ein (erinnerungs-) kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kol-
64
Zugänge und Grundlagen
Es sind Massenmedien, die in modernen, komplexen Gesellschaften die Kommunikation zwischen den Mitgliedern vermitteln.277 Massenmedien sind dabei ein integraler Bestandteil moderner Gesellschaften.278 Niklas Luhmann, der als Begründer der modernen Systemtheorie gilt,279 und seine theoretischen Ansätze zur Konzeptualisierung von Massenmedien und deren Bedeutung für die Gesellschaft scheinen an dieser Stelle hilfreich, um das Phänomen Massenmedien begrifflich zu schärfen. Nach Luhmann setzt sich die Gesellschaft aus sozialen Systemen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Religion, Kunst, Recht und Politik zusammen, die ihrerseits operativ geschlossen und funktional exklusiv sind und sich autopoietisch reproduzieren.280 Es sind die Medien, die in der Gesellschaft Selbstbeobachtung dirigieren.281 Massenmedien, die auch den Rang eines sozialen Systems haben,282 sind aus systemtheoretischer Sicht konstitutiv für die Gesellschaft, denn »die Gesellschaft ist ein kommunikativ geschlossenes System. Sie erzeugt Kommunikation durch Kommunikation«283, wobei Kommunikation eine dreiteilige Einheit aus Information, Mitteilung und Verstehen bildet,284 dabei aber nicht die Leistung eines handelnden Subjektes hat, sondern als ein Selbstorganisationsphänomen fungiert.285 Massenmedien sind in der Luhmannschen Auffassung ein »Funktionssystem eigener Art […], das mit Hilfe des Codes Information/Nichtinformation Weltbeschreibung (inklusive Gesellschaftsbeschreibung) anfertigt«286. Es sind die Massenmedien, die »die Welt in der Gesellschaft für die Gesellschaft«287 repräsentieren. »Die eigentliche Funktion der Massenmedien liegt […] im Lancieren und Prozessieren von Themen, die
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
lektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004. S. 3–22, hier S. 4–5; Zierold, Martin: Memory and Media Cultures. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar / Young, Sara B. (Hrsg.): Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook. Berlin, New York 2008. S. 399–408, hier S. 399. Vgl. Berek 2009, S. 87. Schweiger, Wolfgang: Theorien der Mediennutzung. Eine Einführung. Wiesbaden 2007. S. 11. Vgl. Weber, Stefan: Systemtheorien der Medien. in: Weber, Stefan (Hrsg.): Theorien der Medien. Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus. Stuttgart 2010. S. 189–206, hier S. 191. Vgl. Weber, Stefan: Konstruktivismus und Non-Dualismus, Systemtheorie und Distinktionstheorie. in: Scholl, Armin (Hrsg.): Systemtheorie und Konstruktivismus in der Kommunikationswissenschaft. Konstanz 2002. S. 21–36, hier S. 30. Vgl. Berghaus, Margot: Luhmann leicht gemacht. Eine Einführung in die Systemtheorie. Stuttgart 2010. S. 11. Vgl. Weber 2002, S. 30. Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2004. S. 95. Vgl. Kneer, Georg / Nassehi, Armin: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung. München 2000. S. 95. Vgl. Simon, Fritz B.: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus. Heidelberg 2011. S. 94. Luhmann, Niklas: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2000. S. 304. Luhmann 2000, S. 304.
Theoretische Zugänge
65
erst den möglichen Einstellungen eine Chance geben, sich in der Form von Beiträgen zum Thema bemerkbar zu machen.«288 Nach Luhmann sind es »in der modernen Gesellschaft die Massenmedien, die am Entstehen der öffentlichen Meinung beteiligt sind«289. Medien vermitteln keine Wirklichkeit, sie prägen sie.290 Den Begriff des Gedächtnisses integriert Luhmann dabei wie folgt: Die öffentliche Meinung bildet für die Gesellschaft ein öffentliches Gedächtnis ohne bestimmten Verpflichtungsgehalt. Sie mag Werte und Normen in sich aufnehmen, aber dann so, daß die konkrete Meinung damit noch nicht determiniert ist. Sie bietet Anknüpfungspunkte für die öffentliche wie für die private Kommunikation und grenzt Kommunikationen aus, die als unverständlich, pathologisch falsch oder einfach als lächerlich erscheinen würden.291
Massenmedien bieten Schemata zur Realitätskonstruktion an, die ein soziales gesellschaftliche Gedächtnis formen.292 Für das System der Gesellschaft ist Gedächtnis die Summe von Realitätsannahmen, die ohne Begründung und individuelle Perspektiven als Konsens vorausgesetzt werden.293 Für Luhmann wird »allein dadurch, dass jede Kommunikation bestimmten Sinn aktualisiert, […] ein soziales Gedächtnis reproduziert«294. Die Funktion dieses kollektiven Gedächtnisses ist aber nicht Speicherung, sondern das »laufende Diskriminieren von Vergessen und Erinnern«295, wobei für Luhmann »die Hauptfunktion des Gedächtnisses im Vergessen«296 liegt. An dieser Stelle muss aber erwähnt werden, dass sich Luhmann damit von der in dieser Studie vertretenen Idee eines kollektiven Gedächtnisses abgrenzt.297 Aber auch wenn diese Untersuchung davon ausgeht, dass Bewusstseinssysteme nicht nur Kommunikation in Gang setzen, sondern in eine Praxis des kollektiven Erinnerns eingebunden sind, ist der systemtheoretische Ansatz insoweit wichtig, 288 Luhmann 2000, S. 305. 289 Luhmann 2000, S. 303. 290 Vgl. Vattimo, Gianni / Welsch, Wolfgang: Medien, Welten, Wirklichkeiten. München 1998. S. 7. 291 Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. S. 300. 292 Ohlemacher, Thomas: Die Beobachtung sozialer Bewegung. Eine Annäherung von Systemtheorie und Netzwerkanalyse. in: Moser, Sibylle (Hrsg.): Konstruktivistisch Forschen? Methodologie, Methoden, Beispiele. Wiesbaden 2011. S. 145–171, hier S. 149. 293 Vgl. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Opladen 1996. S. 19. 294 Luhmann 1996, S. 584. 295 Vgl. Luhmann 1996, S. 76. 296 Luhmann 2000, S. 172. 297 »Es geht dabei nicht um das sogenannte »Kollektivgedächnis«, das nur darin besteht, daß Bewusstseinssysteme, wenn sie gleichen sozialen Bedingungen ausgesetzt sind, im Großen und Ganzen dieselben Sachverhalte erinnern. Das soziale Gedächtnis ist keines Wegs das, was Kommunikationen als Spuren in individuellen Bewusstseinssystemen hinterlassen. Sondern es geht um eine Eigenleistung kommunikativer Operationen, um ihre eigene, unentbehrliche Rekursivität«. Luhmann 2004, S. 583–584.
66
Zugänge und Grundlagen
als dass Gedächtnis in der Systemtheorie Luhmanns eine unpersönliche und äußerliche Eigenleistung von Kommunikation der publizistischen Medien ist und Medien daher konstitutiv für die Produktion und Reproduktion eines sozialen Gedächtnisses sind.298 Luhmanns Zusammenhang von Gedächtnis und Medien bedeutet angewendet auf kollektive Gedächtnisprozesse, dass Medien zwar am Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses beteiligt, nicht aber dessen ausschließlicher Träger sind, da interpersonale und nichtmassenmediale Interaktionen Einfluss auf den Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses haben.299 Elena Esposito knüpft ihren Thesen an Luhmanns systemtheoretische Überlegungen zur Entstehung eines kollektiven Gedächtnisses an und geht davon aus, dass Kommunikationstechnologien Formen, Reichweite und Interpretationen des Gedächtnisses der Gesellschaft beeinflussen.300 Esposito muss aber ebenfalls um die Annahme erweitert werden, dass sich erst im Zusammentreffen von Kommunikationstechnologien und deren Nutzer*innen die Bedeutung von Medientechnologien für die Konstruktion eines kollektiven Gedächtnisses erfassen lässt.301 Dies gilt umso mehr für kollektive Gedächtnisprozesse im digitalen Zeitalter. Denn fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung ermöglichen es heute, in qualitativ und quantitativ bisher ungekanntem Ausmaß so gut wie jedes kulturelle Produkt digital zu speichern.302 Mit dem Internet als Speichermedium verbinden sich einerseits große Ängste, dass die digitale Speicherung kulturelle Erinnerung zerstören würde,303 da digitales Speichern dem Vergessen gleich käme,304 weil mit digitalen Speichermedien eine »Erosion des kulturellen, nationalen
298 Vgl. Hein 2009, S. 67. 299 Vgl. Ludes, Peter: Kollektives Gedächtnis und kollektive Vernachlässigung. in: Ludes, Peter / Schanze, Helmut (Hrsg.): Medienwissenschaften und Medienwertung. Opladen u. a. 1999. S. 171–190, hier S. 171. 300 Vgl. Esposito, Elena: Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft. Mit einem Nachwort von Jan Assmann. Frankfurt am Main 2005. S. 10. 301 Vgl. Morley, David: Familienfernsehen und Medienkonsum zu Hause. in: Television 2001 (14). Heft 1. S. 20–25, hier S. 20. 302 Vgl. Dreier, Thomas: Kulturelles Gedächtnis – Digitales Gedächtnis. Eine Einführung. in: Dreier, Thomas (Hrsg.): Kulturelles Gedächtnis im 21. Jahrhundert. Moderne Speichertechnologien, Aufbewahrungs-praktiken und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Karlsruhe 2005. S. 3–18, hier S. 3. 303 Vgl. Osten, Manfred: Das geraubte Gedächtnis. Digitale Systeme oder die Zerstörung der Erinnerungskultur. Eine kleine Geschichte des Vergessens. Frankfurt am Main. 2004. 304 Osten, Manfred: Gespeichert, das heißt vergessen. Moderne Speichertechnologien, Aufbewahrungspraktiken und ihre gesellschaftlichen Implikationen. in: Dreier, Thomas (Hrsg.): Kulturelles Gedächtnis im 21. Jahrhundert. Moderne Speichertechnologien, Aufbewahrungspraktiken und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Karlsruhe 2005. S. 185–196.
Theoretische Zugänge
67
und individuellen Gedächtnis[ses]«305 verbunden sei. Andererseits verbinde das Internet die Weisheit der Einzelnen zur »Weisheit der Vielen«306 und es trage sogar zur wirtschaftlichen Demokratisierung307 bei, erlaube ein ewiges Totengedenken308 und könne womöglich die »fundamentalste Ordnungsregel der realen Welt außer Kraft […] setzen: Jetzt hat nicht mehr alles seinen festen Platz […].«309 Zudem speichere das Netz alles.310 Es gibt Ansätze, das Internet als unendlich großes Menschheitsgedächtnis oder umfassende Weltenzyklopädie zu beschreiben.311 Doch das ewige Weltgedächtnis Internet ist ein Mythos.312 Wikipedia hat beispielsweise als möglicher Wissensspeicher der Menschheit schon heute erhebliche technische und finanzielle Probleme bei der Langzeitarchivierung der ständig fluiden Datenmasse.313 Auch wenn tiefgreifende Veränderungen in der Architektur des kulturellen Gedächtnisses aufgrund des Speicher- und Kommunikationsmediums Internet unübersehbar sind,314 so kann das Internet heute nicht die Funktion eines ewigen Menschheitsgedächtnisses wahrnehmen, sondern muss als »riesige[r] Datenpool ohne Langzeitspeicher«315 bezeichnet werden. Denn mit dem Verlust der Materialität des Gespeicherten ist vermutlich eine drastische Reduktion der Langzeitstabilität verbunden, da bestimmte Formate 305 Osten, Manfred: Digitalisierung und kulturelles Gedächtnis. in: APuZ 53 (2006). Heft 5/6. S. 3–8, hier S. 5. 306 Surowiecki, James: Die Weisheit der Vielen. Warum Gruppen klüger sind als Einzelne. München 2007. 307 Anderson, Chris: The long tail. Nischenprodukte statt Massenmarkt. Das Geschäft der Zukunft. München 2009. S. 61–67. 308 Vgl. Gebert, Katrin: Carina unvergessen. Erinnerungskultur im Internetzeitalter. Marburg 2009. 309 Weinberger, David: Das Ende der Schublade. Die Macht der neuen digitalen Unordnung. München 2008. S. 16. 310 Vgl. Polke-Majewski, Karsten: Kein Vergeben, kein Vergessen. Das Internet hat ein gnadenloses Gedächtnis: Sein Wissen über die Menschen hält ewig. in: DIE ZEIT (2011). Heft 15. URL: http://www.zeit.de/2011/15/Internet-Gedaechtnis vom 07. 12. 2011 (Zugriff am 03. 11. 2017). 311 Vgl. Winkler, Hartmut / Lovink, Geert: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. Regensburg 1997. S. 54 und 62; Rosenzweig, Roy: Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era. in: American History Review 108 (2003). Heft 3. S. 735–762. 312 Greis, Andreas: Das World Wide Web als Menschheitsgedächtnis. Zum Unterschied zwischen Speichern und Erinnern. in: Forum Medienethik 6 (1999). Heft 1. S. 70–77, hier S. 72– 73. 313 Vgl. Lorenz, Maren: Wikipedia als »Wissensspeicher« der Menschheit. Genial, gefährlich oder banal? in: Meyer, Erik (Hrsg.): Erinnerungskultur 2.0. Kommemorative Kommunikation in digitalen Medien. Frankfurt am Main, New York 2009. S. 207–236, hier S. 236. 314 J. Assmann 2002. S. 246. 315 Vgl. Assmann, Aleida: Zur Mediengeschichte des kulturellen Gedächtnisses. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York 2004. S. 45–60, hier S. 55.
68
Zugänge und Grundlagen
und Datenträger ohne die passende Hardware nicht mehr lesbar sein könnten.316 Noch bevor die Speichermedien zerfallen, könnte die Hardware obsolet sein, derer sie bedurften, womit auch die fortschrittlichste Software mit dem Zahlenstrom aus Nullen und Einsen überfordert wäre.317 Damit wäre das Wissen einer mittelalterlichen Urkunde womöglich besser gespeichert als die Daten auf einem Server von Google, YouTube, Wikipedia oder Facebook. Für die Assmanns haben die Demokratisierung der Kultur und der Eintritt ins elektronische Zeitalter ebenfalls ambivalente Folgen, da zum einen »durch die gesteigerte Transportgeschwindigkeit und Speicherkapazität der Medien, die ihre Botschaften ohne Substanzverluste über den Globus tragen, eine virtuelle Weltkommunikationsgemeinschaft«318 entstehe. Dies hätte auch Sprachlosigkeit und Analphabetisierung zur Folge. Diese werden ausgelöst durch »rechnergestütztes Denken, das unter Umgehung der natürlichen Sprache vorangetrieben wird und sich zunehmend von dieser entfernt, so daß die Ergebnisse dieses Denkens nicht mehr in Sprach – und das heißt schließlich: menschlich kommunizierbare Erfahrungen – übersetzt werden können«319. Während für die orale Kultur das individuelle menschliche Gedächtnis und für die Buchkultur die Sprachgestütztheit der Kommunikation entscheidend waren, so gilt für das elektronische Zeitalter, dass beides zwar immer noch in Gebrauch ist, aber seine »kulturprägende Dominanz« verliert.320 Aleida Assmann sieht im »digitale[n] Zahlenkode […] ein neues Gefühl für die Materialität der Datenträger«321, das erzeugt werde durch »die elektronische Flüchtigkeit für ihre Haltbarkeit und die Beschleunigung des Informationsflusses für die Beständigkeit von Nachrichten«322. Aleida Assmann kommt daher zu folgendem Schluss: Die Allianz von Schrift und Gedächtnis wird von der elektronischen Schrift aufgelöst. […] Die digitale Schrift ist kraft ihrer ˏImmaterialitätˊ bzw. elektronischen Energie eine fließende Schrift. […] Die Funktionen des Speicherns und Löschens liegen bei der Digitalschrift extrem nahe beieinander, sie sind nur einen Fingerdruck voneinander entfernt.323
316 Vgl. Sick, Franziska: Digitales Recht und digitales Gedächtnis. in: Sick, Franziska (Hrsg.): Medium und Gedächtnis. Von der Überbietung der Grenze(n). Frankfurt am Main 2004. S. 43–69, hier S. 56. 317 Vgl. Zimmer, Dieter E.: Die Bibliothek der Zukunft. Text und Schrift in den Zeiten des Internet. Hamburg 2000. S. 179. 318 Assmann / Assmann 1994, S. 137. 319 Assmann / Assmann 1994, S. 137. 320 Assmann / Assmann 1994, S. 139. 321 A. Assmann 2007, S. 157. 322 A. Assmann 2007, S. 157. 323 A. Assmann: 2010, S. 211–212.
Theoretische Zugänge
69
Der digitalen Schrift fehle eben aufgrund ihrer Immaterialität die Eigenschaft der Gravur, sie könne jederzeit verändert oder gelöscht werden, die »Daten verflüssigen sich«324. Zudem hafte allem für längere Zeit Gespeicherten und nicht Revidierten der Makel des Veralteten an, sodass für Aleida Assmann »die angemessene Metapher für das Internet deshalb nicht die Bibliothek oder das Archiv [ist], sondern die Börse mit ihren Stimmungsschwankungen und ihrem rapiden Aktualitätsverfall«325. Esposito spricht Teilen der Kommunikation im Internet sogar ab, dass sie überhaupt Kommunikation seien. Da Informationen teilweise autonom durch Algorithmen von Programmen erzeugt werden würden, seien diese weder von dem Sinn der originären Information, noch von dem Sinn der Programmierer*innen geleitet, weil die Handelnde eine Maschine sei, die einen originalen Text reproduziere und der freien Interpretation der Benutzer*innen verfügbar mache.326 Im Zusammenhang mit neuen Medien spricht Esposito in diesem Zusammenhang von einer Transformation des Gedächtnisses.327 Um diese Transformationsprozesse begrifflich greifen zu können, entwickelt sie das Konzept des telematischen Gedächtnisses.328 Individuelle Selektion ist also hier wichtiger als Information, da Information im Internetzeitalter unbegrenzt zur Verfügung steht. Ein Mehr an Information erfordert auch ein erhebliches Mehr an Selektionsleistungen.329 Auch Wolfgang Ernst macht die Rolle der Selektion von Information im Umgang mit dem Internet stark, da es das Wissen allenfalls enzyklopädisch ordne, es aber kaum hierarchisiere.330 Esposito sieht daher die 324 Vgl. Assmann, Aleida: Das Archiv und die neuen Medien des kulturellen Gedächtnisses. in: Stanitzek, Georg / Voßkamp, Wilhelm (Hrsg.): Schnittstelle. Medien und kulturelle Kommunikation. Köln. S. 268–281, hier S. 280. 325 Vgl. A. Assmann 2004, S. 56. 326 Vgl. Esposito, Elena: Kollektives Gedächtnis und soziales Gedächtnis. Erinnerung und Vergessen aus der Sicht der Systemtheorie. in: Klein, Sonja (Hrsg.): Gedächtnisstrategien und Medien im interkulturellen Dialog. Würzburg 2011. S. 49–59, hier S. 57–58. 327 Esposito 2005, S. 287. 328 »Das telematische Gedächtnis behält keine Informationen, sondern nur die eigenen Entscheidungen. Hieraus erklären sich auch die zentrale Bedeutung und die Affinität von Telematik und Organisationen. Beide privilegieren das Moment der Selektion und eine höhere Kontrollmöglichkeit, die sich aus der Verknüpfung von Selektionen (die Knoten im Netz als reine Verbindungsstellen) und eben nicht aus der direkten Verknüpfung von Informationen ergibt. […] In Anbetracht der Flüchtigkeit von Information wird eine auf Information basierende Gesellschaft immer von einem Übermaß an virtueller Information bedrängt werden, gleichzeitig wird sie jedoch immer auch an chronischer Desinformation leiden und sich ständig auf der Suche nach Informationen befinden, welche diejenigen ersetzen sollen, die sich in dem Moment vernichten, in dem sie kommuniziert werden.« Esposito 2005, S. 345. 329 Vgl. Jäckel, Michael: Medienwirkungen. Ein Studienbuch zur Einführung. Wiesbaden 2011. S. 315. 330 Vgl. Ernst, Wolfgang: Das Gesetz des Gedächtnisses. Berlin 2007. S. 265–266.
70
Zugänge und Grundlagen
»Relevanz der sogenannten neuen Medien […] nicht so sehr in einer gesteigerten Fähigkeit […] die Daten aufzubewahren, sondern in einer höheren und sehr raffinierten Fähigkeit zu vergessen«331. Vergessen wird auf diese Art zur Tugend im digitalen Zeitalter.332 Esposito wechselt auf spannende Weise die Perspektive und definiert ihr telematisches Gedächtnis weniger unter den Paradigmen Speicherung, Erinnerung und Stabilisierung, sondern Variation, Selektion und Vergessen.333 Anbieter*innen sind im Internet daher gezwungen, sich einer »Ökonomie der Aufmerksamkeit«334 zu unterwerfen. Das Massenmedium Internet steht also als Speicher- und Kommunikationsmedium zwischen den Paradigmen Speichern und Vergessen und kann als riesiger Datenpool ohne Langzeitspeicher beschrieben werden, in dem sich durch den Verlust der Materialität des Gespeicherten eine drastische Reduktion der Langzeitstabilität vollzieht. Die von Aleida Assmann beschriebene Verflüssigung von Daten und der rapide Aktualitätsverfall in Kombination mit einer teilweise automatisierten Computerkommunikation und Datenschöpfung zwingt die Nutzer*innen im telematischen Gedächtnis Internet ständig zur Selektion. Dieser Effekt ist insbesondere in den Social Media ein Faktor bei der Mediennutzung.335 Im Folgenden soll der Blick von diesen allgemeinen Überlegungen zur Rolle von Medien in kollektiven Gedächtnisprozessen und zur Frage des Leistungsvermögens von Online-Medien als Speichermedien ausgehend stärker auf das konkrete in dieser Studie zu untersuchende mediale Feld, Social Media, gerichtet 331 Esposito, Elena: Eine Erinnerung an das Vergessen. in: Erwägen Wissen Ethik 13 (2002). Heft 2. S. 248–249, hier S. 249; Vgl. Esposito, Elena: Die Formen des Web-Gedächtnisses. Medien und soziales Gedächtnis. in: Lehmann, René (Hrsg.): Formen und Funktionen sozialen Erinnerns. Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen. Wiesbaden 2013. S. 91– 103; Esposito, Elena: Social Forgetting: A Systems-Theory Approach. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar / Young, Sara B. (Hrsg.): Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook. Berlin, New York 2008. S. 181–190. 332 Vgl. Mayer-Schönberger, Viktor: Delete. Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten. Berlin 2010. 333 »Man erinnert nicht deshalb, um die Vergangenheit aufzubewahren, sondern um sich von ihr zu befreien und eine autonome Perspektive zu gewinnen. Das Gedächtnis ist dann keine mehr oder weniger selektive Aufbewahrung der Vergangenheit […], sondern eher ihre Rekonstruktion in der Form von Erinnerungen, die nur in dem Unterschied zu dem existieren, was unvermeidlich vergessen werden muss. Die Erinnerung ist keine unabhängige Einheit, sondern nur eine Seite der für das Gedächtnis grundlegenden Unterscheidung Erinnerung/Vergessen: wenn man nicht vergisst, kann man auch nicht erinnern, und je mehr man vergisst, desto leistungsfähiger wird die Fähigkeit zum Erinnern sein.« Esposito: 2002, S. 248. 334 Franck, Georg: Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf. München 2007. 335 Vgl. Meyer, Erik: Problematische Popularität? Erinnerungskultur, Medienwandel und Aufmerksamkeitsökonomie. in: Korte, Barbara / Paletschek, Sylvia (Hrsg.): History goes pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. Bielefeld 2009. S. 267–287.
Theoretische Zugänge
71
werden. Verknüpft wird dies mit der Erläuterung des für diese Studie zentralen Medienbegriffs: Astrid Erlls Mediums des kollektiven Gedächtnisses. Denn um kollektive Erinnerungsprozesse in den Social Media analytisch sichtbar zu machen, braucht es zwingend einen Medienbegriff, der Medien von ihrer funktionalen Erinnerungsseite her definiert und beschreibt. Astrid Erlls Begriff des Mediums des kollektiven Gedächtnisses in seinen verschiedenen Dimensionen und Komponenten kann dies leisten und ist für diese Untersuchung sowohl in theoretischer als auch in methodisch analytischer Hinsicht leitend. Gedanklicher Ausgangspunkt soll die folgende Feststellung von Sybille Krämer über das Wechselverhältnis von Medien und transportieren Botschaften sein: Medien übertragen nicht einfach Botschaften, sondern entfalten eine Wirkkraft, welche die Modalitäten unseres Denkens, Wahrnehmens, Erinnerns und Kommunizierens prägt. […] Medialität drückt aus, daß unser Weltverhältnis und damit alle unsere Aktivitäten und Erfahrungen mit welterschließender […] Funktion geprägt sind von den Unterscheidungsmöglichkeiten, die Medien eröffnen, und den Beschränkungen, die sie dabei auferlegen.336
Diese Einsicht, dass unsere Wirklichkeit grundsätzlich medial geprägt ist, ist für die in die kollektive Gedächtnisbildung involvierten Medien erkenntnisfördernd337 und eine für diese Untersuchung leitende und produktive Einsicht. Erll definiert für Medien des kollektiven Gedächtnisses zwei Prämissen: Zum einen sind Medien keine neutralen Träger oder Behältnisse von Gedächtniszeichen, sondern es bleibt stets an den mediengestützten kollektiven Erinnerungs- und Deutungsakten eine »Spur« des Gedächtnismediums haften; zum zweiten sind Gedächtnismedien mehr als eine Erweiterung des individuellen menschlichen Gedächtnisses, sie erzeugen eigene medial konstruierte Welten des kollektiven Gedächtnisses, die je nach Maßgabe ihres spezifischen gedächtnismedialen Leistungsvermögens ohne diese Medien nicht existieren würden.338 Erll entwirft einen weiten Medienbegriff, da zum einen im engeren Sinne medientheoretische und kommunikationswissenschaftliche Konzepte nur einen Teilbereich des Verhältnisses von Medialität und Kollektivgedächtnis beleuchten können, die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung aber einen weiten Medienbegriff benötigt, der die für die Bildung eines kollektiven Gedächtnisses relevanten Phänomene erfassen kann.339 Ein kulturwissenschaftlich und gedächtnistheoretisch fundierter Medienbegriff muss zum anderen die verschiedenen medialen 336 Krämer, Sybille: »Was haben Medien, der Computer und die Realität miteinander zu tun?«. in: Krämer, Sybille (Hrsg.): Medien-Computer-Realität. S. 9–26, hier S. 14. 337 Vgl. Erll 2004, S. 6. 338 Vgl. Erll 2004, S. 6. 339 Vgl. Erll 2004, S. 11.
72
Zugänge und Grundlagen
Phänomene erfassen und zugleich sichtbar voneinander differenzieren können; er muss verschiedene Medien wie Literatur, Fernsehen oder Internet vergleichbar machen und dabei die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und spezifischen Leistungsvermögen der jeweiligen Gedächtnismedien und mediale Phänomene verschiedener historischer Epochen und kultureller Kontexte erfassen können, ohne dabei die Unterschiede zwischen diesen Phänomenen zu nivellieren.340 Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, entwirft Erll ein ausdifferenziertes Mehrebenenmodell für Medien des kollektiven Gedächtnisses, das sich für diese Untersuchung als in höchstem Maße handhabbar, produktiv und anschlussfähig erweisen wird. Erlls Medienbegriff hat zwei Dimensionen: eine materiale und eine soziale. Die materiale Dimension hat drei Komponenten. Die erste Komponente bilden »semiosefähige Kommunikationsinstrumente zur Externalisierung gedächtnisrelevanter Informationen«341: Erst durch semiosefähige Kommunikationsmittel (mündliche Sprache, Schrift, Bild oder Ton) werden Externalisierungen möglich,342 die, wie schon gezeigt, die Voraussetzungen zur Bildung eines kollektiven Gedächtnisses sind. Social Media zeichnen sich durch eine hypermediale Vernetzung verschiedenster Kommunikationsmittel aus, was an späterer Stelle noch erläutert werden wird. Die zweite Komponente der materialen Dimension von Erlls Medienbegriff bilden die »Medientechnologien zur Verbreitung und Tradierung von Gedächtnisinhalten«343: Es sind diese konkreten Medientechnologien, die Verbreitung (räumlich) und Tradierung (zeitlich) von Inhalten des kollektiven Gedächtnisses erst möglich machen.344 Die Kommunikationsinstrumente (Komponente 1) erreichen erst durch die Medientechnologien die Erinnerungsgemeinschaften, ohne aber dass die Medientechnologien dabei neutrale Behältnisse für gedächtnisrelevante Semiosen wären, sondern es sind ihre spezifische Materialität, ihr Leistungsvermögen und ihre Grenzen, die die Botschaft beeinflussen, die sie verbreiten und tradieren.345 Für die Gedächtnisforschung ist diese zweite Komponente deshalb besonders interessant, da dies für die kollektive Erinnerungspraxis bedeutet, dass, wenn signifikante Veränderungen in der Medientechnologie (Internet, Web 2.0, Social Media, konkrete Social-Network-Dienste wie Facebook) stattfinden, dies Rückwirkungen auf das kollektive Gedächtnis und die konkreten Erinnerungskulturen hat. Im Zusammenhang dieser Untersuchung bedeutet dies, dass über die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust in 340 341 342 343 344 345
Vgl. Erll 2004, S. 11. Erll 2004, S. 14. Vgl. Erll 2004, S. 14. Erll 2004, S. 14. Vgl. Erll 2004, S. 14. Vgl. Erll 2004, S. 14.
Theoretische Zugänge
73
den Social Media eigene, medienspezifische Narrationen konstruiert werden, die in einem anderen Medium nicht möglich wären und dass auf diese Weise in den Social Media charakteristische Erinnerungskulturen in etabliert werden, die es in dieser Studie zu untersuchen gilt. Die dritte Komponente von Erlls Medienbegriff in der materialen Dimension sind »kulturelle Objektivationen als konkrete Gedächtnismedienangebote und ihre formale Gestaltung«346: Es sind die kulturellen Objektivationen (Literatur, Dokumente eines Archivs, Fotografien etc.), die zu Medienangeboten des kollektiven Gedächtnisses werden.347 In Bezug auf Erinnerungskulturen in den Social Media handelt es sich bei den kulturellen Objektivationen um hypermediale Dokumente, die mit anderen kulturellen Objektivationen durch Hyperlinks verknüpft sind. Die zweite Dimension von Erlls Medienbegriff ist die soziale Dimension. Diese beinhaltet die vierte Komponente von Erlls Medienbegriff des kollektiven Gedächtnisses, die »soziale Institutionalisierung und Funktionalisierung von Medien des kollektiven Gedächtnisses«348. Wie oben breit erläutert worden ist, wird das kollektive Gedächtnis immer in sozialen Kontexten konstruiert. Es ist die soziale Trägerschaft des kollektiven Gedächtnisses, die darüber entscheidet (bewusst oder unbewusst), welche Medien es bei der Rekonstruktion nutzt, was im Speziellen für das kulturelle Gedächtnis gilt, für das die Externalisierung der Erinnerung durch Medien ein zentrales konstitutives Merkmal ist.349 Bei der Funktionalisierung von Medien des kollektiven Gedächtnisses unterscheidet Erll zwei grundlegende Aspekte: die produktions- und die rezeptionsseitige Funktionalisierung von Medien des kollektiven Gedächtnisses. Die produktionsseitige Funktionalisierung findet sich nach Erll im kulturellen Text: »Von den ägyptischen Pyramiden über die Nationalgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts bis hin zum Mahnmal für die ermordeten Juden Europas haben wir es mit produzentenseitigen Funktionalisierungen von Medien des kollektiven Gedächtnisses zu tun.«350 Aber auch einzelnen Personen (Fotograf*innen, Bildhauer*innen oder Autor*innen) können die Funktionsintention des Mediums des kollektiven Gedächtnisses zugeschrieben werden, wenn diese beispielsweise auf eine gewisse Wirkung setzen.351 Für die rezeptionsseitige Funktionalisierung von Medien des kollektiven Gedächtnisses ist es wichtig, zu verstehen, dass als ein Medium des kollektiven Gedächtnisses auch das angesehen werden kann, was von einem Kollektiv als ein solches angesehen oder funktionalisiert wird, auch 346 347 348 349 350 351
Erll 2004, S. 15. Erll 2004, S. 15. Erll 2004, S. 16. Vgl. Erll 2004, S. 17. Erll 2004, S. 17. Vgl. Erll 2004, S. 17.
74
Zugänge und Grundlagen
dann, wenn es ursprünglich nicht als Gedächtnismedium intendiert war.352 Besonders bei der rezipient*innenseitigen Funktionalisierung muss nach Erll von einem weiten Begriff des Gedächtnismedialen ausgegangen werden, da Gedächtnismedium in diesem Zusammenhang alles das ist, »was von einem Kollektiv als Vergangenheit vermittelnd begriffen wird«353. Für kollektive Erinnerungsprozesse in den Social Media kann man für diese produktions- und die rezeptionsseitige Funktionalisierung von Medien eine Aufteilung in Anbieter*innen- und Nutzer*innenrolle nur sehr bedingt annehmen, da hier diese Rollen nicht mehr eindeutig separiert auftreten, was im Folgenden noch weiter ausgeführt werden wird. Für die erste Komponente von Erlls Medienbegriff gilt, wie bereits oben beschrieben, dass »semiosefähige Kommunikationsinstrumente zur Externalisierung gedächtnisrelevanter Informationen«354 in den Social Media interaktiv und in hypermedialer Vernetzung auftreten. Im Vergleich zu traditionellen Massenmedien ist eine Kommunikation in den neuen Medien in der Praxis vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie hypermedial und interaktiv ist. Für diese Untersuchung sind diese Aspekte besonders wichtig, weil Erinnerung als medial vermittelter kommunikativer Prozess analysiert werden soll. Die Art der konkreten Kommunikation im Web 2.0, in den Social Media und auf konkreten Social-Network-Diensten zeichnet sich insbesondere auch durch Hypermedialität und Interaktivität aus. Nach Sven Sager lässt sich Hypermedia »definieren als ein kohärenter, nichtlinearer, multimedialer, computerrealisierter, daher interaktiv rezipier- und manipulierbarer Symbolkomplex über einem jederzeit vom Rezipienten unterschiedlich nutzbaren Netz von vorprogrammierten Verknüpfungen«355. Hypertextsysteme sind mehrfachkodiert, sie bestehen also aus unterschiedlichen medialen Objekten (Text-, Bild-, Audio- und Videodateien), die in den Modulen kombiniert oder durch Hyperlinks miteinander verknüpft356 werden und demnach als »medial komplexe Konfigurationen«357 zu begreifen sind. Aus kommunikations- und medienwissenschaftlicher Sicht besteht das Neue bei hypermedialen Symbolkomplexen »nicht in der Kombination oder Integration ver352 353 354 355
Vgl. Erll 2004, S. 17. Erll 2004, S. 18. Erll 2004, S. 14. Sager, Sven: Hypertext und Hypermedia. in: Brinker, Klaus (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin, New York 2000. S. 587–603, hier S. 589; Sager, Sven: Hypertext und Kontext. in: Jakobs, Eva-Maria / Knorr, Dagmar / Molitor-Lübbert, Sylvie (Hrsg.): Wissenschaftliche Textproduktion. Mit und ohne Computer. Frankfurt am Main, New York 1995. S. 209–226. 356 Storrer, Angelika: Was ist »hyper« am Hypertext? in: Kallmeyer, Werner (Hrsg.): Sprache und neue Medien. Berlin, New York 2000. S. 222–249, hier S. 228. 357 Sager 2000, S. 588.
Theoretische Zugänge
75
schiedener Mediengeräte (Wiedergabe-Maschinen), sondern in der Semiose auf der Produktions- und Rezeptionsseite, den spezifischen Prozessen der Enkodierung und Dekodierung sowie den dabei auftretenden Verstehens- und Verständigungsproblemen«358. Dennoch besteht auch eine Veränderung des Mediums auf der Ebene der Zeichensysteme, da innerhalb eines Mediums verschiedene mediale Formen integriert und vernetzt sind, sodass es sinnvoller scheint, den Begriff Hypermedia anstelle des verbreiteten Begriffs Hypertext zu verwenden,359 auch wenn bei einem sehr weiten Textbegriff (der hier nicht angewendet werden soll) auch auditive, visuelle oder audiovisuelle Medien als Text verstanden werden können, was den Begriff des Hypertextes ebenfalls äquivalent zu Hypermedia setzen würde. Ein weiteres wesentliches Merkmal von hypermedialen Internetdokumenten ist die Vernetzung oder Konnektivität. Im Zusammenhang mit Hypermedia ist in jedem Falle die Verknüpfung mittels Links grundlegend, wodurch eine nichtlineare Organisationsform entsteht, denn während Texte in einer geradlinigen Sequenz ablaufen, bestehen hypermediale Dokumente aus autonomen Modulen, die durch Links miteinander verknüpft sind, sodass ein Netz aus Hyperlinks entsteht mit Links als Wegverbindungen zwischen den Modulen als den Orten, an denen Daten abrufbar sind.360 Die einzelnen medialen Segmente sind dabei informationelle Einheiten und sind als kohärente und funktional einheitliche Ganzheiten zu verstehen und zu rezipieren, in denen sich das qualitative Mehr in der Verknüpfung der Segmente manifestiert, denn gerade dieser Aspekt der Verknüpfung von medialen Segmenten macht aus informationswissenschaftlicher Sicht das Besondere hypermedialer Dokumente aus.361 Diese Verknüpfung von Texten (oder anderen Medien) geschieht durch »hyperlinks, which fundamentally alters author, audience and text«362. Denn anders als etwa bei klassischen Medien (Film oder Buch) gibt es bei hypermedialen Internetdokumenten keine feste narrative Struktur, der die Rezipient*innen folgen müssen, was eine Überforderung darstellen oder zur einem aktiven, produktiven Umgang führen kann.363 Ebenso zentral wie die Hypermedialität ist die Interaktivität online geführter Kommunikationsprozesse in den Social Media. Obwohl Interaktivität der 358 359 360 361 362
Beck, Klaus: Computervermittelte Kommunikation im Internet. München 2006. S. 34. Vgl. Hein 2009, S. 37; Schwabe 2012, S. 92–97. Vgl. Storrer 2000, S. 228. Vgl. Sager 2000, S. 587. Paul, Christopher A.: Re-imaging Web analysis as circulation. in: First Monday 10 (2005). Heft 11. URL: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/12 91/1211 vom 7. 11. 2005 (Zugriff am 03. 11. 2017). 363 Sager, Sven: Intertextualität und die Interaktivität von Hypertexten. in: Klein, Josef / Fix, Ulla (Hrsg.): Textbeziehungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Beiträge zur Intertextualität. Tübingen 1997. S. 109–123, hier S. 119.
76
Zugänge und Grundlagen
transdisziplinäre Schlüsselbegriff zum Verständnis der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ist,364 fehlt es ihm, wie auch anderen Grundbegriffen der Kommunikationswissenschaft, teilweise an Präzision, Eindeutigkeit und Zweckmäßigkeit.365 Es existieren zwei kategorial verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs Interaktivität: Zum einen werden Kommunikationsformen als interaktiv bezeichnet, in denen neue Medien zur Interaktion genutzt werden (E-Mail-, Newsgroup-, Chatroom-Kommunikation) und zum anderen wird die Rezeption von Online-Angeboten als interaktiv bezeichnet, um ihren spezifisch aktiven Charakter zum Ausdruck zu bringen.366 Ausgangspunkt für das kommunikationswissenschaftliche Konzept der Interaktivität ist der aus soziologischen Handlungskonzepten entstammende Begriff der Interaktion, mit dem ein »wechselseitiges soziales Handeln von zwei oder mehreren Personen gemeint ist, wobei jeder der Partner sich in seinem Handeln daran orientiert, dass der andere sich in seinem Handeln auf das vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Handeln des ersteren bezieht«367. Folgt man den Annahmen des symbolischen Interaktionismus, der sich explizit mit zwischenmenschlicher Kommunikation beschäftigt, dann kommunizieren Menschen auf der Basis von Symbolen, deren Bedeutungen im Interaktionsprozess entstehen und die historisch wandelbar sind.368 Ursprünglich ging man dabei von einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht aus, die verbal, paraverbal oder nonverbal erfolgen kann und in der sich Interaktion in so genannten Reaktionssequenzen abspielt, bei denen die Aktivität einer Person die Aktivität einer anderen Person auslöst.369 Doch da derartige Interaktionsabläufe auf dem Feld der Massenkommunikation auch mit Hilfe technischer Kommunikationsmittel, wie vernetzte Computer, stattfinden, wird die physische Anwesenheit der Interaktionspartner*innen nicht mehr als notwendiger Definitionsbestandteil angese364 Vgl. Leggewie, Claus / Bieber, Christoph: Interaktivität-Soziale Emergenzen im Cyberspace. in: Bieber, Christoph / Leggewie, Claus (Hrsg.): Interaktivität. Ein transdisziplinärer Schlüsselbegriff. Frankfurt am Main, New York 2004. S. 7–14, hier S. 7; Sutter, Tilmann: »Interaktivität« neuer Medien – Illusion und Wirklichkeit aus der Sicht einer soziologischen Kommunikationsanalyse. in: Willems, Herbert (Hrsg.): Weltweite Welten. Internet-Figurationen aus wissenssoziologischer Perspektive. Wiesbaden 2008. S. 57–73. 365 Vgl. Neuberger. Christoph: Interaktivität, Interaktion, Internet. Eine Begriffsanalyse. in: Publizistik 52 (2007). S. 33–50, hier S. 33. 366 Bucher, Hans-Jürgen: Online-Interaktivität. Ein hybrider Begriff für eine hybride Kommunikationsform. in: Bieber, Christoph / Leggewie, Claus (Hrsg.): Interaktivität. Ein transdisziplinärer Schlüsselbegriff. Frankfurt am Main, New York 2004. S. 132–167, hier S. 136. 367 Vgl. Bahrdt, Hans Paul: Schlüsselbegriffe der Soziologie. Eine Einführung mit Lehrbeispielen. München 2003. S. 37. 368 Vgl. Blumer, Herbert: Symbolic interactionism. Perspective and method. Berkeley 1986. S. 3–5. 369 Vgl. Opp, Karl-Dieter: Verhaltenstheoretische Soziologie. Hamburg 1972. S. 113.
Theoretische Zugänge
77
hen.370 Die Informatik hat den Begriff der Interaktion übernommen und auf die Nutzung von Computersystemen durch Menschen übertragen, wobei die Forschung zur Human-Computer-Interaction (HCI) versucht, Nutzer*innenschnittstellen so zu gestalten, dass die Interaktion zwischen Mensch und Maschine so leicht wie möglich realisiert werden kann.371 Während in den traditionellen (Offline-)Massenmedien interaktive Kommunikation im Wesentlichen auf wenige Sprecher*innen vor einem Massenpublikum beschränkt ist, verfügen hingegen im Kontext von Online-Medien, in der über Computer vermittelten Kommunikation, Nutzer*innen über einen Rückkanal.372 Hiermit ist eine interaktive, also wechselseitige Kommunikation möglich, wobei sich der Aspekt der Interaktivität auf das Potenzial eines Einzelmediums bezieht, das den Prozess der Interaktion begünstigt oder ermöglicht.373 In interaktiven Medien bricht die klassische Rollenteilung zwischen Sender*innen und Empfänger*innen auf und die Grenze zwischen Massenkommunikation, die primär nur in eine Richtung (von Sender*innen zu Empfänger*innen) stattfindet, und wechselseitiger Individualkommunikation, löst sich auf.374 Festgehalten werden muss, dass in weiten Teilen des »alten« Internets (»Web 1.0«) eine einseitige Massenkommunikation stattgefunden hat, womit dort höchstens ein gradueller Unterschied zu früheren Medien bestand und erst mit dem Web 2.0 Interaktivität ihren tatsächlichen Durchbruch zu einem fundamentalen Strukturmerkmal der Online-Kommunikation vollzogen hatte, was an späterer Stelle noch konkreter erläutert werden wird. Auch wenn das Interaktivitätskonzept nicht nur auf computervermittelte Kommunikation zu beschränken ist, so weisen interaktive Onlinemedien nach Quiring und Schweiger375 dennoch vier mediale Spezifika auf, die traditionelle Massenmedien nicht haben: Erstens muss in der computervermittelten OnlineKommunikation kein Medien- oder Gerätewechsel mehr stattfinden, damit Nutzer*innen Rückmeldungen zu den Anbieter*innen geben können. Während diese zum Beispiel bei Fernsehsendungen vor allem postalisch, telefonisch oder per E-Mail erfolgen, kann Feedback bei Onlineangeboten direkt am Computer 370 Jäckel, Michael: Interaktion. Soziologische Anmerkungen zu einem Begriff. in: Rundfunk und Fernsehen 43 (1995). S. 463–476, hier S. 467. 371 McMillan, Sally J.: Exploring Models of Interactivity from Multiple Research Traditions. User, Documents and Systems. in: Lievrouw, Leah A. / Livingstone, Sonia M. (Hrsg.): Handbook of new media. Social shaping and consequences of ICTs. London 2002. S. 163– 182, hier S. 172–173. 372 Vgl. Neuberger 2007, S. 43. 373 Vgl. Neuberger 2007, S. 43. 374 Vgl. Pürer, Heinz / Bilandzˇic´, Helena: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Ein Handbuch. Konstanz 2003. S. 95. 375 Quiring, Oliver / Schweiger, Wolfgang: Interaktivität – ten years after. Bestandsaufnahme und Analyserahmen. in: Medien & Kommunikationswissenschaft 54 (2006). Heft 1. S. 5–24.
78
Zugänge und Grundlagen
übermittelt werden.376 Zweitens ermöglichen computerbasierte Dienste, dass das Publikum mit massenmedialen Kommunikator*innen schneller, einfacher und häufig kostenlos in Kontakt treten kann.377 Drittens können Medienanbieter*innen das digitale Publikumsfeedback vergleichsweise einfach weiterverarbeiten und gegebenenfalls in das eigene Medienangebot integrieren (Nutzer*innenabstimmungen oder Diskussionsforen).378 Zudem können Besucher*innen- und Zugriffszahlen einfach, kostengünstig und nichtreaktiv erhoben werden.379 Viertens lässt sich bei einigen durchaus als Massenmedien zu bezeichnenden Angeboten die Unterscheidung zwischen Kommunikator*innen und Rezipient*innen kaum mehr aufrechterhalten, da hier Nutzer*innen gleichzeitig als Autor*innen auftreten.380 Will man Interaktivität adäquat erfassen und beschreiben, so muss man verschiedene Niveaus unterscheiden: Zum einem gibt es die Interaktion eines Menschen mit einem Computer (Mensch-Computer-Interaktivität, wobei Nutzer*innen den Datenbestand nicht verändern können, also nur mit einem Anwendungsprogramm interagieren).381 Interaktivität auf diesem Niveau ist kein spezifisches Charakteristikum computerbasierter Medien, trifft auf diese jedoch in höherem Maße zu als auf klassische Medien.382 Ein höheres Niveau an Interaktivität ist gegeben, wenn das Medium im Sinne einer technischen Vermittlung zwischen zwei Nutzer*innen steht (computervermittelte menschliche Kommunikation), also durch das Medium interagiert wird und Interaktivität dann Qualitäten oder Potenziale von Medien meint, die eine Kommunikation zwischen Menschen »mit wechselseitiger Handlungskoordinierung und Verstehen des jeweils subjektiv gemeinten Sinns gestattet«383. Da Interaktivität in computervermittelter Kommunikation also auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann, beschreibt Lutz Goertz Interaktivität als Kontinuum, wobei Interaktivität bei Goertz durch den Grad der Modifikationsmöglichkeiten, die Größe des Selektions- und Modifikationsangebots und den Grad der Linearität/Nicht-Linearität operationalisiert wird.384 Je höher der Grad eines Faktors ist, umso 376 377 378 379 380 381 382 383 384
Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 8. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 8. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 8. Vgl. Fisch, Martin: Nutzungsmessung im Internet. Erhebung von Akzeptanzdaten deutscher Online-Angebote in der Marktforschung. München 2009. S. 15. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 8. Vgl. Beck 2004, S. 50. Vgl. Schönhagen, Philemon: Soziale Kommunikation im Internet. Zur Theorie und Systematik computervermittelter Kommunikation vor dem Hintergrund der Kommunikationsgeschichte. Bern, New York 2004. S. 42. Vgl. Beck 2004, S. 50. Vgl. Goertz, Lutz: Wie interaktiv sind Medien? Auf dem Weg zu einer Definition von Interaktivität. in: Rundfunk und Fernsehen 43 (1995). Heft 4. S. 477–491, hier S. 485.
Theoretische Zugänge
79
größer ist auch die Interaktivität der jeweiligen Medienanwendung.385 Selektion meint dabei in der für das Internet zutreffenden Ausprägung die nutzer*innenabhängige Auswahl aus bereits bestehenden Angeboten, wobei das Web hier zum Partner der Kommunikation im Sinne einer Mensch-Maschine-Kommunikation wird.386 Eine Kommunikation zwischen Sender*innen (in dem Fall die Autor*innen der Webseiten) und Empfänger*innen (den Nutzer*innen) findet zwar statt, jedoch können die Empfänger*innen auf inhaltlicher Ebene nicht zugleich zu Sender*innen werden. Modifikation auf der höchsten Stufe bedeutet die »Hinzufügung, Änderung oder Löschung von Inhalten jeglicher Art«387. Damit ist der in dieser Studie zu untersuchende kommunikative Erinnerungsprozess in den Social Media auf dieser höchsten Niveaustufe von Interaktivität angesiedelt. Interaktivität muss immer graduell aufgefasst werden, um »Handlungsweisen der Nutzer erklärbar machen zu können«388. Quiring und Schweiger entwerfen daher einen Interaktivitätsbegriff, der drei Ebenen aufweist: die Aktionsebene, die Ebene der Situationsevaluation und die Ebene des Bedeutungsaustausches.389 Die Aktionsebene beinhaltet die interaktiven Potenziale von Systemen und die Nutzer*innenperspektive, die wiederum zwei Dimensionen hat: die Steuerungsdimension, auf der die konkreten Eingaben der Nutzer*innen und die Optionen und Regeln, die das System für eine Reaktion bereitstellt, anzusiedeln sind, und die Übertragungsdimension, die sich mit der sinnlichen Ansprache der Nutzer*innen durch das System und der dafür bereitgestellten Technologie beschäftigt.390 Allerdings geben erst »[b]eide Dimensionen zusammen […] Auskunft über die Responsiveness des Systems, d. h. die Fähigkeit des Systems, auf Nutzer*inneneingaben zu reagieren.«391 Die Ebene der Situationsevaluation stellt das Bindeglied zwischen den auf das System bezogenen Aktionen und dem auf Menschen bezogenen Bedeutungsaustausch dar, da sich Nutzer*innen bei interaktiven Medien bei ihrer Situationsevaluation an anderen Parametern orientieren als in einer Kommunikationssituation von Angesicht zu Angesicht.392 Die Ebene der Situationsevaluation umfasst Systemevaluation, die subjektive Einschätzung der Interaktivität von Systemen und das Situationsempfinden, also die Empfindungen der Nutzer*innen, wie etwa die Art der Wahrnehmung einer
385 386 387 388 389 390 391 392
Vgl. Goertz 1995, S. 485–486. Vgl. Goertz 1995, S. 479. Vgl. Goertz 1995, S. 487. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 21. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 13. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 14. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 14. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 16.
80
Zugänge und Grundlagen
Verbundenheit mit anderen Nutzer*innen.393 Die Ebene des Bedeutungsaustauschs ist schließlich die Machtverteilung im Sinne der Kontrolle über den Kommunikationsprozess: »Je mehr Kontrolle ein Nutzer über den zweiseitigen Kommunikationsprozess gewinnt, als desto interaktiver gilt die Kommunikation.«394 Diese Ebene umfasst auch Enkodierung und Dekodierung der Bedeutung, was die Konstruktion von Bedeutung mittels technischer Systeme und die entsprechende Bedeutungszuweisung durch die Nutzer*innen beinhaltet.395 Für Online-Medien wurden zwei für das Erkenntnisinteresse dieser Studie wichtige mediale Spezifika herausgearbeitet, die in potenziertem Maße auch auf Social Media zutreffen: Zum einen ist das Internet (inklusive Social Media) ein hypermediales Netzwerk, das unterschiedliche mediale Dienste verbindet und integriert. Zum anderen sind es die interaktiven Möglichkeiten, die kommunikative Erinnerungsprozesse im Internet und in den Social Media auszeichnen. Eine Differenzierung des Interaktivitätsbegriffs, wie bei Götz, der Interaktivität als Kontinuum mit den Ebenen Selektion und Modifikation und Linearität beschreibt und bei Quiring und Schweiger, die zwischen der Aktionsebene, der Ebene der Situationsevaluation und der Ebene des Bedeutungsaustausches unterscheiden, ist wichtig, um die komplexen interaktiven, kommunikativen Erinnerungsprozesse in den Social Media in der späteren Analyse mittels der ersten Komponente von Erlls Medienbegriff angemessen zu beschreiben. Die zweite Komponente der materialen Dimension von Erlls Medienbegriff bilden die »Medientechnologien zur Verbreitung und Tradierung von Gedächtnisinhalten«396. Für die für diese Studie relevanten Medientechnologien existiert der Begriff Web 2.0. Manch einer traut dem Web 2.0 ziemlich viel zu: Der Zusatz 2.0 bezeichne nichts Geringeres »als den Aufbruch in eine neue Ära – eine neue Ära des Internets und damit der Kommunikation«397. Durch das Web 2.0 entstünde eine Welt, in der alle Menschen Zugang zu einem globalen Kommunikationsnetz hätten und in der Informationen aller Art ohne Einschränkung verändert, verbessert und verteilt werden dürften, sodass die sozialen Ungerechtigkeiten, Kriege und Menschenrechtsverletzungen des frühen 21. Jahrhunderts weitgehend verblassten.398 Andere sprechen im Zusammenhang von Web 2.0 von einer »digitalen Medienrevolution, die einzig vergleichbar ist mit den großen Umwälzungen durch die Erfindung des Buchdrucks oder der Elektrifi393 394 395 396 397
Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 16–17. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 18. Vgl. Quiring / Schweiger 2006, S. 18. Erll 2004, S. 14. Vgl. Huber, Melanie: Kommunikation im Web 2.0. Twitter, Facebook & Co. Konstanz 2010. S. 10. 398 Vgl. Möller, Erik: Die heimliche Medienrevolution. Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern. Hannover 2005. S. V.
Theoretische Zugänge
81
zierung«399. Dem Web 2.0 wird auch zugeschrieben, die Möglichkeit einer kommunikativen Basisdemokratie zu eröffnen, in der mehr Menschen die Chance bekämen, zur Bildung von Öffentlichkeit beizutragen, da neue Wege entstünden, um mit den Kandidaten vor einer Wahl zu interagieren und so eine neue politische Kommunikation in der Breite der Gesellschaft entstehe.400 Doch was kann das Web 2.0 fern von diesen Utopien tatsächlich leisten? Das Web 2.0 war und ist der Motor einer veränderten Wahrnehmung des Internets: Technologien werden neu kombiniert und ermöglichen es den Nutzer*innen, durch einfach handhabbare, browserbasierte Anwendungen ihren Inhalt selbst zu produzieren, sich im Internet darzustellen und verstärkt untereinander zu vernetzen, sodass der Begriff Web 2.0 weniger neue Technologien bezeichnet, sondern eher einen State of Mind beschreibt.401 Der Begriff Web 2.0 wird zwar häufig synonym mit dem der Social Media benutzt, ist aber umfassender, da auch technische, ökonomische und rechtliche Aspekte mit einbezogen werden.402 Web 2.0 meint keine Versionsnummer oder neue technische Ausführung des Internets, sondern spielt auf eine gefühlt wahrgenommene Veränderung des Internets an.403 Der Zusatz 2.0 bezieht sich auf die Benennung von Softwareversionen an, wenn der Sprung auf eine neue Version gleichzusetzen ist mit grundlegenden Veränderungen. Viele Diskurse in der medialen Berichterstattung,404 aber auch zu ökonomischen Potenzialen des internetbasierten Wirtschaftens haben die Annahme aufgegriffen, dass ein tiefgreifender Wandel des Internets stattgefunden habe und so die Vorstellung gefestigt, mit dem Web 2.0 sei eine neue Phase des Internets angebrochen.405 Fest steht, dass das Web 2.0 mit seinen neuartigen Publikations-, Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten zu einem grundlegenden Wandel des Nutzer*innenverhaltens im Internet geführt hat.406 399 Vgl. Münker, Stefan: Emergenz digitaler Öffentlichkeiten. Die sozialen Medien im Web 2.0. Frankfurt am Main 2009. S. 132. 400 Hamann, Götz: Die Medien und das Medium. Web 2.0 verändert die Kommunikation der Gesellschaft. in: Meckel, Miriam / Stanoevska-Slabeva, Katarina (Hrsg.): Web 2.0. Die nächste Generation Internet. Baden-Baden 2008. S. 213–228, hier S. 224. 401 Vgl. Bender, Gunnar: Von Web 1.0 zu Web 2.0. Kommunikation eines Paradigmenwechsels. in: Meckel, Miriam / Stanoevska-Slabeva, Katarina (Hrsg.): Web 2.0. Die nächste Generation Internet. Baden-Baden 2008. S. 132–141, hier S. 132. 402 Vgl. Ebersbach, Anja / Glaser, Markus / Heigl, Richard: Social Web. Konstanz 2016. S. 24. 403 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 24. 404 Vgl. Ballwieser, Dennis / Diedrichs, Lutz (Hrsg.): Spiegel Special. Wir sind das Netz. Leben 2.0. Wie das neue Internet die Gesellschaft verändert. Hamburg 2007. 405 Vgl. Schmidt, Jan: Was ist neu am Social Web? Soziologische und kommunikationswissenschaftliche Grundlagen. in: Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web. Köln 2008. S. 18–40, hier S. 19. 406 Vgl. Bauer, Christian Alexander: User Generated Content. Urheberrechtliche Zulässigkeit nutzergenerierter Medieninhalte. Berlin 2011. S. 1.
82
Zugänge und Grundlagen
Entstanden ist der Begriff Web 2.0 während eines Brainstormings zwischen dem O’Reilly Verlag und der Firma MediaLive International, als der Vizepräsident von O’Reilly, Dale Dougherty, feststellte, dass das Internet durch das Zerplatzen der sogenannten Dotcom-Blase im Jahr 2000 nicht zusammengebrochen, sondern wichtiger denn je geworden war.407 Es vollzog sich ein Wandel des Internets, der mit einem starken Schlagwort wie Web 2.0 belegt werden und im Mittelpunkt der ersten Web-2.0-Konferenz im Jahre 2004 stehen sollte, nach welcher sich der Ausdruck unaufhaltsam im Internet verbreitete und schnell zum Oberbegriff für sämtliche Erneuerungen im Internet wurde.408 Tim O’Reilly selbst hat ein Jahr nach dieser wegbereitenden Konferenz in seinem Artikel »What Is Web 2.0«409 den Begriff Web 2.0 durch die folgenden sieben Aspekte präzisiert: 1. The Web As Platform: Das Web 2.0 erscheint als »gravitational core«410, um den sich eine Fülle an Service-Angeboten und Applikationen (Grafikprogramme, Tabellenkalkulationen, Terminkalender, Umfragetools, Schreibprogramme etc.) versammeln, wobei die Nutzer*innen von überall auf ihre Daten zugreifen können und in kooperativen und kollaborativen Arbeitsformen arbeiten können.411 2. Harnessing Collective Intelligence: »Network effects from user contributions are the key to market dominance in the Web 2.0 era.«412 Nicht ein Betreiber oder eine Betreiberin gestaltet die Inhalte einer Webseite, sondern Nutzer*innen füllen Plattformen durch Informationen in Form von Texten, Bildern, Videos etc., wobei die Struktur einer Seite gemeinsam durch einfache und benutzer*innenfreundliche Oberflächen ohne technische Kenntnisse verändert werden kann.413 Die Benutzer*innenoberflächen sind bewusst einfach gehalten, denn das Web 2.0 soll ein (Massen-)Medium für alle sein.414 Unter diesen Aspekt fallen auch die Stichworte User Generated Content oder Mitmachinternet, die eine aktive Beteiligung der Nutzer*innen und den Dialog zwischen den Nutzer*innen betonen, die eigenständig Inhalte kre-
407 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 24. 408 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 24. 409 O’Reilly, Tim: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. in: Web Squared: Web 2.0 Five Years On (2005). URL: http://www.oreilly. com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html vom 30. 9. 2005 (Zugriff am 03. 11. 2017). 410 Vgl. O’Reilly 2005. 411 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 25. 412 Vgl. O’Reilly 2005. 413 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 26. 414 Vgl. Breidenich, Christof: Arkadien oder Arbeitslager? Design und Kommunikation im Social Web. in: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hrsg.): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg 2011. S. 209–226, hier S. 225.
Theoretische Zugänge
83
ieren.415 3. Data is the Next Intel Inside: Die Qualität und Quantität der Datenbestände, die von den Nutzer*innen permanent generiert werden, spiegeln das Kapital der Webanwendungen wider, womit die Inhalte wesentlicher sind als ihre Darstellung.416 »This fact leads to a key question: Who owns the data?«417 4. End of the Software Release Cycle: »One of the defining characteristics of internet era software is that it is delivered as a service, not as a product.«418 Aus dieser neuen Form der Softwareentwicklung resultiert, dass ein Service erheblich besser aktuell gehalten werden kann, als eine Software. 5. Lightweight Programming Models: »Innovation in assembly.«419 Um die Daten einer breiten Masse von Menschen ständig zugänglich zu machen und zu halten, werden Lightweight Programming Models implementiert, um die Daten sehr einfach und schnell über eine HTTP- oder Web-Service-Schnittstelle bereitzustellen und so über neue, offene, flexible, leicht zu bedienende Schnittstellen, sogenannte APIs, den Zugriff auf die global gesammelten Daten von Servern großer Onlineunternehmen ständig abzuspeichern und zu aktualisieren.420 6. Software Above the Level of a Single Device: Neben dem PC kommen auch mobile oder sonstige Geräte als Endgeräte in Frage, wie Handys, Smartphones oder Tablet-PCs.421 7. Rich User Experiences: Da es im Web 2.0 kaum einen Unterschied mehr zwischen einer Applikation im Netz und einem lokal installierten Programm gibt, bedeutet dies für Webapplikationen einen riesigen Sprung in Sachen Benutzer*innenfreundlichkeit und Benutzer*innendynamik.422 Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Web 2.0 durch eine Fülle an Serviceangeboten und Applikationen, durch die Erzeugung von Inhalten durch Nutzer*innen, durch die zentrale Bedeutung der von Nutzer*innen generierten Daten, durch die Ablösung von Softwareprodukten durch Softwareservices, durch neue Lösungen, um Daten immer zugreifbar und aktuell zu halten, durch eine Vielzahl möglicher Endgeräte neben dem PC, durch eine große Benutzer*innenfreundlichkeit sowie durch eine hohe Nutzungsdynamik auszeichnet. Der Begriff Web 2.0 ist als Sammelbegriff für verschiedene Anwendungen zwar geeignet, die in ihm enthaltene Implikation eines deutlichen Bruchs mit früheren Phasen der Internetentwicklung zu illustrieren, wird jedoch im Detail kritisch
415 Vgl. Stanoevska-Slabeva, Katarina: Web 2.0. Grundlagen, Auswirkungen und zukünftige Trends. in: Meckel, Miriam / Stanoevska-Slabeva, Katarina (Hrsg.): Web 2.0. Die nächste Generation Internet. Baden-Baden 2008. S. 13–38, hier S. 14–15. 416 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016 S. 26. 417 Vgl. O’Reilly 2005. 418 Vgl. O’Reilly 2005. 419 Vgl. O’Reilly 2005. 420 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 27. 421 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 28. 422 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 28.
84
Zugänge und Grundlagen
bewertet.423 Aus kommunikationssoziologischer Sicht erscheint für Jan Schmidt daher die Bezeichnung Social Web als die präzisere, da sie zum Ersten keine Unterscheidung zeitlicher Phasen enthalte, zum Zweiten auf das World Wide Web als zunehmend universalen Dienst des Internets verweise und zum Dritten den grundlegenden sozialen Charakter desjenigen Bereichs des Internets betone, der Kommunikation und anderes aufeinander bezogenes Handeln zwischen Nutzer*innen fördere, also über die Mensch-Maschine-Interaktion hinausgehe.424 Ebersbach, Glaser und Heigl folgend, erscheint es jedoch folgerichtiger, das Social Web als einen Teilbereich des Web 2.0 zu begreifen, der mehr die Bereiche fokussiert ist, bei denen es um die Unterstützung sozialer Strukturen und um Interaktionen über das Internet geht und nicht so sehr darum, Verbindungen zwischen Servern herzustellen oder Daten auszutauschen.425 Im Rahmen von Social Web werden Menschen dabei unterstützt, zwischenmenschliche Interaktionen auszuführen, Informationen oder Wissen auszutauschen oder Kontakte zu anderen Personen herzustellen.426 Dabei findet eine Reihe von Interaktionen innerhalb eines definierbaren Netzwerks statt, die zielgerichtet und durch Regeln gebunden sind, wobei dynamische Webseiten (Medien zweiter Ordnung) das Internet als Trägermedium (Medium erster Ordnung) nutzen.427 Das Social Web des Internets »is already the home of thousands of groups of people who meet to share information, discuss mutual interests, play games, and carry out business«428. Ebersbach, Glaser und Heigl definieren Social Web wie folgt: Das Social Web besteht aus: (im Sinne des WWW) webbasierten Anwendungen, die für Menschen den Informationsaustausch, den Beziehungsaufbau und deren Pflege, die Kommunikation und die kollaborative Zusammenarbeit in einem gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Kontext unterstützen, sowie den Daten, die dabei entstehen und den Beziehungen zwischen Menschen, die diese Anwendungen nutzen.429
Ebersbach, Glaser und Heigl unterscheiden fünf Prototypen, in die sie SocialWeb-Plattformen einteilen, wobei in der unüberschaubaren Fülle immer alle möglichen Kombinationen auftauchen:430 1. Wikis, die auf die kollaborative Erstellung von Texten ausgerichtet sind und zum Ziel haben, gemeinsam Inhalte 423 Schmidt merkt u. a. an, dass Web-2.0-Anwendungen teilweise auf Dienste zurückgreifen, deren Anfänge bis in die 1970er Jahre zurückreichen. Vgl. Schmidt 2008, S. 20–22. 424 Vgl. Schmidt 2008, S. 22. 425 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 30. 426 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 30. 427 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 30. 428 Vgl. Bell, Daniel: Community and Cyberculture. in: Bell, Daniel (Hrsg.): An introduction to cybercultures. London 2003. S. 92–112, hier S. 97. 429 Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 32. 430 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 35.
Theoretische Zugänge
85
zu schreiben, wobei der Inhalt im Zentrum steht und nicht die einzelnen Autor*innen. 2. Blogs, die als persönlich gefärbte Journale meistens von Einzelpersonen geführt werden und häufig tagesaktuelle Themen zum Gegenstand haben, wobei eine Gemeinschaft erst durch die Vernetzung der einzelnen Blogs entsteht. Beck unterscheidet drei Typen von Blogs: persönliche Online-Journale oder -Tagebücher, laienjournalistische Blogs und Corporate Blogs.431 Allgemein sind Blogs eine dezentrale Form des Austausches und vereinen Merkmale der öffentlichen und der interpersonalen Kommunikation432. 3. Microblogs, die sich besonders durch kurze Botschaften auszeichnen, die über eine zentrale Plattform ausgetauscht werden, einen kommunikativen Charakter und eine kurze Aktualitätsspanne haben (Beispiel: Twitter). 4. Social-Network-Dienste, die den Aufbau und die Pflege von Beziehungsnetzwerken zum Ziel haben (Beispiele: LinkedIn, Xing, Facebook). 5. Social Sharing, das sich als eine Gruppe von Anwendungen präsentiert, die jeweils zur Bereitstellung und zum Tausch von digitalen Inhalten dienen (Beispiele: Instagram, Pinterest, YouTube, Flickr, Soundcloud, Prezi).433 Das Social Web insgesamt wird von Ebersbach, Glaser und Heigl gewissermaßen als Unterkategorie des Web 2.0 definiert, das vor allem Anwendungen umfasst, die Informationsaustausch, Beziehungsaufbau und -pflege, Kommunikation und kollaborative Zusammenarbeit in einem gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Kontext unterstützen, die aber auch die Daten, die dabei entstehen und die Beziehungen zwischen Menschen miteinbezieht, die diese Anwendungen nutzen. Die vier in dieser Studie untersuchten Dienste Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram werden in Kenntnis dieser hier mehr als Idealtypen verstandenen Prototypen auch im Folgenden alle weiterhin als Social-Network-Dienste bezeichnet, da bei allen der Aufbau und die Pflege von Beziehungsnetzwerken in der Nutzung im Vordergrund stehen kann. Die dritte Komponente von Erlls Medienbegriff in der materialen Dimension sind »kulturelle Objektivationen als konkrete Gedächtnismedienangebote und ihre formale Gestaltung«434: In Bezug auf diese Untersuchung werden darunter die konkreten hypermedialen Dokumente der spezifischen Seiten der einzelnen Social-Network-Dienste verstanden. Auf die medialen Eigenheiten der untersuchten Dienste und Seiten wird im konkreten Analyseprozess näher eingegangen werden. Die soziale Dimension beinhaltet die vierte Komponente von Erlls Medienbegriff des kollektiven Gedächtnisses, die »soziale Institutionalisierung und 431 Vgl. Beck, Klaus: Neue Medien- alte Probleme? Blogs aus medien- und kommunikationsethischer Sicht. in: Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web. Köln 2008. S. 62–77, hier S. 62–64. 432 Schmidt, Jan: Weblogs. Eine kommunikationssoziologische Studie. Konstanz 2006. S. 9. 433 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 35. 434 Erll 2004, S. 15.
86
Zugänge und Grundlagen
Funktionalisierung von Medien des kollektiven Gedächtnisses«435. Der konkrete Gebrauch des Mediums durch die Erinnerungsgemeinschaft steht hier im Zentrum des analytischen Interesses. Die oben eingeführte Definition des Social Webs ist eine, die bereits von der Funktion der Kommunikation her ausgebreitet wurde, da Informationsaustausch (Publikation und Verteilung vom multimedialen Objekten, die Informationen enthalten), Beziehungsaufbau (Aufbau und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen) und Zusammenarbeit (Sammlung und Herstellung von Wissen und Erkenntnissen) als zentrale Merkmale ausgemacht wurden.436 Eine ähnliche Trias wie Ebersbach, Glaser und Heigl definiert auch Jan Schmidt437 als Komponenten von Social Web Praktiken. Er unterscheidet zwischen drei Handlungskomponenten: Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement. Identitätsmanagement meint in diesem Zusammenhang das Zugänglichmachen von Aspekten der eigenen Person durch das Ausfüllen eines Profilbogens, die Erstellung eines Podcasts oder das Hochladen von eigenen Texten, Bildern oder Videos.438 Um am sozialen Leben des jeweiligen Angebots teilhaben zu können, erzwingen Profilseiten eine Art standardisierte Selbstdarstellung, da Nutzer*innen bei der Registrierung gewisse Aspekte ihrer Person preisgeben müssen, aber dies anhand der Vorgaben von Profilmasken tun, die bestimmte Merkmale abfragen und einen Pool an Kategorien für Selbstdarstellung, Layout und Design vorgeben, sodass das eigene Selbst auf bestimmte Eigenschaften und Profilfelder komprimiert werden muss, wobei ein Konflikt mit dem Bedürfnis und der gesellschaftlichen Anforderung entstehen kann, eine eigene individuelle Identität zu entwickeln, auszudrücken und sichtbar zu machen.439 Mit ihren Online-Identitäten treten Nutzer*innen in der virtuellen Community auf und sind dort bekannt, durch den Login in eine virtuellen Community treten ihre formalen Identitäten (beschreibt die Nutzer*innen als reale Personen) hinter ihre personalen Identitäten (Online-Identitäten), wobei die personalen Identitäten von den Nutzer*innen nach ihren Wünschen ausgestaltet werden können.440 Es werden Online-Persönlichkeiten kreiert, die über die personalen Identitäten identifiziert werden können, sie müssen aber nicht mit den realen Persönlichkeiten der Nutzer*innen übereinstimmen, worin ein Reiz am Social 435 436 437 438 439 440
Vgl. Erll 2004, S. 16. Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 36. Schmidt, Jan: Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0. Konstanz 2011. Vgl. Schmidt 2011, S. 73. Vgl. Schmidt 2011, S. 85. Vgl. Marotzki, Winfried: Interaktivität und virtuelle Communities. in: Bieber, Christoph / Leggewie, Claus (Hrsg.): Interaktivität. Ein transdisziplinärer Schlüsselbegriff. Frankfurt am Main, New York 2004. S. 118–131, hier S. 126.
Theoretische Zugänge
87
Web begründet liegen kann, also die Möglichkeit, mit verschiedenen personalen Identitäten zu experimentieren.441 Beziehungsmanagement meint im Zusammenhang von Social Web einen »active process of building, maintaining, and sustaining a specific set of mutually regarded relationships«442, in dem Beziehungen durch Einträge auf Seiten anderer, durch Nachrichten, durch Aussprache oder Annahme eines Kontaktgesuches und durch das Verlinken von Bildern oder Videos Kontakte geknüpft und gepflegt werden. Auch wenn das Social Web nur ein weiterer Kanal ist, über den Menschen miteinander kommunizieren können, so stellt dieser aber weitere Optionen zur interpersonalen, gruppenbezogenen oder öffentlichen Kommunikation zur Verfügung, die im Rahmen eines online stattfindenden sozialen Beziehungsmanagements beherrscht werden müssen, um soziale Beziehungen zu artikulieren, zu pflegen und im Rahmen eines Beziehungsgeflechtes in einem öffentlichen Netzwerk mit der zum Teil öffentlichen Visualisierung umzugehen.443 Informationsmanagement meint bei Schmidt das Selektieren, Filtern, Bewerten und Verwalten von Informationen.444 Besonders für das Bewerten von Information, was wiederum eine wichtige Komponente im Identitäts- und Beziehungsmanagement sein kann, bieten die verschiedenen Social-Web-Plattformen unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten an, wie der Gefällt-mir-Button bei Facebook oder das Tagging (Inhalte werden mittels Hashtags nach eigenen Kriterien Schlagwörtern zugeordnet) auf Twitter, Instagram und Facebook.445 Die Computer fungieren im Social Web als »linking machines (they link information, data, communication, sound, image, through the common language of digital encoding), they inherently affect the ways we think of linking up to each other, and thus they fit squarely into our concerns about community«446. Unternehmen haben das ökonomische Potenzial von im Social Web positiv bewerteten Produkten längst erkannt447 und bekämpfen das üppige Wachstum großer Social-Network-Dienste daher nicht, sondern fördern und nutzen es,448 was zeigt, welche Reichweite Informationsmanagement im Social Web haben 441 Vgl. Turkle, Sherry: Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York 1997. S. 10–12. 442 Hogan, Bernard J.: Networking in Everyday Life. Toronto 2009. S. 14. 443 Vgl. Schmidt 2011, S. 88–89. 444 Vgl. Schmidt 2011, S. 73. 445 Vgl. Schmidt 2011, S. 103. 446 Jones, Steve G.: Information, Internet, and Community. in: Jones, Steve G. (Hrsg.): CyberSociety 2.0. Revisiting computer-mediated communication and community. Thousand Oaks 1998. S. 1–34, hier S. 29. 447 Vgl. Jones 1998, S. 29–30. 448 Vgl. Tapscott, Don / Williams, Anthony D.: Wikinomics. Die Revolution im Netz. München 2009. S. 1–3.
88
Zugänge und Grundlagen
kann,449 zumal mit Ausnahme von Wikipedia die dominierenden Angebote des Social Web in der Hand von kommerziellen Betreibern sind, die vor allem an Strategien interessiert sind, mit denen sie ökonomisches Kapital aus den Aktivitäten der Nutzer*innen ziehen können.450 Informationsmanagement beruht im Social Web immer auch auf explizit gemachten sozialen Beziehungen, die als Filter für die Verbreitung von Informationen dienen können, ist aber auch routiniert ablaufendes und technisch unterstütztes Auffinden, Bewerten und Austauschen von Informationen, das es jedem ermöglicht, sich in der erweiterten Öffentlichkeit des Internets zu orientieren.451 Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement stehen für spezifische Weisen, sich zur eigenen Person, zu seinem sozialen Umfeld und zur Welt insgesamt kommunikativ zu verhalten, ohne dabei rein auf die Online-Welt beschränkt zu sein, da im Gegenteil Social Web Praktiken immer auch über das Internet hinausreichen und Menschen in die Lage versetzen, gesellschaftliche und soziale Anforderungen zu erfüllen.452 Seit Mitte der 2010er Jahre ist v. a. in populären, teilweise aber auch – ausgehend vom betriebswirtschaftlichen (PR) Gebrauch – in medienwissenschaftlichen Diskursen vermehrt der Begriff Social Media in Erscheinung getreten. Sowohl in etablierten betriebswirtschaftlichen453 als auch in aktuellen medienwissenschaftlichen454 Begriffsdefinitionen von Social Media wird explizit auf die Parallelität zum Begriff des Social Webs hingewiesen oder sie wird implizit deutlich. Eine vielzitierte Definition ist diejenige von Andreas Kaplan und Mi449 Vgl. Kaiser, Carolin: Entscheidungsunterstützung zur Meinungsbeeinflussung in Webcommunitys. in: Meier, Andreas (Hrsg.): Communitys im Web. Heidelberg 2011. S. 83–114. 450 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik: Persönliche Öffentlichkeiten im Social Web und ihre Bedeutung für die Zivilgesellschaft. in: Lange, Dirk (Hrsg.): Entgrenzungen. Schwalbach/Ts. 2011. S. 210–215, hier S. 214. 451 Vgl. Schmidt 2011, S. 105–106. 452 Vgl. Schmidt 2011, S. 106. 453 Vgl. Bendel, Oliver: Soziale Medien. in: Gabler Wirtschaftslexikon. URL: https://wirtschafts lexikon.gabler.de/definition/soziale-medien-52673/version-152520 vom 09. 12. 2010 (Zugriff am 01. 05. 2018); Geißler, Cornelia: Social Media? in: Harvard Businessmanager 31 (2010). Heft 9. URL: http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/artikel/a-721549.html vom 1. 9. 2010 (Zugriff am 01. 05. 2018); Kaplan, Andreas M. / Haenlein, Michael: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. in: Business Horizons 53 (2010). Heft 1. S. 59–68; Kietzmann, Jan H. / Hermkens, Kristopher / McCarthy, Ian P.: Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. in: Business Horizons 54 (2011). Heft 3. S. 241–251; Kilian, Karsten: Was sind Social Media? in: Absatzwirtschaft 52 (2010). Heft 3. S. 61; Stiegler, Christian: Digitale Medientheorien. in: Stiegler, Christian / Breitenbach, Patrick / Zorbach, Thomas (Hrsg.): New Media Culture. Mediale Phänomene der Netzkultur. Bielefeld 2015. S. 11–28. 454 Vgl. Gabriel, Roland / Röhrs, Heinz-Peter: Social Media. Potenziale, Trends, Chancen und Risiken. Berlin 2017. S. 12; Lipschultz, Jeremy Harris: Social media communication. Concepts, practices, data, law and ethics. New York 2018. S. 11–15.
Theoretische Zugänge
89
chael Haenlein: »Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content.«455 Auch die Typisierung von Social Media von Thomas Aichner und Frank Jacob lässt keinen Unterschied zum Social Web erkennen.456 Die sehr weite Definition von Social Media von Roland Gabriel und Heinz-Peter Röhrs als »digitale Medien und Technologien, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander in einem Netz, z. B. im Internet, auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu erstellen und weiterzuleiten«457 oder von Stefan Stieglitz zeigen,458 dass eine scharfe Abgrenzung der Begriffe Social Web und Social Media wenig zielführend ist. Gelegentlich vorgebrachte Abgrenzungsversuche der beiden Begriffe, in denen das Social Web als abstraktes gesellschaftliches sowie medien- und kommunikationstechnisches Phänomen definiert wird, wohingegen Social Media nur die Technologien und konkreten Medienformate umfassen sollen,459 scheinen willkürlich und sind nicht konsensfähig. Stattdessen zeigt der Blick in die betriebswirtschaftliche460, museumspädagogische461 und medienwissenschaftliche462 Literatur, dass der Begriff des Social Webs im Begriff der Social Media aufgeht.
455 Kaplan / Haenlein 2010, S. 61. 456 Vgl. Aichner, Thomas / Jacob, Frank: Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. in: International Journal of Market Research 57 (2015). Heft 2. S. 257–276. 457 Gabriel / Röhrs 2017, S. 12. 458 »Unter Social Media werden Anwendungen verstanden, die über das Internet zugänglich sind und die die Vernetzung und Kommunikation zwischen Nutzern sowie das Erstellen und Veröffentlichen von nutzergetriebenen Inhalten unterstützen«. Stieglitz, Stefan: Social Media. in: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. URL: https://www.enzyklopaedie-de r-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Wissensmanagement/ Soziales-Netzwerk/Social-Media/index.html?searchterm=social+m vom 19. 02. 2019 (Zugriff am 01. 07. 2020). 459 Vgl. 65. Bundesweites Gedenkstättenseminar in Bad Arolsen vom 27.–29. Juni 2019: Herausforderungen des Digitalen für Gedenkstätten und Dokumentationszentren. 460 Vgl. Dahl, Stephan: Social media marketing. Theories et applications. Los Angeles u. a. 2018; Kreutzer, Ralf T.: Social-Media-Marketing kompakt. Ausgestalten, Plattformen finden, messen, organisatorisch verankern. Wiesbaden 2018; Pahrmann, Corina / Weinberg, Tamar / Kupka, Katja / Ladwig, Wibke / Schwencke, Thomas: Social media marketing. Praxishandbuch für Twitter, Facebook, Instagram & Co. Heidelberg 2020. 461 Vgl. Bocatius, Bianca: Museumsvermittlung mit Social Media – webbasierte Partizipation auf neuen Wegen. in: Hausmann, Andrea / Frenzel, Linda (Hrsg.): Kunstvermittlung 2.0. Neue Medien und ihre Potenziale. Wiesbaden 2014. S. 27–46; Drotner, Kirsten: Museum Communication and Social Media. The Connected Museum. Florence 2014; Kronberger, Anika / Kelley, Heather / Friesinger, Günther u. a. (Hrsg.): Social Web and Interaction. Social media technologies for museums. Wien 2016. 462 Vgl. Münker, Stefan: Die Sozialen Medien des Web 2.0. in: Michelis, Daniel (Hrsg.): SocialMedia-Handbuch. Theorien – Methoden – Modelle. Baden-Baden 2010. S. 31–41.
90
Zugänge und Grundlagen
Jan-Hinrik Schmidt und Monika Taddicken verwenden synonym zum Begriff Social Media die deutsche Übersetzung soziale Medien, die äquivalent zum Begriff des Social Webs nach Ebersbach, Glaser und Heigl ebenfalls die Technologien sowie mittelbar die generierten Daten sowie die sozialen Beziehungen umfassen.463 Auch wenn Schmidt und Taddicken darauf aufmerksam machen, dass der Begriff des Social Webs »mehr das soziale Umfeld und das Resultat des Mediengebrauchs«464 betont, so ist doch deutlich, dass Schmidt die Begriffe Social Web, Social Media und soziale Medien synonym gebraucht.465 Auch diese Studie folgt dem weitestgehenden disziplinübergreifenden Konsens und versteht die drei Begriffe als Synonyme. Schmidt und Taddicken schließen die Debatte um die Begriffe mit der Tatsache ab, dass eine Google-Suchmaschinen-Abfrage eindeutig belegt, dass der Begriff Social Media 133x häufiger verwendet wird als der des Social Webs.466 Hajo Hippner verwendet hingegen den Begriff der Social Software.467 Das Konzept der Social Software umfasst im Gegensatz zum Social Web nur Programme und Anwendungen, während das »Social Web auch die bereitgestellten Daten sowie das soziale Geflecht der Beteiligten untereinander subsumiert«468. Hippner nennt Anwendungsprinzipien von Social Software, die direkt auf den Begriff Social Media übertragen und im Kontext dieser Untersuchung produktiv angewendet werden können. Hippner definiert in der konkreten Anwendung von Social Software folgende sechs funktionale Prinzipien: Erstens steht ein Individuum oder eine Gruppe von Menschen im Mittelpunkt der Social Software.469 Während bei traditionellen Anwendungen die individuelle Produktivität zentral ist, konzentrieren sich Social Software Produkte auf die Beziehungen zwischen den Nutzer*innen,470 was sich unter anderem daran zeigt, dass Social-WebDienste personalisiert sind und die Aktionen des Einzelnen nachvollziehbar 463 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik / Taddicken, Monika: Entwicklung und Verbreitung sozialer Medien. in: Schmidt, Jan-Hinrik / Taddicken, Monika (Hrsg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden 2017. S. 3–22, hier S. 8. 464 Schmidt / Taddicken 2017, S. 8. 465 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik: Social Media. Wiesbaden 2018. S. 9–20. 466 Vgl. Schmidt / Taddicken 2017, S. 9. 467 Vgl. Hippner, Hajo: Bedeutung, Anwendungen und Einsatzpotenziale von Social Software. in: Hildebrandt, Knut / Hofmann, Josephine (Hrsg.): Social Software. Einsatz- und Nutzenpotenziale, Web 2.0 im Kundenmanagement, Mobile Social Software, Wissensmanagement mit Wikis, Social Internet, Wikipedia in der Aus- und Weiterbildung, Mobile Communities. Heidelberg 2006. S. 6–17; Stegbauer, Christian / Jäckel, Michael: Social Software – Herausforderungen für die mediensoziologische Forschung. in: Stegbauer, Christian / Jäckel, Michael (Hrsg.): Social Software. Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken. Wiesbaden 2008. S. 7–10. 468 Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 31. 469 Vgl. Hippner 2006, S. 7–8. 470 Vgl. Hippner 2006, S. 7–8.
Theoretische Zugänge
91
sind.471 Zweitens ist die Grundlage von Social Software die Idee der Selbstorganisation: Weblogs und Wikis sind meist nicht aus kommerziellen Gesichtspunkten heraus entwickelt worden, sodass Benutzung und Anwendung kaum reglementiert sind.472 Es existieren nur wenige Verhaltensregeln oder Datenstrukturen und die Nutzer*innen sind es, die die Inhalte an ihre Bedürfnisse anpassen und die Plattform zu ihrem Medium machen und eigene spezifische Verhaltensnormen herausbilden.473 Drittens findet eine soziale Rückkopplung (Social Feedback) durch Social Ratings (Zahl der Querverweise, Kommentare, Punkte etc.) statt; Nutzer*innen bewerten also die Inhalte anderer Nutzer*innen in Gestalt einer digitalen Reputation, wodurch sich einige Nutzer*innen durch Qualität oder Quantität ihrer Beiträge profilieren können.474 Viertens ist nicht Information, sondern Struktur zentral, die aus der hypermedialen Verknüpfung der Informationen entsteht, denn Ziel von Social Software ist eine möglichst dichte Vernetzung von Informationen und Personen, um kollektives Wissen innerhalb von Gruppen zu erschließen.475 Fünftens ist das Individuum in der Kommunikation immer Teil einer Gruppe und Gespräche, die ausschließlich von zweien geführt werden (One-to-One), sind nicht gewünscht, da eine Kommunikation unter vielen (One-to-many) bevorzugt wird.476 Sechstens werden Personen, Beziehungen, Inhalte und Bewertungen immer für alle sichtbar gemacht, da alle Nutzer*innen ihr Wissen der Gemeinschaft zur Verfügung stellen sollen.477 Es herrscht eine große Transparenz hinsichtlich der Aktionen, Daten und Zusammenhänge im Social Web,478 was auch immer wieder zu Kritik an SocialMedia-Angeboten führt. In der Anwendung ist Social Software nach Hippner also auf Beziehungen ausgerichtet, funktioniert nach dem Prinzip der Selbstorganisation, hat ein starkes Element der sozialen Rückkopplung, sie vernetzt Information und Wissen hypermedial und interaktiv, kommuniziert wird in Gruppen und es herrscht das Prinzip der Sichtbarkeit. Boyd und Elisson definieren Social-Network-Dienste (auch Online Social Networks) stärker von ihrem kommunikativen Funktionsaspekt her: We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of
471 472 473 474 475 476 477 478
Vgl. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 32. Vgl. Hippner 2006, S. 8. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 32. Vgl. Hippner 2006, S. 8. Vgl. Hippner 2006, S. 8. Vgl. Hippner 2006, S. 8–9. Vgl. Hippner 2006, S. 9. Ebersbach / Glaser / Heigl 2016, S. 32.
92
Zugänge und Grundlagen
connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site.479
Richter und Koch480 definieren für Kommunikation auf Socia-Network-Diensten sechs Funktionalitätsgruppen, die Teile der von Schmidt definierten Handlungskomponenten im Social Web allgemein (Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement) aufgreifen: 1. Identitätsmanagement meint die Möglichkeit, sich selbst darzustellen und somit bewusst und kontrolliert persönliche Daten einer breiten Masse vorzustellen. 2. (Experten)-Suche meint die Möglichkeit zur Wissenssuche und -nutzung. 3. Kontextawareness meint den Aufbau von Vertrauen und die Herstellung eines gemeinsamen Kontexts als zentralem Bestandteil menschlicher Beziehungen. 4. Kontaktmanagement meint die Pflege der persönlichen Kontakte innerhalb des Netzwerkes mittels Erstellen von Freundeslisten und Austausch von Kontaktdaten. 5. Netzwerkawareness meint das Informiertsein über Aktivitäten im eigenen Netzwerk. 6. Gemeinsamer Austausch meint die Möglichkeit zur Kommunikation der Netzwerkmitglieder mittels E-Mail-ähnlicher Nachrichten, Chatfunktion oder aber die Kommentierung von Pinnwand-Einträgen.481 Für diese Untersuchung lohnt es sich, kurz auf die Funktionen Kontextawareness und Netzwerkawareness einzugehen. Kontextawareness liegt die Annahme zugrunde, dass menschliche Beziehungen von Vertrauen geprägt sind und Verbindungen zwischen Menschen über Social-Network-Dienste Vertrauen schnell herstellen können, erst Recht, wenn ein gemeinsamer Kontext existiert.482 Dies hat zur Folge, dass Kommunikation im Rahmen von Social-NetworkDiensten schneller eine vertraute Ebene erreichen kann, die sonst in öffentlichen Kontexten nicht möglich ist. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass den Nutzer*innen die öffentliche Dimension nicht in vollem Maße bewusst ist. Die Netzwerkawareness meint, dass man über bestimmte Aktivitäten (den aktuellen Status und Änderungen des Status) seiner Kontakte im persönlichen Netzwerk informiert wird, was sich als großer Erfolgsfaktor für die Stickyness der Nutzer*innen (wie lange sich Nutzer*innen auf der Plattform aufhalten) herausgestellt hat.483 Bei den Funktionen, die die Netzwerkawareness unterstützen sollen, wird zwischen Push- und Pull-Funktionen unterschieden, wobei Push-Funktionen beim Login automatisch Informationen über aktuelle Ereignisse im persönlichen Netzwerk zur Verfügung stellen, während Pull-Funktionen Nut479 Boyd, dana m. / Ellison, Nicole B.: Social network sites. Definition, history, and scholarship. in: Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2007). S. 210–230, hier S. 211. 480 Richter, Alexander / Koch, Michael: Funktionen von Social-Networking-Diensten. in: Proceding 7 (2008). S. 1239–1250. 481 Vgl. Richter/ Koch 2008, S. 1242–1249. 482 Vgl. Richter/ Koch 2008, S. 1246. 483 Vgl. Richter/ Koch 2008, S. 1247.
Theoretische Zugänge
93
zer*innen darüber hinaus Informationen zur Verfügung stellen.484 Diese beiden Merkmale, Kontextawareness und Netzwerkawareness, bilden eine zentrale Eigenschaft der Kommunikation in den Social Media, die sich entscheidend auf die kommunikativen Erinnerungsprozesse auswirken. Zusammenfassend kann man festhalten, dass Identitäts-, Beziehungs- und Informations-management zentrale Funktionen der Kommunikation in den Social Media sind. Als Kommunikationsmerkmale lassen sich das Ausgerichtetsein auf Beziehungen, das Prinzip der Selbstorganisation, die starke soziale Rückkopplung, die hypermediale und interaktive Vernetzung von Informationen und Wissen, das Prinzip der Gruppenkommunikation und das Prinzip der Sichtbarkeit herausstellen. Social-Network-Dienste zeichnen sich speziell durch die Prinzipien Kontextawareness und Netzwerkawareness aus, was zu einer ungewöhnlich privaten Art der Kommunikation im öffentlichen Raum führen kann. Zusammengefasst hat dieses Kapitel erläutert, dass Medien des kollektiven Gedächtnisses Wirklichkeits- und Vergangenheitsversionen konstruieren, an denen die Materialität des Mediums (Kommunikationsinstrumente, Technologien und Objektivationen) ebenso beteiligt ist wie seine soziale Dimension, also die Produzent*innen und Rezipient*innen eines Gedächtnismediums, die aktiv Konstruktionsarbeit leisten und entscheiden, welchen Phänomenen gedächtnismediale Qualitäten bei der Auswahl, bei der Enkodierung/Dekodierung und bei der Deutung des zu Erinnernden zugeschrieben werden.485 Es sind die Medien und ihre Benutzer*innen, die ein perspektivisches kollektives Gedächtnis in spezifischen kulturellen und historischen Kontexten erzeugen, wobei die konstruierten Vergangenheitsversionen, Werte und Identitätskonzepte, die durch ein Gedächtnismedium konstruiert werden, immer von der erinnerungskulturellen Situierung abhängig sind.486 Beim Konzept des Kompaktbegriffs Medium des kollektiven Gedächtnisses mit seiner materialen und sozialen Dimension und den vier beinhalteten Komponenten ist zu beachten, dass sich ein Gedächtnismedium im Zusammenspiel verschiedener Faktoren mehrerer Ebenen konstituiert, die in spezifischen erinnerungskulturellen Kontexten stattfinden.487 Gedächtnismedien materialisieren Erinnerung also immer im Horizont bestehender, kulturspezifischer Konfigurationen eines kollektiven Gedächtnisses, die sich aus Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten, Wissensordnungen und Herausforderungslagen, Erinnerungspraktiken und Erinnerungskonkurrenzen bilden und die Produktion, Tradierung und Rezeption von Gedächtnismedien 484 485 486 487
Vgl. Richter/ Koch 2008, S. 1247. Vgl. Erll 2003, S. 150. Vgl. Erll 2003, S. 150. Vgl. Erll 2003, S. 149.
94
Zugänge und Grundlagen
prägen.488 Ein Medium muss daher, wenn es als ein vom kollektiven Gedächtnis vermitteltes Phänomen untersucht werden soll, immer aus einer generalisierenden, ahistorischen Betrachtungsweise herausgelöst und in Beziehung zu ganz bestimmten historischen und gegenwärtigen erinnerungskulturellen Prozessen gesetzt werden.489 Der systemtheoretische Ansatz Luhmanns konnte zeigen, dass Gedächtnis eine unpersönliche und äußerliche Eigenleistung von Kommunikation der publizistischen Medien ist und Massenmedien daher konstitutiv für die Produktion und Reproduktion eines sozialen Gedächtnisses sind. Luhmanns Zusammenhang von Gedächtnis und Medien, angewendet auf kollektive Gedächtnisprozesse, bedeutet, dass Medien zwar am Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses beteiligt, nicht aber dessen ausschließlicher Träger sind, da interpersonale und nichtmassenmediale Interaktion, die auch medial vermittelte Kommunikation ist, Einfluss auf den Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses hat. Von Elena Esposito mit ihren an die Thesen Luhmanns anschließenden systemtheoretischen Überlegungen wurde übernommen, dass Kommunikationstechnologien Formen, Reichweite und Interpretationen des Gedächtnisses der Gesellschaft entscheidend beeinflussen, wobei Esposito um die Annahme erweitert wurde, dass sich erst im Zusammentreffen von Kommunikationstechnologien und deren Nutzer*innen die Bedeutung von Medientechnologien für die Konstruktion eines kollektiven Gedächtnisses als kommunikativer Prozess in Erinnerungskulturen erfassen lässt. Das Internet wurde in Anlehnung an Aleida Assmann als riesiger Datenpool ohne Langzeitspeicher bewertet, in dem sich durch den Verlust der Materialität des Gespeicherten eine drastische Reduktion der Langzeitstabilität vollzieht und das mit Elena Esposito als Medium des Vergessens beschrieben worden ist. Die von Aleida Assmann beschriebene Verflüssigung von Daten und der rapide Aktualitätsverfall in Kombination mit einer teilweise automatisierten Computerkommunikation und Datenschöpfung zwingt die Nutzer*innen im telematischen Gedächtnis Internet ständig dazu, zu selektieren, während die Anbieter*innen auf diese Ökonomie der Aufmerksamkeit reagieren müssen. Dies ist ein entscheidender Mechanismus für Social Media und für sich in diesen konstituierende Erinnerungskulturen. Abschließend wurde Astrid Erlls Medienbegriff Medium des kollektiven Gedächtnisses mit seiner materialen und sozialen Dimension vorgestellt. Dabei wurde am konkreten Erinnerungsmedium der Social Media erläutert, welche spezifischen Faktoren der Materialität des Mediums in materialer (Hypermedialität und Interaktivität) und in sozialen Dimension (Produktionsbedingun488 Vgl. Erll 2003, S. 150. 489 Vgl. Erll 2003, S. 150.
Methodische Zugänge
95
gen von Wissen und Kommunikationsweisen im Social Web) die sich konstituierenden Erinnerungskulturen prägen. Damit ist die Offenlegung der theoretischen Zugänge dieser Studie vollzogen. Es folgt die Erläuterung der methodischen Zugriffe auf das zu analysierende Material.
2.2. Methodische Zugänge In methodischer Hinsicht wurden für die Studie zwei Zugänge gewählt: Am zu untersuchenden Gegenstand in medialer Hinsicht ausgerichtet ist die gewählte methodische Rahmung als Social-Media-Monitoring des Fünf-Phasenmodells490 von Oliver Plauschinat und Florian Klaus. Da das zentrale Ziel dieser Studie die Identifizierung von historischen Erinnerungsmustern in Form von diskursiven Strukturen ist, wurde die methodische Rahmung des Social-Media-Monitorings um eine diskursanalytische Methode erweitert. Eingesetzt wird die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN)491 nach Ingo Warnke und Jürgen Spitzmüller, die im Folgenden in ihrer Rolle für diese Studie erläutert wird.
2.2.1. Der methodische Rahmen: Social-Media-Monitoring Den methodischen Rahmen dieser Untersuchung stellt ein Social-Media-Monitoring dar. In größeren Unternehmen existieren schon lange Pressespiegel in Papierform, in denen die Presse ausgewertet wird, um dann Vermutungen darüber anzustellen, wie das eigene Unternehmen und Konkurrenten in der öffentlichen Kommunikation verhandelt werden; diese Datenerfassung ist zunächst auf eine elektronische Auswertung von Presseerzeugnissen ausgeweitet worden, während heute die Medienbeobachtung in Form von Monitorings auch auf Social Media übertragen wird, da die Daten hier digital und zum großen Teil öffentlich vorliegen.492 Social-Media-Monitoring ist dabei für eine Vielzahl von Unternehmensbereichen und Anwendungsfelder interessant.493 490 Plauschinat, Oliver / Klaus, Florian: Web Monitoring – Methodik zur Beobachtung von Social Media für die Meinungsanalyse. in: Scherfer, Konrad / Volpers, Helmut (Hrsg.): Methoden der Webwissenschaft. Berlin 2013. S. 43–63. 491 Warnke, Ingo / Spitzmüller, Jürgen: Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik – Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. in: Warnke, Ingo / Spitzmüller, Jürgen (Hrsg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin, New York 2008. S. 3–54. 492 Vgl. Werner, Andreas: Social Media – Analytics & Monitoring. Verfahren und Werkzeuge zur Optimierung des ROI. Heidelberg 2013. S. 2–3.
96
Zugänge und Grundlagen
Diese Studie untersucht Social Media jedoch ausdrücklich nicht mit einem ökonomischen PR- oder Marketinginteresse, auch nicht für museumspädagogische Zwecke, sondern will v. a. erinnerungskulturelle Diskurse im Medium des kollektiven Gedächtnisses Social Web identifizieren und die Rückwirkungseffekte des Mediums in medialer und kommunikativer Hinsicht auf diese Diskurse untersuchen. Da der Untersuchungsgegenstand Social-Web-Medien sind, ist das Modell des Social-Media-Monitorings für diese Studie als methodischen Rahmung dennoch geeignet, um den Forschungsprozess zu strukturieren und um ihn transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Konkret wird als Analyseschema des Fünf-Phasenmodells von Plauschinat / Klaus494 in dieser Studie in leicht veränderterer Form eingesetzt. Grundsätzlich umfasst das Modell die Phasen Planen, Zuhören, Analysieren, Verstehen und Handeln. Diese Phasen werden im Folgenden ausgehend von Plauschinat / Klaus inklusive der für diese Untersuchung vorgenommenen Adaptionen erläutert werden. Die erste Phase nennen Plauschinat / Klaus Planung.495 Hier werden die konkreten Fragestellungen und Ziele des Monitorings definiert. Zudem soll hier festgelegt werden, welcher Zeitraum untersucht werden soll. Für diese Untersuchung werden jeweils für alle zu untersuchenden Plattformen, je nach Untersuchungsgegenstand (z. B. das Anne Frank Haus in den Social Media) übergeordnete Fragestellungen formuliert. Aufgrund der Breite dieser Untersuchung werden keine plattformspezifischen Fragestellungen entworfen. Da bei der konkreten Analyse eine diskursanalytische Methode496 zum Einsatz kommt, werden in dieser Studie in dieser Phase keine Analyseleitfäden (Inhaltsanalyse) oder Kennzahlensteckbriefe erstellt, sondern die konkreten Fragestellungen für die folgenden Analysephasen formuliert und offengelegt. Da diese Untersuchung einen diskursanalytischen Ansatz verfolgt und (historische) Erinnerungsdiskurse in (aktuellen) Online-Erinnerungskulturen aufdecken will, geht der Definition der konkreten Fragestellungen immer ein Herausarbeiten dessen voraus, was die Forschung innerhalb transnationaler Erinnerungspraktiken für Diskurse
493 Diese Unternehmensbereiche und Anwendungsfelder sind: Reputationsmanagement, Wettbewerbsbeobachtung, Marktanalyse, Meinungsführeridentifikation (Influencer Detection), Trend Analyse, Krisenmanagement, Issues Management, Kampagnen-Monitoring, Produkt- und Innovationsmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Risikomanagement, Event Detection. Vgl. Kasper, Harriet: Marktstudie Social Media Monitoring Tools. IT-Lösungen zur Beobachtung und Analyse unternehmensstrategisch relevanter Informationen im Internet. Stuttgart 2010. S. 14–15. 494 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 48. 495 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 47–49. 496 Siehe Kapitel 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN).
Methodische Zugänge
97
und Narrative in Bezug auf die jeweiligen Untersuchungsgegenstände identifiziert hat.497 Die zweite Phase ist diejenige der Datenerhebung.498 Hier werden konkrete Social-Media-Quellen hinsichtlich Relevanz und Reichweite eingeschränkt und der zu analysierende Datenpool wird letztendlich bestimmt. Die Auswahlkriterien für die konkret untersuchten Seiten und Beiträge werden hier offengelegt.499 Bei Plauschinat / Klaus erfolgt die Datenerhebung als »Zuhören« vollautomatisiert über Webcrawler. Diese kommen bei dieser Untersuchung zwar auch bei der Datenerhebung zum Einsatz, jedoch wird hier insgesamt ein intellektuelles bzw. manuelles Monitoring vollzogen, dass das Auffinden und die Bewertung von Content ohne den Einsatz von Social-Media-Monitoring Tools vollzieht und v. a. die medienimmanenten Suchmaschinen in Kombination mit öffentlichen Suchmaschinen wie Google zum Auffinden von Social-Media-Seiten nutzt, wie es Evrim Sen500 und Marco Güldenring501 vorschlagen. Die Nutzung von SocialMedia-Monitoring Tools gestaltete sich auch deshalb schwierig, da hierfür auch bei öffentlichen Profilen die Zugriffsrechte vorhanden sein müssen, die nur dem Eigentümer der Seite zur Verfügung stehen, um große Datenmengen zu erheben und automatisch auszuwerten.502 Ebenfalls wird keine elektronische Speicherung der Daten vorgenommen, da dies, aufgrund der bislang fehlenden Möglichkeit503 der Einbindung von datenbankgesteuerten Webangeboten, von Animationen, von Tönen und hypermedialen Verknüpfungen der Social-Media-Plattformen, als nicht sinnvoll erscheint.504 Daraus ergibt sich allerdings ein grundsätzliches
497 Im Falle des Social-Media-Monitorings der Aktivitäten auf den Kanälen des Auschwitz Memorial and Museum werden hier transnationalen Erinnerungsdiskurse und -narrative zum Holocaust allgemein und zum Konzentrationslager Auschwitz konkret herausgearbeitet (siehe Kapitel 3.1.1.Transnationale Erinnerung an Auschwitz und den Holocaust). 498 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 49–50. 499 Beispiel: Alle Twitterprofile die Claus Stauffenberg explizit oder in Abwandlung im Nutzer*innen- oder Profilnamen tragen und aufgrund ihres Profilbildes oder der veröffentlichten Inhalte Bezüge zur historischen Person Claus Stauffenberg aufweisen (siehe Kapitel 4.1.2.2. Claus Stauffenberg auf Twitter). 500 Sen, Evrim: Social Media Monitoring für Unternehmen. Anforderungen an das Web-Monitoring verstehen & die richtigen Fragen stellen. Köln 2011. S. 15–17. 501 Güldenring, Marco: Webmonitoring. Public Relations im Online-Zeitalter. Saarbrücken 2007. S. 33–43. 502 Vgl. Pfaffenberger, Fabian: Twitter als Basis wissenschaftlicher Studien. Wiesbaden 2016. S. 41–70. 503 Stand Dezember 2015 (Beginn der Analysen). 504 Vgl. Mitra, Ananda / Cohen, Elisia: Analyzing the web. Directions and challenges. in: Jones, Steve (Hrsg.): Doing Internet research. Critical issues and methods for examining the Net. Thousand Oaks, Calif. 1999. S. 179–202, hier S. 190; Vgl. Weare, Christopher / Lin, Wan-Ying: Content analysis of the world wide web. Opportunities and challenges. in: Social Science Computer Review 18 (2000). Heft 3. S. 272–292, hier S. 287.
98
Zugänge und Grundlagen
Problem von Onlineanalysen: intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Gewährleitung von Reliabilität und Validität sind nicht vollständig zu erreichen.505 Die Auswertung der Daten erfolgt dann in der dritten Phase, der Datenanalyse.506 In dieser werden die Daten ausgewertet und auch dies erfolgt im konkreten Fall in einem manuellen Monitoring. Da sich Plauschinat / Klaus hier stark an methodischen Verfahren der (Online-)Inhaltsanalyse orientieren, soll in ihrem Modell hier auch eine klassische Codierung stattfinden. Mit Blick auf dieser Phase wird am deutlichsten, warum das Modell von Plauschinat / Klaus hier nur als methodische Rahmung verstanden wird. Denn im konkreten Analyseprozess folgt diese Arbeit theoretischen Annahmen und konkreten Analyseverfahren der Diskursforschung, sodass hier auch keine Codierung stattfindet. Ebenfalls finden die konkreten Analysekriterien von Plauschinat / Klaus zugunsten des DIMEAN-Modells keine Anwendung.507 Den Abschluss bildet die vierte Phase, die Dateninterpretation.508 Hier werden die Ergebnisse der Analysephase noch einmal zusammenfassend kommentiert, interpretiert und diskutiert. Bei Plauschinat / Klaus ist dies sehr stark auf ökonomisch orientiertes Marketinginteresse ausgerichtet, wenn hier mit Hilfe von Marktforschung Typologien von Nutzer*innen erstellt werden. Innerhalb dieser Studie ist diese Phase stark an der Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die leitende Fragestellung nach erinnerungskulturellen Diskursen und medienspezifischen Einflüssen ausgerichtet. Die letzte Phase stellen bei Plauschinat / Klaus die Reaktionen da, in der »die Erkenntnisse des Social-Media-Monitorings unternehmensintern genutzt und umgesetzt werden«509 sollen. Dass dies für diese Untersuchung als nicht sinnvoll erscheint, ergibt sich eindeutig aus dem rein deskriptiven Erkenntnisinteresse dieser Studie. Denn auch wenn man die Phase der Reaktionen in einem weiteren Sinne versteht, so will diese Untersuchung aufgrund ihrer deskriptiven Ausrichtung keine expliziten normativen Handlungsanweisungen zum Umgang mit Social Media formulieren, für keine Akteur*innen irgendeiner Art. Die Adaption des Modells von Plauschinat / Klaus (Abbildung 1) bietet für diese Studie eine passende methodische Rahmung, um den Forschungsprozess zu strukturieren und transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Den me505 Welker, Martin / Wünsch, Carsten / Böcking, Saskia / Bock, Annekatrin / Friedemann, Anne / Herbers, Martin / Isermann, Holger / Knieper, Thomas / Meier, Stefan / Pentzold, Christian / Schweitzer, Eva Johanna: Die Online-Inhaltsanalyse: methodische Herausforderung, aber ohne Alternative. in: Welker, Martin (Hrsg.): Die Online-Inhaltsanalyse. Forschungsobjekt Internet. Köln 2010. S. 9–30, hier S. 24–25. 506 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 51–52. 507 Siehe Kapitel 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN). 508 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 52–53. 509 Vgl. Plauschinat / Klaus 2013, S. 53.
99
Methodische Zugänge
thodisch-analytischen Kern dieser Arbeit stellt allerdings die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN) nach Warnke / Spitzmüller dar, die im Folgenden ebenfalls ausgehend vom originären Analysemodell in der Anwendung für diese Studie dargestellt und begründet wird.
Planen
Zuhören
Planung
Datenerhebung
Welche Seiten sind relevant und sollen untersucht werden?
Welche Diskurse und Narrative sind konkret nachweisbar?
-
-
Diskursanaly!sche Mehrebenenanalyse (DIMEAN) nach Warnke / Spitzmüller 2008:
-
-
Manuelles Monitoring nach Güldenring 2007; Sen 2011 medienimmanente Suchmaschinen (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram) und öffentliche Suchmaschinen (v. a. Google) keine elektronische Datenspeicherung
Dateninterpreta!on
Datenanalyse
Welche konkreten Diskurse sollen iden!fiziert werden?
Erinnerungsgeschichte Rezep!onsgeschichte spezifische Diskurse, Narrationen und Narra!ve (v. a. transnational)
Verstehen
Analysieren
1. Intratextuelle Ebene 2. Akteursebene 3. Transtexuelle Ebene
Welche Transformationen in diskursiver, medialer und kommunika!ver Hinsicht haben die Diskurse und Narrative durchlaufen? -
-
Beurteilung, Diskussion und Einordung der diskursanaly!schen Analyse Beschreibung der konkreten Erinnerungskulturen nach diskursiven, medialen und kommunika!ven Aspekten
Abbildung 1: Eigene Abwandlung des Phasenmodells von Plauschinat / Klaus 2013
2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Die Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN) Die fundierte Analyse von Web 2.0 und Social Media stellt die quantitative und qualitative Sozialforschung seit Beginn der Erforschung dieser medialen Phänomene vor eine Reihe von Problemen.510 Denn, wie schon oben gezeigt, zeichnen sich Social Media durch ihre dynamischen und heterogenen Publikationsund Archivierungspraktiken aus und präsentieren komplex organisierte Zeichenhandlungen, die sich aus den unterschiedlichen Zeichensystemen speisen und in den Realisierungen als multimodale Zeichenensembles zusammenwirken.511 Für die Analyse dieser aus medien-, kommunikations- und diskurswissenschaftlicher Sicht komplexen Systeme bietet die Diskurslinguistik ein für diese Studie handhabbares methodisches Analyseinstrumentarium, das auf den nächsten Seiten kurz erläutert werden soll. 510 Vgl. Scholz, Joachim: Forschen mit dem Web 2.0. Eher Pflicht als Kür. in: Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web. Köln 2008. S. 229– 242. 511 Vgl. Meier, Stefan: Semiotische Diskursanalyse in digitalen Medien. Zur Praxis diskursanalytischer Untersuchungen im World Wide Web. in: Gasteiner, Martin (Hrsg.): Digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien, Köln, Weimar 2010. S. 51– 65, hier S. 65.
100
Zugänge und Grundlagen
Mit der neuen Generation von Internetapplikationen in den Social Media wurde die Diskursanalyse in zunehmendem Maße für die Analyse von Internetkommunikation entdeckt.512 Die neuen Kommunikationsformate von Social Media, die die Interaktions-, Produktions- und Rezeptionsbedingungen des Internets auf einer höheren Stufe ausschöpfen, verknüpfen individuelles und gesellschaftliches Handeln auf neue Weise miteinander und bleiben nicht ohne Einfluss auf Diskursbedingungen, was diese Phänomene vor allem aus zwei Gründen für die Diskursforschung interessant macht: Erstens verändern Social Media, das in öffentliche Kommunikationsprozesse eingebunden ist, traditionelle Praktiken des öffentlichen Diskurses; zweitens ermöglichen Social Media die Beobachtung öffentlicher, interpersonaler Aushandlungsprozesse von gesellschaftlich geteiltem Wissen, sodass man die Konstitution eines kollektiven Gedächtnisses in Echtzeit beobachten und beschreiben kann.513 Etablierte Diskursbedingungen werden durch die neuen Kommunikationsformate verändert, da sie die bestehende Öffentlichkeit um neue gesellschaftliche Kommunikationsprozesse ergänzen und sich als neue Diskursplattformen etablieren, die neue Diskurspraktiken ermöglichen.514 In den Social Media finden sich teils chaotische, teils systematische Kommunikationsprozesse, die sich diskursiv verdichten, wobei die Transparenz des Wissensaushandlungsprozesses, der analytisch nachvollzogen werden kann, für die Diskursanalyse von besonderem Interesse ist, da sie die kommunikative Herstellung von Wissen in einem interpersonalen, kollaborativen Prozess offenlegt.515 Für die Kontextualisierung der Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust in den Social Media bedeutet dies, dass die in einem diskursiven Prozess entstehenden Erinnerungskulturen mithilfe diskursanalytischer Methoden greifbar werden. Bevor der für diese Studie verwendete Diskursbegriff definiert und das konkrete Analyseinstrumentarium der Diskursanalytischen Mehrebenenanalyse vorgestellt wird, erscheint es notwendig, im Folgenden vom untersuchten Material ausgehend zu begründen, warum die methodische Ausrichtung dieser Untersuchung eine diskursanalytische ist und keine mittels inhaltsanalytischer Verfahren. Inhaltsanalytische Methoden versuchen eine reine Beschreibung der Gegenstände zu erreichen und folgen der Annahme, dass Objektivität ermöglicht 512 Vgl. DFG-Projekt: Online-Diskurse. URL: http://www.medkom.tu-chemnitz.de/mk/online -diskurse/home.php (Zugriff am 03. 11. 2017). 513 Vgl. Fraas, Claudia / Pentzold, Christian: Online-Diskurse. Theoretische Prämissen, methodische Anforderungen und analytische Befunde. in: Warnke, Ingo (Hrsg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin, New York 2008. S. 287–322, hier S. 289. 514 Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 289. 515 Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 292.
Methodische Zugänge
101
werden könne, wenn man soziale Realitäten und komplexe Zusammenhänge mittels eines standardisierten Verfahrens analysierte.516 Objektivität soll durch eine starke Systematik und eine aus dieser entstehenden Wiederholbarkeit erzeugt werden.517 Inhaltsanalytische Untersuchungen haben den Anspruch der Wiederholbarkeit, also dass unterschiedliche Forschungsgruppen losgelöst von subjektiven Vorstellungen und spezifischem Vorwissen das gleiche Ergebnis erreichen, was vorgegebene Regeln der Interpretation und Codezuweisungen zur Folge hat, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit möglich zu machen.518 Inhaltsanalytische Methoden versuchen also den Einfluss des Vorwissens des Analysierenden als Faktor zu reduzieren, während diskursanalytische Verfahren einen völlig anderen Weg einschlagen, indem die Reflexion des eigenen Vorwissens einen notwendigen Bestandteil von Diskursanalysen darstellt,519 denn »[d]ie hermeneutische Rückführung des Sinns auf ein subjektives Verstehen und Meinen, sowie die phänomenologische Rückführung auf die Seinsgrundlage, zuletzt die der Lebenswelt, bringen Modelle des Subjekts und der Lebenswelt so in die Analyse ein, dass das Entstehen von Sinn nicht mehr fraglich ist, da dessen Möglichkeit durch diese anthropologischen Modelle bereits garantiert ist.«520 Eine »zentrale Kritik der Diskursanalyse an der Inhaltsanalyse ist, dass es der Inhaltsanalyse nicht um die Analyse der Inhalte (Semantiken), sondern um die Häufigkeitsverteilungen von Wörtern gehe, die dann als numerische Informationen ex post semantisch interpretiert würden.«521 Ohnehin gilt unter Diskursforscher*innen, dass das Gütekriterium der Objektivität auf einer Fiktion beruhe,522 da eine objektive Repräsentation von Gegenständen unmöglich sei.523 Das Kriterium der Nachvollziehbarkeit muss dennoch gewährleistet sein. Diese Nachvollziehbarkeit hat insoweit Grenzen, dass nicht klar definiert ist, welche Kriterien eine Diskursanalyse nachvollziehbar machen, außer dem Versuch des Analysierenden, nachvollziehbar und mit Blick auf die Quellen transparent zu 516 Vgl. Wedl, Juliette / Herschinger, Eva / Gasteiger, Ludwig: Diskursforschung oder Inhaltsanalyse? in: Angermüller, Johannes / Nonhoff, Martin (Hrsg.): Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Bielefeld 2014. S. 537–563, hier S. 552. 517 Vgl. Merten, Klaus: Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis. Opladen 1995. S. 49. 518 Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 553. 519 Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 551. 520 Diaz-Bone, Rainer: Kulturwelt, Diskurs und Lebensstil. Eine diskurstheoretische Erweiterung der Bourdieuschen Distinktionstheorie. Wiesbaden 2010. S. 188. 521 Vgl. Diaz-Bone, Rainer: Die interpretative Analytik als methodologische Position. in: Kerchner, Brigitte (Hrsg.): Foucault: Diskursanalyse der Politik. Eine Einführung. Wiesbaden 2006. S. 68–84, hier S. 77. 522 Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 552. 523 Law, John: Methodisch(e) Welten durcheinanderbringen. in: Feustel, Robert / Schochow, Maximilian (Hrsg.): Zwischen Sprachspiel und Methode. Bielefeld 2010. S. 147–167, hier S. 156.
102
Zugänge und Grundlagen
arbeiten.524 Diskursanalysen versuchen aber eben gerade nicht das zu analysierende Material methodisch mittels standardisierter Verfahren zu quantifizieren. Sie wollen »den Überschuss, also das, was gerade über die ˏreineˊ Analyse oder den Versuch der Abbildung eines Diskurses hinausgeht, nicht methodisch unter Kontrolle bringen […]. Der instabile Punkt ist nicht die Schwachstelle dieser Perspektive, sondern ihre große Stärke.«525 Diskursanalytische Positionen folgen dem methodologischen Prinzip der prinzipiellen Offenheit und Unabgeschlossenheit und weisen der intersubjektiven Reproduzierbarkeit eine untergeordnete Rolle zu.526 Während die Inhaltsanalyse einem stark theoriegeleiteten Forschungsprozess folgt,527 ist der Analyseprozess in Diskursanalysen ein wenig regelgeleiteter, explorativer Prozess, in dem Materialsammlung, Analyseverfahren und Ergebnisse flexibel im Laufe der Analyse dem Gegenstand schrittweise angepasst werden.528 Diese Zirkularität und Offenheit hat ihren Ursprung in der Grounded Theory529, die entdeckende mit validierenden Momenten verknüpft, sodass sich die Analyse nach und nach absichert und sich »als eine von Beginn an einsetzende Kombination von Interpretation und Reorganisation [präsentiert], die schrittweise aus dem Textmaterial heraus eine neue Erklärung oder Deutungsweise für dasselbe zu entwickeln versucht.«530 Der zirkuläre Forschungsprozess der Grounded Theory, der immer wieder zu den Daten zurückkehrt, anhand derer die Beantwortung der Forschungsfrage weiterentwickelt wird, und das Prinzip der Offenheit von Forschenden – als Gegenstand in der Heuristischen Sozialforschung – werden in die Diskursanalyse integriert, indem während der laufenden Analyse immer wieder geklärt wird, welche Medienprodukte in die nächsten Phasen des Forschungsprozesses einbezogen werden sollen.531 Der Forschungsprozess hat insgesamt einen unwissend-suchenden Charakter.532 524 Vgl. Feustel, Robert / Keller, Reiner / Schrage, Dominik / Wedl, Juliette / Wrana, Daniel / van Dyk, Silke: Zur method(olog)ischen Systematisierung der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung. in: Angermüller, Johannes / Nonhoff, Martin (Hrsg.): Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Bielefeld 2014. S. 482–506, hier S. 489. 525 Feustel / Keller / Schrage / Wedl / Wrana / van Dyk 2014. S. 489. 526 Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 552. 527 Vgl. Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim 2010. S. 59–62. 528 Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 553. 529 Vgl. Glaser, Barney G. / Strauss, Anselm L. / Paul, Axel T.: Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern 2010. 530 Vgl. Diaz-Bone, Rainer: Kulturwelt, Diskurs und Lebensstil. Eine diskurstheoretische Erweiterung der Bourdieuschen Distinktionstheorie. Wiesbaden 2010. S. 196. 531 Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 301–302; Sommer, Vivien: Methodentriangulation von Grounded Theory und Diskursanalyse. in: Pentzold, Christian / Bischof, Andreas / Heise, Nele (Hrsg.): Praxis Grounded Theory. Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen Lebenswelten. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Wiesbaden 2018. S. 105–130.
Methodische Zugänge
103
Ein weiterer Vorteil für diese Untersuchung liegt darin, dass in Diskursanalysen das Material in seiner Originalität in die Analyse einfließt, also keine Codierung stattfindet, da dies wiederum zu einer »bedeutungsreduzierende[n] Abstraktion von der Oberfläche des Materials«533 führen würde, sodass die fehlende Codierung die schwache Geregeltheit der Vorgehensweisen konsequent fortsetzt. Insgesamt streben Inhaltsanalysen also v. a. nach Objektivität und meinen, soziale Realitäten und komplexe Zusammenhänge mittels eines standardisierten Verfahrens hinreichend abbilden und analysieren zu können, während Diskursanalysen dem komplexen Wuchern der Diskurse mit unstandardisierten Vorgehensweisen begegnen.534 Diese Untersuchung folgt zum einen diesen diskursanalytischen Grundannahmen. Zum anderen übernimmt diese Studie dem Diskursbegriff nach Michel Foucault. Der Begriff Diskurs wird aber von Foucault in seinem Werk keineswegs einheitlich verwendet.535 Bei Foucault ist das Diskurskonzept ständig im Fluss, Definitionen sind selten, sehr vage und immer nur vorläufig.536 Diese Studie folgt Foucaults Begriffsdefinition des Diskurses, in der er den Diskurs als »eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören«537 definiert. Diese Aussagen definieren sich über ihren gemeinsamen Gegenstand, über implizite wie explizite Regeln, denen sie gehorchen, über spezifische Funktionen, denen sie unterliegen, und über bestimmte Formen, die sie annehmen.538 Im Frühwerk Michel Foucaults postuliert er noch die Abwesenheit des Subjektes, was er aber selbst später relativiert.539 Foucaults Theorie der Abwesenheit des Subjektes folgt der Tradition der Soziologie Durkheims, in der das einzelne Subjekt keine sinnstiftende Rolle spielt, sondern sich Bedeutung allein auf der Ebene des Kollektivbewusstseins konstituiert, was sich bei Foucault nun im Diskurs vollzieht.540 In neueren diskursanalytischen Ansätzen541 wird diese 532 533 534 535 536 537 538 539 540
Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 554. Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 554. Vgl. Wedl / Herschinger / Gasteiger 2014, S. 555. Vgl. Geisenhanslüke, Achim: Gegendiskurse. Literatur und Diskursanalyse bei Michel Foucault. Heidelberg 2008. S. 61. Vgl. Spitzmüller, Jürgen / Warnke, Ingo: Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin 2010. S. 65. Vgl. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main 1981. S. 156. Vgl. Neumeyer, Harald: Methoden diskursanalytischer Ansätze. in: Nünning, Ansgar / Nünning, Vera (Hrsg.): Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze – Grundlagen – Modellanalysen. Stuttgart 2010. S. 177–200, hier S. 178. Vgl. Bublitz, Hannelore: Subjekt. in: Kammler, Clemens / Parr, Rolf / Schneider, Ulrich Johannes / Reinhardt-Becker, Elke (Hrsg.): Foucault Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart 2008. S. 293–296, hier S. 293–294. Vgl. Keller, Reiner: Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms. Wiesbaden 2005. S. 205.
104
Zugänge und Grundlagen
Sichtweise korrigiert, die in Online-Diskursen auch Sprachhandeln von Individuen und Gruppen sehen.542 Diese neueren Ansätze knüpfen an Foucaults Die Ordnung des Diskurses543 an, in der der Diskursbegriff geöffnet wird und Subjekte als aktive und Bedeutung konstituierende Akteur*innen einbezogen werden. Foucault entwirft ein Verständnis von Diskursen »als strategische Spiele aus Handlung und Reaktion, Fragen und Antworten, Beherrschungsversuchen und Ausweichmanövern«544. Diskurse gelten als Orte des Konflikts, an denen mittels verschiedener Kontroll- und Ausschließungsprozeduren Aussagen und Aussagenkomplexe und Subjekte diszipliniert werden, da Akteur*innen zu einem Diskursensemble gehören, wenn sie sich und ihre Äußerungen den entsprechenden, das Diskursensemble charakterisierenden Erfordernissen unterwerfen.545 Zentral in diesem Zusammenhang ist die Verbindung von Macht und Wissen. Macht ermöglicht individuelle und kollektive Erfahrung und bringt Wissen hervor und Wissen bildet sich nicht »ohne ein Kommunikations-, Aufzeichnungs-, Akkumulations- und Vernetzungssystem, das in sich eine Form von Macht ist«546. Die Diskursanalyse bietet dabei Wege, um kollektive Wissensordnungen (Episteme547) nachzuweisen, die sich diskursiv mittels gesellschaftlicher und individueller Kommunikation konstituieren – im Falle dieser Studie in den Social Media – und die sich durch soziale Ensembles (Dispositive548) institutionalisieren und weitere diskursive Kopplungen bilden.549
541 Fairclough, Norman: Analysing discourse. Textual analysis for social research. New York 2006; Wengeler, Martin: Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985). Tübingen 2003; Meier, Stefan: (Bild-)Diskurs im Netz. Konzept und Methode für eine semiotische Diskursanalyse im Word Wide Web. Köln 2008. 542 Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 293. 543 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970. 11. Auflage. Frankfurt am Main 2011. 544 Foucault, Michel: Die Wahrheit und die juristischen Formen. Frankfurt am Main 2003. S. 11. 545 Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 294. 546 Foucault, Michel: Theorien und Institutionen des Strafvollzugs. in: Foucault, Michel: Analytik der Macht. herausgegeben von D. Defert u. F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagrange. Frankfurt am Main 2011. S. 64–68, hier S. 64. 547 »Die Episteme ist das Dispositiv, das es erlaubt, nicht schon das Wahre vom Falschen, sondern vielmehr das wissenschaftlich qualifizierbare vom Nicht-Qualifizierbaren zu scheiden.« Foucault, Michel: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin 1978. S. 124; Einführend zu Foucaults Episteme-Begriff siehe: Balke, Friedrich: Episteme. in: Kammler, Clemens / Parr, Rolf / Schneider, Ulrich Johannes / ReinhardtBecker, Elke (Hrsg.): Foucault Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart 2008. S. 246–249. 548 Zu Foucaults Begriff des Dispositiv siehe: Foucault, Michel / Defert, Daniel / Ewald, François / Lagrange, Jacques / Bischoff, Michael: Schriften in vier Bänden. Dits et écrits. Band 3. Frankfurt am Main 2003. S. 392–393. Einführend zu Foucaults Dispositiv-Begriff: Link, Jürgen: Dispositiv. in: Kammler, Clemens / Parr, Rolf / Schneider, Ulrich Johannes / Rein-
Methodische Zugänge
105
In der Wissenssoziologie werden Subjekte als Größen im Diskurs verstanden, die fähig sind, sich »im Rahmen der ihnen soziohistorisch verfügbaren Mittel nach Maßgabe eigener Sinnsetzung und auch kreativ auf die Erfahrungen und institutionellen Erwartungen zu beziehen, in die sie eintauchen«550. Für OnlineDiskurse ist dies von besonderer Relevanz, da die Produktions- und Rezeptionsbedingungen von neuen Kommunikationsformaten in den Social Media es den Nutzer*innen in hohem Maße erlauben, individueller zu agieren und zu kommunizieren, als das im Kontext anderer massenmedialer Diskurse möglich ist.551 Die Analyse von Online-Diskursen in den Social Media ermöglicht es, interpersonale Aushandlungsprozesse bei der Konstitution und Transformation geteilten Wissens zu beobachten. Die Begriffe des Narratives und der Narration werden in dieser Studie dem gerade beschriebenen konzeptionellen Verständnis von Diskurs folgendermaßen zugeordnet: Narrativ wird als integrative diskursive Kategorie verstanden, die Diskursen eine intelligible sprachliche Gestalt gibt.552 Die konkreten auf den Social-Media-Plattformen und -Seiten angebotenen (Geschichts-)Narrationen enthalten Narrative, die ihrerseits Teil von (Erinnerungs-)Diskursen sind. Methodisch ist diese Untersuchung allerdings zuallererst eine diskursanalytische Studie und keine narratologische553, da im konkreten Analyseprozess das verfahrenspraktische diskursanalytische Mehrebenenmodell DIMEAN von Warnke / Spitzmüller in der Variante von 2008554 zur Anwendung kommt. Dieses Modell ist eine methodologisch begründete und systematische Zusammenführung von zentralen diskurslinguistischen Gegenstandsbereichen und Untersuchungsverfahren.555 Die Ebenen sind als analytisch aufzufassen und nicht als eine Abbildung von Diskurskomplexität, sodass dieses Methodenmodell auch keine theoretische Modellierung des Diskurses aus linguistischer Sicht darstellt, sondern eine Modellierung einer diskurslinguistischen Methode.556 Außerdem ist
549 550 551 552 553
554 555 556
hardt-Becker, Elke (Hrsg.): Foucault Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart 2008. S. 237–242. Vgl. Meier, Stefan: (Bild-)Diskurs im Netz. Konzept und Methode für eine semiotische Diskursanalyse im Word Wide Web. Köln 2008. S. 64. Vgl. Keller 2006, S. 217. Vgl. Fraas / Pentzold 2008, S. 296. Vgl. Ächtler, Norman: Was ist ein Narrativ? Begriffsgeschichtliche Überlegungen anlässlich der aktuellen Europa-Debatte. in: KulturPoetik 14 (2014). S. 244–268, hier S. 258. Vgl. Nünning, Ansgar / Rupp, Jan: ›The Internet’s New Storytellers‹: Merkmale, Typologien und Funktionen narrativer Genres im Internet aus gattungstheoretischer, narratologischer und medienkulturwissenschaftlicher Sicht. in: Nünning, Ansgar / Rupp, Jan / Hagelmoser, Rebecca (Hrsg.): Narrative Genres im Internet. Theoretische Bezugsrahmen, Mediengattungstypologie und Funktionen. Trier 2012. S. 3–50. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008. S. 3–54. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 43. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 24.
106
Zugänge und Grundlagen
von zentraler Bedeutung, insbesondere für die Einbindung in das methodische Design dieser Untersuchung, dass die Ebenen nicht als Anleitung zur schrittweisen Analyse von Texten (oder anderen Medien) zu verstehen sind, denn das Mehrebenenmodell soll als Instrumentarium dienen, um Diskurse analytisch zu fassen, ohne dass hier alle Ebenen immer systematisch abgearbeitet werden müssen.557 Die Analyse umfasst dabei auf der kleinsten Ebene einzelne Wörter und Propositionen, beinhaltet dann einzelne Texte und Akteur*innen und steigt bis zur transtextuellen Ebene auf.558 Von Warnke / Spitzmüller werden in dieser Untersuchung die Ebenen des Modells als methodisches Begriffsinstrumentarium übernommen, nicht allerdings die Stufen der empirischen Analyse, da, wie oben gezeigt, hier die Stufen des Social-Media-Monitorings nach Plauschinat / Klaus den methodischen Rahmen setzen. Die Ebenen der Diskursanalytischen Mehrebenanalyse (DIMEAN) sollen im Folgenden in ihrer Anwendung für diese Untersuchung erläutert werden sollen. Warnke / Spitzmüller betonen ausdrücklich, dass es das Mehrebenenmodell ermöglichen soll, für konkrete Untersuchungen die relevanten Gegenstandsbereiche zu definieren, bei gleichzeitiger Benennbarkeit dessen, was nicht im Fokus des Interesses liegen soll.559 Dieser Grundsatz soll im Folgenden richtungsweisend sein. Die erste von insgesamt drei Ebenen des Modells von DIMEAN ist die intratextuelle Ebene. Diese umfasst eine text-, eine propositions- und eine wortorientierte Analyse. Die wortorientierte Analyse kann zentrale Mehr- und Ein-WortEinheiten identifizieren, die sich beispielweise als Schlüsselwörter560, Stigmawörter561, Namen562 oder Ad-hoc-Bildungen563 präsentieren. Diese genannten Wort-
557 Vgl. Spitzmüller, Jürgen / Warnke, Ingo: Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin 2010. S. 135. 558 Bendel Larcher, Sylvia / Eggler, Marcel: Linguistische Diskursanalyse. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen 2015. 559 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 24. 560 Schlüsselwörter drücken das Selbstverständnis und die Ideale einer Gruppe oder Epoche aus, sind diskursbestimmend, haben eine kontextuelle und konnotative dominante Bedeutung und weisen eine Bedeutungsvielfalt auf. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 26; Vgl. Liebert, Wolf-Andreas: Zu einem dynamischen Konzept von Schlüsselwörtern. Eine exemplarische Analyse am Beispiel Globalisierung. in: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 38 (2003). S. 57–83. 561 Stigmawörter stigmatisieren Konzepte von anderen Gruppen oder Epochen negativ mit dem Ziel der Abgrenzung. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 26. Vgl. Hermanns, Fritz: Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter. zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen »politischen Semantik«. Heidelberg 1994. S. 19. 562 Namen sind im engeren Sinne Mittel der Raumerfassung und begrifflichen Raumbesetzung. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008. 563 Ad-hoc-Bildungen sind als kontextgebundene Augenblicksbildungen zu verstehen, die lexikalische Lücken schließen sollen. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 26; Vgl. Peschel, Corinna: Zum Zusammenhang von Wortneubildung und Textkonstitution. Tübingen 2002.
Methodische Zugänge
107
klassen können je nach Bedarf beliebig erweitert werden,564 wobei sich diese Untersuchung v. a. auf die genannten Wortklassen beschränkt und die Identifizierung von Schlüsselwörtern ins Zentrum des Interesses rückt. Eine propositionsorientierte Analyse nimmt die Satzeinheit in den Fokus und kann semantische, syntaktische und pragmatische Aspekte betrachten. Warnke / Spitzmüller schlagen eine Vielzahl an Klassen vor, während sich diese Untersuchung v. a. auf die Betrachtung der Konstruktion von Sätzen (Syntax) und auf auffällige Metaphern beschränkt.565 Bei der textorientierten Analyse unterscheiden Warnke / Spitzmüller noch einmal zwischen der textuellen Meso- und Makrostruktur und der visuellen Textstruktur, wobei die textuelle Mesostruktur Formen der Textteilgliederung und die textuelle Makrostruktur die thematische Gliederung beschreiben will.566 Für diese Untersuchung sind v. a. die jeweiligen Themenentfaltungen, Textstrategien und Textfunktionen auf dieser Ebene zentral.567 Hier soll dann am jeweiligen Fall untersucht werden, mit welcher abgeleiteten Intention der Text von Anbieter*innen oder Nutzer*innen verfasst worden ist und wie diese Intention konkret strategisch umgesetzt und entfaltet worden ist. Ebenso sind in den Social Media auch die visuellen Textstrukturen von hoher Bedeutung. Warnke / Spitzmüller schlagen hier die Kategorien Layout/Design, Typographie, Text-BildBeziehungen sowie Materialität/Textträger vor.568 In der Kategorie Materialität/ Textträger sollen Trägermedium und Kommunikationsform in die Analyse mit einbezogen werden. Durch die theoretische Grundlegung dieser Untersuchung mit Erlls Medienbegriff 569 steht allerdings für diesen Aspekt ein differenziertes Beschreibungsinstrumentarium zur Verfügung. Wichtig ist, dass Warnke / Spitzmüller auf dieser Ebene Text-Bild-Beziehungen in die Analyse miteinbeziehen. Die zweite Ebene von DIMEAN ist diejenige der Akteur*innen. Insbesondere auf dieser Ebene soll in der konkreten Analyse ein Schwerpunkt liegen, da auf den zu untersuchenden Social-Media-Seiten viele Akteur*innen unterschiedlichste diskursive Netze spannen. Es erscheint nicht nur in Bezug auf Social Media als absolut sinnvoll, auch Diskurshandlungen und die dazugehörigen Akteur*innen in ein diskurslinguistisches Methodenmodell zu integrieren.570 Warnke / Spitzmüller differenzieren diese Ebene weiter aus, indem sie zunächst die Interaktionsrollen identifizieren. DIMEAN unterscheidet hier zwischen den 564 565 566 567 568 569 570
Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 25–26. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 26–29. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 29. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 30. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 30. Vgl. Kapitel 2.1.3.Medientheoretische und -begriffliche Grundlagen. Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 32.
108
Zugänge und Grundlagen
konventionellen Rollen der Textproduzent*innen und -rezipient*innen, wobei die Produzent*innen oder Autor*innen weniger als Personen, sondern als abstrakte Äußerungsmodalitäten zu verstehen sind.571 Nützlich für die Analyse von Social Media kann ggf. auch die weitere Unterscheidung zwischen Authors (Vertexter*innen), Principals (markierte Autor*innenschaft), Animators (Instanzen der Äußerung) auf der Produzent*innenseite und Adressat*innen, Bystanders (Mithörer*innen), Eavesdroppers (nicht autorisierte Empfänger*innen) auf der Rezipient*innenseite sein.572 Zur analytischen Fassung von Erinnerungsdiskursen in den Social Media ist die Identifizierung von Diskurspositionen zentral. DIMEAN bietet verschiedene Klassifizierungen an, um diskursive Praktiken verschiedenster Diskursteilnehmer*innen zu benennen und zu vergleichen. Sehr nützlich scheint das Konzept der Ideology Brokers zu sein, das Akteur*innen der Diskursgemeinschaft beschreibt, die im Diskurs über Autorität verfügen.573 Um die Aushandlungsprozesse um Autorität in Erinnerungsdiskursen analytisch zu durchleuchten, ist das Konzept der Voice574 ebenfalls nützlich, das die Fähigkeit von Sprecher*innen beschreibt, sich unter bestimmten sozialen Bedingungen Gehör zu verschaffen, ihren Standpunkt klarzumachen und ihr kommunikatives Ziel zu erreichen.575 Zudem kann die konkret vertretene Diskursposition hier benannt und beschrieben werden. Ebenfalls auf der Ebene der Akteur*innen kann die Medialität ein Faktor der Analyse sein. Da in dieser Untersuchung der medienspezifische Einfluss des Erinnerungsmediums untersucht wird und hierfür Erlls Medium des kollektiven Gedächtnisses als eine differenzierte medienbegriffliche Grundlage dient, sollen die Klassifikationen von DIMEAN hier außen vor bleiben. Die dritte Ebene von DIMEAN ist die transtextuelle Ebene, die relationale transtextuelle Strukturen zu den anderen Ebenen offenlegen will, die wirksam werden als Bedingung im Sinne einer Kontextualisierung von einzelnen Aussagen oder als Folge von Aussagen, die als diskursive Ereignisse diskursprägend sind.576 Die drei Ebenen von DIMEAN sind derart miteinander vernetzt, dass »die intratextuelle Analyse als Bedingung der Möglichkeit transtextueller Untersuchung angesehen wird. Verbunden sind beide Ebenen durch Akteure […].«577 DIMEAN bezieht also die Befunde der intratextuellen Analyse und der Ak571 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 33. 572 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 33; Vgl. Goffman, Erving: Footing. in: Semiotica 25 (1979). S. 1–29. 573 Blommaert, Jan: The debate is open. in: Blommaert, Jan (Hrsg.): Language ideological debates. Berlin [u. a.] 1999. S. 1–38, hier S. 9. 574 Vgl. Hymes, Deli: Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Towards an Understanding of Voice. London 1996. 575 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 35. 576 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 39. 577 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 39.
Methodische Zugänge
109
teur*innenanalyse auf transtextuelle diskursive Strukturen. Im Falle dieser Untersuchung sind dies Erinnerungsdiskurse, die sich in den Social Media in Narrationen mit spezifischen erinnerungskulturellen Narrativen manifestieren. Auch hier schlagen Warnke / Spitzmüller eine Reihe von Klassifikationen vor, in denen Diskurse auftreten können. Davon werden in dieser Untersuchung v. a. die folgenden das Analyseinstrumentarium komplimentieren. Zum einen wird es in der Analyse immer Ziel sein, auf der transtextuellen Ebene diskurssemantische Grundfiguren aufzudecken. Warnke / Spitzmüller verstehen unter einer diskurssemantischen Grundfigur »eine […] Denkfigur, die die Art und Weise der Thematisierung bestimmter Gegenstände und die damit verbundenen Haltungen in Textverbünden kennzeichnet.«578 Zudem stellen diskurssemantische Grundfiguren die Bedingung für »eine transtextuelle Unterlegung von Aussagen«579 dar. Während für Busse diskursive Grundfiguren textinhaltliche Elemente ordnen und ihr Auftreten an bestimmten Punkten des Diskurses steuern und eine innere Struktur des Diskurses bestimmen, die nicht mit der thematischen Struktur der Texte, in denen sie auftauchen, identisch sein muss.580 Außerdem sind diskurssemantische Grundfiguren häufig »dem Bewusstsein des Sprechers oder Schreibers entzogene[n] Inhalte.«581 Warnke / Spitzmüller betonen ausgehend von Foucault auch, dass Diskurse historisch gewachsene Phänomene, darstellen und diese ihnen innewohnende Historizität bei der Analyse zu berücksichtigen ist.582 Diesem Ansatz ist die gesamte Konzeption dieser Studie – wie bereits oben dargestellt – verpflichtet, womit die zentrale Fragestellung dieser Untersuchung insbesondere auf dieser Untersuchungsebene von DIMEAN einen starken methodischen Widerhall findet. Daneben gilt es auf der transtextuellen Ebene auch Ideologien und Mentalitäten analytisch freizulegen. Mentalitäten sind dabei zu verstehen als »die Gesamtheit von […] Gewohnheiten bzw. Disposition[en] […] des Denkens und des Fühlens und […] des Wollens oder Sollens in […] sozialen Gruppen«583. Ideo578 Warnke / Spitzmüller 2008, S. 40. 579 Warnke / Spitzmüller 2008, S. 41. 580 Vgl. Busse, Dietrich: Das Eigene und das Fremde. Annotationen zu Funktion und Wirkung einer diskurssemantischen Grundfigur. in: Jung, Matthias (Hrsg.): Die Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über »Ausländer« in Medien, Politik und Alltag. Opladen 1997. S. 17–35, hier S. 20. 581 Scharloth, Joachim: Die Semantik der Kulturen. Diskurssemantische Grundfiguren als Kategorien einer linguistischen Kulturanalyse. in: Busse, Dietrich / Niehr, Thomas / Wengeler, Martin (Hrsg.): Brisante Semantik. Neuere Konzepte und Forschungsergebnisse einer kulturwissenschaftlichen Linguistik. Tübingen 2005. S. 133–148, hier S. 137. 582 Warnke / Spitzmüller 2008, S. 42. 583 Hermanns, Fritz: Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte. Überlegungen zu Sinn und Form und Gegenstand historischer Semantik. in: Gardt, Andreas / Mattheier, Klaus / Reichmann, Oskar (Hrsg.): Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Tübingen 1995. S. 69–99, hier S. 77.
110
Zugänge und Grundlagen
logie wird hier als »die Summe der Annahmen, mit deren Hilfe die Mitglieder eines Kollektivs soziale Wirklichkeit konstruieren«584 begriffen. Ideologie wird als Summe von rational reflektierten Wirklichkeitsannahmen verstanden, während Mentalitäten als nicht reflektier- und verhandelbar erscheinen; sie sind assoziativ, man kann über die eigenen Mentalitäten nicht kausallogisch reflektieren, obwohl man sich ihnen durchaus bewusst ist.585 Außerdem werden auf dieser transtextuellen Analyseebene auch gesellschaftliche und politischen Debatten erfasst.586 Insgesamt lassen sich die theoretischen und methodischen Zugänge dieser Untersuchung wie folgt zusammenfassen: Geschichtsdidaktik wird hier als kulturwissenschaftliche Disziplin verstanden, die die Begriffe Geschichtskultur und Erinnerungskultur parallel verwendet. Diese Studie folgt diesem Ansatz, sieht die kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorien als theoretisches Fundament dieser Untersuchung und weist dem Begriff der Erinnerungskulturen eine zentrale konzeptionelle Rolle zu. In Anlehnung an Maurice Halbwachs wird Gedächtnis als ein soziales Phänomen verstanden, dessen Erinnerungen sozial, perspektivisch, konstruktiv und identitätsstiftend sind. Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes von Halbwachs durch Jan Assmann, Gedächtnis als kulturelles Phänomen zu begreifen, ist ein weiterer Baustein des theoretischen Fundamentes dieser Untersuchung, da das Konzept des kulturellen Gedächtnisses neben dem sozialen Bezugsrahmen auch die Medien und ihre Materialität und damit die Art und Weise miteinschließt, wie diese Vergangenheitsbezüge beeinflussen, da Medien in der Konzeption Assmanns als Gedächtnisstützen und Zeichenträger zu Trägern potenzieller Erinnerungsanlässe werden. Assmann übernimmt von Maurice Halbwachs die soziale Rahmung von Erinnerungsprozessen und verknüpft diese mit dem Begriff der Erinnerungskultur. Konzeptionell liegt dieser Untersuchung das Konzept der Erinnerungskultur des Gießener Sonderforschungsbereichs 434 Erinnerungskulturen zugrunde, weil es die Dynamik, Kreativität, Prozesshaftigkeit und vor allem die Pluralität der kulturellen Erinnerung in den Vordergrund rückt und die Ausformung spezifischer Erinnerungskulturen und die konkreten Kommunikationsweisen und Gedächtnismedientechnologien einer Gesellschaft im Fokus hat. Zusätzlich wird die Theorie von Erinnerungskulturen nach Mathias Berek integriert, die den Menschen als kulturelles Wesen begreift, der zunächst individuell erinnert und dabei vergangene Erfahrungen im Zusammenhang gegenwärtiger Handlungsnotwendigkei584 Spitzmüller, Jürgen: Das Eigene, das Fremde und das Unbehagen an der Sprachkultur. Überlegungen zur Dynamik sprachideologischer Diskurse. in: Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur 1 (2005). Heft 3. S. 248–261, hier S. 254. 585 Vgl. Spitzmüller, Jürgen: Metasprachdiskurse. Einstellungen zu Anglizismen und ihre wissenschaftliche Rezeption. Berlin, New York 2005, hier S. 58. 586 Vgl. Warnke / Spitzmüller 2008, S. 43.
Methodische Zugänge
111
ten reproduziert, so Wirklichkeit konstruiert und die Inhalte des individuellen Gedächtnisses in ein kollektives Gedächtnis als Ergebnis subjektiver Erinnerungen abhängig von kollektiven Bedürfnissen und Zuständen in der Gegenwart übernimmt. Erinnerung wird hier als Gebrauch des Gedächtnisses verstanden, als prozesshafte dynamische Aneignung von Vergangenheit in kommunikativen, medialen Diskursen, in denen sich Erinnerungskulturen konstituieren. Damit liefern Halbwachs und Assmanns Theorien in Verbindung mit dem Konzept der Erinnerungskulturen einen entscheidenden Beitrag für ein handhabbares theoretisches Modell, um Erinnerungskulturen im Medium des kollektiven Gedächtnisses Social Media zu beschreiben. Ausgegangen wird weiterhin von der medienwissenschaftlichen Grundannahme, dass Rekonstruktionen von Vergangenheit in sozialen und kulturellen Kontexten nur durch Medien möglich sind, da auf kollektiver Ebene Gedächtnis immer medial vermittelt wird, die in den systemtheoretischen Ansatz überführt wurde. Gedächtnis ist in der Systemtheorie Luhmanns eine unpersönliche und äußerliche Eigenleistung von Kommunikation der publizistischen Medien. Medien sind daher konstitutiv für die Produktion und Reproduktion eines sozialen Gedächtnisses. Luhmanns Zusammenhang von Gedächtnis und Medien, angewendet auf kollektive Gedächtnisprozesse, wurde so verstanden, dass Massenmedien zwar am Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses beteiligt, nicht aber deren ausschließlicher Träger sind, da interpersonale und nichtmassenmediale Interaktionen ebenfalls Einfluss auf den Konstruktionsprozess des kollektiven Gedächtnisses haben. Ebenfalls wichtig ist der Ansatz von Esposito, dass Kommunikationstechnologien Formen, Reichweite und Interpretationen des Gedächtnisses der Gesellschaft beeinflussen. Esposito muss aber insoweit erweitert werden, dass sich erst im Zusammentreffen von Kommunikationstechnologien und deren Nutzer*innen die Bedeutung von Medientechnologien für die Konstruktion eines kollektiven Gedächtnisses erfassen lässt. Diese theoretische Fundierung wird analytisch nutzbar in Erlls Medium des kollektiven Gedächtnisses mit seiner materialen und sozialen Dimension und den vier beinhalteten Komponenten. Dabei wurde gezeigt, wie Medien des kollektiven Gedächtnisses Wirklichkeits- und Vergangenheitsversionen konstruieren, woran die Materialität des Mediums (Kommunikationsinstrument, Technologie und Objektivation) und seine soziale Dimension (Produzent*innen und Rezipient*innen eines Gedächtnismediums) beteiligt sind. Diese theoretischen Grundannahmen wurden in die methodischen Zugänge zu Erinnerungskulturen in den Social Media überführt. Den methodischen Rahmen dieser Untersuchung gibt das Fünf-Phasenmodell für Social-MediaMonitoring von Plauschinat / Klaus. Die Datenerhebung wird hier als manuelles Monitoring ohne elektronische Speicherung vollzogen. Die Datenanalyse stützt sich auf Methoden der Diskursforschung in Gestalt der Diskursanalytischen
112
Zugänge und Grundlagen
Mehrebenenanalyse (DIMEAN) nach Warnke / Spitzmüller. Diskursanalytischen Grundannahmen folgend, setzt diese Untersuchung methodisch weniger auf Abgeschlossenheit und intersubjektive Reproduzierbarkeit, sondern versucht die in den Social Media wuchernden differenten Erinnerungsdiskurse mittels eines explorativen methodischen Zugriffs analytisch greifbar zu machen. Es ist gerade dieser Überschuss, der über eine reine standardisierte Inhaltsanalyse hinausgeht und der mittels der diskursanalytischen Methodik analysierbar wird, auch wenn er methodisch nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden kann. Dieser, womöglich als methodisch instabiler erscheinende Faktor ist aber eben nicht die Schwachstelle dieses diskursanalytischen methodischen Zugangs, sondern seine große Stärke.
3.
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust in den Social Media
Der Begriff der Erinnerungsorte (lieux de mémoire) ist v. a. in den 1980er Jahren vom französischen Historiker Pierre Nora geprägt worden und hat ein spezifisches Forschungsparadigma abgesteckt, das seither in den Geschichts- und Kulturwissenschaften sehr fruchtbar rezipiert worden ist. Nora präzisierte und schärfte seinen Begriff der lieux de mémoire in den 1990er Jahren als »any significant entity, whether material or nonmaterial in nature, which by dint of human will or the work of time has become a symbolic element of the memorial heritage of any community […].«587 Noras Begriff ist vielfach kritisiert und weiterentwickelt worden.588 Georg Kreis hat jüngst als Vorschlag zur analytischen Weiterentwicklung des Begriffs vorgeschlagen, bei »Erinnerungsorten besser von Verdichtungen und Knoten des gesellschaftlichen Diskurses zu sprechen«589 und auf diese Weise stärker die Produktions-, Funktionalisierungs- und Nutzungsprozesse zu fokussieren und offenzulegen. Das noch laufende Projekt »DeutschPolnische Erinnerungsorte«590 des Zentrums für Historische Forschung Berlin591 der Polnischen Akademie der Wissenschaften hat ebenfalls Noras Konzept 587 Nora, Pierre: From Lieux de memoire to Realms of Memory. in: Nora, Pierre / Kritzman, Lawrence D. (Hrsg.): Realms of memory: rethinking the French past. V. 1: Conflicts and divisions. New York 1996. S. xv–xxiv, hier S. xvii. 588 Ausführliche Darstellung der Genese des Begriffs vgl. Siebeck, Cornelia: Erinnerungsorte, Lieux de Mémoire. in: Docupedia-Zeitgeschichte (2017). URL: http://docupedia.de/zg/Sie beck_erinnerungsorte_v1_de_2017 vom 02. 03. 2017 (Zugriff am 08. 11. 2017); Robbe, Tilmann: Historische Forschung und Geschichtsvermittlung. Erinnerungsorte in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. Göttingen 2009. S. 81–112. 589 Vgl. Kreis, Georg: Pierre Nora besser verstehen – und kritisieren. in: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 2 (2008). S. 103–117, hier S. 117. 590 Traba, Robert / Górny, Maciej / Kon´czal, Kornelia / Loew, Peter Oliver (Hrsg.): Deutschpolnische Erinnerungsorte. 5 Bände. Paderborn 2012–2015. 591 Projekt »Deutsch-Polnische Erinnerungsorte« des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften URL: http://www.cbh.pan.pl/de/de utsch-polnische-erinnerungsorte-polsko-niemieckie-miejsca-pami%C4%99ci (Zugriff am 8. 11. 2017).
114
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
jüngst analytisch und methodisch weiterentwickelt und fordert das »Prinzip der Dekonstruktion […] durch eine ›dekonstruierende’ Diskursanalyse, die hinter die Oberfläche der Texte und Bilder […] als Medien der Erinnerungsorte […] dringt«592. Damit wurde Noras Konzept theoretisch und methodisch diskursanalytisch weiterentwickelt.593 Diesem Ansatz folgt diese Studie, wie im vorhergegangenen Kapitel594 breit dargelegt, ebenfalls in theoretischer, v. a. aber in methodischer Hinsicht in seiner diskursanalytischen Ausrichtung, ohne dass Noras Begriff der lieux de mémoire explizit methodisch fruchtbar gemacht wird.
3.1. Das Auschwitz Memorial and Museum Für das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz existiert, anders als für die Geschichte des Antisemitismus, ein exaktes Anfangsdatum und, anders als für die Geschichte des Völkermordes, ein exaktes Enddatum: Am 20. Mai 1940 wurden die ersten polnischen Häftlinge in Auschwitz inhaftiert und am 27. Januar 1945 wurde dieses größte Konzentration- und Vernichtungslager von der Roten Armee befreit.595 In Auschwitz sind in diesem Zeitraum zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen ermordet worden.596 Bevor die Analyse der Social-Media-Auftritte des Museums Auschwitz dargestellt und ausgewertet werden kann, sollen im Folgenden diejenigen diskursiven erinnerungskulturellen Strukturen und Narrative der transnationalen Holocaust- und Auschwitzerinnerung herausgearbeitet werden, die als solche von der geschichtswissenschaftlichen Forschung als die dominanten identifiziert worden sind.
592 Vgl. Hahn, Hans Henning / Traba, Robert / Górny, Maciej / Kon´czal, Kornelia: Deutschpolnische Erinnerungsorte. Reader für Autorinnen und Autoren der Aufsätze über deutschpolnische Erinnerungsorte. Berlin 2009. S. 26–27. 593 Vgl. Kon´czal, Kornelia: Deutsch-polnische Erinnerungsorte: Wie die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte neu konzeptualisiert werden kann. in: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 2 (2008). S. 119–137. 594 Vgl. Kapitel 2. Zugänge und Grundlagen dieser Untersuchung. 595 Vgl. Rees, Laurence: Auschwitz. A new history. New York 2005. S. ix; Dwork, Deborah / van Pelt, R. J.: Auschwitz. New York 2008; Steinbacher, Sybille / Whiteside, Shaun: Auschwitz. A history. New York 2005; Willems, Susanne / Schumann, Frank / Schumann, Fritz: Auschwitz. Die Geschichte des Vernichtungslagers. Berlin 2015. S. 244–250. 596 Vgl. Steinbacher, Sybille: Auschwitz. Geschichte und Nachgeschichte. München 2017. S. 107; S´wiebocka, Teresa / Pinderska-Lech, Jadwiga / Mensfelt, Jarosław / Hansen, Imke: Auschwitz-Birkenau. Vergangenheit und Gegenwart. Os´wie˛cim 2011. S. 12.
Das Auschwitz Memorial and Museum
115
3.1.1. Transnationale Erinnerung an Auschwitz und den Holocaust Kurz nach dem Krieg wurden die Nürnberger Prozesse gegen deutsche Hauptkriegsverbrecher zwar weltweit aufmerksam verfolgt, aber es existierte dennoch zu diesem Zeitpunkt noch keine transnationale öffentliche Aufmerksamkeit für die nationalsozialistischen Verbrechen oder für Auschwitz,597 sodass der Gerichtsprozess sukzessive »an den Rand des öffentlichen Interesses«598 abgedrängt wurde. Ein pauschales »Desinteresse als kollektive Reaktionsform der Rezeption«599 existierte jedoch nicht. Erstmals kam während des Prozesses Auschwitz als ein konkretes Narrativ des Völkermords am europäischen Judentum und als konkreter Ort der Vernichtung international in den Fokus der Öffentlichkeit.600 Damit wurde bereits 1945 in Nürnberg der Grundstein dafür gelegt, »Auschwitz zu einem deutschen und menschheitsgeschichtlichen Erinnerungsort«601 zu machen. International waren in Europa die nationalen Erinnerungsmuster in den während des Zweiten Weltkriegs besetzten Ländern ähnlich, da vor allem diejenigen Aspekte der Vergangenheit kollektiv memoriert worden waren, die integrativen Charakter für die sich nach dem Krieg formierenden Gesellschaften hatten.602 Innerhalb dieser noch sehr jungen europäischen Erinnerungsdiskurse hatten Jüd*innen, die den Holocaust überlebt hatten, noch keine Stimme, auch weil das strikte Vergessen der deutschen Verbrechen am europäischen Judentum nach dem Nürnberger Prozess den universellen Charakter einer kollektiven eu-
597 Vgl. Hansen, Imke: »Nie wieder Auschwitz!«. Die Entstehung eines Symbols und der Alltag einer Gedenkstätte 1945–1955; Huener, Jonathan: Auschwitz, Poland, and the politics of commemoration, 1945–1979. Athens 2003; Kosmala, Beate: Lange Schatten der Erinnerung: Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedächtnis. in: Flacke, Monika (Hrsg.): Mythen der Nationen. 1945 – Arena de Erinnerungen. Mainz 2004. S. 507–540, hier S. 514–515; Steinlauf, Michael C.: Bondage to the dead. Poland and the memory of the Holocaust. Syracuse, NY 1997. S. 43–61. 598 Steinbach, Peter: Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher. in: Blasius, Rainer A. / Ueberschär, Gerd R. (Hrsg.): Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten, 1943–1952. Frankfurt am Main 2008. S. 32– 44, hier S. 39. 599 Krösche, Heike: Nürnberg und kein Interesse? Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945/6 und die Nürnberger Nachkriegsöffentlichkeit. in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg (2006). S. 299–317, hier S. 316. 600 Vgl. Diner, Dan: Gedächtnis und Methode. Über den Holocaust in der Geschichtsschreibung. in: Fritz Bauer Institut (Hrsg.): Auschwitz. Geschichte, Rezeption und Wirkung. Frankfurt am Main, New York 1996. S. 11–22. 601 Reichel, Peter: Auschwitz. in: François, Etienne (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. München 2003. S. 600–621, hier S. 607. 602 Vgl. Flacke, Monika (Hrsg.): Mythen der Nationen. 1945 – Arena de Erinnerungen. Mainz 2004.
116
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
ropäischen Amnesie hatte,603 denn »[t]he Holocaust was only one of many things that people wanted to forget.«604 In Teilen warf auch der Kalte Krieg durch die allseits empfundene atomare Bedrohung und die damit verbundene Möglichkeit einer universellen Selbstvernichtung der Menschheit zunächst einen »Mantel des Vergessens«605 über die Verbrechen von Auschwitz und den Holocaust insgesamt. Dies ändert sich in den 1960er Jahren, als sich zunächst in den USA etwas zu bilden begann, was Peter Novick als »Holocaust consciousness«606 bezeichnet. Als Ursache für eine neue Bereitschaft den Holocaust öffentlich breit zu thematisieren, sieht Novick die leichten Entspannungen zwischen den sich im Kalten Krieg befindlichen Mächten und die Tatsache, dass am Beginn der 1960er Jahre »the cold war outlook was so institutionalized that it was no longer threatened by reminders of World War II.«607 Der Mord am europäischen Judentum wurde jetzt international zunehmend als »eigenständiges und präzedenzloses Verbrechen verstanden und in öffentlichen Vergangenheitsdebatten diskutiert«608. Rückblickend waren es das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann 1961 in Jerusalem, die damit verbundenen Kontroversen über Hannah Arendts Buch Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen609 und das Stück Der Stellvertreter610, die effektiv die Phase des fünfzehnjährigen fast völligen Schweigens über den Holocaust zunächst in der amerikanischen und dann auch in der europäischen Öffentlichkeit beendeten und Auschwitz als zentralen Ort des Verbrechens wieder in öffentliche Debatten brachte.611 In Folge dieser Ereignisse erschien in den USA und in Europa in der kollektiven Erinnerung a distinct thing called ›the Holocaust‹ – an event in its own right, not simply a subdivision of general Nazi barbarism. There was a shift in focus to Jewish victims rather 603 Vgl. Judt, Tony: From the House of the Dead. An Essay on Modem European Memory. in: Ders. (Hrsg.): Postwar. A history of Europe since 1945. New York 2006. S. 803–831, hier S. 808. 604 Judt 2006, S. 808. 605 Diner, Dan: Gedächtnis und Restitution – oder die Begründung einer europäischen Erinnerung. in: Düwell, Susanne / Schmidt, Matthias (Hrsg.): Narrative der Shoah. Repräsentationen der Vergangenheit in Historiographie, Kunst und Politik. Paderborn 2002. S. 71–76, hier S. 72. 606 Vgl. Novick, Peter: The Holocaust and collective memory. London 2000. 607 Novick 2000, S. 127–128. 608 Eckel, Jan / Moisel, Claudia: Einleitung. in: Eckel, Jan / Moisel, Claudia (Hrsg.): Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler Perspektive. Göttingen 2008. S. 9–25, hier S. 12. 609 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. München 2006. 610 Hochhuth, Rolf: Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel. Reinbek bei Hamburg 1967. 611 Vgl. Novick 2000, S. 127–145.
Das Auschwitz Memorial and Museum
117
than German perpetrators that made its discussion more palatable in the continuing cold war climate.612
In den 1970er Jahren bekam die internationale Auseinandersetzung mit dem Holocaust einen Schub mit enormer »katalysatorischer Bedeutung«613 für die internationale Holocausterinnerung. Die unter der Regie von Marvin J. Chomsky produzierte amerikanische Fernsehserie Holocaust (1978)614 »kann als Geburt des internationalen medialen Diskurses über den nationalsozialistischen Genozid gelten.«615 Die Serie wurde zwischen 1978 und 1979 weltweit ausgestrahlt und gilt als internationale »Zäsur in der öffentlichen Erinnerung an die Ermordung der europäischen Juden«616. Die erste Ausstrahlung der Serie im deutschen Fernsehen im Januar 1979 brachte auch in der alten Bundesrepublik eine »erinnerungskulturelle Wende«617 und wurde aufgrund der breiten Diskussion im Vorfeld für viele ein herausragendes Fernsehereignis.618 Das Senden dieser Serien wird heute als das bis dato wichtigste Ereignis der bundesdeutschen Mediengeschichte bezeichnet.619 Die Ausstrahlung bildet die »folgenreichste Zäsur im geschichtskulturellen Diskurs der Bundesrepublik über Nationalsozialismus und Judenmord, die sich unter dem Titel ›Vom Beschweigen zur Medialisierung‹ zusammenfassen lässt«620 und wird als »Beginn einer neuen Phase in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus [und als eine] Zäsur in der Geschichte der kulturellen Erinnerung an die NS-
612 Vgl. Novick 2000, S. 144. 613 Eckel / Moisel 2008, S. 13. 614 Chomsky, Marvin J.: Holocaust. dt: Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß. 419 min. USA 1978. 615 Stiglegger, Marcus: Auschwitz-TV. Reflexionen des Holocaust in Fernsehserien. Wiesbaden 2015. S. 35. 616 Bösch, Frank: Bewegte Erinnerung. Dokumentarische und fiktionale Holocaustdarstellungen im Film und Fernsehen seit 1979. in: Paul, Gerhard / Schossig, Bernhard (Hrsg.): Öffentliche Erinnerung und Medialisierung des Nationalsozialismus. Eine Bilanz der letzten dreißig Jahre. Göttingen 2010. S. 39–61, hier S. 39. 617 Schmid, Harald: Die »Stunde der Wahrheit« und ihre Voraussetzungen. Zum geschichtskulturellen Wirkungskontext von »Holocaust«. in: Historical Social Research 30 (2005). Heft 4. S. 18–28, hier S. 19. 618 Vgl. Wilke, Jürgen: Die Fernsehserie »Holocaust« als Medienereignis. in: Historical Social Research 30 (2005). Heft 4. S. 9–17, hier S. 13. 619 Vgl. Weiß, Matthias: Sinnliche Erinnerung. Die Filme Holocaust und Schindlers Liste in der bundesdeutschen Vergegenwärtigung der NS-Zeit. in: Frei, Norbert / Steinbacher, Sybille (Hrsg.): Beschweigen und Bekennen. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft und der Holocaust. Göttingen 2001. S. 71–102, hier S. 75. 620 Gerhard, Paul: Holocaust. Vom Beschweigen zur Medialisierung. Über Veränderungen im Umgang mit Holocaust und Nationalsozialismus in der Mediengesellschaft. in: Paul, Gerhard / Schossig, Bernhard (Hrsg.): Öffentliche Erinnerung und Medialisierung des Nationalsozialismus. Eine Bilanz der letzten dreißig Jahre. Göttingen 2010. S. 15–38, hier S. 16.
118
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Gewaltverbrechen«621 bezeichnet. Der Sendetermin von Holocaust (1978) gilt deshalb heute als medien- und erinnerungsgeschichtlicher Einschnitt, da sie die kollektiven Vorstellungen über die Ermordung der Jüd*innen weltweit geprägt und das Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erheblich gefördert hatte.622 Zum einen verhalf die Serie dem Begriff Holocaust623 dazu, zum transnationalen und universalen Bezugsrahmen der Erinnerung an den Völkermord am europäischen Judentum zu avancieren.624 Zum anderen hatte Holocaust (1978) auch den Effekt, dass Auschwitz als historischer Ort ab diesem Zeitpunkt zunehmend zum geografischen Kristallisationspunkt der Holocausterinnerung und international mit dem Massenmord am europäischen Judentum verknüpft wurde.625 Im Sommer 1979 besuchte Karol Józef Wojtyła als neuer Papst Johannes Paul II. bei seiner Polenreise auch das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz, was weltweit in den Medien ein breites Echo gefunden hatte.626 Im selben Jahr wurde das ehemalige Lagergelände auch von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.627 Beides führte dazu, dass v. a. ab den 1980er Jahren eine erhebliche Zunahme von Besucher*innen auch aus westlichen Ländern zu verzeichnen war.628 Auschwitz wurde ab diesem Zeitpunkt vermehrt zum zentralen transna621 Vgl. Reichel, Peter: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater. München 2004. S. 250. 622 Vgl. Bönsch, Frank: Film, NS-Vergangenheit und Geschichtswissenschaft. Von »Holocaust« zu »Der Untergang«. in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007). Heft 1. S. 1–32, hier S. 12. 623 Vgl. Garber, Zev / Zuckerman, Bruce: Why do we call the Holocaust »THE HOLOCAUST?« An Inquiry into the Psychology of Labels. in: Modern Judaism 9 (1989). Heft 2. S. 197–211; Klemm, Peter / Ruppel, Helmut: Begriffe und Namen – Versuche, ein Geschehen zu fassen, das nicht faßbar ist: Auschwitz – Holocaust – Schoa – Churban. in: Lohrbächer, Albrecht (Hrsg.): Schoa – Schweigen ist unmöglich. Erinnern, Lernen, Gedenken. Stuttgart 1999. S. 144–146. 624 Vgl. Uhl, Heidemarie: Von »Endlösung« zu »Holocaust«. Die TV-Ausstrahlung von »Holocaust« und die Transformationen des österreichischen Gedächtnisses. in: Uhl, Heidemarie (Hrsg.): Zivilisationsbruch und Gedächtniskultur. Das 20. Jahrhundert in der Erinnerung des beginnenden 21. Jahrhunderts. Innsbruck 2003. S. 153–179, hier S. 153. 625 Vgl. Eckel / Moisel 2008, S. 13. 626 Schmid, Harald: Europäisierung des Auschwitzgedenkens? Zum Aufstieg des 27. Januar 1945 als »Holocaustgedenktag« in Europa. in: Eckel, Jan / Moisel, Claudia (Hrsg.): Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler Perspektive. Göttingen 2008. S. 174–202, hier S. 177; Young, James Edward: The texture of memory. Holocaust memorials and meaning. New Haven 1993. S. 119–154; Young, James Edward: The Texture of Memory: Holocaust Memorials in History. in: Erll, Astrid / Nünning, Ansgar / Young, Sara B. (Hrsg.): Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook. Berlin, New York 2008. S. 357–366. 627 Vgl. Steinlauf, Michael C.: Bondage to the dead. Poland and the memory of the Holocaust. Syracuse, NY 1997. S. 95. 628 Vgl. Steinlauf 1997, S. 89–121.
Das Auschwitz Memorial and Museum
119
tionalen Erinnerungsort, dem auch die Funktion eines Friedhofes für individuelle und kollektive Trauerarbeit zugesprochen wurde.629 Auch wenn die nationalen kollektiven Erinnerungen an den Holocaust international in Teilen länderübergreifend stattfanden, so ist insgesamt zu konstatieren, dass bis zum Ende des Kalten Krieges kein international einheitlicher Phasenverlauf existiert und die nationalen Diskussionen eigene Erinnerungsmuster und -kulturen etabliert haben, die ebenso von der länderspezifischen Rolle im des Zweiten Weltkrieg abhängt, wie von nachfolgenden politischen Ereignissen und Entwicklungen und nicht zuletzt wegen des erinnerungspolitischen Gegensatzes zwischen West- und Osteuropa national höchst uneinheitlich waren.630 Mit dem Ende des Kalten Krieges zerbrachen am Ende der 1980er Jahre viele Nachkriegsmythen631 und die bis dahin geltenden vorherrschenden dominanten Geschichtsbilder und Erinnerungskulturen wandelten sich grundlegend.632 Zentrale Faktoren für diese Entwicklung waren grundlegende Transformationsprozesse in den gesellschaftlichen Strukturen, wie ein Generationenwechsel und anhaltende Migrationsprozesse, in deren Folge die kulturelle und ethnische Vielfalt zunahm und neue Integrationsstrategien entwickelt werden mussten, die ein kollektives Selbstbild ohne ausschließlich nationale Bezüge herstellen konnten.633 Das Jahr 1989 muss in Bezug auf die Holocausterinnerung wiederum als »Zäsur und Auslöser neuer Gedächtniskonstellationen«634 bezeichnet werden. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Prozess in Gang gesetzt, in dessen Folge sich zum einen so etwas wie ein transnationales und gesamteuropäisches Gedenken an den Holocaust entwickelte, zum anderen diese sich etablierende transnationale Erinnerungsgemeinschaft in Europa aber nach wie vor aus konkurrierende Erinnerungen bestand, die nur teilweisen miteinander interagier629 Vgl. Rüsen, Jörn: Über den Umgang mit den Orten des Schreckens. in: Hoffmann, Detlef (Hrsg.): Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-Denkmäler 1945–1995. Frankfurt am Main 1997. S. 330–343, hier S. 338–340. 630 Vgl. Eckel / Moisel 2008, S. 13–14; Berg, Nicolas: »Auschwitz« und die Geschichtswissenschaft. Überlegungen zu Kontroversen der letzten Jahre. in: Berg, Nicolas / Jochimsen, Jess / Stiegler, Bernd (Hrsg.): Shoah – Formen der Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst. München 1996. S. 31–53. 631 Vgl. Judt, Tony: Die Vergangenheit ist ein anderes Land. Politische Mythen im Nachkriegseuropa. in: Transit 6 (1993). S. 87–120. 632 Vgl. Faulenbach, Bernd: Eine europäische Erinnerungskultur als Aufgabe? Zum Verhältnis gemeinsamer und trennender Erinnerungen. in: Flegel, Silke / Hoffmann, Frank (Hrsg.): Von der Osterweiterung zur europäischen Nation? Die EU auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Bochum 2004. S. 91–112. 633 Vgl. Köhr, Katja: Die vielen Gesichter des Holocaust. Museale Repräsentationen zwischen Individualisierung, Universalisierung und Nationalisierung. Göttingen 2012. S. 11–12. 634 Levy, Daniel / Sznaider, Natan: Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust. Frankfurt am Main 2001. S. 150.
120
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
ten.635 Dennoch vollzog sich am Ende des 20. Jahrhunderts der »Übergang von der nationalen zur transnationalen Holocaust-Erinnerung«636. Ab den 1990er Jahren gab es eine starke Zunahme zum einen in der wissenschaftlichen Erforschung des Holocaust durch die Geschichtswissenschaft v. a. in den USA, Deutschland, Israel und Polen, zum anderen der ästhetischen Verarbeitungen und medialen Darstellungen des selbigen.637 Als das zentrale populärkulturelle Massenmedium der Holocausterinnerung der frühen 1990er Jahre kann der Spielfilm Schindlers Liste (1993)638 gelten, mit dem es Steven Spielberg 1993 gelungen war, das öffentliche Interesse weltweit erheblich auf den Holocaust zu lenken.639 Ebenfalls 1993 kam es in Folge des wachsenden amerikanischen Holocaustbewusstseins zu einer stärkeren Auseinandersetzung der amerikanisch-jüdischen Gemeinden mit dem Holocaust und in dessen Folge zur Eröffnung einer nationalen amerikanischen Gedenkstätte in Washington, dem United States Holocaust Memorial Museum.640 Die intensive internationale Auseinandersetzung mit dem Holocaust reichte jedoch weiterhin über die USA und Europa hinaus.641 Diese Entwicklungen der 1990 Jahre hin zu einem transnationalen und gesamteuropäischen Gedenken an den Holocaust lassen sich auch an verschiedenen internationalen Konferenzen642 und institutionellen Beschlüssen ablesen,643 die den 27. Januar – den Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz – als natio635 Droit, Emmanuel: Die europäische Erinnerung an die Shoah im Zeitalter der Opferkonkurrenz. in: Avagliano, Mario / Müller, Claudia (Hrsg.): Die Shoah in Geschichte und Erinnerung. Perspektiven medialer Vermittlung in Italien und Deutschland. Bielefeld 2015. S. 127–138, hier S. 133. 636 Zimmermann, Moshe: Die transnationale Holocaust-Erinnerung. in: Budde, Gunilla-Friederike / Conrad, Sebastian / Janz, Oliver (Hrsg.): Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen 2006. S. 202–216, hier S. 202. 637 Vgl. Eckel / Moisel 2008, S. 15. 638 Spielberg, Steven: Schindler’s List. 194 min. USA 1993. 639 Vgl. Stiglegger 2015, S. 21. 640 Vgl. Pieper, Katrin: Die Musealisierung des Holocaust. Das Jüdische Museum Berlin und das U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington D.C.: ein Vergleich. Köln 2006. S. 92. 641 Beispielsweise wurden auch in Asien Museen und Forschungseinrichtungen ins Lebens gerufen. Vgl. Zimmermann 2006, S. 206–208. 642 Vgl. Kroh, Jens: Das erweiterte Europa auf dem Weg zu einem gemeinsamen Gedächtnis? Die Stockholmer »Holocaust-Konferenz« und ihre Bedeutung für die europäische Erinnerung in: Frölich, Margrit / Jureit, Ulrike / Schneider, Christian / Brockhaus, Gudrun (Hrsg.): Das Unbehagen an der Erinnerung. Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust. Frankfurt am Main 2012. S. 201–216; Sandkühler, Thomas: Nach Stockholm: HolocaustGeschichte und historische Erinnerung im neueren Schulgeschichtsbuch für die Sekundarstufen I und I. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 11 (2012). S. 50–76. 643 Vgl. Nietzel, Benno: Die internationalen Holocaust-Konferenzen 1997–2002.Von der Londoner Goldkonferenz zur Theresienstädter Erklärung. in: Brunner, José / Goschler, Constantin / Frei, Norbert (Hrsg.): Die Globalisierung der Wiedergutmachung. Politik, Moral, Moralpolitik. Göttingen 2013. S. 149–175.
Das Auschwitz Memorial and Museum
121
nenübergreifenden Gedenktag etablierten.644 Diese Bemühungen mündeten in einem Beschluss des Parlaments der Europäischen Union vom 27. Januar 2005, dem 60. Jahrestag der Befreiung: […] in der Erwägung, dass Europa seine Geschichte nicht vergessen darf, nämlich dass die von den Nationalsozialisten errichteten Konzentrations- und Vernichtungslager zu den abscheulichsten und schmerzlichsten Seiten der Geschichte unseres Kontinents gehören; in der Erwägung, dass die in Auschwitz begangenen Verbrechen im Gedächtnis künftiger Generationen weiterleben müssen, als Warnung vor einem solchen Völkermord, der seine Wurzeln in der Verachtung anderer Menschen, in Hass, Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus hat […]«645 und aus diesem Grund »das Gedenken an den Holocaust gefördert wird und zu diesem Zweck der 27. Januar in der gesamten Europäischen Union zum Europäischen Holocaustgedenktag erklärt wird […]«.646
Am 1. November 2005 erklärte dann die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Verabschiedung der Resolution 60/7 den 27. Januar zum »International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust«, womit dieser letztendlich als Gedenktag eine weltpolitische Dimension erhielt, die Erinnerung an den Holocaust auf europäischer Ebene zu einem »Erinnerungsimperativ«647 wurde und zugleich Auschwitz als zentraler Erinnerungsort an den Holocaust einen »global gültigen Wert«648 erhielt. Damit war im Umgang mit dem Holocaust international ein Punkt erreicht worden, an dem »kaum noch nationale Deutungsmonopole vorherrschten, da länderspezifische Gedenkmechanismen und transnationale Interpretationsschemata zusammenwirken.«649 Der Holocaust hatte damit in der europäischen Erinnerung tendenziell einen Platz »als allgemeines Symbol des Bösen […] gänzlich universell und unabhängig von nationalen Erinnerungskulturen«650 erhalten. Dem historischen Ort Ausch644 Vgl. Rousso, Henry: Das Dilemma eines europäischen Gedächtnisses. in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004). Heft 3. S. 363–378. 645 Europäisches Parlament: Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gedenken an den Holocaust sowie zu Antisemitismus und Rassismus (P6_TA[2005]0018) vom 27. Januar 2005. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2 005-0018&language=DE (Zugriff am 02. 11. 2015). 646 Europäisches Parlament 2005 (P6_TA[2005]0018). 647 Droit 2015, S. 132. 648 Brumlik, Micha: Weltbürgerliche Tugend im Zeitalter der Globalisierung. Menschenrechtliche Bildung und globales Gedächtnis. in: Nickolai, Werner / Brumlik, Micha (Hrsg.): Erinnern, Lernen, Gedenken. Perspektiven der Gedenkstättenpädagogik. Freiburg im Breisgau 2007. S. 119–139, hier S. 125. 649 Vgl. Schoder, Angelika: Die Globalisierung des Holocaust-Gedenkens. Die UN-Resolution 60/7 (2005). in: Themenportal Europäische Geschichte (2002). URL: http://www.europa.clio -online.de/2012/Article=553 (Zugriff am 02. 11. 2015). 650 Köhr, Katja / Lässig, Simone: Zwischen universellen Fragen und nationalen Deutungen: der Holocaust im Museum. in: Schönemann, Bernd (Hrsg.): Europa in historisch-didaktischen Perspektiven. Idstein 2007. S. 235–260, hier S. 235.
122
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
witz wurde dabei die Rolle »als Symbol der Konzentrationslager, des Krieges, des Holocaust, der Grausamkeit des 20. Jahrhunderts und schließlich – des Bösen an sich«651 zugewiesen. In Bezug auf die transnationale Dimension der Holocausterinnerung ist der wohl am stärksten in der internationalen Holocaustforschung beachtete Ansatz derjenige der beiden Soziologen Daniel Levy und Natan Sznaider, die ausgehend von den gerade beschriebenen Entwicklungen der 1990er Jahre am Beginn des 21. Jahrhunderts eine Kosmopolitisierung der Holocausterinnerung diagnostizierten.652 Levy und Sznaider sehen die nationalen Erinnerungskulturen von Deutschland, Israel und den USA und die beschriebenen Ereignisse der 1960er Jahren als global prägend an, während die oben dargestellten Entwicklungen der 1990er Jahre als richtungsweisend gelten. Ein zentrales Merkmal der Kosmopolitisierung der Holocausterinnerung ist für Levy und Sznaider eine Entortung derselben, da sich der Holocaust in abstrakte Kategorien von Gut und Böse einreihen läßt, welche zur Entortung der Erinnerung beiträgt. So wird das national verankerte Gedächtnis durch universale Richtlinien angemessener Kommemoration verändert.653 […] So gesehen, ist nationale Identität keine dominante (oder dominierende) kollektive Ideologie mehr, die auf mythologischen Vergangenheiten aufbaut, sondern eine selbstbewußte Wahl, die Individuen aufgrund ihrer Präferenzen für gewisse Erinnerungen treffen. […] Aber die Wahl ist nicht willkürlich. Die Wahl, so unsere These, wird immer mehr von der Art und Weise, wie man sich an den Holocaust erinnert, geprägt. Die historische Erinnerung an den Holocaust (und ihre zukunftsweisende Vereinnahmung für Genozid und ›ethnische Säuberungen‹) ist zu einem Symbol für eine kritische nationale Rückschau geworden und hat somit mythologische Erinnerungen an die heroische Nation verdrängt. Die neuen mythologischen Erinnerungen gelten den Opfern und nicht den Tätern oder Helden. Damit ist der Holocaust zu einem universalen ›Container‹ für Erinnerungen an unterschiedliche Opfer geworden. Dies hat zur ›Globalisierung des Bösen‹ geführt.654
Eine kosmopolitische Holocausterinnerung ist auch eine Erinnerung, »die über ethnische und nationale Grenzen hinausgeht.«655 Neben der Entortung und der
651 Godlewska, Beata: Das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau. in: Łuczewski, Michał / Wiedmann, Jutta (Hrsg.): Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts. Analysen deutscher und polnischer Erinnerungsorte. Frankfurt am Main 2011. S. 31–36, hier S. 31–32. 652 Levy, Daniel / Sznaider, Natan: Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust. Frankfurt am Main 2001. 653 Levy / Sznaider 2001, S. 214. 654 Levy / Sznaider 2001, S. 223. 655 Sznaider, Natan: Holocausterinnerung und Terror im globalen Zeitalter. in: Aus Politik und Zeitgeschichte 48 (2001). Heft 52/53. S. 23–28, hier S. 23.
Das Auschwitz Memorial and Museum
123
damit einhergehenden »Entnationalisierung des kollektiven Gedächtnisses«656 in Folge der Globalisierung der Erinnerung an den Holocaust ist für Levy und Sznaider die Rolle der Jüd*innen in einer kosmopolitisierten Holocausterinnerung entscheidend: In diesem Zusammenhang haben wir darauf hingewiesen, daß Juden bzw. ihre medialen Repräsentationen die wichtigsten Träger der kosmopolitischen Erinnerung, ja geradezu ihre Verkörperung darstellen. Und deswegen ist der Holocaust als das bestimmende Unglück für Juden (und eben nicht für politische Opfer) so wichtig, weil er der ultimative Versuch war, den Kosmopolitismus auszulöschen. Und das ist der gesellschaftliche Grund für die historische ›Einzigartigkeit‹ des Holocaust, der dann auch oft moralisch umgewertet und umgedeutet wurde, als ginge es dabei um eine Konkurrenz der Opfer. Aus diesem Grunde konnte keine andere Katastrophe diese Rolle der Erinnerung in der Zweiten Moderne übernehmen. Dem Holocaust kommt eine moralische Bedeutung zu, die unabhängig von ihren historischen und territorialen Ursprüngen gilt.657
Kosmopolitisierte Holocausterinnerung heißt also für Levy und Sznaider auch, dass das jüdische Leid archetypisch und damit zur identifikatorischen Projektionsfläche und gleichzeitig der Holocaust zu einem universellen moralischen Modell, zum globalen Bezugspunkt, zur weltweit verständlichen Chiffre für jedwede Form der Verletzung von Menschenrechten wurde.658 Das »Lehrstück Holocaust«659 wurde so zu einem »Gründungsmythos«660 mit »moralischen Ansprüchen bzw. d[em] normative[n] Ziel von Gewaltvermeidung«661. Seit 1989 »Europe has been constructed instead upon a compensatory surplus of memory: institutionalised public remembering as the very foundation of collective identity.«662 Diese »zweite Geburt«663 oder »Neugründung Europas […] [war] auf der Basis des Schlimmsten, was es in seiner Vergangenheit begangen und erlitten
656 657 658 659
660 661 662 663
Levy / Sznaider 2001, S. 151. Levy / Sznaider 2001, S. 229. Vgl. Eckel / Moisel 2008, S. 18. Wirsching, Andreas: Vom »Lehrstück Weimar« zum Lehrstück Holocaust? in: Aus Politik und Zeitgeschichte 59 (2012). Heft 1–3. S. 9–14; Vgl. auch Bartov, Omer: Der Holocaust. Von Geschehen und Erfahrung zu Erinnerung und Darstellung. in: Beier, Rosmarie (Hrsg.): Geschichtskultur in der zweiten Moderne. Frankfurt am Main 2000. S. 95–119. Surmann, Jan: »Unfinished Business« und Holocaust-Erinnerung. Die US-Geschichtspolitik der 90er Jahre zwischen »Holocaust-era assets« und Menschenrechtsdiskurs. in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 53 (2005). S. 345–355, hier S. 353. Arenhövel, Mark: Tendenzen der Erinnerung an Diktatur und Bürgerkrieg – auf dem Weg zu einem Weltgedächtnis? in: WeltTrends 37 (2002). S. 11–26, hier S. 23. Judt, Tony: From the House of the Dead. An Essay on Modern European Memory. in: Judt, Tony (Hrsg.): Postwar. A history of Europe since 1945. New York 2006. S. 803–831, hier S. 829. Rousso, Henry: Das Dilemma eines europäischen Gedächtnisses. in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004). Heft 3. S. 363–378, hier S. 377.
124
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
hat«664, erfolgt. Der Holocaust hat dabei den Status einer »Zivilreligion«665 erlangt und ist zum »veritablen Gründungsereignis umgeformt [worden] – bis zu einem gewissen Grad durchaus vergleichbar mit der Reformation oder der Französischen Revolution«666. Auschwitz wurde dabei einerseits zum »Synonym des Grauens«667 und »in einer postmodernen Apokalyptik […] zum Indiz einer metaphysischen Unheilsgeschichte des 20. Jahrhunderts«668 erhoben. Andererseits wurde Auschwitz auch »zum normativen Filter alltäglicher politischer Entscheidungen«669 trivialisiert. Die Kosmopolitisierung der Holocausterinnerung geht bei Levy und Sznaider immer auch mit einer »Universalisierung des Bösen«670, also einer »moralische[n] Universalisierung«671 einher. Denn für Levy und Sznaider ist der Holocaust zu einem »universalen Container für Erinnerung«672 geworden. Am deutlichsten hat diese Universalisierungsthese wohl Jeffrey Alexander formuliert: […] a specific and situated historical event, an event marked by ethnic and racial hatred, violence, and war, become transformed into a generalized symbol of human suffering and moral evil, a universalized symbol whose very existence has created historically unprecedented opportunities for ethnic, racial, and religious justice, for mutual recognition, and for global conflicts becorning regulated in a more civil way.673
Ursächlich für diese Generalisierungs- und Universalisierungsprozesse sind für Levy und Sznaider auch Schindlers Liste (1993) und andere Bemühungen von Spielberg, wie die Survivors of the Shoah Visual History Foundation, da sie als »allgemeine treibende Kraft für die Entortung von Erinnerung«674 an den Holocaust fungierten. Auf diese Art seien weltweit Projektionsflächen und An664 Rousso 2004, S. 376. 665 Probst, Lothar: Der Holocaust eine neue Zivilreligion für Europa? in: Bergem, Wolfgang (Hrsg.): Die NS-Diktatur im deutschen Erinnerungsdiskurs. Opladen 2003. S. 227–238. 666 Diner, Dan: Der Holocaust in den politischen Kulturen Europas. in: Henke, Klaus-Dietmar (Hrsg.): Auschwitz. Sechs Essays zu Geschehen und Vergegenwärtigung. Dresden 2001. S. 65–73, hier S. 65. 667 Kittel, Manfred: Nach Nürnberg und Tokio. »Vergangenheitsbewältigung« in Japan und Westdeutschland 1945 bis 1968. München 2004. S. 160. 668 Bialas, Wolfgang: Die Shoah in der Geschichtsphilosophie der Postmoderne. in: Berg, Nicolas / Jochimsen, Jess / Stiegler, Bernd (Hrsg.): Shoah – Formen der Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst. München 1996. S. 107–121, hier S. 107. 669 Vgl. Naumann, Klaus: Auschwitz im Gedächtnisraum der Presse 1995. in: Hoffmann, Detlef (Hrsg.): Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-Denkmäler 1945–1995. Frankfurt am Main 1997. S. 324–329, hier S. 328. 670 Levy / Sznaider 2001, S. 149–152. 671 Levy / Sznaider 2001, S. 231. 672 Levy / Sznaider 2001, S. 223. 673 Alexander, Jeffrey C.: The Social Construction of Moral Universals. in: Alexander, Jeffrey C. / Jay, Martin (Hrsg.): Remembering the Holocaust. A debate. Oxford, New York 2009. S. 3– 102, hier S. 3. 674 Levy / Sznaider 2001, S. 173.
Das Auschwitz Memorial and Museum
125
knüpfungspunkte für unterschiedlichste Opfergruppen entstanden.675 Die mediale Globalisierung der spezifischen Erinnerung an den Holocaust habe zu dessen Universalisierung geführt,676 da die Leidenserfahrungen verschiedenster Gruppen anschlussfähig und zum Fundament einer europäischen Menschenrechtspolitik und -bildung677 wurden: Der Holocaust ist nun der Völkermord, aufgrund dessen 1948 die UN-Konvention gegen den Völkermord verabschiedet wurde. Die Nazis führten einen Krieg gegen die Juden: Juden als solche waren Feinde, die vernichtet werden sollten, und nicht andere Staaten. Die neuen Kriege sind vielleicht nicht mit dem Horror von Auschwitz zu vergleichen, aber sie sind ein wichtiges Modell im Rahmen einer kosmopolitischen Gesellschaft, in der durch die Medien der Völkermord in jedes Wohnzimmer eindringt. […] Die aus dem Nationalstaat herausgelöste Erinnerung an den Holocaust ist eine Antwort auf die globalen Konflikte der Zweiten Moderne. Das Gedächtnis der Zweiten Moderne entspricht der aktuellen Zeiterfahrung.678
Der Holocaust wurde zum »Sinnbild für die Opfererfahrung schlechthin«679, zum »Modell für andere Opfergruppen«680, zum universellen Bösen und zum Paradigma und Maß für alle folgenden Massenverbrechen und Völkermorde und dient bis heute der Legitimierung einer Politik für Demokratie und Menschenrechte. Da sich soziale und ethnische Gruppen weltweit auf den Holocaust berufen, um so den eigenen Diskriminierungserfahrungen Gehör zu verschaffen, kann man durchaus auch von einer »Funktionalisierung für westliche Leitvorstellungen [sprechen], auch wenn sie mit dem Anspruch auf universelle Gültigkeit vorgebracht werden.«681 Paradoxerweise ist es die Annahme der monströsen
675 Vgl. Bauerkämper, Arnd: Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945. Paderborn 2012. S. 12. 676 Vgl. Molden, Berthold: Genozid in Vietnam. 1968 als Schlüsselereignis in der Globalisierung des Holocaustdiskurses. in: Kastner, Jens / Mayer, David (Hrsg.): Weltwende 1968? Ein Jahr aus globalgeschichtlicher Perspektive. Wien 2008. S. 83–97; Molden, Berthold: Die Globalisierung des Holocaust. in: Recherche 2 (2009). Heft 3. URL: http://www.recherche-online. net/berthold-molden-globalisierung-des-holocaust.html vom 23. 4. 2009 (Zugriff am 02. 11. 2015). 677 Vgl. Alavi, Bettina / Popp, Susanne: Menschenrechtsbildung – Holocaust Education – Demokratieerziehung. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 11 (2012). S. 7–10; Plessow, Oliver: Länderübergreifende »Holocaust Education« als Demokratie- und Menschenrechtsbildung? Transnationale Initiativen im Vergleich. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 11 (2012). S. 11–30; Richter, Regine: Für eine historische und transkulturelle Menschenrechtsbildung. Zur Kritik an der »westlichen« Menschenrechtserzählung. in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 11 (2012). S. 31–49. 678 Levy / Sznaider 2001, S. 184. 679 Eckel / Moisel 2008, S. 21. 680 Droit 2015, S. 133. 681 Eckel / Moisel 2008, S. 21.
126
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Singularität des Holocaust,682 die in erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen im Kontinuum von Partikularität und Universalität funktionalisiert wird.683 Und auch wenn Levy und Sznaider den Partikularismus des Holocaust zu ihrer Universalismusthese in Bezug setzen, so ist bei ihrem Modell nicht ausreichend berücksichtigt, dass durch diese Relativierung des Holocaust dieser eben auch den Bezug zum partikularen Ereignis verlieren kann, sodass die Universalisierung des Holocaust diesen selbst in der Erinnerung zum Verschwinden bringen könnte.684 Dies hätte zur Folge, dass »auch Auschwitz verschwindet, obwohl oder vielleicht gerade weil vom Holocaust überall und ständig die Rede ist«685. »Der Artefakt Holocaust hält […] [zwar] die Erinnerung an Auschwitz präsent«686, doch die Universalisierung des Holocaust hat in der Erinnerung eine direkte Rückwirkung auf die Rolle des Lagers Auschwitz. Denn »Auschwitz verweist auf den konkreten historisch-geographischen Ort des Geschehens, [während] das Wort Holocaust […] ein sprachliches Niemandsland [signalisiert], das raumzeitlich im Ungewissen liegt.«687 Damit ist der Begriff Holocaust weitaus besser für Universalisierungen und Funktionalisierungen geeignet als der Begriff Auschwitz. Ein weiterer Mechanismus des internationalen kollektiven Umgangs mit dem Holocaust wird in der Forschung unter dem Stichwort der Amerikanisierung des Holocaust erörtert. Eine zentrale Figur für die Prägung dieses Begriffs ist der Historiker Peter Novick688. Er untersucht die Ursachen dafür, warum »the Holocaust was first marginalized, then came to be centered in American life«689. Für Novick liegt die Ursache darin, dass sich in der amerikanischen Öffentlichkeit in den 1960er Jahren ein Holocaustbewusstsein durch die Erinnerungspolitik amerikanischer Jüd*innen entwickelt hatte: »American Jews will be at the heart of the story, since Jews have taken the initiative in focusing attention on the
682 Vgl. Meseth, Wolfgang: Aus der Geschichte lernen. Über die Rolle der Erziehung in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Frankfurt am Main 2005. S. 115–120. 683 Vgl. Marchart, Oliver: Umkämpfte Gegenwart. Der ›Zivilisationsbruch Auschwitz‹ zwischen Singularität, Partikularität, Universalität und der Globalisierung der Erinnerung. in: Uhl, Heidemarie (Hrsg.): Zivilisationsbruch und Gedächtniskultur. Das 20. Jahrhundert in der Erinnerung des beginnenden 21. Jahrhunderts. Innsbruck 2003. S. 35–65, hier S. 41. 684 Vgl. Marchart 2003, S. 59. 685 Claussen, Detlev: Die Banalisierung des Bösen. in: Werz, Michael (Hrsg.): Antisemitismus und Gesellschaft. Zur Diskussion um Auschwitz, Kulturindustrie und Gewalt. Frankfurt am Main 1995. S. 13–28, hier S. 13. 686 Claussen 1995, S. 27. 687 Claussen, Detlev: Veränderte Vergangenheit. Über das Verschwinden von Auschwitz. in: Berg, Nicolas / Jochimsen, Jess / Stiegler, Bernd (Hrsg.): Shoah – Formen der Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst. München 1996. S. 77–92, hier S. 84. 688 Vgl. Novick, Peter: The Holocaust and collective memory. London 2000. 689 Novick 2000, S. 6.
Das Auschwitz Memorial and Museum
127
Holocaust in this country.«690 In den 1970er Jahren sei der Holocaust sukzessive zu einer nationalen US-amerikanischen Erinnerung geworden, worauf die Planungen zum Bau des Washingtoner Holocaustmuseums691 und der Eingang in die amerikanischen Massenkultur hinwiesen: »From the 1970s on, a series of events – sometimes trival in themselves but often rich in symbolism – kept the Holocaust on front pages and on the nightly news.«692 Der Holocaust wurde massenwirksam, denn »[i]n various ways, for various purposes, the Holocaust entered the American cultural mainstream; it had become part of the language; it had become, except for hermits, inescapable.«693 Seit den 1980er Jahren und v. a. seit den 1990er Jahren seien auch in den USA die Mechanismen der Universalisierung und Funktionalisierung spürbar gewesen, da auch hier universelle Lehren aus dem Holocaust gezogen worden seien und sich gleichzeitig Gruppen mit unterschiedlichsten Interessen auf ihn berufen hätten, wie Feministen, Homosexuelle oder Tierschutzaktivisten:694 For the political center – on some level for all Americans – the Holocaust has become a moral reference point. As, over the past generation, ethical and ideological divergence and disarray in the United States advanced to the point where Americans could agree on nothing else, all could join together in deploring the Holocaust – a low moral consensus, but perhaps better than none at all. […] The principal lesson of the Holocaust, it is frequently said, is not that it provides a set of maxims, or a rule book for conduct, but rather that it sensitizes us to oppression and atrocity. In principle it might, and I don’t doubt that sometimes it does. But making it the benchmark of oppression and atrocity works in precisely the opposite direction, trivializing crimes of lesser magnitude.695
Amerikanisierung des Holocaust beinhaltet immer auch Universalisierungen, Popularisierungen und Trivialisierungen, die von den USA ausgehen, aber mit der globalen Medialisierung des Holocaust als Teil dieser Amerikanisierung erheblich die kulturellen und nationalen Grenzen der USA überschreiten.696 Im 690 Novick 2000, S. 6. Vgl. Brainin, Elisabeth: Gibt es eine transgenerationelle Transmission von Trauma? in: Uhl, Heidemarie (Hrsg.): Zivilisationsbruch und Gedächtniskultur. Das 20. Jahrhundert in der Erinnerung des beginnenden 21. Jahrhunderts. Innsbruck 2003. S. 103–114, hier S. 105–107. 691 Vgl. Gilson, Estelle: Americanizing the Holocaust. in: Congress monthly 60 (1993). Heft 6. S. 3–6. 692 Novick 2000, S. 226. 693 Novick 2000, S. 231. 694 Vgl. Junker, Detlef: Die Amerikanisierung des Holocaust. Über die Möglichkeit, das Böse zu externalisieren und die eigene Mission fortwährend zu erneuern. FAZ (2000). Heft 210. S. 11. URL: http://faz-archiv-approved.faz.net/intranet/biblionet/r_suche/webcgi?START=A40& T_TEMPLATE=druck&WID=80955-6480065-53134_5 vom 09. 09. 2000 (Zugriff am 16. 11. 2017). 695 Novick 2000, S. 13–14. 696 Vgl. Gerstenfeld, Manfred: The abuse of Holocaust memory. Distortions and responses. Jerusalem 2009.
128
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Zuge der Kritik an der inhaltlichen Trivialisierung des Holocaust wurde auch dessen Kommerzialisierung und Vermarktung unter den Begriffen Shoah-Business und Holocaustindustrie diskutiert. Der Begriff Holocaustindustrie war geprägt worden von Norman Finkelstein, der den Holocaust als jüdische ideologische Darstellung der deutschen Verbrechen am europäischen Judentum zum Zwecke der jüdischen Identitätsfestigung und Rechtfertigung politischer Unternehmungen Israels und dessen Unterstützung durch die USA ansieht.697 Unter dem Begriff Shoah-Business wird v. a. eine Kommerzialisierung des Holocaust in dem Sinne befürchtet, dass er »wie Mickey Mouse, Coca-Cola und McDonald’s zu [einem] uramerikanischen Symbol[en] avanciert«698 und in dessen Folge womöglich beim Hören des Begriffs Holocaust »niemand mehr an ›Auschwitz‹ oder ›Majdanek‹ denken wird, sondern an ein Museum oder ein Memorial.«699 Cole spricht in diesem Zusammenhang in seiner Studie »Selling the Holocaust« sogar von einem Holocaustmythos, an dessen »Dark Tourism«700 auch das Museum Auschwitz verdienen würde: ›Auschwitz‹ is to the ›Holocaust‹ what ›Graceland‹ is to ›Elvis‹. It has become a staple of the ›Holocaust myth‹. lt is the place of ›the angel of death‹, Joseph Mengele. lt forms the backdrop to such filmic ›Holocausts‹ as Sophie’s Choice and Schindler’s List. And it is a prime site of ›Holocaust‹ tourism. Not only is the word ›Auschwitz‹ virtually synonymous with ›Holocaust‹, but the word has become virtually synonymous with generic ›evil‹.701
697 Vgl. Finkelstein, Norman G.: The Holocaust industry. Reflections on the exploitation of Jewish suffering. London, New York 2003. 698 Broder, Henryk M.: Das Shoah-Business. in: DER SPIEGEL (1993). Heft 16. S. 248–256, hier S. 249. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13680385.html vom 19. 04. 1993 (Zugriff am 23. 11. 2017). 699 Broder 1993, S. 249. 700 Vgl. Bowman, Michael S. / Death, Phaedra C. Pezzullo: What’s so ›Dark‹ about ›Dark Tourism‹?: Death, Tours, and Performance. in: Tourist Studies 9 (2010). Heft 3. S. 187–202; BühlGramer, Charlotte: Can Architecture Embody Good and Evil? in: Public History Weekly 5 (2017). Heft 36. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-36/can-architec ture-embody-good-and-evil/ vom 2. 11. 2017 (Zugriff am 14. 11. 2017); Cohen, Erik H.: Educational dark tourism at an in populo site. in: Annals of Tourism Research 38 (2011). Heft 1. S. 193–209. Kidron, Carol A.: Being there togehter: Dark family tourism and the emotive exerience of co-presence in the holocaust past. in: Annals of Tourism Research 41 (2013). S. 175–194; Lennon, J. John / Foley, Malcolm: Interpretation of the Unimaginable: The U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., and »Dark Tourism«. in: Journal of Travel Research 38 (1999). Heft 1. S. 46–50; Lennon, John / Foley, Malcolm: Dark tourism? the attraction of death and disaster. Andover 2010; Sharpley, Richard / Stone, Philip R. (Hrsg.): The darker side of travel. The theory and practice of dark tourism. Bristol 2009. 701 Cole, Tim: Selling the Holocaust. From Auschwitz to Schindler: how history is bought, packaged, and sold. New York 1999. S. 98.
Das Auschwitz Memorial and Museum
129
Zentrale populäre Leitmedien für die Amerikanisierung des Holocaust über die Grenzen der USA hinweg sind in jedem Fall auch für Novick die beiden Filmproduktionen Holocaust (1978) und Schindlers Liste (1993): A double irony. lt was an American ›soap opera‹ that shattered thirty years of German silence on their wartime crimes. lt was the German reception of that American »soap opera« which, as a practical if not a theoretical matter, ended debate in America on the ability of the popular media to present the Holocaust effectively. And – though not for many years on so grand a scale – the American popular media, particularly television, continued to do so: Playing for Time, Escape from Sobibor, Triumph of the Spirit, War and Remembrance; there were many, many others. None of these ever achieved the audience, or occasioned as much discussion, as did Holocaust in 1978. But in the aggregate (supplemented by a steady stream of imported foreign films on the subject), they served to firmly affix the Holocaust on the American cultural map. The culmination (so far) of this process was Steven Spielberg’s 1993 Schindler’s List, which benefited not just from the director’s mega-reputation but from the fact that it appeared in the same year that the Washington Holocaust Museum opened.702
Alvin H. Rosenfeld stellt in seiner vielbeachteten Studie The End of the Holocaust703 die These auf, dass diese Remedialisierung des Holocaust in Folge dieser Amerikanisierung in populären Medien diesen alltäglich werden und so in seiner Singularität zum Verschwinden bringen könnte: What happens in the light of such developments is fairly predictable: as the mass murder of millions of innocent people is trivialized and vulgarized, a catastrophic history, bloody to its core, is lightened of its historical burden and gives up the sense of scandal that necessarily should attend it. The very success of the Holocaust’s wide dissemination in the public sphere can work to undermine its gravity and render it a more familiar thing. The more successfully it enters the cultural mainstream, the more commonplace it becomes. A less taxing version of a tragic history begins to emerge-still full of suffering, to be sure, but a suffering relieved of many of its weightiest moral and intellectual demands and, consequently, easier to bear. Made increasingly familiar through repetition, it becomes normalized. And, before long, it turns into something else-a repository of »lessons« about »man’s inhumanity to man,« a metaphor for victimization in general, a rhetoric for partisan politics, a cinematic backdrop for domestic melodramas.704
Für Rosenfeld sind es auch die amerikanischen Produktionen Holocaust (1978) und Schindlers Liste (1993), die für diesen Prozess zentrale populär-mediale Faktoren darstellen.705 Rosenfeld betont, dass bei dieser Amerikanisierung des Holocaust versucht werde, Wege zu finden, »to balance a history of unbearable 702 703 704 705
Novick 2000, S. 213–214. Rosenfeld, Alvin H.: The end of the Holocaust. Bloomington 2011. S. 11. Rosenfeld 2011, S. 51–94. Rosenfeld 2011, S. 11.
130
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
suffering with affirmative images of hope«706. Indem neben Opfern, Überlebenden und Täter*innen auch Zuschauer*innen, Retter*innen und Befreier*innen erscheinen, soll »the moral symmetry of man«707 wiederhergestellt werden, um so auch zu ermöglichen »to teach what is commonly called the lessons of the Holocaust to diverse and sundry audiences.«708 Rosenfeld geht sogar soweit, dass die meisten Menschen ihre Kenntnisse über den Holocaust eben nicht der Arbeit von Historiker*innen zu verdanken hätten, sondern eher der Tätigkeit von »novelists, filmmakers, playwrights, poets, television program writers and producers, museum exhibits, popular newspapers and magazines, internet web sites, the speeches and ritual performances of political figures and other public personalities«709. Als Folge dieser Entwicklung befürchtet er das Ende des Holocaust: In sum, the image of the Holocaust is continually being transfigured, and the several stages of its transfiguration, which one can trace throughout popular culture, may contribute to a fictional subversion of the historical sense rather than a firm consolidation of accurate, verifiable knowledge. One result of such a development may be an incipient rejection of the Holocaust as it actually was rather than its incorporation by and retention in historical memory.710
Diese Prozesse stehen in direkter Verbindung zum Erinnerungsort Auschwitz. Denn als Erinnerungsort und Symbol des Schreckens hat der Name universale Geltung. Auschwitz abstrahiert nicht in der Weise von der Geschichte wie die später populär gewordenen Begriffe ›Shoah‹ und ›Holocaust‹, die das konkrete historische Geschehen mit einem religiösen Bedeutungsfeld umgeben. Auschwitz steht exemplarisch für das menschenverachtende nationalsozialistische System von Zwangsarbeit und Völkermord, medizinischen Versuchen und Verwertung des Vermögens sowie der körperlichen Überreste der Ermordeten. Es war ein von Menschen betriebenes System rationeller Reduktion von Menschen auf tote Materie.711
Auschwitz ist ebenfalls »längst weltweit zum Synonym für die Menschheitskatastrophe der Moderne geworden«712 und wird heute ebenso nationalisiert, universalisiert und trivialisiert wie der Holocaust insgesamt. Dies hat Folgen für den Platz des historischen Ortes Auschwitz in der kollektiven Erinnerung. Denn »[e]inerseits synthetisiert die ›Americanization of the Holocaust‹ die Pluralität der Darstellungsformen und gibt dem Wissen um Auschwitz jene ›Einmaligkeit‹ zurück, die es im Umfeld konkurrierender Interpretationsmuster zu verlieren 706 707 708 709 710 711 712
Rosenfeld 2011, S. 93. Rosenfeld 2011, S. 93. Rosenfeld 2011, S. 93. Rosenfeld 2011, S. 14. Rosenfeld 2011, S. 14–15. Reichel 2003, S. 600. Reichel 2003, S. 618.
Das Auschwitz Memorial and Museum
131
droht.«713 Dies ist aber nur ein mögliches Interpretationsmuster. Denn die durch die Amerikanisierung transportierten trivialisierten Narrative über den Holocaust, wie die »Symbolisierung der jüdischen Opfer zu einem universellen Opferund Leidensmotiv in der Tradition des christlichen Narrativs, die Stilisierung der Täter als eine homogene Masse haßerfüllter Antisemiten [und] die Darstellung der Vernichtung als ein Einbruch des Bösen«714, haben andererseits auch zur Folge, dass Auschwitz und der Holocaust zu »frei verfügbare[m] Darstellungsmaterial«715 werden, was weitere dramatische Funktionalisierungen und Trivialisierungen zur Folge haben könnte. Zusammenfassend kann man festhalten, dass zunächst die deutschen Verbrechen am europäischen Judentum und Ausschwitz als ein zentraler Ort dieser Verbrechen nach den Nürnberger Prozessen international keinen Platz in Erinnerungskulturen hatten. Dies änderte sich in den 1960er Jahren durch den Eichmann-Prozess und die damit verbundenen Debatten. In den 1970er Jahren war es dann die Fernsehserie Holocaust (1978), die den Begriff Holocaust zum transnationalen und universalen Bezugsrahmen der Erinnerung und Auschwitz zum Kristallisationspunkt und zur Metapher für die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs machte. Eine erneute Zäsur bildete das Ende des Kalten Krieges. Hier setzten international dann endgültig alle diejenigen kollektiven Erinnerungsmechanismen ein, die das kollektive Gedächtnis international in Bezug auf den Holocaust und Auschwitz bis heute prägen. Zum einen eine Kosmopolitisierung der Holocausterinnerung, die den Holocaust vom konkreten historischen Ereignis ablöste, ihn zu einem universalen Container für Erinnerungen und zur identifikatorischen Projektionsfläche für unterschiedliche Opfergruppen und Verbrechen machte. Damit einher gingen zum anderen Prozesse, die den Holocaust zu einem universellen moralischen Modell und zur weltweit verständlichen Chiffre für Menschenrechtsverletzungen aller Art werden ließen. Dies trug auch dazu bei, dass der Holocaust im Zuge dessen zum Fundament einer europäischen Menschenrechtspolitik avancierte. Die mediale Globalisierung des Holocaust in der Populärkultur im Zuge seiner Amerikanisierung unterstützte diese Universalisierung und trug auch zu einer Popularisierung und Trivialisierung bei. Für den Begriff Auschwitz bedeuten diese Prozesse der Kosmopolitisierung und Universalisierung eine Schwächung, da der Begriff Holocaust weitaus besser für Universalisierungen und Funktionalisierungen geeignet ist, da Auschwitz als »Gedächtnis der Dinge«716 und Ort des 713 Krankenhagen, Stefan: Auschwitz darstellen. Ästhetische Positionen zwischen Adorno, Spielberg und Walser. Köln 2001. S. 219. 714 Krankenhagen 2001, S. 220. 715 Krankenhagen 2001, S. 220. 716 Hoffmann, Detlef: Das Gedächtnis der Dinge. in: Hoffmann, Detlef (Hrsg.): Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-Denkmäler 1945–1995. Frankfurt am Main 1997. S. 6–35; Vgl.
132
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
historischen Geschehens konkrete Verbrechen an einen konkreten historischen Ort des Geschehens rückbindet und auf diese Weise Universalisierungen und Funktionalisierungen entgegenwirken kann. Zudem ist offen,717 ob »die Historisierung des Holocaust diesen weniger für allzu einfache Analogien und zynische Instrumentalisierung zugänglich oder verfügbar«718 machen wird.
3.1.2. Das Auschwitz Memorial and Museum in den Social Media Die konkreten Fragestellungen des Social-Media-Monitorings leiten sich direkt aus den im vorangegangenen Kapitel dargestellten transnationalen diskursiven Erinnerungsmustern und Narrativen in Bezug auf den Holocaust und auf Auschwitz ab: Wie setzen sich in den auf den Social-Media-Kanälen des Auschwitz Memorial and Museum auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram kommunikativ vollziehenden Erinnerungsprozessen die spezifischen Erinnerungsdiskurse zum Holocaust medienspezifisch narrativ fort, die in der Holocaustforschung als Kosmopolitisierung, Universalisierung, Funktionalisierung, Amerikanisierung, Popularisierung und Trivialisierung beschrieben werden? Welche Rolle spielt dabei der konkrete Ort historische Auschwitz und die hier ansässige Institution im virtuellen Raum? Ebenfalls wird untersucht, inwieweit die sich hier kommunikativ vollziehenden Erinnerungskulturen zur Geschichte des Holocaust allgemein und zum ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz konkret geprägt sind von der Materialität des Web 2.0 und der Social Media sowie der konkreten jeweiligen Plattform in materiell-medialer und sozial-kommunikativer Hinsicht. Bevor die Datenerhebungen und -analysen der Social-Media-Auftritte des Museums Auschwitz dargestellt, ausgewertet und interpretiert werden, soll an dieser Stelle nochmal ein Leitgedanke der Diskursforschung betont werden, der für die gesamte Studie leitend ist: Ziel ist es nicht, das Material zu sättigen, wie in Inhaltsanalysen angestrebt. Stattdessen sollen mittels eines offenen, vergleichsweise schwach geregelten diskursanalytischen Verfahrens mit induktivem, explorativ-suchendem, zirkulärem Charakter (Grounded Theory) zuallererst DisYoung, James Edward: The texture of memory. Holocaust memorials and meaning. New Haven 1993. 717 Vgl. Zuckermann, Moshe: Zweierlei Holocaust. Der Holocaust in den politischen Kulturen Israels und Deutschlands. Göttingen 2004. 718 Steinweis, Alan E.: Die Auschwitz-Analogie: Die Erinnerungskultur des Holocaust und die außenpolitischen Debatten in den USA während der 1990er Jahre. in: Junker, Detlef / Berg, Manfred / Gassert, Philipp (Hrsg.): Deutschland und die USA in der internationalen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Detlev Junker. Stuttgart 2004. S. 542–558, hier S. 557.
Das Auschwitz Memorial and Museum
133
kurse und deren Narrative in Transformationen als Teil von Geschichtsnarrationen in Erinnerungskulturen und in zweiter Hinsicht in Transformationen in medialer und kommunikativer Hinsicht in den Social Media offengelegt werden.719 Demnach werden immer auch nur bestimmte, in der Analyse konkret benannte Bereiche der Plattformen in das Social-Media-Monitoring einbezogen und dargestellt.720 3.1.2.1. Das Museum Auschwitz auf Facebook Das Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum in Os´wie˛cim (Polen) ist auf Facebook außerordentlich aktiv. Das Museum betreibt eine eigene Facebookseite. Diese sogenannten »Offiziellen Seiten« (auch »Fanseiten«) dienen auf Facebook als offizielle öffentliche Präsenzen von Institutionen, Unternehmen, Marken, Organisationen oder tatsächlich existierenden Personen des öffentlichen Lebens. Diese Facebookseiten dürfen nur von offiziellen Vertreter*innen erstellt und betreut werden.721 Die Facebookseite Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz722 wurde am 13. Oktober 2009 ins Leben gerufen und wird aktuell von 203.508723 Nutzer*innen verfolgt. Sowohl das Museum Auschwitz als auch Facebooknutzer*innen sind auf der Seite aktiv. Im Social-Media-Monitoring in Kombination mit DIMEAN werden v. a. die Aktivitäten des Museums in Bezug auf die Vermittlung historischer Kontexte und Prozesse als medienspezifische Geschichtsnarrationen in Bezug auf Transformationen in diskursiver, narrativer, medialer und kommunikativer Hinsicht untersucht, während Aktivitäten und Reaktionen von anderen (v. a. privaten Nutzer*innen) und Social-Media-Aktivitäten des Museums anderen Natur nur in sekundärer Priorität in die Analyse einfließen.724 Die Phase der Datenerhebung der Facebookseite ist im Januar 2016 erfolgt.725 Zunächst sollen einige Social-Media-Metrics in Bezug auf die Aktivitäten des Museums genannt werden, die mit Social-Media-Monitoring-Analysetools oder 719 Vgl. Kapitel 2.2.2. Das methodische Handwerkszeug: Diskursanalytische Mehrebenenanalyse (DIMEAN). 720 Vgl. Kapitel 2.2.1. Der methodische Rahmen: Social-Media-Monitoring. 721 Vgl. Schwindt, Annette: Das Facebook-Buch. Beijing u. a. 2010. S. 189. 722 Auschwitz-Birkenau State Museum: Facebookprofil Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz. URL: http://www.facebook.com/auschwitzmemorial (Zugriff am 1. Januar 2016). 723 Stand 1. Januar 2016. 724 In der gesamten vorliegenden Studie werden Texte, die in den Social Media veröffentlicht worden sind, von sämtlichen Akteuren*innen in nicht korrigierter Form wiedergegeben. Alle Texte werden in der originalen Orthografie und Grammatik zitiert. Aufgrund der Vielzahl der Fehler wird auch auf das sonst übliche [sic] verzichtet. 725 Die konkreten Zugriffszeitpunkte sind immer angegeben. Diese bewegen sich alle im Zeitraum vom 6. 1. 2016 bis zum 18. 1. 2016.
134
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
manuell ermittelt worden sind. Was die Art der Beiträge betrifft, liefern verschiedene Analysetools etwas abweichende Werte: LikeAlyzer ermittelt eine Verteilung von 45,8 % für Beiträge mit Bildern, 33,3 % mit Links und 20,8 % reine Textbeiträge.726 Der FanPAGE-Check von 1–2-social berechnen folgende Kennzahlen: 42 % Beiträge mit Bildern, 32 % mit Links und 26 % reine Textbeiträge.727 Das Museum veröffentlicht im Durchschnitt vier Beiträge in der Woche728 bzw. 0,74 pro Tag729. Aufgrund der Dominanz von Beiträgen mit Bildern, ist das folgende Social-Media-Monitoring stärker auf die Beiträge fokussiert, die Fotografien und Abbildungen enthalten. Hinzu kommt die Tatsache, dass Beiträge mit Bilddateien größere Reichweiten erreichen als reine Textposts oder Beiträge mit Links, was die Analyse noch zeigen wird. Diskursanalytisch beschrieben werden v. a. die in Beiträgen allen Typs enthaltenen Geschichtserzählungen in textueller und visueller Form und die in diesen transportierten diskursiven und narrativen Elemente, inklusive der transformativen Prozesse auf diskursiver, medialer und kommunikativer Ebene. Im Januar 2016 sind auf der Facebookseite des Museums Auschwitz 48 Fotografien online, die im Jahr 2009 (ab Oktober) hochgeladen worden sind, 69 im Jahr 2010, 77 im Jahr 2011, 237 im Jahr 2012, 189 im Jahr 2013, 237 im Jahr 2014 und 148 Fotografien, die im Jahr 2015 online gestellt worden sind.730 Bei diesen Werten muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Museum sehr häufig Fotografien im selben Jahr und in Folgejahren mehrmals als neuen, eigenen Beitrag veröffentlicht (auch in verschiedenen Sprachen) und teilweise auch bereits schon einmal veröffentliche Fotografien mit der Facebookfunktion Teilen nochmals auf der Chronik präsentiert.731 Die Anzahl der konkreten Bilddateien ist also weitaus geringer, da Abbildungen aus einem begrenzten Pool wiederholt veröffentlicht werden. Was die Art der veröffentlichten Abbildungen angeht, ist also in Bezug auf quantitative und qualitative Geschichtspunkte nur eine Gesamtschau aller Jahre sinnvoll. Bei den veröffentlichten Abbildungen kann man in qualitativer Hinsicht drei Kategorien definieren: 1. Historische Fotografien und Abbildungen von Dokumenten oder Gegenständen aus der Zeit des Nationalsozialismus; 2. Aktuelle 726 LikeAlyzer von Meltwater. URL: http://likealyzer.com/de/facebook/auschwitzmemorial (Zugriff am 1. 1. 2016). 727 FanPAGE-Check von 1–2-social. URL: https://www.1-2-social.de/fanpage-check/analyse/a uschwitzmemorial (Zugriff am 1. 1. 2016). 728 FanPAGE-Check, Zugriff am 1. 1. 2016. 729 LikeAlyzer, Zugriff am 1. 1. 2016. 730 Stand 1. Januar 2016. 731 In der aufgeführten Statistik zu den Beiträgen mit Abbildungen erscheinen nur diejenigen, die nicht über die Teilen-Funktion wieder veröffentlicht wurden (Originalbeiträge). Wiederholungen in Form von Wiederveröffentlichungen der gleichen Fotografie sind auch üblich, ohne die Teilen-Funktion zu verwenden.
Das Auschwitz Memorial and Museum
135
Fotografien, die das ehemalige Lagergelände heute zeigen; 3. Aktuelle Fotografien, die (Gedenk-)Veranstaltungen abbilden. Diese Kategorien dienen zunächst der Strukturierung der folgenden Darstellung, Auswertung und Interpretation der Datenerhebung und -analyse und werden zudem eine weitere Differenzierung erfahren. Die erste Kategorie umfasst sowohl historische Fotografien als auch aktuelle Abbildungen732 von historischen Dokumenten oder Gegenständen aus der Zeit des Nationalsozialismus. In dieser Kategorie wurden insgesamt733 103 unterschiedliche Bilddateien734 veröffentlicht: 19 historische Fotografien mit einzelnen Personen, 17 historische Fotografien mit einer Gruppe von Personen, acht historische Luftaufnahmen, 53 Abbildungen von historischen Gegenständen oder Dokumenten, sechs historische Fotografien von Lagergebäuden (ohne Personen). 19 Fotografien zeigen Personen, deren individuelles Einzelschicksal oder individuelle Rolle für die Geschichte des Lagers thematisiert wird, im Gegensatz zu Fotografien, die eine anonyme Gruppe von Personen zeigen, die ein Kollektiv repräsentieren sollen. Insgesamt präsentiert die Facebookseite des Museums Auschwitz 19 Biografien mittels dieser Fotografien. Zehn Fotografien zeigen Häftlinge des Lagers und damit Opfer des Holocaust, während acht Bilder Täter verschiedenster Art zeigen. Eine Fotografie, die am 27. April 2014735 (1568 L, 278 T, 27 K) 736 veröffentlicht wurde, zeigt Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch des Lagers am 7. Juni 1979 und fällt somit in keine dieser Kategorien. Von den zehn Fotografien mit einzelnen Opfern zeigen drei Frauen und sieben Männer. Das Museum veröffentlichte am 8. April 2015 (1014 L, 226 T, 26 K) 737 eine Fotografie aus der Lagerkartei der Roma Donga Antonia, die am 28. Januar 1943 nach Auschwitz deportiert worden war. Jeweils am 29. Oktober 2012 (794 L, 1027 T, 311 K) 738, 2013 (543 L, 154 T, 68 K) 739, 2014 (82 L, 47 T, 27 K) 740 wurde aus der Lagerkartei von Auschwitz die Fotografie der Krankenschwester Danuta 732 Bei den Bildern handelt es sich in den meisten Fällen um aktuelle Fotografien und Abbildungen von historischen Gegenständen oder Dokumenten. 733 Gezählt wurden die einzelnen Dokumente, nicht die Anzahl der Veröffentlichungen im Zeitraum von Erstellung der Seite am 13. Oktober 2009 bis einschließlich 31. 12. 2015. 734 Alle folgenden Angaben beziehen sich immer auf die Anzahl der tatsächlich unterschiedlichen historischen oder aktuellen Abbildungen und nicht auf die Anzahl der veröffentlichten Beiträge. 735 http://on.fb.me/1PN5GZe (Zugriff am 6. 1. 2016). 736 Für alle Facebookbeiträge wird im Folgenden hinter dem Datum immer die Anzahl der Likes (L), der Veröffentlichungen auf anderen Seiten mittels der Teilen-Funktion (T) und der Kommentare (K) unter dem Originalbeitrag angegeben. 737 http://on.fb.me/1n3Ywod (Zugriff am 6. 1. 2016). 738 http://on.fb.me/1mFNCo5 (Zugriff am 6. 1. 2016). 739 http://on.fb.me/1S3QPv3 (Zugriff am 6. 1. 2016). 740 http://on.fb.me/1MSIq5C (Zugriff am 6. 1. 2016).
136
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Terlikowska veröffentlicht (Abbildung 2), die als Mitglied des polnischen Untergrunds am 29. Oktober 1942 im Alter von 21 Jahren mit einer Phenolinjektion hingerichtet worden war. Eine private Fotografie aus der Zeit vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs von Ella Gartner741 veröffentlichte das Museum Auschwitz am 6. Januar 2010 (287 L, 244 T, 109 K) 742. Gartner war an Vorbereitungen für den Aufstand des Häftlingssonderkommandos beteiligt und wurde aus diesem Grund nach wochenlanger Folter in Auschwitz mit den drei Frauen Róz˙a Robota, Regina Safir und Estera Wajsblum von der SS am 6. Januar 1945 öffentlich durch Erhängung ermordet.743
Abbildung 2: Erinnerungsbeitrag über Danuta Terlikowska vom 29. Oktober 2012
An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, den Begriff Erinnerungsbeiträge einzuführen. Als solche werden in dieser Untersuchung Beiträge auf allen Plattformen bezeichnet, die insoweit eine konkrete Erinnerungsfunktion erfüllen, als dass sie exakt an dem Tag veröffentlicht werden, an dem sich das konkrete im Beitrag erinnerte Ereignis jährt. Alle gerade genannten Beiträge zu weiblichen Opfern sind Erinnerungsbeiträge. Auf Aufbau, Funktion und Reichweite dieser Art der digitalen Holocausterinnerung wird an späterer Stelle noch ausführlich eingegangen werden, wenn einzelnen Beiträge dieser Art breiter beschrieben und analysiert werden. In Erinnerungsbeiträgen zu männlichen Opfern veröffentlichte das Museum Auschwitz am 22. September 2014 (1207 L, 203 T, 38 K) 744 und 2015 (1395 L, 241 T, 741 Teilweise auch Ala, Alla, Alina oder Ela Gartener. 742 http://on.fb.me/1Uwe1jj (Zugriff am 6. 1. 2016). 743 Vgl. Heilman, Anna: Never far away. The Auschwitz chronicles of Anna Heilman. Calgary 2001. S. 143. 744 http://on.fb.me/1n41YPN (Zugriff am 6. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
137
58 K) 745 und am 27. April 2014 (817 L, 331 T, 53 K) 746 eine Lagerfotografie von Witold Pilecki. Pilecki hatte die Widerstandsbewegung Tajna Armia Polska (Geheime Polnische Armee) gegründet, kam am 22. September 1940 freiwillig nach Auschwitz, organisierte dort den Widerstand mit und floh erfolgreich aus dem Lager in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1943.747 Ebenfalls mit Erinnerungsbeiträgen wurde dem Überlebenden Władysław Bartoszewski am 24. April 2015 (1026 L, 165 T, 70 K) 748 gedacht, da dieser an diesem Tag verstorben war. Bartoszewski war im September 1940 nach Auschwitz deportiert und im April 1941 schwer krank entlassen worden.749 Am 7. April 2014 (639 L, 260 T, 24 K) 750 und 2015 (1504 L, 372 T, 42 K) 751 veröffentlichte das Museum private Fotografien von Rudolf Vrba, dem gemeinsam mit Alfred Wetzler an diesem Tag im Jahr 1944 die Flucht aus Auschwitz gelungen war.752 Das Hochzeitsbild von Rudolf Friemel (Abbildung 3) wurde am 18. März 2010 (1497 L, 252 T, 81 K) 753 und 2015 (1497 L, 252 T, 81 K) 754 veröffentlicht. Friemel war es als einzigem Häftling jemals in Auschwitz gestattet worden, im Lager zu heiraten.755 Ein Foto von Otto Küssel wurde am 29. Dezember 2009 (152 L, 2 T, 46 K) 756, 2011 (72 L, 16 T, 13 K) 757 und 2014 (904 L,139 T,47 K) 758 veröffentlicht. Küssel war deutscher Funktionshäftling, der seine Befugnisse im Lager nutzte, um anderen Häftlingen die Haftbedingungen zu erleichtern.759 Beiträge vom 23. April 2014 (555 L, 312 T, 96 K) 760 und 2015 (555 L, 312 T, 96 K) 761 zeigen eine Fotografie von Marian Batko. Der Physiklehrer wurde an diesem Tag im Jahr 1941 als Vergeltungsaktion für entflohene Häftlinge im Zellenblock 11 ohne Nahrung und Wasser eingesperrt und ver-
745 http://on.fb.me/1OA5xYc (Zugriff am 6. 1. 2016). 746 http://on.fb.me/1mFVfLi (Zugriff am 6. 1. 2016). 747 Vgl. Pilecki, Witold / Garlinski, Jarek: The Auschwitz volunteer. Beyond bravery. Los Angeles 2012. 748 http://on.fb.me/1IS7UFD (Zugriff am 7. 1. 2016). 749 Vgl. Bartoszewski, Wladislaw: Mein Auschwitz. Paderborn 2015. 750 http://bit.ly/2myIO9c (Zugriff am 7. 1. 2016). 751 http://on.fb.me/1n5Ip9J (Zugriff am 7. 1. 2016). 752 Vgl. Bauer, Yehuda: Anmerkungen zum »Auschwitz-Bericht« von Rudolf Vrba. in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 45 (1997). Heft 2. S. 297–308. 753 http://on.fb.me/1kOkTwk (Zugriff am 7. 1. 2016). 754 http://on.fb.me/1kOkTwk (Zugriff am 7. 1. 2016). 755 Vgl. Hackl, Erich: Die Hochzeit von Auschwitz. Eine Begebenheit. Zürich 2002. 756 http://on.fb.me/1Z7GLjV (Zugriff am 7. 1. 2016). 757 http://on.fb.me/1IShb0k (Zugriff am 7. 1. 2016). 758 http://on.fb.me/1OOmy2X (Zugriff am 7. 1. 2016). 759 Vgl. Klee, Ernst: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon. Frankfurt am Main 2013. S. 242. 760 http://on.fb.me/1RbFGYT (Zugriff am 7. 1. 2016). 761 http://on.fb.me/1Z7HIbW (Zugriff am 7. 1. 2016).
138
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
hungerte hier.762 Der letzte in dieser Aufzählung ist Kazimierz Piechowski, dem das Museum am 20. Juni 2012 (1407 L, 912 T, 163 K) 763, 2014 (1473 L, 12 T, 44 K) 764 und 2015 (3216 L, 451 T, 139 K) 765 mit einer Lagerfotografie (Abbildung 4) gedachte. Ihm und anderen war am gleichen Tag 1942 mittels gestohlener SSUniformen die Flucht aus Auschwitz gelungen.766
Abbildung 3: Erinnerungsbeitrag vom 18. März 2015 als Hochzeitsbild von Rudolf Friemel und Margarita Ferre
Das Museum wählt also eine relativ kleine Anzahl von Personen aus, derer mittels Erinnerungsbeiträge mit historischen Fotografien gedacht wird. Die Auswahl erscheint im Ansatz eine exemplarische zu sein. Es werden Biografien von Männern und Frauen präsentiert, von verschiedenen Opfergruppen, wie jüdischen Häftlingen, Sinti und Roma oder politischen Häftlingen. Es sind Personen aus verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Positionen innerhalb der Lagerhierarchie und mit verschiedenen Aufgaben und Privilegien. Es werden ebenso Überlebende gezeigt, die entlassen wurden oder denen die Flucht gelungen war. Hinzu kommen hervorstechende Einzelfälle, wie die Hochzeit in Auschwitz. Dabei wird aber vom Museum offensichtlich insoweit nicht flächendeckend auf Repräsentativität geachtet, als dass alle Opfergruppen in glei-
762 Vgl. Pletzing, Christian: Legendary Martyr: Maximilian Kolbe. in: Kirchliche Zeitgeschichte 27 (2014). S. 364–373, hier S. 369. 763 http://on.fb.me/1ZPkSrF (Zugriff am 7. 1. 2016). 764 http://on.fb.me/1UyFOjg (Zugriff am 7. 1. 2016). 765 http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 766 Vgl. Piechowski, Kazimierz / Kaczyn´ska, Eugenia Boz˙ena / Ziółkowski, Michał / Schmidt, Siegfried: Ich war eine Nummer. Geschichten aus Auschwitz. Os´wie˛cim 2008.
Das Auschwitz Memorial and Museum
139
Abbildung 4: Erinnerungsbeitrag über Kazimierz Piechowski vom 20. Juni 2015
chem Maße vertreten sind. Zudem fällt eine starke Tendenz hin zu polnischen Opfern auf. Auffällig ist außerdem, dass allen Opfern eine herausragende, oft heldenhafte Rolle zu kommt, die in den Texten zu den Beiträgen immer deutlich herausgestellt wird. Bei dem zuletzt genannten Erinnerungsbeitrag zu Kazimierz Piechowski vom 20. Juni 2015 handelt es sich mit 3216 Likes, 451 Teilungen und 139 Kommentaren, gemessen an diesen Social-Media-Metrics, um den erfolgreichsten dieser Erinnerungsbeiträge. Typisch für diese Art der Beiträge zu historischen Personen der Lagergeschichte ist, dass neben der Fotografie ein kurzer Text veröffentlicht wird. Im konkreten Fall vom 20. Juni 2015 wurde der folgende Text in englischer Sprache veröffentlicht: On 20 June 1942 between 3 and 4 p.m., four Polish prisoners escaped from the Auschwitz camp. They were: Kazimierz Piechowski (no. 918), Stanisław Gustaw Jaster (no. 6438), Józef Lempart (no. 3419), and Eugeniusz Bendera (no. 8502). They wore SS uniforms which they had stolen from an SS storeroom and left the camp in a car they stole from the SS garages – Steyer 220 with the license plate number SS-20868. 80 kilometers from the camp they distroyed the car and left it in a pit. In the picture: The camp photo of Kazimierz Piechowski. His story: https://en.wikipedia.org/wiki/Kazimie rz_Piechowski767
Auf der intratextuellen Ebene ist auf der wortorientierten Analyseebene einmal der Name der zentralen Person, Kazimierz Piechowski, ein Schlüsselwort. Aber es werden auch andere Personen genannt, die gemeinsam mit Piechowski geflohen waren. Dies ist typisch für diese Art der Beiträge. Eine Biografie ist zentral und wird mit einer historischen Fotografie illustriert, aber auch andere Personen 767 http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016).
140
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
werden genannt. Ähnliches gilt beispielsweise auch für die oben vorgestellten Erinnerungsbeiträge zu Ella Gartner, Witold Pilecki, Marian Batko oder Rudolf Vrba. Weitere Schlüsselwörter im Beitrag zu Piechowski sind prisoners, Auschwitz camp, SS [uniforms/ garages]. Die damit aufgerufenen (historischen) Konzepte und Bedeutungszusammenhänge werden nur transtextuell aufgerufen, aber nicht erklärt. Die Fragen danach, was Auschwitz für ein camp gewesen ist, warum hier prisoners allgemein oder im konkreten Fall von Piechowski und den anderen inhaftiert worden waren, welche Haftbedingungen hier geherrscht haben, was die SS war, welche Aufgaben die SS oder die Häftlinge hatten etc. werden nicht weiter benannt oder ausgeführt. Denn leitend ist intratextuell das Prinzip der Kürze. Dies setzt sich auch auf der textorientierten Analyseebene fort. Insgesamt besteht der Text aus vier kurzen Hauptsätzen, bei denen nur der zweite Hauptsatz zwei untergeordnete Relativsätze enthält. Diese Kürze ist medienspezifisch – in sozial-kommunikativer Hinsicht, nicht in materiell-medialer – typisch für die Textsorte Facebookbeitrag. Mit vier Hauptsätzen zählt dieser Post sicherlich zu den längeren, da Facebookbeiträge üblicherweise aus weniger Sätze bestehen, auch wenn eine mediale Begrenzung wie bei Twitter nicht existiert. Typisch ist diese Länge aber auch für die konkrete hier definierte Textsorte der Erinnerungsbeiträge. Konstitutiv für diese Art der Themenentfaltung im Text sind Strategie und Funktion dieser Beiträge, die den Nutzer*innen in aller Kürze wenige zentrale Informationen liefern sollen. Die Hürden bei der Rezeption sollen dabei offensichtlich so gering wie möglich sein, um eine größtmögliche Gruppe von Nutzer*innen zu erreichen. Die meisten Merkmale der visuellen Textstruktur sind vom Trägermedium Facebook noch viel stärker vorgegeben als die textuelle Gestaltung der Beiträge. Aber es existiert hier immer eine klare TextBild-Beziehung. Wenn möglich, wird vom Museum Auschwitz immer eine Fotografie ausgewählt, deren Grad der vermutlich von Nutzer*innen wahrgenommenen Authentizität so nah wie möglich am im Text beschriebenen historischen Sachverhalt orientiert sein soll. Im konkreten Beitrag von Piechowski sieht man ihn als KZ-Häftling. Würde eine SS-Fotografie zur konkreten Flucht existieren, dann hätte das Museum diese vermutlich veröffentlicht. Einen weiteren Beleg für diese These kann der oben schon benannte Erinnerungsbeitrag zu Rudolf Friemel liefern, der das Hochzeitsfoto von ihm und seiner Braut Margarita Ferrer abbildet. Auf der Ebene der Diskurshandlungen übernimmt naturgemäß zunächst das Museum Auschwitz als Administrator die Interaktionsrolle des Autors. Aussagen zu Autor*innenschaft insgesamt und zu den Instanzen der Äußerung können aufgrund des rein deskriptiven Ansatzes des medial Präsentierten nicht getroffen werden, da diese vom Museum über Facebook nicht mitgeteilt werden, auch wenn dies medial möglich und inhaltlich denkbar wäre. Über den tatsächlichen Kreis der Textrezipient*innen lassen sich ebenfalls hier keine Aus-
Das Auschwitz Memorial and Museum
141
sagen treffen. Ausgehend von der Art der Textgestaltung können jedoch über den antizipierten Adressatenkreis Vermutungen formuliert werden, während die oben angegebenen Social-Media-Metrics der Seite allgemein und des Beitrags konkret Vermutungen über das quantitative Ausmaß der Leserschaft zulassen. Der Text des Erinnerungsbeitrags über Piechowski ist an einen größtmöglichen Kreis von Rezipient*innen und vermutlich nicht an eine spezifische Zielgruppe im Sinne von Geschlecht, Nation, Alter etc. gerichtet. An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, eine weitere Gruppe von Autor*innen in die Analyse miteinzubeziehen. Über die Facebookfunktion des Kommentierens können Nutzer*innen den Text des Erinnerungsbeitrags interaktiv erweitern. Dies wurde beim ursprünglichen Beitrag über Piechowski 139 Mal genutzt. Analysiert man diese Kommentare, so fällt auf der intratextuellen Ebene auf, dass der Großteil aus sehr kurzen Texten von 1 bis 15 Wörtern besteht. Schlüsselwörter sind dabei die Wörter respect (22) 768, brave (14x) 769, hero (7x) 770 oder never (5x) 771. Dies ist auch typisch für die anderen oben genannten Erinnerungsbeiträge über Opfer. Zum Erinnerungsbeitrag über Danuta Terlikowska vom 29. Oktober 2012 (794 L, 1027 T, 311 K) 772 sind beispielsweise auf der intratextuellen Ebene ebenfalls die meisten der 311 Kommentare sehr kurz und beinhalten ähnliche Schlüsselwörter: R.I.P (10x) 773, hero (17x) 774 oder never (48x) 775. Längere Kommentare, die über diese kurzen Äußerungen der Bewunderung, des Mitgefühls oder der Ablehnung hinausgehen, wurden ebenfalls von Nutzer*innen verfasst und veröffentlicht. Beim Erinnerungsbeitrag über Piechowski hat ein Kommentar vom 20. Juni 2015 mit 99 Likes und 10 Antworten wiederum eine Resonanz bei anderen Nutzer*innen ausgelöst: Well done to these men! Went to Dachau 3 years ago, very thought provoking, I am going to Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz next week with my son. Something I have
768 Beispiele: »Respect«; »Great MEN, RESPECT for them«; »Deep respect for those men, who was scared, i think so, but done that anyway!« http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 769 Beispiele: »Wow!! Brave men!«; »The braves !! All respect.«; »Brave men«. http://on.fb.me /1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 770 Beispiele: »heroes«; »These men are heroes«; »Great heroes my respect«; »Real heroes«. http ://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 771 »True Heroes! I know Auschwitz and Dachau! Never more Must Happened!«; »Never Again!«; »Never be forgotten!« http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 772 http://on.fb.me/1mFNCo5 (Zugriff am 7. 1. 2016). http://on.fb.me/1mFNCo5 (Zugriff am 7. 1. 2016). 773 Beispiele: »R.I.P.«; »=c so many lost lives. R.I.P«; »She R.I.P. !!!! With all those 5.500.000 others.« http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 774 Beispiele: »What a hero. RIP.«; »A true heroine!«; »A beautiful heroic person«. 775 Beispiele: »Never Forget«; »RIP and never forget !!!!«; »never again L«. http://on.fb.me/1m FNCo5 (Zugriff am 7. 1. 2016).
142
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
wanted to do for some years now. RIP citizens of Auschwitz and all other places of atrocities.776
Die Antworten der anderen Nutzer*innen beziehen sich dann ebenfalls auf geplante oder bereits vollzogene Besuche des Lagergeländes Auschwitz. In einigen wenigen Fällen kommt es auch vor, dass Nutzer*innen Fragen stellen, wie Marco Vivanti am 21. Juni 2015: Didn’t an officer pass them and salute them? He was returning to the camp and was informed of their escape. He became very upset but then started laughing and when asked why he was laughing, he said he even saluted them as they drove past him.777
Das Museum selbst reagiert jedoch auf Facebook nicht oder nur sehr selten auf solche Anfragen. Es sind andere Nutzer*innen, die auf Bücher oder TV-Dokumentationen verweisen, die Antworten auf solche oder ähnliche Fragen geben können.
Abbildung 5: Erinnerungsbeitrag über Johann Paul Kremer vom 13. November 2009
Auf der Ebene der Diskurshandlungen nehmen bei Erinnerungsbeiträgen zu Opfern die Nutzer*innen vor allem eine Diskursposition ein, die Bewunderung und Respekt für die verschiedenen präsentierten Opferbiografien beinhaltet. Vielfach wird die Position des »Nie wieder« eingenommen und in Kommentaren zum Ausdruck gebracht. Das Museum selbst initiiert auf Facebook v. a. Beiträge, ergreift dann jedoch nur in sehr seltenen Fällen als Kommentator nochmals das Wort. Diskussionen und Debatten zwischen Nutzer*innen, bei denen kontroverse Diskursposition eingenommen werden, sind zudem die Ausnahme. 776 http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016). 777 http://on.fb.me/1OcGLdd (Zugriff am 7. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
143
Das Museum veröffentlicht aber nicht nur Fotografien zu Opfern. Wie bereits erwähnt, wird auch an die Verbrechen von acht Tätern explizit mit Erinnerungsbeiträgen mit Fotografien erinnert, die diese Personen abbilden. Hierbei werden teilweise auch bewusst Mugshotfotografien eingesetzt, um die Personen eindeutig als Täter abzubilden.778 So geschehen auch bei der Fotografie von Johann Paul Kremer (Abbildung 5), die jeweils am 13. November 2009 (275 L, 104 T, 35 K) 779, 2013 (718 L, 0 T, 1 K) 780 und 2015 (718 L, 0 T, 1 K) 781 veröffentlicht worden war. Kremer war als Lagerarzt in Auschwitz tätig und wurde wegen seiner Verbrechen im Krakauer Auschwitzprozess im Jahr 1947 zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt.782 Auch der Leiter des Desinfektionskommandos Josef Klehr783 wird am 11. September 2013 (215 L, 80 T, 29 K) 784 vom Museum in einer Mugshotfotografie gezeigt. Das gleiche trifft auch auf Erich Mußfeldt zu, der Leiter der Krematorien im KZ Majdanek und im KZ Auschwitz-Birkenau war785 und vom Museum Auschwitz in Erinnerungsbeiträgen in einer Fotografie in Gefangenschaft aus dem Jahr 1947 am 1. Januar 2011786 (561 L, 293 T, 216 K), 2012 (81 L, 17 T, 12 K) 787, 2013 (243 L, 100 T, 54 K) 788 und 2014 (312 L, 5 T, 27 K) 789 gezeigt wird. Andere Täter werden in ihrer SS-Uniform abgebildet, wobei die SSRunen diese dabei ebenfalls eindeutig als Täter des NZ-Regimes kennzeichnen. Dies gilt für Richard Baer, der u. a. von Ende 1944 bis Januar 1945 das Kommando über das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau hatte790 und dem ein Erinnerungsbeitrag vom 11. Mai 2014 (435 L, 125 T, 47 K) 791 gewidmet ist. Auch der Lagerkommandant vom KZ Auschwitz III Monowitz, Heinrich Schwarz,792 wurde am 20. Februar 2013 (236 L, 78 T, 56 K) 793 in einem Beitrag in SS-Uniform abgebildet. Nicht sofort als Täter in der veröffentlichten Fotografie zu erkennen ist hingegen Carl Clauberg, der als Gynäkologe der SS Menschenversuche und
778 Vgl. Lashmar, Paul: How to humiliate and shame. A reporter’s guide to the power of the mugshot. in: Social Semiotics 24 (2013). Heft 1. S. 56–87. 779 http://on.fb.me/1PiOJkO (Zugriff am 8. 1. 2016). 780 http://on.fb.me/1MX6ynE (Zugriff am 8. 1. 2016). 781 http://on.fb.me/1OfpmAt (Zugriff am 8. 1. 2016). 782 Vgl. Klee 2013, S. 236. 783 Vgl. Klee 2013, S. 217–218. 784 http://on.fb.me/22PzIAT (Zugriff am 8. 1. 2016). 785 Vgl. Klee 2013, S. 425. 786 http://on.fb.me/1OfshZW (Zugriff am 8. 1. 2016). 787 http://on.fb.me/1PSKa5A (Zugriff am 8. 1. 2016). 788 http://on.fb.me/1VPVMqh (Zugriff am 8. 1. 2016). 789 http://on.fb.me/1mKHtHf (Zugriff am 8. 1. 2016). 790 Vgl. Klee 2013, S. 25–26. 791 http://on.fb.me/1MX9rVF (Zugriff am 8. 1. 2016). 792 Vgl. Klee 2013, S. 370–371. 793 http://on.fb.me/1IUpCZ2 (Zugriff am 8. 1. 2016).
144
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Zwangssterilisationen u. a. in Auschwitz vorgenommen hatte794 und der in einem Erinnerungsbeitrag vom 28. Dezember 2015 (595 L, 0 T, 134 K) 795 in einer Fotografie in Arztkleidung abgebildet wird.
Abbildung 6: Erinnerungsbeitrag über Rudolf Höß vom 2. April 2014
Die in Zusammenhang mit Auschwitz wohl bekanntesten Täter, die in Erinnerungsbeiträgen in Fotografien auf der Facebookseite des Museums erscheinen, sind Rudolf Höß und Heinrich Himmler. Der »Reichsführer der SS« Himmler taucht im für diese Kategorie von Erinnerungsbeiträgen nicht ganz typischen Fotografien auf, die ihn beim Besuch des Lagers zeigen, wie im Erinnerungsbeitrag vom 1. März 2015 (1151 L, 278 T, 63 K) 796, 27. April 2010 (140 L, 3 T, 37 K) 797 und 2014 (521 L, 169 T, 37 K) 798 und vom 25. Februar 2014 (482 L, 491 T, 47 K) 799. Ein Erinnerungsbeitrag mit einer Fotografie des Kommandanten (1940– 1943) des Konzentrationslagers Auschwitz Rudolf Höß veröffentlichte das Museum Auschwitz auf seiner Facebookseite am 2. April 2014 (720 L, 463 T, 76 K)800. Die Fotografie (Abbildung 6) zeigt Rudolf Höß während seines Prozesses in Warschau 1947. Weil Beiträge mit Fotografien von Tätern vergleichsweise intensiv von Nutzer*innen wahrgenommen worden sind, soll der Erinnerungsbeitrag zu Rudolf Höß exemplarisch etwas intensiver diskursanalytisch beschrieben werden. Zur Fotografie verfasste das Museum den folgenden Text: On 2 April 1947 the Supreme National Tribunal in Warsaw sentenced Rudolf Höss, the commandant of the Auschwitz camp from its foundation until 22 November 1943 (later he returned to the camp in May 1944 as the head of the SS garrison to coordinate the 794 795 796 797 798 799 800
Vgl. Klee 2013, S. 81–82. http://on.fb.me/1OfuC7n (Zugriff am 8. 1. 2016). http://on.fb.me/1OfCENl (Zugriff am 8. 1. 2016). http://on.fb.me/1PSVj6b (Zugriff am 8. 1. 2016). http://on.fb.me/22PLX0d (Zugriff am 8. 1. 2016). http://on.fb.me/1PSVj6b (Zugriff am 8. 1. 2016). http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 8. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
145
operation of murdering Jews deported from Hungary). The sentence was carried out on 16 April 1947. Höss was hanged on the site of the former Auschwitz I camp, immediately adjacent to the crematorium and the first gas chamber.801
Auf der intratextuellen Ebene sind auf der wortorientierte Analyseebene neben dem Namen Rudolf Höss die Begriffe commandant, Auschwitz [camp], operation of murdering, sentence, crematorium, gas chamber Schlüsselwörter. Ähnlich wie bei den Erinnerungsbeiträgen zu Opfern, werden die transtextuell aufgerufenen (historischen) Konzepte und Bedeutungszusammenhänge nicht erklärt. Die textorientierte Analyse offenbart, dass im kurzen, aus drei Sätzen bestehenden Text Strategie und Funktion konstitutiv für die Art der Themenentfaltung sind. In aller Kürze sollen wenige zentrale Informationen an die Nutzer*innen vermittelt werden. Die Verurteilung von Höß und dessen Vollstreckung am Jahrestag des Beitrags vor 67 Jahren stehen im Zentrum des Vermittlungsinteresses. Seine Verbrechen werden kurz benannt. Die Hürden bei der Rezeption sollen auch hier so gering wie möglich gehalten werden, um die Gruppe von zu erreichenden Nutzer*innen so groß wie möglich zu gestalten. Es existiert auch hier eine klare Text-Bild-Beziehung, da der Fotografie die Aufgabe zukommt, die von den Rezipient*innen wahrgenommene Authentizität des Beitrags zu erhöhen. Auf der Ebene der Diskurshandlungen hat das Museum Auschwitz die Interaktionsrolle des Autors inne. Aber auch die Nutzer*innen haben mit 76 Kommentaren bei diesem Erinnerungsbeitrag eine Autor*innenrolle eingenommen. Auf der intratextuellen Ebene besteht mit 36 Kommentaren fast genau die Hälfte der Kommentare aus sehr kurzen Texten von 1 bis 15 Wörtern. Schlüsselwörter sind hier die Begriffe hang (16x)802, hell (9x)803 und evil (5x)804. Alle hier öffentlich sichtbaren Kommentare nehmen Diskurspositionen ein, die die Taten von Höß verurteilen und seine Todesstrafe für gerechtfertigt oder für zu milde halten. Nutzer*innen interagierten auch miteinander, wie im Falle des Kommentars von Pauline Hodkinson, in dem sie zum Ausdruck brachte, dass die Strafe ihrer Meinung nach zu milde sei.805 Sieben Nutzer*innen antworteten wiederum 801 http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 8. 1. 2016). 802 Beispiele: »How ironic,that he would be hanged at the exact place he had perpetrated the atrocities against the Jews.«; »Hanging too good for this Nazi.«; »Too bad they couldn’t hang him by his balls.« http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 11. 1. 2016). 803 Beispiel: »I’m all hope that he and his kids burn in hell!!«; »I hope he’s rotting in hell.. Along with the rest of the vile, murdering pigs!!«; »I hope He ROTS in HELL.. My fathers Aunts, Uncles, cousins died at their hands!! I hope they are all BURNING!!!!!!!!!!!!!«. http://on.fb.me /1Jz0Uxh (Zugriff am 11. 1. 2016). 804 Beispiele: »another example of evil personified L«; »Evil lies with evil«; »I took a picture where they hanged this evil vile creature …« http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 11. 1. 2016). 805 »Hanging was too good for him, his misery was over too quick, but at least he was caught and »punished« for his role…………so many others got away with it whilst here on earth, I hope
146
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
darauf, indem sie Hodkinson zustimmten oder auf ihre eigene Familiengeschichte verwiesen, wie im Kommentar von Matthew Cloner806. Eine andere zu Rudolf Höß veröffentlichte Fotografie kann diese Befunde ebenfalls bestätigen. Die Erinnerungsbeiträge vom 16. April 2012 (538 L, 190 T, 56 K)807 und 2014 (1617 L, 397 T, 130 K)808 zeigen beide eine aktuelle Fotografie des Galgens, an dem Höß gehängt worden war. Damit passt dieser Beitrag zwar nicht in die Kategorie der Erinnerungsbeiträge mit historischen Fotografien, soll aber hier dennoch angeführt werden, um den Umgang mit Tätern von Anbieter*innen- und Nutzer*innenseite exemplarisch zu illustrieren. Beide Beiträge haben den gleichen englischen Text809, in dem kurz auf das historische Ereignis der Hinrichtung am 16. April 1947 verwiesen wird. Auf der intratextuellen Ebene ergibt die wortorientierte Analyse der 130 Kommentare des Beitrags von 2014 die Schlüsselbegriffe good (9x)810, hell (6x)811, monster (5x)812 und evil (4x)813. Insgesamt dominieren auch hier Diskurspositionen, die Höß’ Verbrechen verurteilen und seine Strafe für gerechtfertigt oder als zu gering ansehen. Wie bereits oben erwähnt, veröffentlicht das Museum auch historische Fotografien, die eine anonyme Gruppe von Personen zeigen, die repräsentativ für ein Kollektiv stehen. Von dieser Art von Fotografien wurden vom Museum bis einschließlich 2015 17 Fotografien in Erinnerungsbeiträgen veröffentlicht. Fast alle diese Fotografien zeigen Opfer, mit Ausnahme von zwei Fotografien, die Täter zeigen. Zum einen zeigt ein Beitrag vom 25. Februar 2014 (482 L, 491 T, 47 K)814 eine Gruppe von SS-Männern. Im Text zur Fotografie wird die Verleihung des »Kriegsverdienstkreuzes 1. Klasse mit Schwertern« an SS-Sturmbannführer
806 807 808 809
810 811 812 813 814
they were/are made to pay the price at the end of their earthly life when they have to account for their vile actions before God.« http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 11. 1. 2016). »Hi Pauline – I understand your feelings. I lost members of my family at Auschwitz. No one gets away with anything in this life. We all have to stand before God in the end, as you have written.« http://on.fb.me/1Jz0Uxh (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1nd20VA (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). »On 16 April 1947, few minutes after 10 a.m., on the gallows constructed next to crematorium I in the former Auschwitz I camp, near the building of the past commandant’s office, Rudolf Höss, the founder and the first commandant of the Auschwitz concentration camp was executed.« http://on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). Beispiele: »A beautiful instrument at the camp. Good job.«; »Good he deserved it«; »Good riddance«. http://on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). Beispiele: »I hope he rots in Hell«; »Burn in hell, pig.«; »Let suffers in hell!!!!!!!!!!!!!!!«. http:// on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). Beispiele: »No suffering for a Monster«; »Monster…«; »He has pay the price but many others »monsters« are escape. Its good to die in the same place that you have kill 1,5milion innocent people«. http://on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). Beispiele: »Höss = evil mass murderer«; »Evil monster .«; »He was a brutal, evil monster.« http://on.fb.me/1PRSO25 (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1OXcf JW (Zugriff am 11. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
147
Karl Bischoff am 30. Januar 1944 thematisiert,815 der auf der Fotografie auch abgebildet ist. Eine zweite Fotografie, die eine Gruppe von Tätern zeigt, wurde am 24. November 2012 (638 L, 346 T, 43 K)816 veröffentlicht und bildet die Angeklagten des ersten Auschwitz-Prozesses in Krakau ab, der am gleichen Tag im Jahr 1947 begonnen hatte. Dieser Beitrag erzählt im Text ebenfalls Fragmente von Täterbiografien, da er auf die prominenten Angeklagten Arthur Liebehenschel, Maria Mandel und Johann Kremer verweist. Mit einer Anzahl von 15 zeigt die Mehrheit der Fotografien mit Gruppen von Personen Opfer des Holocaust in Auschwitz. Davon wiederum zeigt mit acht Fotografien über die Hälfte ungarische Jüd*innen. Ein Großteil davon wurden in den Monaten Mai, Juni und Juli 2014 veröffentlicht, wie in diese Beiträge vom 23. Mai (1531 L, 1595 T, 276 K)817, 3. (1297 L, 584 T, 128 K)818, 9. (1489 L, 665 T, 136 K)819 und 15. Juni (1156 L, 278 T, 116 K)820 und 7. (1273 L, 490 T, 118 K)821 und 9. Juli 2014 (1182 L, 494 T, 80 K)822. Diese Veröffentlichungen des Museums im Sommer 2014 stehen im Zusammenhang mit historischen Entwicklungen im Sommer 1944. Denn die Nationalsozialisten hatten ab Mitte Mai 1944 massiv mit Deportationen ungarischer Jüd*innen nach Auschwitz begonnen und dabei täglich zwei- bis dreitausend Menschen ins Lager Auschwitz deportiert, sodass bis Anfang Juli 1944 annähernd eine halbe Million ungarischer Jüd*innen nach Auschwitz gebracht worden waren.823 Das Museum erzählt in den Monaten Mai bis Juli 2014 mit diesen Fotografien fragmentarisch die Geschichte der Deportation der ungarischen Jüd*innen nach Auschwitz. Dabei stehen große Opferzahlen und individuelle Schicksale nebeneinander, wie der Beitrag vom 23. Mai 2014 (Abbildung 7) exemplarisch illustrieren kann: 1944/2014 | 70th anniversary of deportation and extermination of Jews from Hungary in Auschwitz On May 23 1944 four trains with Jews deported from Hungary to Auschwitz crossed the border in Kosˇice, with: 3023 Jews from Vis¸eu de Sus (Felso˝visó), 3272 from Nyiregyháza, 3269 from Mukacˇevo (Munkács) and 3110 from Oradea (Nagyvárad) – all together 12,674 people. On 23 May 1944 after the selection of transports from Hungary 5 women were registered in the camp. Most probably a group of young, healthy people were kept in the camp as 815 816 817 818 819 820 821 822 823
Vgl. Klee 2013, S. 51. http://on.fb.me/1VZCleX (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1RGkEQQ (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1l0iGxZ (Zugriff am 11. 1. 2016). http://t1p.de/x5ng (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1PnHHvg (Zugriff am 11. 1. 2016). http://on.fb.me/1Rx4nj7 (Zugriff am 11. 1. 2016). Vgl. Somogyi, Éva: Ausgleich. in: Diner, Dan (Hrsg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Band 1. Stuttgart, Weimar 2011. S. 207–209.
148
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
the so-called deposit (without registering them in the camp – some were soon transported to other concentration camps, some – killed in the gas chambers). Remaining people were murdered in the gas chambers. Jews deported from Hungary a few moments before being murdered in gas chambers. They are waiting in a small forest next to gas chambers and crematoria IV and V [. sic] The girl standing second from the right is Gerty Ackerman of Munkács. Sitting next to her is her sister Wally. Behind the girls, in the white headscarf, is the sister’ mother, RoziRebecca née Mermelstein. The two boys to the left are probably Reuven and Gershon Fogel. Lia Fogel, née Mermelstein is sitting next to the in the dark headscarf. The picture was taken by SS photographers in May 1944 during deportation of Jews from Hungary to Auschwitz.824
Mit 13 Sätzen handelt es sich auf der intratextuellen textorientieren Analyseebene um einen vergleichsweise langen Text eines Erinnerungsbeitrags auf Facebook. Das hier bei der Themenentfaltung zugrunde gelegte Vertextungsmuster verweist transtextuell auf historische Fakten und zeigt zunächst im ersten Satz in Zahlen auf, wie viele Menschen am 23. Mai 1944 nach Auschwitz deportiert worden waren. Dann wird der örtliche Fokus zunächst auf das Lager Auschwitz und die Vorgänge bei der Registrierung gerichtet. Der zweite Teil des Textes erklärt dann die Fotografie, die in Auschwitz, aber nicht am 23. Mai aufgenommen worden war. Die Personen auf der Fotografie, die kurz nach der Aufnahme ermordet worden waren, bleiben aber nicht anonym, sondern werden im Beitrag vom Museum soweit wie möglich namentlich benannt.
Abbildung 7: Erinnerungsbeitrag vom 23. Mai 2014, der eine Gruppe jüdischer Ungarinnen während ihrer Deportation nach Auschwitz zeigt
824 http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
149
Die Reaktionen der Nutzer*innen auf diesen Beitrag fallen mit 276 Kommentaren relativ stark aus. Eine wortorientierte Analyse dieser Nutzer*innenkommentare ergibt die Schlüsselbegriffe never forget (31x)825, sad (17x)826, never again (15x)827, remember (15x)828, horror (5x). Neben diesen üblichen kurzen Kommentaren, die Trauer und Entsetzen ausdrücken, kommentierten auch einige Nutzer*innen in längeren Kommentaren in Referenz zu ihrer eigenen Familiengeschichte, wie Pauline Zoldan829, Barbara Resch Marincel830 oder Ruth Orenbach831. Die Strategie der Themenentfaltung im Vertextungsmuster, die das Museum in der Interaktionsrolle des Autors im zweiten Teil dieses Beitrags vom 23. Mai 2014 einnimmt, in dem das mörderische Geschehen in Auschwitz durch Biografien personalisiert wird, ist in anderen Erinnerungsbeiträgen zur Geschichte ungarischer Jüd*innen im Holocaust noch deutlicher. Exemplarisch soll hier der Erinnerungsbeitrag vom 9. Juni 2014 (1489 L, 665 T, 136 K)832 angeführt werden, 825 Beispiele: »Never forget«; »Never, never, never forget..«; »Never forget!! how cruel the Germans were too these Jews. I hope all the people involved they are living in living hell. For doing such a terrible act.« http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). 826 Beispiele: »so sad and horrible«; »Sad.«; »So sad. Pass by the Wallenberg memorial each day at work. He saved 50,000 Hungarian Jews by giving them diplomatic exemptions. Amazing what one person can do, would there have been more.« http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). 827 Beispiele: »Never again ! OMG !«; »Breaks my heart! Such evil against fellowmen! Never again! Never!«; »We have a responsibility to ensure that future generations are educated and to speak up – Never again«. http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). 828 »That should never ever happen again we need to remember !«; »We must remember what evil man is capable of!«; »remember Belson« http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). 829 »My mother-in-law, parents, gr-parents, and other family were from Munkacs…definitely on this transport. She, Margaret Rupp age 22, survived with only one aunt. It is so surreal to ready these facts documented. We are blessed to still have her in our lives at the age of 91.5 yrs. She and her late husband, Morris Zoldan z’l, also a survivor of auschwitz and other camps, married after liberation and have 3 children, 5 grandchildren, and 7 great-grandchildren with more to come, G-d willing.« http://on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 11. 1. 2016). 830 »My dad helped liberate one of the camps in Germany. He never got over what he saw there. We cannot allow the Holocaust deniers to win! NEVER FORGET!!«. http://on.fb.me/1VZE UxA (Zugriff am 12. 1. 2016). 831 »My family was deported in the same transport from Tiachevo-Ticho. My mother and her sister survived,my three brothers and my sister whom I never knew , were murdered.« http: //on.fb.me/1VZEUxA (Zugriff am 12. 1. 2016). 832 »1944/2014 | 70th anniversary of deportation and extermination of Jews from Hungary in Auschwitz. Fragment of testimony of Dr. Martin Foeldi given during the Adolf Eichmann Trial in Jerusalem We alighted and it was in such a hurried manner and at such a fast pace that we did not realize what was happening. They said to us that the men should stand on the right side with children over the age of 14, and the women on the left with the young boys and girls. They, the women began walking while we were still standing, and suddenly they were almost completely out of view. The younger women were walking separately without boys or girls, and the older women walked in a separate group. After the event we heard of a case
150
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
in dem das Museum als Text zu einer Fotografie, die eine Selektion an der Rampe von Auschwitz zeigt, einen Auszug aus den Aussagen des jüdischen, in Auschwitz als Arzt tätigen Häftlings Dr. Martin Foeldi veröffentlicht, der verstörende Details über die Selektionsprozesse berichtet. Diese Art von Einbezug anderer Quellen, zusätzlich zur historischen Fotografie, bleibt aber die Ausnahme. Bei anderen Erinnerungsbeiträgen dieser Art, die eine Gruppe von Personen repräsentativ für ein (Opfer-)Kollektiv zeigen, wird das übliche und schon vielfach präsentierte Vertextungsmuster angewendet, bei dem in kurzen Sätzen wenige Fakten zur Abbildung geliefert werden. Es werden auf der Facebookseite des Museums Auschwitz aber nicht nur ungarische Auschwitzopfer auf Fotografien gezeigt, sondern auch andere Opfergruppen, wie polnische Personen auf ihrem Weg ins Lager im Beitrag vom 15. Juni 2015 (28 L, 3 T, 1 K)833, weibliche Häftlinge beim Sortieren von gestohlenem Besitz im Beitrag vom 21. Oktober 2013 (126 L, 40 T, 9 K)834, Häftlinge beim Legen von Fundamenten für Gebäude beim Ausbau des Lagers im Beitrag vom 26. März 2011 (368 L, 499 T, 76 K)835, Häftlinge beim Bau der Krematorien von Auschwitz in den Erinnerungsbeiträgen vom 10. Februar 2010 (141 L, 3 T, 44 K)836 und vom 1. Februar 2011 (281 L, 13 T, 30 K)837 oder Häftlinge bei der Evakuierung des Lagers kurz vor der Befreiung in einem Erinnerungsbeitrag vom 17. Januar 2011 (291 L, 187 T, 45 K)838. Eine weitere Fotografie (Abbildung 8), die eine Gruppe von Opfern zeigt, wurde von den Nutzer*innen sehr stark wahrgenommen. Der Erinnerungsbei-
833 834 835 836 837 838
where ›Haeftlinge‹ (detainees) the old hands, if I may call them that, came along. It happened occasionally that one of them would say to a young woman: »Give the child to granny and you go to work.« There were individual instances of this kind – a cousin of mine also handed over her boy and girl to a grandmother and went to work, but she was killed there. I stood there with my son who was only 12 years old. After we had started walking forward, I suddenly came up to a certain man. I did not know who he was. He was dressed in a uniform of the German army, elegant, and he asked me what my profession was. I knew that being a lawyer by profession would not be very helpful and, therefore, told him that I was a former officer. He looked at me and asked: ›How old is the boy?‹ At that moment I could not lie, and I told him: 12 years old. And then he said: ›Wo ist die Mutti?‹ (And where is your mother?) I answered: ›She went to the left.‹ Then he said to my son: ›Run after your mother.‹ After that I went on walking to the right and I saw how the boy was running. I wondered to myself how would he be able to find his mother there? After all, there were so many women and men, but I caught sight of my wife. How did I recognize her? My little girl was wearing some kind of a red coat. The red spot was a sign that my wife was near there. The red spot was getting smaller and smaller. I walked to the right and never saw them again.« http://on.fb.me/1l0iGxZ (Zugriff am 12. 1. 2016). http://short4u.de/56950fbd02529 (Zugriff am 12. 1. 2016). http://on.fb.me/1OfOt8E (Zugriff am 12. 1. 2016). http://on.fb.me/1TSjfG5 (Zugriff am 12. 1. 2016). http://on.fb.me/1Zi7Fp6 (Zugriff am 12. 1. 2016). http://on.fb.me/1J0EGUQ (Zugriff am 12. 1. 2016). https://bit.ly/2uVLGRO (Zugriff am 12. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
151
Abbildung 8: Erinnerungsbetrag vom 27. Januar 2010, der befreite Häftlinge zeigt
trag vom 27. Januar 2010 (3466 L, 12.367 T, 895 K)839 zeigt ehemals in Auschwitz inhaftierte Kinder nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee. Die Rückbindung des Beitrags als Teil der textuellen Makrostruktur an eine Opferperspektive vollzieht sich in diesem Beitrag nicht ausschließlich im Text840, sondern auch in der Text-Bild-Beziehung. Die Perspektive ist allerdings genau genommen zuallererst die der Befreier*innen und erst in sekundärer Lesart die der Befreiten, auch wenn hier intentional vermutlich eine Opferperspektive illustriert werden soll. Die für die Befreiung von Auschwitz ikonisch gewordene Fotografie hat für den Facebookbeitrag allerdings v. a. illustrativen Charakter. Die Aufnahme wurde von Aleksandr Vorontsov, einem sowjetischen Kameramann der Ersten Ukrainischen Front, einige Zeit nach der tatsächlichen Befreiung des Vernich839 http://on.fb.me/1PpmS2o (Zugriff am 12. 1. 2016). 840 »On January 27, 1945, on Saturday, at around 9 a.m. the first Soviet soldier from a reconnaissance unit of the 100th Infantry Division appeared on the grounds of the prisoners’ infirmary in Monowitz. The entire division arrived half an hour later. The same day a military doctor arrived and began to organize assistance. In the afternoon soldiers of the Red Army entered the vicinity of the Auschwitz main camp and Birkenau. Near the main camp they met resistance from retreating German units. 231 Red Army soldiers died in close combat for the liberation of Auschwitz, Birkenau and Monowitz. Two of them died in front of the gates of Auschwitz main camp. One of them was Lieutenant Gilmudin Badryjewicz Baszirow. The first Red Army troops arrived in Birkenau and Auschwitz at around 3 p.m. and were joyfully greeted by the liberated prisoners. After the removal of mines from the surrounding area, soldiers of the 60th Army of the 1st Ukrainian Front marched into the camp and brought freedom to the prisoners who were still alive. On the grounds of the main camp were 48 corpses and in Birkenau over 600 corpses of male and female prisoners who were shot or died in the last few days.At the time of the Red Army’s arrival there were 7,000 sick and exhausted prisoners in the Auschwitz, Birkenau and Monowitz camps. [es folgt der gleiche Text auf Polnisch]«. http://on.fb.me/1PpmS2o (Zugriff am 12. 1. 2016).
152
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
tungslagers im Rahmen einer filmischen Reinszenierung des Ereignisses aufgenommen.841 Auch wenn Vorontsov am 27. Januar vor Ort war, so ist die veröffentlichte Fotografie ein Standbild aus Filmmaterial, das er nach dem 27. Januar 1945 mit Überlebenden auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers inszenierte und dann rückdatiert hatte. Das Filmmaterial wurde für verschiedene Filme verwendet, die u. a. als Beweismaterial im Nürnberger Prozess und für Ausstellungen der Gedenkstätte Auschwitz genutzt worden sind,842 in den meisten Fällen ohne dass diese Rückdatierung sichtbar gemacht worden war. Das konkrete Standbild auf der Fotografie zeigt u. a. die im Lager zurückgebliebenen »Zwillinge des Dr. Mengele«, die in einer mehrfach gedrehten Szene zu sehen sind. Die Kinder hatten am Vortag viel zu große Drillichjacken und -hosen bekommen, die nicht Teil ihrer Kleidung im Lager waren.843 Die abgebildeten Überlebenden Eva und Miriam Mozes erinnerten sich 1985, als sie das Standbild in der Ausstellung im Museum Auschwitz entdeckt hatten, dass sie das Kamerateam der Roten Armee »in Häftlingskleidung gesteckt und sie so lange durch das Lagertor [hatte] gehen lassen, bis die Szene ›authentisch’ genug ausgesehen hatte.«844 Auf Provenienz, Entstehungs- und weitere Verwendungszusammenhänge als Beweis- und Propagandamaterial845 wird vom Museum Auschwitz jedoch nicht hingewiesen. Insbesondere vom geschichtsdidaktischen Standpunkt erscheint dies als sehr problematisch.846 Das Museum Auschwitz folgt auf Facebook in seinen Beiträgen häufig einem kollektiven Bedürfnis nach vermeintlich authentischem visuellen Belegmaterial. Bei dem im konkreten Beispiel 841 Vgl. Anita, Kondoyanidi: The Liberating Experience. War Correspondents, Red Army Soldiers, and the Nazi Extermination Camps. in: The Russian Review 69 (2010). Heft 3. S. 438– 462, hier S. 457. 842 Vgl. Łysal, Tomasz: Reconstruction or Creation? The Liberation of a Concentration Camp in Andrzej Wajda’s Landscape After Battle. in: Slovo 25 (2015). Heft 1. S. 31–47, hier S. 38–39; Agde, Günter: Gerichtsfilme über Nürnberg 1946. in: Filmblatt (Berlin) 7 (2002). Heft 18. S. 4–7. 843 Vgl. Grotum, Thomas: Das digitale Archiv. Aufbau und Auswertung einer Datenbank zur Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz. Frankfurt am Main, New York 2004. S. 259– 260. 844 Vgl. Lagnado, Lucette / Dekel, Sheila Cohn / Schuenke, Christa: Die Zwillinge des Dr. Mengele. Der Arzt von Auschwitz und seiner Opfer. Reinbek 1994. Abbildungsteil letzte Seite (keine Bezifferung der Seiten). 845 Vgl. Kettelhake, Silke: Nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden«: Auschwitz, Fritz Bauer und die filmische Aufarbeitung. in: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 28 (2015). S. 306–313; Asher, Harvey: The Soviet Union, the Holocaust, and Auschwitz. in: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 4 (2003). Heft 4. S. 886–912; Michalczyk, John J.: Filming the end of the Holocaust. Allied documentaries, Nuremberg and the liberation of the concentration camps. London, UK, New York 2016, S. 45–63. 846 Vgl. Benz, Stefan: Die Befreiung von Auschwitz. Wahrheitskonstruktion im Unterrichtsfilm. in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 24 (2013). Heft 3. S. 103–137.
Das Auschwitz Memorial and Museum
153
gewählten Bilddokument handelt es sich aber nicht um ein historisches Dokument für den Tag der Befreiung, sondern vielmehr um einen Beleg dafür, dass das Bedürfnis nach authentischem fotografischen und filmischen Material über den Holocaust schon seit 1945 existiert. Die Fotografie muss aber für das Museum Auschwitz auf Facebook eine andere Funktion erfüllen: die Illustration der Befreiung des Lagers. Die Befriedigung des kollektiven Bedürfnisses nach Material, das Geschichte illustriert und der Erinnerung ein Bild gibt, wird offenbar vor geschichtswissenschaftliche und -didaktische Prinzipien gesetzt. Eine Analyse der Kommentare der Nutzer*innen zu diesem Beitrag zeigt, dass die dominant eingenommene Diskursposition die der Verurteilung der Verbrechen und der fortwährenden Wiederholung in »Nie Wieder«-Appellen ist. Denn der Großteil der Kommentare unter dem Originalpost sind kurz und beinhalten auf der intratextuellen wortorientierten Analyseebene die Schlüsselwörter never (237x)847, remember (52x)848, sad (62x)849 und bless (45x)850. Bevor hier die Kategorie von Erinnerungsbeiträgen mit historischen Dokumenten und Gegenständen beleuchtet wird, soll der Blick noch auf eine spezielle Kategorie von historischen Fotografien gerichtet werden, die das Museum Auschwitz veröffentlicht hat und die von den Nutzer*innen ebenfalls breit wahrgenommen werden. Gemeint sind Luftaufnahmen des Vernichtungslagers Auschwitz, die von der Royal Air Force v. a. ab 1944 gemacht worden waren. Das Museum hat inklusive 2015 acht solcher Fotografien einmal oder mehrmals im Rahmen von Erinnerungsbeiträgen veröffentlicht. Eine Fotografie vom 31. Mai 1944 wurde am gleichen Datum 2013 (484 L, 261 T, 56 K)851 veröffentlicht und zeigt Auschwitz III (Monowitz). Eine weitere am selben Tag aufgenommene Fotografie wurde am 1. Juni 2014 (877 L, 284 T, 57 K)852 gepostet und zeigt Auschwitz II (Birkenau). Diese Fotografien stehen in den meisten Fällen zeitlich in direktem Bezug zum Text der Beiträge, wie auch im Falle der letztgenannten Fotografie vom 31. Mai 1944. Das Museum wählt auf der intratextuellen textorientierten Analyseebene ein Vertextungsmuster, bei dem im ersten Teil ein 847 »Never forget…«; »Never let it happen again!«; »Oh God! RIP! Never again…. Wake up world for Humanity!!!!! Stop killing innocent people!!!!«. http://on.fb.me/1PpmS2o. (Zugriff am 12. 1. 2016). 848 »God has a special place for them ! Bless , honor, remember them.«; »Painful rememberance«; »We must always remember the terrible suffering and immense bravery of those who suffered the horrors of these concentration camps.« http://on.fb.me/1PpmS2o. (Zugriff am 12. 1. 2016). 849 »So sad.«; »Sad sad sad«; »So sad all those poor precious children too ! ;-(». http://on.fb.me /1PpmS2o. (Zugriff am 12. 1. 2016). 850 »My thought are with dead and living let us never fotget. God bless«; »Blessed day, I will never forget.«; »God bless one and all we will never forget, and thank you for are freedom Amen XXX«. http://on.fb.me/1PpmS2o (Zugriff am 12. 1. 2016). 851 http://on.fb.me/1l5Nn4Q (Zugriff am 13. 1. 2016). 852 http://on.fb.me/2008xRz (Zugriff am 13. 1. 2016).
154
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Ausschnitt aus den Aufzeichnungen des Überlebenden Wacław Maliszewski veröffentlicht wird, der Szenen im Lager vor der Ermordung von Menschen durch Gas beschreibt, ohne dass eine konkrete Zeitangabe gemacht wird.853 Im zweiten Teil des Beitrags werden konkrete Opferzahlen vom 1. Juni 1944 genannt.854 Als ein zweites Beispiel kann eine Fotografie vom 13. September dienen, die am gleichen Tag 2012 (520 L, 505 T, 64 K)855 und 2013 (15 L, 12 T, 2 K)856 veröffentlicht worden war und Auschwitz-Birkenau zeigt. Im Beitrag von 2012 berichtet das Museum auf Englisch und Polnisch über eine Bombardierung von Auschwitz am selben Tag im Jahr 1944.857 Diese Beiträge mit historischen Luftaufnahmen sind vielfach von Nutzer*innen kommentiert worden, wie ein weiterer Beitrag vom 21. Dezember 2014 (1001 L, 393 T, 48 K)858 exemplarisch illustrieren kann, der eine Fotografie abbildet, die am gleichen Datum im Jahr 1944 aufgenommen wurde und die Auschwitz II (Birkenau) zeigt. Der Text zum Beitrag des Museums beschreibt die Zustände im Lager kurz vor der Befreiung, wie sie in Teilen auch auf der Fotografie zu erkennen sind (Abbildung 9).859 Eine 853 »[…] Sometimes we worked near the people who were let to the crematorium. Once, when I saw the crowd waiting for being directed in the direction of gas chambers, I asked my two helpers – Hungarian Jews – to explain their people what fate actually awaits them. With interest I watched their faces during this conversation. I saw how they began to argue, but of course I did not understand anything. After a while my companions resignedly waved their hands and came back. When asked about the result of their conversation, they said that those people did not want to believe in what they said, claiming that, after all, if ›you are alive, we can certainly exist in the camp‹.[…]«. http://on.fb.me/2008xRz (Zugriff am 13. 1. 2016). 854 »On June 1, 1944 four trains with Jews deported from Hungary to Auschwitz crossed the border in Kosˇice, with: 3,299 Jews from Mátészalka, 3,421 from Kisvárda, 3,059 from Nagyvárad (Oradea) and 2,615 from Szatmárnémeti (Satu-Mare) – all together 12394 people. On that day 26 Jews selected from the transports from Hungary were registered in the camp. A group of young, healthy people were kept in the camp as the so-called deposit. Remaining people were murdered in the gas chambers.« http://on.fb.me/2008xRz (Zugriff am 13. 1. 2016). 855 http://on.fb.me/1Si7zim (Zugriff am 13. 1. 2016). 856 http://on.fb.me/1OP2M5y (Zugriff am 13. 1. 2016). 857 »On 13 September 1944 IG Farbenindustrie chemical plant was bombed for thirteen minutes. Few bombs fell on the area of Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau camps. Over 40 prisoners and 15 SS men died because of the air raid. Many were wounded. In Birkenau bombs damaged the railroad embankment and the connecting track to the crematoria. At the chemical plant bombs destroyed many damages and approximately 300 people were killed, among them many prisoners who worked there. During the air raid, aerial photographs were made where Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau camps are visible, including gas chambers and crematoria.[…]«. http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 858 http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 859 »On December 21, 1944 the American aerial reconnaissance took pictures of Auschwitz IIBirkenau camp. The camp was getting ready to evacuation. The fences and guard towers which surrounded the former BIII sector were removed. The building of the crematorium and gas chamber II had the covers of the gas chamber and undressing room as well as the chimney and the roof of the crematorium hall taken down. The fences of the crematoria II and III were already dismantled.« http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
155
Analyse der Nutzer*innenkommentare ergibt auf der intratextuellen wortorientierten Analyseebene die Schlüsselwörter never (20x)860, horror (4x)861 und evil (3x)862. Neben den schon bekannten Kommentaren des Entsetzens existieren ebenfalls auch hier Beiträge von Nutzer*innen, die auf Überlebende in der eigenen Familiengeschichte Bezug nehmen.863 Eine weitere Kategorie von Erinnerungsbeiträgen sind diejenigen, die historische Dokumente und Gegenstände abbilden. Insgesamt hat das Museum Auschwitz bis einschließlich 2015 24 Abbildungen mit einem oder mehreren für die Lagergeschichte zentralen historischen Gegenständen veröffentlicht. Es handelt sich dabei um sehr unterschiedliche Sachquellen, die im Rahmen von Erinnerungsbeiträgen (in Abbildungen) veröffentlicht werden, wie Häftlingskleidung am 14. April 2015 (2209 L, 336 T, 73 K)864, ein Tätowierstempel für die Häftlingsnummern am 11. März 2014 (426 L, 256 T, 47 K)865, Prothesen von Häftlingen am 15. Dezember 2013 (539 L, 202 T, 39 K)866, medizinische Instrumente am 17. Januar 2011 (9 L, 4 T, 9 K)867 oder eine Spritze, die für tödliche Phenolinjektionen benutzt worden war. Die Abbildung der Spritze kann exemplarisch illustrieren, wie sich diese Abbildungen von historischen Gegenständen in die Funktion der Erinnerungsbeiträge einfügen. Denn die Beiträge des Mu860 Beispiele: »Never forget! These days more then ever.«; »This is how hell looks like. I have lost people who could be my grandpsrents, my cousins and more…what a crule destination. Never Forget Nor forgive!!!«; »Auschwitz a lesson of cruelty should nevef be forgotten. What a human being can do to another one.Never more.« http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 861 Beispiele: »One thing they could never cover up and hide, the smell of burned bodies. That is one horror you cant escape or hide«; »I agree Dan as we visited other camps none paled in comparison you felt the horror that place delivered – Poland kept history alive by not destroying the camp or even the ghetto – I tell everyone to visit Poland to get a lifetime experience«; »Anyone who has the opportunity to visit Auschwitz in person, should do so. Seeing it only through pictures doesn’t convey the magnitude and horror of this place. I still vividly remember my visit in May 2011. To visit in person is very moving and humbling. Never forget.« http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 862 Beispiele: »Evil«;»write and about the other death camps, they was same evil places«; »These atrocities are still going on in lesser numbers. Auschwitz and other camps should be remembered as the brain child of an evil and mad man. Read ›Night‹ and other books by a man who was taken there as a child and was eventually liberated looking like an old man. This man’s name is Elie Wiesel.« http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 863 »On this day, 21 December, 1944, out of a family consisting of 70+ souls to arrive In Auschwitz on 16 August, 1944, my aunt, Bouli Hasson, was the only family member left alive in Auschwitz. She succumbed on 17 January, 1945, during the evacuation death march, when she could no longer carry on! May all their souls rest in peace!«. http://on.fb.me/1ZtkXob (Zugriff am 13. 1. 2016). 864 http://on.fb.me/1l5UNot (Zugriff am 13. 1. 2016). 865 http://on.fb.me/1KcZgfK (Zugriff am 13. 1. 2016). 866 http://on.fb.me/1W7haaH (Zugriff am 13. 1. 2016). 867 http://on.fb.me/1RM3LUX (Zugriff am 13. 1. 2016).
156
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Abbildung 9: Erinnerungsbeitrag vom 21. Dezember 2014 mit einer Luftaufnahme von Auschwitz des gleichen Datums 1944
seums, die diese Spritze zeigen, haben im Zentrum der Themenentfaltung auf der intratextuellen textorientierte Analyseebenen nicht den Gegenstand als solchen, sondern andere historische Ereignisse der Lagergeschichte, wie der Beitrag vom 23. Februar 2014 (297 L, 248 T, 79 K)868, der an die Ermordung von 39 männlichen Häftlingen im Alter von 13 bis 17 Jahren durch Phenolinjektionen am selben Datum im Jahr 1943 erinnert, oder wie der Beitrag vom 9. Dezember 2014 (605 L, 162 T, 60 K)869, der an die Ermordung von 67 Häftlingen mit der gleichen Methode erinnert. Weitere historische Gegenstände, die in verschiedenen Abbildungen erscheinen, sind Dosen mit Zyklon B. In manchen Fällen ist eine Abbildung einer solchen Dose ohne weiteren inhaltlichen Kommentar veröffentlicht worden, wie am 19. August (73 L, 24 T, 12 K)870 oder am 18. September 2013 (47 L, 16 T, 7 K)871. Im Rahmen von Erinnerungsbeiträgen wird dieser Gegenstand aber ebenfalls eingesetzt, wie im Beitrag vom 3. September 2011 (400 L, 1313 T, 158 K)872 (Abbildung 10). Der Text873 informiert kurz auf Englisch und Polnisch in einem 868 869 870 871 872 873
http://on.fb.me/1JKBblI (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1P0VvSc (Zugriff am 13. 1. 2016). http://short4u.de/56967d16774e6 (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1Oie5lc (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). »Most probably on 3 September 1941, the first mass attempt of killing people with Zyklon B gas took place in the Auschwitz I camp. Around 850 people were murdered. Right after the evening roll-call in 28 cells in the cellars of block 11 (at that time block 13) Germans locked around 600 Soviet POWs and 250 sick Polish prisoners selected from camp hospital. In the volume of Voices of Memory about history of crematories and gas chambers in the
Das Auschwitz Memorial and Museum
157
Abbildung 10: Erinnerungsbeitrag vom 3. September 2011 mit einer Dose Zyklon B
ersten Teil darüber, dass am gleichen Datum vor 70 Jahren in Auschwitz vermutlich der erste Versuch durchgeführt worden war, eine große Anzahl von Menschen mit Zyklon B zu töten, wobei ca. 850 Menschen umgebracht worden waren. In einem zweiten Abschnitt wird aus einem Bericht des Historikers Piotr Setkiewicz zitiert, der hier anscheinend als Pseudozeitzeuge fungieren soll. Eine wortorientierte Analyse der Schlüsselbegriffe der Nutzer*innenkommentare ergibt das bekannte Ergebnis: Never (27x),874 sharing (3x)875 und horror (3x)876. Es existieren hier auch spannende Einzelkommentare: zum einen der bereits bekannte Verweis auf die eigene Familiengeschichte als Diskursposition auf der Ebene der Diskushandlungen, wie im Falle von Tani Neumann877. Auf diesen Erinnerungsbeitrag antwortete das Museum auch einmal auf eine Nachfrage
874 875 876 877
Auschwitz camp, Dr. Piotr Setkiewicz, the head of the Research Department wrote: ›…about 600 Soviet POWs and 250 patients from the hospital were taken to the cellars of Block 11 on orders from camp director SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch, after which pellets of Zyklon B, a preparation used previously in the camp for sanitation purposes (pest control), were poured through the cellar windows. The windows were covered with earth. The following day, after determining that some of the POWs and prisoners were still betraying signs of life, the SS men poured in another dose of gas and succeeded in raising its concentration to lethal levels. This was the first occasion on which the crematorium furnaces proved incapable of burning such large numbers of corpses. Some bodies were stored for several days in the morgue room, while other corpses were most probably buried in a mass grave.‹«. http://on.fb. me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). Beispiele: »Never forget«; »Never Again!«; »Them poor men,women & children never forgotten x«. http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). Beispiele: »sharing thanks.«; »Sharing« http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). »Que Horror…«; »Que espanto, que horror, Gaby !«. http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016).
158
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
einer Nutzerin und trat hier direkt in Interaktion mit der Diskursgemeinschaft, was vom Museum auf Facebook nur selten vollzogen wird. Denn Teresa Anne Stockroske fragte am 3. September 2011: »Is that one of the gas cannisters they would throw in the showers?«878. Das Museum Auschwitz antwortete: »@Teresa: fake showers existed only in crematories II and III but the gas was thrown there through special ›injection‹ columns. Showers were installed to lie to the victims, but they were not used in the gassing process.«879 Neben historischen Gegenständen veröffentlicht das Museum auch verschiedene historische Dokumente zur Lagergeschichte. Insgesamt hat das Museum bis einschließlich 2015 vor allem Zeichnungen von ehemaligen Häftlingen und administrative und andere Dokumente aus Akten des ehemaligen Lagers einmal oder mehrfach veröffentlicht. Insgesamt wurden 13 Zeichnungen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Kinderzeichnungen, wie in einem Beitrag vom 7. Januar 2014 (15 L, 4 T)880, farbige Ölgemälde, wie das am 5. Dezember 2014 (2248 L, 394 T, 68 K)881 veröffentlichte Bild des ehemaligen Häftlings David Olère, oder Tuschezeichnungen, wie das am 7. Januar 2014 (15 L, 4 T)882 veröffentlichte Bild des ehemaligen U.S. Army Lieutenant Clifford Hensel, der bei der Befreiung verschiedener Lager beteiligt war. Die meisten veröffentlichten Zeichnungen sind allerdings Bleistiftzeichnungen, die entweder »realitätsnah« angelegt sind, wie die am 24. November 2009 (149 L, 16 T, 16 K)883 veröffentlichte Zeichnung des ehemaligen Häftlings Mieczysław Kos´cielniak, oder die in surrealistischer Tendenz versuchen, das Grauen von Auschwitz abstrakt abzubilden, wie die am 16. Oktober 2009 (11 L)884 gepostete Zeichnung des Auschwitzüberlebenden Marian Kolodziej. Das Museum Auschwitz nutzt seinen Facebookkanal ebenfalls dazu, um verschiedene v. a. administrative Dokumente aus Akten des ehemaligen Lagers zu veröffentlichen. Insgesamt wurden bis einschließlich 2015 16 historische Dokumente verschiedenster Art in Abbildungen einmal oder mehrfach vom Museum veröffentlicht. Darunter sind Personaldokumente, wie der Befehl der Versetzung des SS-Arztes Josef Mengele nach Auschwitz in einem Beitrag vom 24. Mai 2014 (574 L, 175 T, 54 K)885, ein Protokoll eines Exekutionskommandos in Beiträgen vom 22. November 2010 (140 K, 130 T, 53 K)886 und 2014887, ein Poli878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1OierrY (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1N7HvhZ (Zugriff am 13. 1. 2016). http://on.fb.me/1l99bfW (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1Zmb06F (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1Sg15kl (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1Zmb06F (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1ZwSwpi (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1P2qygi (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1RnlCTx (Zugriff am 14. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
159
zeibericht nach einem Ausbruchsversuch von Häftlingen in Beiträgen vom 7. Oktober 2011 (414 L, 500 T, 77 K)888 und 2013 (41 L, 46 T, 2 K)889, ein Bericht über die Anweisung der Überstellung von Leichen aus Auschwitz III in Beiträgen vom 4. Januar 2011 (286 l, 174 T, 64 K)890 und 2013 (30 L, 20 T, 7 K)891, ein Report über die Fertigstellung der Krematorien in einem Beitrag vom 29. Juni 2012 (192 L, 103 T , 55 K)892 oder ein Protokoll einer Selektion in Auschwitz in einem Beitrag vom 19. November 2009 (67 L, 2 T, 20 K)893. Auch diese Erinnerungsbeiträge werden von Nutzer*innen kommentiert, wie die u. a. am 21. Oktober 2009 (230 L, 363 T, 95 K)894 veröffentlichte Abbildung einer Fahrgenehmigung eines 5 t-LKWs zur Abholung von »Material für die jüdische Wiederansiedlung« aus der Fabrik in Dessau, in der u. a. das Gas Zyklon B produziert worden war. Auffällig ist bei den Kommentaren zu diesen Erinnerungsbeiträgen, dass auf der Ebene der Diskurshandlungen viele Nutzer*innen eine Position einnehmen, in der sie die »Like«-Funktion diskutieren, wie zum Beispiel Chad Harris, der schrieb: »Hopefully the ›Likes‹ are simply people saying they like that the information is getting out, since so much Holocaust denial still exists.«895; oder Piotr Szlagor mit seinem Kommentar: »The ›Like‹ button reffers to the mission, which the Auschwitz Museum carries not to the things that were happening there over 60 years ago.«896 Es existieren noch weitere Kommentare ähnlicher Natur.897 Das Museum Auschwitz nimmt seine Interaktionsrolle als Autor des Beitrags und Administrator der Seite schließlich war und bezieht Stellung zu diesem Punkt: Thank you very much for this discussion. It has already been in another thread as it was pointed out. We are aware of fb [Facebook] ›linguistic‹ system that do not exactly match such pages and we hope to change it. We treat this ›like‹ system as a proof that one finds
888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
http://on.fb.me/1PtbClz (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1nkLy5Q (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1TXjcIZ (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1n1xCO5 (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1KfgpWg (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1RnuGaY (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1nkT5Bm (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1nkT5Bm (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1nkT5Bm (Zugriff am 14. 1. 2016). Weitere Beispiele: »Chad et al. – the site speaks to this issue. They point out that »like« means you like the website, not the actual place.«; »Ok, thats logical.. but i still cant press the Like button anyway.. im glad, that this page exists a lot of people really dont believe something like this happened.. and its a shame i see a lot of them in our city.. i hope they will get brains someday..«; »Of course that is the reason why people like it. I wouldn’t believe anyone could be so ignoble as to join a memorial group that they plan to mock by ›liking‹ it’s posts.« http ://on.fb.me/1nkT5Bm (Zugriff am 14. 1. 2016).
160
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
the information we publish important and valuable in terms of the historical knowledge. Pawel Sawicki Auschwitz Memorial898
Die Kennzeichnung der Autor*innenschaft des Beitrags stellt eine Ausnahme dar. Insgesamt hat das Museum dieses Stellungnehmen zu verschiedenen Themen in Reaktion auf Nutzer*innenkommentare v. a. im ersten Jahr seiner SocialMedia-Aktivitäten auf Facebook sporadisch praktiziert, während in späteren Jahren offenbar die Strategie verändert worden war, da man in der Interaktion mit Nutzer*innen auf Facebook erheblich zurückhaltender geworden ist. Eine weitere Kategorie von Erinnerungsbeiträgen mit Abbildungen sind Fotografien, die das Lager in einer historischen Perspektive ohne Personen (oder nur marginal im Hintergrund) zeigen, also v. a. Gebäudekomplexe, Gebäude oder Teile von Gebäuden in einer Innen- oder Außenansicht präsentieren. Diese Art von Beiträgen machen mit sechs Motiven nur einen sehr geringen Anteil aus und zeigen den Nutzer*innen die Krematorien nach ihrer Sprengung in einem Post vom 12. Januar 2011 (188 L, 1T, 17 K)899, bei dem im Text auch Überlebende der Sonderkommandos zu Wort kommen. Ein weiteres Beispiel ist eine Fotografie der Krematorien von Auschwitz in einem Beitrag mit deutschem Text vom 5. März 2014 (48 L, 31 T, 11 K)900. Der geringen Zahl von historischen Fotografien der Lagergebäude steht eine große Zahl von Beiträgen gegenüber, die das Lager ohne Personen in aktuellen Fotografien zeigen. Bis einschließlich 2015 hat das Museum 235 solcher Fotografie veröffentlicht. Diese Fotografien zeigen das Innere von Gebäuden, wie die eigene Dauerausstellung in einem Beitrag vom 26. Februar 2014 (845 L, 90 T, 64 K)901, Sonderausstellungen, wie in einem Beitrag vom 10. März 2015 (974 L, 129 T, 37 K)902, oder die Krematorienöfen, wie in Beiträgen vom 1. Februar 2015 (2190 L, 447 T, 143 K)903 und vom 27. Oktober 2010 (27 L, 1 T, 23 K)904. In Außenansichten wird das ehemalige Lager ebenfalls gezeigt, wie in einem Beitrag am 12. August 2014 (1602 L, 167 T, 52 K)905, der Ruinen von Baracken und einen Stacheldrahtzaun abbildet. Diese Beiträge haben häufig entweder keine oder nur sehr kurze Texte, die das Abgebildete benennen, wie bei einem Beitrag vom 5. August 2015 (960 L, 242 T, 60
898 899 900 901 902 903 904 905
http://on.fb.me/1nkT5Bm (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1ZxlbdW (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1Q05CDU (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1n9CMah (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1l9RRaH (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1SQ39yr (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1PGU9hg (Zugriff am 14. 1. 2016). http://on.fb.me/1l9TC7z (Zugriff am 14. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
161
K)906, der Baracken von innen zeigt. Interessant sind für diese Studie im engeren Sinne zum einen die Erinnerungsbeiträge, für die aktuellen Fotografien dieser Art verwenden werden. Teilweise wird vom Museum die gleiche Fotografie für unterschiedliche Ereignisse eingesetzt, wie in den Beiträgen vom 27. Mai 2015 (1594 L, 359 T, 137 K)907 und vom 13. Februar 2015 (1258 L, 207 T, 90 K)908, die beide die gleiche Abbildung der Hinrichtungsmauer von Auschwitz im Hof von Block 11 zeigen und im Text an SS-Erschießungsaktionen am jeweiligen Datum erinnern. Strukturell unterscheiden sich die Erinnerungsbeiträge mit aktuellen Fotografien allerdings in keinerlei Hinsicht nicht von den oben breit dargestellten mit historischen Fotografien. Zum anderen ist für diese Studie interessant, wie das Museum Nutzer*innen für diese Fotografien einbindet. Denn die meisten Aufnahmen dieser Art sind nicht vom Museum Auschwitz selbst gemacht, sondern von Besucher*innen fotografiert und dann vom Museum nur veröffentlicht worden. Hierfür hat das Museum auch eine eigene Gallery eingerichtet.909 Die meisten hier präsentierten Bilder zeigen das ehemalige Vernichtungslager in seinem heutigen Zustand ohne Personen910. In seinen Guidelines911 zu diesen Fotografien fordert das Museum Nutzer*innen auf, Bilder per Mail einzusenden. Das Museum wählt dann Fotografien aus und publiziert jede Woche einige davon. Auffällig ist bei den in dieser Gallery hochgeladenen Fotografien, dass sie alle aufgrund von Motiv, Perspektive und digitalem Fotofilter eine gewisse fotografisch-künstlerische Ästhetik aufweisen.912 Als Beispiel hierfür kann die Fotografie von Solange Lalonde dienen, die am 8. März 2014 (716 L, 112 T, 23 K)913 veröffentlicht wurde und die die Wachtürme von Auschwitz II zeigt; oder die Fotografie von Tom Brewer (Abbildung 11), die am 20. März 2012 (393 L, 82 T, 41 K)914 online gestellt wurde und die vom zentralen Turm von Auschwitz II fotografiert worden ist. Eine Analyse der Nutzer*innenkommentare zeigt, dass die 906 »Bunk beds for prisoners inside a wooden barracks in Auschwitz II-Birkenau camp. / Prycze wie˛z´niarskie wewna˛trz drewnianego baraku w Auschwitz II-Birkenau.« http://on.fb.me/1P df6Za (Zugriff am 14. 1. 2016). 907 http://on.fb.me/1P2DVx5 (Zugriff am 14. 1. 2016). 908 http://on.fb.me/1J52d7e (Zugriff am 14. 1. 2016). 909 http://on.fb.me/1la0nX7 (Zugriff am 14. 1. 2016). 910 Teilweise sind Personen im Hintergrund oder am Rande der Fotografie Menschen zu sehen. Im Zentrum der Fotografien stehen jedoch historische Orte, Gebäude und Plätze und nicht Personen. 911 http://on.fb.me/1la0nX7 (Zugriff am 14. 1. 2016). 912 Vgl. Lundrigan, Meghan: #Holocaust #Auschwitz. in: Gigliotti, Simone / Earl, Hilary Camille (Hrsg.): The Wiley Blackwell companion to the Holocaust. Chichester 2020. S. 639–655, hier S. 646–649; Lundrigan, Meghan: Holocaust Memory and Visuality in the Age of Social Media. Ottawa 2019. S. 172–175. 913 https://bit.ly/2GXbGPm (Zugriff am 14. 1. 2016). 914 http://on.fb.me/1P2GTS4 (Zugriff am 14. 1. 2016).
162
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Kontroversität zwischen ästhetischer Fotografie und Motiv kaum insgesamt thematisiert wird. Die meisten Kommentare nehmen auf der Ebene der Diskurshandlungen eine Diskursposition ein, die Bewunderung ausdrückt in Kommentaren wie »Amazing photo«, »incredible picture«, »fantastic photo« oder »Outstanding!«.915 Kritische Kommentare, wie von Mary Anne Gunter916 , bleiben die Ausnahme.
Abbildung 11: Fotografie des Besuchers Tom Brewer vom 20. März 2012
Eine große Anzahl von Fotografien veröffentlicht das Museum zudem von verschiedensten Gedenkveranstaltungen, die vielfach jährlich auf dem ehemaligen Lagergelände stattfinden. Insgesamt wurden 410 solcher Fotografien publiziert. Viele dieser Beiträge haben jedoch ebenfalls keine oder nur kurze Texte, die das abgebildete Geschehen kurz benennen, wie der Beitrag vom Besuch des Governor General of Canada, David Lloyd Johnston, am 26. Oktober 2014 (1690 L, 152 T, 27 K)917 oder vom March of the Living 2013 am 8. April 2013 (619 L, 185 T, 29 K)918, sodass diese Beiträge in der Phase der Datenerhebung zwar gesichtet worden sind, hier jedoch in Hinblick auf die Fragestellung dieser Studie keine ausführliche Darstellung einer diskursanalytischen Analyse vollzogen wird.
915 http://on.fb.me/1P2GTS4 (Zugriff am 14. 1. 2016). 916 »What is striking about this photograph is that, at first glance, it is in its way beautiful, in its lighting and weather. And then you realize, with dawning horror, that you are looking at the portal of hell. No joy ever happened on this platform; no peacefulness. No hope. Only families being separated from each other, many forever.« http://on.fb.me/1P2GTS4 (Zugriff am 14. 1. 2016). 917 »The Governor General of Canada David Lloyd Johnston visited the Auschwitz Memorial today.« http://on.fb.me/1ZxIzIl (Zugriff am 14. 1. 2016). 918 »The March of the Living started at the Auschwitz Memorial. Around 10,000 people, mostly young Jews from all around the world, are marching from Auschwitz I to Auschwitz IIBirkenau.« http://on.fb.me/231NLn7 (Zugriff am 14. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
163
Exemplarisch ausgewählt wurde allerdings der Beitrag zur große Gedenkveranstaltung anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz, der auf der Facebookseite des Museums mit Fotografien dokumentiert worden ist, wie mit einem Beitrag vom 27. Januar 2015 (3749 L, 223 T, 81 K)919, der auf einer Fotografie Witold Pilecki zeigt, wie er vor Publikum im Rahmen der Gedenkveranstaltung spricht. Eine wortorientierte Analyse der Nutzer*innenkommentare offenbart auf der intratextuellen Ebene die Schlüsselwörter never (21x)920, bless (5x)921, remember/pamie˛tamy (4x)922, sad (4x)923 und respect (3x)924, während die textorientierte Analyse zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare oft sehr kurz sind und nur wenige Worte beinhalten. Die meisten Kommentare drücken Trauer und Entsetzen aus, segnen die Opfer oder appellieren, Auschwitz zu gedenken und niemals zu vergessen. Demgegenüber existieren aber auch einige längere Kommentare, die aus mehreren Sätzen bestehen, wie der von Linda Lizotte925, in dem sie ihr Bedauern ausdrückt, dass vor und während des Zweiten Weltkriegs andere europäische Länder die flüchtenden Jüd*innen nicht aufgenommen hätten, der von Ryszard Morawski926, in dem er einige Fakten zur Person Witold Pilecki präsentiert und sein Bedauern ausdrückt, dass Pileckis Familie nicht zur Gedenkveranstaltung eingeladen worden 919 https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 14. 1. 2016). 920 Beispiele: »this world must learn from this never ever again rip to all those who died«; »Never and never forgotten. Praying God bless and protect the Jewish people«; »NEVER EVER AGAIN !!«. https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 921 Beispiele: »God bless the surviors.. who deserve much happiness in their later years!!«; »God bless everyone who died at their rotten hands may god let them rest in peace into eternity xxxxxx«; »Forever in our thoughts…God bless all those that lost their lifes to people who called themselfs human.« https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 922 Beispiele: »Always remembered x«; »We remember …«; »Pamie˛tamy!«. https://goo.gl/60Lb Y4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 923 Beispiele: »watched NIGHT WILL FALL so sad make stone cry«; »It’s so sad you can’t even hear a bird sing .god only knows why they keep it as a museum. THEY SHOULD BE ASHAMED«. https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 924 Beispiele: »All my respect for the victimis of those horrible murders. «heart»-Emoticon«; »Respect.«; »#Respect«. https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 925 »Hitler was a Sob but what about all the others who refused to let the Jews into their countries and give them refuge in their attempt to flee from death and persecution? I am ashamed of us all to sit by and allow this to be!«. https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 926 »This is thanks to Witold Pilecki World truth about Auschwitz. Witold Pilecki was a Polish soldier, a rittmeister of the Polish Cavalry. During World War II, he volunteered for a Polish resistance operation to get imprisoned in the Auschwitz concentration camp in order to gather intelligence and escape. As the author of Witold’s Report, the first intelligence report on Auschwitz concentration camp, Pilecki enabled the Polish government-in-exile to convince the Allies that the Holocaust was taking place.Witold Pilecki was xecuted in 1948 by the Stalinist secret police.Criminals responsible for the death of this Pilecki are Roman Romkowski born Natan Grünspan and Józef Róz˙an´ski born Josek Goldberg Rtm.Pilecki family was not invited to the celebration of 70th anniversary liberation of Auschwitz?« https://goo.gl /60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016).
164
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
sei, oder der Kommentar von Natalija Harbinson927, in dem sie eigene Bezüge zu ihrer jüdischen Großmutter herstellt. Wie eingangs dargestellt, beinhalten nach LikeAlyzer 45,8 % der Beiträge Bilder und 33,3 % Links, während 20,8 % reine Textbeiträge sind. Der FanPAGECheck liefert etwas abweichende Werte von 42 % Bildern, 32 % Links und 26 % reinen Textbeiträge. Die vom Museum Auschwitz veröffentlichten Links können auch Teil von Erinnerungsbeiträgen sein, wenn Verweise zum eigenen Internetauftritt per Link hergestellt werden. Das Museum veröffentlichte z. B. am 1. August 2015 (1707 L, 613 T, 56 K)928 einen Erinnerungsbeitrag anlässlich des Warschauer Aufstands im Sommer 1944 mit einem Link, der auf die eigene Website verweist. Im Text929 werden im üblichen, hier schon mehrfach vorgeführten und analysierten Stil, transtextuelle Bezüge zum historischen Kontext hergestellt, indem kurze Informationen zum Aufstand und zur Verbindung zur Lagergeschichte gegeben werden, nämlich dass im Verlaufe und nach dem Aufstand 500.000 Menschen in Lager deportiert worden waren, davon 13.000 nach Auschwitz.930 Ein anderer Link, der ebenfalls als Erinnerungsbeitrag fungiert, wurde am 14. Dezember 2014 (902 L, 297 T, 25 K)931 veröffentlicht und verweist auf die virtuelle Tour des Museums. Der Text zum Link erinnert an die Fertigstellung des Effektenlagers »Kanada« am gleichen Datum 1943. Daneben wird mit Links auch auf die anderen Social-Media-Kanäle des Museums verwiesen, wie auf Twitter am 25. September 2014 (43 L, 11 T, 1 K)932, auf Instagram am 27. November 2015 (863 L, 120 T, 29 K)933, auf Pinterest am 24. März 2014 (364 L, 66 T, 8 K)934 oder auf YouTube am 27. Dezember 2014 927 »Today I thought of the sadness that I never knew my maternal Croatian Jewish grandmother, Eva Bjelobrk, nor have a photo of her….but also of the incredible bravery of the Croatians that hid children like my mother & aunt. Please take two things to your heart: 1. Life is a gift, enjoy it…live it! 2. Tell your grandparents you love them, hug them close… for people like me …I was born in 1972, who didn’t have maternal grandparents to love«. https://goo.gl/60LbY4 (Zugriff am 18. 1. 2016). 928 http://on.fb.me/1OZbdLD (Zugriff am 18. 1. 2016). 929 »71 years ago, on August 1, 1944, the Uprising broke out in Warsaw. It lasted 63 days and was the largest single military effort taken by any European resistance movement during World War II. The story of the Uprising is inseparably entwined with the story of the German Nazi Auschwitz concentration camp. Both during the Uprising and after its suppression, Germans deported over 500 000 inhabitants from Warsaw as part of the repressive action. About 13 000 of those people, including babies, children and elderly people, were deported to Auschwitz. You can learn about these events in our online lesson ›From the uprising Warsaw to Auschwitz‹. http://lekcja.auschwitz.org/en_8_warszawa/story.html«. http://on.fb.me/1O ZbdLD (Zugriff am 18. 1. 2016). 930 Vgl. Borodziej, Włodzimierz: Der Warschauer Aufstand 1944. Frankfurt am Main 2004. 931 http://on.fb.me/1PAXHKx (Zugriff am 18. 1. 2016). 932 http://on.fb.me/1Jc0wFd (Zugriff am 18. 1. 2016). 933 http://on.fb.me/1ndy1wY (Zugriff am 18. 1. 2016). 934 http://on.fb.me/1U6nGwY (Zugriff am 18. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
165
(1619 L, 1044 T, 66 K)935. Zudem verweist das Museum Auschwitz mit Hilfe von Links auf Bücher des Museums zu speziellen Aspekten der Lagergeschichte, wie im Beitrag vom 30. Juni 2014 (429 L, 98 T, 17 K)936 auf eine Sammlung von Quellenmaterial zu den ersten Vernichtungsaktionen im Lager. Aber auch andere Publikationen des Museums werden verlinkt, wie im Beitrag vom 24. Januar 2014 (324 L, 73 T, 1 K)937 der Museums-Report 2013. Eine letzte häufig erscheinende Art von Verlinkungen sind Verweise auf für das Museum Auschwitz wichtige Zeitungsartikel. Beispielsweise verlinkte das Museum am 6. Februar 2015 (503 L, 11 T, 7 K)938 einen englischen Artikel, der aufgrund eines Beitrags des Museums einen Tag zuvor geändert werden musste, da Sobibor dort als »a Polish extermination camp« bezeichnet worden war. Eine letzte Kategorie von Beiträgen sind diejenigen ohne Fotografie, Abbildung oder Link. Diese haben jedoch auch die geringste Reichweite. Einige wenige dieser Posts sind Erinnerungsbeiträge ohne Abbildungen oder Links, wie ein Beitrag vom 22. Dezember 2015 (383 L, 56 T, 28K)939, der von einem gescheiterten Fluchtversuch von drei Gefangenen am gleichen Datum 1942 berichtet. Die Erinnerungsbeiträge, sich als reine Textbeiträge präsentieren, unterscheiden sich strukturell ebenfalls in keinerlei Hinsicht von Erinnerungsbeiträgen mit Abbildungen oder Links. In reinen Textbeiträgen wird auf Facebook v. a. über für das Museum Auschwitz wichtige Neuigkeiten berichtet, wie in einem Beitrag vom 27. Dezember 2011 (131 L, 20 T, 9 T)940 in dem darüber Auskunft gegeben wird, dass die französische Regierung ein Projekt der Auschwitz-Birkenau Foundation’s Perpetual Fund mit 120 Mio. € unterstützen wird. Es werden aber auch sehr profane Beiträge abgesetzt, in denen beispielsweise den Nutzer*innen ein frohes neues Jahr gewünscht und ihnen für die Aktivitäten auf der Facebookseite gedankt wird, wie am 31. 12. 2011 (257 L, 3 T, 37 K)941. Die Facebookseite bietet für Nutzer*innen auch die Möglichkeit, eigeninitiativ Beiträge direkt auf der Seite zu platzieren. Da diese Beiträge allerdings fast gar nicht von anderen Nutzer*innen oder vom Museum sichtbar zur Kenntnis genommen werden und der Schwerpunkt der Untersuchung primär auf den SocialMedia-Aktivitäten des Museums liegt, werden diese Beiträge nicht in die Untersuchung einfließen. Nutzer*innen kommentieren hier allerdings in vergleichbarer Weise, wie bei Beiträgen des Museums. 935 936 937 938 939 940 941
http://on.fb.me/1ndyCyG (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/1n9CMah (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/239GYI5 (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/1Km0gOP (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/1Q8QfZP (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/1PB0xPI (Zugriff am 18. 1. 2016). http://on.fb.me/1n6l2fO (Zugriff am 18. 1. 2016).
166
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Bevor die Datenerhebungen und -analysen der anderen Social-Media-Auftritte des Museums Auschwitz dargestellt und ausgewertet werden, soll hier in Form eines Zwischenfazits in Thesenform eine zusammenfassende Dateninterpretation der Datenerhebung und -analyse des Social-Media-Monitorings des Facebookseite des Museums Auschwitz erfolgen. Die Facebookseite des Museums Auschwitz ist eine diskursive Schnittstelle verschiedener Erinnerungsdiskurse zum Holocaust, die sich auch unter dem Begriff Kosmopolitisierung, vor allem aber als Amerikanisierung des Holocaust zusammenfassen lassen. Untersucht man die Facebookaktivitäten des Museums Auschwitz auf der transtextuellen Ebene, so wird deutlich, dass sich hier v. a. Erinnerungsmechanismen in diskurssemantischen Grundfiguren fortsetzen, die Teil einer Amerikanisierung des Holocaust sind. Am deutlichsten tritt dies bei den oben beschriebenen und analysierten Erinnerungsbeiträgen des Museums zum Vorschein. Das Museum Ausschwitz verfolgt hier eine Strategie, die Geschichte des Vernichtungslagers und des Holocaust stark an Biografien und Einzelschicksale rückzubinden. Rosenfeld hatte, wie oben gezeigt, die These aufgestellt, dass bei Erinnerungsmechanismen der Amerikanisierung des Holocaust deshalb vor allem in populärkulturellen Darstellungen des Holocaust Personen eine zentral Rolle einnehmen, die sowohl repräsentativ für Täter*innen, Opfer und Helden*innen stehen, um den unerträglichen Narrativen von Leid, Tod, Vernichtung und Schuld positive Bilder von Heldentum und Opferbereitschaft gegenüberzustellen und auf diese Weise die Menschheitsgeschichte wieder in ein moralisches Gleichgewicht zu bringen.942 Das Museum Auschwitz nutzt seine Facebookseite, um die Geschichte des Lagers in Erinnerungsbeiträgen durch Opfer- und Täterbiografien, historische Dokumente, Gegenstände und aktuelle Fotografien des Lagers zu erzählen. Dabei überwiegen auf der intratextuellen Ebene zwar »negative« Narrative von Leid, Tod und Vernichtung, wie oben exemplarisch gezeigt wurde. Demgegenüber stehen jedoch Erinnerungsbeiträge zu heldenhaften Taten Einzelner. Hier könnte in der Tendenz der Versuch erkennbar sein, die moralische Symmetrie der Menschheit943 durch diese positiv konnotierten Narrative auszugleichen, ohne dass dabei allerdings Verbrechen relativiert werden würden. Teil der Amerikanisierung des Holocaust ist nach Rosenberg, wie ebenfalls oben gezeigt, der Versuch, Lektionen aus dem Holocaust zu ziehen.944 Dies funktioniert einerseits über positive Held*innengeschichten, andererseits aber indirekt auch über den impliziten pädagogischen Anspruch der Facebookseite, den Schrecken des Holocaust abzubilden und zu vermitteln. Das Museum 942 Vgl. Rosenfeld 2011, S. 93. 943 »the moral symmetry of man« bei Rosenfeld 2011, S. 93. 944 Vgl. Rosenfeld 2011, S. 93.
Das Auschwitz Memorial and Museum
167
Auschwitz erreicht dies durch beinahe tägliche Beiträge, die die menschenverachtende, massenhafte Vernichtung in Auschwitz medienspezifisch diskursivnarrativ und visuell transportieren. Der darauf immer wieder von den Nutzer*innen vorgebrachte »Nie Wieder«-Appell kann verdeutlichen, dass dieser hergeleitete pädagogische Anspruch der Facebookseite sein Ziel bei den Nutzer*innen offenbar nicht verfehlt. Den historischen Biografien, Fotografien und Dokumenten über Leid und Vernichtung werden auch visuell ästhetische zeitgenössische Fotografien von Besucher*innen entgegengesetzt. Im Zuge dessen vollziehen sich auch diskursive Mechanismen, die Teil einer Kosmopolitisierung des Holocaust sind. Zum einen wird zumindest implizit die Universalisierung des moralischen Modells Holocaust pädagogisch vorangetrieben, der ihn zum globalen Bezugspunkt, zur weltweit verständlichen Chiffre für jedwede Form der Verletzung von Menschenrechten macht. Direkt wird der Holocaust vom Museum Auschwitz auf Facebook zwar nicht in dem Sinne universalisiert, dass er zu einem »universalen Container für Erinnerungen an unterschiedliche Opfer«945 gemacht wird, aber implizit wird das »Lehrstück Holocaust«946 mit »moralischen Ansprüchen bzw. d[em] normative[n] Ziel von Gewaltvermeidung«947 immer wieder vorgeführt, auch wenn dies vom Museum nicht explizit auf der intratextuellen Ebene formuliert wird. Eine Universalisierung des Holocaust in dem Sinne, dass er zum »Sinnbild für die Opfererfahrung schlechthin«948, zum »Modell für andere Opfergruppen«949, zum universellen Böse, zum Paradigma und Maß für alle folgenden Massenverbrechen und Völkermorde gemacht wird, ist nicht erkennbar. Jedoch findet in Ansätzen eine Legitimierung einer Politik für Demokratie und Menschenrechte satt. Der Holocaust wird aber durch die Facebookseite des Museums Auschwitz nicht auf eine Weise funktionalisiert, dass sich hier soziale oder ethnische Gruppen auf ihn berufen, um so Menschheitsverbrechen oder Diskriminierungserfahrungen Gehör zu verschaffen. Dieser Teilaspekt der Kosmopolitisierung des Holocaust findet auf der Facebookseite des Museums Auschwitz nicht in signifikantem Maße statt. Stattdessen wird in der Tendenz stärker die monströse Singularität des Holocaust herausgestellt. Auch die als Teil der Kosmopolitisierung begriffene Entortung des Holocaust ist nicht als Erinnerungsmechanismus auf der Facebookseite des Museums Auschwitz greifbar. Das Museum bemüht sich vielmehr deutlich durch eine Vielzahl von historischen Quellen aller Art, den konkreten historisch-geographischen Ort Auschwitz als Ort des Geschehens im virtuellen
945 946 947 948 949
Levy / Sznaider 2001, S. 223. Wirsching 2012, S. 9–14. Arenhövel 2002, S. 23. Vgl. Eckel / Moisel 2008, S. 21. Droit 2015, S. 133.
168
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Raum sichtbar zu machen und so dieser Entortung und universellen Funktionalisierung entgegenzuwirken. Als weitere These kann formuliert werden, dass die Vermittlung der Geschichte des Vernichtungslagers Auschwitz und des Holocaust auf der Facebookseite Museum Auschwitz stark geprägt ist von der Materialität des Erinnerungsmediums Facebook. Auf der materialen Dimension dieses Mediums des kollektiven Gedächtnisses nutzt das Museum Auschwitz alle hypermedialen und interaktiven Möglichkeiten, um mit Texten, verschiedensten Fotografien, Abbildungen von historischen Dokumenten und Gegenständen aller Art, die Geschichte des Vernichtungslagers zu erzählen und an den Holocaust zu erinnern. Die Analyse der Ebene der Diskurshandlungen zeigt, dass das Museum als Administrator aktiv die Rolle des Textproduzenten einnimmt, jedoch nur in Ausnahmefällen auf antwortende Kommentare von Nutzer*innen reagiert. Die interaktive Dimension des Mediums wird insoweit wahrgenommen, dass Nutzer*innen – typisch für Web. 2.0 und Social Media – auch zu Textproduzent*innen werden, die Kommentare des Museums liken, kommentieren und teilen und auch Kommentare von anderen Nutzer*innen gegenseitig liken. Darüber hinaus findet aber kaum kommunikative Interaktion zwischen den Nutzer*innen statt. Ausführliche, differenzierte Auseinandersetzungen in Form von längeren Kommentaren oder Debatten werden nicht signifikant vollzogen, auch wenn das Medium hierfür große Potenziale bietet. Der medienspezifische Einfluss der Materialität des Erinnerungsmediums zeigt sich v. a. auf der sozialen Dimension des Mediums des kollektiven Gedächtnisses, also in der Art und Weise, wie das Medium konkret institutionalisiert und funktionalisiert wird. Die diskursanalytische Mehrebenenanalyse hat v. a. auf der intratextuellen Ebene gezeigt, dass das Museum seine Erinnerungsbeiträge immer in sehr wenigen und kurzen Sätzen formuliert und dabei eine Strategie der Themenentfaltung anwendet, die sich in wenigen Fakten transtextuell auf ein konkretes Ereignis aus der Lagergeschichte bezieht, das sich an dem Tag jährt, an dem der Beitrag abgesetzt wurde. Die mit den Schlüsselwörtern der Beiträge transtextuell aufgerufenen (historischen) Konzepte und Bedeutungszusammenhänge werden nicht vertiefend erklärt. Leitend ist hier intratextuell immer das Prinzip der Kürze, nicht das der didaktischen Vermittlung. Nutzer*innen sollen in kurzen Texten annähernd täglich ein historisches Update über das historische Geschehen im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz erhalten. Die Hürden bei der Rezeption sollen dabei offensichtlich so gering wie möglich sein, um eine größtmögliche Gruppe von Nutzer*innen zu erreichen. Um die Reichweite der Beiträge weiter zu erhöhen, werden diese oftmals mit historischen oder zeitgenössischen Fotografien versehen, die nicht immer einen direkten Bezug zum Erinnerungsbeitrag haben. Vereinzelt ist dabei
Das Auschwitz Memorial and Museum
169
die Tendenz zu erkennen, dass Illustration und vermeintliche Authentizität vor Transparenz und historischer Korrektheit stehen. Die nicht flächendeckende, sondern exemplarische diskursanalytische Untersuchung der Nutzer*innenreaktionen hat gezeigt, dass die kommunikative Spezifik des Trägermediums einen direkten und deutlichen Effekt auf die Antworten hat. Die Analyse auf der intratextuellen Ebene hat offenbart, dass die Antworten in der Überzahl aus kurzen Kommentaren bestehen, die, je nach Inhalt des Ursprungsbeitrags, Trauer, Entsetzen oder Bewunderung ausdrücken, häufig zum Erinnern aufrufen oder Mahnen, dass Verbrechen dieser Art in Zukunft verhindert werden müssen. Medienspezifische Emoticons werden zwar eingesetzt, um Emotionen auszudrücken, jedoch nicht in einem auffälligen Übermaß. Zudem treten mit signifikanter Häufigkeit Kommentare auf, die Bezüge zur eigenen Familiengeschichte herstellen. Dieses Phänomen lässt sich jedoch nicht zuallererst durch die Materialität des Mediums in materiell-medialer Hinsicht erklären, auch wenn die mediale Struktur es ermöglicht, Bezüge dieser Art vergleichsweise einfach öffentlich herzustellen. Dennoch liegt die Erklärung vermutlich stärker in der Materialität des Mediums in sozial-kommunikativer Hinsicht: Denn man kann mit guten Gründen vermuten, dass diese Nutzer*innenaktivitäten insgesamt auch Teil eines Identitätsmanagements sind, indem die Erinnerung an und die diskursive Positionierung zum Holocaust Teil einer digitalen Identität innerhalb der Social Media werden. Diese Thesen dienen nun als Arbeitsgrundlage für das Monitoring der SocialMedia-Kanäle des Museums Auschwitz auf Twitter, Pinterest und Instagram. 3.1.2.2. Das Museum Auschwitz auf Twitter Der Twitterkanal @AuschwitzMuseum950 existiert seit Mai 2012 und hat heute 15.893 Follower*innen und damit nur 7 % der Reichweite des Facebookkanals des Museums. Daher ist die folgende Darstellung, Auswertung und Interpretation der Datenerhebung und -analyse des Twitterkanals des Museums Auschwitz v. a. auf signifikante Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich zu den Ergebnissen des Monitorings der Facebookseite des Museums fokussiert. Aufgrund der Ausrichtung dieser Studie werden auch hier die Tweets nicht ins Monitoring einbezogen, die Nutzer*innen eigeninitiativ an den Twitteraccount gerichtet haben. Das Museum Auschwitz hat seit der Gründung seines Twitterprofils bis einschließlich Dezember 2015 8.132 Tweets auf seiner Seite veröffentlicht.951 Die 950 Auschwitz-Birkenau State Museum: Twitterprofil Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum). URL: https://twitter.com/AuschwitzMuseum (Zugriff am 20. 1. 2016). 951 Im Monitoring werden äquivalent zum Monitoring der Facebookpräsenz alle Tweets bis einschließlich 31. 12. 2015 betrachtet, wenn nichts anderes angegeben wird.
170
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Phase der Datenerhebung des Twitterkanals des Museums ist im Januar 2016 erfolgt.952 Sowohl in Bezug auf die Anlässe für Tweets als auch auf die Gestaltung, existieren Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich zum Gebrauch von Facebook durch das Museum Auschwitz. Letztere lassen sich v. a. durch mediale Eigenheiten des Mediums sowohl auf der materialen als auch auf der sozialen Dimension erklären. Twitter wird vom Museum Auschwitz ebenfalls v. a. dazu genutzt, um Erinnerungsbeiträge als Tweets zu veröffentlichen. Es existiert aber nicht zu jedem Erinnerungsbeitrag auf Facebook ein äquivalenter Tweet bei Twitter. Untersucht man z. B. die Erinnerungsbeiträge zu historischen Personen auf Twitter, dann fällt auf, dass zum weiblichen Opfer Ella Gartner keine Tweets platziert worden sind, sehr wohl aber zu Donga Antonia am 8. April 2015 (27 L, 68 R, 0 A)953 und zur Krankenschwester Danuta Terlikowska am 29. Oktober 2012 (2 L, 7 R, 0 A)954 (Abbildung 12). Es wurden ebenfalls Erinnerungsbeiträge zu weiblichen Opfern mit historischen Fotografien veröffentlicht, die nicht955 bei Facebook erscheinen, wie in einem Erinnerungsbeitrag vom 26. Januar 2014 (12 L, 17 R, 2 A)956 mit einer Lagerfotografie von Zofia Posmysz. Zu den männlichen Opfern Otto Küsel und Marian Batko existieren ebenfalls keine Erinnerungsbeiträge auf Twitter. Zu Władyslaw Bartoszewski gibt es insgesamt 15 Tweets957 anlässlich von Auftritten bei Gedenkveranstaltungen, wie in einem Tweet vom 11 November 2015 (6 L, 2 R, 0 A)958, oder anlässlich seines Todes, wie in einem Tweet vom 24. Februar 2015 in Englisch (65 R, 23 L, 4 A)959 und in Polnisch (13 R, 7 L, 2 A)960 mit einem aktuellen Foto und einem Link zum eigenen Internetauftritt des Museums mit Informationen zur Person. Auf den polnischen Tweet wurde zwei Mal genantwortet: einmal wurde nur der Ausgangstweet kopiert, während die zweite Antwort nur lautete: »@AuschwitzMuseum [*]«961. Auf den englischen Tweet wurde vier Mal geantwortet: ein weiterer Nutzer wurde verlinkt, Bartoszewski wurde auf Polnisch als Person angezweifelt und zwei 952 Die konkreten Zugriffszeitpunkte sind immer angegeben. Diese bewegen sich alle im Zeitraum vom 22. 1. 2016 bis zum 27. 1. 2016. 953 http://bit.ly/1lR017Z (Zugriff am 22. 1. 2016). 954 https://goo.gl/ugds7S (Zugriff am 22. 1. 2016). (R)etweets, vergleichbar mit der Teilenfunktion bei Facebook; (L)ikes; (A)ntworten, vergleichbar mit der Kommentierfunktion bei Facebook. 955 Zu Zofia Posmysz existiert ein Beitrag auf Facebook vom 26. Januar 2014, der anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum 69. Jahrestag der Befreiung des Lagers eine zeitgenössische Fotografie zeigt: https://goo.gl/BH3Rdo (Zugriff am 22. 1. 2016). 956 http://bit.ly/1Pj6ZPh (Zugriff am 22. 1. 2016). 957 http://bit.ly/1Kuc8hO (Zugriff am 22. 1. 2016). 958 http://bit.ly/1Qp2kMp (Zugriff am 22. 1. 2016). 959 http://bit.ly/1nd7j78 (Zugriff am 22. 1. 2016). 960 http://bit.ly/1RYdMAt (Zugriff am 22. 1. 2016). 961 http://bit.ly/1RYdMAt (Zugriff am 22. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
171
Antworten lauten nur »R.I.P.« und »RIP«. Die anderen Tweets sind ebenfalls anlässlich seines Todes erschienen. Diese verlinken Zeitungsartikel und verweisen auf die Verleihung des Elie Wiesel Awards, wie im Tweet vom 28. April 2013 (6 R, 1 L, 0 A)962, oder gratulieren ihm zum Geburtstag, wie im Tweet vom 19. Februar 2013 (2 R, 0 L, 0 A)963. Ein Erinnerungsbeitrag mit einer historischen Fotografie, wie auf Facebook, existiert auf Twitter nicht.
Abbildung 12: Erinnerungsbeitrag zu Danuta Abbildung 13: Erinnerungsbeitrag vom 25. Mai Terlikowska vom 29. Oktober 2012 2015 von Witold Pilecki
Zu Kazimierz Piechowski gibt es auf der Twitterseite des Museums Auschwitz ebenfalls keinen Erinnerungsbeitrag. Es wurde ausschließlich am 18. Februar 2015 (23 R, 26 L, 2 A)964 ein Tweet mit einem verlinkten Zeitungsartikel veröffentlicht, der seine Überlebensgeschichte erzählt. Im Tweet erscheint aufgrund des Links auch eine aktuelle Fotografie von Piechowski. Die gleichen historischen Fotografien wie auf Facebook wurden auch auf Twitter zu den männlichen Holocaustopfern Rudolf Vrba, Rudolf Friemel und Witold Pilecki veröffentlicht. Zu Rudolf Vrba wurden fünf 965 Tweets platziert. Zwei Tweets wurden am 7. April 2014 abgesetzt, einer auf Polnisch (3 L, 0 R, 0 A)966 und einer auf Englisch (21 L, 32 R, 5 0)967. Der englischsprachige Tweet informiert in aller Kürze ausschließlich über den Fakt der Flucht: »On 7/04/1944 Rudolf Vrba and Alfred Wetzler escaped #Auschwitz. Their report: [Link] #OnThisDay«. Parallel wurden am 7. April 2015
962 963 964 965 966 967
http://bit.ly/1OBvy8j (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1P9YINk (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/20iC9d1 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/20iC9d1 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1Pa2J4q (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1PmD0aN (Zugriff am 22. 1. 2016).
172
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
wieder zwei Erinnerungsbeiträge abgesetzt, ein Polnischer (1 L, 0 R, 0 A)968 und ein Englischer (12 L, 18 R, 0 A)969. Außerdem wurde am 10. April 2015 (6 L, 2 R, 0 A)970 noch ein falscher Tweet des @Normandy_1944971 korrigiert, in dem ein falscher Tag der Flucht angegeben worden war. Zu Rudolf Friemel wurde parallel zu Facebook seine Hochzeitsfotografie am 18. März 2014 (9 L, 6 R, 0 A)972 und 2015 (14 L, 18 R, 0 A)973 getwittert. Ähnlich wie auf Facebook wurde auch die historische Lagerfotografie von Witold Pilecki in Erinnerungsbeiträgen veröffentlicht. Insgesamt existieren zwölf Tweets974 zu Pilecki, sieben davon mit der entsprechenden historischen Fotografie. Die anderen bestehen aus Links, wie im polnischen Tweet vom 25. Mai 2015 (1 L, 2 R, 0 A)975, in dem ein Link zur Seite Polish Military Resistance Movement at Auschwitz976 des Google Cultural Institute platziert worden war. Dort existiert auch ein Eintrag zu Pilecki. Im Tweet vom 9. April 2014 (3 L, 8 R, 0 A)977 wurde ebenfalls ein Link zur Zeitschrift VICE veröffentlicht, in dem die Geschichte Pileckis erzählt wird. Weitere Links zu Pilecki sind platziert worden in einem polnischen Tweet vom 6. März 2014 (1 L, 4 R, 0 A)978, der zu einem Artikel der polnischen Zeitschrift wyborcza.pl über Pilecki führt, in einem Tweet vom 20. August 2013 (0 L, 2 R, 0 A)979, mit einem Link zur polnischen Zeitschrift thenews.pl, und in einem Erinnerungsbeitrag anlässlich seines 64. Todestages vom 25. Mai 2012 (0 L, 2 R, A 0)980, der zu einer privaten Website981 über Pilecki führt. Die schon genannten sieben Erinnerungsbeiträge zu Pilecki veröffentlichen die historische Lagerfotografie (Abbildung 13) anlässlich seines Geburtstages in Erinnerungsbeiträge vom 13. Mai 2014 auf Polnisch (9 L, 15 R, 0 A)982 und auf Englisch (49 L, 63 R, 8 A)983. Anlässlich seines Todestages wurde ebenfalls ein englischer Tweet am 25. Mai 2015 (117 L, 209 R, 4 A)984 platziert. Dem Tag der Flucht aus Auschwitz wurde in Erinne-
968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984
http://bit.ly/1lBDJal Zugriff am 22. Januar 2016). http://bit.ly/1ZRbozI (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1ZGBJuJ (Zugriff am 22. 1. 2016). https://twitter.com/Normandy_1944 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1K0TwLe (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1OKJDy4 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1nD7YPU (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1SBjA2l (Zugriff am 22. 1. 2016). https://goo.gl/WkD5cn (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1OBUfSa (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1S9i4D9 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1ZRw0b0 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1UgflXK (Zugriff am 22. 1. 2016). http://en.pilecki.ipn.gov.pl/ (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1nDgCO6 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1PIX5Cw (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1S9mSIF (Zugriff am 22. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
173
rungsbeiträgen vom 26. April 2014 auf Polnisch (32 L, 49 R, 2 A)985 und Englisch (45 L, 59 R, 1 A)986 und 2015 nur auf Polnisch (11 L, 9 R, 1 L)987 gedacht. Zudem wurde auch am 22. September 2014 (11 L, 13 R, 1 A)988 ein polnischer Erinnerungsbeitrag anlässlich seiner Deportation ins Lager im Jahr 1940 veröffentlicht. Diese Erinnerungsbeiträge haben auf Twitter zwar die gleiche Funktion wie auf Facebook, haben aber aufgrund der medialen Rahmenbedingungen v. a. auf der Textebene eine andere Gestalt, da ein Tweet nur aus maximal 140 Zeichen bestehen darf.989 Die englischen Erinnerungsbeiträge zu Witold Pilecki bestehen beispielsweise aus folgenden Texten: 113 years ago Witold Pilecki was born. He was one of the founders of the resistance movement in Auschwitz.990 On 27 April 1943 at 2 am a co-founder of camp conspiracy Witold Pilecki escaped from Auschwitz #OnThisDay #history991 67 yrs ago Witold Pilecki, co-founder of resistance in Auschwitz, was murdered by communists992
Eine diskursanalytische Mehrebenenanalyse auf der intratextuellen Ebene zeigt exemplarisch die Gestalt von Erinnerungsbeiträgen zu Personen auf der Twitterseite des Museums Auschwitz. Diese Beiträge bestehen aus einem Satz. Schlüsselelemente sind immer eine Zeitangabe als historischer Bezug als Datum (»On 27 April 1943«) oder als numerische Angabe der konkreten zurückliegenden Jahre (»113 years ago«; »67 yrs ago«), der Name der betroffenen Person (»Witold Pilecki«) und häufig seine Funktion im historischen Kontext (»one of the founders of the resistance movement«; »co-founder of camp conspiracy«; »co-founder of resistance«), der Ort des Geschehens (»Auschwitz«) und die vollzogene Handlung (»born«; »escaped«; »murdered«). Für mehr Informationen reichen 140 Zeichen oftmals nicht aus. Das Vertextungsmuster bleibt beim transtextuellen Bezug strikt bei wenigen Daten und Fakten. Wenn Fotografien veröffentlicht werden, bestehen immer direkte Text-Bild-Bezüge. Auf der Ebene der Diskurshandlungen wechseln Nutzer*innen mit der Antwortfunktion nur sehr selten aus der Rolle der Textrezipient*innen hin zu -produzent*innen. 985 986 987 988 989
http://bit.ly/1Qjacx7 (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1KuvinH (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1OLa7zD (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1ndyEpU (Zugriff am 22. 1. 2016). Seit November 2017 können auch Tweets mit 280 Zeichen veröffentlicht werden. Vgl. Decker, Hanne: Jetzt gilt die 280-Zeichen-Grenze bei Twitter. in: FAZ (2017). URL: http://www.fa z.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/ab-jetzt-gilt-die-280-zeichen-grenze-bei-twitter-15282 075.html vom 07. 11. 2017 (Zugriff am 18. 11. 2017). 990 http://bit.ly/1PIX5Cw (Zugriff am 22. 1. 2016). 991 http://bit.ly/1KuvinH (Zugriff am 22. 1. 2016). 992 http://bit.ly/1S9mSIF (Zugriff am 22. 1. 2016).
174
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Weitaus häufiger wird hierzu die Retweetfunktion genutzt. Ein Retweet kann wiederum ebenfalls mit einem Kommentar von dem Produzenten oder der Produzentin des Retweets versehen werden. Der Kommentar ist dann der Text des Retweets.993 Der oben zitierte englische Erinnerungsbeitrag vom 13. Mai 2014 (47 L, 56 R, 8 A) zur Geburt Pileckis wurde z. B. acht Mal von vier Nutzer*innen kommentiert, die als Diskursposition ausschließlich Bewunderung ausdrücken, wie Nick Siekierski: »The greatest and bravest man I’ve ever«; oder CarlToddHand: »we owe an immeasurable debt them«, Barbara Farb »[…] What an amazing man!«; oder D Dunlap: »A lot of courage in the face of horror showing there«.994 Auf Twitter existieren ebenfalls Erinnerungsbeiträge zu männlichen Opfern mit historischen Fotografien, die bei Facebook nicht veröffentlicht wurden, wie der Erinnerungsbeitrag vom 24. Juni 2015 (13 L, 31 R, 0 A)995, der die MugshotLagerfotografie von Edek Galin´ski zeigt. Auf der Täter*innenseite existieren im Vergleich zu den Erinnerungsbeiträgen auf Facebook keine Tweets zu Johann Paul Kremer, Josef Klehr, Erich Mußfeldt und Heinrich Schwarz. Zu Richard Baer gibt es zwei996 Erinnerungsbeiträge, die beide die gleiche Fotografie wie auf Facebook zeigen, auf der Baer in einem Passbildzuschnitt in SS-Uniform zu sehen ist. Die Tweets wurden beide am 11. Mai 2014 auf Englisch (10 L, 15 R, 0 A)997 und auf Polnisch (1 L, 3 R, 0 A)998 mit einem Link zur jeweiligen, sprachlich passenden Wikipediaseite zu Richard Baer anlässlich seiner Ernennung zum Kommandanten von Auschwitz veröffentlicht: »On 11 May 1944 SS-Sturmbannführer Richard Baer became the 3rd commandant of the Auschwitz camp [Wiki-Link]«. Zu Heinrich Himmler wurden 12 Tweets999 veröffentlicht. Zwei dieser Tweets wurden am 27. März 2014 anlässlich der Anordnung Himmlers 1940 das Lager Auschwitz zu errichten auf Polnisch (4 L, 7 R, 0 A)1000 und Englisch (13 L, 30 R, 4 A) platziert: »On 27/04/1940 Heinrich Himmler, Head of the SS, ordered the establishment of the #Auschwitz concentration camp [FB-Link]«1001. Beide Tweets zeigen die gleiche Fotografie wie auf Facebook und verlinken direkt zum Beitrag. Zur Täterperson Rudolf Höß wurden 18 Tweets abgesetzt.1002 Die 993 Um die möglichen Kommentare der Reetweets gesammelt mit einem Monitoringtool auslesen zu können, werden die Zugriffsrechte auf den Account benötigt. Daher können diese nicht berücksichtigt werden. 994 https://bit.ly/1PIX5Cw (Zugriff am 22. 1. 2016). 995 http://bit.ly/1NA1oOX (Zugriff am 22. 1. 2016). 996 http://bit.ly/1Qji1Tz (Zugriff am 22. 1. 2016). 997 http://bit.ly/1ZROkkm (Zugriff am 22. 1. 2016). 998 http://bit.ly/20j9Nzp (Zugriff am 22. 1. 2016). 999 http://bit.ly/1lCx1Rk (Zugriff am 22. 1. 2016). 1000 http://bit.ly/1nDGrxG (Zugriff am 22. 1. 2016). 1001 http://bit.ly/1QpD4pj (Zugriff am 22. 1. 2016). 1002 http://bit.ly/1NpIDxm (Zugriff am 22. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
175
Erinnerungsbeiträge mit Fotografie wurden mit den gleichen Abbildungen wie auf Facebook veröffentlicht, wie die Fotografie, die Höß bei seinem Prozess am 2. April 2014 (18 L, 32 R, 0 A) zeigt: »On 2/04/1947 Supreme National Tribunal in Warsaw sentenced to death Rudolf Höss, the first commandant of #Auschwitz«1003. Zudem wurden weitere Fotografien veröffentlicht, wie in einem Erinnerungsbeitrag vom 10. März 2015 (44 L, 41 R, 2 A)1004: »On March 11, 1946 Rudolf Höss, the first commandant of #Auschwitz was captured by British troops«. Dieser Beitrag zeigt eine Fotografie, die Höß bei seiner Verhaftung durch die britische Armee abbildet. Das Museum Auschwitz nutzt also auch seinen Twitterkanal für Erinnerungsbeiträge mit und ohne Fotografien, in denen die Geschichte von Opfer- und Täterpersonen im Zentrum des Interesses steht. Für die anderen oben am Beispiel von Facebook entwickelten Kategorien von Erinnerungsbeiträgen lassen sich ebenfalls vergleichbare Beispiele finden. Auf Twitter werden ebenfalls Gruppen von Opfern in Fotografien gezeigt, die repräsentativ für eine Opfergruppe stehen. Beispiele hierfür sind die Fotografie anlässlich des ersten Auschwitz-Prozesses in Krakau mit den Angeklagten im Erinnerungsbeitrag vom 24. November 2012 (3 L, 7 R, 0 A)1005 und 2013 (16 L, 32 R, 2 A)1006, die die Täterseite repräsentieren. Analog dazu steht für die Opfer eine Fotografie einer Gruppe ungarischer Jüd*innen nach ihrer Deportation nach Auschwitz im Tweet vom 1. April 2014 (23 L, 14 R, 1 A)1007. Luftaufnahmen vom Lager wurden ebenso getwittert, z. B. am 26. Juni 2014 (51 L, 111 R, 9 A)1008, wie historische Gegenstände, z. B. am 15. März 2014 (8 L, 27 R, 0 A)1009 eine Abbildung von Stempeln, mit denen Häftlinge tätowiert wurden. Auch die schon von Facebook bekannte Abbildung eines Kanisters mit Zyklon B wurde auf Twitter am 2. September 2013 (17 L, 54 R, 2 A)1010 veröffentlicht (Abbildung 14). Dokumente der Lagergeschichte wurden auf Twitter ebenfalls in Erinnerungsbeiträgen publiziert, z. B. am 22. November 2015 (17 L, 40 R, 1 A)1011 eine Liste derjenigen SS-Männer, die am gleichen Datum im Jahr 1940 bei einer Exekution von 40 polnischen Häftlingen beteiligt waren. Am 13. Mai 2013 (5 L, 9 R)1012 wurde eine Zeichnung von ehemaligen Häftlingen auf Twitter veröffentlicht, die den »Alltag« im Lager dokumentieren soll. Ein weiteres Beispiel ist
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
http://bit.ly/1ndURUL (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1ZHoFFv (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1nqEQLN (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1KuPYvY (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1SBQ2lj (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1OCvpkV (Zugriff am 22. 1. 2016). http://bit.ly/1lR017Z (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1SJqfrj (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1NzUOba (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/2ic7ALf (Zugriff am 27. 1. 2016).
176
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
der Erinnerungsbeitrag vom 25. Januar 2015 (19 L, 76 R, 0 A)1013, der SS-Männer beim Vernichten von Beweisen kurz vor der Befreiung des Lagers abbildet.
Abbildung 14: Erinnerungsbeitrag vom 2. Sep- Abbildung 15: Tweet mit einer Fotografie der tember 2013 mit Zykon B Reste der Gaskammern und Krematorien von Auschwitz
Historische Fotografien des Lagers ohne Personen wurden ebenso getwittert, wie die ikonisch für Auschwitz und den Holocaust gewordene Fotografie des Eingangstors von Auschwitz-Birkenau, die ein Tweet vom 23. März 2015 (17 L, 27 R, 3 A)1014 zeigt. Ähnlich wie auf Facebook veröffentlicht das Museum Auschwitz auch auf Twitter zahlreiche aktuelle Fotografien, die das Lager heute zeigen, wie in einem Tweet am 18. November 2015 (14 L, 11 R, 1 A)1015, der die Ruinen der Gaskammern und des Krematoriums zeigt (Abbildung 15). Oft wird hier auf den Instagramkanal des Nutzers verwiesen, der die entsprechende Fotografie dort hochgeladen hatte. Die Fotografien dieses Typs zeichnen sich alle, wie auf Facebook, durch eine ästhetische Qualität aus, die durch Perspektive, Bildaus-
1013 http://bit.ly/1JE7eUL (Zugriff am 27. 1. 2016). 1014 http://bit.ly/1Pj4dJy (Zugriff am 27. 1. 2016). 1015 http://bit.ly/20s8tuc (Zugriff am 27. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
177
schnitt, Bildkomposition und digitalem Fotofilter entsteht und die mehr künstlerisch als dokumentarisch ist. Außerdem nutzt das Museum Auschwitz seinen Twitterkanal ebenfalls dazu, um Fotografien von Gedenkveranstaltungen zu veröffentlichen. Ein Tweet vom 14. August 2013 (15 L, 28 R, 2 A)1016 zeigt z. B. eine Fotografie einer Gedenkveranstaltung anlässlich des in Auschwitz ermordeten Häftlings Maximilian Kolbe, der seit 1941 in Auschwitz inhaftiert war, stellvertretend für einen anderen Häftling starb und 1982 heiliggesprochen worden war.1017 Wie gezeigt, existieren im Vergleich zu Facebook einige Parallelen und Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie das Museum Auschwitz seinen Twitterkanal nutzt. Aber es gibt auch große Unterschiede. Diese liegen v. a. darin, wie das Museum seinen Twitterkanal gebraucht, um mit seinen Nutzer*innen in Interaktion zu treten. Fast täglich reagiert das Museum Auschwitz auf Aktivitäten von Nutzer*innen und tritt mit diesen in einen für jedermann auch ohne Twitterprofil sichtbaren Dialog. So twitterte beispielsweise der Twitterkanal @WTOP1018 am 10. Dezember 2015 (2 L, 2 R, 2 A)1019 einen Link zu einem Artikel1020, in dem über das Entfernen von Denkmälern in New Orleans berichtet wurde, die an die Rolle von News Orleans als Teil der Confederate States of America im Rahmen des US-amerikanischen Bürgerkriegs erinnern. Der Nutzer Duncan Brookwell hatte hierauf geantwortet: »@WTOP I guess we should erase all negative history. The camps at Auschwitz should completely torn down…like it never happened.«1021. Das Museum Auschwitz bezog dazu Stellung und schrieb: »@DuncanBrookwell If we arease all negative history, how come can we learn from it? Auschwitz should be preserved to be a warning @WTOP«1022. Duncan Brookwell antwortete hierzu: »@AuschwitzMuseum @WTOP uhm, yes. The point I was making through sarcasm – a dying art in the US.«1023 Das Museum Auschwitz bezieht hier auf der Ebene der Diskurshandlungen eine Diskursposition mit einem klaren erinnerungspolitischen und -pädagogischen Anstrich: Demnach müsse Auschwitz v. a. als Warnung und Lehrstück erhalten bleiben. Dass hier der sarkastische Unterton 1016 http://bit.ly/1ZSn2Vy (Zugriff am 27. 1. 2016). 1017 Vgl. Dahm, Christof: Kolbe, Maximilian Maria (Ordensname), Rajmund (Taufname). in: Bautz, Friedrich Wilhelm (Hrsg.): Kleist, Heinrich von bis Leyden, Lucas von. Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Band 4. Herzberg 1992. S. 327–331, hier S. 331. 1018 https://twitter.com/WTOP (Zugriff am 27. 1. 2016). 1019 http://bit.ly/1UpRyol (Zugriff am 27. 1. 2016). 1020 Burdeau, Cain: Debate over removal of Confederate monuments stirs passions. in: wtop – Washingtons’s Top News (2016). URL: http://wtop.com/politics/2015/12/debate-over-rem oval-of-confederate-monuments-stirs-passions/ vom 10. Dezember 2015 (Zugriff am 27. 1. 2016). 1021 http://bit.ly/1PDwAUZ (Zugriff am 27. 1. 2016). 1022 http://bit.ly/1PjbJ7h (Zugriff am 27. 1. 2016). 1023 http://bit.ly/1Kalkgu (Zugriff am 27. 1. 2016).
178
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
von Duncan Brookwell nicht erkannt wurde, wird sofort mit einem entsprechenden Antworttweet quittiert. Deutlich häufiger als auf Facebook finden auf Twitter Diskussionen zwischen dem Museum Auschwitz und Nutzer*innen statt, die das Verhalten auf dem ehemaligen Lagergelände betreffen. Teilweise werden diese Diskussionen von Museum selbst initiiert, das seinen Twitterkanal dann als pädagogisches Sanktionsinstrument nutzt. Ein Beispiel hierfür ist ein Tweet vom 1. April 2015 (16 L, 22 R, 25 A)1024, in dem das Museum Auschwitz ein Selfie twitterte, das der Instagramnutzer @charlysheen25 in seinem Kanal veröffentlicht hatte und das ihn und seine weibliche Begleitung in der Dauerausstellung vor einem Haufen mit Schuhen von Auschwitzopfern zeigt. Zu der Fotografie twitterte das Museum Auschwitz: »Selfie in a room full of shoes of victims? Sad and rather disrespectful.«1025 Hiermit nimmt das Museum Auschwitz sofort eine eindeutige Diskursposition ein, indem es dieses Verhalten auf seinem Twitterkanal als Institution als »Sad and rather disrespectful« verurteilt und exemplarisch öffentlich verbal sanktioniert. Die meisten Nutzer*innen stimmten dem Museum in seiner Einschätzung in ihren Antworten zu, wie Carnival Cruiser (@CarnivalCruiser): »[…] Their pic is extremely tasteless.«1026 Hierauf antwortete das Museum Auschwitz: »The author has removed the photo.«1027 An anderer Stelle in der Diskussion nahm das Museum Auschwitz noch differenzierter Stellung und twitterte: »@wienerlibrary The selfie itself can be a tool of commemoration and we see a lot us such examples. But it’s easy to cross the thin line.«1028 Auch andere Nutzer*innen nahmen ähnliche Diskurspositionen ein, wie Ziva David: »@AuschwitzMuseum A selfie w/a huge smile agnst a bkdrp of shoes is totally insensitive Makes U wonder do these folks get it? @wienerlibrary«1029. Andere Nutzer*innen kritisierten aber auch das Museum für seinen Umgang mit diesem Selfie, wie Alexander Johmann: »You’re right, that’s a wrong place for selfies. But better write them privately than to disgrace this young people publicly«1030. Auch auf diese Kritik reagiert das Museum Auschwitz sofort: ».@aj82 On one hand yes. But they post the picture in a public space and give ›Auschwitz‹ tag so that it is extremely easy to find.«1031 In einem zweiten Beispiel von Twitteraktivitäten bezog das Museum Auschwitz ebenfalls sofort eindeutig Stellung. Auf einen Tweet vom 21. Dezember 2015 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
http://bit.ly/20siNlY (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/20siNlY (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1Sj3xVI (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1nOSCrs (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1JExyOj (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/23t1Bio (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1WNIyLf (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1nnvZtN (Zugriff am 27. 1. 2016).
Das Auschwitz Memorial and Museum
179
(22 L, 27 R, 47 A)1032, der den Nutzer Coach K auf einer Fotografie mit gestreckten Armen auf den Gleisen des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz zeigt, schrieb das Museum Auschwitz: »Sadly not all visitors know how to respect the site. Photo by: @[http://www.instagram.com/kikivh96] @kikivh96«. Bei diesem zweiten Beispiel nahmen andere Twitternutzer*innen tendenziell noch mehr eine Diskursposition ein, die der des Museums entgegensteht. Rolf Kraß-Westerink schrieb u. a.: »@AuschwitzMuseum a lot of people here believe he’s doing a ›stop‹ pose. What’s your opinion on this? He’s not laughing or anything like that«1033. Darauf antwortete das Museum Auschwitz: »@krasswesterink We don’t believe he is making a ›stop‹ pose. There is no word mentioning the motive. It’s a funny pose on the unloading ramp«1034. Auch der Protagonist der Fotografie meldete sich später zu Wort und schrieb: »It’s only an EX-concentration camp«1035. Darauf antwortete das Museum Auschwitz: »It’s a Memorial dedicated to over 1,3 million people who were deported and 1,1 million who were murdered there.«1036 Auch andere Nutzer*innen äußerten sich kritisch dem Museum Auschwitz gegenüber, wie z. B. Ryan M: »@AuschwitzMuseum huh? What’s wrong with that? @kikivh96«1037. Auch hierzu bezogt das Museum Stellung: »@inthe250 We see a guy making a disrespectful pose standing where hundreds of thousands arrived for extermination @bartekpop @kikivh96«1038. Der Nutzer Doruk schrieb ebenfalls kritisch: »When did it become common practice for Auschwitz Musesum to start public lynching on the internet? @AuschwitzMuseum @kikivh96«1039; ähnlich auch Jordi McPolla: »@AuschwitzMuseum i think that you have over-exaggerated the pic, it’s just a guy with opened arms. Not disrespectful at all, nothing wrong.«1040. Aber es existieren auch Stimmen, die eine ähnliche Diskursposotion einnehmen, wie das Museum Auschwitz; so schrieb Mogmanski: »@AuschwitzMuseum @kikivh96 It’s not a happy playa to take ›cool‹ selfies or@other pictures.«1041 Alexis schrieb: »@AuschwitzMuseum @kikivh96 I don’t think selfies should be taken at Auschwitz. It’s disrespectful and not appropriate.«1042 Bis heute ist das Museum Auschwitz aber der Bitte von
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
http://bit.ly/1Uq5aA2 (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1RNnnJN (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1WNKoM8 (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1SaPmUq (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1SaPmUq (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1nnB5Gs (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1PAZ4Zk (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1QCIg9l (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1SaQQ0M (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1SaQQ0M (Zugriff am 27. 1. 2016). http://bit.ly/1PDUsb1 (Zugriff am 27. 1. 2016).
180
Erinnerungsorte für die Zeit des Nationalsozialismus und für den Holocaust
Coach K, dem Protagonisten der Fotografie, nicht nachgekommen: »@AuschwitzMuseum I repeat for last time. Delete the image NOW!«1043 Insgesamt nimmt das Museum Auschwitz Nutzer*innen gegenüber eine tendenziell pädagogische Haltung ein. Oftmals werden Nutzer*innen auch korrigiert. So twitterte @jewishcn am 27. Dezember 2015: »Today in Jewish History (1940) 1st Jewish prisoners arrive in Auschwitz death camp; 1 million slain there during WWII.«1044 Daraufhin schrieb das Museum Auschwitz: »Well… First German crimina prisoners arrived on 20 May 1940 and first Polish political prisoners on 14 June 1940.«1045 Zwei Tage später twitterte der Nutzer @historyepics eine Fotografie, die eine zerkratzte Wand zeigt und schrieb dazu: »Inside an Auschwitz gas chamber«. Dadurch wurde impliziert, dies seien Kratzspuren von Häftlingen. Das Museum Auschwitz korrigierte mit einem Tweet: ».@historyepics These are marks of vandalism left by some visitors who do not know how to behave in a historical place.«1046 Auch zu früheren Zeitpunkten hat das Museum immer wieder korrigierend auf diese Weise bei diesem Irrtum eingegriffen, wie in einem Tweet vom 5. August 2013 (6 L, 6 R, 1 A): »@HistoryInPix These are not nail scratch marks, but marks left by some misbehaving tourists. Do not manipulate.«1047 Auch andere Tweets von Nutzer*innen werden korrigiert, wie der Tweet von Stacey, die am 6. Juni 2014 twitterte: »Someone I knew survived D-Day landings, he went on to liberate Auschwitz, an absolute hero. He died early on this year, he’s to you John


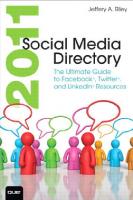






![Die Emslandlager in den Erinnerungskulturen 1945–2011: Akteure, Deutungen und Formen [1 ed.]
9783737013161, 9783847113164](https://dokumen.pub/img/200x200/die-emslandlager-in-den-erinnerungskulturen-19452011-akteure-deutungen-und-formen-1nbsped-9783737013161-9783847113164.jpg)
![Geschichte in den Social Media: Nationalsozialismus und Holocaust in Erinnerungskulturen auf Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram [1 ed.]
9783737012515, 1205703732, 9783847112518](https://dokumen.pub/img/200x200/geschichte-in-den-social-media-nationalsozialismus-und-holocaust-in-erinnerungskulturen-auf-facebook-twitter-pinterest-und-instagram-1nbsped-9783737012515-1205703732-9783847112518.jpg)