Erschliessung der Antike: Kleine Schriften zur Literatur der Griechen und Römer [Reprint 2013 ed.] 9783110967562, 9783598774256
185 92 21MB
German Pages 730 [732] Year 1994
Polecaj historie
![Erschliessung der Antike: Kleine Schriften zur Literatur der Griechen und Römer [Reprint 2013 ed.]
9783110967562, 9783598774256](https://dokumen.pub/img/200x200/erschliessung-der-antike-kleine-schriften-zur-literatur-der-griechen-und-rmer-reprint-2013nbsped-9783110967562-9783598774256.jpg)
Table of contents :
1. Zu Homer und Hesiod
Homer
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
Das Menschenbild Homers
Frauengestalten Homers
Phönizier bei Homer
Die Erforschung der Ilias-Struktur
Zeus’ Reise zu den Aithiopen (Zu Ilias I, 304-495)
Lesersteuerung durch Träume. Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
Noch einmal zum Opferbetrug des Prometheus
Neuere Erkenntnisse zur epischen Versifikationstechnik
Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne
2. Zur frühgriechischen Lyrik
Zu den ‚pragmatischen‘ Tendenzen der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interpretation
Ein neues Alkaios-Buch (Zu W. Rösier, Dichter und Gruppe)
Realität und Imagination. Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεταί μοι κη̑νοζ-Lied
„Freuden der Göttin gibt’s ja für junge Männer mehrere...“. Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 a W.)
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
3. Zur klassischen und hellenistischen griechischen Literatur
Die rätselhafte ‚Große Bewegung‘. Zum Eingang des Thukydideischen Geschichtswerks
Das Plappermäulchen aus dem Katalog (Zur Bittis des Philitas)
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ‚Geburt der Tragödie‘ und die gräzistische Tragödienforschung
4. Zur lateinischen Literatur
Zum Musen-Fragment des Naevius
Zu Cäsars Erzählstrategie (BG I 1-29: Der Helvetierzug)
Horazens sogenannte Schwätzersatire
Ovids ‚Metamorphosen‘ als Spiel mit der Tradition
5. Zur griechischen Sprachwissenschaft
ἄπτερος πυ̑θος - ἄπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer (Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer)
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Klassische Philologie und moderne Linguistik
6. Epilog
Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel am 29. 6. 1990 in der Martinskirche zu Basel
Anhang
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
Indizes
1. Personennamen (Antike und Mittelalter, auch mythologische)
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance, auch fiktive)
3. Orts- und Völkernamen (auch mythologische)
Lebenslauf von Joachim Latacz
Citation preview
Joachim Latacz Erschließung der Antike Kleine Schriften zur Literatur der Griechen und Römer
Joachim Latacz
Erschließung der Antike Kleine Schriften zur Literatur der Griechen und Römer
Herausgegeben von Fritz Graf, Jürgen von Ungern-Sternberg und Arbogast Schmitt unter Mitwirkung von Rainer Thiel
B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig 1994
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Latacz, Joachim Erschließung der Antike: kleine Schriften zur Literatur der Griechen und Römer / Joachim Latacz. Hrsg. von Fritz G r a f . . . - Stuttgart; Leipzig: Teubner, 1994 ISBN 3-519-07425-7 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt besonders fur Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © B. G. Teubner Stuttgart 1994 Printed in Germany Druck und Bindung: Röck, Weinsberg
Vorwort Joachim Latacz hat in seinem wissenschaftlichen Werk große Bereiche und zentrale Themen der antiken Literatur und Sprache dem Verständnis neu erschlossen. Dies versucht der Titel dieses Bandes bündig auszudrücken. .Erschließung' ist dabei in seinem Doppelsinn gemeint: Etwas bislang Verborgenes aufschließen, erstmals sichtbar machen - durch methodisch strenge, zielbewußte Forschung - , und: anderen zu etwas, das sie vorher gar nicht oder nur von ferne kannten, einen Zugang schaffen und es ihnen nutzbar machen - durch sprachlich klare, hermeneutisch überzeugende Vermittlung. Die Herausgeber der hier vorgelegten Festgabe fur Joachim Latacz zum 60. Geburtstag meinen, daß beide Komponenten des Begriffssinns von .Erschließung' die in diesem Band versammelten Arbeiten des Autors deutlich prägen. Das ist nichts Selbstverständliches. Die Kombination beider Kompetenzen in einer Person ist durch die fortschreitende Spezialisierung der Forschung selten geworden. Die Einengung des Blickfelds und die damit verbundene Ausbildung von , Sondersprachen' - beides unvermeidlich als Folge einer rund zweitausendfunfhundertjährigen, seit den Griechen ständig stärker sich verästelnden Forschungstradition - , machen Forschung heute nicht nur für den Laien, sondern oft auch schon für den Kollegen, der ein anderes Spezialgebiet pflegt, schwer verständlich. Vermittlung, wenn sie dann versucht wird, gerät als Konsequenz daraus in die Gefahr, das Komplizierte ungeachtet bester Absicht zu vergröbern: am Ende steht die Simplifikation. Joachim Latacz ist in seinem Werk, wie wir meinen, dieser drohenden Gefahr entgangen. Sachlich strenge, wohlfundierte kritische Argumentation auf hohem Niveau verbindet sich in diesem Werk mit der Befähigung, die mannigfachen Gegenstände, die behandelt werden, einer gebildeten Leserschaft auch über die Fachgrenzen hinaus zu öffnen und als für sie bedeutsam zu erweisen. Abstriche von der Komplexität und Differenziertheit, die die Sache jeweils fordert, sind dabei nicht zugelassen. Diese hermeneutische Tugend (im Sinne Gadamers), die bis zum vorigen Jahrhundert noch den Austausch und die gegenseitige Befruchtung zwischen Gelehrten jeder Provenienz untereinander und mit Künstlern, Dichtern, Intellektuellen
6
Vorwort
ganz verschiedener Interessenrichtung möglich machte, verleiht besonders den großen monographischen Untersuchungen und Darstellungen Joachim Lataczs über Homer, die frühgriechische Lyrik, die griechische Tragödie - ihren Reiz und ihre Wirkung. Sie prägt sich aber, ganz natürlich, auch in den vielen kleineren Abhandlungen und Studien aus. Eine Reihe dieser weitverstreuten Arbeiten in einem Band handlich zu vereinen (und damit, nebenbei, auch die Spannweite der Forschungsinteressen ihres Autors sichtbar zu machen) schien uns nicht nur einem vielfach ausgesprochenen Bedürfnis zu entsprechen, sondern auch - und dieses noch wichtiger - ein Beitrag zur Selbstdarstellung einer Wissenschaft zu sein, die für die Wahrung des intellektuellen Grundniveaus auch heute noch mehr leistet, als ihr zugetraut zu werden pflegt. Der Band beginnt mit dem Bereich, in dem Joachim Latacz die gegenwärtige Forschungssituation maßgeblich und grundlegend bestimmt hat, mit dem großen Kreis der Arbeiten zu Homer und Hesiod. Die Ordnung ist nicht chronologisch, sondern fuhrt von einer Gesamtdeutung der homerischen Dichtung über die Erörterung wichtiger Einzelaspekte zu einem Versuch, die Funktion des antiken Epos in Antike und Moderne sichtbar zu machen. Der zweite Teil gilt der frühgriechischen Lyrik. Die Auswahl will belegen, wie Joachim Latacz bestimmend und klärend in die neueste Diskussion eingegriffen hat. Unter der Rubrik ,Zur klassischen und hellenistischen griechischen Literatur' sind wichtige Beiträge (ζ. B. der für das Verständnis der Thematik und der gesamten Aussageintention des Thukydides grundlegende Aufsatz „Die rätselhafte ,Große Bewegung'") zur griechischen Geschichtsschreibung, zur hellenistischen Dichtung, zur Traumdeutung und zur griechischen Tragödie und ihrer Rezeption zusammengefaßt. Es ist ein besonderes Anliegen dieses Bandes, zu belegen, wie nachhaltig Joachim Latacz auch die Deutung der lateinischen Literatur mitgeprägt hat. In allen vier hier aufgenommenen Aufsätzen zu Naevius, Caesar, Horaz und Ovid werden zum Teil lange tradierte Mißverständnisse korrigiert und die Forschung auf eine neue Basis gestellt. Dem Bild des Forschers Joachim Latacz würde ein wesentlicher Zug fehlen ohne Berücksichtigung seiner großen Kompetenz auch in der Sprachwissenschaft. In den hier nachgedruckten Aufsätzen nimmt Joachim Latacz sowohl zu Fragen aus dem handwerklich-praktischen Bereich als auch zu den großen theoretischen Grundproblemen der Sprachwissenschaft Stellung. Besonders hinweisen möchten wir auf die brillant-kritische Auseinandersetzung mit der modernen Linguistik, deren Mangel an historisch-hermeneutischer Reflexion glänzend nachgewie-
Vorwort
7
sen und deren Anspruch, die traditionelle Grammatiktheorie völlig außer Kraft gesetzt zu haben, in seine Schranken gewiesen ist. Der Band klingt aus mit einer Ansprache Joachim Lataczs zu einer Maturitätsfeier des Humanistischen Gymnasiums Basel, in der zusammenfassend am Ende noch einmal so etwas wie das Gesamtkonzept, von dem her Joachim Latacz der Gegenwart die Antike zu erschließen sucht, sichtbar wird. Die in diesem Band aufgenommenen Schriften wurden - von der Beseitigung von Druckfehlern und Vereinheitlichungen in Druckbild und Zitierweise abgesehen - im wesentlichen unverändert nachgedruckt. Hier und da, besonders in den Literaturangaben, wurden Aktualisierungen vorgenommen. U m die Benutzung des Bandes zu erleichtern, ist die Paginierung der Originalpublikation jeweils am Rande mitgefiihrt. Dank schulden wir allen, die diese Veröffentlichung unterstützt haben: dem Teubner-Verlag und insbesondere Herrn H. Krämer für die vornehme und bereitwillige Aufnahme und Gestaltung dieses Bandes, Frau und Herrn Dr. FreyClavel (Basel) für einen großzügigen Druckkostenzuschuß und insbesondere Herrn Dr. R. Thiel, der den größten Teil der mühevollen Arbeit beim Korrekturlesen und bei der Erstellung des Drucksatzes auf sich genommen hat. Basel - Marburg, im Januar 1994
Inhalt 1. Zu Homer und Hesiod
11
Homer Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos Das Menschenbild Homers Frauengestalten Homers Phönizier bei Homer Die Erforschung der Ilias-Struktur Zeus' Reise zu den Aithiopen (Zu Ilias I, 304-495) Lesersteuerung durch Träume. Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee Noch einmal zum Opferbetrug des Prometheus Neuere Erkenntnisse zur epischen Versifikationstechnik Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne
13
205 227 235 257
2. Zur frühgriechischen Lyrik
281
37 71 95 125 137 175
Zu den .pragmatischen' Tendenzen der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interpretation Ein neues Alkaios-Buch (Zu W. Rosier, Dichter und Gruppe) Realität und Imagination. Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι Krjvoç-Lied „Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere . . . " . Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 a W.) Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur 3. Zur klassischen und hellenistischen griechischen Literatur Die rätselhafte .Große Bewegung'. Zum Eingang des Thukydideischen Geschichtswerks Das Plappermäulchen aus dem Katalog (Zur Bittis des Philitas)
283 309 313
345 357 ....
397 399 427
10
Inhalt
Funktionen des Traums in der antiken Literatur Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ,Geburt der Tragödie' und die gräzistische Tragödienforschung
447
4. Zur lateinischen Literatur
499
Zum Musen-Fragment des Naevius Zu Casars Erzählstrategie (BG I 1-29: Der Helvetierzug) Horazens sogenannte Schwätzersatire Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
501 523 547 569
5. Zur griechischen Sprachwissenschaft
603
άπτερος πΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte? Über seemännische Fachausdrücke bei Homer (Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer) Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik . . . Klassische Philologie und moderne Linguistik
605 625 639 671
6. Epilog
695
Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel am 29. 6. 1990 in der Martinskirche zu Basel
697
Anhang
703
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
705
Indizes 1. Personennamen (Antike und Mittelalter, auch mythologische) . . . . 2. Personennamen (etwa seit der Renaissance, auch fiktive) 3. Orts- und Völkernamen (auch mythologische)
713 713 718 728
Lebenslauf von Joachim Latacz
731
469
1. Zu Homer und Hesiod
Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, Darmstadt 1991 (Wege der Forschung Band 634), 1-29 [ursprünglich: Der Deutschunterricht 31, 1979, 5-23]
Homer Uvo Hölscher zum 65. Geburtstag 1 Homer steht am Beginn der europäischen Literatur. Aus ihm heraus und gegen ihn hat sich alle weitere griechische Literatur entwickelt - samt ihren Ablegern in Rom und bei Roms europäischen Erben. Das Bewußtsein von dieser literaturbegründenden Anfangsstellung Homers ist in Antike und Neuzeit immer lebendig geblieben - bei Literaten wie Literaturtheoretikern, von Aristoteles bis zu Emil Staiger - , nur hat es sich bis in die allerjüngste Vergangenheit hinein rational nicht selbst begründen können. Erst die Forschungen der letzten Jahrzehnte haben klargemacht, warum Homers Bedeutsamkeit gar nicht geringer werden kann: Ilias und Odyssee sind die einzigen Zeugen von höchstem künstlerischen Rang für den ,kopernikanischen' Wendepunkt von Literatur überhaupt: Sie stehen auf der Schwelle zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In ihnen erreicht eine jahrhundertealte Art, die Elemente des Zweckinstruments .Sprache' zu Kunstwerken zu fügen, ihren Höhepunkt, und eine andere nimmt ihren Anfang, die uns seitdem als die einzig denkbare erscheint: Die traditionelle Kunstübung des mündlich coram publico improvisierenden Dichtersängers geht bei Homer über in die neue Art der Wortkunstschöpfung durch schriftliches Konzipieren. Lange Zeit hat man diese Zwischen- und Übergangsstellung Homers als eines Dichters zwischen zwei Zeiten mehr gefühlt als wirklich begriffen: Johann Gottfried Herder hatte sie 1767 mit einem kühnen Bild zu fassen versucht: I „Und dieser Sänger Griechenlands trifft, wie mich dttnkt, eben auf den Punkt der schmal wie ein Haar und scharf wie die Schärfe des Schwerts ist, - da Natur und Kunst sich in der Poesie vereinigten; oder vielmehr: da die Natur das voll-
2
14
Homer endete Werk ihrer Hände auf die Grenze ihres Reiches stellte, damit von hier an Kunst anfinge..."'
Friedrich August Wolf hatte 1795 ihre technischen Voraussetzungen definiert: Verfehlt sei es, „von den Werken Homers [...] so zu sprechen wie von irgendwelchen Büchern aus dem eigenen Bücherschrank und dabei sogar das Wort .schreiben' zu verwenden".2
Gottfried Hermann hatte 1840 durch genaue Stilanalyse den wohl wichtigsten Wesensgrund für ihre singuläre Eigenart: den Improvisationscharakter, ans Licht gebracht: „Dies alles verrät nicht nur, daB diese Dichtung ausschließlich zum Anhören gemacht war, sondern zeigt zugleich, wie leicht es war, Gedichte dieser Art zu extemporieren. Daraus folgt, daB die Schrift zur Abfassung von solcherart Gedichten gar nicht nötig war - Gedichten, die vom Dichter einerseits mit größter Leichtigkeit im Gedächtnis behalten werden konnten und ihm andererseits, falls ihm einmal etwas entfallen war, Material zur Ausfüllung in überreichem Maße selbst zur Verfügung stellten. Damit steht es vollkommen anders bei denjenigen Dichtern, die ihre Gedichte schriftlich abfaßten"3;
und 1854 hatte Georg Curtius die Zwischen- und Übergangsstellung Homers fußend vor allem auf der slawistischen, romanistischen und germanistischen Epos-Forschung seiner Zeit - komparatistisch in ein ideales Ablaufsmodell allgemeiner Literaturentwicklung einzuordnen versucht: I 3
„Es gibt wol wenige Gelehrte, welche an eine ursprüngliche schriftliche Abfassung der homerischen Gedichte glauben. Der durch Wolf entdeckte, durch die bald darauf folgenden Untersuchungen der deutschen, der skandinavischen, der provençalischen, serbischen, finnischen und anderer Heldensage glänzend bestätigte Begriff des Volksepos ging siegreich aus den Kämpfen hervor. Daß in den homerischen Gesängen kein neuer oder gar erfundener Stoff, daß darin alt überlieferte mit dem Glauben und der Sitte des hellenischen Volkes eng verwachsene, in lange schon gepflegtem Heldengesang durchgesungene Sagengeschichte enthalten ist, daran zweifelt jetzt niemand. Die Verschiedenheit dieses volkstümlichen Epos von dem künstlichen, oder auch, wie Jacob Grimm sich ausdrückt, des wahren, das heißt natürlich gewachsenen, wirklich zusammengesungenen von dem falschen, das heißt für die Lesung mit feiner Berechnung und kühler Überlegung gedichteten oder nachgedichteten, ist heut zu Tage schon 1 J. G. Herder, Fragmente über die Bildung einer Sprache, in: Fragmente zur deutschen Literatur (1767), hrsg. durch Heyne. Cotta'sehe Gesamtausgabe, I, Tübingen 1805, S. 146 f. 2 F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum etc., Halle 1795, Kap. 18 Anfang; in den wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet bei J. Latacz, Tradition und Neuerung in der Homerforschung. Zur Geschichte der Oral poetry-Theorie, in: Homer, Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979 [im Folgenden: WdFH], 29 f. 3 G. Hermannus, De iteratis apud Homerum, Leipzig 1840, deutsch in WdFH, 49 f.
Homer
15
Gemeingut der gesammten Literaturgeschichte, ja, man kann fast sagen, aller gebildeten geworden."4
Dies war richtig gesehen, aber bei aller wachsenden Rationalität doch nicht tief genug begründet. Worin denn nun wirklich das ganz Besondere und - von unserem modernen Literaturbegriff her - ganz andere der homerischen Dichtung besteht, das wurde erst rund 80 Jahre später aufgedeckt: Im Jahre 1928, als sich die Homerforschung auf den Spuren Karl Lachmanns im erbitterten Kleinkrieg zwischen den ,Analysewölfen' und den ,Einheitshirten' schon selbst fast aus den Augen verloren hatte, rückte ein junger amerikanischer Gelehrter die Proportionen wieder zurecht: Durch eine in dieser Exaktheit bis dahin unbekannte Analyse eines bestimmten Stilmerkmals Homers, seines formelhaften Epitheton-Gebrauchs, stellte Milman Parry in seiner Pariser Dissertation ,L'Épithète traditionnelle dans Homère' 5 das eigentlich Bedeutsame an Homer: seine Einmaligkeit innerhalb der Weltliteratur, wieder sichtbar vor aller Augen. Was Herder, Wolf, Hermann, Curtius und andere nur erfühlt hatten: die Verschiedenlheit Homers von aller nachhomerischen Literatur, das wurde nun bewiesen: 4 Der Gebrauch der Epitheta - von Wörtern also, die in der uns vertrauten Art von Literatur Hauptmittel der individuellen Selbstprofilierung des Autors sind wird bei Homer nicht etwa von ihrer Bedeutungsnuance, sondern von ihrer metrischen Verwendbarkeit bestimmt; die berühmten .stehenden Beiwörter' Homers („vielduldender göttlicher Odysseus", „schnellfüßiger Achilleus", „weißarmige Here", der vielumstrittene und oft belachte „göttliche Sauhirt Eumaios") - sie sind, wie wir es heute ausdrücken würden, in den allermeisten Fällen ,kontextsemantisch null wertig' und werden vom Publikum des Sängers als altvertraute Bestandteile rhythmischer Nominaleinheiten zwar durchaus erwartet und befriedigt registriert, aber so gut wie nie mehr ,beim Wort genommen', so daß also der heutige Homerleser, der diese Wörter gewohnheitsmäßig als kontextbezogene charakterisierende Attribute zu verstehen sucht, mit einem jedes Verständnis von vornherein verbauenden Fehlurteil an Homer herangeht, mit dem Grundirrtum nämlich, „die literarische Bildung des homerischen Publikums sei dieselbe gewesen wie die des modernen Lesers, und Homers Stilideal sei identisch mit demjenigen, das einen Autor unserer eigenen Zeit inspiriert".6 4
G. Curtius, Andeutungen über den gegenwärtigen Stand der homerischen Frage, Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien 5,1854, S. 4, s. WdFH, 36. 5 M. Parry, L'Épithète traditionnelle dans Homère, Paris 1928. Näheres zu diesem Werk bei J. Latacz, Einführung zu WdFH. 6 M. Party, deutsch in WdFH, 245.
16
Homer
Der Grund für diese grundsätzliche Andersartigkeit des homerischen Stils aber ist, wie Parry zeigen konnte, die durchgängige Traditionalität der Diktion, mittels deren Ilias und Odyssee geschaffen sind: Was wir als .Formeln' empfinden, weil es bestimmte regelmäßig wiederkehrende Sachverhalte und Situationen in die immer wieder gleichen Worte kleidet („und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle"), das hatte sich in der jahrhundertelangen vorhomerischen Sängerpraxis als die bestmögliche und unübertreffbare sprachliche Formung des betreffenden Realvorgangs herausgebildet; von Sänger zu Sänger vererbt, schlossen sich solche Optimalformulierungen allmählich zu einem reichen Fundus zusammen, dessen möglichst vollständige Beherrschung unter möglichst intelligenter Anwendung der für den Hexameter verbindlichen Versi5 fikationsregeln einem I Sänger die flüssige Improvisation auch längerer und motivisch komplizierterer Geschichten aus dem Stegreif und auf Anforderung durchaus erlaubte. Von Vortrag zu Vortrag konnte der Sänger so seine durch lange Übung erworbene .epische Sprachkompetenz'7 vertiefen und verfeinern. Allerdings: Nach neuen Ideen suchte er - nach Parrys Meinung - nicht: „Der Dichter denkt in der Sprache der Formeln. [...] Zu keinem Zeitpunkt sucht er nach Wörtern für einen Gedanken, der noch niemals zuvor Ausdruck gefunden hat, so daß die Frage der stilistischen Originalität für ihn sinnlos ist."8 Bedingt ist dieser Mangel an Originalitätsstreben, wie er in aller nachhomerischen Literatur nicht mehr aufzufinden ist, nach Parry durch die Notwendigkeit, vor einem in Spannung zu haltenden Publikum rasch und ohne Unterbrechung frei aus dem Gedächtnis heraus mündlich zu improvisieren. Dies aber ist eine so völlig andere Weise des Dichtens, als wir sie kennen, daß Parry sich aus seiner HomerAnalyse heraus zu dem allgemeinen Schluß berechtigt fühlte, es gebe „zwei grundsätzlich verschiedene Arten von literarischer Form [...]; der eine Teil der Literatur ist mündlich, der andere geschrieben"9 - und Homer gehörte für ihn natürlich zum mündlichen Teil. Milman Parrys Arbeiten leiteten eine neue Phase des Homerverständnisses ein. Seine Schüler und Anhänger, allen voran Lord und Notopoulos, bauten seine Entdeckungen und Erkenntnisse in den USA weiter aus. Nach dem frühen Tod des Meisters im Alter von 33 Jahren führten sie seine Feldforschung an 7 Einführung und Erläuterung dieses Begriffes bei J. Latacz, Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, München 1977, S. 4 ff. ® M. Parry, deutsch in WdFH, 242. 9 M. Parry, deutsch in WdFH, 269.
Homer
17
Orten mit heute noch lebender mündlicher Sängertradition fort: Lord in Jugoslawien, Notopoulos vor allem im modernen Griechenland, insbesondere auf Kreta. Parrys Homerauffassung schien sich durch den Vergleich mit diesen und anderen mündlichen Nationalepiken immer stärker zu bestätigen. Inzwischen waren unabhängig von Parry auch in den Neuphilologien ähnliche Litelraturent- 6 stehungshypothesen aufgekommen.10 Die verschiedenen Hypothesen begannen zu einem Gesamtbild zusammenzuschießen.11 Daß die Schaffung von Literatur mit Hilfe der Schrift eine relativ späte Entwicklungsstufe im Leben der Kulturvölker ist und daß ihr fast überall eine lange Phase rein mündlichen Dichtens in traditionsgebundenem Formelstil vorausgeht, war danach nicht mehr zu bezweifeln. Zu bezweifeln war nur, ob Homer, ob Ilias und Odyssee wirklich noch ganz in diese Phase hineingehören. Parry hatte das behauptet Aber gewichtige Gründe sprachen dagegen. Ilias und Odyssee sind umfangreiche Großepen - die Ilias umfaßt annähernd 16000, die Odyssee annähernd 12000 Hexameter - mit einer komplexen und offenkundig sorgsam geplanten Handlungsstruktur. Improvisationsepen dagegen sind relativ kurz und tragen, mag der improvisierende Sänger auch noch so begabt sein, strukturell letztlich immer die Zeichen des Augenblicksprodukts an sich.12 Mußte die Improvisationstechnik die Entstehung eines durch vielfache Fernbezüge und Verklammerungen logisch und künstlerisch so geschlossenen Erzählkomplexes von 16000 Lang versen, wie ihn die Ilias darstellt, nicht geradezu verhindern? Kurz: Kann die Ilias wirklich das zufällig erhaltene Produkt einer beliebigen Improvisationsvorführung sein? Mit dieser Frage war die Forschung wieder an der Stelle angelangt, an der schon Wolfs Lehrer Heyne gestanden hatte, als er in seiner berühmten Rezension von Wolfs .Prolegomena ad Homerum' in den .Göttingischen Gelehrten Anzeigen' vom Jahre I 1795 gegen Wolfs Mündlich- 7 keits-Theorie einwandte: „Aber dazu, wird man gleich sagen, ist doch keine Wahrscheinlichkeit, daß ein alter Barde so viele Gesänge, als die Ilias und Odyssee enthält, die er bloß im Gedächtnis gefaßt hatte, in ein solches Ganzes, 10
Darüber gibt Auskunft der Wege-der-Forschung-Band, .Oral Poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher mündlicher Dichtung', hrsg. v. N. Voorwinden und M. de Haan, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1979. 11 Eine Synthese bei M. Curschmann, Oral Poetry in Medieval English, French, and German Literature: Some Notes on Recent Research (1967), WdFH, 469-498. 12 Sehr gute materialreiche Darlegung dieses Problems bei C. M. Bowra, Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten, Stuttgart 1964, Kap. IX (.Umfang und Entwicklung').
18
Homer
als beyde ausmachen, hätte bringen sollen; dazu war schriftliche Aufzeichnung nötig."13 Die auf Milman Parry und Lord fußende Oral poetry-Forschung kommt Anfang der fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts zu der gleichen Folgerung: Homers Epen sind zwar in Sprache und Stil typische Repräsentanten der Mündlichkeitsphase, die Großstruktur ihrer Handlungsanlage jedoch gehört bereits der Schriftlichkeitsphase an. Der (oder die) Dichter von Ilias und Odyssee muß (müssen) also in einer Übergangszeit gelebt haben.14 Noch bildete die alte Art des Dichtens in Formeln und streng stilisierten, immer gleichförmig ablaufenden »typischen* Szenenschilderungen15 den Standard, noch war Wortkunst - als die sinnreiche Sublimierung der alltäglichen Primärzur alltagsüberschreitenden Sekundärsprache des .gottgegebenen Gesanges' gleichbedeutend mit der handwerksmäßig erlernten und dann je nach individuellem Talent vervollkommneten Formung des ,mythos' (des Erzählstoffes) zum ,epos' (zur strukturierten ,Wort'-Erzählung), denn andere Arten von Wortkunst gab es noch nicht; aber schon drängte die allgemeine Ausweitung des geistigen Horizonts, die als Folge des ungeheuren Wirtschaftsaufschwungs im 8. Jahrhundert (Handelsexpansion, Kolonisation) unausbleiblich war und durch die Übernahme der phönizischen Buchstabenschrift in eine bis dahin analphabetische Gesellschaft gewaltige intellektuelle Energien freisetzte, zu neuem Ausdruck. 8 Das Leben hatte nach den Jahrhunderten relativer I Stabilität und irritationsloser Voraussehbarkeit, die auf den Zusammenbruch der ersten griechischen (sog. mykenischen) Kultur um 1150 gefolgt waren, plötzlich seinen altgewohnten Rhythmus verloren; neue Länder und Sitten, neue Gesellschaftsformen, Arbeitstechniken, Handelsprodukte, neue Lebensauffassungen und Moralvorstellungen brachen in rasch aufeinanderfolgenden Wellen in die geschlossene Gesellschaft Griechenlands ein.16 Das Altüberlieferte, bis dahin nicht in Frage Gestellte wurde nun als ein Altes erkannt und hier und da allmählich als Fessel empfunden, das Neue suchte sich seinen Weg auch in der Kunst. 13
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 186. Stück, den 21. Nov. 1795, S. 1861. Näheres in der Einleitung zu WdFH. 14 Dies wird allmählich zur communis opinio der gegenwärtigen Homerforschung, s. die vier Beiträge in Sektion V des Wege-der-Forschung-Bandes .Homer' [= WdFH], 15 Zum Begriff wurde diese Schilderungsweise durch W. Arend, Die typischen Scenen bei Homer, Berlin 1933. Wichtig dazu M. Parrys Rezension, in deutscher Übersetzung in WdFH, 289-294. 16 Dazu vor allem M. Finley, Die Griechen, in: Fischer Weltgeschichte, Band 4., Frankfurt a. M. 1967, bes. S. 304 ff; ders., Die Welt des Odysseus, dtv 21979.
Homer
19
In dieser Zeit des Umbruchs - wohl in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts muß, so meinen wir heute, unsere Ilias, und ein, zwei Jahrzehnte später unsere Odyssee entstanden sein. Uralte Bräuche, unverrückbar-rigide Moralanschauungen, längst obsolet gewordene Waffen und Gebrauchsgegenstände stehen in diesen Epen Seite an Seite mit modernen Lebensgewohnheiten, liberal-verständnisvoller Weltsicht und neuartigen Herstellungs- und Verfahrensweisen in Krieg und Frieden.17 Diese unterschiedlichen Altersschichten säuberlich voneinander absondern und etwa verschiedenen Dichterpersönlichkeiten zuweisen zu wollen, wie es die alte Homer-Analyse mit deprimierender Erfolglosigkeit versucht hatte, erscheint uns heute als falscher methodischer Ansatz. Nicht von verschiedenen Dichtem kann die Ilias, wie wir sie haben, stammen - denn niemals hätten mehrere Einzellieder (gesetzt auch, es hätte solche in schriftlicher Fassung gegeben) sich zu der in Handlungsaufbau und Motivation fugenlosen, von jeder Doppelfassimg freien Werkeinheit zusammensetzen lassen, wie sie unsere Ilias repräsentiert - , sondern ein Dichter - mag nun sein Name ,Horneros' oder anders gelautet haben - hat die generationenlang tausendfach in jeweils neuem Improvisationsvortrag gesungene Gelschichte vom Trojanischen Krieg aus dem 9 Geist seiner Zeit heraus mit reicher Begabung und sicherem Gespür für das Zeitgemäße in neuer Ponderierung neu gestaltet. Daß er dabei ganze Passagen aus anderen Versionen, die er selbst mitangehört hatte, in seine eigene Schöpfung übernahm, ist selbstverständlich: Er konnte ja gar nicht eine völlig neue, sondern er konnte nur die alte Geschichte neu erzählen wollen. Worin im einzelnen seine Fassung sich von denen seiner Vorgänger und Zeitgenossen unterschied, werden wir genau nie wissen können. Aber da keine andere Fassung, sondern nur die seine in schriftlicher Form konserviert wurde, muß der Qualitätsunterschied beträchtlich gewesen sein. Alles, was wir bisher wissen, deutet daraufhin, daß die Hauptursache für diesen Qualitätsvorsprung im Strukturellen lag: Frühere Iiiaden mögen in wesentlich additiver Reihung vom Außenstandpunkt aus nach Chronik-Art den Ablauf des Trojanischen Krieges (insgesamt oder abschnittsweise) nachgezeichnet haben18 - Homer wählt sich seinen Standpunkt mitten im Kriegsgeschehen des beginnenden 10. Kriegsjahres und in der Seele der größten Griechen- und Trojanerführer (Achilleus, Agamemnon; Hektor, Priamos) aus; von einem scheinbar nebensächlichen Beutestreit um zwei 17
Zu diesem sog. kulturellen Amalgam s. z. B. Latacz (oben Anm. 7), S. 16 f. mit Anm. 39. Dies läßt sich noch aus der Struktur der nachhomerischen sog. ,kyklischen' Epen schließen; zu diesen s. unten Anm. 21. 18
20
Homer
Gefangenenmädchen (Chryseis und Briseis) ausgehend, baut er eine psychologisch höchst sublime Zorn-, Ehr- und Eifersuchtshandlung zwischen Achill und Agamemnon auf, in die das ganze Kollektiv des Griechenheeres und damit auch das ganze, neun Jahre schon belagerte Ilios hineingezogen wird; durch eine gewaltige erzählerische Rückblende, die die sechs Bücher vom zweiten bis zum siebenten umfaßt, holt er die Vorgeschichte des großen Krieges seit der Flucht der Helena mit Paris aus Sparta und der Abfahrt des griechischen Verfolgungsaufgebots in Aulis in seine Geschichte mit herein, so daß aus der anfänglichen .Achilleis' in der Tat, wenn wir im achten Buche stehen, inzwischen für uns eine ,Ilias' geworden ist; und durch zahlreiche Anspielungen und Vorausdeutungen eröffnet er uns über das von ihm im 24. Buch erzählte allerletzte Ende 10 der Zomlhandlung hinaus einen weiten Ausblick in die Zukunft - nicht nur bis hin zu Trojas endlichem Fall, sondern sogar, mit kühner Verknüpfung von Mythos und Historie, bis hinunter ins Troja seiner eigenen Zeit, als in der Troas an den Dardanellen das Geschlecht der Aeneaden herrschte19, auf das sich 700 Jahre später, unterstützt durch Vergils Aeneis, Roms julisch-claudische Kaiserdynastie zurückführen wird. Von einem ganz kleinen Ausschnitt aus - die erzählte Zeit umfaßt nur 51 Tage - zieht der Ilias-Dichter auf diese Weise zehn ganze Jahre und mehr an seine Erzählung heran, läßt sie in seine Geschichte vom Zorn des Achilleus hineinwachsen und diese so als Episode kenntlich werden, versteht es aber dennoch, die Erzählmassen nicht ungeordnet und ungewichtet sich übereinandertürmen zu lassen, sondern die .Episode' in der Spannung des Hörers jederzeit als das Eigentliche bewußt zu halten. Was dies erzähltechnisch bedeutet - ständig bewußte Ponderierung von Haupt- und Nebenhandlungen, fehlerfreie intermittierende Nebeneinanderherführung zweier oder mehrerer gleichzeitiger Handlungen und ihre Wiederzusammenfiihrung an dramatischen Knotenpunkten, allmähliche Aufhellung von anfangs bewußt dunkel gehaltenen Motivationslinien u. v. a. m. - , das kann dank hervorragenden Forschungsleistungen20 heute schon wenigstens erahnt werden. Ganz wird es sich nie erfassen lassen, weil uns - wie erwähnt - andere als diese beiden Epen aus der gleichen Zeit
Dazu K. Reinhardt, Dias und Aphroditehymnus, in: Die Ilias und ihr Dichter, hrsg. v. U. Hölscher, Göttingen 1961, S. 507-521. 20 Genannt seien hier stellvertretend nur die beiden Werke von W. Schadewaldt, Iliasstudien, (Leipzig 1938) Darmstadt 31966, und: Der Aufbau der Ilias. Strukturen und Konzeptionen, Frankfurt a. M. 1975.
Homer
21
nicht überliefert sind; wenn man aber einen vorsichtigen Rückschluß von einigen späteren Epen her wagen darf, die - thematisch vergleichbar - in ihrer Struktur aus noch späteren Inhaltsreferaten kenntlich werden21, dann müssen sich Ilias I und Odyssee von den zeitgenössischen Epen wie reichgegliederte, ll kunstvoll verzierte architektonische Prachtbauten von einfachen Ein-Raum-Hütten abgehoben haben. Daß solche Schöpfungen ohne Statik und Planskizze - ins Literarische übersetzt: ohne Schrift - entstanden sein sollten, ist zwar nicht undenkbar, aber unwahrscheinlich. Daß sie von der Mit- und Nachwelt - als Meisterwerke sogleich erkannt - über etwa 150 Jahre hinweg ohne Schrift tradiert worden sein sollten, scheint ausgeschlossen. Ilias und Odyssee, weitgehend in der Form, wie wir sie haben, dürften also um 700 v. Chr. - vermutlich unter Zuhilfenahme der Schrift - als je eine große Einheit geschaffen und dann schriftlich weitergegeben worden sein. Ob ihr Schöpfer .Horneros' hieß, wissen wir nicht; ihn anders zu benennen fehlt freilich jeder Anlaß, denn der Name als solcher ist ohne Belang. Ob beide Epen vom selben Dichter stammen oder jedes seinen eigenen Verfasser hat, kann heute noch nicht gesagt werden; die strukturellen Gemeinsamkeiten - insbesondere die meisterlich gehandhabte Rückblende-, Vorbereitungs- und Retardationstechnik - scheinen eher auf Verfasseridentität hinzuweisen. Ob nun aber ein oder zwei Dichter: Beide Epen sind gekennzeichnet durch ihre Zwischen- und Übergangsstellung zwischen hochaltertümlich traditionsverhafteter Typizität und modern emanzipatorischer Flexibilität - und dies auf allen Ebenen des Kunstwerks, im Wortschatz, in der Wortverbindung, im Satzbau, in der Szenengestaltung, in der Szenenverbindung und in der Struktur größerer Erzähleinheiten. Um diesen Übergangscharakter der Epen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit sichtbar zu machen, der den eigentlichen Grund für ihre von modernen Lesern oft empfundene, selten aber klar begriffene Fremdartigkeit bildet, wollen wir im folgenden zwei Gruppen von Textpartien etwas näher in den Blick nehmen. Die erste repräsentiert den Pol ,Altertümlichkeit', die zweite den Pol .Neuartigkeit'. Auf der Skala, die zwischen diesen beiden Polen liegt, realisiert sich Homers Eigenart. I
21
Die Fragmente der hier gemeinten Epen des sog. .Epischen Kyklos', d. h. der kyklischen Troja-Epen, sind musterhaft zusammengestellt und interpretiert von E. Bethe, Homer. Dichtung und Sage (als Sonderausgabe unter dem Titel .Der Troische Epenkreis' erschienen in der Reihe .Libelli' der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Band 157, Darmstadt 1966).
22
Homer
2 An 14 Stellen22 wird in den beiden Epen ein gemeinsames Essen detailliert beschrieben. Zwar sind diese 14 Beschreibungen durchaus nicht - wie man es bei der zeitlosen Stereotypik der beschriebenen Realvorgänge eigentlich erwarten könnte - sprachlich identisch, sondern sie fassen die sich stets wiederholenden Ablaufsmomente (1. Ankunft im Haus oder am Eßplatz, 2. Bad, 3. Begrüßung durch den Gastgeber, 4. Platznehmen, 5. Händewaschung; 6. Schlachten und [7.] Braten, 8. Mischen des Weines; Zuteilung des [9.] Brotes, des [10.] Fleisches, und 11. Einschenken des Weines) sprachlich immer wieder anders, und sie variieren ihre Abfolge durch Umstellung, Auslassung oder Verbreiterung bzw. Raffung einzelner Stationen immer wieder neu - den eigentlichen Eßvorgang jedoch drücken sie in allen Fällen mit den gleichen zwei Versen aus: Die aber - nach den Genüssen, die da vor ihnen bereitlagen, streckten sie die Hände... Aber nachdem sie den Drang nach Trinken und Essen herausgelassen hatten ...
Johann Heinriçh Voss hatte dieses Verspaar in Idyllisches umgesetzt: „Und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war ..."
Die ruhige Selbstverständlichkeit des homerischen Ausdrucks ist hier verniedlicht und verkindlicht. Auch die erste deutsche Homerübersetzung, die endlich hinter Voss zurückging und aus Vossens zuweilen artigem Spielzeug-Homer wieder einen Griechen des 8. Jahrhunderts machte, Schadewaldts Odyssee in Prosa, vermag das Altertümliche dieses Ausdrucks nicht recht fühlbar werden zu lassen: „Und sie streckten die Hände aus nach den bereiten vorgesetzten I Speisen. Doch als sie sich das Verlangen nach Trank und Speise vertrieben hatten ..."
Drei Eigenheiten sind es, die uns dieses Verspaar als besonders alt erscheinen lassen: (1) Die Umschreibung des physiologischen Vorgangs des ,Sich-Sättigens' durch das noch ganz körperlich empfundene ,den Drang auslassen, herauslassen' (im Griechischen wird hier der ,Drang' durch èros bezeichnet; da ist also èros noch ein allgemeines Mangelgefühl, das noch nicht auf das Geschlechtliche allein eingeengt ist), (2) die einfache Natürlichkeit, mit der der gesamte eigentliche Eßvorgang übergangen wird (bezeichnet werden nur sein An22
Für eigene Vergleiche, die über das im folgenden Gebotene hinausgehen möchten, seien hier die 14 Stellen aufgezählt: Dias 9,89-92; 193-222; 24,621-628-Odyssee 1,103-150; 4,2068; 216-218; 5,194-201; 8,55-72; 449^85; 14,419^154; 15,133-143; 16,11-55; 17,85-99; 20,248-256.
Homer
23
fang lind sein Ende; von der detailliert genußvollen Ausmalung in Form etwa der Aristophanischen Geschirr- und Speisenkataloge, die dann in der römischen Literatur ζ. B. bei Horaz oder Petron satirisch genutzt werden, sind wir hier noch weit entfernt), (3) die , Nucleus-Funktion ' dieser Doppel vers-Formel: Mag die jeweilige Essen-Szene im einzelnen noch so individuell aufgebaut sein, mögen die Szenen noch so verschiedenen Zwecken dienen - stets gipfelt die Beschreibung in unseren beiden Formelversen. Der Dichter bemüht sich also gar nicht erst, irgendeine neue Ausdrucksmöglichkeit für die Situation zu finden, er ist sich der Formel als einer vermutlich seit Generationen im Fundus befindlichen Optimalformulierung sicher und baut seine Szene im beruhigenden Gefühl der Verfügbarkeit des abrundenden .Schlußsteins' auf sie zu. Dafür zur Illustration zwei Beispiele: Im ersten Buch der Odyssee ist im Götterrat von Zeus die endliche Heimkehr des Odysseus bestimmt worden. Athene, die Schutzgöttin und Fürsprecherin des Odysseus und seines ganzen Hauses, schwingt sich vom Olymp herab nach Ithaka (Vers 102). In Gestalt eines alten Freundes der Familie aus dem Nachbarvolke, Mentes mit Namen, bleibt sie wartend auf der Hofschwelle stehen und verfolgt voller Ingrimm (227-229) das ausgelassene Treiben der vielen Freier Penelopes im Hofe (= erstes Szenenelement: Ankunft; vgl. die Aufzählung oben). Der junge Telemach, Odysseus' Sohn, der still vor sich hingrübelnd inmitten der .Besatzer' sitzt, die sich mit Brettspielen die Zeit bis zum Essen vertreiben und das geschäftige Werken der schlachtenden, I bratenden und weinmi- 14 sehenden (= sechstes, siebentes und achtes Szenenelement) Dienerschaft kaum beachten - Telemach also blickt plötzlich auf und sieht den Fremden am Hoftor stehen. Sofort geht er auf ihn zu, greift nach seiner Rechten, nimmt ihm die Lanze ab und heißt ihn mit freundlichen Worten willkommen (= drittes Szenenelement: Begrüßung). Er richtet ihm einen bequemen Lehnstuhl mit Fußschemel her und läßt ihn Platz nehmen (= viertes Szenenelement). Dann heißt es weiter: (136)
Und Handwasser brachte eine Magd in einer Kanne, einer schönen, goldenen, und goß es über einem silbernen Becken über die Hände zum Waschen (= fünftes Szenenelement); und heran rückte sie einen wohlgeglätteten Tisch. Brot aber brachte die Wirtschafterin und stellte es vor sie (= neuntes Szenenelement), Speisen vielfältiger Art noch dazu, reich auftischend von dem, was im Haus war; und der Bratenschneider hob Platten mit Fleisch, verschiedener Art, und setzte sie vor sie (= zehntes Szenenelement), und daneben stellte er ihnen goldene Becher, und ein Mundschenk kam und ging und schenkte ihnen den Wein ein (= elftes Szenenelement).
24
Homer
Damit hat der Dichter bis auf das Bad alle Szenenelemente zusammengebracht, aus denen sich die typische Szene ,Mahl' konstituiert. Das Essen könnte beginnen. Aber die Freier selbst sind noch nicht da. Also fährt der Dichter fort, indem er die wichtigsten Szenenelemente verdoppelt: (144)
Herein aber kamen die Freier (= 1.), die hochmütigen: die setzten sich gleich nacheinander auf Sesseln und LehnsUlhlen nieder (= 4.). Denen gössen nun Schenken Wasser aber die Hände (= 5.), Brot aber häuften Mägde in Körben (= 9.), Knaben schließlich ließen den Trank in den Mischkrttgen aufschäumen bis zu dem Rande (=8. und 11.).
Die Elemente .Ankunft', ,Platznehmen', ,Händewaschung', .Zuteilung des Brotes, Fleisches und Weines' sind damit nun auch für die Freier - in Kurzform - nachgeholt Und jetzt, da alles zum Essen bereit ist, folgt als Krönung unsere Doppelvers-Formel: I 15
Die aber - nach den Genüssen, die da vor ihnen bereitlagen, streckten sie die Hände... Aber nachdem sie den Drang nach Trinken und Essen herausgelassen hatten...
Welcher Variationen - bei stets gleichbleibendem Abschluß - dieser hochaltertümliche Szenentyp fähig ist, mag die folgende Partie zeigen: 17. Buch der Odyssee, Vers 85-99. Telemach kommt nach seiner langen Erkundungsreise zusammen mit dem Seher Theoklymenos, den er in Pylos an Bord genommen hat, in den väterlichen Hof zurück: Aber als sie nun angelangt waren im Haus, dem gutbewohnten (= 1.), legten sie ihre Kleider ab auf Sesseln und Lehnstühlen, und hinein in die Wannen stiegen sie, in die wohlgeglätteten, und badeten sich (= 2.). Und nachdem Mägde sie dann gewaschen hatten und eingerieben mit dem Öle, und ihnen frische Kleider und Überwürfe aus Wolle umgelegt, heraus aus dem Baderaum gingen sie da und setzten sich auf Sessel (= 4.). Und Handwasser brachte eine Magd in einer Kanne, einer schönen, goldenen, und goß es über einem silbernen Becken über die Hände ... zum Waschen (= 5.); und heran rückte sie einen wohlgeglätteten Tisch. Brot aber brachte die achtbare Wirtschafterin und stellte es vor sie (= 9.), Speisen vielfältiger Art noch dazu, reich auftischend von dem, was im Haus war; die Mutter aber [d. h. Telemachs Mutter Penelope] nahm Platz gegenüber, neben einer Säule der Halle, in einen Lehnstuhl gelehnt, die feine Spindel drehend. Die aber - nach den Genüssen, die da vor ihnen bereitlagen, streckten sie die Hände... Aber nachdem sie den Drang nach Trinken und Essen herausgelassen hatten ...
16
Wir können dem Dichter geradezu dabei zusehen, wie und mit I welchen Absichten er den Szenentyp abwandelt: Die langen Essensvorbereitungen -
Homer
25
Schlachten und Braten, Weinmischen (6., 7., 8.) - , die er in der oben zitierten Freierszene bewußt nicht unterdrückt hatte, um an dem daraus ablesbaren verschwenderischen Aufwand den Ingrimm der zuschauenden Athene sich entzünden zu lassen, ersetzt er hier, wo sie die Spannung Penelopes (und des Hörers) auf Telemachs Bericht ganz situationswidrig und infolge ihrer Funktionslosigkeit höchst störend verlängern würden, durch das überbrückende Bad - das hier, nach der strapazenreichen Seereise (und als Symbol für die Wiederaufnahme in die häusliche Gemeinschaft), ganz am Ort ist, dort aber, bei der Göttin (!), die gedankenschnell vom Olymp herabkam, auf den Hörer nur hätte peinlich wirken können. Und wenn er nach der Händewaschung und Brotzuteilung die normalerweise sich noch anschließenden Prozeduren der Fleisch- und Weinzuteilung (10., 11.) hier einfach übergeht, leitet ihn offenkundig derselbe Gedanke, das Übliche in dieser Situation der spannungsvollen Erwartung nur anklingen zu lassen: Der Bratenschneider und der Mundschenk - sie mögen, wie üblich, auch noch ihres Amtes gewaltet haben, viel wichtiger aber, als dies zu erwähnen, ist es hier für den Dichter und seinen eigentlichen Erzählzweck, die Mutter kommen und fragen zu lassen - auf deren Wiederbegegnung mit dem durch die selbständige Reise zum Manne gereiften Sohn das Ganze doch hinzielt. Was wir hier sehen, ist, wie der Dichter die traditionelle Szenentypik fiinktionalisiert,23 Wir sehen aber auch, wie sehr ihm gerade dabei der Formelfundus hilft: Weil ihm die Verse und Vers-Teile für das Gewöhnliche (wir haben sie hier kursiv gedruckt) sozusagen .abrufbereit' zur Hand sind, weil er sie als mündlicher Dichter - ohne den von einem späteren Lesepublikum evozierten Zwang zur Originalität auch im kleinsten Ausldrucksdetail - unbesorgt immer 17 wieder und wieder verwenden kann, schafft er sich die Möglichkeit, über das Gewöhnliche gewissermaßen immer schon hinwegzudenken und dadurch das Ungewöhnliche, das er sagen will, desto fester im Auge zu behalten. Hier zeigt sich - was Milman Parry nicht erkannte (s. oben S. 16) - , daß die Technik des mündlichen Dichtens mittels .Baukastenelementen' gerade nicht ein Hindernis für Originalität war, sondern daß sie ganz im Gegenteil die Voraussetzung bildete für ihre eigene Transzendierung - sofern sie nur zur richtigen Zeit in die
Für andere typische Szenen, ζ. B. die Wappnungsszenen, ist das gezeigt bei J. Russo, Homer against his Tradition, in deutscher Übersetzung in WdFH, 403-426, und bei H. Patzer, Dichterische Kunst und poetisches Handwerk im homerischen Epos, Wiesbaden 1972 [auch in .Homer. Die Dichtung und ihre Deutung', hrsg. v. J. Latacz (WdF Bd. 634), Darmstadt 1991, S. 33 ff.].
26
Homer
richtigen Hände gelangte. Wäre es anders, hätten Ilias und Odyssee, so wie sie sind, niemals zustande kommen können. 3 In dem Bereich, den wir mit den bisher analysierten Textpartien erfaßt haben, unterscheiden sich Ilias und Odyssee grundsätzlich nicht von beliebigen Repräsentanten anderssprachiger Heldenepik. Ob Ilias und Odyssee, GilgameschEpos, Hildebrandslied, Beowulf, Ältere Edda, Rolandslied oder Poema del Cid, ob - um auch die z. T. heute noch lebende Heldendichtung nicht zu vergessen die jugoslawische, neugriechische, albanische, ukrainische, armenische, karakirgisische, nordjapanische oder arabische Heroen-Epik: überall in dieser Dichtung, die von etwa 2000 v. Chr. bis heute reicht, begegnet uns die gleiche „Überfülle detaillierter Schilderungen von Vorgängen [...], die an sich trivial sind und die ein moderner Romanschriftsteller oder erzählender Dichter einfach auslassen würde. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger mechanische Erzählmittel [...], solche Passagen [...] fordern keine allzu große Aufmerksamkeit fUr sich selbst; sie sind keine poetischen Glanzstücke, können aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr wohl einen unaufdringlichen Charme entfalten und unser Vergnügen dadurch erhöhen, daß sie die Personen der Geschichte und deren Lebensumstände in einem klaren Licht erscheinen lassen. Tatsächlich gehen denn auch die Dichter oft über den direkten Zweck solcher Passagen hinaus und erfinden eine neue Wendung oder eine überra18 sehende Ausschmückung, bei der wir mit Vergnügen verweilen. Es gibt solche Stellen I - bis zu einem gewissen Grade und mit sehr ähnlichen Zwecken - in allen Zweigen der Heldendichtung, und in vielen Fällen wird das, was ein bloß mechanisches Erzählmittel sein sollte, am Ende doch echte Dichtung." 24
Auch wenn also Homer, wie sich zeigte, aus solchen .typischen Szenen' tatsächlich „echte Dichtung" zu machen versteht, bleibt er damit noch im Normbereich von Heldenepik allgemein, uralter wie jüngster, und die .Altertümlichkeit' (die sogenannte .Archaik'), die er hier aufweist, ist nichts spezifisch Griechisches oder Homerisches, sondern ein Grundmerkmal traditioneller mündlicher Epik aller Völker und Zeiten. Seine Singularität innerhalb dieser Epik verdankt Homer - wenn wir von seiner unvergleichlichen Kultiviertheit einmal absehen - seiner Meisterschaft in der Großkomposition. Mündliche Improvisationsepik schafft in der Regel, wie bereits erwähnt, Gedichte geringen Umfangs, Kurzepen (um die 3000 Verse). „Dichter, die in den Ausmaßen des Rolandsliedes oder des Beowulf arbeiten, dürften die Kunst des Kurzliedes sehr wohl gekannt und daraus gelernt haben, bevor sie sich Gedichten größeren Umfangs zuwandten. Und natürlich stellt der 24
C. M. Bowra (oben Anm. 12), S. 195.
Homer
27
größere Umfang vor neue Probleme, unter denen das wichtigste die Frage der Konstruktion betrifft. Bei Gedichten solchen Umfangs ist es nicht mehr möglich, sich auf einen einzelnen Höhepunkt zu konzentrieren. Eine ganze Serie von Aktionen wird notwendig, und die Technik wird daher bis zu einem gewissen Grade episodisch sein müssen. Das Problem besteht darin, die Episoden in einen inneren Zusammenhang zu bringen und auf ein zusammenfassendes Ergebnis hinzuleiten. Nicht allen Dichtern gelingt das, obwohl die meisten es zumindest versuchen. Die Hauptaufgabe des Dichters bleibt es, eine in irgendeiner Form zwangsläufig erscheinende Verbindung zwischen den einzelnen Episoden herzustellen, und je enger diese Verbindung ist, desto besser wird die Konstruktion des Ganzen. Solange das Improvisieren noch vorherrscht, ist eine Konstruktion im höheren Sinne Uberhaupt nicht leicht zu schaffen, und wir dürfen nicht überrascht sein, wenn nur wenige Dichter dieses Problem wirklich erfolgreich zu lösen vermögen." 25 I
Die Beispiele, die bisher von der Komparatistik angeführt wurden, um die 19 Möglichkeit rein improvisatorischer Schaffung von Großepen zu belegen, lassen kaum einen anderen Schluß zu als den, daß ,Ilias' und .Odyssee' eben nicht mehr in die Improvisationsphase hineingehören. Weder dem 12 000- Verse-Epos des serbischen Sängers Avdo Mededovic, das Bowra S. 386-388 referiert, noch dem 40000-Verse-Gedicht ,Manas' des Karakirgisen Sagimbai Orosbakow (1867-1930), dessen 6 Teile Bowra S. 395 f. nacherzählt, kann man „Konstruktion im höheren Sinne" zuerkennen. Wie hoch Ilias und Odyssee darüberstehen, hat Bowra in voller Zustimmung zu Aristoteles' Homer-Laudatio26 - mit seiner komparatistischen Methode selbst gezeigt (S. 397-403). Wodurch diese kompositorische Überlegenheit Homers genau erreicht wird, das läßt sich allerdings nicht mehr komparatistisch, sondern nur werkimmanent, durch Textinterpretation aufweisen. 4 Die Ilias beginnt mit einem 12 Verse umfassenden Prooimion: Den Groll singe, Göttin, des Peleussohnes Achilleus, den verfluchten! der den Achaiem unzählige Leiden bereitete, der viele starke Seelen zum Hades hinabsandte, Heldenseelen, und die Helden selbst zu Beutestücken werden ließ für die Hunde
25
C. M. Bowra (oben Anm. 12), S. 370. Die Stellen aus der aristotelischen .Poetik' bei Bowra (s. Anm. 12), S. 397. [Zu diesen Aristoteles-Urteilen s. jetzt die Beiträge Latacz und Schwinge in .Zweihundert Jahre Homerforschung', hrsg. v. J. Latacz (Colloquium Rauricum Bd. 2), Stuttgart - Leipzig 1991. Der genannte Beitrag Latacz in diesem Band S. 137-174]. 26
28
Homer und für die Vögel zum Fräße. - Des Zeus Wille aber vollendete sich [darin] von dem Augenblick an, in dem erstmals die beiden auseinandertraten im Streite: des Atreus Sohn, der Herrscher der Männer, und der edle Achilleus.
20 Dieses erste, längere Stück des Prooimions nennt das Thema: I den Groll des Achilleus, und präzisiert es. Der Groll des Achilleus, so hören wir, soll nicht als individuelles psychisches Phänomen behandelt werden, sondern unter dem Aspekt seiner Folgen („den verfluchten! der den Achaiern unzählige Leiden bereitete"), seiner Folgen für das Kollektiv. Dabei wird im Verlaufe des langen, immer neue Konsequenzen anreihenden Relativsatzes unmerklich der Akzent verschoben. Hatten wir eingangs das Gefühl, der Groll werde im Mittelpunkt des Ganzen stehen, so stellt sich nun allmählich heraus, daß der Groll nur Ausgangspunkt ist für die Erzählung von überindividuellen Ereignissen: Unzählige Leiden werden die Griechen insgesamt infolge von Achills Groll zu erdulden haben. Was für Leiden? Die Präzisierung schreitet zur nächsten Stufe fort: den Tod im Kampfe; und dann, um noch einen Grad konkreter: den erbärmlichen Tod in einem gnadenlosen Kampfe, in dem die Gefallenen noch nicht einmal mehr eingeholt werden können, sondern auf freiem Felde Hunden und Aasgeiern zum Fräße dienen. Und an dieser Stelle der größten Scheußlichkeit plötzlich die Versicherung: Zeus' Wille war's, der sich darin vollendete! Und dies von dem Moment an, in dem das Zerwürfnis zwischen den beiden mächtigsten Griechenführem, Agamemnon von Mykene und Achilleus aus Thessalien, begann! Ein merkwürdiger Anfang. Alles klingt klar und ist doch unklar und verwunderlich. Fragen regen sich: Wieso führte der persönliche Groll eines einzelnen zum Tode seiner Kameraden? Und wie führte er dazu? Daß dies indirekt geschah, erspüren wir. Aber wie? Über welche Zwischenstufen? Und warum hat Zeus es gewollt? Welche Rolle spielt er in der Geschichte? Warum will er, was er will, ausgerechnet seit dem Zerwürfnis zwischen den beiden Griechenführern - nicht eher und nicht später? Wie hängen also alle diese Ereignisse, die uns der Dichter nennt, in der Tiefe miteinander zusammen? - Die äußere Präzisierung des Themas - des .Grolls des Achilleus' - erweist sich als innere Verrätselung und dies wohl nicht nur für uns, die wir der Trojasage fernstehen, sondern wohl auch für Homers Publikum, das in der Sage lebte. Das wird aus dem Fortgang des Prooimions klar: Zuallererst (V. 1) hatte der Dichter seinen Ausgangspunkt 21 genannt: Achills I Groll. Von ihm aus waren wir zunächst gewissermaßen in seine Zukunft vorgestoßen: unzählige Leiden der Griechen, ein Schlachtfeld voller Leichen, Aasgeier und Hunde. Aus der kleinen, privaten Sphäre eines Einzelhelden waren wir also in die größere, weitere Welt der Gemeinschaft hineingeleitet und am Ende auch noch über sie hinausgehoben worden, in die
Homer
29
Welt des Überirdischen: „Des Zeus Wille aber vollendete sich [darin]." Der Blick hatte sich geweitet, der Ausgangspunkt, Achills Groll, war beinahe schon in Vergessenheit geraten. Dann aber, als wir am weitesten von ihm entfernt schienen, bei Zeus, dem Vater der Götter und Menschen, waren wir plötzlich wieder zum Groll zurückgeführt worden: Mit Vers 5 („von dem Moment an, in dem erstmals die beiden auseinandertraten im Streite") stehen wir mitten in der akuten Streitsituation selbst, in der der Funke aufglomm. Und hier nun - nach dem weiten Ausblick in die schreckliche, im einzelnen jedoch ganz undurchsichtige Zukunft des Grolls - löst der Dichter die von Fragen überquellende Spannung, die entstanden ist, durch ein Mittel, das deutlich verrät, wie bewußt er diese Spannung aufgebaut hat: Er läßt sich vom Hörer, der so viele Fragen auf der Zunge hat, gewissermaßen selbst eine Frage stellen: (8)
„Wer von den Göttern hat denn diese beiden im Streite aufeinanderprallen lassen?"
Mit dieser Frage stoßen wir aber nun zugleich über den Groll hinweg in seine Vergangenheit zurück: Die Frage führt zu drei Antworten, von denen jede folgende zeitlich hinter die vorausgehende zurückgreift und so das zu schildernde Geschehen immer tiefer in der Vergangenheit verankert: (9)
Der Leto und des Zeus Sohn [= Apollon]! - Der nämlich, voller Zorn auf den König [= Agamemnon], ließ eine Seuche übers Heer kommen, eine schreckliche, und zugrunde gingen die Leute, weil jenen Chryses, den Priester, in seiner Ehre verletzt hatte der Atride. - (Der nämlich kam zu den schnellen Schiffen der Achaier, um seine Tochter freizukaufen ... usw.) I
Dies also sind die drei Antworten: (1) Apollon hat den Streit (und damit den 22 Groll des Achilleus) entstehen lassen. Warum und wie? - (2) Er zürnte dem Agamemnon und sandte eine Seuche über das Heer, ein Massensterben begann. Wie kam es dazu? - (3) Agamemnon hatte Apolls Priester Chryses nicht geehrt. - Mit der nächsten Frage, die sich hier ergibt („Wie ging diese Entehrung vor sich?"), und der Antwort darauf beginnt dann die eigentliche Erzählung. Was ist das für ein Dicher, der so aufbaut? Der nicht einfach sagt: „Vom Groll des Achilleus will ich singen. - Da war also ein Apollonpriester namens Chryses, der kam eines Tages zu Agamemnon..." usw. Solche engen, kurzsichtigen und kurzatmigen Eingänge müssen im zeitgenössischen Epos durchaus möglich und üblich gewesen sein. Ein Beispiel dafür bietet Homers jüngerer Zeitgenosse Hesiod. Seine ,Theogonie' beginnt er mit der lapidaren Feststellung: „Von den helikonischen Musen wollen wir zu singen beginnen, die den Berg Helikon bewohnen" - und dann folgt eine zwar sehr reizvolle, aber rein
30
Homer
statische Beschreibung des Musenreigens, und bis zum 21. Vers haben wir nicht den leisesten Verdacht, worauf der Dichter eigentlich hinauswill, und auch was wir im 22. Vers an Neuem erfahren, macht unseren Blick nicht viel weiter; ein Ereignis reiht sich ans andere - Assoziationsstil. - Hier dagegen, beim Iliasdichter, wird offensichtlich vom ersten Augenblick an geplant. Der Groll, der als Thema genannt wird, erhält, bevor er sich narrativ entfalten darf, zunächst einmal einen festen Platz in einem großen Zeit- und Kausalgefiige, das um ihn herum aufgebaut wird. Er wird zum Bestandteil eines über seine eigene Schilderung weit hinausreichenden Programms: Schildern will ich, sagt der Dichter, (1) die unmittelbare, lokale Vorgeschichte des Streits zwischen Achill und Agamemnon, (2) den Streit und den daraus entspringenden Groll des Achilleus, (3) die Folgen dieses Grolls für die Gemeinschaft der Achaier - Folgen, in denen Zeus* Wille wirksam war. Der Dichter des Ilias-Prooimions entwirft also bereits in den ersten Versen des 23 Epos eine Konzeption, er steckt sich seinen I Rahmen ab und schafft sich seinen Erzählraum. Er steckt also nicht tief in einem Stoffberg drin und arbeitet sich Schritt für Schritt voran, sondern er steht über dem Stoff. Er hat, wie es scheint, einen festen Werkplan. Aber den deutet er vorerst nur an. Er läßt uns nur so weit in die Zukunft sehen, daß wir merken: Ein Plan ist da. Wie er realisiert werden wird, können wir noch nicht erkennen. Gerade das aber hält uns in der Spannung: Wie wird es weitergehen? Zunächst erledigt der Dichter den ersten seiner drei Programmpunkte: Er führt uns in die Vorgeschichte des Grolls zurück. Der Apollonpriester Chryses, dem die Griechen bei einem ihrer Beutezüge in der Troas seine Tochter Chryseis geraubt haben, kommt zu Agamemnon und bittet bescheiden um die Erlaubnis, die Tochter freikaufen zu dürfen. Agamemnon, dem das Mädchen zugefallen und inzwischen lieb geworden ist, lehnt - obwohl das ganze Griechenheer dem Chryses Beifall murmelt - brüsk ab. ,JDaß ich dich ja nicht, Alter, bei den bauchigen Schiffen erwische", droht er ihm; „dann möchten dir wohl Priesterstab und Götterbinde nichts mehr nützen" (26 ff.). „Deine Tochter aber", fügt er verletzend hinzu, „wird in meinem Palast in Argos Sklavin und Bettgenossin zugleich für mich sein, bis sie alt ist." Und dann: „Verschwinde reg mich nicht auf, damit du halbwegs gesund bleibst" (32). Eine decouvrierende Rede! Agamemnon steht als unleidlicher, intoleranter, selbstgefälliger, taktloser und hartherziger Tyrann vor uns. Unsere Sympathien - wie die des Griechenheeres - sind bei Chryses. Der geht, von Agamemnon
Homer
31
fortgejagt, zum Meeresstrand und betet zu Apollon, Rache an den Achaiern zu üben. Apoll erhört sein Gebet: Er schickt die Pest ins Achaierlager: (53)
„Neun Tage lang flogen durch das Lager die Pfeile des Gottes, aber am zehnten, da rief zur Versammlung das Volk Achilleus."
Der Dichter tritt damit in die Behandlung des zweiten seiner drei Programmpunkte ein: in die Schilderung des Streits und in die Darstellung der Groll-Entstehung. Diese Darstellung selbst, eine psychologische Meisterleistung, müssen wir hier übergehen. An ihrem Ende steht das totale Zerwürfnis. Erreicht hat der Dichter I diesen ,Abschluß' durch den Einsatz der Göttin Athene: Auf dem äu- 24 Bersten Höhepunkt des schneidenden Wortwechsels, als Achill schon zum Schwert griff und dem Königsmorde nahe war, hatte er Athene dem Achill - nur ihm allein sichtbar - erscheinen und ihn - als Ergebnis ihres Eingreifens - das Schwert zurück in die Scheide stoßen lassen (220, vgl. 190). Auch dies ist ein wohlüberlegter struktureller Kunstgriff: Natürlich durfte Achill den Agamemnon nicht töten, wenn der Groll Achills das Thema des Werks bilden sollte. Natürlich durfte dann aber andererseits die Kontroverse auch nicht beigelegt werden, sondern sie mußte als dramatischer ,Basso ostinato' der gesamten Ilias-Handlung bestehenbleiben. Der Dichter löst das Problem durch die Epiphanie der Athene. Ein Achill, der von sich aus nachgegeben hätte, wäre kein Achill gewesen. Darum mußte er gezwungen werden. Durch den Zwang aber konnte zugleich sein durch nichts zu besänftigender Groll glaubhaft motiviert werden: Der Zorn mußte unterdrückt werden, damit der Groll entstehen konnte. Die Kränkung Achills ist darum so irreparabel, weil der Gekränkte, nachdem er die Beleidigungen geschluckt hat, sich selbst nicht mehr verzeihen kann. Der Gedanke daran, nicht spontan reagiert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes .zurückgesteckt' zu haben, der Gedanke also an die geduldete Demütigung bedeutet für Achill einen permanenten Selbstvorwurf, und dieser ist es, der ihn so unversöhnlich macht. Mit dieser Unversöhnlichkeit aber hat der Dichter die Brücke zum dritten seiner drei Programmpunkte geschlagen, zu den Folgen des Grolls für die Gemeinschaft der Griechen. Denn unmittelbar nachdem Achill sein Schwert wieder zurückgestoßen hat (V. 220: „zurück in die Scheide stieß er das große Schwert") und sich damit der Selbstdemütigung bewußt geworden ist, läßt der Dichter ihn sich selbst in die Fesseln des .Großen Eides' (mégas hórkos) schlagen, die ihn von nun an nicht mehr freilassen werden: (240)
„Wahrlich, ein Verlangen nach Achilleus wird noch einmal erfassen die Söhne der Achaier, alle zusammen! Dann aber - wenn es so weit sein wird - wirst du, trotz aller
32 25
Homer Bekümmernis, gar nichts I ausrichten können dagegen, wenn gar viele unter Hektor, dem männermordenden, sterbend dahinsinken werden! Du wirst dir vielmehr im Innern den Mut zerkratzen, voller Ärger darüber, daß du den besten der Achaier so gar nicht geehrt hast!"
Das ist nicht etwa nur eine aus dem Augenblick der Erregung heraus geborene prophetische Drohung, die ihre ganze Funktion schon in der Charakterzeichnung Achills hätte. Vielmehr weisen diese Worte Achills über Achill und die ganze Situation, in der er steht, weit hinaus. Sie implizieren als werkstrukturierender Vorverweis eine erste konkrete Information des Dichters über die Folgen des Streits und des daraus entstandenen Grolls: Achill wird also am Kampfe nicht mehr teilnehmen, und dadurch werden die Troer die Oberhand bekommen, ihr Führer Hektor wird unter den Griechen wüten, und Agamemnon wird - tief getroffen von der Einsicht, allein dagegen nichts ausrichten zu können - sich in Vorwürfen zerquälen, daß er selbst es war, der durch sein autokratisches Verhalten damals im Streite mit Achill dies alles verschuldet hat. Die unbestimmte Voraussage des Prooimions: „der Groll Achills, der den Achaiern unzählige Leiden bereitete", diese Voraussage konkretisiert sich hier. Durch Achills Mund sagt der Iliasdichter deutlich, daß die Geschichte vom Groll Achills, so wie er sie konzipiert hat und nun auszuführen sich anschickt, die Geschichte der stetig sich steigernden Niederlage der Achaier sein wird. Wie diese sich im einzelnen vollziehen wird, wie es überhaupt dazu kommen wird - das allerdings erfahren wir auch hier noch nicht. Wir bleiben weiter in der Spannung. Zunächst folgt der Vermittlungsversuch des alten Nestor. Nestor repräsentiert Erfahrung und Vernunft. Aber sein Appell an die rationale Einsicht muß scheitern angesichts der tiefen Unvereinbarkeit der beiden Charaktere. Die ganze Nestorrede scheint vor allem zu diesem Zweck hier hineingestellt zu sein: zu zeigen, wie machtlos alle menschlichen Mittel sind und wie unversöhnlich also 26 der Groll, die mënis, wirkt. Es ist wie bei der eben I besprochenen Schwurrede Achills: Vordergründig zeichnet der Dichter Charaktere, dahinter aber und in der Tiefe verfolgt er weiter seinen Bauplan. Nach dem Fehlschlag des Vermittlungsversuchs nehmen die Dinge ihren Lauf: Agamemnon läßt als Ersatz für seine Chryseis, die er zur Versöhnimg Apolls hergeben muß, das Beutemädchen Achills, Briseis, aus dessen Zelt abholen. Wir übergehen diese Szene. Das nächste strukturierende Element, das die im Prooimion angelegte, im Schwur Achills dann konkretisierte Grundlinie der Iliashandlung weiterführt, finden wir in der Szene .Achill und Thetis' (348430). Achill sitzt tief bekümmert am Strand und „schaut übers unendliche
Homer
33
Meer" (348). Er klagt seiner Mutter Thetis, die als Meerfrau in den Tiefen wohnt, sein Leid. Thetis kommt und fragt, Achill erzählt. Er erzählt alles, was wir schon wissen, noch einmal, nun allerdings aus seiner Sicht, mit starker Betonung der Hybris Agamemnons. Dann zieht er die Folgerung: (393) (408)
„Aber du, wenn du kannst, nimm dich an deines Sohnes! Geh zum Olymp und bitte Zeus ..." [13 Verse] „Ob er wohl irgendwie geneigt sein möchte, den Troern zu helfen, die aber entlang den Schiffen und beim Meere zusammenzudrängen: die Achaier, dahinsterbend, damit sie auch wirklich alle in den Genuß ihres Königs kommen und damit zur Erkenntnis gelangt auch der Atride, der weithin herrschende Agamemnon, zur Erkenntnis seiner Verblendung: daß er den besten der Achaier so gar nicht geehrt hat."
Worum Achill hier bittet, ist nicht mehr und nicht weniger als die Unterstützung der Todfeinde. Allerdings bittet Achill darum nicht aus Rachedurst. Wäre dies sein Motiv, dann müßte er Agamemnon selbst den Tod wünschen. Achill geht es um eine viel sublimere Bestrafung Agamemnons. Würde Agamemnon einfach getötet, so würde er seine Verblendung mit in den Hades nehmen, und Achill wäre dann zwar nach außen hin gerächt, aber nicht rehabilitiert. Agamemnon muß vielmehr einsehen, daß er I unrecht und Achill recht hatte; nur 27 dann ist Achill der Sieger, weil Agamemnon dann gedemütigt ist. Also darf Agamemnon nicht sterben, er muß vielmehr leben, aber er muß so leben, daß er unter den Folgen seiner Blindheit allmählich sehend wird, daß er seine Blindheit erkennt (411/412). Seine Blindheit erkennen aber kann der Autokrat, der allen Argumenten - wie der Dichter gezeigt hat - unzugänglich ist, nur auf dem Umweg über einen geradezu tragischen Erkenntnisprozeß: Er, der innerlich natürlich davon überzeugt ist, im Interesse der Gesamtheit zu handeln, muß zu der schmerzlichen Einsicht gelangen, daß seine Handlungsweise die Gesamtheit ins Verderben stürzt. Die Achaier müssen sterben, damit ihr Führer sehend wird. Der fast sophokleisch zu nennenden tragischen Ironie, die in dieser Handlungsmotivation liegt (Aristoteles hat die Ilias eine zutiefst tragische Dichtung genannt, Poet. Kap. 22), können wir hier nicht weiter nachgehen. Auch nicht der Frage, was diese Motivation für die Charakteristik des Achill bedeutet, der in vielen Homerbüchern noch immer als ein jähzornig-ehrsüchtiger, grundehrlicher und ein wenig tumber Schlagetot erscheint. Dafür fragen wir wieder nach der strukturellen Bedeutung dieser Achilleus-Worte. Aus Achills Schwur hatten wir die Gewißheit mitgenommen, daß die Ilias die Geschichte der stetig sich steigernden Niederlage der Achaier sein würde. Diese Gewißheit blieb aber noch recht allgemein. Hier nun, in der Bitte Achills, lichtet
34
Homer
sich das Dunkel ein weiteres Stück. Der Urheber der Achaier-Niederlage wird sichtbar: Zeus selbst. Er wird den Troern helfen. Und das konkrete Ergebnis dieser Hilfe wird ein Zurückdrängen der Achaier bis zu ihren Schiffen, ja bis zur Meeresbrandung sein (409/410). Die Achaier werden also in die äußerste Lebensgefahr geraten. Und dann endlich wird Agamemnon zur Erkenntnis seiner Verblendung kommen (411/412). Damit ist der vom Dichter konzipierte Verlauf der Ereignisse wieder ein wenig klarer und konkreter geworden. Aber auch hier handelt es sich wieder nur um eine partielle Aufhellung. Wieder bleiben Fragen offen, ζ. B. die Frage, auf welche Weise denn Zeus helfen wird - oder die Frage, in welcher Form sich Agamemnons Erkenntnis vollziehen wird. I 28 Diese Unklarheit in der Klärung ist vom Dichter offenbar beabsichtigt. Sie ist eines seiner Kompositionsprinzipien. Wir haben nun schon drei Stufen der Planerhellung kennengelemt: zuerst die ganz allgemeine Angabe des Prooimions, Achills Groll habe den Achaiern ,unzählige Leiden' bereitet, dann Achills konkretisierende Prophezeiung in seinem Schwur, das Heer werde sich noch nach ihm sehnen, denn es werde in eine furchtbare Niederlage geraten; und nun haben wir vor uns die Perspektive einer Zurückdrängung der Achaier bis zum Meere, gekoppelt mit der vorerst ihrerseits wieder unbestimmten Voraussage, Agamemnon werde zur Einsicht kommen. Die Technik des Dichters besteht also offensichtlich in einer schrittweisen Aufdeckung des Gesamtbauplans der Ilias. Die Einzelschritte sind dabei jedoch nur relativ klein, und sie enthüllen immer nur so viel vom weiteren Plan, daß der Hörer weitere Fragen stellen muß, daß er also in der Spannung bleibt. Diese Technik ließe sich - mit bewußtem Assoziationsimpuls - .Detektiv-Technik' nennen. Von der verwandten Prolog-Technik im Drama (Euripides!) unterscheidet sie sich dadurch, daß im Drama der Prolog schon den gesamten Bauplan enthält und die Spannung des Zuschauers nur durch seinen Appetit auf die Einzelheiten der Ausführung wachgehalten wird. Hier in der Ilias wird zwar auch dieser Appetit auf die Einzelheiten der Ausführung erzeugt, darüber hinaus aber wird der Bauplan selbst nur stückweise enthüllt, so daß also die Spannung des Hörers gewissermaßen zweidimensional wird: Sie richtet sich einmal auf die Ausfüllung des bereits gezeichneten Plan-Teiles - also in die Tiefe - , zum anderen aber richtet sie sich auch auf die Fortsetzung des niemals ganz erhellten Planes - also gewissermaßen in die Länge. Eine solche Technik der Spannungserzeugung kann nicht von selbst im Gedicht entstehen, sie setzt einen planenden Geist voraus. Wenn sie also tatsächlich existiert, wenn sie nicht nur eine interpretatorische Fiktion ist, dann ist mit ihrer Aufdeckung zugleich auch die Ein-
Homer
35
heit der Ilias aufgedeckt - eine Einheit, die von einem Dichter geschaffen wird, der einem anders vorgeformten Stoff seinen eigenen, wohlüberlegten Gestaltungsplan aufprägt. I Genaue Interpretation der weiteren Iliashandlung würde zeigen, daß die Aus- 29 fiihrung mit dem oben nachgezeichneten Bauplan vollkommen übereinstimmt. Die Existenz des Planes und damit des Planungswillens zu bestreiten wäre danach wohl nur noch Verstocktheit. Diese Interpretationsarbeit im hier gegebenen Rahmen zu leisten ist nicht möglich. Nehmen wir aber einmal an, die Beobachtung sei richtig. Was folgt dann daraus für unsere Ausgangsfrage? Kann eine so sublime Technik der PlanErhellung noch von einem Dichter der Mündlichkeit, rein aus der Improvisation heraus, verwirklicht werden? Wir haben gesehen: Jeder Planteil schließt sich an den vorhergehenden nahtlos und ohne Überlappung an. Bei jedem neuen Teilschritt scheint der Dichter genau zu wissen, wie weit er beim letzten gekommen war. Ist diese Leistung noch mit der angeblich ungeheuren Gedächtniskapazität mündlicher Sänger zu erklären? Muß hier nicht unterschieden werden zwischen einer reproduktiven Gedächtniskapazität, die in der Tat enorm sein kann, und einer kreativen Gedächtniskapazität, die sicherlich schon wesentlich früher an ihre Grenzen stößt? Die Homerforschung ist gerade erst dabei, sich diesen Fragen zuzuwenden. Was wir bisher wissen, läuft jedoch in der Tat alles auf jene Charakterisierung Homers hinaus, die oben gegeben wurde: Die Homerische Epik bildet den Übergang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Daraus erklärt sich ihre Eigenart. Und aus der Meisterschaft, mit der der Dichter dieser beiden Epen die alte Formeltechnik mündlichen Dichtens mit der neuen Technik schriftlichen Konzipierens verschmolzen hat, erklärt sich Homers Faszination.
Colloquium Rauricum, Band 1: Vergangenheit in mündlicher Überlieferung, Stuttgart 1988,153-183
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos I Die Frage nach Umfang und Art von Vergangenheitsbewahrung in mündlicher Überlieferung verdankt sich zwar der Gräzistik (jedenfalls in der ζ. Z. noch vorherrschenden Form der Fragestellung, s. den Beitrag Boedeker, S. 34 f.), kann aber längst nicht mehr allein von der Gräzistik beantwortet werden. Nachdem der Impuls von der Gräzistik auf andere Philologien, aber auch auf nichtphilologische Disziplinen wie Ethnologie, Soziologie, Psychologie, Linguistik, Kommunikationsforschung, Semiotik u.a. übergesprungen ist, hat sich die Problematik ausgeweitet und als wesentlich komplexer erwiesen, als die gräzistischen Initianten seinerzeit geahnt hatten. Während der Impuls von Disziplin zu Disziplin weiterwanderte, verlor er seinen anfänglich engen Zuschnitt und gewann das Format eines allgemeinen heuristischen Instruments zur Aufschließung einer bis dahin weitgehend versperrten Dimension der menschlichen Kultur im ganzen: der ,Oralität'. Für die historische Fragestellung dieses Kolloquiums wichtiger: er erwies sich auch als mögliches Hilfsmittel zur Aufhellung desjenigen Teils der menschlichen Kulturgeschichte, der Jahrhunderttausende hindurch der Normalzustand der Menschheit war - nämlich der .condicio humana oralis' und auf dem das relativ winzige Stückchen schriftlichkeitsgeprägter Menschheitsgeschichte der letzten rund fünftausend Jahre als stecknadelkopfgroßer Sonderfall aufruht, den nur wir Heutige für selbstverständlich halten.
Dem vorliegenden Beitrag liegt eine auf der neueren Forschung basierende Gesamtkonzeption der frühgriechischen Epik zugrunde, die in meiner Einführung in Homer von 1985 (bes. in den Kapiteln I und Π) genauer ausgeführt ist; Einzelverweise auf das dort Gesagte werden hier nur ausnahmsweise gegeben. - Die Literatur-Kurzzitate sind in der Lit.-Liste unten S. 63 aufgelöst.
38
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Seitdem dies erkannt ist, hat die Frage der Mündlichkeit das Odium des Modischen oder gar gewollt Avantgardistischen, das ihr gerade in der deutschsprachigen Gräzistik anfangs angehaftet hatte1, weitgehend verloren; sie wird heute I 154 als seriöser Forschungsgegenstand der Geisteswissenschaft begriffen, zu dem die Gräzistik einen zwar nur kleinen, aber vielleicht nicht unbedeutenden Beitrag leisten kann. Beim internationalen .Oralitä'-Kongreß von Urbino (21.25.7.1980; Akten publiziert 1985) stellte die Gräzistik folgerichtig nur noch zehn der 36 Referenten, und das Themenspektrum reichte von den indischen Veden über polynesische, indonesische, schwarzafrikanische und lateinamerikanische (Indianer-)Oralità bis zur Mündlichkeit des Theaters, der Philosophie und der Lyrik, aber auch bis zur Mündlichkeit von ante festum niedergeschriebenen Universitätsvorlesungen und schließlich bis zu mündlichkeitsgebundenen Kommunikationsformen wie der Gestik und Mimik. Die Begründung für diese Breite des Spektrums lautet in der Formulierung des Kongreßveranstalters Bruno Gentiii so: „In effetto, il fenomeno della oralità è commune ad ogni tipo di società passata e presente, con o senza scrittura, la cui cultura conosca o non conosca la diffusione del libro come principale strumento di communicazione, nei più diversi contesti economici e socio-culturali. La parola orale costituisce, cioè, un mezzo di espressione fondamentale, un tipo di economia discorsiva e communicativa con sue proprie modalità e i suoi specifici effetti, che entra o può entrare, in un rapporto vario e complesso con gli altri mezzi e le altre economie semiotiche: in primo luogo la scrittura, ma anche il gesto, l'immagine, ecc."2
Das ist das Manifest einer neuen Forschungsrichtung. Die Gräzistik ist damit zu einem Mitglied in einem großen Orchester geworden - das allerdings bisher noch keine gemeinsame Partitur hat und zur Zeit noch seine Instrumente stimmt. In dieser Phase des Tastens und Suchens kommt es darauf an, sich vor vorschnellen Verallgemeinerungen und fachübergreifenden Schlußfolgerungen zu hüten. Statt dessen sollten im Interesse einer möglichst um- und weitsichtigen Gemeinsamkeit zunächst mit größtmöglicher Präzision die einschlägigen Daten und Zusammenhänge der je eigenen Disziplin aufgearbeitet werden. Denn eines ist schon jetzt deutlich: daß - wie Gentiii zusammenfaßt - „die Unterschiedlichkeit der kulturellen Situationen keine rigiden und restriktiven Formulierungen legitimiert, die in allgemeiner Weise die eigenständigen Charakteristika einer gegebenen mündlichen Kultur in den Rang einer universalen Definition von
1
J. Latacz, Tradition und Neuerung in der Homerforschung. Zur Geschichte der Oral poetryTheorie, in: Latacz 1979,25-44. 2 B. Gentili, Avvertenza, in: Oralità 1985.
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
39
Mündlichkeit erheben" (33), und speziell für mündliche Dichtung dürfte Gentiiis Mahnung vollauf berechtigt sein, daß „jede mündliche Dichtung in sich und für sich zu untersuchen ist, in ihrem soziokulturellen Kontext" (ebd.). Primäre Aufgabe muß daher die Überwindung der ζ. Z. noch weithin herrschenden Praxis sein, daß der Experte für serbokroatische Volksdichtung seine Analyse-Ergebnisse ebenso als repräsentative allgemeine Mündlichkeitsdefinition ausgibt wie der Experte für neugriechische Volksdichtung, der Afrika-Experte, der Indianer-Experte usw. - und eben auch der Homer-Experte. Eine zureichende Phänomendefinition kann nur aus der Fülle der vollständig gesammelten Einzelbelege erwachsen. Von einer solchen I Sammlung sind wir aber auf dem Gebiet 155 der Mündlichkeitsforschung noch weit entfernt. Ein weiteres Forschungshindernis bildet die heute noch weitverbreitete Meinung, die sogenannte mündliche .Literatur' sei eine primitive Vorform der strahlend aus ihr herausspringenden schriftlichen Literatur: von wenigen und einfachen Gesetzen beherrscht, daher leicht zu durchschauen und mit rascher Souveränität zu beurteilen. In Wahrheit handelt es sich um eine nach Gattungen, Stilen, Formgesetzen und Wirkungsabsichten nicht weniger reich differenzierte Wortkunstwelt, als sie die Literatur der Schriftlichkeit darstellt. Das bisher aus verschiedenen Weltteilen und Kulturkreisen zusammengetragene Material3 zeigt deutlich, daß mündliche Literatur grundsätzlich den gleichen Bestimmungsfaktoren unterliegt wie schriftliche, also etwa: Gattimg, Anlaß, Anzahl der Rezipienten, soziale Stellung und Bildungsgrad des Autors und des Zielpublikums, Erwartungshorizont des Publikums, gesellschaftliche Grundverfaßtheit und aktuelle Bedürfhislage, usw. Vor diesem Hintergrund sind die immer noch anzutreffenden Schnellschlüsse der Art ,Wie mündliche Literatur operiert, kann beispielhaft aus dem Lied XY des neuseeländischen Sängers XY ersehen werden' methodisch wenig förderlich. Π
Entsprechend dieser Grundsatzposition beschränke ich mich im folgenden strikt auf das Material, das ich vergleichsweise am gründlichsten zu kennen glaube: auf die Homerischen Epen Ilias und Odyssee. An dieses Material richte ich die Frage unseres Kolloquiums: ,Wie wird Vergangenheit mündlich überliefert?' 3
Die beiden Grundwerke sind immer noch: Η. M. und Ν. K. Chadwick, The Growth of Literature, 3 Bde, Cambridge 1932, 1936, 1940 - und C. M. Bowra, Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten, Stuttgart 1964 (engl. Originalausgabe: .Heroic Poetry', London 1952). Weitere Literatur: J. Latacz, Spezialbibliographie zur Oral poetry-Theorie in der Homerforcshung, in: Latacz 1979, 573-618.
40
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Bevor die Frage beantwortet werden kann, muß gesichert sein, daß sie an das richtige, d. h. an auskunftsfähiges Material gerichtet wird. Es muß also gesichert sein, daß die schriftlichen (= uns in schriftlicher Form vorliegenden) Epen Ilias und Odyssee tatsächlich Auskünfte über mündliche Überlieferung geben können. Da das Verfahren, das die Homerforschung zu diesem Zweck zu entwickeln sucht, zugleich schon den Erwartungsrahmen für die Antwort auf die eigentliche Frage sichtbar werden läßt, muß seine Darstellung - über das Methodische hinaus - bereits als Teil der eigentlichen Problemklärung gelten. Diese Darstellung darf daher nicht zu knapp ausfallen. I 156 Die wichtigsten Wegmarken des SicherungsVerfahrens sind also die folgenden Feststellungen, Überlegungen und Berechnungen: (1) Die beiden Epen Ilias und Odyssee sind zeitlich nicht weit voneinander entfernt entstanden. Dabei ging die Ilias voraus, die Odyssee folgte. (2) Die Ilias, also das ältere der beiden Epen, ist nach allen äußeren und insbesondere inneren Indizien höchstwahrscheinlich im 3. Drittel des 8. Jh. v. Chr. entstanden (etwa zwischen 730 und 710). (3) Zu diesem Zeitpunkt war die Schrift eine relativ neue Errungenschaft der griechischen Kultur. Alles weist ζ. Z. darauf hin, daß die phönizische Konsonantenschrift um 800 (jedenfalls nicht lange danach) durch griechische Kaufleute in Al Mina übernommen und zur griechischen Phonemschrift umgewandelt wurde, wie wir sie nach ihrer Übernahme durch die Römer mit geringen Modifikationen heute noch benutzen. Die Berechnung des Übemahmezeitpunktes ist von grundlegender Bedeutung für alle weiteren Ableitungen. Sie muß daher hier genauer dargestellt werden. Bis vor kurzem beruhte diese Berechnung auf zwei Fakten: (a) Die frühesten Belege griechischer Schriftlichkeit setzen für uns nach der seit nunmehr über 100 Jahren in diesem Punkte unveränderten Fundlage mit metrischen Gefäß-Aufschriften um 740 ein. Der älteste Beleg ist eine hexametrische Preis-Auslobung auf einer Kanne, die im Jahre 1880 beim Dipylon (»Doppel-Stadttor') in Athen gefunden wurde (Abb. 1). Obwohl die Ausgrabungstätigkeit seit 1880 in Griechenland enorme Flächen freigelegt hat, ist bisher ein älterer Schriftbeleg nicht zum Vorschein gekommen.4 Da aber Gefäßbeschriftung sicherlich eine erst sekundäre Anwendungsform von Schrift ist und da wir nicht
4
A. Heubeck, Schrift, in: Archaeologia Homérica, Kapitel X, Göttingen 1979, 116 mit Anm. 632; Heubecks Datierung auf 735-725 nach Davison 1961 ist durch Coldstream 1968 auf 740 hinaufgerückt worden; 740 ist von Hansen 1983, 239, übernommen. Die Nestorbecher-Aufschrift scheint etwas jünger zu sein, s. unten Anm. 9.
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
41
so verwegen sein werden, darauf zu vertrauen, daß wir in dem Zufallsfund der Dipylonkannen-Aufschrift just den historisch allerersten griechischen Schriftbeleg in die Hand bekommen haben, ist es vernünftig, mit einer gewissen Vorlaufzeit zu rechnen, die vor der Dipylonkannen-Aufschrift lag. Da aber auf der anderen Seite aus den Jahrhunderten XI, X und IX aus dem gesamten griechischen Siedlungsgebiet (abgesehen von dem Sonderfall Kypros) bisher kein einziger griechischer Schriftbeleg bekannt geworden ist und da eben auch die Literatur erst im 8. Jh. einsetzt, ist es ebenso vernünftig, mit einer Zeit völliger Schriftlosigkeit der Griechen nach dem Zusammenbruch ihrer ersten (schriftbesitzenden) Hochkulturphase (der ,mykenischen' Periode) zwischen 1200 und 1100 zu rechnen, d.h., eine .condicio Graeca oralis' für die ca. 300 Jahre zwischen 1100 und 800 anzusetzen. I (b) Die Griechen nannten ihre Schrift anfangs φοινικήϊα, was - wenn man 157 γράμματα ergänzt - etwas wie .Phönizische' (sc. Ritzungen) bedeutet. Darin äußert sich das Bewußtsein der Schriftübernahme von den Phöniziern.5 Der Zeitpunkt dieser Übernahme muß, wie gezeigt, vor 740 liegen (terminus ante quem), aber wegen der Schriftlosigkeit der Jahrhunderte XI, X und IX wohl erst im achten Jh. - nicht viel höher hinauf (also ca. 800 terminus post quem). Der Übernahme-Ori sollte eine Stelle gewesen sein, an der Griechen und Phönizier nicht nur kurzfristig zusammentrafen. Diese Stelle scheint nach allem, was wir bisher sehen, Al Mina in Syrien gewesen zu sein 6 , wo Leonard Woolley 1936-1949 das Hafen- und Lagerviertel eines phönizisch-griechisch-kypriotischen Handelszentrums freigelegt hat (Abb. 2), von dem aus eine Handelsroute nach Euboia-Attika und dann hinüber zur Apenninenhalbinsel führte, bis hinauf nach Pithekussai, dem heutigen Ischia, im Golf von Neapel, und noch weiter hinauf nach Etrurien (Abb. 3). Griechen haben in Al Mina nach den Keramikfunden etwa von 800 an gelebt. Wie neuere Keramik-Analysen gezeigt haben, 5
Heubeck, Schrift 1979, 105-109 (erste Zeugen: Anaximander [?], Hekataios, Herodot); 158 f. zum Verb π ο ι ν ι κ ά ζ έ ν und zur Berufsbezeichnung ποινικαστάς auf der kretischen Bronzeplatte von ca. 500 (,to do φοινικήϊα; φοινικήϊα sc. γράμματα schreiben; eine für die Phoiniker bezeichnende Tätigkeit ausüben' o. ä.); zu γράφειν .ritzen, kratzen, kerben': 140-142. 156 f. 6 Heubeck, Schrift 1979, 84—87, glaubte noch, unter den beiden ihm allein möglich scheinenden Übemahme-Orten Al Mina und Kypros sei Kypros vorzuziehen; für Murray 1982, 120, „scheidet Zypern als Vermittlungsort aus" und kommt am ehesten Al Mina in Frage (121); Burkert 1984, 31, verweist auf das 1982 aus Al Mina bekannt gewordene griechische Graffito von ca. 700, hält aber die Entscheidung „vorläufig offen"; s. Latacz, Homer 1985, 69 f. Zur Bedeutung von Al Mina und zur Handelsroute Al Mina - Euboia - Pithekussai - Etrurien s. Murray 1982, Kap. 5.
42
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
stammten diese griechischen Kaufleute in Al Mina nach aller Wahrscheinlichkeit aus Euboia - d. h. aus einem der Fluchtzentren der mykenischen Griechen nach der großen Katastrophe (das, wie die neuen Ausgrabungen in Lefkandi Abb. 4 - an den Tag brachten, schon um 1050 wieder zu offenbar festgefugten politischen Strukturen und beträchtlichem Wohlstand gelangt war)7. Diese Griechen von Euboia haben etwa um 775 auch Pithekussai besiedelt und dort u. a. Eisenverhüttungsbetriebe begründet.8 Damit hatten diese euboiischen Griechen in der 1. Hälfte des 8. Jh. das südliche und das nördliche Ende sowie die Mitte eines klassischen Handelsweges für den Mitteleuropa-Orient-Handel in der Hand. Neuerungen aller Art - heute würde man sagen: technische Innovationen zur Effizienzsteigerung - konnten auf diesem Wege binnen kurzem quer durch den ganzen Mittelmeerraum verbreitet werden. I 158 Zu diesen Neuerungen gehörte auch das Mittel zur Fixierung der Sprache, die Schrift. Denn die Aufschriften, die auf Pithekussai gefunden worden sind - die berühmteste ist die des sog. Nestor-Bechers (Abb. 5), geschrieben zwischen 730 und 720 9 - , zeigen die Charakteristika des Alphabets von Chalkis auf Euboia (das von Pithekussai dann nach Etrurien wanderte und so Grundlage des lateinischen Alphabets wurde). Wenn Chalkidier von ca. 800 an mit den Phöniziern gemeinsam in den Kontoren von Al Mina saßen, werden sie nicht allzu lange tatenlos zugesehen haben, wie sich ihre phönizischen Kollegen die Registrierund Abrechnungsarbeit durch ein Schreibsystem erleichterten. Die Übernahme dürfte also bald nach 800 erfolgt sein. So weit die beiden seit längerem bekannten Tatbestände. Zu diesem Kenntnisstand ist nun seit 1987 ein neues Dokument hinzugekommen: (c) In Band 12 der , Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N. F.' hat der kürzlich verstorbene Erlanger Gräzist und Schriftforscher Alfred Heubeck in Kooperation mit Würzburger und Erlanger Kollegen und mir eine ,Alphabettafel' veröffentlicht und provisorisch interpretiert, die unser Wissen auf ein neues Fundament stellen könnte.10 Diese .Würzburger Alphabettafel', die 1982 als Bestandteil der Privatsammlung Kiseleff dem Martin v. WagnerMuseum Würzburg (Leiterin: Prof. Dr. Erika Simon) vermacht worden war, ist eine Bronzetafel im Format 21 χ 14 cm, die auf beiden Seiten in 19 bzw. 17 ho7
Murray 1982, 96-98; P. Blome, Lefkandi und Homer, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N. F. [WüJbb] 10 (1984), 9-22. 8 Murray 1982, 94. 9 Heubeck, Schrift 1979, 114; Hansen 1983, 252: „ca.735-720" (den mysteriösen Druckfehler „535-520" hat er in ZPE 58 [1985], 234, korrigiert). 10 A. Heubeck, Die Würzburger Alphabettafel. WüJbb 12 (1986), 7-20.
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
43
rizontalen Zeilen linksläufig mit 24 Folgen des griechischen Alphabets beschrieben ist (Abb. 6, 7, 8). Die Tafel steht, wie sich sogleich herausstellte, nicht allein. Sie hat drei Schwestern, zwei davon in New York: gleiches Material, gleiche Größe, gleiche Beschriftung. Wir meinen, es handle sich um einen set der ursprünglich durchaus noch mehr Exemplare umfaßt haben kann. Schon die vier Exemplare, die wir bisher kennen, lassen aber kaum einen Zweifel daran, daß hier Serienproduktion vorliegt - zu welchen Zwecken auch immer (lediglich angemerkt sei hier, daß auch der sog. Nestor-Becher mit seiner witzig pointierten Zitatverarbeitung kein Einzelstück gewesen zu sein scheint; ich persönlich glaube aufgrund bestimmter Indizien auch hier an Serienproduktion).11 Das Überraschende, ja geradezu Sensationelle an den 4 gleichen Alphabettafeln ist nun, daß sie das soundsooft wiederholte griechische Alphabet noch ohne die Zusatzzeichen Φ, Χ, Ψ und - was besonders auffällig ist - auch ohne das Zusatzzeichen Y darbieten. Man erinnert sich: das phönizische Alphabet enthielt nur die 22 Zeichen aleph bis täw (also griechisch alpha bis tau). I In dieser unverän- 159 derten Reihenfolge, mit den gleichen Buchstabennamen, wurde es von den Griechen übernommen. Allerdings gaben die Griechen einigen Zeichen davon andere Lautwerte, so wie sie sie benötigten, und fügten im Laufe der Zeit fünf weitere Zeichen hinten an: das später so genannte u psilon (.nacktes u'), das sie aus dem phönizischen Konsonanten wäw (griechisch wau, heute Vau) entwickelten, die drei Doppelkonsonanten ph (Φ), kh (X), ps (Ψ), und - ganz zuletzt und spät - das o mega (Ω), das .große O'. Man hat schon immer gewußt, daß die Zufiigung dieser 5 Zeichen eine sekundäre Verbesserungsmaßnahme war, die sich als Folge von Mißverständnissen beim praktischen Gebrauch des unerweiterten 22-Zeichen-Systems aufgedrängt hatte.12 Bisher hatten wir allerdings noch kein einziges Beispiel für griechischen Schriftgebrauch aus dieser Vor-Erweiterungsphase. In den vier Alphabettafeln könnte nun ein solches Beispiel vorliegen. Da die Erweiterung nicht allzu lange nach der Schriftübemahme erfolgt sein kann unsere bisher allererste Inschrift, die der oben erwähnten Dipylon-Kanne von 740, enthält bereits sowohl das Y als auch das X (Abb. 1 : NyN, ΟΡΛΈΣΤΟΝ) - , hätten wir mit den Tafeln also einen Beleg für griechische Alphabetschriftlichkeit kurz nach der Übernahme selbst.
11
Latacz, Homer 1985, 83; s. die Buchstabenreste auf den Pithekussai-Scherben bei A. Johnston, The extent and use of literacy: the archaeological evidence, in: R. Hägg (Hrsg.), The Greek Renaissance of the Eighth Century B. C.: Tradition and Innovation, Stockholm 1983, 63-68. 12 Heubeck, Schrift 1979, 89-90. 96; Heubeck 1986, 16-18.
44
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Alles kommt jetzt darauf an, diese Tafeln zu datieren. Bis zur Stunde haben wir nur für die zwei New Yorker Tafeln eine Datierung, und zwar die vage Angabe .Northern Egypt, 8 th century BC or earlier'. 13 Wir wissen bisher nicht, wer diese Datierung vorgenommen hat und auf Grund welcher Indizien. Leider ist auch noch keine Material-Analyse zustande gekommen. Kommunikationsschwierigkeiten und Voraus-Informationen über zu erwartende technische Probleme beim Versuch der Metall-Datierung haben das bisher verhindert. Die nächste Aufgabe wird also darin bestehen müssen, die 4 Tafeln möglichst an einem Ort zusammenzuführen und vergleichend zu analysieren, dann, die Schmutz- und Patinaschicht zu entfernen, schließlich, eine naturwissenschaftliche Methode zur archäometrischen Bronze-Analyse zu entwickeln, wie es sie nach kompetenter Aussage bisher noch nicht gibt. 14 Sollte dies im Laufe der 160 Zeit gelingen und sich danach bewahrheiten, was wir vermuten, daß nämlich diese Tafeln aus dem Beginn des 8. Jh. stammen und eine Frühform des euboiischen Alphabets repräsentieren, dann wäre der Beginn der griechischen Alphabetschriftlichkeit mit kaum noch erhoffter Präzision datiert und lokalisiert. Vermutlich würde sich dann auch die alte Annahme bestätigen, daß die Übernahme noch vor dem ersten historischen Datum der griechischen Eisenzeit-Geschichte erfolgt ist, nämlich vor 776, dem Beginn der Olympiasieger-Listen.15 Dies ist Zukunftsmusik. Was aber unabhängig von dem Neufund bestehenbleibt, ist das Faktum, daß Schriftgebrauch in Griechenland - jedenfalls Gebrauch einer eigenen griechischen Schrift (theoretisch hätte man ja als Grieche
13
Heubeck 1986, 7. Ich stütze mich hier auf zwei briefliche Gutachten: (1) von Professor George Rapp jr., Direktor des .College of Science & Engineering' an der University of Minnesota, vom 8.12.1987 (Professor Rapp verfügt über eine 20jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Archäometrie und arbeitet mit dem Max-Planck-Institut für Kernphysik Heidelberg zusammen); (2) von Professor Dr. Ulrich Leute, dem Autor des Werks .Archaeometry. An Introduction to Physical Methods in Archaeology and the History of Art', Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft 1987, vom 9.4.1988; beiden Kollegen sei auch an dieser Stelle aufrichtig gedankt. Zu danken habe ich für Mitarbeit an diesen Fragen ferner Jerome Sperling (Athen), Manfred Korfmann (Tübingen), Michel Lejeune (Paris), Rudolf Wächter (Oxford), Heide Froning (Würzburg) sowie ganz besonders Erika Simon (Würzburg), die mir am 8.7.1988 ihre Entscheidung mitteilte, die Würzburger Tafel ungeachtet ihrer Bedenken für eine naturwissenschaftliche Spezial-Untersuchung in München zur Verfügung zu stellen. Die Echtheitsfrage bleibt vorläufig offen. 15 Heubeck, Schrift 1979, 100: das aus bereits 26 Zeichen bestehende .Uralphabet' wurde von den griechischen Händlern „um 775 aus dem Osten nach Euboia mitgebracht"; Heubeck 1986, 18: wahrscheinlich haben „die Euboier [...] spätestens im 2. Viertel des 8. Jh.s ihr Alphabet [...] nach Ischia mitgebracht". Vgl. Murray 1982,122; Latacz, Homer 1985, 24. 70. 14
in der mündlichen Überlieferungsphase
des griechischen Heldenepos
45
jederzeit ζ. B. auch semitisch schreiben können, sofern man Sprache und Schrift beherrschte) - zwischen 1100 und 800 unwahrscheinlich ist. (4) Niederschrift griechischer Dichtung zwischen dem Zusammenbruch der griechischen Palastkultur der Spätbronzezeit (.mykenische Periode') und der griechischen Renaissance des 8. Jahrhunderts kann also nicht stattgefunden haben. Nun erzählen aber Ilias und Odyssee von Vorgängen, die sie selbst vor jene Zäsur legen, die wir den Zusammenbruch der Palastkultur nennen: In Ilias und Odyssee sind die von Schliemann, Dörpfeld, Biegen und anderen seit 1870 wiederentdeckten Palastruinen von Troja, Mykene, Tiryns, Pylos, Theben, Iolkos usw. noch unzerstörte Heimstätten blühenden Lebens, die miteinander in genealogischer Verflechtung und politischem Kontakt stehen, miteinander kooperieren, einander bekämpfen usw. Vorausgesetzt wird also in diesen Epen eine spätbronzezeitliche (,mykenische') griechische Welt. Dieser Widerspruch läßt sich, soweit bisher ersichtlich, nur auf drei Arten lösen: (a) Diese ganze mykenische Welt ist aus einigen noch nach ihrem Untergang sichtbaren Überresten (.Ruinen') zur Entstehungszeit unserer Epen, also im 8. Jh., extrapoliert, sozusagen ,hochgerechnet' worden. (b) Sie ist auf kombinatorischem Wege mittels ,Ruinen-Extrapolation' plus dunklen Familienreminiszenzen bereits nicht allzulange nach ihrem Untergang, und damit lange vor der Entstehungszeit unserer Epen im 8. Jh., rekonstruiert und dann mündlich weiterbewahrt worden. (c) Die Kenntnis dieser Welt - nicht nur ihrer Existenz, sondern, in beschränkterem Umfang, auch ihrer Funktionsweise - hat sich aus ihr heraus über ihren Untergang und über die anschließenden 300 Jahre hinweg durch kontinuierliche mündliche Überlieferung gehalten. I Alle drei Positionen sind während der langen Geschichte der Homerforschung mit Leidenschaft vertreten worden.16 Die geringste Wahrscheinlichkeit hat, wie wir heute sehen können, die erste Position für sich: In beiden Epen werden als Basis der Handlung gewisse historische Grundkonstellationen vorausgesetzt, die zur Entstehungszeit dieser Epen, also im 8. Jh., so vollständig und spurlos von andersartigen historischen Grundkonstellationen abgelöst worden waren, daß es für einen Menschen des 8. Jh. keinerlei Indiz mehr gab, aus dem er die damalige Konstellation hätte hochrechnen können. Dafür nur ein Beispiel: In beiden Epen ist als Siedlungsraum der Griechen historisch korrekt der Siedlungsraum der Griechen des achten Jahrhunderts vorausgesetzt - mit einer Ausnahme: das geAuf eine Literaturliste wird hier verzichtet; Überblick: Lesky 1967.
46
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
samte kleinasiatische Griechenland mitsamt den vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios, Samos usw. fehlt. Es wird als Siedlungsraum nichtgriechischer (kleinasiatischer) Völkerschaften (wie der Phryger, Karer, Lykier usw.) behandelt. Gerade dieses Gebiet - die Heimat des Iliasdichters - war aber bereits seit ca. 1050 griechisch besiedelt.17 Ein griechischer Einwohner dieses Gebiets hätte sich also 300 Jahre später, um 750, bei reiner Fiktion seiner Geschichte im Hochrechnungsverfahren und in Ermangelung jeglichen schriftlichen Quellenmaterials ein Griechenland ohne dieses Gebiet nicht vorstellen können. Ein Griechenland ohne dieses Gebiet ist aber die historische Realität der Vorkatastrophenzeit, also der Zeit der blühenden Paläste (und einiger Jahrzehnte danach, bis zur um 1050 einsetzenden griechischen Kolonisation Kleinasiens, der sog. .ionischen Wanderung')· Die zwingende Folgerung daraus ist, daß die historische Grundkonstellation .Griechenland ohne Kleinasien' vom Zeitpunkt ihrer historischen Existenz an (oder doch von einem Zeitpunkt nicht lange danach an) bis zum Zeitpunkt ihres Erscheinens in der Epik des 8. Jh.s niemals vergessen, sondern entweder über die Katastrophe hinweg oder doch von einem Zeitpunkt bald danach an kontinuierlich weiterbewahrt worden war (= Position c oder b). Das bedeutet natürlich zugleich, daß diese Grundkonstellation 300 Jahre hindurch auch ständig mit Leben erfüllt worden war, daß man sich also Geschichten aus dieser Zeit erzählte. 5) Die Frage ist nun, ob diese Geschichten ebenso historisch waren wie die Grundkonstellation. Die Antwort kann nicht einfach an die .Erzählforschung' (Sagenforschung, Märchenforschung, Ethnologie usw.) delegiert werden. Damit würde eine entscheidende Stufe übersprungen. Zuvor ist vielmehr zu klären, welches das bevorzugte Transportmittel war, mittels dessen diese Geschichten bis ins 8. Jh. transportiert wurden. Schrift kommt, wie gezeigt, nicht in Frage. Der danach allein noch verbleibende mündliche Transport kann aber auf verschiedene Arten erfolgt sein. Die zwei wichtigsten mündlichen Transport-Arten generell sind die ,freie Erzählung' (weder an gesellschaftliche Institutionen noch 162 an erzähleirische Formkonventionen gebunden, willkürlich stattfindend und beliebig gestaltend) und die ,gebundene Erzählung' (institutionell und formal durch Traditionen festgelegt, daher einem Erwartungshorizont antwortend und infolgedessen nicht willkürlich gestaltbar). An dieser Stelle kommt Milman Parry ins Spiel. Er hat nachgewiesen, daß unseren Epen Ilias und Odyssee eine lange mündliche Formtradition zugrunde
17
Murray 1982, 23.
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
47
liegt, 18 daß also Ilias und Odyssee lediglich zwei Repräsentationen eines im Zeitpunkt ihrer Verfertigung bereits sehr alten und während seiner langen Lebensdauer sehr produktiven Typus »gebundener Erzählung' sind. Sichtbar geworden sind diese beiden Typus-Repräsentationen durch die Schrifteinführung des 8. Jh. 19 Ohne die dadurch ermöglichte und im Falle seiner beiden Repräsentationen Ilias und Odyssee tatsächlich realisierte Überführung in die Schriftlichkeit wäre dieser ganze Typus unbekannt geblieben. So jedoch stellen Ilias und Odyssee für uns den sichtbaren Endpunkt einer bestimmten Form des Transportmittels .gebundene Erzählung' dar, deren Normensystem durch genaue Analyse ihrer beiden Repräsentationen Ilias und Odyssee rekonstruierbar ist. Vom Genauigkeits- und Wahrscheinlichkeitsgrad der Rekonstruktion dieses Normensystems hängt dann auch die Antwort auf unsere Frage ab, wieviel Historisches dieses Transportmittel,hexametrische mündliche griechische Epik' transportiert haben kann. Da bisher noch keine Rede davon sein kann, daß die erforderliche Rekonstruktionsarbeit bereits abgeschlossen wäre (für die gegenwärtige Homerforschung steht die Historizitätsfrage nicht gleichermaßen im Zentrum des Interesses wie für dieses Kolloquium), kann die Frage zur Zeit auch noch nicht verbindlich beantwortet werden. Die gängigen Alternativ-Antworten .wenig bis nichts Historisches' bzw. .außerordentlich viel Historisches' haben daher nur den Wert von Vermutungen. Andere Transportmittel neben der hexametrischen mündlichen griechischen Epik müssen natürlich zumindest in Rechnung gestellt werden. Neben der selbstverständlichen .freien Erzählung' (für die uns gerade auch die beiden Epen reiche Belege liefern: in ihnen wird gern, lange, ausführlich und nicht nur .synchronisch', sondern auch zeitschichtenweise mehrfach in die Tiefe der Vergangenheit zurückspringend erzählt) 20 kommt ζ. B. wohl auch die gebundene Erzählung der Chorlyrik in Frage - eine Gattung, die nicht erst im 7. Jh. Alkman oder Terpander erfunden haben können. Hier ist noch viel zu tun. Allerdings dürften sowohl die .freie Erzählung' des Alltags als auch lyrische Gattungen wie die Chorlyrik wesentlich anfälliger für Historizitätsdestruktion sein als das formenkonservative Hexameterepos.
Das Haupttransportmittel für Vergangenheitswissen dürfte danach und nach allen sonstigen Indizien, die wir haben, während der .condicio Graeca oralis' die hexametrische Heldenepik gewesen sein. Um zu erfahren, wie weit dieses Ver18
Parry 1928.1930 (beides in: A. Parry 1971 und Latacz 1979 [deutsche Übersetzung]). Latacz, Homer 1985, Kap. 1. Siehe z. B. Od. 9,507-512: der Sänger erzählt, wie Odysseus erzählt, wie der Kyklop erzählt, wie Telemos erzählt - daß einst ein Odysseus den Kyklopen blenden werde. - Umfassend zur Frage: W. Kulimann, Vergangenheit und Zukunft in der Ilias. Poetica 2 (1968), 15-37. 19
48
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
gangenheitswissen von den Endprodukten Ilias und Odyssee an zurückgereicht haben kann, müßten wir nun wissen, wann diese hexametrische Heldenepik entstanden ist. Hier sind theoretisch zwei Antworten möglich, die denn auch praktisch immer wieder vorgetragen worden sind: (a) Die hexametrische Heldenepik ist erst nach der großen Katastrophe entstanden. Diese Annahme entspricht der oben umrissenen Position 4 b (s. S. 45). Ihre Verfechter verweisen darauf, daß unter den Tausenden von Linear B-Täfelchen, die bisher in den griechischen Spätbronzezeitzentren Knossos, Pylos, Mykene und Theben gefunden worden sind und die alle authentische griechische Schriftdokumente der Vorkatastrophenzeit darstellen, keines ist, das direkt oder indirekt die Existenz einer irgendwie metrisch gebundenen Dichtung zwingend beweisen könnte. Diesem argumentum e silentio wird dann stützend die Wahrscheinlichkeitserwägung an die Seite gestellt, daß in der Zeit nach der Katastrophe gerade die Erfahrung des Verlusts zum Versuch der Rettung des Verlorenen durch (Wort-)Kunst geführt haben könnte. Die Entstehung der hexametrischen mündlichen griechischen Epik würde sich dann einem (vielleicht patriotischen) Nostalgie-Impuls (des Adels) verdanken. (b) Die hexametrische Heldenepik ist bereits lange vor der großen Katastrophe entstanden (= Position 4c, s. oben S. 45). Die Anhänger dieser Position weisen vor allem auf die unerhörte Höhe anderer Künste hin, wie sie kurz vor dem Zusammenbruch in den Palästen erreicht worden war und uns durch die Bodenfunde der letzten Jahrzehnte immer deutlicher geworden ist: Architektur, Malerei, Kleinkunst, Kunsthandwerk (in Gold, Silber, Elfenbein, Einlege-Arbeit usw.). Sie stellen die Frage, ob es wahrscheinlich ist, daß in dieser künstlerisch fast schon überkultivierten Welt gerade die Wortkunst gefehlt haben sollte - die dann aber in den Zeiten des großen Mangels und der allgemeinen Kulturregression nach der Katastrophe erfunden worden wäre. Das Stillschweigen der Linear B-Dokumente dagegen halten die Vertreter dieser Position für eher natürlich: Wie Ilias und Odyssee noch zeigen, ist das Prinzip dieser Wortkunst gerade die Mündlichkeit. Es besteht kein Anlaß zu der Annahme, daß dies jemals anders gewesen war. Hätte diese Kunst also bereits in der Vorkatastrophenzeit bestanden, so wäre sie auch dort im Medium der Mündlichkeit gepflegt worden. Daß sie mittels der relativ spät von den Griechen auf ihre Belange zurechtgestutzten Silbenschrift der Kreter (= Linear B) mit ihrem schwerfälligen und äußerst vieldeutigen Notationssystem jemals ,recordiert' oder gar weiterentwickelt worden wäre, ist eher unwahrscheinlich. Hexameterdichtung in Linear Β ist also gar nicht zu erwarten. Erwähnung von Hexameterdichtung auf Linear Β-Täfelchen
in der mündlichen Überlieferungsphase
des griechischen Heldenepos
49
andererseits wäre in Anbetracht der rein kommerziellen und verwaltungstechnischen Registrierungsfunktion der Linear B-Palastbuchhaltungen eher ein außergewöhnlicher Glücksfall. I Hinzuzufügen wäre ein weiteres Argument, das - obwohl grundsätzlich be- 164 kannt - in der bisherigen Diskussion kaum schon die seinem Beweiswert entsprechende Beachtung gefunden hat: Eine Heldendichtung, die erst nach der Katastrophe erfunden und ausgebildet worden wäre, würde mit großer Wahrscheinlichkeit den Untergang der großen Zeit, zu deren Verherrlichung aus dem Rückblick heraus sie ja dann überhaupt geschaffen worden wäre, in dieser oder jener Form erwähnen. In den uns überlieferten Endprodukten Ilias und Odyssee fehlt aber jeder auch nur annähernd explizite Hinweis auf diesen Untergang (das wenige, was in diese Richtung weist, sind implizite Andeutungen).21 Die Welt der Vorkatastrophenzeit ist in den beiden Epen - noch im achten Jahrhundert als ganz und gar gegenwärtig und intakt vorausgesetzt; von späteren Zuständen und Entwicklungen nimmt diese Epik explizit keine Notiz. Dieser Tatbestand ließe sich, wäre diese Epik erst nach der Katastrophe entstanden, nur durch ein von vornherein zur Norm gemachtes Prinzip systematischer und konsequenter Archaisierung erklären, das die je nachfolgenden Sängergenerationen fehlerfrei, d.h. ohne jeden .Ausrutscher', weiterbefolgt haben müßten. Undenkbar ist das nicht. Wahrscheinlicher dürfte aber die Annahme sein, daß diese Epik vom Untergang der Kultur, die sie voraussetzt, deshalb nichts sagt, weil sie vor diesem Untergang entstanden war. In diese Richtung weisen auch ihre bevorzugten Themen. Es sind vor allem der Kampf um Troja und Theben, aber z.B. nicht der (historisch ja belegte) Zug gegen Knossos im 15. Jh. Die Erklärung dafür könnte darin liegen, daß Troja und Theben für Heldentaten (εργα ανδρών) standen, die - wenn sie überhaupt Historisches reflektieren - mit Ereignissen der damals relativ jüngeren bzw. jüngsten Vergangenheit zusammengehangen haben müssen und die daher nach der aus der Odyssee wohl rückprojizierbaren Devise dieser Epik ,Die Menschen wollen ja immer die neueste Besingung hören' (α 35 If.) gerade in der Zeit vor dem Zusammenbruch am aktuellsten gewesen wären. Über ein Lied des imaginierten Vorkatastrophenzeitsängers Demodokos mit dem Thema , Troja' heißt es dementsprechend einmal in unserer Odyssee:,dieses Liedes Ruhm reichte ja zu diesem Zeitpunkt - τότ(ε) (das heißt aber nach der imaginierten, innerepischen 21
Lesky 1967, Abschnitt VI (.Kultur'). Vgl. Strasburger 1972, 27 („... mit kühnem Vorausblick weit über den Untergang Trojas hinweg in mächtiger Versinnbildlichung des spurlosen Vergehens menschlicher Werke..."; Hervorhebung von mir).
50
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Zeitrechnung: 10 Jahre nach der Eroberung Trojas durch die Griechen) - bis zum Himmel4: θ 74. Knossos lag zu diesem Zeitpunkt in der Tat schon rund 250 Jahre zurück. Es ist m.E. ganz natürlich, daß beim Abbrechen einer lebendigen zeit- und gesellschaftsbezogenen Kunstgattung (und um eine solche hätte es sich nach unseren Voraussetzungen gehandelt) 22 durch Verschwinden ihres gesellschaft165 lilchen Nährbodens vornehmlich der zuletzt gepflegte Themenbestand dieser Kunstgattung .gefriert'. Daß dann nach der Rettung dieser Kunstgattung aus der Katastrophe und über die unmittelbare Nachkatastrophenzeit hinweg keine neuen Themen aus der je aktuellen Gegenwart der Sänger mehr hinzukamen, würde sich vor allem aus der Funktion dieser Epik erklären: Diese Dichtung war zweifellos seit jeher eine Kunst der Oberschicht gewesen: sie hat (wie jedenfalls ihre uns allein noch zugänglichen Spätprodukte Ilias und Odyssee zeigen) den großen Überblick (räumlich und zeitlich), sie kommt nie aus der Froschperspektive, Themen und Geschmacksniveau von Unterschichten kennt sie nicht23 (eben darum hatte sie auch nur von der Oberschicht gerettet werden können: weil nur diese ein Interesse an ihr besaß; gerade diese Oberschicht aber konnte seinerzeit der Katastrophe aufgrund ihrer weiträumigen Verbindungen, ihres Informationssystems und ihrer Verfügungsmacht über Menschen und Transportmittel wenigstens teilweise entkommen und in meist überseeische .refugee settlements' ausweichen). 24 Diese Oberschicht, der Adel, hatte aber, soweit er ihr entkommen war, nach der Katastrophe schwerlich ein Interesse an der rückblickenden Darstellung seines eigenen Fiaskos und seiner nunmehr eher unrühmlichen Gegenwart. Er zog die erhebende und stimulierende Vergegenwärtigung seiner einstigen Größe (und damit die Aufrechterhaltung der Fiktion seiner grundsätzlichen sozialen Identität mit jenen Vorzeithelden über die Katastrophe hinweg) vor. Hesiod, der um 700 dichtende, aus Kleinbauernmilieu stammende Adelsmahner, ist an eine solche aus Klasseninteresse entspringende Selbstschutz-Ideologie nicht gebunden. Er spricht daher das, was die Adelsepik ignorierte, offen aus: , Als viertes der fünf Geschlechter der Menschen, die diese Erde seit Weltbeginn gesehen hat' - sagt er - .schuf Zeus das göttliche Geschlecht der Helden (ανδρών ηρώων θείον γένος), wel-
22
Latacz, Homer 1985, 106. 63-68. J. Latacz, Frauengestalten Homers. Humanistische Bildung 11 (1987), 49 [in diesem Band S. 95-124], 24 Siehe dazu die regelmäßigen Ausgrabungsberichte im Abschnitt .Archaeology in Asia Minor' im .American Journal of Archaeology' und vgl. die Abschnitte .News Letter from Greece' ebd. 23
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
51
che .Halbgötter' genannt werden (οι καλέονται / ημίθεοι): unsere Vorgänger auf dieser Erde (προτέρη γενεή κατ' άπείρονα γαίαν). Aber diese hat teils der Krieg hinweggerafft - und zwar den einen Teil der Krieg um Theben, den anderen Teil der Krieg um Troja -, teils sind sie von Zeus auf die Inseln der Seligen versetzt worden' (Op. 156-173). Diese poetisch formulierte Konstatierung eines möglicherweise tatsächlich historischen Faktums: Zusammenbruch der griechischen Spätbronzezeitkultur nach innerer Schwächung durch militärische Kapazitätsübersteigerung und Flucht der Restbestände nach Übersee (,Inseln der Seligen') ist um 700, nicht lange nach der Entstehung der Ilias, niedergeschrieben worden. Hesiod konnte den Untergang jener großen Zeit unverbrämt und nüchtern registrieren (und damit die Identitätsfiktion der zeitgenössischen Adelsschicht zerstören), weil er außerhalb der traditionellen Adelsepik, außerhalb der traditionellen Vergangenheitsbewahrung mittels der .gebundenen Erzählung' stand. Seine Dichtung will ja gerade nicht rühmend das Vergangene gefroren weitertragen, sondern sie ist wieder (wie es in ihrer lebendigen Blütezeit die Adelsepik auch gewesen war) ganz gegenwartsbezogene Dichtung, die die Lebenswirklichkeit ihres Autors I nicht ,subkutan' als Spiegelung in eine thematisch erstarrte Gattung hineinschmuggeln muß, sondern sie unmittelbar zur Sprache bringen kann. Die Kraft, sich der Adelsdichtung so bewußt und prononciert entgegenzusetzen, wie sie es permanent tut, bezieht die neue Dichtung Hesiods ja gerade daraus, daß sie die thematische und ideologische Erstarrtheit dieser Adelsdichtung erkannt hat.
III Einiges spricht danach dafür, daß die hexametrische mündliche griechische Epik, wie sie uns in ihren Spätprodukten Ilias und Odyssee noch greifbar ist, keine Neuentwicklung der sog. .Dunklen Jahrhunderte' nach der Katastrophe war, sondern die Fortsetzung einer schon vor der Katastrophe gepflegten und schon damals hochkultivierten Wortkunstform.25 Aber auch wenn wir mit dieser Annahme fehlgingen und die oben skizzierte Position 4 b zuträfe (s. S. 45), müßten wir auf jeden Fall von der Voraussetzung ausgehen, daß Vergangenheitsbewahrung im Griechenland der Jahrhunderte XI, X und IX vornehmlich durch die .gebundene Erzählung' des hexametrischen mündlichen griechischen Epos erfolgte. In beiden Fällen würde also unsere eigentliche Frage, von der wir ausgegangen sind (s. oben S. 39), tatsächlich an das .richtige', d.h. an auskunftsfähiges Material gerichtet. Nachdem dies gesichert ist, fragen wir also nimmehr: Was kann diese Form .gebundener Erzählung' über die schriftlose Lücke zwischen ca. 1200/1100 und ca. 725 hinweg an Vergangenheit bewahrt haben?
25
So schon Lesky 1967, Sp. 8, 28 ff. 15,39. 17,29; im gleichen Sinne jetzt auch F. Graf, Griechische Mythologie, München - Zürich 1985. 2 1987, 73-75.
52
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Auf der Grundlage der bisherigen Erwägungen sieht man sofort, daß es nicht übermäßig viel gewesen sein kann. Denn ob die Primär-Ausprägung dieser Dichtung nun bereits vor oder erst kurz nach der Katastrophe erfolgte: ihre Fortsetzung in den späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten war jedenfalls der lebendigen Strukturen, die sie voraussetzte, beraubt; sie hatte .keinen Boden mehr unter den Füßen'. Je weiter sie sich zeitlich von dem, was sie unverändert nach wie vor zugrunde legte, entfernte, desto mehr mußte sich in ihr die Kenntnis von dem, was sie beschrieb, verdünnen - trotz aller gattungsimmanenten »Formenstarre'. Denn diese Dichtung besaß - und zwar, wenn nicht alles trügt, von Anfang an - zwei Wesensmerkmale, die sie zwar als Kunst groß machten, als Transportmittel von Vergangenheit jedoch im gleichen Maße .entleerten': (1) Diese Dichtung ist nicht auf die Fakten konzentriert, sondern auf die Wirkungen dieser Fakten. Die hexametrische mündliche griechische Epik ist nicht Geschichtsschreibung, sondern Rühmung und damit immanente Erziehung; (2) diese Dichtung funktioniert nur auf der technischen Basis der Improvisation. I
167
Aus dem ersten Wesensmerkmal, also der letztlich pädagogischen Wirkungsabsicht, folgte eine immanente Tendenz zur ständigen Um-Interpretation der Fakten im Sinne der je zeitbedingten Bedürfhislage. Aus dem zweiten Wesensmerkmal, der Improvisation, folgte - diese Tendenz unterstützend - eine große Leichtigkeit des technischen Vollzugs dieser Um-Interpretation. Beide Konsequenzen mußten in ihrem Zusammenwirken zwar nicht zu einer Faktendestruktion führen (eine solche hätte für diese Dichtung aufgrund ihrer Sozialfunktion im Gegenteil den Tod bedeutet), aber zu einer Faktenverzerrung und -entstellung, oder besser gesagt: zu einer Verzerrung und Entstellung des ursprünglichen ¥dk\enzusammenhangs. Wie stark diese Dichtung von ihrer Verpflichtung zur Bewahrung der Fakten als solcher durchdrungen ist (also zu dem, was wir Authentizität nennen), gibt sie unzweideutig an jenen Stellen der Odyssee zu erkennen, an denen sie sich indirekt selbst zum Thema macht. Besonders aussagekräftig sind in dieser Hinsicht zwei Szenen im 8. Gesang, d. h. im Epos-Abschnitt .Odysseus bei den Phaiaken '26: Hier erfindet der Odysseedichter einen blinden mündlichen Sänger Demodokos (,der von der Gemeinschaft gern Aufgenommene'), der vor Adelspublikum (den Phaiaken) mündliche Heldendichtung mit dem Thema ,Troja' improvisiert; seine besondere Pointe erhält dieses eingespiegelte Miniatur-Modell der eigenen Vortragssituation (der .performance') des Odysseedichters dadurch, daß dieser Dichter einen der imaginierten Zuhörer zum Rezipien-
Dazu die vorzügliche Interpretation von R. Kannicht, Der alte Streit zwischen Philosophie und Dichtung, Der altsprachliche Unterricht [AU] 23/6 (1980), 16-19 (,Das poetologische Selbstverständnis des Epos'); vgl. Latacz, Homer 1985, 95 f.
in der mündlichen Oberlieferungsphase des griechischen Heldenepos
53
ten einer performance seiner eigenen Taten und Erlebnisse macht: den (vom imaginierten oral poet Demodokos ebenso wie vom imaginierten Demodokos-Publikum nicht identifizierten) Odysseus. Die so geschaffene Situation einer Rückprojektion der eigenen Kunstausübung aus dem 8. Jh. - also aus der Erzählzeit - in die Zeit der Helden selbst - also in die erzählte Zeit erzeugt eine Fülle bewußter (und wahrscheinlich noch mehr unbewußter) Aussagen Uber das Bezugssystem zwischen Dichter, Dichtung und Publikum und wird so zum dokumentarischen Beleg des Selbstverständnisses dieser Kunst. Nach dem Mittagsmahl im Palast des Phaiakenkönigs Alkinoos beginnt Demodokos seinen Heldensang (άειδέμεναι κλέα ανδρών, θ 73), und zwar ,aus einem Lied (οΐμης, gen. part.) 27 , dessen Ruhm ja damals bis zum weiten Himmel hinaufreichte' (s. oben S. SO): die Auseinandersetzung des Odysseus und des Achilleus, ,wie sie einmal in Streit gerieten bei einem Götteropfer, mit schrecklichen Worten' usw. (Θ 74-77). Odysseus, im Gesang des Sängers mit sich selbst konfrontiert, kann die Tränen nicht zurückhalten. Der Sänger endet, Odysseus trocknet seine Tränen, doch da wird der Sänger vom begeisterten Publikum zur Fortsetzung gedrängt und hebt erneut an, Odysseus muß wiederum weinen, Alkinoos bemerkt es und schlägt taktvoll eine andere Unterhaltung vor: Wettspiele. Diese Spiele ziehen sich bis gegen Abend hin und bringen Odysseus eine Stärkung seines schon fast ganz verlorenen Selbstbewußtseins. So bittet er nach beendigter Mahlzeit den Demodokos von selbst um eine Fortsetzung seines mittags abgebrochenen .Troja-Liedes' - nun aber mit einer Episode, die für ihn nicht betrüblich sein kann, sondern ihn als Sieger, als Triumphator über Troja zeigen soll: I „Demodokos! ganz hervorgehoben lobe ich dich von den Sterblichen allen: Dich hat entweder die Muse gelehrt, Zeus' Kind, dich vielleicht auch Apollon: Sehr der Ordnung entsprechend singst du nämlich das schlimme Geschick der Achaier alles das, was sie taten und litten, und alles das, was sie unter Strapazen bewirkten und irgendwie so, wie wenn selbst dabeigewesen oder einem anderen (der dabei war) zugehört. Aber nun mach einen Sprung hinüber und singe das Lied von dem Pferde, dem hölzernen, welches Epeios gemacht hat mit Hilfe Athenes..." (Θ 487-493). Der Sänger unserer Odyssee läßt also einen Augenzeugen bestimmter historischer Ereignisse einen Sänger dieser Ereignisse (der selbst kein Augenzeuge war) deswegen zum .besten Sänger' erklären, weil der Sänger die Fakten so wirklichkeitsentsprechend darstellt, daß bei Augenzeugen der Eindruck entstehen kann, der Sänger sei selbst Augenzeuge (oder doch Zuhörer eines Augenzeugen) gewesen. Die Reputation des oral poet bemißt sich also nach dem Authentizitätsgrad seiner Darstellung. Unter Authentizität ist dabei aber nicht nur objektive Faktenwiedergabe verstanden, sondern darüber hinaus auch .stimmige' Wiedergabe der Fakten Wirkung. Denn Odysseus' Lob bezieht sich ja auf Demodokos' erstes Lied28, in dem er Odysseus und Achilleus .mit schrecklichen Worten' miteinander streiten ließ. Da aber Demodokos, wie Odysseus als Beteiligter natürlich genau weiß, eben nicht bei diesem Streit dabei war, kann er die damals gesprochenen .schrecklichen Worte' nicht wörtlich kennen. Er hat den Streit dennoch .sehr der 27 28
J. B. Hainsworth, in: Odissea Π (1982), 254 ζ. St. J. Β. Hainsworth, a. O. (vorige Anm.), 288 zu V. 489-91.
54
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Ordnung entsprechend' (λίην ... κατά κόσμον) wiedergegeben. Das heißt: Der Anspruch des Publikums richtet sich nicht primär auf Faktengenauigkeit (diese wird als selbstverständlich vorausgesetzt), sondern auf realistisch erscheinende Ausfüllung der nackten Fakten durch Darstellung ihrer Wirkungen auf die beteiligten Menschen. Es ist klar, daß dieser .höhere' (nicht positivistische) Begriff von Authentizität ebensosehr die Bewahrung eines Grundbestands von Fakten sichert, wie er die Bewahrung ihres ursprünglichen Zusammenhanges geradezu verbietet. Denn die Qualität liegt (wie später beim Drama) eben in der neuen Faktendeutung.
Vor dem Hintergrund dieser Selbstdarstellung der hexametrischen mündlichen griechischen Dichtung wäre es naiv, Ilias und Odyssee als Dokumente der Vergangenheitsbewahrung im Sinne eines Historiker-Textes zu lesen. Genauso naiv wäre es allerdings, diesen Dichtungen willkürliche Fakten-Änderung im Bereich der Grundkonstellation zuzutrauen. Wie später das attische Drama von Phrynichos bis zu Euripides kann auch die Hexameterdichtung über Jahrhunderte hinweg eine Änderung der Fakten-Grundkonstellation gar nicht gewollt haben; denn nur bei Beibehaltung des gewohnten und vom Publikum mühelos zu identifizierenden Rahmens der Geschichte waren Um-Interpretation und Neudeutung möglich, weil nur so Vergleichbarkeit gewährleistet war. Die Frage kann also nunmehr nur noch lauten: Was gehörte zur FaktenGrundkonstellation? Selbstverständlich kann es in unserem Zusammenhang nicht das Ziel sein, die Antwort auf diese vielverhandelte Frage in Form eines Katalogs von Einzelpunkten zu geben. Das ist Sache der Einzelforschung. Hier kann es nur darum gehen, das für die Wiedererkennbarkeit einer bestimmten οϊμη Unverzichtbare in Kategorien zu fassen. Im Falle der οϊμη .Trojanischer Krieg' ergeben sich diese Kategorien glücklicherweise nicht nur als logische Po169 stulate aus der I Grundforderung .Wiedererkennbarkeit', sondern auch aus der Konstanz ihrer konkreten Wiederkehr in den verschiedenen uns noch erhaltenen Reflexen dieser οϊμη in der frühen griechischen Literatur zwischen etwa 730 und 580, als die beiden Epen Ilias und Odyssee noch nicht so stark kanonisiert waren, daß sie die οϊμη .Trojanischer Krieg' nahezu allein repräsentierten. Neben diesen beiden Epen, die ja auch nur Ausschnitts-Reflexe der οϊμη sind, stehen in diesen rund 150 Jahren der beginnenden Literatur vielmehr weitere, teils von den beiden Epen unabhängige, teils die beiden Epen partiell mit einbeziehende Reflexe: die beiden Sachdichtungen des um 700 schreibenden Dichters Hesiodos (Theogonia und Erga kai Hemerai), die mythographischen Epen des sog. Epischen Kyklos (von verschiedenen Verfassern im 7./6. Jh. geschaffen mit dem Ziel, den οϊμη-Ausschnitt,Ilias' - 51 Handlungstage aus dem 10. Kriegsjahr - und den οϊμη-Ausschnitt .Odyssee' - 40 Handlungstage aus dem 10. Nachkriegsjahr - durch die lückenfüllende Nachtrags-Erzählung der vor, zwischen und nach ihnen liegenden Ereignisse zur Gesamt-οϊμη zu komplettieren),
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
55
schließlich die vielfältigen (für uns infolge Unkenntnis damals noch allgemein bekannter οΐμη-Segmente oft dunkel bleibenden) οΐμη-Anspielungen und -Verarbeitungen der frühen lyrischen Dichter (besonders Archilochos, Alkaios und Sappho).29 Durch Kombination der logischen Folgerungen aus dem Grundpostulat .Wiedererkennbarkeit' mit den Indizien dieser literarischen Reflexe ergeben sich folgende Kategorien der Fakten-Grundkonstellation (in Klammern jeweils solche Einzelbeispiele, die als sicher gelten können): (1) ein unveränderbarer Handlungsraum (Troja und die Troas); (2) eine unveränderbare Handlungszeit (eine „lange vergangene große alte Zeit", die ihrerseits wiederum eine ,alte Zeit' zur Vergangenheit hat: die Zeit der Argonauten und Theben-Kämpfer); (3) ein unveränderbarer Grundbestand an Personal (Helena als Auslöserin; Agamemnon und Menelaos als Angreifer; Priamos als Angegriffener); (4) eine unveränderbare Faktenfolge (Raub der Helena - zehnjähriger Rachekrieg - Eroberung Trojas - langwierige Heimkehr der Trojakämpfer); (5) eine unveränderbare Fakten-Kausalität (Raub der Helena —» Rachezug-Beschluß der Achaier -» Flottenversammlung in Aulis Überfahrt zur Troas —> Rückforderung der Helena —» Abweisung der Forderung —> Belagerung Trojas —» Widerstand der Festung —> lange Kriegsdauer —» große Menschenverluste auf beiden Seiten —» Kampf zwischen ,Falken' und ,Tauben' in beiden I Lagern —» Notwendigkeit einer ,Wunderwaffe' —> Bau des hol- 170 zernen Pferdes —» Eroberung der Festung —> Zerwürfnisse zwischen den Siegern —» getrennte Heimkehr der Einzelkontingente -> Zersplitterung der Kräfte); (6) ein unveränderbarer Grundbestand an Utensilien (Schiffe; Festungsmauern; das Hölzerne Pferd). Der Eindruck, mit diesen Kategorien sei die Fakten-Grundkonstellation so stark festgelegt gewesen, daß für eigene Erfindung der Tradenten nur wenig Raum blieb, trügt. So waren etwa in den Punkten .Personal' und .Utensilien' jederzeit Neuerungen und zeitgemäße Änderungen bzw. Ergänzungen und Omissionen möglich, in den Punkten ,Faktenfolge' und ,Fakten-Kausalität' waren jederzeit Raffungen, Dehnungen, Interpolationen, Motivations-Änderungen und -VertieDazu tritt das bedeutsame Zeugnis der frühen Sagenbilder: ca. 50 aus dem 7. Jh. beziehen sich auf den Trojastoff; s. dazu die grundlegende literarhistorische Auswertung von R. Kannicht, Dichtung und Bildkunst. Die Rezeption der Troja-Epik in den frühgriechischen Sagenbildern, in: Wort und Bild (Symposion Tübingen 1977), München 1979, 279-296 (+ 6 Tafeln). - Die Bilder bei K. Schefold, Frühgriechische Sagenbilder, München 1964.
56
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
fungen usw. möglich. Der Um-Interpretation durch Binnenverschiebung, Auffüllung, Psychologisierung usw. stand also nichts im Wege. Das Ergebnis mußte im Laufe des Durchgangs der ο'ίμη durch Hunderte von performances, die von Tradenten unterschiedlicher Kenntnis-, Bildungs-, Geschmacks-, Temperaments-, Begabungs- usw. -Voraussetzungen an unterschiedlichen Orten des griechischen Siedlungsgebiets in unterschiedlichen Perioden der griechischen Nachkatastrophengeschichte geschaffen wurden, eine Verzerrung des ursprünglichen Faktenzusammenhangs bis zu dem Grade sein, daß der stets gewahrte Rahmen der Grundkonstellation zum Wechselrahmen wurde, in dem die Bilder von der gewissermaßen gotischen Original-Ausführung über Renaissance-, Barock-, Rokoko- usw. -Fassungen bis zur Klassik-Fassung (wie sie möglicherweise Ilias und Odyssee darstellen) einander ablösten; dabei malte sich jede Zeit gewissermaßen selbst mit in das Bild hinein. IV Dieser Beurteilung des Verhältnisses zwischen Bewahrung und Veränderung von Vergangenheit im hexametrischen mündlichen griechischen Epos schien nun lange Zeit die Auffassung gerade des Entdeckers der Mündlichkeit dieser Epik und Archegeten der Oral poetry-Theorie, Milman Parry, entgegenzustehen. Nach Parry reduzierte das eminent hohe Maß der Formelhaftigkeit dieser Dichtung ihre Veränderbarkeit auf ein Minimum. Die Formeln waren für ihn vorgeprägte Werkstücke, die im Improvisationsprozeß lediglich zusammengesetzt wurden: jeder Hexameter ein kleines Puzzle, zusammengefügt aus zwei- oder mehrgliedrigen Einzelstücken. Diese vorgestanzten Komposita müßten dann gewissermaßen als unveränderbare Informations-Chips - natürlich auch kleinere Sachverhalte starr, .gefroren', weitertransportiert haben. Um-Interpretationen wären dadurch überaus erschwert worden:
171
„Der Dichter denkt in der Sprache der Formeln. Anders als die Dichter, die geschrieben haben, kann er nur jene Ideen in Verse fassen, die in den Wendungen I enthalten sind, die er auf der Zunge hat; höchstens wird er noch solche Ideen ausdrücken, die denen der traditionellen Formeln so stark ähneln, daß er sie selbst nicht als verschieden empfinden würde. Zu keinem Zeitpunkt sucht er nach Wörtern für einen Gedanken, der noch niemals zuvor Ausdruck gefunden hat, so daß die Frage der stilistischen Originalität für ihn sinnlos ist." 30
Auch wenn wir im Gegensatz zu vielen voreiligen Zitatoren dieses Passus nicht übersehen, daß Parry hier ausdrücklich nur vom Stil spricht, kommen wir nicht
M. Parry, in: Latacz, Homer 1979, 242 (deutsche Übersetzung).
in der mündlichen Oberlieferungsphase
des griechischen Heldenepos
57
an der Feststellung vorbei, daß die implizierte Negation der Möglichkeit gedanklicher Neuerung diese Dichtung zu auch inhaltlicher Immobilität verurteilt. Diese Konsequenz seiner Aussage hat sich Parry offenbar nicht klargemacht. Wer diese Konsequenz jedoch zu Ende denkt, sieht sich zu der Annahme gedrängt, die hexametrische mündliche griechische Epik habe vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an - liege dieser nun vor oder nach der Katastrophe - nicht nur den Rahmen ihrer Geschichten über die Zeiten hinweg unverändert weitertransportiert, sondern gerade auch die Rahmenßllung. In letzter Konsequenz würde dies bedeuten, daß wir in Ilias und Odyssee nur minimal veränderte .Reprints' von Jahrhunderte zuvor entstandenen .Originalpublikationen' hätten. Da diese Ansicht sämtlichen Indizien widerspricht (wir brauchen nur an die berühmten homerischen Gleichnisse zu denken, die größtenteils Veranschaulichungsbilder aus der Welt des achten Jahrhunderts sind31), ist sie immer wieder in Zweifel gezogen und bekämpft worden (u.a. von Hainsworth, Hoekstra, Nagler, Nagy, Russo; s. den Beitrag Boedeker). Bisher wurde sie jedoch nie wirklich überwunden. Alle entsprechenden Versuche krankten daran, daß sie an der Oberfläche operierten. Was allein zur Überwindung führen konnte, war eine grundsätzlich andere Vorstellung vom konkreten Ablauf des Improvisationsprozesses, als Parry sie gehabt hatte. Diese neue Vorstellung ist erst 1987 entwickelt worden. In seiner Basier Dissertation .Homerische Versifikationstechnik. Versuch einer Rekonstruktion' hat Edzard Visser durch eine minuziöse Analyse der homerischen Versstruktur zeigen können, wie der mündliche Improvisationsvorgang in der Praxis tatsächlich abgelaufen ist. Als Grundlage der improvisierenden Versifizierung hat sich dabei zweifelsfrei ein dynamisches Prinzip herausgestellt. An die Stelle der bisher vorherrschenden Vorstellung eines .einrastenden' Zusammensetzens von Fertigteilen ist die Vorstellung eines .stufenlosen' Generierens getreten. Vissers ebenso geduldige wie zeitaufwendige Simulation des Versproduktionsprozesses kann hier nicht nachgezeichnet werden. Es sei aber wenigstens versucht, das Prinzip dieses Prozesses, so wie es Visser aufgedeckt hat, an einem Beispiel zu skizzieren und mit einem Gleichnis zu erläutern. I Die sprachliche Abbildung von Vorgängen, die sich in der Welt auf immer 172 wieder gleiche Weise wiederholen, erfolgt in der hexametrischen mündlichen griechischen Epik auch mit immer wieder den gleichen Worten und Wortverbindungen. Die Genialität dieser künstlerischen Verwertung einer Grundgegebenheit des Lebens liegt darin, daß die gleiche Formulierung des Gleichbleiben31
Lesky 1967, Sp. 62, 49 ff.
58
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
den dem Dichter den nötigen Freiraum für die je neuartige Formulierung des nicht Gleichbleibenden, also des Besonderen und Neuen, gab. 32 Im allerkleinsten Elementarrahmen läßt sich das bereits an einem vielverwendeten Paradebeispiel zeigen: Der im Leben stets gleichbleibende Vorgang ,dem X antwortete Y' wird mit der stets gleichbleibenden Formulierung τον ι την ) δ' άπαμειβόμενος προσέφη τους > begonnen. Damit ist aber der Hexameter bereits bis zur Ci-Zäsur (.Hephthemimeres') ausgefüllt: τον ι την ) δ' άπαμειβόμενος προσέφη τους ' J _ u u _ 2 _ U υ _2 υ υ 4_ l u u i . u u i II Ci das heißt: 3 V2 von den insgesamt 6 daktylischen Metren sind bereits fest belegt. Es bleiben noch 2 V2 Metren. Aber auch sie sind nicht mehr vollumfänglich disponibel. Denn eines der Prinzipien dieser Improvisationsdichtung ist es, einen Gedanken in auch nur einem Vers auszudrücken (,stichisches Prinzip'). In unserem Falle bedeutet dieser Zwang, den Gedanken noch im gleichen Vers abzuschließen, daß in den verbleibenden 2 V2 Metren auf jeden Fall noch das gedanklich unentbehrliche Subjekt (wer antwortet?) untergebracht werden muß. Nun werden wichtige Informationen in dieser Improvisationsdichtung entsprechend der natürlichen sprachlichen Sinn-Hervorhebung entweder an den VersAnfang, vor Binnenzäsurstellen oder an das Vers-Ende gesetzt. In unserem Falle kommt nur noch das Vers-Ende in Frage (die anderen Stellen sind bereits besetzt). Heißt das Subjekt des Antwortevorgangs also Odysseus, dann tritt dieser Name ans Vers-Ende: I τον ] την ! δ' άπαμειβόμενος προσέφη u u u 'Οδυσσεύς. τους ' Damit sind von den verbliebenen 2 V2 Metren = 10 Moren 33 weitere 5 Moren belegt. Übrig sind nur noch 5 Moren, d. h. entweder die Rhythmusgestalt u u — u oder die Rhythmusgestalt u . Heißt das Subjekt des Antwortevorgangs 32 33
J. Latacz, Homer. Der Deutschunterricht 31/6 (1979), 15 [in diesem Band S. 22]. 1 More = 1 Zeiteinheit; 1 Daktylus = 4 Moren.
in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos
59
Agamemnon, dann bleibt noch weniger Freiraum: nur noch 4 Moren in entweder der Rhythmusgestalt u u — oder : τον ι την ) δ'άπαμειβόμενος προσέφη υ υ 'Αγαμέμνων. τους > Dieser verbliebene Raum muß rhythmisch auf jeden Fall gefüllt werden, semantisch dagegen nicht auf jeden Fall. Denn was bisher nicht abgeschlossen ist, ist nur der Vers, nicht aber der Gedanke. Der Gedanke bedarf eigentlich keiner Ergänzung mehr. Also wird in den verbliebenen Rhythmusraum nunmehr variables Füllmaterial eingefüllt - in unserem Fall aus dem Bereich der berühmten .stehenden Beiwörter' (Epitheta ornantia). Hier beginnt also der Bereich der Wahl. Die Beiwörter müssen zwei Bedingungen erfüllen: (a) sie müssen metrisch (rhythmisch) passen; (b) sie müssenfconfejcisemantischpassen (d. h. sie müssen eine sinnvolle Erweiterung des jeweiligen Subjekts geben; negative Qualifikationen scheiden dabei aufgrund der Rühmungsfunktion dieser Dichtung von vornherein aus). Da bestimmte Handlungsfiguren von der Tradition mit bestimmten Erkennungseigenschaften gekoppelt sind (charakterologische Solidaritäten), kommen als Füll-Epitheta nur Wörter eines bestimmten Sinnbezirks in Frage. Odysseus ist in der Tradition als Intellektueller vorgegeben, Achilleus als Tatmensch. Ist also Odysseus Subjekt unseres Antworteverses, kann nur ein metrisch passendes Epitheton des semantischen Feldes .Intellektualität' eingefüllt werden. Zur Verfügung stehen: πολύφρων, πολύμητις, πολυμήχανος, ποικιλόμητις u. a. In unserer metrischen Bedürftiislage paßt davon nur πολύμητις. Der Vers wird also komplettiert zu τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς. Ist Achilleus Subjekt des Antworteverses, kann ceteris paribus nur πόδας ώκύς eingefüllt werden: τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς. I Dies ist im Aufriß das Prinzip des Improvisationsprozesses. Es ist freilich nicht 174 das von Parry, sondern das von Visser aufgedeckte Prinzip. Nach Parry nämlich hätte der Dichter, bei Ci angekommen: τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη, nicht zuerst .Odysseus' bzw. .Achilleus' gedacht und erst dann πολύμητις bzw. πόδας ώκύς, sondern er hätte, an dieser Stelle angekommen, sofort
60
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
πολύμητις 'Οδυσσεύς nicht so gedacht:
bzw.
πόδας άκύς Άχιλλεύς.
I τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη
gedacht. Er hätte also
III πολύμητις
II Οδυσσεύς
III πόδας ώκύς
II Άχιλλεύς
bzw. so:
τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη sondern so:
τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη
II πολύμητις 'Οδυσσεύς
Der improvisierende Sänger hätte also mehrteilige Bausteine als Einheiten im Kopf gespeichert, die er produzierend aneinanderpaßte. Wie von der Logik her nicht anders zu erwarten, hat diese Vorstellung in der Homerforschung nach Parry zu den größten Schwierigkeiten geführt. Durch Visser ist sie überwunden. Visser zeigt, daß der Sänger mehrteilige Bausteine (.Formeln') zwar durchaus auch speichert (z.B. eben τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη), daß er sie aber je nach Bedarf auch spontan erzeugen kann (gastronomische Betriebe bieten sowohl vorgefertigte sets - Menüs - an, als sie auch imstande sind, diese stets nach Gästewünschen spontan zu modifizieren bzw. völlig neu zusammenzustellen). Damit ist ein System der Vers-Generierung wiedergewonnen, das erklärt, warum der Sänger nicht gefesselt war, sondern in der selbstgewählten (weil arbeitserleichternden) Unfreiheit zu einem beachtlichen Teil doch auch wieder frei war. Damit ist aber das Prinzip der Kreativität (Originalität) für diese Improvisationsdichtung gerettet. I 175 Konkret ist gezeigt, daß der Vers aus zwei Gruppen von Wortmaterial besteht: (a) aus semantisch unentbehrlichen Wörtern bzw. Wortverbindungen: Determinanten ' (Visser); (b) aus semantisch entbehrlichen Wörtern bzw. Wortverbindungen: , Variable' oder ,freie Zusätze ' (Visser).
in der mündlichen Oberlieferungsphase
des griechischen Heldenepos
61
Die Statistik zeigt nun, daß der traditionelle (für uns durch Homer repräsentierte) Hexameter im Regelfall nur 3, höchstens 4 Determinanten enthält: Subjekt, Objekt, Verb, (Konjunktion). Das bedeutet umgekehrt, daß ein relativ großer Raum des traditionellen Verses, oft sogar der größere Raum, nicht von Determinanten, sondern von freien Zusätzen eingenommen wird. Damit ist aber die typische .weiche Konsistenz' des traditionellen mündlichen Hexameters erklärt: wenig .hartes' Material, viel .weiches' Füllmaterial. Oder mit einem Gleichnis: der in seiner Größe unveränderliche Karton (= Hexameter) wird mit nur wenigen harten Gegenständen gefüllt, der verbliebene Leerraum wird mit Holzwolle ausgepolstert. Wer je einen Karton mit Büchern hat vollpacken wollen, versteht das Bild. Er hat die verschieden großen und dicken Bücher immer wieder anders aneinandergelegt, um möglichst viele im Karton unterzubringen, und hat sich trotz allen Probierens doch immer wieder ärgern müssen über Lücken hier, Überlappungen dort, usw. Der mündliche Sänger als improvisierender Versproduzent hatte aber gar keine Zeit, lange zu probieren. Seine Produktionssituation zwang ihn zum Packen mit Holzwolle. Die spätere Zeit der schriftlichen Hexameterdichtung, die diese Produktionssituation nicht mehr kannte (und nicht mehr erahnte) - Homer kennt sie noch - , versuchte natürlich, möglichst viele Bücher in den Karton zu packen und möglichst wenig Holzwolle zu verwenden: sie versuchte zu dichten (den Vers ,dicht' zu machen). Darum klingt jede schriftliche Hexameterdichtung nach Homer - deutlich zu spüren schon bei Hesiod - anders als die homerische Dichtung. Darum kann aber auch keine Homer-Übersetzung (die ja ebenfalls den Schriftlichkeitsprinzipien folgt) auch nur entfernt die ästhetische Natürlichkeit des homerischen Hexameters erreichen. Was aus dieser Entdeckung für unsere Frage folgt, ist nicht schwer zu sehen: Die Zwischenstellung dieser Dichtung zwischen Faktenbewahrung und Faktenveränderung wird rational durchschaubar. Harte Fakten der Tradition (.hard facts') - z.B. Namen (geographische Namen, Personennamen), bestimmte Gegenstandsbezeichnungen (Alltags-Utensilien, Waffen) - sind seit jeher in dieser Dichtung als Determinanten erschienen und mußten aufgrund der stets gleichbleibenden Intention dieser Dichtung (nicht neue Fakten, sondern neue Deutungen) und der stets gleichbleibenden Technik (mündliche Improvisation im Setzund Füllverfahren) weitgehend Determinanten bleiben. Sie selbst also wurden durch die mündliche Tradierung über die Zeiten hinweg tendentiell unverändert weitergetragen. Ihre Zueinanderordnung jedoch, ihre kausale Verknüpfung, ihre Wertung usw. wurde in dieser Dichtung seit jeher im Sektor der freien Zusätze (der Holzwolle) geleistet. Der Verschiebungsprozeß, d.h. das .Verrutschen' der
62
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
176 ursprünglichen Strukturen (und damit auch die MißVerständnisse), die NeuAuffüllungen und Selbst-Einspiegelungen, kurz: die Um-Interpretation der ,hard facts' vollzog sich vorzugsweise dort. Dies ist genau der Prozeß, dessen Endzustand wir in Ilias und Odyssee vor uns haben: Ein faktischer Kern von Historizität hat sich über die Zeiten hinweg erhalten, wie Archäologie und Linear B-Dokumente zeigen. Aber diese ,hard facts' - deren Gesamtbestand erst durch weitere Einzelforschung einzugrenzen sein wird - sind durch das ständige .Umpacken' (das Einpacken in immer wieder neue Kartons unter Verwendung immer wieder neuer, zeitgemäßer AuffüllMaterialien) gegenüber ihrer ursprünglichen Lage im historischen Originalsystem heillos verrutscht. Ihre ursprüngliche Anordnung ist dadurch im Laufe der Jahrhunderte unkenntlich geworden (und aus dem uns erhaltenen Endzustand am Ende der langen Transportkette ohne zusätzliche Hilfsmittel - wie die Archäologie - nicht mehr rekonstruierbar). Das Bild, das diese Fakten-Anordnung in Ilias und Odyssee darbietet, sieht daher insgesamt phantastisch aus. Daraus hat man immer wieder geschlossen, auch die Fakten selbst verdankten ihre Existenz in der hexametrischen mündlichen griechischen Epik der Phantasie. Dieser Schluß war sicher falsch. Konsequente Weiterarbeit auf dem hier skizzierten Wege - ζ. B. am viel verhandelten und doch noch längst nicht geklärten Schiffskatalog der Ilias mit seinen insgesamt 175 geographischen Namen 34 - wird die hier entwickelte These hoffentlich bestätigen. *
Die Entstellung des ursprünglichen historischen Faktenzusammenhangs durch Rekonstruktion der einzelnen Entstellungsphasen ganz rückgängig zu machen wird nie mehr gelingen. Aber das mündliche Heldenepos als Quelle für die Vergangenheit der Griechen ganz beiseite zu schieben werden wir wohl mit gutem Gewissen auch nicht wagen dürfen. I
34 Neueste Überblicks-Behandlung: G. S. Kirk, The Iliad: A Commentary. Volume I: books 1-4, Cambridge 1985, 168-240.
in der mündlichen Überlieferungsphase
des griechischen Heldenepos
63
Abgekürzt zitierte Literatur Burkert 1984
Hansen 1983 Heubeck, Schrift 1979 Heubeck 1986 Latacz 1979 Latacz, Homer 1985 Lesky 1967 Murray 1982 Odissea
Oralità
A. Parry 1971 Strasburger 1972 Visser 1987
Visser 1988
W. Burkert, Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, SB Heidelberger Ak. d. Wiss. 1984/1, Heidelberg 1984. P. A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca saeculorum Vni-V a. Chr.n., Berlin - New York 1983. A. Heubeck, Schrift, in: Archaeologia Homérica, hrsg. v. H.-G. Buchholz, Kapitel X, Götüngen 1979. Α. Heubeck, Die Würzburger Alphabettafel, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 12 (1986), 7-20. J. Latacz (Hrsg.), Homer. Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979 (Wege der Forschung 463). J. Latacz, Homer. Eine Einführung, München - Zürich 1985. 2 1989. A. Lesky, Horneros. Sonderdruck aus RE Suppl. XI, Stuttgart 1967. O.Murray, Das frühe Griechenland, München 1982 (dtv Nr. 4400; engl. Originalausgabe London 1980). Omero, Odissea, 6 Bde. (Einleitung, Übersetzung ins Italienische, Kommentar), von A. Heubeck, S. West, J. B. Hainsworth, A. Hoekstra, J. Russo, M. Femández-Galiano und A. Privitera, Milano 1981-1986. Oralità. Cultura, Letteratura, Discorso. Atti del Convegno Internazionale (Urbino 21-25 luglio 1980), a cura di B. Gentili e G. Paioni, Roma 1985. A. Parry (Hrsg.), The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry, Oxford 1971. H. Strasburger, Homer und die Geschichtsschreibung, SB Heidelberger Ak. d. Wiss. 1972/1, Heidelberg 1972. E. Visser, Homerische Versifikationstechnik. Versuch einer Rekonstruktion, Frankfurt/M. - Berlin - New York 1987 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XV: Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 34). E. Visser, Formulae or Single Words? Towards a new theory on Homeric verse-making, Würzburger Jahrbücher f. d. Altertumswiss. 14, 1988, 21-37.
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
Abb. 1
Inschrift auf einer T o n k a n n e des geometrischen Stils (Dipylon-Kanne, Athen, ca. 740) [ός νυν ό ρ χ η σ τ ώ ν π ά ν τ ω ν άταλώτατα π α ί ζ ε ι . . . ]
Malatya Karatepe ® Sdirli
Van-See
Urmia-See
Tell Halaf Karkemisch Sukas
Ninive »Nimrud
ASSYRIEN
Assur
Babylon
Abb. 2
Der Nahe Osten. Al Mina
in der mündlichen
Überlieferungsphase
des griechischen
Heldenepos
Chalkis Lefkandi JEretria Pithekussai >
Tell Halaf Naxosi
Tarsos·
^ Ninive
ASSYRIEN »ukas • Hama
Tyroe »Samaria
^ ^
Askaion Naukratis
A b b . 3 F u n d s t ä t t e n g e o m e t r i s c h e r K e r a m i k aus Euboia u n d anderen griechischen O r t e n - ein Indiz f ü r f r ü h e Handelsverbindungen nach O s t e n u n d Westen (aus: M u r r a y 1982)
EUBOIA Lelantinische Ebene
s
Chalkis, îfkandi
Amarynthos
• Theben
ΑΤΤΙΚΑ
Athen
Abb. 4 Euboia in archaischer Zeit. Lefkandi (vgl. B l o m e , W ü j b b 10, 1984) (aus: Murray 1982)
Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung
y . .
fiAbb. 5 Pithekussai, Aufschrift des sog. Nestorbechers ca. 735-720 (aus: Heubeck, Schrift, S. X 109)
ν
o
^ y® Β
Φ 0 Ι
Μ Λ 1 8 ή
*
T
»
3 l l
51
^y^AA
i
Δ ο
m
Ο 4-, -P" J2 3. ."¡^ OS CL, 3 -< &C 2 c 3 i-Η ^ T3 Ί-;
s
O I c/i
sO I D
ω b e s to O
sν ω c
•o i->
Ο > ω 1 -Ο ca. ω 3. S κ -a
ρ· 9-ω Ü ο ο/ ti u> 0 > ω 3. -O co. ω 1 a κ "ö
> -o
> -o
Ρ" 9-ω b 0 ο; Κ
ca i
III
s .y u
ι Ό G ce 6
ω 3. -O CO. ω 3. a κ -a co
>
-o Η
u> o X Ά LT w a to -o ti
\
9-ω b o
QI K
ί
Ό Q/ ω η a QJ Χ
ρ· 9-ω b O
Cu
W
t=: ι_ρ 0 > ω a. •a b b a 1 6 •ω
>
> -O
O > ω 3. -O CCL ω 3. a ti -a to -o
Gymnasium 91,1984, 15-39
Das Menschenbild Homers* Alfred Heubeck zum 70. Geburtstag gewidmet Meine sehr verehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir bitte zunächst, an der im Programmheft ausgedruckten Form des Themas eine kleine Änderung vorzunehmen. Der Vorstand war, als er mir das Thema in dieser Form übertrug, von erfreulichem, aber doch wohl allzu euphorischem Optimismus erfüllt: Das Menschenbild Homers in einer Dreiviertelstunde nachzuzeichnen ist, glaube ich, nicht möglich. Den wenigen Andeutungen, die ich vorzutragen haben werde, ist allenfalls der Titel ,Zum Menschenbild Homers' angemessen. Daß eine derartige Einschränkung, um deren nachträgliche Billigung ich Sie bitten muß, notwendig ist, liegt freilich an der schwankenden und kaum abgrenzbaren Natur der zu behandelnden Materie. I Im Gegensatz zu präzise gestellten Forschungsfragen, die streng syllogistische Lösungsmethoden erfordern, haben es nämlich Untersuchungen zum Menschenbild eines Autors seit jeher an sich, wegen der ungewöhnlichen Menge, Differenziertheit, vor allem aber Vieldeutigkeit des Ausgangsmaterials zu raschen Generalisierungen mit großen Worten und globalen Begriffen zu verführen. Da dem Forscher nur ein Bruchteil des gesamten Assoziationsgeflechts zugänglich ist, innerhalb dessen die einschlägigen Begriffe und Aussagen des Autors ursprünglich einmal gestanden haben, beginnt er mit der Abstraktionsarbeit immer schon zu früh, und seine Nachzeichnung des ursprünglichen Bildes wird so notwendig zur vergröbernden und verzerrenden Skizze. Zu diesem objektiven * Für wichtige Hinweise und stete Gesprächsbereitschaft habe ich meinem Basler Althistoriker-Kollegen J. von Ungern-Stemberg herzlich zu danken. - Die Präzisierung gewisser Gedankengänge hoffe ich in anderem Rahmen leisten zu können.
72
Das Menschenbild Homers
kommt ein subjektives Erschwernis hinzu: Bei einer so eminent persönlichkeits16 fordernden Aufgabe, wie es die Wiedergabe I eines fremden Welt- und Menschenbildes ist, läßt sich die Persönlichkeit dessen, der beobachtet und dann wiedergibt, rational nicht ausklammern; seine eigene Weltsicht legt sich verformend über die fremden Strukturen, noch bevor er mit ihrer Auswertung überhaupt begonnen hat - ein Verfälschungsphänomen, das aus der Psychologie gut bekannt ist als unbewußte Assimilation des Menschenbilds des Observierten an das des Observanten. Die Behandlung von Welt- und Menschenbildthemen wird infolgedessen häufig - das zeigt die Geschichte dieser Thematik gerade auch in unserer Disziplin - mehr zu einem Spiegel des historisch und individuell bedingten Menschenbilds des Forschers als zu einer objektiven Rekonstruktion des Menschenbilds des behandelten Autors. Diese Gefahren völlig auszuschalten ist nicht möglich. Es kann nur versucht werden, sie durch ständiges Überprüfen der Methode, Streben nach begrifflicher Klarheit und durch Vermeiden irreversibler Festlegungen wenigstens unter Kontrolle zu halten. Beim Versuch, das Menschenbild Homers zu rekonstruieren, kommen zu diesen generellen noch eine ganze Reihe spezieller Methodenprobleme hinzu. Sie rühren von der besonderen Stellung der beiden frühgriechischen Großepen Ilias und Odyssee innerhalb der Literaturentwicklung her. Diese Epen stellen ja, wie wir heute wissen, eine Sonderart von Dichtung dar. Sie sind nicht mehr ganz mündliche und noch nicht ganz schriftliche Dichtung 1 . Wir müssen daher in Homericis bei literaturwissenschaftlichen Fragestellungen jeder Art vorab immer erst prüfen, inwieweit herkömmliche Betrachtungsweisen und Methoden auf diese Epen überhaupt anwendbar sind. Im Falle unseres Themas, des Menschenbilds Homers, muß, wie mir scheint, zumindest eine methodische Vorfrage abgeklärt sein, bevor mit der Arbeit begonnen werden kann. Sie lautet: 1. Läßt sich im Blick auf die beiden Großepen Ilias und Odyssee überhaupt von einem Menschenbild Homers, d.h. eines Dichter-Individuums sprechen? Erst wenn geklärt ist, daß dies - wenn auch in einem ganz bestimmten Sinne möglich ist, scheint es sinnvoll, praktische Verfahrensfragen aufzuwerfen. Von diesen dürften die folgenden zwei die wichtigsten sein: 2. Was soll unter .Menschenbild' verstanden werden? Das heißt: was soll eigentlich rekonstruiert werden? - und 1 Eine Hinführung zu dieser Sichtweise habe ich meinem Aufsatz .Homer' in der Zeitschrift .Der Deutschunterrricht' (31, 1979, 5-23) zu geben versucht [in diesem Band S. 13-35].
Das Menschenbild Homers
73
3. Wie soll das Menschenbild Homers rekonstruiert werden? I Alle drei Fragen machen ausgedehnte Überlegungen notwendig, die ich hier 17 nicht in extenso vorführen kann. Statt dessen versuche ich nur knapp die Resultate zu formulieren. (1) Von einem Menschenbild Homers läßt sich nicht im gleichen Sinne sprechen wie von einem Menschenbild Vergils, Lucans, Dantes usw. Denn bei Vergil, Lucan usw. liegt Individualdichtung vor, in Ilias und Odyssee haben wir dagegen traditionelle Dichtung vor uns. Diese beiden Arten von Dichtung unterscheiden sich voneinander durch eine unterschiedliche Auffassung von dem, was wir »Originalität' nennen. Anders als für den individuellen Dichter besteht Originalität für den traditionellen Sänger nicht im ,Anders-Sagen' (im Sinne eines in der Regel kritischen und umwertenden Abweichens vom Althergebrachten), sondern im .Schöner- und Wahrer-Sagen', - also nicht in der Abweichung von der Tradition, sondern in ihrer Vervollkommung 2 . ,Anders-Sagen', im Sinne einer Hervorkehrung der eigenen, ganz persönlichen Welt des Sängers, wird in traditioneller Dichtung (das hat die Oral poetry-Forschung überzeugend herausgearbeitet 3 ) als Dichtungsziel gar nicht gesehen. In dem Augenblick, in dem es als Ziel gesehen wird, d. h. in dem Augenblick, in dem der uns vertraute Originalitätsbegriff auftaucht, ist traditionelle Dichtung mit ihren traditionellen Sängern tot; in der griechischen Literatur stellt sich dieser Umschwung äußerlich am augenfälligsten in der Form der Ablösung der Eposdominanz durch die Lyrikdominanz um 700 dar 4 . Die frühepische Dichtung ist in diesem Sinne bei
2
Das hat W. Schadewaldt - unter Verwertung einiger schon damals zugänglicher Arbeiten zur oral poetry - bereits 1943 in Form eines fingierten Sänger-Interviews gezeigt: ,Die Gestalt des homerischen Sängers', in: Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 3 1959, 75 f. (vgl. auch 42). Inzwischen ist die Unterscheidung zwischen traditionellem und schriftlichkeitsgeprägtem Originalitätsbegriff zu einer der Arbeitsgrundlagen der Homerphilologie geworden. 3 Besonders eindrucksvoll: C. M. Bowra im Kapitel .Innerhalb der Tradition' seines grundlegenden Werkes .Heldendichtung' (Stuttgart 1964, 487-523 [bes. 500]). Daß wir heute in der Homerphilologie dennoch von .Tradition und Neuerung' (.Tradition and Innovation', .Homer against his Tradition' usw.) sprechen, steht dazu nicht im Widerspruch: Mit der Herausarbeitung des .Neuen' innerhalb des Traditionellen (des .Homerischen' im Homer) suchen wir jenem besonderen .Schöner-Sagen' auf die Spur zu kommen, das als offenbar eigentümlicher Qualitätsvorsprung des traditionellen Einzelsängers Horneros die Erhaltung gerade seiner Stoffgestaltungen veranlaßt hat. 4 Hinter dieser äußeren Erscheinungsform verbirgt sich die Ablösung der vorwiegend mündlich konzipierten alten durch die vorwiegend schriftlich konzipierte neue Dichtung (zu der auch Hesiod schon gehört).
74
Das Menschenbild Homers
den Griechen noch nicht individuell (zur Übergangsphase, zu der ich die Odyssee und Hesiod rechnen möchte, später). I 18 Demnach ist in frühgriechischer epischer Traditionsdichtung ein individuelles Menschenbild in unserem Sinne schon vom Gesetz der Gattung her kaum zu erwarten. Im Falle der beiden Epen Ilias und Odyssee, die uns aus dieser frühgriechischen epischen Traditionsdichtung erhalten sind, wird unsere Erwartung jedoch noch geringer sein müssen. Denn unsere Ilias und unsere Odyssee sind ja offensichtlich diejenigen beiden Fassungen uralter Geschichten aus einem umfangreichen Troj asagen-Zyklus, die in ihrem ursprünglichen Adressatenkreis von allen themagleichen oder -ähnlichen Fassungen die größte Zustimmung gefunden haben; das drückt sich in der Erhaltung aus - in der Erhaltung sowohl dieser beiden Epen als auch des Verfassernamens5. Eine solche einzigartige PublikumsZustimmung wäre aber nicht möglich gewesen, wenn die Adressaten - neben ästhetischen und anderen Übereinsümmungen - nicht eine besonders weitgehende Kongruenz gerade auch des Menschenbildes, das diese Epen durchtönte, mit ihrem eigenen Menschenbild empfunden hätten. Die - intentional primären - Adressaten waren nun jene soziale Gruppe, die wir ,Adel' nennen. Diese ganze Gruppe sah sich also in dem vom Einzelsänger Horneros vervollkommneten traditionellen Menschenbild vorzüglich repräsentiert. Dann aber muß sich dieser Einzelsänger Horneros seinerseits mit dem Menschenbild dieser Gruppe 5
Dieser Zusamenhang wird in letzter Zeit zu Recht wieder häufiger in den Vordergrund gerückt. Ebenso knapp wie treffend z. B. R. Kannicht, Dichtung und Bildkunst, in: Wort und Bild, München 1979, 280: „[...] die Dias Homers [...]: schon die Tatsache ihrer Erhaltung und Überlieferung (und zwar unter dem Namen ihres Autors!) das Urdatum ihrer Wirkung schon auf ihre Zeit". - Es handelt sich dabei übrigens durchaus nicht um eine isolierte griechische, sondern um eine allgemein literaturgeschichtliche Erscheinung des Übergangs von nur-mündlicher Vortragsdichtung zur „Textaufzeichnung aus Gründen der Repräsentation"; so erfährt z. B. „die repräsentative Textaufzeichnung im Mittelalter ihre charakteristische Ausprägung bei den (ursprünglich) für den mündlichen Vortrag bestimmten poetischen Werken. Das augenfälligste Beispiel hierfür dürfte die Minnesangsammlung der Manessischen Liederhandschrift sein" (J. Janota/K. Riha, Aspekte mündlicher literarischer Tradition, in: Literaturwissenschaft, Grundkurs 2, hrsg. v. H. Brackert u. J. Stückrath ( - E. Lämmert), Reinbek 1981, 47 f.), und „die nicht unbeträchtliche Menge der Nibelungenhandschriften, ja, eigentlich das .Nibelungenlied' selber als mittelalterliches Literaturdenkmal überhaupt" verdanken wir „der Tatsache, daß [diese gesprochenen Texte] gelegentlich aus dem Munde der Vortragenden ausgeschrieben wurden" (so C. Soeteman, Ritterroman und Gesellschaft, in: Oral Poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung, hrsg. v. N. Voorwinden u. M. de Haan, Darmstadt 1979 [WdF 555], 289 f.; zu den verschiedenen Techniken der Überführung mündlicher Dichtungen in die Schriftlichkeit s. im gleichen Sammelband F. H. Bäuml, Der Übergang mündlicher zur Artes-bestimmten Literatur des Mittelalters, 238-250).
Das Menschenbild Homers
75
ganz besonders stark identifiziert haben. Gerade in seinen Epen ist also ein individuelles Dichter-Menschenbild am wenigsten zu erwarten. Oder molderner 19 ausgedrückt: Der außergewöhnlich hohe gesellschaftliche Affirmationsgrad dieser Epen, der sich für uns an der offenbar gerade von ihnen ausgelösten revolutionär neuen Form der Publikumsresonanz ablesen läßt - nämlich an der Innovation ,Werk-Erhaltung durch schriftliche Fixierung' - , schließt Individualität des Menschenbilds im uns geläufigen Sinne für diese Epen weitgehend aus. Das gilt, wie ich meine, noch nahezu uneingeschränkt für die Ilias. Für die Odyssee scheinen bereits Einschränkungen nötig. Diese ergeben sich - und hier greife ich methodisch etwas voraus - aus dem Odyssee-Menschenbild selbst. Denn das Odyssee-Menschenbild zeigt gegenüber dem Menschenbild der Ilias schon eine gewisse Auflockerung der alten sozialen und ethischen Strukturen, eine relativ größere Offenheit für Unkonventionelles und Individuelles. Das ist natürlich der Reflex einer allgemeinen, alle Lebensbereiche erfassenden gesellschaftlichen Entwicklung. Die Lyrikdominanz konnte ja nicht über Nacht hereinbrechen, sie war vielmehr die literarische Konsequenz einer Individualisierung der ganzen Gesellschaft, einer Individualisierung, die innerhalb der Grenzen des verfügbaren literarischen Genos, des hexametrischen Epos, in dem sie sich natürlicherweise zuerst auszudrücken suchte, ebenso natürlicherweise nicht zu ihrer vollen Entfaltung kommen konnte. Das zweite der beiden frühgriechischen Großepen, die Odyssee, spiegelt dieses Übergangsstadium der versuchten Individualisierung von Traditionsdichtung wider. Nicht nur aus Sprachschatz, Formelgebrauch, Metrik, Komposition usw., sondern auch aus der Ethik, Religion, Psychologie und aus manchen präphilosophischen Spekulationsansätzen dieses Epos hat man mit Recht schon persönlichere Töne herauszuhören gemeint. Natürlich konnten diese Töne nur von einem traditionellen Sänger ins altvertraute Genos hineingewoben werden, der auch selbst schon individueller dachte und fühlte. Welche dieser Züge - oder gar, welche Einzelstellen - nicht mehr nur Gemeingut dieser ganzen traditionsauflösenden Bewegung sind, sondern darüber hinaus ausdrücklich sogar nur Sondereigentum des Odysseedichtere - das werden wir präzise vielleicht niemals sagen können. Aber dies dürfen wir doch immerhin folgern: Das Menschenbild der Odyssee kommt dem, was wir unter einem dichterischen Individual-Menschenbild verstehen, wahrscheinlich schon näher. Für die Verfasserfrage - Unitarier- oder Chorizontenlösung - I geben diese 20 Erwägungen übrigens, wie ich glaube, nichts aus. Jeder traditionelle Sänger, ob das nun Homer selbst war oder ein anderer, würde sich - sofern er eben traditioneller Sänger war - unbewußt den allgemeinen Horizontverschiebungen und
76
Das Menschenbild Homers
Präferenzwandlungen in der zeitgenössischen Gesellschaft zwischen der Abfassung der Ilias und der der Odyssee gleichermaßen angepaßt haben. Diese unbewußte Anpassung an Änderungen innerhalb der gesellschaftlichen Gesamtstruktur gehörte seit Jahrhunderten zum Gesetz der Gattung6. Danach können wir die Antwort auf die erste Frage folgendermaßen formulieren: Ein individuelles Menschenbild in unserem Sinne liegt in der Ilias gar nicht, in der Odyssee wohl nur in Ansätzen vor. Dennoch dürfen wir von einem Menschenbild Homers sprechen. Homers Menschenbild ist - entsprechend dem Gattungsgesetz traditioneller Dichtung im allgemeinen und den Entstehungsbedingungen von Ilias und Odyssee im besonderen - im wesentlichen das Menschenbild seines primären Publikums, also des zeitgenössischen Adels - freilich verfeinert, verdichtet und vertieft bis zu einer bis dahin unbekannten und daher neuartig honorierten Vollendetheit. (2) Damit gehen wir über zur zweiten Frage: Was sollen wir unter dem Begriff .Menschenbild' verstehen? Zunächst darf man feststellen, daß dort, wo dieser Begriff in der Vergangenheit verwendet wurde, häufig eine gewisse idealische, um nicht zu sagen weihevolle Tönung mitklang, - die sich dann häufig mit einer Einengung des Begriffsinhalts auf wertethische, religiöse und nationale Komponenten verband. Das sind historisch bedingte Konnotationen und Restriktionen, die mit dem Begriff selbst ursprünglich nichts zu tun haben und von denen wir den Begriff, falls wir ihn überhaupt noch verwenden wollen, heute tunlichst freihalten sollten. Das Menschenbild ist Teil des Weltbildes und formt sich wie dieses aus der unendlichen Summe von Informationen und Erfahrungen aus allen Lebensbereichen in einem Prozeß ständiger Bewertung und Verknüpfung zu einem Ordnungsraster, durch den die Realität überschaubar gemacht, sinnvoll strukturiert und emotional gefärbt wird. Wie jedes Bild kann das Menschenbild alle Stufen zwischen groß und klein, tief und flach, grob und fein, 21 scharf und unscharf usw. einnehmen. Diese Qualitätsvariabilität - I die schon von einem Einzelmenschen zum nächsten beachtlich sein kann - wird nun besonders ausgeprägt fühlbar bei der Gegenüberstellung eines individuellen mit einem traditionellen Menschenbild: Während das individuelle Menschenbild von jedem Individuum aus persönlichen Erfahrungen und selbst verarbeiteten Traditionselementen jedesmal wieder neu aufgebaut wird, ist das traditionelle Menschenbild gewissermaßen ein von Generation zu Generation durch die Zeiten weitergereichter, im Sinne des .Schöner- und Wahrer-Sagens' ständig berei6
Wie konstitutiv diese globale Anpassung für traditionelle Epik der verschiedensten Sprachund Kulturkreise ist, hat wiederum Bowra (o. Anm. 3) 517-523 gezeigt.
Das Menschenbild Homers
77
cherter und vertiefter und im Sinne der Anpassung an gesellschaftlich-geistige Veränderungen ständig kapazitätsstärker werdender ,Erfahrungsblock'. An Größe, Reichhaltigkeit und Komplexität kann ein solches traditionelles Menschenbild infolgedessen Individualmenschenbildern weit überlegen sein. (3) Daraus ergibt sich - dies die dritte und letzte Vorfrage - die Schwierigkeit einer angemessenen Rekonstruktion. Es ist wohl einleuchtend, daß sich das Menschenbild Homers nicht allein aus den Belegstellen von άνθρωπος, άνήρ, γυνή usw. rekonstruieren läßt. Freilich muß man sehen, daß auch diese Stellen gewissermaßen die Elementar-Ebene - noch längst nicht vollständig ausgewertet sind. Wer die Größenordnungen kennt, um die es hier geht, wird das nicht verwunderlich finden: Allein die Aussagen, die unter Verwendung des Wortes άνθρωπος gemacht werden, umfassen schon rund 200 Stellen, bei άνήρ kommen rd. 1000 Stellen hinzu. Nur für die Auswertung der άνθρωπος-Stellen habe ich seinerzeit bei der Abfassung des Artikels άνθρωπος für das Lexikon des frühgriechischen Epos nahezu ein Jahr gebraucht. Die Wörter άνθρωπος und άνήρ erschließen aber natürlich nur einen Bruchteil der Gesamtzahl aller mittels einschlägiger Lexeme gemachten Aussagen; hinzuzunehmen sind also alle Stellen mit γυνή, παις, γέρων, aber auch θνητοί, βροτοί usw., θυμός, νόος, φρήν usw. usf. Diese Lexem-Aussagen bilden aber natürlich ihrerseits wieder nur einen winzigen Bruchteil der ohne Lexemverwendung gemachten Aussagen, d. h. der im Flusse des Erzählens und Darstellens implizierten Äußerungen, Urteile, Bewertungen usw. Eine vollständige Erfassung dieses in generationenlanger Empirie herangereiften kollektiven Menschenbildes, von dem das Griechenvolk noch über Jahrhunderte hinweg gezehrt hat und das über die Römer auf im einzelnen gar nicht mehr nachvollziehbaren Wegen auch uns noch prägt, ist einem Einzelnen vermutlich I gar nicht möglich, - und nicht zuletzt dies wird ein Grund dafür gewe- 22 sen sein, warum Homer den Griechen stets das Buch der Bücher war. Es ist aber auch ein Grund für die fortbestehenden Kontroversen der modernen Interpreten über bestimmte Aspekte des Menschenbilds Homers. Ob der homerische Mensch ein Bewußtsein von der Einheit seines Selbst hatte oder von der Möglichkeit eigener Entscheidungen, ob er sein Inneres als offenes Kraftfeld für die Götter empfand, ob er an die alten Götter glaubte oder sie aufgeklärt nurmehr .tolerierte' - die Diskussion aller dieser Fragen leidet an der schieren Unmöglichkeit, sämtliche einschlägigen Aussagen der Epen systematisch zu registrieren, umsichtig genug zu interpretieren und zu einem allseits abgesicherten Ergebnis zu verknüpfen. Argumentation und Gegenargumentation erfolgen viel-
78
Das Menschenbild Homers
mehr immer wieder an Hand von ausgewählten Einzelstellen, und das jeweilige Teilproblem muß, um überhaupt traktierbar zu werden, jedesmal aus dem Gesamtzusammenhang des homerischen Welt- und Menschenbildes herausgelöst werden. Nimmt man die Unmöglichkeit hinzu, als Einzelner die Flut der einschlägigen Forschungsliteratur auch nur zu lesen - in einer 1979 erschienenen Homer-Bibliographie nur für die sieben Jahre 1971-1977 werden z.B. schon 133 einschlägige Titel aufgezählt7 - , dann wird deutlich, daß eine wirklich adäquate Rekonstruktion des Menschenbilds Homers möglicherweise für alle Zeiten unerreichbar bleiben wird und daß wir uns jedenfalls noch für lange Zeit mit verdienstlichen Materialsammlungen in der Art von Buchholzens .Homerischen Realien4 vom Ende des vorigen Jahrhunderts oder Finslers erstem Homer-Band von 1907 einerseits und mit spezialistischen Einzelabhandlungen über homerische Psychologie, Ethik, Religion usw. andererseits werden begnügen müssen. Π Trotz dieser pessimistischen Lagebeurteilung möchte ich mich im zweiten Teil meiner Ausführungen nicht auf ein oder zwei Einzelprobleme zurückziehen, sondern wenigstens einen Aufriß des Ganzen wagen. Dabei werde ich versuchen, von außen her, gewissermaßen vom Bild-,Rand' aus, allmählich ins Zentrum vorzudringen. Das soll in folgenden Frage-Schritten geschehen: I 23 1. Wie sieht Homer den Menschen in der Welti (a) räumlich und zeitlich, (b) sozial, (c) ethisch, (d) religiös; 2. Wie sieht Homer den Menschen für sich genommen, psychologisch? Mit einer solchen tour d'horizon werde ich dem Kenner natürlich nichts Neues bieten können, aber dem Liebhaber Homers kann der Überblick vielleicht wenigstens als Anregung dienen. Beginnen wir also mit dem Bild, das Homer von der Stellung des Menschen in der Welt und in der Gesellschaft hat 8 .
7 8
905.
J. P. Holoka, Homer Studies 1971-1977, CW 73, 1979, 65-150, hierr^0-97. Im einzelnen s. dazu meinen Art. άνθρωπος im Lexikon des frühgriechischen Epos, 877-
Das Menschenbild Homers
79
(a) Alle Menschen zusammengenommen, wo und wie auch immer sie leben, bilden eine Einheit, das φΰλον ανθρώπων, .Menschengeschlecht', eine Gattung, die sich durch gemeinsame Merkmale deutlich von den drei anderen HauptGattungen belebter Natur, den Göttern, Tieren und Pflanzen, abhebt. Diese Gattimg, die als solche immer existiert hat (πρότεροι άνθρωποι) und immer existieren wird (έσσόμενοι, όψίγονοι άνθρωποι) dehnt sich in verschiedenen .Stämmen' (φΰλα) über die ganze Erdscheibe aus (έπί χθονί φΰλ' ανθρώπων), in allen Himmelsrichtungen bis hin zum begrenzenden Ringstrom Okeanos. Von den dort, ganz zuäußerst lebenden Menschen hat man nur geringe Kunde: Im Osten und Westen leben in der Region, in der Helios aus dem Ringstrom aufsteigt und wieder in ihn eintaucht, die durch die große Hitze versengten Αιθίοπες, die .Brandgesichter'; was zwischen diesen und den bekannteren Völkern lebt, nennt man zusammenfassend .morgendliche und abendliche Menschen' (ήοίοι καί έσπέριοι ά.). Im Süden kennt man zuäußerst das Zwergvolk der Πυγμαίοι, im Norden - den wärmehungrigen Griechen verständlicherweise am wenigsten vertraut - stellt man sich die "Αβιοι, die ,Gewaltfreien', vor. Diese Randzonengruppen umgeben kreisförmig das eigentliche Menschheitszentrum: Kleinasien und Griechenland - mit der Inselwelt, die zugleich vermittelnder Verkehrsweg ist, dazwischen. Die in diesem Zentrum lebenden Menschen gliedern sich in die beiden Hauptgruppen der Griechen - in der Regel 'Αχαιοί, Άργειοι oder Δαναοί, aber einmal, im Schiffskatalog, auch schon I Πανέλλη- 24 νες genannt9 - und der ,Anderssprechenden ' (άλλόθροοι άνθρωποι, einmal βαρβαρόφωνοι). Die .Anderssprechenden' werden bereits klar nach ihren Einzelsprachen unterschieden, am detailliertesten in Kleinasien, wo so gut wie alle historischen Völkerschaften dieser Zeit geographisch und ethnisch, hier und da auch mit besonderen Eigenheiten und Bräuchen, wohlvertraut sind, also - um nur die wichtigsten zu nennen - die Mysier, Phryger, Troer, Lykier, Lyder, Karer. Im Süden schließen sich die Φοίνικες, die Αιγύπτιοι und die Σιδόνιοι, wohl die Karthager, an; die Odyssee kennt im Westen zusätzlich noch die Σικελοί, vielleicht auch Bewohner Unteritaliens. Die Griechen selbst, die sich für Homer noch nicht in die drei Hauptstämme gegliedert haben, siedeln noch nicht an der kleinasiatischen Küste, sondern nur auf den Inseln (einschließlich Kretas, aber noch ohne Kypros) und auf dem Festland, und zwar in der Regel in einer bereits städtisch geprägten Siedlungsweise. 9
Β 530. Die Stelle wird zu wenig beachtet; M.I. Finley (u. Anm. 13) 98 ist noch 1982 der Meinung, daß „in der Uias und der Odyssee seltsamerweise nie der Name .Hellenen' auftaucht".
80
Das Menschenbild Homers
Frühere Vorstellungen, die die Entstehung der πόλις als Normalform griechischen Zusammenlebens erst in nachhomerische Zeit verlegen wollten, sind im Zusammenwirken von Philologie, Archäologie und Geschichtsforschung korrigiert worden. Die Helden vor Troja, die uns bei unserer Ilias-Lektüre manchmal tatsächlich nichts anderes im Kopf zu haben scheinen als - nach einer unglücklichen Formulierung Leskys - „auf ihren Streitwagen über das Blachfeld zu stürmen" 10 oder - so Bayer in den ,Grundzügen der griechischen Geschichte' von 1970 - ihre „Rosse auf dem Blachfeld zu tummeln" 11 , sie alle, Troer wie Griechen, sind in Wahrheit Politen, die sich allerdings in einer ungeheuerlichen Ausnahmesituation befinden. „Sicherlich", läßt Homer den Odysseus in seiner massenpsychologisch höchst raffinierten Umstimmungsrede im Β der Ilias zu den plötzlich gar nicht mehr so heldisch wirkenden heimwehkranken ,Recken' Edlen wie Gemeinen - sagen, „sicherlich - wenn einer auch nur einen Monat lang wegbleiben muß von seiner Frau, mit dem vielrudrigen Schiff, weil ihn die Stürme des Winters abschneiden und das aufgewühlte Meer, da ist er schon ungehalten vor Ungeduld; für uns aber ist dies das neunte Jahr, daß wir hier ausharren; drum nehm' ich's nicht übel den Achaiern, daß sie ungehalten sind bei 25 den Schiffen, I den gewölbten ...". Der ganzen Beredsamkeit eines Odysseus und eines Nestor und der danach wieder forschen Martialität des unglücklichen Führers Agamemnon bedarf es, bis die Massen wieder in ihr Biwak zurückkehren, und dann traut Homer dem Frieden immer noch nicht und läßt lieber auch noch Athene höchstpersönlich aigisschüttelnd durch das Lager stürmen und jedem einzelnen Kampfkraft im Herzen erregen, bis der Dichter endlich - selbst noch ungläubig staunend über das Paradoxon - konstatieren kann: Β 453
Und da war denen plötzlich der Krieg - süßer als das Heimfahren geworden, das Heimfahren in den bauchigen Schiffen ins liebe Vaterland! ,1ns liebe Vaterland' - oder auch häufig: ,nach Hause ins liebe Vaterland' (οικόνδε φίλην ές πατρίδα γαίαν 12 ): das eben ist die heimatliche Polis, wie sie 10
A. Lesky, Griechische Literatargeschichte, Bern-München 3 1971, 75. E. Bayer, Grundzüge der griechischen Geschichte, Darmstadt 1970, 29. Wichtig scheint mir, daß das οικόνδε dabei noch nicht wie unser ,nach Hause, heim' zu einer bloßen ungegenständlichen Formel abgeblaßt ist, sondern daß der Sprecher damit noch eine ganz konkrete Vorstellung von einem wirklichen, seh- und fühlbaren Haus verbindet; das beweisen die liebevoll konkretisierenden Alternativ-Ausdrücke οίκον έ ς ύψόροφον καν σήν (έήν) ές πατρίδα γαίαν - οίκον έϋκτίμενον και σήν (έήν) ές π. γ. - Zur Bedeutung der Heimat und des οίκος („Landgut, Haus und Hof, Eltern, Frau, Kinder [...] Hausgesinde") eindringlich H. Strasburger, Zum antiken Gesellschaftsideal (u. Anm. 17), 18 f. 11
Das Menschenbild Homers
81
uns nicht nur die Polis-Bilder auf dem Schild des Achilleus oder die vielen Szenen aus der Polis Troja lebendig machen (die ja in der Alltäglichkeit ihrer Details nur der persönlichen Polis-Erfahrung des Sängers entspringen können), sondern auch die vielen kurz eingestreuten Bemerkungen und Reminiszenzen in den direkten Reden, die Homer den .Frontsoldaten' in den Mund legt, vor allem in den Kampfparänesen, häufig auch in den klagenden Kurzlebensläufen, mit denen er gefallenen .kleinen Kämpfern' an Stelle von Vater, Mutter, Geschwistern und Freunden das Ehrendenkmal der Heimat-Polis setzt. Was ist das nun für eine .Stadt', in der der οίκος dieser Menschen steht, das ,Heim', in dem - so sagt Agamemnon einmal - „unsere Frauen und unmündigen Kinder in den Zimmern sitzen und warten" (B 136f.)?13 Nach unseren Begriffen ist es ein Dorf, häufig an einer kleinen Anhöhe gelegen und befestigt 14 , aus kleilneren und größeren Höfen bestehend, deren größter dem βασιλεύς,, Vorste- 26 her' oder - wie ihn Hans-Armin Gärtner treffend genannt hat 15 - .Bauernkönig', gehört. Diese Siedlung, auch άστυ genannt, bildet den Mittelpunkt des Agrarlandes (άγροί); das Weideland (νομοί) - gegebenenfalls mit Schutzgehöften für Herden-Aufseher, Verwalter usw. - liegt drumherum; dann kommt die έσχατιή, die .Äußerste', die die Grenze zur Nachbargemeinde bildet. Dieses Siedlungsbild, das beide Epen prägt und das die Realität des 8. Jahrhunderts widerspiegelt, wird nur hier und da überlagert von den überkommenen Reminiszenzen an die große Vorzeit, die wir die mykenische nennen und die Homer als die Zeit der Helden (ήρωες) kennt. In ihr waren die Menschen zwar nicht anders, als sie in der Gegenwart sind (und in dieser qualitativen Homogenität liegt die Einheit des traditionellen homerischen Menschenbilds begründet), aber sie waren größer, stärker, reicher, schöner als die heutigen (οίοι νΰν βροτοί είσι), sie verfügten dementsprechend über mehr Macht, entfalteten größere Pracht in der öffentlichen und privaten Lebensführung und handelten mit größerer Willkür; Agamemnon von Mykene Zum Folgenden s. jetzt F. Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, Wiesbaden 1981, hier bes. 35 ff. Die allgemeinsten Grundlinien auch bei Μ. I. Finley, Die frühe griechische Welt, München 1982, Kap. 8 (.Staat und Gesellschaft in der archaischen Zeit'), hier bes. 102 ff. 14 Die frühe (spätgeometrische, also $.Π. Jh.) Umwallung (mit einem bis zu 150 cm hohen und 250 cm breiten Bruchsteinsockel, darüber Lehmziegeloberbau) auch von kleinen Landstädten und Landgemeinden, ja selbst von Weilern ist nachgewiesen worden von H. Lauter-Bufé/ Η. Lauter, Archäologischer Anzeiger 1975, 1-9. H.-A. Gärtner, Beobachtungen zum Schild des Achilleus, in: Studien zum antiken Epos, hrsg. ν. H. Görgemanns u. E. A. Schmidt, Meisenheim a. Gl. 1976, 46-65; hier: 55. 59, Anm. 30.
82
Das Menschenbild Homers
in Argos als peloponnesischer αναξ ανδρών, der alle griechischen βασιλήες zum Heerbann aufbieten und ihre Strafexpedition im Ausland jahrelang als Oberfeldherr leiten kann, ist das personifizierte Konzentrat aller dieser auf tradierten Erinnerungen an das mykenische Palastkönigtum aufbauenden Idealisierungsvorstellungen. Denn um Idealisierung handelt es sich selbstverständlich in einer Zeit, die besonders in den Zeitgenössisches widerspiegelnden Gleichnissen, häufig auch in den notwendig aus der Welt Homers heraus gestalteten direkten Reden ihre relative Armut und allgemeine Kleinheit der Verhältnisse verrät. Daß es aber gerade diese Ideale sind: Größe, Stärke, Schönheit, Reichtum, Macht - also nicht etwa Arbeitsamkeit, Fleiß, Bescheidenheit, Geduld, Gerechtigkeit (wie doch schon bei Hesiod) - , das weist das Menschenbild Homers und seiner ursprünglichen Adressaten deutlich als ein aristokratisches Menschenbild aus. (b) Damit sind wir zur sozialen Komponente dieses Menschenbildes überge27 gangen. Die Adressaten der homerischen Erzählunlgen sind die Aristokraten. So ist es selbstverständlich, daß der Blickpunkt, von dem aus Homer die Menschen sieht, ihr Blickpunkt ist. Unter ihnen steht eine dünne Schicht von nicht-aristokratischen Freien, die δημιοεργοί. Oft irrtümlich immer noch mit .Handwerker' wiedergegeben (was griechisch χειρουργοί oder χειροτέχναι heißen müßte) bedeutet δημιοεργοί .diejenigen Leute, die Gemeindliches werken, die für die Gemeinde wirken, die für alle arbeiten' (im Gegensatz zu den anderen, die nur für sich und die Ihren arbeiten)16. Diese δημιοεργοί, zu denen, wie man bei diesem Bedeutungsansatz besser versteht, neben Wandersängern und Baumeistern auch Ärzte und Seher gerechnet werden, bilden eine zahlenmäßig schwache Schicht meist nichtseßhafter Freier; es sind Spezialisten für schwierig zu erlernende Sonderberufe; sie ziehen von Polis zu Polis, über die άστεα ανθρώπων, hin und bieten denen, die sie bezahlen können, ihre Dienste an. Diese Zahlungskräftigen finden sich allerorten unter den freien Grundbesitzern. Sie bilden die Führungsschicht der homerischen Gesellschaft. H. Strasburger17 hat uns sehen 16 F. Gschnitzer (o. Anm. 13) 33. F. Eckstein, Handwerk, Teil 1, in: Archaeologia Homérica, L 37 f. (mit Anm. 255), Göttingen 1974. 17 H. Strasburger, Der soziologische Aspekt der homerischen Epen, Gymnasium 60, 1953, 97-114; Zum antiken Gesellschaftsideal, SBHeid 1976 (4), Heidelberg 1976, 19 f. mit Anm. 43 („die Wirklichkeit der Zeit [scheint] eher , Adelsherrschaft' [zu sein], das heißt der Machtkampf von sich .Könige' nennenden Oberhäuptern der reichsten Geschlechter"; Homers .Könige' sind „die jeweils reichsten Gutsherrn ihrer Gegend. Das gilt genauso für die ¡lias, nur bezieht sie es nicht in die Handlung ein" [Hervorhebung von mir]).
Das Menschenbild Homers
83
gelehrt, daß diejenigen, die Homer als die έσθλοί, άριστοι usw. bezeichnet, die Oberschicht eben dieser freien Grundbesitzer sind, und F. Gschnitzer hat in seiner kürzlich erschienenen .Griechischen Sozialgeschichte' (s.o. Anm. 13) die Position und Lebensform dieser wohlhabenden Grundbesitzerschicht, die wir ,Adel' zu nennen gewohnt sind, mit vorbildlicher Klarheit nachgezeichnet. Es sind Großbauern oder, wenn man will, Gutsbesitzer, die über mehr Land, mehr Vieh, mehr bewegliches Vermögen und mehr Sklaven (δμώες) und Lohnarbeiter (θητες, εριθοι) verfügen als die meisten anderen in der Siedlung. Sie bilden auf Grund ihrer sozialen Vorrangstellung zusammen mit den Gleichgestellten eine natürliche Interessengemeinschaft, die über die Gemeindegrenzen weit hinausreichen kann, nicht zuletzt dank gemeinsamen kriegerischen Unternehmungen, aber auch dank der im Ausland Rechtsschutz verleihenden Institution der .Gastfreundschaft' (ξεινοσύνη, ξενίη), und sie können durch ein Netz solcher auswärtiger Verbindungen sowohl ihren Reichltum (etwa durch Heiraten und Erbschaften) als auch ihre Macht im Innern festigen. Sie entscheiden die laufenden Gemeinschaftsangelegenheiten in der βουλή oder γερουσία, sie sind bei der Verhandlung existentieller Fragen (wie z.B. Kriegsfortsetzung oder Abzug im Β der Ilias) im Rat der Gemeinde, der άγορή, die Wortführer (die Geringeren murmeln nur Beifall oder murren), sie üben nach Gewohnheitsrecht die Richterfunktion aus, und sie sind auch die - bestausgerüsteten - Anführer und Vorkämpfer (πρόμαχοι) 18 im Kriege. Ihre Lebensführung ist aufwendig und repräsentativ, in Häusern, die sich durch Größe und Möblierung, oft sogar Luxus von denen der anderen abheben. Eigener Arbeit in Haus und Hof sind sie wohl noch nicht ganz entwöhnt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter greifen wohl ebenfalls zu 19 , aber nach Ausweis vieler Stellen wird man sich diese .Arbeit' insgesamt mehr als fachkundiges Beaufsichtigen, Anleiten, Verwalten und Organisieren vorstellen: wo immer ein ξείνος zu einem anderen kommt, hat der Besuchte jedenfalls stets sogleich Zeit genug für Empfang, Mahl und Gespräche, und wir gehen kaum fehl, wenn wir diese Grundbesitzer nach ihrer ganzen Lebensführung eher mit Landjunkern als mit Landwirten vergleichen. Als Reiche haben sie die Mittel, sich öfter und aufwendiger als die anderen den schöneren Seiten des
Zur Soziologie und Funktion der πρόμαχοι s. J. Latacz, Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, München 1977 (Zetemata 66), 150. Die manuelle Arbeit dieser .Adeligen' wurde schon von Strasburger stark betont, jetzt auch von Gschnitzer (o. Anm. 13) wieder hervorgehoben (bes. 39). Gewisse Abstriche daran wären - vor allem bei Berücksichtigung der Schildszenerie (s. Gärtner, o. Anm. 15) - m. E. angebracht.
28
84
Das Menschenbild Homers
Lebens zuzuwenden: den Vergnügungen der sportlichen Wettkämpfe, den Ballund Brettspielen, der Jagd, den Festmählern mit Gesang und Tanz und - den Darbietungen der Sänger. Gerade der Sänger, der ja die großen Taten und den Ruhm der Vorfahren dieser Reichen kündet und damit überall, wo er hinkommt, auch ihr κλέος, ihr .Hörensagen', verbreitet, also für ihre .publicity' sorgt, ist ein wichtiges Funktionsglied in ihrer öffentlichen Repräsentation. Darum wird er, wie Intellektuelle stets am Hof der Macht, hoch geehrt - jedenfalls solange er affirmativ operiert; daß er nur eine untergeordnete Stellung einnimmt und ge29 wissermaßen ,an- und abgestellt' werden kann20, ist dem Sänger I dabei durchaus bewußt, und daß er, der an Besitz-Erwerb und Materiellem nun einmal nicht Interessierte, bei diesem Abhängigkeitsverhältnis die Ideale und den Blickpunkt derer singt, die ihn erhalten und in deren Lebenskreis allein er, der Wissende und Welterfahrene, sich auf Dauer wohlfühlen kann, das versteht sich von selbst. So wird die Identifikation des Sängers mit seinen eigentlichen Adressaten - wir könnten sogar so weit gehen, zu sagen: Abnehmern - auf ganz natürliche Weise vollkommen21. (c) Das Menschenbild, das aus derartigen Lebensbedingungen einer materiellen, sozialen und geistigen Unabhängigkeit, aber auch aus dem Bewußtsein öffentlicher Verantwortung und Leistungsverpflichtung erwächst, hat, wie zu erwarten, ein freiheitliches, großzügiges, offenes, stolzes, dynamisches und insgesamt kraftvoll-positives Gepräge. Die Werte, die das Denken und Handeln dieser Menschen leiten - und damit sind wir bei der ethischen Komponente - , lassen sich als .expansive' Werte bezeichnen, d.h.: als erstrebenswert und damit gut gelten mehrheitlich solche Handlungen und Einstellungen, die geeignet sind, das Prestige, den Einfluß, den Ruhm und den Handlungsspielraum des Einzelnen zu erweitern. Handlungsziele sind demgemäß: (1) Besitz (χρήματα) in allen Formen (vor allem Land, Vieh, Kriegsbeute, insbesondere Gold, Silber und EiPhemios und Demodokos haben je nach Laune ihrer jeweiligen .Herrschaft' (das sind in unserer Odyssee: Penelope, Telemachos, die Freier; Odysseus, Alkinoos, u. v. a.) diesen oder jenen Gesang anzustimmen, mit diesem aufzuhören, statt seiner einen anderen zu beginnen, usw. Es scheint mir bedenklich, wie Gschnitzer (.Politische Leidenschaft im homerischen Epos', in: Studien zum antiken Epos [o. Anm. 15] 1-21) aus den unterschiedlichen Stellungnahmen des Epos zur damals aktuellen Generalproblematik .König - Adel - Volk' auf entsprechend verschiedene Sänger-Individuen zu schließen. Sollte es nicht eher so sein, daß der Sänger die Zeitproblematik realistisch widerspiegelt, indem er die verschiedenen Meinungsrichtungen auch in seinem Werk zu Worte kommen läßt, dabei aber an seiner Loyalität zum ,AdeP - das scheint mir deutlich - keinen Zweifel läßt? Das war doch wohl die einem Intellektuellen gemäße Haltung, dessen Prestige sich ja nicht nach seiner Fähigkeit zur Lobhudelei, sondern nach dem Grad seiner Weltkenntnis bemaß.
Das Menschenbild Homers
85
sen, Wagen und Pferde, kriegsgefangene Männer, Frauen und Kinder, die entweder Lösegeld bringen oder als Arbeitssklaven Verwendung finden), (2) Ehre (τιμή), die durch immer neue Beweise der Leistungskraft (άρετη), durch Vermeidung allen unehrenhaften Verhaltens wie z.B. Furcht, Flucht, Unwahrhaftigkeit, niedrige Gesinnung sowie durch unverzügliche und kompromißlose Abwehr jeder Ehrenkränkung (άτιμίη) stets aufs neue erworben werden muß, (3) Ruhm (κΰδος, κλέος), der möglichst weit, am besten über die ganze Welt hin (πάντας έπ' άνθρώπους) und in die Nachwelt hinein (καί έσσομένοισι μετ' άνθρώποισι) reichen soll. Auf diese drei Höchstwerte: Besitz, Ehre, Ruhm, ist das gesamte Wertdenken des homerischen Menschen ausgerichtet, so I daß ein ganzes Bezugsgefüge re- 30 konstruierbar wäre, in dem ζ. B. auch die Werte der tolerierenden Distanzwahrung wie z.B. αιδώς, das ,Nicht-zu-nahe-treten-Wollen' aus Rücksichtnahme auf den Selbstverwirklichungswillen auch des anderen, ihren sinnvollen Platz fänden. Es ist in unserem Rahmen natürlich nicht möglich, dieses Bezugsgefüge mit seinen zahllosen Einzelgliedern und seinen komplizierten Relationen näher zu analysieren. Nicht ungesagt sollte aber vielleicht zweierlei bleiben: (1) daß Homer sein Bild vom menschlichen Streben und Verhalten natürlich nicht wie der reflektierende Ethiker zum System ausgebaut hat (der Systemhunger unserer philologischen Rekonstruktionsarbeit führt uns da oft in die Irre), und (2) daß jedem Kenner der homerischen Menschendarstellung die auch heute noch verbreitete Rede von der .Primitivität', der .Simplizität', der ,Archaik' usw. des homerischen Menschen als bedauerlicher anthropologiegeschichtlicher Irrtum erscheinen muß. Die Methode der sog. strikten Lexikalität hat hier viel Unheil angerichtet. Die Dimension des Ethischen kann nicht nach dem Motto ,quod non est in verbo, non est in mundo' erfaßt werden. Mit Recht hat K. Lanig22 daran erinnert, „daß sich die Seele des Menschen [ . . . ] - nach ihrer potentiellen Struktur - gar nicht verändern kann" und daß wir uns nur „des Abstandes bewußt bleiben (müssen), welcher zu allen Zeiten zwischen den anthropologischen Sachverhalten und deren begrifflicher Faßbarkeit besteht", indem „die anthropologischen Sachverhalte de facto fortgeschrittener und differenzierter sind als die Ausdrucksmöglichkeiten, mit denen sie sich selber aussagen". Die moderne Soziolinguistik hat das bestätigt. Wer in den Epen nicht nur die Benennungen sucht und zählt, sondern mit den homerischen Menschen in ihrem Reden und Schweigen, ihrem Handeln und Stillehalten, ihrem Einander-Verstehen und Einander22
K. Lanig, Der handelnde Mensch in der Ilias, Diss. Erlangen 1953, 3 f.
86
Das Mensebenbild Homers
Zurückweisen mitlebt, der fühlt, wie differenziert, hellhörig, verletzlich, aber auch ironisch und zweifelnd diese Menschen sein können. Das Bild von den ungebrochen heroischen Haudegen, für die „ihre Kriegszüge" - wie selbst Strasburger einmal formuliert hat - „die Festtage ihres Lebens sind" 23 , - dieses Bild ist nicht das Homers. I 31 Wie alle zum Klischee erstarrten Übertreibungen hat allerdings auch diese einen Kern: er liegt darin, daß dem Verhalten dieser Menschen etwas Hocherhobenes, ja sogar durchaus Hochfahrendes und Herrisches sein Gepräge gibt. Dies ist jedoch, wenn man genauer zusieht, gerade keine naive Ungebrochenheit oder gar Kraftmeierei, sondern ein Selbstgefühl, das eben aus dem Bewußtsein der eigenen Differenziertheit und Genußfähigkeit kommt. Dieses Bewußtsein führt dann zu einem ausgeprägten Selbstabgrenzungswillen in dem, was man auch in neuesten Darstellungen nicht zu Unrecht als Herrenmoral24 bezeichnet. Vieles von Friedrich Nietzsches Definition dieses Begriffes trifft auf Homers idealisierte Trojakämpfer zu. „[...] wenn die Herrschenden es sind", sagt Nietzsche, „die den Begriff ,gut' bestimmen, sind es die erhobenen, stolzen Zustände der Seele, welche als das Auszeichnende und die Rangordnung Bestimmende empfunden werden. Der vornehme Mensch trennt die Wesen von sich ab, an denen das Gegenteil solcher gehobener Zustände zum Ausdruck kommt: er verachtet sie [...]. Verachtet wird der Feige, der Ängstliche, der Kleinliche, der an die enge Nützlichkeit Denkende"25 usw. Damit ist der Kern dessen, was diese Menschen in der Sicht Homers kennzeichnet, wie mir scheint, erfaßt: Der sichere, noch unhybride und unaffektierte Standesstolz, das hochgespannte Selbstgefühl, die drängende Lebenslust, die das Selbst stets ganz verwirklichen will26 und sich über Warnungen gern hinwegsetzt (Diomedes, Patroklos, Hektor!), kurz: der prinzipielle Optimismus. Wir brauchen nur an Hesiod zu denken mit seinem
23
H. Strasburger, Der soziologische Aspekt (o. Anm. 17) 105. Richtig dagegen Gschnitzer (o. Anm. 13) 39: „Übrigens gilt ihnen auch der Krieg selbst als schwere und gefährliche Arbeit, nicht etwa als eine Art Sport". Später hat sich Strasburger berichtigt: „Auch der Qiasdichter unterstellt, daß Anführer und Mannschaften im ganzen nur widerwillig vor Troja ausharren, die ersten der Pflicht folgend, die letzteren dem Zwang" (,Zum antiken Gesellschaftsideal' [o. Anm. 17] 18). 24 So z. B. Lesky, Art. .Horneros' (RE Suppl. XI, Stuttgart 1967, Sp. 40, 50 des Sonderdrucks). 25 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Neuntes Hauptstück: Was ist vornehm? (260) [Friedrich Nietzsche. Werke in sechs Bänden, hrsg. v. K. Schlechte, München - Wien 1980, Bd. IV 730]. Vgl. H. Strasburger, Der Einzelne und die Gemeinschaft im Denken der Griechen, HZ 177, 1954, 236: „zugrunde liegt die Überzeugung vom natürlichen WillkürTecht der Stärkeren".
Das Menschenbild Homers
87
„pessimistischen Argwohn gegen die ganze Lage des Menschen"27, um das Bejahende an diesem Menschenbild, das natürlich durch den sozialen Standort des Sängers in dieser brodelnden Zeit bedingt ist, mit einem Schlage zu erfassen. Diese Vitalität leitet sich aber nicht etwa her aus einer Blindheit I gegenüber 32 den Übeln dieser Welt. Die Bedingtheit der Menschen durch die räumliche und zeitliche Begrenzung ihrer Existenz, also durch ihre Erdgebundenheit und Augenblicksbezogenheit (s. LfgrE [o. Anm. 8] 890,48 ff.), ihre Vergänglichkeit (Z 146 ff. Φ 463 ff. τ 328), ihr Ausgeliefertsein an Krankheit und Tod - alles das ist Homer und seinen Hörern durchaus bewußt. Aber es drückt sie nicht nieder. Es macht sie nicht demütig. Und es führt sie nicht in eine resignative oder gar tragische Weltsicht der Auswegslosigkeit hinein28. Schreckliches geschieht, und manches davon - wie etwa das Achilleus-Schicksal - wäre vielleicht auch den homerischen Menschen, hätten sie unsere Begrifflichkeit gekannt, als .tragisch' erschienen. Aber alles das steht für sie - wie Lesky einmal in anderem Zusammenhang formuliert hat - nur „als Teilereignis in der Welt", es „bedeutet nicht das Ganze der Welt", und „es erhält aus den Gesetzen des übergreifenden Ganzen seinen Sinn" 29 . Darum wird es in illusionslosem Realismus akzeptiert. Selbstverständlich wird es nicht gemocht. Nichts ist natürlicher, als daß diese Menschen, die so sehr die Sonne und das Leben lieben, die so sehr an Haus und Gut und auch an ihrer Heimat hängen, die sich nach ihren Frauen sehnen („sind etwa die Atriden die einzigen Menschen", schleudert Achill im I dem Odysseus entgegen, „die ihre Frauen lieben?", und schon im 3. Vers der Odyssee, gleich nach dem Prooimion, heißt das ganze Leidensziel des Helden νόστος ήδέ γυνή, Heimkehr und Frau) - , nichts also ist natürlicher, als daß diese Menschen alles Dunkle, Kummervolle und Lebensfeindliche zutiefst verabscheuen: die Krankheit, das Alter - und das Unerträglichste von allem: den Tod. Das alles ist unschön, häßlich, αίσχρόν, eine Schande geradezu. Aber: es ist da, und es ist unentrinnbar. Dies ist die vielleicht beeindruckendste Erfahrung, die wir mit dem Menschenbild Homers machen können: daß es keine Pseudo-Vitalität ist, die da in den Menschen hineingesehen würde und die im Angesicht des Todes zusam27
F. Nietzsche (o. Anm. 25) 732. Daß die Ilias, wie immer wieder gesagt wird (s. zuletzt u. a. W. Kulimann, Die neue Anthropologie der Odyssee und ihre Voraussetzungen, Didattica Classica Gandensia 17/18, 1977/ 78, 37-49), durch eine tragische Weltsicht geprägt sei (der dann in der Odyssee eine untragische gegenüberträte), vermag ich nicht zu sehen. Daß in einem Kriegsbuch Grauenhaftes steht, bedeutet ja nicht, daß sein Verfasser die ganze Welt tragisch sieht. Hier bedürfte es zunächst einer klareren Begrifflichkeit. 29 A. Lesky, Die griechische Tragödie, Stuttgart 2 1958, 27. 28
88
Das Menschenbild Homers
33 menbräche wie ein Kartenhaus, sondern daß diese Stärke sich als echt I erweist in der Bewährung vor dem Unausweichlichen: da wird dann nicht Trost gesucht bei hoffnungverheißenden Jenseitsmächten, bei magischen Praktiken oder in bettelnder Lebensreue, sondern der Tod wird als verächtliches Odiosum mit hineingenommen in die Realität und als Posten in die stolze Verpflichtung zu permanenter Bewährung (,immer der Beste zu sein und überlegen den anderen') eingesetzt. Wir Heutigen in der vielfältigen Gebrochenheit, Unsicherheit, Desillusioniertheit und Zerquältheit unserer alt gewordenen Existenz vermögen dieses Lebensgefühl nur schwer noch nachzufühlen, weil wir's kaum ertragen können, und wir mögen geneigt sein, uns durch überlegene Ironie von der Sogkraft dieser scheinbar naiven ,Glanz und Gloria-Ideologie' freizuhalten. Aber wir sind als Philologen nicht aufgerufen, zu verurteilen, sondern zu verstehen und zu bewahren. In allem nur sich selbst zu suchen zeugt nicht von Größe und engt ein. (d) Es ist nur konsequent, daß Menschen dieser Art - und damit komme ich zur religiösen Komponente - sich ihre überkommenen Götter gleichgeartet denken. Nicht als weise, abgeklärte, gütige Lichtgestalten, sondern als ebenso leicht erregbare, aufbrausende, aber auch wieder versöhnbare und hilfsbereite, eben ganz und gar vitale Herrentypen, wie sie selbst es sind. Der Götterstaat als Widerspiegelung der eigenen aristokratischen Sozialordnung, die Götter-Ethik als Widerspiegelung der eigenen Herrenmoral: in der Ausbildung dieser Form von Religion, die wir seitdem die homerische nennen, hat sich die Menschenart, die sich im Sängervortrag spiegelte, die wohl stärkste Rechtfertigung und Selbstbestätigung geschaffen, die denkbar ist. Die alte Grundschicht der Ritualreligion mit Gebet und Opferzeremoniell, wie sie uns vor allem W. Burkert verstehen gelehrt hat 30 , vermochte das hohe Gefühl dieser Menschen für Eigenwert und Würde nicht mehr zu befriedigen. In ihrer Freiheit31 und Tatkraft fühlten sie sich dem Vollkommenen offenbar so nahe, daß sie sich ihre Götter nicht viel anders denken konnten, als sie selbst geartet waren. Nur eben noch freier, noch mächtiger - auch den letzten Beschränkungen, denen sie selbst sich nicht entziehen konnten, nicht mehr unterworfen: frei von Alter, Krankheit und Tod. 34 Wir sehen, wie sich I das Menschenbild Homers in diesem Götterbild, das ja
30
W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart usw.
1977. 31 Zum Freiheitsgefühl („überaus empfindlicher Freiheitsdrang") s. bes. H. Strasburger (o. Anm. 26) 240 ff.
Das Menschenbild Homers
89
Bestandteil des Menschenbildes ist, vollendet widerspiegelt 32 . Durch das Insistieren auf der Gott-Entsprossenheit (διογενής, διοτρεφής) und der dadurch bedingten Gott-Ähnlichkeit (θεοίς έπιείκελος u. ä.) soll die unüberbrückbare, aber nicht ergeben hingenommene, sondern eher als Ärgernis empfundene Distanz weiter verringert werden. Aus diesem unmutsvollen Streben nach Distanzverringerung im Vollgefühl der Wesensähnlichkeit erklären sich manche Züge am Menschenbild Homers, die uns Modernen fremdartig, ja befremdlich vorkommen: das Aufbegehren des Menschen gegen den Gott wie von gleich zu gleich (Diomedes im E, Helena im Γ usw.), der vertraute Verkehr zwischen Menschen und Göttern überhaupt, die burschikos-ironische SympathieErklärung in Form burlesker Säkularisierung, kurz: der - wie Finsler es seinerzeit ausgedrückt hat - „geringe Einfluß der religiösen Scheu auf die Handlungen der Menschen" 33 . Auch daß die Götter nicht ganz allmächtig vorgestellt werden, daß über ihnen durch die μοίρα oder αισα ein noch höherer Schicksalswille wirkt, dessen Verwalter sie nur sind, zeugt wohl eher für das trotzige Selbstbewußtsein derer, die derartige Relationen erfanden, als für ein uraltes Prinzip der Volksreligion. Möglicherweise liegt in der zähen Rivalität zwischen diesen Menschen und ihren Göttern auch die eigentliche Erklärung für das vielumstrittene Nebeneinander, Ineinander, Gegeneinander von menschlicher und göttlicher Motivation des menschlichen Handelns. Den Göttern wird offensichtlich nicht mehr die volle, uneingeschränkte Freiheit zugebilligt, über die Richtung menschlichen Handelns allein zu verfügen. Sie dürfen dem Menschen - so haben es vor allem A. Heubeck und H. Gundert in eindringlichen Analysen nahegelegt34 - eigentlich immer nur den Gedanken, die Tat, das Verhalten in den Sinn legen, zu denen er selbst schon disponiert war. In dieser ,Konzessionierung' der Götter I durch die Menschen liegt aber nun ein so selbstverständliches Bewußtsein von 35 der Selbstverantwortlichkeit der eigenen Entscheidung, daß eine Reflexion dar32
Vgl. H. Schwabl, Art. .Menschenbild' im LAW, Sp. 1909: „Das Götterbild ist gesteigertes Menschenbild". 33 G. Finsler, Homer. I: Der Dichter und seine Welt, Leipzig - Berlin 2 1913, IX. 34 A. Heubeck, Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlangen 1954. H. Gundert, Charakter und Schicksal homerischer Helden, NJbb 115, 1940, 225-237, und besonders in seiner Rezension von H. Frankels .Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums', Gnomon 27, 1955, 4 6 5 483. [Das ganze Problem der menschlichen Handlungsfreiheit ist jetzt umfassend aufgearbeitet und gleichfalls im oben angedeuteten Sinne entschieden von A. Schmitt, Selbständigkeit und Abhängigkeit menschlichen Handelns bei Homer. Henneneutische Untersuchungen zur Psychologie Homers, Abh. Akad. Mainz 1990/5, Stuttgart 1990 (eine Vorstudie dazu in DASIU 29, H. 2,1982, 6-23)].
90
Das Menschenbild Homers
über - wie man sie nach Analogie des bereits philosophisch-theologisch verunsicherten Helden im Drama auch in den wenigen expliziten Entscheidungsszenen bei Homer schon suchen zu müssen glaubte - gar nicht in Frage kam. Erst in der Odyssee beginnt den Menschen ihre Selbstverantwortlichkeit zum Problem zu werden; nun beginnen sie - wie der Sänger den Zeus am Epos-Eingang ungehalten ausrufen läßt - tatsächlich allen Ernstes den Göttern die Schuld für ihr Ungemach zuzuschieben; früher - etwa im Falle Agamemnons im Τ - war das eine nicht sehr ernst genommene Ausflucht gewesen, jetzt wird es, scheint der Sänger sagen zu wollen, zur Regel - und auch das ist wohl eine Widerspiegelung sozialer Veränderungen; denn wo die Herren schwächer werden, ihr Selbstgefühl abnimmt und der Freiheitsraum der Wenigen enger wird, schwindet auch der Wille zur Selbstverantwortung - die früher als Teil der sozialen Ausgezeichnetheit unbefragt angenommen wurde - , und für das eigene menschliche Versagen werden nun die fremder, ferner und autonomer gewordenen Götter verantwortlich gemacht. Für den Menschen der Ilias aber ist das Sich-Entscheiden-Müssen eine noch gar nicht problematisierte Selbstverständlichkeit, deren Implikationen - wie ζ. B. den Fehlschlag nach einer Fehlentscheidung - er in der Regel in der nachträglichen Selbstbeschuldigung und Selbstanklage wissend auf sich nimmt. Von einer „Alleinverantwortlichkeit von Gottheit und Schicksal" und einer „Marionettenhaftigkeit menschlichen Tätig-Seins" - so hat Heubeck ([o. Anm. 34] 80) die durch den Namen Snell gekennzeichnete Position 1954 schon genannt und abgelehnt - sollten wir vielleicht heute denn doch nicht mehr sprechen. (2) Damit sind wir beim innersten Kreis des Menschenbilds Homers angelangt, bei der psychologischen Komponente. Wie sieht Homer den Menschen als Einzelwesen? Die Unzahl der hier möglichen Aspekte wurde jahrzehntelang, seit E. Rohdes ,Psyche' von 1894, über W. F. Otto, Bickel, Böhme, Wilamowitz und vor allem Snell auf die eine Frage nach Homers und seiner Adressaten Vorstellung von der menschlichen Seele reduziert. Es wurde weniger danach gefragt, wie die Menschen bei Homer wahrnehmen, erleben, fühlen, denken, verstehen, wollen usw., sondern wo sie dies zu tun glauben. Anlaß für diese eigen36 artig enge und zugleich ein I modernes Bedürfnis widerspiegelnde Fragestellung war die seit der Antike bekannte, aber erst seit ca. 1800 zunehmend bestaunte Tatsache, daß bei Homer die uns Modernen so liebgewordene Dichotomie ,Leib-Seele' jedenfalls in der uns vertrauten sprachlichen Form offenbar nicht existiert. Weder für ,Leib' noch für .Seele' gibt es, wie im späteren Griechisch und seitdem bei uns, einen Terminus, d. h. ein eindeutiges, also stets dasselbe
Das Menschenbild Homers
91
bezeichnendes Alleinvertretungswort. Statt dessen verwendet Homer eine Vielzahl von semantisch offenbar verschieden nuancierten Einzelwörtern. Daraus glaubte man schließen zu müssen, daß Homer Leib und Seele nicht, wie wir, als je eine Einheit und damit auch den ganzen Menschen nicht als organische Einheit aus Leib und Seele sah. Die Tragweite dieser Schlußfolgerung, war sie richtig, lag auf der Hand: Es mußte sich das uns Vertraute dann erst nach Homer entwickelt haben; offenbar hatte die .Entdeckung' des Körpers und der Seele erst nach Homer stattgefunden. B. Snell hat diesen Gedanken in seinem bekannten Essay ,Die Auffassung des Menschen bei Homer' von 1939 so formuliert: „Wo es keine Vorstellung vom Leib gibt, kann es auch keine von der Seele geben, und umgekehrt" 35 und: „[...] die Vorstellung von einem Mittelpunkt, der das organische System beherrscht, ist Homer noch fremd" 36 . Dann aber folge, daß Homer noch nicht die Seele als πρώτον κινούν, als .erstes Bewegendes', kenne. Infolgedessen könne bei ihm aus dem Menschen selbst auch noch nicht „der echte Ursprung einer Regung" kommen. Daraus erkläre sich dann folgerichtig, daß „(Homer) echte, eigene Entscheidungen des Menschen noch nicht kennt". Dies wiederum erkläre, warum bei Homer „das Eingreifen der Götter solche Rolle spielt". Das Endergebnis dieser ganzen Schlußfolgerungsreihe war dann das bereits vorhin zitierte Bild des Menschen als einer Art Marionette: „Geistige und seelische Wirkungen sind Einflüsse der von außen wirkenden Kräfte, und der Mensch steht vielerlei Mächten offen, die auf ihn eindringen, ihn durchdringen können [...]. Die Helden der Ilias [...] fühlen sich [...] ihren olympischen Göttern (ausgesetzt)". Die Menschen Homers würden sich, wenn dieses Ergebnis richtig wäre, nicht als „leiblich-seelisches Ganzes und einheitliches I Selbst" empfinden, sie würden 37 - wie H. Gundert ([o. Anm. 34] 466 f.) es schon 1955 formuliert hat - „sich ins Leere einer uneigentlichen, bloß auf ein Außen .reagierenden' Existenz verflüchtigen". Eine solche Verfassung der homerischen Menschen stünde in einem so evidenten Widerspruch zu Homers wirklicher Menschendarstellung, wie sie auch hier nachzuzeichnen versucht wurde, daß man in Snells Rechnung von Anfang an eine Fehlerstelle vermutete. Heute, nach den Gegenreden und Differenzierungen von Gundert, Heubeck, H. Frankel, Regenbogen, Lesky, Schwabl,
35 B. Snell, Die Auffassung des Menschen bei Homer, in: Die Entdeckung des Geistes, Göttingen 5 1980, 18 (zuerst - nur unwesentlich anders - in NJbb 114, 1939, 3 9 3 ^ 1 0 ) . 36 B. Snell 28; alle folgenden Zitate ebenda und 29.
92
Das Mensebenbild Homers
Adkins u. v. a. 37 , glauben wir zu sehen, wo der Fehler lag: Die Rekonstruktion des homerischen Menschenbilds war sozusagen .umgekehrt' vorgegangen. Sie war nicht vom gesamten dargestellten Sein, Handeln und Fühlen der homerischen Menschen ausgegangen, sondern von einer bestimmten Teilmenge von Wörtern, mit denen Homer über diese Menschen redet. Eine solche Rekonstruktionsmethode ist jedoch grundsätzlich zu eng. Mit Recht hatte Gundert (a. O. 467) gefragt, „ob das Vokabular Homers wirklich genügt, um das Wesen seiner Menschen zu bestimmen". Ich denke, wir sehen heute: es genügt nicht. Wenn Gundert damals weiterfragte, „ob ein wirkliches Bild des Menschen nicht doch erst aus der Analyse der Handlung hervorgeht", so hat er damit die Richtung gewiesen, in der wir künftig weitergehen müssen. Aus der Analyse der Art, wie Agamemnon, Achilleus, Hektor und Odysseus, Priamos und Nestor, Helena, Andromache, Penelope und alle die anderen Menschen Homers handeln, reden, miteinander umgehen, kurz: sich verhalten, können wir, denke ich, klarer, konkreter und umfassender Homers Bild vom Menschen rekonstruieren als aus rationalisierender und systematisierender Überstrapazierung der paar traditionellen Benennungen, mit denen Homer die so schwer zu erfassende Binnenorganisation des Wesens ,Mensch' - ohne jede ,seelenkundliche' Ambition - sprachlich einzufangen sucht. In der Praxis gehen wir ja ohnehin in dieser Weise vor; wie könnten wir sonst konstatieren, was doch jeder sieht, daß schon das Menschenbild der Odyssee von dem der Ilias nicht unmerklich abweicht, das Hesiods gar grundverschieden davon ist - obwohl doch die ,seelenkundlichen' Benennungen - ψυχή, θυμός, φρήν - usw. und ihr Gebrauch in allen drei Werken wesentlich identisch sind! 38
Die von Böhme und Snell aufgeworfene Problematik ist damit naltürlich nicht gegenstandslos geworden. Sie ist nur an ihre Stelle gerückt worden, an die Stelle nämlich einer speziellen Teilfrage. Diese Teilfrage gilt der Entwicklung der menschlichen Begrifflichkeit im Bereich des Leib-Seele-Problems. Auch in diesem kleineren Maßstab gesehen kann der ganze Fragenkomplex heute zwar noch nicht als erledigt gelten: In einer unter meiner Anleitung entstandenen Dissertation von Th. Jahn, die demnächst in den ,Zetemata' erscheinen wird 37a , ist jetzt - wie ich glaube - überzeugend nachgewiesen, daß die Verhältnisse im Wortfeld ,Seele-Geist' bei Homer ganz anders liegen, als wir alle unter dem Banne von Snells faszinierenden Ideen geglaubt hatten, - insofern hier nämlich Genaue Literaturnachweise bei Schmitt (o. Anm. 34). Inzwischen erschienen: Th. Jahn, Zum Wortfeld , Seele-Geist' in der Sprache Homers, München 1987 (Zetemata, Heft 83). 37a
Das Menschenbild Homers
93
gar nicht ein semantisch, sondern ein metrisch bestimmtes System vorliegt. Aber diesen Spezialfragen können wir hier nicht weiter nachgehen. Als wesentliches Ergebnis wollen wir nur festhalten, daß auch für Homer die Menschen, die er sieht und darstellt, sich ihres einheitlichen Selbst durchaus bewußt sind, daß sie sich durchaus nicht als Spielball überirdischer Gewalten fühlen. Nicht immer können sie sich zwar erklären, wie sie dazu kamen, sich zu dem Tun zu entscheiden, das sie wählten, und dann sagen sie wohl häufig - so wie in anderer Weise auch wir noch - : ,das hat Zeus so gefügt, Ares verhindert, Hera gemacht'. Der Sänger bildet diese Art der Menschen, sich die Dinge zurechtzulegen, ab. Aber er ist weit davon entfernt, seine Zuhörer als nicht selbstverantwortliche .Geschöpfe Gottes' darzustellen. Der Sänger ist über die Städte der Menschen hingezogen und hat ihren Sinn kennengelernt, den der .Anderssprechenden' und den der Griechen. Er weiß, was sie besitzen, erstreben, fühlen, denken und glauben. Er kennt die sozialen Unterschiede, die Armut und den Reichtum. Was er aus eigenem Erleben nicht erfahren konnte, hat ihm eine reiche Tradition vermittelt. So ist er in der Lage, Wissen und Erfahrung in einzigartiger Weise in seiner Person zu vereinen. Wenn er zu uns spricht, dürfen wir also darauf vertrauen, eine authentische Stimme jener Zeit zu vernehmen. Sein Menschenbild ist, wie wir sahen, das der Aristokratie - ein Menschenbild der hohen Regungen und der Ideale. Wir selbst mögen heute anders gestimmt sein. Aber das sollte uns nicht dazu verführen, uns durch Herausgreifen bestimmter Einzelstellen, durch Umakzentuierung u. dgl. mit unseren eigenen Problemen der Zerrissenheit, der Angst und des Unglaubens in Homers Welt I hineinzuschmuggeln. Homers Menschenbild muß, 39 denke ich, so, wie es über Jahrhunderte hinweg gewirkt hat, bestehen bleiben als ein Entwurf vom Menschen, mit dem wir fertig werden müssen 38 . Die Schwierigkeiten des modernen Menschen mit aristokratischen Menschenbildern überhaupt hat Nietzsche schon zu seiner Zeit mit (natürlich triumphierender) Schärfe in ihren historischen, sozialen und psychologischen Bedingtheiten bloßgelegt (er spricht von der „vornehmen Moral, welche [...] nicht die Moral der .modernen Ideen' ist und deshalb heute schwer nachzufühlen, auch schwer auszugraben und aufzudecken ist" (a. O. [o. Anm. 25] 732); in seiner späteren Rechenschaftslegung sagt er über den in .Was ist vornehm?' vorgestellten Typus und Begriff des .gentilhomme': „Man muß Mut im Leibe haben, ihn auch nur auszuhalten, man muß das Fürchten nicht gelernt haben [...] Alle die Dinge, worauf das Zeitalter so stolz ist, werden als Widerspruch zu diesem Typus empfunden, als schlechte Manieren beinahe, die berühmte .Objektivität' zum Beispiel, das .Mitgefühl mit allem Leidenden', der .historische Sinn' [...] mit seinem Auf-dem-Bauch-Liegen vor petits faits, die .Wissenschaftlichkeit'": - so in .Ecce homo' (a. O. [o. Anm. 25] 1141). Hundert Jahre weiterer Demokratisierung haben diese Schwierigkeiten nicht geringer werden lassen. Das tiefe Unverständnis für Homers Menschenbild, das sich
94
Das Menschenbild Homers
hinter der überlegen (oder auch schamhaft) daherkommenden Verkindlichung (oder auch Barbarisierung) der .Helden' Homers verbirgt, hat hier seinen natürlichen Grund. Die Homerlektüre in der Schule sollte dennoch versuchen - .den Mut im Leibe haben' - , durch die modern gewordene Fernrohr- oder ,Alteritäts'-Perspektive, in der Homer wie ein exotisches PaläozoikumsFossil bestaunt wird, wieder zu den wirklichen Menschen Homers durchzustoßen. An ihnen kann der junge Mensch von heute die Verarmung, in die ihn unser Zeitalter der Pathosfurcht, Formlosigkeit und kultivierten Schnoddrigkeit hineingetrieben hat, besonders wirkungsvoll erfahren.
Humanistische Bildung 11, 1987, 43-71
Frauengestalten Homers ι Dem Zug der Zeit und dem Generalthema dieser Vorlesungsreihe entsprechend hätte der Titel dieses Vortrags 1 eigentlich ,Die Frau bei Homer' lauten sollen. Meine Abneigung gegen eine solche Themastellung entspringt nicht nur dem Mißbehagen an der modischen Betrachtungsweise, die ,die Frau' zu einer Art Mikroskopier-Objekt neben tausend anderen macht, sondern vor allem der Erwägung, daß wir das Eigentliche, das ein Dichter sagen will, nicht im Generellen finden werden. Wenn wir uns aus Homers Aussagen über Frauen und aus seinen individuell gezeichneten Frauenporträts ein allgemeines Bild der Frau rekonstruieren, dann erfassen wir nicht Homers Aussagcabsicht, sondern seine Aussag^Voraussetzungen. Die allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb deren der Dichter und mit ihm seine Gestalten stehen, sind ja für den Dichter (sofern es sich nicht um sozialkritische Dichtung handelt) niemals Darstellungsziel 2 . Sie sind vielmehr etwas selbstverständlich Vorgegebenes, das nicht thematisiert zu werden braucht, weil es dem Dichter wie seinem Publikum bekannt ist. Das, worum es im dichterischen Kunstwerk geht, ist nicht die Information der Nachwelt über die zeitgenössische Lebenswirklichkeit. Das Ziel des Dichters liegt auf einer höheren Ebene. Homer als Quellentext zu lesen be-
* Die Vortragsform wurde weitgebend belassen. Dem Zweck dieser Übersicht entsprechend ist einschlägige Literatur nur in Auswahl genannt; zu den einzelnen behandelten Frauengestalten sind nur die wichtigsten Homerstellen erwähnt. Eine erschöpfende Behandlung des Themas könnte nur im Rahmen einer Arbeit über die Homerische Kunst der Charakterzeichnung erfolgen. 2 Dazu und zum Folgenden s. Verf., Perspektiven der Gräzistik, Freiburg - Würzburg (Ploetz) 1984, 23-27; ,Zu den pragmatischen Tendenzen der gegenwärtigen gräzistischen LyrikInterpretation', Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 12, 1986 [in diesem Band S. 283-307]; .Realität und Imagination. Zu Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied', Museum Helveticum 42,1985, 67-94 [in diesem Band S. 313-344],
96
Frauengestalten Homers
deutet also, die eigentliche Absicht des Dichters zu verkennen und hinter seiner Forderung zurückzubleiben. Das heißt natürlich nicht, daß wir uns, wenn wir Homers Frauengestalten verstehen wollen, um ,die' Frau bei Homer nicht kümmern müßten. Die Lebenswirklichkeit der Frau, so wie Homer sie sieht, ist Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Ilias und Odyssee. Diese Rahmenbedingungen bilden natürlich die Grundlage der individuellen künstlerischen Formungen. Zugleich bilden sie die Verständigungsgrundlage zwischen dem Autor und seinem Publikum. Infolgedessen müssen auch wir sie kennen. Wir müssen sie sogar möglichst genauso gut wie der Autor und sein primäres Publikum kennen. Nur dürfen wir dabei nicht stehenbleiben. ,Die Frau bei Homer' - das wäre zu wenig, das wäre Beschränkung auf eine Soziologie der Literatur. Wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen nach der Art und Weise fragen, wie allgemeine Frauenrealität von diesem ganz bestimmten Dichterindividuum Homer gestaltet ist. Daher also nicht ,Die Frau bei Homer', sondern .Frauengestalten Homers'. I 44 Für unser konkretes Vorgehen ergeben sich aus dieser Grundsatzüberlegung zwei Folgerungen: 1. Wir müssen Homers Frauengestalten aus ihrer von Homer vorausgesetzten Lebenswirklichkeit heraus verstehen; diese Lebenswirklichkeit muß also zunächst rekonstruiert werden. 2. In einem zweiten Schritt müssen wir über diese Elementar-Ebene hinausgehen und die künstlerischen Absichten zu erfassen suchen, die Homer mit der Formung seiner individuellen Frauengestalten verfolgt hat. Diese beiden Aufgaben in einem kurzen Vortrag befriedigend zu lösen ist unmöglich. Was allein möglich ist, sind Ansätze und Einblicke. Bei deren Präsentation werde ich mich auf die zweite Aufgabe konzentrieren, die, wie gesagt, in meiner Sicht die eigentliche ist. Erleichtert wird mir diese Konzentration auf das Künstlerische durch den glücklichen Umstand, daß die erste der beiden Aufgaben, also die Rekonstruktion der Lebenswirklichkeit von Frauen zur Zeit Homers, in einer neueren Publikation vorbildlich aufgegriffen und weitgehend bereits gelöst worden ist: Im Jahre 1982 hat Gisela Wickert-Micknat in dem unentbehrlichen Sammelwerk ,Archaeologia Homérica' den Einzelband ,Die Frau' 3 vorgelegt. Darin sind die wesentlichen Informationen zum Thema ,Die Frau zur Zeit Homers', über die wir heute verfügen, umsichtig gesammelt, zu3 Gisela Wickert-Micknat, Die Frau, in: Archaeologia Homérica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos, hrsg. von F. Matz f u. H.-G. Buchholz, Kap. R, Göttingen 1982.
Frauengestalten Homers
97
sammengestellt und ausgewertet. Auf dieses Werk kann sich jeder, der zum Thema spricht, dankbar stützen. Bevor ich aber seine wichtigsten Ergebnisse kurz referiere, muß ich seine Reichweite umgrenzen, um mögliche Fehlerwartungen zu verhindern. Π Wer ,Die Frau zur Zeit Homers' hört, wird zunächst mit Recht eine umfassende und vollständige Darstellung der Lebensbedingungen und der Lebensweise von Frauen aller Gesellschaftsschichten im gesamten griechischen Siedlungsraum zur Zeit Homers erwarten. Dies kann Frau Wickert-Micknats Darstellung jedoch nicht leisten. Ursache ist die Quellenlage: einzige schriftliche Quelle für Griechenland zur Zeit Homers sind Homers Werke selbst. Dies ist kein Zufall der Überlieferung, sondern eine logische Folge der historischen Gesamtentwicklung des frühen Griechenlands4. Die Griechen waren - nach ihrer Einwanderung in die Balkanhalbinsel um 2000 - in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends zu einer unerhörten kulturellen Hochblüte gelangt. Um 1200 jedoch war diese Blüteperiode einschneidend unterbrochen worden: Wellen von Einwanderern aus dem Norden hatten die erste griechische Hochkultur (wir nennen sie die .mykenische') mit ihren hochorganisierten, durch schriftliche Registratur gesteuerten Verwaltungsstrukturen zerschlagen. Die Einwanderer blieben I zwar 45 zum größten Teile nicht im Lande, sondern zogen weiter, aber was sie hinterließen, waren Ruinen, nicht nur im architektonischen Sinne. Die gesellschaftliche Führungsschicht war geflüchtet, vertrieben und durch die Abwehrkämpfe dezimiert, der ausgeklügelt hochgezüchtete Wirtschaftskreislauf war durch die Verwüstung der Leitungszentren und der Wirtschaftsflächen und -instrumente zerstört, der Schock des Zusammenbruchs wirkte auf die Überlebenden lähmend. Geschichtliche Zäsuren dieser Art sind uns nicht unvertraut. Die Griechen brauchten wohl ein bis zwei Generationen, bis sie sich allmählich zu erholen begannen. Freilich mußten sie wieder von vorn anfangen. Dabei gingen sie in der gesellschaftlichen Organisation nunmehr andere Wege als in der ersten Entwicklungsphase. Das starke Zentralkönigtum ließen sie nicht wieder aufleben. An seine Stelle trat eine Art dezentralisierter Oligarchie, die ein schnelles Tempo des Wiederaufschwungs nicht begünstigte. Dennoch machte die Gesamtentwicklung relativ rasche Fortschritte. Bereits im 11. Jahrhundert griffen die Griechen
4
Die folgende historische Skizze ist genauer ausgeführt in meiner Einführung in Homer (,Homer', München u. Zürich [Artemis] 1985 [ 2 1989], Kap. I und Π.
98
46
Frauengestalten Homers
erneut - und diesmal auf breiter Front - auf die kleinasiatische Westküste hinüber, die mit ihren vergleichsweise weiten Anbau- und Weideflächen ganz andere Wirtschaftsperspektiven bietet als das Mutterland und die kleinen Bergland-Inseln der Kykladen. Die Einzelphasen der gesellschaftlichen Konsolidierung in den folgenden zwei Jahrhunderten sind noch nicht hinreichend geklärt. Deutlich sehen wir zur Zeit nur das Ergebnis: Um 800 setzt eine zweite große Wirtschafts- und Kulturblüte ein. Fragt man einmal nicht nach deren Ursachen, sondern nach ihren auslösenden Momenten, so wird man unter diesen wohl eines nennen müssen, das die frühere Forschung wahrscheinlich unterschätzt hat und für dessen Bedeutung uns erst neuere Erkenntnisse und Überlegungen die Sinne geschärft haben: die Schrift. So wie es kein Zufall sein kann, daß die Zeit der Hochblüte der mykenischen Kultur durch die Schriftübernahme um 1450 auf Kreta eingeleitet wurde, so wird es auch kein zufälliges Zusammentreffen unabhängiger Entwicklungen sein, daß der zweite kulturelle Aufschwung Griechenlands zeitlich mit der erneuten Schriftübernahme - diesmal aus Phönizien - zusammenfällt. Und auch darin scheinen die Abläufe beider Aufschwungsphasen zumindest ein Stückweit vergleichbar, daß auch jetzt - um 800 - , ebenso wie damals nach 1450, die Schrift zunächst nur zur Befriedigung praktischer Bedürfnisse dient. Handelskorrespondenz, Rechnungsstellung, Registratur usw. das scheinen Anfang des 8. Jh.s zunächst die einzigen Verwendungsformen der Schrift gewesen zu sein. Faktenregistrierung, Daten-Archivierung oder gar die Beschreibung bestehender Wirtschafts- und Sozialstrukturen lagen zunächst noch nicht im Gesichtskreis der Schreibenden. Die Idee zu solcher Schriftverwendung war noch nicht geboren. Das ist nicht verwunderlich. Die sekundären und tertiären Verwendungsmöglichkeiten neu erfundener Instrumente müssen erfahrungsgemäß auch sonst je neu erfunden werden. Daß Schrift nicht nur als Gedächtnisstütze in den kleinen Alltagsdingen und über kurze Zeiträume hinweg dienen kann, sondern auch zur Fixierung größerer Systemzusammenhänge und damit zur Sicherung vorhandenen Wissens zum Zwecke seiner Überbietung verwendet werden kann, das mußte erst begriffen werden. Es scheint, daß es im Griechenland des 8. Jahrhunderts zum ersten Mal in einem Kulturbereich begriffen wurde, in dem wir aus unserer heutigen Welterfahrung heraus solche Erkenntnisse am wenigsten vermuten würden: nicht im pragmatisch denkenden Kreis der Händler und Warenproduzenten, sondern in der relativ praxisfernen, vergangenheitszugewandten Gilde der professionellen .Heldensänger', der αοιδοί. Bereits beim zweiten Blick jedoch erscheint es ganz natürlich, daß dieser Stand der Sänger - seit Jahrhunderten daran gewöhnt, die gewaltigen Stoffmassen der zu Mythen zusammengewachsenen ,Nationalgeschichte' logisch zu ord-
Frauengestalten Homers
99
nen und zu systematisieren - die Möglichkeiten, die die Schrift dem eigenen Geschäft eröffnete, zuerst erkannte und verwertete. Auch in anderen Kulturen beginnt Literatur mit der Niederschrift geschichtlicher Erinnerung. Für die Griechen des 8. Jahrhunderts war das, was wir Geschichte nennen, ihre Heldensage. Daß sie das erste war, was nach einer jahrhundertelangen Phase rein mündlicher Tradierung in den Schutz der Schriftlichkeit überführt wurde, ist nur natürlich. Wann diese Idee im Verlauf des 8. Jh.s aufkam und zu ersten Verschriftlichungen von Teilen des Heldenepos führte, wissen wir nicht. Auch bei diesem Prozeß sehen wir nurmehr das Ergebnis: das fertige Großepos - für uns repräsentiert durch die Ilias. Daß diese Neugestaltung der uralten Geschichte vom Kampf der Festland- und der Inselgriechen gegen Ilios-Troja, die Burg am Dardanelleneingang, als Neugestaltung aus dem Geist des 8. Jh.s heraus die erste umfangreichere literarische Schöpfung der Griechen war (ganz so, wie es die späteren Griechen selber sahen), kann heute kaum mehr bezweifelt werden. Damit ist aber die Ilias Homers die erste größere griechische Schriftquelle überhaupt. Mit ihr wurde demzufolge die literarische Schriftlichkeit in Griechenland - und damit in Europa - erst begründet. Infolgedessen können wir andere Quellentexte außer der Ilias (und der etwas späteren Odyssee) aus der gleichen Zeit gar nicht erwarten. Die Ilias hatte Schrittmacherfunktion. Sie führte exemplarisch vor, daß Verschriftlichung von Sach- und Denkzusammenhängen in großem Maßstab möglich ist. Alles was an Texten im frühen Griechenland entstand, entstand im Blick auf sie und ist infolgedessen jünger. Die Ilias ist folglich für die Zeit, aus der heraus sie spricht, die einzige Quelle für uns. Die Lebenswirklichkeit zur Zeit der Ilias- und der Odyssee-Entstehung in den Jahrzehnten um 700 - und das bedeutet auch: die Lebenswirklichkeit von griechischen Frauen zur Zeit der Ilias- und der Odyssee-Entstehung um 700 - kann also, wenn wir von den stummen Bodenfunden absehen, nur aus Ilias und Odyssee selbst zurückgewonnen werden. I III Für das Rekonstrukt, das natürlich nur so weit reichen kann wie eben Ilias und Odyssee selbst reichen, bedeutet das erhebliche Beschränkungen. Denn der (oder die) Dichter dieser beiden Epen hat (bzw. haben) aus einer vielfach eingeschränkten Perspektive heraus geschaffen. Die erste Einschränkung war geographisch-ethnischer Natur: Homer gehörte dem griechischen Teilstamm der Ionier an und lebte im ostionischen Siedlungsraum, d. h. im ionischen Kolonisationsgebiet der westkleinasiatischen Küsten- und Inselregion (Smyrna/Chios - Milet/
47
100
Frauengestalten Homers
Samos). Sein Erfahrungshorizont war damit - auch wenn wir häufige Reisen in Rechnung stellen - vorgeprägt durch die Lebensverhältnisse im ostionischen Raum, kann also nicht repräsentativ für alle Griechen dieser Zeit sein (gar nicht z.B. für die Doner). - Die zweite Einschränkung von Homers Perspektive ist sozialer Natur: Homer gehörte entweder selbst dem Adel an oder war in Adelskreisen aufgewachsen. Was gerade diese Restriktion für sein Frauenbild bedeutet, wird noch näher zu erörtern sein. - Drittens ist Homers Perspektive durch die Dichtungstradition beschränkt, in der er steht. Homer war ja nicht der Erfinder der Gattung .Heldenepos', sondern ihr Vollender. Die Gattung blickte, als Homer sie aufnahm, bereits auf eine mehrhundertjährige Geschichte zurück. Sie war in diesem langen Zeitraum von ungezählten, für uns namenlos bleibenden Dichtersängern gepflegt worden, die die alten Helden- und Göttersagen bei sich bietender Gelegenheit in mündlich improvisiertem hexametrisch rhythmisierten Vortrag zur viersaitigen Phorminx in immer wieder neuer Fassung darzubieten verstanden. Dadurch waren im Laufe der Jahrhunderte - bei aller Variabilität in der Auswahl und Gestaltung der Einzelheiten - feste Eckdaten geschaffen worden, nicht nur im Faktischen der HandlungsaWäu/e, sondern auch im Grundprofil der wichtigsten stehenden Handlungsfiguren. An diesen Eckdaten konnte auch Homer, als er die Gattung gegen Ende des 8. Jh.s mit Hilfe der Schrift perfektionierte, nicht rütteln5. Daß also - um rasch einige dieser Eckdaten in die Erinnerung zurückzurufen - , daß etwa Paris, der Sohn des Trojanerkönigs Priamos, der Liebesgöttin Aphrodite den Preis der Schönheit zugesprochen und dafür Helena, die schönste Frau der Welt, erhalten hatte, daß daraufhin die Achaier Griechenlands zum Rachefeldzug unter König Agamemnon von Argos-Mykene gegen Troja aufgebrochen waren, der Kampf um Troja und damit um Helena zehn Jahre lang gedauert hatte, usw. - das alles hatte sich zu einem Erzählgerüst verfestigt, das nicht verändert werden konnte. Teil dieses Gerüstes war nun aber auch die Grundanlage der handlungstragenden Figuren. So war etwa der Griechenheld Achilleus traditionsgemäß der jugendlich-idealische Kämpfertyp, stark, gerecht, wahrheitsliebend und großgeartet - Agamemnon der herrscherli48 che Fürst und I Oberfeldherr, schroff auf Rang und Würde pochend bis zur Arroganz (und manchmal Dümmlichkeit) - Odysseus der kluge Diplomat, ideenreiche Vermittler und Erfinder - Aias der Recke: ein Mann, ein Wort. Bei den Frauengestalten gab es natürlich ebensolche Festlegungen: Helena die leidenschaftsgetriebene Normdurchbrecherin - Penelope: Symbol der klugen treuen Partnerin - Kirke die Hexe, Sinnbild weiblicher Verführungskunst (die uns im 5
Dazu Verf., Homer (oben Anm. 4) 93-96.
Frauengestalten Homers
101
Wort ,becircen' heute noch begleitet); und bei den Göttinnen auf dem Olymp, die ihre Züge ja ebenfalls aus dem menschlichen Erfahrungsraum der Sänger bezogen, gab es kaum weniger feste Vorprägungen, wie etwa Hera, die majestätische Zeusgattin und Göttermutter, im Dauerkampf gegen die Eskapaden ihres unausrechenbaren Gatten nicht zur Ruhe kommend - Athene die energisch handelnde und mit männlichem Weitblick vorausplanende Zeustochter - Artemis die männerscheue Reinheitsliebende, an Natur und Tierwelt hingegeben, - usw. Das alles waren Profile, die sich im Lauf der Sangesübung immer klarer gegeneinander abgesetzt hatten und die der je folgenden Sängergeneration weitgehend standardisiert als Modelle vorgegeben waren. Als Homer gegen Ende des 8. Jahrhunderts seine Neugestaltung der Trojasage schuf, war er infolgedessen bei der Formung seiner Handlungsträger - und das heißt eben auch: seiner Frauengestalten - durchaus nicht etwa völlig frei. Neben den beiden ihm wohl unbewußten Determinanten ,Stammesgebundenheit' und .sozialer Standort' führte ihm auch noch die Eingebettetheit in die Gattungstradition und damit der natürliche Zwang zur Rücksichtnahme auf den Erwartungshorizont des Publikums die Hand. Daraus ergibt sich, daß auch das Bild, das wir aus Ilias und Odyssee für ,Die Frau zur Zeit Homers' gewinnen, nicht in einem umfassenden Sinne repräsentativ sein kann. Es zeigt gerade nicht ,Die griechische Frau des 8. Jh. v.Chr.', sondern es zeigt nur Teilaspekte damaliger Frauenwirklichkeit - und auch diese in der Überformung durch eine festgewordene Erzähltradition, so daß wir oft nicht entscheiden können, ob ein bestimmter Zug, auch wenn er an verschiedenen Frauengestalten regelmäßig wiederkehrt, tatsächlich Reflex der Realität des 8. Jahrhunderts ist oder tradierter Reflex einer früheren Entwicklungsphase der Gesellschaft - oder vielleicht gar schlichtweg dichterische Phantasie. IV Im Bewußtsein dieser grundsätzlichen Vorbehalte und Unsicherheiten versuche ich nun - in äußerster Raffung natürlich und unter Betonung der für mein Darstellungsziel besonders relevanten sozialen Komponente - das von Frau Wickert-Micknat erarbeitete Bild, das uns hier als Fundament dienen soll, zu referieren. I Vorauszuschicken ist die Feststellung, daß dieses Bild nichts Sensationelles 49 bietet. Es zeigt in allem Wesentlichen die seit Jahrtausenden gelebte Existenz der Frau im Rahmen der natürlichen Arbeitsteilung der Geschlechter. Dies allerdings mit einer ganz wesentlichen Einschränkung: Infolge der sozialen Herkunft des Dichters aus dem Adel (oder vielleicht sagen wir besser: aus der gesell-
102
Frauengestalten Homers
schaftlichen Oberschicht) ist der Blickwinkel stark eingeengt: Er bringt uns in einer überdimensionierten Ausschnittsvergrößerung ganz überwiegend die Lebensweise von Frauen aus der Oberschicht vor Augen. Sogenannte .kleine Leute' kommen vor, sind aber nur Verfügungsmasse und dienen als Staffage: Sie tauchen nur auf, um wieder zu verschwinden; nicht daß sie verachtet würden - sie interessieren nicht. Sich an dieser Gewichtung bei Homer zu stoßen wäre töricht: für die Schicksale kleiner Leute hat sich die große europäische Literatur ja auch seither nur selten interessiert, nicht aus Standesdünkel, sondern weil es in der Natur der Sache liegt: Literatur ist nun einmal als Ausdrucksform von Hochkulturen eine Angelegenheit der diese Hochkulturen tragenden Oberschichten. Bei Homer ist dieser ihr Grundzug allerdings besonders ausgeprägt. Das Leben spielt sich bei ihm nahezu ausschließlich in den obersten Gesellschaftsschichten ab, und der Zwang, Angehörige niedrigerer Schichten möglichst nur als dienende Staffage zu verwenden, geht so weit, daß dort, wo aus kompositorischen Gründen für eine gewisse Zeit Niedrigstehende zu Handlungsträgem gemacht werden, so gut wie nie die manchmal geradezu komisch wirkende Enthüllung fehlt, die betreffende Dienstperson sei nur durch Schicksalsschläge in diese ihre abhängige Lage versetzt worden und stamme eigentlich gleichfalls aus der Oberschicht. So darf etwa der Schweinehirt Eumaios in der Odyssee nur deshalb so handlungstragend sein, weil er in Wirklichkeit, wie sich herausstellt, ein Sohn des Königs von Syrie ist6 und im Herrenhaus von Ithaka zusammen mit der jüngsten Tochter des Herrscherpaares aufgewachsen ist7, und wenn die Magd Melantho, die im Herrensaal auf Ithaka serviert, zweimal das Wort zu frechen Ausfällen gegen den als Bettler anwesenden Odysseus erhält, dann versäumt der Dichter nicht die erläuternde Rechtfertigung, dies sei nun allerdings keine gewöhnliche Dienstmagd gewesen, sondern ebenfalls ein im Herrenhaus großgewordenes Mädchen, das die Hausherrin Penelope geliebt habe wie den eigenen Sohn8. - Ähnlich geht es in der Ilias zu: Die Frauen im belagerten Troja gehören fast ausschließlich dem Königshause an oder sind mit ihm verwandt, und die naturgemäß raren Frauen im Belagerungsheer der Achaier, in der Regel Kriegsgefangene, stammen ebenfalls aus den höchsten Kreisen. Chryseis z.B., die Lagergenossin Agamemnons, ist Tochter des Apollonpriesters von Chryse, und Briseis, die Gefährtin des Achilleus, um die der ganze Streit zwischen Achill und Agamemnon entbrennt, ist auch nicht etwa eine ge-
6 7 8
Od. 15,403-414. Od. 15,363 f. Od. 18,321-323.
Frauengestalten Homers
103
wöhnliche Liebesdienerin, aus der Beute abgestellt, I sondern sie ist die ehema- 50 lige Frau des Stadtkönigs Mynes von Lyrnessos9, - usw. Hinter der Sorgfalt dieser sozialen Aufwertungsstrategie scheint ein starker Selbstabgrenzungswille der Aristokratie zu stehen. Das hat zur Folge, daß das Epos Standesdichtung ist - und dies offenbar schon seit Jahrhunderten (und vermutlich von allem Anfang an), so daß Homer in Ilias und Odyssee auch in diesem Punkte nur die Tradition fortsetzt10. Fragen wir nun, wie sich das Leben dieser Frauen im Regelfalle abspielt, so treffen wir auf die wenig aufregende typische Daseinsform von Frauen einer Art Landadels-Oberschicht11. Als Kinder und Jungmädchen wachsen sie in der Obhut von Ammen und Kinderfrauen wohlbehütet im Schöße der Familie auf dem Gutshof auf und werden von früh an durch eine offenbar gediegene Erziehung im häuslichen Bereich - und zwar ohne Trennung von ihren männlichen Geschwistern und sonstigen männlichen Altersgenossen - auf ihre Lebensaufgabe, selbst einmal ein großes Haus zu leiten, vorbereitet. Wenn die ersten Freier kommen, werden sie in Ausgleichung familien- und machtpolitischer Interessen mit persönlichen Neigungen von den Eltern verheiratet. Wenn sie dem Manne folgen - was die Regel ist - , übernehmen sie in dessen Haus die Schlüsselgewalt. Die Kinder, die sie gebären, müssen sie nicht selbst betreuen und großziehen, sondern können sie der Pflege durch zuständiges Dienstpersonal überlassen. Zur Kinderbetreuung in eigener Person hätten sie auch gar nicht die Zeit, da sie durch die Organisation und Überwachung des in der Regel recht großen Haushalts voll in Anspruch genommen werden. Wir befinden uns ja (in diesem Punkte sind die Aussagen des Epos so homogen, daß an der Realitätsentsprechung des Bildes kein Zweifel bestehen kann) in der Zeit einer weitgehend autarken Einzelgehöft-Wirtschaft, die nicht nur Ackerbau und Viehzucht in relativ großem Maßstab betreibt, sondern zugleich ihr eigener Weiterverarbeitungsbetrieb für die selbstproduzierten Rohprodukte ist. Im Haushalt wird also nicht etwa nur gekocht, gebacken, gepökelt usw., sondern es wird dort auch das gesamte eingebrachte Korn gemahlen, der Wein gekeltert, die Oliven zu Öl verarbeitet usw., und - dies der zeitaufwendigste und zugleich repräsentativste Wirkungsbereich der Hofherrin - die gesamte Wollproduktion wird durch Spinnen 9
II. 2,688-693; 19,295 f. Dazu Leaf, Kommentar zu Β 690; Kirk, Kommentar (1985) zu Β 689-693. 10 Verf., Homer 43^17. 11 Das Folgende im wesentlichen nach Wickert-Micknat (oben Anm. 3). Die homerische Gesellschaft und ihre Lebensform insgesamt ist dargestellt in: Verf., Das Menschenbild Homers, Gymnasium 91,1984, 15-39 [in diesem Band S. 71-94],
104
51
Frauengestalten Homers
und Weben im Hause selbst zu allen möglichen Arten von Textilien verarbeitet, sowohl für den Eigenbedarf als auch zu Repäsentations- und Geschenkzwecken. Die Herrin des Hauses hat alle diese Arbeiten, die von einem hierarchisch gestuften Heer von Dienstboten ausgeführt werden, erfolgreich zu leiten und zu überwachen und außerdem im auffalligsten und außenwirksamsten Bereich: in der Textilproduktion, selbst ein möglichst eindrucksvolles Beispiel von Kunstfertigkeit und Geschmack zu geben. - Dies ist freilich nur der Arbeitsbereich. Darüber hinaus hat die Frau, deren Ehemann ja dank seinem Wohlstand zu den führenlden Männern der jeweiligen Gemeinschaft gehört, die bei solcher Exponiertheit natürlicherweise anfallenden Repräsentationspflichten zu erfüllen, vor allem bei den nicht eben seltenen Besuchen (die in diesen Zeiten nicht Stunden, sondern Tage dauern), aber durchaus auch bei öffentlichen Anlässen wie Familien- oder Gemeindefesten, - und sie hat schließlich ihrem Manne nach Möglichkeit Beraterin zu sein. - Es ist ganz selbstverständlich, daß bei solcher Aufgabenfülle und Verantwortlichkeit die Stellung dieser Frauen von großer persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit und parallel dazu von großer Geachtetheit geprägt ist. Die Frau kann sich nicht nur in Haus, Hof und Gemeinde frei bewegen, sie hat auch in der Regel neben dem gemeinsamen Schlafgemach der Ehepartner ihre eigenen Frauenräumlichkeiten, in die sie sich mit schicklicher Begründung zurückziehen kann. Darüber hinaus aber ist es ihr nicht etwa nur gestattet, sondern es wird von ihr als Selbstverständlichkeit erwartet, daß sie sowohl im normalen Tagesablauf als auch besonders bei Besuchen neben ihrem Mann im Megaron, dem Hauptraum des Hauses und Zentrum des familiären und gesellschaftlichen Lebens, residiert. Um ihre vielfältigen Pflichten optimal erfüllen zu können, stehen ihr nicht nur weibliche und auch männliche Arbeitskräfte zu Gebote, sondern auch persönliche Helferinnen und Betreuerinnen, die sie entlasten - wie die ταμίη, die Verwalterin und persönliche Vertraute, oder die άμφίπολοι, die ihr als .Umhegerinnen', d.h. als Zofen, Botinnen, Begleiterinnen beim Ausgang usw., dienen. - Alles in allem entsteht der zuverlässige Eindruck, daß diese Frauen in einem Verhältnis gleichwertiger Partnerschaft zu ihrem Manne leben und eher den Status geachteter Führungspersönlichkeiten als den abhängiger Hausmütterchen besitzen. Der erzwungene Rückzug der Frau in die Anonymität beginnt erst mit der Entwicklung der Austauschwirtschaft, der damit verbundenen politischen Einflußminderung der Aristokratie und - so merkwürdig das in modernen Ohren klingen mag - der Entstehung demokratischer Regierungsformen. Dem können und wollen wir hier nicht weiter nachgehen. Uns genügt es festzuhalten, daß die Frauen des 8. Jh.s, von denen Homer spricht, unter sozialer Zurückgesetztheit offensichtlich nicht zu leiden haben.
Frauengestalten Homers
105
V Vor diesem Hintergrund, der ihnen allen gemeinsam ist, wollen wir nun einige der Frauengestalten Homers gesondert in den Blick nehmen. Ich muß mich hier auf einige wenige beschränken und diese wenigen überdies nach einem Kriterium auswählen, das sachlich paradox ist, nämlich nach dem Kriterium möglichst kurzzeitiger Handlungsfunktion innerhalb der Gesamterzählung. Paradox ist dieses Kriterium deshalb, weil Homer wie jelder Dichter eine Figur natürlich um so 52 feiner und nuancenreicher ausarbeitet, je länger er sie handeln läßt. Je länger sie handelt, in desto vielfältigeren Aktionen, Reaktionen und Relationen wird sie gezeigt. Entsprechend mehr hat sie dann auch zu reden. Dies ist entscheidend. Denn das Epos profiliert nach seinem Gattungsgesetz eine Figur nicht durch Beschreibung, sondern durch Aktion, und hier vor allem durch direkte Rede. Je öfter der epische Dichter eine Figur auf Situationen und Herausforderungen durch Reden reagieren läßt, um so mehr läßt er sie an Profil gewinnen. Diesen Profilierungsprozeß kann der Interpret aber nicht durch Paraphrase deutlich machen. Er muß die Figur selbst reden lassen - in all den Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks, die ihr der Dichter in den Mund legt. Zugleich muß der Interpret aber auch die Situationen so scharf wie möglich charakterisieren, auf die eine Figur reagiert, die Reden der anderen, auf die sie antwortet, usw. Nur so kann wenigstens von fernher deutlich werden, wieviel Verständnis und Einfühlung der Dichter in die Persönlichkeitsgestaltung einer Figur investiert und welcher Grad an Welterfahrung und Einsichtsfähigkeit in das Wesen von Menschen hinter seiner Formung steht. Das alles kostet Zeit. Es ist deshalb gerade für die am feinsten ausgearbeiteten Frauengestalten Homers hier nicht zu leisten - etwa für Penelope, die ja zusammen mit ihrem Mann Odysseus und ihrem Sohn Telemachos das Zentrum der gesamten rund 12000 Verse umfassenden Odysseehandlung bildet. Ich habe daher vier Frauengestalten ausgewählt, die stofflich im Rahmen eines Vortrags gerade noch zu bewältigen sind, für den Dichter aber zentral genug waren, die ganze Kraft seiner Gestaltungsfähigkeit zu fordern. Es sind: Arete und Nausikaa in der Odyssee, Andromache und Helena in der Ilias. Arete Die Gattin des Königs der Phaiaken und Mutter der Nausikaa ist eine Gestalt, die in Homerdarstellungen als Charakter selten einen prominenten Platz einnimmt. Sie soll hier am Anfang stehen, weil sie zusammen mit ihrer Tochter Nausikaa offenkundig die Idealvorstellung des Dichters von einem gewisserma-
106
Frauengestalten Homers
ßen heilen Frauendasein in einer heilen Welt verkörpert. Heile Verhältnisse sind ja selten in Ilias und Odyssee. Von den Frauen der Ilias - soweit sie handlungstragend sind - lebt keine einzige ein Leben, das nicht durch den Druck des Krieges gestört, beengt, ja geradezu erwürgt würde, und den Frauen der Odyssee - wenn wir von Göttinnen und Nymphen wie Athene, Kalypso, Kirke, den Sirenen usw. absehen - ist die ruhige Geordnetheit eines lediglich mit den normalen Lebensproblemen gefüllten Daseins gleichfalls nicht vergönnt: Penelope und die Frauen ihres Hauses - etwa die alte Amme Eurykleia - leben seit 20 Jahren im 53 Herrenlhaus von Ithaka allein, in ungeklärter Lage, zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankend - Helena, die Frau des Menelaos, die wir in der Odyssee im Herrenhaus von Sparta in scheinbar heiterer Erfüllung wiederfinden, ist in Wahrheit, wie der Dichter immer wieder spüren läßt, eine Gebrochene, die nur noch abbüßt. Von diesen Krisenlagen hebt sich um so leuchtender das Leben auf Scheria, der Insel der Phaiaken, ab. Das ist wohl kaum ein zufälliger Zug der alten Odysseus-Sage. Es ist vielmehr eine Notwendigkeit der Erzählanlage unserer , Odyssee ': Odysseus, der seit zwanzig Jahren Feme, soll heimkommen. Wo er herkommt, herrscht das Anomale: Krieg zuerst, dann die Irrfahrten übers Meer und über fremde Länder, darauf das Ausgeliefertsein an eine durch die Intensität ihrer Zuwendung erdrückende Nymphe: Kalypso, schließlich die zwanzigtägige Floßfahrt, der Seesturm, der Schiffbruch, das Zurückgeworfensein auf die buchstäblich nackte Existenz beim Angetriebenwerden an Scherias Küste. - Das ist die Vergangenheit. Aber dort, wo Odysseus hinkommen wird, auf Ithaka, herrscht ebenfalls das Anomale: das Herrenhaus besetzt von einer Horde junger Freier, die aus Enttäuschung täglich unverschämter werden, die Frau - Penelope - am Ende ihrer Kraft zu widerstehen, der Sohn Telemachos, ohne Vater aufgewachsen, im ständigen Zweifel über seine Identität, das Volk von Ithaka nur noch der Verdrängung lebend ... Zwischen die Anomalie des Herkunftsbereiches und die Anomalie des Ziels schiebt der Dichter unserer Odyssee die Normalität des Phaiakenlandes ein. Hier soll Odysseus - so läßt der Dichter zu Beginn des 5. Gesanges ausdrücklich durch seinen Zeus verkünden - zum ersten Mal nach zwei Jahrzehnten wieder erfahren, was Normalität denn eigentlich ist - damit er gerüstet sein kann für die Wiederherstellung des Normalen auch im eigenen Bereich, auf Ithaka. - Das Phaiakenland und seine Gestalten sind also durchaus nicht, wie man immer wieder lesen kann, erbauliche Erholung für den Hörer durch ein eingestreutes Märchen. Das Phaiakenland hat vielmehr erzähle-
Frauengestalten Homers
107
rische Funktion 12 . An den Phaiaken - und ganz besonders an den Phaiakenfrauen - findet Odysseus ein Bild, ein Vorbild dessen, wo er wieder hin soll, und über diese Brücke findet er, der sich nach zwanzig Jahren Anomalie selbst kaum noch kennt, wieder zu sich selbst. Die überragende Gestalt bei den Phaiaken ist Arete, die Frau des Vornehmsten, Alkinoos. Wir begegnen ihr zum ersten Mal im 6. Gesang: Als Nausikaa, die Tochter, am frühen Morgen zum Wäschewaschen fahren will, da sitzt die Mutter schon am Herd mit ihren Frauen und dreht die Spindel 13 : Viele schöne Speisen legt sie der Tochter in den Korb, Zubrot, Wein im Ziegenschlauch und anderes, und gibt ihr schönes Öl in einer golde\nen Lekythos mit, daß sie sich 54 nach dem Baden mit ihren Mädchen ölen könne14. Nachdem dann das Zusammentreffen Nausikaas mit dem schutzflehenden Odysseus am Strand beschrieben wurde, läßt der Dichter das Bild Aretes in einer liebevollen Schilderung aus dem Mund Athenes, Odysseus' göttlicher Helferin, ein Stückweit klarer werden: (7,48) „Dies also, fremder Vater, ist das Haus, das du von mir gewiesen haben möchtest! / Finden wirst du drinnen die zeusgenährten / Herrn beim Mahle. Du aber geh hinein; hab keine Scheu im Herzen: / ein kühner Mann hat ja in allen Werken / besseren Erfolg ... / Die Frau des Hauses wirst du zuerst im Hause finden: / Arete ist ihr Name ... / (66) Die hat Alkinoos zu seiner Gattin gemacht / und sie geehrt, wie keine andre auf der Welt geehrt wird/von allen Frauen, die zumindest heute Haus halten unter Männern - / so von Herzen hoch geehrt ist diese und geliebt / von ihren Kindern und von Alkinoos selber / und von den Männern des Volkes, die wie auf eine Göttin auf sie blickend / laut sie begrüßen, wann immer sie die Stadt hinaufgeht. / Denn es mangelt ihr auch selbst nicht an Verstand, an klugem, / und mit ihren wohlbedachten Plänen löst sie Streitigkeiten sogar unter Männern! / Wenn die dir wohlwill, / ist für dich noch Hoffnung, deine Lieben zu erblicken und zurückzukehren / ins hochgedeckte Haus in deinem Vaterlande". Da ersteht also vor unseren Augen, zunächst von fernher, aus der Sicht der anderen - der Kinder, des Mannes, des Volkes - , das Bild einer idealen Adelsfrau, anerkannt, geehrt und geliebt von allen, klug und einflußreich. Als Odysseus dann wirklich ins Haus kommt, folgt er dem Ratschlag. Er geht geradewegs durchs Megaron hindurch zu Arete und Alkinoos, schlingt die Arme
12
Verf., Homer 182-185. Wegweisend: W. Mattes, Odysseus bei den Phäaken, Würzburg
1958. 13 14
Od. 6,52 f. Od. 6,76-80.
108
Frauengestalten Homers
um Aretes Knie und bittet sie, ihren Mann und die Gäste in der Halle, ihm zur Heimkehr zu verhelfen15. Alle sitzen sprachlos da vor Staunen16; denn niemand hatte Odysseus kommen sehen, Athene hatte ihn in einem Nebel hergeleitet17. Odysseus hat speziell Arete angesprochen18. Die gute Form verlangte, daß Arete nun erwidert. Doch sie schweigt 19 . Sie schweigt lang und länger. Als das Schweigen peinlich wird, ergreift der alte Ratsherr Echeneos das Wort und rät das Nötige zu tun: Odysseus aufstehen heißen (er kauert immer noch am Herdrand!), ihm einen Imbiß vorsetzen, inzwischen alles Weitere erwägen. So geschieht es. Als die Speisen vor Odysseus stehen und die Weihespende für Zeus gespendet ist, hält Alkinoos die Entscheidungsrede: Die Herren sollen für heute heimgehen; der Fremde werde hier im Hause bleiben und Gastfreundschaft genießen. Morgen werde man sein Heimgeleit beraten. - Odysseus dankt. Die Herren gehen. Odysseus bleibt mit Arete und Alkinoos allein zurück. Als er die Mahlzeit beendet hat und die Mädchen mit dem Abräumen fertig sind, hat Arete immer noch kein Wort gesprochen! Da endlich (7,233) begann unter diesen Arete, die hellarmige, mit Worten ... I 55 Und nun enthüllt sich, warum sie dem Odysseus nicht erwidert hatte; was sie, die so gewandte Frau, gehindert hatte, den Anstandsregeln zu genügen. Was schon wie peinliches Versagen (oder Vergeßlichkeit des Dichters) ausgesehen hatte, entpuppt sich nun als Ausdruck höchsten Feingefühls: Od. 7,139-152. Od. 7,154. 1 7 Od. 7,140. 1 8 Od. 7,146: 'Αρήτη, θύγατερ Ρηξήνορος άντιθεοιο ... 1 9 Das Verständnis der ganzen folgenden Szene bis zum Ende des Gesanges ist erstmalig eröffnet worden durch die Deutung von U. Hölscher, Das Schweigen der Arete, Hermes 88, 1960, 257-265. Weiterführung von S. Besslich, Schweigen - Verschweigen - Übergehen. Die Darstellung des Unausgesprochenen in der Odyssee, Heidelberg 1966, 143-147, und - innerhalb einer weitgespannten Analyse des Bautyps, zu dem diese Szene gehört - von B. Fenik, Studies in the Odyssey, Wiesbaden 1974, 5 - 1 3 0 (lediglich mit Feniks Bedeutsamkeitsverringerung Aretes besonders was das .Intermezzo' 11,336 ff. betrifft: Fenik 105 ff. - gehe ich nicht einig: Sie ist das Ergebnis einer allzu einseitig .horizontalen' Interpretationsweise, s. meine Darlegungen in den GGA 232,1980, 40-42). Die von Hölscher inaugurierte Deutung der Szene ist heute weithin anerkannt; s. ζ. Β. A. Heubeck, Die Homerische Frage, Darmstadt 1974, 115 f., und Hainsworth im neuen italienischen Odyssee-Kommentar (Omero, Odissea, Vol. Π, Milano 1982, 214—216); auch Hainsworth hat übrigens, obwohl er die Überlegenheit Aretes über ihren naiv-betriebsamkonfusen (περίεργος) Mann erkennt (217), die Bedeutung des .Intermezzos' für die Konsequenz von Aretes Charakterbild m. E. nicht durchschaut (216, zu 11,346). Für die extreme Selbsteinengung der älteren Homerforschung ist es im übrigen bezeichnend, daß Arete in ihr überwiegend als Ausgangspunkt für analytische bzw. unitarische Hypothesengebäude interessant war, nicht als poetische Gestalt. 15
16
Frauengestalten Homers
109
(7,234) Sie hatte nämlich Überwurf und Leibrock und die ganze Kleidung, die so schöne, beim ersten Blick als die erkannt, / die sie persönlich angefertigt hatte mit den Mädchen! / Da redete sie ihn nun an und sprach die gefiederten Worte: / „ Fremder! Danach möchte ich dich nun als erstes, ganz persönlich, fragen: / Wer bist und woher kommst du unter Menschen? Wer hat dir diese Kleider da gegeben? / Sagst du nicht ausdrücklich, du seiest übers Meer, umhergetrieben-heimatlos, hierher gekommen ? " Die Frage steht im Raum. Mit ihr ist alles gesagt. Warum sie nicht sogleich antworten konnte auf seine Bitte. Warum sie gleich ganz stumm geblieben war. Was hätte sie dem fremden Mann denn sagen sollen, der da plötzlich in Kleidern vor ihr kniete, die sie selbst gewoben hatte, die also aus dem eigenen Hause stammten! Wie war er da herangekommen? Welcher Zufall! War ihre Tochter ein Mädchen im heiratsfähigen Alter - nicht heute morgen erst mit einem Wagen voller Kleidung zum Wäschewaschen an den Strand gefahren? Und nun der Fremde da in frischgewaschenen Kleidern aus dem eigenen Haushalt? Der sich als leidgeprüfter Irrfahrer aus der Ferne ausgibt ... Nun wird verständlich, warum sie auch dann noch nicht geredet hatte, als ihr Mann schon auf den Fremden eingegangen war. Und: warum sie gerade so lange geschwiegen hatte, bis die Gäste das Haus verlassen hatten. Warum sie also jetzt erst spricht. Odysseus, der Fremdling, erklärt nun. Plötzlich hat auch er das Zweideutige der Situation erkannt. Er legt sich geradezu ins Zeug, zufriedenstellend zu erklären: Schiffbruch vor Ogygia, als einziger heil davongekommen, an Ogygias Küste angetrieben, sieben Jahre von Kalypso festgehalten, im achten Jahre endlich freigegeben - siebzehn Tage einsam auf einem Floße übers Meer gefahren, Scheria schon in Sicht - doch dann der Sturm, das Floß zerbrochen, am Ende schwimmend nur Scherias Strand erreicht - die völlige Erschöpfung, der tiefe Schlaf die Nacht hindurch und auch den nächsten Tag noch, das Erwachen gegen Abend erst, die spielenden Mädchen ... und dann - Nausikaa, Aretes Tochter: (7,292) „... die traf den richtigen Gedanken: / (295) sie gab mir reichlich Brot und dunklen Wein /und hieß im Fluß mich baden - und hat mir diese Kleider da gegeben! / - Dies ist - wiewohl mit Kummer nur erzählt - die Wahrheit! " Da hat sich also alles aufgeklärt. Arete ist befreit. Nach einem abschließenden Gespräch zwischen den beiden Männern (7,335) gebot Arete mit den weißen Armen ihren Mädchen, / ein Lager unterm Säulenumgang herzu\richten; schöne 56 Tücher, /purpurfarbene, daraufzuwerfen, und oben Laken draufzubreiten, / und Decken draufzulegen, wollene, zum Drüberziehen ... Mit der Detailfülle dieser Schilderung, die die Sorgfalt der persönlichen Betreuung durch die Herrin des Hauses in Worte faßt, gibt der Dichter zu verste-
110
Frauengestalten Homers
hen, wie sehr Arete sich versöhnt fühlt, ja wie sehr sie (des Verdachts sich schämend?) nun für den Fremdling sogar eingenommen ist. Mit ihrem langen Schweigen aber, das als .sprechendes Schweigen' der ganzen Szene vorher eine eigentümliche Gespanntheit gab, hat er verdeutlicht, was eine Frau von wahrem Adel in seinen Augen (und in denen seiner adeligen Hörer) auszuzeichnen hat: nicht Scheu, nicht Dienstbeflissenheit, nicht das zufriedene Aufgehen in der Beschränktheit häuslicher Betätigung, sondern Wachheit, Übersicht, Mitdenken, aber auch - und dies nun als das spezifisch Weibliche - äußerster Takt. Unter den Szenen, durch die der Odysseedichter Arete im folgenden weiter an Profil gewinnen läßt, ragt besonders eine noch hervor. Im 11. Gesang, mitten in seinen Abenteuer-Erzählungen von Troja über die Kyklopen bis zu Kalypso, läßt der Dichter den Odysseus eine Pause machen. Odysseus hat gerade von seiner Begegnung mit den Heroinen-Seelen erzählt, dann daran erinnert, daß es schon Nacht und Zeit zum Schlafen sei, und schließlich erneut um Heimgeleit entweder heut noch oder morgen - gebeten. Alle sitzen schweigend da, im Banne des Gehörten. Da nimmt wiederum Arete das Wort: (11,336) „Phaiaken! Was ist euer Eindruck von diesem Manne da? / Von seinem guten Aussehn, seiner Größe, seinem ausgewognen Denken? / Gastschützling ist er meiner, sicher! aber Anteil an der Ehre hat hier jeder! / Drum habt mit seinem Heimgeleit nicht allzu große Eile und schmälert ihm auf diese Art nicht die Geschenke, / die er so nötig braucht! Groß ist ja das Vermögen, / das ihr mit Götterhilfe in den Häusern liegen habt!" Arete war die erste, die das Schweigen gebrochen hatte. Jetzt springt ihr Echeneos bei: (11,344) „Freunde! wirklich - nicht gegen unsern Zweck und M i s re Meinung ist, / was die Königin, umsichtig, anrät. Also leistet Folge! / Doch freilich ist's Alkinoos hier, von welchem Werk und Wort nun abhängt!" Und daraufhin trifft Alkinoos dann die Entscheidung: Odysseus soll bis morgen bleiben. Was leistet diese kurze Szene für Arete? Arete hat die Abenteuer-Erzählungen des Odysseus nicht nur als Unterhaltung aufgenommen. Sie hat beim Hören auch ihre Schlüsse von der Außergewöhnlichkeit der Erzählung auf den Erzähler 57 - und auf sein Auditorium gezogen. Sie hat erspürt, I daß die Persönlichkeit, die sie da beherbergt und deren Patronin sie geworden ist, mit den ihr gebührenden Sonder-Ehren behandelt werden muß und nicht mit den üblichen .protokollarischen' Gastgeschenken wieder abgeschoben werden darf. Als von den Männern, die ganz im Banne des Erzählten stehen, offensichtlich keiner - auch ihr Mann nicht - realisiert, daß Odysseus mit seinen letzten Worten ihnen eine Entscheidung zugeschoben hat, die durchaus nicht nur zeitlicher Natur ist, da greift sie
Frauengestalten Homers
111
vorsichtig ein. Sie weist dezent darauf hin, daß die Männer sich selbst unter Wert verkaufen würden, wenn sie die Ehre der Anwesenheit des Odysseus, dieses außerordentlichen Mannes, nicht zu würdigen verstünden. Zugleich legt sie die Lasten der Beschenkung geschickt und unauffällig vom eigenen Hause weg auf alle um. Echeneos, von den Männern noch der Klügste, begreift das als erster und nimmt es rasch auf: „Ja, Freunde! da hat unsere umsichtige Königin sehr schön unsere eigenen Gedanken ausgesprochen!" So kann er gerade noch den mangelnden .Situationsdurchblick' der Männer verschleiern - besonders den des Königs, den er mit seinem letzten Satz geradezu anstoßen muß, sich daran zu erinnern, daß die Entscheidungsgewalt bei ihm (und nicht bei seiner Frau) liegt. Das Ideal der taktvoll klugen Frau ist also mit dieser Szene noch faßlicher geworden. Der Dichter hat es um einen wesentlichen Zug bereichert: diese kluge Frau (περίφρων 345 bedeutet ja eigentlich .ringsum bedenkend') ist sogar so klug, die Überlegenheit der eigenen Intelligenz über die des Ehemannes zu verbergen. Im Epos selbst hat nur einer das durchschaut (und nur diesen einen konnte der Dichter es durchschauen lassen): Odysseus. Als er von Scheria scheidet, (13,57) gab er Arete in die Hand den Becher / und redete sie an und sprach die gefiederten Worte: / „Bleib wohlbehalten mir, o Königin, für alle Zeit... / Ich kehre heim - du aber: hab deine Freude hier im Hause / - an deinen Kindern - und am Stadtvolk - und an Alkinoos, dem König!" Daß Odysseus sich bei seiner Ankunft zuerst an Arete wandte, war Befolgung eines Rates. Daß sein Abschied von Scheria Abschied von Arete ist, das ist sein eigener Entschluß. Der Kluge hat die Kluge erkannt. Sie scheiden voneinander in Respekt. Nausikaa Klugheit, Takt und Einfühlungsvermögen sind die Eigenschaften, die der Odysseedichter auch an Aretes und Alkinoos' Tochter, an Nausikaa, in den Vordergrund rückt. Das wird gleich in der Einführung des jungen Mädlchens deutlich: 58 Athene war des Nachts ans Bett der schlafenden Nausikaa getreten und hatte ihr im Traum geboten, ihre Gedanken nun auf Heirat und auf Hochzeit zu richten. Große Wäsche solle sie machen, unten an der Flußmündung am Meeresstrande, in den Waschgruben (so steuert der Dichter auf die Begegnung des Odysseus mit dem jungen Mädchen zu). Nausikaa ist betroffen und verwirrt, beeilt sich aber, dem Traumbild zu gehorchen. Als sie in die Halle kommt, sitzt die Mutter
112
Frauengestalten Homers
am Rocken, der Vater bricht gerade zur Versammlung auf. Da tritt sie auf der Schwelle ganz nahe an den Vater heran: (6,57) „Lieber Papa! könntest du mir nicht einen Wagen richten lassen, / einen Lastwagen, gutgerädert, daß ich die schöne Kleidung / zum Fluß hinfahren kann zum Waschen, die mir gar schmutzig daliegt? / Sowohl dir selbst steht's schließlich zu (gehörst ja zu den Ersten!), /im Rat zu sitzen sauber angezogen, / - und dann hast du ja noch fünf Söhne hier im Hause, / die zwei verheirateten und die drei schmucken Junggesellen: / die woll'n ja stets in frischgewaschnen Kleidern/ zum Tanze gehn! - An alles das muß ich. ja denken!" / So sprach sie, denn sie scheute sich, die freudige Hochzeit beim Namen zu nennen / dem lieben Vater gegenüber. Der aber merkte alles und gab ihr zur Antwort: / „ Weder will ich dir die Maulesel verweigern, Kind, noch irgend etwas andres! / Die Knechte sollen dir den Wagen richten ..." usw. Mit welchem Geschick das junge Mädchen sein eigenes Interesse an der Ausfahrt nach uraltem Rezept hinter den vorgeschobenen Interessen der anderen verbirgt, das hat unzählige Homerleser entzückt. Bis hierher handelt allerdings Nausikaa nicht anders, als tausend andere Mädchen ihres Alters handeln würden (zum schmunzelnden Vergnügen ihrer Väter). Daß Nausikaa zu mehr befähigt ist als diese anderen, das zeigt der Dichter nach dem einstimmenden Auftakt in einer zweiten großen Szene - unten am Strand: Odysseus, vom Jauchzen der banspielenden Mädchen erwacht, ist aus dem Ufergebüsch hervorgetreten, die Blöße mit einem Strauchzweig deckend. Die Mädchen sind schreiend weggerannt, (6,138) stoben hierhin die eine, die andere dorthin ... Einzig Alkinoos' Tochter blieb ... / (141) und trat ihm gegenüber, sich beherrschend ... - Einzig Alkinoos' Tochter! Der Unterschied zwischen den vielen und der einen wird konkret ins Bild gesetzt: hier die auseinanderstiebenden Jungen Gänse' - dort ihre Haltung bewahrende Altersgenossin aus dem Herrenhause. Mit der Inszenierung dieser extremen Situation - ein junges Mädchen hält völlig auf sich allein gestellt abseits von Elternhaus und Wohnsiedlung einem nackten fremden Mann stand (wobei das gesamte Vokabular der Szenenschilde59 rung die typische Iliasszene .Selbstüberwindung und mutiges I Standhalten eines an sich unterlegenen Kämpfers in der Schlacht' evoziert 20 ) - verrät der Dichter 20
Siehe Verf., Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, München 1977, 195 f. zum μένειν in der Schlacht; Standhalten durch Einwirkung eines Gottes ist ein stehendes Motiv (zur konkreten Wirkung einer Mut- oder Kraftübertragung s. Verf., Zum Wortfeld .Freude' in der Sprache Homers, Heidelberg 1966, 21-24). Die „Beherztheit im Denken, Handeln und Sprechen" hebt jetzt auch G. Wickert-Micknat in einer Spezialstudie über ,Die Tochter in der frühgriechischen Gesellschaft' als hervorstechendes
Frauengestalten Homers
113
in exemplarischer Pointierung die Rollenerwartung, die bei ihm und der ihn tragenden Gesellschaftsschicht gegenüber Repräsentantinnen des Adelsstands besteht: Erwartet werden Sicherheit und Selbstvertrauen, Standfestigkeit, Gewachsensein, Klugheit und Geistesgegenwart - auch und gerade bei noch jungen Standesangehörigen. Die Darstellung und Vermittlung dieser Standesideale wirkt um so authentischer, als sie implizit geschieht und nichts Proklamatorisches an sich hat: Die gesellschaftlichen Grundgegebenheiten sind nur der Stoff, aus dem die Figur gemacht ist; sie gehen als Selbstverständlichkeiten in die eigentliche Zielsetzung ein. Diese beginnt dort, wo die .typische Szene' (.Landfremder erbittet Schutz von Einheimischem und bekommt ihn zugesagt') zu Ende ist: Als Nausikaa die Mädchen zurückgerufen hat, der Schutzflehende gebadet und bekleidet ist - dank Athenes Hilfe strahlt er in Schönheit und Anmut - , da offenbart sich die alle Konventionen hinter sich lassende Individualität dieses jungen Mädchens aus dem Adel in einer spontanen, von Kraft und Sicherheit geprägten persönlichen Erklärung: (6,239) „Hört einmal her, hellarmige Gefährtinnen; ich möchte etwas sagen! / Nicht gegen aller Götter Willen ... / kann dieser Mann zu den Phaiaken. die den Göttern nah sind, kommen! / Vorhin nämlich machte er mir keinen sonderlichen Eindruck, eher unansehnlich, / nun aber gleicht er den Göttern, die den weiten Himmel bewohnen! / Ja, könnte doch ein solcher Mann , Gatte ' mir heißen! / hier wohnend auf die Dauer - und gefiel 's ihm, dazubleiben! - /Nun gut! Gebt, Gefährtinnen, dem Fremdling Speis und Trank!" Es ist erstaunlich, wie sehr diese Äußerung seit der Antike bis heute mißverstanden werden konnte. Ein antiker Erklärer glaubte sie gegen den Vorwurf der Unschicklichkeit (απρεπείς) und Zügellosigkeit (άκόλαστοι) durch den Hinweis auf die deutlich erkennbare allgemeine Libertinage der Phaiaken (τρυφώντες oi Φαίακες καί παντάπασιν άβροδίαιτοι) verteidigen zu sollen. Die treffende Erklärung des Ephoros, diese Rede sei Ausdruck einer zum Höchsten geborenen edlen Seele (έξ εύφυοΰς προς άρετήν ψυχής) zitierte er ohne Beifall. Der jüngste Kommentator, J.B. Hainsworth, erkennt zwar die Zeitbedingtheit moralischer Wertungen an, glaubt die Jungfrau aber immer noch durch das ver-
Merkmal der homerischen Nausikaa hervor (Saeculum 36, 1985, 113-132, hier 128; Hinweis von J. v. Ungern-Sternberg). Daß Nausikaa nach Normen handle, die in unserem „ Z e i t a l t e r [ . . . ] mehr oder minder außer Kraft gesetzt sind", und daß wir es schwer haben, die Regeln dieser „uns fernen Gesellschaft überhaupt wahrzunehmen" (115), ist freilich ein rein subjektiver Eindruck der Verfasserin (der auch sonst in seltsam apodiktischer Verallgemeinerung ihre Arbeiten durchzieht, s. dazu Verf., Homer 30 f.).
114
Frauengestalten Homers
harmlosende Urteil ,naiv bezaubernd' („ingenuamente affascinanti") absichern zu müssen 21 . - Der Dichter hatte erkennbar anderes im Sinn: Er hat im Umkreis dieser Stelle genügend deutlich gemacht, daß die Außergewöhnlichkeit dieses Mädchens im eigenen Land bis zu diesem Zeitpunkt kein männliches Pendant gefunden hatte22 (gerade hier, in dieser ihrer .Erklärung', läßt er das von Nausikaa selbst noch einmal besonders klar betonen: ένθάδε, αυτόθι 245). Daß dies 60 so sein mußte, versteht der Hörer im wirklich gemeinten Sinlne aber eben erst dann, wenn er diese Rede hört! Der Dichter läßt Nausikaa so selbstverständlich offen reden, um eindeutig klar zu machen: Für dieses Mädchen gab es tatsächlich nur einen Partner wie Odysseus. Nur so gesehen bekommt die Begegnung zwischen Nausikaa und Odysseus ihre eigentliche Dimension. In den uralten Abenteuer-Erzählungen des Seefahrers Odysseus mag diese Begegnung, falls es sie dort schon gab, eine Romanze gewesen sein. Der Odysseedichter macht aus ihr ein Schicksal23. Er erreicht das dadurch, daß er der Gestalt des jungen Mädchens Züge verleiht, die im Ansatz eben jene starke Persönlichkeit erkennen lassen, deren Anziehungskraft sich ein Odysseus seiner Natur nach gar nicht entziehen kann (und hier doch muß), - Züge, wie er sie auch an seiner Frau Penelope so liebt24. Ganz deutlich wird das in der nächsten Rede Nausikaas: Als Odysseus seinen Imbiß, den sie ihm hat reichen lassen, beendet hat, läßt sie die Wäsche falten und auf den Wagen legen, steigt selbst hinauf und gibt dem fremden Mann Verhaltensmaßregeln: (6,255) „Brich auf nun, Gast, zur Stadt zu gehen, damit ich dich geleite/ zu meines Vaters Haus ... /(258) Ρaß auf. so mußt du's machen (du bist ja, wie mir scheint, nicht ohne Köpfchen!): / Solange wir durch Äcker kommen und Kulturland, / so lange gehe mit den Mägden hinter den Mauleseln und dem Wagen / rüstig hinterher; ich übernehme die Führung. / Aber sobald wir die Stadt betreten " (hier verliert sie sich in einer weitläufigen Erklärung, woran man denn diesen topographischen Ort erkennen könne - natürlich um das etwas Peinliche, das sie jetzt sagen muß, hinauszuzögern), (273) „ja, da möcht' ich dem Gerede, dem unliebsamen, der Phaiaken aus dem Wege gehen, daß kei21
Alle zitierten Beurteilungen der Rede im neuen italienischen Odyssee-Kommentar z. St. Od. 6,276-284. 23 Eben darum konnte Goethe auf den Gedanken kommen, aus der homerischen Episode sogar ein Nausikaa-Drama zu machen, s. Wickert-Micknat, Tochter 114, und jetzt E.-R. Schwinge, Goethe und die Poesie der Griechen, Wiesbaden 1986, 43 mit Anm. 215 (Nachweise). 24 Den „sichtbaren Bezug zwischen Scheria und Ithaka" gerade auch in der Personengestaltung hebt hervor K. Riiter, Odysseeinterpretationen. Untersuchungen zum 1. Buch und zur Phaiakis, Göttingen 1969,246. 22
Frauengestalten Homers
115
ner hinter meinem Rücken / lästert (und sie sind recht ungehemmt im Volke!). / Da könnt' zum Beispiel einer von der boshafteren Sorte, wenn er uns begegnet, sagen: / , Wer ist denn der da, der Nausikaa dort hinterhergeht, schön und groß, / der Fremde ? Wo hat sie ihn gefunden ? Ihr Mann soll der wohl werden ?..."' Nicht nur durch die Treffsicherheit der Lagebeurteilung und durch die Fähigkeit, die eigene Person kritisch mit den Augen der anderen zu sehen, muß das junge Mädchen (bei aller Altklugheit) dem erfahrenen Manne imponieren, sondern vor allem durch die - ihm sehr vertraute - Gabe, das Gewünschte so diplomatisch wie möglich zu sagen: Indirekt, eine Spottrede erdichtend, macht sie ihm taktvoll klar, daß es besser sei, wenn er am Stadtrand warte, bis er das Gefühl habe, der Wäschewagen sei am Zielort angelangt, und erst dann zum Elternhaus des Mädchens gehe ... Wie sollte Odysseus, der Vielgewandte, Listenreiche, der später auf Ithaka den Listenreichtum seiner Frau Penelope so sehr bewundem wird, sich dieses Talents (das überdies den Vorzug der Jugend für sich hat) nicht freuen? Zumal er die starke Sympathieerklärung, die in der Formulierung der fiktiven Spottrede liegt, nicht überhören kann ... I Ich kann die Feinheit der Charakterzeichnung gerade in der Gestalt der Nau- 61 sikaa aus Zeitgründen nicht weiterverfolgen. Auch so wird aber vielleicht schon deutlich geworden sein, wie tiefdringend das Verständnis dieses Dichters für weibliches Verhalten ist und wie intensiv er sein Ziel verfolgt, Frauengestalten zu schaffen, die bei aller notwendigen Typik doch einheitliche und glaubhafte Individualitäten sind25. *
Noch deutlicher und überzeugender als an den ruhigen, gelassenen .Positivfiguren' der vorbildhaften Phaiakenfrauen zeigt sich das an den Frauengestalten der Ilias. Hier war eine ganz andere Grundbefindlichkeit umzusetzen: Frauen, die ständig in der Anomalie des Krieges, ständig in der Angst leben. An die Fähigkeit des Dichters, die Gleichartigkeit der Situation nicht zu einer massiven Einebnung individueller Persönlichkeitsprofile fuhren zu lassen, waren da hohe Anforderungen gestellt. In den beiden einander polar zugeordneten Gestalten der Andromache und der Helena hat Homer diese Aufgabe besonders eindrucksvoll gelöst.
25
Im gleichen Sinne speziell zu Nausikaa: S. Besslich, Nausikaa und Telemach. Dichterische Funktion und Eigenwert der Person bei der Darstellung des jungen Menschen in der Odyssee, in: Gnomosyne (Festschrift Marg), München 1981, 103-116, und Wickert-Micknat, Tochter 128.
116
Frauengestalten Homers
Beide Frauen sind Schwiegertöchter des Stadtkönigs Priamos von Troja und seiner Gattin Hekabe. Andromache ist Frau des ,braven' Sohnes Hektor, des Stadtschützers und Kommandanten des Verteidigungsaufgebotes - Helena Frau des .schwarzen Schafes' der Familie, Paris. Andromache ist auf normalem Wege in die Königsfamilie hereingekommen (sie hat aus einer Nachbarstadt Trojas als Tochter des dortigen Stadtkönigs26 in die trojanische Dynastie eingeheiratet), Helena ist auf äußerst anomalem Wege nach Troja gekommen: Paris hat sie ihrem Manne Menelaos, dem regierenden Fürsten von Sparta in Griechenland, und ihrem Töchterchen Hermione entführt (und sie ist nicht ungern mitgegangen). So wie Homer nun Hektor den Soldaten Paris dem Künstler gegenüberstellt, so kontrastiert er auch die beiden Frauen. Andromache Hektors Frau 27 wird dreimal ausführlicher vorgestellt: im 6., im 8. und im 24. Gesang. Der erste Auftritt im 6. Gesang schlägt den Grundton an: Hektor ist vom Schlachtfeld in die Stadt gelaufen, um in verzweifelter Kampfsituation Trojas Frauen zu einer Bittprozession zur Stadtschützerin Athene auf dem Burgberg aufzufordern. Bei Wege schaut er auch ins eigene Haus hinein. Aber Andromache ist nicht daheim. Sie ist mit dem Kind und einer Amme zum Turm geeilt (386) und steht dort γοόωσά τε μυρομένη τε: schluchzend und klagend (6,373). Als Hektor schon wieder auf dem Weg zur Schlacht ist, kommt sie ihm 62 beim Skaiischen Tor entgegen - hinter ihr I die Kinderfrau (6,400), den kleinen Jungen an die Brust gedrückt, den verspielten, noch nichts begreifenden, / den Hektorsproß, den so geliebten, vergleichbar einem schönen Sterne ... Daß von Anfang an das Kind dabei ist (schon vorher in untrennbarer Einheit mit der Mutter: ή γε ξύν παιδί, Ζ 372), ist programmatisch. Diese enge MutterKleinkind-Beziehung gibt es sonst in beiden Epen nirgends. Entsprechend wird die Persönlichkeitszeichnung fortgesetzt: Während Hektor noch still über diese Szene lächelt, tritt Andromache Tränen vergießend (δάκρυ χέουσα, 405) an ihn heran, faßt seine Hand und beginnt ihre lange, beschwörende Bittrede so: 26 D. 6,395-398; Theben unterm Piakos (das ,Hypoplakische Theben') ist das spätere Adramytteion (heute Edremit). 27 Meisterhaft (bei aller zeitbedingten idealischen Hochgestimmtheit) die Ausdeutung von W. Schadewaldt, Homerische Szenen. I: Hektor und Andromache, Die Antike 11, 1935, 149170 (wiederholt in ,Von Homers Welt und Werk', zuletzt 4 1965) („Aber man irre sich nicht, und lasse das Bild der Homerischen Andromache nicht unbewußt mit den empfindsamen Frauengestalten aus dem bürgerlich-idyllischen Klein-Epos des 18. Jahrhunderts verfließen. Die Liebe Andromaches hat etwas Unbedingtes, Elementares": HWW 4 220).
Frauengestalten Homers
117
(6,407) „Du Unbegreiflicher, Getriebener! Zugrunde richten wird dich dieser Kampfesdrang! und hast kein Mitleid / mit deinem kleinen Sohn und mit mir Armen: deine Witwe /werde ich bald sein ..." Der erste Gedanke gilt dem Mann, der zweite dem Kind, und erst der dritte sich selbst! - Unter den Argumenten, die sie dann in langer Reihe aufeinander folgen läßt - wie ungezählte Frauen, die ihren Mann dem Krieg nicht opfern wollen - ist eines, das wieder jenseits aller Typik liegt und ihrer Gestalt einzigartige Kontur verleiht: daß es keinerlei Wärme mehr für sie geben wird, wenn er nicht wiederkommt; denn sie hat weder Vater mehr - noch Brüder (alle sieben hat Achilleus an einem Tage umgebracht) - noch Mutter ... (6,429) „Hektor, da bist ja für mich Vater und verehrungswürdige Mutter /und Bruder - und du bist mir auch blühender Gatte!" Als Hektor ihr daraufhin lange von Vaterland und Pflicht redet, ins Abstrakte sich flüchtend, und sich von dem Kleinen mit einem hochgestimmten Gebet voller Vater- und Adelsstolz verabschiedet hat, (6,483) da nahm sie den Kleinen an den warmen Busen / unter Tränen lachend, und den Gatten faßte Mitleid, als er's merkte, und er streichelt sie und spricht nun ein wirklich tröstendes, persönliches, ganz privates Wort, (6,495) die Gattin aber, die liebe, ging zum Haus hin / immer wieder sich umwendend, die quellende Träne vergießend ..., und am Ende der Szene steht das gleiche Wort, mit dem Andromaches Grundsituation schon zu Beginn gekennzeichnet wurde: γόος, Schluchzen. In Andromache der Weinenden zeichnet Homer grundsätzlich das Opfer. Die Klagerede, die er sie ihrem Mann im 24. Gesang halten läßt, als Hektor wirklich gefallen ist, würde dieses Bild nur vertiefen. Wir übergehen sie zugunsten einer anderen, scheinbar ganz unbedeutenden Szene, in welcher deutlich wird, wie wenig sich Homer mit Typen zufriedengibt und wie intensiv er darum ringt, selbst das Typische eines Frauenschicksals noch als Ergebnis ganz individueller Züge zu begreifen: Im 8. Gesang ruft Hektor in I mitreißender Siegesgewißheit 63 zum Angriff gegen die Lagermauer der Achaier auf. Dann, zu seinen Pferden gewandt: (8,185) „Xanthos! und du, Podargos! und Aithon, und du, edler Lampos! /Nun zahlt mir zurück jene Pflege, die euch in reicher Fülle / Andromache stets angedeihen ließ, des edlen Eëtion Tochter, / wenn sie erquickendes Futter euch vorsetzte / und Wein zum Trinken euch mischte, sooft ihr mochtet / - und dies, noch bevor sie mir das Essen richtete, der ich doch ihr blühender Gatte mich nenne!" Die Stelle ist im Originaltext sprachlich recht sperrig überliefert und darum seit der Antike als nicht authentisch und töricht verdächtigt worden. An den sprachlichen Merkwürdigkeiten gibt es nichts zu deuteln, aber diese können
118
Frauengestalten Homers
auch Ergebnis früher Mißverständnisse und .Besserungsversuche' sein. Man fragt sich, welcher Rhapsode auf eine so ausgefallene Idee gekommen sein könnte, wie sie diese Stelle repräsentiert, wenn es nicht eben jener Dichter war, der die Andromachegestalt als charakterliche Einheit konzipiert hat. Es ist ja ein kleiner Zug nur, der hier Andromache verliehen wird, aber sehr charakteristisch: Die Frau, die sich um die Dinge ihres Mannes sorgt so wie um ihn; denn was ihm gehört, das ist ein Stück von ihm, und so bezieht sie es in ihre Fürsorge ein: was sie für seine Pferde tut, tut sie für ihn. Es ist die Frau, die Verbindungen schafft zum Mann, wo immer es nur geht - nicht um seinen Dank zu ernten, sondern weil ihr Sinnen ganz auf ihn und seine Sphäre ausgerichtet ist. Andromache lebt ganz aus Hektor. Wenn sie um sein Leben bittet, bittet sie um ihres. Ihre Identifikation mit dem Manne ist vollkommen. Gerade das aber ist es, was sie zum Opfer prädestiniert. Eine Frau wie Andromache - das zeigt Homer - , sich selbst zurückstellend und darum bewußt ungleichwertig (eben darin aber glücklich), muß die Opferrolle notwendig selber auf sich ziehen. Helena In scharfen Kontrast zu Andromache stellt der Iliasdichter seine Helena. Helena ist überlegen. Und sie ist unglücklich. Dies aber nicht im vordergründigen Sinn der ,unglücklichen Frau', sondern im Sinne eines Leidens an sich selbst28. Die Trojasage hatte Helena vermutlich von Anfang an als Kriegsgrund angegeben. Helena muß also in ungezählten Versionen der Geschichte aufgetreten sein. Was dabei allein unverändert geblieben sein dürfte, war wohl ihre Auslöserfunktion. Sonst aber wird sich die Figur je nach Weltsicht, Moralauffassung und Niveau der Sänger von Version zu Version anders dargestellt haben. Die 64 beiden Pole dürften dabei von Anfang an dieselben I gewesen sein wie in der späteren griechischen und europäischen Dichtung: entweder schuldloses Opfer männlicher Verführungskunst oder zuchtlose Ehebrecherin. Dazwischen lagen unendlich viele Möglichkeiten von Abstufung und Variation; ob sie schon vor Homer in größerer Anzahl realisiert wurden, ob also wirklich viel Mühe auf die psychologische Feinzeichnung dieser Figur verwendet worden war, möchte man 28
Gute Beobachtungen in dieser Richtung zuletzt bei B. L. Hijmans Jr., Alexandras and his grief. Grazer Beiträge 3, 1975, 177-189 (bes. 184 ff.). - Ohne Verständnis für die auch vom Dichter unserer Trojasagenversion (der sog. ,Ilias') vorausgesetzte Grundlagenfunktion der Helenagestalt, ohne Verständnis aber auch für die Homerische Helena überhaupt* Netta Zagagi, Helen of Troy: Encomium and Apology, Wiener Studien 19, 1985, 63-88 (nützlich als Literatursammlung).
Frauengestalten Homers
119
eher bezweifeln. Homer aber hat die Figur offensichtlich als Herausforderung begriffen. Wenn er auch sonst schon überall eine „Psychologisierung des Faktischen der Sage"29 zum Angelpunkt seiner Sagenversion gemacht hat, so trifft das in besonderem Maße auf seine Helenagestalt zu. Er hat sich die Frage gestellt: ,Was geht eigentlich vor in einer Frau wie Helena?' Seine Antwort ist ein hochdifferenziertes Portrait, nahezu eine psychologische Fallstudie. Die Alternative .Opfer - Verbrecherin' schiebt er als unrealistisch beiseite. An ihre Stelle setzt er ein Individuum. Er beginnt damit, daß er Helena zunächst in bewährter Weise von außen zeigt, sie mit den Augen anderer vorstellt. Dabei wird sofort ihr kardinales Wesensmerkmal deutlich: sie ist - anders als Andromache - öffentliche Person. Das erste, was von ihr verlautet, ist ihre Eigenschaft, zu provozieren. Helena ist, ohne daß sie etwas dafür könnte, lebende Provokation. Sie läßt niemanden kalt, löst in jedem etwas aus, zwingt zur Stellungnahme. Dies wird jedoch nicht etwa konstatiert, sondern vorgeführt: Helena als Triebkraft des Handelns aller beteiligten Parteien, als Posten in den je verschieden angelegten Rechnungen verschiedener Personen und Personengruppen. So wird Schritt für Schritt deutlicher, welche ungeheuerliche Wirkung von Helena ausgeht. Zur Selbstverständlichkeit wird für den Hörer, daß der Krieg um sie entbrennen mußte. Zuerst erscheint sie - bezeichnenderweise - im Munde einer Göttin: Heras. Im 2. Gesang der Ilias droht das Achaierheer der Kommandogewalt seiner Führer zu entgleiten; des langen Kampfes müde, dringen die Krieger auf Heimkehr. Da greift Hera ein. Sie schickt Athene ins Achaierheer hinab, die Flucht zu hemmen. Dies die Begründung: (2,158) „Sa also sollen heimwärts in ihr Vaterland / die Argeier flüchten, über den weiten Rücken des Meeres? / Sollen sie denn wirklich dem Priamos und den Trojanern als Prahl-Objekt belassen / die Frau aus Argos - Helena? derentwegen viel Achaier / in Troja umgekommen sind - fern ihrer Heimaterde?" Um Helena ist also noch nicht genug gestorben worden. Der Kampf muß weitergehen - gerade auch aus Göttersicht - , weil es eben um Helena geht. Athene führt Heras Auftrag aus. Die Flucht des Achaierheeres kommt zum Stehen. Neue Heeresversammlung. Thersites redet, Odysseus redet, I schließlich 65 redet Nestor. In seiner Rede wird der Rang Helenas in der Motivation der Belagerer deutlich: (2,354) „... drum dränge keiner darauf, heimzukehren, /bevor er 29 W. Kullmann, Zur Methode der Neoanalyse in der Homerforschung, Wiener Studien 15, 1981, 26; dazu Verf., Homer 99 ff.
120
Frauengestalten Homers
nicht mit einer Troerfrau geschlafen, / um so zu rächen unsern seufzerreichen Kampf um Helena!" Kurz darauf die Wirkung auf den verlassenen Ehemann, Menelaos: ,Das Kontingent aus Lakedaimon führte Menelaos, (2,589) zum Kampfe treibend: seine Begierde war am größten, / den seufzerreichen Kampf um Helena zu rächen'. Schließlich die Wirkung auf den jetzigen Ehemann, Paris. Als ihn sein Bruder Hektor als Weichling tadelt, bietet er einen Entscheidungszweikampf zwischen sich und Menelaos an: (3,68) „Die andern Troer laß nur niedersitzen und die Achaier alle, / mich aber und den Aresliebling Menelaos laßt in der Mitte / zusammentreffen, um Helena und den gesamten Schatz zu kämpfen! " Von der Seite der Hauptbeteiligten her ist damit klargestellt, wie sehr und mit welcher Zielrichtung das Denken und Wollen aller von Helena beherrscht wird. Jetzt kann sie selbst auftreten. Das geschieht in sechs großen Szenen in den Gesängen III und VI. Die erste dieser Szenen macht zunächst klar, daß Helena nicht nur Objekt der anderen ist: Die Götterbotin Iris kommt im Auftrag Aphrodites zu ihr, sie zur Stadtmauer herauszurufen: (3,125) Die aber fand sie in der Halle. Sie webte ein großes Gewebe, / doppelseitig, purpurn, und webte hinein viele Kampfmüh 'n / der rossezähmenden Trojaner und der erzgepanzerten Achaier, /Mühen, die sie ihretwegen litten unter Ares' Schlägen. Helena ist also nicht nur Objekt der anderen, sie ist sogar Objekt ihrer selbst: Ihrer Wirkung, ihrer zerstörerischen Wirkung, ist sie sich so zwingend und getrieben bewußt, daß sie sich diese Wirkung sogar im Bild selbst vorführen muß. Die Provokation, die in ihr liegt, ist ein Stück von ihr und doch von ihr nicht zu beherrschen: nicht Helena wirkt - es wirkt aus Helena. Auch auf sie selbst. Die Wirkung auf sie ist dauernde zwanghafte Selbstvergegenwärtigung. Bis hierher bleibt die Zeichnung noch im Allgemeinen. Umrisse werden abgesteckt. Dann aber setzt die Konkretisierung ein: Helena spürt Sehnsucht nach ihrem ersten Mann, nach ihrer Heimatstadt, den Eltern ... Sie geht zur Stadtmauer. Als sie an den greisen Ratsherrn der Trojaner vorbeigeht, wird die wesentliche Erscheinungsform ihrer Wirkung sinnfällig gemacht: Unwillkürlich flüstern die Alten einander zu: (3,156) „Nicht zu verargen ist es, daß die Troer und die wohlgerüsteten Achaier /um eine solche Frau lange Zeit Schmerzen erdulden: / unheimlich gleicht sie ja unsterblichen Göttinnen von Antlitz! / Aber auch so - mag sie auch von dieser Art sein - kehre sie heim zu Schiffe / und 66 bleibe uns und unsern Kindern für die Zu\kunft nicht zurück als Unheil!" Erscheinungsform ihrer Wirkung ist also ihre übermenschliche Schönheit. Diese Schönheit aber ist ein Fluch.
Frauengestalten Homers
121
Wie dieser Fluch auf die, von der er ausgeht, selbst zurückwirkt, das macht die dritte Szene offenbar: Helena mit Priamos, ihrem Schwiegervater, im Gespräch auf Trojas Mauer (die berühmte ,Teichoskopie'); der greise König sie entschuldigend („nicht du bist mir schuld - schuld sind mir die Götter!" 164), sie selbst aber völlig illusionslos: (3,173) „Hätte doch nur der Tod mich erfreut, der schlimme, damals, als ich hierher / deinem Sohne folgte, nachdem ich Ehebett im Stich gelassen, die Verwandten, /meine Tochter, die spät erst geborene, geliebte, und die zärtlichen Altersgenossinnen! - /Aber dies ist nicht geschehen! So schmelz' ich denn dahin im Weinen ..." Damit ist der Grundton angeschlagen, auf den Homer das Selbstverständnis Helenas gestimmt hat: quälendes Bewußtsein einer Schuld, an der aber dann doch immer wieder nicht eigentlich sie selbst sich schuldig fühlt (unverkennbarster Ausdruck der Gespaltenheit), und aus dem permanenten Scheitern der Identitätssuche und dem Gefühl einer Fremdbestimmtheit heraus, für die doch wiederum sie selbst als ,einklagbare' Person die Verantwortung übernehmen muß und übernimmt, die verzweifelte Selbstverfluchung bis hin zum Wunsch nach Selbstzerstörung: „Wer ist dieser Achaier dort unten, stark und groß?" hatte Priamos sie gefragt, „einem königlichen Manne gleicht er!" - Antwort: „Das ist der Atreussöhn, der große Herrscher Agamemnon, / beides in einer Person: ein guter König und ein starker Kämpfer - / und ßr mich der Schwager, -für mich Hundsföttin! - wenn er es jemals war" (3,167. 170. 178-180). Auf der gleichen Linie liegend die Ironie, die bis zum Zynismus geht: (3,234) „Ja, die anderen Achaier... seh' ich alle, /(236) doch zwei vermag ich nicht zu erblicken, zwei Truppenführer: / Kastor den Rossezähmer und den Faustkämpfer Polydeukes, / meine eigenen Brüder, von der gleichen Mutter geboren. /Sind sie vielleicht nicht mitgezogen aus dem liebenswerten Lakedaimon? / Oder sind sie zwar sehr wohl hierhergezogen mit der Meeresflotte, / jetzt aber nicht geneigt, sich in die Männerschlacht zu stürzen, / weil sie Schimpf und Schande fürchten, die zahlreich an mir hängen?" Der Zynismus ist das einzige Mittel, das ihr geblieben ist, sich überhaupt noch zu bewahren. In der vierten Szene richtet sie ihn gegen Aphrodite, der sie (das weiß sie) ihr Unglück verdankt: „Setz dich doch selbst zu Paris! der Götter Pfad verlasse / und kehr auf deinen Füßen gar nicht mehr zurück in den Olymp! /Sondern unablässig jammere dich ab um jenen und beschütz I ihn, / bis er dich 67 zu seiner Bettgenossin macht oder zu seiner - Sklavin!" (3,406); in der fünften und sechsten Szene richtet sie den Zynismus gegen den Mann, dem sie verfallen ist, gegen Paris (3,426: Aphrodite hat Helena, unmittelbar nachdem Paris im Zweikampf gegen Menelaos kläglich unterlegen ist, zu Paris ins Schlafgemach
122
Frauengestalten Homers
gezwungen und ihr eigenhändig einen Sessel, ihm gegenüber, hingerückt): Dort setzte Helena sich nieder, die Tochter Zeus ' des Aigishalters (!), / die Augen abgewandt, und schalt den Gatten: / „Bist du zurück aus dem Kriege? Wärst du dort lieber umgekommen! / von jenem Mann bezwungen, dem starken, der zuvor mein Gatte war! / Natürlich! vorher hast du groß geprahlt, du seist dem Aresliebling Menelaos / mit deiner Kraft, den Armen und der Lanze überlegen!/Nun geh doch! Fordere doch jetzt heraus den Aresliebling Menelaos, / zum zweiten Male gegen dich zu kämpfen! - Doch laß nur! Içh. geb' dir den Rat, / ganz stillzuhalten und nur nicht mit dem blonden Menelaos / in Krieg und Kampfdich einzulassen / unbesonnen - daß du nicht bald von seinem Speer bezwungen daliegst!" Der Hohn, so bitter und wegwerfend er klingt, entspringt natürlich nicht blanker Angriffslust, sondern ist Ausdruck einer existentiellen Enttäuschung. Obwohl sie selbst an ihrer Aggressivität am meisten leidet, kann sie auf diese Aggressivität nicht verzichten, um sich wenigstens ein Stückchen Selbstgefühl noch zu bewahren. Doch je weiter sie den Zynismus treibt, in dem sie Rettung sucht, desto tiefer und heilloser verletzt sie sich selbst. Das Schlimmste für sie ist, daß sie auch das weiß: (6,344 - zu Hektor) „Mein Schwager! Schwager einer Hündin, eines Übel bewirkenden Scheusals! / Hätte mich doch an dem Tag, an dem mich die Mutter geboren, / ein böser Sturmwind weggetragen / ins Bergland oder in die Wogen des schäumenden Meeres, / wo mich die Woge fortgerissen hätte, bevor dies alles hier geschehen! / Aber nachdem die Götter nun einmal diese Schrecklichkeiten hier beschlossen hatten, / ja, wär' ich dann doch wenigstens die Gattin eines beßren Mannes! / der ein Geßhl besäße für die Mißbilligung der Menschen und ihre viele Schmähung! / Dieser hier jedoch hat weder jetzt soliden Sinn noch wird er ihn in Zukunft / haben ..." Das alles wird im Beisein ihres Mannes ausgesprochen, an ihm vorbei, über ihn hinweg dem hochgeschätzten Schwager Hektor, der für Helena wirklich Mann ist, mitgeteilt. Man hat das oft als .Taktlosigkeit' bezeichnet. Doch das ist keine Kategorie für Helena Was aus dieser Frau spricht, ist äußerste Verbitterung, quälende Verzweiflung, ja Selbsthaß: daß sie einem Manne hörig ist, den sie verachtet, dafür haßt und verachtet sie sich selbst. Daß die dämonische Leidenschaft in ihr, deren sie nicht Herr ist, sie einem Manne zugetrieben hat, der in seiner kritiklosen Indolenz ihrer von scharfem Intellekt geprägten Persönlichkeit 68 nicht wert ist, - daß eine Befreiung I aus dieser Bindung aber dennoch - trotz aller Einsicht in ihre Verderblichkeit - unmöglich ist und daß das einzige Mittel, das ihr bleibt, sich noch zu wehren, ein Zynismus ist, der sie, wie sie fühlt, ständig mehr vergiftet und zerfrißt - das erzeugt in ihr, die für alle anderen der
Frauengestalten Homers
123
höchste Wert ist 3 0 , das Gefühl tiefster Wertlosigkeit. Der immer wieder in ihr aufsteigende Todeswunsch - weit davon entfernt, Koketterie zu sein - ist die natürliche Konsequenz. VI In Andromache hat Homer den Typ der Frau und Mutter, die liebend, sorgend, praktischen Verstands und eher passiv-angepaßt fast ganz aus ihrem Manne lebt, durch individuelle Züge in eine durchaus verstehbare, in ihrem sympathischen Bewahrungsstreben zur Identifikation geeignete Gestalt des normalen Menschenlebens umgesetzt. In Helena, der schönen, stolzen, selbstbewußten, intellektuellen Partnerin, die leidenschaftlich-aktiv mit dem Mann lebt und ihren Teil am Leben fordert, nicht in sich ruht, sondern nach außen .sprüht', darum unwiderstehlich begehrt wird und folglich nicht erhaltend, sondern zerstörend wirkt, hat er versucht, die alles Menschenmaß übersteigende Außergewöhnlichkeit jener Sagenfigur, die einen zehnjährigen Völkerkrieg - fast einen .Weltkrieg' -
Für die Achaier: (1) Achilleus in 9,339: Warum hat denn Agamemnon das Heer gesammelt und hierhergeführt? Etwa nicht wegen Helena der Schönhaarigen? - (2) Achilleus in 19,325: Mein Vater weint wohl jetzt um seinen Sohn. Der aberführt in fremdem Lande Krieg mit Troern wegen der schaudernmachenden Helena! - (3) Agamemnon in 3,458 nach dem Zweikampf Menelaos - Paris zu den Troern: Gebt Helena heraus! - (4) Agamemnon in 4,174: Das Schlimmste für mich wäre bei ergebnislosem Abzug, daß wir dann dem Priamos und den Trojanern als Triumphstück Helena dalassen miißten! - (5) Diomedes in 7,401 als Antwort auf das Friedensangebot der Troer (alle geraubten Sachwerte zurück, dazu noch Reparationen; wegen Helena werde der Druck auf Paris ebenfalls stärker): Weder die Sachen, die Alexandres anbietet, nehme einer an, noch Helena! Die Troer stehen kurz vor dem Zusammenbruch. - (6) Agamemnon in 9,140 - 282: Wenn Achill mit seinen Leuten wieder mitkämpft, soll er nach der Eroberung Trojas u. a. zwanzig Troerinnen bekommen, die die schönsten nach Helena sind! Für die Trojaner: (7) Der alte Ratsherr Antenor in 7,350: Geben wir doch lieber Helena zurück! - (8) Paris in 7,362: Antenor, die Götter müssen dich mit Wahnsinn geschlagen haben! Ich verkünde es hier ein für allemal in aller Öffentlichkeit: Die Frau gebe ich nicht zurück! Die Schätze, die ich damals mitgenommen habe, können sie hingegen alle haben. - (9) Der Dichter über den Troer Antimachos in 11,125: Der hatte am meisten Geld von Paris bekommen dafür, daß er gegen die Rückgabe Helenas an Menelaos in Troja Stimmung machte! - (10) Hektar in höchster Lebensgefahr, verfolgt von Achilleus, in 22,114: Was, wenn ich Achilleus von selbst, waffenlos, entgegenginge und ihm verspräche, Helena und alles damals von Alexandres Geraubte - Ursprung des Streites - den Atriden zurückzugeben (und dazu noch alles, was die Stadt besitzt)? Für die beiden höchsten Olympier Zeus und Hera: (11) Zeus schlägt Hera in der Götterversammlung vor (4,19), sich vielleicht doch damit anzufreunden, daß Troja weiterbewohnt wird und Menelaos seine Helena wieder heimführt. Hera droht ihm darauf eine Palastrevolution an (4,29).
124
Frauengestalten Homers
ausgelöst haben sollte, sich selbst und seinem Publikum durch Umsetzung in eine von Dämonie getriebene und daran leidende Ausnahmepersönlichkeit wenigstens ansatzweise begreiflicher zu machen. Daß beide Frauengestalten ebenso wie die der Arete und der Nausikaa - in ihrer typologischen Homogenität wie in ihrer individuellen Differenziertheit nur aus tiefdringender Welterfahrung und Verständnisfähigkeit heraus geschaffen werden konnten, versteht sich von selbst. In Homer bekundet sich damit die Einsichtsfähigkeit seiner Zeit, des 8. Jahrhunderts v.Chr. Der Fortschrittsstolz unserer Gegenwart gerade im psychologischen Bereich kann dem, der sich in diese vor zweitausendsiebenhundert Jahren geschaffenen Frauengestalten vertieft, danach leicht in neuem Licht erscheinen.
Ulrich Gehrig/Hans Georg Niemeyer (Hrsgg.), Die Phönizier im Zeitalter Homers (Ausstellung Kestner-Museum Hannover, 14.9.-25.11.1990), Mainz 1990, 11-21. (Bibliographie:) 253
Phönizier bei Homer Nicht jedem wird sofort begreiflich sein, warum eine Ausstellung, die den Phöniziern gilt, unter den Namen des griechischen Dichters Homer gestellt wird, mehr noch: warum ein Zeitraum von rund 300 Jahren (ca. 900-600 v. Chr.) sogar als Zeitalter Homers bezeichnet wird. Was widersinnig scheint, entpuppt sich jedoch bald als wohlbegründet: Die umfangreiche Literatur, die die Phönizier, wie wir wissen, damals selbst besaßen, war auf vergänglichem Material (vor allem Leder- und Papyrusrollen) geschrieben und ist darum verloren (nur karge Reste - Inschriften meist, Graffiti u. dgl. - haben sich erhalten), und die I übrigen schriftkundigen Völker des östlichen Mittelmeerraums (vor allem Ara- 12 mäer, Assyrer und Ägypter) haben im genannten Zeitraum (sieht man vom damals eher randständigen Alten Testament ab) ein bedeutendes Literaturwerk, das sich bis zu uns erhalten hätte, nicht hervorgebracht. Die beiden einzigen nach Qualität und Umfang alles andere überragenden Literaturprodukte, die im Mittelmeergebiet zu jener Zeit entstanden, sind in der Tat die beiden griechischen Epen Ilias und Odyssee (zusammen fast 28 000 Verse lang), die wir Homer verdanken. Ilias und Odyssee sind aber zugleich auch das spektakulärste Wirkungsprodukt der Phönizier selbst; denn hätten die Griechen nicht um 800 v. Chr. die Alphabetschrift von den Phöniziern übernommen, dann wären Ilias und Odyssee vermutlich nicht entstanden und erhalten geblieben, zumindest aber hätten sie nicht schriftlich aufgezeichnet und damit auch nicht zum Ausgangspunkt der europäischen Literaturentwicklung werden können. Die Griechen haben also, pointiert gesagt, ihren Homer - und Europa hat seine Schriftkultur - den Phöniziern zu verdanken. Eindrucksvoller läßt sich die Mittlerrolle der Phönizier zwischen Orient und Okzident nicht belegen. ,Die Phönizier im Zeitalter Homers' - das ist also treffende Bezeichnung des wohl fruchtbarsten Augenblicks im Zusammenleben zweier Nachbarvölker, die
126
Phönizier bei Homer
die europäische Kulturgeschichte nicht nur geprägt, sondern erst eigentlich begründet haben. Intensiv waren die Beziehungen der beiden Völker immer schon gewesen, lange vor Homer bereits. In der zweiten Hälfte des 2. Jtsd. v.Chr. hatten schon einmal enge Kontakte bestanden, besonders im 14. und 13. Jh. v.Chr., als die sogenannten ,mykenischen' Griechen (die sich großenteils ,Achaier' nannten und so auch von den Nachbarvölkern genannt wurden) das Erbe der Minoer von Kreta angetreten hatten und mit ihren Schiffen die Küsten des östlichen Mittelmeers ansteuerten. In dieser ersten Blütezeit des Griechentums, die man auch ,Ägäische Koiné' genannt hat, wurde mancherlei Kulturgut aus Ägypten und dem Osten, darunter auch von den Phöniziern, übernommen, wobei, wie üblich, mit den Sachen auch die Wörter wanderten: chrysós zum Beispiel, ,Gold', Chitön, ,das Hemdkleid', sesamon, ,der Sesam'. In dieser ersten Austauschzeit war wohl auch der Name für das Volk im Küstenstreifen unterm Libanon-Gebirge mit seinen reichen Stadtstaaten Byblos, Beirut, Sidon, Tyrus (von seinen orientalischen Nachbarn Kanaan genannt) entstanden: Phoinikes, ,die Karmesinrot-, Purpurfärber' (dasselbe hatte offenbar bereits die semitische Bezeichnung Kanaan - akkadisch Kinahhi - bedeutet). Schon damals also war das Volk berühmt für seine Handwerkskunst - in diesem Falle für das Färben von Gewändern mit dem kostbaren Saft der Purpurschnecke; doch wissen wir aus anderen Quellen (zumal dem ,Buch der Könige' im Alten Testament), daß Phönizier noch in einem zweiten Handwerk Außerordentliches leisteten: in der Fertigung und kunstreichen Ornamentierung von Metallprodukten, insbesondere Gefäßen aus Gold und Silber, Bronze, Zinn und Kupfer. Die wichtigste (und sicher früheste) Rohstofflieferantin lag ja vor der Tür: die Insel Zypern (Kupros), die über das lateinische cuprum noch heute unserem Kupfer den Namen gibt. Die Nachfrage nach solchen wertvollen Metallarbeiten war offensichtlich groß und trieb die Produzenten, wie es scheint, schon früh in die entferntesten Regionen des Mittelmeers hinaus, nach Sizilien, Sardinien, Spanien (Gades ~ Cádiz), aber auch zur Insel Thasos in der Nordägäis, mit ihren Gold- und Silberminen. Beschleunigt wurde diese .Goldsucher-Welle' im gleichen Maße, in dem das ursprüngliche heimatliche Handelsgut, das vielbegehrte Holz der Zedern vom Libanon, allmählich rarer wurde (der Mangel machte sich bereits um 1100 bemerkbar). Aus dieser ersten Phase der Kontakte, die auf Seiten der Phönizier noch nicht durch eine ausgeprägte Handelstätigkeit charakterisiert war, vielmehr durch Produktion von ,Luxusgütern', mögen jene Reminiszenzen in der Epentradition der Griechen stammen, die das Levante-Volk noch ganz in positivem Lichte
Phönizier bei Homer
127
zeigen - als Sidonier (Bewohner der Stadt Sidon, heute Saida, also nicht allgemein Phoiniker): kunstfertig, wohlbegütert, seßhaft und darum auch den Überfällen und Raubzügen anderer ausgesetzt. Bei Homer, der das Endprodukt der alten Epentradition darstellt, erscheinen solche Erinnerungen natürlich nur noch selten und meist vermengt mit den Erfahrungen aus späteren Phönizier-Begegnungen, doch lassen sie sich durch ihren Grundton - Anerkennung fremder Leistung, Stolz auf den Besitz .sidonischer' Erzeugnisse - deutlich von einem späteren Bilde scheiden, das ganz andere, wenig schmeichelhafte Seiten der Phoinikes in den Blickpunkt rückt. Zunächst zwei Stellen aus dem älteren der beiden Epen, der Ilias (etwa um 730 v. Chr. zu datieren); es I sind zugleich die einzigen Erwähnungen Phöniziens 13 in diesem Epos. An der ersten geht es um die Rettung Trojas vor der drohenden Erstürmung durch das Invasionsheer der Achaier: Hektor, der Oberbefehlshaber der trojanischen Truppen, verläßt für kurze Zeit seine verzweifelt kämpfenden Soldaten und eilt in die Burg zurück, um eine Bittprozession der Frauen Trojas zum Tempel der Athene zu veranlassen: in höchster Not kann Hilfe nur noch von den Göttern kommen. Er trifft seine Mutter Hekabe und sagt ihr seinen Wunsch, den sie sofort versteht. Sie weist die Dienerinnen an, die Frauen zu einem Sammelpunkt zu rufen (VI 288-95): „ ... stieg aber selbst hinab ins Schlafgemach, das duftende, wo ihr Gewänder lagen, buntgefärbte, Arbeiten von Frauen, I Sidonischen, die Alexandras selbst, der göttergleiche, von Sidon hergebracht, das weite Meer befahrend, auf eben jener Fahrt, als er die Helena heraufgebracht, die edle. Von diesen Kleidern hob Hekabe eines auf, Athene zum Geschenke, das weitaus schönste von den Farben her und auch das größte, und wie ein Stern schien es heraus (es lag als letztes unter andren)." (Übersetzung hier und im folgenden vom Verf.)
Deutlich wird hier nicht nur die Faszination, die der Grieche (der die Stelle dichtete) ebenso wie jeder andre Fremde (hier die Königin von Troja) beim Betrachten der sidonischen .Spitzenerzeugnisse' empfindet, sondern auch die außerordentliche Begehrtheit dieser Textilien, die dazu führte, daß ausländische Königshöfe (hier vertreten durch den trojanischen Prinzen Alexandros = Paris) sich die Spezialistinnen für solche Arbeit ins eigene Land zu holen suchten (ob durch Anwerbung, Kauf oder Raub, bleibt an unserer Stelle offen). Die Geschichte vom Raub der Helena durch Paris gehört nun zum ältesten Erzählbestand der Trojasage: gut möglich also, daß in der frühen Version, die hier zugrunde liegen muß (weil nur in der frühen Version die Fahrt des Paris von Sparta über Ägypten und von dort hinauf nach Norden ging), auch von einem
14
128
Phönizier bei Homer
Zwischenhalt in Sidon die Rede gewesen war. Aus anderen Quellen wissen wir, daß phönizische Handwerker in der Tat schon sehr früh außerhalb Phöniziens wirkten und ζ. T. für immer ansässig wurden (z.B. auf Euboia und Kreta, offenbar auch in Attika). Nicht auszuschließen also, daß diese Praxis des 10. und 9. Jhs. v. Chr. schon in mykenischer Zeit ihren Ursprung hatte, als die achäischen Zentralpaläste reich genug waren, sich ausländische Spezialhandwerker zu engagieren und zu halten. Die zweite Ilias-Stelle ergänzt das Bild. Da setzt Achilleus bei den Leichenspielen zu Ehren seines gefallenen Freundes Patroklos als Kampfpreis für den Sieger im .Sprint' ein ganz besonderes Wertstück aus (XXIII741-51): „... ein Silber-Mischgefäß, kunstvolle Arbeit, konnte sechs Maß fassen, an Schönheit aber trug's den Sieg davon auf der gesamten Erde bei weitem, denn Sidoner voller Kunstsinn hatten's schön gefertigt. Phoiniker aber hatten's mitgebracht über das dunkle Meer hin und hatten Halt gemacht im Hafen und dem Thoas es als Gastgeschenk gegeben. Doch für den Sohn des Priamos, Lykaon, hatte es als Gegenwert gegeben dem Patroklos, dem Helden, Iasons Sohn Euneos. Und dieses setzte nun Achilleus aus als Kampfpreis, seinem Freund zu Ehren, für den, der schnellster werden sollt' mit seinen hurt'gen Füßen. Dem Zweiten aber setzt' er einen Ochsen aus, groß, feist vom Fette, und dann ein Halb-Talent von Gold: der letzte Preis, den er bestimmte."
Die Bewunderung für die Sidones polydaidaloi, ,die vielkünstlerischen Sidonier', und ihre weltweit konkurrenzlos schönen Metallarbeiten kennen wir bereits. Neu sind zwei andere Punkte: Erstens ist hier eine deutliche Trennung gemacht zwischen Herstellern (den Sidoniem) und Vertreibern (den Phoinikern), und zweitens ist das Wertstück in eine noch fernere Vergangenheit zurückprojiziert als die sidonischen Gewänder der Königin von Troja. Denn Thoas, dem das Prunkstück - mehr wert als ein Mastochse und 25 Pfund Edelmetall - überreicht wird, ist in der Sage König der Insel Lemnos zu jener fernen Zeit, als die Argonauten durch die Dardanellen nach Kolchis fuhren - lange vor dem Trojanischen Krieg - und als Iason, ihr Anführer, Thoas' Tochter Hypsipyle zur Mutter des Euneos machte. Auch hier ist uralte Tradition, die bis auf ein frühes Argonauten-Epos zurückgehen könnte, nicht auszuschließen. Stutzig macht ja schon der Ort der Handlung: die Insel Lemnos in der Nordägäis ist für die Schiffahrt von Süden her unentbehrliche letzte Station auf dem Weg zur 80 km nordwestlich liegenden Silber-Insel Thasos, von deren Bedeutung für die Sidonier schon die Rede war. Ob es da ein Zufall ist, daß als Gastgeschenk für Thoas, den Inselherrn (der die Ankerung erlauben muß), ein Si/ber-Mischkrug figuriert, ist nicht ganz leicht zu glauben. I
Phönizier bei Homer
129
In der Odyssee, die später als die Ilias entstanden ist (um 700 v. Chr.), treffen 16 wir in der Regel auf ein gänzlich anderes Phönizier-Bild; dazu sogleich. Doch ist auch in der Odyssee nicht alles über einen Kamm zu scheren. An zwei, drei Stellen lugt auch hier die alte Hochschätzung, ja Bewunderung hervor - und immer sind es dann auch hier Sidonier, nicht Phoiniker, denen der Respekt gilt. Im 4. Gesang der Odyssee besucht Odysseus' Sohn Telemachos in Sparta Agamemnons Bruder Menelaos, um sich bei ihm nach dem Verbleib seines verschollenen Vaters Odysseus zu erkundigen. Menelaos erzählt ihm, was er weiß, und will ihm zum Abschied drei edle Pferde und einen schönen Wagen (sowie einen Becher) schenken. Telemachos jedoch weist darauf hin, daß Ithaka weder genügend Auslauf noch Nahrung für edle Rosse biete, und erbittet sich statt dieser eine andre Gabe: ein keimelion, eine .Antiquarie' (noch heute sprechen wir von der ,Zimelie', einem Kleinod). Menelaos willigt lächelnd ein (4,612-19): „Nun denn! dann tausch' ich dir das ein - ich kann's ja! Von den Geschenken, die in meinem Hause als Cimelien liegen, geb' ich dir jenes, das das schönste ist und seinem Wert nach höchste: Ich geb' dir einen Mischkrug, schön gefertigt, ist von Silber ganz durch und durch, jedoch der Rand dran ist vergoldet: ein Werk Hephaists! und zugeeignet hat mir's Phaidimos, der edle, der König der Sidonier, als sein Haus mich bergend hüllte, nachdem ich dort auf meinem Rückweg hingekommen war: Dir will ich's nunmehr schenken!"
Wir registrieren, daß das Prachtstück mindestens den Gegenwert von drei edlen Rossen und einem Luxuswagen darstellt (Menelaos kann sein erstes Angebot unmöglich unterbieten) und daß es aus dem Besitze eines Königs - hier des Königs der Sidonier selbst - in den Besitz eines anderen ranghohen Königs, des Bruders Agamemnons, wechselt. Und wieder, wie schon an der ersten Stelle, wird die Kostbarkeit nicht erst am Wohnort des jetzigen Besitzers auf dem Handelsweg erstanden, sondern vom jetzigen Besitzer bei einer Reise in die Levante erworben und als wertvolles Souvenir in die Heimat mitgebracht. An einer zweiten Stelle gehen Sidonier und Phönizier zwar schon durcheinander, doch ein Rest der alten Achtung vor den reichen Könnern aus dem Osten scheint auch hier noch durchzuschimmern: Im 15. Gesang der Odyssee erzählt der treue Schweinehirt Eumaios seinem unerkannten (weil als Bettler verkleideten) Herrn Odysseus seine Biographie. Es stellt sich heraus, daß der Schweinehirt in Wahrheit selbst ein Edler ist, ein Königssohn, der als kleiner Bub von seinem Kindermädchen entführt wurde (ein altes Schema, das sich bis in unsre Femsehserien durchgehalten hat). Dieses Kindermädchen ist nun allerdings nicht irgendwer. Zunächst wird sie als Phoinissa bezeichnet, .Phönizierin'.
130
Phönizier bei Homer
Dann aber, im Verlauf der längeren Geschichte, läßt sie der Dichter selbst zu Worte kommen (15,425-29): „Aus Sidon, erzreich, rühme ich mich herzustammen, die Tochter von Arybas bin ich, dem steinreichen. Doch haben Taphier mich geraubt, die räuberischen Männer, als ich vom Lande heimging, mich hierher verkauft dann, in dieses Mannes Haus - und der gab einen angemeßnen Kaufpreis."
Schon vorher hatte Eumaios die reiche Tochter ganz entsprechend eingeführt (15,417/18): „Es lebte da bei meinem Vater damals ein Phönizierweib im Hause, schön, groß, und wohlvertraut mit glänzend-prächt'gen Werken."
Da ist nicht der geringste Unterschied gemacht zu Dienerinnen aus anderen Völkern, die man sich ins Haus nimmt - zu den sieben Frauen aus Lesbos etwa, die Agamemnon im 9. Gesang der Ilias dem Achilleus als Geschenk anbietet, wenn er seinem Kampfboykott entsage (IX 270-72): „... sieben Frauen, wohlvertraut mit edlen Werken, aus Lesbos stammend ... ... und an Schönheit alle Frauen übertreffend."
Wie wertvoll die Sidonierin hier ist, zeigt der ,angemeßne Kaufpreis', den ein fremder König (nicht ein Bauer etwa) für sie bietet. I 17 Bis hierher also strahlt das Bild, das sich die Griechen von den Leuten unterm Libanon-Gebirge machten, in den hellsten Farben. Und indirekt mag in dieses Bild noch manches andere hineingehören, was auf den ersten Blick keinen Bezug dazu zu haben scheint. Wenn ζ. B. für das uralte Erkennungszeichen zwischen Odysseus und Penelope, das Ehebett, das einst Odysseus selbst aus einem Ölbaumstamme fertigte und mit Gold, Silber und Elfenbein verzierte, im Jahre 1966 eine verblüffend ähnliche Möbel-Parallele aus phönizischer Produktion gefunden wurde, so mag das wiederum die offenbar unbegrenzte Hochschätzung belegen, mit der die frühen epischen Sänger der Griechen auf die handwerklichen Fähigkeiten der Phönizier schauten und die sie dazu brachte, ihren Helden 18 Odysseus, den .Vielgewandten', der alle Handwerkskünste I optimal beherrschen mußte (wie z.B. den wunderbaren Floßbau im 5. Gesang der Odyssee), eine phönizische Möbelfertigungstechnik anwenden zu lassen. In der gleichen Erzählung des Eumaios, die so Rühmliches von der Phönizierin aus Sidon zu berichten weiß, ist freilich auch die dunkle Seite des griechischen Phönizierbildes schon enthalten. Die hochgewachsene, schöne und geschickte Tochter des reichen Mannes aus Sidon entpuppt sich plötzlich als Fremdenliebchen, verschlagene Kidnapperin und schließlich sogar als ganz ge-
Phönizier bei Homer
131
meine Diebin. Das bricht mit einer Wucht herein, die geradezu erschreckend wirkt (15,415-22): „Da kamen einst Phoiniker, diese schiffsberühmten Männer, Halunken, hatten massenweise Tand und Putz im schwarzen Schiffe. Es lebte aber da beim Vater ein Phönizierweib im Hause, schön, groß, und wohlvertraut mit glänzend-prächt' gen Werken. Die also suchten die Phoiniker, meisterhafte Blender, zu verführen. Sie machte Wäsche, da vereinte einer sich zum ersten Mal mit ihr beim Schiffsheck im Liebesspiel - und das betört die Sinne ja gewöhnlich dem zarteren Geschlecht der Frau'n, auch dann, wenn eine gut von Art ist."
Zu allen anderen Vorzügen kam also bei der Sidonierin im Grunde auch noch charakterliche Integrität hinzu („wenn eine gut von Art ist"). Aber der phönizische Verführer packt sie, nachdem er erfahren hat, wer sie ist, bei ihrer Elternund Heimatliebe: Er stellt, als unverbindliches Lockangebot zunächst („mit uns könnt'st du ja jetzt nach Haus zurückgelangen ...")> eine eventuelle Mitnahme in Aussicht. Da läßt sie die Schiffsbesatzung schwören, sie unversehrt nach Haus zu bringen, und nachdem sie diesen Schwur erhalten hat, entwickelt sie einen raffinierten Plan: Keiner der Männer soll sie auf der Straße oder bei der Quelle ansprechen oder gar dem König etwas von der Sache sagen (der würde sie sonst unverzüglich fesseln lassen und den Schiffsleuten Verderben sinnen), dafür aber sollen sie ihre Warentauschgeschäfte beschleunigen, und wenn ihr Schiff gefüllt sei, dann solle man ihr Nachricht geben; sie werde dann alles Gold, das sie gerade ergattern könne, mitbringen, daneben aber I auch noch 19 einen anderen Fährlohn zahlen: sie ziehe nämlich den kleinen Sohn des Königs auf, so einen aufgeweckten kleinen Burschen, mit dem sie auch das Haus verlassen dürfe; den werde sie mitbringen, und der werde den Händlern einen enormen Gewinn eintragen, wenn sie ihn ins Ausland verkauften, zu Leuten andrer Zunge. Die Händler willigen natürlich ein, und alles läuft nach Plan. Nachdem das Schiff mit Waren vollgeladen ist, schicken sie einen „mit allen Wassern gewaschenen" Mann zum Königshof; der lenkt die Königin und ihre Frauen durch eine goldene Kette mit Bemsteinperlen ab und nickt der Sidonierin verstohlen zu. Da geht sie mit dem kleinen Eumaios hinaus. Als sie die Vorhalle durchqueren, wo noch das Tafelgeschirr auf den Tischen steht (der König ging mit seinen Edlen gerade zur Versammlung) (15,469/70), da ließ sie schnell drei Becher in dem Bausch des Kleids verschwinden und trug sie fort. Ich aber folgte ihr in meiner Einfalt."
Sechs Tage lang segeln sie gemeinsam Tag und Nacht dahin, am siebten aber läßt Artemis die Frau tot wie I ein Meerhuhn in den Schiffsraum plumpsen 20
132
Phönizier bei Homer
(offenbar ein göttliches Strafgericht); das Schiff landet schließlich in Ithaka, und Laertes, Odysseus' Vater, kauft den Phöniziern den Eumaios ab. Es ist zwar deutlich, daß die Sidonierin zum Bösen verführt wird (und der Dichter findet zunächst auch Worte der Entschuldigung für sie), dann aber ist sie es, die mit ihrem rundum .ausgereiften' Entführungsplan kriminelle Energie entwickelt und die Sache konsequent - bis zum Abschluß mit gemeinem Diebstahl - durchsteht. Diese ganze Skizze der Entwicklung eines an sich gut veranlagten Menschen zum Bösen ist in Ilias und Odyssee singular. Keiner anderen der vielen Dienstbotenfiguren wird im Homerischen Epos ein derart schäbiges Verhalten zugeschrieben (auch nicht den ungetreuen Mägden des Odysseus, die zwar frech und schamlos sind, jedoch nicht kriminell). Das zeigt, daß der Dichter nur bei einer Phoinissa mit bereitwilliger Zustimmung des Publikums zu seiner ,Sex and Crime-Story' rechnen konnte. In der Geschichte spiegelt sich demnach ein allgemeines Urteil, besser Vorurteil, den Leuten aus Phönizien gegenüber wider: „Jawohl - genau das ist's, was diesen Leuten zuzutrauen ist!" Das gleiche negative Phönizierbild schlägt sich an noch zwei weiteren Odyssee-Stellen nieder. Im 14. Gesang - das ist in der Chronologie der Odysseehandlung einen Abend früher als die eben besprochene Szene - erzählt der als Bettler verkleidete Odysseus dem Schweinehirten Eumaios seine angebliche Lebensgeschichte. Auch da kommt ein Phönizier vor. Bei einem Aufenthalt in Ägypten, bei dem der - damals noch hochgestellte - Bettler auf dem besten Weg gewesen sein will, ein steinreicher Mann zu werden (14,288- bis 91), „... da kam ein Mann an aus Phönizien, der betrügerische Dinge wußte, Halunke der! der hatte schon viel Übles zugefügt den Menschen! Der hat mich schlau beschwatzt und mitgenommen, bis wir kamen nach Phoinike, wo seine Hausbesitzungen und Güter lagen."
Im nächsten Frühjahr nimmt der Phönizier seinen Gast auf einem Schiff nach Libyen (= Afrika) mit, angeblich um ihn an einem gewinnträchtigen Handel zu beteiligen - aber das war nur „Lügenwerk", das er ausgeheckt hatte. In Wahrheit wollte er seinen Gastfreund nämlich - so hören wir - in Libyen verkaufen und dafür einen „riesigen Gewinn" einheimsen. Es kam dann freilich anders. Die Betrüger kamen alle in einem von Zeus gesandten Seesturm um (Strafmotiv!), und nur der Erzähler (= Odysseus) konnte sich retten. Wie tiefverwurzelt das Klischee von den ,phönizischen Betrügern' zur Entstehungszeit dieser Odyssee-Partien bereits ist, zeigt besonders eindrucksvoll eine weitere Stelle aus einer erfundenen Lebensgeschichte des Odysseus, wieder einen Gesang früher. Da ist es Athene, die, in der Gestalt eines jungen Ithakers dem gerade auf Ithaka erwachten Odysseus entgegenkommend, vom übervor-
Phönizier bei Homer
133
sichtigen Odysseus genasführt werden soll. Er erzählt der Göttin in Menschengestalt eine Schauergeschichte, wie er auf Kreta einen Sohn des Königs Idomeneus getötet habe, der ihm seine Trojabeute nehmen wollte, und wie er dann zu einem Schiff im Hafen geflüchtet sei und dessen Besatzung um ,Asyl' gebeten habe (13,272-77): „Da lief ich rasch zu einem Schiff, und die Phoiniker, die erlauchten (!), fleht' ich um Hilfe an, gab ihnen reichlich von der Beute, und hieß sie, mich nach Pylos hinzubringen und an Land zu setzen, oder ins schöne Elis auch, wo die Epeier herrschen. Doch - wirklich wahr! - die hat von dort die Macht des Windes fortgestoßen, ganz wider ihren Willen, und sie wollten mich nicht täuschen!"
Da seien sie denn hierher abgetrieben worden, in tiefer Nacht und bei schwerer See; sie seien entkräftet an Land gegangen und hätten sich erst einmal ausgeruht; er selbst sei dann vor Erschöpfung eingeschlafen (13,283-86), „die aber nahmen meine Schätze aus dem Bauch des Schiffes und legten sie genau dort ab, wo ich im Sande ruhte .... und stachen nach Sidonien dann in See, dem gutbewohnten."
Da muß Athene denn doch lächeln! Sie streichelt ihren Schützling, verwandelt sich aus dem jungen Mann in die Göttin zurück, und es wird kein Zufall sein, daß sie dem Odysseus gerade hier, nach diesem Wundermärchen, das größte Kompliment für seinen Listenlreichtum und für seine Phantasiegeschichten 21 macht, das er in der ganzen Odyssee erhält. Das war denn doch der Gipfel! Die notorischen Gauner aus Phönizien zu Ehrenmännern zu machen, die in dunkler Nacht einem in tiefem Schlafe ruhenden reichen Manne sein Geld gewissermaßen auch noch fürsorglich in die Hosentasche schieben! Tatsächlich - nur Odysseus ist imstande, so unschuldsvoll zu flunkern, daß man ihm selbst das X noch abnimmt, das er aus dem U macht! Es ist wohl nicht mehr nötig, noch weitere Belege vorzuführen. Das Bild ist klar: Die Phoiniker, die in der Odyssee (vor allem in deren zweiter Hälfte) beschrieben werden, sind nicht dieselben mehr wie die, die man in einer älteren Zeit, wie's scheint, Sidonier nannte. Natürlich hat die Forschung sich gefragt, worin der Wandel seinen Ursprung haben könnte. Im neuesten Odyssee-Kommentar (1988) sieht der englische Kommentator J.B. Hainsworth das „antiphönizische Vorurteil" zwar auch rassisch begründet (ein erster Hauch von Antisemitismus ist in der Tat kaum zu verkennen), im wesentlichen aber sozial bedingt: .Fliegende Händler' sind dem seßhaften Bauern - damals wie in späteren Gesellschaften - stets ein Dorn im Auge. Wir wissen, daß der (die) Dichter von Ilias und Odyssee dem Adel - das sind zu jener Zeit die Großbauern und Landbesitzer - sehr nahe stand(en), vielleicht sogar selbst dieser Oberschicht ent-
134
Phönizier bei Homer
stammte(n). In diesen Kreisen ist die Antipathie gegen die .Händlerseelen' (ζ. B. auch Odyssee 8,159-64) noch bis weit in die klassische Zeit hinein lebendig geblieben. Die Schärfe der Verwerfung fällt in den Odyssee-Partien dennoch auf. So wird ζ. B. das griechische Wort, das wir hier mit .Halunken' wiedergegeben haben, in der ganzen Homerischen Epik mit ihren annähernd 28000 Versen nur auf die Phönizier angewandt - und bedeutet möglicherweise etwas noch viel Verächtlicheres, da es von einem Wortstamm abgeleitet ist, der ,nagen' oder .knabbern' bedeutet. Ein solches Maß von Angewidertheit ist zu einer Zeit, als die Griechen selbst in großem Stil Seehandel trieben und den Markt im Mittelmeergebiet sogar beherrschten - also seit etwa 700 v. Chr. - kaum noch denkbar. Das schlimme Bild des betrügerischen, profitsüchtigen und raffgierigen, trick- und fintenreichen Phöniziers, der alles an- und verkauft, was ihm unter die Hände kommt - auch Menschen - , wird also wohl schon vorher, d.h. in der Hauptsache im 8 Jh. v. Chr. entstanden und dann für zwei, drei Generationen zum Klischee geworden sein. Wie alle solche Fremdvölkerbilder wird es wohl nicht völlig ohne Grundlage in der Realität gewesen sein. Wie alle solche Bilder wird es aber auch jener Eigentümlichkeit menschlicher Selbstsucht seine Schärfe und Überzogenheit verdanken, der wir in der Geschichte der Völker so oft begegnen: Gerade von denen, denen man im Praktischen am meisten schuldet (Handwerk und Handel, Maße und Gewichte, Rechnungswesen und Schriftgebrauch, Weitläufigkeit und Pragmatismus), setzt man sich gern am rigorosesten ab. So werden wir das Bild, das uns Homer von den Phöniziern seiner Zeit vermittelt, eher mit Nachsicht registrieren. Im Lichte dessen, was die Phönizier gerade jener Zeit Europa brachten - und was zu präsentieren erklärtes Ziel dieser Ausstellung ist - , bleibt das bösartige Phönizierbild der Griechen, wie es sich bei Homer besonders in der Odyssee-Erzählung spiegelt, eine Episode.
Phönizier bei Homer
135
Bibliographie Buchholz, H.-G. (1988), Der Metallhandel des zweiten Jahrtausends im Mittelmeerraum, in: M. Heltzer/E. Lipinski (Hrsg.), Society and Economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500-1800 Β. C.), 187 ff. Burkert, W. (1984), Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie 1984/1. Coldstream, J. Ν. (1982), Greeks and Phoenicians in the Aegean, in: H. G. Niemeyer (Hrsg.), Phönizier im Westen. Die Beiträge des Internationalen Symposions über ,Die Phönizische Expansion im westlichen Mittelmeerraum' in Köln vom 24. bis 27. April 1979, Madrider Beiträge Bd. 8. Latacz, J. (1989): Homer. Der erste Dichter des Abendlands. Muhly, J. D. (1970): Homer and the Phoenicians. - Berytus 19,19 ff. Niemeyer, H. G. (1984), Die Phönizier und die Mittelmeerwelt im Zeitalter Homers, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 31, 3 ff. Röllig, W. (1982), Die Phönizier des Mutterlandes zur Zeit der Kolonisierung, in: H. G. Niemeyer (Hrsg.), Phönizier im Westen (s. oben unter Coldstream). Wathelet, P. (1974), Les Phéniciens dans la composition formulaire de l'épopée grecque, Revue Belge de Philologie 52, 5 ff.
253
Colloquium Rauricum, Band 2: Zweihundert Jahre Homer-Forschung, Stuttgart und Leipzig 1991, 381^114
Die Erforschung der Ilias-Struktur Gliederung 1. Zum Begriff .Struktur' 2. Allgemeine Rahmenbedingungen für eine Erforschung der Ilias-Struktur 3. Hauptstationen der Diasstruktur-Erforschung (a) Antike und Mittelalter bis Eustathios (um 1150) (b) Mittelalter, Renaissance, Neuzeit bis F.A. Wolf (c) Von Heyne/Wolf bis Wilamowitz/Schadewaldt (d) Von Wilamowitz/Schadewaldt bis zur Gegenwart
1. Zum Begriff .Struktur' Bevor die Problemgeschichte skizziert werden kann, ist zu sichern, daß die Problemstellung in der Sache begründet ist und die Forschung nicht einem Phantom nachjagt. Zu fragen ist also, ob und inwieweit .Struktur' überhaupt eine Kategorie des homerischen Epos selbst ist. In der neuzeitlichen Homerphilologie spielt der Begriff der Struktur von Anfang an eine entscheidende Rolle. Nachdem F. A. Wolf die Argumentation in den zentralen Kapiteln 26-31 seiner .Prolegomena' ausdrücklich auf ihn gegründet hatte (s. unten S. 160 ff.) - neben sinnverwandten Ausdrücken verwendete er dabei mehrfach explizit das Wort structura1 - , ist der Begriff zu einer der Grundkategorien der literaturwissenschaftlichen Homer-Interpretation geworden und bis heute geblieben. In der antiken Homerphilologie seit den Alexandrinern hat der Strukturbegriff dagegen niemals eine vergleichbare Rolle gespielt. Der Grund ist, daß dort die souveräne Strukturanalyse des Aristoteles, die ja auch uns noch in den Bann zieht, als abschließende Problem-Aufarbeitung und Auflösung der bibliogr. Abkürzungen unten S. 173 f. 1 Cap. XXX init.: artificium structurae et compositions Carminum Homericorum; cap. XXXI init.: hanc artem et structurant [Carminum Homericorum],
138
Die Erforschung der Dias-Struktur
-Lösung empfunden wurde und Zweifel an der Wohlstrukturiertheit von Ilias und Odyssee infolgedessen in aller Regel gar nicht aufkamen.2 I 382 In der .Poetik' hat Aristoteles .Struktur' hauptsächlich mittels der griechischen Wörter σύστασις und σύνθεσις 3 ausgedrückt, häufig in Kombination mit dem Genitiv-Attribut των πραγμάτων (.die Zusammenfügimg der Handlungseinheiten'), verbal auch in der Form συνιστάναι oder συντιθέναι τά μέρη (του ένός και ολου). Die Verwendung dieser Bild-Ebene des .Setzens', .Zusammensetzens' war damals durchaus nicht neu. Sie war seit langem vorbereitet durch dichtungstheoretische Reflexionen der Dichter selbst, die wir allerdings nur noch in Reflexen über die Dramatiker (vor allem Aristophanes) und über Pindar4 bis zu Alkaios zurückverfolgen können: Zum Begriff θέσις, der in unserem Alkaios-Fragment 204,6 V. erscheint, merkt jedenfalls das Etymologicum Magnum an: θέσις, ή ποίησις, παρά 'Αλκαίω.5 Neben dieser in allen Sprachen naheliegenden Metapher aus dem Bereich des handwerklichen Fertigens - speziell des Mauerns, Bauens, Zimmerns (struere, construere, structio, constructio, structura; τιθέναι, συντιθέναι, ίστάναι, συνιστάναι, πυργοΰν, όρθοΰν, ίδρύσασθαι, άραρίσκειν, άρμόζειν, τεκταίνεσθαι; fugen, bauen, auftauen, Aufbau, Bauformen usw.) - steht im Griechischen (ähnlich im Lateinischen, z.B. lucidus ordo Hör. a.p. 41: .durchsichtige Anord2 Aristoteles' erhaltene Schrift Περί ποιητκής hat zwar zusammen mit den anderen sog. akroamatischen Schriften bis zur Publikation im 1. Jh. v. Chr. „in Archiven geruht" (Fuhrmann 1986, 145), auf die einzigartige Nachwirkung der Aristotelischen Dichtungstheorie als solcher hatte das allerdings kaum einen Einfluß: Zum einen wird die Theorie in den (für uns verlorenen) exoterischen Schriften einen Niederschlag gefunden haben (darauf verweist die erhaltene Schrift selbst: Kap. 15), zum anderen hat die peripatetische Schultradition die Lehre mündlich und schriftlich weitergetragen (Theophrast, Neoptolemos u. a., s. Koster, Epostheorien 85-123); das erhaltene Vorlesungsmanuskript (s. unten S. 148 f.) ist nur ein (für uns unschätzbarer) Reflex der durch ihre Erklärungsstärke zweifellos von Anfang an außergewöhnlich wirkungsmächtigen Theorie; vgl. Koster, Epostheorien 160: „Wie kein anderer hat er die poetische Technik der epischen Dichtung analysiert." Vorstufen hat es natürlich gegeben (abgesehen von Piaton greifen wir einen Rest z. B. bei Protagoras VS 80 A 30, dazu Koster, Epostheorien 22 Anm. 1; Nickau 1966, 159), aber an Systematik ist wohl nicht zu denken. Zur nacharistotelischen Zeit s. unten S. 155. 3 Kap. 5.8.26 usw. „Spricht Aristoteles [...] von σύστασις, meint er [...] die Komposition, ordnende Gestaltung des Dichters": Koster, Epostheorien 54; es „läßt sich kein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Bezeichnungen [σύνθεσις und σύστασις] feststellen": Koster a. O. Beide Termini können sowohl .Struktur' als auch .Strukturierung' bedeuten. 4 Maehler 1963 passim; Material auch bei D. Müller, Handwerk und Sprache, Meisenheim 1974, vor allem im Kapitel .Das Bauwesen', S. 79 ff. ^ Näheres zu θέσις/θειναι als poetologischen Termini bei Gentiii 1989, 87 ff. (.Poetica della Mimesi').
Die Erforschung der Dias-Struktur
139
nung') seit altersher eine Übertragung aus dem Bereich des Militärischen: es handelt sich um die Begriffsfamilie κόσμος, κοσμεί ν. Obwohl die mit diesen Wörtern ausgedrückte spezielle Begrifflichkeit für das Selbstverständnis Homers als Dichters von Großstrukturen eine entscheidende Rolle spielt, ist sie bisher in der Forschung kaum ausgewertet worden. Das Versäumte soll im folgenden nachgeholt werden. Dazu ist ein etwas längerer Anlauf nötig. Solon hat um 600 die Kampfparänese in Distichen, die er, wie Plutarch berichtet, heimlich zu Hause verfertigt hatte, als einen κόσμος έπέων6 bezeichnet (den er anstelle eines Prosa-Appells - άντ' άγορής - .gesetzt' - θέμενος habe): Fr. 2.2G.-P. Was soll κόσμος hier bedeuten? .Schmuck' (der Worte) ist unmöglich, da I κόσμος έπέων hier die ganze Elegie (die 100 Verse umfassende 383 ,Salamis-Elegie') meint, also ein ganzes Werk. Offenbar hat also κόσμος hier schon die gleiche oder doch eine ganz ähnliche Bedeutung wie unser heutiges Wort .Kosmos;' also κόσμος έπέων ~ .ein Kosmos von (oder: aus) Worten'. Wie ist das genau gemeint? Die Erklärer der Solon-Stelle bringen meist Parallelen bei, die wenig oder nichts erhellen. Unausgewertet bleibt dagegen eine überaus erhellende Stelle aus der Odyssee. Es ist die Stelle θ 492. Dort bittet am Phaiakenhof Odysseus den Demodokos: άλλ' αγε δή μετάβηθι και 'ίππου κόσμον αεισον δουρατέου, τον Έπειός έποίησεν συν Άθηνη ... Aber wohlan nun! steig um (= wechsle das Thema) und singe den Kosmos des Pferdes, des Pferdes aus Holz, das Epeios gefertigt mit Hilfe Athenes!
Üblicherweise wird κόσμος hier als ,Bau' aufgefaßt. Jula Kerschensteiner hat sich in ihrer Spezialuntersuchung zu κόσμος, wenn auch mit Bedenken, für ,aus Balken gefügter Bau des hölzernen Pferdes' entschieden (Kerschensteiner, Kosmos 8). Hains worth im neuesten Odyssee-Kommentar führt nur die Scholien-Angaben zur Stelle an (την κατασκευήν, ή την οίκονομίαν, ή την ύπόθεσιν), trifft aber unter ihnen keine Entscheidung (Privitera übersetzt in der gleichen Ausgabe mit ,il progetto'). ,Bau' in diesem Sinne ist aber ausgeschlossen: Demodokos singt auf Odysseus' Aufforderung hin ja gerade nicht vom ,aus Balken gefügten Bau des hölzernen Pferdes'. Das wäre eine technische Beschreibung (Material, Werkzeuge, Verfahren), die der des Floßbaus in ε 228-
6 Zum Weiterleben dieser Metapher (Parmenides, Demokrit u. a.) s. Kerschensteiner, Kosmos 6 - 1 0 („das tektonische Gefüge des Gesanges"); Koster, Epostheorien 24—28 („schöne Bauordnung der Verse"; „Homer ist für Demokrit der inspirierte Dichter, der seinen Stoff, wie ein Architekt, als schöne Ordnung mannigfacher Verse gestaltet hat").
140
Die Erforschung der Dias-Struktur
262 gleichen müßte. Für Technik-Schilderungen hat aber Odysseus in der gegebenen Situation weder Sinn noch Zeit: er möchte ja durch die Bestellung des Themas .Hölzernes Pferd' die Rühmung des größten je von ihm errungenen Erfolgs, nicht etwa die seiner handwerklichen Fähigkeiten evozieren („he desires to hear of his greatest exploit": Hainsworth, Odyssey z. St., nach Mattes, Odysseus 112; daß im übrigen das Handwerkliche gar nicht seine Leistung war, wird durch die eigens zugesetzte Hersteller-Angabe τον Έπειός έποίησεν συν Άθήνη klargestellt; das Lied soll also offensichtlich erst jenseits der Bauphase einsetzen). Wovon Demodokos in Erfüllung des Odysseus-Wunsches wirklich singt, ist etwas anderes: (1) die Inbrandsetzung der eigenen Lagerhütten durch die Achaier, (2) ihre Einschiffung, (3) die gleichzeitige gespannte Lauerstellung der Odysseus-Leute im Bauch des Pferdes, das schon in Troia auf der άγορή steht, (4) die Beratung der Troer, was mit dem Pferd anzufangen sei, (5) ihre verhängnisvolle, aber schicksalsgewollte Entscheidung, das Pferd als Weihegabe aufzunehmen, (6) das Herausströmen der Achaier aus dem Pferd, (7) der Verlauf des Straßenkampfs in Troia und der Sieg der Achaier, (8) der Sieg gerade des Odysseus, zusammen mit Menelaos, am Hause des Deiphobos. Das also ist der'ίππου κόσμος δουρατέου, den Odysseus erbeten hatte und der allein dann auch nur Grund für die Erschütterung des Odysseus sein kann, die der I 384 Dichter herbeiführen muß, um Odysseus sein bisher gewahrtes Schweigen brechen lassen zu können und ihn dazu zu bringen - unter ausdrücklichem Hinweis auf die Wirkung dieses soeben gehörten Demodokos-Liedes (άοιδοΰ / τοιοΰδ', οιος οδ' έστί, θεοις έναλίγκιος αΰδήν, ι 3 f.) - seine Geschichte zu erzählen (είμ' Όδυσεύς, ι 19). Wenn aber somit der Ausdruck 'ίππου δουρατέου κόσμον άείδειν hier nicht die Besingung des Fertigungsprozesses meinen kann, muß er eine Kurzform für 'ίππου δουρατέου άοιδής κόσμον άείδειν 7 sein, ,den Liedkosmos vom hölzernen Pferd singen'. Nach anderen hatte auch Frau Kerschensteiner diese Bedeutung zwar erwogen („die geordnete [oder ausgeschmückte] Erzählung vom hölzernen Pferd": 8 Anm. 1), dann aber wegen der Singularität einer solchen Spezialverwendung von κόσμος wieder verworfen. Schadewaldt hatte dieses Bedenken nicht gehabt und schon vier Jahre vorher lapidar mit, singe das Lied von dem hölzernen Pferde' übersetzt.8
7
Zu dem Ausdruck κοσμειν άοιδήν, „einen κόσμος άοιδής schaffen", s. Kerschensteiner, Kosmos 10. 8 Schadewaldt 1958.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
141
Daß nur dies die richtige Auffassung sein kann, liegt auf der Hand. Die monierte Singularität des Wortgebrauchs ist aus dem Zusammenhang psychologisch zu erklären: Demodokos hatte nach dem Mittagessen zunächst die οίμη von Beginn (Θ 74-82) und Verlauf (Θ 90/91) des πημα (θ 81) ,Troianischer Krieg' gesungen. Jetzt, nach dem Abendessen, nachdem Odysseus bei den Sportwettspielen wieder Zutrauen zu sich selbst gefaßt hat, möchte er, daß nicht vom πημα bzw. οιτος (θ 489) der Achaier mehr die Rede ist, sondern von ihrem Sieg und speziell von seiner eigenen νίκη (θ 520). Seinen Wunsch nach dem Themawechsel leitet er gebührlich ein mit einem Sängerlob (Θ 487-491): ,Λημόδοκ', έξοχα δή σε βροτών αίνίζομ' άπάντων ή σέ γε Μοΰσ' έδίδαξε, Διός πάϊς, ή σέ γ' 'Απόλλων λίην γαρ κατά κόσμον 'Αχαιών οιτον άείδεις, οσσ' ερξαν τ' έπαθόν τε και οσσ' έμόγησαν 'Αχαιοί, ώς τέ που ή αύτός παρεών ή άλλου άκούσας." Die Hauptbetonung in diesem Lob liegt auf κατά κόσμον - das hier, singulär in beiden Epen, noch durch ein λίην gesteigert wird: ,ganz außergewöhnlich κατά κόσμον! ' Was den Odysseus am Liede des Demodokos am meisten beeindruckt hat, war also der κόσμος dieses Lieds. So ist es ganz natürlich, daß sich ihm bei der unmittelbar ans Lob sich anschließenden Formulierung seines Themawechsel-Wunsches als primäres Wunschziel der gleiche Ausdruck aufdrängt: άλλ' άγε δή μετάβηθι καί ϊ π π ο υ κόσμον άεισον! „Aber nun wechsle das Thema und singe den Kosmos des P f e r d e s ! Die zweite κόσμος-Verwendung (492) muß also hier dasselbe meinen wie die erste (489). Was ist das genau? I κόσμος bezeichnet ein Qualitätsmerkmal, das seinen ursprünglichen Ort innerhalb der Adelsgesellschaft im militärischen Bereich hat. Schon J. Kerschensteiner hatte nach Sichtung sämtlicher Belege für κόσμος, (δια)κοσμεΐν, die militärische Rangbezeichnung κοσμήτωρ usw. eine so klare Dominanz der militärischen Gebrauchsweise festgestellt, daß sie fragte „Ist etwa dieser militärische Gebrauch der ursprüngliche?" (6). Zumindest für die Beziehung , κόσμος im Bereich des Militärischen: κόσμος im Bereich der Sängerkunst' ist diese Frage zu bejahen. Eine Übertragung in umgekehrter Richtung ist undenkbar. Die militärischen Belegstellen zeigen nun aber fast stets eine enge Zusammengehörigkeit von κόσμος (samt seinen Ableitungen) mit Zahlbestimmungen (κοσμειν ές δεκάδας [Αχαιούς]: Β126; κοσμειν τρίχα ['Ροδίους]: Β 655; κοσμειν πένταχα [άνδρας]: Μ 85; κοσμειν τριστοιχί [εντεα]: Κ 471, usw.): Die Zahlbestimmungen geben die Zusammenordnung und Gruppierung von zunächst unüberschaubar vielen Einzelteilen eines Ganzen zu überschaubaren .Portionen'
142
Die Erforschung der Ilias-Struktur
an. Was durch solche Gliederung erreicht wird, ist κόσμος: .Ordnung', .Geordnetheit'. Dieser Zustand wird als schön empfunden; die κοσμηταί πρασιαί, .ordentlich gereihten (sozusagen in Reih und Glied stehenden) Beete' in Alkinoos' Garten werden von Odysseus staunend bewundert, θηειτο η 133: es ist eine „geregelte Anordnung im Sinne einer Reihung" (Kerschensteiner, Kosmos 6), die den ästhetischen Sinn befriedigt; aus diesem Zusammenfall von Zustand und Effekt entwickelt sich für κόσμος ganz natürlich die Sekundärbedeutung .Zierde', ,Schmuck': „geregelte - und das heißt schöne - Anordnung, Ausstattung" (Kerschensteiner, Kosmos 7). κοσμείν bedeutet also .ungeordnete Massen/Mengen in überschaubare (und damit praktikable) und dadurch den ästhetischen Sinn befriedigende Einheiten gliedern und auf diese Weise zu einer Ordnung formen'. Hier liegt die Verbindungsstelle zwischen militärischem und .poetologischem' Gebrauch. Was Demodokos in seinem ersten Liede λίην κατά κόσμον gesungen hatte, das war der οιτος der Achaier vor Troia, sozusagen ihr .Leidensweg' (so wie auch der νόστος 'Αχαιών von Troia her, von dem in α 326 Phemios singt, als Δαναών κακός οιτος bezeichnet wird, α 350). In welcher Weise Demodokos diesen .Leidensweg' gesungen hatte, beschreibt Odysseus so (Θ 490): οσσ' έρξαν τ' επαθόν τε καί οσσ' έμόγησαν 'Αχαιοί. Das doppelte οσσα betont die Menge der Taten, Leiden, Mühen. Es geht Odysseus offensichtlich nicht um Aufschmückung, sondern um Anzahl, Reihenfolge. Anordnung der Einzelteile dieser Menge. Entsprechend bittet er auch für das jetzt von ihm gewünschte Hölzeme-Pferd-Lied um „κατά μοιραν καταλέγειν" (θ 496), also um die geordnete Erzählung nach Art des .Katalogs'. 9 In beiden Fällen, beim οιτος- wie beim ϊππος-Lied, bedeutet die am Lied gelobte Qualität, sein κόσμος, nicht „kunstvolle Ausschmückung des Liedes" (Kerschensteiner, 386 Kosmos 10), um I die es gerade dem Odysseus ja auch sonst nicht geht (im .Intermezzo', λ 367, lobt Alkinoos Odysseus' eigene Erzählung gerade dafür, daß Odysseus sie so erzählt habe - κατέλεξας - ώς οτ' αοιδός έ π ι σ τ α μ έ ν ω ς , und zwar als Darstellung der κήδεα λυγρά π ά ν τ ω ν Άργείων σέο τ' αύτοΰ), sondern die gelobte Qualität ist .Ordnung' im Sinne von .sinnvoller, zweckmäßig hergestellter Geordnetheit'. 10 9
Zu καταλέγειν, κατάλογος usw. als .poetologischen' Termini s. Krischer 1971 passim. Hainsworth, Odissea (englisch) z. St.: „the allusion is obviously to a well-known story"; ders. zu 489: „In an oral tradition the sequence of themes that identifies a song is easily disordered" usw., mit Verweis auf das gleiche Kriterium bei modernen serbokroatischen Sängern. 10
Die Erforschung der Dias-Struktur
143
Daß beim Sängerkunstwerk so viel Wert auf Geordnetheit gelegt wird, ist nichts, was aus dem allgemeinen Rahmen des Wertekanons der homerischen Gesellschaft herausfiele. Das besondere Interesse der homerischen Dichtung am Ordnen, Reihen, Schichten, Fertigen, Errichten, Bauen ist bekannt. Es zeigt sich überall, wo Mehrteiliges beschrieben wird, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich (Schiffe am Strand, Zelte in der Bucht, Heeresformationen auf dem Schlachtfeld; architektonische Gebilde vom rohen Mauerwerk über Häuser, Gebäudekomplexe und Palastanlagen bis hin zu ganzen Siedlungen; Handwerksund Gewerbeprodukte wie Geräte, Werkzeuge, Transportmittel - Wagen, Schiffe - , Schmuckstücke, Kunstgegenstände usw.). Die Bewunderung für das ,gut Gemachte' (εύποίητος, εύτυκτος, εύεργής, τετυγμένος), ,gut Gebaute' (έΰδμητος), ,gut Gefügte' (ευ άραρυιαι) ist überall präsent. Ihren intensivsten Ausdruck findet sie in der Schildbeschreibung. Auch hier aber richtet sich die Bewunderung weniger auf das fertige Produkt (damit ist der Dichter relativ schnell fertig: Τ 14-18) als auf die Produktion als solche, den Fertigungsprozeß, die Machart. Die einzelnen Arbeitsgänge und Produktteile werden in ihrer Funktionalität für das durch die Kombination von Zweckmäßigkeit und Schönheit ausgezeichnete Produkt bewundernd sprachlich nachvollzogen (wie kunstvoll dabei die epische Sprache die Gegliedertheit des manuell gefertigten Produkts als imaginatives Bild zu evozieren vermag, das hat die Interpretation der Schildbeschreibung seit Lessing immer deutlicher gemacht11); als auffälligstes Qualitätsmerkmal des erdichteten Schild-Panoramas, das „das Ganze der Menschenwelt erscheinen läßt" 12 , hat sich in den Analysen immer wieder dessen zweckvoll auf Universalität zielende Geordnetheit herausgestellt.13 Eine Dichtung, die ein derart durchgängiges Interesse an der wohlgeordnet zweckmäßigen Darstellung der wohlgeordneten Zweckmäßigkeit komplexer Organisations- und Werkprodukte hat, kann das komplexe Werkprodukt der eigenen Tätigkeit, das Wortkunstwerk, unmöglich nicht dem gleichen Anspruch unterwerfen. Daß sie das in der Tat nicht tut, machen auf indirekte Weise jene I Stellen klar, an denen sie den Schöpfer des , Material'kunstwerks mit dem des 387 Wortkunstwerks auf eine Stufe stellt. Als die umfassendste und erhellendste dieser Parallelisierungen ist wiederum die Schildbeschreibung zu benennen: Der Schöpfer des Schildes und der Schöpfer des epischen Gedichts, „der göttliche Schmied und der Dichter, [stehen] eng nebeneinander, so eng, daß sie fast inein11
Siehe den Abschnitt Β Π in: Latacz, Dichtung (,Die Schildbeschreibung'). Marg 1971,38. 13 M a r g 1971, 31. 34 u. ö. 12
144
Die Erforschung der Eias-Struktur
ander übergehen. Einer spricht, schafft für den andern", „Hephaistos vertritt den Künstler und auch den Dichter". 14 Auf indirekte Art verweisen also Ilias und Odyssee tatsächlich unentwegt auf das, „was Dichtung zu Dichtung macht". 15 Wenn das frühe Epos in der Enthüllung seines Kunstprogramms nicht weiter ginge als bis zu dieser indirekten Selbstdarstellung, bliebe es durchaus im Rahmen dessen, was erwartbar ist; daß Dichtung ihre eigenen Normen expliziert, ist schließlich keine ihrer Seinsbedingungen. Tatsächlich aber geht das homerische Epos noch einen Schritt weiter (und verrät auf diese Weise den hohen Grad seiner künstlerischen Reflektiertheit): Der Dichter spiegelt Produktion und Rezeption der eigenen Kunst in Form von kleinen Epos-Darbietungen in sein großes Epos ein. So kann er die Qualitätskriterien seiner Kunst dann doch noch unverhüllt benennen.16 κόσμος ist offensichtlich eines der bedeutsamsten davon, κατά κόσμον άείδενν - das bedeutet, einen aus zunächst unüberschaubar vielen Einzelteilen bestehenden Erzählkomplex - wie den οίτος Αχαιών insgesamt (θ 489) oder den 'ίππος δουράτεος (θ 492 f.) als einen Teil davon zu einem überschaubaren, zweckmäßig angeordneten und ästhetisch befriedigenden Sinnzusammenhang - einem Kosmos eben - zu formen. Den Begriffen κόσμος und κοσμεί ν liegt damit in der immanenten Poetik des homerischen Epos letztlich dieselbe Vorstellung zugrunde wie unseren Begriffen .Struktur' und .strukturieren'. Wenn wir also von der Struktur der Ilias sprechen, muten wir der Ilias nichts zu, was ihr nicht eigen wäre. Wir messen dann das Werk vielmehr an einem jener Kunstkriterien, an denen es bereits sein Schöpfer maß. Damit ist freilich nur gesichert, daß Struktur im homerischen Epos bewußt erstrebt wird, nicht, wie sie in den Großepen Ilias und Odyssee verwirklicht ist. Aus den ,Puppen in der Puppe' läßt sich das gerade nicht ersehen. Denn ob sie kleiner oder größer sind - sie haben stets nur Teil-Charakter. Selbst wenn die Referate des οΐτος 'Αχαιών- und des 'ίππος δουράτεος-Lieds (die ja im übrigen nur Skizzen sind) weit umfangreicher und detaillierter wären, könnten sie unmöglich erkennen lassen, was κόσμος, Struktur, für den Dichter von Ilias und Odyssee bedeutete. Nur .richtige' Reihenfolge, Vollständigkeit (also keine Auslassung von Wesentlichem, kein Zusatz von Wesensfremdem), ästhetisch ansprechende Gliederung, zweckmäßige Anordnung konnte es wohl schwerlich sein. Auch das zwar wäre schon nicht wenig, wenn man den abgrundtiefen 388 Hohn bedenkt, mit I dem jahrzehntelang ein jeder überschüttet wurde, der Phä14
M a r g 1971,43. Marg 1971,8. 16 Dazu Latacz, Homer 40-42. 110 f. 15
Die Erforschung der Dias-Struktur
145
nomene dieser Art in unsrer Ilias und Odyssee tatsächlich wahrzunehmen glaubte. Doch alles konnte das nicht sein. Zu welchem Anspruch κόσμος für den Dichter eines Großepos sich weiten mußte, das konnte nur beim Dichten eines Großepos zutage treten. Da wuchs dann mit dem Werk notwendig der Begriff. An dieser Stelle also ist die Forschung wieder auf die beiden Epen selbst zurückverwiesen. 2. Allgemeine Rahmenbedingungen für eine Erforschung der Ilias-Struktur Voraussetzung für das Vorhandensein von Struktur ist, daß jemand strukturiert hat. Wo bestritten wird, daß jemand strukturiert hat, kann ein Werk nicht als strukturierte Einheit gelten, sondern nur als Agglomerat oder Konglomerat. Strukturforschung an Werken dieses Werkcharakters wäre sinnlos, weil sie Nichtvorhandenes erfinden und dann die eigene Erfindung untersuchen müßte. Konsequenterweise hat die Analyse Strukturforschung nicht selbst betrieben und ihren Gegnern, die Struktur zu sehen und auch für andere sichtbar machen zu müssen glaubten, Schimärenforschung vorgeworfen. Die Analyse als methodische Richtung der Homerphilologie fällt also für eine .positive' (d. h. Erkenntnisse über die Beschaffenheit der als vorhanden vorausgesetzten Struktur erstrebende) Strukturforschung aus. Aber auch wo das Vorhandensein von Struktur als selbstverständlich gilt, weil nicht bestritten wird, daß jemand strukturiert hat, findet .positive' Strukturforschung nicht statt. Damit fallen auch Antike und frühe Neuzeit aus. Der Fall Aristoteles ist eine nur scheinbare Ausnahme: Aristoteles geht es primär nicht um die Erforschung der Ilias- (und 0£fyiiee-)Struktur, sondern - im Rahmen eines Gattungsvergleichs (Epos: Drama) - um die Erfassung der Struktur von Epos überhaupt. Er kann daher nicht eigentlich als Archeget der Iliasstruktur-Erforschung gelten, sondern eher als Archeget literarischer Strukturforschung allgemein (wie sie sich in der modernen Bauformen- und Erzählforschung fortsetzt). Warum Aristoteles' Epos-Analyse dennoch den Ausgangspunkt jeder Iliasstruktur-Erforschung bildet, wird weiter unten zu zeigen sein. .Positive' Iliasstruktur-Erforschung konnte infolgedessen erst entstehen als Antwort auf die Leugnung einer Iliasstruktur. Diese Leugnung kündigt sich an (sie wird durchaus noch nicht, wie oft unterstellt, mit Entschiedenheit vollzogen; s. dazu unten) bei Friedrich August Wolf. In Wolfs Gefolge (Hermann, Lachmann usw.) wird die Leugnung systematisch ausgebaut zum Theorem. In der Abwehr dieses Theorems durch den sog. Unitarismus (die .Einheitshirten') kommt es allerdings lange Zeit noch immer nicht zur Ausbildung einer .positi-
146
Die Erforschung der Dias-Struktur
ven' Iliasstmktur-Erforschung, da die Unitarier jahrzehntelang auf die Analytiker vorzugsweise nur re-agieren und sich damit den Gang der Debatte vorschreiben lassen. Da diese Debatte entsprechend der Grundvoraussetzung der 389 Analyse (Leugnung einer I Iliasstruktur) partikularistischen Charakter hat, hält sie auch die Unitarier zunächst vom Blick aufs Ganze eher ab. Wo sich ein Unitarier zum Blick aufs Ganze aufschwingt - Ansätze dazu finden sich naturgemäß vom allerersten Anfang der Analyse-Abwehr an, Nachweise sind überflüssig - , verwickelt er sich regelmäßig schon nach kurzem Aufflug wieder ins Geplänkel der analytischen Hindernisbeseitigung. Die Überwindung dieser Eingebundenheit in das Kleinklein einer vom Gegner vorgegebenen Apologetik und der Durchbruch zu einer weitgehend freien Unabhängigkeit des neuen Blicks aufs Ganze finden - nach dem Auftreten einzelner Vorboten - mit unterschiedlicher Zwecksetzung, aber in gleicher Sichtweise erst bei Ulrich v. WilamowitzMoellendorff (1916) und Wolfgang Schadewaldt (1938) statt (dazu weiter unten). Die Analyse hatte ,positive' Strukturforschung nicht betreiben können, weil sie nicht das Sein des Werks erklären wollte, sondern sein Werden. Der Unitarismus hatte .positive' Strukturforschung so lange nicht betreiben können, wie er sich auf die Analyse einließ. Als Schadewaldt den Unitarismus 1938 durch Setzung eines eigenen, autonomen Zieles aus der Bindung an die Analyse befreit und einer .positiven' Iliasstruktur-Erforschung den Weg gewiesen hatte (die „charakteristische Erzähl- und Bauweise des Gedichts [verfolgen]": Iliasstudien, p. IV), schoben sich zunächst zwei andere Forschungsrichtungen in den Vordergrund, die zwar im Unterschied zur Analyse die Ilias durchaus als strukturierte Einheit anerkannten, jedoch ihr Ziel so wie die Analyse primär in der Rekonstruktion des Werdens dieser Einheit sahen: die Neo-Analyse (nach Mulders Vorgang Pestalozzi, Kakridis und andere, s. den Beitrag von Wolfgang Kulimann u. S. 425 ff. [hier nicht abgedruckt]) und die Oral poetry-Forschung (Milman Parry und seine Schule, s. den Beitrag von James P. Holoka u. S. 456 ff. [hier nicht abgedruckt]). Die Iliasstruktur-Erforschung war damit für weitere rund vier Jahrzehnte (bis etwa 1980) ins zweite Glied verwiesen (über ihre Weiterfuhrung durch Heubeck, Reinhardt und andere s. unten S. 171 f.). Dieser Verlauf der Forschungsgeschichte erklärt, warum auch theoretisch im Bereich der Struktur-Erforschung bisher nur wenig geleistet ist. Eine Sammlung einschlägiger Bemerkungen aus dem Munde derer, die seit Schadewaldt und meistens auf den Spuren Schadewaldts das Angefangene voranzutreiben strebten, würde nur das Defizit an Reflexion und Theorie enthüllen, das in der Homerphilologie (wie bekanntlich in der Gräzistik überhaupt) insbesondere im
Die Erforschung der Ilias-Struktur
147
Vergleich mit der germanistischen Strukturforschung besteht. Ohne der überzogenen Theoretizität neuphilologischer Begriffsartistik das Wort reden zu wollen (die zumeist mit erstaunlicher Leistungsschwäche in der praktischen Textdeutung einhergeht17), kann doch nicht übersehen werden, daß die nur mangelhafte Ausbildung der Iliasstruktur-Erforschung zum Teil auch auf ein unterentwickeltes Verständnis für Struktur an sich und ihre literarischen Erscheinungsformen zurückzuführen ist I („... wenn man nicht darauf wartet - das Un-Erwartete wird 390 man nicht finden: es ist nicht ausfindig zu machen und unentdeckbar": Heraklit VS 22 Β 18). Struktur wird von den verschiedenen literaturwissenschaftlichen Schulen der letzten Jahrzehnte - wie ζ. B. dem Formalismus, dem Strukturalismus, der Erzählforschung, jeweils in ihren zahlreichen Varianten selbstverständlich je anders definiert.18 Hier ist nicht der Ort, die Unterschiede auszubreiten. Es wäre aber förderlich, erstens die Vielfalt der Definitionsmöglichkeiten überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und zweitens die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Struktur realisieren kann, bei der praktischen Arbeit am Text im Blick zu haben, also etwa (1) die Ebene der Geschickte (der story, des plot - also des erzählten Geschehens und der Geschehensfolge), wo es um die Beziehungen zwischen dem Ganzen und seinen Teilen geht (dieser Aspekt wird im Hinblick auf die Iliasstruktur intensiv verfolgt von Ernst-Richard Schwinge, unten S. 482 ff. [hier nicht abgedruckt]); (2) die Ebene der Erzählweise, wo es um die chronologische Anordnung, Rhythmisierung usw. der Erzählung geht (Erzählzeit und erzählte Zeit, point of view); (3) die Ebenen des Erzählvorgangs und der Erzählinstanz, wo es um den Unterschied zwischen Autor und Erzähler (als Rolle) geht: gerade für Ilias und Odyssee mit ihren zahlreichen vom Autor geschaffenen Binnen-Erzählern (Nestor, Helena, Glaukos usw.; Odysseus bei den Phaiaken und in der Bettlerrolle), die öfter mehrfach ineinandergeschachtelt werden, von augenfälliger Bedeutung. - Damit sind nur einige der Ebenen genannt, auf denen Struktur und Strukturierung faßbar werden und deren konsequente Observation durch die ganze Ilias hindurch mehr zum Verständnis des Organismus ,Ilias' beitragen könnte als die Spekulation über seine Genese.
3. Hauptstationen der Iliasstruktur-Erforschung Obgleich .positive' Iliasstruktur-Erforschung in ausgebildeter Form erst als Reaktion auf die Analyse einsetzt und ihre Vollform obendrein erst nach Erkenntnis und Ablegung ihrer .Reaktivität' bei Schadewaldt (1938) erreicht, ist sie in Ansätzen natürlich vom Beginn der Ilias-Rezeption an vorgebildet. Da es wohl keinen Hörer/Leser der Ilias geben wird, der angesichts der evidenten Einheit der .Geschichte' - ein Held zieht sich in seinem Ehrgefühl verletzt vom Kampf zurück, tritt unter dem Druck der Folgen seines Rückzugs wieder ein und nimmt Dazu W. Barner, in: Literaturwissenschaft. Grundkurs 2, Reinbek 1981, 121. ^ Das Folgende nach R. Fellinger, Zur Struktur von Erzähltexten, in: Literaturwissenschaft. Grundkurs 1, Reinbek 1981, 338-352. Vgl. auch H. v. Einem/K. E. Born/F. Schalk/W. P. Schmid, Der Strukturbegriff in den Geisteswissenschaften, AbhAkMainz 1973/2.
148
Die Erforschung der Dias-Struktur
für diese Folgen seines Rückzugs Rache - Strukturbeobachtungen vermeiden kann, sind dort, wo in erhaltenen Schriften aus Antike, Mittelalter und Neuzeit die Rede auf die Ilias kommt, vielfach auch Äußerungen zur Struktur des Werks zu finden. Ob ihre Sammlung nützlich wäre, ist freilich zweifelhaft: Selbst wenn sich häufig hinter solchen fragmentarischen Reflexen eine ganzheitliche Strukturvorstellung verbergen mag, handelt es sich nicht um zielbewußte Forschung. Von Nutzen kann daher nur die Betrachtung jener (wenigen) einschlägigen Äußerungen sein, in denen die Iliasstruktur tatsächlich thematisiert und über eine gewisse Strecke hin aus gezieltem Erkenntnisinteresse heraus verfolgt wird. 391 Diese ,Hauptlstationen' der Iliasstruktur-Erforschung sind im folgenden in das traditionelle Epochen-Raster eingeordnet. (a) Antike und Mittelalter bis Eustathios (um 1150) In dieser nahezu 2000 Jahre währenden ersten Rezeptions-Epoche gelten beide Epen als Schöpfungen eines einzelnen Dichters, Homers, und damit als Einheiten. Diese Einheiten sind überragende Kunstwerke, ihr Schöpfer Homer ein alle anderen überragender Künstler, der Dichter schlechthin, ό ποιητής. Da dies evident ist, kommt niemand auf den Einfall, es nachweisen zu wollen. Sollte es überhaupt zu einer Thematisierung der Struktur der Epen kommen, bedurfte es infolgedessen eines anderen als des apologetischen Motivs. Dieses Motiv ist der Wunsch, zu zeigen, warum die beiden Epen und ihr Schöpfer so überragend sind. Da dieser Aufweis nur auf der Basis des Vergleichs möglich ist - die beiden homerischen gegen die Vielzahl der nachhomerischen Epen - , ist es unausbleiblich, daß mit anderen Vergleichspunkten auch die Struktur der Epen in den Blick kommt. Dies mag schon in den Kreisen der literarisch interessierten Sophistik begonnen haben und hat sich natürlich in der Akademie noch intensiver fortgesetzt.19 Seinen ersten und für den Rest der Epoche maßgebenden Höhepunkt findet dieses Erkenntnisinteresse aber erst bei Aristoteles. Aristoteles geht an die Dias nicht als Homer-Interpret heran. Sein Blickpunkt liegt viel höher. Er hat als Schüler Piatons viel Widersprüchliches über Dichtung gehört, überwiegend aber Negatives. In den Jahren zwischen 343 und 340 hat er als Prinzenerzieher am makedonischen Königshof in Mieza den jungen Alexander im Rahmen des damals üblichen Curriculums intensiv mit der griechischen Dichtung vertraut gemacht, d. h. mit ihm Dichtertexte gelesen. Im Vordergrund standen dabei Epos und Tragödie, aber auch Iambos, Dithyrambos und Komödie spielten eine Rolle. Nach der Thronbesteigung Alexanders nach Athen zurückgekehrt, hat er in der neugegründeten eigenen Schule neben philosophischen, juristischen, politischen, historischen und vielen anderen Texten auch poetische Texte und Dokumente der Dichtungsrezeption (SiegerliFuhrmann, Dichtungstheorie 73; Koster, Epostheorien 22-42.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
149
sten von Dichter-Agonen, Didaskalien u. dgl.) in großem Umfang gesammelt. Auf der Basis eines gar nicht groß genug zu denkenden Textmaterials hat er dann eines Tages auch seine seit der Schülerzeit herangereiften Gedanken über Dichtung zu Papier gebracht und offensichtlich nicht als Hauptgeschäft, sondern mehr zur Entspannung der Gemeinschaft - immer wieder einmal vorgetragen, schwerlich immer in der gleichen Form. Der Text, der unter dem Titel ,Über die Dichtkunst' auf uns gekommen ist, war ursprünglich ein Vorlesungsmanuskript, womöglich von anderen unter Zuhilfenahme anderer Fassungen redigiert, niemals zur Veröffentlichung bestimmt und insgesamt ein Musterbeispiel jener .Gedächtnisstützen', von denen Piaton im ,Phaidros' sagt, wer nichts Wertvolleres zu bieten habe als was er ein für allemal schriftlich fixiert habe, verdiene den Namen .Philosoph' nicht. 20 Aus vielen Andeutungen in der .Poetik' blitzt deutlich auf, daß Aristoteles im mündlichen Gespräch dieser Schrift in der I Tat mit wesentlich 392 Wertvollerem hätte ,zur Hilfe kommen' können. Die kanonische Geltung, die der vorliegenden Textform seit der Renaissance widerfahren ist, mutet, so gesehen, grotesk überzogen an. Nimmt man jedoch den überlieferten Text als einen von vielen denkbaren Versuchen, mit den beschränkten Mitteln der Sprache auf die Gesamtanschauung zu verweisen, die dahintersteht, und sucht man diese Gesamtanschauung in sich nachzuvollziehen, dann erkennt man, wie evident und zugleich grundlegend die Einsichten über Poesie sind, zu denen Aristoteles gelangt war. Dies ist besonders deutlich im Bereich der Strukturanalyse (die Aristoteles als analytischem Denker natürlich mehr als alles andere lag).
Für Aristoteles ist das Drama - Tragödie und Komödie - die zur Zeit vollendetste Realisationsform von Dichtung. Infolgedessen gilt sein Hauptinteresse dem Drama.21 Alle anderen Gattungen werden entweder als Neben- oder als Vorformen betrachtet. Wichtigste Vorform der Tragödie ist das Epos. Der bedeutendste Vertreter des Epos ist Homer, Dichter von Ilias und Odyssee. Die Gebiete, auf denen Homer den anderen Epikern überlegen ist, sind zahlreich und von verschiedener Art. Entscheidend aber ist das Gebiet der Struktur. Denn Dichtung hat stets Wirkung zum Ziel, und Wirkung steht und fällt mit der Struktur. Die meisten Epiker verfehlen die .richtige Struktur' (und bringen sich und die Rezipienten dadurch um die Wirkung: den Genuß, das Vergnügen, die Empfindung des .Schönen'): 1453 a29 f. Die .richtige' Struktur ist folgende: δει τους μύθους - καθάπερ έν ταΐς τραγωδίαις - συνιστάναι δραματικούς, και περί μίαν πραξιν ολην και τελείαν, εχουσαν αρχήν καί μέσα και τέλος, ϊν' ώσπερ ζωον εν ολον ποιη την οίκείαν ήδονήν (1459 a 18-21): Man muß die Fabeln - ebenso wie in den Tragödien - so zusammensetzen, daß sie .dramatisch' sind und sich um eine einzige Handlung drehen, eine ganze und abgeschlossene, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, damit die Sache - ebenso wie ein Lebewesen, eins und ganz - den ihr eigentümlichen Genuß bewirkt.
20 21
Piaton, Phaidros 275 d ff. Zum Aufbau der, Poetik' s. Fuhrmann, Dichtungstheorie 4 ff.
150
Die Erforschung der Ilias-Struktur
Der Schlüsselbegriff dieser in Postulatform gekleideten Strukturdefinition ist .Lebewesen' (ζωον). Dies ergibt sich zwingend aus der Tatsache, daß das einzige Vergleichsobjekt, mit dessen Hilfe Aristoteles den Kern seiner Strukturvorstellung illustriert, eben ζωον ist. Ebenso wie ζωον als Vergleichsobjekt in der oben zitierten Definition der Epoj-Struktur verwendet wird, erscheint es als Vergleichsobjekt in der von der Sache her identischen Definition der TragödienStruktur. Während es in der Definition der Epos-Struktur zur Illustration der Definitionsbestandteile »Einheit und Ganzheit' dient, dient es in der Definition der Tragödien-Struktur zur Illustration des Bestandteils .angemessene Ausdehnung': Femer: Da es sich so verhält, daß sowohl ein schönes Lebewesen als auch jegliche schöne Sache, die aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, diese Bestandteile nicht nur als geordnete (τεταγμένα) aufweisen muß, sondern auch I eine Ausdehnung haben [muß], die nicht zufällig ist - denn das Schöne besteht in Ausdehnung und Geordnetheit (weswegen weder ein klitzekleines noch ein riesengroßes Lebewesen schön sein kann, weil es sich der Anschauung entzieht), darum muß, ebenso wie bei Körpern und Lebewesen leicht überschaubare Ausdehnung, so bei den Fabeln leicht erinnerbare Länge vorhanden sein (1450 b 341451 a 6).
Es ist nicht nötig, im einzelnen zu explizieren, wie die Hierarchie der Definitionsbestandteile dieser Strukturdefinitionen geschichtet ist. Was auf der Hand liegt, ist, daß die von Tragödie wie Epos geforderte Wirkung, der Genuß (ήδονή, τέρψις und die daraus folgenden Wirkungskomponenten ελεος und φόβος), das Schöne (το καλόν) voraussetzt, daß das Schöne wiederum Ausdehnung (μέγεθος) und Geordnetheit (τάξις) zur Voraussetzung hat und daß Ausdehnung und Geordnetheit nicht beliebige Ausdehnung und beliebige Geordnetheit sein dürfen, sondern Ausdehnung und Geordnetheit eines schönen Lebewesens: eins, ganz, in sich abgeschlossen, nicht zu klein und nicht zu groß und vor allem was an vielen Stellen dann nur noch angedeutet wird, weil es im Begriff .Lebewesen' impliziert ist, - organisch-funktional, d.h. in der bestmöglichen Weise zur Erfüllung seiner Aufgabe konditioniert, also nichts für die Erfüllung der Aufgabe Notwendiges entbehrend, nichts für die Erfüllung der Aufgabe Überflüssiges enthaltend und jeden Einzelbestandteil an der für die Erfüllung der Aufgabe erforderlichen Organismus-Stelle darbietend: και τά μέρη συνεστάναι των πραγμάτων [χρή] οϋτως ώστε μετατιθεμένου τινός μέρους ή άφαιρουμένου διαφέρεσθαι και κινείσθαι τό ό λ ο ν ö γαρ προσόν ή μή προσόν μηδέν ποιεί έπίδηλον, ούδέν μόριον του όλου έστίν (1451 a32-35): Und die Teile der Handlungen sollen so zusammengestellt sein, daß, wenn irgendein Teil woandershin gesetzt oder weggenommen wird, das Ganze ausein-
Die Erforschung der Dias-Struktur
151
andergerissen und erschüttert wird (διαφέρεσθαι και κινεΐσθαι). Denn dasjenige, dessen HinzufUgung oder Nicht-Hinzufügung überhaupt nicht auffällt, ist kein Bestandteil des Ganzen.
Einheit und Ganzheit dürfen also keine formale, sondern müssen eine organische Einheit und Ganzheit sein. Deswegen kann weder die von einem bestimmten Zeitabschnitt konstituierte noch die durch einen bestimmten .Helden' hergestellte Einheit und Ganzheit die der Poesie eigentümliche Wirkung hervorrufen: in beiden Fällen wird etwas von sich selbst her Zufälliges und damit UnEinheitliches und Un-Ganzes zu einer Pseudo-Einheit/Ganzheit zusammengezwungen. Die vielen Dichter von Herakles- und Theseus-Epen mußten daher scheitern (1451 a 19-22): Ό δ' "Ομηρος, ώσπερ και τα άλλα διαφέρει, και τοΰτ' εοικεν καλώς ίδειν, ήτοι δια τέχνην ή δια φύσιν Όδύσσειαν γάρ ποιών ούκ έποίησεν άπαντα οσα αύτω συνέβη [...] άλλα περί μίαν πράξιν, οϊαν λέγομεν, την Όδύσσειαν συνέστησεν - ομοίως δέ και την Ίλιάδα (1451 a22-30): ! Homer aber hat - so wie er sich auch in den übrigen Hinsichten [über die ande" ren] heraushebt - auch in dieser Hinsicht offenkundig richtig gesehen, entweder aufgrund von .Fachkompetenz' oder durch Naturbegabung: beim Verfassen der Odyssee hat er nicht ausnahmslos alles gedichtet, was ihm [Odysseus] passierte [...], sondern er hat die Odyssee um eine einzige Handlung im von uns gemeinten Sinn herum zusammengestellt - und ähnlich auch die Ilias.
Scheitern mußten aber aus eben diesem Grunde auch alle Dichter von Geschichts-Epen (und überhaupt historischen Dichtungen mit einem gewissen Vollständigkeitsanspruch), weil die Ereignisfülle innerhalb ein und desselben Zeitabschnitts, aber auch die Ereignisfolge in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten Ereignis-Summen bzw. Ereignis-Agglutinationen darstellen, „aus denen keineswegs ein einziges Ziel hervorgeht". Διό, ώσπερ ε'ίπομεν ήδη, και ταύτη θεσπέσιος αν φανείη "Ομηρος παρά τους άλλους, τω μηδέ τον πόλεμον - καίπερ έχοντα αρχήν καί τέλος - έπιχειρήσαι ποιειν ολον λίαν γάρ αν μέγας και ούκ εύσύνοπτος εμελλεν έσεσθαι ό μύθος, ή τω μεγέθει μετριάζοντα καταπεπληγμένον τη ποικιλία, νύν δ' έν μέρος άπολαβών έπεισοδίοις διαλαμβάνει την ποίησιν (1459a3037): Deswegen kann wohl, wie wir schon festgestellt haben, auch in dieser Hinsicht Homer als gottbegnadet erscheinen - verglichen mit den übrigen - , daß er den
152
Die Erforschung der Dias-Struktur Krieg (obwohl der doch einen Anfang und ein Ende hat) auch nicht ganz zu dichten unternommen hat; die Fabel hätte dann nämlich allzu groß und nicht leicht Uberschaubar zu werden gedroht, oder, falls sie in der Ausdehnung Maß gehalten hätte, aufgrund der Buntheit [der Ereignisse] allzu verwickelt. So aber hat er einen einzigen Teil davon beiseite genommen und die Dichtung mittels Einzelszenen gliedernd entfaltet. 22
Homer gilt Aristoteles also als Musterbeispiel für den richtigen Begriff und infolgedessen dann auch die richtige Umsetzung von Struktur. Wie man sieht, ergibt sich dieses einzigartig positive (.gottbegnadet', θεσπέσιος) Urteil gerade auch aus der Betrachtung der Ilias. Denn in der Ilias vermied Homer nicht nur, wie in der Odyssee, den Fehler der pseudo-einheitlichen ,Ein-Held-Handlung', sondern auch den noch viel schwerer zu vermeidenden der pseudoeinheitlichen ,Eine-Geschichte-Handlung' (den, wie im Anschluß an die zuletzt zitierte Stelle notiert wird, die Dichter der ,Kyprien' und der .Kleinen Ilias' begingen, indem sie zwar eine einzige, aber aus vielen Teilen - nicht Szenen - bestehende Geschichte dichteten, μίαν πράξιν πολυμερή, während Homer ja, wie zuvor ge395 lobt, εν μέρος I άπέλαβεν). Homer hat die Fabel der Ilias richtig seligiert (εν μέρος άπολαβών = μήνις Άχιλήος) und richtig strukturiert (έπεισοδίοις διαλαμβάνει την ποίησιν); seine επεισόδια sind, wie in 1455 b 28 impliziert wird, gemäß der Forderung in 1455b 13 οικεία, d.h. nicht irgendwo hergeholt und zugesetzt, sondern mit der Geschichte, die er erzählt, organisch verbunden und für sie wesentlich. Die Ilias ist also strukturell ein Muster-Epos. Das Beeindruckendste an dieser Strukturanalyse ist: sie verrät, daß wesentliche Elemente des aristotelischen Strukturbegriffs, soweit er die Dichtung betrifft, gerade aus der Betrachtung der Ilias gewonnen sind (ζ. B. die höhere Qualität der Einteiligkeit gegenüber der Mehrteiligkeit, die nur aus dem Vergleich ,Ilias: andere Epen des Troischen Sagenkreises' - wie die zitierten .Kyprien' und die .Kleine Ilias' - evident werden konnte). Wenn sich also in so tiefdringenden modernen Analysen der Iliasstruktur wie der von Ernst-Richard Schwinge (unten S. 482 ff. [hier nicht abgedruckt]) die Angemessenheit des aristotelischen Strukturbegriffs erneut beweist, dann spricht das letztlich nur für die unerhörte Qualität einer Dichtung, die einen solchen Strukturbegriff mitbegründet hat. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Bemühungen der im 19. Jh.
Athetese und Epeisodion-Auffassung nach Nickau 1966, zuletzt überzeugend neu begründet von A. Köhnken, Terminologische Probleme in der .Poetik' des Aristoteles, Hermes 118, 1990, 129-149 (bes. 136-149); s. auch unten den Beitrag von E.-R. Schwinge [hier nicht abgedruckt].
Die Erforschung der Ilias-Struktur
153
aufgekommenen .Analyse', die strukturelle Qualität der Ilias nicht zu erkennen, als nur schwer nachvollziehbare Verirrungen. Selbstverständlich stellte die Ilias, ebenso wie die Odyssee, Aristoteles nicht anders als ungezählte Hörer/Leser vor ihm an vielen Stellen und in vielerlei Hinsicht vor Verständnisschwierigkeiten. Diese sind jedoch fast ausnahmslos nicht von struktureller Art und werden insoweit in einem eigenen längeren Kapitel über προβλήματα 'Ομηρικά (Kap. 25), nach vorausgehendem Generalverweis auf die Eigengesetzlichkeit von Dichtung („die .Richtigkeit', όρθότης, ist in der Dichtung nicht von gleicher Art wie in der Politik oder irgendeinem anderen Fachgebiet"; s. dazu unten F. A. Wolf, S. 163 f.), in Kategorien aufgeteilt und mit Lösungsmöglichkeiten versehen (Probleme des Realitätsbezugs des Dargestellten, Probleme der Charakterdarstellung, sprachliche Probleme, Probleme der logischen Stimmigkeit). In struktureller Hinsicht hat Aristoteles lediglich zwei Ausstellungen zu machen, die sich ihm allerdings nicht aus der Betrachtung der Iliasstruktur an und für sich ergeben, sondern aus der vergleichenden Betrachtung von Epos-Struktur einerseits (worunter dann durch Systemzwang auch die Iliasstruktur fällt) und Tragödien-Struktur andererseits: (1) Verglichen mit der Tragödie ist die Einheitlichkeit der Epos-Struktur geringer; dies allerdings notwendigerweise - weil nämlich (2) verglichen mit der Tragödie die Epos-Struktur grundsätzlich größere Länge des Kunstwerks (μήκος) erforderlich macht, wodurch ein geringerer Grad von ,Versammeltheit' (άθρόον 1462 b 1) bedingt ist. Aristoteles bemüht sich selbst darum, klarzustellen, daß diese Einschränkungen keinerlei Kritik an der Struktur von Ilias und Odyssee für sich genommen darstellen sollen, sondern Wert-Abstufungen, die aus seiner speziellen teleologischen Entwicklungstheorie resultieren, in der das τέλος von poetischer Struktur schlechthin die Tragödie bildet: I καίτοι ταΰτα τά ποιήματα συνέστηκεν ώς ένδέχεται άριστα και ότι μάλιστα μιας πράξεως μίμησις (1462 b 10/11): Gleichwohl sind diese Dichtungen [Ilias und Odyssee] unter Berücksichtigung der objektiven Möglichkeiten optimal strukturiert und so weit wie überhaupt erreichbar die Nachbildung einer einzigen Handlung.
Entsprechend dem natürlichen Grundsatz .Keine Struktur ohne strukturierende Instanz' (s. oben S. 145) ging Aristoteles mit Selbstverständlichkeit davon aus, daß die Iliasstruktur (ebenso wie die Odysseestruktur) das Werk eines Mannes sei (der für ihn Horneros hieß). Diesen einen stellt er sich folgerichtig als planenden Architekten vor, der ganz ebenso vorging, wie er es aus der zeitgenössischen Dichterpraxis kennt und als beispielhaft empfiehlt:
396
154
Die Erforschung der Ilias-Stmktur
τους τε λόγους και τους πεπονημένους δει και αύτόν ποιοΰντα έκτίθεσθαι καθόλου, ειθ' οΰτως έπεισοδιοΰν και παρατείνειν (1455 a34-b2) [...] μετά ταύτα δέ ήδη ύποθέντα τα ονόματα έπεισοδιοΰν (1455 b 12 f.): Und die Fabeln, sowohl die in dichterischer Form vorliegenden als auch diejenigen, die man selbst dichtet, muß man [zunächst] in allgemeinem Umriß exponieren und dann in dieser [exponierten] Weise ,in-szenieren' [d. h. in Einzelszenen umsetzen, verbalisieren] und Ausdehnung gewinnen lassen [folgt als Beispiel für .exponieren' in einem neunzeiligen Satz die Strukturskizze der Euripideischen .Iphigenie bei den Taurern']; danach soll man dann, nachdem man die Namen [den Figuren] unterlegt hat, ,in-szenieren' [d. h. Einzelszenen ausarbeiten].
Genau in dieser Weise ist, wie 1459 a 36 f. zeigt (oben S. 151 f.), nach Aristoteles' Vorstellung auch Homer verfahren (Homer „hat einen einzigen Teil davon beiseite genommen und die Dichtung mittels Einzelszenen gliedernd entfaltet"). Die Ilias ist also (ebenso wie die Odyssee) ein von Anfang an in eben dieser Weise, in der sie vorliegt, geplantes Werk. Aristoteles' Entwurf einer optimalen Epos- und Tragödien-Struktur steht innerhalb einer Dichtungsanalyse, die auf das Allgemeine zielt. Die konkreten Einzel werke dienen nur als Ausgangsmaterial für die , Generalformeldie dann ihrerseits die Anforderungen an das konkrete Einzelwerk bestimmt. Innerhalb dieser ,strukturalistischen' Ausrichtung von Strukturforschung kann die Iliasstruktur nur éin - wenn auch wichtiges - Teil-Element der Materialbasis bilden. Eine speziell auf die Iliasstruktur zielende einläßliche Interpretation der Ilias kann also von Aristoteles nicht erwartet werden. Hätte er eine solche vorgelegt (so wie er das als Prinzenerzieher in Mieza vermutlich nicht nur einmal getan hat), dann hätte sie sich - das ergibt sich zwingend aus Aristoteles' Abstraktionsprodukt - in der Richtung von Schadewaldts, Heubecks, Reinhardts und Schwinges Interpretation bewegt, d.h. in Richtung auf eine unitarische Iliasdeutung, wie sie als Reaktion auf die Analyse seit Beginn des 20. Jh.s sich ent397 wickelt hat und heute weithin vorherrscht. I Die Analyse hat also das große Verdienst, durch ihren Versuch einer Destruktion der Aristotelischen IliasstrukturDeutung eben diese Aristotelische Iliasstruktur-Deutung aus ihrer ,strukturalistischen' Beschränkung gelöst, ihre Umsetzung in lebendige Werkinterpretation veranlaßt und sie so erst zu ihrer eigentlichen Wirkung gebracht zu haben. Was die nach-aristotelischen Jahrhunderte bis zu Eustathios angeht, so sind tiefergehende Struktur-Erforschungsversuche, soweit ersichtlich, jedenfalls nicht publiziert worden. Die Homerphilologie bewegte sich im wesentlichen auf dem Gebiet der von Aristoteles in Kap. 25 der,Poetik' skizzierten προβλήματα 'Ομηρικά. Die alexandrinische Editions- und Kommentierungstätigkeit, die wir vor
Die Erforschung der Dias-Struktur
155
allem in den Homerscholien und bei Eustathios fassen, berührte Strukturfragen nur am Rande (die Annahme von Interpolationen und die Durchführung von Athetesen nach Art des durch Wolfs Mißverständnis nachmals berühmt gewordenen Zenodorus-,Falls' - Prolegomena cap. XXX Anm. 97 - haben keine systematische Strukturforschung zur Grundlage, sondern beruhen in der Regel auf den gleichen Kriterien, die dann von Wolf an wieder die Analyse dominieren: frigide, inepte, absurde, indecenter usw.; über den Grund der für Aristophanes und Aristarch belegten Athetese des Odyssee-Schlusses ab ψ 297 wissen wir, wie schon Wolf cap. XXXI feststellte, trotz aller Bemühungen nichts Genaues; gegen gezielte Strukturdiskussionen auf Aristotelischem Niveau spricht aber schon die fast völlige Absenz einer .Struktur-Terminologie' in den Scholien 23 ). Die Reflexe der Strukturdiskussionen, die in Kreisen der alexandrinischen Dichter (Theokrit, Kallimachos usw.), der hellenistischen Philosophenschulen (vor allem der Stoa), der kaiserzeitlichen Dichtungstheoretiker (Horaz, Auetor Περί ΰψους) und anderswo geführt wurden 24 , lassen nichts erkennen, was wirklich wesentlich über Aristoteles hinausginge. Das Fazit kann demnach nur lauten: In den rund 1850 Jahren zwischen Homer und Eustathios hat eine .positive' Iliasstruktur-Erforschung im Sinne einer das Besondere der Iliasstniktur würdigenden Dichtungsinterpretation nicht stattgefunden. Aristoteles mit seiner .strukturalistischen' Würdigimg bildet den einsamen Höhepunkt antiker und byzantinischer Iliasstruktur-Erforschung überhaupt. (b) Mittelalter, Renaissance, Neuzeit bis F. A. Wolf Voraussetzung für jede Iliasstruktur-Erforschung ist die genaue Kenntnis des Iliastextes und eine daraus erwachsene, auf den Text nur noch in Einzelheiten angewiesene Abbildung des Gesamtbaus im Geist des Forschers. Während des I Mittelalters war diese Voraussetzung schon im byzantinischen Osten kaum mehr 398 gegeben; noch viel weniger im Westen. Im Osten sprechen die Widmungen der Homer-Erklärungsschriften von Johannes Tzetzes (ca. 1110-1180) an Mitglieder des byzantinischen Kaiserhauses ebenso wie Tzetzes' oft verschrobene und sachlich falsche Versuche, die Kenntnis der homerischen Epen im Kreise der
23
Eine Durchsicht der Scholien-Indices von Baar und Erbse unter den einschlägigen Termini förderte nichts Wesentliches zutage. 24 Koster, Epostheorien 93-158.
156
Die Erforschung der Ilias-Struktur
Gebildeten zu verbreiten, eine beredte Sprache25, und die beiden großen Homerkommentare des Eustathios von Thessalonike (ca. 1110-1192) - Sammelbecken der antiken Homergelehrsamkeit - weisen in die gleiche Richtung: trotz mancher eigenen Beobachtung des gelehrten Kirchenmannes sind sie im Grunde Paraphrasen - durch deren Lektüre sich die Leser (wenn sie bis zum Ende kamen) wohl meistenteils von der Verpflichtung dispensierten, das Original zur Hand zu nehmen. Im Westen lagen die Verhältnisse noch schlimmer. Weitgehend war Homer dort nur aus zweiter oder dritter Hand bekannt, und - dies das größte Hindernis - fast nur aus lateinischen Quellen: Ilias Latina (1070 Hexameter), Dictys v. Kreta (6 Bücher), Dares Phrygius - alle auf die frühe Kaiserzeit zurückgehend und allesamt unsägliche Entstellungen Homers. Doch damit war der Niedergang der Homerkenntnis im Westen noch nicht am Tiefpunkt angelangt. Der phantastisch-erotische Roman de Troie (ca. 1165) des Benoit de Sainte-Maure - vielfach nachgeahmt, versifiziert, ins Lateinische übersetzt usw. - deckte den echten Homer vollends zu (z. T. sogar in Byzanz), und was an vager Homerkenntnis im ausgehenden Mittelalter noch übrig war, macht Chaucers The House of Farne (1384) deutlich: so gut wie nichts. Nur eines hatte sich gehalten: die Fama, daß Homer ein großer Dichter war. Im übrigen hielt sich alles an Vergil. Daran hat auch Pilatos von Boccaccio angeregte Übersetzung Homers ins Lateinische fehlerhaft und überdies in schlechtem Latein verfaßt (ca. 1360) - nichts geändert. Als Manuel Chrysoloras 1396-1400 in Florenz den führenden Männern einigermaßen Griechisch beigebracht hatte, folgte kein Umschwung, sondern eine rund 100 Jahre anhaltende Experimentierphase, in der man darin wetteiferte, lateinische Versionen Homers - in Versen oder Prosa - herzustellen. Das Interesse konzentrierte sich dabei auf die Übersetzungsproblematik, an StrukturErforschung ist gar nicht zu denken. Im Jahre 1488 endlich erschien in Florenz der erste Druck Homers (ed. Demetrios Chalkondyles; die erste Aldina folgte 1504). Natürlich führte auch dies nicht gleich zu Strukturforschungen: damals erschien ein griechischer Text nach dem anderen im Druck; es galt zunächst zu rezipieren. Aus der fortschreitenden Aneignung des antiken Denk- und Gestaltungsniveaus erwuchs danach zunächst der Wunsch, selbst ähnlich Großartiges zu schaffen: die Produktion von nationalen Epen, Tragödien usw. setzte ein. I 25
Finsler 1912, 10; das Folgende nach Finsler 1912, 1-14 (,Das MiUelalter'). Finslers materialreiche Darstellung des Inhalts der heute schwer beschaffbaren frühen Literatur ist auch sonst herangezogen.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
157
Unter den im Druck erschienenen griechischen Werken befand sich eines, das 399 bisher so gut wie unbekannt gewesen war (obwohl es während des ganzen Mittelalters lateinische Kurzfassungen davon gegeben hatte): Aristoteles' Poetik (Aldina 1508, innerhalb der Rhetores Graeci; breitenwirksame zweisprachige Ausgabe - griechisch und lateinisch - von Alessandro de' Pazzi, Florenz 1536). Kein anderes griechisches Buch hat das europäische Geistesleben in den folgenden drei Jahrhunderten, bis ins 18. Jh. hinein, so sehr beschäftigt und befruchtet wie dieses. 26 Homerrezeption und Poetik-Rezeption gingen in der Folge Hand in Hand (bei der Bedeutung Homers für Aristoteles' Dichtungstheorie nur natürlich). Dichter, Dichtungstheoretiker und Philologen vor allem in Italien, Frankreich, England, Holland, Deutschland führten in Werkvorreden, Poetiken, Traktaten, Essays usw. ein unablässiges Gespräch über Dichtung - wie sie ist, sein sollte, einmal war - , über den Wert der Gattungen und des Epos im besonderen, über den Unterschied zwischen Homer und Vergil, über antike und moderne Dichtung und welche davon vorzuziehen sei (die Querelle des Anciens et des Modernes), über Vernunft, Gefühl, Geschmack und vieles andere mehr. Es konnte gar nicht ausbleiben, daß in diesem europäischen Konzert auch manches - richtig oder falsch - zur Struktur der beiden Epen vorgetragen wurde. Seinen Ausgang nimmt, was darüber gesagt (und fabuliert) wird, regelmäßig von den antiken Zeugnissen über eine sog. .Peisistratische Redaktion' der homerischen Epen (Cicero, Aelian, Plutarch, die Suda u. a.), wonach Homer ursprünglich nur einzelne Gesänge verfaßt und je nach Fertigstellung und Bedarf vorgetragen hätte; diese hätte dann Lykurg von Ionien nach Griechenland gebracht, Rhapsoden hätten sie bei Festen vorgetragen, und erst der athenische Tyrannos Peisistratos (2. Hälfte des 6. Jh.s) hätte sie (im Rahmen seiner großen ,Kulturreform') zu einer ,Ilias' und einer ,Odyssee' zusammenstellen lassen. Diese Geschichte (die schon Finsler 1912 als „Ding der Unmöglichkeit", „Fabel" und „Mär" bezeichnet hatte und von der Lesky 1967 hoffte, ihr sei inzwischen „ein für allemal der Boden entzogen" 27 ), haben, seit Leo Allatius 1640 in seiner Arbeit ,De patria Homeri' „das antike Material über Homer nahezu vollständig und in guter Ordnung" 28 vorgelegt hatte, viele Berufene und Unberufene fortgesponnen (Perizonius, Bentley, Rapin u. a., s. Finsler 1912, 202-207). Der vielleicht Unbedarfteste von ihnen (der Homer nur aus lateinischen und französischen Übersetzungen kannte, die er folgerichtig für viel geeigneter hielt als die
26 27 28
Fuhrmann, Dichtungstheorie 185-308 (,Die aristotelische Poetik in der Neuzeit'). Finsler 1912, 202; Lesky 1967, Sp. 146, 50. Finsler 1912, 148.
158
Die Erforschung der Ilias-Struktur
griechischen Originale) war Perrault in seiner Parallèle des Anciens et des Modernes (1688-1697); ausgerechnet er aber wurde für die künftige Entwicklung wichtig: durch ihn wurde die Aufmerksamkeit auf F. Hédélin Abbé d'Aubignacs Conjectures académiques ou dissertation sur l'Iliade gelenkt (um 1664 entstan400 den, aber erst 1715 gedruckt), einen Essay, dessen I Verfasser Finsler nicht zu Unrecht den „Vater der modernen Homerkritik" nennt 29 - vor allem, weil d'Aubignac - zwar dilettantisch, doch mit Blick für wirklich Problematisches über das damals schon hundertfach Nachgeredete hinaus den Blick, wenigstens oberflächlich, endlich einmal auf die Struktur der Epen richtete (Wolf hat denn auch, wie längst gesehen ist, d'Aubignac „mehr verdankt, als seine Eitelkeit ihm erlaubte zuzugestehen": Finsler 1912, 210; s unten S. 165). Doch so viel da auch zusammenkam, nirgends drang es bis zum Rang wirklicher SttuktaT-Erforschung vor. Das war schon deshalb unmöglich, weil dem allen keinerlei systematische //omer-Erforschung zugrunde lag. Entsprechend hat viel später Wilamowitz die Epoche - kernig wie immer, aber treffend - so abgetan: „Bentley beobachtete, daß das Vau in den epischen Versen sehr häufig konsonantische Kraft hat [...]: der einzige Fortschritt, den die zünftige Philologie zwischen Eustathios und Heyne gemacht hat". 30 Dennoch war die Epoche für die Iliasstruktur-Erforschung von Bedeutung, freilich indirekt: In ihr geriet am Ende, nach fast 300 Jahren unbeschränkter Herrschaft, diejenige Autorität ins Visier, die mit der allgemeinen Lehre von der Handlungseinheit die Einheit auch von Ilias und Odyssee gedeckt, ja unangreifbar gemacht hatte: Aristoteles. Zwar ist es im Grunde gar nicht Aristoteles, gegen den sich die Revolte richtet, sondern der „poetologische Aristotelismus" (M. Fuhrmann 31 ), den Dichtung und Dichtungstheorie im Laufe der unendlichen Debatte der letzten drei Jahrhunderte unmerklich selbst errichtet und dem sie sich dann unterworfen hatten, doch dieser Unterschied wird zunächst nicht klar gesehen (erst Lessing deckt ihn auf, leider damals ohne Wirkung32). Unter dem Motto .Freiheit vom Regelzwang freie Bahn dem Originalgenie' wird gegen Ende der Epoche offen gegen Aristoteles aufbegehrt, und in den Sog gerät mit allem, was Aristoteles als gut und richtig angesehen hatte, nun auch Homer hinein, und ganz besonders die von Aristoteles so unablässig gerühmte Handlungseinheit seiner Epen.
29 30 31 32
Finsler 1912,210. Wilamowitz, Ilias 9. Fuhrmann, Dichtungstheorie 189 (und passim). Fuhrmann, Dichtungstheorie 272 f.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
159
Alles, was an Argumenten gegen eine einheitliche Struktur der Ilias früher isoliert in der Debatte aufgetaucht war, wird nun gesammelt und gebündelt: jene Nachrichten über eine ,Peisistratische Redaktion', die Nachricht vom Homer, der gar nicht schreiben konnte, die Anstöße der Neueren an den ,Längen' in der Iliashandlung (die langen Kampfschilderungen, die langen Reden vor der Schlacht, die langen Gleichnisse, die langen Beschreibungen von Menschen, Gegenständen, Örtlichkeiten, die Wiederholungen, die .epische Breite' überhaupt), gewisse .Widersprüchlichkeiten' im Handlungsablauf (meist freilich solche von nicht struktureller Art), die Athetesen antiker Homergelehrter usw. Hinzu treten neuere Gesichtspunkte, die anwendbar erscheinen, vor allem das neue Verständnis I für die Zeitbezogenheit von Dichtung und damit die Forde- 401 rung nach historischer Betrachtungsweise auch Homers (Pope, Blackwell, Wood, Herder), daneben auch die Entdeckung mündlicher, häufig improvisierter, Volksdichtung (Herder). Das alles sind, wie wir heute leicht sehen, äußerliche Dinge, die das Werk selbst, seine innere Organisation und damit seinen eigenen Zeugniswert gar nicht betreffen und die infolgedessen niemals die Erforschung der Struktur - Vers für Vers, Szene für Szene, Gesang für Gesang ersetzen können. Aber zusammen mit der Grundstimmung des Anti-Aristotelismus baut sich daraus ein Potential an Kritikbereitschaft und Kritik-Empfänglichkeit auf, das geradezu zur Entladung drängt. Der Umschwung findet statt bei Christian Gottlob Heyne (seit 1763 in Göttingen). Heyne selbst legt den Grund, sein Schüler Friedrich August Wolf baut aus, treibt voran, verschärft, spitzt zu - und erntet den Ruhm - , vor allem, weil er es versteht, Längstbekanntes pointiert zu formulieren und geschickt miteinander zu verbinden, und weil er es versteht - lange vor Wilamowitz - , das Pathos der Wissenschaftlichkeit zu kultivieren. Daß die Zeit der überwiegend admirativen Homersicht sich dem Ende zuneigt, wird bei Heyne erstmals deutlich vor 200 Jahren, in seiner Homervorlesung des Sommersemesters 1789, die uns durch eine Mitschrift Wilhelm v. Humboldts erhalten ist:33
33 Wilhelm v. Humboldts Werke, hrsg. v. A. Leitzmann, Siebenter Band, Zweite Hälfte: Paralipomena, Berlin 1908, 550-553. Der Hrsg. Leitzmann teilt in der Einleitung mit (550): „ich fand das Heft im Nachlaß Friedrich August Wolfs auf der berliner Königlichen Bibliothek, dem es Humboldt geliehen oder geschenkt hat" (Wolf war seit 1783 Professor in Halle, konnte die Vorlesung also nicht selbst hören). - Näheres dazu jetzt in: Wilhelm v. Humboldt, Briefe an Friedrich August Wolf, textkrit. herausgegeben und kommentiert von Ph. Mattson, Berlin - New York 1990, 332-352 (Hinweis von W. Barner, Poetica 22, 1990, 516 Anm. 9).
160
Die Erforschung der Ilias-Struktur „Homers Hauptwerke: Iliade, Odyssee. Von Homer nie aufgeschrieben, die Schreibekunst war noch zu wenig kultiviert, als daß man mehr als zum öffentlichen Denkmal bestimmte Dinge aufgeschrieben hätte [...] Auch war's Sitte der Zeit, nur durch Sprechen zu lehren, durch Hören zu lernen. Vorzüglich wurden Gedichte gesungen, oft wiederholt, endlich gelernt [...] Lange erhielten sich Homers Gedichte nur in Gesängen der Rhapsoden [...] In der früheren Zeit waren immer nur einzelne Stücke aus der Iliade und Odyssee, Rhapsodien. Diese wurden einzeln abgesungen [...] Alte einzelne Rhapsodien waren die τειχομαχία, κατάλογος των νεών, Πάτροκλος etc. Gesammelt und aufgezeichnet wurden Homers Gedichte [Hervorhebung von mir] erst spät; von wem, ist zweifelhaft. Man legt es bei dem Lykurg [...] ferner dem Pisistratus oder seinen Söhnen [...] endlich dem Solon. Leicht können alle daran teilgehabt haben ..." I
402 In dieser .Frühgeschichte' der Homer-Überlieferung ist natürlich ein gewichtiges Struktur-Urteil enthalten: Ilias und Odyssee sind erst nach 600 als Zusammenstellung von ursprünglichen Einzelgedichten Homers, Rhapsodien, zustande gekommen, unsere Ilias ist also nicht ein einheitliches Werk eines einzigen ursprünglichen Verfassers, das nach einem bestimmten Werkplan (von dem doch, wie wir sahen, Aristoteles ausgegangen war) geschaffen wurde. Die bisherige communis opinio ist damit verworfen. Sollte nicht auch diese These vereinzelt bleiben, hätte an diesem Punkte die Struktur-Erforschung beginnen müssen, also die strukturelle Interpretation von innen her. Es kommt anders. Sechs Jahre später, 1795, bringt Heynes Schüler Wolf seine Vorrede zu der Ilias-Ausgabe heraus, die in der Waisenhausbuchhandlung (Libraria Orphanotrophei) der Franckeschen Stiftungen zu Halle an der Saale erschienen war. 34 In dieser Vorrede kündigt er zunächst die Grundsätze seiner Textgestaltung an, wie üblich. Es geht ihm um die emendatio, d. h. um die Befreiung des Textes von den Fehlern, die er ex longa peregrinai ione in barbariem (Kap. 1) auf sich gezogen hat, und um die Rückgewinnung der Ursprungs-Textform (ut propius ad antiquam et suam formant revocetur [liber], ebd.). Darum ist es natürlich allen bisherigen Ilias-Herausgebern gegangen. Aber sie alle sind unwissenschaftlich verfahren. Und außerdem konnten sie die erst vor 7 Jahren publizierten VilloisonScholien noch nicht verwerten. Wolf will sie mit seiner Ausgabe alle überbieten. Er will dies in Form einer systematischen Geschichte des Iliastextes tun [die Idee hatte er bekanntlich aus Eichhorns .Einleitung ins Alte Testament' 35 ]. Vom gegenwärtigen Textzustand der Ilias-Vulgata will er über 6 Etappen hinweg bis zum allerersten erreichbaren Textzustand zurückstoßen. Natürlich muß dieser 6-Etappen-Weg in der Darstellung, die er hier vorlegt, in umgekehrter Reihenfolge erscheinen, also die älteste Etappe zuerst, und so fort. Was also ist die älteste Etappe? Wann ist der Text zum ersten Male niedergeschrieben worden? Wann kann er überhaupt zum erstenmal niedergeschrieben worden sein? - Die folgenden Überlegungen bis Kapitel 25 sind identisch mit denen Heynes. Also ursprüngliche Mündlichkeit, Einzelgesänge, Rhapsodenüberliefe34 35
Wolf, Prolegomena. Die Ausgabe: Halle 1794. Siehe Grafton/Most/Zetzel 1985,18-26.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
161
rung durch Auswendiglernen von Rhapsode zu Rhapsode (mit leichten Änderungen und eigenen Zusätzen). Daraus ergibt sich dieselbe Folgerung, die auch Heyne schon gezogen hatte: niedergeschrieben kann der Text erst nach angemessener Verbreitung der Schriftgewandtheit worden sein, also - entsprechend den antiken Zeugnissen - in der sog. .Solonischen' oder .Peisistratischen Redaktion*. Diese Folgerung wird Wolf von Beginn des Kapitels 32 an vortragen.
Zwischen Kapitel 25 und 32 schiebt Wolf 6 Kapitel ein, die er als das Eigentliche, das Neue und zugleich das Kernstück seiner ganzen Theorie betrachtet. Alles Bisherige, heißt es zu Beginn des Kapitels 26, seien nur προτέλεια diversae et altioris quaestionis gewesen. Diese neue quaestio stelle eine Wende dar: „In hac repente omnis campus disputationis mutatur." An die Stelle der antiken vestigia histórica trete nun Mutmaßung und Räsonnement (coniectura et ratiocinatio). Der Haufe (vulgus) pflege derlei heutzutage als hypotheses zu diffamieren. Nun denn, sei's I drum: er habe lange zugewartet, dum praefidentior alius 403 hoc auderet, nun wolle er nicht länger für seinen Ruf fürchten, planissimeque statim dicamus, quod res est. Das klingt dramatisch, und man erwartet Unerhörtes. Genauso hat auch Heyne es empfunden. Doch was dann kam, schien ihm bescheiden, und er behauptet: „Dem Ree. schien die Sache sehr einfach zu seyn, und er trug sie immer so vor: [,..]." 36 Darüber ist danach der große Zwist zwischen Schüler und Lehrer ausgebrochen. Ob Heyne recht mit seinem Anspruch hatte oder nicht, ist weniger bedeutsam (wohl eher nicht37). Wolfs Ankündigung und Heynes Reaktion zeigen aber, daß diese sechs Kapitel in der Tat brisanter waren als das gesamte übrige opusculum. Sie wurden denn auch später zu einem Meilenstein der Homerphilologie: mit ihnen begann für die, die Wolfs hypotheses für attraktiv und für fundierenswert erachteten, die eigene Weiterarbeit auf Wolfs Spuren die Analyse. Die sechs Kapitel 26-31 gelten der Struktur der Ilias. Obgleich sie, wie schon Heyne zu Recht monierte, ziemlich weitschweifig und überdies rhetorisch sind, lassen sich folgende Hauptgedanken extrahieren: Die Ilias kann nicht von einem einzigen Verfasser stammen, denn
36
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 186. Stück, den 21. Nov. 1795, S. 1862. Heyne war von zerstreuten Gelegenheitsdichtungen Homers ausgegangen, Wolf opfert Homer zugunsten eines ,Kollektiv-Epos'. 37
162
Die Erforschung der Dias-Struktur
26
(1. Argument) sie ist zu umfangreich für diese frühe Zeit (ohne Schrift - die ja lt. Voraussetzung noch nicht verwendet wurde - war sie weder konzipier- noch rezipierbar);
27
(2. Argument) ihr Programm (das Prooimion) deckt nicht das Ganze, sondern nur die eigentliche μήνις, also die Gesänge 1-18.
28
29
(Erklärungsthese) Die Einheit der Ausführung, die wir haben, war in der Geschichte angelegt. Infolgedessen konnten andere sie herstellen, sobald die Geschichte nur ein Stückweit angefangen war. (3. Argument) Die kyklischen Epen haben die komplexe und kohärente Struktur von Ilias und Odyssee nicht nachgeahmt (also war diese damals noch nicht vorhanden). I
404 30
(Erklärungsthese) Dafür, daß andere die vorhandene Einheit hergestellt haben, sprechen un-homerisch anmutende Verbindungsstücke und Widersprüchlichkeiten;
31
(Erklärungsthese) außerdem fühlt man, daß auch größere Stücke (z.B. der Schluß der Odyssee ab ψ 297 oder die letzten 6 Gesänge der Ilias) nicht von Homer sind.
Von Bedeutung ist heute allenfalls noch das 2. Argument (Kap. 27). Denn das 1. Argument (das Wolf als firmamentum causae nostrae ansah, mit dem seine ganze These stehe und falle: Kap. 26 Ende, und dazu die pathetische Fuß-
Die Erforschung der Dias-Struktur
163
note 84: Iacta est alea) ist durch die sich häufenden Schriftfunde aus dem 8. Jh. inzwischen dahingeschwunden, und das dritte bedarf keiner Widerlegung (mit dem gleichen Recht könnten wir fragen, warum keine griechische Dichterin je Sappho nachgeahmt hat); alles andere sind Erklärungshypothesen. Wie kommt Wolf also auf das zweite Argument? Fest steht für ihn zunächst, daß in den Epen tatsächlich ein System der Struktur und Komposition steckt: „Quin insit in iis artificium structurae et compositionis aliquod, dubitati nullo pacto potest" (30). Nur müsse man angesichts des Umfangs der Epen (Argument 1) fragen, ob dieses Kunstsystem unbedingt von Homer sein müsse oder auch von anderen Geistern stammen könne („Homerine id sit an ab aliis ingeniis adscitum": 30). Zur Schaffung eines solchen Systems habe schließlich sowohl das Thema der Gedichte eingeladen als auch die Anordnung der fabula („invitante ipso argumento eorum [carminum] et ordine fabulae": 30). An dieser Stelle hätte, das sieht auch Wolf, die Strukturanalyse der Ilias einzusetzen. Ihr weicht er aus: „Etiam hanc quaestionem pono tantum, non pertracto". Warum? „Est enim immensae materiae, nec necessaria proposito nostro" (30). Die Strukturfrage ist also suspendiert. Sie wird in den folgenden 200 Jahren ungezählte Geister umtreiben. Immerhin gibt Wolf die Richtung an. Wenn das Thema von Homer ist und auch die Anordnung der Fabel (er meint wohl: die Zielrichtung), dann muß zumindest der Anfang der Ilias von Homer sein: „Homerus, id est is, a quo maior pars et priorum rhapsodiarum series deducta est" (31). Was ist maior pars und priorum rhapsodiarum series aber nun genau? Was ist von Homer, wie weit hat er ausgearbeitet, welche Teile? Man spürt: hier liegt der Punkt (der ja noch uns beschäftigt), hier muß entschieden werden. Aber: dies herauszufinden überläßt Wolf anderen: „difficultates illas aliis mandabo" (27 Anfang). Wem? Allen Mitforschern, auch den methodisch anders Orientierten, insbesondere aber denen, die die mirìfica forma et descriptio horum έπων partiumque dispositio deswegen besser beurteilen können, weil sie die „Leistungsfähigkeit des menschlichen Geistes I auf diesem Gebiet 405 kraft ihres eigenen Geistes abzuschätzen vermögen und ihr Kunsturteil durch das Studium der antiken Literatur geschult haben" („qui vim Immani ingenii in hoc genere metiri possunt ex suo ingenio, et iudicium artis subactum habent antiquarum litterarum cognitione"). Wer ist das? Klopstockii, Wielandi, Vossii! (27). Damit ist die Strukturforschung an die - Dichter delegiert! Immerhin sagt Wolf an einigen Stellen bei aller .evasiveness', die ihm auch seine jüngsten amerikanischen Herausgeber bescheinigen38, doch noch genauer, 38
Grafton/Most/Zetzel 1985, 34.
164
Die Erforschung der Ilias-Struktur
was seiner Meinung nach auf jeden Fall nicht von Homer (dem primus auctor) stammt: Wenn das Thema von Homer stammt und wenn das Thema die μήνις Άχιλήος ist, dann können die letzten 6 Gesänge nicht von Homer sein. Denn die sieben Prooimionsverse kündigen nicht mehr an („nunquam [...] certis argumentis docebitur septem illos versus quidquam ultra promittere quam duodeviginti rhapsodias": 27), und die letzten sechs Gesänge enthalten ersichtlich nicht den Zorn Achills gegen Agamemnon und die Griechen, sondern einen neuen Zorn, der für die Griechen gänzlich ungefährlich ist; die letzten sechs Gesänge sind also lediglich eine appendix, von irgendeinem ingeniösen Rhapsoden der Folgezeit stammend („ab aliquo ingenioso rhapsodo proxime insequentis aevi composita": 27). Hier zeigt sich deutlich, wie subjektiv und ohne Sinn für Poesie die Argumentation ist (schon Cesarotti hatte in seiner Rezension der Prolegomena darauf verwiesen, daß gerade die letzten Iliasgesänge vielen als die besten gelten39, und E.-R. Schwinge hat 1981 just diesen Teil unserer Ilias als Gipfel- und Zielpunkt der Komposition gedeutet40). In der Tat wird im Prooimion zunächst nur eine gegen die eigenen Leute gerichtete μήνις angekündigt. Aber die Geschichte entwickelt sich ja, sie beginnt zu leben, der Groll hat Folgen, die ihn einholen und verwandeln... Doch das sind Kategorien, die erst Schadewaldt und Reinhardt entfalten werden. Wolf kennt nur die Logik der allerersten Ebene, die Logik des mathematischen Verstands. Das ist der erste Teil seines Erbes. Der zweite ist das Gefühl. „Sooft ich die letzten sechs Gesänge der Ilias gelesen habe, habe ich gefühlt (sensi), daß da gewisse Dinge sind (talia quaedam), die ganz unhomerisch klingen" (31). Wolf ist zu klug, sich bei .Gefühl, Gespür' festzulegen. Er schränkt sich, wie stets an den brisanten Stellen, selbst ein, stellt sich in Frage: „Aber dieses mein Gefühl will ich niemandem als Argument verkaufen" („Sed hunc sensum meum nemini pro ratione venditabo": 31). Daß er es gerade durch die Leugnung tut, ist oft bedauert worden. Bei dem Gemisch aus ratio und sensus ist es in der Folgezeit im Analyse-Unitarier-Streit geblieben. I 406 Dreierlei ist, was die Bedeutung dieser sechs Kapitel angeht, festzuhalten: (1) Wolf gibt der Iliasstruktur-Erforschung, indem er sie in die Textgeschichte einreiht, für die Zukunft einen wissenschaftssystematischen Ort. Strukturforschung muß nun nicht mehr als letztlich subjektives ästhetisches Geschäft betrachtet werden, sondern kann sich als Erfordernis begreifen, das bewältigt sein muß, bevor Interpretation beginnen kann. 39 40
Bei Finsler 1912, 465. Schwinge 1981.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
165
(2) Wolfs eigener Beitrag zur Iliasstruktur-Erforschung in ihrer durch ihn bestimmten neuen Position ist sehr gering. Erstens wird das Strukturgefiige insgesamt nicht durchgearbeitet (es bleibt im wesentlichen bei der 18 + 6-Beobachtung - die ua. bereits von d'Aubignac gemacht worden war 41 ), zweitens ist sich Wolf seiner Sache trotz aller Selbstermutigungen niemals sicher, er weicht aus, nimmt zurück, schiebt auf, verweist auf später, delegiert an andere und sät mit Fleiß Verdacht, besonders durch Hypothesen in Frageform (,wenn es aber nun so wäre, daß ...?'); daß er sich bei der Verkündigung der .neuen' Botschaft elend fühlte, verrät ein Ausdruck in dem Satz, mit dem er sie beginnt: „evanescunt ferme vestigia histórica, et in locum eorum trepide succedit coniectura et ratiocinatio" (26); er ist zutiefst erschüttert von der eigenen Kühnheit (was ihn positiv von den meisten seiner Jünger unterscheidet) und möchte sich daher nicht endgültig festlegen; mit Recht sprechen Grafton, Most und Zetzel 1985 von seiner „deliberate ambiguity", die ihm erlaubt habe, „to sit on both sides of the fence". 42 Er ist also nicht der starke Anwalt seiner Sache, zu dem die Nachwelt ihn gern machen wollte. Wer ihn immer und immer wieder liest, stellt fest, daß diese .ambiguity' schwerlich, wie oft unterstellt, Koketterie oder Taktik ist, sondern Ausdruck einer offenbar tatsächlich quälenden inneren Spaltung; er war - zumindest bei der Niederschrift - wohl wirklich noch für eine Widerlegung offen: „Ac ne nunc quidem haec disputo, ut cuiquam persuadeam, cui non ipsa res persuadeat, sed ut, si quid erraverim aut in falsum detorserim, erroris convincar ab acutioribus": Kap. 26 Anm. 84. (3) Wolf hat durch seine wiederholte Delegation der Strukturfrage an andere mit dem Auftrag, Indizien für die von ihm vermutete multiple Autorschaft der Ilias-Einheit zu sammeln, die Homerforschungsrichtung der ,Analyse' (und als deren Widerpart den ,Unitarismus') inauguriert. Er hat damit ein Forschungsfeld eröffnet, das, wenn es sich als das begriffen hätte, was es eigentlich sein sollte: Strukturforschung, das Verständnis der Ilias (und der Odyssee) bald auf ein höheres Niveau hätte heben können. Da aber die eigentliche Zweckbestimmung (nämlich die Iliasstruktur als Gesamtgefüge, wie es vorliegt, transparent zu machen) bald aus dem Blick geriet, entwickelte sich dieses Forschungsfeld zu einem Kampflschauplatz, auf dem es schließlich nur noch um den Preis des 407
41
Finsler 1912, 210; vgl. Grafton/Most/Zetzel 1985, 35: „... he never made a detailed internal analysis of the Homeric corpus." 42 Grafton/Most/Zetzel 1985, 34.
166
Die Erforschung der Ilias-Struktur
Scharfsinns ging. Es entstand, was Albin Lesky 1954 „das fragwürdigste Kapitel philologischer Forschung" nannte.43 (c) Von Heyne/Wolf bis Wilamowitz/Schadewaldt Die rund hundert Jahre des Analyse-Unitarier-Streites, die auf Wolfs geprobten Aufstand folgten, können und müssen hier im einzelnen nicht dargestellt werden. Die Hunderte von immer neuen Rekonstruktionsversuchen sind größtenteils von Finsler 1913 referiert worden (von Heyne bis Rothe 1910); bis zum Jahre 1929 hat Mülder in Bursians Jahresberichten (zuletzt Bd. 239, 1933) das Referat fortgeführt; danach trat eine Lücke ein, die nur unvollkommen geschlossen werden konnte durch vor allem Leskys ,Die Homerforschung in der Gegenwart' (1952), Heubecks ,Die Homerische Frage' (1974) und Holokas Homer-Berichte in der amerikanischen Fachzeitschrift ,The Classical World' (zuletzt Bd. 83/84, 1990, für die Jahre 1978-1983). Die gesamte Debatte ist gekennzeichnet durch eine ermüdende Repetitivität der Argumente und durch schrankenlose Subjektivität (die in der Regel als ,Logik', ,Sinn für Poesie' usw. verkauft wird). Daß das gar nicht anders sein kann, hat bereits Heyne in seiner Rezension von Wolfs .Prolegomena' ausgesprochen: „Historische Beweise fehlen für Ja und Nein; also muß historische Wahrscheinlichkeit entscheiden."44 Auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit ist aber dann natürlich alles möglich. Insgesamt dürfte heute die Mehrheit der Homeriker - insbesondere die nichtdeutschsprachigen - das Fazit unterschreiben, das Heubeck 1974 über eine ungeheuer detaillierte Arbeit der Analyse formuliert hat: „Schade, daß so viel Fleiß und Scharfsinn auf eine hoffnungslose Sache verwendet ist." 45 Der Grund dafür, daß diese Sache hoffnungslos ist, lautete in Wilamowitz' Urteil über Lachmanns Liedertheorie wie folgt: „Er glaubt die Ilias in ihre Teile zu sondern [...] In Wahrheit weiß er vorher, was sie sein soll." 46 Das Urteil trifft auf die gesamte Debatte zu: Analytiker wie Unitarier wußten immer schon vorher, was die Ilias sein sollte, da sie bereits antraten mit dem Ziel, entweder die Struktureinheit zu ,verteidigen' oder sie zu .vernichten'. Sie suchten nicht das innere Strukturgesetz der Ilias, wie sie da ist, zu erfassen, sondern sie schufen sich eine jeweils neue Ilias nach ihrem Bilde: jeder ein neuer Iliasdichter. 43
45 46
A. Lesky, Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Homerischen Epos (1954), in: Latacz .), Homer. Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979,297. Siehe oben Anm. 36. Heubeck 1974, 21 (über Theiler 1962). Wilamowitz, Ilias 21.
Die Erforschung der Ilias-Struktur
167
Der Umschwung deutete sich an bei Wilamowitz 1916 (,Die Ilias und Homer') und wurde vollzogen durch Schadewaldt 1938 (.Iliasstudien'). Wilamowitz entwirft bereits das künftige Programm: ! „In neuester Zeit scheint mir die Analyse, auch wenn sie von der Interpretation des einzelnen ausgeht, nicht selten in einen Fehler zu verfallen, den ich das Zerkrümeln nenne. Es wird da mit einer Vielheit von parallelen Fassungen und Bearbeitungen gerechnet, so daß am Ende von dem Gedichte nichts mehr übrig bleibt. Das liegt wieder daran, daß ein fremder Maßstab angelegt wird, der doch nicht der richtige sein kann, weil ihm zuliebe alles umgeformt werden muß, statt die Art des Dichters gelten zu lassen [...] Das Zerkrümeln führt am Ende dazu, sich aus der einen Ecke der Ilias einen Vers oder eine Versreihe zu holen und anderes anderswoher und sich daran zu freuen, wie hübsch es wäre, wenn das beieinanderstünde. Sie sagen dann, das wäre die wahre Ilias, und es ist doch ein Cento: Mit der Methode kann man viele Iiiaden machen; nur die Ilias, die wir haben, geht dabei verloren. Packen wir sie doch ganz ebenso an wie jeden anderen Text [...] Zunächst müssen wir das Gedicht als ein Ganzes angreifen, denn so liegt es vor uns [...] Es kommt ja nur auf das an, was die Ilias wirklich ist, und wie kann man das anders herausbringen als durch Interpretation?" (23 f.)
Das Gedicht muß also als ein Ganzes angegriffen werden, man muß die „Art des Dichters" gelten lassen, und die Arbeitsmethode sei die Interpretation! Damit ist gesagt, daß man sich auf die Dichtung einlassen muß und nichts an Kriterien von außen in sie hineintragen darf, was man nicht zuvor aus ihr selbst geschöpft hat. Dies ist in der Tat der Weg der wirklichen Vernunft, der seit Aristoteles von den einsichtigsten Geistern empfohlen worden war. Nietzsche hatte ihn so begründet: „Homer als der Dichter der Ilias und Odyssee ist nicht eine historische Überlieferung, sondern ein ästhetisches Urteil."47 Doch Wilamowitz, der so klar das Richtige erkennt, kann sich, wo es an die Praxis geht, noch immer aus der alten Zielsetzung, die Wolf vorgegeben hatte (und die er selbst vier Seiten vorher „nichts als negativ" nennt 48 ) nicht befreien: „Wenn es überhaupt gelingen soll, das Werden [!] der Ilias aus dem Zustande, in dem sie vorliegt, zu erschließen, so muß mit dem Abtragen der jüngsten Schichten begonnen werden [...] Die Vergleichung mit einer methodischen Ausgrabung drängt sich auf." 49 Die „Art des Dichters" (die doch gelten gelassen werden soll) ist also wieder nicht die Art des Dichters desjenigen Werks, das vor uns liegt, sondern des Dichters eines anderen, eines, das durch „Abtragen der jüngsten Schichten" zurückgewonnen werden muß. Es geht wieder nicht um das Sein der Dichtung, sondern 47 48 49
Bei Schadewaldt, Iliasstudien 28. Wilamowitz, Ilias 20. Wilamowitz, Ilias 24.
408
168
Die Erforschung der Ilias-Struktur
um ihr Werden. Damit ist trotz besserer Einsicht erneut der Weg beschritten, auf dem „am Ende von dem Gedichte nichts mehr übrig bleibt". Das vor uns liegende Kunstwerk wird zerschlagen und zur Seite geräumt, um darunter nach ei409 nem I imaginären .wahren4 Kunstwerk zu suchen. Entsprechend ist sofort das alte Instrumentarium wieder da: Spitzhacke, Geologenhammer, Lupe und Sombrero. Wie sich das in der Praxis auswirkt und worin die Leistung Schadewaldts besteht, der alles das beiseite legen wird, um wirklich die „Art des Dichters" zu erfassen, kann nur ein intensives vergleichendes Studium der beiden Bücher zeigen. Den Unterschied der Sichtweisen und Methoden aber mag hier die Kontrastierung der Behandlung eines exemplarischen Iliasteils verdeutlichen, des 11. Gesangs, des A. Für Wilamowitz besteht das Λ aus „zwei Stücke[n] [...] die gar nichts miteinander zu tun haben" (182), einem , Verwundungs- oder Schlachtgedicht' (Λ 1 ) 1-596, und einer .Nestoris' (Λ 2 ), 597-848. Λ1 ist ein „Prachtstück künstlerisch geschlossener Komposition" (182), ein „schön profilierter Geisonblock, dem [hinten] nur ein Stück abgeschlagen ist" (197). Λ 2 hingegen ist ein „jüngeres Stück" (207), „recht hübsch, aber recht unfrei" (206), „völlig abgerundet" (206), und „an ein Proömion ließe es sich bequem anfügen" (206) (und er erfindet eines: vier Hexameter offenkundig auf den Spuren Wolfs, der gar vier Verse eines völlig neuen Ilias-Proomions erfunden hatte, das viel besser passen würde: Kap. 27). In Λ1 hat ein wieder anderer Dichter noch eine „Einlage" (192) eingefügt: 499-520 (Nestor fährt den verwundeten Arzt Machaon aus der Schlacht), die zur Vorbereitung von Λ 2 erfunden worden ist, und zwar „wie jeder sofort sieht, ganz fremdartig" (192), „durchaus nicht schlecht, fällt aber gegen den hohen Ton von Λ ab" (192). Ferner steht am Schluß von Λ1 noch ein viertes Stück: 575-596 (Eurypylos wird verwundet), „eine ganz späte und elende Interpolation, geradezu ein Cento, in dem kaum hier und da ein paar nicht entlehnte Wörter stehen" (194). Für Schadewaldt ist Λ1 ebenfalls eine „geschlossene Einheit", wie Wilamowitz gezeigt habe, aber kein Einzelgedicht. Denn das Versprechen des Zeus (V. 187 ff.) sichert Hektor den Sieg zu (9), aber Hektor wird dreimal ,angesetzt' und dreimal .zurückgezogen' (12). Nun verlangt ein Einzelgedicht, weil es ja „in kleinem Maßstab Großes zeigen will, bei wechselnden Formen schnelle Entwicklung und baldigen Eintritt dessen, worauf es ankommt" (12). Infolgedessen kann Λ 1 nie ein .Einzelgedicht' gewesen sein (14). Wie ist dann die Voraussage an Hektor zu erklären? Nun, der in 187 f. vorausgesagte Einbruch Hektors in die Schiffe erfolgt tatsächlich aber am Ende des O! Also dreieinhalb Gesänge später! Also ist ein neuer Blickpunkt nötig, werden neue Kategorien erforderlich, die aus dem bei Wilamowitz herausgekommenen Unsinn Sinn machen. Diese Kategorien können nur sein: Vorbereitung - Arbeit auf weite Sicht - Vorblick und Aufschub - Spannung (zu dem das ,Beinahe' gehört): 15. Wenn man unter diesem neuen Blickpunkt sieht, daß sich von Λ bis zu Σ ein großer Bogen spannt, mittels dessen ein Plan auf weite Sicht verwirklicht wird (17), dann erschließt sich einem Λ 1 als „die Vorbereitung dieser Plan-Realisierung und somit [...] ein .Gebilde von letzter Hand'" (17). Auch vom Inhalt her kann ja Λ1 nie ein Einzelgedicht gewesen sein, da dann sein Thema gewesen wäre .Flucht zu
Die Erforschung der Ilias-Struktur
169
den Schiffen'. Das ist kein Gegenstand für ein .altes Einzellied'. Das Stück ist also schon im Keim nicht anders denn als Teil eines vorgefaßten größeren Ganzen vorstellbar (72 f.). - Auch Λ 2 ist Anfang einer Bewegung, niemals der Anfang eines .Einzelgedichts' (Thema: .Ein Verwundeter wird aus der Schlacht gefahren'!). Es ist eine .Szene', ein .Akt', ein „Bauglied, das über sich hinausweist" (19). Die ganze „Nestor-Patroklos-Episode ist die Vorbereitung der Patroklie" (20). - Ferner sind die Verse 499-520 keine „Einlage", sondern ein Verbindungsstück, an dem sich die Verknüpfungstechnik des Diasdichters sehen läßt (76): Vom Schlachtgeschehen zweigt ein Nebenweg ab, der zu dem neuen Geschehensraum hinüberführt, an Achill vorbei: das ist die „Klammertechnik" des Diasdichters (76). - Auch 575-596 ist nicht ein „Cento", sondern eine Verklammerungsszene: die Machaon-Klammer verklammert mit dem Anfang von Λ 2 , die Eurypylos-Klammer mit dessen Ende: beides zusammen zeigt die .Episodentechnik', I die bei 410 der Szenenkomposition eines Gro/3-Epos nötig wird. - Betrachtet man so das Λ nunmehr im ganzen, dann zeigt sich: In Λ 1 wird Hektor auf Achilleus zugetrieben (aber zurückgenommen und aufgehoben) - in Λ 2 wird Achilleus auf Hektor zugetrieben (aber aufgeschoben). Das ist „Technik der gestaffelten Vorbereitung" (150), es ist „überlegene dichterische Strategie" - das ist die „Handschrift Homers" (24).
Der Unterschied ist deutlich: Wilamowitz löst auf und zerstört, Schadewaldt sieht zusammen und erhält. Wilamowitz schneidet Ganzheiten auf, zerlegt sie in Einzelteile und gibt den Einzelteilen nach einem von ihm selbst erdachten, freilich keineswegs systematisch erarbeiteten Benotungsverfahren Zensuren: .künstlerisch geschlossen', ,schön profiliert', .abgeschnitten', ,recht hübsch', ,ganz fremdartig', .durchaus nicht schlecht' usw. Die so benoteten Einzelstücke werden dann klassifiziert: .Geisonblock', .Einlage', .Interpolation' usw. Was vorliegt, ist ein aus eigener Machtvollkommenheit geübtes Willkürregiment, dem sich das Werk zu unterwerfen hat. Schadewaldt hingegen fallt keine Qualitätsurteile, sondern fragt nach der Funktion der (auch von ihm durchaus gesehenen) Teile. Entsprechend ist seine Terminologie rein funktional: ,Szene', ,Akt',,Bauglied',,Verklammerung', .Verknüpfungstechnik' usw. Das ist prinzipiell die gleiche .strukturalistische' Betrachtungsweise wie bei Aristoteles. Nur geht sie nicht mit Aristoteles' Begriffen an das Werk heran, sondern schafft sich aus dem aufmerksamen Blick auf die Sache ihre eigene Terminologie. Die Folgerungen aus seiner Methode zieht Schadewaldt dann so: Es sei zu fragen ,Wo ist das gleiche Stilgepräge wie im Λ?' (28). Er meint mit ,Stilgepräge' nicht das gleiche wie Wilamowitz mit ,StiP. Er meint also nicht .Prachtstück', ,recht hübsch' und .elende Interpolation', sondern .Szenen- und Klammertechnik', .Vorbereitung und Aufschub', ,Spannungssteigerung und Retardation'. Stellt man die Frage so, glaubt er, dann „muß Schritt für Schritt am Gegenstande selbst das lebendige Baugesetz der Ilias anschaulich werden". Denn: „Homer beurteilen lernen heißt ästhetisch urteilen lernen" (Nietzsche)
170
Die Erforschung der Ilias-Struktur
(28). Damit ist das uralte Prinzip wieder in sein Recht gesetzt, das schon der Struktur-Erforschung des Aristoteles den Erfolg verbürgte: Man pfropft Homer nicht seine eigene, notwendig beschränkte Ästhetik auf, sondern man gewinnt seine Ästhetik aus Homer. Das führt nun allerdings nicht zu einer Teile aussondernden Baugeschichte, sondern zu einem dynamisch mitgehenden Nachvollziehen der Timi-Idee. Es kann nicht zweifelhaft sein, welches dieser beiden Konzepte der Iliasstruktur-Erforschung einem sprachlichen Kunstwerk adäquater ist. Bestätigung dafür, daß Schadewaldt die richtige Sicht hatte, läßt sich vor allem aus der allgemeinen Erzählforschung gewinnen. Schadewaldts Kategorien wie , Vorausdeutung, Verknüpfung, Retardation' usw. finden sich in diesem Forschungszweig, der auf die allgemeinen Normen aus ist, allenthalben wieder. In Eberhard Lämmerts , Bauformen des Erzählens' gelten den ,Rückwendungen' und den ,Vorausdeutungen' ganze eigene Kapitel. Bei Lämmert findet sich aber vor allem das Grundkonzept der Schadewaldtschen Struktur-Erforschung wieder: das Ausgehen von 411 dem, I was Lämmert die .Koexistenz von Einzelgliedern im sprachlichen Kunstwerk' nennt und von wo aus er zum Begriff der ,sphärischen Geschlossenheit des Erzählwerks' gelangt. Lämmerts Werk ist zu einem Klassiker der Literaturwissenschaft geworden, weil es die Struktur von Erzählwerken auf einer primären (funktionalen) Ebene von offenbar universaler Gültigkeit transparent macht. Schadewaldt ist auf eigenem Weg zu analogen Kategorien gekommen. Der Grund, warum z.B. Heubeck Schadewaldts ,Iliasstudien' „das wohl wichtigste deutsche Homerbuch nach Wilamowitzens ,Die Ilias und Homer'" nennt 50 , ist letztlich in dieser eigenständigen Leistung zu sehen. (d) Von Wilamowitz/Schadewaldt bis zur Gegenwart Auf die Erstauflage der Schadewaldtschen ,Iliasstudien' (1938) folgten Krieg und Nachkriegszeit. Die Bedeutsamkeit von Schadewaldts Neuansatz ging zunächst unter. Statt der Weiterführung der durch Schadewaldt begründeten neuen Form von Iliasstruktur-Erforschung erlebte zunächst noch einmal die alte Methode der Analyse eine Renaissance. Die Namen Theiler, Jachmann, Von der Mühll bezeichnen die Nachblüte eines Programms, das in forschungssystematischem Betracht schon überholt war. Natürlich waren auch diese Werke, wie alle Werke des Analyse-Unitarier-Streits seit Wolf, für die Iliasdeutung als solche
50
Heubeck 1974, 49.
Die Erforschung der Eias-Struktur
171
nicht etwa unfruchtbar. Die Struktur-Erforschung freilich brachten sie nicht voran. Das gleiche muß auch von den allermeisten Arbeiten der nach dem zweiten Weltkrieg aufgeblühten Oral poetry-Forschung festgestellt werden. Für die Homer-Interpretation als solche und für die Rekonstruktion der Arbeitsweise eines Sängerdichters wie Homer ist die Richtung von unschätzbarem Wert. Die Struktur der Ilias, um die allein es uns hier geht, ist durch diese Richtung allerdings bisher nicht entscheidend aufgehellt worden (im Fall der Odyssee sieht es, insbesondere dank Feniks Arbeiten, anders aus51). Die Neo-Analyse (oder motivgeschichtliche Forschung, s. den Beitrag von Wolfgang Kulimann unten S. 425 ff. [hier nicht abgedruckt]) kann im Rahmen unseres Themas außer Betracht bleiben, da sie ausdrücklich (, Motiv geschickte') den genetischen Aspekt im Blick hat. Ihre Rekonstruktionen können, wo sie in Vermeidung der Selbstgewißheit der alten Analyse Wahrscheinlichkeiten sichtbar machen, das Verständnis für das Sosein der Iliasstruktur bedeutend fördern. Die Homerforschung hat sich in den letzten etwa drei Jahrzehnten stark erweitert. Heute umfaßt sie neben der eigentlichen Philologie auch Archäologie, Alte Geschichte, Sprachwissenschaft, Religionswissenschaft, verschiedene Zweige der I Literaturwissenschaft und viele andere Gebiete. Das Erkenntnis- 412 interesse ist infolgedessen weitgestreut, die Produktion auf dem Gesamtgebiet kaum noch überschaubar.52 Die Erforschung der Struktur der beiden Epen steht nicht im Mittelpunkt. Sie ist sogar infolge des Verblassens des Analyse-Unitarier-Streites in den letzten 30 Jahren an den Rand gedrängt worden. Es ist daher verständlich, daß Werke, die Schadewaldts Ergebnisse in großem Stile weiter ausgebaut hätten, zunächst noch ausgeblieben sind. Arbeiten, die kleineren Komplexen innerhalb der Textcorpora gelten oder die spezielle Strukturprobleme in den Blick nehmen, gibt es mehrere, etwa die Studien von Beßlich, Krischer, Lohmann, Nicolai. In allen ist der Einfluß Schadewaldts beträchtlich. Das gilt auch von zwei Arbeiten, die am ehesten als gezielte Iliasstruktur-Erhellungen gelten können: von Heubecks .Studien zur Struktur der Ilias' und von Karl Reinhardts großangelegtem Versuch 53 , über Schadewaldts ,strukturalistischen' Ansatz noch mehr ins Individuelle vorzustoßen, die Dichtungsweise des Iliasdichters über das Normative hinaus in ihrem lebendigen Vollzug architektoni-
51 52
Vor allem Fenik 1974. Verf., Alfred Heubeck und die deutsche Gräzistik, Gymnasium 94, 1987, 341-345 (hier:
345). 53
Reinhardt, Dias.
172
Die Erforschung der Dias-Struktur
sehen Bauens an einem lebenslang als Aufgabe gefühlten Einzelbauwerk nachvollziehbar zu machen. Schadewaldts resignativer .Epilog', jenes Zitat aus Goethes .Dichtung und Wahrheit', das er der 3. Auflage der ,Iliasstudien' 1966 beigab 54 , ist insoweit nicht berechtigt. Arbeiten aus neuerer Zeit - seit ca. 1980 können sogar zeigen, daß das Interesse für die Iliasstruktur-Erforschung nicht nur in der nicht-deutschsprachigen Welt (wo man Schadewaldt erst spät .entdeckte') wiedererwacht ist.55 Das große Iliasbuch, das man sich nun, nach Analyse, Unitarismus und Oral poetry-Forschung, denken könnte, wird zwar wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Doch auf die Dauer wird - das macht Emst-Richard Schwinges Beitrag in diesem Bande [hier nicht abgedruckt] deutlich - der Wunsch nach Einsicht in die Struktur jenes Werkes, das die Kriterien der europäischen Poetik so tief bestimmt hat, der Ilias Homers, sich nun durch Forderungen nach Beschäftigung mit Wichügerem kaum mehr von seinem Ziel abbringen lassen. I
54
Schadewaldt, Iliasstudien 3 1966, 183. Siehe die Arbeit von Andreae/Flashar 1977; die Studien von Köhnken und Latacz in: Latacz, Dichtung; die Strukturanalysen in: Latacz, Homer; die Arbeiten von Schwinge 1981 und in diesem Bande [hier nicht abgedruckt]; die Arbeiten von de Jong (zitiert im Beitrag Schwinge). Vorher schon wichtig: Hellwig und Friedrich (unten zitiert im Beitrag Schwinge). Weiteres im Beitrag von Uvo Hölscher zur Odyssee-Struktur, unten S. 415 ff. [hier nicht abgedruckt]. 55
Die Erforschung der Elias-Struktur
173
Abgekürzt zitierte Literatur Andreae/Flashar,
Beßlich (1966)
Fenik (1974) Finsler 1912 Finsler 1913 Fuhrmann, Dichtungstheorie Fuhrmann 1986 Gentiii 1989
Grafton/Most/Zetzel (1985)
Hainsworth, Odissea
Heubeck 1950
Heubeck 1974 Holoka (1990) Jachmann (1949) Kerschensteiner, Kosmos Koster, Epostheorien Krischer (1971) Lämmert
B. Andreae/H. Flashar, Strukturaequivalenzen zwischen den homerischen Epen und der frühgriechischen Vasenkunst, Poetica 9, 1977, 217-264 (= H. Flashar, Eidola. Ausgewählte Kleine Schriften, hrsg. v. M. Kraus, Amsterdam 1989, 7-55). S. Beßlich, Schweigen - Verschweigen - Übergehen. Die Darstellung des Unausgesprochenen in der Odyssee, Heidelberg 1966. B. Fenik, Studies in the Odyssey, Wiesbaden 1974 (Hermes Einzelschriften, H. 30). G. Finsler, Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe, Leipzig-Berlin 1912. G. Finsler, Homer, Berlin 1907. 2 1913. M. Fuhrmann, Einführung in die antike Dichtungstheorie, Darmstadt 1973. Aristoteles, Poetik, griechisch-deutsch von M. Fuhrmann, Stuttgart 1986. B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma - Bari 1984. 2 1989. A. Grafton/G. W. Most/J. E. G. Zetzel (Hrsg.), F. A. Wolf, Prolegomena to Homer, translated (etc.) by G./M./Z., Princeton 1985. J. B. Hainsworth, Kommentar zu Odyssee 5-8, in: Omero, Odissea, vol. Π, Milano 1982 (englisch: A Commentary on Homer's Odyssey, vol. I, Oxford 1988). A. Heubeck, Studien zur Struktur der Ilias (Erlangen 1950), in: Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, hrsg. v. J. Latacz, Darmstadt 1991, 450 ff. A. Heubeck, Die Homerische Frage. Ein Bericht über die Forschung der letzten Jahrzehnte, Darmstadt 1974 (Erträge der Forschung, 27). J. P. Holoka, Homer Studies 1978-1983, Classical World 83, 1990, 393-461 (Part I); 84, 1990, 89-156 (Part Π). G. Jachmann, Homerische Einzellieder, in: Symbola Coloniensia J. Kroll oblata, Köln 1949. Repr. Darmstadt 1968. J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern, München 1962 (Zetemata, 30). S. Koster, Antike Epostheorien, Wiesbaden 1970 (Palingenesia, V). T. Krischer, Formale Konventionen der homerischen Epik, München 1971 (Zetemata, 56). E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1955 u. ö.
413
174 Latacz, Homer Latacz, Dichtung Lesky (1952) Lesky 1967 Lohmann (1970)
Die Erforschung der Ilias-Struktur J. Latacz, Homer. Der erste Dichter des Abendlands, München-Zürich 1985. 2 1989. J. Latacz (Hrsg.), Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, Darmstadt 1991. A. Lesky, Die Homerforschung in der Gegenwart, Wien 1952. A. Lesky, Horneros, in: RE Suppl XI, Stuttgart 1967 (Sonderausgabe). D. Lohmann, Die Komposition der Reden in der Ilias, Berlin 1970 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 6).
Maehler 1963
Marg 1971 414
Mattes, Odysseus Nickau 1966 Nicolai (1973) Reinhardt, Ilias Schadewaldt, Iliasstudien Schadewaldt 1958 Schwinge 1981
Theiler (1962) Von der Mühll 1952 Wilamowitz, Ilias Wolf, Prolegomena
H. Maehler, Die Auffassung des Dichterberufs im frühen Griechentum bis zur Zeit Pindars, Göttingen 1963 (Hypomnemata, 3). W. Marg, Homer über die Dichtung. Der Schild des Achilleus, Münster 1957. 2 1971 (Orbis antiquus, 11). I W. Mattes, Odysseus bei den Phaiaken, Würzburg 1958. K. Nickau, Epeisodion und Episode. Zu einem Begriff der aristotelischen Poetik, MusHelv 23, 1966, 155-171. W. Nicolai, Kleine und große Darstellungseinheiten in der Ilias, Heidelberg 1973. K. Reinhardt, Die Ilias und ihr Dichter, hrsg. v. U. Hölscher, Göttingen 1961. W. Schadewaldt, Iliasstudien, Leipzig 1938. 'Darmstadt 1966. W. Schadewaldt, Homer. Die Odyssee. Übersetzt in deutsche Prosa von W. Sch., Reinbek 1958 u. ö. E.-R. Schwinge, Homer, Ilias, in: Literaturwissenschaft. Grundkurs 1, hrsg. v. H.Brackert u. J. Stückrath, Reinbek 1981, 106-118. W. Theiler, Ilias und Odyssee in der Verflechtung ihres Entstehens, MusHelv 19, 1962, 1-27. P. Von der Mühll, Kritisches Hypomnema zur Ilias, Basel 1952. U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer, Berlin 1916. F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum sive de Operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabili ratione emendandi, vol I, Halis Saxonum 1795.
Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, WdF Bd. 634, Darmstadt 1991, 515-551 [ursprünglich in: Gnomosyne. Festschrift für Walter Marg zum 70. Geburtstag, hrsg. von Gebhard Kurz, Dietram Müller und Walter Nicolai, München: Beck, 1981, 53-80]
Zeus' Reise zu den Aithiopen (Zu Ilias I, 304-495) Aber die Dias ist nicht früh (Walter Marg, 1957) Es gilt umzulernen. Das Große rückt an das Ende (Karl Reinhardt, 1961)
I
In den Jahren um 1960, als die zum Motto gewählten Worte niedergeschrieben wurden, konnte sich die Überzeugung, daß die Ilias spät, d. h. ein Werk der Reife ist, in Deutschland auf nur eine Forschungsmethode stützen: auf jenes damals schon 150 Jahre lang praktizierte Verfahren, das wir .Analyse' nennen. Seither sind zwei weitere Verfahren hinzugekommen: das der Oral poetry-Theorie und das der allgemeinen Erzählforschung. Die Analyse war, indem sie die Ilias (wie die Odyssee) für sich allein in den Blick nahm, prinzipiell einzelwerkgebunden. Mit der Oral poetry-Theorie wurde der Schritt über das Einzelwerk (und die Einzelsprache) hinaus getan: das Epos als Gattung kam in den Blick, und zwar nicht nur das griechische und lateinische Epos, sondern das Epos .aller Völker und Zeiten'. 1 Dieser zweite Weg, der hundert Jahre vorher schon einmal I be- 516
1 C. M. Bowra, Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten, Stuttgart 1964. - Die im Folgenden verwendeten bibliographischen Abkürzungen sind: Heubeck (1974) A. Heubeck, Die homerische Frage. Ein Bericht über die Forschung der letzten Jahrzehnte, Darmstadt 1974 (Erträge der Forschung 27).
176
Zeus' Reise zu den Aithiopen
gönnen worden war, seitdem jedoch ,auf freiem Felde' endete,2 hatte eine erste Erhöhung des Standpunktes zur Folge: die Ilias erschien nun nicht mehr als alleinstehendes Einzelgebäude, durch dessen Zimmerfluchten sich jeder Forscher unter Vemagelung je anderer Türen, Durchbrechung je anderer Wände und Abtrennung je anderer Flügel und Etagen seinen eigenen Königsweg zur Rekonstruktion der .ursprünglichen' Bau-Idee bahnen durfte, sondern sie erschien nun als ein Gebäude neben vielen ähnlichen. Allein durch die Ähnlichkeiten verbot sich manche .Vemagelung' nun ganz von selbst. Die Zahl der bisher als Singularitäten nach Nivellierung schreienden .Ungewöhnlichkeiten' (vor allem im großen Bereich der Wiederholung3) nahm damit deutlich ab.
517
Mit der allgemeinen Erzählforschung, deren Auswertung für die Homerphilologie (wie für die Klassische Philologie überhaupt) heute noch in den Kinderschuhen steckt,4 wird diese Erl Weiterung des Blickfelds voraussichtlich ein weiteres Stück vorankommen: Die Ga«M«gsgebundenheit der Oral poetry-Theorie und der mit ihr mitgegebenen vergleichenden Epenforschung wird aufgehoben werden durch eine zweite Erhöhung des Standpunktes: vom Subtyp ,Epos' hinauf zum Typ ,Erzählwerk'. Daß damit eine weitere Relativierung - wo nicht Eliminierung - der unumstößlichen »Ecksteine' der Analyse einhergehen wird, ist abzusehen. Denn je klarer sich die sachbedingten Strukturierungsmittel und
Lachmann (1847) Lämmeit Lesky (1967) Reinhardt WdFH
2
K. Lachmann, Betrachtungen über Homers Ilias. Mit Zusätzen von Moriz Haupt, Berlin 1847. E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart (1955) 7 1980. A. Lesky, Horneros, Sonderdruck aus RE, Suppl.-Bd. XI, Stuttgart 1967. K. Reinhardt, Die Ilias und ihr Dichter, hrsg. von Uvo Hölscher, Göttingen 1961. J. Latacz (Hrsg.), Homer. Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979 (WdF 463)
Dazu J. Latacz, Tradition und Neuerung in der Homerforschung, WdFH, 40 f. Grundlegend zum Problem der .Wiederholungen' B. Fenik in: Studies in the Odyssey, Wiesbaden 1974, S. 133-142, in deutscher Übersetzung in WdFH, 540-555. 4 Erwähnt sei hier der anregende und zukunftsweisende Versuch von W. Nicolai, Kleine und große Darstellungseinheiten in der Ilias, Heidelberg 1973 (dessen literaturwissenschaftlichen Ausgangs- und Zielpunkt T. Krischer im Gnomon 49, 1977, 225-229, kaum zureichend gewürdigt hat). - Zu Anwendungsversuchen in der Caesarforschung s. J. Latacz, Zu Casars Erzählstrategie, Der Altsprachliche Unterricht 1978, Heft 3, 70-87 [in diesem Band S. 523-545]. Das Ziel der typologischen Erzählforschung ist es, Formen aufzusuchen, die „gerade dies als Kennzeichen aufweisen, daß sie in allen existierenden und denkbaren Werken der Erzählkunst auftreten können"; daß „gerade die historische Dichtungsbetrachtung" (d. h. die Einzelinterpretation) „aus dem Aufweis typischer Grundformen Nutzen ziehen" kann (Lämmert 16 f.), ist evident. 3
(Zu ñias I, 304-495)
177
-gewohnheiten des Erzählers als solchen - in welcher Erzählgattung auch immer - herauszubilden beginnen, als desto beschränkter beginnt die Innensicht einer Homerphilologie dagegen abzufallen, die sich um die empirisch ableitbaren Gesetze literarischen Bauens - erfolge es nun schriftlich oder mündlich - weniger bekümmerte als um die Etablierung und sorgsame Pflege so unobjektivierbarer Kategorien wie .Angemessenheit', ,Passendheit', .Schönheit' oder gar ,Dezenz'. Allerdings bedeutet .Beschränktheit' nicht Entbehrlichkeit. Von den bisher begangenen Hauptwegen der Homerphilologie ist jeder so nötig wie der andere. Sich auf einen von ihnen festzulegen und die anderen abzulehnen oder gar zu ignorieren, wie es im Kreise der Homeriker leider immer noch geschieht, muß als kurzsichtig und forschungshemmend gelten. Das Phänomen der .Reserve', mit der man der je anderen Richtung .gegenüberstehen' zu dürfen glaubt, dürfte Residuum einer unter den heutigen Wissenschaftserfordernissen nicht mehr aufrechtzuerhaltenden idealistischen Auffassung von der Autonomie der Forscherpersönlichkeit sein. Was in den skizzierten drei Wegen der Homerforschung vorliegt, das sind nicht Wahlmöglichkeiten, sondern Stufen der Annäherung an den Forschungsgegenstand. Die je höhere Stufe setzt die niedere voraus; die Innensicht der Analyse samt ihrer Umkehrung: der Synthese, und die Außensicht der vergleichenden Epen- und Erzählforschung müssen sich, wenn Wissenserweiterung erzielt werden soll, im Forscher vereinen, - so wie sich bei jeder Kunstwerkdeutung die genaueste Vertiefung ins Detail mit der zurücktretenden Distanzierung typologisch-vergleichender Ganzheitenbetrachtung verbinden muß. Anders werden wir I der aus der allgemeinen Literaturwissenschaft kommenden Herausforderung einer noch höheren Abstraktionsstufe, wie sie neuerdings etwa in Gestalt der heranreifenden Literatursemiotik an uns herantritt,5 schwerlich gewachsen sein.
Das hier entworfene Drei-Stufen-Modell einer Homerphilologie, die ihren Blickpunkt ständig weiter nach ,außen' zu verlegen bereit ist und sich dabei doch ihren Ausgangspunkt der engstmöglichen Textnähe - auch auf der höchsten ,Außensicht'-Stufe - stets gegenwärtig hält, kann sich durch vielerlei Vorzüge empfehlen. Sie alle aufzuzählen und abzuhandeln ist hier nicht der Ort. Nur auf einen von ihnen - den methodologisch wichtigsten - soll hier hingewiesen werden: auf die Möglichkeit der Ergebnissicherung durch Methoden,Suppletion'. Wir belegen diese Möglichkeit mit einem konkreten Forschungsverlaufsfall, der uns sowohl zu unserem Eingang zurück- wie zu unserem eigentlichen Thema hinfuhren wird: Das in den Motti dieser Arbeit ausgedrückte Ergebnis der Iliasforschung war, solange es sich auf das Verfahren der Analyse allein stützen mußte, nur relativ schwach fundiert. Denn die Analyse war wegen ihrer mangelnden Intersubjektivität im Bewußtsein der Zunftgenossen wie der interessierten Öffentlichkeit zu einer Art ironisch belächelten Sandkastenspiels geworden, und selbst forscheste ® Siehe z. B. A. Eschbach/W. Rader (Hrsg.), Literatursemiotik I, Tübingen 1980 (darin besonders: D. Janik, S. 135-147).
518
178
Zeus' Reise zu den Aithiopen
Analytiker waren sich bei aller subjektiven Überzeugtheit von der Schlüssigkeit ihres Gedankengebäudes der letztlichen Unverbindlichkeit ihrer Rekonstruktionsversuche bewußt. Dieses verbreitete Unverbindlichkeitsgefiihl, das das ganze Analyse-Synthese-Ballspiel begleitete, färbte auch auf das vielleicht einzige Analyse-Ergebnis ab, das - wie wir heute wissen - objektiv richtig war: daß unsere Ilias ein später - in der negativ wertenden Terminologie der Analytiker .Zusammenschnitt' zahlloser vorausliegender Thema-Versionen sei. Das allgemeine Mißtrauen auch gegen dieses Ergebnis wurde noch vermehrt durch die Unfähigkeit der Analyse, eine wirklich plausible konkrete Vorstellung vom Zu519 standekommen eines solchen I .Zusammenschnitts' zu entwickeln. Änderung brachte erst das zweite Forschungsverfahren, die Mündlichkeitstheorie Parrys, Bowras und ihrer Schüler. Nachdem hier auf unabhängigem Wege das im Prinzip gleiche, nur positiv gewertete Ergebnis erzielt worden ist, und nachdem darüber hinaus die Erzählforschung ihrerseits solche Strukturen, wie sie auch unsere Ilias prägen, als hochorganisierte Spätschöpfungen ausgewiesen hat,6 nachdem also alle drei Wege unabhängig voneinander zum gleichen Resultat geführt haben, sind Mißtrauen und Zweifel gegenüber der Einsicht, daß die Ilias „nicht früh" ist, heute nicht mehr rational vertretbar. Dies um so weniger, als durch das Zusammenspiel der Verfahren nunmehr auch eine plastische Vorstellung von der Art gewonnen werden konnte, wie in einer Tradition mündlicher Ependichtung überhaupt „das Große an das Ende rücken" kann. Wir wissen jetzt: immer wenn traditionelle mündliche Dichtung den höchstmöglichen Grad ihrer technischen Perfektion erreicht hat, ist potentiell der glückliche Augenblick des großen Wurfs gegeben; denn nun kann der Sänger in souveräner Verfügung über alle Handwerksgriffe und -geräte frei werden für das jenseits aller Technik liegende .Große'. Das ist in der Kunstform .mündliche Dichtung' nicht anders als in allen anderen Künsten. Ob dieser potentielle Augenblick genutzt wird oder ungenutzt vorüberstreicht, das allerdings hängt vom Zusammentreffen oder Ausbleiben sehr verschiedenartiger historischer Komponenten ab; im Falle Homers hat der Glücksfall sich ereignet. Die drei bisher bekannten Hauptwege der Homerforschung haben also das, was Walter Marg, Karl Reinhardt und andere um 1960 als ihre persönliche, durch Kombination von Textkenntnis und Kenntnis der damaligen Forschungsgeschichte zustandegekommene Überzeugung aussprachen, inzwischen durch gegenseitige Ergebnisbestätigung in den Rang nahezu einer Gewißheit erhoben:
6
Vgl. dazu Lämmert 23 f. mit 30 f. (zur erzähltechnischen Komplexität der Ilias).
(Zu ¡lias I, 304-495)
179
Die Ilias, so wie wir sie haben, ist in der Tat ,spät', und das Große an ihr ist in der Tat ein Ausfluß eben dieser Spätheit. Diese Erkenntnis (die sich gerade an den Schnittpunkten der I genannten drei 520 Forschungswege, also bei denjenigen Forschern in aller Welt, die die Integration der Wege oder .Schulen' betreiben, im letzten Jahrzehnt zu einem kraftvollen Konsens verdichtet hat) hat für die Homerforschung der jüngsten Gegenwart eben jene höchsterfreuliche praktische Kursänderung zur Folge, die durch die theoretische Horizonterweiterung gefordert war: Das Konstruieren von idealen Ur-Iliaden und dazugehörigen Depravationsgeschichten ist aus der Mode gekommen und hat - hoffentlich endgültig - dem ernsthaften Bemühen um Erfüllung einer uralten Forderung Platz gemacht, die z.B. R. A. Schröder im Jahre 1937 folgendermaßen formulierte: „die Ilias nicht als ein .Gewordenes', sondern als ein ,Gekonntes', ein ,Kunst'-Werk anzusehen7". Diese Forderung schien schon einmal der Erfüllung nahe. Als im Jahre 1938 Schadewaidts .Iliasstudien' erschienen - das, wie man ein Vierteljahrhundert später sah, „wohl wichtigste deutsche Homerbuch nach Wilamowitzens ,Ilias und Homer'" (Heubeck 1974, 49), die „große Wende" (Lesky 1967, 79) - , da schien ja in der Tat „die Frage nach dem Kunstwerk,wie wir es in Händen halten, und nicht nach seinen Vorgängern, in der Mitte" zu stehen (Lesky 1967, 92). Aber die methodische Grundsituation der Homerphilologie war damals einfach noch nicht zwingend genug, die Wiederaufnahme (oder gar unbewegte Fortsetzung) der Analyse-Konstruktionen auch noch nach Schadewaldt als den methodisch unmöglichen Rückfall erscheinen zu lassen, der er - wie wir heute sehen - in Wirklichkeit war. Immer noch, auch bei Schadewaldt, geschah ja alles, was geschah, auf dem einen, dem ersten Wege der Forschung, jenem Wege, den die Analyse geschaffen hatte, - nur daß Schadewaldt ihn in umgekehrter Richtung gegangen war. So konnte es nach wie vor als legitim erscheinen, die Richtung eben emeut umzukehren. War Schadewaldt auch ein .besserer' Unitarier als alle vor ihm, so blieb er doch ein Unitarier, und also galt es nichts anderes, als nun eben auch ein .besserer' Analytiker zu sein. Theiler, Jachmann, Von der Mühll, Marzullo (um nur sie zu nennen) handelten also nur folgerichtig, und das alte Spiel begann von neuem. Und so mußte denn Schadewaldt, als er 1965 die ,Diasstudien' zum dritten Male in die Welt entsandte, sein Werk im .Epilog 1965' voll hilflosen Stolzes dem Schiff im Ozean des Irrtums vergleichen, des Irrtums, „der sich, wenn vorzügliche Geister ihn beiseite I gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zu- 521 sammenschließt". 8 Ein paar Jahre später schon hätte er nicht mehr in dieser Weise resigniert. Aber 1965, als er den ,Epilog' niederschrieb, sah er noch nicht, daß er den Schlüssel zur Öffnung des .ptolemäischen Weltbilds' der Homerphilologie längst schon in den Händen hielt: Schon auf S. 25 der .Iliasstudien' hatte er einen Blick über den Zaun der textimmanenten Interpretation, also über das in sich gesättigte Analyse-Synthese-Verfahren des ersten Forschungsweges hinweg getan:
7
Zitiert von Heubeck, 50 f. ® W. Schadewaldt, Iliasstudien, Dannstadt 3 1966, S. 183 (der ganze .Epilog' ein Zitat aus Goethes .Dichtung und Wahrheit').
180
Zeus' Reise zu den Aithiopen
„Denn dem, was sich hier auf dem Wege der reinen Textauslegung ergab, kommt von ganz anderer Seite unser mittlerweile recht sicher gewordenes Wissen über die Arbeitsweise der frühen Sänger und Rhapsoden entgegen", und es folgte die Aufzählung von Arbeiten über slavische und serbokroatische Volksepik, die ihm damals bekannt geworden waren: J. Meier, E. Drerup, C. M. Bowras .Tradition und Design', R. Trautmann, M. Braun und andere (Milman Parry ist noch nicht dabei), - aus denen dann der gewichtige Schluß gezogen wird: „Daß das die Niederschrift erfordernde Großepos die reife Spätform des Heldensanges ist, hat zumal die vergleichende Epenforschung dargetan." 9 Und ganz am Ende des Buches schließlich die weit vorausschauende Einsicht:
522
„Verfehlt ist eine Homeranalyse, die die Ilias aus vorhandenen roh zugerichteten .Gedichten' zusammengebaut sein läßt. Der Textbefund der Interpretation spricht gerade dort dagegen, wo er am ehesten dafür sprechen müßte. Und diesem Textbefund kommt das Bild der geschichtlichen Voraussetzungen, unter denen Homer gedichtet haben muß, von ganz anderer Seite entgegen. Der alte Sänger Demodokos, genauso wie der serbische Guslar, formen das Ganze ihrer Gesänge fließend; nur Thema, Motive, Erzählformen, Einzelverse, Versteile, Sprachgut sind gegeben. Nach Ausweis seiner Technik der Verswiederholungen steht auch Homer noch im Strom der Fortentwicklung jenes alten Singens. Was bei dem alten Aöden einst fließendes Stegreifsingen war, ist bei Homer I bereits .Dichten' geworden - ein Dichten, dem die Niederschrift das Bauen ins Große und die einsichtige Durchgestaltung der Zusammenhänge ermöglicht, das aber auch so noch fließendes Gestalten, Neugestalten älterer Themen, Stoffe, .Quellen', Bilder, Motive ist." 10 Aber erst dreißig Jahre später, während seines Amerika-Aufenthalts von 1968, sollte Schadewaldt durch die Begegnung mit Milman Parrys Sohn Adam die eigentliche ,Oral poetry-Theorie' in ihrer damals fortgeschrittensten Form kennenlernen.11 Wie befreit er diesen zweiten Weg der Homerphilologie von da an als die lang gesuchte methodologische Absicherung der eigenen Ergebnisse empfand, zeigt sein nachgelassener Aufsatz über ,Die epische Tradition'. 12
Wenn wir aus dem Beispiel Schadewaldt, das im Ahnen, Suchen und endlichen Finden des Gelehrten den Gang der neueren Homerforschung so deutlich abbildet, die richtige Lehre ziehen, dann werden wir keinen Zweifel mehr daran haben, daß ein nochmaliger Rückfall in das Verfahren der reinen Analyse-Synthese-Argumentation heute methodologisch nicht mehr möglich ist. Der Rest von Unsicherheit darüber, ob wir auch wirklich das Richtige tun, wenn wir Homers Epen wie jedes andere sprachliche Kunstwerk zunächst einmal als etwas Gegebenes betrachten und dieses Gegebene in seinem So-Sein zu verstehen suchen, ohne die zu deutende Stelle noch vor Arbeitsbeginn unter das Fragezeichen einer möglichen .Unechtheit', ,Stümperhaftigkeit' usw. zu stellen, ist heute beseitigt. Wir können heute wieder ,frei' interpretieren - und damit das, was ' Iliasstudien 3 , 26 Anm. 1. 10 Iliasstudien 3 ,161 f. 11 Siehe Maria Schadewaldt in WdFH, 537 Anm. 1. 12 In WdFH, 529-539.
(Zu nias I, 304—495)
181
Schadewaldt, Reinhardt, Harder, Marg und viele andere begonnen haben, mit neuem Impetus fortführen. Wie nötig diese Fortführung nach der Unsicherheitsphase ist, durch die die gesamte Homerforschimg infolge der allseitigen Erschütterung alter Glaubenssätze in den letzten zwanzig Jahren hindurchgehen mußte, kommt in allen Forschungsbilanzen der jüngsten Zeit deutlich zum Ausdruck. Zitiert seien nur zwei Stimmen: im gleichen Jahre 1974 rühmt Heubeck Schadewaldts „Kunst der Homerinterpretation" (50), I mit der „die Wege zu einem 523 neuen Homerverständnis gebahnt" worden seien (14), und klagt Fenik bitter darüber, daß man „große Teile unserer Literatur lesen (könne), ohne ein einziges Mal auf den Text verwiesen zu werden, ausgenommen zum Zwecke der Anhäufung statistischer Daten"; dies sei besorgniserregend einseitig, und daher seien „die wachsenden Anzeichen erwachenden Interesses bei unseren eigenen Wissenschaftlern, die Theorie der Oral poetry auf die Interpretation der Texte anzuwenden, [...] willkommen und ermutigend" (WdFH, 550), und als Vorbild empfiehlt auch er - neben Rothe, Arend, Hölscher, Mattes, Beßlich, Rüter, Heubeck und Lesky - Wolfgang Schadewaldt. Denen, die Schadewaldts Weg damals mitgegangen sind und ihn, wie Walter Marg, interpretierend und anregend verbreitert und verlängert haben, 13 kann die heutige Generation wohl keine befriedigendere Genugtuung und Bestätigung verschaffen als die, daß sie an ihre Leistungen anzuknüpfen versucht. II Der Bauplan der Ilias wird im 1. Buch vom Prooimion an schrittweise aufgedeckt.14 Die Einzelschritte folgen zunächst rasch und regelmäßig aufeinander: I (1) Im Prooimion erfahren wir, daß ein Groll des Griechenhelden Achilleus 524 gegen den griechischen Heerführer Agamemnon Achills eigenen Kameraden .unzählige Leiden' schaffen wird; im Sterben der Griechen wird sich Zeus' Wille erfüllen. 13 Die von Walter Marg veranlaßten und betreuten Homer-Arbeiten zeichnen sich nicht nur durch besondere Betonung des Interpretatorischen ganz im Sinne Schadewaldts aus, sondern auch durch einen starken innovatorischen Impuls; neben W. Nicolais Neuansatz (s. oben Anm. 4) muß besonders die Dissertation von G. Kurz (Darstellungsformen menschlicher Bewegung in der Ilias, 1961) sowie die Dissertation von S. Beßlich (Schweigen - Verschweigen Übergehen. Die Darstellung des Unausgesprochenen in der Odyssee, 1966) genannt werden, von denen die letztere „einen Ehrenplatz unter den neueren Odysseebüchern verdient" (Heubeck, 107). 14 Dazu Näheres in meiner Homer-Darstellung in der Zeitschrift: Der Deutschunterricht 31, 1979, 5 - 2 3 (bes. 16-23) [in diesem Band S. 13-35, bes. S. 24-35],
182
Zeus' Reise zu den Aithiopen
(2) Im Schwur Achills (225-244) präzisiert der Dichter zum ersten Mal: das Sterben der Griechen wird durch Achills von Agamemnon provozierten Groll und seine daraus sich ergebende Kampfenthaltung herbeigeführt werden (240-244). (3) In Achills kurzer Anrede an die beiden Abgesandten Agamemnons, Talthybios und Eurybates, die den ungeliebten Auftrag erfüllen müssen, die Briseis abzuholen, läßt der Dichter diese Vorstellung vom weiteren Handlungsverlauf durch eine erneute feierliche Absichtserklärung Achills in uns noch fester werden (338-344). (4) In Achills Bitte an Thetis (365-412) wird der Plan weiter aufgehellt: Zeus wird das griechische Belagerungsheer von den Troern bis ins seichte Küstenwasser zurückdrängen lassen. Dann wird Agamemnon seine ατη erkennen und dem Achill Abbitte leisten (408-412). (5) In Thetis' unmittelbar darauffolgender Antwort wird der Zusammenhang zwischen den Plan-Teilstücken 1-4 verdeutlicht. Thetis sagt: (419)
,Dieses Wort aber (d. h. Achills Bitte um Zurückdrängung seiner Kameraden) zu Zeus, dem donnerfreudigen, zu sagen, geh ich selbst zum Olympos, dem schneebedeckten, ob Zeus wohl willfahre. Doch du nun, bei den Schiffen sitzend, den schnellkreuzenden, groll den Achaiern, - und vom Kampf halte dich völlig fern! '
Mit diesen schrittweise einander ergänzenden Vorausdeutungen (den ,zukunfts525 gewissen' 15 des Erzählers im Prooimion und I den ,zukunfts-ungewissen', aber für den Hörer nicht weniger .erfüllungssicheren' der handelnden Personen in ihren Reden) ist das Grundgerüst des Ilias-Planes vor uns aufgebaut: Der Bauplan setzt sich aus zwei komplementären Haupt-Teilen zusammen, von denen der eine auf der göttlichen Ebene wirksam sein wird, der andere auf der menschlichen. Der göttlicherseits zu verantwortende Teil wird in der Gewährung der Tnetis-Bitte durch Zeus bestehen, sein menschlicherseits zu verantwortendes Komplement wird in Achills Groll und seiner daraus folgenden Kampfenthaltung bestehen. Beide Plan-Teile sind in den Thetis-Worten 419-422 vereinigt. Nach diesen Worten haben wir eine in den Hauptlinien klare Vorstellung vom weiteren Verlauf der Iliashandlung (, Achill wird grollend bei den Schiffen sitzen, Zeus wird die Griechen zu eben diesen Schiffen zurück- und hinabdrängen'), - und wir erwarten nun den Beginn der so geplanten Aktion. VoraussetDie Terminologie nach E. Lämmerts Typologie des Vorausdeutungswesens im Erzählwerk (Bauformen 139-194; hier besonders zur Erzählervorausdeutung im Odyssee-Prooimion: S. 146 f., sowie zur ,zukunftserhellenden' Wirkung auch der Personenvorausdeutungen: S. 176, 178 f., 189-194; weiteres s. unten S. 189 f.).
(Zu ¡lias I, 304-495)
183
zung für diesen Beginn ist die Gewährung der Thetis-Bitte. Thetis muß also zu Zeus gehen. Da tritt etwas für uns Unerwartetes ein: Thetis kann nicht zu Zeus gehen. (423)
.Zeus nämlich - zum Okeanos, hin zu den trefflichen Aithiopen brach er gestern zum Mahle auf, und die Götter folgten alle miteinander.'
Daher muß Thetis, sagt sie, ihre Unterredung mit Zeus verschieben: (425)
, Am zwölften Tage jedoch, da wird er wiederkehren zum Olympos, und da (τότε) gehe ich dann (επειτα) zum Hause des Zeus.'
Warum diese 12-Tage-Frist? Warum ist Zeus gerade in dem Augenblick, in dem er für den Fortgang der Handlung so dringend gebraucht wird, bei den Aithiopen? Oder anders, erzähltechnisch: wozu innerhalb des bisher so zügigen, nahezu zeitdeckend 16 .dramatischen' Erzähltempos (seit Handlungsbeginn sind sieht man von der Pest ab - erst wenige Stunden vergangen) plötzlich diese .Stauung des Handlungsfortschritts' t7 ? I Kaum ein aufmerksamer Leser wird sich diese Frage an dieser Stelle nicht 526 stellen. Ein Scheinproblem ist es also nicht, das damit aufgeworfen wird. Im Gegenteil: Es ist ein Grundproblem des Homerverständnisses, das sich hier verbirgt. Denn denkbar sind nur zwei Antworten: Entweder liegt eine Schwäche oder eine Stärke der Erzählung vor. Im ersten Falle wäre eine ursprünglich durch einfache zügige Sukzession Spannung erzeugende Erzählstruktur durch unterbrechenden Einschub einer spannungmindernden oder gar -vernichtenden .Wartezeit' zerstört worden, im zweiten Fall hätte ein Erzähler - aus welchem Grund auch immer - ein Erzählmittel bewußt eingesetzt (und das könnte dann nur das der Retardation sein). Oder wieder erzähltechnisch: Im ersten Falle handelte es sich um den .unbeabsichtigten Bruch einer Technik', im zweiten um die .beabsichtigte Technik eines Bruches'. 18 Den beiden möglichen Antworten entsprechen historisch die beiden Gegenpositionen des ersten Homerforschungsverfahrens: Die Analyse sah Zerstörung einer Form und Schloß: .Was wir haben (unsere Ilias), ist Depravation eines Ursprünglichen: die ursprüngliche Ilias war früh' - die Synthese (der Unitarismus) sah Gestaltung einer Form und Schloß: ,Was wir haben (unsere Ilias), ist Vollendung eines Ursprünglichen; unsere Ilias ist spät.'
16
Zum Terminus: Lämmert 84. Der Terminus nach Lämmert 90. 18 Termini nach N. Mecklenburg, Kritisches Interpretieren. Untersuchungen zur Theorie der literarischen Wertung und Literaturkritik, München 2 1976, S. 85. 17
184
Zeus' Reise zu den Aithiopen
Die Akten der Kontroverse füllen Regale. Sie beginnen mit kurzen kraftvollen Plädoyers der Anklage (Karl Lachmann 1847, 4-7 und 94-96; Moriz Haupt bei Lachmann 1847, 98-101), setzen sich fort mit jahrzehntelangen detailverbissenen Recherchierungskämpfen und Indizienschlachten zwischen Anklage und Verteidigung (vorzügliches Referat von K. Ameis und C. Hentze im .Anhang zu Homers Ilias', I, 3 1896,12-34), und sie enden - nach zahllosen Repetitionen der alten Argumente in unserem Jahrhundert, von Wilamowitz 19 über Schade527 waldt 20 bis zu Von I der Mühll 21 - mit einem Machtwort der Verteidigung (Karl Reinhardt, Die Ilias und ihr Dichter, 95), das nach Alfred Heubecks großer Homerforschungsbilanz von 1974 (S. 56) für lange Zeit zugleich zum Schlußwort werden könnte. Wir haben jedoch gesehen: Eine ungeprüfte Übernahme von Ergebnissen der ersten Forschungsphase in die veränderte Forschungssituation von heute käme dem Verzicht auf die inzwischen verfügbare Möglichkeit der Ergebnissicherung gleich. Daher stellen wir die Frage hier von neuem. Nun aber allein vom Text her. Die Analyse-Synthese-Debatte dient uns nicht als Ausgangspunkt. Gedanken und Argumente dieser Debatte werden selbstverständlich auch hier erscheinen. Aber sie werden sich nun verschränken mit Gedanken und Argumenten der beiden hinzugekommenen Forschungswege. Diese Verschränkung wird die alten Argumente weniger abgegriffen und das ganze Problem vielleicht in neuem Licht erscheinen lassen. ΠΙ Unsere erste Teilfrage lautet: Wird die vom Erzähler durch den Mund seiner Figur (Thetis) angekündigte 12-Tage-Frist im Handlungsfortgang realisiert, d.h. mit erzählter Handlung gefüllt? Es gibt ja im Erzählwerk das Phänomen der nicht mit erzählter Handlung gefüllten .symbolischen Zeitspanne', die „als empirische Zahl ganz unverbindlich bleibt" (Lämmert 31). Dazu gehört z.B. bei Homer das έννημαρ der Odyssee, das „als verdreifachte Dreiheit ein großes Zeitmaß bedeutet" und als „formelhafte Frist" den Übergang „aus der bekannten Welt in den zauberhaften Bereich unerhörter Wesen und Abenteuer" anzeigt (Lesky 114 f.). In der Tat hat man hierher auch unsere 12-Tage-Frist des 1. Iliasbuches gestellt: Thaddaeus Zielinski hat in seiner Untersuchung über ,Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos' die 12 Tage nicht 19
Die Ilias und Homer, Berlin 1916, bes. S. 256. Iliasstudien 3 ,145 f., 77. 21 Kritisches Hypomnema zur Dias, Basel 1952, S. 27-29. 20
(Zu ¡lias I, 304—495)
185
nur als einen „bestimmten Ausdruck für einen unbestimmten Begriff, wie anderlwärts έννημαρ usw." aufgefaßt, sondern auch die Wiederaufnahme von 528 Thetis' 12-Tage-Ankündigung durch den Dichter mittels der Wendung 'Αλλ' οτε δή ρ' έκ τοιο δυωδεκάτη γένετ' ηώς in Vers 493 als eine „rein technische Formel" bezeichnet, die man entfernen könne und müsse, um „den echten Zusammenhang wiederherzustellen"; nehme man die 12 Tage, die „ein rein äußerlicher technischer Notbehelf' seien, ernst, „so wird der ganze Sinn der Handlung ruiniert".22 Wäre diese Auffassung richtig, dann wäre das Motiv der 12tägigen Wartezeit ein ,blindes'23 Motiv; es läge also eine Erzählschwäche vor. I Die Auffassung kann aber nicht richtig sein. Denn die 12-Tage-Frist wird re- 529 alisiert. Zwischen die Ankündigung ihres Beginns in V. 424 f. und die Feststellung ihres Endes in V. 493 tritt nämlich die Erzählung zweier Geschehensabläufe von beträchtlicher Zeiterstreckung: (1) Die Ankunft der Sühn-Gesandtschaft für Apoll in Chryse, ihr Opfer für den Gott, ihre Nächtigung in Chryse und ihre Rückkehr ins Lager des Hauptheers am Vormittag des nächsten Tages (V. 430-487).
22
Philologus, Suppl.-Bd. 8, Leipzig 1901, S. 438, 437, 440. Zielirtskis Fehlschlüsse wirken bis zu Lämmert (Bauformen 85) weiter. Da sie dort zu verfehlten Folgerungen führen, seien sie hier kurz widerlegt: Zielinskis Gleichsetzung der ,Nacht in Chryse' mit der,Nacht vom Anfang des B ' ist schon deswegen unhaltbar, weil Athene den Odysseus in Β 169 f. nicht „bei seinem Schiffe (trifft), gerade wie er [...] von Chryse zurückgekehrt ist" (Zielinski 439), sondern wie er gerade mit den anderen βασιλήες und έξοχοι άνδρες (Β 188) von der Peira-Versammlung zu seinem Schiff hinuntergelaufen ist (B 194 πάντες ακούσαμε ν, vgl. auch 171 άχος); er war also Anfang des Β längst von Chryse zurück. - Bei der Interpretation der 12 Tage zu Anfang des Ω macht Zielinski denselben Fehler: daß „die Nacht, die auf die Spiele folgte, dieselbe ist wie die, in der Priamos zu Achill gekommen ist - 24,3 = 351" (Z. 440), wird - um nur im Vordergründigsten zu bleiben - erstens dadurch ausgeschlossen, daß der Dichter den Zeus am 12. Tag nach Beginn der Mißhandlung von Hektors Leichnam durch Achill (24,31) gegenüber der herbeizitierten Thetis die Angabe machen läßt, die Götter stritten sich nun schon έννημαρ um die richtige Antwort auf Achills Fehlverhalten (24,107, womit die Iterativa in 24,23 f. zeitlich fixiert sind), und daß er zweitens den Hermes dem Priamos bei dessen Ankunft im Achaierlager versichern läßt, Hektors Leichnam sei noch wohlerhalten, obwohl dies nun schon δυωδεκάτη δέ οί ηώς / κ ε ι μ έ ν φ (413) sei (vgl. auch Priamos' Worte in 24,637-642). - Die Absurdität von Zieliñskis Gleichsetzungs-Idee im Falle des Ω wird im übrigen schon durch das Iterativum λήθεσκεν in 24,13 erwiesen. 23 Lämmert 193 f. („dem wirklich blinden und nicht bloß trügerischen Motiv (haftet) ein Schlackenrest an [...]"; es ist „nicht in vollem Sinne künstlerisch .verarbeitet'").
186
Zeus' Reise zu den Aithiopen
(2) Das Grollen des Achilleus - sowie seine Boykottierung aller Gemeinschaftsunternehmungen seiner Kameraden und sein Leiden daran (488492). Der Geschehensablauf 1 kann realiter nur einen Teil der 12 Tage füllen, - wenn wir genau sind (und wir werden sehen, daß der Dichter genaues Mitdenken und Mitrechnen ganz bewußt von uns verlangt), etwa 24 Stunden (vgl. unten S. 193), der Geschehensablauf 2 hingegen kann sie ganz ausfüllen: (488)
Αύτάρ ό μήνιε νηυσΐ παρήμενος ώκυπόροισι διογενης Πηλήος υιός, πόδας ώκύς Άχιλλεύς· οΰτε ποτ' εις άγορήν πωλέσκετο κυδιάνειραν οΰτε ποτ' ές πόλεμον, άλλα φθινύθεσκε φίλον κηρ αΰθι μένων, ποθέεσκε δ' άϋτήν τε πτόλεμόν τε. Die Iterativformen, kombiniert mit der durativen Aktionsart der in die Iterativformen gesetzten Verben (πωλέομαι .verkehren', φθινύθω .vergehen', ,sich verzehren', ποθέω ,sich sehnen'), gleichermaßen aber auch die Durativität der in Normalform erscheinenden Verben (μηνίω .grollen', μένω .bleiben, harren') zeigen an, daß hier eine zu allen Zeiten geläufige erzählerische Form der Zeitraffung vorliegt, die Lämmert die ,iterativ-durative Raffung' nennt und so definiert:
530
„Die iterativ-durative Raffung faßt einen mehr oder weniger großen Zeitraum durch Angabe einzelner, regelmäßig sich wiederholender Begebenheiten (iterativ) oder allgemeiner, den ganzen Zeitraum überdaulemder Begebenheiten (durativ) zusammen. Beide Formen treten nicht selten eng verflochten auf und haben die gleiche Grundtendenz, ruhende Zuständlichkeit zu veranschaulichen; daher sind sie in einer Kategorie zusammengefaßt. Ihre Grundformeln sind: ,Immer wieder in dieser Zeit...' oder ,Die ganze Zeit hindurch ... '"(S. 84).
Bis hierher ergibt sich, daß die 12 Tage nicht ausgesparte (nur benannte), sondern gefüllte Zeit sind. Sie können also nicht wegfallen, ohne daß ihre Füllungen mitfielen. Daraus ergibt sich unsere zweite Teilfrage: welchen Funktionswert haben die Füllungen für die durch sie unterbrochene übergeordnete Handlung? Hier entscheidet sich die Grundalternative .Erzählschwäche oder Erzählstärke'. Sind die Füllungen für die übergeordnete Handlung funktional entbehrlich, dann rechtfertigen sie deren Unterbrechung nicht oder jedenfalls nicht zwingend - und vice versa. Funktional entbehrliche Füllungen von Wartezeiten erscheinen im Erzählwerk als .„Beigabe' additiver Art innerhalb einer sonst zügigen Erzählung" (Lämmert
(Zu nias I, 304-495)
187
46). Als Beispiel führt Lämmert die Novelle von der ,Wilden Engländerin' in Tiecks .Zauberschloß' an und folgert dann: „Zur Ablenkung, zur Unterhaltung, zur Zeitfüllung [...] wird die Geschichte der Engländerin hier eingefügt. Das Eintreten von Wartezeiten im Handlungsablauf ist ein überaus beliebtes Mittel zur Einfügung additiver Handlungsstränge."
Die Füllungen in unserem Falle sind nicht von dieser Art. Sie sind nicht additive, sondern notwendige Handlungsteile. Zunächst Füllung 1, die Sühn-Gesandtschaft nach Chryse. Sie ist zweiter Teil und Abschluß eines Geschehensverlaufs, der lange vor Eintritt der 12-TageFrist, unmittelbar nach Schluß der Heeresversammlung, begann, in Vers 312, im Rahmen einer die ganze Struktur unserer Ilias fundierenden Handlungsgabelung.24 I
Um Art und Bedeutung dieser Handlungsgabelung klar herauszuarbeiten, 531 greifen wir kurz zurück: Gleich zu Beginn des A werden zwei Haupt-Handlungsebenen imaginiert, eine menschliche und eine göttliche. Zweimal erfolgt ein Eingriff aus der göttlichen in die menschliche Ebene (48: Apollon sendet die Pest; 194-221: Athene hindert Achill am Königsmord), die Handlung bleibt jedoch in der menschlichen Ebene, verläuft also einsträngig (dazu und zu allem Folgenden s. die Skizze S. 203). In V. 305 jedoch gabelt sich die Handlung der menschlichen Ebene in zwei Stränge: einen Achilleus-Myrmidonen-Strang und einen Agamemnon-Hauptheer-Strang. Die Gabelung ist Folge und erzähltechnischer Ausdruck der Entzweiung der beiden Helden. Die beiden Stränge werden von nun an nebeneinanderherlaufen und sich - nach einer Begegnung im I - erst in Τ 54/55 (Beginn der μήνιδος άπόφασις) wieder vereinen. Da der Achill-Strang durch Aktionslosigkeit gekennzeichnet sein muß, wird die Haupthandlung auf dem Agamemnon-Strang (und dem Götter-Handlungsstrang) verlaufen. Da aber die Funktion des Achill-Strangs für die Gesamtstruktur eben in seiner Aktionslosigkeit besteht, muß dem Hörer diese Aktionslosigkeit während der gesamten Dauer der Zweisträngigkeit (A 305-T 54) stets bewußt gehalten werden. Wie dies erreicht wird, werden wir sehen. Unmittelbar nach der Haupt-Gabelung (Achill-Strang : Agamemnon-Strang) erfolgt noch eine zweite Gabelung, diesmal des Agamemnon-Stranges, und zwar in 3 Nebenlinien: Der Ausdruck als solcher ist schon von Reinhardt (85) verwendet; auf der gleichen Seite heißt es bei Reinhardt (wie auch sonst öfter): „Ein Studium der Romantechnik an großen Beispielen der Weltliteratur könnte nicht schaden" - : eben dies wird im vorliegenden Aufsatz indirekt versucht.
188
Zeus' Reise zu den Aithiopen
(1) Agamemnon entsendet eine Siihn-Gesandtschaft unter Odysseus nach Chryse (308-311); in V. 312 sticht die Gesandtschaft in See und segelt über die Fluten davon (έπέπλεον [Imperfekt!]). (2) Agamemnon setzt Reinigungsriten innerhalb des Hauptheers in Gang (312 oi δ' άπελυμαίνοντο καί εις αλα λύματα βάλλον); diese dauern unbe532 stimmt lange Zeit an (άπΙελυμαίνοντο, βάλλον [Imperfekt!]) und verbinden sich mit einem großen Sühn-Opfer für Apollon (315-317 ερδον [Imperfekt!]). (3) Agamemnon entsendet die beiden Herolde Talthybios und Eurybates zu Achill, Briseis abzuholen (318 b-326). Von diesen 3 Nebenlinien wird die zweite (Reinigungsriten und Opfer) nur angesetzt, ihre Zeiterstreckung und Beendigung wird nicht berichtet - aus gutem Grunde, wie wir sehen werden. Die dritte Nebenlinie (Abholung der Briseis) wird sofort nach ihrem Ansatz weitergeführt; sie leitet zum Achill-Strang über, der dadurch zum Haupthandlungsstrang wird: die Herolde kommen zu Achill, erhalten die Briseis und gehen mit ihr zu Agamemnon zurück (327-348 a). Damit ist diese Nebenlinie wieder in den Agamemnon-Strang eingemündet und beendet. Die Handlung läuft auf dem Achill-Strang weiter, der also weiterhin Haupthandlungsstrang bleibt: Achill bricht über die Wegnahme der Briseis in Tränen aus (δακρύσας 349), geht zum Strand und ruft seine Mutter Thetis an, Thetis kommt, erfahrt das Vorgefallene, vernimmt Achills Bitte und antwortet darauf mit dem Versprechen, die Bitte Zeus vorzutragen. In dem Moment, in dem die Haupt-Handlung an diesem Punkt angelangt ist, sind die Nebenlinien 2 (Reinigungsriten und Sühn-Opfer im Hauptheer) und 1 (Sühn-Gesandtschaft nach Chryse) immer noch unabgeschlossen. Für die Vorstellung des Hörers bedeutet das, daß das Sühn-Opfer im Hauptheer noch immer andauert und die Sühn-Gesandtschaft noch immer auf hoher See dahinsegelt. Für das Kausalgefüge der vom Dichter geplanten Gesamtstruktur aber ist diese Unvollendetheit gleichbedeutend mit dem Fehlen eines Abschlußsteines gerade an der Stelle, an der er weiterbauen muß: Apollon ist noch immer unversöhnt, noch also ist die Pest vom Heer nicht fortgenommen. Der Abschlußstein .Versöhnung Apolls' muß also gesetzt werden. Wie jeder Abschlußstein, der Gewicht tragen soll, muß er aber so gesetzt werden, daß er zugleich abschließt und fundiert. Das bedeutet: Apolls Versöhnung darf nicht nur so obenhin und 533 nebenbei mit ein paar Worten konstatiert I werden,25 so daß an ihrer Tragfähig25
In V. 314-317 ist eine Versöhnung noch nicht einmal angedeutet, geschweige denn konstatiert; beschrieben werden hier die Bemühungen um Versöhnung. Reinhardts (85 Anm. 2) Ge-
(Zu ¡lias I, 304—495)
189
keit Zweifel bleiben könnten. Sie muß vielmehr so voll und rund beschrieben werden, daß jeder Hörer fühlen kann: Apollon ist versöhnt. Dafür aber war die Voraussetzung, daß die Tat, die zu Apollons Zorn geführt hatte: die Verweigerung der Rückgabe der Chryseis an ihren Vater, vollständig wiedergutgemacht wurde. Die Sühn-Opfer des Hauptheers waren natürlich gleichfalls nötig, aber sie mußten so lange fruchtlos bleiben, wie die Hauptbedingung nicht erfüllt war, die der Seher Kalchas genannt hatte: (97)
ούδ' ö γε πρίν Δαναοίσιν άεικέα λοιγόν άπώσει, πρίν γ' άπό πατρί φίλω δόμεναι έλικώπιδα κούρην άπριάτην άνάποινον, αγειν δ' ίερήν έκατόμβην έςΧρύσην ·
Die Rückgabe der Chryseis, und zwar in Chryse, mußte also dargestellt werden. In diesen Darstellungszwang hatte sich der Dichter mit der Kalchas-Prophezeiung selbst begeben. Wie stark dieser selbstauferlegte Zwang war, werden wir heute nicht mehr nur mit der - durchaus zutreffenden - werkgebundenen Erklärung Karl Reinhardts ,Seherworte verlangen Erfüllung' 26 begründen, sondern darüber hinausgehend mit den allgemeinen Strukturierungsprinzipien, die die Erzählforschung aufgedeckt hat: Die Vorausdeutungen im Erzählwerk hat Eberhard Lämmert in die beiden Hauptklassen der (zukunftsgewissen) Autor-Vorausdeutungen und der (zukunftsungewissen) Personen-Vorausdeutungen geteilt. Das Wesen der PersonenVorausdeutungen - zu denen unsere Kalchas-Prophezeiung und -Anweisung ja gehört - besteht nun darin, daß sie dem Leser die gleiche Erfiillungsgewißheit vermitteln können wie die Autor-Vorausdeutungen: I „Wo Träume, Ahnungen, Prophezeiungen im Laufe des erzählten Geschehens kundgetan werden, da steuern sie merkwürdigerweise trotz ihrer theoretischen Unverbindlichkeit den Leser in einer ähnlichen Weise wie es durch die gewissen Vorausdeutungen des Erzählers geschieht." Sie „... lassen den Leser eine künftige Handlungsphase oder den Gesamtausgang mehr oder minder bestimmt antizipieren..." (Lämmert 178 f.).
Um diese Wirkung auf den Leser, wo nötig, zu verstärken, bedient sich der Erzähler bestimmter Techniken der .Beglaubigung' (Lämmert 179). Legt er eine
genargumente gegen Von der Mühll (28: „[...] daß Apollon versöhnt wurde [...], steht implicite schon 312 ff. [...]") treffen insoweit noch nicht den Kem. 26 Reinhardt 84.
534
190
Zeus' Reise zu den Aithiopen
Vorausdeutung einer göttlichen Instanz in den Mund, so verbietet sich für den Leser ein Zweifel an ihrer Erfüllung von vornherein. Aber „Auch Vorausdeutungen aus Menschenmund können durch gewisse Darbietungsregeln eine besondere Bekräftigung erfahren. Kehren bestimmte Ahnungen oder Prophetien vor wichtigen Handlungsphasen wieder, so mehrt sich mit jedem Eintreffen einer Vorausdeutung das Vertrauen des Lesers zu diesem Ritus von Weissagung und Erfüllung." „Das Gesetz der Wiederholung entfaltet hier wie allenthalben in der Kunst seine autonome Wirksamkeit" (Lämmert 182).
Eben diese Beglaubigungstechnik - bereichert um Züge, die Lämmert nicht aufgreift - hat der Iliasdichter bei der Kalchas-Prophezeiung angewandt. Er leitet Kalchas' Worte so ein: (68)
τόίσι δ' άνέστη Κάλχας Θεστορίδης, οίωνοπόλων οχ' άριστος, ος ήδη τά τ' έόντα τά τ' έσσόμενα πρό τ' έόντα, και νήεσσ' ήγήσατ' 'Αχαιών "Ιλιον είσω ήν δια μαντοσύνην, την οί πόρε Φοίβος 'Απόλλων. Zunächst das .Gesetz der Wiederholung': ,und er hatte die Schiffe der Achaier nach Ilion geführt durch seine Sehergabe': man möchte meinen, eine stärkere Beglaubigung der unbedingten Zukunftskenntnis dieses Sehers sei nicht möglich. Und doch bildet sie nur einen Teil dieses wuchtigen, viereinhalb Verse umfassenden Beglaubigungs-,Apparats': Κάλχας Θεστορίδης - das Patronymikon schon eine ganze kleine Beglaubigungswelt, etymologisch und genealogisch: 535 Sohn des Sehers Thestor also, des I , Gotteswortsagers', und der wiederum war des Sehers Idmon Sohn, des .Wissenden'. Danach die Attribute: ,von den Vogelflugkundigen der bei weitem beste', ,der das Seiende wußte, das Künftige und das Vergangene' - und schließlich, nach der , Wiederholungsbeglaubigung', der Abschluß: ,durch seine Sehergabe, die ihm verliehen hatte Phoibos Apollon'. Am Ende also noch der Name des Gottes, den es hier zu versöhnen gilt, als letzte Quelle eben der Versöhnungs-Weisung, die der Seher gleich verkünden wird! Unmöglich, daß ein Erzähler, der eine Seherweisung mit solchem Wahrheitsanspruch ausstattet, nicht auch im gleichen Augenblick schon ihre peinlich genaue Erfüllung konzipiert hätte. Doch auch damit nicht genug. Kalchas endet, nachdem er die Bedingungen für Apolls Versöhnung genannt hat - Rückgabe der Chryseis und Opfer für Apoll in Chryse selbst - , mit den Worten: (100) „.. .τότε κέν μιν ίλασσάμενοι πεπίθοιμεν." „dann wohl werden wir - wenn wir ihn versöhnt haben - ihn auch überzeugen."
(Zu ¡lias I, 304—495)
191
Da haben wir augenfällig eine Abart jener „abschließenden Formen der ungewissen Vorausdeutungen" vor uns, denen - als „Wünsche" oder „Erwartungen" handelnder Personen geäußert - „nichts .Konjunktivisches' an (haftet)", die vielmehr „auf Grund des poetischen Zusammenhangs .erfüllungssicher'" sind (Lämmert 190 f., im Rahmen einer Johann Peter Hebel-Deutung). Daß der Dichter nach dieser Vorausdeutung die Sühn-Gesandtschaft nach Chryse schildern mußte, so schildern mußte, wie er sie hier konzipiert hatte, wird nun wohl deutlich sein. Wie genau er sich dann bei der Ausführung an die Konzeption gehalten hat, zeigt die Szene auf Schritt und Tritt. Wir heben nur das Allerdeutlichste heraus: .Rückgabe' und ,Opfer' hatte er durch Kalchas fordern lassen - in .Rückgabe' und ,Opfer' gliedert sich die Schilderung. Am Ende der Prophezeiung hatte er bedeutungsschwer ίλάσκεσθαι verlangen lassen, also nicht nur rasche Rückgabe, Erledigung einer lästigen Pflicht, sondern Bemühung um den Gott - und: ,gesandt bin ich', sagt Odysseus in seiner Rede an den Priester, .dir dein Kind zu bringen und dem Phoibos I eine heilige Hekatombe zum 536 Opfer darzubringen, für die Achaier, (444)
ο φ ρ ' ί λ α σ ό μ ε σ θ α ανακτα',
und als sie dann mit aller Sorgfalt (die man in der Analyse so oft beanstandet hat und mit deren .Verteidigung' Reinhardt sich in seiner unglücklichen Ablehnung der gerade hier so erhellenden Oral poetry-Erkenntnisse entsagungsvolle Mühe gegeben hat) 27 - als sie dann mit aller Sorgfalt das Opfer ausgeführt haben, da krönen sie ihr voll zugewandtes Werben um den Gott mit immer wieder neuen, lang anhaltenden, fast inbrünstigen .Versöhnungsliedern': (472) oi δέ πανημέριοι μολπη θεόν ί λ ά σ κ ο ν τ ο καλόν άείδοντες παιήονα κούροι 'Αχαιών, μέλποντες έκάεργον und endlich dann: (474) ό δέ φρένα τέρπετ' άκούων. Jetzt ist Apollon versöhnt. Die Opfer, die zur gleichen Zeit im Hauptheer vor Troja dargebracht werden (315-317; s. oben S. 187 f. und unten S. 197 f.), vereinigen sich - wenn wir die Dinge zusammensehen - mit denen in Chryse, aber nun erst, da hier in Chryse die Bedingungen erfüllt sind, wird beiden Opfern Er-
Reinhardt 87-95; zum Zusammenspiel von ,Kern' und .Variationen' in der für mündliche Dichtung .typischen Szene' des Opfers s. jetzt im Rahmen eines umfassenderen Zusammenhangs J. A. Russo, Homer gegen seine Tradition, in WdFH, 410 f.
192
Zeus' Reise zu den Aithiopen
hörung zuteil. So ist nun durch die Handlung hier in Chryse auch jene zweite Nebenlinie, die vorhin in der Schwebe blieb, bleiben mußte, zu Ende geführt. Daß die .Gesandtschaft nach Chryse' ein entbehrlicher Handlungsteil sei, wird man danach wohl in der Tat nicht sagen können. Aber noch haben wir nur ihren Abschluß-Chaiakter herausgearbeitet. Daß sie auch fundiert, aufbaut, nach vome weist, wurde bisher nur angedeutet. Dies deutlicher zu zeigen genügen nun allerdings wenige Worte: Rückgabe der Chryseis und Sühn-Opfer für den 537 Gott, dies - so hatten wir gesehen - waren nach I der Konzeption des Dichters die zu erfüllenden Voraussetzungen für Apolls Versöhnung. Die Versöhnung Apolls ihrerseits war die Voraussetzung für das Aufhören der Pest (97 ούδ' ö γε πριν Δαναοισι... λοιγόν άπώσει / πρίν γ' άπό πατρί ... δόμεναι ... κούρην). Das Aufhören der Pest aber ist die Voraussetzung für das Verbleiben der Achaier vor Troja Dies hatte ja der Dichter gleich zu Handlungsbeginn durch Achills Mund ausgesprochen: (59)
, Abide, jetzt seh ich uns zurückgeschlagen schon zurück nach Hause kehren - falls wir dem Tode überhaupt entgehen sollten - , wenn denn gleichermaßen Krieg und Pest die Achaier niederzwingt. '
Also: Ohne Rückgabe der Chryseis keine Versöhnung des Apoll, ohne Versöhnung des Apoll kein Ende der Pest, ohne Ende der Pest keine Wiederaufnahme des Kampfes, und - so können wir nun hinzusetzen - ohne Wiederaufnahme des Kampfes keine Ilias. Die Rückgabe der Chryseis, in Chryse, ist also im letzten der Ermöglichungsgrund für das Zustandekommen unserer Ilias. Sollte aber dieser Ermöglichungsgrund erzählerisch so umgesetzt werden, wie der Dichter es in der Kalchas-Prophezeiung konzipierte, d. h. in Form derjenigen Szene, die in unserer Ilias als .Gesandtschaft nach Chryse' erscheint, dann war diese Szene als Fundament der gesamten Epos-Handlung gedacht.28 Wir sind von der Frage ausgegangen, ob die beiden Füllungen der 12-TageFrist funktional entbehrliche Füllungen sind oder nicht. Für die erste dieser Füllungen, die .Gesandtschaft nach Chryse', können wir die Frage nun mit Sicherheit verneinen. Die .Gesandtschaft nach Chryse' ist unentbehrlicher Abschluß einer Nebenhandlung, die das Fundament der Haupthandlung ist. Die I 538 Nebenlinie 1 des Agamemnon-Strangs muß also - ebensowie die Nebenlinie 3
Es trifft gerade das zu, was Hölscher (Untersuchungen zur Form der Odyssee. Szenenwechsel und gleichzeitige Handlungen, Berlin 1939) zwar für die Chrysefahrt nicht gelten lassen wollte (43), für die Patroklos-,Nebenhandlung' jedoch, die im Δ beginnt, als .Ausnahme' innerhalb der Ilias anerkannte: „[...] ja, die Nebenhandlung ist einzig dazu erfunden, in der Haupthandlung die entscheidende Wendung zu bringen" (45).
(Zu ñias I, 304-495)
193
(Abholung der Briseis) - explizit zu Ende erzählt werden. Die Frage ist nur: wann? Wir lassen diese Frage vorerst stehen und gehen zur zweiten Füllung der 12Tage-Frist über, zur Beschreibung von Achilleus' Groll. Wir hatten gesehen (oben S. 185 f.), daß diese Beschreibung wegen ihres iterativ-durativen Charakters im Unterschied zur ersten Füllung - deren Handlung nachrechenbar nur etwa 24 Stunden der realen Zeit ,12 Tage' in Anspruch nimmt (nämlich einen Nachmittag, eine Nacht und einen Vormittag) - die gesamte 12-Tage-Frist ausfüllen kann. Erst diese Beschreibung also liefert die ,Rest-Füllung'. Um so wichtiger ist die Frage, ob vielleicht sie eine .entbehrliche' Füllung ist. Wir gehen aus von der oben (S. 187) dargelegten in Vers 305 beginnenden Zweisträngigkeit der Ilias-Handlung. Haupthandlungsstrang ist nach der Handlungsgabelung in V. 305 der Achilleus-Strang. Er bleibt es aber nur bis zur verbindlichen Festlegung seines künftigen Charakteristikums: der Aktionslosigkeit. Diese erfolgt in der Achill-Thetis-Absprache. Thetis weist Achilleus an: (421) άλλά σύ μεν νυν νηυσΐ παρήμενος ώκυπόροισι μήνι' Άχαιόΐσιν, πολέμου δ' άποπαύεο πάμπαν. Diese Anweisung enthält zwei Forderungen, eine affektsteuernde und eine verhaltenssteuernde: »Grolle und halte dich vom Kampfe fern!' Die völlige Aktionslosigkeit, die ja der menschlicherseits zu verantwortende Teil des Aktionsplans der Göttin und damit des Dichtungs-Bauplans des Erzählers ist, wird erst durch das Zusammenwirken beider Komponenten erzielt. Achill muß, wenn der göttlicherseits zu verantwortende Planteil, die Zurückdrängung der Achaier bis ins Küstenwasser, verwirklicht werden soll, d.h. wenn Thetis' Bitte an Zeus überhaupt einen Sinn haben soll, auch wirklich seiner - bisher nur vage (V. 240. 341) ausgesprochenen - Drohung treu bleiben: er darf unter keinen Umständen am Kampfe teilnehmen, - auch nicht etwa grollend, aber doch. Wie nötig diese explizite Weisung bei einem Achilleus ist, das weiß die Mutter - so gibt der Dichter zu verlstehen - sicherlich am besten, - sie, die den Charakter ihres Soh- 539 nes und seine schicksalhafte Bestimmung ja gerade kurz vorher nach des Dichters Willen angedeutet hat. War dieser Achilleus in V. 169 eigentlich doch schon nach Hause gefahren - und sitzt doch immer noch da! Was es ihn kostet, wirklich nicht am Kampfe teilzunehmen, das werden wir, die Hörer, dann ja in der Patroklie erkennen. Thetis' Anweisung ist - als Vorausdeutung einer Göttin - zugleich wieder ein Schritt innerhalb der Bauplan-Aufhellung des Iliasdichters. Fixiert ist damit die
194
Zeus' Reise zu den Aithiopen
Grundsituation Achills bis zum T, d.h. die Grundsituation auf dem AchilleusStrang. Für die Sichtbegrenztheit der Analyse-Synthese-Phase ist es bezeichnend, daß die Thetis-Anweisung naiv beim Wort genommen und das Groteske der daraus folgenden Deutung (.grolle zwölf Tage lang, am 13. gehe ich zu Zeus, dann kannst du wieder aufhören und weiterkämpfen') gar nicht empfunden wurde (vgl. ζ. B. Ameis-Hentze zu A 421 άλλά σύ μέν νυν: „νυνflir jetzt, d.i. solange ich nicht mit Zeus gesprochen habe", ebenso im Anhang I, S. 19). Daß Thetis hier, statt einen 12-Tage-Boykott anzuordnen, Achills Grundhaltung festlegt, folgt daraus, daß der Dichter durch ihren Mund offenkundig die Struktur seiner Ilias vorzeichnet; daß dabei die .verdeckte' Handlung der nächsten 12 Tage mitgezeichnet wird, ist nur ein Bestandteil der Absicht, nicht die Absicht selbst.
Die Grundsituation Achills ist also durch Thetis' Anweisung fixiert - fixiert allerdings nur als Imperativ. Daß die Weisung ausgeführt wird, daß Achill sich auch wirklich daran hält, daß der Achill-Strang tatsächlich durch völlige Aktionslosigkeit gekennzeichnet ist - das muß der Hörer, wenn er die tragische Vergeblichkeit aller Entwürfe, Hoffnungen, Pläne, Bemühungen und Leiden auf der Agamemnon-Linie in allem Folgenden aus dem tiefen Kontrast heraus mitempfinden und miterleiden soll, immer wieder aufs neue sehen und spüren. Aktionslosigkeit als die stärkste Aktion dieser Epos-Handlung spürbar zu machen das war wohl die schwierigste erzähltechnische Aufgabe des Iliasdichters. Er hat sie genial gelöst, indem er die Achill-Linie, die ja dadurch wirkt, daß auf ihr nichts geschieht, auf der also ein Geschehen auch gar nicht berichtet werden durfte, nach ihrem .Verschwinden' im Anschluß an die Achill-Thetis-Unterre540 dung imlmer wieder im Verlauf der Vordergrundhandlung für Augenblicke in ihrer aktionslosen Existenz .rezidivieren' läßt. Dafür einige Beispiele: 2,239 ff. Thersites hält in der Heeresversammlung seine Aufwiegelungsrede, in der er das Heer zur Meuterei auffordert. Er klagt Agamemnon der Undankbarkeit und Un Würdigkeit an: , Der ja auch jetzt den Achill, einen Mann, viel besser als er selbst ist, ehrlos gemacht hat; genommen nämlich hat er seine Ehrengabe, selbst entrissen. Aber wahrhaftig - der Achill hat keine Galle im Leibe, ein Weichling! Weiß Gott! Sonst nämlich hättest du, Atride, jetzt zum letzten Mal Schmach zugefügt! '
(Zu Ilias I, 304-495)
195
μεθήμων - das nimmt in der Sicht des Thersites auf das παρήμενος 1,488 Bezug. (Dies also hier, die Agore des B, ist eine [vielleicht in Wirklichkeit sogar die erste] der Agorai, die Achill nach 1,490 nicht mehr besuchte.)29 2,375 ff. Agamemnon lobt in derselben Versammlung den Nestor und beklagt sein eigenes Verhalten damals gegenüber dem Achill: .Aber mir hat... Zeus Leiden gegeben, der mich in fruchtlose Streitereien und Zänkereien hineinwirft. Haben doch ich und Achill um ein Mädchen zu kämpfen begonnen, mit heftigen Widerworten, und ich hab' zu zanken begonnen! Aber wenn wir dereinst zu einem Beschluß uns beraten, dann wird es für die Trojaner keinen Aufschub des Verderbens mehr geben, auch nicht ganz kurz nur.'
2,686 ff. Im Griechenkatalog werden die Myrmidonen und ihr Führer Achilleus als untätig ausgespart: I , Aber die dachten nun nicht an den tosenden Kampflärm; denn da war keiner, der sie zu Reihen geführt hätt', lag ja doch drin in den Schiffen der fußschnelle Achilleus... '
Und - um nur im Β zu bleiben - schließlich noch die den Griechenkatalog beschließende Frage des Dichters an die Muse, wer denn nun der Beste unter den gerade aufgezählten Achaiern war, und welches die besten Pferde. ,Die besten Pferde', antwortet er selbst, .waren die des Eumelos, und der beste Mann war der telamonische Aias, (769) οφρ' Άχιλεύς μήνιεν solange Achilleus grollte'.
Und dann wird die gesamte Situation genauer ins Gedächtnis zurückgerufen: ,Der nämlich (sc. Achill) war bei weitem der Beste ... Aber der lag ja bei den bauchigen, schnellkreuzenden Schiffen, denn er war in Groll gefallen gegen Agamemnon; und seine Leute vergnügten sich an der Brandung des Meeres mit Diskus- und Speerwerfen und mit Bogenschießen, und die Pferde - bei ihren Wagen jedes standen sie da, Klee rupfend und sumpfigen Eppich; und die Räder lagen wohlumhüllt in den Zelten der Herren, und diese, ihren Führer, den kriegserprobten, schmerzlich missend, schlenderten hierhin und dahin im Heerlager und kämpften nicht.' Von der Vorführung weiterer Stellen in den folgenden Gesängen sehen wir ab (Faesi hat sie in seinem Iliaskommentar, Berlin 4 1864, S. 13 Anm., zusammen29
Gegen Wilamowitzens Idee, mit 1,488-492 seien Versammlungen und Schlachten vor der mit dem grandiosen Β-Aufmarsch beginnenden ersten Ilias-Schlacht im Δ gemeint, hatte sich selbst Von der Mühll (29) ausgesprochen; s. dazu unten S. 195 f..
541
196
Zeus' Reise zu den Aithiopen
gestellt). Es sind, wie hier, immer nur kurze Andeutungen. Und es ist zu fragen, wie dieses intermittierende Aufblitzen in seiner Verweisfunktion voll verstanden werden sollte ohne ein tragendes Fundament? - ein Fundament, das im Bewußtsein des Hörers an allen diesen Rezidivierungsstellen als Erinnerungshintergrund jedesmal wieder aktualisiert werden konnte, also jedesmal wieder ganz ,da' war? Dieses Fundament bilden die Verse A 488-492, unsere zweite .Füllung'. In ihnen tritt Achilleus unmittelbar vor seinem .Verschwinden' noch einmal als die Gestalt und in der Haltung vor uns, wie wir ihn fortan im Bewußtsein halten sollen: I 542
(488)
,Aber der grollte - bei den Schiffen sitzend, den schnellkreuzenden, der gott-geborene Peleus-Sohn, der an den Füßen schnelle Achilleus. Weder zur Versammlung ging er jemals, der männer-ehrenden, noch jemals in den Kampf, - aber unaufhörlich verzehrte er sein Herz sich dort an der gleichen Stelle bleibend, und unaufhörlich sehnte er sich nach Schlachtenlärm und Krieg.'
αύτάρ ό μήνιε νηυσί παρήμενος ώκυπόροισι - das ist noch die Ausführung jener Thetis-Anweisung άλλά σύ μέν νυν νηυσί παρήμενος ώκυπόροισι / μήνι' Άχαιοισιν ausVers 421 f., und das gilt sicher auch für die 12 Tage, in denen Achill auf Zeus hofft. 30 Aber dann, mit dem Folgenden, geht der Dichter über diesen Zeitraum verdeutlichend hinaus und zeichnet in der aufzählenden Negation allen Agierens und in Achills Leiden daran die Grundsituation des Helden über alle folgenden Gesänge bis zum Τ hinweg. Das hat die antike Homer-Erklärung richtiger gesehen als die moderne bis hin zu Wilamowitz, 31 wenn sie dazu sagt: (sch. bT z. St.) ή πρόληψίς έστιν ή ... Eine fundierende Prolepsis ist es in der Tat, was hier vorliegt. Es hat sich gezeigt, daß auch die zweite Füllung der 12-Tage-Frist für die übergeordnete Handlung unentbehrlich ist. Keine der beiden Füllungen darf also fallen. Beide rechtfertigen eine Unterbrechung der Haupthandlung. 543 Somit muß unsere letzte Frage lauten: fordern sie die Unterlbrechung auch? Und zwar in der gewählten Form, als Unterbrechung von genau 12 Tagen? 30
Hervorragend herausgearbeitet - nach Haesecke und Heimreich - von C. Hentze, Anhang zur Ilias, I, S. 23: „Elf lange Tage muß er warten, bis seine Bitte vor Zeus gebracht wird: welche schmerzliche Prüfung für den Grollenden, der den Tag der Vergeltung so heiß herbeisehnt, für den feurigen Helden, der sich nach Kampf und Schlachtruf sehnt! Nun diese Zeit vorübergegangen ist, ohne daß er seinen Zorn gestillt hat, können wir die Tiefe seines Grolls ermessen." 31 Die Dias und Homer, 256. Treffend dagegen ζ. B. Kurz (oben Anm. 3) 56, vgl. 39 f.
(Zu litas /, 304-495)
197
Wir beginnen mit der Chryse-Gesandtschaft. Was wir gesehen hatten, war: zu Ende erzählt werden mußte sie. Die Frage war nur: wann? Wesentlich ist zunächst dies: Da nach der Abgabelung der Chryse-Gesandtschaft die Haupthandlung weiter vorangeschritten ist, kann die Chryse-Gesandtschaft nur als Unterbrechung der Haupthandlung zu Ende erzählt werden. Und wegen ihrer Fundament-Funktion fordert sie diese Unterbrechung auch (s. oben S. 192 f.). Die Frage, die sich der Erzähler danach zu stellen hatte, war also zunächst nur die nach dem Ort, an dem die Unterbrechung erfolgen sollte. Die Entscheidung darüber war nicht ins Belieben des Erzählers gestellt. Zu berücksichtigen waren mehrere Faktoren. Dadurch, daß der Erzähler an der Handlungsgabelung die Schiffe abgehen und mit Kurs auf Chryse hatte dahinsegeln lassen, um sich von ihnen ab- und der Haupthandlung zuzuwenden, zuwenden zu können, hatte er die .Gesandtschaft nach Chryse' nicht nur zur Nebenhandlung, sondern auch ausdrücklich zur zeitlichen Parallel-Handlung gemacht. Je umfangreicher die Zeiterstreckung dieser Parallelhandlung war, um so weiter mußte der Erzähler auf dem Zeitstrang der Haupthandlung nach vorne schreiten, ehe er die notwendige Unterbrechung der Haupthandlung durch Wiedereingliederung der Nebenlinie vornehmen konnte. Daß er tatsächlich in diesen erzähltechnischen Kategorien dachte und plante, zeigt der Synchronismus zwischen den beiden Parallelhandlungen, den er in Achills Rede an Thetis - also auf dem derzeitigen HauptHandlungsstrang - angebracht hat (und auf den nach anderen Reinhardt 32 mit Recht nachdrücklich hingewiesen hat): (389) „την μεν γαρ συν νηί θοη έλίκωπες 'Αχαιοί ές Χρύσην πέμπουσιν, αγουσι δέ δώρα ανακτι." Der Erzähler läßt also in diesem Augenblick den Achill (völlig I wahrschein- 544 lichkeitskonform) sich die Gesandtschaft noch auf der Hinfahrt vorstellen. Die Zeitvorstellung des Hörers wird damit im gleichen Sinne gesteuert. Der Ort, an dem dies geschieht, ist etwa die Mitte des Achill-Thetis-Gesprächs. Dieses Gespräch ist aber absolut zeitdeckend gestaltet. Nur 36 Verse nach dem Synchronismus wird es bereits beendet sein - das heißt: die Gesandtschaft kann selbst nach Beendigung des Gesprächs schwerlich schon in Chryse auch nur angekommen sein. Eine Unterbrechung der Haupthandlung vor Beendigung dieses Gesprächs kam also schon aus diesem rein technischen Grunde nicht in Be-
32
Reinhardt 86: „Merklicher kann auf die auseinanderlaufenden Handlungen nicht hingewiesen werden."
198
Zeus' Reise zu den Aithiopen
tracht. 33 Der Ort der geplanten Unterbrechung stand damit auf der einen Seite (sozusagen als terminus post quem) fest: in jedem Falle erst nach dem AchillThetis-Gespräch. Wie aber nun weiter? Ließ sich die Unterbrechung ohne weiteres einfach an das Achill-Thetis-Gespräch anschließen? Der Dichter hatte, wie er durch sein eigenes Synchronismus-Signal zu erkennen gegeben hatte, bis hierher zeitparallel erzählt. Das bedeutete, daß der Hörer sich bei Beendigung des Achill-Thetis-Gesprächs die Gesandtschaft nach Chryse immer noch auf der Hinfahrt vorstellte. Sie mußte aber auf jeden Fall angekommen sein und ihren Auftrag ausgeführt haben, bevor Thetis Zeus traf. Denn sobald Zeus mit Thetis sprach, mußte es zur Gewährung ihrer Bitte kommen. Danach aber mußten die Kampfhandlungen wieder beginnen - wie es ja im Β dann auch sogleich geschieht. Das aber bedeutete, daß der Dichter Zeus die Bitte erst dann gewähren lassen konnte, wenn die Griechen wieder kampffähig waren, d. h. wenn die Pest zu Ende war. Krieg und Pest zugleich - das war unmöglich, nachdem der Dichter ja durch Achills Mund gleich zu Beginn die Pest zum möglichen Abbruchsgrund der Belagerung hatte deklarieren lassen (s. oben S. 192). Der Kampf konnte also erst wieder beginnen, wenn - wie oben gezeigt 545 (S. 190 f.) - Apoll in Chryse ernsthaft und dauerhaft verlsöhnt worden war. Dies sollte nach der Planung des Dichters den Rest des Tages füllen, und Odysseus' Vollzugsmeldung sollte erst etwa am Mittag des nächsten Tages im Hauptheer eintreffen. So weit also mindestens mußte der Dichter auf dem Haupthandlungsstrang vorrücken, bis er Thetis mit Zeus sprechen lassen konnte. Was sollte er in der Zwischenzeit mit Thetis tun? Er konnte sie nicht unmittelbar nach dem Gespräch mit ihrem Sohn zu Zeus aufbrechen, aber erst am nächsten Mittag ankommen lassen. Götter reisen nicht im Maultiertempo, und wie lange Thetis vom Trojastrand bis zum thessalischen Olympos braucht, das erfahren wir im Ω - als Iris sie, in der Gegenrichtung, ,sturmfüßig hindurch zwischen Samos und Imbros', in Minutenschnelle holen kommt (24,77-98). Also mußte der Dichter Thetis warten lassen zumindest bis zum folgenden Mittag. Erzähltechnisch ausgedrückt: der Einschub einer .Wartezeit' als solcher war in jedem Falle unvermeidlich. Wo aber Thetis warten lassen? Auf dem Olymp? Götter antichambrieren nicht. Oder so: Thetis kommt auf dem Olymp an, erfahrt, Zeus ist heute nicht zu sprechen, kehrt wieder um, benachrichtigt Achill,
33
Nicht möglich also (auch nicht für einen .Interpolator') die von Hölscher (oben Anm. 28, S. 43) erwogene Lösung: „Es könnte ja auch die Chrysefahrt sogleich im Anschluß an 311 erzählt werden..."
(Zu nias I, 304-495)
199
man müsse warten, taucht ins Meer hinab, taucht am nächsten Tage wieder auf, um sich erneut auf den Weg zu machen...? Der Dichter fand das Mittel, sich diese Handlungsstückelei zu ersparen, darin, daß Thetis ihre eigene Wartepflicht und -zeit schon vorher kannte. Dann aber war die nächste Frage, welche Begründung dieser Wartezeit zu geben war, nicht schwer zu lösen: Zeus durfte auf dem Olymp nicht »greifbar' sein, er mußte - so schien's am besten - so weit weg sein, daß er dem Hörer (der j a die spätere Vorstellung einer göttlichen Ubiquität ohnehin nicht kannte) in der Tat nicht gut erreichbar schien. Da bot sich denn als bester Ausweg eine - möglichst weite .Auslandsreise' an. Der Ausweg, den der Dichter damit wählte, ist im Erzählwerk aller Zeiten sehr beliebt. .Wartezeiten' werden regelmäßig dann in die Handlung eingeschoben, wenn .Rückwendungen' nötig werden oder als wünschenswert erscheinen. Nötig werden solche .Rückwendungen' u. a. immer dann, wenn von der Haupthandlung zeitlich bereits überholte Ereignisse deswegen nachgeholt I und heran- 546 geholt werden müssen, weil sie das .fundament des künftigen Spannungsbogens bilden" (Lämmert 118). Rückwendungen dieser Art nennt Lämmert .parallele Rückschritte' (S. 112-122, insbes. 114-116). Mit ihnen „geht der Erzähler an der Linie der Haupthandlung einige Schritte zurück und holt die Ereignisse auf einem anderen Schauplatz bis zum gegenwärtigen Stand der Dinge nach" (Lämmert 113). Der „Platz, an dem solche retardierenden Elemente in den Gesamtaufbau einer Erzählung eingefügt werden", ist vorzüglich der „Beginn einer neuen Handlungsphase"; parallele Rückschritte „treten mit Vorzug an Gelenkstellen des Erzählens auf und leiten einen Neuansatz ein. Schauplatzwechsel und Personeneinführung unterstützen in der Regel die durch den Rückschritt bewirkte Gliederung" (Lämmert 122). Die Zeit schließlich, die für den Rückschritt benötigt wird, ist häufig „ein spannungsleerer Zeitraum, wie er vor allem bei längeren Reisen eintritt, die selbst nicht Schauplätze der Handlung sind" (Lämmert 120). „Da eine neue Handlung noch nicht im Fluß, neue Spannung noch nicht erwachsen ist, kann der Erzähler sich hier in Ruhe .die Zeit nehmen', Wissenswertes oder Kurioses aus der Vergangenheit mitzuteilen" (Lämmert 112). ,Sich die Zeit nehmen' ist dabei im erzähltechnischen Sinne, ganz buchstäblich, zu verstehen, also als „Zeit, die natürlich zu diesem Zwecke vom Dichter eigens .eingeräumt' wurde" (Lämmert 46). Eben dieser Vorgang liegt auch an unserer Stelle vor. Die Zeit, die der Iliasdichter für den parallelen Rückschritt .Gesandtschaft nach Chryse' benötigte, hat er sich in Form einer Auslandsreise des Zeus .genommen'. Daß die Reise gerade zu den Aithiopen gehen mußte, ergab sich - auf welchen Umwegen auch
200
Zeus' Reise zu den Aithiopen
immer - aus der bereits erörterten Notwendigkeit, Zeus so weit wie möglich fortzuschicken. Die Aithiopen, nach uralter Sage das „sonnennahe Volk am Rande des großen Weltstroms", die „den sich stets aufs neue füllenden ,Tisch der Sonne' haben, an dem sie (in Tischgemeinschaft) Helios und alle Götter bewir547 ten", 34 - dieses Volk am Ostrand der Welt eiglnete sich als (für solche Fälle in der Oral poetry wohl .reserviertes'35) Reiseziel offenbar am besten. Indessen ist noch eine Frage offen: warum gerade zwölf Tage? Hier sind wir mehr als bisher auf Vermutungen angewiesen. Sicher scheint zunächst dies: Überbrückende Zeiträume - ebenso wie Wiederholungen ein und desselben Tuns - werden im frühen Epos niemals mit beliebigen Zahlen (zwei, fünf, acht) gemessen, sondern stets mit drei oder einem Vielfachen von drei. Das bedeutet, der Dichter hätte es mit drei, sechs oder neun Tagen genug sein lassen können. Warum wählte er zwölf? Zunächst wird man wohl sagen dürfen, daß ein Wiederbeginn der Kämpfe schon zwei oder drei Tage nach dem Nachlassen der Pest - .unaufhörlich brannten die Scheiterhaufen mit den Leichen dicht an dicht' (V.52) - weder einem frühgriechischen Aoiden noch seinem realistischen Publikum als angemessen erscheinen konnte. Dann aber hatte der Dichter ja auch noch etwas anderes im Sinn. Mit Lämmert hatten wir zunächst gesehen, daß Wartezeiten Neuansätze vorbereiten, und F. Göbel belehrt uns in einer Arbeit über .formen und Formeln der epischen Dreiheit in der griechischen Dichtung", daß die mit der Zahlnennung „erreichte Stufe die Grundlage für eine Wendung abgibt, mit der ein starker Handlungsfortschritt verbunden ist". 36 Wie einschneidend die Handlungsstruktur der Ilias gerade durch diesen Neuansatz hier verändert wird (Beginn der kontrapunktischen Zweisträngigkeit), hatten wir ebenfalls gesehen. Gleich mit dem Thetis-I 548 Zeus-Gespräch wird die Kontrapunktik beginnen; mit dieser spannungsvollen Gewißheit entläßt uns ja der Dichter in die .Wartezeit' der 12 Tage, wenn er Thetis, die Göttin, ihre Rede an Achilleus so enden läßt: 34
A. Lesky, Aithiopika, Hermes 87, 1959, 27-38 (hier 38, 28). Am Anfang der Odyssee ist es bekanntlich Poseidon, der ,auf Auslandsreise' bei den Aithiopen ist. - Aus dem griechisch-deutschen Schulwörterbuch zu Homer von Crusius (Hannover 2 1841) entnehme ich s . v . Αιθίοπες folgende Bemerkung Zoëgas: „Die Äthiopen sind im Allgemeinen bei dem Dichter die letzten Bewohner der Erde, das entfernteste Volk, zu welchem der Dichter die Götter zu schicken wußte, um Zeit für Dinge zu gewinnen, die nach seinem Plane vorfallen mußten." An derartige .natürliche' Auffassungen, die uns seit der Analysephase der Homerforschung pervers vorkommen könnten, müssen wir uns heute durch exaktes Interpretieren erst wieder gewöhnen. 3¿ F . Göbel (Stuttgart 1933), S. 18. 35
(Zu Ilias I; 304-495) (427)
201
,... und ich glaub', ich werd' ihn überreden!' (sc. den Zeus).
Gleich also wird Achill .verschwunden' sein. Das Fundament für die Kontrapunktik in Form des Bilds vom .grollenden Achilleus' muß der Dichter also vorher legen. Für ein Fundament, das solche Last zu tragen haben wird, wären aber wohl auch sechs Tage noch zu wenig gewesen. Paralleler Rückschritt (Chryse-Gesandtschaft) und fundierender Vorschritt (Achills Groll) in ihrem Ineinanderwirken legten so eine Zeitspanne nahe, die zumindest länger als sechs Tage war (vgl. Hentze, a. O. 23). Damit ist freilich immer noch nicht die Zahl zwölf erklärt. Die Möglichkeit einer Erklärimg ergibt sich, wenn wir bewußt den Bereich der Beweisbarkeit verlassen. Es ist längst gesehen, daß auch am Ende unserer Ilias eine 12-TageFrist steht: ,Neun Tage lang', so bittet Priamos den Achill in Ω 664, .möchten wir Hektor beweinen, am zehnten ihn bestatten und das Leichenessen halten, am elften ihm den Hügel schütten - und am zwölften werden wir dann kämpfen, wenn's denn nötig ist.' So geschieht es. Unsere Ilias endet am 11. Tage dieser 12-Tage-Frist, mit dem Leichenessen klingt sie aus. Mit dem zwölften Tage hätte ein neues Epos beginnen müssen; die homerische Ilias, deren Kern ja die homerische .Achilleis' ist, war hier zu Ende. Begonnen aber hatte die homerische .Achilleis', der Kern also, mit der kontrapunktischen Zweisträngigkeit nach jener ersten 12-Tage-Frist im A. Die beiden gleich langen Zeiträume nicht zusammenzusehen fällt schwer. Sollten sie vom Iliasdichter wirklich zur Zusammensicht bestimmt gewesen sein, dann wohl nur mit einer Funktion: die große Retardation, die unsere Ilias im Gesamtablauf des trojanischen Krieges darstellt - rund 50 Tage innerhalb von 10 Jahren - , nach beiden Seiten abzusetzen. Der ,Groll des Achilleus' - das mag einmal ein winziges Motiv in einer langen Kette von Motiven und Ereignissen innerhalb des großen Sangeszyklus vom Parisurteil bis zu Trojas Fall gewesen I sein. Es wird nie beweisbar sein, ob wirklich 549 erst der Dichter unserer Ilias dieses winzige Einzelmoüv zum Brennpunkt einer eigenen Stoffgestaltung gemacht hat. Der Gedanke, daß er es getan haben und das Eigene durch zwei große Zäsuren von je ,12 Tagen' aus dem Strom der Sangestradition herausgehoben haben könnte,37 ist dennoch verführerisch. Am 37
Vgl. M. M. Willcock, A Commentary on Homer's Iliad (Books 1-6), London 1970, zu V. 425: „The interval of twelve days [...] also has the strange effect of isolating the action of the Iliad from the continuity of the Trojan War, especially as there is a similar interval of twelve days at the end of the Iliad, for such is the length of the truce which Achilleus agrees with Priam for the Trojans to mourn and bury Hektor (XXIV 667)." Die 22 inneren Gesänge unserer Ilias (Β-Ψ) umfassen nur 8 Tage, die beiden Außengesänge (A und Ω) dagegen 21 bzw. 22 Tage (siehe ζ. B. die Tabelle in der Einleitung von Faesis Iliaskommentar). Diese Disproportion ist
202
Zeus' Reise zu den Aithiopen
zwölften Tag des Waffenstillstands wird der große Erzählstrom, den der Iliasdichter mit dem ersten Tage von Zeus' Reise zu den Aithiopen für seine eigene Geschichte gleichsam angehalten hatte, wieder weiterfließen; dann wird die magisch-fixierende Wirkung der zwei ,Zwölf-Tage-Barrieren' wieder aufgehoben sein. Fassen wir nach diesem Blick in den Bereich der bloßen Möglichkeiten zusammen, was sich wirklich sagen läßt: Die erzähltechnischen Schwierigkeiten, die der Iliasdichter mit Zeus* Reise zu den Aithiopen geschaffen und bewältigt hat, machen es unmöglich, ihn als einen Repräsentanten noch wenig entwickel550 ter I Epik anzusehen. Sowohl die Oral poetry-Forschung als auch die allgemeine Erzählforschung haben gezeigt, daß das Erzählen in seiner historischen Entwicklung nur ganz allmählich von der einfachen Sukzession zu den komplexeren Formen einer vielfältig verschränkten und durch Vor- und Rückgriffe gegliederten Dichtkunst hinaufgelangt.38 Da hier an unserer Stelle Erzählmittel dieser Art nicht nur angewandt, sondern technisch perfekt beherrscht sind, muß es sich beim Iliasdichter um einen späten und reifen Dichter handeln. Wenn sich aber unter den bisher bekanntgewordenen Werken der Oral poetry aus aller Welt, auch unter den höchstentwickelten, kein Werk vom Komplexitätsgrad der Ilias findet, dann möchte man den Grund dafür am Ende doch in jenem Glücksfall sehen, der oben angedeutet wurde: daß auf dem höchsten Gipfelpunkt einer jahrhundertelang kultivierten mündlichen Sangeskunst ein besonderes Dichtertalent sich des neuen, nicht lange vorher erst für unalltägliche Zwecke »entdeckten' Strukturierungsmittels .Schrift' bediente, um eine Ilias damit zu schaffen, die so unerhört war, daß sie niemals mehr vergessen wurde.
Folge der .Dehnzeiten'-Zusammendrängung am Werk-Anfang und Werk-Ende: Von den vier Dehnzeiten unserer Ilias (9 Tage Pest, 12 Tage Aithiopenreise, 12 Tage Leichenschändung, 12 Tage Waffenstillstand) liegen die ersten beiden im A, die letzten beiden im Ω. Die Pest-Zeit und die Leichenschändungs-Zeit ergeben sich dabei als natürliche Handlungskonsequenzen von selbst; nur die beiden 12-Tage-Fristen der Aithiopenreise und des Waffenstillstands werden vom Erzähler (durch den Mund von Handlungsfiguren) ausdrücklich angekündigt (A 425; Ω 657/ 667/670): das sieht sehr nach .Erzählstrategie' aus. (Vgl. dazu auch oben S. 183 mit Anm. 18). [Die Idee, daß die Ilias als ganze eine „Retardation innerhalb des Gesamtablaufs der Troica" sei, hatte, wie ich nachträglich sehe, auch Heubeck schon geäußert, s. WdFH 458. - Latacz 1990.] [Unschlüssige Spekultationen zur Frage - ohne Kenntnis der deutschsprachigen Forschung - in Kirk's Ilias-Kommentar (Cambridge 1985), zu A 423-5]. 38 Für die Oral poetry-Forschung s. Bowra (oben Anm. 1), Kap. 9 (Umfang und Entwicklung), für die Erzählforschung s. Lämmerts ganzes Buch.
(Zu llias I, 304—495)
5 Χ
=3 £ o« s ϋ J I I 1 "a ¿ a j< — 1 1 §• Κ S Il II ΟΤ ο I Ο ι ο I
Kotinos, Festschrift für Erika Simon, hrsg. v. Heide Froning, Tonio Hölscher und Harald Mielsch, Mainz/Rhein 1992, 76-89
Lesersteuerung durch Träume Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee In den letzten Jahren haben Bücher, die die antiken Texte mittels Freudscher Kategorien interessanter machen wollen, Hochkonjunktur. Daß auch die Träume in den Texten zum Objekt der unersättlichen Begierden unserer Freudianer werden würden, war selbstverständlich. Schließlich hatte Freud mit seiner .Traumdeutung' von 1900 (Motto des Titelblattes: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo = Verg. Aen. 7,312; schief verwendet) die Psychoanalyse nach eigenem Bekunden überhaupt begründet. Nichts bietet sich daher spontaner an, als Freud an den Träumen, die in den antiken Texten (besonders den poetischen) eingeschlossen sind, unwiderleglich zu .verifizieren' 1 . Solcherart Versuche wären sogar förderlich (da ja der Traum als solcher ein universales Menschheitsphänomen ist), wenn dabei nur beachtet würde, daß erstens die antiken Dichter Freud noch nicht gelesen hatten und zweitens literarische Träume nicht mit realen Träumen identisch sind. Träume in literarischen (d. h. in nicht-medizinischen, nicht-magischen, nicht-onirokritischen usw.) Texten sind fingierte Träume. Sie werden für ein Literaturwerk nur zu einem Zweck erfunden: sie sollen wirken. So altbekannt dies in der Literaturwissenschaft ist, so staunenswert vermutlich für so manchen Psychoanalytiker. Dabei ist doch der Nutzen, den gerade die Beachtung dieses Unterschiedes für die Psychoanalyse bringen könnte, evident: Wirken können Träume auf den Leser eines Literaturwerks nur, wenn sie nachvollziehbar die Traum-Erfahrung und die Traum-Handhabung der vom Autor angezielten Rezipienten widerspiegeln. Beachtet demnach die psy-
1
Zur Kultfigur dieser Bewegung droht mit seinen überbordenden Phantasien G. Devereux zu werden, insbesondere mit seinem Traumbuch von 1976, das (auch in der deutschen Übersetzung) bereits mehrere Auflagen erlebt hat (s. Literaturverzeichnis). Selbst seriöse Interpreten wie z. B. J. Russo vermögen sich Devereux' freudianischer Symbolismuswut nicht immer zu entziehen (s. Russo im Odyssee-Kommentar 1985 zu τ 541: Penelope soll sich, wie ihr Traum-Kummer über die getöteten 20 Gänse zeige, im Unterbewußtsein an den Freiern gefreut haben; noch unkontrollierter in Devereux' Sinne: Α. N. Athanassakis [1987], 265-67).
206
Lesersteuerung durch Träume
choanalytische Forschung den Primärzweck literarischer Träume, dann vermag sie indirekten Aufschluß über das Traumwissen der Zeit zu erhalten, in der der Dichter des betreffenden Literaturwerks wirkte. Besonders zu beachten ist nur eine Eigenart antiker Traumfingierung: sie lehnt sich (wie so viele andere literarische Verfahren der Antike) eng an den πρώτος εύρετής Homer an: Technik und Funktionen der Traumfingierung im Sprachkunstwerk sind in der griechisch-römischen Antike im wesentlichen die Homers. Die Traumhandhabung Homers verdient daher eine besonders eingehende Analyse. Viel ist dafür bereits getan2. Auch bei den philologischen Arbeiten hat man allerdings häufig das Gefühl, die Autoren meinten, Homer berichte Träume, die ihm Agamemnon, Priamos, Penelope, Nausikaa usw. selbst erzählt hätten. Infolgedessen fehlt es oft - bei vielen vorzüglichen Beobachtungen im einzelnen - an der .Interpretation aus einem Punkt'. Versuchen wir, hier einen Schritt voranzukommen! Homer erfindet und inkorporiert sowohl nicht-ausgeführte als auch ausgeführte Träume 3 . Nicht-ausgeführte sind solche vom Typ ,Fixationstraum': Achilleus verfolgt Hektor im 22. Gesang der Ilias dreimal um die Stadt herum und kann und kann ihn nicht erreichen. Die quälende Vergeblichkeit des Laufens macht Homer dem Hörer/Leser klar (er läßt sie ihn erfühlen) durch den Vergleich mit jenem allbekannten Fixationstraum, in dem man läuft und läuft und doch nicht von der Stelle kommt. Hier liegt eine einfache, eine punktuelle, primäre, elementare Lesersteuerung vor. Der Dichter muß dem Leser die Gefühlsnuance unendlicher Ergebnislosigkeit vermitteln, weil der Leser nur so begreifen kann, 77 daß Troia I durch rein menschliche Bemühung niemals eingenommen worden wäre; erst als - bei der vierten Stadtumrundung - Apollon und Athene (zugunsten des Achilleus) eingreifen, erreicht Achill den Hektor. Hektors Fall und Troias Untergang - das ist dem Leser durch die Traum-,Fermate' klar geworden - waren wirklich und wahrhaftig gottverhängt! Auch nicht-ausgeführte Träume haben also bei Homer schon keinen Beiläufigkeitscharakter (nach dem Muster: , Anton hatte schlecht geträumt und war deswegen mißgelaunt'), sondern sie haben starke Steuerungsfunktion. Diese 2
Als besonders förderlich erweist sich bei der Arbeit am Homertext Α. M. H. Kessels' Studie (s. Literaturverzeichnis). 3 Den folgenden Grundsatzausführungen liegt meine Arbeit von 1984 zugrunde (s. Literaturverzeichnis) [in diesem Band S. 447-467], Dort auch die Grundgliederung der antiken TraumErwähnungen (unter denen die literarischen Träume nur für uns - infolge der Überlieferungslage - eine Vorzugsstellung einnehmen) sowie die notwendigen Begriffserläuterungen.
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
207
Funktion erhalten sie kraft eines Grundcharakteristikums antiker Traumfingierung: kraft ihrer Bedeutsamkeit: Von Homer an werden Träume fast ausnahmslos nur für bedeutsame Handlungsfiguren an bedeutsamen Handlungspunkten fingiert, und folgerichtig ist dann auch der je fingierte Traum-Inhalt bedeutsam. Dieser Grundzug der Bedeutsamkeit erklärt sich nicht nur, wie meist unterstellt wird, aus der Bedeutung des Traums als eines irrationalen Phänomens für den ,naiven ' antiken Menschen (wie naiv der antike Mensch war, ersehen wir heute schön aus den überfüllten Praxen unserer Psychoanalytiker, die ja als gute Traum-Ausleger gelten). Die Bedeutsamkeit des Traums im Literaturwerk erklärt sich vielmehr aus seiner hohen Funktionalität für die Strukturierung eines sprachlichen Kunstwerks, wie sich noch zeigen wird. Aus dem Bedeutsamkeitscharakter der Traumfingierung folgt aber - was viel wesentlicher ist - der hohe Grad der Elaboriertheit der fingierten Träume. Ein Grundsatz guter Dichtung ist ja: Je wichtiger die Funktion eines Erzählmittels, desto sorgfältiger seine Ausarbeitung. Man kann das bei Homer etwa an den Gleichnissen verfolgen - die eben nicht schmückendes Beiwerk sind, sondern oft erst die eigentliche Situationserhellung bringen; man kann es auch an den Beschreibungen von Gegenständen, Körpermerkmalen usw. sehen - wie etwa an der Beschreibung des Schildes des Achilleus in der Ilias (18. Gesang) oder der Beschreibung der Narbe des Odysseus in der Odyssee (19. Gesang) - , die eben nicht, wie eine schlichte Kunstbetrachtung einstmals annahm, entbehrliche Exkurse sind4, sondern vertiefende und oft erst den eigentlichen Sinn der Vordergrunderzählung konstituierende Hintergrund- und Umfeldschaffungen.
Ganz ebenso verhält es sich mit den Traumfingierungen. Nur daß sie Hintergrund- und Umfeldschaffungen im seelischen Bereich sind. Dies trifft nun freilich in noch weit höherem Maße als für die nicht-ausgeführten Träume für die ausgeführten Träume zu. Bei Homer verteilen sich die sieben ausgeführten, die .großen' Träume, die er formt, auf zwei Traum-Typen: (1) den sogenannten Außen-Traum, (2) den sogenannten Innen-Traum. Der Außentraumtyp, dem bei Homer sechs der sieben großen Träume angehören, wird stets als eine von außen (in der Regel von einer Gottheit) kommende Traumweisung gestaltet, d. h. der Träumende, so wird geschildert, erinnert sich nach dem Erwachen, wie im Traum eine ihm eng vertraute Person an sein Lager getreten sei und ihm in einer beeindruckend klaren, schlüssigen und blitzartig erhellenden Rede aus einer sümmigen Deutung seiner gegenwärtigen Situation 4
Dazu s. A. Köhnken, Die Narbe des Odysseus (1976), jetzt in: Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, hrsg. v. J. Latacz (1991), 491-514.
208
Lesersteuerung durch Träume
heraus eine bestimmte Handlungsanweisung gegeben habe. Unter dem Eindruck, soeben eine im Wachzustand nie erreichte unverrückbare Wahrheitserkenntnis erlebt zu haben, schickt der Betroffene sich im Anschluß daran unverzüglich an, die Weisung auszuführen. - Träume dieses Typus werden vom Dichter stets mit unerhörter Sorgfalt an die träumende Person und an die Handlungskonstellation, in der sie sich im Traumzeitpunkt befindet, angepaßt. Sie lösen daher beim Hörer/Leser neben vielem anderen vor allem zwei wesentliche Steuerungseffekte aus: (1) Sie vermitteln dem Rezipienten ein aufs dichteste komprimiertes Wesensbild der betreffenden träumenden Handlungsfigur. (2) Sie lenken die Werkverlaufserwartung des Rezipienten in eine ganz bestimmte Richtung. Ihre persönlichkeitscharakterisierende Wirkung auf den Leser erreichen die Träume durch eine Art von Identifikationszwang: Die unverzügliche Befolgung der Traumweisung durch den im Traume Angewiesenen - ohne jedes Zögern 78 oder Analysieren mittels Traumdeutern - signalisiert dem Rezipienten das I totale Einverständnis des Betroffenen mit dem soeben per Traum von ihm entworfenen Persönlichkeitsbild. Die personale Wahrheitserkenntnis, die der Dichter seiner Handlungsfigur mittels eines nur auf sie zugeschnittenen Traumes zuteil werden läßt, wird also durch die spontane Zustimmung dieser Handlungsfigur als objektiv richtig ausgewiesen und dadurch zwingend auf den Rezipienten übertragen. Einfach ausgedrückt: Durch die Träume, die der Dichter seine Figuren haben läßt, fixiert er in den Lesern eine unwiderstehliche Ganzheitsvorstellung von der Persönlichkeit der jeweiligen Handlungsfigur. Als Beispiel diene Agamemnon, der glücklose, aber hochfahrend-selbstverliebte Oberfeldherr der Griechen: zehn Jahre lang fast liegt er schon mit einem Riesenheer vor Troias Mauern, träumt vom Sieg und kann und kann die Stadt nicht nehmen. Da schickt ihm Zeus eines Nachts und zwar zu einem Zeitpunkt, als seine militärische Lage fast aussichtslos geworden ist - einen, wie es ausdrücklich heißt, .vermaledeiten' (das heißt also: einen trügerischen) Traum: Nestor, sein engster Berater in der Wirklichkeit des Wachens, sagt ihm als Traumbild: ,Du bist der Größte, Agamemnon, und heut greif an! Denn heut noch wirst du Troia nehmen!' - Als Leser wissen wir sofort: Das ist genau der Traum, den ein Mann wie Agamemnon träumen wird und dem er - das ist das Entscheidende - auch auf der Stelle glauben wird. Genau so kommt es. Natürlich endet dann der Angriff, den er leitet, in der Katastrophe. Aber von diesem Augenblick an steht für den Iliasleser das Bild des Unglücksmenschen Agamemnon fest, und keiner wundert sich, daß dieser Mensch, nachdem er Troia - nicht durch eigenes Verdienst zwar, sondern durch Odysseus' List, das Hölzerne Pferd - am Ende doch genommen hat, arglos nach Hause kommt
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
209
und sich - der Unglücksmensch! - zu Haus im Bad von seiner eigenen Frau umbringen läßt5. Der Traum, den Homer im 2. Ilias-Gesang für ihn erfunden hat, hat - wie ein Blitz - mit einem Mal das ganze So-Sein dieses Menschen aufgedeckt.
In dieser Weise wirkt der erste Steuerungseffekt sich aus. Der zweite bezieht sich nicht auf die Charakterzeichnung, sondern auf die Werkstruktur. Ich möchte ihn .Erwartungsstrukturierung' nennen. Gute Literatur zeichnet sich ja, wie Aristoteles in der .Poetik' herausgearbeitet hat, vor allem durch zwingende Einheitlichkeit der Handlung aus. Diese aber wird durch den Notwendigkeitscharakter - das άναγκαιον - des Handlungsablaufs erzielt. Das bloße Aneinanderkleben von Handlungssequenzen vermag ja, wie wir aus Trivialromanen oder Fernsehserien wissen, niemals wirklich zu berühren. Notwendigkeit muß aber auf den Rezipienten übertragen werden. Durch explizite Beteuerungen, daß dieser oder jener Handlungsteil notwendig sei, kann das nicht geschehen. Vielmehr muß durch implizite, sozusagen subkutane Binnensteuerungen eine feste Notwendigkeitsempfindung im Rezipienten erzeugt werden. Der Rezipient muß zu diesem Zweck in die vom Autor angelegte Handlungsstruktur immer wieder gewissermaßen .einrasten'. Erst durch diese Verschmelzung kann das Werk, das ja als solches eine eigene, eine Dornröschenweit bildet, erwachen und zur Blüte kommen. Eines der Erzählmittel, die diese Notwendigkeitsempfindung vermitteln können, ist der gut fingierte Traum. Das ist natürlich längst gesehen und etwa bei Eberhard Lämmert in den ,Bauformen des Erzählens' (Stuttgart 7 1980, 178 f.) treffend formuliert: „Wo Träume, Ahnungen, Prophezeiungen im Laufe des erzählten Geschehens kundgetan werden, da steuern sie [...] den Leser". Das ist eine Abstraktion. Wie die Lesersteuerung durch Träume praktisch funktioniert, kann nur der Einzelfall verdeutlichen. Beim Agamemnon-Beispiel funktioniert sie scheinbar dadurch, daß der Traum vom Blitzsieg, den Zeus dem Agamemnon schickt, vom Erzähler selbst mehrfach als .Unheilstraum' bezeichnet wird, so daß der Leser diesen Traum von vornherein ex negativo verstehen muß: als einen Traum, der sich eben nicht erfüllen wird. Diese äußere Vorab-Information durch den Erzähler hat freilich an dieser Iliasstelle besondere Gründe. Im Regelfall erfolgt dergleichen nicht. Es wäre eigentlich auch hier nicht nötig. Denn schon der Traum-Inhalt als solcher reicht an sich in seinem Kontext aus, die Erwartung des Lesers in die gewünschte Richtung zu lenken: Wenn ein Feldherr in eben jenem Augenblick vom Blitzsieg träumt, in dem sein Heer nicht nur durch eine Massenseuche, sondern auch durch einen Kampfboykott seiner kampfstärksten Alliierten (Achilleus mit den Myrmidonen) in Wahrheit völlig lahmgelegt ist, dann ist dem Leser klar, daß dieser Traum ein bloßer .Traum' wird bleiben müssen - den ein Mann wie Agamemnon not^ Zur Kontrastfunktion der Agamemnongestalt für die Odysseusgestalt in unserer Odyssee s. U. Hölscher, Das Schicksal der Atriden, in: Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman ( 2 1989), 297-310; J. Latacz, Homer. Der erste Dichter des Abendlands ( 2 1989) 192.
210
Lesersteuerung durch Träume
wendig träumen muß (wir würden heute wohl von einem Kompensationstraum sprechen), der aber gerade deshalb, bei eben diesem Menschen, nur bedeuten kann: er wird die Stadt an diesem Tage gerade nicht erobern. Auf eben diese Traum-Empfindung hat der Erzähler aber mit der Fingierung des Agamemnon-Traumes hingesteuert. Denn durch alles, was er im folgenden erzählen wird - und darunter sind auch Anfangserfolge des Agamemnon-Vorstoßes - , wird sich beim Leser nun die Gewißheit durchhalten: ,Das wird nicht so bleiben! Der Umschlag wird bald kommen!' Der Leser rezipiert die erzählte Handlung also von nun an mit einem Wissensvorsprung, d. h. von einer höheren Warte aus, und das bedeutet: er rezipiert sie nicht mit naiver Empathie, sondern aus einer wissenden Gebrochenheit heraus, die Distanzierung schafft und damit einen reflektierenden Genuß ermöglicht. I
79 Auch für den Psychologen mag es wichtig sein zu sehen, wie niveausteigernde Effekte dieser Art in einem literarischen Kunstwerk durch zielsichere Traumhandhabung erreicht werden können. Denn dahinter wird er ja ein tiefes Wissen um die Beziehungen zwischen Traum-Inhalt und Persönlichkeitsstruktur einerseits und um die Wirkungsweise von Träumen nicht nur auf die Träumenden, sondern auch auf die Adressaten von Traumberichten andererseits erkennen. Beide genannten Steuerungseffekte - der persönlichkeitscharakterisierende und der erwartungsstrukturierende - gehen in noch zwingenderer Weise vom Typ des .Innentraumes' aus. Wie bereits gesagt, kommt dieser bei Homer nur ein Mal vor. Wohl deshalb, weil er noch schwieriger zu formen ist. Wir werden gleich verstehen, warum. Es handelt sich um den berühmten Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee. Penelope hat fast volle zwanzig Jahre auf ihren Mann Odysseus gewartet. Niemand kann sagen, ob er überhaupt noch lebt. Troia, wohin er vor zwanzig Jahren mit dem Griechenheere aufbrach, ist bereits seit fast zehn Jahren eingenommen, alle anderen griechischen Troia-Überlebenden sind längst zu Hause, nur Odysseus nicht. Die Odyssee schildert nun, wie Odysseus doch noch heimkommt. Sie schildert aber nur die Krisis der Geschichte, die letzten 40 Tage. Am 35. dieser 40 Tage kommt Odysseus auf seiner Heimat-Insel Ithaka an (das ist im 13. der 24 Gesänge), am 39. Tag (das ist im 23. Gesang) fallen sich die Ehepartner nach 20 Jahren wieder in die Arme. In den 5 Tagen zwischen dem 13. und dem 23. Gesang vollzieht sich der vorsichtig tastende Wiedereintritt des Königs von Ithaka in die ihm fremd gewordene Heimat. Dabei ist das Hauptproblem natürlich die Wieder-Annäherung der Ehegatten. Dieses Einander- Wiederfinden kann ja nicht im Hauruckverfahren geschehen, 20 Jahre lassen sich nicht einfach überspringen. Da sind Mauern der Entfremdung hochgewachsen. Der Dichter zeigt, wie sie Schicht für Schicht, fast Stein um Stein, wieder abgebaut werden müssen. Der Kunstgriff, der ihm das ermöglicht, besteht darin,
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
211
Odysseus inkognito heimkehren zu lassen. Die Göttin Athene hat ihn dazu in das Gegenteil von dem verwandelt, was er ist: den König in den Bettler. Diese größtmögliche Polarität scheint den größtmöglichen Schutz vor vorzeitiger und damit lebensgefahrlicher Entdeckung durch Odysseus' Feinde, die Freier der Penelope, zu bieten. Die Polarität sichert aber auch die Wahrung des Inkognitos vor der eigenen Frau, Penelope. Zumindest sollte sie's. Doch gerade unterm Schutze dieses beide Partner äußerlich sichernden Inkognitos kann es zu der vom Dichter angezielten inneren Annäherung kommen. Der Bettler, der da am vierten Tag seines Ithaka-Aufenthalts im Königshaus vor der Königin Penelope erscheint, erweist sich nämlich als atypischer Vertreter seines Standes: weitgereist, erstaunlich lebensklug, verständig, überlegend, ja sogar energisch und aufblitzend nur, jedoch erkennbar - souverän. Penelope fühlt sich zu ihm seltsam hingezogen. Sie spricht mit ihm - verwundert sich ob seiner Einsicht - die Gedanken beider nähern sich allmählich - ohne daß es ihnen recht bewußt wird - in vielerlei Gesprächen immer stärker aneinander an. Durch Eingriff eines Dritten (der alten Amme Eurykleia) kommt es fast zu einer verfrühten Wiedererkennung. Doch der Dichter biegt das ab. Im unmittelbaren Anschluß daran aber treibt er die innere Wiedererkennung, die er soeben durch den Abbruch der drohenden äußeren als einzig angemessen ausgewiesen hat, ein ganz entscheidendes Stück voran. Als Mittel dazu setzt er einen Traum ein - so: Da nahm den Faden des Gespräches wieder auf die umsichtige Penelopeia: „Fremder! Dieses will ich dich noch, dieses Kleine, persönlich fragen - denn es ist ja auch schon bald die Zeit des Schlafes da, des süßen - jedenfalls für jeden, den der Schlummer Ubermannt, der süße, und war' er auch bekümmert! Aber mir hat auch noch ein Leid, das gar nicht auszumessen ist, gebracht die Schicksalsgottheit: Tagsüber nämlich find' ich noch Erleichterung beim Klagen und beim Weinen, wenn ich nach meinen Alltagspflichten schaue und nach denen meiner Mägde; wenn dann aber die Nacht gekommen ist und alle in den tiefen Schlaf hat sinken lassen - da lieg' ich auf meinem Bett, und mit geballter Wucht um das gepreßte Herz herum stören mich stechend scharf die Sorgen auf in meinem Jammern ... (Beispiel aus dem Mythos als Gleichnis: So wie die Mutter Aedon, zur Nachtigall geworden, zu Frühlingsbeginn im dichten Blätterschutz der Bäume herrliche Lieder auf ihren Sohn Itylos singt, um ihn klagend, den sie im Wahn versehentlich getötet hat)... so ist auch mir zwiefach der Sinn erregt, dahin und dorthin: soll ich bei meinem Sohne bleiben und alles fest bewahren: meinen Besitz, die Mägde und das große Haus mit hohem Dache, das Ehelager meines Mannes in Ehren haltend und des Volks Nachrede scheuend - oder soll ich nun doch mitgehen mit demjenigen der Achaier, der als der Beste um mich freit in der Halle, mit einer hohen Summe Brautgelds? I Mein Sohn, solang er noch ein Kind war, voller Einfalt, ließ es nicht zu, daß ich mich neu verheiratete, des Gatten Haus verlassend - nun aber, wo er ja schon groß ist und die Mannesreife erlangt hat, hat er sogar den Wunsch, daß ich wieder aus dem Hause gehe; in ärgerlichem Unmut wegen des Besitztums, das ihm aufessen die Achaier!
80
212
Lesersteuerung durch Träume
Aber jetzt sag mir über diesen Traum deine Meinung! Höre zu: Gänse fressen mir im Hofe - zwanzig Stück - den Weizen aus dem Wasser(trog), und ich wärme mich an diesem Anblick. Da kommt aus dem Gebirg ein großer Adler, krummen Schnabels, und allen bricht er ihre Hälse und tötet sie. Und die liegen da auf éinen Haufen in der Halle - er aber schwingt sich auf in den klaren Luftraum. Und ich weinte und schluchzte - immer noch im Traum! - , und es liefen zusammen die Frauen mit den schönen Flechten um mich, die ich erbärmlich jammerte, daß mir der Adler getötet die Gänse. Zurück kommt er da plötzlich - setzt sich auf die Balkenspitze unter der Decke, und mit menschlicher Stimme verwehrt er's mir und spricht: .Getrost, du Tochter des Ikarios, des weitberühmten! Nicht Traum, sondern Wirklichkeit (ist das), gute, die ganz gewiß in Erfüllung gehen wird! Die Gänse sind Freier, ich aber: ein Adler als Vogel war ich dir zuvor, jetzt aber bin ich als dein Gatte wieder da, der ich allen Freiern ein schmähliches Ende bereiten werde!' so sprach er aber mich ließ der honigsüße Schlummer frei, und hinguckend nahm ich die Gänse in der Halle wahr den Weizen rupfend bei dem Troge, - geradeso wie vorher." Ihr gab zur Antwort da der listenreiche Odysseus: „Frau! keinesfalls kann man zu dem Traume eine Meinung sagen, die anderswohin abweicht, da dir ja doch Odysseus selbst gezeigt hat, wie er ihn vollziehen (zur Vollendung, Erfüllung bringen) wird: Den Freiern zeigt sich klar das Verderben, allen miteinander, und keiner wird da wohl dem Tode und den Todeskrallerinnen noch entgehen!" Zu ihm sagte da wiederum die umsichtige Penelopeia: „Fremder! wahrhaftig: Träume sind Dinge, gegen die's kein Mittel gibt (ονειροι αμήχανοι), unscheidbaren Sinnes (άκριτόμυθοι), und nicht alles erfüllt sich (von dem, was sie sagen) den Menschen ..."
Natürlich hat dieser Traum im Kreise der Homer-Experten unendliche Debatten ausgelöst. Sie sollen hier nicht ausgebreitet werden. Ich übergehe viele andere Aspekte, die der Traum auch noch hat, und möchte im Rahmen meines eigenen Interpretationsanliegens nur zeigen, wie dieser Innentraum die Funktion der Lesersteuerung noch intensiver, noch zwingender erfüllt als alle Träume vom Typ ,Außentraum'. Zunächst die Funktion der Charakterzeichnung. Penelopes Problem besteht in seinem nackten Kern in ihrer unentschiedenen Stellung zwischen Freiern und Odysseus. Diesen Kern enthüllt der Traum. Penelope träumt also keine ,Tages-
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
213
reste', Penelope träumt ihr Problem. Wie beim Traum des Agamemnon in der Ilias dient also die Traumfingierung auch hier nicht dazu, irgend etwas Nebensächliches aus dem Leben des Träumenden zu illustrieren, sondern dazu, sein Existenzproblem, um das sein Denken kreist, in voller Klarheit darzustellen. Der glücklose Feldherr träumt vom Blitzsieg, die unentschiedene Noch-Ehefrau des Verschollenen von einer endlichen Entscheidung zwischen den zwei Ansprüchen, dem der Gattentreue und dem des Lebenspragmatismus, zwischen denen sie zerrieben wird. In beiden Fällen erreicht der Träumende sein Wunschziel nur im Traum - wodurch dem Rezipienten klargemacht wird: Dies ist ein Mensch von der Art, daß er von dieser Zielverwirklichung nur träumen kann. Beide Agamemnon wie Penelope - (das macht der Traum in beiden Fällen deutlich) wollen etwas für sie Lebenswichtiges (bei Penelope ist dies die Entscheidung), sie sind jedoch zu schwach, es aus eigener Kraft zu verwirklichen. Die Aufgabe des Dichters, der den Traum Penelopes geformt hat, war damit allerdings noch nicht gelöst. Die Persönlichkeit Penelopes war komplizierter als die Agamemnons - um so viel komplizierter, I als ihre ganze Lebenslage und 81 Lebensproblematik komplizierter war. Penelope wird in der Odyssee immer wieder mit dem Epitheton ,periphron' charakterisiert. Das heißt nicht einfach ,klug', .intelligent' (obwohl dies beides mitgemeint ist), sondern es bedeutet so viel wie ,ringsherum-denkend'. Wir würden vielleicht sagen: ,eine Frau von außerordentlicher Umsicht'. Natürlich muß Penelope so sein, sie könnte sonst nicht Partnerin des Odysseus sein - dessen herausragende Eigenschaft: die vielerfahrene Klugheit, die Odyssee als ganze ja entfalten will. - In dem Moment, in dem Penelope ihre Traum-Erzählung an den Bettler beginnt, nennt der Dichter sie erneut ,periphron'. Offenbar will er noch eine zweite, eine besondere Beziehung betonen, die zwischen dem Wesen der Person, die träumt, und ihrem Traum besteht. Natürlich ist Penelope stets ,periphron', in allen Dingen, auch den kleinsten. Dasjenige ,periphron'-Sein, auf das es in der Odyssee ankommt, ist aber doch nur eines, ein grundsätzliches: Penelope muß umsichtig genug sein, sich die Möglichkeit, im äußersten Notfall doch noch einem der Freier in eine neue Ehe zu folgen, nicht selbst zu nehmen. Selbstverständlich würde sie nicht gern wieder heiraten. Der Dichter läßt sie immer wieder sagen, wie verhaßt ihr diese Vorstellung ist, sogar, wie verhaßt ihr alle diese Freierlinge sind. Er läßt es sie jedoch nur vor Vertrauten sagen, vor dem Sohn Telemachos zum Beispiel oder vor den treuen Dienerinnen. Sie weiß ja sehr genau - und sagt auch das sehr deutlich immer wieder - , daß nicht nur ihre Eltern, sondern vor allem der Sohn Telemachos, der jetzt erwachsen ist, es gerne sähe, wenn die Mutter sich wiederverheiratete, aus dem Haus ginge und ihm so zugleich die
214
Lesersteuerung durch Träume
Freier vom Hals schaffte, die den Erbhof kahlzufressen drohen, und ihm das alleinige Verfiigungsrecht über den Hof abträte. Penelope hat diese Entwicklung schon lange kommen sehen. Sie hat darum die Freier nicht einfach abgewiesen, sondern hingehalten. Sie hat nie gesagt: „Ich werde niemals einen von euch heiraten!", sondern immer nur: „Ich bin noch nicht entschieden". Drei Jahre Zeit hat sie zuletzt mit der Webelist gewonnen: Vorgeblich mußte sie zuvor noch das Bahrtuch für ihren Schwiegervater Laërtes fertigweben, falls der plötzlich stürbe - nur hatte sie's am Tag gewebt und nachts wieder aufgetrennt. Vor kurzem sind die Freier ihr nun freilich auf die Schliche gekommen, und jetzt ist die Entscheidung wirklich nicht mehr länger aufzuschieben6. Das alles hatte sie kommen sehen - und sich daher den letzten Ausweg offenhalten müssen. Das aber hatte sie nur tun können, indem sie sich niemals vergaß und etwa den Freiern ihren Herzenswunsch verriet: ,Ich wünschte, Odysseus würde kommen und euch alle töten!' Nun sitzt ein fremder Mann vor ihr, der ihr zwar merkwürdig sympathisch ist, von dem sie aber, außer dem, was er ihr selbst erzählt hat, gar nichts weiß. Wie soll sie wissen, auf welcher Seite dieser Fremde wirklich steht? So wie sie die Freier kennt - gerade gestern abend erst hat sie erfahren, daß sie ihr den Sohn Telemachos umbringen wollten - , könnte dieser Bettler ja sogar ein gutgetarnter , Spion' der Freier sein - oder aber auch ein Glücksritter, wie die vielen vor ihm, die aus der prekären Lage der Königs-, Witwe' auf irgendeine Weise Kapital für sich zu schlagen suchten. Andererseits könnte der Fremde freilich auch tatsächlich, wie er vorgibt, ein Bekannter, vielleicht sogar Vertrauter, ja, ein Abgesandter ihres Mannes sein. Sie ist sich nicht im klaren. Äußerlich hat sie ihn soeben erst, gerade weil er ihr so merkwürdig sympathisch ist, bereits getestet: Als er ihr erzählte, er habe vor 20 Jahren ihren Mann Odysseus in seiner Heimat Kreta gesehen, hat sie ihn gefragt, was dieser ,Odysseus' denn damals angehabt habe. Diesen Test hat der Bettler mit Bravour bestanden. Erstaunlich - eigenartig! Penelope ist sehr beeindruckt. Auch von der Sicherheit, mit der der Fremde im Anschluß an den bestandenen Test die Rückkehr ihres Mannes vorausgesagt hat: noch in diesem Jahr, in diesem Monat noch vor dem nächsten Neumondstag! Das wisse er vom König der benachbarten Thesproten. Odysseus sei nur noch nach Dodona aufgebrochen, zum Zeus-
6
Penelopes kritische Lage ist vorzüglich dargestellt von E. Siegmann, Homer. Vorlesungen Uber die Odyssee, hrsg. v. J. Latacz/A. Schmitt/E. Simon (1987) 105-107. Zu grundsätzlich gleichem Textverständnis war bereits 1963 Lydia Allione gelangt (,Penelope in der Odyssee. I: Die Geschenkeforderung', jetzt deutsch in: Homer [s. o. Anm. 4] 261-281).
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
215
Orakel, um nach der besten Art der Rückkehr zu fragen: offen - oder heimlich? Aber kommen werde er, und zwar mit unerhörten Schätzen, so vielen, daß seine Erben bis ins zehnte Glied noch davon zehren könnten! Das alles hat Penelope beeindruckt, sie ist erfreut und ordnet an, diesen Fremden da zu waschen und zu I pflegen - was dann geschieht und zu dem Zwischenspiel der Fast-Erken- 82 nung durch die Narbe führt. Während dieses Vorgangs hat Penelope natürlich über das Gehörte nachgedacht - so intensiv, daß sie die Fußwaschung gar nicht recht bemerkt hat (der Dichter sagt: Athene hatte ihr den Sinn abgewendet). Sie hat verglichen und erwogen, wohl auch erste Entschluß-Ansätze ausgebildet. Sie hat begonnen, ihre Entschluß-Unfähigkeit allmählich zu überwinden. Es sind ihr Kräfte zugewachsen. Der Bettler könnte ja die Wahrheit sagen. Das schüfe eine völlig neue Lage. Aber Penelope wäre nicht περίφρων Πηνελόπεια, die .ringsherumdenkende Penelope', wenn sie sich mit dem bisher Gehörten schon zufriedengäbe. Jetzt will sie wissen, wie der Fremde reagiert, wenn es um Schwierigeres geht, um kompliziertere, weil innere Beziehungen. Aus dieser Stimmung heraus läßt der Dichter sie dem Bettler nunmehr einen komplizierten Traum erzählen, zu dem er Stellung nehmen soll. Die Betonung liegt hier auf .kompliziert'. Eine Frau wie Penelope, das zeigt die Kompliziertheit des fingierten Traums, darf nicht sozusagen tumb genug sein, einen planen Traum zu haben. Wohl darum kann der Dichter sie auch keinen Außentraum haben lassen. In einem solchen würde Odysseus an ihr Lager treten und ihr sagen: „Morgen komme ich zurück und bring' die Freier um!" Was sollte sie mit der Erzählung eines solchen Traumes bei dem Bettler erreichen? Im schlimmsten Falle hätte sie sich damit unwiderruflich verraten. Er könnte zu den Freiern gehen und verkünden: „Penelope träumt von nichts anderem als von eurem Tod. Ihr Versprechen, vor drei Stunden abgegeben, daß sie jetzt endlich einen von euch heiraten will, ist nichts als eine neue Hinterlist!" Das wäre dann das Ende aller Handlungsmöglichkeiten. Penelope muß also in dieser hochriskanten Lage, wenn sie überhaupt einen Traum erzählen soll, einen komplizierten Traum erzählen. Der Dichter macht ihr diesen komplizierten Traum - und überzeugt damit den Leser von der Einheit der Person Penelope: Die .umsichtige' Penelope erhält den Traum, den sie in dieser kritischen Situation verdient und der sie dadurch für den Leser in ihrer Wesensart noch komprimierter faßbar macht. Sie träumt das, was sie nach des Odysseedichters Willen an dieser Stelle seiner übergeordneten Handlungsplanung träumen soll, nicht töricht, sondern sozusagen ,klug', d.h. nicht offen, sondern verhüllt. Darum ist der Traum, den sie hier zu träumen hat, ein allegorischer, ein symbolischer Traum: Penelope muß die Dinge, die sie nach des Dich-
216
Lesersteuerung durch Träume
ters Willen träumen soll, damit sie eine ganz bestimmte Wirkung auf die Adressaten ihrer Traumerzählung - nämlich auf Odysseus und den Leser - haben können, so träumen, daß sie nicht eindeutig sind. Darum zunächst die scheinbar harmlosen Alltagstraumfiguren: Gänse und Adler. Um recht verstanden zu werden: Es ist mir klar, daß angesichts der Auflösung, die dann gegeben wird, typologisch in diesem Traum das vorliegt, was Freud die Verschiebung eines gefährlichen latenten in einen ungefährlichen manifesten Trauminhalt nennen wird. Der Dichter kannte das Phänomen zweifelsfrei aus der Empirie, wenn er es auch nicht in dieser Weise hätte erklären können, da er ja nicht Freud gelesen hatte. Es ist mir ferner klar, daß der Traum genau dem Typ des Freudschen Todeswunschtraums für die im Traum Bejammerten entspricht. Auch dieses Phänomen der Inversion der Affekte konnte, da es ja (das wollte Freud ja zeigen!) universal ist, dem Dichter aus der Empirie bekannt sein. Darauf aber kommt es mir nicht an. Mir kommt es vielmehr darauf an, zu zeigen, wie sich der Dichter diese empirisch ihm vertrauten Phänomene für seine literarischen Zwecke zunutze macht. Auf dieser Ebene jedoch sehen wir sofort, daß weder die Gänse noch der Adler wirklich ,harmlos' sind. Die Gänse ζ. B. sind nicht .irgendwo', sondern ,in meinem Hofe', es sind nicht Gänse, die irgendwo im Hofe im Gänsemarsch dahinmarschieren, sondern solche, die ,fressen'; Gänse schließlich, die nicht, wie es natürlich wäre, nach ihrer Anzahl im unbestimmten bleiben, sondern exakte ,zwanzig'. Eine reichlich unkonventionelle Gänseschar mithin. Als Leser der Odyssee werden wir jedoch diese eigenartigen exakten zwanzig im Königshof Penelopes fressenden Gänse sofort verstehen. Wir werden nämlich begreifen, daß der Dichter bei der allegorischen Verrätselung bereits die Wahrscheinlichkeit der Auflösung, die er plante, im Auge haben mußte: Gänse in Freier zu verwandeln war für den Leser nur dann kein lächerlicher Vorgang, wenn es von vornherein Freier-ähnliche Gänse waren. Das aber sind sie. Darum die Zahl - auch die Freier bilden eine festbegrenzte Gruppe (nur daß der Dichter natürlich nicht .einhundertneun' sagen konnte - das war die reale Zahl der Freier - , weil das lächerlich gewesen wäre und überdies die Auflösung, die ja noch folgen sollte, überflüssig gemacht hätte), darum der Ort - auch die Freier halten sich gewöhnlich im Hof und Haus auf - , darum die Tätigkeit - auch die Freier tun nichts anderes als .fressen'. - In gleicher Weise könnten wir den .großen Adler' erklären, die Tatsache, daß dieser Adler die Beute völlig unangetastet läßt - zwanzig Beutestücke und keines schleppt er für die Jungen weg? - , usw. Die Sonderbarkeiten des, wie Freud sagen würde, manifesten Trauminhalts erklären sich also aus den Realitätsgegebenheiten, die der Dichter im Traume spiegeln will. Daß er dabei im Prinzip ganz ähnlich verfährt wie nach Freud der gewöhnliche Träumende, wird kein Zufall sein, kann aber in meinem Zusammenhang unerörtert bleiben. Auch die Frage, warum der Dichter den Traum noch im Traume deuten läßt, muß ich jetzt auf sich beruhen lassen. Ich weise nur noch darauf hin, daß er Penelope auf diese Deutung des Traums im Traum in keiner Weise reagieren läßt - dieselbe Penelope, die eben noch im gleichen Traum mit Freude und mit Jammer nicht zurückgehalten hatte. Auch in diesem Zug liegt aber wieder Charakterzeichnung vor, denn würde der Dichter Penelope etwa (ob der erhaltenen Deutung) im Traum in Jubel I ausbrechen lassen - was sie dem Bettler ja dann erzählen würde - , dann würde er sie sich wiederum vor dem Bettler verraten lassen. Darum darf sie auf die Deutung im Traum in keiner Richtung reagieren nur so kann sie .periphron' bleiben.
An diesem Punkte aber endet der persönlichkeitscharakterisierende Steuerungseffekt des Traumes, um in den erwartungsstrukturierenden zu münden. Er ist, wie ich glaube, der eigentliche Zweck des Traumes. Die Anpassung des Trau-
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
217
mes an die Wesensart Penelopes, ebenso wie die Anpassung des Traumes an die reale Lage, in der Penelope im Traumzeitpunkt sich befindet - beides sind nur Teile einer Vorbereitungsprozedur. Die Vorbereitungsprozedur stellt sicher, daß der Traum sein eigentliches Ziel - das Ziel der Leserlenkung - optimal erreichen kann. Die Frage ist: Was genau soll der Traum beim Leser bewirken? Vorweg ist es vielleicht nicht überflüssig, noch einmal darauf hinzuweisen, daß der Dichter den Traum gar nicht erfinden würde, wenn er nichts bewirken sollte. In einem literarischen Kunstwerk von Qualität ist nichts Überflüssiges. Vom Notwendigkeitscharakter des sprachlichen Kunstwerks war ja schon die Rede. Kunst ist nicht Leben, sondern Verdichtung von Leben auf das Wesentliche hin. Das Zufällige des Alltags hat im Kunstwerk keinen Platz. Der Dichter unserer Odyssee hat eine Sagengestalt namens Penelope niemals gesehen, von ihren Träumen weiß er selbstverständlich nichts. Wenn er Penelope hier träumen läßt, verfolgt er damit einen künstlerischen Zweck. Fragen wie , Wann hat sie das denn eigentlich geträumt?' oder .Warum hat sie keinem anderen von diesem Traum erzählt?' sind daher fehl am Platz. Entscheidend ist allein, daß der Dichter sie diesen Traum genau an dieser Stelle seiner Werkkomposition - und an keiner früheren oder späteren - genau diesem Adressaten - keinem anderen - erzählen läßt. Das heißt: Er will an genau dieser Stelle seiner Komposition mit Penelopes Erzählung dieses Traumes an den Bettler etwas bewirken. Wollen wir demnach verstehen, was er bewirken will, müssen wir den genauen Kenntnisstand des Lesers an dieser Werkstelle kennen und nachvollziehen - d. h.: Was weiß der Leser bis hierher und was erwartet er zu diesem Zeitpunkt? Der Leser weiß, daß der Bettler, der Odysseus ist, die Freier töten will. Das weiß er seit dem 13. Gesang, wo Odysseus im Gespräch mit seiner Schutzgottheit Athene diese Absicht festgelegt hat. Von da an war alles, was der Dichter den Odysseus tun ließ, auf dieses eine große Ziel hin ausgerichtet. Der Leser weiß bisher - zusammen mit dem Bettler/Odysseus - noch zwei Dinge nicht, die er - zusammen mit Odysseus - erfahren möchte, weil er sie wieder zusammen mit Odysseus - erfahren muß: Erstens: Wie wird der Bettler die Tat realisieren? Die Freier sind - das weiß der Leser seit dem 16. Gesang - ihrer hundertneun. Wie wird ein Einzelner diese Übermacht überwinden? Zweitens: Wird der Bettler/Odysseus die Tat tun im Bewußtsein, damit auch die Wünsche seiner Frau zu treffen? Denn das ist ja bisher die große Unbekannte: Odysseus weiß sich einig mit der Göttin, Athene, mit seinem Sohn, Te-
218
Lesersteuerung durch Träume
lemachos, sogar - seit wenigen Minuten - mit seiner ältesten Vertrauten, der Amme Eurykleia. Der Kreis der Verbündeten hat sich Schritt für Schritt gerundet. Wer fehlt, ist die, um die es geht: Penelope. Solange diese Lücke nicht geschlossen ist, kann Odysseus' Tat-Entschlossenheit, die ja aus voller Überzeugung kommen muß, noch nicht vollendet sein. Er muß sich als Vollstrecker des Willens auch und gerade seiner Frau verstehen können. Penelope muß also dasselbe wollen wie Odysseus. Und er muß das, bevor er handelt, wissen. In beiden Punkten bringt nun der Traum Penelopes Klarheit und damit den notwendigen, vom Leser erwarteten Handlungsfortschritt. Erstens nämlich erfährt Odysseus per Penelopes Traum von seiner Frau erstmals explizit - aus ihrem eignen Munde - , daß sie nichts mehr ersehnt als den Tod der Freier durch die Hände ihres Mannes. Er erfährt das um so überzeugender, als sie es nicht direkt, sondern via Traumverkleidung, also als Bild ihrer intimsten und elementarsten Wünsche ausspricht - auch da noch vorsichtig, wie es ihrem Wesen, das er kennt, entspricht (zumal sie zu einem fremden Bettler redet), aber in der Sache nicht mißdeutbar. Von diesem Moment an weiß Odysseus definitiv, daß er mit der Tat die Wünsche beider Ehepartner erfüllen wird. Dem Leser seinerseits ist von diesem Moment an klar: Jetzt ist Odysseus' Tat-Entschlossenheit komplett. Zweitens bringt der Traum Klarheit in der Frage, wie die Freiertötung vor sich gehen wird. Nach der so erfüllungsgewissen Voraussage des Bettlers, Odysseus werde noch vor dem Neumondstage hier sein, war Penelope in tiefes Nachden84 ken versunken. Sie erwacht daraus mit der plötzlichen Bitte an den I Bettler, nur dieses noch, dies Kleine, fragen zu dürfen: „Was meinst du zu dem Traum da?" Deutlich ist: bis zu dieser Frage ist sie noch nicht voll entschlossen. Sie hat eine Idee, will sich aber von dem, der so erstaunlich stärkend und belebend auf sie wirkt, sozusagen noch den letzten Anstoß geben lassen. Als der Bettler die Traumdeutung des Traum-Odysseus energisch zur einzig möglichen erklärt, ist bei Penelope der letzte Damm gebrochen. Sie wiegelt zwar noch ab - die Vorsicht ist ihr Wesen - : Träume können sich erfüllen oder auch nicht - , aber gerade diese lange Erörterung zeigt, wie ich meine, an, wie tief sie diese Traumerzählung und die todernste Bestätigung der Bedeutsamkeit dieses Traumes durch den Fremden aufgerührt hat. Aus diesem inneren Aufruhr heraus kommt ihr ganz plötzlich die Kraft, sich endlich zu entscheiden und die Entscheidung auszuhalten. Und sie verkündet, im Tone endlicher, zutiefst befreiter Gewißheit die Entscheidung: Morgen setze ich die Bogenprobe an! Damit ist die Klärung, die der Leser erwartet hatte, abgeschlossen. Beide Fragen, die er hatte, sind erledigt. Bei der ersten - .Wird Odysseus im Einver-
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
219
ständnis mit seiner Frau handeln können?' - ist die Antwort ein klares Ja. Damit ist die Frage abgeschlossen. Bei der zweiten Frage - ,Wie wird Odysseus die Tat realisieren?' - ist die Antwort intrikater. Es ist eine Antwort, die eine neue Frage aufwirft. Indem sie eine Erwartung erfüllt, löst sie eine neue aus. Das ist die wohl kunstreichste Art der Lesersteuerung. Der Leser sieht nämlich in der Traum-Passage nicht nur den letzten Stein im Reifen von Penelopes Entscheidung, er sieht darin auch den letzten Schritt hin auf die Freiertötung. Bis hierher war ja immer noch das Wie nicht klar. Nun aber sieht der Leser, wie die Traum-Erzählung und die Traum-Bestätigung durch den Bettler, der Odysseus ist, in der Person, die jetzt als nächste handeln muß, Penelope, die ideale Lösung für das Problem, das beide haben, auf den Weg bringt: die Bogenschußprobe. Wenn Penelope fast nebenbei, sozusagen als Historie dieses Testes, erzählt, daß einst Odysseus diesen Schuß durch die 12 Äxte als gewöhnliches .Training' zu betreiben pflegte, dann faßt der Leser diese Worte viel ernster, viel konkreter auf: als Skizzierung der Entwicklung, die nun folgen wird: Odysseus hat soeben durch Penelope, die's gar nicht weiß, das Mittel in die Hand bekommen, nach dem er dauernd suchte, um die Freier möglichst unauffällig im wahrsten Sinne des Wortes ,in die Hand' zu bekommen. Der Leser ahnt: Odysseus wird sich zugleich als einzig würdiger Freier Penelopes erweisen, weil nur er den Schuß - natürlich! mit seinem eignen Bogen! wird leisten können, und er wird aus dieser Position des einzig Würdigen heraus mit diesem gleichen Bogen die durch eben diesen Würdigkeitsbeweis sinnfällig legitimierte Rache an den Freiern in die Tat umsetzen! Was leistet also - fragen wir zum Schluß - der Traum Penelopes? Die Erzähllinien der beiden Ehepartner Odysseus und Penelope waren seit dem 17. Gesang schrittweise immer stärker konvergiert (s. Skizze). Aber erst in dem Erzählstück ,Traum der Penelope' fallen sie zusammen. Indem jeder der beiden im Verlaufe dieser Traum-Passage den anderen, ohne es direkt zu wissen, in seinem jeweils individuellen Vorhaben bestätigt, verschmilzt das Tun beider Partner zur Einheit, noch bevor sie sich in persona wiedervereinigt haben 7 . Die konkrete per7 Als höchste Erfüllung einer Ehe hatte der Odysseedichter den Odysseus gegenüber Nausikaa die όμοφροσύνη bezeichnen lassen (ζ 181-185); die allmähliche Verschmelzung von Odysseus und Penelope in eben dieser όμοφροσύνη insbesondere während des 19. und 20. Gesanges hat - nach dem Vorgang u. a. von Ann Amory(-Parry) und N. Austin - 1982 J. Russo überzeugend herausgearbeitet. Eine Reihe von Interpreten hat diesen Punkt, der gegenüber der Weltfremdheit einer brav .philologisch' werkelnden Analyse den entscheidenden Fortschritt im Odysseeverständnis darstellt, bereits übernommen (in unserem Traum-Zusammenhang s. z. B.
220
Lesersteuerung durch Träume
sönliche Wiedervereinigung, die dann am Schluß, im 23. Gesang, erfolgen wird, kann so dem Rezipienten als selbstverständliche Besiegelung des innerlich bereits Vollzogenen erscheinen8 - und nicht als ein plötzliches .dramatisches' Er85 eignis mit Hilfe äußerer I Erkennungszeichen (die Bettstatt als Erkennungszeichen kann dadurch eine neue Dimension gewinnen). Der Notwendigkeitscharakter, der den Ereignisablauf unserer Odyssee für jeden Leser deutlich prägt, empfängt so seine Rundung. Nur eine Frage ist noch offen: Warum mußte das Erzählstück, in dem die beiden Hauptfiguren-Linien zusammenfallen, ausgerechnet ein Traum sein? - Der Dichter steuert auf die Bogenprobe hin. Er muß, wie dargelegt, verhindern, daß diese Bogenprobe als Resultat eines .einsamen Beschlusses' der Penelope herauskommt. Die Bogenprobe muß das Ergebnis gemeinsamer Entscheidung beider Partner sein. Eine bewußte gemeinsame Entscheidung der beiden Partner ist jedoch nicht möglich, da der verkleidete Odysseus sich vor der Freiertötung nicht entdecken darf. In Frage kommt infolgedessen nur eine unbewußte Gemeinsamkeit in der Entscheidung. Odysseus muß als Bettler durch sein Verhalten die Entscheidung in Penelope reifen lassen, Penelope muß sie alleine treffen, Odysseus aber sie erfahren, billigen und sie durch seine Billigung befördern. Von diesem Augenblick an ist es die Entscheidung beider. Der Haken ist nun freilich, daß Odysseus die Entscheidung nur dann mittragen kann, wenn er weiß, daß es keine Entscheidung gegen, sondern für ihn ist (denn äußerlich ist es ja eine gegen ihn). Dazu muß er das wahre, unverhüllte innerste Empfinden Penelopes erfahren. Das aber könnte Penelope offen nur dem Odysseus selbst aufdecken, nicht einem fremden Bettler, den sie erst seit ein paar Stunden kennt. Die Aufdeckung ihres Fühlens muß daher verhüllt erfolgen, aber dennoch überzeugend. Penelope muß ihr Innerstes enthüllen können, ohne es enthüllen zu
Morris 1983, 48-51); die Mehrheit der Interpreten (und damit vermutlich die Schulpraxis) hat diese Einsicht freilich noch längst nicht in die Odyssee-Interpretation integriert. Die wachsende Rezeption des neuen Odyssee-Kommentars der Fondazione Lorenzo Valla (die Gesänge 17-20 sind dort in Bd. V [1985] kommentiert worden von Russo selbst; s. vor allem die Seiten XII f. 222 f. 260 f.) wird hoffentlich (besonders wenn der Kommentar vollständig in Englisch vorliegt) den Durchbruch bringen. 8 Dazu trägt gerade der Anfang des vielgescholtenen 20. Gesanges bei: Wie hier die Linie der .Annäherung der Ehegatten unterhalb derBewußtseinsschwelle' durch Häufung weiterer Traumund Wachtraum-Szenen vom Dichter immer zwingender auf den Rezipienten übertragen wird, hat Russo 1983 (11-17) durch natürliches Hinhören auf die Textsignale stellvertretend für das Publikum, an das der Dichter unsrer Odyssee sich primär wandte, sensibel nachvollzogen (s. auch die Skizzen S. 225 f.).
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
221
müssen. Welche Mittel standen für einen so komplexen Zweck zur Auswahl? Ein direkter Götter-Eingriff wäre zu umständlich gewesen. Er hätte nicht so blitzartig Klarheit schaffen können, wie es in dieser Lage nötig schien. Er wäre außerdem kompromittierend für Penelope gewesen, da Penelope in einer Götterszene, die sie dem Bettler referierte, hätte reden müssen. Damit hätte sie sich unzweideutig offenbart. Ein Mittel, das Penelope das Reden ganz ersparte, war ein Traum (der Träumende ist passiv). Der Traum spricht selbst. Und ist dabei doch unverbindlich: anders als ein Göttereingriff kann er - möglichen unerwünschten Ohren gegenüber - heruntergespielt, ja für bedeutungslos erklärt werden: Träume sind Schäume (V. 560-569). Für diejenigen, die er betrifft, jedoch - Odysseus und Penelope, den Leser - ist seine Bedeutung um so manifester.
Ausgewählte Literatur: I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
Allgemeines Büchsenschütz, B., Traum und Traumdeutung im Alterthume, Berlin 1868 (noch immer nützlich). Bouché-Leclercq, Α., Histoire de la divination dans l'antiquité, Paris 1879 (bes. Buch Π, Kap. 1). Hey, F. O., Der Traumglaube der Antike. München 1908 (Schulprogr.) Binswanger, L., Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traums von den Griechen bis zur Gegenwart, Berlin 1928. Björck, G., ONAPΙΔΕΙΝ. De la perception de rêve chez les anciens, Eranos 44, 1946, 306314. Oppenheim, A. L., The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, Philadelphia 1956. van Lieshout, R. G. Α., Greeks on Dreams, Diss. Cambridge 1972, Utrecht HES Publishers 1980 (offset). Rez.: CW 75, '82, 318 f. (White) / G&R 29, '82, 102 (Walcot) / CR 32, '82, 282 (Dowden) / REG 45, '82, 505-08 (Meillier) / AC 52, '83, 460 (Byl) / LEC 51, '83, 84 (Druet) / JHS 105, '85, 205 f. (Del Corno) / Mnemosyne 28, '85,164-66 (Kessels) Dazu: Brilliante, C., I Greci ed il sogno. Alcune considerazioni su uno studio recente [se. van Lieshout], QUCC 55, 1987,143-150. Gourevitch, D., La recherche de l'inconscient dans la littérature antique - Problèmes de méthode, in: The Unconscious (Tbilisi, Metsnieresa 1978) Π 655-662 [zu Euripides und Aelius Arist.]. Stuhrmann, R., Der Traum in der altindischen Literatur im Vergleich mit altiranischen, hethitischen und griechischen Vorstellungen, Diss. Tübingen 1982 (V & 296 S., 36 Abb.).
222 10.
Lesersteuerung durch Träume Latacz, J., Funktionen des Traums in der antiken Literatur, in: Traum und Träumen. Traumanalysen in Wissenschaft, Religion und Kunst, hrsg. v. Therese Wagner-Simon u. Gaetano Benedetti, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1984, 10-31. [in diesem Band S. 467] [Eine Kurzfassung davon Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, N. F. 10, 1984, 23-39], I
11. zur Oneirokritik 1. 2.
Hopfner, Th., Artikel .Traumdeutung' in: RE VI (2), Sp. 2233-2245. Del Corno, D., Ricerche sull'onirocritica greca, RIL 96, 1962, 334—366.
III. zur Aretalogie 1. 2.
Weinreich, O., Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und Römer, Gießen 1909 (= R G W VIII) Michenaud, G./Dierkens, J., Les rêves dans les ,Discours Sacrés' d'Aelius Aristide, II e siècle ap. J.-C., Essai d'analyse psychologique, Université de Mons/Bruxelles 1972.
IV. zur Medizin Palm, Α., Studien zur Hippokratischen Schrift ,Περί διαίτης', Diss. Tübingen 1933. V.
zur Philosophie
1.
Wijsenbeek-Wijler, Henriette, Aristotle's Concept of Soul, Sleep, and Dreams, Diss. Amsterdam 1976. Macrobius, Commentary on the Dream of Scipio, translated with an Introduction and Notes by W. H. Stahl, New York 1952.
2.
VI. zur Dichtung (a) 1. 2.
Epos
Messer, W. S., The Dream in Homer and Greek Tragedy, New York 1918. Wetzel, J. G., Quomodo poetae epici et Graeci et Romani somnia descripserint, Diss. Berlin 1931. 3. Hundt, J., Der Traumglaube bei Homer, Greifswald 1935. 4. Steiner, H. R., Der Traum in der Aeneis. Diss. Bern 1952. 5. Amory(-Parry), Anne, Omens and Dreams in the Odyssey, Diss. Harvard 1957 (ungedr.). 6. Bowcott, E., Dreams in the Homeric Poems. M. A.-Thesis Durham 1959 (ungedr.). 7. Amory(-Parry), Anne, The Gates of Horn and Ivory, Yale Classical Studies 20,1966, 1-59. 8. Grillone, Α., Il sogno nell'epica latina. Tecnica e poesia, Palermo 1967 (die Träume bei Ennius, Vergil, Ovid, Lucan, Valerius Flaccus, Silius Italicus, Statius, Claudianus). 9. Kessels, Α. Η. M., Studies on the Dream in Greek Literature [jedoch in Wahrheit nur zu Homer], Diss. Utrecht 1973, Utrecht HES Publishers 1978, 269 p. Rez.: REG 93, '80, 277 f. (Said) / G&R 27, '80, 84 (Arnott) / CR 30, '80, 283 (Borthwick) / CW 75, '82, 189 f. (Fuqua) / Maia 33, '81, 190 f. (Fasce) / Mnemosyne 38, '85, 394-97 (van Lieshout). 10. Mirezza, Ν., The dream in myth and epic poetry, Diss. New York Univ. 1981, 247p. (microfilm; summary in DA 42, '82, 3150 A).
Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee
223
(b) Drama 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Staehelin, R., Das Motiv der Mantik im antiken Drama, Gießen 1912 (= R G W ΧΠ) Messer (s. oben VI a 1 ) Bächli, E., Die künstlerische Funktion von Orakelsprüchen, Weissagungen, Träumen usw. in der griechischen Tragödie, Diss. Zürich 1954. Lennig, R, Traum und Sinnestäuschung bei Aischylos, Sophokles, Euripides, Diss. Tübingen 1969. Kessels (s. oben VIa9) Devereux, G., Dreams in Greek Tragedy. An Ethno-Psychoanalytical Study, Berkeley: UCP 1976, repr. paperback 1980. Rez.: Times Lit. Suppl. 75, '76, 1534 (Knox) / GFF 7, '84, 91 (Citti) / Gnomon 52, '80, 49-51 (Del Como) - deutsche Übers.: Träume in der griech. Tragödie. Eine ethnopsychoanalytische Untersuchung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp '82 (Suhrkamp Taschenbuch 1985). Marenghi, G., Psicoanalisi e tragedia greca. Il motivo del sogno, in: Studi R. Cantarella, Univ. di Salerno, 1st. di filol. class.: Laveglia Ed. 1981, 77-95.
(c)
Geschichtsschreibung
1.
Loretta, F., Träume und Traumglaube in den Geschichtswerken der Griechen und Römer, Diss. Graz 1957 (ungedr.). Frisch, P., Die Träume bei Herodot, Diss. Köln 1968 (= Beitr. zur Klass. Philologie, Heft 27) [s. dazu W. Marg, Gnomon 42,1970, 515-517],
2.
(d) Zum ,Traum Penelopes ' speziell (über das in VI a Genannte hinaus): 1. 2. 3.
Büchner, W., Die Penelopeszenen in der Odyssee, Hermes 75, 1940, 129-167 (bes. 147 ff.) Georgiades, G. Α., La rêve de Pénélope, Psyché 4, 1949, 740-745. Devereux, G., Penelope's Character, Psychoanalytical Quarterly 26, 1957, 378-386 [„eccentric interpretations": Russo 1982, 9 Anm. 12; s. aber oben Anm. 1], I 4. Rankin, A. H., Penelope's Dreams in Book XIX and XX of the Odyssey, Helikon 2, 1962, 617-624. 5. Allione, Lydia, Telemaco e Penelope nell'Odissea, Torino 1963 [s. oben Anm. 7]. 6. Amory, Ann, The Reunion of Odysseus and Penelope, in: Essays on the Odyssey, ed. by C. Taylor Jr., Bloomington 1963, 100-121 [s. oben Anm. 7], 7. Vester, H., Das 19. Buch der Odyssee, Gymnasium 75, 1968, 4 1 7 ^ 3 4 (bes. 426 ff.). 8. Kessels, A. H. M., De droom van Penelope en Odyssee 19, in: Verh. Ned. Filol. Congres 33, 1974, 146-151. 9. Austin, N„ Archery at the Dark of the Moon, Berkeley 1975 (bes. 211-235) [s. oben Anm. 7]. 10. Russo, J., Interview and Aftermath: Dream, Fantasy, and Intuition in Odyssey 19 and 20, AJPh 103,1982, 4-18 [s. oben Anm. 7], 11. Morris, J. F., Dream scenes in Homer, a study in variation, TAPhA 113, 1983, 39-54 [s. oben Anm. 7]. 12. Athanassakis, A. N., Penelope's dream in the context of the eagle against serpent motif, Hellenika 38, 1987, 260-268 [s. oben Anm. 1],
Lesersteuerung durch Träume Reider, G. Α., Epiphany and Prophecy in Dreams in the Homeric Epics, Diss. Boston Univ. 1989 [nach dem mir allein bekannten summary in DA 50, 1989, 679 A, in der Grundtendenz wohl eher ein Rückschritt: „... the Homeric notion that dreams come from gods is not a literary device [... ] but a product of genuine religious experience ... "]
Lesersteuerung durch Träume
226 89
•S -S . i a ? j s BicSs« g sii Vf Ό ¡, V Κ ι ^ ^ p i ^ fA Sc s a l c i S J-b-Ö-Ü" " §«2«•sà 'λ e.g νsΝs=."I! 8 β) l% ss» >-2j C "·§ 3 S gcS "α33ϊάΌ υ oo J2 O
Ό J> 00
3
a>
•Si
ωα,
I o ζ Β Ο > 00 Β S •S υs « O l-i Ό θ! •a
o •8 H
o > JH u ω £ υ 0 1 P" ω 3. -a b c a 3. > -o >
824
254
825
Neuere Erkenntnisse zur epischen Versifikationstechnik
sen. Wir haben nur ein einziges Textdokument, in dem die chronologisch aufeinanderfolgenden Stadien seines eigenen Entstehungsprozesses nur als Einschlüsse aufgeholben sind. Diese Einschlüsse ausfindig zu machen wird der nächste Schritt sein müssen. Am fruchtbarsten wird aber zunächst wohl eine Kontrast-Untersuchung sein, also eine Analyse der Versbildungsnormen in einem Themasektor, der unzweifelbar wesentlich jünger ist als der Sektor .Tötungsszenen' (also etwa der Sektor .Gleichnisse'). Eine erste Hilfestellung bei der Weiterarbeit in diachronischer Sicht könnte die folgende Hypothese über den Entwicklungsverlauf der Versifikationstechnik geben, die von Eva Tichy (Marburg) stammt (Tabelle VII): Tabelle VII
(hypothetischer Entwicklungsverlauf der epischen Versifikationstechnik nach Eva Tichy, Marburg)
Ό Cicero, Aratea; Germanicus; Manilius) b. Ähnliche Stoffe: Numenios: Halieutikon (um 250) Eratosthenes: Hermes (um 220) Pankrates: Halieutika I Boios: Omithogonia Alexandras Lychnos: Phainomena (1. Jh.) (u.v.a.) c. Nikandros v. Kolophon (um 200) Theriaka - Alexipnarmaka - Heteroiumena - Georgika (—> Vergil)
Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne IV. Das mythologisch-idyllische Epos (Epyllion) (—> röm. Neoterik) 1. Kallimachos: Hekale (um 260) 2. Theokrit, Ειδύλλια (3. Jh.) 3. Bion v. Smyrna: Adonis (gegen 200) 4. Moschos v. Syrakus: Europe (1. Jh. v.) D. DAS LATEINISCHE EPOS DER REPUBLIKANISCHEN ZEIT I. Die Rezeption des griechischen Heldenepos (4- Homer) 1. Livius Andronicus: Odusia (gegen 200) 2. Cn. Naevius: Bellum Punicum (z.T.) (um 200) II. Die Rezeption des griechischen Sach-Epos 1. Das philosophische Epos: Lucretius, De rerum natura (vor 55 v.) (*- Empedokles) 2. Das historische Epos a. Naevius (um 200): Bellum Punicum b. Ennius (bis ca. 170): Annales 3. Das sog. Lehrgedicht Cicero: Aratea (u.a.) (1. Jh. v.) E. DAS LATEINISCHE UND GRIECHISCHE EPOS DER KAISERZEIT I. Die Rezeption des griechischen Heldenepos Vergil : Aeneis (29-19) II. Die Rezeption des griechischen Sach-Epos 1. Vergil: Geórgica (37-29) 2. Ovia: Metamorphosen (vor 8 η.) 3. Manilius: Astronomica (um 10 η.) III. Die Reproduktion des griechischen Heldenepos 1. Ptolemaios Chennos; Skopelianos; Peisandros; Soterichos 2. Valerius Flaccus: Argonautica (um 80 n.) 3. Papinius Stalius: Thebais, Achilleis (bis 90 n.) 4. Quintus Smyrnaeus: Τά μέθ' Όμηρον (Posthomerica) (3. Jh. n.) 5. Triphiodoros: 'Ιλίου "Αλωσις (um 300) 6. Claudianus: Γιγαντομαχία, De raptu Proserpinae (um 400) 7. Nonnos: Διονυσιακα (s. Jh.) 8. Ps.-Oipheus: Αργοναυτικά (um 500) 9. Kolluthos: 'Αρπαγή 'Ελένης (um 500) IV. Die Reproduktion des hellenistischen Sach-Epos 1. Grattius: Cinegetica (1. Jh. n.) 2. Dionysios Pennegetes: Περιήγησις της οικουμένης (124 n.) 3. Oppianos v. Kilikien:'Αλιευτικά (um 180) 4. Oppianos v. Apamea: Κυνηγετικά (Ίξευτικά?) (um 215) 5. Nemesianus, Cynegetica (gegen 300) 6. Terentianus Maurus: De litteris. De syllabis. De metris (um 300) 7. Avienus: Phainomena, Ora maritima (gegen 400) 8. Ps.-Orpheus: Λιθικά (4. Jh.) V. Die Aktualisierung der Geschichts-Epik 1. (Vergil: Aeneis) 2. Lucanus: Pharsalia (vor 65 n.) 3. Silius Italicus: Punica (vor 100 n.) 4. Claudianus: De bello Gothico, De bello Gildonico (um 400) 5. Corippus: Iohannis (6. Jh.) VI. Die Rezeption des hellenistischen (mythol.-) idyllischen Epos (1. Vergil: Bucolica [42-39]) 2. Appendix Vergiliana (Culex, Ciris, Moretum, Dirae, Copa) 3. Ausonius: Moseila (um 370) 4. Musaios: Τά καθ' Ήρώ και Λέανδρον (um 450) VII. Die Rezeption des religiösen/kultischen Epos 1. Proklos: Hymnen (5. Jh.) (philosophische Hymnen) 2. Das christliche Epos Proba - Eudokia - Commodianus - Iuvencus - Nonnos (Metabolé = Joh.-Evangelium) - Pnidentius (s. Tabelle 2) I
275
276 106
Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne
Tabelle 2
Direkte Funktionen Zielpunkt: Mensch (Held) primär: Unterhaltung (τέρπει ν)
linear narratives mythologisches Epos
idyll. Epos (Epy Ilion)
parodisches Epos
Epen des epischen Kyklos (um 600 v.) Epen des thebanischen Sagenkreises (Oidipodeia, Thebais, Epigonoi) Herakles-Epik Argonauten-Epik These us-Epik (arch. Periode) Panyassis: Herakleia (ca. 470) Antimachos: Thebais (um 400) Apollonios: Argonautika (ca. 260) Livius Andronicus: Odusia (gegen 200)
(Vorfonnen in den sog. homerisch αϊ Hymnen, z.B. HerrnesHymn.)
Batrachomyomachia Margit es
Ovidius: Metamorphoses
Val. Flaccus: Argonautica (um 80 n.) Statius: Thebais (bis 90) Quintus: Τά μεθ* "Ομηρον (3. Jh.) Triphiodoros: ΊλΙου άλωσις (um 300) Claudianus: Γιγαντομαχία, De raptu Proserp inae (um 400) Nonnos: Διονυσιακά (5. Jh.) Kolluthos: 'Αρπαγή Ελένης (um 500)
Matron ν. Pitane: ΆτπKÒV δείπνο ν (um 330) Ka 11 imachos: Hekale (um 260) Theokrit: Ειδύλλια (3. Jh.) Bion: Adonis (gegen 200) Moschos: Europa (1. Jh. v.)
(Vergil: Bucolica) Appendix Vergiliaoa
Ausonius: Moseila (um 370) Musai os : Td κά& "Ηρώ καΙΛέανδρον (um 450)
Ennius: Hedyphag etica (um 280)
Zielpunkt: Sache primär: Pro· blematmerung
primär: Erklärung und Belehrung
primär: nationale/ patriotische Erhebung (historisches Epos, National-Epos)
Homer:: Ilias - : Odyssee (vor 700)
(deskriptives SachEpos; oft zur Demonstration von Virtuosität: »Lefo'-gedicht) Η es iodos: Theogonia - : Erga (um 700) frühe genealogische und historische Epik (Ps.-Hesiod: Ehoien; Eumelos, Hegesinos, Aristeas) (7./6. Jh.)
Archestratos: Hedypatheia(um 350)
Choirilos: Persiká (um 400) (Griechen-Perser)
Aratos: Phainomena (um 250) Numenios: Halieutikon (um 250) Eratosthenes: astron. Lehrgedichte (gegen 220) Pankrates: Hai. (?) Boios: Omithogonia (?) Nikandros: Theriaka u.a. (um 200) Alexandres Lychnos: Phainomena ( 1. Jh.) Cicero: Aratea Manilius: Astronomica (um 10 n.) Grattius: Cyneg. Dionysios: Περιήγησις της ο'ικουμένης (124) Oppianos: 'Αλιευτικά (um 180) Oppianos: Κυνηγετικά (um 215) Nemesianus: Cyneg. (gegen 300) Terentianus Maurus: De litteris. De syllabis, De me tris (um 300) Carmen de ponderibus et mensuris (um 400) Avienus: Ora maritima (gegen 400)
Rhianos: Messeniaka u.a. (um 220) Naevius: Bell. Pun. (um 200) Ennius: Annales (bis ca. 170) Vergil: Aeneis (29-19)
Lucanus: Pharsalia (vor 65 n.) Silius Italicus: Punica (vor 100 n.)
Claudianus: De bello Gothico/De bello Gildonico (u.a.) (um 400) Corippus: Iohannis (6. Jh.)
277
Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne Indirekte Funktionen Zielp.: RELIGION/KULT primär: Glorifizierung oder/und Missionierung (Bekenntnis- und Überzeugungs-Epos; Teil: Bibel-Epos (B)) sog. Homerische Hymnen Xenophanes Parmenides Empedokles
Antimachos: Artemis (um 400)
(Kallimachos: Hymnen)
1. allgemeine Bildung - 2. moralische Erziehung - 3 . intellektuelle Schulung 4. ästhetische Erziehung - 5. Sprachkultivierung - 6. Gefuhls-/Geschmacksbildung etc. Die Vermittlung erfolgt durch dich tu ngs theoretische Reflexion in .Poetiken' (ποιητική τέχνη) (seit Aristoteles, Horaz, Περί ΰψους) ITALIEN Savonarola: In Poeticen Apologeticus (1492) Vida: Poetica (1527) Capriano: Della vera poetica (1555) Minturao, Poetica Toscana (1563) Trissino, Poetica (1563) Castelvetro: Comm. in Aristot. Poet. (1570) Giord. Bruno: Eroici Furori (1585)
Proba: Cento Vergilianus [B] (360) Eudokia: 'Ομηρόκεντρα [Β] (vor 460) Proklos: (7 philos.) Ύμνοι (5. Jh.) Commodianus: Carmen apologeticum (5. Jh.?) Iuvencus: Evangeliorum libri [B] (5. Jh.) Prudentius: Apotheosis, Hamartigenia, Psychomachia (B) (5. Jh.)
Salel: Epìtre de Dame Poésie (1545) Du Bellay: Défense et illustration de la langue française (1549) Pelletier du Mans: Art poétique (1555) J.C. Scaliger Poetice (1561)
Salviati: Difesa dell' Orlando Furioso (1585) Patrici: Della Poetica (1585/86) Lombardelli: Discorso (1586) Beni: Comparazione Tasso-Homero-Virgilio (1607)
Lucretius: De rerum natura (vor 55 v.) Vergilius: Geórgica (Ovidius: Metam.)
FRANKREICH
ENGLAND
Wilson: Art of Rhetorique (1560) Ascham: The ScholeMaster(1570) Sidney: Apology for Poetry (1595)
Vauquelín de la Fresnaye: L'Art poétique français (1605) B oileau-Despréaux: L'Art poétique (1674) Le Bossu: Traité sur le poème épique (1675)
Le Clerc: Parrhasiana (1699) 1687-1713: Querelle des Anciens et des Modernes (Perrault-FontenelleLa Bruyèred'Aubignac-La Motte-Terrasson: La Fon taine-Longep ierrede Callières-Boûeau· André Darier· Fineloo-BoivinM™* Anne Dacier, Dubos)
DEUTSCHLAND
Dryden: Apology for Heroic Poetry (1674) Sheffield: Essay on Poetry (1682) Temple: Essay upon the ancient and modem learning (1692)
Opitz: Aristarchus oder über die Verachtung der deutschen Sprache (1617) - : Buch von der deutschen Poeterei (1624)
278
Hauptfunkeionen des antiken Epos in Antike und Moderne
108
Direkte Funktionen Zielpunkt: MENSCH (Held) primär: Unterhaltung (τέρπει v) linear narratives mythologisches Epos
idyll. Epos (Epy lüon)
Boccaccio: Filostrato (Troilus u. Griseida) - : Teseide (um 1340)
Hutten: Nemo (1512) (nach Homers Οδτις)
Basini: Meleagris (1445)
Marino: Adone (1623) Chamberlayne: Pharonnida (1659)
Boileau: Le Lutrin (1678)
Pope: The Rape of the Lock (1712/14)
Glover: Leonidas (1737) Wilkie: The Epigoniad (1753) Goethe: Achilleis (1799)
I
Goethe: Hermann und Dorothea (1798)
Zielpunkt: SACHE primär: Problematisierung
primär: Erklärung und Belehrung
primär nahonale/pa· triotische Erhebung
(deskriptives Sach-Epos; oft zur Demonstration von Virtuosität: .Lehr 4 · gedieht
(historisches Epos, National-Epos)
(auf Aufzählung hier verzichtet)
WaltharUied (9. Jh.) Petrarca: Africa (1343) Basini: Hesperis (1460) Boiardo: Orlando Innamorato (1495) Ariosto: Orlando Furioso (1538) Trissino: Italia liberata da' Gotti (1547) Ronsard: Franciade (1570/71) Camoes: Lusiaden (1572) Tasso: Gerusalemme liberata (1575) Warner: Albion's England (1586) Daniel: History of the Civil Wars (1595) Dayton: The Baron's War (1596) Davenant: Gondibert (1651) Chapelain: La Puce lie (1656) Desmarets: Clovis ou la France chrétienne (1657) Scudéry: Alane ou Rome Vaincue (1664) Dryden: Annus mirabilis (1667) Blackmore: Prince Arthur (1695) Addison: The Campaign (1704) Postel: Der große Wittekind (1724) Voltaire: Henriade (1728) - : La Pucelle (1762) Macpherson: The Works of Ossian (1765)
279
Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne
109
Indirekte Funktionen Zielp.: RELIGION/KULT primär: Glorifizierung oder/und Missionierung
1. allgemeine Bildung - 2. moralische Erziehung - 3. intellektuelle Schulung - 4. ästhetische Erziehung - 5. Sprachkultivierung - 6. Gefühls-ZGeschmacksbildung etc. Die Vermittlung erfolgt durch dichtungstbeoretiscbe Reflexion in, Poetiken4 (ποιητική τέχνη) (seit Aristoteles, Horaz, π. ΰψουζ)
(Bekenntnis- und Ubeizeugungs-Epos; Teil: Bibel-Epos [B])
Dante: (Divina) Commedia (1307-21) Vida: Christias (Β] (1535) Saluste: Judith [B] 1560 - : La Semaine (1578) Spenser: Faerie Queen (1590-96) Cowley: Davideis [BJ (1656) Milton: Paradise Lost [Β] (1667/74) - : Paradise Regained [Β] (1671) Klopstock: Messias (Β] (1751) Bodmer: Noachide [Β] (1752) Wieland: Die Prüfung Abrahams [Β] (1753)
Prankreich Muratori: Della perfetta poesia italiana (1706) Cira vina: Della ragione poetica (1708) - : De disciplina poetarum (1712) Vico: Principi di Scienza nuova (1715) Ricci: Dissertationes Homericae (1740/41) Conti: De' Fantasmi poetici (1756) Cesarotti (trad. Ossian) (1760-72) Andres: Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura (1785-1822)
Batteux: Cours de Belles Lettres ( 1750)
England Swift: Battle of Books (Satire) (1704) Shaftesbury: Soliloquy or Advice to an Author (1710) Pope: Essay on Criticism (1711) Addison: Spectator u.a. (1714) Spence: Essay on Mr. Pope's Odyssey (1727)
Hume: Of the Standard of Taste (1742) Burke: Philos. Enquiry into the Origin of the Sublime and Beautiful (1757)
Home: Elements of Criticism (1761-65) Young: On original Composition (1759) Wood: Essay on the Original Genius of Homer (1769)
Deutschland
Gottsched: Critische Dichtkunst (1730) Gesner: Chrestomathia Graeca(1731) Bodmer Von dem Wunderbaren in der Poesie (1732) Breitinger: Critische Dichtkunst (1740) Winckelmann: Kunstgeschichte (1764) Lessing: Laokoon ( 1766)
Herder: Kritische Wälder/Briefe zur Beförderung der Humanität (1794) Klopstock - Goethe Schiller - W. v. Humboldt - Gebrüder Schlegel, u.a.
2. Zur frühgriechischen Lyrik
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 12, 1986, 35-56
Zu den pragmatischen' Tendenzen der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interpretation* Seit Hermann Frankels .Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums' (1951) und Max Treus kommentierten Lyriker-Ausgaben (Alkaios 1952, Sappho 1954, Archilochos 1959) war die Interpretation der frühgriechischen Lyrik in Deutschland etwa drei Jahrzehnte lang in relativ ruhigen Bahnen verlaufen. Von dem Drängen, das seit den sechziger Jahren besonders in Italien auf eine grundsätzliche Erneuerung des Interpretationsansatzes abzielte, wurde die Praxis der Lyrik-Interpretation an Universität und Schule im deutschsprachigen Raum kaum erfaßt. Diese Lage hat sich seit kurzem fühlbar geändert: Ausgehend von den neohistoristischen Tendenzen der zur Zeit praktizierten .Literaturwissenschaft im technischen Zeitalter' ist über Fragen der Lyrik-Interpretation auch in der Gräzistik eine Grundsatzdebatte in Gang gekommen. Sie spielt sich vorerst noch in wenigen Fachzeitschriften ab und wird von wenigen Spezialisten bestritten. Schon bald dürfte sie jedoch praktische Konsequenzen für die Darstellung der frühgriechischen Lyrik auch in Literaturgeschichten, Handbüchern und Lehrerzeitschriften erlangen. Kernpunkt dieser Debatte ist die Frage, wie stark bei der Interpretation eines Sappho- oder Alkaios-Liedes, eines ArchilochosIambos oder einer Pindar-Ode die pragmatischen Komponenten des jeweiligen Einzelkunstwerks zu Buche schlagen sollen. Es spricht einiges dafür, daß die Interpretationserheblichkeit dieser pragmatischen Komponenten (wie Ort, Zeit, Autor, Publikum, Umstände usw. der Erst-Darbietung eines Poems) gegenwärtig überschätzt wird. Bevor die Ergebnisse dieser Überschätzung in Form von Lehrplan-Einheiten und Lehrer-Handreichungen autoritativ die Schule erreichen und das Bild einer künftigen Gebildetenschicht von Sappho und Alkaios (und womöglich von Lyrik überhaupt) gravierend verändern, sollte die Debatte aus * Dem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, der 1984 bei der Marktoberdorfer Ferientagung der Gymnasiallehrer für Alte Sprachen gehalten wurde (erschienen in .Dialog Schule-Wissenschaft. Klassische Sprachen und Literaturen', Band XIX, München 1985; ich danke dem Herausgeber, Herrn Min.-Rat Neukam, für die Genehmigung zum Nachdruck).
284
Zu den ,pragmatischen' Tendenzen
den Expertenzirkeln ins Plenum verlagert werden - hin zu den Studierenden, Gymnasiallehrern und Schülern; interessant ist sie genug. Der folgende Überblick - im Bericht so objektiv wie möglich, in der Bewertung die eigene Position nicht verleugnend - möchte zu dieser wünschbaren Verbreiterung der Debatte beitragen. I 36
1. Die bisherige Forschungssituation Der erste Schritt zum Verständnis der gegenwärtigen Auseinandersetzung muß darin bestehen, sich ein möglichst klares Bild vom Verlauf der Forschungsgeschichte zu schaffen. Das ist freilich schwer genug. Eine Geschichte der gräzistischen Lyrikforschung existiert nicht. Vorreden von Lyriker-Ausgaben, Einleitungen zu Lyriker-Monographien und Lyrik-Gesamtdarstellungen sowie die einschlägigen Abschnitte der Literaturgeschichten können die fehlende Zwischenbilanz nicht ersetzen. Bibliographien 1 und sterile Katalogberichte 2 haben nur Materialwert und vermögen die Strukturen der Forschungsentwicklung nicht herauszuschälen. Einen regelmäßig fortgeführten Lyrik-Forschungsbericht vergleichbar etwa den Homer- und Dramen-Forschungsberichten im .Gymnasium', im .Anzeiger für die Altertumswissenschaft', in .Classical World' usw. haben wir nicht. Ein Wege-der-Forschung-Band .Frühgriechische Lyrik' ist nicht in Sicht. Diese Lage ist ein schweres Forschungshemmnis. Denn auf diese Weise ist jeder, der heute zum Kreis der Spezialisten neu hinzutritt, zur individuellen Zusammenschau von Forschungsaktivitäten gezwungen, deren Verästelungsdichte in den rund 200 Jahren seit dem Beginn der ersten methodisch fundierten Sammlungs- und Deutungsversuche einen Grad erreicht hat, wie er auf kaum einem zweiten Spezialgebiet der Gräzistik anzutreffen ist. Das bedeutet nicht nur einen ständig unökonomischer werdenden Zeitaufwand, sondern bei der (menschlich verständlichen) unterschiedlichen Gründlichkeit, mit der der Einzelne sich sein Bild erarbeitet, auch eine ständig wachsende Reduktion von Tempo und Effektivität des Forschungsfortschritts: das Gebiet wird stärker als andere beherrscht von Repetitivität und Pseudo-Originalität der Fragestellungen
1 Für die Jahre 1936-1952: G. M. Kirkwood, .Classical World' 47, 1953, 33^42, 49-54. Für die Jahre 1952-1967: D. E. Gerber, CW 61,1967/68, 265-279. 317-330. 378-385. - Für die Jahre 1967-1975: D. E. Gerber, CW 70, 1976, 66-157. [Für die Jahre 1975-1985: D. E. Gerber, CW 81, 1987, 73-144 (Parti); 81, 1988, 417-479 (Partii)] 2 Zum Beispiel H. Saake's .Entwicklung der Sappho-Forschung' in seinen ,Sappho-Studien', München usw. 1972,13-36.
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
285
und Problemlösungen, vom Ausweichen auf Kleinstprobleme und von allgemeiner Orientierungslosigkeit. Diese Lage ist freilich im Falle der Lyrikforschung ein Reflex der Sache selbst; sie - wie das in neueren Publikationen häufig anklingt - einer allgemeinen Reflexionsunfähigkeit oder -unwilligkeit früherer Gelehrtengenerationen zuzuschreiben wäre verfehlt. Die Lyrikforschung steht im Grunde genommen seit zweihundert Jahren unter dem Zwang der elementaren Grundlagensicherung. Ihre Rastlosigkeit und ihre Scheu vor theoretischer Selbstreflexion sind nur die Antwort auf das Material, das ihr Objekt ist. Das beherrschende Merkmal dieses Materials ist bekanntlich seine Lückenhaftigkeit, und zwar Lückenhaftigkeit auf allen Ebenen der Texte selbst wie ihrer Umgebung: (1) die Texte sind nur in Trümmerform erhalten (wobei die Klein- und Kleinstfragmente - bestehend aus Zeilenanfängen, -mitten und/oder -enden, Silben, Silbenteilen, Einzelbuchstaben oder Buchstabenresten - prozentual weit überwiegen), I (2) die Überlieferung dieser Trümmer folgt keinem ra- 37 tionalen Prinzip (etwa derart, daß wir immerhin ganze Bücher vor uns hätten, in denen nur Seiten oder Seiten-Teile fehlten), (3) die ursprünglichen Werkkonstituenten Gesang und (häufig) Tanz sind verloren, (4) synchrone historische Quellen sind nicht vorhanden, so daß die Strukturen, in die Entstehung und Darbietung der Werke eingebettet waren, für uns im dunkeln bleiben (und, wenn überhaupt, nur in einem hochkomplizierten und irrtumsträchtigen Zirkelverfahren aus den Fragmenten selbst .extrapoliert' werden können). Dieser Materialzustand hat zwei Folgen, die sich wechselseitig bedingen: Angesichts der Faszination, die von der Unvollständigkeit als solcher ausgeht, ist die Lust zum Wagnis der Deutung gerade bei diesen Textfragmenten, in denen jedes Wort auf Qualität verweist, besonders groß - und angesichts der Unmöglichkeit, die Ergebnisse solcher Deutungsabenteuer (sofern sie nur grundsätzlich mit logischen Mitteln erzielt worden sind) definitiv zu bestätigen oder zu widerlegen, wird die Zahl der Hypothesen Legion. Das Ergebnis ist ein Maß an Tolerierungszwang und daraus folgender .legitimer Subjektivität', wie es in anderen Sparten unserer Disziplin (deren Arbeitsgrundlage Ganztexte sind), unmöglich wäre. Am Ende steht eine allgemeine Unsicherheit. Unter diesen Voraussetzungen mußte die interpretatorische Bewältigung der frühgriechischen Lyrik bis zum heutigen Tage hinter dem, was etwa die Eposoder die Drameninterpretation vorzuweisen haben, weit zurückbleiben. Es gilt, sich die Unterschiede plastisch klarzumachen: während die Interpretation des frühgriechischen Epos von Anfang an über einem Textcorpus von ca. 30000 vollständig erhaltenen Hexametern operieren konnte, die in vier großen Text-
286
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
blocken vorlagen (Ilias, Odyssee, Hesiod, hom. Hymnen), während sich die Dramen-Interpretationen auf 44 ganz erhaltene Stücke stützen konnte, bestand die erste Aufgabe der Lyrik-Interpretation darin, die zu interpretierenden Texte zunächst einmal zu ermitteln und aus den über die gesamte antike Literatur verstreuten Quellen sinnvoll herauszulösen, sie dann unter Heranziehung der ebenfalls erst zu ermittelnden antiken Zeugnisse über Leben und Werk der einzelnen Dichterpersönlichkeiten sinnvoll zusammenzuordnen, und schließlich, sie nach einer mühevollen Rekonstruktion des antiken Systems lyrischer Rhythmusgebung (,Metrik') sowie nach einer nicht minder mühevollen Wiedergewinnung ihrer ursprünglichen Sprachform (.Dialektrekonstruktion') textkritisch abgesichert und von den Entstellungen einer oft achtlosen Tradition gereinigt als sauber konserviertes Ruinenfeld eines verschütteten und weitgehend bereits abgeschriebenen literarischen Bezirks der Betrachtung und sinngebenden Erläuterung zu präsentieren. Diese Aufgabe - in Wahrheit die Rückeroberung einer bereits versunkenen Welt - nahm seit etwa 1800 die besten Köpfe ihrer Zeit nicht weniger als fünf Jahrzehnte lang in Anspruch. Als nach Hermanns, Welckers, Schneide wins, Ahrens' und vieler anderer Vorarbeiten im Jahre 1843 Theodor Bergks .Poetae lyrici Graeci' erschienen, lag eine Zeit entsagungsvollster Hingabe ans Detail hinter der Lyrikforschung dieser Jahre, die hoffentlich auch künftigen Philologengenerationen noch als Ruhmesblatt unserer Disziplin erscheinen wird. I 38
Mit Bergks Sammlung war der Weg zur Interpretation im höheren Sinne (zur .Höheren Kritik') erstmalig überhaupt eröffnet. Aber noch bevor diese über erste Versuche der Zusammenschau in Einzelabhandlungen, Literaturgeschichten usw. hinausgelangen konnte, setzte eine neue Entwicklung ein, die den angelaufenen Interpretationsprozeß durchkreuzte und bis heute nachhaltig durchkreuzt: Mit dem 1855 entdeckten großen Alkman-Papyrus3 kam die ,Fundbewegung' ins Rollen. Es setzten jene Text-Neufunde auf Papyrus (z.T. auch Pergament, Tonscherben und anderen Schriftträgern) ein, die Page in der Praefatio seiner ,Poetae Melici Graeci' (1962) zu Recht inopinata ac mirifica poesis melicae incrementa nannte4. Ihre rasche Aufeinanderfolge ließ alle Versuche zu Gesamtbilanzen immer wieder zu Provisorien werden. Ansätze zu theoretischer Durchdringung des Materials wurden erst recht erstickt. Die praktischen Erfordernisse der Aufarbeitung des jeweils Neugefundenen nahmen viel Zeit und Kraft in Anspruch, und die durch jeden weiteren Neufund stärker konsolidierte Erfahrung, 3 4
Siehe dazu D. L. Page, Alemán, The Partheneion, Oxford 1951. Page, PMG ΥΠ.
der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interpretation
287
daß allgemeine Urteile durch plötzlichen Materialzuwachs hinfällig oder doch modifikationsbedürftig wurden, riet zu vorsichtiger Zurückhaltung. Es liegt auf der Hand (und bedarf unseres Verständnisses), daß ein solcher Zustand der permanenten Offenheit dem Entwerfen umfassender Analysen, Definitionen und Theorien wenig günstig ist. Die heute gängigen Lyriker-Ausgaben - sei es in Taschenbuchform, sei es als Schul-Texte - erwecken in der Regel den Eindruck einer trotz aller Bruchstückhaftigkeit recht ansehnlichen Fülle; für eine literaturwissenschaftliche Analyse scheinen sie ein zwar schwer handhabbares, quantitativ aber ausreichendes Material zu bieten. Dies ist jedoch ein erst in neuerer Zeit, seit etwa 30 Jahren, eingetretener Zustand. Die Zeit davor verfügte über wesentlich geringere Textmengen. Das ist zwar allgemein bekannt, wird aber selten mit präzisen Vorstellungen verbunden und führt daher nicht zu den gebotenen Schlußfolgerungen. Um Ausmaß und Tempo des Textzuwachses (und der damit einhergehenden ,Gehetztheit' und Unabgeschlossenheit der Lyrikforschung) allein in den rund 50 Jahren zwischen 1898 (Erscheinungsjahr des 1. Bandes der ,Oxyrhynchus Papyri') und 1952 möglichst augenfällig werden zu lassen, setze ich eine Tabelle von Fundpublikationen her (zur besseren Übersichtlichkeit sind nur Sappho und Alkaios, und auch bei ihnen nur die größeren Funde, berücksichtigt): I 1898 1902 1914
5 94 66 16 44
1922 63 1925 44 1937 2 1939 98 b 1941 98a 1952
1
Sappho (Κύπρι καν] Νηρηίδες...) (τεθνάκην δ' άδόλως θέλω) (das Atthis-Arignota-Lied) (0]i μέν ίππήων στρότον ... ) (das Hektor-AndromacheLied, erster Teil)
(Όνοιρε μελαινα[) (zweiter Teil) (δεΰρύ μ' έκ Κρήτας... ) (das Kleïs-Lied, 2. Teil) (das Kleïs-Lied, 1. Teil)
(das Aphrodite-Lied, Verse 1-21) [war bereits durch literarische Zitate bekannt] (Zählung und Text nach Voigt)
Alkaios 6
(Τόδ' αύτε κΰμα τώ προτέρω νέμω)
34 38
(Δεΰτέ μοι νά]σον Πέλοπος λίποντες) (das Melanippos-Lied)
42 44 70 73
(das Helena-Troia-Lied) (Thetis vor Zeus [nach Ilias 1,495 ff.]) (das Anti-Pittakos-Lied) (die Schiffs-Allegorie)
129 130 b 283
(das Große Gebet) (das Große Verbannungslied) (das Helena-Paris-Lied)
Die Lyrikforschung bildet nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Arbeitsgebiet der Gräzistik; die Zahl der Lyrikspezialisten im allgemeinen, der Sappho-, Alkaios- usw. -Spezialisten im besonderen ist beschränkt; die notwen-
39
288
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
dige Folge ist, daß allein die Herstellung verwertbarer Texte aus dem Rohmaterial der im Papyrus-Original meist schwer zu entziffernden Schriftzeichenfolgen in einem dialektischen Korrekturprozeß (Erstedition, Kritik der Erstedition, Lücken-Ergänzung, Hypothesenbildung über den möglichen Gesamtsinn des Fragments, über den ursprünglichen Gesamtzusammenhang usw.) in der Regel Jahre dauert, in der Mehrzahl der Fälle sogar nach wie vor als unabgeschlossen gelten muß. Wir arbeiten also im Grunde mit Hypothesen. Das führt zum Kern des Problems zurück: Die neugefundene Textmenge ist einerseits zwar groß genug, die Arbeitskapazität der kompetenten Spezialisten auszulasten, andererseits aber nicht entfernt ausreichend, um die grundsätzliche Unsicherheit, von der die Rede war, etwa aufzuheben. Denn bei allem äußerlichen Anschwellen der Lyriker-Editionen von Bergk (1843) über Diehl (1925) zu Page (PLF 1955, PMG 1962) bleibt es ja eine Tatsache, daß wir ζ. B. von Sappho nach wie vor nur ein einziges vollständig erhaltenes Lied (Nr. 1, an Aphrodite) haben und daß vollständige Stücke auch bei den anderen Lyrikern zwischen Kallinos und Pindar (von Theognis abgesehen) seltene Ausnahmen sind. Daran haben auch die quantitativ respektablen Zugewinne der Nachkriegszeit nichts geändert: zwar konnte Page in seinem ,Supplementum Lyricis Grae40 cis' von 1974 bedeutsame Überreste etwa aus I Stesichoros (aus der ,Geryoneïs', der ,Iliou Persis', dem ,Equus Ligneus', der .Eriphyle') und aus Ibykos (zahlreiche Mythenlieder: Troja, Theben, Sparta usw.) sowie aus der antiken Sapphound Alkaios-Kommentierung (29 Seiten im .Supplementum'!) vorlegen (und seitdem sind allein aus den Oxyrhynchus-Papyri 1977, 1980 und 1983 weitere Bruchstücke aus Alkman, Tyrtaios und anonymen Melikern hinzugekommen; dazu tritt als bedeutender Fund die 1974 publizierte Kölner Epode des Archilochos)5, aber durch alle diese Funde hat sich die Trümmerlandschaft nur verdichtet, nicht zum Sinngebilde strukturiert. Einerseits also ein ständiger Zustrom von Quantität (der Kräfte band), andererseits kein Zugewinn an Fundqualität: eine Lage, die eine prinzipielle Wartehaltung fördern mußte (genaugenommen blieben alle Lyrikerfragmente , Wartetexte'). Konkret hat sich diese Wartehaltung in der Lyrikforschung seit dem Beginn der Fundbewegung als Theorieverzicht geäußert - .Theorie' hier verstanden als ein aus den empirischen Befunden autonom entwickeltes System
5 Erstedition: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 14, 1974, 97 ff. (Merkelbach und West); jetzt Fr. 196 a im ,Delectus' West; Echtheitsdebatte in der Zeitschrift .Poetica' 6, 1974 (nach der Verbindung der beiden Hesychzitate [im Testimonienapparat bei West] kann an der Echtheit kaum mehr ein Zweifel bestehen).
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
289
von Aussagen über die Seinsweise der frühgriechischen Lyrik; von Aussagen vor allem über 1. innertextliche Konstituenten: Stoff, Motiv, Formensprache, Aufbau, Stil, Haltung usw. (.Werkästhetik'), 2. außertextliche Konstituenten: Autor, Entstehungsvoraussetzungen und -bedingungen, Darbietungsweise, Publikumsbezug, Wirkung usw. (,Produktionsund Rezeptionsästhetik, Wirkungsästhetik'). Selbstverständlich hat es Ansätze zur Behandlung von einzelnen dieser Konstituenten - überwiegend autorbezogen, zuweilen auch autor-übergreifend bis zur Erfassung einer ganzen Lyrikform (Elegie, Iambos, Melos) oder Formvariante (Monodie, Chorlied), selten gattungsdeckend - immer schon gegeben, zum System einer Lyriktheorie jedoch sind sie nie zusammengearbeitet worden (der Platonisch-Aristotelische „Ausschluß der kleinen, zumal der lyrischen Gattungen" 6 mag dabei die »theoretische Hemmschwelle' unbewußt erhöht haben). Der Theorieverzicht der gräzistischen Lyrikforschung stellt sich in drei Hauptformen dar: 1. als unbewußter Theorieverzicht, d.h. als Selbstverständlichkeit des Anspruchs, frühgriechische Lyrik mit dem herkömmlichen philologischen Instrumentarium (vertiefte Griechischkenntnis, Metrik-Kenntnis, Kenntnis der Überlieferungslage, literarhistorische Kenntnisse) angemessen verstehen und interpretieren zu können. Die Interpretation erfolgt hier aus dem jeweils gängigen zeitgenössischen Lyrikverständnis heraus, das durch die Rezeption insbesondere der Muttersprachenlyrik und deren institutionell bedingte Interpretation in Schule und Öffentlichkeit I bestimmt ist. Gemildert nur durch ein gewisses Maß 41 an .historischer Interpretation' (nach A. Boeckh) 7 , findet hierbei eine dauernde Spontan-Übertragung moderner Kategorien auf den antiken Gegenstand statt. Diese Art des Zugangs herrschte vor allem im 19. Jh. vor, reicht aber durchaus bis in die Gegenwart hinein (sie liegt z.B. weitgehend in M. L. Wests LyrikDarstellung von 1981 im .Neuen Handbuch der Literaturwissenschaft' vor) 8 ;
6
M. Fuhrmann, Einführung in die antike Dichtungstheorie, Dannstadt 1973,125. G. Jäger, Einführung in die Klassische Philologie, München 2 1980, 104 f.; vgl. A. Hentschke/U. Muhlack, Einführung in die Geschichte der Klassischen Philologie, Darmstadt 1972, 8 8 96. 8 M. L. West, Melos, Iambos, Elegie und Epigramm, in: Neues Handbuch der Lit.-Wiss., hrsg. ν. Κ. v. See, Bd. 2: Griechische Literatur, hrsg. v. E. Vogt u. a., Wiesbaden 1981, 73-142 (z. B. zu Sappho: „Wir haben den Eindruck, daß die Gegenwart dieser Frau eine Art beseelenden Glanzes auf ihre Umgebung wirft. Das ist echte Dichtung": 98). 7
290
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
2. als bewußter Verzicht auf Theorie schlechthin, d. h. als Ablehnung von Literarästhetik bzw. Poetologie überhaupt. Zur Grundhaltung erhoben ist diese Position ζ. B. von Wilamowitz in seiner einflußreichen .Griechischen Literatur des Altertums' ( 3 1912): „So bleibe auch ungefragt, wie sich die modernen Theorien von Lyrik mit den Tatsachen der hellenischen Praxis vertragen. Wenn diese nur verstanden wird, kann sich jeder die Rechnung selbst aufmachen." 9 Die verständnisfördernde Funktion von Theorie (die Wilamowitz z.B. im Falle der Aristotelischen Poetik natürlich anerkennt) wird hier verkannt. Die Folgen für die Interpretation sind grundsätzlich die gleichen wie bei 1. Auch diese Haltung ist nach wie vor verbreitet und äußert sich gerade in der Schulpraxis bekanntlich gern als pauschale Ablehnung des .theoretischen Krams' (woraus sich ganze Generationenkonflikte in den Lehrerkollegien zu entwickeln pflegen); 3. als bewußter Verzicht auf eine eigene Theorie und (ersatzweise) Übernahme fremder Lyrik- (Dichtungs-, Literatur-) Theorien. Das Bedürfnis nach .höheren Gesichtspunkten', das als Reaktion auf das Scheitern des Totalitätsanspruches der positivistisch-historischen .Altertumswissenschaft' in der Zeit zwischen Jahrhundertwende und erstem Weltkrieg stark geworden war (Werner Jaegers Basier Antrittsvorlesung von 1914!10), führte seit den zwanziger Jahren zur Abkehr von der Historie und zur Hinwendung zu den Geisteswissenschaften im engeren Sinne, besonders zur Philosophie und Soziologie, zur Germanistik und zur entstehenden Literaturtheorie in ihren verschiedenen ideologischen Ausprägungen; ihren Höhepunkt erreichte diese Bewegung, deren Folge die Abspaltung einer neukonzipierten ,Klassischen Philologie' als Literaturkunde von 42 der umfassenden Altertumswissenlschaft war, in der Geburt des dritten Humanismus auf der Naumburger Fachtagung 1930. Die geschichtliche Komponente der Disziplin, hinter die nicht mehr zurückgegangen werden konnte, wurde nun .aufgehoben' in der Konzentration auf die Ideen- und Gmreigeschichte 1 1 ; in den Arbeiten Werner Jaegers (besonders in der .Paideia'), Rudolf Pfeiffers, Bruno Snells, Wolfgang Schadewaldts und - als gewisser Höhepunkt - Her9 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die griechische Literatur des Altertums, in: Die Kultur der Gegenwart (I 8). Ihre Entwicklung und ihre Ziele, hrsg. v. P. Hinneberg, Leipzig - Berlin (1906) 3 1912, 34 f. W. Jaeger, Philologie und Historie, in: Humanistische Reden und Vorträge, Berlin 2 1960, 1-16. Dazu u. a.: K. Reinhardt, Die Klassische Philologie und das Klassische, in: Von Werken und Formen, Godesberg 1948, 440 f.; Hentschke/Muhlack (s. oben Anm. 7) 128 f.; Verf., Perspektiven der Gräzistik, Freiburg - Würzburg 1984,8 ff. 11 Hentschke/Muhlack 130 f. 132-135.
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
291
mann Frankels nahm die geistesgeschichtliche Frageweise eine zentrale Stellung ein (die konkreten Übernahmewege und Verbindungslinien zu den geisteswissenschaftlichen Nachbardisziplinen sind im Detail noch kaum erhellt). Für die Lyrik-Interpretation bedeutete dieser generelle Wandel des Selbstverständnisses der Disziplin (1) thematisch: die bis heute im Vordergrund gebliebene Frage, welche Idee zu welchem Zeitpunkt von welchem Lyriker aus welchem innerliterarischen Vorbild bzw. Keim mit welcher Nachwirkung neu in die Welt gebracht worden sei (Stichworte sind die .Entdeckung' des Geistes, das .Erwachen' der Persönlichkeit, usw.), (2) methodisch: die Anlehnung an die Literaturbetrachtungsweisen der Nachbarphilologien, insbesondere der Germanistik, und der philosophischen Hermeneutik; die Folge war hier eine (selten präzis reflektierte) Übernahme der verschiedensten theoretischen Ansätze (Autonomie- und Genie-Ästhetik, New Criticism; aber auch marxistische Theorie-Ansätze, Kritische Theorie [z.B. Adorno, Habermas], hermeneutische Theorie [Gadamer], neuerdings Rezeptionsästhetik und -geschichte)12. Von diesen drei Formen des Theorieverzichts war und ist die dritte zweifellos die fruchtbarste, indem sie theoretische Aspekte in die gräzistische Lyrik-Interpretation überhaupt hineinbringt und (günstigenfalls) durch die Evidenz entsprechender interpretatorischer Erfolge die Nützlichkeit von Theorie an sich erweist; doch kann auch dadurch die eigentliche Forderung natürlich nicht erfüllt werden: Die Gesetze eines Gegenstandsbereichs sind präzise nur durch die Analyse seiner selbst zu ermitteln, nicht durch analogische Applikation von AnalyseVerfahren, die an ähnlichen Bereichen entwickelt wurden. Es ergibt sich: Die außergewöhnliche Lückenhaftigkeit ihres Materials hat die gräzistische Lyrikforschung - ohnehin Teil einer wenig theoriefreudigen Disziplin - an die Entwicklung einer eigenen Lyrik-Theorie noch kaum denken bzw. sie darauf verzichten lassen. In Wartehaltung verharrend hat sie statt dessen hier und da Fremdtheorien übernommen und mit deren Hilfe bestimmte Aspekte der frühgriechischen Lyrik - vor allem den (diachronischen) Aspekt ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung - zum Thema gemacht. Wie frühgriechische Lyrik konstituiert und als System strukturiert ist, wie sie im Einzelfall entsteht, wie sie .funktioniert' hat, wodurch und wie sie wirken wollte und gewirkt hat - , diese (synchronische) Analyse hat die Lyrikforschung bisher allenfalls ansatzweise in den Blick genommen; eine Poetik der frühgriechischen Lyrik (ebenso übrigens wie des Epos) steht noch aus. I 12
Vgl. bei Jäger (oben Anm. 7) das Kapitel .Hermeneutik als Theorie der Interpretation'
292 43
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
2. Die neuen Tendenzen Mit den großen Lyriker-Ausgaben von Page (PLF 1955, PMG 1962) wurden die Textfragmente in nie zuvor verfügbarer Fülle, Vollständigkeit und Aufbereitung präsentiert. Etwa gleichzeitig wurde umfassend der erreichte Stand der Interpretation dokumentiert: 1951 erschien in New York Hermann Fränkels .Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums' (der deutschen Fachwelt 1955 von H. Gundert in einer ausführlichen Gnomon-Besprechung vorgestellt), 1955 in Oxford D.L. Pages großer Sappho- und Alkaios-Kommentar 13 . Wenn irgendwann, so war jetzt der Zeitpunkt für einen Neuansatz der Lyrikforschung gekommen. Um so erstaunlicher mutet es aus heutiger Sicht an, daß das Erscheinen dieser Werke weithin offenbar eher als eine Art krönenden Abschlusses empfunden wurde. Als der Neuansatz dann wirklich kam, ging er nicht von Deutschland oder England, sondern von Italien aus. Dort war in den sechziger Jahren unter dem Patronat des .Consiglio Nazionale delle Ricerche' der ,Gruppo di Ricerca per la Lirica Greca e la Metrica Greca e Latina' an der Universität Urbino begründet worden. Unter der Leitung von Bruno Gentiii begann diese Forschergruppe eine rührige und produktive Tätigkeit. Das Schwergewicht lag auf der Editions- und Kommentierungsarbeit. In rascher Folge erschienen in der Reihe ,Lyricorum Graecorum quae exstant (Collana di Testi Critici, diretta da Bruno Gentili)', die 1958 mit Gentiiis Anacreon eröffnet worden war, Tarditis Archilochus (1968), Pratos Tyrtaeus (1968) und Martinas Solon (1969); inzwischen sind 1980 noch das 2. Theognis-Buch von Vetta und 1984 der Alemán von Caíame gefolgt; Mimnermos, Hipponax, Semonides, Sotades und Pindar sind in Vorbereitung. Begleitet wurde diese Reihe von zahlreichen .flankierenden' Erklärungsschriften in der Reihe .Filologia e Critica' (diretta da Bruno Gentili) sowie von Interpretationsaufsätzen in der neubegründeten Zeitschrift .Quaderni Urbinati di cultura classica' (Direttore: Bruno Gentili). Darüber hinaus wurde die Erneuerung von Diehls .Anthologia Lyrica Graeca' in Angriff genommen (die Elegiker, herausgegeben von Gentiii und Prato, sind inzwischen bereits erschienen). Ziel aller dieser Arbeiten war und ist die Überwindung des Zustande der Theorielosigkeit zunächst im Bereich der Interpretationsgnmrf/age« : Ausgangspunkt der Interpretation soll die Anerkennung und Zugrundelegung des »pragmatischen' Charakters der frühgriechischen Lyrik sein, d.h. ihrer (schon vom
13
D. Page, Sappho and Alcaeus. An Introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry, Oxford 1955 (zuletzt 1983).
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
293
Historismus erkannten) Eigenart, überwiegend anlaßgebundener, zweckbestimmter und singulärer (also ursprünglich nicht auf Wiederholung im Sinne von ,Kunstkonsum' zielender) Dialog zu sein. Dieses Konzept ist natürlich als Gegenposition zu den überwiegend autonomieästhetisch orientierten Interpretationsweisen der unmittelbar vorangegangenen Epoche entstanden (in Italien vorzüglich durch Benedetto Croce repräsentiert). Die Grundhaltung ist dementsprechend anti-idealistisch (woraus u. a. auch Sympathien und Bindungen zur marxistischen Literaturtheorie resultieren). - Als exemplarische I Realisation des 44 Programms kann Pratos Tyrtaeus (1968)14 gelten: Grundlage der Textdeutung muß die Einbettung der Appelldichtung des Tyrtaios in die historische Situation seiner Zeit und seiner Kultur sein („lo studio della civiltà in cui visse e operò uno scrittore del passato": VII). Die ,Produktionsbedingungen' des Dichters dürfen nicht ,im deformierenden Licht anachronistischer Geschichtstranspositionen' (Tyrtaios ein anderer Theodor Kömer) gesehen und ,nach dem Maßstab rigider ästhetischer Formeln' (dies gegen Croce) beurteilt werden, sondern sie sind zu sehen „nel momento politico, economico, sociale nel quale l'artista operò e dal quale ricevette gli impulsi più immediati per la sua poesia" (20*). Innerliterarische Einflüsse und Impulse (im Sinne der Geistesgeschichte), insbesondere der Einfluß des Epos und speziell Homers, sind bei der Interpretation selbstverständlich zu berücksichtigen, aber nicht im Sinne eines freischwebenden Dialogs der Geister, sondern als natürlicher Bestandteil der durch einen „vasto patrimonio linguistico" mitgeprägten konkreten Lebenssituation eines griechischen λόγιος άνήρ des 7. Jh. (25* f. 21*. 48*). An diesem Konzept ist zunächst (methodologisch) wichtig, daß mit ihm die Lyrik-Interpretation überhaupt unter eine Leitidee gestellt wurde. Als Folge des oben dargestellten Theorieverzichts hatte sich ja eine Interpretationshaltung ergeben, die noch 1972 in einer .Einführung in die Geschichte der Klassischen Philologie' so beschrieben werden konnte: „So werden beute ζ. B. an ein Gedicht vielerlei Aspekte und Methoden herangetragen, ohne daß auf ihre Beziehung untereinander, noch auf den Zweck ihres Gebrauchs reflektiert wird [...] Die Verselbständigung der Spezialgebiete führt zur Orientierungslosigkeit derer, die in ihnen arbeiten." 15
Aus dieser Orientierungslosigkeit wies die Urbiner Gruppe einen Weg. Es schien überdies - das war und ist der praktische Gewinn - ein Weg zumindest in die richtige Richtung zu sein. Er ließ den ästhetischen Bereich, dem sich die In-
15
Siehe unten das .Verzeichnis der Ausgaben'. Hentschke/Muhlack 136.
294
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
terpretation in der vorangegangenen Generation aus Überdruß am Positivismus zu ausschließlich (und wohl auch methodisch verfrüht) zugewandt hatte, zunächst einmal seitab liegen und knüpfte - hinter den dritten Humanismus zurückgehend - an den Weg des Historismus speziell Wilamowitzscher Prägung an (vgl. etwa Karl Reinhardt zu Wilamowitz' .Einleitung in die attische Tragödie': „[...] schlägt seine Definition der griechischen Tragödie in ihrem historischen Realismus allen ästhetischen, romantischen und klassizistischen Spekulationen ins Gesicht [...] Kein Wort vom Tragischen. Um so anschaulicher die Schilderung der Vorbereitungen, des Publikums in Erwartung der Aufführung ..."; und allgemein: „[...] wie er bemüht ist, den Buchstaben in die Umwelt zu versetzen, die ihn erst belebe. Den Umwelten entheben sich ihm die Individuen. In seinen Lyrikern - ,Sappho und Simonides' - trägt ihm das überraschende Früchte. Seiner .Hellenistischen Dichtimg' geht ein ganzer Band Umwelt-I 45 Schilderung voraus" 16 ; und vgl. Hentschke/Muhlack: „Wilamowitz ging es darum, geistige Produkte, vor allem die Dichtung, in ihr historisches Milieu zu stellen") 17 . Selbstverständlich wurde dieser Weg nicht einfach wiederholt, sondern weitergeführt und dabei zeitgemäß verbreitert. Mit dem Historismus alter Prägung verbanden sich jetzt die in der Geschichtswissenschaft und -philosophie inzwischen stark nach vorn drängenden gesellschaftswissenschaftlichen sowie die hinzugewonnenen geisteswissenschaftlichen Betrachtungsweisen (während von Wilamowitz Reinhardt noch hatte sagen können: „Nach soziologischen oder gar geistesgeschichtlichen Analysen darf man allerdings bei ihm nicht suchen") 18 . Hinzu trat der vor allem in der neueren Linguistik beherrschend gewordene Struktur-, System-, Funktions- und Synchroniegedanke. Das gesellschaftliche ,Umfeld' des Dichters, und zwar als System, trat in den Vordergrund. Wirtschafts- und Sozialgeschichte wurde wichtig, aber auch - in Italien viel eher als in Deutschland - die Psychodynamik des Übergangs von einer Mündlichkeits- zu einer Schriftlichkeitskultur (mit deren systematischer Erforschung in den zwanziger/dreißiger Jahren Milman Parry und seine Schule begonnen hatten und die inzwischen in den USA zu einem eigenen Forschungsgegenstand geworden war) 19 . Was der Historismus begonnen hatte, die durch möglichst präzise Faktenrekonstruktion ermöglichte Distanzierung des antiken 16
K. Reinhardt, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, in: Vermächtnis der Antike, Göttingen 1960, 366. 17 Hentschke/Muhlack 131. 18 Siehe oben Anm. 16 (S. 367). 19 Verf., Perspektiven der Gräzistik, Freiburg - Würzburg 1984; Homer. Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979 (WdF 463), Einführung.
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
295
Kunstwerks und seine .objektive' Wiedereinbettung in seine originäre Entstehungs-, Darbietungs- und Wirkungssituation, das wurde hier nun unter Einbeziehung neuer Detailerkenntnisse und reflektierterer Fragestellungen fortgeführt. Das Ergebnis war, daß die Lyrikerfragmente zusehends schärferes Profil gewannen. Eine neue Sachlichkeit kam in der Lyrikdeutung auf. Manchem der frühen griechischen Lyriker tat das gut. Die Überreste der Kampfappelle des Kallinos und des Tyrtaios etwa verloren durch ihre konsequente Beziehung auf die zur Zeit ihrer Entstehung in Ephesos bzw. Sparta das Denken der Verantwortlichen beherrschende Existenzbedrohung viel von ihrem scheinbar überzeitlich gemeinten patriotischen Pathos und wurden zu situationsbedingten Dokumenten einer schwer lastenden politischen Realität 20 . Alkmans großes Mädchenchorlied (Fr. 1) verlor in einer großangelegten Untersuchung der griechischen Jugenderziehungs-Institutionen des 7./6. Jh. viel von seiner scheinbar poetisch begründeten Rätselhaftigkeit und wurde zum Exempel eines institutionelle Bedürfnisse befriedigenden Initiationsliedtypus 21 . - An Beispielen wie diesen können die Verdienste und Chancen dieser Forschungsrichtung deutlich werden, aber auch ihre Grenzen und Gefahren. Auf sie wird später einzugehen sein. I Die italienische Forschergruppe machte (zumindest in der frühen Phase ihrer 46 Tätigkeit, Ende der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre) zwar den gesamten historischen Ort des lyrischen Kunstwerks, mit allen seinen Einzelkomponenten, zum Ausgangspunkt der Interpretation, wandte jedoch den größeren Teil ihres Interesses dem Autor zu: unter welchen historischen Bedingungen wächst der Autor auf, wie und wodurch wird er geistig geprägt, welche soziale Schicht repräsentiert er, welche zeitgenössischen Stimmungen, Denkbewegungen, Fragestellungen etc. schlagen sich, ihm unbewußt, in seinem Werke nieder bzw. welche betont er, usw. Weniger Aufmerksamkeit galt dem Publikum, dem anderen der beiden Partner im Kommunikationsprozeß ,Autor - Hörer/Leser' (.Produzent - Rezipient'). Ihm wandte sich die gräzistische Lyrikforschung - in Aufnahme der italienischen Anregungen, vor allem aber im Gefolge einer entsprechenden Wendung insbesondere der deutschen Germanistik und Literaturwissenschaft - Ende der siebziger Jahre in der Bundesrepublik zu. Zur produktionsästhetischen Betrachtungsweise trat damit die rezeptionsästheüsche22. Beide wa20
C. Prato, Tyrtaeus (Introduzione); Verf., Kampfparänese ..., München 1977 (Zetemata 66), .Methodologische Vorüberlegungen' sowie S. 21-26. 21 C. Caíame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce antique, Rom 1977. 22 Beste Einführung: W. Barner, Neuphilologische Rezeptionsforschung und die Möglichkeiten der Klassischen Philologie, Poetica 9, 1977, 499-521; Ders., Rezeptions- und Wirkungsge-
296
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
ren im .Pragmatismus' der Urbiner Schule angelegt: Produktion und Rezeption als die beiden Pole des Kommunikationsprozesses sind Teile der pragmatischen Gesamtsituation des Kunstwerks, ihre Erforschung - wenn sie denn schon aufgespalten werden soll - fallt also zwei Teildisziplinen dessen, was man ,Werkpragmatistik' nennen könnte, zu. Vor der genaueren Darlegung der Ziele dieser Richtung sind angesichts des hohen Originalitätsanspruches, mit dem die Rezeptionsforschung zuweilen auftritt, ein paar historische Erinnerungen vielleicht nicht überflüssig. - Selbstverständlich war die Frage nach den Bedingungen der Werkaufhahme, nach der Beschaffenheit des intendierten und des tatsächlichen Publikums - des primären wie des sekundären (d.h. des örtlich größeren und/oder zeitlich späteren) - , nach der Art der Implikation dieses Publikums in das Werk schon während des Schaffensprozesses, nach der Wirkung des Werkes auf das Publikum und nach der Technik des Künstlers, diese Wirkung zu erzielen - diese ganze Fragestellung war natürlich immer schon ein Bestandteil theoretischer Beschäftigung mit Literatur. Vielleicht wäre es nützlich zu erkennen, daß sie sogar zu denjenigen Fragestellungen .gehört, aus denen sich Literaturwissenschaft im 5. Jh. v. Chr. überhaupt entwickelt hat; denn damals war es ja, daß sich die Rhetorik bewußt als Technik der Publikumssteuerung in der Sophistik zu etablieren begann und prompt einer ersten Diskussion (und bald auch gnadenlosen Destruktion in der Aristophanischen Komödie und im Platonischen Dialog) unterzogen wurde. Von besonneneren Vertretern der modernen Rezeptionsforschung ist dieses hohe Alter ihrer Disziplin auch durchaus bemerkt worden (ebenso wie die Tatsache, daß die gesamte antike Poetik von der impliziten Poetik Homers bis zur expliziten 47 des Aristoteles, Horaz, Longin usw. im Kern I Wirkungsästhetik ist) 23 . Wahr bleibt freilich, daß nicht nur die Philologien der neueren Literaturen, sondern auch die Klassische Philologie diesem Aspekt des sprachlichen Kunstwerks lange Zeit nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben - obgleich hier in der einschlägigen Debatte meist zu rasch geurteilt und verurteilt wird: eine genauere Prüfung würde im Falle der Klassischen Philologie zeigen, daß die rezeptionsästhetische Fragestellung ganz sachangemessen immer bei denjenigen Literaturformen besonders stark in den Vordergrund rückte, bei denen der direkte Publikumsbezug besonders augenfällig sinnbildend ist, also vor allem bei
schichte, in: Literaturwissenschaft. Grundkurs 2 (Rowohlt-Taschenbuch Nr. 6277), Hamburg 1981, 102-124. 23 Barner 1977, passim; 1981, 105.
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
297
den auf unmittelbare Wirkung zielenden ursprünglich mündlichen Formen wie Drama (Komödie, Tragödie, Satyrspiel) oder Rede (politische und Gerichtsrede); wo dagegen das Werk schon vom Autor selbst auf beliebig häufige Wiederholbarkeit der Rezeption, also auf ,Rezeptivität', angelegt ist (etwa Thukydides' κτήμα ές άεί; Ennius' volito vivos per ora virum; Horazens monumentarti aere perennius: Geschichtsschreibung, literarische Epik, .Gedankenlyrik'), da hielt sich die rezeptionsästhetische Kommentierung der Klassischen Philologie zu Recht zurück bzw. trat sie sachangemessen eher in der Variante .Nachlebensforschung' (~ Rezeptionsgeschickte) auf. Selbstverständlich war die theoretische Bewußtheit solchen rezeptionsästhetischen bzw. -geschichtlichen Vorgehens avant la lettre gering. Auf der anderen Seite ist aber in solchen Arbeiten der hohe theoretische Anspruch der modernen Rezeptionsforschung praktisch oft bereits in vorbildlicher Weise eingelöst. Der wichtigste Kritikpunkt an der heutigen Rezeptionsforschung lautet ja: „Zwischen hoher Theoretizität auf der einen und der reinen Materialaufarbeitung bzw. Dokumentation auf der anderen Seite klafft in vielen Fällen eine als unbefriedigend empfundene Lücke. Von manchen wird sie sogar als die Fragestellung selbst kompromittierend gedeutet" (W. Bamer) 24 . In den Textkommentaren der Gräzistik und Latinistik feiert dagegen meist umgekehrt die „reine Materialaufarbeitung bzw. Dokumentation" Triumphe, gerade auch innerhalb solcher Fragehorizonte wie ,Was setzt der Autor mit dieser bestimmten Aussage bei seinem Publikum voraus? In welcher Richtung steuert er es mit gerade dieser Formulierung seiner Aussage? Welche bereits einkalkulierte Reaktion auf seine Aussage macht sich der Autor für die Formulierung der Fortsetzung seiner Aussage zunutze?' usw. Heutige literaturwissenschaftliche Fragerichtungen sollten, wenn sie auf sich selbst reflektieren, erkennen, daß sie in der Regel nur (entsprechend der fortschreitenden .Mikroskopierung' von Wissenschaft in der modernen technischen Welt) relativ winzige Teilphänomene eines früher mit Selbstverständlichkeit gehandhabten Interpretations-Gesamtverfahrens herausgreifen und zu einem eigenen - entsprechend großdimensionierten - Problemfeld mit entsprechend zahlreichen terminologischen Neuprägungen zur separaten Bezeichnung von Mikro-Einheiten größerer (seit jeher bekannter) Komponenten und Abläufe ausbauen; falls sich die betreffenden .Mikro-Ingenieure' dann in ihrem neugeschaffenen Mikroprozessoren-System häuslich I einrichten, kann es ihnen so vorkommen, als 48 sei ihre kleine Welt bereits die ganze. Die ,,überzogene[n] oder unreflektierte[n]
24
Barner 1981,112.
298
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
Totalansprüche", die Bamer mit Recht rügt 25 , kommen daher. In Wirklichkeit hat natürlich auch die rezeptionsästhetische Fragestellung, wie Barner zu betonen nicht müde wird, entsprechend ihrem Forschungsgegenstand (der ein winziges Teilglied des Gesamtphänomens .sprachliches Kunstwerk' ist) nur Aspektcharakter26, und der Aspekt, den sie hervorhebt, hat überdies nicht für jede Literaturgattung und -form und nicht für jedes Einzelwerk gleiche Erheblichkeit. Darauf kommen wir bei der Kritik der neuen Tendenzen zurück. Unter denjenigen Wortkunstformen, die der rezeptionsästhetischen Fragestellung besonders fruchtbare Ansatzmöglichkeiten bieten, stehen die situationsbezogenen mündlichen obenan. Das erklärt sich daraus, daß mündlich darzubietende situationsbezogene Wortkunstwerke sich wegen der unmittelbar gegebenen Kontroll- und Reaktionsmöglichkeiten des Publikums gewissermaßen stärker gegen möglichen .Einspruch' absichern müssen, d.h. sich mittels impliziter Kritikabweisung und Sympathiegewinnung in ihrer Aussage- und Wirkungsabsicht behaupten und durchsetzen müssen. Da solche Werke infolgedessen mit rezeptionslenkenden Signalen - also mit ,Rezeptionsvorgaben', ,Rezeptionsvorprägungen' usw. - besonders dicht und massiv durchsetzt sind, bieten sie der rezeptionsästhetischen Interpretation besonders leichte und zugleich besonders sinnerhellende Zugriffsmöglichkeiten. Dieser Kunstwerktyp liegt nun gerade in den Schöpfungen der frühgriechischen Lyriker vor. Ihre Situationsbezogenheit ist, wie weiter oben bereits ausgeführt, schon im 19. Jh. als wesensprägend erkannt worden. Ihre Mündlichkeit - Mündlichkeit natürlich nur der Darbietung war zwar ebenfalls seit jeher bekannt - besonders hervorgehoben wurde sie ζ. B. in den einschlägigen Arbeiten von Richard Harder („Die ganze altgriechische Literatur ist gleichsam auf der Bühne rezitiert")27 und R. Muth („an ein Lesepublikum ist für Jahrhunderte nicht zu denken") 28 , den Nachweis hatte bereits F. A. Wolf in den .Prolegomena ad Homerum', § 17, geführt - , sie war aber in der praktischen Interpretationsarbeit merkwürdig unfruchtbar geblieben. Die weithin bekannten Interpretationen etwa von Hermann Fränkel (der an sich natürlich ebenfalls von der Mündlichkeit der Darbietung ausgeht: er redet nur von .Sprecher' oder ,Sänger') und Max Treu belegen das. Hier trat ein Wandel ein durch die allmähliche Aufnahme der amerikanischen Oral poetry-Forschung 25
Bamer 1981,112. Barner 1977, 520 und öfter. 27 R. Harder, Bemerkungen zur griechischen Schriftlichkeit, Die Antike 19, 1943, 86-108 (= Kleine Schriften, München 1960,57-80), hier 105. 28 R. Muth, Randbemerkungen zur griechischen Literaturgeschichte. Zur Bedeutung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit der Wortkunst, WSt 79, 1966, hier: 252. 26
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
299
auch in Europa. Schon die Forschergruppe um Gentiii hatte dem Aspekt der Mündlichkeit friihgriechischer Lyrik-Darbietungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet 2 9 . Zum methodischen I Angelpunkt gemacht wurde dieser Aspekt 49 aber erst in jenem Buch, das die erste praktische Erprobung der Rezeptionsforschung in der Gräzistik bedeutete, in Wolfgang Röslers .Dichter und Gruppe. Eine Untersuchung zu den Bedingungen und zur historischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel Alkaios' (1980) 30 . Das Buch hat beachtliche Bewegung in die Lyrikforschung gebracht, wie u. a. die Besprechungen zeigen, die von fast jubelnder Zustimmung (erwartungsgemäß von italienischer Seite) über partielle Anerkennung und prinzipielles Unverständnis bis zu heftiger Ablehnung, ja Entrüstung reichen 31 . In jedem Falle hat das Buch das Verdienst, den oben gekennzeichneten Zustand der Theoriearmut innerhalb der gräzistischen Lyrik-Interpretation beendet und das theoretische Bewußtsein allgemein geschärft zu haben. Eine eingehende Würdigung ist an anderer Stelle gegeben 32 . Hier sei nur festgehalten, daß es dem Autor in der Tat gelungen ist, mit dieser Vorlage einer ,,funktionsorientierte[n] Textbetrachtung, die unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zunächst die kommunikative Intention herausarbeitet, die der Verfasser im Hinblick auf sein historisches Publikum verfolgte" (12), die von ihm erhoffte „methodische Umorientierung" (23) zumindest in den Gesichtskreis der gräzistischen Lyrikforschung zu rücken. Unterscheidungen wie die zwischen .primärem' und .sekundärem' Publikum (Alkaios' Hetairie auf der einen, wir als ursprünglich nicht intendierte Rezipienten auf der anderen Seite), zwischen frühgriechischer Hör- und klassischer Lesepoesie, zwischen μελο-ποιοί, .Liedermachern', und Buchdichtern, zwischen kommunikationsorientierter Anlaßkunst und publikumsferner, auf Zeitlosigkeit zielender monologischer ,self-expression' des .einsamen Ich' 33 werden bei der künftigen Interpretationsarbeit nicht mehr unberücksichtigt bleiben können. In welcher Weise sie fruchtbar gemacht werden sollen, ist eine andere Frage.
29
Siehe ζ. B. Prato, Tyrtaeus 49* f.; vgl. G. Cerris Besprechung von Adrados' .Orígenes de la lirica griega', Gnomon 52, 1980, 607 f. (mit Literaturangaben). 30 Habilitationsschrift Konstanz 1977, München (Fink) 1980. 31 Gabriele Burzacchini, Gnomon 54, 1982, 113-117 („Accade perciò raramente di dissentire": 117); Verf., Gymnasium 89, 1982, 337-339 [in diesem Band S. 309-312]; H. Eisenberger, GGA 233, 1981, 24-38; Th. Geizer, Poetica 14, 1982, 321-332. Vgl. Verf., Perspektiven der Gräzistik, 23-27. 32 Gymnasium 89, 1982, 337-339. [in diesem Band S. 309-312] 33 Dazu W. Röslers Besprechung von O. Tsagarakis, Self-Expression in Early Greek Lyric, Elegiac and Iambic Poetry (Wiesbaden 1977), Gnomon 52, 1980, 609-616.
300
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
Eines der zentralen Probleme, für die Röslers funktionsorientierter Ansatz eine größere Sensibilität angebahnt hat, ist die Bestimmung des Ausmaßes, in dem die mündliche Darbietungsweise die Produktion und die Produktgestaltung in der frühgriechischen Lyrik beeinflußt haben könnte. Mit der näheren Untersuchung dieser Frage hat Rosier kürzlich selbst begonnen: In einem Aufsatz im 9. Band der .Würzburger Jahrbücher' 34 hat er versucht, die Funktion und die Bedeutsamkeit der Deixis für das Verständnis einer Dichtung aufzuweisen, die offensichtlich häufig noch ganz konkret zeigt: ,du da', ,der dort drüben', .diese Stadt hier', usw. Es ist klar, daß Rezeptionsästhetik hier unmittelbar interpreta50 tionserheblich werden kann. I Rösler hat sich in seiner Untersuchung zu Recht zunächst auf die Unterschiede konzentriert, die in diesem Punkte zwischen der frühgriechischen und der späteren Lyrik bestehen oder zu bestehen scheinen. Ausgehend von einem Deixis-Modell, das der Sprachphilosoph Karl Bühler 1934 in seinem Werk .Sprachtheorie' vorgelegt hat, zeigt Rösler gut, wie die mündlich vorgetragene frühgriechische Lyrik im Zeigebereich durch „faktische .Demonstratio ad oculos'" geprägt wird, die schriftlichkeitsbestimmte Buchlyrik dagegen durch „mentale ,Deixis am Phantasma'". Wenn z.B. Sappho im sog. Arignota-Lied 35 (Fr. 96 V.) die inzwischen drüben in Lydien verheiratete Freundin Arignota den Mädchen ihres Kreises als sehnsuchtsvoll nach Mytilene Herüberdenkende vorstellen will, muß sie die kleinasiatische Küste nicht erst als Imaginationsgebilde beschwören, sondern sie kann mit einem κηθι, .dort drüben' (V. 18). auf diese Küste, die ja von Mytilene aus (normalerweise) gut sichtbar ist, einfach hindeuten; Catull dagegen muß im Phasellus-Gedicht, wenn er seinen Lesern das Schiff vorstellen will, mit ,ille' (,Phasellus ille'), mit .videtis' und mit der Anrede .hospites' ein imaginäres Zeigfeld, in dem es ihn selbst, ein Schiff, Fremde und ein Betrachten des Schiffes gibt, erst erzeugen. Der Unterschied ist natürlich signifikant, und schon im Alkaios-Buch hatte Rösler gut gezeigt, zu welchen abstrusen Fehldeutungen eine Lyrik-Interpretation führt, die diesen Unterschied ignoriert: wenn etwa Frankel den Alkaios dafür tadelt, daß er im Trinklied Nr. 338 V. einfach mit ,Da regnet es!' beginnt (ύει μέν ό Ζευς), ohne klarzumachen, daß dies von drinnen, von der wannen Stube aus gesagt sei, während Horaz mit dem einleitenden Appell , vides ut alta stet ni ve candidum / Soracte' (c. 19) doch viel klarer und überlegener den Blick des Le-
34 W. Rosier, Über Deixis und einige Aspekte mündlichen und schriftlichen Stils in antiker Lyrik, WüJbb N. F. 9, 1983, 7-28. 3 5 Gegen Page und mit Treu (Sappho, Tusculum-Biicherei 6 1979, 215) und Snell (bei Voigt, S. 108) halte ich άριγνωτα hier für einen Eigennamen (im Nom.).
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
301
sers erst einmal aus dem mit diesem Appell imaginierten Fenster hinauslenke. In Wahrheit - so sagt Rösler wohl richtig gegen Frankel - besteht kein Unterschied (und also kein Grund zur Alkaiosschelte), weil Alkaios das Zeigfeld, in dem er mit seinen Gefährten und zugleich Zuhörern ja im Augenblick des Liedvortrages sitzt, nicht erst vorzustellen braucht, während Horaz es für die Phantasie des Lesers erst herstellen muß 36 (ich lasse hier allerdings die m. E. grundlegende Frage beiseite, ob sich nicht zumindest Alkaios selbst bei der Abfassung dieses Lieds eine auch situationsunabhängige Darbietung vorgestellt hat; hat er wirklich ein Lied gemacht, für dessen Vortrag er auf die spezielle Situation .Symposion an einem Regentage' warten mußte?). An Beispielen dieser Art kann Rösler zeigen, daß der synchrone Situationsbezug beim mündlichen Vortrag die frühgriechische Lyrik offenbar viel tiefer prägt, als es einer vom Umgang mit Leselyrik herkommenden Interpretation vertraut ist, und daß der moderne Interpret frühgriechischer Lyrik infolgedessen, wenn er das ursprüngliche Sinnsystem eines frühgriechischen Liedes wiedergewinnen will, sich - vom Vertrauten abstrahierend - noch viel bewußter aus seiner gewohnten Interpretationshaltung geradezu heraustreiben muß, als das in der bisherigen gräzisüschen I Lyrikdeutung meist üblich war. Die prinzipielle 51 Verschiedenheit der beiden Lyrik-Ausprägungen ist damit dargetan. Ohne schon an dieser Stelle in die grundsätzliche Kritik an den neuen Tendenzen einzutreten, sei in diesem konkreten Zusammenhang nur darauf hingewiesen, daß über der Betonung des Trennenden allerdings das Verbindende, das es zwischen den beiden Lyrik-Ausprägungen ja zweifellos auch gibt, zu kurz gekommen zu sein scheint. Im Bestreben, den Konsequenzen seiner Beobachtungen möglichst umfassende Geltung zu verschaffen, wird Rösler zu einer allzu schroffen und sauberen Polarisierung gedrängt: frühgriechische Lyrik, verhaftet im Hier und Jetzt situaüonsbezogener Darbietung, ist gleichbedeutend mit Demonstratio ad oculos - spätere Leselyrik, berechnet auf beliebig evozierbare freie Imagination, ist gleichbedeutend mit Deixis am Phantasma37. Fiktion wäre somit der frühgriechischen Lyrik noch grundsätzlich wesensfremd. Dies ist zumindest der Eindruck, den der unvoreingenommene Leser des Aufsatzes mit fortschreitender Lektüre immer stärker gewinnen muß.
36
Rösler, Dichter und Gruppe 251-255. Deixis-Aufsatz (s. oben Anm. 34) 17. 28; Näheres s. Verf. (unten Anm. 41). [Rösler hat seine Position präzisiert und gegen Mißverständnisse abgesichert in GGA 237, 1985, 149 Anm. 1.] 37
302
Zu den .pragmatischen' Tendenzen
Es sollte eigentlich keiner genaueren Dokumentation bedürfen müssen, um die Unhaltbarkeit einer derartigen Kontrastierung aufzuweisen. Solange sprachliche Kommunikation besteht, ist Demonstratio ad oculos als Deixis-Funktion ebenso selbstverständlich wie Deixis am Phantasma. Jede Erzählung, Besprechung usw. schafft notwendig eine eigene sekundäre Wirklichkeit mit einem dazugehörigen sekundären (abgebildeten, imaginären, fiktiven) raumzeitlichen Koordinatensystem; Wortkunst ist nur ein Spezialfall sprachlicher Kommunikation und unterliegt somit der gleichen sprachimmanenten Gesetzlichkeit. Eine Verteilung der beiden Grund-Zeigevarianten an bestimmten Evolutionsstadien der Wortkunst wäre ein Kurzschluß. Mündlichkeit vollends hat mit einer bestimmten Form von Deixis gar nichts zu tun. Beschränkt sich mündliche Kommunikation strikt auf die Besprechung eines vor aller Augen liegenden real synchronen Gegenstands, dann wird natürlich Deixis in ihr vorwiegend bis ausschließlich als Demonstratio ad oculos auftreten. Sieht es hingegen mündliche Kommunikation auf die Schaffung von imaginären (für die Kommunikationsteilnehmer physisch nicht wahrnehmbaren und auch empirisch nicht erinnerbaren) Ereignis- oder Gedankenzusammenhängen ab, dann muß Deixis darin natürlich vorwiegend bis ausschließlich als Deixis am Phantasma auftreten (so ist ja das ganze Epos ein einziges .Stellt euch vor!'). Es ist wahrscheinlich richtig, daß bei Alkaios Deixis vornehmlich als Demonstratio ad oculos auftritt. Das liegt aber nicht an der Mündlichkeit der alkalischen Lyrikdarbietung, sondern an ihrer außergewöhnlich hochgradigen Situationsbezogenheit. Diese ist natürlich eine Folge des durch Alkaios' Lebensform bedingten appellati ven Charakters seiner Lieder. Das Leben dieses Mannes war geprägt vom politischen Kampf. Die Plattform dieses Kampfes war die politische Gesinnungsgruppe. Mit ihr ging Alkaios ins Exil, bereitete er die Rückkehr an die Macht vor, usw. Gegen52 wartslbezug, Appellcharakter ist für eine Dichtung, die ein solches Leben reflektiert, natürlich. Für andere Vertreter der frühgriechischen Lyrik treffen andere Lebensformen und entsprechend andere Redeformen zu. Hier gilt es zu differenzieren, und zwar - wie Rösler an anderer Stelle zu Recht betont - „ohne den Zwang, für alle lyrischen Gattungen generell geltende Antworten zu finden", und indem man „zunächst den ,Sitz im Leben' zu erfassen trachtet, den die jeweiligen Texte ursprünglich innehatten"38. In der Tat würde sich ja ein „fiinktionsorientierter Ansatz", der sich nicht an der je speziellen Form und Aussageintention verschiedener Lyrik-Ausprägungen orientierte, selbst ad absurdum führen. 38
Besprechung von Tsagarakis (s. oben Anm. 33), 615.
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
303
Wenn in einer bestimmten Ausprägung der frühgriechischen Lyrik statt der Redeform ,situationsbezogene Besprechung' die Redeformen .Erzählung, Erinnerung, Vorstellung, Reflexion u. ä.' im Vordergrund stehen, dann ist für diese Lyrik-Ausprägung von vornherein die Deixis-Funktion ,Deixis am Phantasma' jedenfalls in Rechnung zu stellen. Wird einem Sprachkunstwerk, das sein eigenes Zeigfeld konstituiert und seinen eigenen Fiktionsraum schafft, eine reale Situation untergeschoben, in die es mit allen seinen Referenzsignalen .hineinpaßt', dann kann das nur zu absurden Deutungen führen. Dies hat Rosier selbst klar gesehen und ζ. B. an Alkaios Fr. 6 (mit dem extrem deiktischen Beginn ,Da kommt schon wieder eine Woge, die vom vergangenen Sturm herrührt') im einzelnen erwiesen: ein realistisches Verständnis dieser Deixis wäre „absurd" 39 . Daraus ist die Lehre zu ziehen, daß natürlich auch ein frühgriechischer Lyriker Vorstellungen und Situationsbilder, die er hat, im Lied zu einer Fiktionssituation gestalten kann, die dann auch sein Publikum, das doch physisch vor ihm sitzt, sich erst in seiner Phantasie »nachbilden' muß. Da in diesen Fällen der „vorausgesetzte Wissens- und Wahrnehmungshorizont"40 dieses primären Publikums dem jedes sekundären Publikums nur wenig überlegen ist (die Überlegenheit reduziert sich auf den Unterschied .Zeitgenossenschaft : Nachwelt'), tendiert hier die Bedeutsamkeit der Autopsie gegen Null, und dies schon für den Autor selbst und sein Publikum: für beide war die synchrone Realsituation nur der selbstverständliche Ausgangspunkt für Intentionen, die jenseits dieser Selbstverständlichkeiten lagen. Wollten wir uns in solchen Fällen ausgerechnet auf die Realsituation kaprizieren, würden wir mithin den Sinn des Werks verfehlen. Es ist deutlich, daß eben dies die Grundhaltung ist, die uns, den sekundären Rezipienten, von vielen Liedern Sapphos abgefordert wird. Daß diese Lieder sich gern aus Vorstellungen entfalten, ist bekannt. Als Beispiel diene gleich das einzige ganz erhaltene Lied, das ,Gebet an Aphrodite': Buntthronig unsterbliche Aphrodite, Kind des Zeus du, listenflechtendes, ich bitte dich: drück mir nicht in Überdruß und Qualen nieder, Herrin, den Mut! I Sondern: Komm hierher! wenn du einmal auch zu andrer Zeit schon diese meine Stimme hörend aus der Ferne ihr dein Ohr geschenkt hast, und des Vaters Haus verlassend gekommen bist - nachdem den goldnen
39 40
Rosier, Dichter und Gruppe 128. Rösler, Deixis-Aufsatz 14.
S3
304
Zu den .pragmatischen' Tendenzen Wagen du unter's Joch geschirrst hast, und schön dich zogen hurtige Sperlingsvögel hoch über der schwarzen Erde, eifrig die Flügel schlagend, herab vom Himmel, hindurch durch des Luftraums Mitte: flugs waren sie da - und du, o Selige, lächelnd mit göttlichem Antlitz hast du gefragt, was ich denn jetzt wohl wieder für ein Leid nur hätte, und wonach ich jetzt denn wieder riefe und was ich denn am sehnlichsten bekommen möchte in meinem liebestollen Sinn? - „Wen soll ich jetzt denn wieder überreden, daß du ihn führen kannst (?) in deine Liebe? Wer macht dich, meine Sappho, krank? Denn: wenn sie flieht - bald wird sie suchen! Und wenn Geschenke sie nicht annimmt - geben wird sie! Und wenn sie nicht liebt - rasch wird sie lieben, auch wenn sie nicht will!" Komm zu mir auch jetzt! und von dem schlimmen Kummer mach mich frei - und alles das, was meine Sinne daß es geschehe glühend wünschen, laß geschehen! - Und du selber: A/i'fstreiterin sei mir!
In unserem Zusammenhang kommt es nur auf dieses an: Die Hoffnung, Aphrodite werde in der Liebesnot auch diesmal helfen, rankt sich empor allein an der Erinnerung, daß Aphrodite ja auch früher schon geholfen hat, und diese Erinnerung verdichtet sich zu einem Bild, das so - mit Sperlingswagenfahrt und wörtlichem Dialog - natürlich nur in Sapphos Vorstellung existiert. Als Sappho dieses Lied den Mädchen ihres Kreises vortrug, konnte denen ihre Anwesenheit im realen Zeigfeld Sapphos zum Verständnis des Liedes wenig helfen; sie mußten die fingierte Situation - wie Aphrodite die Sperlingsvögel anschirrt, vom Olymp herniederfährt usw. - in ihrer Vorstellung genauso rekonstruieren wie wir (und konnten dabei dem, was Sappho damit im Grunde sagen wollte, genauso fern bleiben oder nahe kommen wie nur unsereiner). Das gleiche ließe sich z. B. an den Liedern 94 und 96 zeigen, aber auch - vielleicht weniger erwartungsgemäß - an 31, dem berühmtesten Liebeslied der frühgriechischen Lyrik, φαίνεται μοι κήνος, wo κήνος, scheinbar konkreteste .Demonstratio ad oculos', in Wahrheit Bestandteil reinster Imagination ist. Das ist an anderer Stelle ausgeführt 41 . Was hier zählt, ist vorerst nur dies: Die möglichst konkrete Auffassung, die uns nahezu die Autopsie zur Vorbedingung eines wirklich authentischen Liedverständ-
Realität und Imagination. Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κηνος-Lied, MusHelv 42,1985, 67-94. [in diesem Band S. 313-344]
der gegenwärtigen gräzistischen
Lyrik-Interpretation
305
nisses machen möchte (und uns damit den Mut nimmt), kann vielfach ganz verfehlt sein. I 3. Wertung Die neuen Tendenzen der gräzistischen Lyrik-Interpretation haben den Zug zum Historischen, Faktischen und Konkreten gemeinsam. Sie wollen Lyrik (wie Literatur überhaupt) deuten über die Aufdeckung ihrer Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit. Dazu dient ihnen die Rekonstruktion der ursprünglichen Produktions- und Rezeptionsbedingungen. Ziel ist die möglichst detailgetreue Wiedergewinnung der primären Interaktionsprozesse zwischen Umwelt, Künstler, Werk und Publikum. An dieser Konzeption ist unbestreitbar richtig der (selbstverständliche) Gedanke, daß das angemessene Verständnis einer Schöpfung nur möglich ist auf der Grundlage der möglichst genauen Erfassung des Funktionszusammenhangs, aus dem heraus sie entstand und für den sie bestimmt war bzw. ist. Eine große Gefahr der neuen Tendenzen besteht darin, daß sie versucht sind, die Erhellung des Milieus eines Kunstwerks schon für die Erhellung dieses Werkes selbst zu nehmen. Diese Gefahr ist mit Tendenzen dieses Typs bekanntlich stets verbunden. Schon die Wilamowitzsche Konzeption von Philologie ist ihr nicht entgangen: „Wilamowitz ging es darum, geistige Produkte, vor allem die Dichtung, in ihr historisches Milieu zu stellen. Er betrachtete den Aufweis solcher Bedingungen schon als hinreichende Verständigungsgrundlage."42 Aus dem Ungenügen an eben dieser Enge entstand Jaegers Neubeginn. Eine Verständigung im Interesse weiterer Interpretationsfortschritte könnte von der Übereinstimmung darüber ausgehen, daß das Milieu auch für den frühgriechischen Lyriker die selbstverständliche (und normalerweise gar nicht problematisierte) Voraussetzung seines Werkes war. Insofern er Künstler war, ging es ihm um anderes. Das ist eine Erkenntnis, die offenbar nicht banal genug ist, um nicht immer wieder betont werden zu müssen. Sie wird natürlich seit jeher auch von den Vertretern des .realistischen' Typs literarischer Interpretation geteilt. So hat Wilamowitz seine Darstellung der .Griechischen Literatur des Altertums' beschlossen mit Gedanken über ,Das Individuum', die wohl auch von Vertretern der aktuellen Interpretationstendenzen unterschrieben werden können:
42
Hentschke/Muhlack 131.
54
306
Zu den .pragmatischen' Tendenzen „Solange die Dichter nur das Bedürfnis befriedigen, ein Kultlied oder ein Hochzeitslied machen, Gemeingefühl aussprechen, des Publikums Willen erfüllen, sind sie Handwerker; es ist ein Segen gewesen, daß das die griechischen Dichter in so weitem Sinne geblieben sind, aber sie müssen noch etwas anderes sein, wenn sie auf uns noch als lebendige Kräfte wirken wollen." 43
Freilich sind die Anerkennung und die praktische Umsetzung von Grundsätzen zwei verschiedene Dinge. Vor dem Hintergrund der oben unter 1 dargelegten Forschungsdesiderate kann die heute so stark in den Vordergrund gestellte Rekonstruktion des historischen Orts der frühgriechischen Lyrik - eingeschlossen den gesamten Kommu55 nikationsprozeß I (Schaffung, Darbietung, Aufnahme) - nur eine notwendige Vorstufe der eigentlich zu leistenden Interpretation sein. Die Fragen des , Woraus' und ,Für wen' müssen zum ,Was' und ,Wie' führen. Produktions- und Rezeptionsästhetik sollten nicht aus emotionaler Opposition heraus als überlegene Gegenposition zur Werkästhetik aufgeblasen werden; sie machen Werkästhetik nicht entbehrlich. Die ästhetischen Valenzen eines Sappho-Liedes - Bild, Metapher, Wortfolge, Assoziation, Synästhesie, Klang 44 usw. - sind noch längst nicht aufgedeckt; eine Typologie der dichterischen Zeichen (»poetische Semiotik'), wie wir sie dringend brauchten, ist nicht in Sicht. So darf man vielleicht sagen: Die neuen Tendenzen der gräzistischen Lyrikforschung sind insgesamt zwar zu begrüßen, weil sie die Interpretation fundierter, theoriebewußter und auch vielseitiger machen können. Sie sollten aber nicht als Passepartout mißbraucht und vor allem nicht schon als das Ganze der Interpretation mißverstanden werden. Literaturwissenschaft im technischen Zeitalter neigt - als historisches Phänomen, das ja auch sie ist - zur Überbetonung des Technischen (.Kommunikation', .Interaktion', .Rezeption', .Funktion'; .Produzent', .Konsument' usw.). Das kann nur eine Durchgangsstation sein. Jede Epoche bringt ihre eigene Literaturwissenschaft hervor, die je andere Aspekte am Kunstwerk ins Licht rückt. Die perfekte, endgültige Interpretationsmethode ist glücklicherweise - eine Utopie. I
43
Siehe oben Anm. 9 (S. 310). Vgl. A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur 3 1971, 849: „Immerhin scheint hier Gelegenheit zu der Feststellung gegeben, daß sich die moderne Erforschung der Klangwirkung antiker Dichtung und Rede bislang auf ein zögerndes Tasten beschränkt hat." 44
der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interpretation
307
Lyriker-Ausgaben (seit 1955) I.
Melos
1. Poetarum Lesbiorum Fragmenta edd. E. Lobel et D. Page, Oxford 1955 (= PLF). 2. Poetae Melici Graeci, ed. D. L. Page, Oxford 1962 (= PMG). 3. Lyrica Graeca Selecta ed. D. L. Page, Oxford 1968 (= LGS) (Ed. minor). 4. Bacchylides, edd. B. Snell et H. Maehler, Leipzig 101970 (BT) [zuletzt 1992], 5. Sappho et Alcaeus, Fragmenta ed. Eva-Maria Voigt, Amsterdam 1971. 6. Supplementum Lyricis Graecis ed. D. Page, Oxford 1974. 7. Pindarus, edd. B. Snell et H. Maehler, Leipzig 81987 (BT). Π.
Elegie und Iambos
8.
Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati ed. M. L. West, Oxford, 2 Bde., 1971/72. 1989/1992. 9. Poetae Elegiaci. Testimonia et Fragmenta, edd. Β. Gentili et C. Prato. Pars I: Leipzig. 1979. 2 1988. Pars Π: Leipzig 1985 (BT). 10. Delectus ex Iambis et Elegís Graecis, ed. M. L. West, Oxford 1980 (Ed. minor). 2
ΠΙ.
Einzelne Lyriker in der Reihe .Lyricorum Graecorum quae exstant' (Edizioni dell'Ateneo, Roma)
II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Anacreon, ed. B. Gentiii. 1958. Archilochus, ed. G. Tarditi. 1968. Tyrtaeus, ed. C. Prato. 1968. Solon [nur Testimonia], ed. Α. Martina. 1969. Theognis, Elegie, libro Π, ed. M. Vetta. 1980. Alemán, ed. C. Calarne. 1984. Semonides, edd. E. Pellizer/G. Tedeschi. 1990. Pindarus [nur Threnorum Fragmenta], ed. Maria Cannata Fera. 1990.
IV. Einzelne Lyriker in der Reihe ,The Loeb Classical Library', ed. D. Campbell. 19. 20. 21. 22. 23.
Greek Greek Greek Greek Greek
Lyrik I (Sappho u. Alkaios). 1982. Lyrik II (Anakreon, Anacreontea, Alkman). 1988. Lyrik ΙΠ (Stesichoros, Ibykos, Simonides). 1991. Lyrik IV (Bakchylides, .kleine' Meliker). 1992 Lyrik V (jüngere Meliker'). 1993.
V.
Zweisprachige Auswahlausgabe griechisch-deutsch, mit durchweg neuen Übersetzungen sowie Einleitungen (mit Forschungsstand) zu jedem Einzellyriker und zu den einzelnen Lyrik-Arten:
24.
Die griechische Literatur in Text und Darstellung. I: Archaische Periode, hrsg. v. J. Latacz, Stuttgart (Reclam) 1991 (616 S.).
56
Gymnasium 89, 1982, 337-339
Ein neues Alkaios-Buch W. Rösler: Dichter und Gruppe. Eine Untersuchung zu den Bedingungen und zur historischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel Alkaios. München (Fink) 1980. Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste: 50. 297 S. DM 78,-.
Dieses engagiert und bei aller Solidität spannend geschriebene Buch (ursprünglich eine Konstanzer Habil.-Schrift von 1977) wird die Interpretation nicht nur der Alkäischen, sondern der frühgriechischen Lyrik insgesamt ein gutes Stück voranbringen. Im Zusammenhang einer Neukommentierung der wichtigsten längeren Alkaios-Fragmente (6. 42. 70. 72. 73. 129. 130b. 140. 208a. 283. 298; .Trinklieder': 38 a. 335. 338. 346. 347; Zählung nach Voigt) legt R. eine umfassende und neue Wege weisende Überprüfung des bisherigen Methoden-Inventars bei der Lyriker-Interpretation vor. Sein Ziel ist es dabei, einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel anzubahnen. Die traditionell dominierende Textbetrachtung vornehmlich vom Autor her (geistesgeschichtlich: Snell; stilkritisch: Fränkel; biographisch-positivistisch: Page; emotiv: New Criticism, bes. Kirkwood und Martin) soll ersetzt (gemeint aber doch wohl: ergänzt) werden durch eine Textbetrachtung vom Standpunkt der ursprünglichen Adressaten, d. h. der .ersten Rezipienten' her. Mit dieser Schwenkung vom produktionsästhetischen zum rezeptionsästhetischen Blickpunkt als gezielt gewähltem und konsequent beibehaltenem Ausgangspunkt detaillierten Interpretierens hält die Rezeptionsforschung - vorbereitet durch theoretische Programmerklärungen, Gesamtüberblicke und Projekt-Entwürfe1 - ihren konkreten Einzug auch in die Gräzistik. Das Debüt scheint mir wohlgelungen.
1 Beispiele: W. Barner, Neuphilologische Rezeptionsforschung und die Möglichkeiten der klassischen Philologie, Poetica 9, 1977, 499-521. R. Kannicht, ,Der alte Streit zwischen Philosophie und Dichtung', AU 23/6, 1980, 6 - 3 6 (zuerst Vortrag 1977). H. Funke, Homer und seine Leser in der Antike, in: Forschung an der Universität Mannheim. Methoden und Ergebnisse. Mannheimer Vorträge, Akad. Winter 76/77, 26-38. - Ein vorzügliches Anwendungs-Beispiel für die Detail-Interpretation bietet R. Kannicht, Dichtung und Bildkunst. Die Rezeption der
310
Ein neues Alkaios-Buch
Der Einwand, leser- bzw. hörerbezogene Textinterpretation (im Sinne von Rezeptionsästhetik avant la lettre) sei bei der Lyrikerdeutung schon immer (auch) betrieben worden, träfe R.s Leistung nicht. Wie andere moderne Ansätze (z.B. mod. Linguistik, Oral poetry-Theorie) ist zwar auch der der Rezeptionsforschung gerade für die Gräzistik in der Tat nicht ,neu' (zur Alkaios-Deutung speziell wäre auf manche Einsicht und praktische Konsequenz schon in Max Treus Tusculum-Ausgabe (1952) zu verweisen, z.B. S. 99. 109. 119. 122). Neu aber ist die Folgerichtigkeit, mit der hier die Möglichkeiten des Ansatzes ausgeschöpft werden. Es zeigt sich, daß die Methode, diszipliniert und maßvoll angewandt, auch im Falle weit zurückliegender Literaturen höchst förderlich für eine Vertiefung des Textverständnisses sein kann, und dies sogar in ausgesprochen dunklen Literatur,nischen', die gerade dem rezeptionsästhetischen Instrumentarium mit seiner Angewiesenheit auf historische Dokumentabilität wegen der nur schwer aufschließbaren Enge und Unbestimmtheit des vom Autor intendierten Hörerkreises wenig entgegenkommen (daß die primäre Kommunikationssituation z.B. der attischen Komödie dank deren enormem Öffentlichkeitsradius 338 leichter zu rekonstruieren I ist, liegt ja auf der Hand). R. ist sich dieser Schwierigkeiten (die sich z.B. der Kallinos-/Tyrtaios-Interpretation ganz ähnlich stellen 2 ) und der entsprechenden Unsicherheiten durchaus bewußt (sympathisch die kritische Selbstironie in Äußerungen wie: „daß also alles doch ganz anders war: wer könnte dies ausschließen?": 106). Aber er versteht die Unsicherheiten durch permanente Methodenreflexion zu mindern. Die Untersuchung ist zweigeteilt: Nach den methodologischen und forschungsgeschichtlichen Erörterungen der .Einleitung' (9-25) folgen als erster Hauptteil „Die geschichtlichen Voraussetzungen der Lyrik des Alkaios und ihre [d.h.: der Lyrik] Rezeption bis zum Ende des 5. Jh." (26-114), als zweiter Hauptteil .Einzelinterpretationen' (115-285). Eine neue Textkonstitution der Fr. 298 und 41/42 sowie die üblichen Register beschließen den Band. Unter Auswertung aller erreichbaren Sekundär-Informationen und deren Verbindung mit den impliziten Realitätsreflexen in den Alkaiosliedem selbst entwirft R. im ersten Teil ein geschlossenes und in den Hauptzügen überzeugendes Bild der Entstehungssituation der Gedichte und ihrer eigenen Stellung
Troja-Epik in den frühgriechischen Sagenbildern, in: Wort und Bild (Symposium Tübingen 1977), München (Fink) 1979, 279-296 (+Tafeln). 2 Vgl. Rez., Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Qias, bei Kallinos und Tyrtaios, München 1977 (Zetemata 66), 23.
Zu W. Röster, Dichter und Gruppe, München 1980
311
darin: Der kleine Stadtstaat Mytilene um 600 nach der tyrannoiden Entartung des Königtums der Penthiliden zum erbittert umkämpften Objekt rivalisierender Adelssippen und Adelsparteiungen - Hetairien - geworden und von rasch aufeinanderfolgenden Tyrannen-Herrschaften erschüttert (Megakles, Penthilos, Smerdis [?], Melanchros, Myrsilos), - der δάμος noch ohnmächtig und von Tyrannis-Aspiranten machtpolitisch ausgenutzt, - Alkaios selbst, zusammen mit seinem Bruder Antimenidas und (zunächst) mit Pittakos Führer einer ebenfalls die Macht erstrebenden Adelshetairie, - seine Lieder Appelle, Verwünschungen, Ermunterungen, Hoffnungen und Tröstungen an die Adresse eben dieser kleinen politischen Kampfgemeinschaft, die für ihre Mitglieder Lebens-Mittelpunkt war (mehr als die Familie), - die (schriftliche) Komposition der Lieder ganz auf den Vortrag bei den Zusammenkünften (Symposien) dieser Gemeinschaft abgestellt3, - das Lied infolgedessen vornehmlich Ausdruck der jeweiligen Gruppenlage und -Stimmung, keine individualistische ,Self-Expression'4, - an einen allgemeinen, auch nur gruppenüberschreitenden ,Dichterruhm' vom Liedverfasser daher nicht gedacht, - die Liedverbreitung zunächst mündlich, dann in Form von ,Commersbüchern' erfolgt, - die Tradierung schließlich von den Alexandrinern durch eigenständige Textrekonstruktion gesichert. Manches an diesen Thesen mag überzogen und einiges unwahrscheinlich sein. Zum Beispiel: Daß nicht jede Hetairie einen musisch so begabten Anführer hatte wie Alkaios, weiß der Dichter selbst (Fr. 72: in Pittakos' Hetairie gehe es kulturlos zu), seine Hetairoi wußten's natürlich auch, und daß deren Lob dann keinerlei Stolzgefühle und Ruhmeshoffnungen bei Alkaios ausgelöst haben sollte, das wäre fast unmenschlich (ganz abgesehen von der Allgegenwärtigkeit des Ruhmesgedankens als solchen in dieser noch so Homer-nahen Adelsgesellschaft), und wenn Alkaioslieder schon zu Lebzeiten des Dichters - wenn auch als Botschaft des Exilierten an die Rest-Hetairie - in Briefform durch fremde Hände über Land befördert wurden (Fr. 130 b, S. 272-285), ja sogar Alkaios selbst „Gedichte, die im Symposion zu Gehör gebracht worden waren, niederschrieb, um sie einem auswärtigen ξένος zuzusenden" (105), dann müßte unser Dichter schon erstaunlich lebensblind oder indolent gewesen sein, wenn er seine 3 Konstitutiv für diese Deutung sind jene häufigen Form-Elemente der alk. Gedichte, die einen bestimmten, nur den ersten Rezipienten sofort verständlichen .situativen Kontext' anzeigen: die 1. Pers. PI. (im echten ,Wir'-Sinn: ,Wir, diese Gruppe hier') und das konkret deiktische Dem.-Pron. (ζ. Β. τόδε τέμενος 121,1/2: .dieses Heiligtum hier'; τόνδε Ζόνυσσον 121,8/9: .diesen Dionysos hier'; τώργον τόδε 140,9: .dieses [uns allen hier bekannte] Unternehmen'). 4 Vgl. dazu Röslers Besprechung von O. Tsagarakis, Self-Expression in Early Greek Lyric ....Gnomon 52, 1980, 609-616.
312
Ein neues Alkaios-Buch
gefragten Lieder, die ihn einige Mühe gekostet hatten, lediglich den Zufälligkeiten mündlicher Verbreitung preisgegeben, womöglich gar die Blätter, auf die er 339 sie doch hingeschrieben, gelwissenhaft vernichtet hätte. Von einer (vielleicht auch nur wohlwollend .geduldeten') Art von .Publikation' parallel zum Anwachsen seines Bekanntheitsgrades, und erst recht von einer eigenhändigen Thesaurierung seiner Kreationen wird man bei Alkaios also wohl doch auszugehen haben 5 . Dementsprechend dürfte die Annahme, selbst bei der Abfassung von Schmähliedern gegen .Intimfeinde' (162) der Hetairie wie den abtrünnigen Pittakos (ζ. B. Fr. 70. 129) habe Alkaios mit der Möglichkeit einer Liedrezeption gerade auch im Kreise des Geschmähten nicht einmal gerechnet (183 m. Anm. 173), das Raffinement damaliger politischer Kampfmethoden unterschätzen6. Die durchaus richtige These, die (uns bekannten) Alkaioslieder seien primär Hetairie-bezogen, sollte nicht so weit gehen, jeglichen andersgerichteten Publikumsbezug der gesamten Alkaios-Produktion (deren ursprünglichen Umfang wir nicht einmal abschätzen können) a priori zu leugnen; davor sollte schon Fr. 74 warnen, dessen von einem Scholion berichtete Adressierung an ,die Mytilenäer' R. (S. 40 Anm.) wegzudeuten sucht. Trotz solcher aspektbedingter Überspitztheiten muß das Gesamturteil über diese Forschungsleistung entschieden positiv lauten. In den Einzelinterpretationen des zweiten Teiles hat R. mit scharfem Blick eine solche Fülle von Interpretationsfortschritten erzielt, daß sie hier nicht einmal aufgezählt werden können, und dafür, daß er diese Fortschritte durch mutigen Griff zu einer bisher in Gräzistenkreisen eher mißtrauisch betrachteten modernen literaturwissenschaftlichen Interpretationsmethode erzielt hat, sollten wir ihm besonders dankbar sein.
5 Vgl. die ausführliche Besprechung des Röslerschen Werkes durch H. Eisenberger, GGA 233, 1981, 24-38 (hier: 33). 6 Die Aufhellung der historischen Hintergründe ist überhaupt zu kurz gekommen; wie etwa eine Hetairie (wenigstens typologisch) .funktioniert' - eigentlich die zentrale Frage des ganzen Ansatzes - , wird nicht erörtert und bleibt offenbar auch R. (vgl. etwa Anm. 123 auf S. 160) weitgehend unklar; nützliche Ansätze zu einer Aufarbeitung dieses Komplexes jetzt bei J. Seibert, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griech. Geschichte, Darmstadt 1979.
Museum Helveticum 42, 1985, 67-94
Realität und Imagination Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied* I In einem kürzlich in den .Würzburger Jahrbüchern' (Bd. 9, 1983) erschienenen Aufsatz1 hat Wolfgang Rosier seine in dem Buch »Dichter und Gruppe' 2 vorgelegte , funktionsorientierte ' 3 Interpretation der frühgriechischen Lyrik weiter abzustützen versucht. Beweisziel ist hier - wie schon im genannten Alkaios-Buch, nur grundsätzlicher und detaillierter - , daß Deixis, wenn sie (in Form der verschiedenen .Zeigewörter': Demonstrativpronomina, Lokaladverbia, daneben Anreden usw.) in frühgriechischer Lyrik auftritt, dasjenige, worauf sie hinzeigt, nicht im Hinzeigen erst .erzeuge' (also in der Phantasie des Hörers erst entstehen lasse) - dies sei Kennzeichen erst der späteren Leselyrik - , sondern dem Hörer, in dessen realem Wahrnehmungsfeld sich die betreffenden Personen und Gegenstände im Augenblick des Liedvortrags konkret befänden, tatsächlich nur zeige. Um den Unterschied zwischen den beiden Zeige-Modi möglichst klar zu machen, zieht Rösler die Bühlersche Unterscheidung zwischen der konkreten .Demonstratio ad oculos' und der abstrakten (mentalen) .Deixis am Phantasma' heran. Richtig stellt er zunächst fest, daß Deixis in der frühgriechischen Lyrik, für sich betrachtet, nicht zu erkennen gebe, „ob das, worauf sie hindeutet, historische Realität gewesen oder ob - was a priori, blickt man über den Text nicht hinaus, genauso möglich erscheint - Fiktion vorliegt; oder in Bühlerscher Terminologie: ob es sich um ursprüngliche Demonstratio ad oculos oder schon von vornherein, d. h. bereits seitens des Autors, um Deixis am Phantasma handelt" * Zu den Hinweisen auf abgekürzt zitierte Literatur s. die Liste am Schluß des Artikels. 1 Über Deixis und einige Aspekte mündlichen und schriftlichen Stils in antiker Lyrik, WüJbb N. F. 9 (1983) 7-28. [Seine im folgenden kritisierte Position hat Rösler nach Erscheinen dieses Aufsatzes präzisiert und gegen Mißverständnissse abgesichert in GGA 237, 1985,149 Anm. 1]. 2 Dichter und Gruppe. Eine Untersuchung zu den Bedingungen und zur historischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel Alkaios, München 1980 (im folgenden zitiert als DuG). 3 Siehe bes. DuG 21 f.
314
Realität und Imagination
(17). Dieser korrekten Tatbestandsbeschreibung (in der nur das Kolon „blickt man über den Text nicht hinaus" stört, da es als objektive Bedingung hinstellt, was in Wahrheit Theoriebestandteil ist) folgt dann aber ein Satz, der zu jenen 68 Überspitzungen gehört, I die den Hauptgrund für die teilweise heftig ablehnenden Reaktionen4 auf Röslers gesamte an sich durchaus begrüßenswerte Fortführung der .pragmatischen' Richtung in der Lyrikdeutung (Gentiii und die Urbiner Lyrik-Forschungsgruppe5) bilden dürften: „Hierzu ist in diesem Aufsatz bereits eindeutig Stellung bezogen worden, und zwar zugunsten der zuerst bezeichneten Auffassung." Dieser Satz, so wie er dasteht, kann nicht anders verstanden werden (auch wenn er so rigoros vielleicht nicht gemeint sein sollte), als daß Rösler jede Deixis in frühgriechischer Lyrik (natürlich sofern sie nicht textimmanent anaphorisch oder textextern anaphorisch, also Erinnerbares heraufbeschwörend, ist) als Demonstratio ad oculos verstanden wissen will - ein Eindruck, den der nächste Satz noch weiter festigt, indem er diese Auffassung der Deixis in der frühgriechischen Lyrik als eine Erkenntnis erscheinen läßt, die erst „durch den Faktor Mündlichkeit und seine Implikationen" möglich geworden sei: „Doch wurde damit keineswegs eine Communis opinio wiederholt: Noch in der neueren Forschung zur frühen griechischen Lyrik, in der der Faktor Mündlichkeit und seine Implikationen noch allzuoft ausgeblendet werden, ist jene Alternative durchaus ungeklärt" (und in der Fußnote wird als Beleg vor allem auf Martin und Tsagarakis sowie auf Röslers Auseinandersetzung mit Tsagarakis im Gnomon 1980 verwiesen6; ob gerade diese Autoren repräsentativ für die „neuere Forschung zur frühen griechischen Lyrik" sind, bleibe dahingestellt). Im Gegensatz zu Rösler will mir scheinen, daß es kein Gewinn, sondern ein Unglück wäre, wenn die .realistische' Deixis-Auffassung zur communis opinio der Lyrikdeutung würde. Zunächst: Daß Deixis in der frühgriechischen Lyrik, soweit uns das die geringen Reste überhaupt beurteilen lassen, relativ häufiger in der Funktion von Demonstratio ad oculos auftritt als in der Lyrik späterer Literaturperioden, ist bekannt; bekannt ist spätestens seit dem Historismus auch der Grund dafür: der pragmatische Charakter weiter Teile der frühgriechischen Lyrik, d. h. ihre oft interpretationsentscheidende Eigenart, in sehr vielen Fällen 4 Siehe bes. die Rezensionen von Eisenberger in GGA 233 (1981) 24-38 und Geizer in Poetica 14 (1982) 321-332; auf einige Überspitztheiten habe auch ich selbst hingewiesen: Gymnasium 89 (1982) 337-339 [in diesem Band S. 309-312], ^ Consiglio Nazionale delle Ricerche: Gruppo di Ricerca per la Lirica Greca e la Metrica Greca e Latina, mit der Zeitschrift .Quaderni Urbinati', hrsg. von Gentili u. a. 6 H. Martin, Alcaeus, New York 1972; O. Tsagarakis, Self-Expression in Early Greek Lyric, Elegiac and Iambic Poetry, Wiesbaden 1977; W. Rösler in Gnomon 52 (1980) 609-616.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos
φαίνεται μοι κήνος-Lied
315
jedoch nicht immer! - konkrete (nicht imaginäre), anlaßgebundene, zweckbestimmte und singulare (also nicht auf Wiederholung angelegte) mündliche Anrede an ein konkretes (nicht imaginiertes) Publikum zu sein - eine Eigenart, die dieser Lyriktyp mit allen jenen Literaturtypen teilt, die eine Situation oder einen Sachverhalt nicht erzählen, sondern besprechen (also nicht erzählend erst konstituieren, sondern als bereits existenten und für das Publikum physisch wahrnehmbaren oder ihm erinnerlichen nur erörtern) I - Literaturtypen, in denen in- 69 folgedessen die Merkmale der in gewöhnlicher Alltagskommunikation üblichen direkten Rezeptionssteuerung (vor allem Stimmklang, Wort- und Satzbetonung, Gestik, Mimik, Deixis) breiten Raum einnehmen: Hierzu rechnen Teile der mimetischen Gattungen (besonders der attischen Komödie) ebenso wie Teile der rhetorischen Literatur (Gerichts-, Versammlungsreden). Daß diese Eigenart die frühgriechische Lyrik stärker prägt, als die nachhistoristische Lyrik-Interpretation der Gräzistik meist anzuerkennen bereit war, und daß sie daher bei der praktischen Deutungsarbeit künftig stärker berücksichtigt werden muß als bisher, ist ohne weiteres zuzugeben. Jedoch: Daß Deixis am Phantasma und damit Fiktion der frühgriechischen Lyrik noch fremd wären, also später erst hätten .entdeckt' werden müssen, daß demnach eine Entwicklungslinie „von der Rede über das Hier und Jetzt" (= frühgriechische Hörlyrik) „zur Fiktion" (= spätere Leselyrik) anzusetzen sei (28), das ist mit den Tatsachen nicht zu vereinbaren und muß als teleologisierende Konstruktion zurückgewiesen werden. Was dahintersteht, ist möglicherweise das bekannte, von der neueren Oral poetry-Forschung offenbar immer noch nicht genügend bekämpfte Vorurteil, was früh und mündlich ist, das sei identisch mit einfach, realistisch und konkret, das späte Schriftliche dagegen sei kompliziert, abstrakt und fiktiv. Das trifft in dieser Form, wie gleich zu zeigen sein wird, noch nicht einmal für mündlich abgefaßte, d. h. improvisierte Dichtung zu, für schriftlich abgefaßte und mündlich nur vorgetragene Dichtung (wie sie in der frühgriechischen Lyrik auch nach Röslers Meinung vorliegt), kann es erst recht nicht zutreffen. Die weitverbreitete Ansetzung eines Korresponsionsverhältnisses zwischen Mündlichkeit und Realismus (Konkretheit, Nicht-Fiktivität) ist ein Überbleibsel der Romantik. Weder ist Mündlichkeit notwendig mit Nicht-Fiktivität verknüpft noch Schriftlichkeit notwendig mit Fiktivität. Die Begriffspaare .Mündlichkeit/Schriftlichkeit' und ,Nicht-Fiktivität/Fiktivität' stehen in keinem kausalen Verhältnis zueinander. Dies zu erkennen reicht ein kurzer Blick auf die frühgriechische Literaturentwicklung im ganzen aus. Eine ausnahmslos .realistische' (situationsbezogene) Funktion der Zeigewörter in der frühgriechischen Lyrik wäre vor dem Hintergrund dieser Entwicklung unbegreiflich. Die frühgriechische Lyrik war im
316
Realität und Imagination
7./6. Jahrhundert als ,neue', schriftlich konzipierte Lyrik in einem Akt der Befreiung von Formel, Schema, Typik und Norm vornehmlich aus dem narrativen Epos herausgewachsen. Diese narrative Epik, mit der Verfasser wie Publikum eines frühen lyrischen Vortrags großgeworden waren, baute aber auf dem Fundament ausschließlich der Deixis am Phantasma auf, sie war ein einziges .Stellt euch vor!'. Vom Parisurteil auf dem Ida über das Schiffslager in Aulis bis zur Topographie des Stadt- und Kampfgeländes in der Troas, vom Kyklopen bis zur Zauberin Kirke, von Zeus und Hera auf dem Wolkenlager bis zu Apollons Schlag gegen Patroklos wurde ja im Epos unaufhörlich an die Imaginationskraft 70 des Hörers appelliert. Mit der Errichtung Trojas (Thebens I usw.) vor den geistigen Augen seines Publikums baute der epische Sänger bei jedem Vortrag aufs neue ein großes wohlorganisiertes imaginäres Zeigfeld auf, mit ,oben' und ,unten' (Olymp und Menschenwelt und Hades), mit .links' und .rechts' (in den Schlachtschilderungen der Ilias etwa), mit .Skaiischem Tor', ,Haus des Paris', ,Zelt des Achilleus' usw. - ein Zeigfeld, in das sich jeder Hörer entsprechend seiner individuellen Rekonstruktionskraft hineinzusehen und hineinzutasten hatte, darin in nichts vom modernen Leser unterschieden. Weder konnte ja der Sänger gemeinsame .Erinnerung' reaktivieren (niemand, weder er noch seine Hörer, war dabeigewesen), noch konnte er direkte »Aktualisierung'7 evozieren (denn Dimensionen wie die geschilderten waren ihm selbst wie seinem Publikum empirisch unbekannt). Das raumzeitliche Koordinatensystem seiner Erzählung mußte also vom Sänger .fingiert' und von seinen Hörern dementsprechend .rekonstruiert' werden (ebenso wie der Handlungsgang im einzelnen, die Charaktere der Figuren usw.). Das hohe Maß an imaginativer Responsion, das dadurch dem Hörer eines Epenvortrags abverlangt wurde, war selbstverständlicher Teil der Rezeption. Es schloß den Nachvollzug sogar mehrerer übereinandergetürmter Fiktionsschichten ein - etwa wenn der Sänger erzählt, wie Odysseus erzählt, wie der Kyklop erzählt, wie Telemos erzählt, daß einst ein Odysseus den Kyklopen blenden werde (Od. 9,507-512) - , und es Schloß damit zugleich innerhalb dieser je sekundären, tertiären usw. Fiktionsschicht auch wieder ein quasi-konkretes Hinzeigen fiktiver Figuren auf andere fiktive Figuren mittels sprachlich durch Zeigewörter signalisierter fiktiver Zeigegesten ein (also eine »sekundäre',,tertiäre' usw. Demonstratio ad oculos, z.B.: der Sänger imaginiert, wie Diomedes seinen Gefährten den Ares zeigt, der Hektor begleitet: καί νυν oi πάρα κείνος "Αρης „auch jetzt ist wieder jener Ares dort bei ihm", E 604).
7
Zu .Erinnerung', .Aktualisierung' und .Rekonstruktion' s. Rösler, Deixis-Aufsatz 15-20.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
317
Dieser kurze Rückblick auf das Epos zeigt: Wenn Deixis in der frühen griechischen Lyrik tatsächlich nur als konkretes Hindeuten auf das im Augenblick des Liedvortrags je Sicht- und Hörbare (und allenfalls noch auf das den Anwesenden Erinnerliche) aufgetreten wäre, so hätte das Publikum dies als Verkürzung der Wortkunst um eine ganze Dimension und damit als künstlerischen Rückschritt empfinden müssen (vom Künstler selbst, der sich .verkrüppelt' hätte, gar nicht erst zu reden). In Wahrheit liegt die Sache natürlich so, daß die neue Lyrik für das Publikum (wie für den Künstler) auch in diesem Punkte eine Erweiterung und Bereicherung der bis dahin erreichten literarischen Möglichkeiten brachte: Im Epos hatten nur Deixis am Phantasma und Fiktion geherrscht (die Gegenwart blieb ausgeklammert), die Lyrik bringt jetzt mit dem konkreten Gegenwartsbezug die Demonstratio ad oculos hinzu. Für den Hörer ändert sich dadurch nun allerdings die Rezeptionssituation im Bereich der literarischen Deixis einschneidend: Als Lyrik-Hörer gerät er in einen I Entscheidungszwang, 71 den er als Epos-Hörer nicht gekannt hatte: Bei jeder sprachlichen Deixis-Form, die er hört, muß er entscheiden, welche der beiden Deixis-Grundmöglichkeiten gemeint ist, d. h. er muß die in der Lyrik doppeldeutig gewordenen sprachlichen Zeigegesten jeweils (von Fall zu Fall) durch Kombination aller textlichen und außertextlichen Daten einer der beiden Deixis-Grundmöglichkeiten zuordnen. Die gleiche Aufgabe stellt sich uns. Bei jedem Demonstrativpronomen, bei jedem deiktischen Zeit- bzw. Ortsadverb, bei jeder Anrede usw., die in frühgriechisch-lyrischen Kunstwerken erscheinen, müssen wir von neuem fragen und entscheiden, ob ein solches Element (a) textimmanent anaphorisch, (b) textextern anaphorisch (d. h. an voraussetzbares außertextliches Wissen erinnernd), (c) fingierend oder (d) konkret hindeutend ist. Dieser Entscheidungspflicht können wir uns nicht durch den Hinweis auf den erfahrungsgemäß überwiegend realistischen, situationsbezogenen Charakter der frühgriechischen Lyrik entziehen. Wir haben vielmehr davon auszugehen, daß die Proportionen der oben mit a-d bezeichneten Deixis-Funktionstypen zueinander von lyrischem Dichter zu lyrischem Dichter verschieden sind: Bei dem einen steht mehr das Praktische, die unmittelbare Bewirkungsabsicht im Vordergrund (so bei der militärisch-politischen Appelldichtung eines Kallinos oder Tyrtaios) - dann überwiegt natürlich der .realistische' Typ (d) - , bei einem anderen (so etwa bei Sappho) spielen Erinnerung, Vorstellung, Träumen, Reflektieren eine gewichtige Rolle - dann nimmt Typ (c) mehr Raum ein. Daran zeigt sich nebenbei erneut, daß nicht die Mündlichkeit der frühgriechischen Lyrikdarbietung für die Konkretheit ihrer Deixis-Verwendung verantwortlich ist, sondern ihre Situationsbezogenheit (deren Grad je nach Lebensform und Themenwahl des Dichters variieren kann).
318
Realität und Imagination
Wer wie Rosier vom Œuvre nur eines dieser Lyriker ausgeht, der gerät leicht in die Gefahr, die dort angetroffenen Proportionen zu generalisieren, d. h. sie für die Proportionen der frühgriechischen Lyrik insgesamt zu nehmen. Rosier geht von Alkaios aus. Alkaios war ein politischer Dichter. Sein Leben war geprägt vom politischen Kampf. Die Plattform dieses Kampfes war die Gesinnungsgruppe (Hetairie). Mit ihr ging Alkaios ins Exil, mit ihr bereitete er die Rückkehr an die Macht vor, usw. Wo eine solche Gegenwart zum Lied wird, herrschen natürlich Lage-Analyse, Appell, Warnung, Beschwörung und ähnliche stark präsentische und direkt-kommunikative Redeformen vor (sind aber selbst hier, wie gleich zu zeigen sein wird, nicht exklusiv). Dies ist nicht Ausdruck einer Wesenseigentümlichkeit der literarischen Gattung, deren Alkaios sich bedient, sondern Reflex seiner Lebensform. Bei anderen Vertretern der frühgriechischen Lyrik, die andere Lebensformen pflogen, treten andere Redeformen in den Vordergrund: Vorstellung, Schilderung, Erlebnisbewältigung, Selbstermutigung u. ä. Sobald aber diese Redeformen erscheinen, tritt Deiktisches in ihnen 72 natürlich häufiger auch als Deixis am Phantasma auf. I Hier wird nun die Frage der theoretischen Vorgeprägtheit des Interpreten relevant. Ist ein Interpret auf .realistische' Auffassung der Deixis eingeschworen, wird er geneigt sein, einem Sprachkunstwerk, das sein eigenes Zeigfeld erst konstituiert, ein reales oder gar historisches Zeigfeld zu unterlegen und für ein solches Lied, das sich seinen eigenen Fiktionsraum schafft, nach einem realen Raum zu suchen, in den es mit allen seinen scheinbar konkreten Referenzsignalen ,hineinpaßt'. Das muß dann zu falschen, ja zu lächerlichen Deutungen führen. Rosier kennt diese Gefahr selbst. Er weiß auch, daß sie durchaus nicht nur in der Lyrik der Lesekultur auftritt, sondern ebenso in der Lyrik der frühgriechischen Hörkultur. Er zitiert nicht nur die erstaunte Philologenfrage zu Catulls Phasellus-Gedicht, „wie denn Catull sein altersschwaches Boot vom Meer in den heimatlichen Gardasee überführt habe" 8 , sondern er sieht auch klar, daß sich bei Alk. Fr. 6 - einem Lied, das extrem deiktisch beginnt mit Τόδ' αΰτε κΰμα τώ προτέρω 'νέμω / στείχει ,Da kommt schon wieder eine Woge, die vom vergangenen Sturm herrührt' „ein »realistisches* Verständnis der gegenwartsbezogenen Aussagen [...] nur unter der absurden Voraussetzung durchhalten (ließe), Alkaios habe den Text auf einem von der unruhigen See bedrohten Schiff vorgetragen"9. Man ist versucht hinzuzusetzen: Und er müßte dann das Lied - falls er es nicht auf der Reling sitzend improvisierte - schon vorher in Erwartung genau dieser Sturm-AVogensi8 9
Deixis-Aufsatz 24 Anm. 39. DuG 128.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
319
tuation komponiert und, als der Fall dann wirklich eintrat, beglückt aus der Tasche gezogen haben. (Wobei die Ironisierung ein Kardinalproblem der ganzen .pragmatischen' Lyrikdeutung aufdeckt, dem hier leider nicht weiter nachgegangen werden kann; wenn ζ. B. Alk. Fr. 338 "Τει μέν ό Ζευς ,Da regnet es ... ' wirklich, wie Rosier meint, nur für den Augenblick verfaßt war, in dem die Gemeinschaft die in diesem Lied besprochene Realität tatsächlich so erlebte 10 wie lange hat Alkaios dann mit dem fertigen Lied ,abrufbereit' auf eben diese Situation gewartet?) Bereits dieser eine Fall sollte eigentlich zeigen können, daß natürlich auch ein frühgriechischer Lyriker - ebenso wie der frühgriechische Epiker - sein Publikum zur Rekonstruktion soeben erst von ihm fingierter Situationen nötigen kann und daß der Vorsprung des primären Publikums uns gegenüber in Fällen dieser Art sich stark verringert - er mißt dann nur gerade so viel, wie die Spanne zwischen Zeitgenossenschaft und Nachwelt stets beträgt. Immerhin könnte der Schlußfolgerung, Deixis in frühgriechischer Lyrik müsse also nicht eo ipso Demonstratio ad oculos sein, gerade in diesem Falle - Alk. Fr. 6 - noch durch den Hinweis auf die allegorische Bedeutung von τόδε κΰμα begegnet werden; zwar wird mit τόδε κΰμα nicht auf eine reale Meereswoge hingeldeutet, aber doch auf etwas Reales, „was mit ,der Woge' und den anderen 73 maritimen Details gemeint war" und „den έτάΐροι [...] selbstverständlich sofort bewußt (wurde)" (DuG 130); ob das Hindeuten auf etwas, was den Hörern erst im Moment der Perzeption des Deuteworts „bewußt" wird, wirklich noch Demonstratio ad oculos und nicht vielmehr schon eine Form von Deixis am Phantasma ist (Erzeugung einer Vorstellung von physisch nicht Wahrnehmbarem; vgl. Rosier selbst, DuG 120: Allegorie ist „Präsentation einer fiktiven, zur realen Lage aber analogen Situation"), mag in einem solchen besonderen Fall noch diskutierbar sein. Nicht mehr diskutierbar aber ist ein Fall wie Alk. Fr. 130 b, ein Lied, das Alkaios nach Röslers eigener Deutung aus einsamem Exil in einem Tempelheiligtum als „poetischen Brief' (DuG 275) an seine in der Ferne weilenden έταΐροι schickt, um ihnen „Informationen [...] über seinen augenblicklichen Aufenthaltsort und die dort herrschenden Lebensbedingungen" (277) zukommen zu lassen, Informationen, die sie „in den Stand setzten, sich die Situation des Dichters aus der Ferne zu vergegenwärtigen" (277) - und solche Briefe entsprechen einer zu Alkaios' Zeit bereits „selbstverständlichen Praxis poetischer Epistolographie" (274). - Epistolographie wurde erfunden, um eine zur
10 DuG 251: „Alkaios [...] gab" (sc. in diesem Lied) „die Realität wieder, wie sie die Gemeinschaft in diesem Augenblick (für ihn war das Lied ja verfaßt) erlebte." (Hervorhebung von mir.)
320
Realität und Imagination
Zeit unmögliche Demonstratio ad oculos durch Deixis am Phantasma zu ersetzen. Wenn also Alkaios in diesem Lied Zeigewörter verwendet (V. 9/10 ώς δ' Όνυμακλεης / çv0a [δ'] çloç έοίκησα ,und wie Onymaklees hab' ich mich hier einsam niedergelassen'), so deutet er mit ihnen stets auf etwas hin, was die Adressaten im Augenblick der Perzeption vermittels dieser Zeigewörter in ihrer Vorstellung erst generieren müssen. Dies sind Belege für Deixis am Phantasma aus Alkaios. Belege aus anderen frühgriechischen Lyrikern, deren Denken weniger auf Wirksamkeit und Tat gerichtet war, brauchen danach wohl kaum noch vorgeführt zu werden (an die zahlreichen Fälle von Anrede und Deixis in Sappho-Liedem, die Vergangenes und/oder Vorgestelltes illusionieren - etwa die Götterhochzeit Fr. 141, Aphrodites Sperlingswagenfahrt und Dialog mit Sappho Fr. 1, das Gespräch mit Hermes Fr. 75, die Zwiesprache mit dem Traum Fr. 63, eine Traummitteilung an Aphrodite Fr. 134 - sei hier nur erinnert; wir kommen darauf zurück). Daß Deixis in der frühgriechischen Lyrik grundsätzlich nicht funktional ein-, sondern mehrdeutig ist, hat danach Ausgangspunkt der Interpretation zu bleiben. Ferner ist festzuhalten, daß denjenigen Fällen, in denen ein deiktisches Sprachelement mit hoher Wahrscheinlichkeit in der ursprünglichen Darbietungssituation als Demonstratio ad oculos fungiert hat (ihr Prozentsatz scheint mir von Rosier überschätzt zu sein; vielfach ist Sicherheit gar nicht zu gewinnen), so viele Fälle von bereits ursprünglicher Deixis am Phantasma gegenüberstehen, daß eine verallgemeinernde Theorie der abendländischen Lyrik-Entwicklung, die allein auf dem natürlichen Funktionswandel ursprünglicher Demonstratio ad oculos im Zuge zeit- und/oder ortsversetzter Rezeption aufbaut und daher das 74 Idealbild einer sauberen Entwicklung ,vom planen I Realismus zur Fiktion' erzeugt (so bes. S. 26), den Tatsachen nicht gerecht werden kann. II Wie sehr die Verallgemeinerung der .Demonstratio ad oculos- und RealismusThese' den Blick für die Tiefendimension und die eigentliche Aussageabsicht frühgriechischer Lyrik zu verstellen vermag, das kann besonders gut Sapphos berühmtes φαίνεται μοι κήνος-Lied zeigen. Auf den ersten Blick scheint das Lied die optimale Stütze der RealismusThese zu sein: (1) Es beginnt extrem deiktisch φαίνεται μοι κήνος 'ίσος θέοισιν / εμμεν' ώνηρ, οττις ένάντιός τοι..., und diese Deixis scheint vollkommen konkret (als Zeigegestik auf eine synchrone Realsituation) verstanden werden zu müssen, (2) es scheint tatsächlich eine nur „restringierte Entfaltung des voraus-
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
321
gesetzten Wissens- und Wahrnehmungshorizonts"11 zu bieten; denn wo, wann und mit welchen Beteiligten die besprochene Situation historisch .stattfand', wird nicht gesagt (und kann auch im verlorenen Schlußteil mit seiner Rückwendung auf die Sprecherin kaum gesagt gewesen sein), wird also, wie es scheint, bei einem primären Publikum als unmittelbar sieht- und hörbar vorausgesetzt; nur wir, das sekundäre Publikum, so scheint es, müssen uns die damalige Realsituation in einem mühsamen Puzzlespiel zu rekonstruieren suchen. Danach scheint dieses Lied geradezu prädestiniert, die Argumentation der Realismus-These als Paradebeispiel zu stützen. Wenn es dennoch bisher in dieser .Kronzeugen'-Funktion noch nicht herangezogen worden ist, dann wird das daran liegen, daß bei diesem Lied schon im Jahre 1913 genau die Deutung vorgelegt worden ist, die eigentlich erst auf Grund der neuen .funktionsorientierten' Theorie hätte möglich werden dürfen: „Fassen wir doch die Dinge so concret, so real, wie sie sich darstellen. Da sitzt der Mann, da sitzt Agaiiis12, da kommen die Gäste und gratulieren" usw. Das war bekanntlich nicht die Deutung eines Außenseiters, sondern die für die damalige Lyrik-Auffassung repräsentative und noch auf Jahrzehnte hinaus .verbindliche' Deutung von Wilamowitz. Wer bei Wilamowitz weiterliest, sieht überdies sofort, daß kaum ein Postulat der neuen Theorie dort nicht schon erfüllt ist: Der im Lied selbst anscheinend nur .restringiert entfaltete vorausgesetzte Wissens- und Wahrnehmungshorizont' wird in Hinsicht auf Zeit, Ort, Art des Publikums, Vorwissen und Erwartungshaltung des Publikums usw. geradezu vorbildlich rekonstruiert: „[...] daß die Dichterin, aus deren Chor die Braut nun ausscheidet, mit I ihrer Kunst das Fest 75 verherrlichen wird, hat jeder erwartet, hat etwas besonderes erwartet, denn er wußte, daß Sappho für diese Schülerin besonders heiß fühlte" usw. 1 3 : ,funktionsorientierte' Interpretation im besten Wortsinn - nur eben avant la lettre. Verständlich also, daß dieses Sappho-Lied mit seiner Interpretationsgeschichte von der neuen Lyrik-Theorie bisher nicht gerade in den Vordergrund gerückt wurde. Daß es freilich von dieser Theorie im prinzipiell gleichen .realistischen' Sinn gedeutet werden muß, versteht sich von selbst; mehrere bei aller Knappheit unmißverständliche Bemerkungen in Röslers Alkaios-Buch lassen das zweifelsfrei erkennen; wir zitieren hier nur die Äußerung, daß „der Beginn von Sappho Fr. 31 (Verhältnis von κήνος und Relativsatz) genauestens 11
Rosier, Deixis-Aufsatz 14. , Agallis', von Paton ersonnen und von Wilamowitz kraft seiner Autorität als ursprüngliche Adressatin dieses Lieds in der gesamten gebildeten Welt eingebürgert, ist erst 1965 durch den berühmten Papyrusfund (Nr. 213 Β Voigt) verschwunden. 13 Sappho und Simonides 58. 12
322
76
Realität und Imagination
übereinstimmt" mit der Struktur von Alk. Fr. 129,14, wo κήνων zu verstehen sei „als Geste, mit der [...] von der Textebene weg auf einen Autor wie Publikum gleichermaßen bekannten Aspekt der Realität Bezug genommen wird" (DuG 200), und wer noch zweifelt - weil κήνων in dem strukturell verglichenen Alkaios-Fragment ja offensichtlich auf einen vergangenen „bekannten Aspekt der Realität" Bezug nimmt (meint also Rosier, auch das κήνος im Sappho-Lied nehme auf einen gewissermaßen vergangenen' realen ,Mann' Bezug?) - , der gewinnt völlige Gewißheit durch die auf Sappho 31 gemünzte Anmerkung zu dem „[...] expliziten Gegenwartsbezug lyrischer Dichtung, wie er ganz elementar in der Verwendung präsentischer Verbformen zum Ausdruck kommt", ein Gegenwartsbezug, den „als fiktiv zu erklären" (wie H. Fränkel es tut) „jede Einsicht in den spezifischen Funktionszusammenhang früher Lyrik und ihren fundamentalen Unterschied gegenüber dem Epos (eben .Besprechung' statt .Erzählung') ein für allemal verbaut" (DuG 157 Anm. 113). Damit ist deutlich genug gesagt, daß Rosier implizit von der gleichen Deutung - „so concret, so real" - ausgeht wie seinerzeit Wilamowitz. Solange eine explizite Interpretation des Lieds aus seiner Feder noch nicht vorliegt, wollen wir uns zwar hüten, vorweg zu urteilen oder zu polemisieren; so viel aber dürfen wir wohl jetzt schon sagen: Eine etwaige Wiederbelebung der „so concreten, so realen" Hochzeitslied-Deutung, wie sie damals Wilamowitz vorgelegt hat, würde einen eklatanten Rückschritt im Verständnis dieses Lieds bedeuten. Denn die Wilamowitzsche Hochzeitslied-These ist - wie vornehmlich Setti und Page gezeigt haben - beim besten Willen nicht zu halten. Der Grund dafür liegt aber nicht im Äußeren nicht in der SpezialSituation .Hochzeit' etwa (dann ginge es nur um Variantenfindung - .Verlobung' z. B., oder .Rendezvous') - , der Grund liegt tiefer; er liegt in der Unmöglichkeit der .realistischen' Deutungsweise an sich: Gerade dieser realistischen Deutungsweise, der es doch mit seinen massiven Referenzsignalen so ungewöhnlich gut entgegenzukommen scheint, hat sich dieses Lied von Anfang an widersetzt. Je konkreter, greifbarer, praller die Situationen wurden, die man dem Liede unterschob, desto widerborstiger wußte es sich einem wirklich befriedigenden I Verständnis zu entziehen. Das läßt sich nur als Indiz darauf verstehen (und auch das ist längst vermutet worden14), daß gerade bei diesem vermeintlich so ungeheuer .konkreten' (.concreten') Lied die konkrete
„Es scheint aber, daß jede zu spezielle Heranziehung des .Konkreten', wie man es nennt, bei dieser Dichterin doch mehr vergröbert als klärt. Dinge, die vielleicht am Rande mitgehen, rücken ins Zentrum der Dichtung, und auf Gelegenheit und äußere Umstände wird abgeschoben, was vielmehr Sapphos eigenste Art ist": Schadewaldt 1936, 362 (= HuH 2 134).
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
323
Auffassung die in Wahrheit falsche ist. Das scheinbar schlagendste Exempel für den .expliziten Gegenwartsbezug' frühgriechischer Lyrik, der Eingang von Sapphos φαίνεται μοι κήνος - in Wahrheit ein Fallstrick für die ganze Theorie? III Sämtliche vorgelegten Deutungen des Lieds zu überschauen dürfte unmöglich sein; es sind ja nicht nur die expliziten Interpretationsversuche zu berücksichtigen; Erstaunliches, nicht selten Originelles bieten auch Bücher und Arbeiten anderer Themenstellung (insbesondere Arbeiten zu Catull c. 51), Literaturgeschichten, Gesamtdarstellungen der griechischen Kultur, daneben vielfach auch noch die Lyrik-Kapitel germanistischer Handbücher, und auch die Medizin, die Psychologie, nicht zu vergessen die Psychoanalyse, haben sich herausgefordert gefühlt. Bei aller Fülle scheint es aber doch so, als ob es nur zwei Grundvarianten der Deutung wären, die immer wieder neu - oft mit eindrucksvollem Ideenreichtum - umspielt werden (von Kuriosa - etwa: Sappho liebt den άνήρ 15 ; Sappho schildert sich in der Situation einer , Voyeuse' 16 ; Sappho vergeht vor Eifersucht, weil nicht sie selbst, sondern das Mädchen heiratet 17 , u.ä. - sehen wir ab): (1) Das Lied ist ein öffentliches Hochzeits-(Verlobungs-)Lied, abgefaßt vor der Hochzeit für die Hochzeit und vorgetragen bei der Hochzeit (als ,Festlied', .Glückwunsch' o. ä.), adressiert an die Braut (die von Sappho geliebt wird), aber mitbestimmt natürlich für die Ohren der Festteilnehmer. - Diese Deutung wird vertreten von Wilamowitz 1913, Snell 1931, Schadewaldt 1936 und 1950, H. Fränkel 1951 (1962. 1969), Treu 1955 (1958. 5 1976 u. ö.) und von vielen anderen. (2) Das Lied ist das Dokument einer Selbsterfahrung beim Anblick des zutunlichen Zusammenseins eines von Sappho geliebten Mädchens mit einem jungen Mann bei beliebiger Gelegenheit (Hochzeit - eigene oder fremde - , aber auch sozusagen .Rendezvous auf der Gartenmauer'), abgefaßt nach dem (realen) Erlebnis einer solchen Szene (oder mehrerer solcher Szenen) I und vorgetragen am ehesten vor dem Mädchenkreis (in dem sich mögli- 77 cherweise auch das im Lied angeredete Mädchen befand). - Diese Deutung 15
A. J. Beattie, Sappho fr. 31, Mnemosyne 4 (1956) 103-111. R. O. Evans, Remarks on Sappho's ,Phainetai moi', Studium Generale 22 (1969) 1016-
1025. O. Tsagarakis, Some neglected aspects of love in Sappho's Fr. 31 L.-P., Rh. Mus. 122 (1979) 97-118. (Dagegen Bremer 1982.)
324
Realität und Imagination
wird vertreten von H. Frankel 1924 (= 1955. 1960. 1968 [S. 43]), Page 1955 (bis 1983), Snell 1966 (S. 97), Privitera 1969 (.innerer Monolog'), West 1970 (den Mädchen vorgesungen, aber eigentlich für die Nachwelt abgefaßt: „she wrote it down for posterity"), McEvilley 1978 (Parodie auf Auftrags-Hochzeitslieder; Sapphos wahre Empfindungen bei Hochzeiten ihrer Mädchen) und von vielen anderen. Daß die erste dieser beiden Deutungsvarianten (.offizielles Festlied') nicht zu halten ist, hat Page (nach Setti) durch scharfe Formulierung der Unannehmbarkeit ihrer wirkungsästhetischen Implikationen gezeigt: „It is now to be restated simply that this poem contains no mention of, or allusion to, a bride or bridegroom or wedding or ceremony of any kind. It is indeed a comfort to be rid of such a misconception. For what sort of wedding-song would this appear to bride and bridegroom - this unabashed recital, not of the merits of the groom and virtues of the bride, but of the intensity of physical passion which overwhelms Sappho when she looks but a moment at the .bride'? What will the ,bridegroom' make of it? With what pleasure will they listen, ,father and weddingguests', to this revelation of Sappho's uncontrollable ecstasy, this confession that she cannot speak, that her ears are humming, that her eyes are blinded, that her flesh is smitten as with a fever, that sweat pours down her, and that she feels next-door to death?" Und Page schließt feierlich: „There was never such a wedding-song in the history of society; and there should never have been such a theory in the history of scholarship." (Sappho and Alcaeus 32 f.)
Unter dem Eindruck dieses Appells an das natürliche Gefühl für menschlich Mögliches und Unzumutbares haben selbst beredteste Verfechter der ersten Deutungsvariante wie Snell (1931:,.Dadurch läßt sich [...] noch strikter erweisen, daß wir wirklich, wie Wilamowitz meint, ein Hochzeitslied vor uns haben") ihre Meinung aufgegeben (1966, S. 97: „[...] möchte ich heute doch nicht mehr annehmen, daß es bei der Hochzeit gesungen sein müßte"). Dabei hatte Page Unzumutbares nur für Braut und Bräutigam, Brauteltern und Festversammlung im Sinn. Noch unzumutbarer aber wäre ja die Situation für Sappho selbst: Was sie da singt, ist ja persönlichstes Bekenntnis (konventionelle Schönheitspreisung, wie man die tonlose Selbstdiagnose genannt hat, hat einen anderen Klang); soll ein Bekenntnis dieser Art, das Nähe, Intimität des Sprechens und des Hörens voraussetzt, tatsächlich - wie ein real verstandenes κήνος jener dort drüben' (also ein relativ weit Entfernter, nicht οδε oder οΰτος!) es dem griechischen Ohr unweigerlich signalisieren würde - gewissermaßen über die ganze Länge der Hochzeitstafel hinweggesungen sein, als festliche Proklamation? Das alles ist ganz unerträglich - nicht, weil es uns nicht paßt, sondern weil es nicht zu Sappho paßt.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos
φαίνεται μοι κήνος-L/ed
325
Es bleibt die zweite Deutungsvariante: „This is a poem sung by Sappho to her friends; its subject is the emotion which overwhelms her when she sees a beloved girl enjoying the company of a man"! (und dann: „Only for one generation in 2.500 years has it ever been mistaken for anything else": Page 33). I Eine 78 reale Beobachtung Sapphos wäre auch bei dieser Deutung das Motiv der Liedentstehung, doch wäre sie im Lied nicht als zeitgleich mit dem Liedvortrag fingiert, sondern als zeitlich schon zurückliegend vorausgesetzt; das Präsens wäre gerade nicht Ausdruck eines .expliziten Gegenwartsbezugs', sondern als Tempus des Besprechens, das keine Zeitstufe, sondern eine Sprechhaltung anzeigt (das alles hat H. Weinrich dargelegt18), Ausdruck der äußersten .Gespanntheit', mittels dessen das Erlebnis, das für Sappho nur physikalische, nicht seelische Vergangenheit ist, ,ver-gegenwärtigt' würde - vergegenwärtigt für Sappho selbst wie vielleicht auch für das angeredete Mädchen und für das möglicherweise vorhandene Publikum. Diese Funktion des Präsens - die ja, wie Weinrich durch seine systematischen Untersuchungen verständlich gemacht hat, für die .besprechenden' literarischen Gattungen wie Drama, biographischer Essay, literarische Kritik, philosophische Abhandlung und eben gerade auch für die Lyrik signifikant ist 19 - würde vom Publikum auf Grund der realen Evidenz - ein .jener Mann dort drüben', der einem Mädchen .gegenübersäße', wäre ja physisch im Augenblick des Liedvortrags nicht wahrnehmbar - augenblicklich verstanden, die Situation des Tête-à-tête, durch das Lied von Sappho imaginiert, würde von den Hörern - ob damals etwa Mitzeuge oder nicht - in eben der Beleuchtung, die Sapphos Worte schüfen, augenblicklich (vom einen einfühlsamer, vom anderen gröber - wie üblich) .rekonstruiert': Deixis am Phantasma, Fiktion. Der Sinn des Liedes könnte dann sein: äußerste Komprimierung und Zuspitzung des Schmerzlichen, um wieder zu sich selbst zurückzufinden („Doch alles kann ertragen werden ..."); das Publikum wäre nur Zeuge eines Vorgangs der persönlichen Erlebnisverarbeitung und -bewältigung, und selbst das in dem Liede angeredete Mädchen, falls es beim Liedvortrag anwesend wäre, könnte sich nur noch als in die Tatenlosigkeit geworfene Zeugin eines im Augenblick des Liedvortrags endgültig werdenden Rückzugs in die unter Qualen wiedergewonnene Unabhängigkeit empfinden. Daß diese Deutungsvariante zu jedenfalls sinnvolleren Verstehensmöglichkeiten führen kann als die erste, dürfte außer Frage stehen. Die Entscheidung über die Funktion der Deixis am Anfang dieses Liedes und damit über Realität oder
19
H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 2 1971. Weinrich 41 f.
326
Realität und Imagination
Fiktivität der sprachlich dargestellten Eingangssituation des Liedes wäre also wenn man diese zweite Deutungsvariante akzeptiert - bereits hier gefallen, und zwar zugunsten von Deixis am Phantasma und Fiktivität. Damit wäre auch das Beharren auf der angeblich durchgängigen Situationsbezogenheit frühgriechischer Lyrikdarbietungen nicht mehr möglich. Das wiederum würde bedeuten: Die These von dem angeblich in jedem Falle umfassenderen Wissens- und Wahrnehmungsvorsprung des primären Publikums eines frühgriechischen Lied79 vortrage gegenüber jedem sekundären Publikum I wäre nicht mehr zu halten. Denn: Ein primäres Publikum, das sich die Eingangssituation dieses Lieds (ein junges Mädchen und ein junger Mann tief ineinander versunken, und die Vortragende schmerzlich von fern beobachtend) im Augenblick des Liedvortrags rezipierend erst vorzustellen hätte, wäre jedem sekundären Publikum, also auch uns, im Kern um nichts voraus. Der übersteigerte Geltungsanspruch der neuen Deixis-These wäre damit reduziert, das Beweisziel der vorliegenden Untersuchung erreicht. Dieses Ergebnis vermag jedoch inzwischen nicht mehr zu befriedigen. Im Überdenken der Deixis-These hat sich die ursprüngliche Fragestellung verschoben. Das Sappho-Lied, das ursprünglich nur als Prüfstein dienen sollte, hat sich als das eigentliche Problem enthüllt. Denn auch die zweite Deutungsvariante wenngleich der ersten deutlich überlegen - befriedigt nicht. Der erste Grund (für sich allein genommen allerdings kaum ausreichend) ist, daß diese Deutung Sappho zu viel ,moderne' Technik zumutet. Moderne Lyrik (wie übrigens auch Epik; den Extremfall bildet Werfeis ,Lied von Bernadette') kann auch Vergangenes im Präsens .erzählen'; Sappho jedoch verfügt - soweit wir sehen - über diese Technik sonst (noch) nicht. Vergangenes wird bei ihr tatsächlich mit den präteritalen Verbformen, den Tempora der .erzählten Welt' dar- und vorgestellt - und diese präteritalen Formen sind bei ihr besonders häufig. Das Stilmittel des Gespanntheit erzeugenden ,Erzählpräsens' (oder .lyrischen Präsens') hat sie soweit ersichtlich - sonst nirgends. Präsens bedeutet bei ihr Besprechung von entweder tatsächlich im Zeitpunkt des Liedvortrags (noch) Gegenwärtigem oder - und das führt uns auf den zweiten Grund, der mir entscheidend scheint - von im Zeitpunkt des Liedvortrags wenigstens als gegenwärtig Vorstellbarem. Das φαίνεται μοι κήνος-Lied ist Anrede an ein Mädchen und gehört damit zum Liedtyp .Anrede, Ansprache an einen Adressaten'. Solche Ansprachen mögen in manchen Fällen real sein; Fr. 96 (an Atthis), Fr. 98 b (an die Tochter Kleis) sind neben manchen anderen vielleicht so vorzustellen. Andere solcher Ansprachen sind deutlich fingiert, so wie die „Zwiesprache" mit dem Traum, Όνοιρος (Fr. 63), die, wie Treu 205 sagt, anscheinend „eine Antwort weder er-
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
327
wartet noch erhält". Im Augenblick des Liedvortrags ist der Traum, der angeredet wird, natürlich nicht wahrnehmbar, das Lied fingiert ihn, macht ihn lebendig, macht ihn für die Dauer des Liedvortrags zum Teilnehmer der Kommunikationssituation zwischen der Vortragenden und ihrem Publikum. Im Falle des Aphrodite-Gebets Fr. 1 ist es ebenso: Das Lied bringt die Göttin ,zur Existenz' (und damit die Liebe, um deren Entzündung es bittet). Und die namenlose Konkurrentin, an die nach ihrem Tode, weil sie an Pieriens Rosen keinen Anteil hat, niemand mehr sich erinnern wird (Fr. 55), wird wohl ebenfalls im Lied in den Sappho-Kreis als Gegenbild nur hineinbeschworen; daß Sappho sie mit diesem Liede ganz real tatsächlich angesungen, angefahren hätte, ist nicht gut vorstellbar. In allen diesen (und vielen anderen) Fällen ist I jedoch die Anrede (der Dia- 80 log, wie in Fr. 1 mit Aphrodite, in Fr. 95 mit Hermes), wenn auch fiktiv, so doch als möglich vorstellbar; nichts hindert, den (fiktiven) Adressaten tatsächlich anzureden und von ihm (fiktiv) angehört zu werden: Der fiktive Dialog kommt (und das ist ja der Sinn solcher Dialogfiktionen) überall zustande. Im φαίνεται μοι κήνος-Lied wäre das jedoch bei Deutungsvariante 2 nicht möglich. Denn wenn die im Liedeingang dargestellte Situation des Tête-à-tête tatsächlich stattgefunden hätte und von Sappho beobachtet worden wäre, dann hätte sie eine Anrede Sapphos an das Mädchen unmöglich gemacht. Es ist ja schlechterdings undenkbar, daß Sappho die Vorstellung beim Hörer suggerieren wollte (und insofern ist Deutungsvariante 2 im Kern identisch mit Deutungsvariante 1), sie sei in eben dieses Tête-à-tête (das sie doch als so intensiv und einvemehmlich empfand, daß es in ihr die existentielle Betroffenheit hervorrief, die zu diesem Liede führte) mit einer realen ,Rede an das Mädchen' (,... der Dir da gegenübersitzt, scheint mir den Göttern gleich zu sein ... ') hineingestoßen. Die ,Rede an das geliebte Mädchen', als die das ganze Lied sich darstellt, könnte also damals, als Sappho diese reale Szene beobachtete, nur stilles Selbstgespräch gewesen sein - Gedanken und Gefühle beim Innewerden einer schrecklichen Gefahr, die sich da anbahnt, indem ganz deutlich sichtbar ein Band sich herstellt zwischen diesem jungen Manne und dem Mädchen, ein Einverständnis, das sich in ihrem Antlitz, ihrem Lachen spiegelt, ein Aufeinanderzugehen dieser beiden, wo jedes Wort und jede Geste ein Schritt weiter weg von Sappho ist und eine Angst erzeugt, die lähmt, die krank und passiv macht, weil man ja sieht: Man kann nichts tun, das nimmt ja seinen Lauf, und - ,ich verliere sie!' Wenn es aber das ist, was Sappho in diesem Liebeslied ausdrücken wollte (nicht ein Erstaunen über Schönheit, wie Schadewaldt gemeint hat 20 , nicht fla20
Schadewaldt 1950, 102 (Winckelmanns θάμβος!).
328
Realität und Imagination
che Eifersucht, wie mit Page 21 so viele meinen, sondern: daß in eine tiefe Liebe eine lähmende Angst, diese Liebe zu verlieren, plötzlich eingebrochen ist und dieses zerrissene, schmerzvolle Liebesbekenntnis hervorgetrieben hat, das den Verzicht schon mitenthält: ,aber alles ist zu ertragen ...'), wenn es das ist: warum hat dann Sappho dieses Erleben in eine Form gekleidet, die ihr sonst fremd ist, die für ihre Art, Leiden zu bewältigen, untypisch ist? Warum hat sie hier singular einen fiktiven Dialog geformt, der nicht zustande kommt? Also einen nicht nur nichtwirklichen, sondern sogar unmöglichen Dialog? - Einen Augenblick lang stockt man hier und sagt sich: Vielleicht ist gerade das der Sinn! Die bereits eingetretene Unmöglichkeit des Zueinanderkommens schon durch die Form des Liedes auszudrücken. Die Distanz mit Worten zu malen. Aber wie vertrüge sich mit dieser Absicht, bestände sie, der Ton, der die Anrede prägt? 81 Diese Anrede ist ja so gar nicht .distanziert', sie drängt, sie will I sich mitteilen, sie ist angewiesen auf das Angehörtwerden: „... denn wenn ich auf Dich blicke, kurz nur, stockt mir die Stimme ...", usw. Diese Intensität der Anrede, dieses Hinüberwollen zum anderen scheint den Hörer doch geradezu zu zwingen, sich vorzustellen, wie Sappho all das Bedrängende, das sie da als ihr Gefühl benennt, heraussagt; wie sie es dem Mädchen tatsächlich mit-teilt. Es ist nicht anders als bei den anderen Dialogfiktionen Sapphos: Diese Anreden zwingen den Hörer, sich vorzustellen, wie Sappho zu Aphrodite, zu Hermes, zu dem Traumgott tatsächlich spricht, wie sie zum Traumgott etwa sagt: „O Traum, der Du durch schwarze Nacht gehst, wenn der Schlaf... Süßer Gott, ja wahrlich, von der Qual (kannst Du befreien [?] ...)", usw. Sollte es hier tatsächlich anders sein? Sollte die Anrede nur hier in Sapphos Œuvre nichts anderes sein als das aus der späteren Lyrik bekannte technische Mittel, einen .inneren Monolog' als Dialog lediglich zu inszenieren? Gab es für das primäre Publikum (und gibt es damit für uns) keine Möglichkeit, sich die Ausgangssituation, die das Lied errichtet, so vorzustellen, daß sie das Angeredetwerden des Mädchens und damit das Zustandekommen des Dialogs zwischen Sappho und dem Mädchen nicht verhindert? Eine Möglichkeit also, sich Sappho in dem Moment, in dem das Lied aus ihrem Mund erklingt, in eben jener Intimität der Zwiesprache mit dem geliebten Mädchen versunken vorzustellen, die das Lied doch suggeriert? Die aber nur zu erreichen ist, wenn das angeredete Mädchen auch wirklich anredbar ist, wenn es also nicht durch ein Gespräch mit .jenem Mann' vollständig absorbiert und Sapphos Wort damit entzogen ist?
21
„A love in jealousy", Page 33.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
329
Es scheint, daß es eine solche Möglichkeit tatsächlich gibt. Es scheint, daß die primären Adressaten des Liedes, also Sapphos Mädchenkreis, im Gegensatz zu uns nach einer solchen Möglichkeit gar nicht erst suchen mußten - weil sie nämlich den Liedanfang von vornherein anders verstanden als die moderne Interpretation zum mindesten seit Wilamowitz. Bei diesem .anderen' Verständnis des Liedanfangs aber spielt nun, wie es scheint, eben jenes κήνος, um das es uns hier schon vom ersten Wort an geht, die Schlüsselrolle. Die modernen Deutungsvarianten 1 und 2 setzen beide übereinstimmend voraus, daß κήνος deiktisch ist und auf einen realen Mann hindeutet - sei es einen im Augenblick des Liedvortrags physisch tatsächlich anwesenden (Variante 1), sei es einen in der Vergangenheit irgendwann einmal physisch tatsächlich anwesend gewesenen. Zeitgenössische Hörer jedoch konnten κήνος, so ist zu befürchten, in dieser deiktischen Funktion nur so lange (miß-)verstehen, bis sie in der linearen Reihe der aufeinanderfolgenden Informationssignale bei ώνηρ οττις angekommen waren. In diesem Augenblick Schloß sich das bis dahin wegen der pragmatischen Evidenz (ein Mann war nicht sichtbar) zwar nicht real-deiktisch, aber immer noch fiktiv-deiktisch verstehbare isolierte κήνος mit ώνηρ οττις zu einer Gesamtverbindung zusammen, die die Funktion ,Deixis' für κήνος ausschloß. I Über diese Gesamtverbindung κήνος ώνηρ οττις in dem Sappho-Liedfrag- 82 ment Nr. 31 ist viel geschrieben worden. Tatsache bleibt jedoch bei allen Spekulationen, die über diese Pronominalkorrelation angestellt wurden, daß das Spontanverständnis eines zeitgenössischen Hörers das κήνος innerhalb dieser Verbindung nur so begreifen konnte, wie es z.B. Ebeling im .Lexicon Homericum' für die epische Sprache definiert: „[...] ad ea, quae sequuntur, spectat κείνος; praecedit κείνος sententiae relativae, qua accuratius explicatur":, κήνος geht dem Relativsatz voraus, durch den es genauer erklärt (entfaltet) wird'. Bei Ebeling folgen 8 Belege aus Ilias und Odyssee; zwei davon wollen wir heranziehen: ξ 156
εχθρός γάρ μοι κείνος όμως Άΐδαο πύλησι γίγνεται, ος πενίη ε'ίκων άπατήλια βάζει. ,verhaßt nämlich ist mir jener gleich des Hades Pforten, der seiner Armut nachgebend Betrügerisches schwatzt'.
und - diesmal mit όστις statt ος und adjektivisch neben άνήρ: θ 209 άφρων δή κείνος γε και ούτιδανός πέλει άνήρ, ος τις ξεινοδόκω έριδα προφέρηται άέθλων δήμω έν άλλοδαπφ· εο δ' αΰτοΰ πάντα κολούει.
330
Realität und Imagination .unsinnig ist ja offensichtlich jener Mann und nichtswürdig, der mit seinem Gastgeber in fremdem Land in Wettstreit tritt'.
In beiden Fällen steht κείνος nicht isoliert und zeigt auf einen weiter entfernt stehenden (Mann) hin, der im Augenblick des Zeigens und unabhängig vom Zeigeakt bereits vorhanden ist, sondern in beiden Fällen ist κείνος mit einem relativen Definitionssatz verbunden, der die Figur des mit κείνος Vorgezeigten erst kreiert. Dabei gehört der relative Definitionssatz nicht zur Gruppe der appositiven Relativsätze (.Goethe, der 1749 geboren wurde, war ein großer Dichter'), sondern zur Gruppe der attributiven sinn-notwendigen (.restriktiven') Relativsätze (,Hunde, die bellen, beißen nicht'): Der Relativsatz bei κείνος kann nicht weggelassen werden, ohne daß eine unsinnige bzw. sinnlose Aussage entsteht. Die besondere Funktion von όστις aber, im Gegensatz zu einfachem ος, besteht darin, daß mit όστις die Beliebigkeit der Individualität der kreierten Figur unterstrichen wird; der Sprecher konstituiert mit (έ)κεινος όστις eine fest umrissene Kategorie von Personen oder Gegenständen, die, solange sie nur die vom Sprecher per Relativsatz festgelegten Merkmale aufweisen, untereinander von Sprechers wegen austauschbar sind. Dieser Funktionsbeschreibung von εκείνος όστις (die wir hier trotz ihrer linguistischen Banalität um der Interpretationsklarheit willen so detailliert ausführen) entspricht im Deutschen nun durchaus nicht überwiegend die Wiedergabe jener, der' (und gar nicht, deiktisch, jener 83 dort drüben, der'), sondern zumeist ,derjelnige, welcher', oder auch (wenn όστις substantivisch ist) ,wer'. Der Hauptanwendungsbereich dieses Pronomens im heutigen Deutsch ist vermutlich die juristische Fachsprache; Beispiel: BGB § 196: „In zwei Jahren verjähren die Ansprüche 1. 2. [ 7.
der Kaufleute, Fabrikanten [... ] derjenigen, welche Land- oder Forstwirtschaft betreiben [... ] ]
derjenigen, welche, ohne zu den in Nr. 1 bezeichneten Personen zu gehören, die Besorgung fremder Geschäfte [...] gewerbsmäßig betreiben" usw. Mit .derjenige, welcher' (bzw. .wer') wird ein beliebiges, dem Sprecher natürlich persönlich unbekanntes Mitglied von solchen Personenkreisen bezeichnet, die im gleichen Sprechakt erst kreiert werden. Sie werden mittels .derjenige, welcher' (bzw. ,wer') kreiert, weil eine gängige nominale Bezeichnung für sie im Sprachkorpus nicht existiert. Diese Bezeichnung existiert deswegen nicht, weil der betreffende Personenkreis zu klein oder zu speziell oder zu zufällig oder zu instabil oder zu subjektiv konstituiert ist, als daß ein allgemeines Interesse aller Sprachteilhaber an der Prägung einer entsprechenden nominalen (Dau-
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-L/ed
331
er-)Bezeichnung bestünde. Mit .derjenige, welcher' (bzw. ,wer') stellt die Sprache ein Mittel zur Verfügung, diesem Normdefizit bei Bedarf von Fall zu Fall ganz nach individuellem Belieben abzuhelfen 22 . Nichts spricht dafür, daß Sappho in diesem Liedeingang ihr κήνος οττις anders gemeint und daß es ihre Hörer anders verstanden haben könnten als in der beschriebenen Weise. Sappho sagt also nicht ,Es scheint mir jener Mann dort drüben den Göttern gleich zu sein - er, der Dir da gegenübersitzt und ... und ...', sondern sie sagt ,Es scheint mir derjenige Mann den Göttern gleich zu sein, welcher Dir gegenübersitzt und Dich aus der Nähe süß reden hört und lachen voller Liebreiz' (und das ist das gleiche wie ,Es scheint mir der Dir gegenübersitzende und Dich aus der Nähe süß reden und voller Liebreiz lachen hörende Mann den Göttern gleich zu sein'). Der Mann, von dem die Rede ist, hat also vor dem Augenblick des Sprechakts noch keine Existenz, sondern wird im Augenblick des Sprechakts erst kreiert. Es ist also kein objektiv vorhandener Mann - entweder sichtbar oder doch erinnerbar - , sondern ein von Sappho nur vorgestellter und von ihren Hörern am Leitseil der οττις-Satz-Definition vorzustellender, kurz: ein fiktiver Mann. Diese Auffassung des κήνος ώνηρ δττις ist fast nie auch nur erwogen worden. Wilamowitz, der auf den ersten Blick genau sie aufzugreifen und zu I bekämpfen 84 scheint, meint in Wahrheit eine andere Nuance; er nennt sie .generalisierende' Bedeutung des οττις und polemisiert in einer Art dagegen („als ob ein junges Mädchen in Lesbos auf den Ball gegangen wäre und sich von einer Jünglingsbrust an die andere geworfen hätte und mit jedem Ballherrn gekichert": S&S 58), die anzeigt, daß er an eine andere als die .realistische' Deutung der Eingangsszene eben gar nicht zu denken vermag: Hinter οττις (das dann ,wer immer',,jeder, der' bedeuten müßte) verbärgen sich, so wie Wilamowitz es versteht und ablehnt, reale wechselnde Liebhaber (.Kavaliere'). Diese Auffassung ist hier natürlich nicht gemeint; sie kann nicht gemeint sein, weil sie schon rein sprachlich unmöglich wäre: In diesem Falle müßten die Verba ίσδάνειν und ύπακούειν (mit oder ohne äv) im (iterativischen) Konjunktiv stehen. - Klarer scheint Page gesehen zu haben, der unter seinen drei Verständnismöglichkeiten für κήνος ... οττις als Nr. II auch anführt: ,Any man who sits opposite you is 22 Nähere Ausführungen dazu im Artikel άνήρ im LfgrE, bes. Sp. 854 f. (,,άνήρ wird durch einen Relativsatz bestimmt [...] Rund 2 / 3 der Rei.-Sätze sind modal, d. h. stehen in einem nur vorgestellten Zusammenhang, in dem auch ά. nur eine vorgestellte Person bezeichnen kann": Sp. 854,18 ff.; „Im Plural: hier wird die Umschreibung meist gewählt, weil eine einfachere Bezeichnung der betr. Personengruppe nicht vorhanden ist": Sp. 855,17 ff.). (Die Modalität des Relativsatzes ist übrigens nicht Bedingung für die Fiktivität des άνήρ.)
332
Realität und Imagination
fortunate"; er aber sieht dann sofort in der „addition of the specific ό άνήρ" einen Hinderungsgrund; warum, verrät er nicht (dazu sogleich). Immerhin hat Page aber schon die beiden Stellen aus Sappho selbst zitiert, die κηνος οττις in eben dieser gleichen Funktion zeigen und dieselbe Auffassung also auch für unser Lied nahelegen: Fr. 26,2-4 ο.|ττιναι.ς γαρ εΰ θέω, κήνοί με μά]λιστα πάΓντων aívovxaji .Diejenigen nämlich, denen ich wohltue, die schaden mir jeweils von allen am meisten'.
und Fr. 16,3 0]i μεν ίππήων στρότον, oi δέ πέσδων, oí δέ νάων φαΐσ έπ[ί] γάν μέλαι[ν]αν ε]μμεναι κάλλιστον, εγω δέ κήν' οττωτιςεραται ,... ich aber (halte für das Schönste) dasjenige, was einer jeweils begehrt'.
Geht man sämtliche Belege für έκεινος όστις in der frühgriechischen Dichtung von Homer bis Bakchylides durch, so zeigt sich, daß die regelmäßige Bedeutung der Pronominalverbindung eben die beschriebene ist. Auf die Idee, κήνος οττις als Jener dort drüben - , er, der Dir gegenübersitzt' usw. zu verstehen, konnte man nur kommen,weil man κήνος von allem Anfang an deiktisch auffaßte; mit οττις war dann zwar nur äußerst schwer zurechtzukommen, doch die Not, mit seltenen und entlegenen Parallelen operieren zu müssen, nahm man um des scheinbaren Gewinns des'Gegenwartsbezuges willen (eben Jener dort drüben') gern in Kauf; dahinter stand - Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. I 85 Die Sprachnorm sieht anders aus. Sie tritt uns in Beispielen wie Theognis 223 entgegen: όστις τοι δοκέει τον πλησίον 'ίδμεναι ούδέν, άλλ' αυτός μοΰνος ποικίλα δήνε' εχειν, κείνος γ' άφρων έστί, νόου βεβλαμμενος έσθλοΰ' .Derjenige fürwahr, der meint, sein Nächster wisse gar nichts, sondern er allein sei im Besitz mannigfacher Kenntnisse, der ist unsinnig'.
oder bei Hesiod, von dessen zahlreichen einschlägigen Sätzen nur Op. 343 angeführt sei: Τον φιλεοντ' έπί δαίτα καλειν, τον δ' έχθρόν έάσαι· τον δέ μάλιστα καλειν όστις σέθεν έγγύθι ναίεΐ'
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos
φαίνεται μοι κήνος-Li'ed
333
,Den Wohlgesonnenen soll man zum Essen einladen, den Feind lassen, den aber lade am meisten ein, der nahe bei dir wohnt!'
womit zu vergleichen ist Op. 700 την δέ μάλιστα γαμείν, ήτις σέθεν έγγύθι ναίει ,die aber sollst du vorzugsweise heiraten, die in deiner Nähe wohnt'.
In den letzten beiden dieser drei Fälle steht nicht κείνος, sondern ος (ή), in allen dreien aber - und darauf kommt es uns im Augenblick an - steht nicht Konjunktiv oder Optativ, sondern der Indikativ - wie in Sappho 31. Drückt das generalisierende όστις die Beliebigkeit der Identität der betreffenden Person aus der Sprecherperspektive aus, so unterstreicht der Konjunktiv bzw. Optativ in solchen οστις-Sätzen die Beliebigkeit des Zeitpunkts der betreffenden Handlung; Indikativ dagegen zeigt an, daß die Handlung mit der betreffenden Person fest verbunden ist, zeitlich nicht beliebig verschiebbar, und daß sie dauerhaft, nicht intermittierend zu denken ist: .derjenige, der in der Überzeugung lebt', .derjenige, der seinen Wohnsitz in deiner Nachbarschaft hat'. In unserem SapphoLied wird also κήνος ώνηρ οττις ένάντιός τοι / ίσδάνει auch nicht bedeuten (wie Wilamowitz vorschnell annahm): .derjenige Mann, der Dir jeweils (bald heut, bald morgen - irgendwann) gegenübersitzt' (und eben dadurch kämen wir ja nur, wie Wilamowitz, auf die Deutung .häufiger Männerwechsel' und reagierten dann vielleicht empört...), sondern es wird bedeuten: .derjenige Mann, der dir gegenüber seinen Sitz hat' - dauernd, gewohnheitsmäßig, etabliert. Diese Nuance des Gewohnheitsmäßigen wird unterstrichen durch die Wahl des , SitzVerbs' ίσδάνειν: Zwar haben wir leider keine Möglichkeit, bei Sappho selbst zu prüfen, ob sie einen Unterschied zu machen pflegt zwischen ίζάνειν und ϊζειν, aber Homer gibt ein Indiz: In der Odyssee schildert er, wie Odysseus zum Gutshof seines Vaters Laertes kommt (Od. 24.208): I ενθα oí οίκος εην, περί δέ κλίσιον θέε πάντη, έν τω σιτέσκοντο καί ϊζανον ήδέ ϊαυον δμώες άναγκάίοι, τοί οί φίλα έργάζοντο. .Dort hatte er ein Haus, und ringsum lief eine Pergola (?), in der zu essen, zu sitzen und zu schlafen pflegten seine Knechte ...'
Nicht nur die benachbarte -σκ-Iterativform - der ganze Kontext (im Augenblick, in dem Odysseus ankommt, sind die Knechte gar nicht da, sie sind zum Steinesammeln weggegangen: 223) macht klar, daß die ανω-Form, die neben ϊ ζ ω steht, ,usitativ' ist (vgl. Chantraine, Gramm. Horn. I 316: „déterminé"); ίζάνειν
86
334
Realität und Imagination
bedeutet nicht »zufällig dasitzen', sondern ,zu sitzen pflegen' (so wohl übrigens auch bei Ibyc. 317 a 2). Es ist nun nicht mehr schwer zu sehen, was für ein ,Mann' das sein muß, der dem von Sappho geliebten Mädchen .gewohnheitsmäßig gegenübersitzt', der ihm gegenüber .seinen Platz hat': In dieser Hinsicht haben schon Wilamowitz, Schadewaldt und Snell den richtigen Weg gewiesen: άνήρ bedeutet,Ehemann'. Im .Lexikon des frühgriechischen Epos' habe ich im Artikel άνήρ seinerzeit die zahlreichen Stellen zusammengestellt, an denen „άνήρ als Komplementär- oder Gegensatzbegriff zu ,Frau'" die „spezielle Bed. Ehemann (: Ehefrau)" hat und im Deutschen wiedergegeben wird mit „([...] mein, dein, ihr) Mann"; eine eigene Rubrik habe ich damals denjenigen Stellen gewidmet, an denen mit άνήρ in dieser Gebrauchsweise „ein möglicher, zukünftiger Ehemann" gemeint ist (LfgrE Sp. 830/31). Im Jahre 1978 hat McEvilley durch eine Darlegung von Sapphos Wortgebrauch im semantischen Feld ,Mann - Frau' gezeigt, daß Sappho offenbar konsequent unterscheidet zwischen παις (κόρα) junges Mädchen', παρθένος ,Jungfrau' und γυνή .verheiratete Frau' einerseits, und zwischen ήΐθεος .Jungmann' und άνήρ .verheirateter Mann' andererseits23, κήνος ώνηρ οττις kann danach wohl nur bedeuten .derjenige Ehemann, welcher' - natürlich ohne daß der Hörer das .Ehe-' etwa explizit signalisiert bekäme; spricht man zu einer Frau von .demjenigen Mann, der Dir gegenüberzusitzen pflegt', so versteht sie und jeder, der es hört, .Dein Mann'; bei einem unverheirateten, aber heiratsfähigen Mädchen versteht sich darüber hinaus von selbst, daß der zukünftige Mann gemeint ist. Daß Sappho vom (zukünftigen) Mann des Mädchens spricht, wird auch durch ένάντιός τοι ΐσδάνει nahegelegt: Die soziale Bedeutsamkeit des , Gegenübersitzens' wurde schon 1929 von Turyn mit vielen Parallelstellen belegt 24 ; 1977 hat dann Ruth Neuberger-Donath sämtliche Homer-Belege für .Gegenübersitzen' analysiert; wie nicht anders zu erwarten - im Grunde ist es ja auch heute nicht 87 anders - , ergab sich, daß ein Einander-Gegenübersitzen von I Mann und Frau schon an sich enge Zusammengehörigkeit signalisiert; ist aber das Einander-Gegenübersitzen Gewohnheit (.institutionalisiert'), dann handelt es sich um (Ehe-) Mann und -Frau; die Folgerung für Sappho 31: „thus the two persons facing each other are apparently man and wife" (200). Sappho imaginiert also, so scheint es, im Eingangsteil des Liedes eine Szene, in der das Mädchen, das sie liebt, und dessen Mann einander gegenübersitzen; 23 24
McEvilley 1978, 6-9. Turyn 1929, 30 f.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κηνος-Lied
335
sie sieht vor sich, wie das Mädchen spricht und lacht und wie der Mann voll stiller Freude zuhört. Warum gerade diese Szene? Warum nicht ,Den Göttern gleich scheint mir Dein künftiger Mann'? Warum diese - ausgerechnet diese ausmalende Umschreibung? Warum an das ένάντιος ίσδάνει, das ja den Status .Ehemann' bereits hinreichend ausdrückt, noch mit καί ... καν das süße Reden und das liebreizende Lachen des Mädchens .angehängt'? Doch wohl, weil eben dies - das süße Reden und das Lachen voller Liebreiz das ist, was Sappho an dem Mädchen so hinreißt; darum geht es als so bestimmend in die ,Definition' auch des potentiellen Ehemanns des Mädchens ein. Es ist in Wahrheit Sappho, die erlebt, was sie dem Manne zuschreibt, Sappho aber auch, die zugleich weiß, daß alles das, was sie da erlebt und liebt, einst (bald?) einem Mann gehören wird. Derjenige Mann, der dann in dieser Lage ist, d. h. der dieses Mädchen zur Frau hat (,der gegenüber Dir / zu sitzen pflegt'), der scheint Sappho den Göttern gleich zu sein. Snell hat mit vielen Parallelen gezeigt, daß der Beginn dieses Sappho-Lieds ein Makarismos ist. Es ist allerdings ein Makarismos in einem wohl anderen Sinn, als Snell es meinte. Es ist ein Makarismos eines Mädchens (nicht einer Braut am Hochzeitstag), der die Ausstrahlung dieses Mädchens preist und zugleich einen scharfen Schmerz darüber ausdrückt, daß der, der da preist, nicht selbst an der Stelle des Glücklichen sein kann. Sehr viele Parallelen zur Eingangsstrophe dieses Liedes sind schon vorgeschlagen worden. Die wirklich schlagende Parallele jedoch ist, soweit ich sehe, bisher nicht darunter (Turyn kam in die Nähe, S. 33; Schadewaldt 1950, 103, sah nicht, wie nah er war). Mir scheint, es ist die folgende: Odyssee ζ. Odysseus nackt am Strand von Scherte, erwacht vom lauten Ballspiel der Mädchen um Nausikaa, die Blöße deckend aus dem Buschwerk vorgetreten; die Mädchen schreiend weggerannt, nur Nausikaa ist dageblieben. Odysseus überlegt: Soll er der Form Genüge tun und als ικέτης ihre Knie umschlingen? Oder ist nicht vielmehr ein Formfehler in dieser Lage die einzig angemessene Form? Er entscheidet sich für den Fehler, redet das liebreizende Mädchen nur von fern an (ζ 149 ff.):
,,Γουνοΰμαί σε, όνασσα' θεός νύ τις ή βροτός έσσι; εΐ μεν τις θεός έσσι, τοί ούρανόν εύρύν εχουσιν, Άρτέμιδί σε έγώ γε, Διός κούρη μεγάλοιο, ειδός τε μέγεθος τε φυήν τ' αγχιστα έΐσκω; εί δέ τίς έσσι βροτών, τοί έπί χθονί ναιετάουσι, τρισμάκαρες μεν σοί γε πατήρ και πότνια μήτηρ, I τρισμάκαρες δε κασίγνητοι - μάλα πού σφισι θυμός αίέν έϋφροσύντισιν ίαίνεται είνεκα σείο,
88
336
Realität und Imagination
λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορόν είσοιχνεΰσαν. κείνος δ' αΰ περί κήρι μακάρτατος εξοχον άλλων, ος κέ σ' έέδνοισι βρίσας οικόνδ' άγάγηται. ού γάρ πω τοιούτον έγώ 'ίδον όφθαλμόΐσιν, οΰτ' ανδρ' ούτε γυναίκα· σέβας μ' εχει είσορόωντα. „wenn Du aber eine Sterbliche bist [...] dreimal selig sind Dir dann Vater und hehre Mutter, dreimal selig auch die Brüder: sehr muß ihnen doch das Herz in Wohlgefühlen warm werden um Deinetwillen, wenn sie ein solches Blütenblatt zum Reigen gehen sehen. Derjenige aber ist ums Herz herum der seligste von allen anderen, der Dich mit Brautgeschenken aufwiegt und heimfuhrt. Denn niemals noch hab' ich mit eignen Augen einen Sterblichen gesehen, nicht Mann, nicht Frau, der so war! Ein Schauer erfüllt mich, wie ich Dich anseh' !"
Die Übereinstimmungen im Ausdruck und in der Absicht liegen auf der Hand. Odysseus' Rede ist eine einzige Huldigung. Sie zeigt, daß die höchstmögliche Steigerungsstufe der Schönheitspreisung eines jungen Mädchens darin besteht, demjenigen neidvoll das höchste Glück auf Erden zuzusprechen, der einst als Ehemann sein Leben mit diesem Mädchen teilen wird. Natürlich ist es nicht Mißgunst, die sich hier äußert; das Mädchen wird dem Glücklichen nicht ernsthaft mißgönnt. Auch Eifersucht (auf den Mann) ist nicht im Spiele, es sei denn in jener feinen Variante, die eigenes erotisches Interesse so dezent wie überhaupt nur möglich offenbart - und eben dadurch das gepriesene Mädchen stolz und glücklich macht. Diese Form des Makarismos liegt wohl auch bei Sappho vor. Nur kommt sie hier aus einer ganz anderen Lebenssituation als bei Odysseus, und darum nimmt der Makarismos bei Sappho eine ganz andere Intensität an. Das zeigt die Fortsetzung: τό μ' ή μάν / καρδίαν έν στηθεσιν έπτόαισεν. Hier bedürfte eigentlich jedes Wort einer gesonderten Untersuchung. Wir können nur andeuten: τό kann hier wohl nur die gesamte vorgestellte Konstellation bezeichnen und zusammenfassen: ,das' - d.h.:,diese Vorstellung'. „Diese Vorstellung", sagt Sappho, „hat mir das Herz in der Brust - έπτόαισεν". Sehr wichtig scheint an diesem Verb zunächst das Tempus: Es ist der einzige Aorist im ganzen Lied. Sonst haben wir nur Praesentia und Perfecta - die Tempora des Besprechens. Dieser eine Aorist steht zu auffällig da, als daß er nicht etwas Besonderes zu bedeuten haben sollte. Er schließt das Eingangsbild ab und leitet über zur Pathographie. Er bildet Grenze und Brücke. Weinrich hat an vielen Textbeispielen gezeigt, wie ein Tempus-Übergang dieser Art (mehrere Tempora der Tempusgruppe I - ein einziges Tempus der Tempusgruppe II - wieder mehrere Tempora der Tempusgruppe I) wirkt: Er macht den Hörer aufmerksam, zeigt an, daß mit ihm das, was
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
337
davor gesagt war, zusammengekommen wird, daß eine Art rückschauende Bi- 89 lanz erfolgt, bevor das Neue kommt 25 . „Es scheint mir derjenige den Göttern gleich / zu sein, derjenige Mann, der gegenüber Dir / zu sitzen pflegt und Dich aus der Nähe süß reden / und voller Liebreiz lachen hört...". Das ist das Bild. Es klingt aus. Und dann plötzlich das alles zusammengenommen, auf einen Punkt zusammengepreßt durch das τό: ,das ...'; die Verbform führt die Komprimierung fort und zieht (wie so oft bei diesem Typ von Tempusfolge) das Fazit 26 : ,Das - hat mir das Herz in der Brust jäh erschreckt'. Schon der Autor περί ϋψους benutzt bei seiner Würdigung dieses Sappho-Lieds, um έπτόαισεν zu glossieren, das Verb φοβεισθαι. Ammonios der Semasiologe hat πτόησις als plötzlichen Affekt definiert (παραυτίκα) und mit φόβος gleichgesetzt, also: jäher Schrecken, Entsetzen, Panik, Schock' 27 . Bei Homer bedeutet πτοέω regelmäßig ,in jähen Schrecken versetzen'. Das also ist das Fazit, das Sappho zieht: „Das - hat mir das Herz in der Brust in panisches Entsetzen gestürzt!" „Denn wie ich auf Dich blicke, kurz nur, ist zum Sprechen kein Raum mehr in mir ..." - und es folgt die ganze grausam deutliche Pathographie. Am Schluß, der Ohnmacht nahe, dann das ,Dennoch!': „Aber alles ist zu ertragen ...". Die Lebenssituation, die bei Sappho zu der Vorstellung vom göttergleich glückseligen Ehemann geführt hat - natürlich eine gänzlich andere als die des schiffbrüchigen, auf Hilfe angewiesenen, stets diplomatischen Odysseus - , ist nun nicht schwer mehr zu erraten: Sappho ist mit diesem Mädchen, das sie so liebt, zusammen; sie hört ihr süßes Reden und ihr liebreizendes Lachen - und mitten im Glück steigt die Vorstellung in ihr auf, wie dieses Mädchen einst dies alles einem Mann hinschenken und wie der Mann all dies besitzen wird - an ihrer Statt. Erzieht sie doch - reinstes Paradoxon - auch dieses Mädchen einzig dafür. - Die Vorstellung stellt sich zunächst spontan ein, mit jener Selbstverständlichkeit, mit der man beim Anblick eines reizvoll-schönen jungen Mädchens, das augenfällig (wie Sappho anderswo - Fr. 105 a - selbst sagt) reif ist für die μαλοδρόπηες, die .Apfelpflücker', gleich auch an den Mann denkt, der dieses ,Reis' besitzen wird; die Rede des Odysseus an der zitierten Stelle zeugt 25
Weinrich 64-71; zum Griechischen 290 f. (die Bestimmung der Aoristfunktion ist zu grob; die ausgedehnte Diskussion der Weinrich-Thesen, auf die hier nicht eingegangen werden kann, hat vieles schärfer herausgearbeitet; im vorliegenden Falle dient der Aorist offenkundig der Reliefgebung: Er bezieht die Vision, die sich immer weiter hätte ausspinnen können, urplötzlich abschneidend auf das konkrete Jetzt des Sprechers zurück: , so hat das auf mich gewirkt! '). 26 Weinrich 68. 27 Die Belege sind vorgeführt und gedeutet bei Privitera 1969, 32 f. Viele Parallelen für das .Erschrecken' bei Schadewaldt 1950, 101 f.
338
Realität und Imagination
für die Selbstverständlichkeit der Assoziation28. Bei Sappho jedoch, die ja das I 90 Mädchen kennt und liebt, tritt diese Vorstellung, die sonst als Kompliment im Allgemeinen bleibt (.glückselig, wer dich heimführt!'), nicht nur von vornherein in der ganz subjektiven Färbung auf, die durch die .SituationsVerschmelzung' entsteht (.glückselig der Mann, der Dir gegenübersitzt so, wie jetzt ich Dir gegenübersitze'), sondern die Vorstellung legt auch die Statik des reinen Vergleiches ab, die sie sonst hat: Sie entfaltet ihre eigene Dynamik, das Bild entwickelt sich, es dehnt sich aus: „... Dir gegenübersitzt - und aus der Nähe süß Dich reden hört - und lachen - voller Liebreiz"; und indem es sich entwickelt, indem Schritt für Schritt alles das, was Sappho an dem Mädchen, dem sie gegenübersitzt, so liebt, allmählich von Sappho weggleitet und auf den Mann übergeht, blitzt jäh die Erkenntnis in ihr auf, was das bedeutet: Verlust. Und da spricht Sappho das Entsetzen aus, das in diesem Augenblick von ihr Besitz ergriffen, ihr fast das Herz aus der Brust gerissen hat:" ... das hat mir - wahrhaftig! - das Herz in der Brust jäh aufgeschreckt!" Warum? Die Begründung wird zu einem Bekenntnis, das den Schock verstehen läßt: .Denn sowie ich auf Dich blicke, ganz kurz nur, spüre ich mit allen Fasern meines Leibes und meiner Seele, was Du mir bist (und was ich ohne Dich wäre)'. Das Bekenntnis der tiefen Liebe ist zugleich ein Bekenntnis der Angst - der Angst, das, was beinahe göttergleich macht, verlieren zu müssen, vielleicht schon bald. Liebe und Angst vor dem Verlust der Liebe verschmelzen zu einem Zustand ohnmachtsähnlicher Gelähmtheit. Dann aber, am Ende, doch wieder die Kraft, sich aufzuraffen - das Dennoch: ,Aber alles kann man ertragen . . . ' . - Das ist kein Lied, das stillsteht. In ihm geht etwas vor, folgen Gefühle aufeinander, reift ein Entschluß. Auf seine Art erzählt das Lied eine Geschichte. So aufgefaßt, ordnet sich dieses Lied in die charakteristische Ablaufstypologie Sapphischer Lieder ein, wie sie uns andere Fragmente zeigen: (1) Entwurf einer Vorstellung (eines Bildes): Fr. 1: Aphrodite auf dem Sperlingswagen; Fr. 94: die Abschiedsstunde; Fr. 96: Arignota, gerade jetzt auf und abgehend am lydischen Meeresstrande - (2) Wirkung dieser Vorstellung auf Sappho: Fr. 1: neuer Mut; Fr. 94: Wunsch, zu sterben; Fr. 96: Ermutigung der eigenen Wer-
28
Sie schlägt sich, universell wie sie ist, überall auch in den Termini für ein Mädchen, das auf dem Gipfel seiner Schönheit ist, nieder: παρθένος ανδρός ώραίη (so Hdt. 1,107; öfter auch, von Hdt. an, γάμου ώ„ woraus vielleicht sogar das allgemeinste neugriechische Wort für ,schön' erwachsen ist: G. Fatouros, Glotta 54, 1976, 239 f.); virgo matura viro; eine .mannbare' Jungfrau.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied
339
bung um Atthis (diese Deutung kann hier nicht mehr näher begründet werden29) - (3) Entschluß: Fr. 1: ,Ich will weiterkämpfen!' (σύμμαχος εσσο); Fr. 94: vermutlich ein ,Und dennoch!'; Fr. 96: vermutlich: ,Laßt uns am Schönen, das wir haben, uns erfreuen!' - Hier in Fr. 31 stünde am Beginn die Vorstellung, wie das Mädchen, dem jetzt Sappho gegenübersitzt, zu einem anderen spricht und lacht; zu dem - wer es auch sei - , an dessen Stelle Sappho, weil sie Frau und nur ,Vorbereiterin' ist, nie sein wird. In dem Moment, in dem ihr das überdeutlich klar wird - eben an der Vision klar wird, die I sie hat - , setzt die Wirkung ein: 91 panisches Erschrecken, verzweifeltes Hinschauen auf das Mädchen, Festhaltenwollen - und doch wissen, wie vergeblich all das ist. Am Ende steht der Entschluß, auch damit fertig zu werden. Es ist die gleiche Haltung zum Leben wie in den anderen Liedern. In dieser Deutung könnte das Lied dem Mädchen tatsächlich zugesungen sein. Der Dialog ist nicht unmöglich, er ist für den Hörer vorstellbar. Er stünde an einem Punkt innerhalb des Lebenszyklus des ganzen Sappho-Kreises, der typisch wäre wie die anderen, die sich in Sapphos Liedern spiegeln: Ankunft (etwa Fr. 49,2), Verliebtheit (etwa Fr. 49,1; Fr. 1), Werbung (Fr. 1; 96), Erfüllung (Fr. 48), Zurückweisung (Fr. 1) und tiefe Depression (Fr. 1; 94), Abschied (Fr. 94), Sehnsucht nach dem Abschied (Fr. 96) u. a. Schadewaldt, der für unser Lied ja von der Hochzeitsdeutung ausging, setzte es in dem „typischen Phasenablauf dieses Scheidens" 30 , den er in Sapphos Liedthematik zu erkennen glaubte, als Hochzeitslied kurz vor dem Trennungslied Fr. 94 an (auf das dann im idealtypischen Phasenablauf das Sehnsuchtslied Fr. 96 folgen würde). Für uns stünde das Lied in einer idealen Rhythmuskurve des Lebensablaufs innerhalb des Sappho-Kreises an einem anderen Punkt: vor der Hochzeit, dort, wo die Bindung Sapphos an ein Mädchen nach langem Umgang miteinander am stärksten geworden ist, der Zeitpunkt des Scheidenmüssens aber ganz nah bevorsteht. Es fällt nicht schwer, sich in diese Phase der innigsten Verbundenheit hineinzufühlen, in der die Angst vor dem Auseinandermüssen so bedrängend wird, daß das, was kommen wird, sich zur Vision verdichtet. Da hält dann Sappho keinen rationalen Vortrag: „Derjenige Mann, der Dir jetzt bald Tag für Tag gegenübersitzen wird ..."; redete sie so, dann würde sie natürlich nicht im Präsens sprechen; statt der Präsentien ίσδάνει und υπακούει stünden dann die Futura (bzw. prospektive Modi). Dann hätten wir es allerdings auch mit einer lehrhaft-logi-
Sie ist mit äußerster Sensibilität vorgetragen worden von Snell 1931, 83 Anm. 2. Schadewaldt 1936, 372 Anm. 29, erwähnt sie etwas skeptisch. 30 Schadewaldt 1936, 366 (= HuH 2 138).
340
Realität und Imagination
sehen ,Vorbereitungsrede auf den bevorstehenden Abschied' zu tun31. Doch dies ist nicht Sapphos Art; es paßt zu Hesiod, zu Theognis. Sappho aber predigt 92 nicht. Sie gibt nur wieder, was über sie hereinbricht: I ,Der Mann, der Dich bekommt, der kommt mir wie ein Gott vor! So wie Du sprichst und lachst... Ach, wenn ich daran denke ... Brauch' ich Dich doch nur anzuschaun, ganz kurz nur - und mir stockt die Stimme ... Es scheint, daß dieses Lied - ein Liebesbekenntnis von höchster Intensität, aus Angst geboren, und zugleich ein Versuch der Fassung - nicht zu begreifen ist, wenn sein Beginn in eine konkrete Situation realer Deixis .eingepaßt' wird.
31
Das Präsens φαίνεται steht als ,urteilendes' Präsens (Schwyzer, Gr. Gr. Π 2 270) auf einer anderen Ebene als die beiden Präsentien ίσδάνει und υπακούει, die ich hier als .visionäre' Präsentien bezeichnen möchte. Die Gebrauchsweise dieses visionären Präsens miißte in größerem Zusammenhang untersucht werden. Schwyzer, Gr. Gr. II 2 273, nennt eine ähnliche Erscheinungsweise des, wie er sagt, ,praesens pro futuro' das .prophetische Präsens'; aus den wenigen Belegen, die er für diese Erscheinungsweise zur Hand hat, erschließt er richtig, bei einem solchen Präsens sei „im allgemeinen die zeitliche Einordnung durch den Zusammenhang (Futura, Imperative im Kontext; Bedingung) gegeben", fügt aber mit der Verwunderung des Sprachwissenschaftlers hinzu: „Und doch wäre das im ersten Fall" (d. h. im Falle des .prophetischen' Präsens) „nicht nötig, indem vor dem Auge des Sehers die Zukunft gegenwärtig erscheint (wie bei der künstlerischen Verwendung des praesens pro praeterito die Vergangenheit ... )". Der theoretisch zu erwartende Typus, den Schwyzer hier vermißt, ist offenbar im Eingang von Sappho 31 belegt: ein reines .prophetisches' Präsens (für das die Bezeichnung .praesens visionis' angemessener erscheint). In den narrativen Texten (aus denen Schwyzer seine Belege hat; daß sie zum Teil in Dramen stehen, ist für den Texttyp ohne Belang) kann dieser von Schwyzer postulierte und theoretisch in der Tat zu postulierende ,reine Typus' nicht erscheinen, weil dort ein .prophetisches' Präsens stets eingebettet ist in einen Erzählkontext; der Übergang zum .prophetischen' Präsens muß daher dort durch sprachliche Sondersignale angekündigt werden. In einem lyrischen (Einzel-)Text - der ja nicht erzählt, sondern bespricht - sind derartige Sondersignale entbehrlich, weil hier ein wesentlicher Teil des Kontextes durch den gemeinsamen pragmatischen Lebens- und Erfahrungsraum (den sog. nichtsprachlichen Kontext oder Kotext) gebildet wird. Im Sappho-Lied 31 ist eine normale Lebenssituation künstlerisch nachgeformt: die Situation einer Meinungs- und Gefühlsäußerung des einen von zwei Partnern innerhalb eines Zwiegesprächs über ein beiden Partnern bewußtes und sie bedrängendes Problem; dieses Problem ist in diesem Falle die unabwendbar drohende Zerstörung einer beglückenden Liebesbeziehung zwischen Sappho und einem ihrer Mädchen durch die bevorstehende Verheiratung des Mädchens. Im Rahmen dieser Situation könnte das angeredete Mädchen die Präsentien ίσδάνει und υπακούει gar nicht anders denn als .visionäre' Präsentien verstehen, weil alle anderen Verstehensmöglichkeiten durch den pragmatischen Kontext (den Kotext) ausgeschlossen sind (linguistisches Paradebeispiel für diesen bedeutungsentscheidenden Einfluß des Kotextes ist die semantisch unterschiedliche Eindeutigkeit des Rufs .Feuer! ', je nachdem, ob er von einem Kanonier, einem Raucher oder einem Kinobesucher ausgeht). - Die Frage, wie Catull den Liedeingang verstanden hat, ist vorläufig absichtlich ausgeklammert worden. Das umstrittene identidem weist jedoch daraufhin, daß er so, wie hier vorgeschlagen, aufgefaßt hat.
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lierf
341
Leben scheint es erst zu gewinnen, wenn es von einer Vorstellung aus erschlossen wird - einer Vorstellung, die wir genauso in uns rekonstruieren müssen und können, wie sie die ersten Adressaten - vielleicht sogar die erste Adressatin, falls das Lied doch zuallererst ein Geschenk für sie war - in sich erschließen mußten. Es sieht so aus, als sei die frühe Lyrik uns am Ende doch nicht so fern. A l s Abschluß ein Versuch, die neue Deutung allein durch die Übertragung auszudrücken: Es scheint mir derjenige gleich den Göttern zu sein, der Mann, der gegenüber Dir stets seinen Sitz hat und von nahem süß Dich reden hört und lachen voller Liebreiz ... Das hat mir - wahrhaftig ! das Herz in der Brust jäh aufgeschreckt! Denn wie ich auf Dich blicke, kurz nur, ist zum Sprechen kein Raum mehr in mir nein: ganz gebrochen ist die Zunge, fein ist augenblicks unter die Haut ein Feuer mir gelaufen und mit den Augen seh' ich nichts, es dröhnen die Ohren, I herab rinnt kalter Schweiß an mir, ein Zittern hält ganz gepackt mich, fahler noch als Dürrgras bin ich - vom Totsein wenig nur entfernt komm ich mir selbst vor ... Doch alles kann ertragen werden (ist zu ertragen), da j a (nachdem) -
42
Realität und Imagination
Literatur (ohne allgemeine Darstellungen; Reihenfolge chronologisch) ι 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21
22
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Sappho, in: Sappho und Simonides. Untersuchungen über griechische Lyriker, Berlin 1913, 17-78 (= S&S). H. Frankel, Eine Stileigenheit der frühgriechischen Literatur, GGN 1924,63-127 = Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München 1955 u.ö. (S. 43: „die rückschauende Betrachtung dieses Zustands ...")· A. Turyn, Studia Sapphica, Leopoli 1929 (Eos, Suppl. 6). B. Snell, Sapphos Gedicht ΦΑΙΝΕΤΑΙ MOI ΚΗΝΟΣ, Hermes 66 (1931) 71-90. 368. W. Schadewaldt, Zu Sappho, Hermes 71 (1936) 363-373 (= Hellas und Hesperien I 2 134-145(= HuH 2 ). A. Setti, Sul Fr. 2 di Saffo, SIFC 16 (1939) 195-221. W. Schadewaldt, Sappho. Welt und Dichtung. Dasein in der Liebe, Potsdam 1950. H. Fränkel, Sappho, in: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, New York 1951. München 2 1962 (hier S. 199 f.). München 3 1969. Sappho, Lieder. Griechisch und deutsch hrsg. von M. Treu, München 1955 (TusculumBücherei). München 6 1979. D. Page, Sappho and Alcaeus. An Introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry, Oxford 1955 u. ö. (zuletzt 1983). Α. Beattie, Sappho Fr. 31, Mnemosyne 9 (1956) 103-111. R. Merkelbach, Sappho und ihr Kreis, Philologus 101 (1957) 1-29. C. Del Grande, Saffo, ode Φαίνεται μοι κήνος'ίσος, Euphrosyne 2 (1959) 181-188 (das Lied will das junge Mädchen darüber hinwegtrösten, daß der junge Mann von ihren Reizen so .göttlich' unbeeindruckt bleibt!). R. Bagg, Love, ceremony and daydream in Sappho's lyrics, Arion 3 (No. 3) (1964) 44— 82 (das Lied beschreibt ein Gefühl des .sexuellen Exils', weil Sappho an der beobachteten Szene klar wird, daß sie des Mädchens Sehnsucht nach Virilität als lesbische Homosexuelle nie wird erfüllen können). M. Manfredi, Sull'Ode 31 L.-P. di Saffo, in: Dai Papiri della Società Italiana, Florenz 1965, 16 f. (Papyrusfund mit dem ursprünglichen Wortlaut von Fr. 31,16). B. Snell, Wiederabdruck von Nr. 4 mit Rücknahme der Hochzeitslied-Vortragsthese (S. 97), in: Gesammelte Schriften, Göttingen 1966. G. Wills, Sappho 31 and Catullus 51, GRBS 8 (1967) 167-197. G. L. Koniaris, On Sappho, fr. 31 L.-P., Philologus 112 (1968) 173-186. G. A. Privitera, Saffo fr. 31,13 L.-P., Hermes 97 (1969) 267-272. Ders., Π commento del Περί ύψους al fr. 31 L.-P. di Saffo, QUCC 7 (1969) 26-35. Ders., Ambiguità antitesi analogia nel fr. 31 L.-P. di Saffo, QUCC 8 (1969) 3 7 - 8 0 (strukturalistisch; die beobachtete Szene ist real, das Lied ist die Reaktion darauf als .fiktiver Dialog', d.h. als Monolog). I L. Rydbeck, Sappho's Φαίνεται μοι κήνος, Hermes 97 (1969) 161-166 (ausführliche .linguistische' Analyse des οττις ohne überzeugende Lösung; die Präsentien ίσδάνει und υπακούει fungieren als praes. hist.: Deutungsvariante 2).
Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied 23
24 25
26 27
28 29
30 31 32 33 34
35
36
37 38 39 40 41
343
R. O. Evans, Remarks on Sappho's „Phainetai moi", StudGen 22 (1969) 1016-1025 („The description is of the intensity of emotional reaction of the voyeur [or perhaps the eavesdropper]"). G. Devereux, The nature of Sappho's seizure in fir. 31 as evidence of her inversion, CQ 20(1970) 17-31 (psychoanalytisch). M. L. West, Burning Sappho, Maia 22 (1970) 307-330 („The original experience had been a real one [...] Once it was made into a song, however, it was freed from its connexion with particular circumstances. Soon enough it ceased to matter who the ,you' had been, who the man had been, when and where he and she had sax together": Deutungsvariante 2). M. Marcovich, Sappho fr. 31. Anxiety, attack, or love declaration? CQ 22 (1972) 19-32. F. Manieri, Saffo. Appunti di metodologia generale per un approccio psichiatrico, QUCC 14 (1972) 46-64 (Auseinandersetzung mit Devereux [oben Nr. 24]: Sappho war keine latente, sondern eine manifeste Homosexuelle). C. Segal, Eros and incantation. Sappho and oral poetry, Arethusa 7 (1974) 139-160. G. Bonelli, Saffo, 2 Diehl = 31 Lobel-Page, AC 46 (1977) 4 5 3 ^ 9 4 (gegen die strukturalistische Interpretation Priviteras [oben Nr. 21]; die philologisch-exegetische Lektüre des Liedes müsse ersetzt werden durch eine intuitive ästhetische). T. McEvilley, Sappho. Fragment Thirty One: the face behind the mask, Phoenix 32 (1978) 1-18. Ruth Neuberger-Donath, Sappho 31. 2s. ... οττις ένάντιός τοι /ίσδάνει, Acta Classica 20(1977) 199 f. O. Tsagarakis, Some neglected aspects of love in Sappho's Fr. 31L.-P., Rh. Mus. 122 (1979)97-118. G. Addivinola, Amore e morte nella poesia di Saffo, Riscontri 2 (1980) 41-54. A. M. van Erp Taalman Kip, Enige interpretatie-problemen in Sappho, Lampas 13 (1980) 336-354 (341-345 zu Fr. 31: die göttliche Ruhe des Mannes ist Sapphos erotischer Exzitation gegenübergestellt). Simonetta Nannini, Saffo e Calipso: Horn. Od. 5,154s. e 198, Sapph. frr. 1,23 s. e 31,2 s. V., QUCC 34 (1980) 37 f. (Sapphos Liebe ist noch geheim; sie hat Angst, das Mädchen könnte sie nicht erwidern). L. Rissmann, Homeric allusion in the poetry of Sappho, Diss. Ann Arbor (L. Koenen) 1980: abstract in DA 41 (1980) 662 a (Wiederaufnahme der Hochzeitsliedthese; der ,Mann' ist der ,göttliche' Held des Epos, Sappho ist eine .kleine Kämpferin'). E. Robbins, „Everytime I look at you ..."!: Sappho Thirty-One, TAPhA 110 (1980) 255261 (erneute Wiederaufnahme von Welckers Deutung [s. oben Nr. 34]). J. M. Bremer, A reaction to Tsagarakis' discussion of Sappho fr. 31, Rh. Mus. 125 (1982) 113-116. D.E. Gerber, Studies in Greek Lyric Poetry: 1975-1985 (Part I), CW 81, 1987, 140. E. Lefèvre, Otium und τολμάν. Catulls Sappho-Gedicht c. 51, Rh. Mus. 131, 1988, 324337. F. Lasserre, Sappho. Une autre lecture, Padova 1989, 147-160.
344 42
43
Realität und Imagination W. Rösler, Realitätsbezug und Imagination in Sapphos Gedicht ΦΑΙΝΕΤΑΙ MOI KHΝΟΣ, in: Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den Griechen, hrsg. v. W. Kullmann / M. Reichel, Tübingen 1990 (= ScriptOralia 30), 271-290. M. Weißenberger, Liebeserfahrung in den Gedichten Sapphos und das Problem des Archaischen, Rh. Mus. 134, 1991, 209-237.
Museum Helveticum 49, 1992, 3-12
„Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..." Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 a W.) 1 Nach wie vor stellt die 1974 edierte1 Kölner Epode des Archilochos ein ungelöstes Rätsel dar. Alle Bemühungen des internationalen Experten-Aufgebots konnten auch bei diesem Fragment nicht mehr bewirken als bei wohl 90% der frühgriechischen Lyrik-Überreste insgesamt: die Schwierigkeiten der Textkonstitution haben eine zum poetischen Kern vorstoßende Gesamtdeutung und ästhetische Würdigung auch hier bisher verhindert. Von 1974 bis 1987 sind rund 120 SpezialStudien erschienen2; in nur wenigen davon finden sich Ansätze, das Fragment für eine dringend nötige Archilochos-Poetik auszuwerten, und auch diese sind inzwischen seltener geworden: wo keine feste Basis ist, regiert Beliebigkeit und ein Konsens scheint unerreichbar. Das ist um so unbefriedigender, als gerade dieser Torso mit seinen 53 Versen kraft seiner evidenten dichterischen Qualität die Kenner nachgerade sinnlich spüren läßt, welche Schlüsselstellung das unzerstörte Ganze in einer analytischen Bestimmung der künstlerischen Höhenlage frühgriechischer Dichtung einnehmen würde. Rhythmik und Sprachmelodie, Rhetorik und Metaphernspiel, Fülle und Nuancenreichtum der angeschlagenen Töne - Aggressivität, Spott, Ironie, Sarkasmus, Humor, Schelmerei, sympathieheischende Übertreibung, Schmeichelei, einfühlsame Werbung, Realismus, Fürsorglichkeit und Zartgefühl - lassen die Meisterschaft erahnen, mit der hier unter der Oberfläche eines Verfiihrungs.berichts' Publikumsverführung betrieben wird - Verführung durch Sprache, ήδονή. Von fernher wird begreiflich, wieso schon Heraklit Archilochos - zusammen mit Homer! - aus den Dichter- Agonen entfernen wollte (VS 22 Β 42 DK), und das vorgebliche .archaische'
1
R. Merkelbach/M. L. West, Ein Archilochos-Papynis, ZPE 14 (1974) 97-113. Gesammelt und typologisch geordnet in der Basler Lizentiatsarbeit von R. Stockmar, Die .Kölner Epode' des Archilochos (1990). 2
346
.Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere.
Gepräge der frühen griechischen Dichtung3 - angesichts der Virtuosität der hier demonstrierten hochreflektierten Hörerlenkung löst es sich in nichts auf. I 2
4
Die in den letzten Jahren weithin eingeschlafenen Bemühungen, wenigstens ein Stückweit in die Sphäre der .Höheren Kritik' hinaufzugelangen, können erneuten Auftrieb - sofern nicht Zusatzfunde helfen - nur durch Fortschritte in der Erhellung der Elementarprobleme dieses Texts erhalten. Unter diesen nimmt die Frage, worin die τέρψις eigentlich konkret besteht, um die der Sprecher das Mädchen bittet (V. 13. 22), eine Vorzugsstellung ein. Daß die „endless speculations on this problem [...] futile" seien, daß „we do not know [it] and we are not meant to know", daß, schließlich, „the interpretation of this poem should start precisely with this uncertainty" (51), ist die einzige m. E. wirklich folgenreiche Fehlbeurteilung in der sonst außergewöhnlich förderlichen Neukommentierung des Fragments durch Slings 19874. Nicht nur würden nämlich durch die Lösung dieser Frage verschiedene Folgekontroversen auf der gleichen Elementar-Ebene entschieden werden können (z. B. die Frage des Umfangs und der spezifischen Art der Metaphorik in diesem Text, besonders in den Versen 21-24), sondern es würden dann auch Fragen eben jener .Höheren Kritik' beantwortbar - etwa das Problem, welches Bild der Frau in diesem Text vorausgesetzt (oder vom Autor tendenziös gezeichnet) wird, daran anschließend die Frage, für welches Publikum der Text primär bestimmt war, endlich, als Konsequenz davon, die Frage, ob dieser Iambos tatsächlich, wie im Gefolge Martin Wests5 nicht wenige verstehen, einen eher konventionellen ,Kulttext' im Rahmen des Beschimpfungsritus darstellt oder ob er doch vorwiegend biographisch6 auszudeuten ist. Daß damit dann die aktuelle Diskussion um Autor-Ich und lyrisches Ich erreicht wäre, liegt auf der Hand. Unbewußt sieht auch Slings selber das nicht anders. Dies zeigt sich darin, daß er an der m.E. entscheidenden Stelle, in V. 21, eine Konjektur macht, von der er meint, sie könne „continue and clarify the metaphor". Das ist sehr vage ausgedrückt. In Wahrheit widerlegt der Kommentator durch eben diese Konjektur sein eignes Credo, das er ans Ende seiner Arbeit
3
Dazu Verf., Die griechische Literatur in Text und Darstellung. Band 1: Archaische Periode (Stuttgart 1991) 14. 144-149. 4 S. R. Slings, First Cologne Epode, in: Some Recently Found Greek Poems. Mnemosyne, Supplementum 99 (Leiden etc. 1987) 24-61. 5 M. L. West, Studies in Greek Elegy and Iambus (Berlin - New York 1974). 6 So jetzt wieder Slings, a. O. 35.
Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 a W.)
347
stellt: „It is therefore better to assume that no information at all is provided as to how the narrator's orgasm is reached": wenn keine Information darüber vom Autor vorgesehen wäre, dürfte der Kommentator sie auch nicht durch eine Konjektur .einschmuggeln' wollen. Das aber tut er. Das Wort, das Slings in 21 konjiziert, ist ύποφ[λύσαι. Auf Seite 28 zu V. 14 (in Slings' Sonderzählung) erfahren wir, daß er diese Konjektur, nach anders orientierten früheren Versuchen, erst in „this edition", also 1987, vorlege. Im eigentlichen Kommentar, auf Seite 39, wird die Konjektur in ebenso lakonischer Manier nur vorgestellt („I can think of nothing better than ύποφλύσαι [not attested, cf. fr. 45 άπέφλυσαν] ..."), nicht abgesichert oder gar erläutert: I entwe- 5 der eine unbewußte Reaktion, um den Selbstwiderspruch mit dem oben zitierten Credo möglichst klein zu halten, oder ein Zeichen dafür, daß dem Erfinder die Bedeutsamkeit seiner Erfindung gar nicht klar war. In jedem Fall verhinderte das Fehlen jeder näheren Begründung die Rezeption des Vorschlags: West setzte in seiner ,Editio altera aucta atque emendata' der , Iambi et Elegi Graeci' von 1989 zu V. 21 weiterhin sein ύποφ[θάνειν in den Apparat, das er schon in der editio princeps von 1974 vorgeschlagen (und in den .Delectus' von 19807 übernommen) hatte. Slings' Vorschlag wird noch nicht einmal erwähnt. Daß ύποφθάνειν nicht der Weisheit letzter Schluß ist, konzediert West 1989 selbst durch ein (bei eignen Konjekturen eher seltenes) „fort." (im .Delectus' 1980: „possis"). Slings weist ύποφθάνειν zurück mit der Begründung, es bedeute nicht ,to be first', sondern ,to be earlier'. Sinnvoll wäre in unserem Zusammenhange beides nicht: „unterhalb von Mauerkrone und Tor zuvorzukommen mißgönn mir nicht, mein Lieb!" ist schlechthin unverständlich, „... erster zu sein ..." nicht minder: daß auch das Mädchen eine τέρψις haben solle, wird ja im Kontext eigens ausgeschlossen - V. 14 νέοισιν ά ν δ [ ρ ά σ ι ν - (worin dann .zuvorkommen'?), und darauf, daß er unbedingt der ,erste' bei dem Mädchen sein will, stellt der Sprecher in seiner ganzen Werbung nirgends ab (daß ύποφθάνειν regelmäßig als modales Partizip zu einem anderen Verb verwendet wird, also nicht das ,Eher-Sein' an sich bezeichnet, sondern das ,Eher-Sein' worin, sei nur am Rande angemerkt), ύποφθάνειν ist also aufzugeben. (Die weiteren Vorschläge - aufgezählt von Slings 28 ζ. St. - lohnen keine Diskussion.) Aus eben diesem Ungenügen an ύποφθάνειν - und dem Gefühl, daß an dieser Stelle, am Ende von V. 21, das entscheidende Verb gestanden haben muß, das den Inhalt des μ]ή τι μεγαιρε (22) und damit das Ziel der ganzen Verführungs7
Delectus ex Iambis et Elegís Graecis, ed. M. L. West (Oxford 1980).
348
.Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..."
strategie bezeichnete - habe ich in einer Archilochos-Vorlesung des Wintersemesters 1987/88 das gleiche Verb wie Slings ins Spiel gebracht (zunächst noch im Inf. praes.: ύποφλύειν); im Archilochos-Kapitel von Band 1 der .Griechischen Literatur in Text und Darstellung'8, das zur gleichen Zeit entstand, habe ich dann den Infinitiv (aor.) ύποφλύσαι gleich in den Text gesetzt (S. 264) und in Unkenntnis des etwa zeitgleich erschienenen Kommentars von Slings - im Apparat z. St. als meine eigene Konjektur bezeichnet. Als Walter Burkert mir Anfang 1988 seinen Archilochos-Aufsatz ,Die betretene Wiese' zusandte, antwortete ich am 2.2.1988 mit einem dreiseitigen Brief, der meinen Vorschlag präsentierte und begründete9.1 6 Diese Übereinstimmung zweier unabhängig voneinander arbeitender Archilochos-Interpreten im Verständnis einer vorher 13 Jahre lang ungeklärten Stelle schien mir bemerkenswert genug zu sein, Martin West in einem Gespräch (18.11.1990) damit bekannt zu machen. Seine Antwort war, das Verb ύποφλύειν passe nicht zum Stil des Textes. Er führte damit eine Grundvorstellung von der Stil-Ebene der Epode weiter, die er seit der editio princeps verteidigt hatte: Merkelbachs λευκ]όν... μένοβ in V. 52 ζ.Β. hatte er schon 1975 abgelehnt mit gleicher Argumentation: „... and so graphic a reference to the physical semen is out of keeping with the style of the song"10. Es gilt sonach, West für die Auffassung zu gewinnen, daß (von λευκόν einmal abgesehen) zumindest das Verb ύποφλύσαι für eiaculari mit dem Stil der Kölner Epode im Gegenteil sogar sehr gut vereinbar wäre. Darüber hinaus gilt es zu zeigen, daß ύποφλύσαι für das, was an dieser Stelle des Textes ausgedrückt werden mußte, sogar die optimale Lösung war. 3 Zuerst das zweite: die Einordnung des Wortes in den Argumentationsverlauf des Sprechers. - Das Mädchen hatte eine μίξις abgelehnt (πάμπαν άποσχόμενος V. 1 ; s. dazu Slings ζ. St.). Sie hatte aber die Erregtheit ihres Partners sehr wohl 8
S. oben Anm. 3 (hier S. 243-269). W. Burkert, Die betretene Wiese. Interpretenprobleme im Bereich der Sexualsymbolik, in: Die wilde Seele. Zur Ethnopsychoanalyse von Georges Devereux, hrsg. ν. Η. P. Duerr (Frankfurt/M. 1987) 32-46. - Burkerts Antwort (Karte v. 15.2.1988): „ύποφλύειν ist ein interessanter Vorschlag, vielleicht besser als ύποφθάνειν." 10 M. L. West, Archilochus Ludens. Epilogue of the Other Editor, ZPE 16 (1975) 217; erörtert von Slings S. 50. Ganz im Sinne Slings' (und unabhängig von ihm) meine Bemerkung in Griechische Literatur (s. oben S. 1, Anm. 3) 265 Anm. 14: „der Unterschied zum Ton der Nummern 2 5 - 3 0 liegt auf der Hand." 9
Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 aW.)
349
wahrgenommen (V. 3: die Doppelung von έπείγεαι im absoluten Gebrauch und σε θυμός ίθύει legt dem Mädchen in gerade noch angemessener Ausdrucksweise in den Mund, was der Sprecher vom Publikum in der Darbietungssituation des Textes an sich, dem Sprecher der Fiktionssituation, wahrgenommen wissen will: in beiden Verben gehen die Begriffe ,Eile' und ,Getriebenheit, Begierde' eine innige Verbindung ein). Als ,Ventil' hatte sie ihm eine andre offeriert. Daraufhin besteht der Sprecher - durch die Versagung offensichtlich nur noch mehr in Glut versetzt - darauf, sofort zu bekommen, was er jetzt, weil ihn der Trieb im Griff hat, bekommen muß: die Entleerung: (13) τ]έρψιές εΐσι θεής πολλαί νέοισιν άνδ[ράσιν παρέξ το θείον χρήμα - των τις άρκέσε[ι. Befriedigungen" kennt die Göttin vielerlei für junge Männer außerhalb des göttlichen Geschäfts! davon wird's éine (bestimmte) tun! I
Der Sprecher redet von Befriedigungen ausschließlich für junge Männer (nicht 7 für Mädchen; auch von Slings hervorgehoben). Solche Befriedigungen kennt er also. Er bittet demnach um eine Gunst, die unter jungen Männern gängig war. Er könnte derart wissend und erfolgsgewiß nicht davon reden, wenn er sich darauf nicht verstünde. Was das für τέρψεις waren, wissen wir aus literarischen und bildlichen Darstellungen zur Genüge: Masturbation, homosexueller Interkruralverkehr, homosexueller Analverkehr u. a.12. „Davon wird's eine tun!" Das Mädchen kann natürlich nicht wissen, was der Sprecher vorhat. Um sie dafür zu gewinnen, muß er's ihr genau erklären (nachdem er die Erörterung aller anderen Probleme, die ihn in seinem momentanen Zustand selbstverständlich wenig interessieren, fortgeschoben hat; wir denken an die Szene zwischen Kinesias und Myrrhine in Aristophanes' Lysistrate, V. 904-951): (19)
π]είσομαι ώς με κέλεαν πολλόν μ' ε[ θρ]ιγκοΰ δ' ενερθε και πυλέων ύποφ[λύσαι μ]ή τι μέγαιρε, φίλη* Folgsam will ich so tun, wie du mich heißt: weit (etwa: halt' ich) mich (vom Eingang fern),
" Zu dieser Übersetzung von τέρψιες s. Verf., Zum Wortfeld .Freude' in der Sprache Homers (Heidelberg 1966) 174—219 (Zusammenfassung 217 f.). Aus der reichhaltigen Literatur seien hier nur genannt: K. J. Dover, Greek Homosexuality (London 1978, Cambridge/Mass. 21989) 97-99, und W. A. Krenkel, Masturbation in der Antike, Wiss. Zeitschr. Univ. Rostock 28 (1979) Heft 3, 159-178.
350
„Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..." doch unterhalb von Mauerkron' und Tor überzulaufen weig're mir nicht, du mein Lieb!
Die Folgsamkeit soll durch eine Ersaizbefriedigung belohnt werden. Daß die Befriedigung als solche in der eiaculatio bestehen muß, ist seit Beginn der Unterredung beiden klar; es kann nur darum gehen, wie (und das bedeutet beim erreichten Stand der Dinge: wo) sie geschehen soll. Vergleicht man einmal nur die (17) Trimeter unsres Textes miteinander, bemerkt man, daß die sinntragenden und den Gedanken weiterführenden Begriffe überwiegend in die Position vor dem zweiten anceps gesetzt sind (έπείγεαι 3; τέρεινα 6; το θείον 15 usw.). In V. 21 ist demnach ενερθε stark betont. Wenn aber der Erguß unterhalb von .Mauerkron' und Tor' erfolgen soll, kann nur der gesamte Bezirk unterhalb des Damms gemeint sein, also nicht etwa der mons pubis (wie weithin immer noch verstanden wird), der ja gerade oberhalb liegt. .Unterhalb' kann dann nur inter crura (besser: inter femora) bedeuten, eine gängige Praxis des homosexuellen Verkehrs unter Männern, die als διαμηρισμός bezeichnet wurde (Dover 98). Damit das Mädchen, von dem vorausgesetzt wird, daß es derlei Praktiken nicht kennt, auch sicher sein kann, daß dabei nichts .passiert' (s. Slings zu V. 35, S. 50), erklärt der Sprecher dann den weiteren Verlauf: (μ]ή τι μέγαιρε, φίλη-) σχήσω γαρ ές πρη[ κ]ήπους· I (... weig're mir nicht, du mein Lieb!) Ich werde nämlich auf den Gras (tragenden o. ä.) Garten zu halten.
Daß diese ποη[ κήποι hier der mons pubis sein sollen (so, kategorisch, Slings ζ. St.; dagegen unentschieden Burkert 1987, 39), ist im Lichte der bisher gegebenen Deutung nicht nur unwahrscheinlich, sondern schlicht unmöglich. Nicht nur die Anatomie gibt das nicht her, es wäre auch nicht dazu angetan, das Mädchen zu beruhigen (vgl. Slings zu V. 35, S. 50, der aber nicht die Folgerung für die Bedeutung von ποη[ κήπους zieht12a). Erfolgt der Erguß jedoch unterhalb 12a £>er Sprecher unterstellt dem Mädchen trotz dessen Jugend (Neobule ist δις τόση, V. 26!) ein klares Wissen um den Zusammenhang von eiaculatio und Empfängnis, und zwar nicht nur durch die Konzentrierung des Gesprächs auf eben diesen Punkt (besonders signifikant: V. 3 9 41), sondern vor allem durch die Verzahnung von Forderung des Mädchens (πάμπαν άποσχόμενος 1) und Zusage des jungen Mannes (πείσομαι ώς με κέλεαΐ" κτλ. 19 ff.; πάμπαν άποσχόμενος bedeutet hier schwerlich, in absolutem Gebrauch, ,dich in Enthaltung übend', sondern hatte nach aller Wahrscheinlichkeit, wie üblich, ein konkretes Objekt [,dich enthaltend] von XYZ' im Genitiv oder Infinitiv bei sich, πολλόν μ' ε[ 20 dürfte genau darauf antworten). Die damit zugleich unterstellte ,Vorsicht' des Mädchens (ob ohne Hintersinn oder als besonders raf-
Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 aW.)
351
des Damms - zwischen den μηροί herbeigeführt (διαμηρίζειν, Dover 98) - , und zwar im Liegen (έκλινα 44), dann ergießt der Samen sich ins Gras - in welchem ja der Akt dann in der Tat erfolgt: έν ανθε[σιν / τηλ]εθάεσσι λαβών / έκλινα 42-44. Daß es das Mädchen so verstanden hat (und akzeptiert), zeigt es durch sein Gewähren (der Sprecher vergewaltigt sie ja nicht). Das Ergebnis ist programmgemäß: θερμ]όν άφήκα μένος 52 (beim Umfangen, An-sich-Drücken und Liebkosen; daß ξανθής in 53 nicht das Schamhaar meinen kann und daher nicht mit τριχός komplettiert werden muß, sondern mit κόμης ,lang herabfallendes Haupthaar', hat Slings zu V. 35, S. 50, überzeugend klargemacht). Das πρώτον ψεΰδος der bisherigen Interpretation ist, so gesehen, die starre automatische Verknüpfung von ενερθε θριγκοΰ και πυλέων 21 und ές ποη[ κήπουβ 23/24 zu zwei Bestandteilen derselben Aussage-Ebene; daraus resultierte die Alternative ,entweder beides metaphorisch oder beides nicht-metaphorisch'; Interpreten wie Degani/Burzacchini, die ποη[ κήπους konkret als .giardino' verstehen wollten, glaubten sich infolge dieses Automatismus dazu verpflichtet, auch ενερθε θριγκοΰ και πυλέων konkret als ,il cornicione e le grandi porte del tempio' (sc. einer Göttin, z.B. Hera13 ) aufzufassen, und zogen sich damit den Spott zu: „Are we really to believe that the speaker invites the girl for a ride in the park?" (Slings zu I θ]ριγκοΰ). Ein Zwang zu derart automatischer Verknüpfung besteht in Wahrheit nicht. Wenn der Sprecher dem Mädchen die Praktik des διαμηρισμός erläutern wollte, war er lediglich bei der Erklärung des eigentlichen Akts gezwungen, Körperteile zu benennen - was er in V. 21 durch schonende Umschreibung tut. Die zur Beruhigung bestimmte und den Widerstand des Mädchens auf physischer Ebene dann auch tatsächlich überwindende Ankündigung der Art und Weise der Beendigung des Akts dagegen bedurfte nicht nur keiner Metaphern mehr, sondern mußte unter den gegebenen Voraussetzungen desto überzeugender wirken, je planer sie erfolgte.
finierte Form, ins Zwielicht zu setzen, nach dem Motto ,fiir ihr Alter weiß sie allerhand') hat ihren Realgrund im mangelhaften Wissen der Zeit um Kontrazeption: „The scanty evidence available suggests that the contraceptive knowledge of antiquity was confined largely to the heads of medical encyclopedists, to a few physicians and scholars. The average citizen was probably quite ignorant of the subject - even, indeed, as he is today": Ν. E. Himes, Medical History of Contraception (Baltimore 1936, New York 2 1970) 100; vgl. W. A. Krenkel, Familienplanung und Familienpolitik in der Antike, WüJbb Ν. F. 4 (1978) 197-203. 13 E. Degani/G. Burzacchini, Lirici Greci. Antologia (Firenze 1977. 5 1986) 14 f. zu den Vv. 14-16.
9
352
.Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..."
Das Mädchen gewährt also hier dem Sprecher (wie er seinem Publikum suggeriert) etwas, was sonst nur homosexuelle Praxis unter Männern war 14 : welche Wirkung diese Behauptung auf das (männliche) Publikum - und gegebenenfalls, bei biographischer Deutung, auf die eigentlichen Adressaten (die LykambesSippe) - haben mußte, wäre in einem Neuansatz zu klären. 4 Damit können wir zur Frage der Stilhöhe des Wortes φλύω übergehen. Eine Sammlung und Interpretation sämtlicher Belegstellen des Simplex und der Komposita (άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι-, περιφλύω, dazu ύπερφλύζω) sowie der zugehörigen Nomina (φλύος, φλυσμός, φλυκτίς) und Erweiterungen (φλύζω mit Komposita) - insgesamt mehr als 50 Stellen von Homer bis zu den Kirchenvätern und spätantiken Lexika - hat ergeben, daß das Verb nur mit folgenden 4 Bedeutungsvarianten auftritt: (1) .schwellen, strotzen' (Vegetation); (2) »aufwallen, kochen, sieden, überlaufen' (Flüssigkeiten); (3) .ausstoßen, erbrechen u. ä.' (auch hier vor allem Flüssiges); (4) .sabbern, schwatzen' (ebenfalls mit Flüssigkeits-Vorstellung). In keinem einzigen Falle liegt obszöner Gebrauch vor 15 . Die erste Belegstelle innerhalb der Gräzität weist bereits die wesentlichen Komponenten der Hauptverwendungsweise auf:
io
(II. 21,361; Skamander hat Hephaistos, von dessen sengender Flamme bedrängt, um Einhalt gebeten) Φηπυρί καιόμενος, ά ν α δ ' ε φ λ υ ε καλά ρέεθρα, ώςδέ λέβης ζει ένδον έ π ε ι γ ό μ ε ν ο ς πυρίπολλω, κνίσην μελδόμενος άπαλοτρεφέος σιάλοιο, πάντοθεν άμβολάδην, ύπό δέ ξύλα κάγκανα κείται, ώς του καλά ρέεθρα πυρί φλέγετο, ζέε δ' ϋδωρ. (und Skamander bittet Hera, Hephaistos .zurückzupfeifen'; dies geschieht; daraufhin) I ... "Ηφαιστος δέ κατέσβεσε θεσπιδαές πυρ, αψορρον δ' αρα κύμα κατέσσυτο καλά ρέεθρα. So sprach er, brennend, und aufbrodelten die schönen Fluten, und so wie eine Pfanne innen siedet, bedrängt von starkem Feuer,
S. Dover, a.O. (oben Anm. 12; Ausnahmen selten und unsicher [Vasenbilder]). ^ Für die manuelle Zusamenstellung und gewissenhafte Auswertung der Belege danke ich Annemarie Ambühl (Ölten - Basel), für die Kontrolle und hilfreiche Erweiterung des Materials mittels CD-ROM René Nünlist (Basel).
Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 a W.)
353
die das Fett ausschmilzt von einem wohlgenährten Mastschwein, überall hochspritzend, und drunter liegen dürre Scheite, so wurden bei diesem die schönen Fluten gesengt vom Feuer und kochte das Wasser; (...) ... und Hephaistos erstickte das gott-entzündete Feuer, und zurück stürzte da die hoch-aufgeschwollene Woge hinab in die schönen Fluten.
Bemerkenswert schon hier, daß das άναφλύειν kausal verknüpft wird mit dem Verb έπείγεσθαι, das ja auch in unserem Archilochos-Text eine herausragende Rolle spielt (V. 3 und 40; vgl. Slings S. 31: „the keynote"). Spätere Erklärungen des Verbs in Scholien bleiben auf exakt der gleichen Linie: (1) Schol. in Apoll. Rhod. 1,275 a: φλύζειν δέ κυρίως τους λέβητας φαμεν καιομένους άναβάλλειν τη θερμότητι το ϋδωρ; (2) Schol. ree. in Aisch. Prom. 504: μάτην φλΰσαι (richtig: φλύσαι, s. Wests Ausgabe 1990)] ψευδώς φλυαρήσαι. Β. κατά παράχρησιν το φλΰσαι· κυρίως δέ φλύω έστίν έπί σιδήρου παφλάζοντος. ή καί άλλως· ποια λέξις των λοπαδίων τό φλΰ φλΰ, όταν βράζωσιν („Eigentlich bezieht sich φλύω auf bullerndes Eisengerät. Oder anders: Ein kleine Pfannen betreffender Ausdruck ist φλΰ [= plu-plu], wenn diese sieden."16). Mit dieser Bedeutung eignete sich das Verb ebenso für die ,küchentechnische' Gebrauchsweise wie für die medizinterminologische (Corpus Hippocraticum, Galenos, Dioskorides usw.: von Blut und anderen Körperflüssigkeiten); mit der Nuance ,sabbern, schwatzen' empfahl es sich insbesondere für die poetische (Aischylos, Nikander, Anthologia Palatina usw.); mit der Nuance ,(her)ausstoßen, sich erbrechen' kommt es in weiter Streuung in allen möglichen Textsorten vor. Sämtliche Verwendungsweisen sind ,seriös', Zweideutigkeiten sind nicht belegt. Das wird vor allem damit zusammenhängen, daß das Wort ursprünglich unbezweifelbar onomatopoetisch ist (.blubbern'; .bubble up': LSJ), wie Eva Tichy in einer umfassenden Aufarbeitung des Materials 1983 nachgewiesen hat 17 . Die Vielzahl der Komposita - in manchen Fällen nur ein Mal belegt - zeigt, daß Augenblicksbildungen jederzeit erfolgen konnten. In V. 21 der Kölner Epode ist der entscheidende Begriff das .unter' (ενερθε). Da nun unser Text geradezu dadurch charakterisiert ist, daß er gern doppelt (dazu Slings zu έπείγεαι καί σε θυμός ίθύει, S. 32), kann die Doppelung ενερθε - ύ π ο φλύσαι I an gerade dieser Stelle, die die entscheidende Klärung des vom Sprecher angezielten Verfahrens bringt, um so weniger verwundern. Unter dem Druck, jeglichen Vul16 Übersetzung von Eva Tichy, Onomatopoetische Verbalbildungen des Griechischen (Wien 1983) 139 Anm. 125. 17 S. Anm. 16 (hier: 136-141).
il
354
.Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..."
garismus zu vermeiden (der erniedrigen und darum das Gegenteil des Gewollten bewirken würde) und doch unmißverständlich das Gemeinte zu benennen, bildet der Sprecher ,aus dem Augenblick heraus' das eher freundliche - wenn nicht gar, in Anbetracht der .Küchenherkunft' dieses Wortes, ein wenig komisch auf das Mädchen wirkende - ύπο-φλύσαι ,unten überlaufen': eine Umschreibung, die, indem sie das Mädchen einen gewissen Aufwand an Kreativität beim Werbenden spüren läßt, der Adressatin sowohl echtes Bemühen als auch Achtung verrät und dadurch für den Sprecher einnimmt (ein konstitutives strategisches Element jeglicher Werbepsychologie). Wenn aber der Liebhaber das umworbene Mädchen mit seinen sprachlichen Originalitätsbemühungen erst einmal zu einem kleinen Lächeln bringen kann, ist schon viel gewonnen (den Rest wird dann die Weiterführung der Strategie auf der psychologischen Ebene - die Abwertung der .anderen' und die Erklärung der Einzigartigkeit der Angebeteten [24-34. 35/36. 37-41] - besorgen)18. Als Fazit läßt sich festhalten, daß das Verb das Gemeinte keinesfalls obszön benennt, sondern es - im Einklang mit der Metaphorik des Anfangs dieses Verses 21 - bildhaft umschreibt. Das Publikum wird die einfallsreiche Treffsicherheit, mit der ein .harmloses' Alltagswort in diesem Zusammenhang vom .Erzähler' ad hoc zum Ausdruck eines sexuellen Vorgangs umfunktioniert worden sein wollte, vermutlich nur bewundert haben. 5 Hier könnten wir die Akte schließen - wäre da nicht ein Phänomen, das die Konjektur ύποφ[λύσαι zusätzlich zu stützen scheint: Unter den rund 300 Fragmenten, die wir noch aus Archilochos' Liedern haben, sind zwei, in denen er das Wort φλύ(ω) selbst benutzt: (Fr. 45W.) κύψαντεςϋβριν άθρόην ά π έ φ λ υ σ α ν (Fr. 284 W., aus Herodian) καί φλω φ λ ύο ς παρ' Άρχιλόχω έπί φλυαρίας. In beiden Fällen ist das Wort zwar nicht in der zweiten der oben aufgezählten vier Bedeutungsvarianten gebraucht, aber die Stellen zeigen etwas, was für uns 18
So, in vorzüglicher Strukturanalyse, Slings, a. O. 34 f. - Van Sickle's Kritik, Slings' Kommentar huldige zu sehr dem „traditional focus on detail at the expense of wider structure and scope", scheint mir auf unaufmerksame Lektüre zurückzugehen; Van Sickle's „comment" zu Slings' ύποφλύσαι verdient diesen Namen nicht (J. Van Sickle, Praise and Blame for a ,Full Commentary' on Archilochus, First Cologne Epode, BICS 36 [1989] 104-108 [hier: 108. 106 Anm. 14]).
Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196a W.j
355
viel wesentlicher ist: das Wort gehörte zum individuellen poetischen Sprachschatz des Archilochos. Womöglich noch bedeutungsvoller ist ein zweites Faktum: In der Anthologia Palatina haben wir bekanntlich zwei Epigramme ver-l schiedener Verfasser, die sich auf die Lykambes-Geschichte beziehen (abge- 12 druckt bei West vor Fr. 30, p. 15). In beiden wird den Töchtern des Lykambes eine Apologie gegen die Verleumdungen des Archilochos in den Mund gelegt: züchtige Mädchen seien sie gewesen, zu Unrecht habe Archilochos sie so geschmäht! In beiden Epigrammen lautet der entscheidende Begriff, mit dem bezeichnet wird, was Archilochos an ihnen tat, φλύσαι: (A. P. 7,351 = Dioscorides epigr. 17) 5 άλλα καθ' ήμετέρης γενεής ριγηλόν όνειδος φήμην τε στυγερήν ε φ λ υ σ ε ν 'Αρχίλοχος. (Α. Ρ. 7,352 = Meleager [?] epigr. 132) 3 πολλά δ' ό πικρός αισχρά καθ' ήμετέρης ε φ λ υ σ ε παρθενίης Αρχίλοχος. Auch wenn wir unterstellen, daß der zweite Verfasser den ersten nur imitiert (dazu Degani/Burzacchini S. 28): wo hat der erste den ja nicht allzu häufigen Begriff φλύσαι für die Bedeutung Jemanden mit Schimpf und Schande überschütten' her? Bisher wurde gern auf das oben zitierte Fragment 45 W. verwiesen: „Evidente l'allusione dotta - típicamente alessandrina - all' άπέφλυσαν del nostro frammento": Degani/Burzacchini S. 28. Da ergibt sich allerdings sofort die Schwierigkeit, daß die alexandrinischen Epigramme von den Mädchen des Lykambes sprechen, in Fr. 45 jedoch das Maskulinum steht (κύψαντες). Die Erklärung dieses .kleinen Anstoßes' - von Degani/Burzacchini in Klammern herunterspielend lässig nachgeschoben - lautete: „il masch. κύψαντες rivela che non solo le figlie, ma anche il padre era preso di mira dal poeta." Solange man für φλύω im überlieferten Archilochos nur den einen Beleg άπέφλυσαν im Fragment 45 hatte, war diese Art der ,Hindernisbeseitigung' nur zu gut verständlich. Im Lichte der hier vorgeschlagenen Ergänzung stellen sich die Dinge anders dar. Daß die alexandrinischen Epigramme insbesondere auf unsere Kölner Epode reagieren (ριγηλόν όνειδος, φήμην στυγερήν, πολλά αισχρά ... καθ' ήμετέρης π α ρ θ ε ν ί η ς , vgl. αν]θος δ' άπερρύηκε π α ρ θ ε ν ή ϊ ο ν über Neobuie in V. 27 unserer Epode), wird man kaum bezweifeln können. Es wäre demnach nicht verwunderlich, wenn jenes Wort, mit dem die Späteren die in ihren Augen möglicherweise ärgste Schmähung der Lykambes-Töchter in diesem Lied bezeichnet sahen (s. oben zum ursprünglichen Ort des διαμηρισμός), die
356
„Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere..."
Epigrammverfasser ganz besonders umgetrieben (und zur Verwendung mit gelehrter Änderung der Bedeutungsvariante inspiriert) hätte: ύποφλύσαι.
(Symposion ,Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den Griechen', Freiburg i. Br., 11.-14.10.89) ScriptOralia 30, 1990, 227-264
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur* Günter Neumann Septuagenario Für das frühgriechische Symposion ist in der Altertumswissenschaft in den letzten zwanzig Jahren ein beachtlicher Forschungsaufwand getrieben worden (siehe die Bibliographie unten S. 390-395). Niemand würde diesen Aufwand für gerechtfertigt halten können, wenn es sich beim συμ-πόσιον nur um das gehandelt hätte, was der Name zu besagen scheint: um ein gemeinschaftliches Trinkgelage. In diesem Falle hätte der Gegenstand tatsächlich nicht mehr verdient als das antiquarische Interesse, das ihm bis etwa zur Mitte unseres Jahrhunderts in reichem Maß zuteil geworden ist, in Arbeiten wie denen von Martin, Bielohlawek, Herter, Von der Mühll und anderen.1
* Der Beitrag wurde erstmals am 23.9.1988 als Vortrag in englischer Sprache mit anderer Akzentsetzung und in anderem Aufbau beim .Second Symposium on Symposia' an der Universität Hamilton/Ontario (Kanada) vorgelegt (für die Einladung dorthin sage ich William J. Slater meinen aufrichtigen Dank) und anschließend als Vortrag in verschiedenen Versionen an den Universitäten Ann Arbor/Mich., Cornell, Brown wiederholt; allen kanadischen und amerikanischen Kollegen, die mich in der Diskussion gefördert haben, danke ich herzlich. - Für das Freiburger Symposion wurde eine neue Fassung erarbeitet, die auch die inzwischen erschienene Literatur noch einbeziehen konnte; Wolfgang Kulimann bin ich für die Einladung zu dem ungewöhnlich anregungsreichen Freiburger Symposion zu großem Dank verpflichtet. - Für die hier vorgelegte schriftliche Fassung war mir ganz besonders förderlich die soeben erschienene brillante Studie von Richard Kannicht, Thalia. Über den Zusammenhang zwischen Fest und Poesie bei den Griechen, in: W. Haug/R. Warning (Hrsgg.), Das Fest (Poetik und Hermeneutik XIV), München 1989, 29-52 (Kannicht steckt sozusagen den Großrahmen ab, innerhalb dessen meine Spezialfragestellung steht; sachlich ergänzen die beiden Arbeiten einander um so besser, als im Grundsätzlichen, soweit ich sehe, völlige Übereinstimmung besteht). 1 Die im Text nur durch Verfassernamen oder Verfassernamen + Publikationsjahr gekennzeichneten Arbeiten sind in der Bibliographie unten S. 390-395 nachgewiesen.
358
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
In den letzten zwanzig Jahren jedoch hat das Interesse am Symposion eine neue Dimension erhalten. Durch eine Reihe von einschlägigen Untersuchungen 228 ist klar geworden, daß das frühgriechische Symposion eine tragende I Rolle im Entwicklungsprozeß der griechischen Literatur gespielt hat, d. h. in jenem Prozeß, der durch die Erfindung der griechischen Phonemschrift zur Literalität und danach zur Textualität geführt hat2 - also in letzter Instanz zu dem, was sich heute als ,Medien-Kultur' präsentiert. Deutlich zu unterscheiden ist dabei vor allem anderen, daß diese Rolle weder dem Symposion der vor-alphabetischen Zeit zukommt (das in den homerischen Epen δαίς heißt) noch dem Symposion der klassischen Zeit nach den Perserkriegen (das Piaton im Symposion σύν-δειπνον nennt3). Sie kommt ausschließlich jenem Symposion zu, das in den rund zweihundertfünfig Jahren zwischen etwa 750 und 500 in Griechenland lebendig war. In diesen rund 250 Jahren nahm die alte soziale Einrichtung , Gemeinschaftsmahr (die es bei den Griechen wie bei anderen Völkern wohl immer schon gegeben hatte) eine neue Form und einen neuen Inhalt an. Für diesen Wandel einer alten Institution gab es viele Gründe; sie alle leiteten sich aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel dieser Aufbruchszeit her. Einer dieser Gründe für die Wesensänderung des Gemeinschaftsmahls bestand darin, daß die zum Symposion gewandelte δαίς seit dem 8. Jh. eine neue, zusätzliche, sich immer mehr verstärkende und verbreiternde Funktion erhielt: Die neu entstandene Institution .Symposion' wurde - um es gleich möglichst griffig zu formulieren - zu einem Vorführ-Ort, Experimentier-Raum, Umschlagplatz und Transportmittel für die entstehende Literatur. Damit war das Symposion für rund zweieinhalb Jahrhunderte - das heißt: für eine relativ ausgedehnte Zeit des Übergangs zwischen überwiegender Mündlichkeit und überwiegender Schriftlichkeit der Wortkunst eine Art .intellektuelle Schaltstelle', an der durch kollektive Annahme oder Verwerfung von künstlerischen Tendenzen und Qualitätsnormen Entscheidungen fielen, die (das wird zunehmend deutlicher) die Richtung unserer europäischen Kulturentwicklung mitbestimmt haben. Angesichts dieser seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung kann der bisher für die Institution ,frühgriechisches Symposion' erbrachte Forschungsaufwand nur ein erster Anfang sein. So wie bei der Erforschimg des attischen Theaters, der in funktionaler Hinsicht wichtigsten Nachfolge-Institution des frühgriechischen 2
Zu diesem Prozeß im einzelnen siehe J. Latacz, Homer. Der erste Dichter des Abendlands, München - Zürich 2 1989 (' 1985), 23-29. 3 Plat., Symp. 172 b 2 u. ö.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
359
Symposions, lange Zeit mehr die äußeren Fragen (Festgeschichte, Baugeschichte, Spiel-Organisation, Aufführungspraxis usw.) I im Vordergrund gestan- 229 den haben und erst in jüngster Zeit tieferdringenden funktionsbezogenen Fragen (Theater als Selbstvergewisserung, Sinnfindungs- und Zielbestimmungsraum der Polis) Platz machen, ist es bisher auch beim Symposion noch vornehmlich um Äußeres gegangen 4 - wobei auch in dieser Hinsicht das Erreichte nicht zufriedenstellend ist; es kann ja nicht genügen zu wissen, wie man beim Symposion lag und welche Trinkgefäße man benutzte usw.; die innere, .gruppendynamische' Struktur und die persönliche Bindewirkung etwa oder der gesamtgesellschaftliche Stellenwert des ganzen Instituts sind im Detail noch kaum erforscht. Immerhin haben vor allem die beiden in den letzten Jahren durchgeführten .Symposia on Symposia' (1984 London, 1988 Hamilton/Ontario)5 ein Fundament gelegt, das erste Schritte auf eine Funktionsanalyse hin möglich macht. Die folgenden Überlegungen möchten in diesem Sinne zur Klärung zweier Grundfragen beitragen: (I) Wie ist das frühgriechische Symposion zu seiner zentralen Bedeutung für die Literaturentwicklung gekommen? (II) Wie hat sich die neugewonnene Bedeutung des frühgriechischen Symposions auf die entstehende Literatur ausgewirkt, sowohl äußerlich (auf die Verbreitung und die Quantität der Texte) als auch innerlich (auf die Machart, die Struktur, die Qualität und die Intention der Texte)?
I. Die Übernahme literarischer Funktionen 1.
Voraussetzungen
Die Vorbedingungen dafür, daß das Symposion eine oder sogar die Schlüsselposition innerhalb der frühgriechischen Literaturentwicklung übernehmen konnte, war, daß seine Vorgänger-Institution, die δαίς, ihre Erfüllung schon seit jeher nicht im materiellen, sondern im geistigen Genuß suchte und fand. Für die vorliterarische Zeit, soweit wir von Ilias und Odyssee aus rückblickend in sie hineinleuchten können (d. h. für eine Zeitspanne der sog. Dark Ages), ist diese Vor-
4 Zusammenfassender Überblick: O. Murray, Das frühe Griechenland, München 1982, 2 6 0 267. ^ [Die Kongreß-Akten sind inzwischen erschienen: O. Murray (Hrsg.), Sympotica, Oxford 1990; W. J. Slater (Hrsg.), Dining in a Classical Context, Univ. of Michigan Press 1991]
360
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
bedingung erfüllt. Die zahlreichen Epos-Stellen - 1940 von Karl Bielohlawek 230 gesammelt und gedeutet - besagen, I daß das Trinken selbst nur den Hintergrund bildete und zu bilden hatte für das τέρπεσθαι entweder durch den Sängervortrag (άοιδή) oder durch eigenes Geschichten-Erzählen und Geschichten-Anhören der Teilnehmer (μΰθοι, επεα, λόγοι) - den Hintergrund also für das, was wir heute Kunstkonsum und intellektuelle Kommunikation nennen. Der Begriff τέρπεσθαι drückt dabei stets ein ,genußvolles Sich-Vergnügen' aus, wie die semasiologische Analyse der betreffenden Stellen zeigt.6 Was die δαιτυμόνες bei der δαίς nach dem eigentlichen Essen genießen, sind in der Regel Erzählungen, also die Vergegenwärtigung von Vergangenem entweder aus der Heroen- und Göttersage (wenn der Sänger singt) oder aus der persönlichen Lebensgeschichte der Teilnehmer (wenn diese selbst erzählen; ζ. B. Nestor, Phoinix, Odysseus in den Apologen der Odyssee usw.). Weder vom Sänger noch von den Teilnehmern wird also in der Regel Gegenwärtiges vorgetragen. An einer Stelle wird diese Regel allerdings durchbrochen: Im Anschluß an ein gemeinsames Essen der Anführer läßt Homer in kritischen Situationen sozusagen in Lagen mit dringendem Handlungsbedarf - in der Ilias (und mutatis mutandis auch in der Odyssee) beim Wein auch Beratungen und Erörterungen der je aktuellen Probleme stattfinden.7 Die δαίς ist also offensichtlich schon seit altersher nicht eindeutig festgelegt auf eine reine Unterhaltungs- und Amusement-Funktion, sondern sie kann, wenn die Umstände es erfordern, aucli zum Beratungsort werden, wo Meinungsbildung und Weichenstellung stattfinden (normalerweise ist dafür die offizielle Institution der βουλή vorgesehen; die Grenzverwischungen ergeben sich natürlich aus der Lebenspraxis). Beide Funktionen, die Hauptfunktion der Unterhaltung ebenso wie die Nebenfunktion der Lagediskussion, resultieren aus dem Grundcharakter der δαίς, nicht primär Gemeinschaftsspeisung zu sein (mit der Tendenz der Abfütterung; wir denken etwa an die .Schulspeisung'; daher scheint auch die häufige Vermengung mit den spartanischen συσσίτια8 bedenklich, jedenfalls sind weitere Abklärungen wünschenswert), sondern sozialer und geistiger KommunikationsAnlaß, und zwar für Angehörige der Führungsschicht. Ein Auffangbecken für einen sich formierenden .Literaturbetrieb' war also in 231 der Gestalt der alten δαίς beim Übergang von der Mündlichkeit zur I Schrift6
J. Latacz, Zum Wortfeld .Freude' in der Sprache Homers, Heidelberg 1966, 208-214, 217 f. Ameis-Hentze zu 192. K. Bielohlawek, Gastmahls- und Symposionslehren bei griechischen Dichtem. Von Homer bis zur Theognissammlung und Kritias, WSt 58, 1940, 11-30, hier 13. ® Murray, Das frühe Griechenland, 260. 7
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
361
lichkeit im 8. Jh. vorhanden und verfügbar. Damit war ein Angebot da. Es bedurfte nur einer entsprechenden Nachfrage. Sobald diese auftauchte, mußten die beiden Glieder ineinandergreifen: die entstehenden literarischen Aktivitäten mußten sich der δαίς, des freiwilligen Adelsmahls, als des für sie prädestiniert erscheinenden Operationsraumes bemächtigen. Zusammen mit anderen Komponenten insbesondere der gesellschaftlichen Strukturveränderung (.strukturelle Revolution des 8. Jahrhunderts' 9 ) mußte auch dies zur Wesensänderung der δαίς beitragen: die δαίς verschwand, das συμπόσιον entstand.
2.
Zeitpunkt
Eine einigermaßen zutreffende Rekonstruktion der Grundlinien der frühgriechischen Literaturentwicklung ist darauf angewiesen, den Zeitpunkt dieses Wandels zu bestimmen. Konkret: Wann tauchte Literatur auf, suchte sich eine .Heimstatt' und fand sie im Symposion? Aus äußeren Indizien läßt sich diese Frage schlüssig nicht beantworten - etwa aus dem für das 8. Jh. im kleinasiatischen Ionien belegten starken Anstieg von Zahl, Größe und Qualität der ausgegrabenen Kratere und Trinkbecher. 10 In dergleichen spiegelt sich zwar sicherlich die wachsende Bedeutung der Adels-Symposien als politischer Steuerungsorgane, und daß Schrift, Text, Literatur an diesem Bedeutungszugewinn ihren Anteil gehabt haben könnten, läßt sich ohne weiteres vermuten; beweisen aber läßt es sich von dieser Seite her natürlich nicht. Hier kann nur eines weiterhelfen: die Schriftgeschichte. Da ist zunächst eine .negative' Zeitbestimmung nötig: Literatur kann nicht sofort mit oder unmittelbar nach der Erfindung der Phonemschrift um 800 aufgetaucht sein. Denn nach den Untersuchungen speziell von Heubeck (1979, vgl. 1984) und Burkert (1984) kann es heute als gesichert gelten, daß die griechische Schrift-Übernahme und Schriftsystem-Anpassung an die Muttersprache um 800 in einem kommerziellen Zusamenhang erfolgte. 11 1 Die hierhergehörigen Fakten 232
9
Definition der .strukturellen Revolution' bei Α. M. Snodgrass, Archaic Greece. The Age of Experiment, Berkeley etc. 1980, 13 f.; neueste umfassende Darstellung und gründliche Analyse: Κ. A. Raaflaub, Homer und die Geschichte des 8. Jh. v. Chr., in: J. Latacz (Hrsg.), Zweihundert Jahre Homerforschung: Rückblick und Ausblick (Colloquium Rauricum Π), Stuttgart - Leipzig [1991], 10 O. Murray, The symposium as social organisation, in: R. Hägg (Hrsg.), The Greek Renaissance of the Eighth Century Β. C. (Symposium Athens 1.-5.6.1981), Stockholm 1983, 195-199; vgl. Latacz, Homer, 73. 11 Nähere Nachweise: Latacz, Homer, 24—26, 70 f.
362
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
(die sog. Renaissance des 8. Jh.s mit den Merkmalen Bevölkerungswachstum, Wirtschaftsexpansion, Emporion von Al Mina, Fernhandel, Kolonisationsbeginn usw.) sind bekannt. Vor diesem Hintergrund ist es ganz unwahrscheinlich, daß die Griechen das phönizische Schreibsystem eingeführt und zur Phonemschrift vervollkommnet hätten, um .Literatur zu machen'. Schriftverwendung zu Literaturzwecken ist also sekundär und hinkt darum zeitlich nach. Das ist das eine. Von der anderen Seite her wirkt aber einer allzu langen Ausdehnung dieser , Nachhinkphase ' die mentalitätsbedingte Innovationsfreude gerade der griechischen Intellektuellenschicht entgegen. Die geistige Elite der Griechen, die zu jener Zeit das .kollektive Gedächtnis' verwaltete, d.h. die Sänger (άοιδοί), kann unmöglich überlange Zeiträume gebraucht haben, um die Chance zu erkennen, die sich mit der Schrift auch ihr nun bot. Wer sieht, wie der Sänger Homer (ebenso wie zweifellos viele andere Sänger vor ihm) den Neuerer feiert, in allen Bereichen (Prototyp: Odysseus), der kann sich das Ausmaß der Indolenz gar nicht vorstellen, das die άοιδοί des 8. Jh.s besessen haben müßten, um an der Verwendbarkeit und Effizienz der Schrift auch für ihr Geschäft längere Zeit vorbeizusehen. Hier mit Jahrzehnten zu rechnen, wie es heute immer noch ζ. T. geschieht, ist sicherlich ganz griechen- (und übrigens auch welt-)fremd. Glücklicherweise haben wir bereits seit 1958 den schlagenden Beweis dafür, daß die Sänger an den neuen Möglichkeiten nicht vorbeisahen: die Inschrift auf dem Nestorbecher von Ischia. Die Bedeutung dieser Aufschrift für die Rekonstruktion der Literaturentwicklung ist, wie mir scheint, immer noch nicht voll erkannt. Dabei ist das Richtige bereits 1967 gesehen worden: Antony Raubitschek hat schon damals klar ausgesprochen, daß diese Aufschrift nichts Geringeres als die Existenz von Literatur beweist.12 Das ist lange Zeit nicht angemes233 sen rezipiert worden, und 1978 hat Eric A. Halvelock mit seiner .Interpretation' der Aufschrift (einer Interpretation, die - wie er selbst vermutete - vielleicht Α. E. Raubitschek, Das Denkmal-Epigramm, in: L'Épigramme grecque (Entretiens Fondation Hardt 14), Vandœuvres - Genève 1967, 1-36, hier 28 („Das Verhältnis zwischen Epos und Epigramm ist so zu verstehen, daß Leute, vielleicht Rhapsoden, die die Sprache des Epos kannten, die kurzen Gedichte verfaßten, welche auf Grab- und Weihdenkmälern und auf Gegenständen wie dem Nestorbecher aufgeschrieben wurden"; vgl. den Diskussionsbeitrag von A. Dihle, ebd.: „Im Fall der frühen Inschrift vom Nestorbecher kann man bereits Indizien für die schriftliche Erfindung erkennen [...]. Die Fähigkeit dessen, der die zur Wiedergabe großer Zusammenhänge entwickelte Sprachtechnik des Epos erlernt hat, gelegentlich auch konzis und pointiert mit Hilfe eben dieser Kunstsprache zu formulieren, ist durch die Gnomen bei Homer und vor allem bei Hesiod reichlich bezeugt. Wer eine Gnome wie solche der Ύποθηκαι Χείρωνος prägen konnte, vermochte auch eine kurze Grabschrift in epischer Sprache zu erfinden".
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
363
„not worthy of its subject" sei 13 ) das schon Erkannte vollends wieder zugeschüttet. Als dann Gentiii mit Teilen seiner Schule ihm leider auch in diesem Punkte folgte, war die anfangliche Klarheit ganz dahin. Wer mit Havelock und Gentiii mitgeht, muß annehmen, daß eine literarische Kommunikation zwischen Autoren und Lesern nicht vor der zweiten Hälfte des 5. Jh.s zustande kam. 14 Das ist ausgeschlossen. Schon Nieddu hatte 1980 auf dem Oralitä-Kongreß die Unhaltbarkeit einer solchen These mit reicher Dokumentation aufgewiesen; 1982 und 1984 hatte er in Arbeiten in .Scrittura e Civiltà' den Nachweis noch detaillierter geführt. Doch Gentiii hatte sich schon in der Kongreß-Diskussion von 1980 nicht geneigt gezeigt, die These seines Freundes Havelock preiszugeben,15 und er hält auch in der zweiten Auflage von .Poesia e pubblico nella Grecia antica' von 1989 noch daran fest. 16 Inzwischen sind die Gegenstimmen immer lauter geworden und die Gegenargumente immer zwingender; zusammengefaßt und erweitert um neue Aspekte sind sie von Egert Pöhlmann in dem Aufsatz .Mündlichkeit und Schriftlichkeit gestern und heute' von 1988. Was den Beweiswert des Nestorbechers betrifft, sei hier in äußerster Kürze der Gedankengang wiederholt, den ich schon 1985 ausführlich entwiclkelt 234
13 E. A. Havelock, The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences, Princeton/New Jersey 1982, 195 („Can we imagine the elderly owner of this cup, after taking a swig, passing it to the boy across the table? He says to him, ,A great [!] cup, isn't it? Here, please drink out of it. My man, Execestides, made it. He's a good worker. But do you know what I did? After he made it, I got him to write down what the cup does to you. Can't read it myself [!] but you can see it there. Shall I tell you what it says?" Leaning over, with a slight leer, ,Whoso drinks of this cup shall be seized of desire. Here, boy, drink up, and I'll sing you more of it.' [...] Whether this interpretation be viewed as probable, possible, or not worthy of its subject [...]"). - Ähnliche Phantastereien, mit ebenso .schelmischer Selbstironie' („such a scene may seem only a flight of fancy"), auch zur Aufschrift der Dipylon-Kanne, ebd. 194. - Wie ernst solche Unseriositäten genommen werden, zeigt jetzt wieder die Magisterarbeit von D. S. Du Toit, The Influence of the Transition from the Oral to the Written Mode on Narrative Structure with special reference to Homer's Odyssey, Pretoria 1988, 165. - Leider haben auch Gentili und seine Schule, soweit ich sehe, nie wiederspiochen. 14 E. A. Havelock, The Preliteracy of the Greeks (1976/77), in: Havelock, Literate Revolution (1982), 185-207; ds„ The Alphabetization of Homer (1978), in: Havelock, Literate Revolution (1982), 181, sowie andernorts. B. Gentili, in: B. Gentili/U. Paioni (Hrsgg.), Oralità. Cultura, Letteratura, Discorso. Atti del Convegno Internazionale, Urbino 21.-25.6.1980, Roma 1985, 394 ff., und andernorts. 15 Gentili/Paioni (Hrsgg.), Oralità, 93. 16 B. Gentili, Poesia e Pubblico nella Grecia antica da Omero al V secolo, Roma - Bari 2 1989, 24 f.
364
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
habe: 17 Die Aufschrift - hier in der Umzeichnung und Ergänzung von Heubeck 1979 (Abb. I) 18 - ist eigens für diesen Becher (bzw. für dieses Becher-Modell, bei Serienproduktion) original komponiert worden: ός δ' αν χοΰδε πίησι ποτηριού: ,Wer aber aus diesem Becher hier trinkt... Der Autor dichtet also nicht etwas, was dann sekundär als Becher-Aufschrift Verwendung findet, sondern er dichtet eine Becher-Aufschrift. Eine derart gezielte Verwendung von Schrift ist aber erst in dem Augenblick möglich, in dem der Autor mit Lesern rechnen kann. Hinter dieser Aufschrift steht also die bereits selbstverständliche Praxis, Gedanken nicht auf direktem mündlichen Wege zu übermitteln, sondern über das anonyme Zwischenglied ,Schriftträger'. Das aber bedeutet, daß es zur Zeit der Erfindung dieser Aufschrift - also vor 735/20 - bereits schriftlichkeitsbestimmte Kompositionsweise gab - so wie sie auch uns vertraut ist. Das gleiche lehren alle frühen Grab-, Weih- und Besitzer-Inschriften aus dem Ende des 8. und dem Beginn des 7. Jh.s, die ja als Mitteilungen an Leser konzipiert sind. Die geringe Anzahl erhaltener Inschriften dieser Art kann natürlich kein Gegenargument sein; in einer Sache wie dieser würde eine einzige Inschrift zum Beweis genügen. Die nächste Frage ist naturgemäß: Wer hat diese (überwiegend metrischen) Texte verfaßt? Für die den Anfang der Entwicklung repräsentierenden hexametrischen Aufschriften (Dipylon-Kanne, Nestor-Becher, Mantiklos-Bronze, Nikandre-Statue usw.) ist die Frage m. E. durch jene Beobachtung beantwortet, die Klaus Alpers bereits 1970 publiziert und die Heubeck 1979 (X 115) weitergeführt hat: Die beiden Hexameter der Nestor-Aufschrift sind durch je zwei vertikale Punktierungslinien gegliedert (Abb. 2). Diese Linien können keine WortTrenner sein (es müßten dann mehr sein). Sie liegen genau an den Zäsur-Stellen B2 und C2 bzw. Bi und C2 (+ 1) der Fränkelschen Notation. Dadurch wird ein Schluß, den Raubitschek (und Dihle) schon 1967 aus dem frühen epigraphischen Gesamtbefiind (außerhalb des Nestorbechers) gezogen hatte(n), bestätigt: Diese hexametrischen Aufschriften sind von epischen Sängern verfaßt19 (das hatte übrigens für das damals zugängliche Material im Jahre 1900 schon Wilamowitz konzediert).20 Zugleich zeigen aber diese Zäsur-Signale, zusammen mit (1) der 235 Kleinheit und Gleichmäßigkeit der Buchstaben und mit (2) der Parallellftihrung der beiden Hexameterzeilen, daß in der Nestorbecher-Aufschrift Übertragung 17
Latacz, Homer, 80-83. Die Abbildungen im Anhang unten S. 385-389). Siehe oben Anm. 12. 20 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die Textgeschichte der griechischen Lyriker, Berlin 1900, 35. 18
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
365
der Schreibpraxis von längeren Hexameter-Texten her vorliegt, die natürlich normalerweise auf vergänglichem Material geschrieben wurden.21 Das bedeutet: (1) Im Zeitpunkt der Aufbringung der Nestorbecher-Aufschrift existieren bereits Epen-Manuskripte (wie umfangreich oder -arm auch immer), die sowohl lediglich graphische Konservierungen von schriftlos verfertigter Hexameterdichtung sein konnten (dieser Schlußfolgerung - auf Grund anderer Indizien u. a. schon von Dihle 1970 gezogen - kann selbst die Havelock-Schule nicht ausweichen: Havelock 1978, 17; Gentiii 1984. 2 1989, 20) als auch Produkte schriftlichkeitsbedingter Neukompositionen. - (2) Da der Nestorbecher ja sicherlich kein Allerweltsstiick ist, sondern zweifellos zum .Luxusporzellan' gehörte, für das eine angemessenere Zweckbestimmung als die Verwendimg beim Symposion gar nicht denkbar ist,22 muß bereits für einen Zeitraum, der nicht allzu kurz vor 735/20 liegen kann (dazu ist die auf dem Becher dokumentierte Schreibpraxis schon zu entwickelt), mit schreib- und lesekundigen Symposion-Teilnehmern gerechnet werden; berücksichtigt man den äußerst pointenreichen Inhalt der Becher-Aufschrift, 23 der den Text aus der Masse der lebenspraktischen zeitgenössischen (Grab-, Weih- usw.) Aufschriften heraushebt und ihn in der Tat zu einem kleinen Stück Literatur für sich macht, dann ist der weitere Schluß unausweichlich, daß die Adressaten nicht nur schreib- und lesekundig, sondern auch bereits ,literaturfähig' waren. Das Ergebnis dieser Analyse ist, daß die Schrift schon vor 735/20 Eingang ins Symposion und damit in die zeitgenössische ,Kulturszene' gefunden haben muß, und zwar als Mittel nicht nur der Dichtungs-Fixierung, sondern auch der Dichtungs-Schaffung, also der Schaffung von Literatur. II. Folgen der Funktions-Übernahme 1. Publikation und Verbreitung der literarischen Produkte Die Fertigung von Epigrammen wie der Nestorbecher-Aufschrift und der weiteren noch erhaltenen frühen Gegenstandsaufschriften, durch die uns ein I winzi- 236 ger, aber für die entscheidende Schlußfolgerung vollkommen ausreichender Einblick in die damalige Literaturproduktion ermöglicht wird, konnte im Rahmen der Gesamtproduktion nur ein - nach Umfang und Thema begrenztes -
21 Die epigraphische Begründung dafür bei L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1 1961, 2 1990, 64 f. 22 Vgl. Murray, Das frühe Griechenland, 263. 23 A. Heubeck, Schrift (Archaeologia Homérica, Fase. X), Göttingen 1979, 112-114.
366
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
Nebenprodukt sein. Zur Zirkulation gegenstandsunabhängiger Texte konnte dieser Sonderbereich nicht führen. Im Hauptbereich aber, von dem der Nebenzweig ,Gegenstandsaufschriften' sozusagen seine Nahrung bezog, d.h. im Bereich der Epenproduktion, lag dem Gesichtskreis derer, die diese Texte schufen, der Gedanke an den Aufbau einer .Buchproduktion' mit zugehörigem Vertriebssystem offensichtlich noch fern (obgleich das Vorbild derer, von denen die Schrift übernommen worden war, diesen Gedanken hätte nahelegen können; 24 hier sind noch weitere Untersuchungen erforderlich). Auf der anderen Seite zeigt die weitgestreute Kenntnis Homers bei den Verfassern der uns überlieferten Dichtung des 7. Jh.s seit Hesiod, daß der Verbreitungsgrad von Literatur bereits in der zweiten Hälfte des 8. Jh.s zumindest in den Kreisen der literarisch Interessierten groß war. Wie kamen unter diesen Voraussetzungen Publikation und Verbreitung zustande? Zunächst wird man davon auszugehen haben, daß die Änderung der Herstellungsweise des Produkts nicht zwangsläufig eine Änderung der Absatzform nach sich zieht. Dichtung war seit jeher durch mündlichen Vortrag vor versammeltem Publikum veröfffentlicht und durch Zirkulation eher der Produzenten als der Produkte verbreitet worden. Diese Praxis aufzugeben bestand zunächst kein Anlaß. Veröffentlichung geschah also zunächst sicher weiterhin durch mündlichen Vortrag im engeren Lebensbereich des Verfassers (wobei jetzt nicht mehr improvisiert, sondern rezitiert wird; Vorlesen bleibt als Stilbruch tabu), Weiterverbreitung erfolgte zunächst auch weiterhin durch mündlichen Vortrag des reisenden Verfassers selbst oder reisender Zuhörer. Dabei kann es aber nicht allzu lange geblieben sein. Denn das neue Herstellungsverfahren hatte Auswirkungen auf die Produkt-Struktur, und damit dann auch auf den Produkt-Umfang, die Produkt-Menge und die Produkt-Qualität. Als Folge des dadurch grundsätzlich veränderten Produkt- Werts mußte sich anschließend ein Bedürfnis auch nach einer neuen Verbreitungsform einstellen. Im folgenden soll versucht werden, diese Schrittfolge hypothetisch nachzuvollziehen. I 237 2.
Struktur und Umfang der literarischen Produkte
Genaue Analyse der Diktion der Nestorbecher-Aufschrift und der frühen Epigramme allgemein zeigt, daß mit der neuen schriftlichen Kompositionsweise der 24
W. Burkert, Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, SB Heidelberg 1984/1, 33-35.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
367
Verzicht auf die alte Formelstruktur möglich geworden war. Die Formelstruktur war eine Konsequenz des Improvisationszwanges gewesen. Sie hatte auf dem Prinzip .Setzen und Füllen' beruht, d.h.: zuerst drei bis vier .Stahlpfosten' in den Versmantel setzen - und dann die Zwischenräume zwischen ihnen mit losem .Strauchwerk' füllen. Dieses Verfahren hat 1987 Edzard Visser in seiner Basler Dissertation transparent gemacht und jüngst in den .Würzburger Jahrbüchern' 1988 noch einmal erläutert. Das Ergebnis dieses Verfahrens war eine relativ große Lockerheit der Struktur gewesen, mit viel Platzreserven, die beliebig aufgefüllt werden konnten. Daraus waren Repetitivität und Abundanz gefolgt und insgesamt ein großer Raumbedarf für wenig Aussage. 25 Die neue schriftliche Kompositionsweise konnte dagegen auf das Vorausreservieren von Freiräumen verzichten, weil sie nicht unter Zeitdruck stand. Sie konnte, um im Bild zu bleiben, die Reserveräume zwischen den Stahlpfosten wegfallen lassen und Pfosten neben Pfosten rammen. Das führte zu Formel-Reduktion und Einzelwort-Dichtung und damit zu Sinnkondensation (man betrachte unter diesem Gesichtspunkt die Hexameter der Nestorbecher-Aufschrift, der Mantiklos-Bronze und der Nikandre-Statue: ist hier bereits - auch die Götter-Epitheta - j e d e s einzelne Wort funktional unentbehrlich; die an sich erforderliche Vergleichsanalyse kann hier nicht durchgeführt werden 26 ). Im großen sehen wir das neue Verfahren bereits bei Hesiod wirksam, der nicht nur deswegen nicht mehr ganz homerisch klingt, weil er nicht mehr so gut .Homerisch' kann, sondern auch, weil er (programmgemäß) gar nicht mehr so sehr .Homerisch' reden will.21 Dieser Prozeß zulnehmender Sinnkondensation setzt sich bei den er- 238 sten Elegikern und Iambographen, also bei Kallinos, Tyrtaios, Archilochos und 25
Näheres bei J. Latacz, Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos, in: J. v. Ungern-Sternberg/ H. Reinau (Hrsgg.), Vergangenheit in mündlicher Überlieferung (Colloquium Rauricum I, 20.-23.8.1987), Stuttgart 1988,153-183, hier 170-175 [in diesem Band S. 37-70, hier 55-61], 2 " Vgl. Dihle bei Raubitschek, Das Denkmal-Epigramm, 28, zum unepischen Wort ποτηριον (statt der epischen Termini κύπελλον, δέπας, κοτύλη). Schon 1966 stellte West im Theogonie-Kommentar fest: „Hesiod's narrative is more condensed than Homer's" (75) und sprach von Hesiods „brevity" (75), „directness" (74) und „his natural inclination to tell the story more laconically" (74); er bewertete das damals noch als ein Nicht-Können (73: „It is as if an artisan with his big, awkward fingers were patiently, fascinatedly, imitating the fine seam of the professional tailor"); mehr als ein Nicht-Können ist es aber ein Nicht- Wollen, gut analysiert von L. E. Rossi, I poemi omerici come testimonianza di poesia orale, in: R. Bianchi Bandinelli (Hrsg.), Storia e Civiltà dei Greci, I, Milano 1978, 73-147, hier 127: „Per Esiodo, già, la formularità omerica è diventato uno stile poetico" [...] „si tratta di una oralità di riflesso" [... ] ,,L' epos narrava: Esiodo, adattandone le forme, ragiona e valuta, in modi non epici. Per Esiodo non orale e scritto è oggi più d'uno studioso".
368
Die Funktion des Symposions fìir die entstehende griechische Literatur
Semonides, wie wir beim Vergleich der Diktionen sehen können, laufend fort. Selbstverständlich ist der Vergleich von Produkten der Gattungen .Elegie' und Jambos' mit dem gattungsfremden Epos methodisch nicht sauber, aber da Elegien und lamben aus der vor-alphabetischen Zeit auf keine Weise rekonstruierbar sind, stellt das Substitutionsverfahren die einzige Möglichkeit dar. Daß es absolut irreführende Daten liefern sollte, ist ganz unwahrscheinlich. An der Verläßlichkeit des wichtigsten Datums jedenfalls dürfte kaum ein Zweifel möglich sein: Mit der neuen Kompositionsweise wird mehr Sinn auf weniger Raum möglich, also eine größere Dichte und Kompaktheit der Aussage. Das aber hat ein Sinken des Gesamtraumbedarfs zur Folge. Die Produkte können also generell kürzer werden. Ob diese neu entstandene technische Möglichkeit der Umfangsreduktion auch praktisch ausgenutzt wurde, hing nun davon ab, ob sie bei den Text-Herstellern und Text-Abnehmern auf ein gleich gerichtetes Bedürfnis traf. Geschah das, dann mußte die Folge eine breite Diversifikation der neu entstehenden Texte und damit ein schnelles Anwachsen der Gesamt-Text-Afe«££ sein. Genau diese Entwicklung sehen wir im 7. Jh. ablaufen:28 Obwohl die Zusammenhänge zwischen dem Wandel der Gesellschaftsstruktur im 8. und 7. Jh. und dem Wandel der Mentalität der Menschen während dieser Zeit bisher noch nicht genügend untersucht sind (Hermann Fränkels Ephemeritätskriterium und die vielseitig ergänzenden Studien von Max Treu in ,Von Homer zur Lyrik', Bruno Snell in .Dichtung und Gesellschaft' und viele speziell amerikanische einschlägige Arbeiten stellen immerhin einen Anfang dar), scheint doch auch jetzt schon das Resultat dieses Wandels auf dem Gebiet der Literatur deutlich zu sein: An den Proportionen der überlieferten Textmengen in den verschiedenen Text-Gattungen ist abzulesen, daß den neuen geistigen Bedürfnissen der lange, narrative Text nicht mehr gemäß war; statt seiner entstanden viele relativ kurze Texte, die folgerichtig nicht Vergangenes erzählten, sondern Gegenwärtiges besprachen 239 und die, wenn sie I Vergangenes einbezogen (am häufigsten natürlich in der Chorlyrìk), dieses Vergangene in der Funktion der Folie für das Gegenwärtige benutzten.
3. Menge der literarischen Produkte (Quantität) Kurze Texte der beschriebenen Art entstanden seit etwa 700 in schneller Folge und in großer Zahl. Man hat den Tatbestand der Text-Menge, wie ich glaube, 28
Latacz, Homer, 27.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
369
noch nicht ausreichend ausgewertet. Abb. 3 zeigt, wie groß die poetische Produktion - außerhalb der Epik - bereits im 7. Jh. ist: Selbst wenn wir Solon, Sappho und Alkaios ausklammern und erst dem 6. Jh. zuweisen, also nur die zehn wichtigsten zweifelsfrei dem 7. Jh. zuweisbaren Lyriker - von Kallinos bis zu Mimnermos - in die Rechnung einbeziehen, verfugen wir über nicht weniger als 2 363 ganz oder teilweise erhaltene Verse; rechnen wir entweder auf Grund alexandrinischer Buchanzahl-Angaben (z.B. Alkman) oder auf Grund allgemeiner Erwägungen (ζ. B. der Vielfalt der gepflegten poetischen Formen bei Archilochos: Iambos, Distichon, Epodenform, in Kombination mit einer Schätzimg des Lückenumfangs zwischen den erhaltenen Resten ursprünglich umfangreicher Produktionen wie z.B. der gegen Lykambes gerichteten Parabel Fr. 172181W.) diese 2363 erhaltenen Verse auf den ursprünglichen Bestand hoch und zwar mit äußerster Zurückhaltung etwa in der Ansetzung dessen, was die Alexandriner später ein ,Buch' nannten (so sind in der Tabelle für 1 Buch lediglich 500 Verse angesetzt, obwohl wir etwa von Sappho sicher wissen, daß 1 Buch ihrer alexandrinischen Ausgabe über 1000 Verse umfaßte) - , so kommen wir auf einen geschätzten Gesamtversbestand von mindestens 15 000 Versen für diese zehn Dichter des 7. Jahrhunderts. Dies ist natürlich nur die Produktion derjenigen Autoren, von denen entweder Texte oder zumindest Nachrichten - wie ζ. B. die bloße Namensnennung - sich bis zu uns gerettet haben. Da aber Überlieferung natürlich immer Selektion ist,29 werden wir schließen, daß die ursprüngliche Textmenge allein im Bereich der Dichtung - und da wieder allein im Bereich .Elegie, Iambus, Chorlyrik' - im 7. Jh. die errechneten 15 000 Verse (also etwa den Umfang der Ilias) in der Realität um ein Vielfaches überstieg. I 4. Ursachen des Textmengen-Anstiegs - Anlässe für die literarische Produk- 240 tion - Position des Symposions unter den Anlässen - Auswirkungen des Anlasses .Symposion' auf den Charakter der literarischen Produkte Dieser Textmengen-Anstieg hat sicherlich mehrere Ursachen. Unter technischem Aspekt war er sicher auch Folge der schnelleren Erlernbarkeit des Versemachens (früher hatte ja ein Dichter - ein αοιδός - wegen der ungeheuren Komplexität der auf Gedächtnisstärke gegründeten Improvisationstechnik jahrelang trainieren müssen, bevor er sich an die Öffentlichkeit wagen konnte). Er war aber andererseits ohne Zweifel auch die Folge eines starken - nun nicht 29
Was erhalten blieb, war „sozusagen Spitzenproduktion": Kannicht, Thalia, 38.
370
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
mehr durch .Gildengrenzen' gebremsten - Kreativitätsschubs. Schließlich muß er auch Folge einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage, infolge des schnell wachsenden Interesses für diese Art von Dichtung und entsprechend starker Vermehrung von Vorfiihrungs- (.performance'-) Gelegenheiten, gewesen sein. An dieser Frage wird weiterzuarbeiten sein. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang schon jetzt (gegenüber andersgerichteten Versicherungen): Die gewaltige dichterische Produktion schon des 7. Jh.s kann auf keinen Fall monokausal erklärt werden. Es kann also auch nicht realitätsgerecht sein (was in den letzten etwa zehn Jahren zur Mode zu werden drohte), die Steigerung der Produktion allein aus einem erhöhten Poesie-Bedarf der Institution .Symposion' abzuleiten. Neben dem Symposion stand ja eine Vielzahl weiterer .performance'-Gelegenheiten. Herington hat 1985 Belege für etwa 15 gesamtgriechische, überregionale und regionale Feste zusammengestellt, zu denen im 7. und 6. Jh. άγώνες μουσικοί gehörten (nicht nur so bekannte Feste wie die Delia, Pythia, Olympia, sondern auch etwa regionale Feste wie die Endymatia in Argos, die Ithomaia in Messenien, das Demeter-Fest auf Paros usw.), 30 und Richard Kannicht hat 1989 darauf aufmerksam gemacht, daß hinter den 34 erhaltenen sog. homerischen Hymnen noch ein gut Teil weiterer früher Feste verborgen liegt.31 Alles das dürfte allerdings immer noch nur die Spitze des Eisbergs sein. Regional- und Lokalfeste, für die ζ. B. Chorlieder gebraucht wurden, dürfte es in Griechenland schon im 8./7. Jh. Hunderte im Jahr gegeben haben, 32 und die Kolonisation weitete den Bedarf natürlich dauernd weiter aus. Dazu kommen die privaten Anlässe wie Hochzeit und Bestattung, 241 Initiation und Ephebie, I Sportsiege und Familienfeste aller Art. Sie müssen als Stimulans für weitere Mengen von (Gelegenheits-)Poesie eingerechnet werden. Herington hat demnach völlig recht, wenn er ganz Griechenland im 7. und 6. Jh. singen hört und von einer .song culture' spricht.33 Indessen: Bei allen diesen Festen handelte es sich um offizielle Anlässe. Was die Künstler dafür produzierten, hatte in erster Linie dem jeweiligen Fest-Charakter und Fest-Zweck zu dienen. Es durfte also nicht sozusagen .egoistisch' sein. Die Person des Autors hatte in den Hintergrund zu treten. Alkmans Partheneia und Sapphos Epithalamia (Hochzeitslieder) geben einen Begriff davon. Und die umfangreichen Erzählungen historischen Inhalts im Distichon-Maß, die 30 J. Herington, Poetry into Drama. Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley - Los Angeles - London 1985,163-166. 31 Kannicht, Thalia, 40 f. 32 „Die Gesamtzahl von bekannten Götterfesten geht in die Hunderte": Kannicht, ebd., 40. 33 Herington, Poetry into Drama, 39.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
371
Bowie 1986 für Tyrtaios, Semonides und Mimnermos (also ebenfalls für das 7. Jh.) erschlossen hat, werden auf der gleichen Linie gelegen haben (ihr eigentlicher Ort war sicher nicht das Symposion, sondern der patriotische Anlaß, das Staatsfest). Allenfalls in der öffentlichen Spottdichtung, die Dover, West und andere als eine Urfunktion des Iambos angesetzt haben,34 konnte die Persönlichkeit des Autors stärker nach vorn treten, doch muß auch hier mit Ritual-bedingten Regelzwängen gerechnet werden - die dann vom Autor ζ. B. Rollendichtung forderten.35 Andererseits muß nun aber unter dem Eindruck des gesellschaftlichen Strukturwandels und des damit verbundenen veränderten Lebensgefühls während des 8. und 7. Jh.s das Bedürfnis gerade der kreativen Menschen, der Intellektuellen und Künstler, immer größer geworden sein, ihrer persönlichen Welt Ausdruck zu geben. Als Podium, Plenum und Arena für Produktionen dieser Art bot sich das Symposion an. Sein Vorgänger, das Gemeinschaftsmahl, war ja seit jeher, wie gesehen, ein Ort des intimeren geistigen Genießens gewesen. Nun, nachdem I sich die Art der poetischen Produktion (Schriftgebrauch) und der Charakter der 242 Produkte gewandelt hatten, nahm das alte Gemeinschaftsmahl, das sich im Zuge des sozialen Wandels zum Symposion geformt hatte, die neuen Arten des τέρπειν auf. Von besonderer Wichtigkeit scheint mir dabei zu sein, zu erkennen, daß die Entwicklungsschritte in dieser Reihenfolge erfolgt sein müssen. Also nicht das Symposion hat die neuen literarischen Formen erzeugt, sondern die neue gesellschaftliche Gesamtbefindlichkeit hat sowohl (neben anderen neuen kommunikativen Formen) ein neues Gemeinschaftsmahl, das Symposion, als auch neue literarische Formen erzeugt. Das bedeutet unter anderem, daß die neue Symposionsdichtung nicht grundsätzlich und durchgängig vom Symposion her be34
M. L. West, Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlin - New York 1974. K. J. Dover, The Poetry of Archilochus (Entretiens Fondation Hardt 10), Vandœuvres - Genève 1963, 183— 222. 35 Die nach dem Fund der Kölner Archilochos-Epode (1974) neu entflammte Debatte über das frühgriechische Rollengedicht (u. a. J. M. Bremer, Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten, Amsterdam 1978. S. R. Slings, Archilochus, eerste Keulse epode, Lampas 13, 1980, 315-335; englisch in: J. M. Bremer/A. M. van Erp Taalman Kip/ S. R. Slings, Some recently found Greek poems [Mnemosyne Suppl. 99], Leiden 1987. W. Rösler, Persona reale o persona poetica? L'interpretazione dell',io' nella lirica greca arcaica, QUCC 19, 1985, 131-144) dürfte mit W. Albert, Das mimetische Gedicht in der Antike. Geschichte und Typologie von den Anfängen bis in die augusteische Zeit (Beiträge zur Klass. Philologie 190), Frankfurt a. M. 1988, - auf indirekte Weise - in ein neues Stadium getreten sein.
372
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
stimmt war, dem Symposion nicht ihren Ursprung und Sinn verdankte. Sie war vielmehr grundsätzlich selbstbestimmt. Der Ort, an dem sie sich präsentierte, war weder ihr wesentlicher Bestimmungsfaktor noch ihr wesentliches Thema. Er war ein Bestimmungsfaktor unter vielen - so wie später für das attische Drama das θέατρον ein Bestimmungsfaktor war, ein wichtiger, aber weder der einzige noch der eigentliche. Im θέατρον konnte Trauer ebenso wie Freude zum Ausdruck kommen, Heiteres ebenso wie Tragisches, Ironisches, Aggressives, Obszönes usw. - eben die ganze Skala menschlicher Erlebnisfähigkeit. Das θέατρον als Darbietungsort mit seinen spezifischen Restriktionen prägte den poetischen Schöpfungen zwar seinen Stempel auf, aber die poetischen Schöpfungen waren etwas aus sich heraus bereits, bevor sie ins Theater kamen. Ich möchte vorschlagen, das Symposion, insoweit es literarischer Ort ist, unter diesem Aspekt und mit dieser Parallele zu betrachten. Das Symposion wäre dann - um es auf einen ganz knappen Begriff zu bringen - eine Art intimen Kammertheaters, in dem der Vortragende und sein Publikum (jedenfalls bei der »Uraufführung') sich persönlich in der Regel kennen (und in dem die Rollenverteilung zwischen Autor und Publikum im Laufe eines Abends wechseln kann), das aber bei aller Intimität der persönlichen Beziehungen von den Teilnehmern niemals mit ihrem unmittelbaren, natürlichen Alltags-Realitätsraum verwechselt wird. Sowohl der Vortragende als auch seine Zuhörer sind sich während des Vortrags stets bewußt, daß sie nicht zu Hause, sondern beim Symposion sind, daß sie sich sozusagen ,im Theater' befinden und daß der poetische Vortrag, der sich in diesem Raum ereignet, etwas Besonderes ist - das, was wir , Kunst' nennen. I 243 Die erhaltenen poetischen Kreationen, von denen wir sicher wissen, daß sie beim Symposion vorgetragen wurden, bestätigen diese Rekonstruktion ihrer Eigenart. Sie sind hoch-elaborierte Kunstwerke. Sie sind in aller Regel nicht spontan entstanden (selbstverständlich gab es derartiges ebenfalls36). Die NichtSpontaneität dieser neuen Wortkunst machte ja gerade den Unterschied gegenüber der Improvisationskunst (oder der bloßen Repetition) der früheren mündlichen Dichtung aus. Bei der schriftlichen Abfassung stellte sich der Autor Darbietungsort und Publikum zwar vor (jedenfalls in einem allgemeinen Sinn),37 so wie das alle mündlich vorgetragene schriftlich präparierte Wortkunst tut (einschließlich akademischer Vorträge bei wissenschaftlichen Symposien!), aber 36
Spontangedichte wie die Kurz-Siegeslieder von Pindar und Bakchylides (gleich nach dem Sieg gedichtet) sind die Ausnahme. 37 Albert, Mimetisches Gedicht, 51 ff.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
373
es dürfte sich von selbst verstehen, daß der Autor bei der Abfassung nicht das Ziel im Auge hatte, das vorgestellte Publikum in seiner Schöpfung lediglich zu spiegeln; er wollte es vielmehr in seinen Bann ziehen. Wenn Sappho im Gebet an Aphrodite (Fr. 1) die Epiphanie der Göttin auf dem Sperlingswagen ausmalt, dann zieht sie ihre Hörerinnen in eine Bildwelt hinein, die nur in ihrer Phantasie besteht. - Wenn Alkaios in Fr. 6 vom Schiff im Seesturm singt, dann läßt er vor den Augen seiner εταίροι eine abgeschlossene und stimmige Szene erstehen, wie sie in der Zufälligkeit der Realität keiner der Anwesenden jemals so erleben könnte. - Wenn Hipponax den Gott Hermes Μαιαδεΰ! - , vor Kälte mit den Zähnen klappernd - βαμβαλύζω - , erbarmungswürdig um ein κυπασσίσκον und um σαμβαλίσκα aus dem Haus des Nachbarn bittet, dann steht der Typ des Bettelvagabunden - gerade in dieser Karikatur unvergeßlich für alle Zeit als Kunstwerk im Raum. Bei aller anti-idealistischen und anti-ideologischen Affektion, die bis zu einem gewissen Grade gerade in Deutschland und Italien verständlich ist und die sich durch das .technologische' Gesamtklima unserer Zeit besonders stark ins Recht gesetzt fühlen mag, sollten wir doch die Grundwahrheit aller Kunst nicht eifernd beschränken und verkleinern wollen: Der Dichter, sofern er Dichter ist, malt die Wirklichkeit nicht ab, er erschafft seine eigene Wirklichkeit. Das gilt bei aller Unterschiedlichkeit der damaligen und der späteren , Produktions- und Rezeptionsbedingungen' - auch für die frühgriechische Dichtung. I
5. Folgen des neuen Produkt-Charakters für die Verbreitung und Tradierung 244 der Produkte - Steigerung der Produkt-Qualität und Rückwirkungen der Qualitätssteigerung auf Verbreitung und Tradierung Die hohe künstlerische Leistung, die, wenn sie gelang, hinter der Symposionsdichtung stand, wurde vom Publikum erkannt und anerkannt. Das würde sich, wenn sonst nirgends, schon in der puren Banalität zeigen, daß Dichter wie Tyrtaios, Archilochos, Semonides, Mimnermos Lied um Lied produzierten. Es zeigt sich aber vor allem im Widerschein der Publikums-Anerkennung: der RuhmesErwartung. Es ist sicherlich ein Fehlschluß gewesen, den meisten frühgriechischen Dichtern der lyrischen Gattung diese Ruhmes-Erwartung schlichtweg abzusprechen.38 Schon Odysseus sagt bei den Phaiaken bewundernd zum Sänger Demodokos, er werde allen Menschen (πάσιν άνθρώποισιν) von der hohen Qualität des Demodokos-Singens erzählen (Od. θ 497 f., s. Abb. 4), also Demo38
Ζ. B. W. Rosier, Dichter und Gruppe, München 1980, 56-77.
374
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
dokos' κλέος verbreiten. Es wäre unbegreiflich, wenn Demodokos' lyrische Nachfolger, von Archilochos bis Sappho, nicht den gleichen Wunsch nach κλέος verspürt hätten. Darum besteht kein Anlaß, die Reflexe in der frühgriechischen Dichtung, die sich von solcher künstlerischer Ruhmes-Erwartung erhalten haben, wegzudeuten. Selbst wenn ζ. B. Sappho in Fr. 147 V. μνάσεσθαί τινα φαμι t και έτερον t άμμέων mit άμμέων tatsächlich nicht sich selbst meint, sondern ihren ganzen Kreis (wie man gedeutet hat), dann hat sie damit ja nicht etwa die Erwartung ausdrücken wollen, die Nachwelt werde einst noch der Girlanden gedenken, welche Atthis zu flechten wußte! Seinen eigentlichen Sinn und Rang fand der Kreis erst in Sapphos Liedkunst. Das hat Sappho in ihren Liedern immer wieder ganz klar gemacht. Sich an Sapphos Kreis erinnern, das bedeutete: Sapphos Lieder kennen. Es war ja gerade das Wissen ¿arum, das das stolze Selbstbewußtsein des Kreises und seiner Dichterin stiftete, das aus so vielen Liedern Sapphos spricht (nicht nur aus Fr. 55! s. Abb. 5). Darum kann es unmöglich richtig sein, anzunehmen, diese Dichter könnten ihre Schöpfungen dem Zufall überlassen haben. Schon Wilamowitz hat 1900 in der .Textgeschichte der griechischen Lyriker' als letzten Ausgangspunkt unserer 245 Lyriker-Überlieferung „Hausarchive [...], auch die der Dichter I selbst" angenommen; 39 Herington hat die darauf bezüglichen Zeugnisse wieder in Erinnerung gerufen. 40 Selbstverständlich werden sich auch Hörer Kopien gemacht haben (die dann wohl auch bei Reisen mitwanderten; Gedichtversendung im Brief ist seit Alkaios Fr. 401 Β a 2 V. belegt).41 Mündliche Tradierung wird man nicht ganz ausschließen, aber ein Fall wie der des attischen Skolions 891 PMG zeigt deutlich, daß die mündliche Überlieferung, wie Wolfgang Rosier in einer schönen Studie von 1983 gezeigt hat, von nur „marginaler" Bedeutung war: Der Papyrusfund von 1951 hat klargemacht, daß dieses attische Skolion ein nur vierzeiliger Bestandteil eines umfangreichen Alkaiosliedes ist und daß dieses umfangreiche Lied selbst eben völlig unabhängig von den Liederbüchern (,SkolienSammlungen'), die es gegeben hat, durch die Jahrhunderte tradiert wurde (Abb. 6). Und wenn Aristoteles Sappho im lesbischen Dialekt zitiert (den er gewiß nicht sprachwissenschaftlich rekonstruiert hat), dann zeigt das eben, wie ebenfalls schon Wilamowitz 1900 gesagt hat, 42 daß es seit der Entstehung der
40 41 42
Wilamowitz, Textgeschichte, 40. Herington, Poetry into Drama, 203. Rösler, Dichter und Gruppe, 274; vgl. Herington, Poetry into Drama, 189-191. Wilamowitz, Textgeschichte, 52.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
375
Sappho-Lieder von Lesbos her eine zuverlässige schriftliche Überlieferung gab, also in der Tat - um es nun einmal ganz konkret zu sagen - Papyrusblätter, die man erwerben und benutzen konnte. Daß es eben solche Papyrusblätter waren, auf die die Dichter des 7. und 6. Jh. s ihre Texte schrieben (die Frage der Notenschrift lassen wir hier einmal beiseite), ist ja nicht zu bezweifeln. Jedenfalls ist es unvorstellbar, daß Sappho die annähernd 12000 Verse, die die Alexandriner noch von ihr besaßen, auf Tonscherben oder Steine geritzt hätte. Das stärkste Argument für schriftliche Thesaurierung und Verbreitung von Anfang an dürfte aber in der außerordentlich hohen Qualität der Texte liegen. Auch das Qualitäts-Argument ist m. E. noch nicht genügend ausgewertet. Die Qualität der frühgriechischen Dichtung wird zwar oft gepriesen, aber selten sichtbar gemacht. Zu viel Mühe mußte bisher noch auf die elementaren Fragen der philologischen Arbeit verwendet werden. Zu diesen elementaren Fragen gehört ja aber nicht nur die papyrologische, dialektologische, grammatikalische, metrische usw. Text-Konstitution, sondern auch die ganze historische, soziologische und funktions-orientierte Text-Einbettung. Alles das sind Interpretationsvorbereitende technische Prozeduren, mit denen wir uns zunächst einmal in die damaligen Rezipienten zu verwandeln suchen. An die I Rezeption sind wir damit 246 noch nicht herangekommen. Wie ein Alkaios-Lied auf die Hörer gewirkt hat, darüber wissen wir noch immer wenig. Das zu wissen wäre aber das Wichtigste. Es ist ja davon auszugehen, daß die primären Hörer dieses Liedes über alles das, was wir uns heute mühsam rekonstruieren müssen, mit Selbstverständlichkeit bereits verfügten: über den vollständigen Text (plus Melodie), über Dialekt, Grammatik und Rhythmus-Verständnis, außerdem über intime Kenntnis des historischen Orts des Liedes. Mit denjenigen Dingen, die heute uns als das A und O erscheinen, gaben sich die primären Hörer gar nicht ab. Ihr Genuß begann erst jenseits dessen. Zu diesem Genuß trugen viele Komponenten bei. Manche davon sind in den letzten Jahren immerhin schon in das Blickfeld der Lyrikdeutung gerückt, z.B. die Komponente der μετα-τωίησις - heute ,Intertextualitât' genannt. Beziehungen zwischen einem neuen Literaturprodukt und schon bekannten Literaturprodukten zu erkennen ist ja nicht erst heute ein Teil des literarischen Genusses. So haben auch die frühgriechischen Dichter nicht etwa nur auf Homer und Hesiod angespielt (bekanntestes Beispiel ist immer noch Alkaios Fr. 44: Achilleus, Thetis und Zeus; s. Abb. 7), sondern sie haben auch durchaus aufeinander angespielt. Wenn Solon in Fr. 20 dem Mimnermos (Fr. 6) in der Lebensalterfrage widerspricht, so ist das nur ein besonders deutliches Beispiel (s. Abb. 8). Meyerhoff hat 1984 mehr gegeben. Auch derartiges ist nicht denkbar ohne eine
376
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
gewisse Text-Zirkulation. Das immer wieder gehörte Gegenargument des fehlenden Buchhandels sollte allmählich aus der Diskussion verschwinden. Buchhandel ist ja keine Voraussetzung für schriftliche Dichtung und Text-Zirkulation. Das ganze europäische Mittelalter kennt keinen systematischen Buchandel und ist doch voll von Intertextualität! Eine andere Komponente dürfte aber noch wesentlich wichtiger für den Kunstgenuß gewesen sein: die der künstlerischen Durchgestaltung eines Textes, kurz: der künstlerischen Qualität. Es ist gleichzeitig diejenige Komponente, die letztlich die entscheidende geworden ist für den Durchbruch der neuen Verbreitungs- und danach auch Publikationsform des ausgehenden 6. und beginnenden 5. Jh.s: des Kopiersystems auf breiter Front. Denn je künstlerischer durchgestaltet ein Text ist, desto individueller und damit schwerer in die Erinnerung zurückzurufen ist er - desto wertvoller also und damit desto bewahrenswerter für viele: Darin liegt der stärkste Stimulus für die Institutionalisierung des Abschreibern. I 247 Auch in der Qualitätsfrage haben in den letzten Jahren erste Tastversuche begonnen (s. die Arbeiten von Degani 1984, Adkins 1985, Fowler 1987). Dieser Weg ist vielversprechend. Wohin er führen könnte, sei zum Abschluß an einem konkreten Beispiel wenigstens angedeutet: an Alkaios Fr. 140 V. 6. Alkaios Fr. 140 V. als Beispiel höchster Qualität frühgriechischer Symposionsdichtung ].··[
μαρμαίρει δέ μέγας δόμος χάλκωι, παισα δ' "Αρηι κεκόσμηται στέγα λάμπραισιν κυνίαισι, κατ τάν λευκοί κατέπερθεν ιππιοι λόφοι νεύοισιν, κεφάλαισιν ανδρών αγάλματα- χάλκιαι δέ πασάλοις κρύπτοισιν περικείμεναι λάμπραι κνάμιδες, ερκος ίσχύρω βέλεος θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κάτ ασπίδες βεβλήμεναν πάρ δέ Χαλκίδικαν σπάθαι, παρ δέ ζώματα πόλλα καί κυπάσσιδες. των ούκ εστι λάθεσθ' έπεί δή πρώτιστ' ύπά τώργον έσταμεν τόδε.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
377
... funkelnd flammt ja das große Haus von Erz - ganz ist für Ares ausstaffiert der Bau mit hellblitzenden Helmen, von denen weiß aus der Höhe die Büsche aus Pferdehaar nicken: Köpfen von Männern Prunk und Zier! Erzgewirkt, machen die Haken der Wand unsichtbar - ringsherumgehängt blanke Beinschienen: Schutz gegen starkes Ferngeschoß, und Brustpanzer aus frischem Lein, und Hohlschilde, zu hohen Stapeln aufgehäuft; dabei Schwerter aus Chalkis auch, dabei Gürtel in Mengen und Schurze aus Lederwerk deren nicht zu gedenken: unmöglich, seit dieses Werk wir auf uns nahmen hier! I
Das Fragment ist lange Zeit als trockener Waffen-Katalog gedeutet worden 248 (siehe die Bibliographie S. 395). Nach der Lektüre von Frankels und Page's Text-Behandlungen mußte man zu dem Schluß kommen, der Junker Alkaios stehe hier als eine Art Franz Moor in einem besetzten Forsthaus und zähle die Scalps auf, die dort wie Hirschgeweihe dekorativ an den Wänden hängen. Mäurach hat dann 1968 gezeigt, daß das Lied keine behagliche Besitzer-Inventur ist, sondern ein drängender, vorwärtstreibender Appell. Maria Grazia Bonanno hat das 1976 aufgegriffen und aus Frankels Forsthaus oder Page's Waffenmuseum einen Ares-Tempel gemacht, in dem die Hetairie sich angesichts der ringsum aufgehängten Beutegaben an ihre ruhmvolle Tradition erinnert. Bei Rosier 1980 und Anne Pippin Burnett 1983 klingt manches davon an, aber zur einheitlichen Deutung ist es noch nicht zusammengewachsen. Hier sollen nur ein paar Punkte hervorgehoben werden: (1) Der grimmig-sarkastische Paränesen-Ton Wir alle kennen diesen Ton aus den homerischen Kampf-Paränesen.43 Hier bei Alkaios wird er vor allem durch das "Αρηι κεκόσμηται (V. 2) erzeugt. Schon Frau Bonanno hatte 1976 vermutet, daß "Αρηι nicht Dat. instr. sei, sondern Dat. commodi, und hat als Parallele für κοσμεί ν τινί τι unter anderem die OdysseeStelle θ 13 herangezogen. Eleonora Cavallini hat das 1981 durch Tragikerstellen gestützt, die unser Alkaios-Lied zu zitieren scheinen.
J. Latacz, Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios (Zetemata 66), München 1977, 246. Beispiele: Β 381-393, Δ 242-249, Ζ 5 5 6 0 , 0 220-228.
378
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
Die Parallele θ 13 scheint mir aber noch nicht ausgeschöpft zu sein. Nausikaa kommt dort von ihrem langen Waschtag in ihre Kammer im Elternhaus zurück, und ihre Zofe Eurymedusa macht es ihr gemütlich: ή oí πυρ άνέκαιε καί είσω δόρπον έκόσΐίει. κοσμειν bedeutet hier .schön anrichten, zubereiten, fein garnieren'. Auf unsere Alkaios-Stelle umgesetzt, erhalten wir den Sinn: ,und der ganze Bau ist dem Ares angerichtet - mit funkelnden Helmen (usw.)' I 249 Ich glaube nicht, daß , Ares' da den Tempelherrn meint, dem man Votiv-Waffen aufgehängt hat. Dagegen sprechen in Vv. 7/8 die Worte κρύπτοισιν πασσάλοις (κρύπτουσιν πασσάλους) κνάμιδες, sowie in V. 11 κατ ασπίδες βεβλήμεναι (ασπίδες καταβεβλημένοι): Man hängt dem Gott im Tempel nicht so viele Beinschienen an die Haken, daß die Haken gar nicht mehr zu sehen sind, und man stapelt die Schilde im normalen Tempel nicht zu hohen Lagerhaufen auf. Das klingt alles nicht nach Tempelschmuck, sondern nach Munitionsdepot. Entsprechend sollten wir beim Dativ "Αρηι vielleicht nicht an den Gott des Kultes denken, sondern an den blutgierigen Kriegsgott des Epos (der metonymisch so oft für .Krieg' steht!) - an den μιαιφόνος, βροτολοιγός, ατός πολεμοιο, den die θεράποντες "Αρηος mit Blut sättigen müssen, αίματος άσαι (E 289 u. ö.). Also: ,und für Ares angerichtet ist der ganze Bau!' Das bedeutet: das ganze Haus wartet nur darauf, für Ares dazusein - aber nicht als Tempelgabe, sondern als funkelndes Besteck, bereit zu Ares' .Tränkung'. Das ist dann freilich ein anderer Ton als Frankels .Die ganze Halle ist mit Krieg geschmückt' oder Treus .prangt doch das ganze Haus in Waffenglanz'. Statt dessen hört man den gepreßten Ton grimmiger Drohung, den wir aus den homerischen Paränesen so gut kennen. Die Waffen-Aufzählung ist dann auch kein liebevolles Streicheln der Einzelstücke mehr, sondern ein grimmiges , Hinknallen' - j e d e s Stück ein neuer Trumpf.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
379
(2) Die Gliederungs-Struktur
]...[ μαρμαίρει δέ μέγας δόμος χάλκωι, παισα δ' "Αρηι κεκόσμηται στέγα I 2 /,
λαμπραισιν κυνίαισι, κατ ΚΤΝΙΑΙ
τάν λευκοί κατέπερθεν Ίππιοι λόφοι νεύοισιν, κεφάλαισιν övδρων άγάλματα^άλκιαι δέ πασάλοις κρύπτοισιν περικείμεναι
ΚΝΑΜΙΔΕΣ
1 '/3
λάμπραι κνάμιδες, ερκος ίσχύρω βέλξρς θόρρακές τε νέω λίνω
ΘΟΡΡΑΚΕΣ '/2
ΑΣΠΙΔΕΣ '/2
κόιλαί τε κάτ ασπίδες βεβλήμεναι· I παρ δέ Χαλκίδικαι σπάθαι, πάρ δέ ζώματα πόλλα
ΣΠΑΘΑΙ '/j | και κυπάσσιδες.
ΖΩMATA •Λ
ΚΤΠΑΣΣ. '/,
των ούκ εστί λάθεσθ' έπεί δη πρώτιστ' ύπά τώργον εσταμεν τόδε.
D i e Graphik sucht zu verdeutlichen, wie der Raum, den die einzelnen Waffen im Text einnehmen, immer kleiner wird, von einzweidrittel Versen für die κ υ ν ί α ι bis zu nur noch einem halben Vers für die zwei Waffenstücke ζώματα + κ υ π ά σ σ ι δ ε ς zusammen. Das Tempo wird durch Reduktion der attributiven Elemente Schritt für Schritt gesteigert, es entwickelt sich v o m Legato bis zum Staccato, wird sozusagen atemlos - um dann auf των (in V. 14) in einer langen Fermate auszuruhen - und in dem Maestoso des Schluß-Appells auszuklagen. (3) D i e Klang-Struktur ]...[ μαρμαίρει δέ μέγας δόμος 12άλκωι| ποάσα δ' "Αρηι κεκόσμηται στεχα λαμπραισιν_κυνίαισι, κατ τα ν λευκοί κατέπερθεν ίππιοι λόφοι νεύοισιν, Κεφάλαισιν ανδρών αγάλματα ^άλκια^δέ πασάλοις κρύπτοισιν περικείμεναι λάμπραι κνάμιδες, έρκος ίσ^ύρω βέλξρς θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κάτ ασπίδες βεβλήμεναι· ijàp δ^_Χαλκΐ0ΐ_και| σπάθαι,
Vergleich: Hipponax Fr. 32 W.
Έρμη, φίλ' Έρμη, Μαιαδεΰ, Κυλλήνιε, έπεύχομαί τοι, Κάρτα jàp κακ&ς ρι^ώ καιβαμβαλύζω ... δός χλαίνα ν "Ιππώνακτι και κυπασσίσκον και σαμβαλίσκα κ_άσκερίσκα_καί ^ρυσοΰ στατηρας έ^ήκοντα τούτέρου τοίχου.
380
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
πάρ δέ ζώματα πόλλα και κυ^άσσιδες. των ούκ έστι λάθεσθ' έπε'ν δή πρώτιστ' ύπά τώργον εσταμεν τόδε.
Die Zeichnung versucht anzudeuten, wie durchgefeilt die Alliterationstechnik zumindest mit μ (ν), κ (χ, γ) und π (β, φ) ist. Das ist bei Alkaios natürlich kein Einzelfall. Für Skeptiker ist zur Illustration des Phänomens als solchen das unbestritten klangmalende Hipponax-Fragment 32 W. aus der zweiten Hälfte des 6. Jh.s danebengesetzt. Da hört man, wie der Sprecher friert und klappert (Degani hat das im Kommentar schön herausgebracht). Was Alkaios mit dieser KlangTechnik hier erreichen will, dürfte die Stimmung verbissener Entschlossenheit sein. Auch hier wäre natürlich weiterzuarbeiten. I 251 (4) Die Rhythmus-Struktur
Korzeniewski hat 1968 in seiner griechischen Metrik reiches Material dafür beigebracht, daß die äolischen Dichter die sinntragenden Begriffe gern (nicht immer natürlich) in den Nucleus des Verses setzen, d.h. in den Choriambus. 44 Im folgenden ist ein Versuch gemacht, dies auf unser Alkaios-Lied umzusetzen: metrum: 2 gl ia II Nucleus 1 Nucleus 2
υ-
]...[ μαρμαίρει δέ μέγας δόμος χάλκωι, παίσα δ' "Αρηι κεκόσμηται στέγα λάμπραισιν κυνίαισι, κατ τάν λεΰκοι κατέπερθεν ϊππιοι λόφοι νεύοισιν, κεφάλαισιν ανδρων αγάλματα- χάλκιαι δέ πασάλοις κρύπτοισιν 7ΐερικείμεναι λάμπραι κνάμιδες, ερκος ίσχύρω βέλερς θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κατ ασπίδες βεβλήμεναν πάρ δε Χαλκίδικαι σπάθαν, πάρ δέ ζώματα πόλλα και κυπάσσιδες. των ούκ εστί λάθεσθ' έπεί...
XX j-uu-J u - u - u u II
> μέγας >
Αρηι
> κυνιαισι > κεφαλαισι(ν)
> κναμιδες ερ> νεω >
ασπίδες
-> Χαλκιδικαι —> εστι λαθεσθ'
Das Lied klingt anders, wenn man es in dieser Weise hört (auf die Binnenreime wie κνάμιδες - ασπίδες sei nur am Rande hingewiesen). 44
D. Korzeniewski, Griechische Metrik, Darmstadt 1968, 133-140.
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
381
(5) Die Assoziationskraft Oft wurde zur Erklärung des Liedes auf Waj5%«-Aufzählung im Epos hingewiesen. Möglicherweise ist die wirklich angestrebte Assoziation indessen eine andere. Als Beispiel ist Agamemnons Aufzählung der angebotenen Geschenke für Achilleus aus dem I der Ilias hergesetzt: 120
άψ έθέλω άρέσαι δόμεναί τ' άπερείσι' αποινα. ύμίν δ' έν πάντεσσι περικλυτά δώρ' όνομήνω: επτ' άπύρους τρίποδας, δέκα δέ χρυσόίο τάλαντα, α'ίθωναζ δέ λέβητας έείκοσι, δώδεκα δ' ίππους πηγούς αθλοφόρους, ο'ί άέθλια ποσσίν αροντο.
130
[...] δώσω δ' έπτά γυναίκας άμύμονα εργα ίδυίας, Λεσβίδας, ας οτε Λέσβον έϋκτιμένην ελεν αυτός έξελόμην, αϊ κάλλει ένίκων φύλα γυναικών. τάς μέν οί δώσω, μετά δ' εσσεται ήν τότ' άπηύρων, κούρη Βρισηος· έπί δε μέγαν ορκον όμοΰμαι... [..·]
135
ταΰταμέν αυτικα παντα παρεσσεταν
135
εί δέ κεν αΰτε αστυ|μέγα Πριάμοιό] θεοί δώωσ' άλαπάξαι, νηα αλις γρυσοΰ και γαλκοϋ νττησάσθω είσελθών, οτε κεν δατεώμεθα ληΐδ' 'Αχαιοί, Τρώίάδας δέ γυναίκας έείκοσιν αυτός έλέσθω, αί κε μετ' Άργείην Έλένην κάλλιστοι εωσιν.
140
εί δέ κεν|"Αργος|ίκοίμεθ' Άχαι'ΐκόν, οΰθαρ άρούρης, γαμβρός κέν μοι ëor τείσω δέ μιν Ισον 'Ορέστη, ος μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίη ενι πολλή. τρεις δέ μοί είσι θύγατρες évi μεγάρω εΰπήκτω,
7,10 20,12 (Α) SOFORT I 7
(Β) TROIA
20
(C) ARGOS 3
382
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
145
Χρυσόθεμις καί Λαοδίκη και Ίφιάνασσα, τάων ήν κ' έθέλησι φίλην άνάεδνον άγέσθω προς οίκον Πηλήος· έγώ δ' έπί μείλια δώσω πολλά μάλ', οσσ ού πώ τις έή έπεδωκε θυγατρί.·
150
έπτά δέ οι δώσω εΰ ναιόμενα πτολίεθρα, Καρδαμύλην Ένόπην τε και Ίρήν ποιήεσσαν, Φηράς τε ζαθέας ήδ' "Ανθειαν βαθύλειμον, καλήν τ' Α'ίπειαν και Πήδασον άμπελόεσσαν. ... :
7
ν ψ ψ ταΰτά κέ οί τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. δμηθητω! [rechts beigeschriebene Ziffern: Zahlennennungen] I 253 Vgl. Alkaios Fr. 140, Ende: πάρ δέ Χαλκίδικαι σπάθαι, πάρ δέ ζώματα πόλλα και κυπάσσιδες ...
>r
\t
V
>
των ούκ εστι λάθεσθ'! έτιεί δη πρώτιστ' ΰπά τώργον έσταμεν τόδε. Bei diesem Geschenke-Katalog ist ja wohl deutlich, daß er keine Inventarliste ist. Hier wird vielmehr eine Masse aufgestaut - eine Masse, die immer größer, schwerer, wuchtiger wird. Ihr Druck wird so stark, daß der Adressat am Ende kaum mehr standhalten kann. Die Masse der Geschenke soll Achilleus erdrücken, überrollen - so daß er am Ende gar nicht anders kann als der Forderung, die in den Gegenständen liegt, nachzugeben: ταΰτά κέ oi τελέσαιμι: - δμηθητω!
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
383
So auch bei Alkaios: των - οΰκ εστι λάθεσθαι ! Die Aufzählung hat ein Potential aufgetürmt und zusammengeballt, das durch seine bloße Präsenz die Adressaten zum Handeln zwingt: .Unmöglich, daran auch nur einen Augenblick lang nicht zu denken!' *
Mit Beobachtungen dieser Art dürften wir dem Zentrum des Alkaios-Liedes noch ein Stück näher kommen können als mit den Untersuchungen zum Umfeld des Textes. Alkaios selbst hat ja um den Voraussetzungsreichtum seiner Kunst sehr wohl gewußt und darüber reflektiert, wie ζ. B. Fr. 204,6 V. zeigt, wo er über seine ποίησις (wie viele antike Dichter nach ihm) als über eine θέσις (ein θεΐναι) spricht (Abb. 9); Gentiii hat darüber 1984 im Aufsatz .Poetica della Mimesi' manches Klärende gesagt. Umfeld-Untersuchungen werden natürlich auch weiterhin gebraucht. Das Eigentliche wird aber damit nicht zu leisten sein. Das Lied hat ja auf sein Publikum nicht dadurch gewirkt, daß es von Waffen sprach, sondern dadurch, wie es von Waffen sprach. Die volle historische Dimension der Lieddeutung wird darum erst I dann in den Blick kommen, wenn 254 dieses , Wie' bedacht wird. Historisch interpretieren kann ja nicht bedeuten: die historischen Umstände interpretieren. Es kann nur bedeuten, die gesamte historische Situation des Liedes zu erfassen. Der Ort der Lied-Darbietung, das Symposion, ist nur ein Teil davon. Der Kunstgenuß des Symposiasten ist ein zweiter - und doch wohl der wesentlichere. Denn das Stimulans für die Höher-Entwicklung der beim Symposion dargebotenen Liedkunst war die Reaktion der Hörer. Diese war aber um so positiver, je qualitätvoller ein Lied war. Das war es, was den Liedermachern den Impuls zur Überbietung gab - nicht anders als in der gleichzeitig sich entwickelnden Welterklärungsbemühung, die wir »Wissenschaft' und .Philosophie' nennen. Auf diese Weise bewirkte das Symposion Steigerung der poetischen Qualität und Entwicklung neuer poetischer Ideen. Die Produkte der Wortkunst wurden so immer kostbarer - und der Wunsch, sie zu besitzen - orts- und zeitunabhängig zu besitzen - , immer stärker, nicht anders als in anderen Künsten. Nur daß in der JVorfkunst der einzige Weg, diesem Wunsch gerecht zu werden, in der Vervielfältigung bestand. So ist das frühgriechische Symposion über die Wertsteigerung, die es für Produkte der Wortkunst erzwang - zusammen mit den öffentlichen Festen und (was
384
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
hier nicht näher ausgeführt werden konnte) mit der milesischen Denkerschule zu einem Motor der griechischen und damit der europäischen Literaturentwicklung geworden. I
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
385
Anhang
h o o
Λ
sv vecTOpoc: ε[2-3]ι: ευποτ[ον]: ποτεριον Ιιοοδαντοδεπιεα: ποτερι[ο]: αυτικακενον h^epochaipecei: καλλιοτε[φα]νο: αφροδιτεο [vgl. μήνιν άειδε θεά:
Πηληϊάδεω: Άχιλήος]
Abb. 1: Die Aufschrift des Nestorbechers
vectopoc: ε[εντ]ι: ευποτ[ον]: ποτεριον hocôavTo5enieci: ποτερι[ο]: αυτικακενον
i
I
Β2 C2 Ιιιμεροοίιαιρεοει: καλλκ;τε[φα]νο: αφροδιτεο
i
i
Β,
C-l
Abb. 2: Die Zäsuren-Markierung in den Hexametern der NestorbecherAufschrift (Alpers - Heubeck)
Abb. 3: (Textmenge Poesie in den Jhh. VIII-VI) siehe S. 389
δη τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς· ,,Δημόδοκ', έξοχα δή σε βροτών αίνίζομ' απάντων ή σε γε Μοϋσ' έδίδαξε, Διός πάϊς, ή σέ γ' 'Απόλλων
386
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
αϊ κεν δή μον ταύτα κατά μοιραν καταλέξης, αύτίκα και πάσιν μυβησομαι άνθρώποισιν. ώς άρα τοι πρόφρων θεός ώπασε θέσπιν άοιδην." Abb. 4: D i e Ruhmeserwartung des epischen Sängers ( O d y s s e e θ 497 f.) I
256 κατθάνοισα δέ κείσην,ούδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν εσσετ' ούδέ t ποκ' t ύστερον ού γάρ πεδέχηις βρόδων τών έκ Πιερίας, άλλ' άφάνης κάν Άίδα δόμωι φοιτάσηις πεδ' άμαύρων νεκύων έκπεποταμένα. Abb. 5: Die Ruhmeserwartung des lyrischen Dichters (Sappho Fr. 5 5 V.)
POxy. 2298fr. 1 (ed. Lobel) ( = Alkaios Fr. 249 V.) [•]
] ov χ[ό]ροναί..[ ].νάα φ[ερ]έσδυγον ]ην γάρ ο[ύ]κ αρηον ]ω κατέχην άήταις έ]κ γάς χρή προίδην πλό[ον αϊ δύναταΐι καί πίαλίάμαν ëbrlrii. έπει δέ κ' έν π]όν[τωι γ]ένηται τώι παρέοντι τρέχην (?) άνοΟγκιχ. μ]αχάνα αν]εμος φέρ[ ]εν ].ι[ Aus: W. Rosier, Die Alkaiosüberlieferung im FIEC, 1188, Budapest 1983).
,attisches ' Skolion bei Athenaios (PMG Fr. 891)
< x - u > έκ γης χρή κατίδην πλόον εϊ τις δύναιτο και ΐίαλάμην eyoi. έπει δέ κ' έν πόντωι γένηται τώι παρέοντι τρέχε.ι.ν.άνάγκη.
6. und 5. Jh. (Actes du VII e Congrès de la
Abb. 6: Originäre Lyriker-Überlieferung und Lyriker-Nebenüberlieferung in .Liederbüchern'
Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur
387
(= 112 PAGE, LGS)
Alkaios 44 V. άγ[
]·[ Ö.[
].[
έ[
].[.].ρ[..]..[
μ[.]ρ[ μάτε[ρ
]νι κάκω περρ[ ]άσδων έκάλη να[
6 μάτε[ρ' έξονομ]άσδων έκάλη νά[ιδ' ύπερτάταν
νύμφ[αν ένν]αλίαν ά δέ γόνων [άψαμένα Δίος Ικέτευ[
]τω τέκεος μάνιν[
νύμφ[αν ένν]αλίαν ά δέ γόνων [άψαμένα Διός 8 ίκέτευ' [άγαπά]τω τέκεος μάννν [ P. Oxy. 1233 frr. 9. 1-8, 3. 1-7
Abb. 7: Beispiel 1 für μεταποίησις (Intertextualität) I
257 Mimnermos 6 West Diogenes Laertius 1. 60 de Solone φασί δέ αυτόν καί Μίμνερμου γράψαν-ιος αϊ γαρ άτερ νούσων ιε καί άργαλέων μελεδωνέων έζηκονταέτη μοίρα κίχοι θανάτου, έπιτιμώντα αύτφ ειπείν [Solon 20 West] [Diogenes Laertius 1. 60, v. ad Mimn. fir. 6] [0 1
>>·* . » α • S . a 3 ó.s
2 a S
l l l l l l l 3·
lE ^ l l l ' â . Ë S8.S i s g o _ sea
υ ' ! •*· 2
¿ m 1 „ ri ¿ , ¿ 8 * 1 α S a*^ 3 ρ
S I l i •S« 4 I I f -
Ji . g"1 ^ S g o g î j î ï .
i.a lν
I l i
J s?
l>§ s s
δ χ „•HO u sS "s g a κ vi .a e « ρ i M f l e Ï I S I · * 8 · 8 *
ι
fS· la rS f fi^ i g a· r S--' p
ï i - .sr» a s S ^ c »
1
g
δ s i 3
5
s
-a
2 •5 3 c « 1 1
l'i i.ι J á ; «,g «Ό
8.3 Ξ S Ì "
S3·«
5 38 s ·» « g s a s j
g !
' « O u
S" I Sôi,c g E s fö < J 2 •α-ο-ω > y o ^ . m 9 i£ 3 S
¡ i l ^ ' l l · •s § ¡ * 1 3 9 5. S S β eäSo-S 2
i i
l ^ l l u J Hg 3 U î O tí >> Is-»
UH
I S - I I I I S S SP.? 3 'S tí -S « co •δ
g-o
§
H " s
H i
ä . a . Svr s - J ^ s s *
ä υ Q > ε
1
δ
» 1 i E 3 - = S a "i
u •a
a. -
I
¿.f I73
ts
.„s S3
3 § ··< u-DU fi) CQ Vì to > M
i p . § ¡
1 I
"8
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
455 17
u> h« S ρ a -η ω ? ts ω >
I
§ s-S.8 ë ^ l i c i
i
8·§{Ξ g ? £
00 Γ -
O. i i f ¿ΐη I I « s «
feri ι so
a..Γ « έ «ä •S « l i n e i Vy k-ñ
3 «Ï.S iS· 3 "
456 18
Funktionen des Traums in der antiken Literatur - so träumte sie - schnitt er ihr die kranke Pupille I auf und tröpfelte ein Mittel hinein. - Als es Tag ward, ging sie gesund davon."
Der Realitäts- oder gar Wahrheitsgehalt solcher Traumheilungsberichte soll hier nicht weiter erörtert werden. (2 b) Die zweite Form der Traumdiagnostik wurde von den griechischen Ärzten praktiziert. Hier geht es rationaler zu. Die Traumdiagnostik bildet hier nur einen Teil der Gesamtbehandlung, die Träume werden als Teilsymptome zur Bildung einer Gesamtdiagnose verwertet. Zahlreiche interessante Einzelheiten über diese psychosomatische Globaltherapeutik erfahren wir aus einem medizinischen Traktat, der für uns den frühest-erhaltenen zusammenhängenden antiken Traumtext überhaupt darstellt, in der Schrift Περί ένυπνίων, .Über Träume', eines für uns namenlosen griechischen Arztes aus der Zeit um das Jahr 400 v. Chr. Die Schrift bildet einen Teilabschnitt einer umfassenden Abhandlung über den Zusammenhang von Gesundheit und richtiger Ernährung. Infolgedessen geht es dem Verfasser, der uraltes, ζ. T. außergriechisches, bes. indisches Material benutzt, vor allem um die diätetischen Hinweise, die insbesondere Leibreizträume dem Arzt geben können. So zeigen Träume von Brunnen oder überhaupt von Wasser häufig Blasenstörungen an, usw. Ganz allgemein aber gilt für diesen Mediziner, daß „Träume, die zu den gewöhnlichen Tagesverrichtungen in Gegensatz stehen" (ζ. B. Angstträume), Krankheit indizieren, und zwar durchaus auch Krankheiten der Seele (της ψυχής). Der Verfasser ist zwar nicht gerade ein Hippokrates, er arbeitet selten empirisch und kompiliert lieber, und sein Elaborat ist offenbar eher zufällig ins Corpus Hippocraticum hineingeraten, aber seine Schrift ist äußerst wertvoll als Beleg für eine schon früh einsetzende Tendenz der griechischen Medizin, nicht nur körperliche, sondern auch seelische Krankheitssymptome für die Diagnostik und die Therapie zu verwerten. Die mantische Traumauffassung, die in den Träumen gottgesandte Zeichen sieht, auf die es mit Gebeten und Beschwörungen zu reagieren gilt, ist hier offenkundig aufgegeben. Auf der anderen Seite wirkt aber diese Art der Traumverwertung, wenn sie uns auch später, etwa bei Galen, in gereifterer Form entgegentritt, immer etwas mechanistisch. Der Grund dafür liegt in der betont .naturwissenschaftlichen' Sichtweise, die sich - das Kind mit dem Bade ausschüttend - nicht nur der mantischen Traumauffassung verschließt, sondern auch der ganzen zu dieser Zeit schon sehr bewegten philosophisch-psychologischen Traumdiskussion. Da 19 haben wir, wie man wohl erkennt, den Anfang einer Aspektspaltung I vor uns, die die Behandlung der Traumthematik bis in unsere Tage hinein prägt: hier der primär medizinische Zugang, der von der lastenden Notwendigkeit, Heilerfolge
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
457
zu erzielen, bestimmt ist - dort der primär philosophische Zugang, der - von praktischen Zwecksetzungen frei - dem rein theoretischen Erkenntnisinteresse dient. (3) Dieser zweite, philosophische Zugang hat bei den Griechen schon sehr früh eingesetzt, im 6. Jh. v. Chr. Wir haben von den Philosophen vor Sokrates zu wenig Aussagen, um ihre Traumtheorien noch wirklich erkennen zu können. Nur hier und da blitzt ein Wort zu uns herüber, das uns trotz oder wegen seiner Dunkelheit tief anzurühren vermag. Etwa wenn Heraklit in Fragment Β 89 sagt: „Im Wachen hat man eine einzige und allen gemeinsame Welt - im Schlafen aber wird jeder einzelne in seine Eigenwelt hinweggewendet" (die .Individualität' des Traumes!)
oder in Fragment Β 26 - noch dunkler - : „Der Mensch in der Nacht: Licht zündet er an für sich selbst, sobald erloschen seine Sichtwerkzeuge" (der häufig empfundene .persönliche Offenbarungscharakter' des Traumes?).6
Wir vermögen nur zu ahnen, welche Wege das griechische Denken nach Heraklit weitergehen mußte, um auf solchen Bahnen schließlich zu Einsichten zu gelangen, wie sie dann Piaton ausspricht, etwa im ,Timaios' (71): „Der Seherkunst bedient sich die Seele im Schlaf - weil sie da an Verstand und Denken keinen Anteil hat";
denn: „die Seherkunst hat der Gott der menschlichen Bewußtlosigkeit (ά-φροσύνη) gegeben; niemand nämlich kann bei klarem Bewußtsein (εν-νους) an die Seherkunst rühren, - die goi/erfüllt - und wahr ist".
Diese Seherkunst der Seele aber, die μαντική, ist, wie im ,Phaidros' (244) erklärt wird, nur ein anderes Wort für den schöpferischen Wahn, die μανία, über die es an der gleichen Stelle heißt: „die kostbarsten unserer Güter bringt uns der Wahn, wenn er als göttliches Geschenk beschert wird. Wahrlich, die Prophetin in Delphi und die Priesterinnen in Dodona haben in Wahn verzückt vieles Schöne - in privaten und öffentlichen Dingen - für Hellas bewirkt - bei klaren Sinnen aber Kümmerliches - oder gar nichts."
Im Traum ist der Mensch der Wahrheit am nächsten: eine Einsicht, deren ganze Bedeutung uns offenbar erst heute - im gleichen Maße, I in dem sie von der 20 neueren Traumforschung gestützt wird - allmählich aufzugehen beginnt.7 ® Vgl. Aischylos, Eumeniden, Vers 104 (den schlafenden Erinyen erscheint das Traumbild Klytaimestras und sagt u. a.:) „schlafend nämlich wird der Geist durch Augen hell". 7 Vgl. die hervorragende Abtastung der Selbstdarstellungsfunktion des Traumes durch G. Benedetti, Der Offenbarungscharakter des Traumes an sich und in der psychotherapeutischen Beziehung., unten S. 179-193 [hier nicht abgedruckt]. Im gleichen Sinne - als .Enthüllung des Tiefenselbst des Träumers im Traum' - deute ich weiter unten Agamemnons Traum bei Homer. Große Dichtung - und Homer ist dafür nur ein Beispiel - kennt diese Traumfunktion spontan.
458
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
Gegenüber solchen Einblicken in die tiefe Bedeutsamkeit des Traumes für die menschliche Welt- und Selbsterkenntnis muten die mit Demokrits Atomismus einsetzenden und von Aristoteles' nüchterner Seelen- und Traum-Analyse beförderten Versuche, die Träume für absolut bedeutungslos zu erklären, kalt und gefühllos an: Etwa Demokrit (bei Aetius V 2,1): „Die Träume kommen durch das Herantreten äußerer Bilder zustande"
oder - in seiner Nachfolge - Epikur (Gnom. Vat. Epicur. 24 = S. 63 Von der Mühll): „Träume haben keine göttliche Natur und keine mantische Kraft, sondern entstehen durch Einfall von Bildern."
Die Kluft zwischen idealistischem und materialistischem Welt- und Menschenbild ist hier, wie man sieht, auch für den Teilaspekt der Traumauffassung bereits kraß aufgebrochen. Auf die vielen späteren - modifizierenden und nuancierenden - Stimmen aus dem Kreis der philosophischen Traumtheoretiker einzugehen erlaubt leider der verfügbare Raum nicht. IV So schließe ich hier die Übersicht über die ersten beiden Gruppen der antiken Traumtexte ab und gehe nunmehr zu jener Textgruppe über, der mein eigentliches Interesse gilt, weil sie, wie ich glaube, die tiefsten Einsichten der Antike in Wesen und Wirkung des Traumes vermitteln kann: zu den sprachlichen Kunstwerken. - Auch hier freilich ist Auswahl nötig. Die Graphik zeigt die vielen Gattungen, die Fülle der Namen. Ich muß mich auf die Dichtung beschränken. Die wesensmäßige Affinität großer Dichtung zu Traum und Unbewußtem ist oft betont worden. Herder hat die Träume „die Mütter der eigentlichen Dichtkunst" genannt. Was damit gemeint ist, kann uns wieder Piaton lehren. An einer Stelle, die die neuzeitliche Auffassung von wahrer Dichtung für lange Zeit bestimmt hat, im .Phaidros', unmittelbar anschließend an jene vorhin zitierte Deutung des Traumes als Mittel der Wahrheitserkenntnis, sagt Piaton (Phdr. 245): I 21
„Eine dritte Form aber der Besessenheit und des Wahnes kommt von den Musen. Wenn sie eine zarte, schlummernde Seele ergreift, weckt sie sie auf und begeistert sie zu Liedern und zu anderer Dichtung [...]. Wer aber ohne den Wahnsinn der Musen sich den Pforten der Dichtkunst naht, in der Überzeugung, schon durch gute Technik ein fähiger Dichter zu werden, der bleibt erfolglos, und die Dichtung des Vernilnftlers schwindet vor der Dichtung der in Wahn Verzückten ins Nichts."
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
459
Große Dichtung also ein Schöpfen aus der Tiefe des Unbewußten. Daraus spricht persönliche Erfahrung. Diese Erfahrung kam Piaton aus der Vertrautheit mit der Dichtungstradition seines Volkes zu. Begonnen hat diese Tradition für jeden Griechen mit Homer. Er ist den Dichtem der Griechen - und auch noch denen der Römer - , zumal ihren epischen und tragischen Dichtern, im Schaffensprozeß stets gegenwärtig, unmittelbar lebendig gewesen, - zuerst, in den Jahrhunderten etwa bis zum Hellenismus, noch ganz unbewußt und selbstverständlich, später dann jahrhundertelang noch wenigstens als reflektiertes Paradigma. Wo die Dichter eines Volkes eine solche ιδέα ποιήσεως, eine Idee von dem, was Dichtung ist, so unzerstörbar in sich tragen - wir würden heute vielleicht sagen: so völlig internalisiert haben - , da vermögen sie sich natürlich von ihr auch in den kleinsten Einzelheiten der sprachlichen, motivischen und kompositionellen Gestaltung nur schwer zu lösen. Ob es einen Charakter zu zeichnen gilt, eine bestimmte menschliche Konstellation zu formen, eine Handlungsstruktur aufzubauen - stets stellen sich unweigerlich die entsprechenden homerischen .patterns' ein. Diese Verhaftetheit im Urbild der Dichtung Homer zeigt sich nun auch in der Behandlung des poetischen Gestaltungsmittels ,Traum'. Aischylos, Sophokles, Euripides, aber auch etwa der Geschichtsformer Herodot, und natürlich auch Vergil und seine römischen Nacheiferer, ja selbst die kaiserzeitlichen Romanschriftsteller noch - sie alle stehen in ihrer Traumbehandlung - formal, inhaltlich und funktional - im Banne Homers. Selbstverständlich bringen die jeweils anderen Gattungserfordernisse, Zeitstimmungen und Erkenntnisstufen, und vor allem die jeweils anderen persönlichen Traum-Erfahrungen neue Nuancen in die Traumbehandlung hinein - aber am Grundgerüst wird selten einmal gerüttelt. Den Gründen für dieses erstaunliche Festhalten an der Tradition können wir hier nicht nachgehen. Es muß genügen festzustellen: Technik und Funktionen der Traumflngierung im Sprachkunstwerk sind in der griechisch-römischen Antike im wesentlichen die Homers.8 Fragen wir also, wie Homer mit dem Traum umgeht. I In Ilias und Odyssee zusammengenommen sind sieben ausgeführte Träume 22 erzählt, drei in der Ilias, vier in der Odyssee. Die Träumenden sind in der Ilias Agamemnon, Priamos und Achill, in der Odyssee dreimal Penelope, einmal Nausikaa. Wir sehen: es sind alles Hauptfiguren, die der Dichter träumen läßt. 8 Gegenteilige Behauptungen (ζ. B. Devereux passim) beruhen auf mangelhafter Kenntnis der Texte und der Erklärungsliteratur. Eine kenntnisreiche und differenzierte Erörterung dieser Frage ζ. B. bei Lennig, S. 34—40.
460
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
Damit fassen wir bereits ein erstes Charakteristikum der antiken literarischen Traumfingierung: die Bedeutsamkeit. Bedeutsam im Rahmen des jeweiligen Kunstwerks sind die träumenden Personen, bedeutsam sind - demgemäß - die Inhalte ihrer Träume, und bedeutsam sind schließlich die Situationen, in denen der Autor Träume einsetzt. Natürlich heißt das nicht, daß Homer die tausend kleinen Alltagsträume, die jedermann träumt, nicht kennte. Er gibt uns sogar ein eindrucksvolles Beispiel für die Selbstverständlichkeit seiner Kenntnis »normaler' Traumerfahrung: Im 23. Buch der Ilias verfolgt Achill den fliehenden Hektor dreimal um die ganze Stadt Troja herum. Er kann ihn nicht einholen. Beide laufen und laufen ... ja, wie laufen sie eigentlich? Dem Dichter kommt ein Gleichnis in den Sinn: „Ganz so wie man im Traum einen Fliehenden einfach nicht erreichen kann: weder vermag der eine zu entkommen noch der andere einzuholen ganz so konnte Achill den im Lauf nicht erreichen, und der nicht entkommen." (23,199)
Die meisten unter uns kennen wohl diesen quälenden Fixationstraum: man läuft und läuft und kommt doch nicht eigentlich von der Stelle. Diese vollkommene Vergeblichkeit der höchsten Anspannung macht Homer hier durch das Gleichnis deutlich. Mit der Verwendung dieses universalen Traumtyps in einer Verdeutlichungsfunktion verrät er zugleich, wie völlig vertraut er selbst und seine Hörer mit Alltagsträumen waren. Aber große Dichtung kann Alltagsträume nicht gebrauchen - nur eben einmal in einer Spezialfunktion, wo sie - selbst typisch etwas Typisches zu erhellen vermögen. Sonst aber sind sie unbrauchbar, denn große Dichtung ist Selektion des Bedeutsamen. - Wie stellt sich dieses Bedeutsame bei Homer im Falle der Traumfingierung dar? Nehmen wir wenigstens einen homerischen Traum zum Abschluß näher in den Blick, den Traum Agamemnons im 2. Buch der Ilias, und konzentrieren wir uns dabei auf drei Fragen: ( 1 ) wie wird der Traum eingeführt? (2) wie wird er als Traumgeschehen gestaltet? - und: (3) welche Funktion im Kontext der Dichtung wird ihm zuerteilt? I 23 Vorweg eine kurze Skizze der Situation: Die Griechen liegen schon im neunten Jahr vor Troja Sie können und können es nicht nehmen (wir erinnern uns nebenbei an .Alexander vor Tyros' bei Artemidor!). Nun ist auch noch eine Seuche im Lager ausgebrochen: Tiere und Menschen sterben dahin - die Scheiterhaufen lodern dicht an dicht. Niemand weiß Abhilfe. Da beruft Achilleus, der stärkste Krieger und Führer des größten Subkontingents, die Heeresversammlung ein. Die gespannte Atmosphäre einer - sagen wir: .Krisen-Versammlung' -
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
461
breitet sich aus. Der Seher Kalchas wird befragt. Und er benennt den Grund zögernd, ängstlich; denn was er zu sagen hat, ist ungeheuerlich: schuld an der verzweifelten Lage ist - Agamemnon, der Oberfeldherr. Er hat in kalter Selbstgefälligkeit durch eine Tat voller Hybris den Gott Apoll erzürnt. Nun rächt sich Apoll - die Pest ist sein Werk. Apoll muß versöhnt werden, vorher kann der Kampf nicht weitergehen. - Agamemnon reagiert nervös, gereizt, empört. Es kommt zu einem schweren Streit zwischen ihm und Achill. Schon zieht Achill das Schwert - das Zerwürfnis zwischen den beiden Mächtigsten ist besiegelt. Zwar steckt Achill zurück, aber er schwört einen schlimmen Schwur: er wird sich mit seinen Leuten am Kampf nicht mehr beteiligen, bis ihn Agamemnon wieder ehrt. - Agamemnon - als hätte er nicht eben erst gesehen, wohin Hybris führt - schnippst gekränkt und mit einem ,Jetzt erst recht!' die Drohung fort: „Heb dich nur davon, du Feigling! ich brauch' dich nicht!" Die Versammlung löst sich auf. Wie ist die Lage? Die Seuche dauert an, Apoll ist nicht versöhnt, das Heer ist doppelt dezimiert: erst durch das Massensterben, nun auch noch durch Achills Verweigerung. Ein paar Tage später sendet Zeus dem Agamemnon einen Traum. Zeus hat damit einen Plan im Sinn, er will Achill Genugtuung verschaffen, er will, daß der Kampf wieder beginnt und daß die Griechen darin furchtbar unterliegen damit Agamemnon drastisch zur Erkenntnis seines Fehlverhaltens kommt. Aber davon weiß Agamemnon nichts. Er erlebt nur den Traum. Hören wir nun Homer selbst (2,16): „So sprach Zeus zum Traum" (der Traum ist also hier eine Art Person!), „und auf machte sich der Traum, als er das Wort gehört. Rasch kam er bei den schnellen Schiffen der Achaier an und ging geradewegs zu Agamemnon, dem Atriden. Den fand er vor schlafend im Zelte - ringsum war ganz er gehüllt in ambrosischen Schlaf. I Da trat der Traum ganz nahe an sein Haupt heran, dem Nestor gleichend, den ja von allen seinen Räten am meisten ehrte Agamemnon. Dem also gleich sich machend sprach der gottgesandte Traum: ,Da schläfst du, Sohn des großen Atreus! Nicht recht ist's, daß die ganze Nacht hindurch ein Mann schläft, der Entschlüsse fassen muß, in dessen Hand das Kriegsvolk steht, der so viel zu bedenken hat! Nun aber hör mich und begreife schnell: Ich bin ein Bote dir von Zeus! Von Zeus, der aus der Ferne für dich sorgt - und Mitleid mit dir hat. Sich rüsten lassen sollst du, heißt er, die Achaier, und mit aller Kraft! Denn jetzt kannst du vielleicht die große Stadt der Troer nehmen! Nicht länger nämlich sind die Götter im Olymp gespalten: gewonnen hat sie allesamt die Hera, ständig bittend, -
24
462
Funktionen des Traums in der antiken Literatur den Troern also ist nun Leid verhängt von Zeus! Du aber - birg das ja in deinem Sinn, und nicht Vergessen packe dich, sobald der süße Schlummer dich entläßt! ' So also sprach der Traum und schritt davon. Den aber ließ er dort zurück, im Herzen daran denkend, was sich nicht vollenden sollte: Wähnte nämlich zu nehmen die Priamos-Stadt noch am nämlichen Tage Tor, der er war - und wußte so gar nicht die Werke, die Zeus sich in Wahrheit ersonnen.
[...] Wachte dann auf aus dem Schlaf, und noch war um ihn die göttliche Stimme Setzte aufrecht sich auf, glitt hinein in den Mantel, den weichen... " (er rüstet sich und geht direkten Wegs zu Nestor).
Das also ist eines9 der Traum-Modelle, die Homer der nachfolgenden Dichtung hinterlassen hat. - Wir stellen nun unsere Fragen. Frage 1: Wie ist der Traum eingeführt? Typische Merkmale sind: daß er von einem Gott kommt - hier von Zeus - , daß er einen Auftrag hat, den er dem Menschen vermitteln muß, daß er ans Kopfende des Lagers tritt, daß er die Gestalt eines Menschen annimmt (also nicht als Gott erscheint), und zwar eines Menschen, dem der Schlafende sich besonders eng verbunden fühlt - hier Nestors - , daß er den Schlafenden als Traumbild dieses befreundeten Menschen auf seinen momentanen Zustand eigens hinweist („du schläfst") und sich damit ausdrücklich als Traum ausweist. Nun Frage 2: Wie ist der Traum gestaltet? - Typisch ist: daß der Schlafende einen vollständigen, zusammenhängenden und stimmigen Traum erlebt - keine Lücken, keine Fetzen, Symbole, Allegorien, keine Verschwommenheit. Ferner: 25 daß die Traumgestalt nichts andelres tut, als eine Rede zu halten, eine Rede, die in sich völlig logisch ist und die die vollständigste Kenntnis der derzeitigen WflcMeiiJumstânde des Schlafenden offenbart, so als wäre die Traumgestalt der Schlafende selbst, nur daß sie alles viel klarer, einfacher und entschiedener weiß als der Schlafende im Wachheitszustand, zudem aber auch noch des Schlafenden Zukunft kennt - jedenfalls die unmittelbare, die direkt aus seiner Gegenwart folgt. Es ist, als ob die Traumgestalt mit einem einzigen Blick Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Schlafenden umfaßte und ihm daher mit einem Schlage eine Klarheit über sich selbst verschaffen kann, die ihm selbst bis zu diesem Augenblicke nicht erreichbar war (wir denken an Heraklit und Piaton: 9
Es ist der sog. .Außentraum'-Typus (der Traum wird als von außen her an den Menschen herantretend gesehen). Homer kennt daneben auch den ,Innentraum'-Typus (ζ. B. Odyssee 19,535-553 [Penelope spricht:] „Doch auf! deute mir diesen Traum und höre! Gänse fressen mir in dem Hause, zwanzig, den Weizen aus dem Wasser..." usw.).
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
463
der Traum als Mittel der persönlichen, fast darf man schon sagen: der personalen Wahrheitserkenntnis). - Schließlich ist typisch, daß der Schlafende völlig passiv (im herkömmlichen Wortsinn) ist, nichts tut, nur sieht und hört - das aber mit unerhörter Klarheit (wir denken wieder an Heraklit: „Der Mensch in der Nacht: Licht zündet er an für sich selbst, sobald erloschen seine Sichtwerkzeuge"!). Schließlich Frage 3: Welche Funktion hat der Traum? - Zunächst - und auch das ist wieder typisch - : den Schlafenden zum Handeln zu bringen. Der Schlafende erwacht, noch ist er völlig umhüllt von dem eben Erlebten, kerzengerade setzt er sich auf, und es gibt keinerlei Schwanken: Er schickt sich sofort an, den Auftrag auszuführen. Die Traumerscheinung hat ihm unmittelbare Gewißheit gegeben. - Durch diese Gewißheitsvermittlung an den Schlafenden aber schafft sich der Dichter - poetologisch gesehen - mit der Traumfingierung ein unfehlbar wirksames Mittel der Handlungssteuerung. An entscheidenden Punkten der Handlung, bei Handlungsstillstand zumal, an Alternativpunkten der Handlungsführung, bedarf der Dichter, wenn er den Traum einsetzt, keiner langen äußeren Begründungen mehr, warum das Geschehen so und nicht anders weitergehen muß. Denn das augenblickliche Gewißheitsempfinden des Schlafenden springt ja unmittelbar, d.h. ebenfalls augenblicklich, auf den Rezipienten über und macht so jede weitere Motivierung überflüssig. Traumfingierung, wie sie hier geschieht, ist also zugleich Rezeptionssteuerung.10 ,Wie sie hier geschieht' darin liegt freilich das Geheimnis des prompten Funktionierens dieses Mittels. Denn wir müssen uns doch fragen: Warum ist denn der Rezipient eigentlich so unwiderstehlich überzeugt? Nicht umsonst wurde oben so eindringlich die Vorgeschichte des Traumes vorausgeschickt: Wer in aller Welt würde denn die Gewißlheitsempfindung 26 Agamemnons teilen - in einer Situation wie dieser, wo alle äußeren Umstände doch in Wahrheit gegen die Ausführung des erhaltenen Traumauftrags sprechen? Die verheerende, kräftezehrende Seuche gerade erst überwunden, das stärkste Kontingent im .Ausstand', das Heer also in der schlechtestmöglichen Verfassung - wer würde denn in dieser ungünstigen militärischen Ausgangslage die Gewißheitsempfindung des Oberfeldherm teilen - wenn... dieser OberfeldDaß es sieb dabei um ein typisches und universelles Erzählmittel handelt, hat E. Lämmert gezeigt (.Bauformen des Erzählens', Stuttgart 7 1980, S. 178 f.): „Wo Träume, Ahnungen, Prophezeiungen [d. h. ,ungewisse Vorausdeutungen', in Lämmerts Terminologie] im Laufe des erzählten Geschehens kundgetan werden, da steuern sie merkwürdigerweise trotz ihrer theoretischen Unverbindlichkeit den Leser in einer ähnlichen Weise wie es durch die gewissen Vorausdeutungen des Erzählers geschieht".
464
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
herr nicht eben - Agamemnon wäre! Dieser Agamemnon, den wir zuvor erlebt haben, in seinem Trotz, seinem ,Jetzt erst recht!', seiner ichbezogenen, zutiefst erfolgssüchtigen, aber eben auch zutiefst erfolgsabhängigen Selbsttäuschung über die wahren Anforderungen seines hohen Amtes! Wem hat das denn der Traum gesagt: ,Du bist der Sohn des großen Atreus, du bist Oberfeldherr, du mußt Rat wissen, du mußt handeln Und dann, einschmeichelnd: .Jetzt kannst du vielleicht Troja nehmen! Die Gelegenheit ist günstig'. Ein anderer, ein wirklicher Feldherr hätte vielleicht den Kopf geschüttelt ob solcher Fehleinschätzung der wahren Lage. Darauf stößt Homer den Hörer selber hin; denn als Agamemnon nach dem Erwachen zu Nestor eilt und ihm und dem ,Generalstab' seinen Traum erzählt, da läßt Homer eben diesen Nestor, der doch als Traumbild den ominösen Angriffsbefehl soeben selbst noch übermittelt haben soll, den also läßt Homer recht reserviert und fast betreten sagen: „O Freunde! Mitführer der Argeier! Wenn diesen Traum ein anderer von den Achaiern erzählt hätte - für Trugwerk (ψευδός) hielten wir's und ließen ihn stehen! - Nun aber hat ihn der gesehen, der von sich sagen kann, der oberste der Achaier zu sein. - Also voran! Rüsten wir die Leute!" - Das ist deutlich. Der Generalstab faßt sich im Innern an den Kopf! Ein Nestor also hätte solchem Traume nicht geglaubt, - und wir, die Hörer - das ist wichtig - hätten einem Nestor auch nicht geglaubt, daß er einem solchen - zutiefst eitlen - Traume glaubt. Mit einem Wort (und was das bedeutet, wird gleich verständlich werden): Ein Mann wie Nestor hätte einen solchen Traum gar nicht erst gehabt! Aber Agamemnon? Sagt der Traum nicht genau das, was er möchte? Ist das nicht genau der Traum, der zu ihm ,paßt'? Was würde er denn lieber hören als gerade dies? Daß er sich jetzt - gerade jetzt! - einmal so recht beweisen kann, ohne Achill, den verhaßten Konkurrenten, - daß er eine ungeheure Tat vollbringen kann, die ihm mit einem Schlage seine angeknackste Existenz vor den anderen und vor sich selbst - vor allem vor sich selbst - wieder voll akzeptabel machen würde! I 27 Der Traum Agamemnons ist der Traum vom triumphalen Blitzsieg, den jeder Erfolglose träumt - erfolglos, weil verblendet. Freilich: Zeus hat den Traum geschickt. Muß also Agamemnon nicht an ihn glauben? Unter Homerspezialisten würde sich daran eine stürmische Debatte entzünden. Hier kann darauf nicht eingegangen werden. Nur dies vielleicht: Warum hat der Dichter den Zeus gerade dem Agamemnon gerade einen Traum, diesen Traum, schicken lassen? Hat er nicht damit seinen Zeus seinen Agamemnon richtig einschätzen lassen?
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
465
So scheint mir wie in vielen anderen homerischen Träumen, so auch in diesem noch eine zweite Funktionskomponente wirksam zu sein: die der Charakterisierung eines Menschen auch durch die Art der Träume, die er hat - oder ganz genau: die der Dichter ihn haben läßt. Weitere Beispiele, etwa der Traum Penelopes im 19. Buch der Odyssee, würden das überzeugend deutlich machen können. Damit würde freilich der gesteckte Rahmen überschritten. Hier konnte es nur um einen ersten Einblick gehen. Es war eine Tour d'horizon, die wir unternommen haben - mehr nicht. Vielleicht reicht aber auch sie schon aus, um jenen Eindruck zu vermitteln, auf den es abgesehen war: Was die Antike über den Traum gedacht und gesagt hat, ist tief und unveraltet. Es lohnt auch heute noch, darauf zu hören.
Anhang In Weiterführung einer gleichlautenden Angabe 1923 (Gesammelte Werke XIII, 357-359) wies Freud 1932 in der Zeitschrift .Allgemeine Nährpflicht' (Bd 15 = Ges. Werke XVI, 261-66) daraufhin, daß das Prinzip der Traum entstellung unabhängig von ihm selbst im Jahre 1899 auch vom Wiener Ingenieur Josef Popper (genannt ,Lynkeus') in dessen Buch ,Die Phantasien eines Realisten' gefunden worden sei. Freud führte dabei u. a. aus: „Die Traumentstellung war das tiefste und schwierigste Problem des Traumlebens. [...] Meine Erklärung der Traumentstellung (sc. .Ausdruck eines Kompromisses, [...] Zeugnis eines Konflikts zwischen den miteinander unverträglichen Regungen und Bestrebungen unseres Seelenlebens') schien mir neu zu sein, ich hatte nirgends etwas ähnliches gefunden. Jahre später (ich kann nicht mehr sagen, wann) gerieten »Die Phantasien eines Realisten« von Josef Popper-Lynkeus in meine Hand. Eine der darin enthaltenen Geschichten hieß »Träumen wie Wachen«, sie mußte mein stärkstes Interesse erwecken. Ein Mann war in ihr beschrieben, der von sich rühmen konnte, daß er nie etwas Unsinniges geträumt hatte. Seine Träume mochten phantastisch sein wie ein Märchen, aber sie standen mit der wachen Welt nicht so in Widerspruch, daß man mit Bestimmtheit hätte sagen können, »sie seien unmöglich oder an und für sich absurd«. Das hieß in meine Ausdrucksweise übersetzt, bei diesem Manne kam keine Traumentstellung zustande, und wenn man den Grund ihres Ausbleiben erfuhr, hatte man auch den Grund ihrer Entstehung erkannt. Popper gibt seinem Manne volle Einsicht in die Begründung seiner Eigentümlichkeit. Er läßt ihn sagen: »In meinem Denken wie in meinen Geßihlen herrscht Ordnung und Harmonie, auch kämpfen die beiden nie miteinander ... Ich bin eins, ungeteilt, die Anderen sind geteilt und ihre zwei Teile: Wachen und Träumen führen beinahe immerfort Krieg miteinander«. Und weiter über die Deutung der Träume: »Das ist gewiß keine leichte Aufgabe, aber es müßte bei einiger Aufmerksamkeit des Träumenden selbst wohl immer gelingen. - Warum es meistens nicht gelingt? Es scheint bei Euch etwas Verstecktes zu liegen, etwas Unkeusches eigener Art, eine
466
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
gewisse Heimlichkeit in Eurem Wesen, die schwer auszudrücken ist; und darum scheint Euer Träumen so oft ohne Sinn, sogar ein Widersinn zu sein. Es ist aber im tiefsten Grund durchaus nicht so; ja es kann gar nicht so sein, denn es ist immer derselbe Mensch, ob er wacht oder träumt«. Dies aber war unter Verzicht auf psychologische Terminologie dieselbe Erklärung der Traumentstellung, die ich aus meinen Arbeiten über den Traum entnommen hatte. Die Entstellung war ein Kompromiß, etwas seiner Natur nach Unaufrichtiges, das Ergebnis eines Konflikts zwischen Denken und Fühlen, oder, wie ich gesagt hatte, zwischen Bewußtem und Verdrängtem. Wo ein solcher Konflikt nicht bestand, nicht verdrängt zu werden brauchte, konnten die Träume auch nicht fremdartig und unsinnig werden. In dem Mann, der nicht anders träumte als er im Wachen dachte, hatte Popper jene innere Harmonie walten lassen, die in einem Staatskörper herzustellen sein Ziel als Sozialreformer war." [Hervorhebungen von mir]
Sowohl die Tatsache als auch die Ursache der Traumentstellung hätte Freud indessen auch schon bei Artemidor finden können (dessen Werk er natürlich in toto kannte, wenn auch vermutlich größtenteils nicht in der Originalsprache). Artemidor (der seinerseits nur ältere Erkennmisse weitergab) unterschied zwischen .Schlafgebilde' (ένύπνιον) und ,Traum4 bzw. ,Traumgesicht' (ονειρος, οναρ): 11 und passim. Das .Schlafgebilde' ist lediglich ein natürliches Weiterwirken der Tagesreste in den Schlaf hinein („gewisse Affekte sind von der Art, daß sie zurückkehren und sich selbst emeut vor der Seele aufstellen und so die Träume hervorrufen": 11,16 f.), das .Schlafgebilde' deutet daher lediglich auf das Seiende (τά οντα: 11,15), d.h. auf die gegenwärtige Verfassung des Träumenden, und ist daher für den wissenschaftlichen Traumdeuter belanglos; denn derartiges zu sehen bedeutet nicht, „eine Voraussage des Zukünftigen zu haben, sondern ein Er-innern des Gegenwärtigen" (I 1, 23 f.). - Das .Traumgesicht' (ονειρος, οναρ) dagegen ist eine bedeutungsvolle Eigen-Aktivität der Seele (ονειρός έστι κίνησις ή πλάσις ψυχής πολυσχήμων = .das Traumgesicht ist ein Sich-Bewegen oder vielgestaltiges Formen der Seele': I 1,17), welche das zukünftige Gute bzw. Schlimme andeutet (σημαντική) των έσομένων αγαθών ή κακών: I 2,18). Allein dieses Phänomen ist für den Traumdeuter relevant. Allerdings muß er wissen, daß dieses Phänomen in zwei Erscheinungsformen auftritt: (1) als theorematischer Traum, (2) als allegorischer Traum (θεωρηματικοί ονειροι : άλληγορικοί ονειροι: 12 und passim.). Theorematische Träume sind solche, „deren Erfüllung ihrer Erscheinung vollkommen entspricht" (I 2) oder, anders gesagt, „die so in Erfüllung gehen, wie sie geschaut werden" (οϋτως άποβαίνοντας ώς θεωρούνται: IV 1,2 f.) - allegorische Träume sind diejenigen, „die eines durch anderes andeuten, indem die Seele in ihnen etwas nach natürlichen Gesetzen verrätselt (verschlüsselt)" (οί δι' άλλων άλλα σημαίνοντες, αΐνισσομένης έν αύτοίς φυσικώς τι τής ψυχής: I 2,9 f.), oder, anders gesagt, „diejenigen, die auf das, was sie bedeuten, durch Rätsel hinzeigen" (τους τα
Funktionen des Traums in der antiken Literatur
467
σημαινόμενα δι' αινιγμάτων έπιδεικνύντας: IV 1, 3 f.). [Martin Kaiser, der letzte Bearbeiter der Krauss'schen Artemidor-Übersetzung, bemerkt dazu 1965 (S. 23 Anm. 6): „Im Deutschen nennt man sie eher symbolische Traumgesichte, άλληγορειν = das Gemeinte durch etwas anderes ausdrücken. Es sind also Traumgesichte, in denen die Traumentstellung wirksam ist." - Ich füge hinzu, daß in den von Artemidor verwendeten Begriffen πλάσις της ψυχής = ,ein Formen der Seele', bzw. ή ψυχή αίνίττεταί τι = ,die Seele verrätselt etwas', auch die Traum arbeit impliziert ist.] Die Tatsache der (Traumarbeit und) Traumentstellung ist also Artemidor (und seinen Vorgängern, die er häufig zitiert) bekannt; er nennt sie nur nicht TraumentStellung, sondern Traumverrätselung: ein geringer terminologischer Unterschied - das gemeinte Phänomen ist in beiden Fällen dasselbe. - Aber auch die Ursache der Traumentstellung ist Artemidor bekannt. Im Prooimion zum 4. Buch mahnt er seinen Sohn: „Denk auch daran, daß diejenigen Menschen, die eine gute und moralisch einwandfreie Lebensweise führen, keine Schlafgebilde (ένύπνια) haben und auch sonst keine sinnlosen Halbschlafphantasien (άλογα φαντάσματα), sondern nur Tiaumgesichte (δνειροι), und zwar meist theorematische; denn ihre Seele wird nicht aufgewühlt - weder durch Befürchtungen noch durch Hoffnungen, und außerdem sind solche Leute auch Herr ihrer körperlichen Begierden (Triebe)" (VI prooem. p. 200,14-19).
Allegorische Träume, d.h. Träume, in denen die Traumverrätselung (~ Traumentstellung in Freuds Terminologie) wirksam ist, sind also auch bei Artemidor schon die Folge von Lebenskonflikten. Wer dagegen mit sich eins ist, wer nichts zu .verdrängen' hat, der „träumt nicht anders als er im Wachen denkt" (Freud, s.o.), - d.h.: er träumt ,theorematisch' nach Artemidor, „nicht fremdartig und unsinnig" nach Freud (s. o.).
Literatur s. S. 221-224
Originalbeitrag 1993
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ,Geburt der Tragödie' und die gräzistische Tragödienforschung* Friedrich Nietzsche hat seine Schrift ,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' als Klassischer Philologe, näherhin als Gräzist abgefaßt. Er hatte sich schon während seiner Schulzeit in Pforte1, später dann als Student in Bonn und Leipzig für die Griechen als das Zentrum seiner Interessen entschieden, er hatte in Leipzig sowohl im Seminar bei seinem Lehrer Friedrich Ritsehl als auch im von ihm mitbegründeten Leipziger Philologischen Verein ausschließlich über
* Vortrag, gehalten am 30. September 1993 beim Nietzsche-Kolloquium in Sils-Maria. - Der Vortragsstil wurde beibehalten. - Abgekürzt zitierte Literatur: Gründer = K. Gründer, Der Streit um Nietzsches .Geburt der Tragödie'. Die Schriften von E. Rohde, R. Wagner, U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Hildesheim: Olms 1969. v. Reibnitz = Barbara von Reibnitz, Ein Kommentar zu Friedrich Nietzsche, ,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' (Kap. 1-12), Stuttgart - Weimar: Metzler 1992. Hellas und Hesperien = W. Schadewaldt, Richard Wagner und die Griechen. Drei Bayreuther Vorträge (urspr. Programmhefte der Wagner-Aufführungen Bayreuth 1962/63/64), in: Hellas und Hesperien. Gesammelte Schriften zur Antike und zur neueren Literatur in zwei Bänden. Zweiter Band, Zürich - Stuttgart: Artemis 2 1970, 341-405. KSA = Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in IS Bänden, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari, München 1980. KSB = Friedrich Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari, München 1986. VdA = K. Reinhardt, Vermächtnis der Antike, Ges. Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 21966. Ndr. 1989. 1 Anhang I bei v. Reibnitz (.Arbeiten aus der Schulzeit'), S. 343. Daraus für unser Thema besonders wichtig: .Primi Ajacis stasimi inteipretatio et versio cumpraefatione' (November 1862); , Prim um Oedipodis regis carmen choricum' (Hausarbeit April/Mai 1864). Näheres dazu und zur Valediktionsarbeit (,De Theognide Megarensi', Juli/August 1864) bei v. Reibnitz 10-13.
470
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
Fragen der griechischen Literaturgeschichte gearbeitet und vorgetragen 2 , er hatte seit Mai 1868 eine akademische Karriere im Fach Gräzistik geplant3, dann 1869 gern den Ruf auf die außerordentliche Professur für Griechische Philologie an der Universität Basel angenommen^, und er fühlte sich seit Herbst 1869, wie wir aus dem Briefwechsel wissen, immer stärker durch die Zunft, durch Ritsehl und durch sich selbst gedrängt, seine frühe Berufung mit 24 Jahren und ohne Promotion durch eine gräzistische Arbeit allseits zu rechtfertigen5. In einem Briefentwurf vom 20. April 1871 an den philologischen Verleger Wilhelm Engelmann in Leipzig, dem er zusammen mit dem Anschreiben eine Frühform der ,Geburt der Tragödie' unter dem Titel ,Musik und Tragödie' übersandte, heißt es: „Wie Sie ersehen werden, suche ich auf eine völlig neue Weise die griechische Tragödie zu erklären ...". Obgleich es dann im gleichen Satz weitergeht mit der Erläuterung: „... indem ich einstweilen von jeder philologischen Behandlung der Frage völlig absehe und nur das ästhetische Problem im Auge behalte"6, haben wir doch davon auszugehen, daß Nietzsche zu jenem Zeitpunkt überzeugt war, ein gräzistisches Forschungsproblem zu behandeln und - wenn auch selbstverständlich „auf eine völlig neue Weise" - zu lösen, - nicht etwa ein philosophisches. Den beiden weiteren Vorformen der ,Geburt der Tragödie', also erstens dem in 30 Exemplaren hergestellten Privatdruck ,Sokrates und die griechische Tragödie' vom Juni 1871 7 und zweitens der ebenfalls im Juni 1871 für die .Preussischen Jahrbücher' geplanten Aufsatzversion von ,Musik und Tragödie' 8 lassen sich andere als gräzistische
2 Anhang II bei v. Reibnitz (.Materialien und Arbeiten der Studienzeit'), S. 344-347: Rezensionen zu Arbeiten über Hesiod, Anakreon, Eudokia, Theognis, Heraklitische Briefe, Aristoxenos, Lukian; Aufsätze über das Corpus Theognideum, Diogenes Laertios, Suidas, AristotelesPhilologie in Alexandria, das Certamen Homeri et Hesiodi, die Menippeische Satire, Demokrit. Näheres dazu bei v. Reibnitz 13-24. 3 Brief an Erwin Rohde vom 3. oder 4. Mai 1868 (KSB 2, 275), Auszug bei v. Reibnitz 15 f. („Übrigens, lieber Freund, bitte ich dich aufrichtig, deine Augen fest auf eine einmal einzuschlagende akademische Carrière zu richten [...] Hier ist eine ängstliche Selbstprüfung gar nicht an der Stelle: wir müssen einfach, weil wir nicht anders können, weil wir keine entsprechendere Lebenslaufbahn vor uns haben, weil wir uns zu nützlicheren [!] Stellungen den Weg verrannt haben, weil wir gar kein anderes Mittel haben, unsere Constellation von Kräften und Ansichten unseren Mitmenschen nutzbar zu machen als eben den angedeuteten Weg."). 4 Die Berufung erfolgte am 10. Februar 1869. Literatur zum Berufungs-Komplex aufgeführt bei v. Reibnitz 25 Anm. 118 und 119. 5 v. Reibnitz 36. 6 KSB 3, 194; Auszug bei v. Reibnitz 45 f. (Hervorhebung von mir). 7 v. Reibnitz 46-49. 8 Zu ,Musik und Tragödie' s. v. Reibnitz 45, zu der Aufsatzversion davon s. v. Reibnitz 47 f.
und die gräzistische
Tragödienforschung
471
Intentionen ebenfalls nicht ablauschen - auch wenn die inzwischen bei Nietzsche eingegangenen Reaktionen auf den Privatdruck seine Zweifel an der Verständnisfähigkeit seiner gräzistischen Fachkollegen augenscheinlich hatten wachsen lassen 9 . Aus diesen Zweifeln erklärt sich zwar seine Rückforderung des Manuskripts von Engelmann und die Einreichung Anfang Oktober 1871 beim Musikverteg Fritzsch in Leipzig (bei Richard Wagners Verlag also)10, aber es läßt sich daraus keinesfalls der Schluß ziehen, Nietzsche hätte die Schrift grundsätzlich nicht mehr als gräzistischen Forschungsbeitrag angesehen11. Wie die Gräzistik auf das im Januar 1872 erschienene Buch dann reagierte und daß diese Reaktion Nietzsche endgültig auf den Weg zur Philosophie trieb, den er in einem Brief an Erwin Rohde vom 29. März 1871 immerhin schon einmal recht konkret erwogen hatte 12 - das alles ist bekannt, gehört aber in die Wünfcwngsgeschichte der .Geburt der Tragödie'. Als es geschrieben wurde, war das Buch bestimmt, in die Gräzistik hineinzuwirken und die Gräzistik auf einen grundsätzlich besseren, höheren Standpunkt hinaufzuführen. Die Zuständigkeit der Gräzistik, Nietzsches Buch und Nietzsches ganzen Ansatz zu beurteilen, abzuwägen und schließlich anzunehmen oder zu verwerfen, war also im Falle der .Geburt der Tragödie' sowohl damals ohne weiteres gegeben als sie auch heute noch gegeben ist. Aus dieser Sachlage leitet sich der folgende Versuch ab, die .Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' in der Sicht der Gräzistik und speziell der gräzistischen Tragödienforschung zu beleuchten. Dabei muß von vornherein be9 Brief an Erwin Rohde vom 4. August 1871 (KSB 3, 215 f., Auszug bei v. Reibnitz 47 Anm. 52): „... Man bemüht sich der Entstehung der rätselhaftesten Dinge nahe zu kommen und jetzt verlangt der geehrte Leser, daß das ganze Problem durch ein Zeugniss abgethan werde, wahrscheinlich aus dem Munde des Apollo selbst...". 10 Rückforderung: Anfang Juni 1871 sowie am 28. Juni 1871 (KSB 3, 200 und v. Reibnitz 48); Anfang Oktober 1871 Übergabe des Manuskriptanfangs ,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' an Wagners Verleger E. W. Fritzsch in Leipzig: v. Reibnitz 48 f. (dort auch Auszug aus Richard Wagners hellsichtig besorgter Brief-Reaktion auf den Verlegerwechsel). 11 Selbstverständlich wollte Nietzsche mit einem neuartigen Ansatz über den engen (seiner Meinung nach engstirnigen) Kreis der Gräzistik hinaus Wirkung erzielen ( so kann ich nicht anders glauben als daß das allerweiteste denkende Publikum sich für diese Schrift interessiren muß. Um diesem mich verständlich zu machen, habe ich auf die stilistische Darstellung und Deutlichkeit besonderen Fleiß gewandt": Brief an Engelmann vom 20. April 1871 [KSB 3, 194] - eine überaus verdienstliche Grundhaltung, wie sie leider auch von der heutigen Gräzistik verhängnisvollerweise immer noch mit Mißtrauen betrachtet wird), aber die Fachkollegen waren doch sein erstes Zielpublikum. 12 Brief an Erwin Rohde vom 29. März 1871 (KSB 3, 189; Näheres bei v. Reibnitz 43 mit Anm. 31).
472
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
tont werden, daß dieser Versuch sinnvollerweise gar nicht würde unternommen werden müssen und können, wenn Nietzsches Schrift für die gräzistische Tragödienforschung gänzlich folgen- und bedeutungslos gewesen und geblieben wäre. Der Reiz der Aufgabe liegt vielmehr gerade darin, die langfristige Fruchtbarkeit eines seinerzeit geradezu exorbitanten Ärgernisses aufzuweisen. Um dieses Ziel innerhalb der kurzen verfügbaren Zeitspanne wenigstens annähernd zu erreichen, werde ich in folgenden vier Schritten vorgehen: (1) Darstellung der Faktenlage im Problemfeld .Griechische Tragödie allgemein', und zwar so, wie sich diese Faktenlage innerhalb der Gräzistik bereits zur Abfassungszeit der ,Geburt der Tragödie' darbot und wie sie Nietzsche, wenn er wollte, auch seinerseits sehen konnte oder hätte sehen können; (2) Erkenntnisstand der gräzistischen Tragödienforschung in derjenigen Sonderfrage, die Nietzsche lösen wollte, also in der Frage des Ursprungs der griechischen Tragödie; (3) kurze Zusammenfassung des Lösungsangebots, das Nietzsche machte; (4) Auswirkungen von Nietzsches Lösungsangebot auf die Folgeforschung. Zu allen diesen vier Komplexen liegt eine immense Spezialliteratur vor. Im Jahre 1992 ist speziell zu Komplex 3, also zu Inhalt, Aufbau, Absicht und Hintergrund der ,Geburt der Tragödie' das bislang gründlichste und umsichtigste Hilfsmittel hinzugekommen, das die , Geburt der Tragödie'-Forschung kennt, nämlich Barbara v. Reibnitzens ,Geburt der Tragödie'-Kommentar. Ihn wird jeder, der zur Sache spricht, dankbar benützen. Ich beginne mit Komplex 1, der damaligen Faktenlage auf dem Gebiet .Griechische Tragödie' insgesamt. Um das Interesse auch derjenigen Zuhörer zu berücksichtigen, die diesem Forschungsgebiet etwas femer stehen, werde ich auch solche Fakten nicht unterschlagen, die für den Kenner selbstverständlich sind. Dafür bitte ich die Experten schon jetzt um Nachsicht. Mir liegt jedoch daran, ein möglichst plastisches Gesamtbild zu erzeugen, vor dessen Hintergrund alles Folgende dann klarer in seiner Eigenart erfaßt und selbständig beurteilt werden kann.13
Zum folgenden Abschnitt I vgl. Verf., Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993 (UTB Nr. 1745), besonders Teil Α Π .Institutionelle Grundlagen des Theaters (Theatergeschichte)', S. 29-50.
und die gräzistische
Tragödienforschung
473
I Im Jahre 534 v.Chr. - also vor jetzt über 2500 Jahren - fand nach Ausweis unserer zwar späteren, aber in den Kernpunkten wohl zuverlässigen griechischen Quellen in der Stadt Athenai - und zwar auf einem Teil des Hauptplatzes, der Agorà, einem Teil, der dem Dionysos geweiht war - ein Ereignis statt, das die europäische Kulturentwicklung bis zum heutigen Tage nachhaltig geprägt hat. Erstmals wurde eine ,Trag-ödia' öffentlich dargeboten, und zwar als Bestandteil eines über mehrere Tage sich erstreckenden staatlichen Kultfestes, der sog. Großen Dionysien. Dies war das bedeutendste der fünf Feste, die dem Gott Dionysos zu jener Zeit in Athen jährlich gefeiert wurden, Ende März/Anfang April. Damals, im Jahre 534, hatte in Athen ein Einzelherrscher die Macht in Händen, mit kleinasiatischer Bezeichnung ,Tyrannos' benannt. Es war der Führer der einen von drei athenischen Adelsparteien, die damals um die Herrschaft über Athen und die Region Attika konkurrierten. Sein Name war Peisistratos. Peisistratos, ein Mann von national-konservativer Prägung, wollte Athen politisch und kulturell die erste Position in Griechenland verschaffen. Bis dahin war die Führungsstadt des ganzen Griechentums Milet gewesen, jene damals schon rund 500 Jahre alte ionische Kolonistenstadt an der Westküste Kleinasiens, in der um 600 mit der milesischen Denkerschule Europas Wissenschaft und Philosophie begonnen hat 14 . Durch die Expansion der Perser bis an die kleinasiatische Westküste hatte Milets Macht und Bedeutung um die Jahrhundertmitte stark gelitten, und ein Großteil der milesischen und aus Milets Nachbarstädten stammenden Intellektuellen hatte Zuflucht vor allem in der damaligen , Neuen Welt' gesucht, d. h. im griechischen Sizilien und im griechischen Unteritalien. Peisistratos und seine Anhänger suchten diese Entwicklung aufzuhalten und die uralte ionische Stadt Athen zum neuen Zentrum des Griechentums zu machen. Dafür brauchte Peisistratos die überzeugte Unterstützung vor allem der Unterschichten, der Kleinbauern, Handwerker, Händler. Er gewann sie nicht nur durch politische und wirtschaftliche Vergünstigungen, sondern auch durch kulturelle Neuerungen, die ihren Interessen entgegenkamen und die sie über eine stärkere Identifikation des Staates mit ihren Grundüberzeugungen und Grundgefühlen im politischen und religiösen Bereich fester an den Herrscher banden. Das System versuchte sich also durch die uralte Strategie des ,panem et circenses' zu verankern.
14
Dazu genauer Verf., Die griechische Literatur in Text und Darstellung. Band 1: Archaische Periode, Stuttgart: Reclam 1991, 512-518.
474
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
Peisistratos erkannte vor allem das Potential von großen Festen15. An ihnen können nationale und religiöse Gefühle innerer Erhebung ineinanderfließen und verschmelzen. Ihre Erlebnisqualität ist emotional, sie erfaßt infolgedessen wenn das Fest gelingt - tiefe Schichten der Persönlichkeit und ist damit der Einflußnahme durch Wortpropaganda überlegen. Peisistratos und seine Leute hatten als Modell eine für uns kaum mehr übersehbare Anzahl von lokalen und regionalen Festen vor Augen. Deren stets begrenzte Ausstrahlung war jedoch jüngst gesteigert worden durch neu begründete allhellenische Wettbewerbs-Feste: Nach dem Vorbild der Spiele in Olympia für Zeus (seit 776) waren nämlich vor erst 40-50 Jahren drei neue gemeingriechische Feste etabliert worden: im Jahre 582 die Pythien in Delphi für Apollon und die Isthmien bei Korinth für Poseidon, im Jahre 573 die Nemeen bei Nemea auf der Peloponnes für Zeus. Bei diesen Neubegründungen waren Religion und Nationalgefühl eine enge Verbindung eingegangen mit dem urgriechischen Hang zum Wettkampf, dem Agón. Peisistratos erkannte die Wirkungsmacht der Bündelung dieser drei Komponenten »Religion',,politisches Gemeinschaftsempfinden' und ,Exzitation durchs Agonale', und er setzte diese Erkenntnis um in die Neubelebung zweier alter attischer Feste, die im Volk besonders tief verankert waren: der Panathenäen für die Stadtgöttin Athene und der Großen Dionysien für den Gott Dionysos 16 . Er organisierte beide Feste um und gab ihnen eine feste Ablaufsordnung. An den Panathenäen verknüpfte er die religiöse Erhebung mit der geistigen, indem er hier erstmals Homers Epen Ilias und Odyssee, die zu Nationalepen geworden waren, ungekürzt durch einander ablösende Rhapsoden vortragen ließ, und an den Großen Dionysien machte er den Tragödien-Wettbewerb zum Festbestandteil. Wie der erste Tragödien-Wettbewerb, der im Jahre 534 stattfand, konkret aussah, können wir nicht sagen. Immerhin ist aufgrund von Nachrichten über die allerersten attischen Tragödiendichter Thespis, Choirilos, Phrynichos und Aischylos nicht auszuschließen, daß schon von Anfang an, sicher aber seit 510 in jedem Jahr drei Tragödiendichter mit jeweils drei oder vier Stücken, also mit einer Trilogie oder einer Tetralogie miteinander um den ersten Preis konkurrierten. Das bedeutet, daß die Athener an den Großen Dionysien jedes Jahr neun ^ Zu den griechischen Festen s. jetzt R. Kannicht: Thalia. Über den Zusammenhang zwischen Fest und Poesie bei den Griechen, in: W. Haug/R. Warning (Hrsgg.), Das Fest (Poetik und Hermeneutik XIV), München 1989, 29-52. Speziell zu den Panathenäen und den Großen Dionysien s. L. Deubner, Attische Feste, Berlin 2 1966; H. W. Parke, Festivals of the Athenians, London 1977 (deutsch: Athenische Feste, Mainz 1987); Erika Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary, Wisconsin 1983; A. W. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford (1959) 3 1988.
und die gräzistische Tragödienforschung
475
oder zwölf neue Tragödien vorgeführt bekamen. Reprisen gab es nicht. Jedes Stück war als Festbestandteil zu nur einmaliger Aufführung bestimmt 17 . Da diejenigen drei Tragödiendichter, die am Ende tatsächlich aufführen durften, die Gewinner eines langwierigen Ausleseverfahrens waren, läßt sich die Dichte der jährlichen Tragödienproduktion in Athen und damit der Kreativitätsschub, der mit Peisistratos' Initiative verbunden war, kaum überschätzen. Dichtung komprimierte sich in Griechenland seit 534 v. Chr. in der Tragödie 18 . Wie diese im konkreten Einzelfalle damals aussah, wissen wir allerdings auch heute noch nicht. Die erste vollständig erhaltene Tragödie, die wir besitzen, stammt aus dem Jahre 472, also 62 Jahre nach Einführung des Tragödienwettbewerbs. Es sind die Perser von Aischylos. Aus den 62 Jahren zwischen 534 und 472 haben wir nur Namen von Tragödiendichtern, etliche Tragödientitel, ein paar kümmerliche Textfragmente und - dies immerhin - eine ganze Menge Nachrichten, die allerdings allesamt nicht aus jenen 62 Jahren stammen, sondern aus viel späterer Zeit. Setzt man dieses gesamte Informationsgut in einen vernünftig scheinenden Zusammenhang, dann ergibt sich daraus immerhin so viel: Die erste Form der Tragödie, so wie sie 534 vor das Volk von Athen gelangte, scheint bereits eine Art Spielgeschehen gewesen zu sein, das von zwei Akteuren getragen wurde, dem choros, einem tanzenden Gesangsensemble, einerseits, und dem hypokritës ,Antworter' und ,Ausdeuter', also einem dem chorós gegenüberstehenden Einzelsprecher andererseits 19 . Diese Form, so heißt es, habe Thespis erfunden. Damit waren also die für alle Zukunft gültigen zwei Grundkomponenten der Tragödie etabliert: Chorgesang und Einzelrede. Der Chorgesang war dabei das Primäre. Das wäre selbst dann völlig klar, wenn wir nicht ausdrücklich erführen, den Einzelsprecher habe erst Thespis eingeführt. Es wäre deshalb klar, weil während der ganzen folgenden Entwicklungsgeschichte der attischen Tragödie Chor und Einzelsprecher (oder Schauspieler) dadurch scharf voneinander abgesetzt sind, daß der Chor erstens in anderen Rhythmen sich äußert als der Einzelsprecher und zweitens in einem anderen griechischen Dialekt: der Chor singt stets in sog. lyrischen Maßen, d. h. in vergleichsweise freien und variablen Rhythmen, während der Einzelsprecher fast ausschließlich im festen 17
Siehe Verf. (oben Anm. 13), 22-25. Dazu genauer J. Herington, Poetry into Drama. Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley - Los Angeles - London 1985. 19 Über die Frage, ob ,hypokritës' als ,Antworter' oder , Ausdeuter' zu verstehen sei, hat es eine umfangreiche Debatte gegeben. Da .hypokritës' in der 2. Hälfte des 5. Jh. bereits eindeutig .Schauspieler' bedeutet, dürfte klar sein, daß das Wort jedenfalls von Anfang an den .Sprechrollenträger' bezeichnete (der je nach Spielphase einmal .antwortete', einmal .ausdeutete'). 18
476
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
Einheitsmaß des iambischen Trimeters spricht, und der Chor singt stets in dorischem oder doch dorisch getöntem Dialekt, der Einzelsprecher aber spricht stets Ionisch, die Sprache Athens. An ein primär vorhandenes chorisches, gesangliches Element, das von außerhalb Athens hereingekommen war, muß sich also in Athen sekundär ein Sprech-Element, näherhin ein Einzelsprecher-Element angesetzt haben. Dadurch wurde eine Dialogstruktur ermöglicht, die im Wechsel zwischen gesungenen Chorpartien und gesprochenen Schauspielerpartien bestand. Diese Dialogstruktur implizierte die Möglichkeit von Spannung und von Handlung. Handlung heißt auf griechisch drama. Mit Thespis scheint demnach das europäische Drama geboren worden zu sein. Es präsentierte sich in jener Frühzeit offensichtlich als eine Art musikalisches Schauspiel, in jedem Falle aber als ein Kombinationskunstwerk, dessen drei Grundelemente Tanz, Gesang und Rede waren. Auch über Stoff und Inhalt dieser Frühform der Tragödie läßt sich etwas sagen. Von Thespis sind noch vier Tragödientitel überliefert - neben vier Fragmenten, deren Echtheit nicht gewiß ist. Die Titel aber sind sehr aufschlußreich. Sie lauten ,Die Priester' - ,Die Jünglinge' - ,Die Wettspiele des Pelias' und ,Pentheus'. Das sind zwei pluralische und zwei singularische Titel. Schon hier fassen wir also eine Konstante der griechischen Tragödie: Benennung entweder pluralisch - und das heißt: nach der Gruppe oder Rolle, die die Chormitglieder verkörpern - oder singularisch (Pelias, Pentheus), also nach der Hauptfigur. Das wird bis zum letzten Stück des jüngsten der drei großen Tragiker Athens so bleiben, bis zu Euripides' Bakchen, die nach Euripides' Tod im Jahre 406 aufgeführt wurden. Es hört sich dabei wie Symbolik an, daß eines der allerersten Stücke, die wir kennen, nach der gleichen Hauptfigur benannt ist, die auch im letzten Stück des Euripides im Vordergrund steht, nach Pentheus, jenem König Thebens, der sich dem Gott Dionysos und seinem Kult mit allen Kräften des Verstandes widersetzte und eben darum unterging. Das mag ein Zufall sein. Wichtiger für uns ist etwas anderes: die Rolle des Chores. Der Chor ist, wie wir sahen, letztlich Ursprung der Tragödie, und er bleibt (die Bakchen\) Bestandteil der Tragödie bis zu ihrem Ende. Wie die Entwicklung der Gattung weiterging, kann hier im einzelnen nicht ausgeführt werden. Die Gesamtlinie ist jedoch klar: Wir wissen, daß Aischylos, der im Jahre 499/98 debütierte, einen zweiten Einzelschauspieler hinzufügte, und Sophokles, der im Jahre 470 debütierte, einen dritten, und daß Sophokles ferner die Anzahl der Choreuten von bis dahin 12 auf 15 erhöhte und die Bühnenmalerei einführte. Die Tendenz all dieser Neuerungen ist einfach abzulesen: sie geht auf mehr Akteure und damit auf mehr Dramatik und Aktion und - durch
und die gräzistische
Tragödienforschung
477
die Bühnenmalerei - auf mehr Illusionierung hin. Anfängliche Einfachheit weicht zunehmender Komplexität. Diese bisherige Darstellung der Faktenlage könnte den Eindruck erwecken, als läge die Entwicklung der griechischen Tragödie zumindest seit 472, dem Aufführungsjahr von Aischylos' Persern, wie ein aufgeschlagenes Buch vor uns. Leider ist das Gegenteil der Fall. Ohne Sie in die Einzelheiten der schwierigen Tragödienforschung hineinziehen zu wollen, möchte ich zur besseren Beurteilung der Forschungssituation lediglich auf drei grundlegende Informationsdefizite aufmerksam machen: (1) Der Tragödienwettbewerb hat im Jahre 534 begonnen und als feste Institution mindestens bis zum Ende des Peloponnesischen Krieges, d. h. bis zum Jahre 404 fortbestanden. Aus dieser Zeit sind uns die Namen von 47 Tragödiendichtem überliefert. Rechnen wir auch nur mit diesen 47 - in Wirklichkeit hat es weit mehr gegeben - und gehen wir von der Grundannahme aus, während der rund 135 Jahre zwischen 534 und 400 habe der Wettbewerb auch nur neun Tragödien vor das Volk gebracht, so kommen wir auf eine Gesamtzahl von etwa 1.200 Tragödien, die zwischen 534 und 400 aufgeführt worden sind 20 . Wir aber haben nur von dreien dieser 47 Tragödiendichter Werke in den Händen, und zwar auch nicht das jeweilige Gesamt-Œuvre, sondern nur eine schmale Auswahl: sieben Stücke von Aischylos, sieben von Sophokles und 17 echte von Euripides. Das sind zusammen 31 Tragödien. Vom ursprünglich vorhandenen Gesamtbestand sind das 2,5%! Alle Schlußfolgerungen, Rekonstruktionen usw., die wir anstellen, beruhen also auf nur 2,5 % des Ausgangsmaterials. (2) Griechische Tragödien waren, wie wir gesehen haben, zumindest in der Blütezeit der Gattung, also in den genannten 135 Jahren, an den Großen Dionysien niemals Einzelwerke. Sie standen vielmehr stets als Teilstücke im Gesamtzusammenhang eines Dreier- oder Viererverbunds, der Trilogie oder der Tetralogie (wobei das vierte Stück einer Tetralogie seit spätestens
20 Die Rechnung stimmt auch dann, wenn in den ersten Jahrzehnten nach 534 noch nicht jährlich drei Trilogien aufgeführt worden sein sollten. Denn da wir spätestens seit 430 auch am zweiten großen athenischen Dionysos-Fest, den Lenäen (Januar/Februar), mit einem Wettbewerb von zwei Tragödiendichtern mit je zwei Tragödien, also jährlich weiteren vier Tragödien, zu rechnen haben (H.-D. Blume, Einführung in das antike Theaterwesen, Darmstadt 1978, 28), kommen in den 30 Jahren zwischen 430 und 400 rund 120 Tragödien zu den Tragödien der Großen Dionysien hinzu.
478
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
500 in der Regel ein Satyrspiel war 21 ). Wir aber besitzen nicht eine einzige vollständige Tetralogie und nur eine vollständige Trilogie, die Orestie des Aischylos vom Jahre 458. Alle anderen 28 Tragödien, die wir noch haben, sind Einzelstücke, die aus ihrem ursprünglichen tetralogischen Zusammenhang herausgerissen sind. An der eben genannten Orestie des Aischylos, der einzigen Trilogie, die wir noch haben, können wir andrerseits jedoch ablesen, wie im Grunde unentbehrlich zum wirklichen Verständnis einer einzelnen Tragödie die Kenntnis ihrer drei Partnerstücke und damit der Gesamtidee der Tetralogie ist 22 . Diese Kenntnis ist uns jedoch versagt. Alle unsere Stück-Interpretationen sind infolgedessen von vornherein entscheidend restringiert. (3) Diejenigen Tragödien, die uns von Aischylos, Sophokles und Euripides erhalten sind, verdanken ihre Erhaltung überwiegend praktisch-pädagogischen Gesichtspunkten: sie wurden etwa seit dem 1. nachchristlichen Jahrhundert für die Schullektüre ausgewählt. Nun soll etwa Aischylos 80 Tragödien zur Aufführung gebracht haben, Sophokles gar 120. Diese Angaben sind durchaus glaubhaft. Nach welchen Kriterien aber die antiken ,Lehrplangestalter' aus dieser enormen Gesamtzahl ihre sieben Aischylos- und sieben Sophokles-Stücke ausgewählt haben, wissen wir nicht. Wir müssen natürlich mit spezifischen Auswahl-Interessen sowohl der Auswahlzeit als auch speziell der damaligen Jugenderziehung rechnen. Entscheidendes, was für die Erkenntnis der Dichtungsintentionen von Aischylos und Sophokles wichtig wäre, dürfte uns also auf diese Weise verlorengegangen sein. Machen wir uns nur diese drei Restriktionen bewußt - es gibt in Wirklichkeit viel mehr, z. B. den vollständigen Verlust der gesamten musikalischen und choreographischen Dimension der griechischen Tragödie - , dann werden wir bereits bei unserer Beurteilung und Wertung der erhaltenen Gattungsreste überaus bescheiden werden müssen. Die enormen Lücken unserer Kenntnis, die ich Ihnen durch den verteilten Überblick über die erhaltene Gesamtproduktion augenfällig machen möchte [s. hier S. 497 f.], zwingen also die gräzistische Tragödienforschung -jedenfalls dort, wo sie ehrlich und methodisch bewußt betrieben wird -
21
Zum Satyrspiel insgesamt s. B. Seidensticker, Das Satyrspiel, in: Das griechische Drama, hrsg. v. G. A. Seeck, Darmstadt 1979, 204-257. Als Spielform hatte es das Satyrspiel offenbar schon lange vor 534 gegeben, zum vierten Stück einer tragischen Tetralogie wurde es aber erst zwischen 520 und 500 (also lange vor Aufnahme der Komödie in den staatlichen Agon der Großen Dionysien [486]). 22 Dazu genauer Verf. (oben Anm. 13) 92 f.
und die gräzistische
Tragödienforschung
479
schon im Bereich des erhaltenen Materials zu einem Interpretationstyp des prinzipiellen Vorbehalts. Π Es ist wohl evident - und damit komme ich zum zweiten Hauptpunkt - , um wieviel mehr die Vorbehaltsgesinnung in jenem Bereich angebracht ist, zu dem wir gar keine zeitgenössischen Materialien mehr besitzen, sondern nur noch verstreute Nachrichten (oft vielfach deriviert, verkürzt, verstümmelt) aus späterer Zeit, nämlich im Bereich der Ursprungsfrage der Tragödie. Sie war es ja, die Nietzsche lösen wollte. Es ging ihm um die Wurzel der Tragödie. In seiner Basler Tragödien-Vorlesung vom Sommersemester 1870 lautete der 1. Abschnitt: ,Die antike und die neuere Tragödie in Ansehung ihres Ursprungs', und Ende März 1871 kündigte er seinem Freunde Erwin Rohde in einem Brief eine Schrift mit dem Titel, Ursprung und Ziel der Tragödie' an23. Die Ursprungsfrage hatte aber die Gelehrten schon seit jeher umgetrieben, schon bei den Griechen selbst. Das lag nicht zuletzt am puren Namen des Produktes. ,Trag-ödia' ist ein Kompositum aus den beiden Bestandteilen trag- und odia. Was , ödia' bedeutete, nicht nur rein semantisch, sondern auch für die Ursprungsfrage, das war seit jeher klar: Gesang (wir sprechen heute noch von ,Ode\ ,Odeion' usw.). Am Anfang also mußte irgendein Gesang gestanden haben, das schien sicher. Irritierend aber wirkte stets der erste Wortbestandteil: ,trag-'. Ho trágos (ό τράγος) war nämlich im Griechischen der Bock, und näherhin der Ziegenbock. Tragodia bedeutete also für den Griechen ,Bock-Gesang', und das war immerhin befremdlich. Alle anderen literarischen Gattungsbezeichnungen waren im Griechischen entweder harmlos sprechend - wie ζ. B. Epos, das einfach ,Wort' bedeutete und damit die pure Narrativität bezeichnete, oder Melos, das ,Lied' bedeutete (wir sprechen heute noch von ,Mel-odie' ~ .Liedgesang') - , oder aber die Gattungsbezeichnungen waren Fremdwörter und gaben damit zu keinerlei Assoziationen Anlaß, wie Iambos oder Elegeia, deren Grundbedeutung kein Grieche kannte, weil es kleinasiatische Lehnwörter waren. Auch die Schwestergattung der Tragödie, die Kom-ödie, war für einen Griechen semantisch völlig transparent: Ho kömos (ό κώμος) bezeichnete den .ausgelassenen Schwärm fröhlicher Zecher', und Köm-ödia somit den .Gesang des Zecherschwarmes'. Dagegen stand nun dieser ,Bock-Gesang', der zur Erhabenheit des damit bezeichneten Kunstgebildes in schroffstem Widerspruch zu stehen schien! Wie
23
Hervorhebung in den Titeln von mir.
480
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ,Geburt der Tragödie'
war der Name zu erklären? Welche augenscheinlich urtümlichen Vorgänge verbargen sich dahinter? Diese Frage stand von Anfang an - geheimnisvoll gewissermaßen und dunkel lockend - im Raum. Aber es gab darüber keinerlei alte Quellen. Lag also schon die Frühgeschichte der Tragödie, in jenen Jahren zwischen 534 und 472, über die wir redeten, im dunkeln, so erst recht ihre Vor- und Urgeschichte. Diese wenigstens ein kleines Stückweit aufzuhellen hatten sich die Gräzisten schon seit der Begründung der Klassischen Philologie als einer von der Theologie emanzipierten Wissenschaft durch Friedrich August Wolf in Halle im Jahre 1787 unermüdlich angestrengt. Zu einer schlüssigen und allseits anerkannten Theorie waren sie in den über 80 Jahren vor Nietzsches Ansatz freilich nicht gekommen. Dies war auch gar nicht zu erwarten. Jeder Versuch einer Rekonstruktion des Tragödienursprungs war ja erstens auf nur äußerst wenige und dazu noch zeitlich vom Rekonstruktionsobjekt weit getrennte Notizen in der beginnenden griechischen Literaturgeschichtsforschung angewiesen, und er hing zweitens von der Gründlichkeit der Kenntnis eines, wie wir gesehen haben, extrem defizitären Restbestandes der Gattung ab. Alle Ursprungstheorien mußten daher notwendig gekennzeichnet sein durch Subjektivität - Subjektivität in der Wertung des Erhaltenen und der anschließenden Rückprojektion aus dem subjektiv gewerteten Erhaltenen in eine unbekannte Prähistorie hinein, Subjektivität aber auch in der Kombination von Erhaltenem und daraus derivierter Rückprojektion mit den wenigen noch vorhandenen Reflexen der antiken Ursprungsdiskussion. Das ganze Forschungsfeld war infolgedessen extrem spekulativ. Sollte auch nur ein Mindestmaß von spekulativ erzielter Plausibilität erreicht werden, dann mußte hier mit einem Höchstmaß an eindringender Kenntnis nicht nur der erhaltenen 31 Tragödien, sondern der ganzen erhaltenen griechischen Literatur von ihrem Beginn bei Homer bis mindestens zum Ende des 5. Jahrhunderts gearbeitet werden. Dazu kam die bei Forschungsfragen dieses sensiblen Typs besonders angebrachte Forderung nach äußerster methodischer Strenge beim Aufbau eines Argumentationsgebäudes. Man darf nicht einwenden, dies sei aus heutiger Sicht gedacht. Seit Friedrich August Wolf in seinen .Prolegomena ad Homerum' (Halle 1795) in einer ähnlich sensiblen Ursprungsfrage, nämlich der nach der Genese von Ilias und Odyssee, philologische Stringenz in beispielhafter Weise vorgeführt hatte, war für jeden Tragödienforscher das Niveau fixiert. Die Aufstellung von phantasievollen Ursprungshypothesen unter Berufung auf die letztliche Unbeweisbarkeit von Gegenhypothesen war seither nicht mehr legitim. Unter diesen Voraussetzungen war es vor Nietzsche in der Ursprungsfrage unter den Tragödienforschern zu einem Konsens über nur ganz wenige Einzel-
und die gräzistische Tragödienforschung
481
punkte, andererseits aber zu einer rational begründeten Zurückhaltung in der Ursprungsrekonstruktion insgesamt gekommen. Die Einzelpunkte hier durch Vorführung von vornietzscheschen Gelehrtenmeinungen zu deduzieren haben wir leider nicht die Zeit. Ich möchte diese Einzelpunkte aber auch nicht nur einfach anschauungslos aneinanderreihen. Daher habe ich Ihnen die Hauptstelle ausgeschrieben, auf der alle Rekonstruktionen des Ursprungs der griechischen Tragödie seit 200 Jahren basieren: die Tragödienentstehungshypothese des Aristoteles, aus seiner Schrift Peri poiëtikês (Περί ποιητικής), ,Über die Dichtkunst', einem literarhistorischen Versuch, den Aristoteles nach der Begründung seiner Schule, des Peripatos in Athen, nach 336 vermutlich mehrfach als Vorlesung vorgetragen hat. Wir lesen den Text in einer um Wörtlichkeit bemühten Übersetzung, die von mir selbst stammt: Aristoteles poet. 1449 a9 ff.: „Entstanden aus improvisatorischem Ursprung (απ' άρχής αυτοσχεδιαστικής) - sowohl sie selbst [die Tragödie] als auch die Komödie, und zwar jene von den Anstimmern des Dithyrambos, diese von den Anstimmern der Phallos-Lieder, wie sie auch heute noch in vielen Städten der Brauch sind - wurde sie in kleinen Schritten größer (κατά μικρόν ηύξήθη), indem man vorantrieb, was immer deutlich an ihr hervortrat; und nachdem sie viele Wandlungen erfahren hatte, hielt die Tragödie inne, sobald sie ihre Natur erreicht hatte (έπεί έσχε την αύτης φύσιν: ihr Wesen verwirklicht hatte). Und die Zahl der hypokritai (ύποκριταί = .Schauspieler') hat von einem auf zwei als erster Aischylos geführt und die Partien des Chores verringert und [damit] dem Wort als dem Hauptakteur den Weg bereitet; drei und die Bemalung der Skené - Sophokles. - Dann noch zur Größe: aus kleinen Geschichten und lachenerregender Diktion (έκ λέξεως γελοίας) - auf Grund der Umformung aus Satyrhaftem (διά το έκ σατυρικού μεταβαλειν) - wurde sie nach längerer Zeit [erst] respektabel (άπ-εσεμνύνθη), und das Versmaß wandelte sich vom Tetrameter zum Iambos. Anfangs nämlich verwendete man den Tetrameter infolge der satyrhaften und mehr tänzerischen Anlage der Schöpfung (δια τό σατυρικήν και όρχηστικωτέραν είναι την ποίησιν), nachdem aber das Sprechen aufgekommen war [nämlich im Gegensatz zum bis dahin regierenden Singen], fand die Natur selbst das adäquate Versmaß: am sprechbarsten von allen Maßen ist nämlich der Iambos (Indiz dafür: die meisten Metren, die wir in unserer Alltagsrede zufällig herausbringen, sind lamben - Hexameter sind's nur selten, und mit ihnen verletzen wir dann auch die Harmonie des Sprechflusses). - Dann noch zur Zahl der Auftritte (έπ-είσ-δδια = Episoden). - Und alles andere, wie es jedes für sich ausgeschmückt worden sein soll, wollen wir zunächst einmal als erledigt ansehen; denn es wäre eine Aufgabe für sich, das im Detail auszuführen."
Wir lassen hier von vornherein die Frage beiseite, ob Aristoteles, rund 200 Jahre nach der erstmaligen Installation des Tragödienwettbewerbs, überhaupt noch sicheres Wissen über die Entstehungsgeschichte der Tragödie haben konnte oder nicht. Die Mehrheit der Tragödienforscher damals, vor Nietzsches Zugriff wie
482
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
heute, ist der Ansicht, er konnte es. Nehmen wir demnach Aristoteles beim Wort, dann schälen sich die folgenden sieben Einzelpunkte heraus, die in der neuzeitlichen Forschung - vor und nach Nietzsche - als plausibel galten und gelten: (1) Die Tragödie hat sich schrittweise aus einem Samenkorn zur Vollform entwickelt (daß dieser Ansatz dem entelechetischen Prinzip Aristotelischen Philosophierens entspricht, braucht in diesem Fall die Tatsachenlage nicht zu verfälschen). (2) Der Same, die Keimzelle der Tragödie war ein Stegreifgeschehen (Aristoteles sagt: ,aus improvisatorischem Ursprung'). (3) In dem darauffolgenden Prozeß allmählichen Reifens, d. h. Anwachsens und Sich-Verbreiterns, ist als Haupttendenz die Zurückdrängung des Chors wirksam gewesen (Aristoteles sagt: .Aischylos hat die Chorpartien verringert'). Am Anfang stand also eine Chor-Aktion, d. h. Gesang und Tanz. (4) Der anfängliche improvisierte Chorgesang war ein Dithyrambos. Ein Dithyrambos (der Name ist wahrscheinlich phrygisch) war, wie man immer wußte, ein besonderer Liedtypus, und zwar ein spezifisches Dionysos-Kultlied.
(5) Die Tragödie war am Anfang noch nicht respektabel (Aristoteles sagt: .wurde sie nach längerer Zeit erst respektabel'). Sie bediente sich vielmehr einer, wie er sagt,,lachenerregenden Diktion' und behandelte, wie er sagt, .kleine Geschichten'. (6) Der Grund dafür war, daß die Tragödie zunächst eine satyrhafte und tänzerische Anlage hatte. (7) Das Ganze hatte zunächst noch keine Sprechpartien (Aristoteles sagt: .nachdem aber das Sprechen aufgekommen war ...'). Alle diese sieben Punkte zusammengenommen, bedeutet das: die Tragödie war am Anfang eine satyrhafte, eher lachenerregende mimetische Darstellung kleiner Geschichten durch einen singenden und tanzenden Chorkörper, der zu seinem Dithyrambos durch einen oder mehrere ,Anstimmer' aktiviert wurde. Problematisch erschien in dieser Theorie eigentlich stets nur die Rolle des von Aristoteles so genannten ,Satyrhaften'. Nachdem sich aber aus anderen Indizien schon früh ergeben hatte, daß das Gefolge des Dionysos, des schwärmenden Gottes, von Anfang an aus Satyrn unter ihrem Anführer Seflênos (Silen) bestand und daß diese Satyrn von Anfang an gekennzeichnet waren durch einen Rauschzustand, der evoziert war durch Alkohol (Wein), rhythmische Musik und exzessiven Tanz (also durch das gleiche, was wir im Mittelalter als Veitstanz oder auch, in der neuesten Zeit, als Diskotheken-Enthemmung kennen), da schien
und die gräzistische
Tragödienforschung
483
auch dieses .Satyrhafte' sich durchaus ins Bild zu fugen. Nahm man noch hinzu, daß die Vasenmalerei der Griechen die Satyrn oft in angedeuteter Bocksverkleidung zeigte, mit Fellschurz, Bocksbart und erigiertem Phallos, der die sprichwörtliche böckische Geilheit signalisierte24, dann schien die Aristotelische Tragödienursprungstheorie im ganzen stimmig. Am Anfang, das schien klar, stand eine Art Massenhypnose, die zur Selbstvergessenheit der Kultanhänger führte, zu einem offenbar freiwillig herbeigeführten Heraustreten aus der normalen individuellen Existenz, also - da .Heraustreten' auf griechisch ék-stasis (εκστασις) heißt - zur Ekstase. Die Mittel zur Herbeiführung dieses Ekstase-Zustands waren Rauschmittel aller Art, darunter in vermutlich führender Position die Musik, in ihren Elementen .Rhythmus', .Klang', .Lautstärke', ,Motivrepetition' und, möglicherweise, ,Selbststeigerung durch gegenseitige Stimulierung von Einzel-Anstimmem (also Vorsängern) und Chor'. Dies war im wesentlichen der Erkenntnisstand vor Nietzsche. Er ist aus zahlreichen Werken der gräzistischen Tragödienforschung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts belegbar, und Frau v. Reibnitz hat im Anhang ihres .Geburt der Tragödie'-Kommentars zwei aufschlußreiche Beispiele abgedruckt, das eine aus Karl Otfried Müllers .Geschichte der griechischen Litteratur' (2. Aufl. Breslau 1857), das zweite aus Yorck von Wallenburgs .Die Katharsis des Aristoteles und der Oedipus Coloneus des Sophokles' (Berlin 1866). Beide Bücher hat Nietzsche nach Frau v. Reibnitzens Recherchen in den Jahren 1870 und 1871 je zweimal aus der Universitätsbibliothek Basel ausgeliehen. Besonders in Müllers Literaturgeschichte konnte er im 21. Kapitel unter der Überschrift .Ursprünge der dramatischen Poesie' (2. Band, S. 22-40) eine ausführliche Darstellung der Tragödienentstehung finden, in der alle größtenteils auch heute noch gültigen Einzelerkenntnisse über den Dionysoskult als Keimzelle der Tragödie (einschließlich der Bedeutung der Satyrverkleidung durch „Umlegen von Bocksund Rehfellen um die Lenden, Behängen des Gesichts mit großen Blättern von allerlei Gewächsen statt eines Bartes, endlich in dem Anlegen ordentlicher Masken" und des ,,Verlangen[s], aus sich herauszugehen, sich selbst fremd zu werden", schließlich auch der Bedeutung des ,,Chorgesang[es]" als des „urspriinglichste[n] Bestandteil[s]" der Tragödie in Form des „Dithyrambus":
24 Zu diesen Bock-Attributen s. genauer A. Lesky, Die tragische Dichtung der Hellenen, Göttingen 3 1972, 36 f. Zu den wichtigsten Darstellungen gehört die Neapler Satyrspiel- oder Pronomos-Vase (um 400), bei Pickard-Cambridge (oben Anm. 16) abgebildet als Fig. 49, bei Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, Princeton 2 1961, als klare Umzeichnung dargeboten in Abb. 32/33.
484
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
S. 28 f.) zu einem abgerundeten Bild zusammengefaßt waren25. Nietzsche hat diese Einzelerkenntnisse weder bestritten noch gar bekämpft, sondern er hat sie übernommen und als selbstverständlich vorausgesetzt. Insoweit bedeutete seine eigene Schrift weder eine Revolution noch überhaupt eine Neuerung26. Dies trifft auch für das von Nietzsche so außerordentlich stark betonte Element , Musik' zu. Immer wieder ist behauptet worden, Nietzsche habe dieses Element aus seiner eigenen Musikbegeisterung (die ja schon in der Schule einen großen Teil seiner Freizeit einnahm27) und aus der aus ihr sich entwickelnden Wagner-Begeisterung heraus in die Ursprungsgeschichte der griechischen Tragödie zuriickprojiziert. Diese These ist ganz vordergründig. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte in der Gräzistik eine so intensive Beschäftigung mit griechischer Metrik, Rhythmik und Musik, daß kein Gräzist, der Sinn für Musisches besaß, daran vorbeigehen konnte. Insbesondere die diversen Schriften von A. Rossbach und R. Westphal28 hatten das Bewußtsein für die grundlegende Bedeutung der Musik (in den Formen Rhythmik, Orchestik, Musik i. e. S.) in der Entwicklung der griechischen Lyrik und damit auch großenteils der späteren Dramatik geschärft. Westphals Credo (in mehreren Schriften immer wieder anders formuliert), „dass Dichter und Componisi in Einer Person vereint war"29 liegt so gut wie allen zeitgenössischen Darstellungen der frühen griechischen Literaturgeschichte zugrunde und hat noch bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts 25
In der Frage des Tragödienna/ne/ΐΐ hatte sich Müller zwischen den beiden seit der Antike umstrittenen Haupttheorien (Benennung der Satyr-Sänger nach ihrer Ähnlichkeit mit Böcken vs. Benennung nach der Dithyramben-Aufführung „um das brennende Opfer eines Bockes") für die zweite Theorie entschieden (Geschichte der griechischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders, Breslau 2 1857, S. 31). 26 Das ist in der neueren Tragödienforschung innerhalb der Gräzistik immer so gesehen worden; als Beispiel zitiert v. Reibnitz 183 Anm. 8 G. F. Else, The Origin and Early Form of Greek Tragedy, Cambridge 1965, 10. Gerade daraus erklärt sich ja die langdauernde Ignorierung der Nietzscheschen Tragödienentstehungstheorie in der Fachwissenschaft: Der eigentlich fachwissenschaftliche Teil seines Buches bot nichts Neues, der mit Neuerungen aufwartende Teil konnte nicht als fachwissenschaftlich gelten (s. unten S. 490 f.). 27 Zur Rolle der Musik in dem von Nietzsche mitbegründeten Verein .Germania' in der Pforter Schulzeit s. v. Reibnitz 10 f. 28 Gekrönt durch das zweibändige Werk .Metrik der Griechen im Vereine mit den übrigen musischen Künsten' von A. Rossbach und R. Westphal, Leipzig 2 1867/68 (I: Rhythmik und Harmonik nebst der Geschichte der drei musischen Disciplinen, mit Supplement ,Die Fragmente der griechischen Rhythmiker und die älteren Musikreste'; II: Die allgemeine und specielle Metrik). Westphals Hauptwerke besaß Nietzsche bzw. lieh er 1870 in Basel aus (v. Reibnitz 357); über Rhythmik und Metrik las er an Universität und Pädagogium (v. Reibnitz 358). 29 R. Westphal, Die Fragmente und die Lehrsätze der griechischen Rhythmiker, Leipzig 1861, S. 4.
und die gräzistische
Tragödienforschung
485
hineingewirkt, wenn etwa Wilhelm Christ in seiner .Geschichte der griechischen Literatur' (4. Aufl. 1904) die Behandlung der Lyrik mit dem Satz einleitete: „Aber die Ausbildung der Lyrik war bei den Griechen in noch höherem Grade als bei uns mit der Geschichte der Musik verknüpft" 30 . So war es ganz selbstverständlich, daß Karl Otfried Müller in seiner .Geschichte der griechischen Literatur' (die Nietzsche, wie wir sahen, ausgiebig benutzte) nach der Behandlung des Epos, der Elegie und des Iambus und vor dem Übergang zur Melik (Sappho und Alkaios, die Chorlyriker) ein ausführliches Kapitel über ,Die Entstehungszeit der Griechischen Musik' einschob (S. 265-294, rund 30 Seiten). In den griechischen Literaturgeschichten des 20. Jahrhunderts ist das mehr und mehr abgekommen, so daß spätere Gräzistengenerationen für eine individuelle Marotte Nietzsches halten konnten, was in Wahrheit (und mit gutem Grunde) allgemeiner Lernstoff seiner Zeit war. Daß am Anfang der Tragödie die Musik stand, war damals eine allgemein geteilte Überzeugung, nicht nur unter Fachgräzisten, sondern auch im gebildeten Publikum (zu dem natürlich auch die zeitgenössische Musikerzunft, darunter Richard Wagner, gehörte); gerade ein Gräzist bedurfte nicht erst Richard Wagners, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Allerdings war diese Einsicht vor Nietzsche, soweit ersichtlich, noch nie zum Gegenstande einer monographischen Behandlung gemacht worden; sie zog sich vielmehr untergründig wie ein langer roter Faden durch die einzelnen Kapitel der griechischen Literarhistorie von Homer bis Aischylos - hier und da auftauchend, aber nie thematisch werdend. Nietzsches Idee bestand darin, die Sache auf den Punkt zu bringen - und dieser Punkt ist formuliert im Titel seiner Schrift: ,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik'. Dieser Titel hat seit jeher elektrisierend gewirkt. Der Grund für diese starke Wirkung ist vielleicht noch auffindbar: In seinen diversen Vorarbeiten hatte Nietzsche das Thema des geplanten Buches längere Zeit traditionsgemäß vorwiegend mit dem Worte .Ursprung' (seil, der Tragödie) bezeichnet - bis Anfang 1871. Im Februar 1871 lieh er sich v. Wallenburgs .Katharsis'-Buch zum zweiten Male aus 31 . Auf S. 22 heißt es dort nun aber in Anm. 2: „Die Entstehungsart der griechischen Tragödie ist die eines Naturprodukts. Die Continuität ihres Wachsthums entzieht sich der Reflexion, und so erscheint sie gleich der dem Haupte des Zeus entsprungenen
Athene unmittelbar in der von Aeschylus ihr
gegebenen Vollendung." v. Wallenburgs Vergleich ist nichts anderes als die 30 W. Christ, Geschichte der griechischen Literatur bis auf die Zeit Justinians (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, Band 7), München 4 1904, S. 116. 31 Nachweise bei v. Reibnitz 360.
486
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
Verbalisierung der alten Bildformel .Geburt der Athene aus dem Haupte des Zeus' (die übrigens - auch dies vielleicht nicht ohne Einfluß - gleich auf S. 2 von Müllers Literaturgeschichte, noch in der Einleitung, auf das plötzliche Erscheinen Homers und Hesiods aus dem Strom der vorhomerischen mündlichen Epik angewandt wird). Es wäre nicht verwunderlich, wenn Nietzsches definitiver Buchtitel ,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' (Oktober 1871) aus der lektürebedingten Übernahme dieses alten Geistgeburt-Mythos zu erklären wäre. Der Wechsel von der nüchtern wissenschaftlichen Diktion zu dem mythisch-vitalistischen Sprachgestus, der den ganzen Text des Buches prägen wird, wäre dann freilich nicht nur sachbezogen zu verstehen, sondern auch selbstreferentiell: Gemeint wäre programmatisch nicht nur das historische Ereignis der griechischen Tragödiengeburt, sondern auch das unmittelbar aktuelle ihrer erstmals wirklich verstehenden Wiedergeburt durch Nietzsches vorgelegte Schrift. Nietzsches .Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' also keine langdauernde pedantische Erforschung, sondern eine plötzliche Entbindung die Umschlagvignette, auf die ihm so viel ankam32: das Bild des entfesselten Prometheus, erhielte so dann ihre eigentliche Bedeutung und Funktion zurück: Bildsymbol zu sein für das, was auch die Titelworte sagen wollten. III Damit sind wir beim dritten Punkt: dem Lösungsangebot, das Nietzsche machte. Hier kann und darf ich mich viel kürzer fassen - nicht nur, weil ich vor einem Kreis von Kennern spreche, sondern auch, weil die Parallelen zwischen Faktenlage und Erkenntnisstand einerseits und Nietzsches Ansatz andererseits weitgehend bereits implizit deutlich geworden sein dürften. Das 1. Kapitel beginnt sogleich mit jenem grandiosen Suggestivbild, das im Gedächtnis der Nachwelt mit Nietzsche mehr als jede andere Metapher verbunden bleiben sollte: mit dem Prinzipienpaar des Apollinischen und Dionysischen. Daß die Korrelation dieser beiden Prinzipien nicht Nietzsches Erfindung war, sondern eine lange Vorgeschichte hatte, hat Barbara v. Reibnitz schön gezeigt33. Sie hat aber mit ebensolcher Treffsicherheit darauf hingewiesen, daß die totale Generalisierung dieses Begriffspaars, als Erklärungsmuster für Religion, Kunst und Kulturgeschichte überhaupt, Nietzsches Werk war 34 . Nietzsche sagt ja gleich im ersten Satz, „daß die Fortentwicklung der Kunst an die Duplizität des 32 33 34
v. Reibnitz 273 f. v. Reibnitz 61-64. v. Reibnitz 64.
und die gräzistische Tragödienforschung
487
Apollinischen und des Dionysischen gebunden ist", und der gleich darauffolgende Vergleich mit der Duplizität der Geschlechter macht klar, daß .Fortentwicklung' hier .Fortbestand und Existenz' bedeutet. Dieser Vergleich enthebt den Autor aber jeglichen Begründungszwanges. Denn daß Mann und Frau als zweiseitige Einheit die Menschheit garantieren, ist unmittelbar einsichtig. Indem Nietzsche das Apollinische und das Dionysische in den gleichen Seinsrang hebt wie Männliches und Weibliches35, weist er jede Forderung nach Gründen automatisch ab und kann so lapidar an die „unmittelbare Sicherheit der Anschauung" appellieren, also an das Evidenzerlebnis. Jeder Leser muß schon hier sofort verstehen, daß es in diesem Buch um mehr gehen wird als um Gräzistisches jedenfalls im alten Sinne (wir erinnern uns an seinen Brief an Engelmann, worin es hieß: „... indem ich einstweilen von jeder philologischen Behandlung der Frage völlig absehe"), und Nietzsche spricht denn auch im gleichen ersten Satz weder von Gräzistik oder überhaupt von Philologie, sondern von der „ästhetischen Wissenschaft". Unüberhörbar ist damit der Anspruch formuliert, über alle bisherigen Lösungsversuche hinauszugehen, indem die griechische Tragödie - das Griechische überhaupt - in eine übergeordnete allgemeine Norm ästhetischer Gesetzmäßigkeit eingeordnet werden soll und so dann als Exemplum dienen kann. Das Sinnbild des entfesselten Prometheus wird immer klarer, und Nietzsches selbstbewußte Konstatierung in Kap. 7, daß das Problem des Ursprungs (seil, der griechischen Tragödie) „bis jetzt noch nicht einmal ernsthaft aufgestellt, geschweige denn gelöst ist" 36 , verliert vor diesem Hintergrund ihre scheinbare Arroganz37. 35
Will man diese Gleichung über ihre ontologische Erklärungsfunktion hinaus ausschöpfen (was Nietzsche selbst, doch wohl bewußt, vermieden hat), so wäre das Apollinische als Männliches, das Dionysische als Weibliches zu sehen; insbesondere bei den Dichtern (v. a. Eurípides, Bakchen) und bildenden Künstlern hat Dionysos oft feminine Züge. 36 KSA 1, 52. 37 So empfand es auch Rohde - wohl nicht nur aus Freundschaft zu Nietzsche (, Afterphilologie', bei Gründer, S. 76): „Schon den Alten aber schien das Wesen dieser wunderbaren tragischen Lust höchst dunkel und geheimnissvoll (wie namentlich der Platonische Philebus zeigt), und wer, einmal selbst von ihr ergriffen, sich vergebens nach der verborgenen Art dieser despotisch in ihre Kreise zwingenden widerspruchsvollen Kunst gefragt hat, der wird wohl wahrlich den verlachen, der, nach einer Aufzählung der dürren Notizen, die uns ein karges Schicksal gegönnt hat, die Entstehung dieser tragischen Kunst [...] für erklärt hält. Einen wirklichen Aufschluss wird er nur von demjenigen erwarten, dem es gelänge, in die ursprünglichen, tieferregenden Bewegungen, aus denen zu einer ganz bestimmten Zeit zum ersten Male diese unerklärliche Kunst der Schmerzensfreude in Griechenland [...] erstand, mit sympathischer Empfindung einzudringen. Während man nun ehrlicher Weise gestehen muss, dass dazu die bisherige Philologie gar keinen emstlichen Versuch gemacht hat, gewinnt eben hierfür unser Freund [Nietz-
488
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ,Geburt der Tragödie'
Die These selbst, die dann entwickelt wird, läßt sich, mit der unvermeidlichen Vergröberung des Komprimierungszwanges, so zusammenfassen: Kunst ist zu jeder Zeit das Produkt des Widerstreits von Apollinischem und Dionysischem. Versöhnung zwischen beiden tritt nur periodisch ein, gebiert dann jedoch aus einem „Wunderakt"38 der Paarung seltene Wunderwerke. Eines davon war die attische Tragödie. Ein zweites - so werden wir von Kap. 16 an erfahren - ist die „musikalische Tragödie"39 Richard Wagners. Das Dionysische, als das ungeheure Grausen und zugleich wonnevolle Entzücken, ausgelöst durch die Aufhebung des Rationalen und den Einbruch des Irrationalen, steigt aus dem innersten Grunde des Menschen empor als das existentiell Vitale, wie es im orgiastischen Gott Dionysos und seinem Kult einst auch bei den Griechen in die Welt gekommen ist, und es äußert sich dann nach Nietzsche vornehmlich in der „unbildlichen Kunst der Musik" 40 . Das Apollinische hinwieder, als der schöne Schein der inneren Phantasiewelt, steigt aus dem Trieb des Menschen hoch, das Schwere, Grausige des Lebens heiter zu verhüllen, einem Trieb, wie er sich bei den Griechen in der Schaffung der olympischen Götterwelt und der affirmativen homerischen Kunst vergegenständlichte, und das Apollinische äußert sich, dem Wesen des griechischen Traum-, Licht- und Wahrheitsgotts Apollon entsprechend, vornehmlich in der Kunst der Bildnerei im weitesten Sinne, d.h. im Bilden, Formen, Strukturieren. Das Wunderwerk der attischen Tragödie kam nun zustande dadurch, daß der rauschhafte dionysische Untergrund der Welt, der sich im Satyrchor der Griechen ein erstes Mal als in einem ersten Kunstgebilde sublimiert hatte, später, im Vollzug des tragischen Spiels, durch die Bildnerund Verklärungskraft des Apollinischen vollends .aufgehoben' wurde. In der
sehe] die Möglichkeit aus jenen tiefen Einsichten Schopenhauers in das innerste Wesen der Musik" (Hervorhebungen von mir). - Rohde hat den Einfluß Schopenhauers auf Nietzsches Tragödienentstehungshypothese, wie viele nach ihm, sicher überschätzt; Nietzsche hatte Schopenhauer mit der Wiederentdeckung der griechischen Musik innerhalb der zeitgenössischen Gräzistik (s. oben S. 484) zusammengesehen. Daraus erwuchs ihm ein intuitiver Einblick, den es bis dahin so noch nicht gegeben hatte - woraus er das Hochgefühl schöpfte, das „Problem des Ursprungs [der Tragödie] [sei] bis jetzt noch nicht einmal emsthaft aufgestellt" worden (Hervorhebung von mir). Daß diese Feststellung „provokativ" wirkte (so v. Reibnitz 182), ist selbstverständlich; leider wirkte sie jedoch provokativ im negativen, nicht im positiven Sinne, nämlich im Sinne einer Herausforderung, die bis dahin gültige Grundposition der Ursprungsforschung zusammen mit Nietzsche objektiv zu überdenken. 38 KSA 1, 25. 39 KSA 1, 138. 40 KSA 1, 25.
und die gräzistische
Tragödienforschung
489
entwickelten Vollform der griechischen Tragödie lebte dann das Dionysische fort im Chor, das Apollinische im Dialog 41 (wir sagen heute besser: in den Sprechpartien). Solange das so entstandene vollendete Kunstwerk aus der Kraft des Mythos lebte, d. h. bei Aischylos und Sophokles, bei denen die Tragödienhelden, wie Prometheus oder Ödipus „nur Masken des ursprünglichen Helden Dionysos" 42 sind, war die Tragödie als die Überwindung des metaphysischen Grauens durch Kunst die einzige, weil zutiefst erschütternde und zugleich erhebende Tröstung des Menschen. Als aber Euripides, angestiftet durch Sokrates und die Sokratik, sich von Dionysos als letztlich einzigem Tragödienhelden abwandte und statt seiner die gänzlich unmythischen Menschen seiner eignen Zeit auf die Bühne brachte, d. h. die „bürgerliche Mittelmäßigkeit"43, da begann die Tragödie zu sterben. Denn was war hier geschehen? Euripides hatte Dionysos vertrieben - „Und siehe: Apollon konnte nicht ohne Dionysos leben!"44 Euripides trieb den Chor und damit die Musik aus der Tragödie hinaus (denn was er als Musik betrachtete, den ,Neuen Dithyrambus', das war nicht Urgewalt, sondern Schellengeklingel), er trieb damit den Rausch aus der Tragödie hinaus, und letztlich auch den Traum. An seine Stelle setzte er den dialektischen Intellektualismus, den flachen Optimismus der .Wissen ist Macht'-Bewegung, das Disputieren und Zerreden, die Erkenntnisgier. Damit aber war das vitale Zentrum der Tragödie zerstört. Der Geist der Musik war aus ihr entfernt. Und am Entschwinden dieses Geistes der Musik ging sie zugrunde. An dieser Stelle hat Nietzsche den Übergang und Anschluß an die eigene Zeit und Erfahrungswelt gewonnen, und die ganze folgende Erörterung45 wird indirekt umkreisend das unerhörte Ereignis der Neugeburt des schon für immer tot Geglaubten durch Richard Wagners musikalische Tragödie aus dem deutschen Mythus feiern. Es ist längst gesehen und gezeigt, vor allem vom Gräzisten Wolfgang Schadewaldt im Lohengrin-Programmheft der Bayreuther Festspiele von 1962 und im Meistersinger-Programmheft ebenda von 1963, wie sehr in diesem zweiten Teile Nietzsche von Wagners Griechenrezeption (die außerordentlich tiefdringend, umfassend und professionell war) beeinflußt war 46 . Wagners kunsttheoretische Schriften, seit dem Sommer 1847, in dem er als Hofkapellmeister in Dresden Aischylos' Orestie „mit unerhört eindringlicher Gewalt" 41 42 43 44 45 46
KSA 1, 63 f. KSA 1, 71. KSA 1, 77. KSA 1, 40. Kap. 16 ff. Hellas und Hesperien 2Π 341^105.
490
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches ,Geburt der Tragödie'
(wie er selbst sagt) auf sich einstürzen fühlte, hatten, in Schadewaldts Formulierung, den „Gedanken Nietzsches von der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik [...] eindeutig präformiert" 47 . Wahrscheinlich hatte Nietzsche auch erfahren oder erkannt, daß Wagners tetralogische Ringdichtung: .Rheingold, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung' nach Droysens Rekonstruktion der Aischyleischen Prometheus-Tetralogie48 geschaffen worden war 49 . Die Denkund Gefühlswelt Nietzsches und Wagners bildet hier eine so enge - und, wie man ausdrücklich betonen muß - gräzistisch so kenntnisreich fundierte Einheit, daß es ganz unverständig und töricht wäre, den zweiten Teil von Nietzsches Buch als höfisch-elegante Verbeugung vor dem verehrten Meister abzutun. Dies allerdings ist - nicht zur Ehre der Gräzistik - nach dem Erscheinen der .Geburt der Tragödie' nur allzuoft geschehen. IV Damit kommen wir zum letzten Hauptpunkt: den Wirkungen von Nietzsches Lösungsangebot auf die gräzistische Folgeforschung. Ich begnüge mich hier ausdrücklich mit der Wirkung auf die Fachgräzistik. Ich rede nicht von der allgemeinen Wirkung, die bekanntlich in weiten Kreisen überwältigend war und schon 1874 eine zweite Auflage nötig machte. Schon gar nicht rede ich von der Wirkung auf den Wagnerkreis und auf die künstlerische Erneuerungsbewegung. Dies werden Berufenere nach mir tun. Ich beschränke mich auf die Fachgräzistik. Da sind nun zwei Wirkungswellen auszumachen. Die erste ist die allbekannte des Skandals. Ein paar Stichworte werden genügen: Noch 1872, also im Erscheinungsjahr der .Geburt der Tragödie', veröffentlichte der damals 23 jährige Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff, ebenfalls ein Pforte-Zögling und zu jener Zeit frisch promovierter Gräzist an der Universität Berlin, seine sog. .Zukunftsphilologie! Eine erwidrung auf Friedrich Nietzsches, ord. Professors der classischen philologie zu Basel, Geburt der Tragödie'. Die Schrift ist ein einziges Pamphlet, das durch überlegen-ironische Widerlegungen (oft Scheinwiderlegungen) von Einzelheiten aus Nietzsches Buch zu dem Schluß kommt, er, Wilamowitz habe hiermit den „beweis für die schweren vorwürfe der Unwissenheit
47 48 49
Hellas und Hesperien 2Π 356. J. G. Droysen, Aischylos, Werke. Übers, v. J. G. D., Berlin (1832) 21841. Hellas und Hesperien 2Ü 359 f.
und die gräzistische
Tragödienforschung
491
und des mangels an Wahrheitsliebe"50 Nietzsches geliefert, woraus er die Berechtigung ableitet zu der Aufforderung: „halte hr. N. wort, ergreife er den thyrsos, ziehe er von Indien [wie Dionysos] nach Griechenland, aber steige er herab vom katheder, auf welchem er Wissenschaft lehren soll; sammle er tiger und panther zu seinen knieen, aber nicht Deutschlands philologische jugend, die in der askese selbstverläugnender arbeit lernen soll, überall allein die Wahrheit zu suchen." 51 Diese rüde Aufforderung zur Berufsaufgabe (die übrigens nicht nur rein sachliche Ursachen hatte, sondern auch auf den „berühmtesten Philologenstreit in der Geschichte der modernen Wissenschaft" 52 zurückging, nämlich auf den Bonner Eklat zwischen sowohl Nietzsches als auch Wilamowitzens Lehrern Otto Jahn und Friedrich Ritsehl) gründete sich letztlich auf die allgemeine Intoleranz der zeitgenössischen, vorwiegend positivistisch orientierten Gräzistik gegenüber allen Versuchen, fehlende Glieder einer Evolution divinatorisch zu ergänzen und Argumentation, wo sie mangels Indizien unmöglich war, probeweise durch Vision zu ersetzen (eine natürliche Folgewirkung der in jenen Jahren von Triumph zu Triumph eilenden naturwissenschaftlichen Methode); Nietzsches Sprache, die sich ganz bewußt vom damals gängigen Philologenstil abhob 53 , trug das Ihrige zur Ablehnung durch die Zunft bei. Wäre Nietzsches Buch in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen, hätte die Reaktion vermutlich anders ausgesehen. So aber löste die Wilamowitzsche Attacke eine Lawine von unschönen öffentlichen Zänkereien aus, unter denen das Sendschreiben des damaligen Kieler Extraordinarius für Gräzistik und Nietzsche-
50
U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Zukunftsphilologie! eine erwidrung auf Friedrich Nietzsches, ord. professors der classischen Philologie zu Basel, .Geburt der Tragödie' (Berlin 1872), in: Gründer, S. 55. 51 Wilamowitz, ebd. 52 C. W. Müller: Otto Jahn, in: Classical Scholarship. A Bibliographical Encyclopedia, ed. by W. W. Briggs and W. M. Calder m . New York - London 1990, 227-238, hier 232. 53 Vgl. Nietzsches Brief an Engelmann vom 20. April 1871 (Auszug bei ν. Reibnitz 45): „... so kann ich nicht anders glauben als daß das allerweiteste denkende Publikum sich für diese Schrift interessiren muß. Um diesen mich verständlich zu machen, habe ich auf die stilistische Darstellung und Deutlichkeit besonderen Fleiß gewandt" (Hervorhebung von mir). - Nietzsche hat diesen Stil bekanntlich 14 Jahre später im ,Versuch einer Selbstkritik' (KSA 1, 11-22; August 1886) mit einer Art wilder Haßliebe geradezu .zerrissen' („schwerfällig, peinlich, bilderwütig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen, ungleich im Tempo, ohne Willen zur logischen Sauberkeit, sehr überzeugt und deshalb des Beweisens sich überhebend, mißtrauisch selbst gegen die Schicklichkeit des Beweisens ..." usw.), ohne freilich mit diesem Ausfall seinen heutigen Leser wirklich zu überzeugen; denn in der Tat - was für ein andrer Stil wäre adäquat gewesen? Das sah Nietzsche selbst, wenn er fortfuhr: „Sie hätte singen sollen, diese ,neue Seele' - und nicht reden!" Für Wilamowitz hatte sie bereits gesungen!
492
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
Freundes Erwin Rohde mit dem Gegentitel, Afterphilologie', wohl am berühmtesten geworden ist. Etwas übertrieben, aber im Kem nicht unrichtig, wirft da Rohde Wilamowitz u. a. „die sorgfältig ausgebildete absolute Unfähigkeit" vor, „irgend etwas zu verstehen, das über den Zustand des plattesten Behagens hinaus fuhren könnte", und er kanzelt den jungen Dr. phil. als „vollendeten Ignoranten", als einen Menschen „von unsäglicher Roheit der Vorstellungen" und eben als „wirklichen Afterphilologen" 54 ab. Nun war Wilamowitz freilich, was die reine Fachgräzistik betraf, alles andere als ein „vollendeter Ignorant"; er hatte bereits in seiner 120 Seiten umfassenden Valediktionsarbeit als Abiturient in Pforte unter dem Titel .Trauerspiele' 55 eine Sachkenntnis der griechischen Tragödie an den Tag gelegt, die der Nietzsches in der Tat um einige Stufen überlegen war - was die Zunft dem Pamphlet gegen Nietzsche leicht entnehmen konnte, so daß sie sich stillschweigend darauf einigte, Wilamowitz als ihr Sprachrohr anzusehen und Nietzsche fürderhin wie einen Paria totzuschweigen. Das hatte die fatale Folge, daß Nietzsches Thesen zunächst in der Gräzistik wirkungslos blieben, um so mehr, als Wilamowitz binnen weniger Jahre zum führenden Gräzisten des deutschen Sprachraums aufstieg und die gräzistische Szene bis zu seinem Tode 1931 eindeutig als Meinungsführer dominierte. Andererseits zeigte aber Wilamowitzens eigene Behandlung der Ursprungsfrage und der griechischen Tragödie überhaupt in seiner .Einleitung in die attische Tragödie' von 1889 einen derart eklatanten Mangel an philosophischem, ästhetischem und überhaupt theoretischem Verständniswillen, daß mancher in der Zunft heimlich gerade in Wilamowitz die , Verknöcherung' der Philologie, die Nietzsche in der .Geburt der Tragödie' so heftig angeprangert hatte und gegen die er in der Tat eine neue Philologie der Zukunft setzen wollte, aufs traurigste verkörpert sah. Vom innersten Leben der Tragödie hatte Wilamowitz offensichtlich wenig oder nichts verstanden; seine Tragödiendefinition, die alles Philosophische und sogar die Katharsis-Erkenntnis des Aristoteles als rührseliges Gefasel abtat, irritierte damals sogar die überzeugtesten Wilamowitz-Freunde: „Eine attische Tragödie ist ein in sich abgeschlossenes Stück der Heldensage, poetisch bearbeitet in erhabenem Stile für die Darstellung durch einen attischen Bürgerchor und zwei bis drei Schauspieler, und bestimmt, als Teil des öffentlichen Gottesdienstes im
54 E. Rohde: Afterphilologie. Zur Beleuchtung des von dem Dr. phil. Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff herausgegebenen Pamphlets: .Zukunftsphilologie!'. Sendschreiben eines Philologen an Richard Wagner (Leipzig 1872), in: Gründer, S. 67.98.101.107. 55 Bei J. Wohlleben, Der Abiturient als Kritiker, in: Wilamowitz nach 50 Jahren, hrsg. von W. M. Calder m/H. Flashar/Th. Lindken, Darmstadt 1985, 3-30.
und die gräzistische
Tragödienforschung
493
Heiligtume des Dionysos aufgeführt zu werden"56. Wie stand diese positivistische Gebrauchsanweisung gegen Nietzsches intuitives Begreifen eines tiefen seelischen Bedürfnisses da?57 In dieser unglaublichen Anaisthesia (αναισθησία), Empfindungslosigkeit, des größten Fachgräzisten seiner Zeit gegenüber dem dynamischen Vitalkern der griechischen Tragödie war denn auch die Gegenreaktion begründet, die zweite Wirkungswelle, die von Nietzsches Lösungsvorschlag ausging. Ans Tageslicht trat sie freilich erst bei Wilamowitz' Schülern58. Die hatten, wie man aus manchem Lebensrückblick weiß, gleich mittelalterlichen Mönchen den langweiligen Livius auf, und den das Blut beschleunigenden Ovid, sprich: Nietzsche, unterm Hörsaaltische liegen 59 . Die ungeheure Spätwirkung der ,Geburt der Tragödie' (aber natürlich auch der späteren Schriften Nietzsches) bei der Schülergeneration von Wilamowitz ist oft beschrieben worden; ich weise nur auf den 1985 erschienenen Sammelband .Wilamowitz nach 50 Jahren' hin. Der Gräzist Ernst Vogt hat da die Nietzsche-Wirkungen von Werner Jaeger bis zu Karl Reinhardt nachgezeichnet. Nicht erwähnt hat er Max Pohlenz, ebenfalls WilamowitzSchüler aus dessen Göttinger Zeit. 1930 bringt Max Pohlenz seine überaus einflußreiche zweibändige .Griechische Tragödie' heraus (1954 erschien eine zweite überarbeitete Auflage). Wilamowitz ist da zwar immer noch präsent - er 56
U. v. Wilamowitz-Moellendorff: Euripides, Herakles. Erklärt von U. v.. W.-M. Band I: Einleitung in die attische Tragödie. Berlin: Weidmann, 1889. Reprint Darmstadt 1981, S. 107. 57 Siehe ζ. Β. Κ. Reinhardt: Ulrich ν. Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931), in: Die Großen Deutschen. Deutsche Biographie in vier Bänden. Ergänzungsband, Berlin 1957; wieder in: VdA 361-368, hier 366: „... schlägt seine Definition der griechischen Tragödie in ihrem historischen Realismus allen ästhetischen, romantischen und klassizistischen Spekulationen ins Gesicht [...] Kein Wort vom Tragischen." 58 Daß der Nietzsche-ähnliche Erklärungsansatz der Cambridge School (G. Murray, Jane Harrison u. a.) Anfang des 20. Jh. genetisch nicht auf Nietzsche zurückging, ist von v. Reibnitz 183 mit Anm. 9 richtig herausgestellt worden; das Bedürfnis, über vordergründig Phänomenologisches („dürre Notizen": Rohde, oben Anm. 37) hinauszukommen und in nicht-aristotelischer Weise das Wesenhafte der Tragödie zu erfassen, war allerdings das gleiche, so daß Nietzsches Durchbruchsversuch auch dadurch legitimiert wird. 59 Siehe z. B. K. Reinhardt, Akademisches aus zwei Epochen. I: Wie ich klassischer Philologe wurde (Die Neue Rundschau 66, 1955, 37-58), wieder in VdA 380 ff., hier 381: „Auch hatte Nietzsches Briefwechsel mit Erwin Rohde einen starken Eindruck [auf mich] hinterlassen, nicht zuungunsten der Philologie [...] Es schien noch eine andere Antike als die durch die Universität vermittelte zu geben"; „Nach Absolvierung meines Kandidatenjahres nahm ich Urlaub und bereiste [...] dreiviertel Jahr lang Griechenland, die Ägäis und die kleinasiatische Türkei [...] Erhebendster Augenblick, da ich inmitten des sich bräunenden Röhrichts des weit ausgebreiteten, befreienden Mäandertales, auf meinem anatolischen Pferdchen, Nietzsches .Fröhliche Wissenschaft' in der Satteltasche ..."
494
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
spricht schon programmatisch aus dem demonstrativ antinietzscheschen Titel des Einleitungskapitels: ,Die Geburt der Tragödie aus attischem Geiste'. Aber noch im gleichen Einleitungskapitel, nach der pflichtschuldigen Abweisung des ,auf Musik getauften' Schopenhauer- und Wagner-Knechtes Nietzsche, plötzlich der unerhörte Satz: „Dagegen führt uns in das Wesen der Tragödie Nietzsches Hinweis auf den dionysischen Zug des Griechentums. Denn wesenhaft, nicht zufällig ist die Tragödie mit Dionysoskult und dionysischer Ekstase verbunden." 60 Da war der ganze Wilamowitz plötzlich weggewischt - und Nietzsche in sein Recht gesetzt. - Doch das war nur der Anfang. Geradezu zum Leitbild einer neuen Gräzistik wurde Nietzsche bei einem anderen WilamowitzSchiiler, Karl Reinhardt (1886-1956). In seinen Arbeiten und Vorlesungen wird Nietzsche nicht etwa nur erwähnt, nein, er wird zum Thema zahlreicher öffentlicher Vorträge gemacht. Ich zitiere nur aus dem Vortrag von 1941 ,Die Klassische Philologie und das Klassische': „Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die klassische Philologie mühselig, wie ein überorganisiertes, in sich selbst leerlaufendes Unternehmen. Was mit höchster Begeisterung begonnen worden war, das endete - nicht bei den Stumpfen, sondern bei den Wachen - in Askese, Pflichterfüllung, ausharrendem Heroismus." 61 Da sei Nietzsche aufgetreten. Er habe als erster die Totenstarre der Klassischen Philologie diagnostiziert. Und er - sagt Reinhardt - war es auch, der die „fortschreitende Entfremdung zwischen Altertum und Publikum"62 aufzuhalten suchte mit einer „humanistischen Selbstbesinnung, die bis in die Tiefen vorstieß"63. Nietzsche war für Reinhardt, so wörtlich, der „Dämon des Jahrhunderts"64, von dem er sich magisch angezogen fühlte 65 . Denn Nietzsche hatte, wie Reinhardt fühlt und weiß, das richtige Konzept. Er wollte, „wie ein Arzt am Krankenbette der .gelähmten' Zeit" sitzend, eine „umfassende Gesundheitslehre" schaffen. Leider kam er über „Vorschwebendes" 66 nicht hinaus. Aber gerade dieser intelligente Systemmangel war ja das Belebende! Nietzsche war eben nicht, wie seine Zunftkollegen, „Humanist im
60
M. Pohlenz, Die griechische Tragödie, I (Leipzig - Berlin 1930) 8 = 2 I (Göttingen 1954) 25 (Hervorhebungen von mir). 61 K. Reinhardt, Die Klassische Philologie und das Klassische (Vortrag Frankfurt/M. 1941), in: VdA 334-360, hier 342. 62 VdA 344. 63 VdA 344. 64 K. Reinhardt, Nietzsche und die Geschichte (Vortrag Paris 1928), in: VdA 296-309, hier 302. 65 So Carl Becker im .Nachwort' zu VdA, S. 411. 66 VdA 345.
und die gräzistische Tragödienforschung
495
Hauptamt" 67 , nein: „Wie ein sauberer Wasservogel schwimmt er auf den Fluten der Gelehrsamkeit der Zeit, ohne benetzt zu werden." 68 Nur so konnte es dann auch gelingen, daß Nietzsche letztlich alles angestoßen hat, was nun an neuem Leben in die Gräzistik Einzug hält. Alles das ist 1941 gesagt. Wir schreiben heute das Jahr 1993. Weitere 50 Jahre sind vergangen. Es würde Stunden dauern, aufzuweisen, wie ungeheuer aufrührend, belebend, erfrischend Nietzsche, auch der Nietzsche der .Geburt der Tragödie', seitdem auf die Gräzistik weitergewirkt hat. In der bewegten Zeit des 68er-Aufbruchs schreiben z.B. zwei Frankfurter Assistenten der Klassischen Philologie eine neue .Einführung in die Geschichte der Klassischen Philologie' 6 9 , in der sowohl Wilamowitz als auch Werner Jaeger, der Begründer des „blutlosen" .Dritten Humanismus', dem Verdikt verfallen. Als Vorbild aber für eine Gräzistik, in der nicht mehr der Mensch nur noch der Wissenschaft zu dienen habe, sondern die Wissenschaft dem Menschen, erscheint nun Friedrich Nietzsche! Sie mögen sagen: „Junge Leute, eine junge, aufgeregte Zeit - kein Wunder also, - und sicher bald vergessen!" - Aber 1979 veröffentlicht der 70 jährige Klassische Philologe und Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Viktor Pöschl in dem Sammelband .Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert' einen Aufsatz mit dem Titel .Nietzsche und die klassische Philologie' 70 . Da kommt nun die späte Rehabilitation - nach über 100 Jahren - ex cathedra: Eine kaum geglaubte Anzahl von einzelnen Entdeckungen wird aufgezählt, die Nietzsche auch im engsten Fachbereich gemacht hat und die in der Periode seiner Ächtung nur unbemerkt geblieben waren. Und zur .Geburt der Tragödie' heißt es: „Die These ist unhaltbar, aber sie hat dazu geführt, daß Nietzsche zu einem der großen Wiederentdecker des frühen Griechentums wurde." 71 - Ich persönlich, um zum Schluß zu kommen, (als Schüler Uvo Hölschers, eines Lieblingsschülers von Karl Reinhardt) glaube, daß Nietzsche in Wahrheit zu viel mehr geworden ist als nur zu einem der großen Wiederentdecker des frühen Griechentums. Er war zwar nicht der große Erforscher - si-
67
VdA 344. VdA 346. 69 Ada Hentschke/U. Muhlack, Einführung in die Geschichte der Klassischen Philologie, Darmstadt 1972. 70 V. Pöschl, Nietzsche und die Klassische Philologie, in: H. Flashar/K. Gründer/ A. Horstmann (Hrsgg.): Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert. Zur Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaften, Göttingen 1979, 141-155. 71 V. Pöschl, ebd. 155. 68
496
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie'
eher nicht! - , aber, mit Karl Reinhardt zu reden, er war der große Erschließer72. Er hat uns gezeigt, wo wir das Wesen der griechischen Tragödie fassen sollen. Und darum glaube ich auch nicht, wie Pöschl meinte, daß Nietzsches These in der .Geburt der Tragödie' „unhaltbar" ist. Hier geht es um den Begriff der »Haltbarkeit'. Gerade Nietzsche war es ja, der zeigen konnte, daß die philologische ,Unhaltbarkeit' uns in den tiefsten Dingen zuweilen den Blick auf die wahre Haltbarkeit, die Evidenz, versperren kann. So scheint mir denn die , Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' am Ende doch ein großes Werk zu sein, höchst lehrreich immer noch und gerade auch für die, die es vor 120 Jahren gnadenlos verstießen - für die Gräzisten!
72
VdA 309.
und die gräzistische Tragödienforschung
497
Chronologie der Aufführungen (Übersichtstabelle) 534 525/24 515 510 496 492
Thespis-Tragödie in die Dionysien aufgenommen (Peisisttatos) Aischylos geb. (Athen-Eleusis) Pratinas von Phleius (1. Sieg mit Satyrspiel) Phrynichos (1. Sieg) Sophokles geb. (Athen-Kolonos) Phrynichos, Miletou Halosis
484 480 476 472
Aischylos 1. Sieg [Phrynichos, Alkestis] [Phrynichos, Phoinissen] (Phineus) Perser (Glaukos Potnieus) (Prometheus Pyrkaieus)
468 467 465/59 ?
458 456/55 455 450er Jahre 447/445 442 (?) 441 438 438 (?) 434/32 431 430 (?) 428
Sophokles
Eurípides Aristophanes •484 od. 480 (Salamis)
1. Sieg (Laios) (Oidipus) Sieben gegen Theben (Sphinx) Hiketiden (Aigyptioi) (Danaïden) (Amymone) Prometheus Desmótes (Prometheus Lyómenos) (Prometheus Pyrphöros) Agamemnon Choephoren Eumeniden (Proteus) gest. in Gela (Sizilien) 1. Aufführung (Peliaden) Aias geb. (Athen-Kydathen) Antigone 1. Sieg (Kreterinnen) (Telephos) (Alkmeon in Psophis) Alkestis Trachinierinnen Oidipus Tyrannos Medeia (Philoktet) (Diktys) (Theristai) Herakliden Hippolytos
498
Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie' Aischylos
426 (?) 425 [Lenäen] 425 (?) 424 424 (?) 423 422 421 vor 417 417 (?) 416 (?) 415
Sophokles
Euripides Hekabe
Aristophanes l.Sieg: Acharner
Andromache Ritter[Lenäen] Hiketiden Erechtheus
Wolken [Dionysien] Wespen [Lenäen] Frieden [Dionysien]
Elektro Elektro Herakles (Alexandres) (Palamedes) Troerinnen (Sisyphos) Vögel [Dionysien] Ion Iphigenie bei den Taurern Helena (Andromeda) Thesmophoriazusen Lysistrate (Antiope ?) (Hypsipyle ?) Phoinissen
414 414 (?) 413 (?) 412 411 410/09(?) 409 408 408 (?) 406 406/00
Philoklet
405 401 392 388 385
gest. io Athen Oidipus auf Kolonos
Orest Kyklops gest. in Pella Iphigenie in Aulis (Allaneon in Korinth) Bakchen Frösche [Lenäen]
Ekklesiazjusen [Lenäen] Piatos gest. unecht: Rhesos (4. Jh. ?)
4. Zur lateinischen Literatur
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 2, 1976, 119-134
Zum Musen-Fragment des Naevius* Von den 65 in Strzeleckis1 Teubneriana als echt anerkannten Naevius-Fragmenten scheint kaum eines weniger problematisch zu sein als das unter der Nummer 1 geführte2: novem Iovis concordes
filiae
sórores
Der Schein trügt jedoch. Weder die Position noch die Funktion des Verses sind geklärt. Sicher ist nur eines: mit den 5 assoziationsreichen Wörtern dieses Sa-
Für wertvolle Anregungen danke ich Egert Pöhlmann (Vandoeuvres 1975). Bibliographische Abkürzungen: ANRWI 2 Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, hrsg. v. Hildegard Temporini, Teil I Band 2: Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik, Berlin - New York 1972 Barchiesi M. Barchiesi, Nevio Epico, Padua 1962 V. Buchheit, Vergil über die Sendung Roms. Untersuchungen Buchheit zum Bellum Poenicum und zur Aeneis, Heidelberg 1963 (Gymnasium-Beiheft Nr. 3) Jocelyn, Ennius H. D. Jocelyn, The Poems of Quintus Ennius, in: A N R W I 2, 987-1026 Lausberg H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, München 2 1963 Leo, Lit.-Gesch. F. Leo, Geschichte der Römischen Literatur. I 2 Berlin 1913 Leo, Plaut. Forsch. F. Leo, Plautinische Forschungen, Berlin 2 1912 Leo, Sat. Vers F. Leo, Der Satumische Vers, Berlin 1905 Mariotti, Bell. Poen. S. Mariotti, II Bellum Poenicum e l'arte di Nevio, Rom 2 1969 Mariotti, Liv. Andr. S. Mariotti, Livio Andronico e la sua tradizione artistica, Mailand 1952 Marmorale E. V. Marmorale, Naevius Poeta, Florenz 2 1953 Mazzarino Cn. Naevii Belli Poenici carminis fragmenta coll. A. Mazzarino, Messina (1966) 2 1973 Mocker G. B. Mocker, De Musis a poetis Graecorum in componendis carminibus invocatis, Diss. Leipzig 1893 Morel Fragmenta Poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium ed. W. Morel, Leipzig 2 (1927) 1963
502 120
Zum Musen-Fragment des Naevius
tumiers I sind die „spezifisch hellenischen"3 Gestalten der Muserà umschrieben. Dies sichert dem Vers nun allerdings von vornherein und unabhängig von seiner Bedeutung im Werkganzen ein besonderes Interesse zu. Denn im letzten Jahrzehnt des 3. Jh. v.Chr., als Naevius sein Epos dichtete und Literatur in lateinischer Sprache noch keineswegs eine Selbstverständlichkeit war - ihr Geburtsjahr lag gerade eine Generation zurück, und ihre bisherigen Rezipienten waren eher als Theaterbesucher auf Unterhaltung aus denn als Leser auf Belehrung - , in dieser Frühphase der Literaturentwicklung also in so exquisit anspruchsvoller lateinischer Umschreibung von den Μοΰσαι zu reden, das bedeutete nicht nur die Umsetzung eines komplizierten Stückes literarisierter griechischer Mythologie ins Römische, sondern darüber hinaus die immanente Aufforderung, ein Kernstück griechischer Reflexion über das Zustandekommen von Literatur als
Müller, Ennius - Naevius
Q. Enni carminum reliquiae. Acc. Cn. Naevi Belli Poenici quae supersunt, emend. et adnot. Lucianus Mueller, Petersburg 1884 Richter W. Richter, Das Epos des Gnaeus Naevius, Nachrichten Akad. Göttingen 1960, 41-66 Skutsch, Studia Enniana O. Skutsch, Studia Enniana, London 1968 Strzelecki Cn. Naevii Belli Punici carminis quae supersunt ed. W. Strzelecki, Leipzig 1964 Suerbaum W. Suerbaum, Untersuchungen zur Selbstdarstellung älterer römischer Dichter. Livius Andronicus - Naevius - Ennius, Hildesheim 1968 (Spudasmata 19) Traina A. Traina, Vortit barbare. Le traduzioni poetiche da Livio Andronico a Cicerone, Rom 1970 Warmington Π Remains of Old Latin, newly ed. and transi, by E. H. Warmington. Π: Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius, London (1936) 1961 Waszink, Anfangsstadium J. H. Waszink, Zum Anfangsstadium der römischen Literatur, in: ANRWI 2, 869-927 Waszink, Camena J. H. Waszink, Camena, C&M 17, 1956, 139-148 (Mélanges Carsten H0eg) Livius zähle ich nach Morel, Naevius nach Strzelecki, Ennius nach Vahlen 2 . 2 „Über Fr. 1 Mor. (die Anrufung oder wenigstens die Erwähnung der Musen) ist in der Berichtszeit" (d. h. seit 1962, s. S. 905) „nichts Neues geschrieben worden": Waszink, Anfangsstadium 911. Spezialstudien zu dem Fragment gibt es m. W. auch vor 1962 nicht. 3 Mayer, Musai, RE XVI (1933) 681. Vgl. W. F. Otto, Theophania, (Hamburg 1956) Frankfurt/M. 1975, 26: „Die Muse ist eine Gestalt, derengleichen keinem anderen Volk in der Welt erschienen ist." ^ Vgl. unten Anm. 38.
Zum Musen-Fragment des Naevius
503
solcher nachzuvollziehen 5 . Für die Bewertung der Rolle des Naevius und seiner Dichtung innerhalb der Geschichte der römischen Literatur wäre es wichtig zu wissen, ob diese Aufforderung zu diesem Zeitpunkt lediglich eine Wiedererinnerung für seine Leser darstellte oder eine Überraschung; anders gesagt: hat Naevius mit seinem Musenvers lediglich im Vorübergehen auf Vorstellungen von Dichtung, vom Dichten und von der Würde des Dichters angespielt, die in Rom um das Jahr 200 herum bereits zum Bildungsbesitz gehörten, oder hat er diese Vorstellungen als erster in Rom eingeführt, genauer: auch für die entstehende lateinische Literatur verbindlich zu machen gesucht? Träfe das zweite zu, so wäre Naevius nicht nur Roms erster schöpferischer Dichter, sondern auch - vor Ennius - so etwas wie sein erster Dichtungstheoretiker. Zu der außergewöhnlichen geistigen Beweglichkeit und Produktivität dieses Mannes würde das passen. Ob die Analyse des Musen-Fragments allein diese Frage entscheiden kann, mag man bezweifeln, wohl aber stellt sie die Voraussetzung dafür dar. *
Die Möglichkeit, daß mit dem Vers mehr intendiert war als ein bloßer Rekurs auf ein Stück Bildungsgut, entfiele sofort, wenn es wahrscheinlich wäre, daß der Vers schon das Ganze der Aussage über die Musen bildete. Wenn das Wort Musae, das der Vers selbst ja nicht enthält, nicht in unmittelbarem logischen Zusammenhang mit dem Vers - vor ihm oder nach ihm - fiel, dann war der Vers nicht mehr als eine Periphrasis in der Funktion entweder einer Antonomasie (Beispiel: A 9 Λητούς και Διός υιός = Apollon) oder einer mythologischen .Anspielung'. I Die .Anspielung', die zum Grenzverschiebungstropus der Emphase gehört, 121 wird von Lausberg folgendermaßen definiert: „Die Figur" (sc. die Emphase) „wird vom Redenden angewandt entweder mit der durch die Gefährlichkeit der Rede-Situation [...] bedingten ernsthaften Absicht, das Verständnis des eigentlichen Gedankens beim Hörer zu verhindern [... ] oder mit der spielerischen Absicht, dem Hörer eine ihn befriedigende eigene
5
Zum ,poetologischen' Symbolgehalt der Μοΰσαι s. neben Mayer (oben Anm. 3) 681 vor allem W. F. Otto, Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens, Darmstadt 3 1971, besonders 31-35; K. v. Fritz, Das Proömium der hesiodischen Theogonie, (Festschrift Snell, München 1956), in: Hesiod, hrsg. v. E. Heitsch, Darmstadt 1966, 313. 304; E. Siegmann, Zu Hesiods Theogonieproömium, (Festschrift Kapp, Hamburg 1958), in: Hesiod (wie oben), 322; K. Deichgräber, Die Musen, Nereiden und Okeaninen in Hesiods Theogonie, Abh. Mainz 1965, 178-181; M. P. Nilsson, Gesch. d. griech. Rei. I 3 , München 1967,253.
504
Zum Musen-Fragment des Naevius Denkleistung zwecks Erreichung des Verständnisses des eigentlichen Gedankens zuzumuten. Diese spielerische Absicht heißt .Anspielung' (significatici, suspicio et figura; υπόνοια, συνέμφασις) und dient bald der verfremdenden Dunkelheit des ornatus [...], bald dem Scherz [...]. - Die Anspielung wird auch gerne als Probe des Hörers auf den Bildungsbesitz benutzt [...]".
In beiden Fällen - Antonomasie oder Anspielung - würde der Begriff Μοΰσαι durch die Periphrasis ersetzt, würde als solcher also gar nicht mehr fallen. Wäre Naevius so verfahren, dann wäre die Annahme einer besonderen Relevanz des Musen-Fragments im oben angedeuteten Sinne gegenstandslos. Daß er so verfahren sein sollte, ist jedoch nicht wahrscheinlich. Denn die nackte Periphrasis ,neun Iupitertöchter, einträchtige Schwestern' hätte eine Verrätselung (dis simulât io: Lausberg § 428) des Begriffes dargestellt,wie sie nach unserem Wissen noch nicht einmal in der griechischen Literatur gängig war6, den Lesern des ersten originalen epischen Kunstwerks in latei-
6
Der Musenanruf erfolgt im antiken Epos regelmäßig mittels des Vokativs des eigentlichen Musennamens (Μοΰσα[ι], Musa[é\) oder eines Äquivalents (ζ. Β. θεά A 1, α 10; dea Lucr. 1,6; diva Stat. Achill. 1,3; deae Stat. Theb. 1,4; das Material bei Mocker 18 f.). Ersatz des Musennamens durch bloße Umschreibung - also auch ohne Nennung des Musennamens im unmittelbaren Kontext des Umschreibungsverses - ist, soweit ich sehe, in keinem Falle sicher belegt: Der am ehesten vergleichbare Eumelos-Vers (Fr. 16, S. 195 Ki.) Μνημοσύνης και Ζηνός 'Ολυμπίου έννεα κοΰραι - schon in sich weniger stark verrätselt infolge der für griechische Ohren klärenden Anfangsstellung von Μνημοσύνης - hatte, wie sich aus der Nachahmung bei Solon 1,1 f. D. Μνημοσύνης καί Ζηνός 'Ολυμπίου άγλαά τέκνα, Μοΰσαι Πιερίδες... (seinerseits nachgeahmt vom Dichter des Orphischen Hymnus LXXVI, s. Mocker 21) schließen läßt, das Wort Μοΰσαι wahrscheinlich im unmittelbaren Kontext, bildet also wohl eher eine Stütze der oben vorgetragenen Rekonstruktion. - Das gleiche gilt grundsätzlich für den Antimachos-Vers (Fr, 1 , S. 276 Ki.) Έννέπετε Κρονίδαο Διός μεγάλοιο θύγατρες: nicht nur denkt der Grieche hier beim Lesen, wie die Scholiasten mit ihrer Zitation des Verses zu A 1 verraten, schon wegen des Verbs έννέπω sofort an einen Musen-Anruf, - auch hier wird außerdem das Wort Μοΰσαι wahrscheinlich nachgefolgt sein (vorangegangen kann es wegen Eustaths Zitierweise nicht sein); darauf führt ein Vers wie hymn. Horn. ΧΧΧΠ 2: ήδυεπεΐς κοΰραι Κρονίδεω Διός ϊστορες φδης, der auf den ersten Blick kaum weniger komplett erscheint als der Antimachos- und der Eumelos-Vers und dem dennoch ein Μήνην άείδειν τανυσίπιερον εσπειε Μ ο ΰ σ α ι vorangeht. - Zusammenfassend darf man sagen, daß versfüllende Musenumschreibungen ohne Nennung des Wortes Μοΰσαι (oder eines Äquivalents) im gleichen Vers (1) nicht nur im griechischen Epos, sondern in der gesamten griechischen Dichtung verschwindend geringe Ausnahmen sind (vgl. das allein für das Epos erdrückende Material bei Mocker 15-17),
Zum Musen-Fragment des Naevius
505
nischer Sprache also noch viel weniger zugemutet werden konnte, - es sei denn, ihre Entschlüsselung wäre durch eine zentrale einschlägige Informationsstelle gerade innerhalb der jungen lateinischen Literatur vor dem .Bellum Punicum' garantiert gewesen. Aber auch dies ist unwahrscheinlich. Denn sieht man von den Theaterstücken ab - die erstens kaum Gelegenheit zu ausführlicherer Explikation des Gesamtkomplexes der griechischen Musenvorstellung gegeben haben dürften und zweitens jedenfalls nicht als allgemein verbreiteter Lesestoff in der Hand I des Publikums vorausgesetzt werden konnten7 - , so konnte als Bezugs- 122 punkt nach ihrem Bekanntheitsgrad eigentlich nur Livius' ,Odusia' in Frage kommen. Livius aber hatte - soweit ersichtlich - die Μοΰσαι als Musae gar nicht eingeführt. *
Livius hatte sein Ziel, die griechische 'Οδύσσεια in Rom heimisch zu machen, zu erreichen gesucht durch eine Übersetzungsmethode, die möglichste Wörtlichkeit mit möglichster Klarheit verband8. Das Prinzip der Wörtlichkeit stieß für ihn dort an seine Grenzen, wo seine konsequente Durchführung für den römischen Leser zu Verständnisschwierigkeiten geführt hätte. Das war immer dann der Fall, wenn griechische Begriffe einerseits wegen ihres spezifisch griechischen Assoziationsgehalts unübersetzbar waren, andererseits bei einfacher Übernahme durch Transkription - als höchste Form der Wörtlichkeit - ohne erläuternden Kommentar unverstanden oder halbverstanden geblieben wären9. Eine besondere Gruppe solcher Begriffe bildeten für Livius die zu seiner Zeit in Rom noch nicht eingebürgerten griechischen Götternamen. Hier setzte er die schon lange vor ihm 10 außerhalb der Dichtung geübte Praxis fort, nicht zu transkribieren, sondern Äquivalente aus der nationalrömischen Religion und Mythologie einzusetzen - übernommene oder von ihm selbst festgesetzte. Zu dieser
(2) nach aller Wahrscheinlichkeit regelmäßig durch Nennung des Wortes Μοΰσαι (oder eines Äquivalents) im unmittelbaren Kontext erhellt wurden. 7 Leo, Lit.-Gesch. 56. 260. 8 Vgl. Mariotti, Liv. Andr. 71 f. 36. 9 Klar erkannt ist dieses Übertragungsprinzip auch von Mariotti (Liv. Andr. 2 6 - 3 5 ) noch nicht; aber in einem Satz wie dem folgenden ist es impliziert: „Nell'assenza daü'Odyssea di grecismi lessicali di origine letteraria, può sorprendere il fatto che, mentre 'Οδυσσεύς diventava italicamente Ulixes, all'Odissea sia stato conservato il titolo nella forma originale, anche se questo era certo già noto al pubblico colto romano." (30, Hervorhebung von mir). 10 Leo, Lit.-Gesch. 74; Mariotti, Liv. Andr. 26.
506
Zum Musen-Fragment des Naevius
Gruppe gehörte auch Μοΰσαι 11 . Dies läßt sich deswegen mit nahezu absoluter Gewißheit sagen, weil unter den kargen Livius-Resten zwei Stellen überliefert sind, an denen die einfache Transkription von Μοΰσαι vermieden ist. Hätten wir nur Fr. 1 : virum mihi, Camena, insece versutum, so müßte damit gerechnet werden, daß künstlerische Erwägungen die Vermeidung der Transkription ,Musa' nahelegten; denn die hier im Eingangsvers des Gesamtwerks natürlicherweise angestrebte Idealform des Saturniers 12 W W W / W W mit der verfugenden gegenläufigen Silben Verteilung 2 2 3 3 3 war, wenn das Prinzip möglichster Wörtlichkeit mit seinen Teilkomponenten Wortanzahl und Wortfolge13 nicht schon zu Beginn durchbrochen werden sollte, bei Verwendung von Musa nicht zu realisieren; Camena war da die ideale Lösung - damit aber auch möglicherweise gar nicht bewußte Umsetzung eines Übertragungsgrundsatzes, sondern nur glücklicher Augenblickseinfall. I 123 Diese Erklärung scheidet aus an der zweiten der beiden Stellen: Fr. 23. Die Odysseestelle θ 480/481 οϋνεκ' αρα σφέας / οίμας Μοΰσ' έδίδαξε mußte aus künstlerischen Gründen durchaus nicht mit nam diva Monetas filia docuit wiedergegeben werden. Die Idealform des Saturniers, wie sie auch hier wieder vorliegt, wäre an dieser Stelle, die wegen ihrer unauffälligeren Position im Werkinneren viel weniger nach strikter Durchführung des Wörtlichkeitsprinzips verlangte als der Eingangsvers, durchaus auch bei Verwendung des transkribierten Musa zu erreichen gewesen. Wenn sich Livius auch hier gegen die Transkription und für die Setzung eines Äquivalents entschied, so darf das als Beweis dafür gelten, daß er den komplexen Bedeutungs- und Assoziationsgehalt, den das griechische Μοΰσα - gerade auch an dieser Odysseestelle - hat, bei seinen römischen Lesern nicht voraussetzen zu können glaubte: wenn er die Kühnheit der etymologisierenden Umschreibung ,diva Monetas filia ' - also .göttliche
11
Daß Livius das Äquivalent Camenae festgesetzt habe, wird zwar heute allgemein angenommen (s. zuletzt Waszink, Anfangsstadium 887: die Casmenas-Steüe aus dem .Carmen Priami' sei endgültig als nachennianisch erwiesen), - beweisbar ist es aber natürlich nicht. 12 Zu den metrischen Fragen am ausführlichsten Barchiesi 294-327, hier bes. 327. 319. Pighis typographisch schwierige Notation übernehme ich nicht; W = ,Wort' (in Anlehnung an De Groots ,word verse'). 13 Vgl. Mariotti, Liv. Andr. 35 f.
Zum Musen-Fragment des Naevius
507
Erinnerin-' oder ,Eingeberin-Tochter' 14 - in Kauf nahm, dann muß es für ihn festgestanden haben, daß etwa der im Μοΰσα-Begriff dieses Odysseeverses zentrale Aspekt der Inspiration aus einem einfach transkribierten Musa vom römischen Normalleser nicht hätte herausgefühlt werden können. Fr. 23 beweist also, was Fr. 1 allein nicht beweisen könnte: Livius hat ,Musa ' nicht zufällig, sondern absichtlich vermieden. Sein Motiv dafür war die Überzeugung, einem römischen Gebildeten seiner Zeit, mochte er auch durchaus imstande sein, ein sprachlich und künstlerisch so anspruchsvolles 15 lateinisches Wortkunstwerk wie die ,Odusia' zu lesen und zu verstehen, könne die für den Dichter selbst als geborenen Griechen selbstverständliche Bedeutung von Μοΰσα(ι) nicht oder nicht voll zugänglich sein 16 . Wann Livius die ,Odusia' publizierte, wissen wir nicht. Die in modernen Handbüchern17 geäußerte Vermutung, Livius habe schon in frühen Jahren womöglich I noch vor seiner Berufung zum Festspieldichter des Jahres 240 seinen Schülern aus ihr vorgelesen, kann das Richtige treffen, aber für das Datum der Veröffentlichung in Buchform - auf die es in unserem Zusammenhang ankommt - ist damit nichts gewonnen. Leo hat die Buchpublikation mit großer innerer Wahrscheinlichkeit als den krönenden Abschluß einer längeren Vorlesungsphase angesehen 18 , das heißt, sie wird eher später als früher in Livius' Lebenszeit anzusetzen sein (der terminus ante quem ist wohl 207, als die Decemvirn den Dichter mit der Abfassung des offiziellen Sühneliedes beauftragten). 14
Vgl. Leo, Lit.-Gesch. 74; Mariotti, Liv. Andr. 30. Mariottis (45) Erklärung, die Substitution von Götternamen durch Umschreibung mit filius/filia erfolge bei Livius aus stilistischen Gründen (so schon Leo, Plaut. Forsch. 91), ist richtig, aber kaum ausreichend. Eine Neuprägung wie Monetas filia - wobei Moneta eine spontan verstehbare Volksetymologie ist (Walde-Hofmann Π 108) - war zur Stilerhöhung viel weniger geeignet als zur Sinnverdeutlichung; Traínas Behauptung (13): „Ma è un'identificazione, per così dire, etimologica, che parte dal nome più che dalle funzioni del dio" trifft m. E. auf die Moneta-Stelle gerade nicht zu: der Griff nach Moneta war gerade durch die Funktion der Muse an der Odysseestelle έδίδαξε ~ docuit) veranlaßt; dasselbe Motiv lag ja letztlich wohl auch der Wiedergabe von Μούσα α 1 durch Camena zugrunde: Waszink, Camena 142 f., und zustimmend Suerbaum 9 Anm. 24. Zusammenfassend zur Frage jetzt Waszink, Anfangsstadium 887 („sehr wohlüberlegte Übersetzungen"). Die zeitweilige - historisch wie ästhetisch undurchdachte - Geringschätzung des Livius ist wohl durch Mariottis Livius-Buch überwunden; vgl. jetzt Waszink, Anfangsstadium 885 f. 872. 874 (die ,Odusia' war keinesfalls „als Textbuch für seinen Unterricht gemeint"). ^ Skutsch, Studia Enniana 18, geht sicherlich zu weit, wenn er überlegt, ob „the name Musae" überhaupt vor Ennius ' Lebenszeit schon in Rom bekannt war; dazu unten Anm. 40. 17 Zum Beispiel Bieler, Lit.-Gesch. I 30; Klotz, Lit.-Gesch. 7; Schanz-Hosius I 4 46. 18 Leo, Lit.-Gesch. 56. 55; Plaut. Forsch. 88 Anm. 2; zustimmend Mariotti, Liv. Andr. 19 Anin. 1, und Büchner, Lit.-Gesch. 37; nicht überzeugend Waszink, Anfangsstadium 874 („das früheste Werk des Dichters").
508
Zum Musen-Fragment des Naevius *
Zwischen der Publikation der ,Odusia' und der des .Bellum Punicum' lag, wie es scheint, kein allzu großer zeitlicher Abstand. Dann aber spricht nichts dafür, daß Naevius sich im Hinblick auf die Geläufigkeit des Μοΰσαι-Begriffs bereits völlig anderen Verhältnissen im römischen Publikum gegenübergesehen hätte als sein Vorgänger Livius. Die geistigen Voraussetzungen für die Rezeption des griechischen Μοΰσαι-Begriffs waren durch Livius' Publikumserfolg eher noch ungünstiger geworden. Denn Livius hatte die Μοΰσαι dem römischen Publikum nicht nur femgehalten, sondern sie darüber hinaus durch lateinische Äquivalente ersetzt. Wer jetzt die Μοΰσαι in die lateinische Literatur einführen wollte, hatte nicht mehr nur ihre komplexe Bedeutung zu erklären, sondern zusätzlich noch ihre Identität mit ihren inzwischen eingebürgerten lateinischen Äquivalenten zumindest mit den Camenae - in die Erklärung einzubeziehen. In dieser Situation, in der dem römischen Normalleser aus der Lektüre noch nicht einmal der Begriff ,Musae' selbst geläufig war, konnte eine bloße Umschreibung des Begriffes in den rhetorischen Formen der Antonomasie oder der .Anspielung' noch viel weniger auf auch nur einigermaßen glattes Verständnis stoßen - und dies desto weniger, je voraussetzungsreicher die Periphrasis war 19 . Wie außergewöhnlich voraussetzungsreich aber gerade die Naevianische Periphrasis ist, das hat erst die Forschung der letzten Jahrzehnte gezeigt. Lucian Müllers Fehlurteil .aperta imitado Homeri' 20 hat den Blick für die Problematik der Periphrasis lange verstellt und war der Grund dafür, daß die Naevius-Philologie glaubte, mit Fr. 1 immer am schnellsten fertig sein zu dürfen. I 125 Von den drei Komponenten der Umschreibung: Neunzahl (novem), Iupiterabkunft (Iovis filiae), schwesterliche Eintracht (concordes sorores) finden sich bei Homer nur die ersten beiden, jedoch auch diese nicht zur Einheit eines GeDiese Schlußfolgerung ergibt sich aus dem Vergleich mit einer weit weniger voraussetzungsreichen Periphrasis wie der des Apollon in Fr. 20: nicht nur kann Naevius noch nicht einfach Arquitenens setzen, wie später Vergil (Aen. 3,75), - auch die Attribut-Häufung pollens sagittis inclutus arquitenens scheint ihm für das Spontanverständnis noch nicht ausreichend: er setzt in einem Erläuterungsvers eine weitere Verständnishilfe und schließlich noch die Auflösung selbst hinzu: sanctus love prognatus Pythius Apollo-, daß er ,neun Iupitertöchter, einträchtige Schwestern' für leichter verständlich gehalten haben könnte als ,pfeilgewaltiger hochberühmter Bogenhalter', ist nicht anzunehmen; das Motiv für die Attribut-Häufung aber in reinem Ausschmückungsstreben zu sehen, widerrät die große Mühe, die derartige Epitheton-Latinisierungen, zumal unter den hohen Versifizierungsanforderungen des Saturniers, gemacht haben dürften; das wesentlich stärkere Motiv, Griechisches durch umfassende Erklärung einzubürgern, macht diese Mühe eher begreiflich. 20 Müller, Ennius - Naevius 249 (vgl. ΧΧΠ: „cum imitatione Homeri manifesta").
Zum Musen-Fragment des Naevius
509
samtbegriffs verschmolzen wie bei Naevius, sondern auf zwei weit auseinanderliegende Stellen in Ilias und Odyssee verteilt: die Iupiterabkunft erscheint im Verlaufe des ausführlichen Musenanrufs der Schiffskatalog-Einleitung Β 484 ff. (εί μή 'Ολυμπιάδες Μοΰσαι, Διός αΐγιόχοιο / θυγατέρες Β 491 f.), die Neunzahl in der Rede der ψυχή' Αγαμέμνονος in der 2. Nekyia (Μοΰσαι δ' έννέα πάσαι άμειβόμεναι όπί καλή / θρήνεον ω 60). Der Akzent, der bei Naevius auf diesen beiden Komponenten liegt und sie zu Definitionskonstituenten werden läßt, fehlt bei Homer ganz und gar. Für Homers Musenbegriff ist weder das genealogische noch das numerische Moment konstitutiv, viel eher noch das des Wohnsitzes ("Εσπετε νυν μοι, Μοΰσαι, 'Ολύμπια δώματ' εχουσαι Β 484. Λ 218. Ξ 508. Π 112). Genealogie und Anzahl sind mehr akzidentelle Merkmale, die daher nur nebenbei und an dementsprechend unauffälligen und .zufälligen' Stellen der Epen erwähnt werden.,concordes' schließlich und ,sorores' haben bei Homer überhaupt kein Gegenstück. Die Homerische Musenvorstellung ist also im Vergleich zur Naevianischen (1) informationsärmer - es fehlt ihr die besondere Qualifikation (concordes) und die Verwandtschaftsbetonung (sorores) - , und sie ist (2) präzisionsärmer - weder die Zahl ist für sie konstitutiv noch die Genealogie (novem, Iovis filiae). Diese Anzeichen - mehr Information, mehr Präzision, also mehr System hätten schon L. Müller auf jenen Autor als Quelle der naevianischen Musenumschreibung führen können, den erst 10 bzw. 50 Jahre später - unabhängig voneinander und im Vorübergehen - Mocker und M. Mayer 21 ausfindig machten und den wiederum 20 Jahre später Mariotti 22 in die Naevius-Philologie einführte: auf Hesiod. Daß Naevius die Theogonie-Verse 60 ή δ ' (Mnemosyne)ετεκ'έννέα κ ο ύ ρ α ς ό μ ό φ ρ ο ν α ς und 76 έ ν ν έ α θ υ γ α τ έ ρ ε ς μεγάλου Δ ι ό ς έ κ γ ε γ α υ ί α ι mit seiner Umschreibung kombiniert hat (mit der seit Livius für die SaturnierTechnik gebräuchlichen Distanz-Kontamination 23 ), hat Mariotti zweifelsfrei nachgewiesen. Seine Ansicht jedoch, der Herkunftsort dieser Kombination: Hesiods Theogonieproömium, habe vom „gelehrten Leser" ohne weiteres identifi21
Mocker 24 Anm. 1; M. Mayer, Musai, RE XVI (1933) 706. Bell. Poen. 53-56. 23 „Contaminazione a distanza": Mariotti, Liv. Andr. 47 Anm. 1, in Aufnahme einer Andeutung Leos, Plaut. Forsch. 91; weitere Beispiele bei Mariotti, Bell. Poen. 55 Anm. 22. - Zu sorores („suggerito istintivamente dal contesto") Mariotti, Bell. Poen. 55 mit Anm. 19. 22
510
Zum Musen-Fragment des Naevius
ziert werden können 24 , bedarf der Modifizierung: selbst .gelehrten Lesern' falls solche als reguläre Adressaten des gelehrten Dichters Naevius überhaupt angenommen werden dürfen (wie unwahrscheinlich diese Annahme ist, wurde zu zeigen versucht) - , selbst ihnen wäre der Vollzug der von Naevius intendierten Identifikation nicht spontan möglich gewesen, wenn der Musenvers in sei126 nem I ursprünglichen Kontext innerlich ebenso zusammenhanglos gewesen wäre, wie er sich heute uns in unseren Fragmentsammlungen darbietet; denn wenn die Idee, den Naeviusvers auf die Hesiodstelle zu beziehen, nach dem Wiederauftauchen des Verses rund 400 Jahre zu ihrer Geburt gebraucht hat 25 - und das im Kreise der nicht nur .gelehrten', sondern professionellen modernen NaeviusLeser - , wenn es also unter den Kennern der antiken Literatur in moderner Zeit rund 400 Jahre gedauert hat, bis die Anspielungsabsicht des Naevius begriffen wurde, so liegt das daran, daß der Vers in seiner heutigen Gestalt eben nicht evident auf Hesiod weist; das aber bedeutet, daß der Vers in seinem ursprünglichen Zusammenhang jene syntaktisch-semantische Autarkie, die er heute ausstrahlt und die ihn statt als Torso als eine Art gesättigte Verbindung erscheinen läßt, nicht besessen haben kann, sondern daß er - bevor er zu metrischem Demonstrationszweck herausgebrochen wurde - fest in einen Sinnzusammenhang hineingebunden gewesen sein muß, der die Identifikation seines Anspielungszieles erleichterte, und das heißt: der ihn erläuterte. Auch von hier aus - vom Voraussetzungsreichtum der Periphrasis her - ist demnach deutlich, daß sich die Funktion des Verses nicht darin erschöpft haben kann, bloße Umschreibung des mythologischen Begriffs Μοΰσαι zu sein. *
Damit wird nun ein - zunächst negativer - Schluß auf die Position des Verses möglich: wenn der Vers auf Grund seines Voraussetzungsreichtums zu seinem Verständnis eines erläuternden Kontextes bedurfte und demgemäß von vornherein auf mehr und anderes angelegt war als auf bloße Umschreibung des Musenbegriffs, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß er als Proömiumseinleitung den Eingangsvers des Epos bildete, relativ gering. Spielerisch verrätselte vers24
Mariotti, Bell. Poen. 56. Die editio princeps des Caesius Bassus, der den Musenvers überliefert, erschien - besorgt von Parrhasius - im Jahre 1504 (s. Barchiesi 146 Anm. 801); von diesem Zeitpunkt an war der Vers - auch wenn ihn die Naevius-Erstausgabe der beiden Stephanus (Robert und Henri Estienne, Paris 1564: Barchiesi 172) noch nicht enthielt (Barchiesi 173 Anm. 973) - den Philologen zugänglich.
Zum Musen-Fragment des Naevius
511
füllende Musenumschreibungen, auch wenn sie durch unmittelbar nachfolgendes Μοΰσαι .aufgelöst' wurden, stellten als Werkeingangsverse schon in der griechischen Tradition die Ausnahme dar (s. oben Anm. 6). Naevius, der sich ganz anderen Rezeptionsbedingungen gegenübersah und die Voraussetzungen für ein Spiel mit mythologischen Begriffen überhaupt erst schaffen mußte (oben S. 508 mit Anm. 19), kann es einerseits schwerlich gleich mit dem ersten Vers auf raffinierte Übertrumpfung griechischer Künsteleien abgesehen haben, andererseits wird er sein Epos schon aus künstlerischem Instinkt kaum statt mit einer Musen-Invocatio mit einer Musen-Explanatio begonnen haben. Damit ist durch innere Indizien gestützt, was Leo 26 seinerzeit aus dem äußeren Indiz der Zitierweise bei Caesius Bassus (et alio loco) erschlossen hatte: „Naevii carmen ab hoc versu coepisse minime constat" (Morel)27.1 Wenn der Vers aber nicht am Werkbeginn stand, wo dann? Von den verschiedenen Versuchen, ihn dem Proömium des Gesamtwerks überhaupt abzusprechen und ihn an irgendeine Stelle ins Werkinnere zu versetzen (s. Barchiesis Referat 510f.), überzeugt keiner. Daß der Vers an irgendeiner .zufälligen' Stelle gestanden haben könnte, so wie der Vers ω 60, das scheint auf Grund seiner oben erschlossenen ursprünglichen Zugehörigkeit zu einem größeren .Musenzusammenhang' ausgeschlossen. Seine ausgefeilte strukturelle Vollkommenheit, derentwegen er ja von Caesius Bassus zitiert wird (auch hier wieder W W W / W W + 2 2 3 3 3 , dazu Binnenalliteration des o 28 , Homoioteleuton concordes sorores29, zweifaches Hyperbaton: Iovis - filiae und concordes - sorores30), stellt ein zusätzliches Gegenargument dar. Eine ursprüngliche Position an werkstrukturell herausragender Stelle ist danach das Natürliche. Solche Stellen sind im antiken Epos die Neueinsätze - in der Regel gleichbedeutend mit Proömien - und die Sphragis. Wo überall im .Bellum Punicum' 26
Sat. Vers 16 Anm. 3. Ein weiteres Argument gegen die Anfangsstellung des Verses ergibt sich, wie mir scheint, aus Varrò r.r. I 1,4 quoniam ut aiunt deifacientes adiuvant, prius advocabo eos nec ut Homerus et Ennius Musas, sed duodecim deos consentis: dieser Satz wurde wahrscheinlich im J. 37 geschrieben, d. h. etwa 10 Jahre, nachdem sich Varrò in ,De poetis' und ,De poematis' intensiv nicht nur mit Ennius, sondern auch mit Livius Andronicus und Naevius beschäftigt hatte (zur Datierung s. Dahlmann, RE Suppl. VI [1935] 1186; ders., Studien zu Varros ,De poetis', Abh. Mainz 10, 1962, 654; ders., Varros Schrift ,De poematis', Abh. Mainz 3, 1953, 89). Es ist unwahrscheinlich, daß Varrò unter diesen Umständen den Brauch der Museninvokation am Werkbeginn nicht auch mit Naevius exemplifiziert hätte,wenn Naevius tatsächlich so begonnen hätte. 28 Offenbar bisher übersehen, s. die Liste bei Mariotti, Bell. Poen. 79-81. 29 Mariotti, Bell. Poen. 78 Anm. 47. 30 Mariotti, Bell. Poen. 81 Anm. 55. 27
512
Zum Musen-Fragment des Naevius
Naevius Proömien oder proömienartige Neueinsätze gehabt hat, können wir natürlich nicht wissen. Daß der historische Teil des Epos - mit welchem der von Lampadio abgeteilten Bücher er auch begann - durch ein Proömium eingeleitet wurde, ist möglich, daß jedoch Naevius gerade zur Bezeugung derjenigen von ihm berichteten Ereignisse, die in die Helligkeit seiner eigenen Gegenwart fielen, die Musen zu Hilfe gerufen hätte, ist angesichts der uralten, auch nach Homer beibehaltenen entgegengesetzten epischen Tradition - Anrufung zur Verbürgung des vom Dichter nicht selbst Wißbaren - wenig wahrscheinlich. Der gesamte historische Teil darf also wohl bei der Suche nach der ursprünglichen Position des Musenverses ausgeklammert werden31. Ob das Epos des Naevius eine Schluß-Sphragis hatte, wissen wir nicht; wo ihm eine solche zugeschrieben wurde, geschah dies allein zu dem Zweck, einen Ort für die bei Gellius überlieferte Varro-Notiz über Naevius' autobiographische Feststellung seiner Kriegsteilnahme zu finden32. Der Raum für die Lokalisierung des Musenverses engt sich somit weiter ein. Es scheint, daß nur der mythische Teil (die Archaeologie) ernsthaft in Frage kommt, das heißt, eine Stelle innerhalb der (höchstenfalls) 3 ersten Bücher. Ob innerhalb dieser mythischen Vorgeschichte des Kriegsberichtes, die auf Grund ihrer aitiologischen Funktion für das Hauptthema der welthistorischen Konfrontation Rom - Karthago eine einzige blockartige Einheit gebildet haben muß, noch Raum für eine Zäsur war, wie sie ein ßi««enproömium darstellt, kann bezweifelt werden; vom Inhalt her wäre dies allenfalls vor dem Einsatz des eigentlichen mythologischen Konfrontations-Aitions, also der Aeneas-Dido-Be128 gegnung, I sinnvoll gewesen; diese aber hat mit Sicherheit bei Naevius nicht den Umfang und damit das strukturelle Sondergewicht gehabt, das ihr später Vergil gab: in einem .Bellum Punicum' war ja die Aeneas-Dido-Beziehung als Präfiguration der werkzentralen Rom-Karthago-Beziehung erzähllogisch viel selbstverständlicher verankert als in einer ,Aeneis\ tendierte daher in diesem eher pragmatischen Zusammenhang viel weniger zu dramatischer Verselbständigung und bedurfte infolgedessen auch kaum einer besonderen Hervorhebung durch eine eigene Einleitung33.
31
Vgl. Barchiesi 511. Weniger einleuchtend Richter 56 Anm. 3. Siehe Suerbaum 22 Anm. 65; 26 Anm. 79. 33 Die Dido-Frage ist im einzelnen hier nicht zu erörtern; die neueste Doxographie (Waszink, Anfangsstadium 912-915) schließt mit dem - meines Erachtens richtigen - Fazit: „unmöglich [...], die Gestalt der Dido - und ihr Liebesverhältnis zu Aeneas - aus dem .Bellum Poenicum' auszuschalten". 32
Zum Musen-Fragment des Naevius
513
Sind auf Grund dieser Erwägungen alle übrigen theoretisch möglichen Positionen des Musenverses als wenig wahrscheinlich ausgeschlossen, so sprechen auf der anderen Seite starke Indizien für ein Werkei/igangiproömium als ursprünglichen Sitz des Verses. Das wichtigste dieser Indizien ist der Ursprungsort der im Musenvers von Naevius zusammengeschweißten Musen-Merkmale, Hesiods Musenhymnus: er ist ein Proömium. Das zweite Indiz ist der Beginn des Ennianischen Epos: wenn Ennius sein Proömium mit Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum, also einem - in diesem Falle evidenten - Zitat aus dem Hesiod-Proömium beginnt, so ist das am leichtesten als das erste Teilglied seiner dauernden Auseinandersetzung mit seinem großen Vorgänger Naevius zu verstehen34. *
Wenn der Musenvers demgemäß am wahrscheinlichsten in einem Proömium des Gesamtepos stand, ohne dieses jedoch einzuleiten35, worin bestand dann seine Funktion? Die eingangs durchgeführte Inhaltsanalyse hat ergeben, daß der Vers eine Periphrasis darstellt, die jedoch weder als Antonomasie noch als .Anspielung' fungiert haben kann, da die mit ihr gegebene Begriffsdefinition wegen ihrer Ungeläufigkeit die Identifikation des gemeinten Begriffs wenn nicht vereitelt, so doch ungemein erschwert hätte. Die Periphrasis wirkte mit ihrer dichten Merkmalsaufzählung selbst informierend; sie war also eine Periphrasis mit Erläuterungs- oder Aufklärungsfunktion. Solche Periphrasen treten in der Dichtung häufig auf als .glossierende Synonymie': „Die .glossierende Synonymie' ist die (manchmal vorgeschaltete, meist aber nachgeschaltete) Erläuterung (Quint. 8,2,13: interpretan) eines .dunkeln' Ausdrucks durch einen .klareren' Ausdruck. Der zu erläuternde dunkle Ausdruck kann sein: [...] 2) ein Fremdwort [...], das [...] durch einen Tropus [...], besonders Periphrase und Synekdoche, erläutert wird" (Lausberg § 284). I
Das Fremdwort, das Naevius - wenn er es geläufig machen wollte - zu erläutern 129 hatte, war Μοΰσαι. Ob es - in der transkribierten Form, Musae ' - vor oder nach dem Erläuterungsvers gestanden hat, ist nicht auszumachen; Naevius' Praxis in
34
Vgl. Strzelecki XX sq. So auch Strzelecki XXI; Marmorale 233; Warmington Π 46; dagegen .sedis incertae': Mariotti, Bell. Poen. 116 (= Fr. 51), Barchiesi 511. 557 (= Fr. 54), Mazzarino 56 f. (= Fr. LV). 35
514
Zum Musen-Fragment des Naevius
vergleichbaren Fällen 36 könnte auf Nachstellung deuten. Die Erläuterung selbst führte Naevius mittels einer Zusammenstellung von Musen-Merkmalen durch, für die er folgerichtig auf den locus classicus der griechischen Musenvorstellung zurückgriff: auf den Musenhymnus zu Beginn des mythologisch-theologischen Lehrgedichts des Hesiod. Der Rückgriff auf Hesiod erklärt sich also nicht einfach allgemein aus der .Berühmtheit' 37 der Theogonie, sondern spezieller als die logische Konsequenz der Erläuterungsabsicht, die Naevius verfolgte. *
Diese Erläuterungsabsicht war jedoch allein mit der wenn auch noch so merkmalreichen Information über die Musae' noch nicht voll erreicht, - selbst wenn die Information in Anlehnung an die Hesiodstelle durch Aufzählung von Kompetenzen, Aktivitäten oder gar Namen einzelner Musen noch fortgesetzt worden sein sollte. Die Erläuterung war erst dann vollständig, und die offensichtlich intendierte Einführung des Begriffs ,Musae' war erst dann abgeschlossen, wenn der von Livius verwendete Begriff, Camena ' zuvor verdrängt worden war. Dies konnte auf zweifache Weise geschehen: entweder durch refutatio des CamenenBegriffs oder durch explizite Gleichsetzung des Camenen-Begriffs mit dem Musen-Begriff. Es ist wahrscheinlich, daß Naevius den zweiten Weg gegangen ist. Denn die metaphorische Umschreibung der literarhistorischen Leistung gerade des Naevius in nachnaevianischer Zeit bedient sich auffalligerweise beider Musenbezeichnungen, bald des lateinischen ,Camenae', bald des griechischen ,Musa': (1) Im nachnaevianischen Grabepigramm auf Naevius (Fr. 64 M.) heißt es: Immortales mortales si foret fas Aere, fièrent divae Camenae Naevium poetam. Die Satumier spielen unzweifelhaft auf das Epos an. (2) An der sicher auf Naevius zu beziehenden bekannten Stelle aus dem nachennianischen literarhistorischen Lehrgedicht des Porcius Licinus dagegen heißt es (Fr. 1, p. 44 M.): 36
37
Vgl. Fr. 20:
dein pollens sagittis inclutus arquitenens sanctus love prognatus Pythius Apollo und Fr. 58: cum tu arquitenens, sagittis pollens Dea Fleckeisens Ergänzung Dea in Fr. 58 hat Strzelecki, Eos 49, 1957/58, 65-68, überzeugend gesichert. ' „11 proemio della Teogonia era famoso ...": Mariotti, Bell. Poen. 56.
Zum Musen-Fragment des Naevius
515
Poenico bello secundo Musa pinnato gradu intulit se bellicosam in Romuli gentem feram. Auch hier muß das Epos gemeint sein: die TheaterptoáuVüon des Naevius hatte ja lange vor dem 2. Punischen Krieg begonnen. Suerbaum (304) hat die Ausdrucksweise des Porcius Licinus als „[...] im Gegensatz zu der des Grabepigramms (Musa statt Camena) [...] unpräzise" bezeichnet. Näher scheint eine andere Erklärung zu liegen: beide Dichter sind präzise, I weil beide ihre Musenbezeichnungen aus Naevius haben; denn Naevius 130 hatte beide Bezeichnungen verwendet, und zwar so, daß im wahrsten Sinne des Ausdrucks ,Musa se intulit in Romuli gentem feram', also als Einführung der Musae nach Rom in Form einer Gleichsetzung der Livianischen Camenae mit den Hesiodischen Μοΰσαι. Diese Gleichsetzung der dem Leser noch unvertrauten griechischen mit den vertrauten römischen Gottheiten, die sich in der Form einer synonymischen Gleichung vollzog, machte auf der Seite der noch unvertrauten Gottheiten natürlich ein Mehr an Information nötig. Anders gesagt: über die griechischen Μοΰσαι mußte ausführlicher informiert werden. In diesen Informationsteil dürfte unser Vers - wenn die Information nicht ausschließlich aus ihm bestand - hineingehören. Er informiert über Anzahl, Abkunft und Wesensart der Musae in engster Anlehnung an den entsprechenden Informationsabschnitt des Musenhymnus bei Hesiod. Was uns mit dem Vers erhalten ist, ist also ein Unterabschnitt des Musae-Teils38 der Gleichsetzung. Den anderen Teil der Gleichsetzung, den Camenae-Teil, haben wir nicht mehr. Nicht unmöglich wäre es, daß er sich hinter der ominösen Wortreihe ... curvam; Ac quas memorant nosce nos ee camenarum (priscum vocabulum ita
Auf die Camenae können sich die Worte nicht beziehen wegen der Neunzahl („a group of nine goddesses was not to be found among the gods of Rome": Waszink, Camena 142, im Zusammenhang seiner Erklärung des Livianischen indefiniten Plurals Camenae; vgl. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 2 1912, 219) und allgemein wegen der Übernahme aus Hesiod. Wer den Vers als Umschreibung der Camenae auffaßte (z.B. Skutsch, Studia Enniana 18; Waszink, Camena 139 Anm. 1; Suerbaum 33 Anm. 103; Jocelyn, Ennius 1014 Anm. 264. 1020; gänzlich undifferenziert R. Häussler, Der Tod der Musen, A&A 19, 1973, 121 Anm. 23), erlag der Autarkie-Ausstrahlung des Verses, die das Verständnis der Hesiod-Anspielung verhinderte (s. oben S. 510); nicht anders war es offenbar bereits Terentianus Maurus ergangen, der ebenfalls in Unkenntnis des ursprünglichen Kontextes (Barchiesi 79 f.) - den bei Caesius Bassus vorgefundenen Vers des für ihn schon altersgrauen Naevius ebenfalls nur auf die (altersgrauen) Camenen beziehen zu können glaubte: ut si vocet Camenas quis novem sorores. Natürlich hat Naevius mit seinem Hesiod-Zitat nicht einen Neun-Camenen-Glauben einführen wollen; eine Gleichung ist Ausdruck der Gleichwertigkeit der geglichenen Größen, nicht ihrer Gleichheit.
516
Zum Musen-Fragment des Naevius
natum ac scriptum est etc.) verbirgt, die bei Varrò 1. L. 7,26 überliefert ist, die dann Scaliger zu der hexametrischen Wortfolge Musas quas memorant nosce nos esse emendiert
39
und die schließlich Vahlen zu dem Hexameter
Musas quas memorant nosce nos esse Camenas erweitert und in der Nachfolge Scaligere dem Ennius zugeschrieben hat (Enn. ann. Fr. 2 V. 2 ). Daß die Worte, falls sie ursprünglich eine rhythmisch gebundene Aussage über Musen und Camenen darstellten - wofür der Zusammenhang bei Varrò zu sprechen scheint - , eher dem Naevius als dem Ennius gehört haben dürften, hat u. a. schon Lucian Müller vermutet, der sie in der konjizierten Fassung Musas quas memorant Grai quasque nos Casmenas in seiner Naevius-Ausgabe als unmittelbare Fortsetzung an den Musenvers anhängte. So weit wird man nicht gehen. Aber daß andererseits eine Gleichsetzung der Camenen mit den Musen, wie sie für die Frühphase der lateinischen Literaturentwicklung - nicht nur auf Grund des Varro-Zitats - immer schon ange131 nommen werden I mußte, nicht gerade von Ennius durchgeführt worden sein kann, einem Dichter, für den die Musae bereits eine Selbstverständlichkeit sind40, das wird man als sehr wahrscheinlich ansehen dürfen.
39
Die paläographische Rechtfertigung dieser Emendation bei Müller, Ennius - Naevius 157, im app. crit. 40 K. Latte, Rom. Rel.-Gesch. (München 1960) 77 Anm. 2: „Für Fulvius Nobilior stand die Gleichsetzung der Camenae mit den Musen bereits ebenso fest wie für seinen Schützling Ennius". - Ausführlich zu den Musen bei Ennius: Suerbaum 268-295. Der polemische Ton, in dem Ennius im Proömium des 7. Buches über seine Beziehung zu den Musen spricht, zeigt m. E. an, daß er sie nicht „als erster [...] zu den Schutzgöttinnen seiner Dichtung erhoben hat" (Suerbaum 270), sondern daß er als erster den hohen künstlerischen Anspruch, den sie verkörperten, erkannt und erfüllt zu haben glaubte; das richtet sich (wie schon Cie. Brut. 75-76 sah; vgl. Waszink, Anfangsstadium 873) allein gegen Naevius (rem 213 kann kaum auf die .Odusia' gehen), der sich in Ennius' Verständnis noch ganz unreflektiert und daher zu Unrecht in den Schutz der Musen gestellt hatte; bei Musarum scopulos 215 liegt der Ton nach dem ganzen Zusammenhang (ars-ingenium-Kcmtiast, s. die Herausarbeitung des Gegensatzes bei Suerbaum 290 und dazu die Präzisierung von Brown, CR 21, 1971, 375) kaum auf Musarum, sondern auf scopulos, also nicht: „ ... ich habe die Schwierigkeiten der Musen ...", sondern: „... ich habe die Schwierigkeiten der Musen (gemeistert)"; vgl. jetzt den Katalog der künstlerischen .Innovationen' des Ennius bei Jocelyn, Ennius 1013-1020.
Zum Musen-Fragment des Naevius
517
Die Gleichsetzung muß zwischen Livius Andronicus und Ennius erfolgt sein, und alles weist - wie sich zeigte - darauf hin, daß Naevius sie vollzog. Die Varro-Stelle könnte ein Reflex des Vorgangs sein41. *
Zu fragen ist nun noch, in welchem Zusammenhang die Gleichsetzung als ganze gestanden haben kann. Daß sie ins Proömium gehörte, wurde gezeigt. Aber an welcher Stelle des Proömiums stand sie? Überblickt man die Entwicklung der epischen Proömiengestaltung von Homer an, so zeichnen sich zwei Typen ab: (1) Bei Typus I sind Thema-Angabe und Inspirationsbitte - die beiden Hauptkonstituenten des Proömiums - miteinander verschränkt: der Dichter bittet die inspirierende Gottheit, ihm den gesamten Inhalt - also Thema und Stoff - seines Werkes einzugeben: A 1 Μήνιν αειδε, θεά, Πηληϊάδεω Άχιλήος ... α 1 "Ανδρα μοι εννεπε, Μοΰσα, πολύτροπον ... Dieser Typus, bei dem die totale Inspiration erbeten wird, ist beschränkt auf die Phase 42 epischen Dichtens, in der der Glaube an die Wirkkraft der göttlichen Muse noch lebendig war, das heißt auf die Phase der improvisie41
Skutschs (Studia Enniana 21) Vermutung, die Worte bildeten einen Ennius-Hexameter aus dem 15. Annalen-Buch (die Camenen erscheinen Fulvius Nobilior im Traum und bitten ihn um eine Heimstatt: die spätere aedicula Musarum), scheint mir zu phantastisch („fanciful suggestion" konzediert er selbst); vgl. Suerbaums Zurückhaltung 349 (das Varro-Zitat sei schwerlich aus Ennius). 42 Rein formale Nachahmungen blieben nach dem Verlust des Gefühls für den eigentlichen Sinn natürlich immer möglich und waren wegen des stilistischen Effekts beliebt, nicht nur in Parodien - wie etwa in den parodierenden Anfängen der Batrachomyomachie oder des .Attischen Gastmahls' des Matron (Brandt I 60; zu den Musenanruf- und Musengebet-Parodien mit reicher Stellensammlung: H. Kleinknecht, Die Gebetsparodie in der Antike, Stuttgart - Berlin 1937, 103-116) - , sondern auch in emster homerisierender Epik, vgl. z. B. Stat. Achill. 1,3 diva, refer. Das Material ist (nach Mocker, s. oben Anm. 6) fast vollständig gesammelt und in verschiedenen Richtungen durchinterpretiert worden von (1) E. R. Curtius, ZRPh 59, 1939, 129-188; ZRPh 63, 1943, 256-268; Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern - München 8 1973, 235-252 (,Die Musen') - (2) W. Kranz, Sphragis, RhM 104, 1961, 3 ^ 6 . 97-124 (auch in: Studien zur antiken Literatur und ihrem Fortwirken, Heidelberg, 1967, 27-78) - (3) S. Accame, L'invocazione alla Musa e la .Verità' in Omero e in Esiodo, RFIC 91, 1963, 257-281. 385-415. Die oben skizzierte Typologie der epischen Proömiengestaltung geht jedoch von einer anderen literarhistorischen Konzeption aus, die durch M. Parrys Forschungen angeregt ist und die an anderer Stelle auszuführen sein wird.
518
Zum Musen-Fragment des Naevius
renden mündlichen Epik, in der jeder Epenvortrag - als freie Neuschöpfung über einem Grundthema - für den Sänger jedesmal ein neues Wagnis mit allen Risiken des Gelingens oder Mißlingens war; die Erfahrungen, die der Sänger in langjähriger Vertragspraxis machte, mußten in ihm notwendig die Überzeugung entstehen lassen, daß eine höhere Macht - die Muse - den Sänger I im Zeitpunkt des freien Improvisierens lenkte und beherrschte. (2) Bei Typus II sind Thema-Angabe und Inspirationsbitte voneinander getrennt: der Dichter läßt sich Thema und Stoff nicht mehr aus dem Mund der Muse .einsingen', sondern für sein Thema und seinen Stoff erklärt er sich selbst verantwortlich (an die Stelle der bisher üblichen Imperative der traditionellen Verben des Singens tritt jetzt die 1. Person), die Muse oder eine andere Macht bittet er nur noch um Beistand: Ilias parva Fr. 1 Ki. "Ιλιον ά ε ί δ ω καί Δαρδανίην εύπωλον Αρ. Rh. 1,1 'Αρχόμενος σέο, Φοίβε, παλαιγενέων κλέα φωτών μνήσομαι Lucr. 1,1 Aeneadum genetrix ... 24 te sociam studeo scribendis versibus esse Verg. Georg. 1,1 Quid faciat laetas segetes ... 5 hinc canere incipiam. vos, o clarissima mundi lumina... 24 tuque adeo (sc. Caesar Octavianus)... 40 da facilem cursum atque audaeibus adnue coeptis ... Dieser Typus entsteht in dem Augenblick, in dem Epik nicht mehr improvisierenden mündlichen Vortrag bedeutet, sondern schriftliche Textkonstitution mit allen dadurch geschaffenen Möglichkeiten der experimentierenden Selbstkorrektur; an die Stelle der früheren Unsicherheit des Sängers tritt mit der Schrift das Gefühl der Sicherheit, und damit einher geht der Ersatz des alten Inspirationsglaubens durch das neue Selbstbewußtsein des leistungsstolzen Individualisten. Die traditionelle Inspirationsbitte wird als
Zum Musen-Fragment des Naevius
519
Formelement des Proömiums beibehalten, aber mit neuem Sinn und mit neuen Funktionen gefüllt. I Daß das Proömium des Naevius zum Typus II gehört hat, ist kaum zu bezweifeln. Fraglich ist dann allerdings immer noch die Reihenfolge der beiden voneinander getrennten Proömiumskonstituenten: zuerst die modifizierte Inspirationsbitte und dann die Thema-Angabe - oder umgekehrt? Die Entscheidung bringt die Thematik des Naevianischen Epos: Im .Bellum Punicum' liegt ein historisches Epos vor. Historische Epen aber beginnen - in natürlicher Aufnahme eines Prinzips griechischer Geschichtsschreibung, das seinerseits auf eine Grundeigenschaft griechischen Denkens zurückgeht - mit der Thema-Angabe und fahren fort mit der Frage nach der Ursache des thematisierten Ereigniskomplexes - woraus sich dann in der Erzählung selbst die Abfolge .Vorgeschichte - eigentliches Thema' ergibt. So bei Herodot, so bei Thukydides, und so auch beim vermutlichen Begründer des entwickelten historischen Epos, bei Choirilos von Samos43. Daß die lateinische historische (bzw. mythologisch-historische) Epik dieses Prinzip aufgenommen hat, zeigt neben anderen Belegen - vor allem Lucans Pharsalia-Proömium - Vergils Aeneisproömium: auf die Thema-Angabe in den Versen 1-7 folgt mit Vers 8 (bei gleichzeitigem strukturellen Rückgriff auf das Ilias-Proömium) unter Verwendung des Formelements ,Inspirationsbitte' die Hereinholung der Vorgeschichte:
43
Vgl. Leo, Lit.-Gesch. 86, mit der Erweiterung: „Nicht anders werden es die hellenistischen Epiker gemacht haben"; dazu dann K. Ziegler, Das hellenistische Epos, Leipzig 2 1966, 76 Anm. 1: „Und was Naevius angeht, so ist ohne Zweifel auch für ihn die zeitgenössische Epik das Muster gewesen"; vgl. auch Richter 47-49. 41 Anm. 3 (Ende); Buchheit 49 mit Anm. 180, und bes. Mariotti, Bell. Poen. 11 f., der aber Ubersieht, daß sich die Annahme griechischer Strukturiertheit des naevianischen Epos nicht mit der Insertions- (oder .Digressions'-) These (14. 25) verträgt; inzwischen scheint diese These allerdings glücklicherweise ihren Höhepunkt überschritten zu haben, s. die Problemgeschichte bei Waszink, Anfangsstadium 905-910. Choirilos hatte im Proömium offenbar zuerst als captatio benevolentiae den Mangel an epischen Stoffen beklagt (Aristot. Rhet. 1415 a 3; Fr. 1 Ki.) und dann (wahrscheinlich in der Form der modifizierten Inspirationsbitte, wie später Vergil; zu ήγεο ist - nach Μουσάων θεράπων Fr. 1,2 Ki. - doch wohl der Vokativ Μοΰσα zu ergänzen; so auch schon Mocker 15) mit der ThemaAngabe zugleich die Vorgeschichte angekündigt: Fr. 1 a Ki. "Ηγεό μοι λόγον άλλον, δπως Άσίης άπό γαίης ήλθεν ές Εύρώπην πόλεμος μέγας, λόγον bezieht sich zweifellos auf den Herodotischen Logos (vgl. Richter 48 mit Anm. 1), dessen Charakteristikum das weite Zurückgreifen auf die άρχή des Krieges ist (vgl. die Titel-Angabe des Epos im Pap. nr. 245 P.: Χοιρίλου ποιήματα Βαρβαρικά, μηδικά. περσ[ικά], wozu Lesky, Lit.-Gesch. 3 347).
520
Zum Musen-Fragment des Naevius
8
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso quidvc dolens regina deum ... Naevius wird sein Proömium nicht anders strukturiert haben. Nicht nur die dargestellte Proömientypik spricht dafür, sondern auch die bekannte strukturelle Anlehnung Vergils an Naevius. Wenn das .Bellum Punicum' mit der ThemaAngabe begann - also etwa: ,Den Krieg zwischen Römern und Puniern will ich besingen, den Krieg, der ...' (dann Reflexionen über Bedeutung und Folgen des Krieges) - und danach mit einer modifizierten Inspirationsbitte an die Musen (deren erläuternde Gleichsetzung mit den Camenen in dieser Binnenposition, wie der Vergleich etwa mit dem .Musenblock' Β 484-493 zeigt, im Gegensatz zu einer Position am unmittelbaren Werkbeginn strukturell durch die Tradition 134 gedeckt war) I die Rückblende auf die mythische Vorgeschichte des 1. Punischen Krieges einleitete, dann ist - neben manchem Wichtigeren, was hier nicht zur Debatte steht - auch das et alio loco begreiflich, mit dem Caesius Bassus sein Zitat unseres Musenverses einführt: den ersten Vers des Epos hätte man schwerlich so lose einführen können, für den achten oder zwanzigsten jedoch paßte die Formel genausogut wie für den hundertsten. *
Am schwierigsten zu beantworten ist die letzte Frage, warum Naevius gerade hier, bei seiner Aufforderung an die Musen, ihm die mythische Vorgeschichte der von ihm selbst teilweise miterlebten Rom-Karthago-Auseinandersetzung (und das bedeutet: die Aeneas-Sage) mitzuteilen, die Korrektur seines Vorgängers Livius Andronicus in Form der Gleichsetzung der Camenae mit den Musae vornahm. Mehr als Vermutungen - über die im Bereich fragmentierter Literatur ja ohnehin nicht hinauszukommen ist - sind hier nicht möglich. Vielleicht wird man eines festhalten dürfen: der ärmliche Surrogat-Charakter des Livianischen Äquivalents Camenae muß für einen so kreativen und selbstbewußten Geist wie Naevius, der sich nach Ausweis seiner Dramentitel und der Struktur seines Epos in griechische Literatur und griechisches Denken intensiv hineingelebt hatte, besonders fühlbar gewesen sein. Die Einführung der Μοΰσαι in Rom - für die die Gleichsetzung mit den Camenae, wie gezeigt, die kulturhistorisch bedingte Voraussetzung darstellte - war nur der bekenntnishafte Schlußpunkt in einem Dichterleben, das von Anfang an der Verpflanzung griechischer Geistigkeit nach Rom gegolten hatte. Daß dieser Schlußpunkt gerade im Zusammenhang mit der literarischen Einbürgerung der Aeneas-Sage gesetzt wurde, das heißt aber: im Zusammenhang mit der Proklamation des nationalen Erbfolgeanspruchs Roms
Zum Musen-Fragment des Naevius
521
an Troja, und das wiederum bedeutet: im Zusammenhang mit der .Anbindung' Roms an die griechische Kulturwelt - das wird man wohl kaum als Zufall werten dürfen.
Der Altsprachliche Unterricht 35, 1978, 70-87
Zu Cäsars Erzählstrategie (BG11-29: Der Helvetierzug)1 Cäsars Schriften stellen im Lektürekanon der lateinischen Schulschriftsteller ein Unikum dar. Denn bei keinem anderen in der Schule gelesenen lateinischen Au1 Überarbeitete und mit Anmerkungen versehene Fassung eines Vortrags, der am 12.3.1976 beim Anregungstag für die Altphilologen Unterfrankens in WUrzburg gehalten und danach mehrfach wiederholt wurde (, Verein der Freunde des Humanistischen Gymnasiums e. V.' in Coburg; Maximilians-Gymnasium München, u.a.), erwachsen aus einer im Wintersemester 1974/ 75 in Würzburg gehaltenen Cäsar-Vorlesung. - Der Begriff .Erzählstrategie' hatte sich mir aus der Gesamtinterpretation der Schriften Cäsars von selbst ergeben; daß er - „erst in letzter Zeit häufiger begegnend" - auch in der modernen Erzähltheorie eine Rolle zu spielen beginnt, zeigt jetzt das Buch ,Erzählstrategie. Eine Einführung in die Normeinübung des Erzählens' (Heidelberg 1976; Uni-Taschenbücher Nr. 495) von Klaus Kanzog (das Zitat S. 104). Für das Verständnis der Schriften Cäsars scheint mir der Begriff deswegen besonders geeignet zu sein, weil er den ,Berichts'-Charakter dieser Schriften von vornherein als gewollte Fiktion enthüllt, und diese Fiktion - geschaffen vor allem durch einige .Grundsatzentscheidungen' (Mensching [s. Anm. 12], S. 10) wie die Pseudo-Objektivität des ,Er' oder die Pseudo-Sachlichkeit eines scheinbar .Strengen Stils' - ist m. E. bereits die erste .erzählstrategische' Tat des Schriftstellers Cäsar [der Begriff hat inzwischen Karriere gemacht, ζ. B. Heft 5/90 des .Altsprachlichen Unterrichts': .Caesar als Erzählstratege']. - Im methodischen Ansatz verwandt ist der Aufsatz von W. Görler .Die Veränderung des Erzählerstandpunktes in Cäsars .Bellum Gallicum", Poetica 8, 1976, S. 95-119 (ursprünglich Vortrag Augsburg [Mommsengesellschaft] Juni 1976). Görlers Hauptthese, Cäsar sei „bei der Abfassung seines ,Bellum Gallicum' von vornherein einem wohlüberlegten Plan gefolgt" (S. 117), in dem er vom Erzählerstandpunkt der (überwiegend) „personalen Innensicht" in den Anfangsbüchern zum „auktorialen Erzählerstandpunkt" in den späteren Büchern übergegangen sei (Näheres unten Anm. 16, dort auch die verwandte Theorie Montgomerys), ließe sich als eine der vermutlich zahlreichen möglichen .Detailfüllungen' des Begriffs .Erzählstrategie' auffassen (eine weitere solche .Detailfüllung' dürfte die Theorie Mutschlers darstellen, s. dazu unten Anm. 22). Der pädagogische Wert der Cäsar-Schullektüre, der in letzter Zeit wieder häufiger in Frage gestellt wurde (materialreich vor allem Fuhrmann, M., Cäsar oder Erasmus?, Gymnasium 81, 1974, S. 394-407), wird durch die neuere Cäsar-Erzählforschung auf sprunghaft gestiegenem Niveau literaturwissenschaftlich gesichert; die herkömmlichen leicht angreifbaren didaktischen Rechtfertigungsargumente wie .sprachliche Klarheit' u. dgl. - von schulpraktiscber Seite schon lange als vordergründig empfunden (zuletzt eindringend Maier, F., Zur Didaktik des Lektüre-
524
Zu Casars Erzählstrategie
tor ist das Mißverhältnis zwischen Werk-Intention und Rezeptions-Intention so kraß: ein literarisches Werk von höchstem intellektuellen Anspruch und von aktuellster praktischer Zielsetzung trifft hier auf ein Lesepublikum mit der denkbar elementarsten Fragestellung. Dieses Mißverhältnis zwischen Autor-Erwartung und Leser-Erwartung wird bei Casars Schriften, solange sie als sprachlicher Übungsstoff für Fremdsprachen-Erlemer verwendet werden, im letzten natürlich immer unaufhebbar bleiben. Aber es kann gemildert werden - dadurch, daß es bewußt gemacht wird. Je bewußter es von den Schülern empfunden wird - eben als Mißverhältnis empfunden wird - , um so mehr wird in den verschiedenen Altersstufen durchscheinen können von der eigentlichen Dimension, in der das Werk liegt. Da nun das Cäsarbild der sog. gebildeten Schichten bei uns nach wie vor weitgehend vorgezeichnet wird durch die Schullektüre von Casars .Bellum Gallicum', wächst dem Lateinlehrer eine große Verantwortung zu: Von seiner Fähigkeit, das Mißverhältnis sichtbar zu machen, hängt es ab, wie groß die - im Prinzip ja unvermeidliche - Verkürzung und Verzerrung des Cäsarbildes der künftigen Urteilsfähigen sein wird. Dieser Sachlage sind sich die Lateinlehrer wohl zu allen Zeiten bewußt gewesen. Bewußt gewesen sind sie sich auch der Tatsache, daß sie der Verantwortung nur dann ausreichend gewachsen sein können, wenn ihnen das erwähnte Mißverhältnis selbst klar vor Augen steht, - d. h. wenn sie im Unterschied zu ihren Schülern genau wissen, was der Autor des .Bellum Gallicum' eigentlich sagt, will und ist. An diesem Punkte beginnen allerdings die Schwierigkeiten. Denn an diesem Punkte kommt die Cäsarphilologie ins Spiel. Ohne intensive Beschäftigung mit ihr wird der Lehrer die außergewöhnliche Forderung, die gerade Cäsar an ihn stellt, heute kaum mehr erfüllen können. Wie aber steht es mit der Cäsarphilologie heute? Falls der Lehrer überhaupt das Glück hatte, während seiner Universitätsausbildung mit ihr Bekanntschaft zu schließen - das ist selten genug der Fall 2 - , stellt sich ihm die Cäsarphilologie dar als eine Art Bergwerk
Unterrichts in der Sekundarstufe I, in: Plädoyer für Erziehung, hrsg. v. Staatsinstitut für Schulpädagogik München, 1977, S. 203-222) - werden gegenwärtig von der Fachwissenschaft in systematischer Analyse überwunden - ein Vorgang, dem sich bei der Bedeutung der Cäsarlektüre für die allgemeine Gymnasialbildung kaum ein Lateinlehrer wird verschließen wollen. - Woldemar Görler (Heidelberg), Klaus Stiewe (Erlangen), Otto Schönberger (Würzburg) sowie Friedrich Maier (München) habe ich für die Lektüre und Kritik einer ersten Fassung des Haupttextes herzlich zu danken. 2 Vgl. Adcock, F. E., Caesar als Schriftsteller, Göttingen 21962, S. 3: „Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, hat kein Professor der Universität Cambridge im letzten halben Jahrhundert auch nur die kürzeste Vorlesung den Werken Caesars gewidmet." - An den deutschen Universi-
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
525
mit Hunderten von Klein- und Kleinststollen, ohne erkennbare zentrale Leitstelle. Gelingt es dennoch, unter all den grammatikalischen, stilistischen, antiquarischen, topographischen und historischen Interpretationen von Einzelstellen einen locus superior ausfindig zu machen, von dem aus ein freier Rundblick möglich wird, so ist das beim heutigen Stand der Cäsarforschung jener Kriegsschauplatz, auf dem die obtrectatores Caesaris unter der Fahne Rambauds3 und die defensores Caesaris unter der Standarte Oppermanns4 von zwei Seiten her am Cäsartexte zerren, beherrscht von der Idee, eine These zu behaupten bzw. zu stürzen, über die Cäsar selbst, wie ich glaube, mit einem ironischen Lächeln hinweggegangen wäre5.1 In dieser Situation der Cäsarphilologie - Verzettelung hier, Thesenbesessenheit dort6 - scheint es mir nicht überflüssig zu sein - und sei es auch nur zur Ermutigung derer, die mit dem Cäsartext in der Hand täglich an der ,Front' stehen - , wieder einmal ins Bewußtsein zu heben, was für eine einzigartige, ihre Interpreten weit überragende Persönlichkeit aus dem ,Bellum Gallicum' in die Schulstube hineinspricht7. Ein Stückchen dieser Persönlichkeit möchte ich zu
täten scheint das Bild nicht ganz so düster zu sein: eine Stichprobe an Hand der Vorlesungsverzeichnisse ergab, daß in den 16 Semestern seit dem SS 1970 an 5 Universitäten (FU Berlin, TU Berlin, Bochum, Bonn, Würzburg) immerhin insgesamt sieben Cäsar-Vorlesungen gehalten worden sind. Legt man dieses Testergebnis allerdings auf die 25 deutschen Universitäten um, an denen Klassische Philologie vertreten ist, dann zeigt sich, daß die Chance für den Einzelstudenten äußerst gering ist. 3 Rambaud, M., L'art de la déformation historique dans les commentaires de César, Paris 2 1966. Die weiteren Cäsar-Arbeiten Rambauds bei Kroymann und Gesche (s. Anm. 6). 4 Oppermann, H., Probleme und heutiger Stand der Caesarforschung, in: Caesar, hrsg. von D. Rasmussen, Darmstadt 1967 (= Wege der Forschung, Bd. 43), S. 485-522 (im folgenden: WdF Caesar). - Die weiteren Cäsar-Arbeiten Oppermanns bei Kroymann und Gesche (s. Anm. 6). 5 Vgl. Seel, O., Caesar-Studien, Stuttgart 1967 (= AU-Beiheft 1 zu Reihe X), S. 91: „Pathetische Panegyrik vermag ihn so wenig zu fassen wie kleinlicher Krittel." 6 Die Forschungssituation wird vorzüglich belegt durch die souverän gegliederte Cäsar-Gesamtbibliographie 1945-1972 von J. Kroymann in .Aufstieg und Niedergang der römischen Welt' (im folgenden: ANRW) I 3, 1973, S. 457-487. Heranzuziehen ist ferner der mehr historisch orientierte Forschungsbericht von Helga Gesche, Caesar, Darmstadt 1976 (= Erträge der Forschung, Bd. 51). 7 Den angemessensten Versuch, sich dem Kern dieser Persönlichkeit zu nähern, stellt vielleicht die vorsichtig umkreisende, sich selbst ständig in Frage stellende Studie Otto Seels .Zur Problematik der .Größe" dar (in: Caesar-Studien [s. Anm. 5], S. 43-92). Seels berechtigte Negation jeder wirklich adäquaten Persönlichkeitsbeschreibung sollte jedoch nicht zum Verzicht auf die Nachzeichnung klar erkennbarer Persönlichkeits k o η s t a n t e n führen („... er [war] alles [...] und von allem auch das Gegenteil": S. 83).
71
526
Zu Casars Erzählstrategie
fassen versuchen mit einer Interpretation der Helvetierfeldzugschilderung im 1, Buch. Mit ihr möchte ich zeigen, wie beschränkt der Ansatz jener ist, die Cäsar gewissermaßen in Einzelfunktionen zerlegen und diese dann säuberlich ausweiden: also: Cäsar der Schriftsteller - Cäsar der Heerführer - Cäsar der Politiker - Cäsar der Staatsmann usw. Dieser isolationistischen Forschungstendenz gegenüber möchte ich die Einheit von Casars Persönlichkeit in den Vordergrund rücken - und dies unter dem, wie ich hoffe, erhellenden Begriff der Strategie. *
Bevor ich mit der Interpretation beginne, muß ich einige Feststellungen treffen, die teils mehr, teils weniger selbstverständlich sind, die ich aber zur Fundierung des Folgenden nicht entbehren kann8. 1. Die erste Feststellung ist, daß Cäsars eigentliche Bedeutung nicht auf dem literarischen, sondern auf dem politischen Sektor liegt. Cäsar war in erster Linie nicht Geschichtsschreiber, sondern Geschichtstäter, sein Lebenszweck war nicht, Literatur zu machen, sondern Politik. Diesem Zweck waren alle seine weiteren Aktivitäten untergeordnet, also auch - und vor allem - seine Schriftstellerei. Für das .Bellum Gallicum' bedeutet das, daß es als literarisches Werk zu jener Werkkategorie gehört, die wir als .sekundär' bezeichnen können. Denn es ist nicht um seiner selbst willen geschaffen, von einem Mann, der seine eigentliche Lebensleistung im Niederschreiben eben dieses Schriftwerks sieht - so wie ζ. B. Livius - , sondern es ist geschaffen als Beschreibung einer bereits erbrachten Eigenleistung der militärisch-politischen Praxis, von einem Mann, der seine Lebensleistung nicht in der Literatur sieht, sondern in der aktiven Veränderung der politischen Konstellationen seiner Zeit. 2. Daraus ergibt sich die zweite Feststellung. Sie betrifft die Rolle der Philologie im Zusammenhang mit der Person Cäsars. Wenn Cäsars literarische Werke, da sie von Cäsar dem Politiker stammen, .sekundäre' literarische Werke sind, sind sie nicht um ihrer selbst willen zu interpretieren, sondern sie sind auf Cäsar den Politiker hin zu interpretieren. Die Funktion der Cäsarphilologie muß daher im Gesamtkontext der Cäsarforschung die einer dienenden Disziplin sein.
8
Es handelt sich dabei um überwiegend feststehende Erkenntnisse der Cäsarforschung; dafür mag der Hinweis auf Geizer, M., Caesar. Der Politiker und Staatsmann, Wiesbaden 6 1960 (im folgenden: Geizer, Caesar) genügen.
(BG11-29:
Der
Helvetierzug)
527
3. Andererseits hat die Cäsarphilologie innerhalb der Gesamt-Cäsarforschung eine Schlüsselstellung. Denn sie arbeitet im Gegensatz zur Geschichte, zur Epigraphik, zur Numismatik, zur Archäologie nicht mit Fremddokumenten (also nicht mit Zeugnissen anderer über Cäsar, mit Inschriften zu Ehren Cäsars, mit Münzbildern und Porträts von Cäsar), sondern die Cäsarphilologie arbeitet mit Selbstdokumenten. Damit hat sie von allen Zweigdisziplinen der Cäsarforschung die größte Chance, Cäsars Persönlichkeit so nahe wie möglich zu kommen. Denn Cäsars Schriften sind - mögen sie sich auch noch so sehr den Anstrich vollendeter Objektivität geben - , sie sind Selbstdarstellung9. Das heißt, ihre Perspektive ist notwendig persönlich. Denn der Selbstdarsteller kann niemals wirklich neben sich treten oder sich gar gegenübertreten. Wenn infolgedessen die Philologie I mit der notwendigen Behutsamkeit vorgeht, kann es ihr ge- 72 lingen, die charakteristischen Persönlichkeitskomponenten des Autors herauszulösen. Dies werden solche Komponenten sein, die sozusagen unterhalb der Bewußtseinsschwelle des Autors liegen, Komponenten, die zu verhüllen dem Autor deswegen nicht möglich ist, weil er damit die Substanz seiner Persönlichkeit aufgeben würde. Die Herauslösung solcher Persönlichkeitskonstanten, deren Zusammenstellung am Ende zu einem wenigstens approximativen Persönlichkeitsbild führen kann, ist aber nur möglich, wenn größere Erzählkomplexe im Zusammenhang in den Blick genommen werden. Denn eine Konstante prägt sich zwar in jedem der Einzelpunkte aus, aus denen sie besteht, - erkennbar wird sie aber für den Betrachter nur in der Form der Linie, die die Einzelpunkte verbindet. Soweit die allgemeinen Voraussetzungen. Nun zur Interpretation selbst. Der größere Erzählkomplex, an dem hier eine der tragenden Persönlichkeitskonstanten Cäsars herausgearbeitet werden soll: der Helvetierfeldzug, bildet den einen der beiden Großteile des 1. Buches; den anderen Großteil bildet der Germanenfeldzug gegen Ariovist. Beide Großteile des 1. Buches beginnen im 1. Kapitel, das 1. Kapitel leitet sie beide ein. Zugleich leitet das 1. Kapitel das Gesamtwerk ein. Das 1. Kapitel stellt also, bildlich gesprochen, das Stellwerk dar für die synchronisierte Abfahrt zweier Nahzüge und eines Fernzuges. Uns interessiert zunächst, wie Cäsar diese verschiedenen Erzählstränge im 1. Kapitel ansetzt.
9 Vgl. Seel, O., Ambiorix. Beobachtungen zu Text und Stil in Caesars Bellum Gallicum, jetzt in: WdF Caesar (S. 279-338), S. 334: „Selbstrepräsentation eines der geprägtesten und prägendsten Römer. Sein Bericht ist gewiß alles andere als eine naive Reportage ..."
528
Zu Cäsars Erzählstrategie
Reiht er den einen Erzählbeginn an den anderen an - , oder stellt er Beziehungen her, verknüpft er? Und wenn ja, wie? Was wir zunächst sehen, ist, daß Cäsar in diesem Kapitel erst einmal seine Maßstäbe setzt. Er gibt seine Kategorien an. Er tut dies auf eine Weise, die seinem Werk sogleich eine exzeptionelle Stellung innerhalb der literarischen Gattungstypik verleiht. Denn anders als die griechischen und römischen Geschichtsschreiber expliziert er seine Maßstäbe und Kategorien nicht, sondern er verbirgt sie in der Hülle reiner Faktizität. Herodots .Perserkrieg' beginnt so: „Von des Halikarnassiers Herodotos persönlicher Ausforschung ist dies der Aufweis hier, damit weder das von Menschenhand bewirkte Geschehen durch die Einwirkung von Zeit verdämmert noch Vollbringungen, groß und staunenswert, die einem von Hellenen, die anderen von Nicht-Hellenen hervorgebracht, ihr κλέος verlieren." Des Thukydides ,Peloponnesischer Krieg' beginnt so: „Thukydides aus Athen hat aufgezeichnet den Krieg zwischen den Peloponnesiern und den Athenern, beginnend gleich als er ausbrach, und erwartend, groß werde er werden und am bedeutendsten von allen vorhergegangenen." Sallust beginnt seinen Jugurthinischen Krieg' so: „Grundlos klagt über seine Natur das Menschengeschlecht, sie werde - schwach und kurzlebig, wie sie sei - mehr durch den blinden Zufall als durch die eigene Tatkraft regiert." Cäsars .Gallischer Krieg' aber beginnt so: „Gallien ist, als Ganzes gesehen, in drei Teile geteilt: den einen bewohnen die Belgier, den zweiten die Aquitanier, den dritten die, die sich selbst Kelten und die wir Gallier nennen."
Dieser Beginn stellt sich offenbar ganz bewußt aus der traditionellen historiographischen Primordialtopik heraus. Keine Rede von der Größe, der Bedeutung, dem Ruhm dessen, was der Autor zu beschreiben sich anschickt, wie bei Herodot und Thukydides. Keine philosophische Rechtfertigung wie bei Sallust. Über73 haupt kein subjektiver Ton, sondern I vom ersten Satz an reine Fakten. Also als Geschichtsschreiber im herkömmlichen Sinne will Cäsar nicht gelesen werden. Als was dann? Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig, weil sie die Antwort auf jene andere vorhin gestellte Frage erleichtern könnte, wie Cäsar die verschiedenen Erzählstränge im 1. Kapitel ansetzt. Als was also will Cäsar sich dem Leser darstellen? Wir analysieren den Text des 1. Kapitels genauer: Die Schilderung setzt ein mit einem geographisch-ethnographischen Überblick über den GesamtKriegsschauplatz. Dieser Überblick ist äußerst kurz. Er gibt nur das Allernotwendigste. Er ist also streng funktionalisiert. Er hat keinen Eigenwert. Cäsar hat kein Interesse an geographischen und ethnographischen Beschreibungen um ih-
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
529
rer selbst willen10. Das Land wird nicht beschrieben, sondern es wird mit zwei glatten Schnitten in 3 Teile seziert: divisa est. Diese 3 Teile werden dann sofort benannt - Belgae, Aquitani und Celtae - , und damit hat Cäsar bereits drei der vier Grundbausteine, mit denen er im Werk hantieren wird. Das Verhältnis Casars zu dem Land, in dem er acht Jahre seines Lebens verbracht hat, erscheint so vom ersten Satz an als das Verhältnis des Handelnden zu seinem Objekt. Gallien ist Cäsars Objekt, aber kein literarisches, sondern ein emotionsfrei, rational und analytisch gesehenes militärisches Objekt. Das wird noch deutlicher, wenn der geographische Teil des 1. Kap. in den ethnographischen übergeht, also vom 4. Satz an (§ 3): horum omnium fortissimi sunt Belgae ... Im 1. Satz - Gallia est omnis divisa - war die S e z i e r u n g des Landes erfolgt, im 2. Satz - hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt - folgte die linguistische und ethnische B e g r ü n d u n g der Vivisektion, im 3. Satz Gallos ab Aquitanis Garunna flumen [...] dividit - erfolgte die klare F i x i e r u n g d e r S c h n i t t l i n i e n : hier nun, im 4. Satz, folgt mit der Setzung des 1. Adjektivs - fortissimi - das Wegschneiden aller anderen möglichen Gesichtspunkte außer dem militärischen: „von diesen allen die tapfersten sind die Belgier" - also nicht: ,νοη diesen allen die reichsten, die ärmsten, die arbeitsamsten, die erfolgreichsten' o. dgl., sondern: die tapfersten. Damit gibt Cäsar zu erkennen, daß bereits die geographisch-ethnographische Grundlegung des Werks unter rein militärischem Aspekt erfolgt. Die Ausschließung alles anderen als des Militärischen geschieht dabei mit solcher scheinbarer Selbstverständlichkeit, daß wir gar nicht erst auf den Gedanken kommen, Land und Leute hätten ja auch unter anderen Blickwinkeln und zu anderen Zwecken vorgeführt werden können. Das wird u. a. durch die Wortstellung erreicht: nicht horum omnium Belgae fortissimi sunt - so die normale lateinische Wortstellung11 - , sondern: horum omnium fortissimi - sunt Belgae. Das ist eine suggestive Wortstellung, die dem Leser das Gefühl suggeriert, an das Land und seine Bewohner sei von
10
Diese funktionale Auffassung der .Exkurse' beginnt sich, nachdem Rasmussen die fortschreitende Universalisierung der ethnographisch-geographischen Information wahrscheinlich gemacht hat (Rasmussen, D., Das Autonomwerden des geographisch-ethnographischen Elements in den Exkursen, jetzt in: WdF Caesar, S. 339-371), immer stärker durchzusetzen, s. ζ. B. Seel (s. Anm. 5), S. 37-43; Oppermann (s. Anm. 4), S. 506 f.; Montgomery, Η., Caesar und die Grenzen. Information und Propaganda in den Commentarli de bello Gallico, Symbolae Osloenses 49,1973, S. 74-78. 80. 11 Kühner-Stegmann II 2, § 246, Nr. 10.
530
Zu Casars Erzählstrategie
vornherein nur eine einzige Fragestellung möglich, nämlich die nach der Kampfkraft, und das heißt: die militärische Fragestellung12. Diese Suggestion ist von Cäsar mit Sicherheit beabsichtigt. Sie erfolgt nicht unbewußt, nicht so, als sei für Cäsar die nur-militärische Sicht seinem Wesen nach die einzig mögliche und dies habe sich dann auch in der Wortstellung niedergeschlagen. Gegen eine solche Deutung sprechen nicht nur die großen universell ausgerichteten geographisch-ethnographischen Exkurse an späterer Stelle innerhalb des »Bellum Gallicum', sondern auch die ganze Anlage von Casars militärischer Erzählung, in der nämlich, wie wir gleich näher sehen werden, das Militärische nur die φαινόμενα sind, nur der Rauch sozusagen, unter dem ein Brand von ganz anderer Dimension schwelt. Cäsars Interessenhorizont ist durchaus nicht so engbegrenzt, daß nur das Militärische in ihm Platz fände. 74 Warum aber I dann diese programmatische Fixierung der Vorrangstellung des Militärischen zu Beginn des Werkes? Diese Programmerklärung hat offenbar g a t t u n g s d e f i n i e r e n d e Funktion, und zwar so: Diejenige Textgattung, in der der militärische Gesichtspunkt von Natur aus an erster Stelle steht, sind die Frontberichte, die der römische Feldherr an den Senat zu senden hatte13. Indem Cäsar gleich zu Anfang des publizierten Gesamtwerks den Ausschließlichkeitsanspruch des militärischen Gesichtspunkts innerhalb seiner Kriegsschilderung betont, ordnet er sein Werk in die Gattung der .Frontberichterstattung' ein und schließt es damit aus der Gattung .Geschichtsschreibung' aus. Die Frage, ob Cäsars Schriften Geschichtsschreibung sind oder nicht, brauchte kaum noch erörtert zu werden, wenn diese Eigendefinition Cäsars ernst genommen würde14, - allerdings mit derjenigen Modifikation, die schon Cäsars Zeitgenossen vornahmen: Sie nahmen zwar zur Kenntnis, daß Cäsar nicht als Geschichtsschreiber, sondern als Frontberichterstatter gelesen werden wollte, aber sie erkannten gleichzeitig, daß seine Variante dieser Textgattung die alte Form zerbrach und sie zu etwas Neuem aufhöhte und veredelte, daß hier eine Alltagsform schriftlicher Zweckkommunikation zu Litera-
12
Vgl. Knoche, U., Caesars Commentarli, ihr Gegenstand und ihre Absicht, jetzt in: WdF Caesar, S. 231 f.; Mensching, E., Caesars Interesse an Galliern und Germanen, GGA 227,1975, S. 16-18. 13 Vorzügliche Aufarbeitung dieser Frontberichte an Hand des geringen Materials (vor allem Cicero-Briefe) bei Rambaud (s. Anm. 3), S. 19-43. 14 Vgl. Raaflaub, K., Rezension zu Szidat (s. Anm. 26), Gnomon 47, 1975, S. 271: das „BG, in dem eben nicht von den Ereignissen distanzierte Historiographie, sondern der für ein bestimmtes Publikum und in einer bestimmten politischen Situation verfaßte Tatenbericht eines um Anerkennung ringenden Feldherm vorliegt".
(BG11-29: Der Helvetierzug)
531
tur transzendiert wurde 15 , so wie es andere mit anderen Alltagsformen getan hatten: Cicero mit dem Brief, Ennius mit dem Gespräch (sermo) u.dgl. Dies sollten auch wir erkennen und aufhören, Cäsar einen Geschichtsschreiber zu nennen. Zurück zum fortissimi-Sa.tzl - Wir sagten: Cäsar hat den militärischen Gesichtspunkt gleich zu Beginn des Gesamtwerks offensichtlich bewußt so stark akzentuiert. Er legt damit die thematische Ebene der gesamten Schilderung des .Bellum Gallicum' eindeutig fest: Beschränkung auf das Nurmilitärische und Ausschluß nicht etwa nur des Erbaulichen in allen seinen Variationen, sondern sogar des spezifisch Politischen. Das bedeutet für unsere Frage von vorhin: Cäsar will sich im .Bellum Gallicum' ausschließlich als F e l d h e r r darstellen. Aber als was für ein Feldherr! Dies nun klärt der propterea-quod-Satz. Dieser Kausalsatz klingt auf den ersten Blick ganz harmlos und selbstverständlich. Er scheint lediglich eine Erklärung der besonderen Tapferkeit der Belgier zu geben: Die Belgier sind deswegen die tapfersten Gallier, scheint er nur zu sagen, weil ihre Distanz zur provincia am größten ist, und diese Distanz wird unter den drei einander ergänzenden Aspekten der großen Kulturferne (longissime absunt), der Industrieferne (die effeminandos am'/nos-Wendung) und der Germanennähe (proximique sunt Germanis) beleuchtet. Diese Erklärung scheint ganz simpel zu sein. Aber der Satz leistet mehr als diese Erklärung. Er hat mehrere Ebenen. Ich hebe drei davon heraus. Auf der ersten Ebene bringt er eine Fülle von impliziten Detail-Informationen: 1. Die Belgier wohnen am weitesten von der römischen Provinz entfernt. Wer außerhalb der Provinz wohnt, hat an cultus und humanitas keinen Anteil. Die Belgier haben daran also am wenigsten Anteil. Wer am wenigsten Anteil daran hat, ist am tapfersten. - Ferner: In Gallien ziehen mercatores durch das Land. Dieser Handelsverkehr geht von der römischen Provinz aus. Wer in Gallien am weitesten von der Provinz entfernt wohnt, lebt am Rande des Weltmarktes. Wer am Rande des Weltmarktes lebt, hat die größte Chance, urwüchsig und primitiv zu bleiben. Denn der von den Römern beherrschte Weltmarkt ist ein Markt denaturierender Produkte. - Schließlich: Die Belgier leben dicht neben den Germanen. Die Germanen leben jenseits des Rheins. Wer Nachbar der Germanen ist, hat die größte Chance, sich seine männliche Tapferkeit zu bewahren. Denn 15 Cie. Brut. 262: Sed dum voluti alios habere parata, unde sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fonasse fecit, qui illa volent calamistris inurere: sanos quidem homines a scribendo deterruit. - Hirt. BG VIH praef. 5: qui (sc. commentarti) sunt editi ne scientia tantarum rerum scriptoribus deesset, adeoque probantur omnium iudicio, ut praerepta, non praebita facultas scriptoribus videatur.
532
Zu Cäsars Erzählstrategie
75 er muß I ständig mit den Germanen Krieg führen. Ständige Kriegführung mit den Germanen verbürgt in Gallien ein Höchstmaß an Tapferkeit. Der absolute Maßstab kriegerischer Tapferkeit ist also das Volk der Germanen. Die Allertapfersten sind sie. Das sind die wichtigsten Informationen, die der Satz in seinen drei Einzelsträngen zusammenpreßt. Und dies ist die erste Ebene des Satzes: die Ebene der reinen Informationsvermittlung. 2. Darüber liegt aber noch eine zweite Ebene. Mit ihr kommen wir der Frage, als was für ein Feldherr Cäsar sich darstellen will, ein Stück näher. Was leistet denn der Kausalsatz über die reine Informationsvermittlung hinaus? Oder anders gesagt: Was wird mit dieser Informationsvermittlung erreicht? Machen wir die Eliminationsprobe: Hätten wir nur den Satz Horum omnium fortissimi
sunt Bel-
gae ohne den Kausalsatz, so hätten wir einen traditionellen römischen Frontbericht, nicht mehr. Der nachgeschobene Kausalsatz aber stößt über die traditionelle Gattung hinaus. Indem er eine Begründung gibt, und zwar in der Form einer umfassenden soziokulturellen Analyse - wie wir gesehen haben - , schafft er Hintergrund. Mit der Informationsvermittlung des Kausalsatzes ist ein ganzes Panorama des Kriegsschauplatzes entworfen und zugleich zu Rom in Beziehimg gesetzt16. Auf den Autor bezogen heißt das: Cäsar stellt sich mit dem Kausalsatz als der analysierende, der begreifende Feldherr dar, als der Intellektuelle, der die Uniform des Generals nur übergezogen hat. Offenbar will Cäsar gleich zu Beginn des Werks dem Leser gegenüber eines ganz deutlich werden lassen: Hier spricht nicht ein alter Haudegen, der verläßlich sein Kriegshandwerk betreibt, ohne allzusehr nach den Kausalzusammenhängen zu fragen, sondern hier spricht ein Angehöriger der hochgebildeten römischen Oberschicht, ein Mann, der gewohnt Montgomery (s. Anm. 10) hat in Cäsars Darstellung von „Verhältnissen, die er selbst in dem betreffenden Augenblick nicht kannte" (S. 67), „zwei grundlegend verschiedene Techniken der Erzählung" (S. 70) ausgemacht: eine mehr .einseitige' Erzähltechnik, bei der der Erzähler sein eigenes schrittweises Hineintasten in das Unbekannte in strenger Beschränkung auf die Perspektive des Selbsterlebten wiedergibt, und eine Technik des „allgemein orientierenden, epischen" (S. 72) Überblicks; diese Zweiteilung kehrt in der Terminologie Görlers (s. Anm. 1) als „personale Innensicht" (S. 101) und „auktoriale Perspektive" (S. 117 u. ö.) wieder. Die erste Erzählweise steht, wie Montgomery (S. 71) mit Recht feststellt, der militärischen Frontberichterstattung nahe (Ciceros Kilikienberichte z. B. „spiegeln [...] nur die äußeren Manifestationen feindlicher Angriffsbewegungen in all ihrer Undurchsichtigkeit": S. 59), die zweite Erzählweise erinnert an die .olympische Allwissenheit' (Görler, S. 102 mit Anm. 18) des Epikers (Montgomery, S. 72) oder des „klassischen Historiographen" (Görler, S. 116). Es ist deutlich, daß unser Kausalsatz die zweite Erzähltechnik repräsentiert.
(BG11-29:
Der
Helvetierzug)
533
ist, Dinge und Menschen als Bestandteile eines umfassenden Beziehungsnetzes zu sehen und erst aus solcher rationaler Analyse heraus Feststellungen zu treffen. Cäsar macht durch diese Betonung s e i n e r Sicht der Feldherrnschaft gleich im Anfang des Werkes klar, daß er die Feldherrnschaft nur als eine von vielen Möglichkeiten seiner Persönlichkeitsentfaltung ansieht, nicht als Wert sui generis oder gar als Berufung. Indem er klarstellt, daß die Kategorien seines Denkens weit über das Nurmilitärische hinausgehen - besonders eindrücklich tut er das durch die lapidare Kulturkritik der effeminandos animos-Wendung - , indem er also dies klarstellt, präsentiert er sich den Lesern - und das heißt in erster Linie seinen Standesgenossen im römischen Senat - als Mann der souveränen Analyse und Synthese, der selbstverständlich im Amt des Imperators nur eine Durchgangsstation sehen wird. Damit haben wir die zweite Ebene des Kausalsatzes bloßgelegt. Wir können sie die Ebene der Selbstdarstellung nennen. Und wir wollen festhalten: Kausalsätze dieser hintergrundschaffenden Art durchziehen das Werk fast von Kapitel zu Kapitel. Sie sind ganz allgemein die Gefäße der Analyse und der Reflexion. Wenn wir Cäsars schriftstellerische Eigenheit und zugleich Cäsars Persönlichkeit erfassen wollen, werden wir also diese Sätze ganz besonders beachten müssen. Denn in ihnen spiegelt sich der geistige Horizont dieses Mannes, der da scheinbar vor unseren Augen nur Legionen hin- und herführt, Lager aufschlägt und abbricht und die Gallier mit schadenfroher celeritas schockiert. 3. Von der zweiten Ebene des Kausalsatzes aus, also von der Ebene der Selbstdarstellung aus, wird nun auch die dritte Ebene des Satzes verständlich. Ich möchte sie die Ebene der strukturierenden Vorplanung nennen. Mit ihr kommen wir in die Nähe der eingangs gelstellten Frage, wie die drei verschiedenen 76 Erzählstränge, die vom 1. Kapitel ihren Ausgang nehmen, im 1. Kapitel angesetzt werden. Das Kapitel beginnt mit dem Begriff Gallia. Dieser geographische Begriff wird in den folgenden Sätzen zwar ethnographisch differenziert, aber er wird nicht übersprungen, d. h. am Ende des horum omnium fortissimi-Satzes, wenn der Stammesname Belgae fällt, befinden wir uns immer noch im Bereich des GaZ/ia-Begriffs. Aus diesem Begriffsbereich heraus führt wiederum erst der propterea-quod-SdAz. Denn an seinem Ende steht der Begriff Germani. Langsam wegführend von cultus und humanitas bringt der Kausalsatz die Germanen ins Blickfeld. An die Seite des Ga//i'a-Begriffs hat sich am Ende des Kausalsatzes der Germania-Begriff gestellt. Und zwar nicht mechanisch-additiv, sondern über das logische Mittelglied der Kampfkraft. Die Germanen sind eingeführt als
534
Zu Cäsars Erzählstrategie
absoluter Maßstab kriegerischer Tapferkeit. Wer in Gallien besonders tapfer ist, der ist es, weil ihn die Germanen dazu zwingen. Was erreicht Cäsar mit dieser Einfuhrung der Germanen? - Erstens den Eindruck, daß es sich bei den gallischen Stämmen, von denen er berichtet, um ein äußerst gefährliches Potential handeln müsse; denn Völker, die ständig Krieg mit den Germanen führen (quibuscum continenter bellum gerunt), sind fast so gefährlich wie die Germanen selbst, es sind Fast-Germanen Zweitens erreicht er, daß der Leser gleich zu Beginn des Werks als die eigentliche, latente Drohung die Germanen im Bewußtsein speichert. Beides zusammengenommen bedeutet, daß Cäsars Gallischer Krieg von allem Anfang an in einer Dimension gesehen werden soll, die der zeitgenössische Römer auf Grund seines tiefsitzenden Germanentraumas ohne weiteres als weltgeschichtlich bezeichnet hätte, ein Krieg nämlich zur Abwehr der existenzbedrohenden Germanengefahr17. Damit ist nun zugleich die Frage angeschnitten, wie die drei genannten Erzählstränge im 1. Kapitel angesetzt werden. Zuerst zum Germanenfeldzug: Der Germanenfeldzug des 1. Buches wird nicht etwa als Programmpunkt, also formal, angekündigt. Anders: Der ganze Kampf gegen die Germanen wird im 1. Kapitel bereits so zwingend kausal mit dem Kampf gegen die Gallier verknüpft, daß der Germanengroßteil des 1. Buches, der Feldzug gegen Ariovist, wenn seine Erzählung beginnt, dem Leser nur als längst erwartetes erstes Glied einer Kette erscheinen muß18. Das ist das, was ich strukturierende Vorplanung genannt habe, und damit haben wir die dritte Ebene des Kausalsatzes erfaßt. 17 Die häufig diskutierte Frage, ob die starke Betonung der Germanengefahr historisch gesehen eine propagandistische Übertreibung war oder nicht (s. z. B. Timpe, D., Caesars gallischer Krieg und das Problem des römischen Imperialismus, Historia 4, 1965, S. 198. 201 f.; Raditsa, L., Julius Caesar and his Writings, ANRW (s. Anm. 6), I 3, 1973, S. 420. 423 ff.; E. Täubler, Bellum Helveticum. Eine Cäsar-Studie, Gotha - Stuttgart 1924, hat m. E. zu Recht betont, daß Cäsars große analytische Leistung gegenüber seinen Zeitgenossen gerade in der historisch richtigen Einschätzung dieser Gefahr bestand), diese Frage kann hier außer Betracht bleiben; es geht hier nicht um die Rekonstruktion der historischen Realität, sondern der schriftstellerischen Intention. Und da scheint mir deutlich, daß Cäsar gleich hier am Werkbeginn ein Beispiel dafür gibt, wie er „den unvoreingenommenen Leser in den Bann [zwingt], die Dinge so zu sehen, wie der Verfasser will" (Geizer, Caesar, S. 155), indem er nämlich „durch die Beschwörung der Ereignisse von 107 und die Dramatisierung der .Gefahr aus dem Norden' offensichtlich von vornherein an die großen Erfolge des Marius anzuknüpfen [versuchte]" (Raaflaub [s. Anm. 14], S. 265). Dies hatte - ohne eingehendere Interpretation - bereits E. Norden erkannt; seine Folgerung, „das Germanentum ist im ersten Buche und auf weite Strecken des zweiten das eigentliche Leitmotiv, das ihnen vom Standpunkt des rückschauenden Beobachters einen weltgeschichtlichen Hintergrund verleiht" (Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania, Leipzig -
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
535
Ich ziehe zunächst das Fazit aus der Analyse des propterea-quod-Salzes: Cäsar stellt sich mit diesem Satz dar als der informierende, analysierende, planende Intellektuelle im Uniformrock des Generals. Er stilisiert sich als der umsichtige Stratege 19 . Und es scheint so, als ob er auch seine Erzählung strategisch angelegt hätte. Darauf führte jedenfalls die Befragung des propterea-quod-Saizes nach seiner Strukturierungs-Funktion. Denn die Art, wie Cäsar von den Galliern zu den Germanen überleitet, hat mit dem Zufälligkeitscharakter eines Berichtsoder Chronik-Stils ganz gewiß nichts gemein. Der Leser wird hier zu einer ganz bestimmten Sicht der Phänomene genötigt. Auch Cäsars Erzählung scheint also von Strategie bestimmt zu sein. Wenn das so ist, dann allerdings ist, wie mir scheint, die ganze Problematik der .déformation historique' überwunden. Die Kleinlichkeit der Fälscherhypothese fällt in die Augen 20 . Der Begriff der Erzählstrategie kann die Kontroverse um Cäsars Glaubwürdigkeit auf eine Ebene heben, die dem Mann mit Sicherheit gemäßer ist. I Sehen wir zu, ob die Helvetierfeldzugschilderung weiteren Aufschluß geben kann. Sie läßt sich unterteilen in 8 Akte:
Berlin 2 1922, S. 362), stützte sich auch auf sein Verständnis des Einleitungskapitels; wenn Täubler (s. Anm. 17) diese Folgerung Nordens eine „falsche Germanenprämisse" nennt, die sich aus den „beiläufigen Bemerkungen" über die Germanen als „Gradmesser der Tapferkeit der gallischen Volksstämme" (so Norden a. O.) mitnichten ergebe (Täubler, S. 165), verkennt er Cäsars Erzählstrategie. Diese Strategie legt es ja gerade darauf an, die explizite Begründung einer Aktion nicht abrupt und unvorbereitet zu geben, sondern sie durch das vorzubereiten, was Täubler „beiläufige Bemerkungen" nennt; sehr gut Mensching (s. Anm. 12): „... die Beweisführung [...] wird [...] um so wirkungsvoller, je weniger sie als Argumentation zu erkennen ist" (S. 11). Wenn der Leser in I 33 das Argument .Germanengefahr' e x p l i z i e r t erhält (... neque sibi homines feros ac barbaros temperatures existimabat, quin cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in provinciam exirent at que inde in It al i am co η tenderent) enthält es für ihn keinen wesentlichen neuen Gesichtspunkt mehr, die Gefahr eines Leserwiderspruchs gegen die Autor-These ist damit unterschwellig bereits abgeschwächt. Vgl. auch unten Anm. 22. 19 Vgl. Veith, G„ Caesar als ,Vater der Strategie', jetzt in: WdF Caesar, S. 372-378: „Hier ist freilich reinste Individualität im Spiele: das ist nicht mehr römische - das ist caesarische Strategie. Spezifisch caesarisch überhaupt alles das, was sich nicht in Regeln fassen läßt und dennoch oder eben darum das Höchste ist: die Schablonenfreiheit der Kriegführung [...], die Kunst, den Gegner jedesmal zu durchschauen und sich selbst niemals durchschauen zu lassen ..." (S. 374). 20 Sorgfältige h i s t o r i s c h e Analyse ist seit langem schon zum gleichen Ergebnis gekommen: „Es zeigt sich einmal mehr (fern jeder kleinlichen Schnüffelei nach vermeintlichen Fälschungen), daß Caesar [...] in der Auswahl, Anordnung und Bewertung richtig überlieferter Tatsachen mit größter Kunst sein bestimmtes Bild der Ereignisse dem Leser zu suggerieren versucht" (Timpe [s. Anm. 17], S. 202).
536 M
M
M
Zu Casars Erzählstrategie
I.
Vorgeschichte vor Cäsars Ankunft in Gallien
2-6
Π.
Erster militärischer Teilerfolg Cäsars bei Genf
7/8
m.
Bericht über die Feindplanung
IV.
Zweiter militärischer Teilerfolg Cäsars am Arar
10-15
Diplomatischer Erfolg Cäsars (Dumnorix): Isolierung der Helvetier
16-20
Gesamtsieg Cäsars bei Bibracte. Kapitulation der Helvetier
21-27
v. VI. VII.
vin.
9
Zwangsrücksiedlung der Helvetier
28
Kriegsbilanz
29
(M =,Motivationsblock')
Was sofort ins Auge springt, ist, daß nicht ein ununterbrochener ereignisaufzählender militärischer Tatenbericht gegeben wird. Ein solcher hätte etwa so gelautet: „Im Begriff, meine Statthalterschaft der beiden Gallien und Illyricums anzutreten, erhielt ich in Rom eine Meldung, wonach unsere jenseitigen gallischen Besitzungen unmittelbar bedroht waren durch einen Auswanderungs- und Durchmarschplan des Stammes der Helvetier. Der Tag X für die Realisierung dieses helvetischen Planes war der 28.3.58. Ich brach sofort von Rom auf, verhinderte den Rhöneübergang der Feinde, machte ein Viertel von ihnen am Arar nieder, verfolgte sie bis Bibracte und schlug sie vernichtend. Was von ihnen noch am Leben war, ließ ich ins ursprüngliche Siedlungsgebiet zurückkehren."
Angereichert mit diesen und jenen Einzelheiten wäre das - soweit wir aus den kargen überlieferten Parallelen schließen können - der Duktus traditioneller militärischer Frontberichterstattung gewesen. Cäsar will jedoch mehr. Vor die Erzählung des Beginns der Kampfhandlungen schiebt er eine Vor-Information (Kap. 2-6), in den Bericht der Kampfhandlungen hinein schiebt er zweimal eine Zwischen-Information (Kap. 9 und Kap. 16-20). So weit die rein formale Beschreibung des Tatbestands. Wir fragen nunmehr nach der Funktion dieser vorgeschalteten und eingeschobenen Teile. Zunächst die Kapitel 2-6. Sie bringen die Vorgeschichte der ersten Amtshandlung Cäsars, sie betten diese erste Amtshandlung in ihren historischen Kontext ein und machen sie so verständlich. Aber nicht so, wie etwa Frankel meint, wenn er sagt, Orgetorix werde eingeführt, weil für Cäsars „Geschichtsauffassung ein ehrgeiziger Mann mindestens als auslösender Faktor notwendig war"
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
537
und „weil die Parallele mit Casars eigenem Aufstieg" nahelag 21 . Das kann nicht schon der ganze Grund sein. Nur die Persönlichkeit eines verstorbenen Helvetierfursten vorzuführen, - das wäre ziemlich oberflächlich. Was Cäsar I vielmehr mit dieser Vorgeschichte vorführen will, das ist die geschichtliche Konstellation, innerhalb deren und als deren Exponent seinerzeit Orgetorix operierte. Diese Konstellation war folgende: erstens gehörten die Helvetier zu den tres potentissimi et filmissimi populi in Gallien (3,8) - zusammen mit den Haeduem und den Sequanern - , zweitens litten sie unter Raumnot (Kap. 2), drittens waren die Helvetier mit der stammesübergreifenden Verschwörung des Orgetorix die Keimzelle einer romgefahrdenden gesamtgallischen Union 22 . Und diese Konstellation - das ist entscheidend - lebt auch nach Orgetorix' Tod weiter 23 ! Aggressivität und Raumnot haben bei den Helvetiem auch jetzt wieder zu jenem alten Auswanderungsplan geführt. Auch jetzt wieder - so suggeriert Cäsar durch die Vorgeschichte - könnten die Helvetier also den Funken liefern für eine pangallische Einigungsbewegung, wie schon damals unter Orgetorix, Casticus und Dumnorix. D a r u m sind sie für Rom so gefährlich, - und d a r u m ist der Kampf gegen sie nicht ein unbeachtliches kleines Scharmützel, sondern eine unbedingte Notwendigkeit von politischer Tragweite. So hat Cäsar seine erste Amtshandlung in
21
Fränkel, H., Über philologische Interpretation am Beispiel von Caesars Gallischem Krieg, jetzt in: WdF Caesar, S. 178. 22 1 2,1-2: (Orgetorix civitati Helvetiorum) persuasit, ut [...] exirent: perforile esse [...] totius Galliae imperio potiri. - I 3,8: (Orgetorix Casticus Dumnorix) inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse speroni. - D. E. Koutroubas, Die Darstellung der Gegner in Caesars .Bellum Gallicum', Diss. Heidelberg 1972, S. 10-19, behauptet, „Caesar verschweigt also das wirkliche Ziel des Planes des Orgetorix, die Einheit und Unabhängigkeit Galliens" (S. 18) und „er verbirgt... den wirklichen Grund der römischen Erregung" (S. 16). Damit ist der latente Suggestionseffekt der Erzählung m. E. ganz verkannt: die immanente Erzählstrategie führt den intelligenten Leser notwendig zu gerade den SchluBfolgerungen, die Koutroubas in Cäsars Darstellung vermißt, und dies viel zwingender, als es eine explizite Benennung der Feindmotive vermöchte; denn diese hätte Thesencharakter und wäre damit diskutierbar, durch die einschleichende Suggestion dagegen wird die Geschehensdeutung des Autors („gemeinkeltisches Bewußtsein" schon Täubler [s. Anm. 17], S. 32-41. 51) aus dem Bereich der Diskutierbarkeit von vornherein herausgehoben (vgl. Menschings Formulierung, oben Anm. 18). Die suggestive Erzählstrategie erweist sich damit als die übergeordnete Strategie der „Widerspruchsmilderung" und „Bestätigungsintensivierung" (Mutschier, F.-H., Erzählstil und Propaganda in Caesars Kommentarien, Heidelberg 197S, S. 242), und der von Mutschier überzeugend aufgewiesene Stilzug des ,geschehensnahen Erzählens ' stellt offenbar nur e i η e s der Mittel dieser Gesamtstrategie dar. 23 Von einer „ g e r i n g e n Nachwirkung von Orgetorix über seinen Tod hinaus" (Fränkel [s. Anm. 21], S. 178 Anm. 9) kann also keine Rede sein. Die funktionelle Bedeutung des OrgetorixBerichts betont auch Montgomery (s. Anm. 10), S. 63 (mit Anm. 35).
78
538
Zu Casars Erzählstrategie
Gallien, den Schlag gegen die Helvetier, durch die Vorschaltung der Vorgeschichte in eine ganz andere Dimension gerückt. Erzähltechnisch bedeutet dieses Vorgehen folgendes: Rückgriffe auf Ereignisse, die vor dem Berichtszeitraum liegen, sind nicht etwa aus Vervollständigungsstreben gemacht, sondern sie lassen ein Ereignis, das innerhalb des Berichtszeitraums liegt, als Teilstück einer einheitlichen Entwicklungslinie erkennen, die außerhalb des Berichtszeitraums begann. Das berichtete Ereignis verliert dadurch seinen Zufälligkeitscharakter. - Eine solche Erzählweise ist unstreitig das Resultat einer genauen Planung. Nun zum zweiten der eingeschobenen Teile, dem Kap. 9. - Am Ende von Kap. 8 ist eine Patt-Situation beschrieben. Die Helvetier haben den RhoneÜbergang versucht, sind aber immer wieder zurückgeschlagen worden. Irgend etwas muß nun geschehen. Aber von Seiten der Helvetier. Und es geschieht auch etwas: In Kap. 10 berichtet Cäsar, die Helvetier hätten nun doch ihren Plan Nr. 2 realisiert, nämlich durch das Gebiet der Sequaner und Haeduer zu ziehen. Warum aber zwischen Kap. 8 und 10 das ganze Kap. 9 mit seiner Wiedergabe der Überlegungen des Haeduers Dumnorix? Wozu diese Unterbrechung (oder Ausbuchtung) des bis dahin streng linearen Handlungsablaufs? Wozu die Vorgeschichte der Durchmarscherlaubnis durch das Sequanergebiet erzählen? Hätte es nicht genügt, den Durchmarsch der Helvetier durch das Sequanergebiet als Faktum zu geben? Ausgeschlossen. Denn die Vorgeschichte enthielt ja gerade das Wesentliche. Der Helvetier O r g e t o r i x hatte seinerzeit deswegen eine so große Gefahr für Rom dargestellt, weil er der Exponent gallischer Unionsbestrebungen gewesen war. Nach seinem Tode hat nun aber D u m n o r i x sein politisches Erbe angetreten: Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat et cupiditate regni adductus novis rebus studebat, et quam plurimas civitates suo benefìcio habere obstrictas volebat. Die Orgetorix-Linie setzt sich also in Dumnorix fort. Cäsar sieht wiederum die Gefahr einer pangallischen Staatsbildung am Horizont 24 . Dies gilt es im letzten zu verhindern. Und darum wird die Dumnorix-Geschichte erzählt und unmittelbar vor die Erzählung von Cäsars nächster Aktion gestellt, einer Aktion, die in der Tat eine starke Begründung braucht: die Überschreitung der Provinzgrenze25. 24
Zur Funktion der Orgetorix-Dumnorix-Linie (Unterstreichung der Romgefährdung) jetzt auch die breiten Ausführungen von Friederike Heubner, Das Feindbild in Caesars Bellum Gallicum, Klio 56, 1974, S. 129-149. 25 Die latente Rechtfertigungsabsicht in der Darstellung der Ereignisse vor dem Grenzübertritt ist gut herausgearbeitet bei Klotz, Α., Caesarstudien, Leipzig - Berlin 1910, S. 22 f., 24 f. Der Widerspruch von Collins, J. H., Caesar as Political Propagandist, ANRW (s. Anm. 6), I 1,
(BG11-29:
Der
Helvetierzug)
539
Auch hier erkennen wir also das Prinzip der schriftstellerischen Planung. Motivationen des gegnerischen Handelns verdanken ihre Darlegung nicht etwa dem Komplettierungseifer des gewissenhaften Chronisten, sondern sie sollen Casars eigenes Handeln - sein I So-und-nicht-anders-Handeln - erklären, und zwar auf 79 einer übermilitärischen Ebene erklären - , so daß Cäsar eben nicht als von Fall zu Fall reagierender Heerführer, sondern als intellektuell weitausgreifender vorausschauender Politiker erscheint, der das gesamte Motivationsgeflecht auch seiner Gegner in seine eigene Kalkulation einbezieht26. Dies zeigt sich nun noch deutlicher an dem dritten der Einschübe, die ich vorhin aufzählte, d.h. an den Kap. 16-20. Diesen Kapiteln sind in letzter Zeit zwei gesonderte, ausführliche Behandlungen zuteil geworden27. Für meinen Zweck genügt es, folgendes festzuhalten: Die Kap. 16-20 sind ebenfalls (wie Kap. 9) formal gesehen eine Unterbrechung des Schlachtfeldberichts, sie sind aber ebenfalls keine Unterbrechung des Feldzugsberichts. Sie geben nämlich dem Leser Einblick in die Grundkomponenten der gallischen Innenpolitik. Sie decken die beiden Hauptströmungen gallischer Politik auf: die bedingt prorömische, repräsentiert durch Liscus und Diviciacus, und die nationalpatriotische antirömische Richtung, repräsentiert durch Dumnorix. Die Dumnorix-Geschichte der Kap. 16-20 ist also wieder nicht nur eine Geschichte, sondern sie ist zugleich wieder ein Beleg für etwas, was über ihr steht. Sie legt die politischen Motiwerflech-
1972, S. 927-929, und seine Gegenthese, der Grund für die DetailfUlle der Einleitungskapitel sei einfach das Streben nach umfassender Sachinformation des Lesers am Werkbeginn, verkennt m. E. den ungewöhnlich starken Motivierungswillen, den das komplexe Kausalgeflecht gerade dieser Kapitelfolge verrät. Gegen Collins (mit anderen Gründen) auch Walser, G., Caesar und die Germanen. Studien zur politischen Tendenz römischer Feldzugsberichte, Wiesbaden 1956 (= Historia. Einzelschriften, H. 1), S. 7 (Collins' oben zitierter Aufsatz ist eine Bearbeitung seiner bereits 1952 publizierten Dissertation); Geizer, Caesar, S. 94 mit Anm. 7; Timpe (oben Anm. 17), S. 205; Görler (oben Anm. 1), S. 105.117. 26 Diesen Motivierungswillen hebt - mit anderer Akzentuierung - besonders Görler (oben Anm. 1), S. 105 (mit einem erhellenden Howald-Zitat), hervor. - Vgl. auch Szidat, J., Caesars diplomatische Tätigkeit im Gallischen Krieg, Wiesbaden 1970 (= Historia. Einzelschriften, H. 14), S. 100 ff., und Raaflaub (s. Anm. 14), S. 264. 27 Schönberger, O., Caesar, Dumnorix, Diviciacus. Zu Caesar, De bello Gallico I 16-20, Anregung, Zeitschrift für Gymnasialpädagogik, Heft 6/71, S. 378-382; Mutschier (s. Anm. 22), S. 151-154.
540
Zu Cäsars Erzählstrategie
tungen frei, die den Untergrund der militärischen Operationen bilden 28 . Der Komplex der Kapitel 16-20 macht klar, daß schon der 1. Feldzug Cäsars in Gallien überhaupt, der gegen die Helvetier, die gesamte gallische Problematik einer römischen Statthalterschaft in Gallien in nuce enthält - und daß dieser Feldzug gegen die Helvetier, so wie er von dem geführt wurde, der da schreibt, viel mehr war als eine militärische Operation, nämlich eine diplomatische Glanzleistung. Mit dieser Funktion gehören nun die Kap. 16-20 in eine Reihe mit dem Kap. 9, mit den Kap. 2 - 6 und mit dem propterea-quod-Saiz des 1. Kapitels: Diese Partien - man könnte sie .Motivationsblöcke' nennen - durchsetzen die reine Militärgeschichte in einer Funktion, die vergleichbar ist der der Reden in der .großen' Historiographie, d.h. sie legen die Tiefenstruktur des Oberflächengeschehens frei. Damit heben diese Motivationsblöcke Cäsars Schriften über das Niveau der Militärschriftstellerei weit hinaus. Sie zeigen, daß Cäsar nicht militärische, sondern politische Kriegsgeschichte schreibt, nicht als berufsmäßiger Militär, sondern als Politiker, für den auch der Krieg nur einer von vielen Faktoren seiner umfassend angelegten Strategie ist29. Die Existenz dieser Motivationsblöcke und ihre Position im Erzählablauf zeigen aber noch ein anderes. Wie wir mehrfach gesehen haben, nötigt Cäsar durch 28
Mutschier (S. 153 f.): Die Passage dient „dazu - durch das Wecken von Sympathie für Diviciacus zum einen, von Mitleid mit den gedemütigten Sequanern, und d. h. zugleich Empörung gegen den hochfahrenden Ariovist zum anderen - , den Leser auf die dann vor allem in Kap. 33 rational motivierte Entscheidung, gegen den Suebenfürsten vorzugehen, gefühlsmäßig vorzubereiten". Ich sehe die Funktion noch umfassender. 29 Als „the true tendance and propaganda of the Bellum Gallicum" bezeichnet Collins [ANRW (s. Anm. 6), I 1, 1972, S. 942] zu Recht den von Geizer (Caesar-Auswahl, Heidelberger Texte, Heidelberg 1948, S. 25) folgendermaßen formulierten Willen Cäsars: „Die Gegner sollen [...] erkennen, wie aussichtslos es ist, einen Mann von solchen Fähigkeiten und Machtmitteln politisch vernichten zu wollen." Durch trockene Faktenreporte hätte Cäsar diese Erkenntnis bei seinen Gegnern freilich nie erreicht. Durch die .Motivationsblöcke' aber imponiert er. Es ist bezeichnend, daß er sie nur zur Motivation des eigenen Handelns einsetzt. Bei der Darstellung von Aktionen seiner Unterbefehlshaber legt er, wie Montgomery (s. Anm. 10, S. 69. 71) gezeigt hat, den Hauptakzent auf deren Unfähigkeit zur Motivanalyse des feindlichen Handelns und zur politischen Konstellationsanalyse ganz allgemein; dadurch macht er den gewaltigen Unterschied zwischen ihrer und seiner eigenen intellektuellen Potenz evident. Wenn Rambaud (s. Anm. 3, passim) gerade in denjenigen Werkteilen, die ich .Motivationsblöcke' nenne, Cäsars Geschichtsfälschung am Werke sieht, so drückt sich darin sein ganzes kategoriales Cäsar-Mißverständnis aus: der Vorwurf muß auf doppelte Weise ins Leere stoßen, weil erstens gerade in deutenden Analyseteilen (wie etwa den Reden bei Thukydides) Fälschung am schwierigsten nachweisbar wäre, zweitens Cäsar mit seinen Analyseteilen gerade nicht, wie Thukydides, aus Forschergeist heraus auf historische Wahrheitssuche aus ist, sondern aus persönlichem Interesse heraus auf politische Wirklichkeitsveränderung. Der Fälschungsvorwurf geht also an Cäsar ganz vorbei.
(BG11-29:
Der
Helvetierzug)
541
diese Partien dem Leser eine ganz bestimmte Sicht der Dinge auf: Das begann schon mit der Wortstellung des Adjektivs fortissimi im 1. Kapitel, und das setzte sich fort mit dem zweckvollen Einschub des Feindplanungskapitels 9 unmittelbar vor dem Grenzübertritt. Besonders deutlich aber wird diese erzählerische Suggestion Casars an dem einen Punkt, den ich bis hierher aufgespart habe, nämlich an der Art, wie Cäsar die drei Erzählstränge des 1. Kapitels miteinander verknüpft. Die Verknüpfung des Gallierstranges mit dem Germanenstrang hatten wir bereits erklärt. Noch offen geblieben ist die Frage nach der Art, wie der zweite Großteil des 1. Buches, der Helvetierfeldzug, im 1. Kapitel verankert ist. Zunächst möchte es so scheinen, als erfolge diese Verankerung rein äußerlich: „Am tapfersten von den Galliern sind die Belgier, weil sie ständig mit den Germanen im Krieg stehen. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt ..." Der Übergang klingt ein wenig krampfhaft: Von den Galliern insgesamt über die Kampfkraft der Belgier zu den Germanen - das scheint noch konsequent; aber dann plötzlich, scheinbar ganz assoziativ, I die Wendung zu 80 den Helvetiern: „deswegen sind auch die Helvetier so tapfer" usw. Da meint man geradezu ein »übrigens' zu hören. Ist das also nur eine oberflächliche Verknüpfung, gemacht, um die beiden Großteile des 1. Buches schon im Eingangskapitel irgendwie zusammenzubinden - und sei's auch nur durch bloße Nennung der beiden Völkernamen Germani und Helvetii30! Gemacht also nur, um die Hauptthemen des 1. Buches zu benennen, also als Inhaltsangabe? Nachdem wir gesehen haben, daß Cäsar nicht zu den katalogisierend erzählenden Schriftstellern gehört, werden wir skeptisch sein. Cäsar erzählt nun einmal nicht formal-additiv, sondern kausal. Der Schluß liegt also nahe, daß die Art der Verknüpfung der Helvetier mit den Germanen über das Zwischenglied des Kampfkraft-Topos (fortissimi) etwas Substanzielles aussagen will. Aber was? Eigentlich läßt sich das erst sehen aus der genauen Analyse der beiden getrennt erzählten Feldzüge selbst. Denn erst dann läßt sich erkennen, auf welche Weise die beiden Feldzugsschilderungen zusammengesehen werden können, wie sie also aufeinander bezogen sind. Eine solche ParallelAnalyse beider Feldzugsschilderungen kann ich hier nicht durchführen. Ich kann nur versuchen, vom Schluß der Helvetierfeldzugsschilderung her das dennoch Planvolle dieser scheinbar assoziativen Helvetier-Germanen-Verknüpfung des 1. Kapitels zu zeigen. Was sagt nämlich Cäsar im Schlußteil seines Berichts (Kap. 28) über die Beziehung zwischen Helvetiern und Germanen? Er hat die Helvetier, die noch üb30
So Täubler (s. Anm. 18).
542
Zu Casars Erzählstrategie
rig waren, wieder zurücksiedeln lassen und hat sie durch eine Art MarshallPlan-Hilfe auf eine nationale Wiederbelebung hinprogrammiert. Dann kommt die Begründung für diese scheinbar philanthropische Haltung (28,4):„Dies tat er vor allem aus der Überlegung heraus, weil er nicht wollte, daß das von den Helvetian verlassene Gebiet leerstünde (vacare), und damit nicht wegen der Güte des Bodens die Germanen, die jenseits des Rheins siedeln, aus ihrem Gebiet in das der Helvetier hinüberwechselten und so Nachbarn der Provinz und der Allobroger würden." Das also - aufgeschoben bis hier ans Ende des Feldzugsberichts - ist der eigentliche Grund für Cäsars Helvetierfeldzug. Nicht die möglichen Transitschäden, nicht der Schutz der socii usw. - Gründe, die Cäsar am Beginn des Feldzugs (Kap. 10) genannt hatte - , nicht sie sind die Ursache für Cäsars Eingreifen. Die Ursache sitzt tiefer: Es ist die Furcht vor dem Entstehen eines Siedlungsvakuums in der Schweiz. Denn dieses Siedlungsvakuum würde mit Sicherheit die Germanen anziehen. Die Verhinderung der helvetischen Umsiedlung entpuppt sich von hier aus als die Verhinderung einer germanischen Expansion. Der Helvetierfeldzug ist also ein präventiver Germanenfeldzug. Und damit ist der Helvetierfeldzug mittelbar schon der erste Schlag gegen die Germanen. Die beiden Feldzüge, der gegen die Helvetier und der gegen die Germanen, sind also nicht zwei innerlich voneinander unabhängige Operationen, sondern sie gehören wesensmäßig zusammen, der erste ist das Vorspiel des zweiten. Alles, was das Hegemoniestreben der Germanen über Gallien unterstützen könnte, muß im Keim verhindert werden. Die ungehinderte Auswanderung der Helvetier wäre eine ungeheure Unterstützung des germanischen Hegemoniestrebens gewesen. Deswegen mußte sie vereitelt werden 31 . Sollte Ariovist tatsächlich „nach dem Auszug der Helvetier [...] nicht in das verlassene Gebiet nachgedrängt" sein (Walser [s. Anm. 25], S. 4), so würde das natürlich wiederum nichts gegen das hier vertretene Textverständnis besagen. Es kommt hier nicht darauf an, was war, sondern was Cäsar .sein' lassen wollte. Das Recht, die Wirklichkeit zu strukturieren, darf Cäsar nicht abgesprochen, sondern muß ihm auf Grund seiner praktischen Zielsetzung in noch höherem Maße zugestanden werden als etwa Thukydides. - Geizer (Kleine Schriften Π, Wiesbaden 1963, S. 10 f.) vermißt bei „dem Strategen und Staatsmann vor allem den Hinweis auf die raumpolitische Bedeutung der Eroberung Galliens"; andrerseits sei es undenkbar, daß Cäsar dieses Motiv, das er „selbst nicht ausspricht", gar nicht gehabt haben sollte, da es ja in Rom zu dieser Zeit zum politischen Kampfinventar gehörte (z. B. Cie. prov. cons. 19 ff. - Pis. 81: (Caesaris) imperium [...] Germanorum immanissimis gentibus obicio et oppono). Dieser scheinbare Widerspruch löst sich, wenn man die hier vorgelegte ,erzählstrategische' Interpretation der Helvetierfeldzugsschilderung akzeptiert. Cäsar spricht das von Geizer vermißte Motiv eben sehr wohl selbst aus, nur implizit, - eben durch die immanente erzählerische Suggestion, er habe die reichsbedrohende Gefahr einer Germaneninvasion in helvetisches Gebiet hinein von Anfang an gesehen und daher die Auswanderung der Helvetier vereitelt. Den oberflächlichen Eindruck, die
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
543
Diese Beziehung zwischen den beiden Feldzügen ist es, die Cäsar - natürlich andeutend erst und vorerst nur ihm selbst voll verständlich - durch die Verknüpfung von Helvetiern und Germanen im 1. Kapitel ausdrücken will: Der Helvetierfeldzug als erster Teil des Abwehrkrieges gegen die Germanen. Gallier, Germanen und Helvetier werden im 1. Kalpitel in einer Weise miteinander verknüpft, die schon dort dem Leser die Deutung ermöglicht: der Gallische Krieg ist ein Präventivkrieg gegen die Germanen, und der Helvetierfeldzug ist sein erster Teil. Das ist Cäsars Intention schon im 1. Kapitel. Aber natürlich weiß Cäsar, daß der Leser diesen komplizierten Zusammenhang (den er ja selbst erst im nachhinein realisierte32) nicht so rasch begreifen kann. So führt er den Leser allmäh-
helvetische Auswanderung sei nur als Kaprice einer vaga gens zu werten (so Walser [s. Anm. 25], S. 5 f.), wollte Cäsar gerade nicht entstehen lassen. Was Rambaud ihm als Mangel an Tiefblick vorwirft, daß er nämlich „parle d'Arioviste indépendamment des Helvètes, et décrit la migration de ce peuple comme un fait isolé, produit par des causes locales" (s. Anm. 3, S. 98), gerade das hat Cäsar durch die oben dargelegte Verknüpfung von Helvetiern und Germanen vermieden. Wie er anders hätte vorgehen sollen, ist im Grunde auch gar nicht vorstellbar; denn da er u. a. die oben zitierten Reden Ciceros aus den Jahren 56 bzw. 55 natürlich kannte, hätte er die darin enthaltene Sinngebung seines Gallierkrieges ja in jedem Falle bei der Abfassung in das Werk hineinnehmen müssen, - selbst wenn sie nicht s e i n e Idee gewesen wäre; denn daß sie schlagkräftiger war als das alte bellum pro sociis gerere-Motiv (das Geizer ihm allein unterstellt: Kl. Sehr. Π, S. 7), stand wohl außer Frage. Es ist durchaus möglich, daß Cäsar bei Krìegsbeginn die Lage noch nicht so global überschaute und daß er realiter im Jahre 58 wirklich nur darauf aus war, die Helvetier „möglichst in einen Kampf zu verstricken, um dann durch ihre völlige Niederwerfung ein größeres politisches und militärisches Manövrierfeld zu bekommen" (so Szidat [s. Anm. 26], S. 144; zustimmend Raaflaub, Gnomon 47, 1975, S. 265. Ähnlich schon Täubler [s. Anm. 17], S. 18; Timpe [s. Anm. 17], S. 211. Wohl zu weitgehend dagegen Collins [s. Anm. 25], S. 932: „... he went to Gaul hoping for war, and [...], once there, he made war at his own good pleasure"). Es ist aber gerade bezeichnend, daß der Erzähler Cäsar dem Leser nicht die begrenzte militärisch-pragmatische Anfangssicht suggeriert, die der Feldherr Cäsar seinerzeit möglicherweise selbst hatte, sondern eine wesentlich universellere, kausale, ja teleologische Sicht: der Helvetierfeldzug als erstes Teilglied des Germanenfeldzuges. (Daß sich dem heutigen Historiker aus der globalen Retrospektive heraus genau die gleiche Sicht ergibt, zeigt z. B. Timpe, D., Zur Geschichte der Rheingrenze zwischen Caesar und Drusus, in: Monumentimi Chiloniense [= Festschrift E. Burck], Amsterdam 1975, S. 128: „Die caesarische Rheingrenzenpolitik hatte besonders am Oberrhein durchschlagenden Erfolg: Ariovist und seine Hilfsvölker wurden über den Rhein zurückgetrieben, den Helvetiern der Schutz wohl des Hochrheins übertragen [Gall. 1,28,4].") - Die Möglichkeit dieser Sichtweise stellt nebenbei (da sie geraumen Abstand von den Ereignissen voraussetzt) eine erneute Bestätigung der heute kaum noch bestreitbaren Ansicht dar, daß das Werk in seiner vorliegenden Gestalt erst im nachhinein und in einem Zug geschaffen ist (z. B. Mensching [s. Anm. 12], S. 18: „Die Abfassung des ganzen BG im Winter 52/51 ist unzweifelhaft"): die
544
Zu Casars Erzählstrategie
lieh an die Erkenntnis heran. Am Ende der Helvetierfeldzugsschilderung - nach all den Hintergrundinformationen und Motivanalysen, die das militärische Geschehen in seiner Martialität relativieren und es eher als sachlich-kühle Konsequenzvorgänge erscheinen lassen, - am Ende der Helvetierfeldzugsschilderung hat der Leser die Erkenntnis, die Cäsar intendiert hatte, voll und überzeugt in sich aufgenommen. Wenn das so ist, dann ist es das Ergebnis von Casars Erzählstrategie. Cäsar hat von Anfang an die Linie seiner Erzählung so ausgerichtet und so zugespitzt, daß an ihrem Ende diese von ihm gewollte Erkenntnis sich beim Leser einstellt. Das bedeutet: Cäsar legt nicht nur den Krieg selbst, sondern auch die Erzählung des Krieges strategisch an. Die Kriegsstrategie wird widergespiegelt in der Erzählstrategie. Oder anders herum: Die Erzählstrategie suggeriert dem Leser eine bestimmte Kriegsstrategie. So planvoll wie Cäsar Krieg führt und Politik betreibt, so planvoll schreibt er auch. Rationalität, Planung, Strategie - das ist die alles dominierende Persönlichkeitskonstante Cäsars. So ist Cäsar der Schriftsteller von Cäsar dem Feldherrn und Cäsar dem Politiker nicht verschieden. Und alle drei Lebensbereiche sind wiederum nur Teile einer Gesamtstrategie der Selbstverwirklichung. Nun versteht man auch, denke ich, warum es Cäsar gereizt hat, seine Kriege im Medium der Schriftlichkeit noch ein zweites Mal zu führen. Sich selbst komprimiert darzustellen, zusammengezogen und zusammengeballt in den engen Raum eines in ein paar Stunden zu bewältigenden Buches, und dabei die Kraft seiner strategischen Begabung nicht nur im Erzählten, sondern, viel suggestiver noch, im Erzählen auf den Leser zu übertragen - , das mußte ihn reizen. Denn eine solche immanente, nicht explikative Selbstdarstellung mußte seinen großen politischen Plänen und Ideen ja viel förderlicher sein als jedes Lob aus dem Munde anderer. Darum, glaube ich, hat Cäsar zum Mittel der literarischen Darstellung gegriffen. So wäre dann allerdings auch Cäsars Erzählstrategie nicht um ihrer selbst willen entwickelt worden, sondern sie wäre als Glied eines einzigartigen, für uns kaum noch begreifbaren Versuches einer allgemeinen Lebensstrategie entstanden. Möglich, daß Cäsar diese Strategie auf weite Strecken selbst nur in sein Leben hineingesehen hat 33 . Aber daß er das tat, zeigt, in welch großem Ausmaß
Einleitung, in der die aus dem nachträglichen Überblick über das fertige Gesamtwerk gewonnene prägnanteste Form der Sinndeutung gegeben wird (wie es z . B . in den Epenproömien der Fall ist), schreibt der Autor natürlich zuletzt. 33 Diese Möglichkeit deutet auch Geizer an (Caesar, S. 86): „Er setzte bei der Konstruktion seiner Politik keinen Stein, auf dem er nicht weiterbauen konnte, so daß der rückschauende Be-
(BG11-29:
Der Helvetierzug)
545
strategisches Denken seine Persönlichkeit bestimmte. Und das erklärt, warum diese Persönlichkeit jeden, der mit ihr in Berührung kommt, in ihren Bann zieht - damals wie heute.
obachter unter den Eindruck gerät, es sei tatsächlich wie von einem Architekten das Ganze schon in allen Einzelheiten vorausgedacht gewesen." Die ganze Anlage der gallischen Commentarli zeigt, daß Cäsar, als er das Werk schrieb, bereits selbst - als sein eigener „rückschauender Beobachter" - völlig unter diesem Eindruck stand. Aus dem vermutlich geradezu überwältigenden Gefühl der Selbstgewißheit heraus, das ihm der Anblick dieser unerhörten eigenen Lebenskonsequenz gewährt haben muß, setzte er dann den nächsten Baustein - eben das ,Bellum Gallicum'.
Der altsprachliche Unterricht, 23,1980,5-22
Horazens sogenannte Schwätzersatire* Horazens Satura 19 ist - wie Fraenkel in seinem Horazbuch sagt - „heute die populärste von allen", eine, die „noch in vielen humanistischen Gymnasien gelesen (wird), wo man sonst die Sermones vermeidet".1 In der Tat: jeder von uns kennt dieses kleine Drama von dem entsetzlichen Überfall, der den jungen Dichter in Gestalt eines nicht abzuschüttelnden Gelegenheitsbekannten auf der Heiligen Straße ereilt: ibam forte via sacra, sicut meus est mos ... /accurrit quidam notus mihi nomine tantum, /arreptaque manu ... Allzu große Vertrautheit mit einem Text ist jedoch für das Verständnis oft gefährlich: sie stumpft ab, macht blind und schläfert ein. Fraenkel selbst hat aus der Rebellion gegen diesen , Vertrautheitseffekt'2 den Mut zu seinem Buch geschöpft3 - I und in der Tat Erstaunliches herausgebracht. Gesamtdeutungen frei- 6 lieh waren sein Fall nicht, und schon gar nicht in den Saturae. Was er zu Sat. I 9 sagt, ist - wie wir sehen werden - in bestimmter Hinsicht sogar ganz außergewöhnlich unzureichend. Aber auch sonst steht es mit der Sinndeutung dieser
* Leicht veränderter und mit Anmerkungen versehener Vortrag, hervorgegangen aus einem Horaz-Seminar des WS 76/77 an der Universität Würzburg, gehalten 1977 bei Fortbildungstagungen für Gymnasiallehrer in Würzburg, Bamberg und München. - Karl Büchners in anderem Argumentationszusammenhang fast nebenbei gegebene, intuitiv richtige Deutung des .Schwätzers' (Rivista di cultura classica e medioevale 3, 1961, S. 3-15, = ,Studien zur römischen Literatur', Bd. 3, Wiesbaden 1962, S. 113-124; vgl. auch seine Satiren-Übersetzung bei Reclam, 1975, S. 193 zu V. 11, S. 194 zu V. 43) war mir - ebenso wie den allermeisten Hörems des Vortrags (aber auch etwa V. Buchheit im .Gymnasium' 75, 1968, S. 519-547 [s. Anm. 32]) - entgangen. Vielleicht darf ich die unabhängig erzielte Übereinstimmung in einer zentralen Interpretationsfrage als zusätzliche Stütze meiner im übrigen anders pointierten, auf allmähliche Entwicklung einer Gesamtdeutung hinarbeitenden Darstellung nehmen. - Zur Deutungsgeschichte der Satura und zu Büchners Position in ihr s. Anm. 6 und 32. 1 Fraenkel, Ed., Horaz, Dannstadt 1963, S. 135. 2 So - mit Bezug auf Caesars ,Bellum Gallicum' - Seel, O., Caesar-Studien, Stuttgart 1967, S. 49. 3 Fraenkel (s. Anm. 1), S. ΧΠΙ.
548
Horazens sogenannte Schwätzersatire
.populärsten Satura von allen' nicht zum besten. Die Sicherheit, die über der Auslegung zu ruhen scheint, ist in Wahrheit die Sicherheit des Banalen: „Das 9. Gedicht", sagt U. Knoche im deutschen Standardwerk der römischen Satirenforschung, „gestaltet ein alltägliches Erlebnis, wie Catull 10; es ist die Schwätzersatire."4 - ,Schwätzersatire' - mit diesem Etikett ist das Gedicht im deutschen Sprachraum festgelegt: Satura 19 ist also eine .Satire auf einen Schwätzer' - und damit Punktum! Mag es auch kaum einen Kenner dieses Gedichts unter uns geben, der den Sinn des Werkchens wirklich darin sieht, nichts anderes als eine Satire auf einen Schwätzer zu sein - Worte und Bezeichnungen entfalten ihre eigene Wirksamkeit.5 Immer dann, wenn man 19 nicht gerade liest, sondern nur darüber spricht und dabei die Bezeichnung .Schwätzersatire' gebraucht, erliegt man - wider besseres Wissen - der Magie des Terminus. Man assoziiert unwillkürlich das, worüber man eigentlich, als man das Gedicht las, schon hinaus war. Darum - weil wir eigentlich viel mehr bei diesem Gedicht empfinden als die konventionelle Gedichtbezeichnung aussagt - scheint es mir an der Zeit, den Terminus ,Schwätzersatire' aus unserem Sprachgebrauch verschwinden zu lassen. Um aber etwas zu finden, was an seine Stelle treten könnte, müssen wir das Gedicht erneut auf seinen Sinn befragen. Wir werden dabei ausgehen von einer Bestandsaufnahme der bisher schon vorgeschlagenen Sinndeutungen.6 Vor dem 4
Knoche, U., Die römische Satire, Göttingen 3 1971, S. 50. Vgl. z. B. Hering, W., Gedanken zu einer Satire des Horaz (19), Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. Χ/ΧΙ, 1974/75, 56: „In der wissenschaftlichen Literatur findet man im allgemeinen die Satire nach dem Wesen des aufdringlichen Menschen gekennzeichnet: der Schwätzer ... An sich ist dagegen kaum etwas einzuwenden. Bedenken wären anzumelden, wenn eine solche Bezeichnung die Aussage der Satire beschreiben sollte." Gerade das geschieht! (vgl. S. 9 ff. und Anm. 32). 6 Für die Deutungsgeschichte kann ich mich jetzt auf eine von mir angeregte Staatsexamensarbeit stützen, Egel, Sigrid, Geschichte der Deutung von Horazens sogenannter Schwätzersatire (I 9) in der deutsch- und englischsprachigen Forschung der letzten hundert Jahre. 103 S., Würzburg 1979 (masch.). Die Parallelarbeit für die französisch- und italienischsprachige Forschung ist leider noch nicht abgeschlossen, wird aber, soweit bisher ersichtlich, keine nennenswert von Egel abweichenden Resultate erbringen. Egel hat 150 allgemeine und spezielle Horaz-Publikationen von 1873-1975 durchgearbeitet; 56 davon waren für die Deutungsgeschichte von Sat. 19 verwertbar; auf einige von ihnen wird im folgenden, jeweils mit der Quellenangabe „Egel", verwiesen. Die hier vorgelegte Deutung als solche brauchte nach Egels Arbeit in keinem Punkt geändert zu werden. [Die oben erwähnte Parallel-Arbeit ist inzwischen fertiggestellt: Heller, Rita, Die 9. Satire des 1. Satirenbuchs des Horaz. Ihre Interpretation im westlichen romanischen Sprachraum. 119 S. Würzburg 1979 (masch.). Heller hat 35 einschlägige Publikationen (franz., ital., span., portug.) von 1860-1971 ausgewertet. Die Ergebnisse kongruieren mit denen Egels; fruchtbar für unseren Zusammenhang sind besonders Diaz, Α., La Novena Satira del primo libro 5
Horazens sogenannte Schwätzersatire
549
Hintergrund des ausgefalteten Deutungsspektrums werden wir unsere eigene Interpretation aufbauen. Und I am Ende werden wir dann entscheiden, ob einer 7 der vorgelegten bisherigen Deutungen die Krone zuerkannt werden soll, oder ob sich aus der Gedichtanalyse eine weitere Deutung ergeben hat, die möglicherweise noch etwas tiefer dringt. Zuerst also die Bestandsaufnahme: Die vielen Deutungen, die das Gedicht seit der Antike erfahren hat, lassen sich hier natürlich nicht alle einzeln vorführen. Selbst wenn das technisch möglich wäre, würde der Variantenreichtum nur verwirren. Wir ordnen daher die individuellen Interpretationen zu vier7 Gruppen oder Klassen zusammen. Diese vier Klassen stellen Grundmöglichkeiten der Deutung dar, die immer wiederkehren. Es sind folgende: 1. Das Gedicht ist eine Spielerei, ein exercitium, eine wirkliche nuga, ohne allzu tiefe Bedeutung. Als exemplarische Vertreter dieser Auffassung seien drei Horazforscher genannt, alles deutsche: Wili nennt das Gedicht ein „künstlerisches Exercitium" und ein „Übungsstück des Mimiambischen",8 Knoche sagt darüber lapidar: „Das 9. Gedicht gestaltet ein alltägliches Erlebnis, wie Catull 10; es ist die Schwätzersatire", und Ed. Fraenkel gar definiert nicht nur „Bericht über einen alltäglichen Vorfall", sondern macht 19 sogar zum Lückenbüßer: „Vermutlich haben, zumindest teilweise, die Satiren 7, 8 und 9 ... der Absicht ihr Entstehen zu verdanken, die Zahl der Satiren auf zehn zu bringen."9
de Horacio, Anales del Instituto de Literaturas Clasicas I, (Buenos Aires) 1939, 189-289, und Noirfalaise, Α., Horace et Mécène, LEC 18, 1950, 289-303], 7 Egel, S. 67-81, unterscheidet 11 Gruppen (zu deren Aufeinanderfolge nach einem bestimmten Prinzip s. S. 552): I. Humoristischer Bericht - Übungsstück - Π. Charakterstudie (I + Π = bei mir 1) - ΙΠ. Verspottung/Entlarvung(= bei mir 2) - IV. Literarkritik (identisch mit der Interpretation von Buchheit, s. Anm. 32) - VII. Moralische Belehrung - VIEL Kontrastbild (zwischen den Gegenwelten urbanitas und rusticitas; so besonders Büchner, s. S. 551 f.) - IX. Darstellung von Ton und Geist im Hause des Mäzenas - (so besonders Eckert, K., Horazens Freundschaft mit Maecenas als eine Seite seiner Religiosität, Diss. Freiburg 1957, S. 41; auch Röver/Oppermann, s. S. 551) - XI. „Ringen um sein Selbstverständnis als Dichter und Mensch" (so formuliert von Hering [s. Anm. 5], S. 64; weiteres dazu s. Anm. 32) (VII-XI = bei mir 4). - Diese Deutungen sehen alle etwas Richtiges (und die meisten Interpreten kombinieren denn auch mehrere), sie sind aber nur Einzelaspekte. Zu fragen ist nach der Gedicht-Idee. 8 Wili, W., Horaz und die augusteische Kultur, Basel 1948, S. 96 f. 9 Fraenkel (s. Anm. 1), S. 134.
550
Horazens sogenannte Schwätzersatire
Ob es ein Zufall ist, daß diese Auffassung so häufig gerade von deutschen Forschem vertreten wird, 10 muß sich noch zeigen. Zunächst die zweite Deutungskategorie: 2. Das Gedicht dient der Verspottung oder Verdammung - entweder (a) einer bestimmten Individualperson oder (b) eines Typus. (a) Die Beziehung auf einen bestimmten lebenden Zeitgenossen - Volpi in seiner Properz-Edition von 1755 hatte z.B. an Properz gedacht - , diese Beziehung wird I zwar in den Kommentaren immer noch erwähnt, aber in der Regel nur, um sie abzulehnen;11 sie kann heute als überwunden gelten. (b) Die Beziehung auf einen Typus dagegen, und zwar in der Form der Deutung .diese Satura verspottet eine bestimmte Sorte von Menschen', ist auch heute noch durchaus geläufig. Sie mag hier belegt werden mit einem Wort des französischen Horazforschers Lejay und mit einer Äußerung aus dem Lehrerkommentar von Röver/Oppermann: „Horace a voulu railler une espèce d'intrigants qui se propageait à la faveur du nouveau régime" 12 und: „Zielscheibe der Kritik ist die Klasse, der Typ derer, die durch H. bei Mäcenas empfohlen werden wollen".13 Ähnlich äußern sich auch Kiessling/ Heinze: „Horaz zeichnet offenbar nicht ein Individuum, sondern einen Typus." 14 Diese Deutung geht natürlich tiefer als die erste, denn in ihr wird aus der künstlerischen Spielerei eine schon fast gesellschaftskritische Attacke. Noch wichtiger aber scheint, daß die Verspottungsthese den quidam zum Zentrum des Gedichtes macht. Bevor wir diesen Gedanken weiterführen, gehen wir zur dritten Deutungsmöglichkeit über: 3. Nach ihr soll das Gedicht die alten Bekannten des Horaz warnen, aus der Bekanntschaft mit ihm Vorteile herausschlagen zu wollen. Diese Deutung, die
10 Weitere Belege: Breithaupt, K. O. (Kommentar 2 1903), S. 63: „humoristischer Bericht"; Witte, K., Der Satirendichter Horaz, Erlangen 1923, S. 28 f.: „Mimus", „anekdotenhaftes Gedicht"; Hanslik, R., Untersuchungen zu dem ersten Satirenbuch des Horaz, Commentationes Vindobonenses 3, 1937, S. 23: „Charakterzeichnung des zudringlichen Dichterlings". - Nach Egel S. 67 f. 11 Kiessling/Heinze (Kommentar 7 1959), S. 144: „Den Namen des ungenannten Dichterlings erraten zu wollen [...] ist verschwendete Mühe"; Röver/Oppermann, S. 97: Gesprächspartner nicht mit dem Namen genannt - müßig, es vermuten zu wollen ! ..." 12 Lejay, P. (Kommentar 1911), S. 232. 13 Röver/Oppermann, S. 97. 14 Kiessling/Heinze, S. 144.
Horazens sogenannte Schwätzersatire
551
ζ. Β. auch im Kommentar von Orelli/Baiter vertreten wurde, 15 gab dem vielgelesenen englischen Horazkommentator Wickham sogar die Idee zu seiner Überschrift für die 9. Satura ein: „The wrong way to Maecenas' friendship", 16 und der schon zitierte Lejay formulierte: „La satire devient un avertissement aux aventuriers que la fortune d'Horace empêchait de dormir, en première ligne à ses anciens compagnons d'hasard." 17 Nach dieser Auffassung wäre also die Satura eine Art Selbstverteidigung. Damit kommen wir aus der Fremdbezogenheit der ersten beiden Deutungen in die Selbstbezogenheit hinein. Denn nun ist das Gedicht ja nicht mehr etwas für sich Existierendes, mit Horazens privater Existenz nicht unmittelbar Verbundenes, sondern es ist Bestandteil der persönlichen Welt des Dichters und damit natürlich auch kein Exercitium mehr, sondern gestaltete eigene Lebenswirklichkeit. Was an dieser Deutung allerdings stört, ist die allzu konkrete Funktionalisierung, die hier vorgenommen wird: Hat das Gedicht wirklich Abschreckungsfunktion? Ist es wirklich eine Art Drohbrief? I Wir gehen über zur vierten und letzten Deutung: 9 4. Nach ihr ist das Gedicht ein Dokument der Freundschaft, ein pignus amicitiae, ein Preislied auf den Mäzenaskreis. Für diese zweifellos umfassendste Deutung führe ich fünf Belege an: Röver/Oppermann, Turolla, Rudd, Büchner und Hering. Bei Röver/Oppermann heißt es: „Das innere ,Thema' des Gedichts ist der Geist des Hauses des Mäcenas, das Lob des homo purus."18 Da ist noch allgemein vom ,Geist des Hauses' die Rede. Konkreter äußert sich Turolla, wenn er sagt: „La satira continua insomma il ciclo dell'amicizia e dell'amico." 19 Noch weiter ist in dieser Richtung vorgedrungen der kanadische Horazforscher Rudd. Er schreibt: „... in a sense this poem, like 1.5, is the document of a coterie." Und an anderer Stelle: „Maecenas and his friends knew very well that this was their poem ... Horace's friends liked him all the more for inviting them to admire themselves." 20 Am tiefsten aber sehen Büchner und - in seiner Nachfolge Hering den Sinn des Gedichts. Nach Büchner wird in ihm „mit derselben preisenden Gebärde" wie in Satura I 5 dargestellt, „wonach Horaz den Menschen
15
Orelli, J. C./Baiter, J. G/Hirschfelder, W./Meves, W. (Kommentar 1892), S. 116: „Hosce igitur homines male sedulos monet ne solitis parasitorum artibus se in Maecenatis amicitiam irrepere posse sperent: ,a me certe' inquit, .tales numquam commendabuntur'." (Egel, S. 71). 16 Wickham, E. C. (Kommentar 1891), S. 91 (Egel, S. 70). 17 Lejay (s. Anm. 12), S. 232. 18 Röver/Oppermann, S. 97. 19 Turolla, E., Le satire, Turin 1958, S. XXIV. 20 Rudd, N„ The Satires of Horace, Cambridge 1966, S. 86, 88.
552
Horazens sogenannte Schwätzersatire
beurteilt und wie es im Maecenaskreise zugeht",21 und Hering formuliert - mehr den sozialen Aspekt hervorkehrend - : „Horazens Ideal ist eine Freundschaft von Gleichgestellten und Gleichgesinnten, die keine Rangunterschiede hinsichtlich Besitz und Bildung kennt, ein Ideal, das ihm bei Maecenas verwirklicht schien."22 Überblicken wir diese vier Grundmöglichkeiten der Sinndeutung, so stellen wir als erstes fest, daß sie dem Gedicht von Stufe zu Stufe mehr zutrauen. Der Sinn des Gedichts wird immer tiefer. Die Trennungslinie zwischen weniger tiefen und tieferen Deutungen liegt dabei zwischen (2) und (3). Die ersten beiden Deutungen sind .leichter', die letzten beiden .schwerer'. Vor diesen Möglichkeiten stehend fühlt man sich, wenn man die Satura als Ganzheit vor sich sieht - mit dem ernsten ,Mäzenas-Block' (V. 43-60) in der zweiten Hälfte - innerlich spontan mehr zu den schweren Deutungen hingezogen. Aber ist das wirklich berechtigt? Sind diese letzten beiden Deutungen angesichts des durchgehend heiteren, humorvoll-ironischen und ridikülen Tons nicht doch vielleicht zu schwer? Muten sie dem Gedicht nicht etwas zu, was es gar nicht leisten will? Es hilft nichts: Zu den schweren Deutungen kann man sich erst verstehen, wenn erwiesen ist, daß die leichten falsch sind. Dazu muß gezeigt werden, daß die leichten Deutungen nicht aufgehen, daß man mit ihnen nicht durch das ganze Gedicht .hindurchkommt', wie wir sagen, - daß sie also einen unerklärten und beunruhigenden Rest zurücklassen. Um dies zu zeigen, müssen wir zu einer neuen Interpretation ansetzen. Ausgangspunkt dafür soll eine besondere Auffälligkeit sein, die in dieser Form bisher noch kaum beachtet scheint. Ich meine die, daß die leichten Deutungen Hand in Hand mit der Bezeichnung des Anonymus als .Schwätzer' gehen. Wir vergewissern uns rasch: Wili, für den das Gedicht ein exercitium ist, nennt den Anonymus einen I 10 ,Aufdringling' und .Schwätzer', 23 Knoche nennt ihn einfach .den Schwätzer', 24 und dort, wo Röver/Oppermann die zweite Deutung verfechten, nennen sie den Unbekannten einen .ehrgeizigen, eitlen Schwätzer'.25 Anders die Vertreter der schweren Deutungen. Für Lejay ist der Fremde stets ,Le fâcheux', also der »Lästige, Aufdringliche', und für zwei der Vertreter der vierten, also der schwersten Deutung, ist er entweder ,il seccatore' (.der lästige Kerl', .der Plagegeist') - so Turolla - oder .the pest' (.der Quälgeist', .die Pla21 22 23 24 25
Büchner (s. Anm. *, zitiert nach den .Studien'), S. 122, 121. Hering (s. Anm. 5), S. 62. Wili (s. Anm. 8), S. 97. Knoche (s. Anm. 4), S. 50. Röver/Oppermann, S. 97.
Horazens sogenannte Schwätzersatire
553
ge'), so Rudd. 26 Daraus ist zu schließen, daß die Deutung des Anonymus als .Schwätzer' ebenfalls eine .leichte' Deutung ist. Wer im Anonymus den Schwätzer sieht, kann offenbar im ganzen Gedicht nichts wirklich Ernsthaftes mehr sehen. Wenn aber demgemäß die Deutung des Anonymus so eng mit der Deutung des Gesamtsinns des Gedichts gekoppelt ist, dann ist die typologische Frage, die Frage, welchen Typus der Anonymus repräsentiert, der Angelpunkt des Gedichtverständnisses. Ist die Schwätzer-Deutung nämlich falsch, dann bildet offenbar sie das Hindernis für ein tieferes Eindringen in den Sinn des Gedichts. Ist sie dagegen richtig, dann sind die schweren Gedichtdeutungen überzogen und abzulehnen. Ist also der horazische quidam ein Schwätzer? Auf den ersten Blick scheint daran ein Zweifel gar nicht möglich. Horaz belegt ihn ja dreimal mit Ausdrücken, die man wohl in diesem Sinne verstehen muß: In V. 13 heißt sein Reden garrire,21 und in V. 33, im parodischen Orakel der Alten, wird er offensichtlich gleich zweimal, wenn auch indirekt, als .Schwätzer' bezeichnet: durch garrulus am Versbeginn und durch loquaces am Vers-Ende. Das scheint deutlich genug. Denn daß die Wörter garrulus und garrire hier tatsächlich .schwatzhaft' bzw. .schwatzen' bedeuten sollen, und nicht die ebenfalls mögliche abgeschwächte, versöhnlichere Nuance des .Plauderns' ausdrücken sollen, das kann kaum fraglich sein. Das Orakel verlöre ja seine Pointe, wenn es statt auf .Schwätzer' auf etwas so Schalkhaftes wie .Plaudertasche' hinausliefe. Horaz nennt also den quidam in der Tat ein paarmal .redselig' oder .schwatzhaft'. Die Frage ist nur: Steht damit die garrulitas bereits als Kennmerkmal des Anonymus in dieser Satura fest? Ist das Schwatzen seine dominierende Eigenschaft? Schließlich nennt Horaz an einer anderen Stelle der Saturae - in 14,12 - auch seinen Vorgänger Lucilius einmal garrulus. Will er damit diesen genialen (trotz aller Kritik ja auch von ihm bewunderten) Dichter von Saft und Kraft, der mit Staatsmännern wie Scipio Africanus von gleich zu gleich verkehrte, als .Schwätzer' kennzeichnen? Natürlich nicht. Natürlich kann jemand als garrulus, als .redselig' oder .schwatzhaft' oder ,Vielredner' bezeichnet werden, ohne deshalb gleich typologisch in die Kategorie der .Schwätzer' eingeordnet zu werden. In unserem Falle kommt es I also tatsächlich darauf an,
26
Rudd (s. Anm. 20), S. 79 ff. Vgl. Röver/Oppermann z. St.: „damit ist der quidam sozusagen tituliert".
il
554
Horazens sogenannte Schwätzersatire
ob das garrire das Kennmerkmal des Anonymus ist. Nur dann wäre er wirklich ein .Schwätzer'. Nun ist das Kennmerkmal eines Typus eine Funktion seines Haupt-Interesses. Beim Schwätzer stellt sich das Hauptinteresse natürlich so dar, daß er im Schwatzen völlig aufgeht. Ein stärkeres Interesse hat er nicht. Das wissen wir aus der eigenen Lebenserfahrung. Da diese jedoch bei Philologen wenig gilt, brauchen wir Belege. Daran fehlt es nicht. Unter den vielen antiken Definitionen der Schwatzhaftigkeit sind die drei treffendsten die des Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, 28 die des Theophrast in den .Charakteren' III (άδολεσχίας) und VII (λαλίας) sowie schließlich die des Plutarch im Traktat Περί άδολεσχίας. Die Definitionen dieser drei Autoren stimmen in einem Punkte völlig überein: Der Schwätzer kennt nichts Schöneres - und das bedeutet: nichts Weitergehendes - als eben das Schwatzen; der Schwätzer verfolgt dementsprechend mit seinem Plappern keine eigennützigen, wohlkalkulierten Ziele - der Schwätzer ist identisch mit Oberflächlichkeit, Planlosigkeit, Harmlosigkeit. Er ist zwar auch lästig, aber auf lächerliche Weise. Er ist nicht gefährlich; von ihm geht keine Bedrohung aus. Vor allem aber: Man ist ihm keinerlei Ernsthaftigkeit schuldig, - weil er vom Typ her grundsätzlich nicht ernstzunehmen ist. Trifft dies auf Horazens quidam zu? Wir analysieren das Gedicht noch einmal und achten dabei besonders auf die Verhaltensweise des Anonymus. Die ersten beiden Verse führen mit dem Imperfekt ibam, mit der Betonung des Gewohnheitsmäßigen durch sicut meus est mos und mit der Unterstreichung der völligen Realitätsabgewandtheit - totus in Ulis - eine in sich geschlossene höhere Welt der dichterischen Meditation ein (meditans). - Die Ruhe und Gelassenheit dieser Situation wird im nächsten Verspaar abrupt gestört. Es findet eine Invasion statt: accurrit - arrepta. Der Zustand der ersten beiden Verse ist aufgehoben. Das ganze Gedicht bis zum letzten Wort wird von jetzt ab den Versuch der Wiedergewinnung dieses Zustandes schildern. - Dieser Versuch hat drei Hauptphasen: Erstens die Abwimmelungsphase (3—43), zweitens die Überzeugungsphase (43-60, = ,Mäzenas-Block') und drittens das, was ich einmal die SOS-Phase nennen möchte (60-Ende). - Deutlich ist von Phase zu Phase eine größere Anstrengungsintensität zu erkennen: zuerst der mehr äußerliche Versuch, den Störer abzuwimmeln, dann der mit innerem Engagement unternom28
Aristot., N. E. 1117b33.
Horazens sogenannte Schwätzersatire
555
mene Versuch, ihm durch Kontrastierung zweier Welten die substantielle Aussichtslosigkeit seiner Wünsche klarzumachen, schließlich - nachdem diese beiden Versuche der Binnenlösung des Problems fehlgeschlagen sind - der Hilferuf an die Außenwelt. Nun die einzelnen Phasen: Die Abwimmelungsphase hat 6 Einzelstufen. Die 1. Stufe stellen die Verse 4 und 5 dar: Horaz reagiert hier auf die Störung noch I normal, nämlich mit der für solche Fälle in der Konvention vorgesehenen 12 Verabschiedungsformel: cupio omnia quae vis.29 Die 2. Stufe wird gebildet von den Versen 6-8 a. Horazens Reaktion ist hier zwar immer noch normal, aber sie geht bereits auf die Grenze des Normalen zu; denn mit numquid vis und gar erst mit dem ironischen pluris hoc mihi eris bewegt er sich bereits am Rande der Unhöflichkeit. Diese ersten beiden Stufen sind zwar in sich unterschieden durch Steigerung, gehören aber doch wieder zusammen durch das Mittel des Versuchs: die Sprache, das Wort. Die 3. Stufe besteht aus den Versen 8-13: Hier tritt an die Stelle der abwimmelnden Sprache die abwimmelnde Aktion: Veränderung des Gehtempos, Sprechen mit einem Dritten. Das Abwimmelungsmittel wird also stärker. Wir halten für diese ersten 3 Stufen ausdrücklich fest, daß bis hierher der quidam nicht geschwatzt, sondern nur gehandelt hat: Er ist herangestürmt (accurrit), hat Horazens Hand geschüttelt (arreptaque manu) und hat die zwar übertrieben stilisierte, aber als solche doch normgerechte ,Wie geht's'-Frage gestellt. Nach der ersten abweisenden Antwort hat er kein Wort gesprochen, sondern Horaz nur still begleitet (cum adsectaretur). Nach der zweiten abweisenden Antwort hat er ebenfalls nicht etwa zu schwätzen begonnen, sondern sich mit dem pikierten noris nos, docti sumus in ein antwortheischendes beleidigtes Schweigen begeben. Erst nachdem daraufhin eine scheinbar endlich ermunternde Antwort erfolgt ist, nämlich das pluris hoc mihi eris - erst danach hat er von etwas Objektivem zu reden begonnen, von den Straßen und der Stadt, also von Dingen, die mit der Zweierbeziehung zwischen Horaz und ihm nicht unmittelbar mehr zusammenhängen. Und hier erst wird sein Reden denn auch
Für die philologische Einzelinterpretation im engsten Sinne verweise ich pauschal auf die Kommentare, daneben aber insbesondere auf Marouzeaus treffliche Erläuterung in: Introduction au Latin, Paris 1941.
556
Horazens sogenannte Schwätzersatire
erstmalig von Horaz mit dem Verb garrire bedacht.30 - Wir dürfen schon hier feststellen, daß so kein wahrer Schwätzer vorgeht. Der Schwätzer stößt nicht wie ein Habicht zielsicher auf ein bestimmtes Opfer zu, er geht nicht schweigend nebenher, und er spielt auch nicht den Beleidigten. Das alles sind für einen Schwätzer schon zu viele, zu subtile Varianten. Der Schwätzer reißt das Wort an sich und schwätzt und schwätzt und schwätzt. - Unser quidam dagegen scheint mit dem, was Horaz garrire nennt, nur seine Abwimmelung vereiteln zu wollen. Er redet nicht, um zu reden, sondern um sich den Anschein zu geben, seine Unerwünschtheit gar nicht zu bemerken. Die 4. Stufe des Abwimmelungsversuchs bestätigt das. Diese Stufe umfaßt die Verse 13-19. Das Abwimmelungsmittel wird hier noch stärker. Auf das Wort und auf die Tat, also auf die Aktivität, folgt hier von Horazens Seite aus die Passivität - das Schweigen. Was tut der quidam darauf? Beginnt er nun endlich, da er freie Bahn hat, loszulegen? Etwa so wie es bei Theophrast von ihm heißt: I 13
„Der Schwätzer hält eine Lobrede auf seine eigene Frau. Dann erzählt er den Traum, den er in der letzten Nacht gehabt hat. Dann geht er der Reihe nach im einzelnen durch, was es beim Mahle gegeben hat. Dann ... sagt er, daß die jetzigen Menschen viel schlechter seien als die in den alten Zeiten, daß der Weizen auf dem Markt billig sei, daß viele Fremde anwesend seien ..." usw. usw. usw.
Sagt der horazische quidam ein Wort in dieser Richtung? Im Gegenteil: er nutzt Horazens Schweigen nicht zu harmlosem Schwatzen, sondern zu einer Absichtserklärung aus; er gibt die objektiven Themen, die Schwätzerthemen, denen er sich eben erst zugewandt hatte, also sogar wieder auf und geht in die Zweierbeziehung zurück: „Schon lange merk' ich", sagt er, „daß du wegwillst. Aber ich bleibe dir auf den Fersen." Und als Horaz nun zur 5. Stufe des Abwimmelungsversuchs übergeht (V. 16-19), zur Abschreckung durch Hinweis auf Strapazen, da zeigt sich in der Antwort des Anonymus ganz deutlich, daß sein Interesse gar nicht dem Schwatzen gilt - das könnte er ja auf der belebten Sacra Via strapazenlos und ohne solchen harten Widerstand viel leichter befriedigen: sein Interesse gilt vielmehr Horaz. Noch wissen wir nicht, warum. Und auch Horaz weiß es noch nicht. Er weiß nur, daß alle seine bisherigen 5 Abwimmelungsversuche fehlgeschlagen sind. Er resigniert, - aber es ist eine temporäre Resignation, nicht ohne Hoffnung; denn das Bild vom Last-Esel impliziert die Aussicht auf Befreiung von der Last. Horaz ergibt sich also zunächst einmal, wartet aber Bis hierher hat Horaz ihn noch nicht für einen Schwätzer gehalten, von hier an hält er ihn für einen solchen, bald wird er ihn nicht mehr dafUr halten. Treffend Büchner, S. 113: „Und so ist nur zu schließen, daß sich in der Satire ein Geschehen vollzieht."
Horazens sogenannte Schwätzersatire
557
auf seine Chance. Und die kommt. Denn der quidam beginnt nun von sich zu reden, von seinen überragenden Künsten und Fähigkeiten. Das gibt Horaz die Möglichkeit, den quidam abzulenken, indem er ihn an seine Familie erinnert. 31 Nach dem Einsatz (1) des Wortes, (2) des Handelns, (3) des Schweigens und (4) der Abschreckung nun also die höchste Stufe der Abwimmelungsbemühung: die Erinnerung an stärkere Verpflichtungen, der Appell an engere menschliche Bindungen, als es die Gelegenheitsbeziehung zwischen dem quidam und Horaz ist. Aber auch dieser Versuch schlägt fehl. Die engeren Bindungen, an die Horaz appelliert, gibt es nicht, - des Unbekannten engste Bindung ist, wie es scheint, Horaz. Das bedeutet nun allerdings das Todesurteil. Und zwar das Todesurteil (wie Horaz in komischer Verzweiflung parodierend meint), von Schwätzermund zu sterben. Wäre die Satura hier zu Ende, so müßten wir uns trotz mancherlei Bedenken vielleicht am Ende dennoch Horazens Typbezeichnung garrulus anschließen. Aber die Erzählung geht weiter. Und zwar mit einer Szene, deren Bedeutung für den Gedichtsinn man, soweit ich sehe, bisher noch nicht recht erkannt hat. Es ist die Szene, I die die Verse 35-43 umfaßt. - Zunächst stellen wir fest, daß zwi- 14 sehen 34 und 35 eine Zäsur liegt. Bisher war das Gedicht ein Ineinander zweier Personen. Das Außen spielte nur eine Kulissenrolle. Jetzt aber, mit ventum erat ad Vestae, findet eine explizite Abwendung vom Innen und Hinwendung zum Außen statt. Wir stehen vor dem Vestatempel, die Tageszeit wird angegeben, eine Gerichtsverhandlung mit Bürgschaftssumme (vadato) und mit Plädoyers (litem) steht vor der Tür. - Warum dieser Einbruch der Außenwelt in die Zweierbeziehung? Weil alle Binnenlösungsmöglichkeiten durch die 5 Abwimmelungsvarianten erschöpft sind. Die Rettung, die Wiederherstellung der Ruhelage, auf die alles, wie wir sahen, von Anfang an abzielt, kann jetzt nur noch von außen kommen. Das ist psychologisch völlig konsequent. Damit aber bildet diese Was mit dieser Erinnerung an mater und cognati genau gemeint ist, ist bisher ungeklärt. Egel (S. 24-29) fand 7 Deutungsmöglichkeiten, darunter so verzweifelte wie ,Horaz will dem quidam zu verstehen geben, daß er ihn für geisteskrank hält.' (Kiessling; wie sollte der .Geisteskranke' das begreifen?) oder ,Horaz will dem quidam zur Abschreckung suggerieren, der vorgebliche Krankenbesuch gelte einem ansteckend Kranken' (Salmon, E. T., Horace's ninth satire in its setting, in: Studies in honor of Gilbert Norwood [= The Phoenix, Suppl.-Bd. I], 19S2, S. 186). Die Lösung wird am ehesten in der Richtung liegen, die neben anderen (z. B. Heinze im Kommentar z. St.) Buchheit andeutet: sarkastische Frage, ob er denn nicht eine Mutter oder sonstige Verwandte habe, die an seinem Wohlbefinden, das doch bei diesem Allround-Dasein gefährdet scheine, interessiert seien" (Buchheit [s. Anm. *], S. 530). Für die hier vorgetragene .Stufen'-Interpretation (Blutsverwandtschaft als letzter Rettungsanker) ist die genaue Nuance allerdings ohne Belang.
558
Horazens sogenannte Schwätzersatire
Szene der Verse 35-43 in dem kleinen Drama den Peripetiepunkt. Entweder bleibt die Situation wie sie ist, oder sie wird von außen her beendet. Dieses Entweder-Oder wird nun statisch ausgebaut zu einer Entscheidungsszene. Das ist nun wieder künstlerisch völlig konsequent. Denn wenn das Ganze als Drama angelegt ist - und daß es das ist, hat schon Porphyrio notiert - , dann gehört auch eine Entscheidungsszene dazu. Das Wesentliche ist nun aber die Frage, wer sich hier entscheidet Es ist nicht etwa Horaz. Das hatte z. B. Lejay gemeint, der zu diesem Vers notierte, Horaz müsse sich hier entscheiden, ob er nun über die Palatintreppe zur Tiberbrücke gehen wolle oder über den vicus Tuscus. Wer sich entscheiden muß, ist vielmehr der Anonymus. Er sagt ja deutlich in der Formelsprache der Tragödie fast - : dubius sum, quid faciam. Schon das ist aufschlußreich. Ein Schwätzer, der sich entscheidet? Noch aufschlußreicher aber - und, wie ich glaube, geradezu erhellend - ist die Art der Entscheidung. Es ist nämlich keine Spontanentscheidung. Der quidam sagt nicht sofort: natürlich bleibe ich bei dir. Er wägt vielmehr ab. Er sagt dubius sum. Die Entscheidung ist also nicht ganz einfach. Der quidam steht in einem wirklichen Interessenkonflikt. Auf der einen Seite drohen ein empfindlicher Geldverlust und weitere juristische Scherereien (wie wir ja dann am Schluß der Satura sehen) - auf der anderen Seite droht der Verlust Horazens. Wenn der quidam überhaupt abwägt angesichts dieser Alternative, dann müssen die beiden entgegenstehenden Interessen mindestens gleich stark sein. Der Unbekannte hat also ein ausgesprochen starkes Interesse an Horaz, und zwar an Horaz als Person. Welches, wissen wir nun noch immer nicht genau, wenngleich wir es natürlich - wie Horaz selbst ahnen. Eines aber sehen wir bereits: der Typ des Schwätzers würde in einen solchen Interessenkonflikt gar nicht erst hineingeraten. Denn sein dominierendes Interesse ist einzig und allein das Schwatzen. Einen Geldverlust um eines ganz bestimmten Beschwatzungsobjekts würde er nicht auf sich nehmen. Wozu auch? Vor Gericht hätte er ja viel mehr Objekte. Seine Entscheidung wäre eine Spontanentscheidung. Mit einem „Ach du meine Güte" würde er sich dem Gericht zuwenden. Unser quidam dagegen wägt ab - und entscheidet dann - , und zwar für Horaz. Das Interesse an Horaz ist also stärker als das an Geld. Der Nachteil wird in Kauf genommen. Das heißt: Horaz muß für den quidam einen Vorteil bedeuten. Und diesen Vorteil hat der quidam rational kalkuliert. Der quidam ist also kein planloser Schwätzer, sondern ein planender Erfolgsstratege.32 I 32
Diese Typdeutung taucht im von Egel behandelten Forschungszeitraum (also seit 1873) volldurchdacht zum ersten Mal bei Orelli/Baiter/Hirschfelder/Meves (s. Anm. 15) auf: „Volgaris opinio, qua haec satira, sive mimus est ex Sophronis genere, garruli descriptionem continere
Horazens sogenannte Schwätzersatire
559
putatur, procul dubio e male intellecto v. 33 orta est. Nam lectori integro continuo patebit hic non garruli χαρακτήρα depingi, qualis, ut hoc utar, apud Theophrastum (Char. 3) describitur, sed potius id sibi poetam proposuisse, sive veram rem narrat sive fictam, ut certos quosdam homines derideret atque in posterum a se abigeret, qui iudicii elegantiam et poeticam facultatem affectantes atque exemplum Vergilii Horatiique aemulati in Maecenatis familiaritatem se intrudere conarentur et, quo certius hoc assequerentur, sine ullo pudore nihilque verentes, ne vilem suum et abiectum animum proderent, omnibus modis Horatii amicitiam expugnare contenderent" (S. 116). Wie man sieht, ist der Typus hier allerdings nur „durch Aufzählung seiner negativen Eigenschaften" (Egel, S. 80) umschrieben, ein schlagendes Gegen-Etikett gegen .Schwätzer' fehlt. Wohl deshalb blieb diese Auffassung in der Literatur folgenlos. Der .Schwätzer' beherrschte weiter das Feld - wenn auch häufig mit modifizierenden Zusätzen, die - zuweilen durchaus in die richtige Richtung zielend - das Unbehagen der Interpreten an diesem Etikett verraten. Im folgenden eine kleine Auswahl (nach Egel, S. 82-88): Lucían Müller (Komm. 1891, S. 117): (aber S. 114 auch: F. Ch. Höger, Kl. Beiträge zur Erkl. des Horaz, Programm Freising 1891. S. 77: G. T. A. Krüger (Komm. 141897, S. 78): G. Schimmelpfeng (Komm. 1899, S. 108,111):
A. Kornitzer: Zu serm. 1 9 , 4 3 ff., in: WS 22, 1900, S. 222-228: K. O. Breithaupt (Komm. 2 1903, S. 67 ff.): K. Witte, Gesch. d. röm. Dichter im Zeitalter des Augustus, Π 1, Erlangen 1931, S. 46 ff.: W. Wili (s. Anm. 8), S. 97: (aber auch: Schöne/Färber (Komm. 2 1955, S. 274): Kiessling/Heinze (Komm. 71959, S. 144 ff.): (aber auch: Röver/Oppermann (Komm. 1961):
(aber auch:
.Schwätzer' .Streber') .Schwätzer', mit der Gesinnung, für sich zu arbeiten, .klebriger Schwätzer' .Schwätzer, ohne dabei zu denken' (!), .Vielschwätzer', .abscheulicher Schwätzer' .zudringlicher, alberner, wichtigtuender Schwätzer' .unverschämter und gemein gesinnter schöngeistiger Schwätzer' .zudringlicher Schwätzer' .Schwätzer' .Aufdringling') .zudringlicher und selbstgefälliger Schwätzer' .heilloser Schwätzer' .Aufdringlicher', .Streber') .ehrgeiziger, eitler Schwätzer' (S. 97/100), .alberner Hohlkopf' (!) (S. 99) .geschwätziger Streber' (S. 98/100))
560 16
Horazens sogenannte Schwätzersatire
Die Entscheidungsszene erweist sich damit als Angelpunkt des Gedichts. Nach ihr ist die Situation verändert. Wir merken es sofort am nächsten Wort des quidam. Keine Floskeln und Belanglosigkeiten mehr, sondern ein hartes, geradezu erschreckendes Zustoßen: Maecenas quomodo tecum? „Wie steht Mäzenas mit dir?" Und an Horazens Antwort wird sofort deutlich, wie sich auch für sein Bewußtsein die Lage verändert hat. Keinerlei Ironie mehr - vielmehr ein vorsichtiges, fast ängstlich zurückweichendes paucorum hominum et mentis bene sanae ,Kein Freund von vielen und mit sehr gesunden Kategorien'. Der Wechsel des Tons zeigt an: Horaz der Akteur hat in der Entscheidungsszene etwas erkannt. Und durch diese Entscheidungsszene und durch den Wechsel seines eige-
V. Buchheit, Homerparodie und Literarkritik in Horazens Satiren 17 und 19, Gymnasium 75,1968, 519-555:
H. Antony, Humor in der augusteischen Dichtung, Diss. Wien (1970), S. 75/104: U. Knoche (s. Anm. 5), 3 1971, S. 50:
.aufdringlicher und überheblicher Schwätzer und Dichterling' (S. 530), .Schwätzer' (S. 531ff.), .angeberischer Tölpel' (!) (S. 536), stupider (!) garrulus poeta (S. 540) .zudringlicher Schwätzer' , Schwätzersatire '.
In der englischsprachigen Literatur überwiegt zwar ,bore' (seltener ,windbag' oder einfach ,garrulus'), aber worin denn dieses ,bore'-Sein eigentlich besteht (nämlich nicht im Schwatzen), wird auch hier nicht gesagt. So hatte die richtige Typdeutung 60 Jahre auf ihre Wiederentdeckung zu warten: 1961 erklärte K. Büchner (s. Anm. *) den quidam als ,üblen Erfolgsjäger' (S. 113), wobei er diese neue Bezeichnung aus einer im Kern schlagend richtigen Gesamtcharakterisierung gewann: „hinter seiner scheinbar so spontanen Natürlichkeit und seinem aufdringlichen Wesen verbergen sich Methode und Routine seiner Jagd nach Erfolg und Gewinn" (S. 113; eine wirklich überzeugende, die feinsten Nuancen dieses Typs erfassende und mit den treffendsten Worten nachzeichnende Charakterbeschreibung ist damit natürlich immer noch nicht geleistet; in welcher Richtung dies zu geschehen hätte, kann eine Arbeit von Rudolph Berlinger über den Typ der .Vorlauten' andeuten (,Das Gegenbild. Zwei Analysen', WüJbb N. F. 1, 1975 [= Festschrift Ernst Siegmann], S. 171-174)). Die Zähigkeit der Tradition verhinderte auch hier wieder, daß diese Erkenntnis durchdrang (s. Anm. *), diesmal vermutlich gefördert gerade durch Buchheits .Gymnasium'-Aufsatz (s. in dieser Anm. weiter oben). Aufgenommen wurde Büchners Deutung, soweit ich sehe, bisher nur in 2 Publikationen des Rostocker Latinisten Wolfgang Hering, die an zu entlegenem Ort erschienen sind, als daß sie den Gymnasiallehrer hätten erreichen können: s. oben Anm. 5 und die Fortsetzung des dort zitierten Aufsatzes Wiss. Zeitschr. der Univ. Rostock, Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe ΧΧΠΙ, 1974, S. 245-249. - Büchners und Herings Arbeiten liefern für die oben (S. 9) festgestellte Wechselbeziehung zwischen Typbezeichnung und Gesamtdeutung der Satura den Beweis: sobald der quidam .richtig' verstanden ist (nicht Hanswurst, sondern Karrierist), erledigen sich die .leichten' Deutungen als zu naiv von selbst.
Horazens sogenannte Schwätzersatire
561
nen Tons will Horaz der Dichter diese Erkenntnis offensichtlich auch auf seine Leser, auf uns, übertragen: die Erkenntnis nämlich, daß er sich in dem anderen getäuscht hat. 33 Er hat ihn unterschätzt. Er hat ihn nicht ernstgenommen. Er hat ihn für einen Schwätzer gehalten. Darum hat er ihn garrulus und loquax genannt. Fortan aber, und zwar bis zum Ende der Satura, I wird er keinen dieser Ausdrücke mehr von dem Anonymus gebrauchen. Die Entscheidungsszene hat den quidam decouvriert: Er ist kein Schwätzer, wie sich jetzt zeigt, sondern ein Karrierist.34 Er setzt alle möglichen Mittel ein, um ans Ziel zu kommen, auch das des scheinbar harmlosen Plauderns. Horaz konnte sich über ihn täuschen, weil sich manche seiner Verhaltensweisen mit denen eines harmlosen Schwätzers deckten. Beim Preisen der Straßen und der Stadt in V. 13 ist das von sich aus klar. Eine Kongruenz der Verhaltensweisen liegt aber auch in den Vv. 2 2 33
Diese Beobachtung der Erkenntnisfunktion der Entscheidungsszene führt mich zu einer gänzlich anderen Auffassung der für den Gedichtsinn zentralen Verse 44—48, als sie Büchner vertritt. Eine ins einzelne gehende Diskussion gehört nicht hierher. Nur so viel: Büchner legt die Worte paucorum hominum et mentis bene sanae dem quidam in den Mund, weil (1) Horaz die eigentliche Absicht des quidam (Horaz als .Sprungbrett' zu Mäzenas zu benutzen) gar nicht habe erahnen können und deswegen auch niemals so .scharf' und .schlagfertig' hätte reagieren können, und weil (2) der Ausdruck sanus in Horazens Munde eine unpassende, ja falsche Charakterisierung des Mäzenas wäre. - Zu (1): Die Ahnung, die Büchner vermißt, wird durch die Entscheidungsszene in Horaz erzeugt. Horaz der Dichter schildert das kühl kalkulierende Abwägen des quidam ja gerade deswegen so ausgebreitet, damit der Leser versteht, daß dem bisher in der Tat ahnungslosen Opfer Horaz an dieser Stelle ,ein Licht aufging'. Am Ende dieser Peripetie (vgl. die längst beobachtete .Umkehrung' usque sequarte V. 19 zu ego ... sequor V. 43) ist Horaz auf Abwehr eingestellt. Als der Angriff mit dem Stichwort .Maecenas' dann tatsächlich in der einzig vermutbaren Richtung erfolgt (einzig vermutbar, weil sich der junge, noch längst nicht arrivierte Dichter ein anderes .Äquivalent' für den Geldverlust des Fremden als seine Freundschaft mit Mäzenas gar nicht vorstellen kann), da ist Horaz nicht mehr unvorbereitet und kann daher klug parieren, und zwar in einer Art - dies gegen (2) - , die zugleich ein Würdigkeitsbeweis gegenüber Mäzenas ist (s. dazu S. 563); denn diese souverän überlegte Parade realisiert in sich ja gerade die Eigenschaft, durch die sie den Gönner charakterisiert: sanitas. Sanus zu sein ist nämlich - entgegen Büchners Behauptung - sehr wohl eine .exquisite Eigenschaft' (115) des Mäzenas: Sat. I 6,98 (vor die Wahl gestellt, sich seine Eltern auszusuchen, würde der Freigelassenensohn Horaz genau die Eltern wählen, die er hat) demens / iudicio volgi, sanus fartasse tuo (sc. Maecenatis), und dazu vgl. Eckert (s. Anm. 7), S. 41: „V. 44 enthält ein Bekenntnis zur Freundschaft überhaupt, wobei wieder - wie in Sat. I 6,89 und 98 - die Gesundheit des Denkens (sanus) als Voraussetzung für die richtige Einschätzung eine Rolle spielt". Alle abqualifizierenden Attribute Büchners (,grob und taktlos', S. 121; .brüsk-salopp', S. 120; .schnöder und schlagfertiger Hieb', S. 119; .schnoddrige Bemerkung', S. 118) können nichts daran ändern, daß in diesem Sinne gerade Vers 44, wenn Horaz ihn .spricht', Mäzen am stärksten von der Richtigkeit seiner Wahl überzeugen muß (vgl. auch Anm. 36). 34 Will man also das Gedicht weiterhin nicht vom .Bild', sondern vom .Gegenbild' her benennen, dann böte sich m. E. statt .Schwätzersatire' am ehesten noch .Karrieristensatire' an.
17
562
Horazens sogenannte Schwätzersatire
25 vor, und da ist es nicht so ohne weiteres deutlich. Erst wenn man einmal ein Stück aus Plutarchs Traktat .Über die Schwatzhaftigkeit' neben diese Verse hält, wird es offenbar. „Genau dasselbe erleiden die Schwätzer", sagt Plutarch da, „bei solchen Gegenständen, in denen sie sich durch Erfahrung oder ein gewisses Training vor den anderen auszuzeichnen glauben. In sich selbst und seinen eigenen Ruhm verliebt, verwendet so ein Mensch den größten Teil des Tages auf das, worin er sich selbst übertrifft: der Bücherwurm schwelgt in Geschichten, der Grammatiker in Regeln, der Vielgereiste und Herumgekommene in Erzählungen von fremden Ländern."35
Als der quidam in V. 22 mit den Namen von Horazens besten Freunden Varius und Viscus begann, hätte Horaz eigentlich die Ohren spitzen müssen. Aber dann schien der quidam ja mit seinen Dicht-, Tanz- und Gesangeskünsten tatsächlich nur zu prahlen, ganz wie der Schwätzertyp, den Plutarch beschreibt. So wurde Horaz eingelullt. Er hatte die Anti-Schwätzer-Signale, die Karrieristensignale in diesen Worten (und auch davor schon: V. 7) mißdeutet. Nun ist er plötzlich aufgewacht. Und darum nimmt er in dem Stück der Satura, das ich den Mäzenas-Block genannt habe, den quidam plötzlich ernst. Auch hier will er ihn natürlich loswerden, aber nun auf gänzlich andere Weise als vorhin. Vorhin hatte er mit ironischer und z. T. komisch-verzweifelter Überlegenheit zu ihm geredet. Substanziell war er gar nicht beteiligt gewesen. Er hatte mit dem quidam nur gespielt. Jetzt aber setzt er sich ein, um ihn loszuwerden. Er hat begriffen, daß von dem scheinbar Harmlosen eine Bedrohung ausgeht. Der quidam will in Horazens Welt eindringen. Er will sich der Person des Horaz bedienen, um an Mäzenas heranzukommen. Er will auf die gleiche agis gressive Weise, mit Unverschämtheit und I plumper Gewalt, mit der er in Horazens morgendliche Phantasiewelt eingebrochen ist, nun auch in die Welt Mäzens und seiner Freunde einbrechen. Und da nun richtet Horaz sein , Apage, Satana' auf: non isto vivimus illic, quo tu rere, modo: „nicht auf diese Weise leben wir dort, wie du es dir errechnest"; denn: domus hac nec purior ulla est nec mag is his aliena malis: ,es gibt kein Haus, das reiner wär' als dieses - und fremder dieser Art Rankünen' - , wir glauben den Priester-Wächter aus dem Reich Sarastros zu hören. Ein Gegensatz wird aufgerichtet, wie er schärfer nicht mehr gedacht werden kann, ein Gegensatz zwischen der schmutzigen, korrupten Welt des materialistischen, geltungssüchtigen Karrieristen und der reinen, idealistischen Welt des Mäzenas und seiner Freunde.
35
Plut., De garrulitate 514 a.
Horazens sogenannte Schwätzersatire
563
Wir brauchen nun wohl nicht mehr lange weiterzufragen. Die Antwort auf unsere Ausgangsfrage nach dem Typ, der hier gezeichnet wird, ist bereits gegeben: Ein Schwätzer ist er nicht! Beantwortet ist damit im Grundsatz auch schon die zweite, eigentliche Frage, die wir uns eingangs gestellt hatten, die nach dem Sinn des Gedichts. Die .leichten' Deutungen haben sich als zu flach erwiesen. Sie scheiden also aus. Von den beiden .schweren' Deutungen aber scheint die letzte, die vierte, dem Sinn des Gedichts am nächsten zu kommen. Es geht tatsächlich zunächst einmal um die Darstellung des Mäzenaskreises in dieser Satura. Allerdings ist das wohl noch immer nicht der tiefste Sinn des Gedichts. Der tiefste Sinn scheint in einer Richtung zu liegen, die Fraenkel angedeutet hat, wenn er sagt: Zentrum der Satura ist Horaz. Nur hat Fraenkel das noch zu eng gemeint. Er zielt damit nur auf die Alternative ,Quidam - Horaz'. Es scheint aber, daß Horaz in noch tieferem Sinne das Zentrum des Gedichts bildet. Es geht ihm nämlich in Satura 19 im letzten um gar keinen anderen außer um ihn selbst. Also auch nicht um den Freundeskreis. Er will mit I 9 weder nur ein Gruppenbild des Zirkels und der Freundschaft in diesem Zirkel für die Außenwelt schaffen, noch will er damit, wie Rudd meint, den Mitgliedern dieser Clique Selbstbewunderung einträufeln. Er will vielmehr mit diesem Gegenbild einen ganz persönlichen Würdigkeitsbeweis erbringen. Ich meine das so: In der sehr direkten Satura I 6, die vor I 9 entstanden ist, hatte er in V. 51 deutlich ausgesprochen, wie stark die Sorge auf ihm lastete, ob er dem Freundschaftsanspruch eines Mannes wie Mäzenas auch gewachsen sei, der doch so außerordentlich behutsam darin sei, Würdige in den Kreis hereinzuziehen, Männer, die für häßliche Intrigen nicht geschaffen seien: praesertim cautum dignos adsumere prava / ambitione
procul.
Das war damals alles sehr direkt, in unmittelbarem Zwiegespräch mit Mäzenas gesagt. Jetzt, mit der so ganz indirekten Schilderung der Satura 19, wird der Beweis erbracht, daß Horaz tatsächlich würdig ist. Hier ist Horaz gegenüber I 6 menschlich ein gutes Stück weitergekommen,36 er hat den Anspruch des Dies sollen, wie mir scheint, die vielen kleinen Einzelzüge indirekter Selbstcharakterisierung zeigen, die durch das Gedicht hindurchgehen und die man, solange man sie nicht von der Gesamtidee her zu sehen vermag, immer wieder mißverstehen wird. Nur ein Beispiel: In V. 11 wünscht sich Horaz im stillen (tacitus) das cholerische Temperament gewissermaßen .Bolans des Schrecklichen', um sich des Störenfrieds besser erwehren zu können. Salmon (s. Anm. 31), S. 185, sieht in diesem Wunsch verschmitzte Selbstironie; denn anderswo bezeichne sich Horaz doch selbst als jähzornig: „... a sly dig this at Horace's own notoriously swift temper (Π 3,323: Epistles I 20,25)". Eine ganz verkehrte Deutung der Bezüge! Sicher erinnert Horaz an seine
564
Horazens sogenannte Schwätzersatire
19 Mäzenas, wie es I scheint, begriffen. Die ganze Satura 19 sagt zwar: so bin ich nicht! Aber dadurch, daß Horaz das eben gar nicht ausspricht, daß er es vielmehr nur am Gegenbilde zeigt, dadurch streift diese Selbstaussage die letzten Reste der direkten und damit immer etwas plumpen Selbstempfehlung ab. Horaz empfiehlt sich nicht, sondern er erweist sich als würdig, und zwar dadurch, daß er nicht - wie noch in I 6 - sein Bild zeichnet, sondern sein Gegenbild. Gerade dadurch, daß er sich nicht würdig nennt, erweist er sich als würdig. Das Sprechen vom eigenen Würdigsein - das hat Horaz offenbar in der Zwischenzeit gelernt - wäre schon ein Ausdruck des Unwürdigseins. Darum spricht er hier nun gar nicht mehr von Würde. Er zeigt nur - sich und den anderen, - und dadurch, durch die Feinheit des Indirekten, erbringt er den Beweis seiner menschlichen Sublimitât. Das Gedicht ist also weder Spielerei noch Verspottung, und es ist auch kein konkretes Abschreckungsgedicht an alte Jugendkameraden. Schon gar nicht ist es ein Gelegenheitsgedicht, wie Fraenkel meinte, - nur zur Auffüllung einer Zehnzahl bestimmt. Vor allem aber ist es nicht„Die Schwätzersatire". Es ist vielmehr zunächst einmal ein Huldigungsgedicht, vielleicht das sublimste von allen, die Horaz dem Mäzenas gewidmet hat. Denn die Sublimitât, mit der Horaz hier seine Würdigkeit erweist, offenbart ja, daß der, dessen Horaz sich damit als würdig erweist, noch eine Stufe höher, - auf der höchsten Stufe menschlicher Kultiviertheit steht. Mit dieser Huldigung hat nun aber Horaz das Ideal aufgerichtet, zu dem er sich bekennt. Aus dem allmählich sich entfaltenden Bild des mit allen Wassern gewaschenen und gerade darum so erbärmlich armseligen Karrieristen hat sich das Bild einer kategorial anderen, reinen Welt, ohne ambitio und corruptio, entwickelt, einer Welt der menschlichen Integrität und der heiter-gelassenen Geistigkeit.
Schwäche, sicher tut er das auch .verschmitzt', aber diese Verschmitztheit ist nicht lustiger Selbstzweck, sondern sie hat Funktion: sie gibt per se zu erkennen, „welche Fortschritte der Dichter als Diplomat im Vergleich zu I 2; 3; 4; 6 gemacht hatte. In früheren Jahren würde er die Rolle des cerebrosus Bolanus. ... vermutlich selbst übernommen haben": so ganz richtig schon L. Müller (s. Anm. 33), S. 114. „Durch sein von urbanitas geprägtes Verhalten" (Egel, S. 12) selbst in dieser extremen Selbstbeherrschungsprüfung - und zwar von Anfang bis zu Ende: distanziert, beherrscht und rational - erweist Horaz sich gerade des ianifiU-Anspruchs würdig, dessen voller Anerkennung (das darf ja nicht übersehen werden) er, wenn auch mit der üblichen leisen Ironie, die ganze 326 Verse lange 3. Satura des 2. Satirenbuches gewidmet hat (vgl. dort besonders die Definition des insanus als dessen, den die mala stultitia und die inscitia veri caecum agit, V. 43 f., und dazu Kiessling/Heinze).
Horazens sogenannte Schwätzersatire
565
Magnum narras, vix credibile! hatte der quidam auf das Bild dieser Welt reagiert: „Gewaltig, was du da erzählst! Kaum glaublich!" Etwas von diesem Staunen, daß es eine solche Welt überhaupt gibt, hat offenbar auch Horaz empfunden. Dieser früher nicht gekannten Welt angehören zu dürfen erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Und diesem Gefühl der Dankbarkeit unter der lachenden Oberfläche eines ironischen und selbstironischen Spiels Ausdruck zu geben, das ist, wie ich glaube, der Sinn des Gedichts. I
Horazens sogenannte Schwätzersatire
IX Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos, nescio quid medi tans nugarum, totus in illis: 1. Abwimmelungs-Phase
5
accurrit quidam notus mihi nomine tantum, arreptaque manu ,quid agis, dulcissime rerum?' .suaviter, ut nunc est' inquam, ,et cupio omnia quae vis.' cum adsectaretur, ,numquid vis?' occupo, at ille ,noris nos' inquit: ,docti sumus'. hic ego .pluris hoc' inquam ,mihi ens'.
misere discedere quaerens, ire modo ocius, interdum consistere, in aurem 10 dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos manaret talos. ,o te, Bolane, cerebri felicem' aiebam tacitus, cum quidlibet ille garrirei, vicos, urbem laudaret. utilli IS nil respondebam, .misere cupis' inquit ,abire: iamdudum video; sed nil agis: usque tenebo; persequar hinc, quo nunc iter est tibi.' , nil opus est te circumagi: quendam volo visere non tibi notum; trans Tiberim longe cubat is, prope Caesaris hortos.' ,nil habeo quod agam, et non sum piger: usque sequar te.' 20 demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus,
1. Versuch J ) 2. Versuch ]
I. Mittel
I 3. Versuch
f-2. Mittel
( 4. Versuch
3. Mittel
/ 5. Versuch
•4. Mittel
temporäre
566
Horazens sogenannte Schwätzersatire cum gravius dorso subiit onus.
incipit ille: ,si bene me novi, non Viscum pluris amicum, non Varium facies: nam quis me scribere plures aut citius possit versus? quis membra movere 25 mollius? invideat quod et Hermogenes ego canto.' interpellandi locus hic erat: ,est tibi mater, cognati, quis te salvo est opus?' ,haud mihi quisquam. omnis conposui.' .felices! nunc ego resto, confice: namque instat fatum mihi triste, Sabella 30 quod puero cecinit divina mota anus urna: „hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra: garrulus hunc quando consumet cumque: loquacis, si sapiat, vitet, simulatque adoleverit aetas.'" I 21
PERIPETIE (Entscheidungsszene) 35 ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei praeterita, et casu tum respondere vadato debebat; quod ni fecisset, perdere litem. ,si me amas' inquit, .paulum hic ades.' ,inteream, si aut valeo stare aut novi civilia iura; 40 et propero quo scis.' ,dubius sum, quid faciam' inquit, ,tene relinquam an rem.' ,me, sodes.' ,ηοη faciam' ille, et praecedere coepit; ego, ut contendere durum cum Victore, sequor. II. Überzeugungsphase .Maecenas quomodo tecum?' hinc repetit. ,paucorum hominum et mentis bene sanae.' 45 ,nemo dexterius fortuna est usus, haberes magnum adiutorem, posset qui ferre secundas, hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni summosses omnis.' ,ηοη isto vivimus illic, quo tu rere, modo: domus hac nec purior ulla est 50 nec magis his aliena malis; nil mi officit, inquam, ditior hic aut est quia doctior; est locus uni cuique suus.',magnum narras, vix credibile.' ,atqui sic habet.' ,accendis quare cupiam magis illi proximus esse.' ,velis tantummodo: quae tua virtus, 55 expugnabis: et est qui vinci possit, eoque difficilis aditus primos habet.' ,haud mihi dero: muneribus servos corrumpam; non, hodie si exclusus fuero, desistam; tempora quaeram,
Resignation
6. Versuch
i
-5. Mittel
(komisch-verzweifelte ) totale Resignaiton
Kapitulation
Horazens sogenannte Schwätzersatire
60
occurram in triviis, deducam, nil sine magno vita labore dedit mortalibus.'
/ / / . ,SOS'-Phase
65
70
75
haec dum agit, ecce Fuscus Artistius occurrit, mihi carus et, ilium qui pulchre nosset. consistimus. ,unde venis?' et ,quo tendis?' rogat et respondet. veliere coepi et pressare manu lentissima bracchia, nutans, distorquens oculos, ut me eriperet male salsus ridens dissimulare; meum iecur urere bilis. ,certe nescio quid secreto velie loqui te aiebas mecum.' ,memini bene, sed meliore tempore dicam: hodie tricésima sabbata: vin tu curtís Iudaeis oppedere?' ,nulla mihi' inquam ,religio est.' ,at mi: sum paulo infirmior, unus multorum. ignosces; alias loquar.' huncine solem I tam nigrum surrexe mihi! fugit inprobus ac me sub cultro linquit. casu venit obvius illi adversarius et ,quo tu, turpissime?' magna inclamat voce, et .licet antestari?' ego vero oppono auriculam. rapit in ius: clamor utrimque, undique concursus, sic me servavit Apollo.
567
568
Horazens sogenannte Schwätzersatire
Grundmöglichkeiten der Deutung I. Wili (96): „künstlerisches Exercitium" Knoche (1971, S. 50): „Das 9. Gedicht gestaltet ein alltägliches Erlebnis, wie Catull 10; es ist die Schwätzersatire". Fraenkel (S. 141): „Bericht über einen alltäglichen Vorfall"... (134): „Vermutlich haben, zumindest teilweise, die Satiren 7, 8 und 9 ... der Absicht ihr Entstehen zu verdanken, die Zahl der Satiren auf zehn zu bringen." Π. Lejay (1911, S. 232): „Horace a voulu railler une espèce d'intrigants qui se propageait à la faveur du nouveau régime ..." Röver/Oppermann z.St.: „Zielscheibe der Kritik ist die Klasse, der Typ derer, die durch H. bei Mäcenas empfohlen werden wollen ..." Ähnlich Kiessling/Heinze. m. Lejay (S. 232): „La satire devient un avertisssement aux aventuriers que la fortune d'Horace empêchait de dormir, en première ligne à ses anciens compagnons d'hasard." IV. Röver/Oppermann a. O.: „Das innere ,Thema' des Gedichts ist der Geist des Hauses des Mäcenas, das Lob des homo purus." Turolla (1958, S. XXIV): „La satira continua insomma il ciclo dell'amicizia e dell'amico (seil, nach 3, 5 und 6)". Rudd{ 1966, S. 81): „... in a sense this poem, like 1.5, is the document of a coterie." ... (82 f.): „Maecenas and his friends knew very well that this was there poem. ... Horace's friends liked him all the more for inviting them to admire themselves." Bächner (1961) und Hering (1974) ähnlich, aber noch tieferdringend.
Typ-Bezeichnung „Aufdringling und Schwätzer" („Schwätzer")
„(ehrgeiziger, eitler) Schwätzer" „heilloser Schwätzer" „Le fâcheux"
„D seccatore" „The pest"
Vgl. schon Porphyrio: 6x ,molestus' - 3x ,importunus\ nur lx (in der Einl.) .garrulus*.
Dialog Schule-Wissenschaft ΧΠ, 1979, 5 ^ 9
O v i d s , Metamorphosen 4 als Spiel mit der Tradition Wenn gerade Ovid am Anfang der diesjährigen Vortragsreihe stehen darf, so möchte man in dieser Entscheidung des Veranstalters einen höchst glücklichen Zusammenfall von gewandelter Ovidauffassung und sich wandelnder Selbstauffassung heutiger Klassischer Philologen erkennen. Eine Fachtagung, die mit Ovid beginnt, mit einem spielenden Ovid beginnt, kann wohl von vornherein mit jenem tiefseriösen philologischen Sendungsbewußtsein, das zuweilen geradezu zu Ideologie und Religionsersatz erstarrte, nicht viel im Sinn haben; und zu dem beinahe obligatorisch gewordenen Selbstkasteiungszwang, der die Klassische Philologie in den letzten Jahren in eine schweißtreibende Modernitätsjagd hineinhetzte, will der Beginn mit gerade diesem Thema auch nicht recht passen. Die ovidische Spiel-Idee als Intrada einer Zusammenkunft Klassischer Philologen aus Universität und Schule - das kann man wohl nur als heitere Absage an akademische Pflichtverkniffenheit ebenso wie an zensurenarithmetische Programmierungsdidaktik auffassen. Was sich in dieser Absage und in dieser Sympathie für den spielenden Ovid an tieferen Motiven offenbart, das ist, so will mir scheinen, das wachsende Unbehagen an der Verpflichtung zur eigenen Bedeutsamkeit. Die Einsicht, daß auch, was wir betreiben, eigentlich ein Spiel ist Spiel in einem Sinn, der noch zu definieren sein wird - , diese Einsicht gewinnt offenbar wieder an Boden. Wenn nicht alle Zeichen trügen, gehen die Jahre der verbissenen, oft auch verbitterten und resignierten Homo-ludens-Ferne ihrem Ende zu. Eines dieser Zeichen ist nun eben der Wandel der literarischen Präferenzen. Texte, die nicht schon bannerartig gewichtige Botschaften und tiefgründige Ideen verkünden - so wie Lukrez etwa oder Vergil es tun - , sondern die geistvoll und voraussetzungsreich die Dinge und sich selbst um des Publikumsgenusses I willen nicht allzu ernst und wichtig nehmen - der Roman des Petronius 6 etwa, Horazens Saturae und eben auch Ovids elegische und epische Dichtungen - , solche Texte werden heute wieder an Universität und Schule nicht mehr nur auf Verordnung aus Bildungs- oder auch Erholungsgründen gelesen, sondern
570
Ovids .Metamorphosen' als Spiel milder Tradition
selbstgewählt aus wiedergewonnener innerer Nähe. Damit erhalten jene Autoren, die von dignitätsfixierten Generationen verworfen werden mußten, weil sie von ihnen nicht verstanden werden konnten, wieder eine Chance. Unter den Werken, die vom Affinitäts- und Interessenwandel der letzten Jahre besonders stark profitiert haben, stehen Ovids Metamorphosen mit an vorderster Stelle. I Noch im Jahre 1949 war Walter Marg1 in seinem Überblick über die Ovidauffassungen des 19. und 20. Jahrhunderts zu dem Resümee gelangt: „Man muß Ovid loben, aber man mag ihn nicht." Auf das Metamorphosenverständnis hatte sich diese Antipathie gegen den Autor besonders nachteilig ausgewirkt. Man darf heute, ohne zu übertreiben, feststellen, daß Struktur, Eigenart und Sinn dieses Gedichtes bis zu Walther Kraus' RE-Artikel von 1942 und zu Hermann Frankels Ovidbuch von 1945 fast überhaupt nicht und bis zu den 1960 bzw. 1963 erschienenen Aufsätzen von Doblhofer und v. Albrecht über Ovids Humor nur sehr unzureichend begriffen worden sind. Seit Doblhofer und v. Albrecht jedoch, also in den letzten 15 Jahren, sind erstaunliche Fortschritte in der Metamorphoseninterpretation erzielt worden. Wie groß diese Fortschritte sind, ließe sich nur durch einen Gesamtüberblick über die Ovidforschung der letzten 100 Jahre zeigen. Ein solcher Überblick - für den es hervorragende Ansätze in Gestalt der Forschungsberichte von Kraus und 7 v. Albrecht gibt - ist hier I natürlich nicht möglich. Ganz kann aber auf den historischen Rückblick nicht verzichtet werden, weil ohne ihn der eigene Deutungsversuch, den ich Ihnen im folgenden vorlegen möchte, nicht einzuordnen und nicht einzuschätzen wäre. Wie bereits angedeutet, läßt sich von einer ersten Phase des Metamorphosenverständnisses vor Kraus und Frankel - und von einer zweiten von Kraus und Fränkel bis zu Doblhofer und v. Albrecht sprechen. Die vorfränkelsche Phase war dadurch gekennzeichnet, daß in ihr das Werk als dichterisches Kunstwerk zu wenig ernst genommen wurde, die mit Fränkel beginnende dadurch, daß es zu ernst genommen und ihm eher zuviel Tiefsinn aufgebürdet wurde. Mit Doblhofer und v. Albrecht begann dann die dritte Phase der Metamorphosendeutung, in der wir uns gegenwärtig noch befinden; sie wird noch zu charakterisieren sein.
* Die bibliographischen Nachweise im bibliographischen Anhang unten S. 601.
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
571
Zunächst zurück zur ersten, zur vorfränkelschen Phase. Sie gliedert sich in drei Unterabschnitte - geschaffen durch das Erscheinen der beiden großen Oviddarstellungen von Richard Heinze im Jahre 1919 und von Edgar Martini im Jahre 1933. Im ersten Abschnitt, bis zu Heinze, werden die Metamorphosen allgemein noch gar nicht als eigenständiges Kunstwerk erkannt, sondern sie werden, wie besonders Guthmüller in seiner Dissertation von 1964 gezeigt hat, als eine Art mythographisches Lexikon, eine Art antiker .Roscher', mit dem Ziele der Rekonstruktion verlorengegangener griechischer und römischer Ovidvorläufer durchgeblättert. Für die Metamorphosen als solche fiel bei diesen Quellenforschungen zunächst nur hier und da etwas ab; so hat besonders Lafaye in seinem 1904 erschienenen Buch über die griechischen Modelle der Metamorphosen die Erkenntnis immerhin schon vorbereitet, daß Ovid kein Sagensammler und die Metamorphosen kein mythologisches Kompendium in Versform sind. Den Durchbruch dieser Erkenntnis brachte Heinze. In seiner Abhandlung über Ovids elegische Erzählung wurde der Dichter der Fasten und der Metamorphosen in größerem Rahmen erstmalig als Künstler gewürdigt. Damit war die Voraussetzung für ein Verständnis des Werkes geschaffen. Verstanden war das Werk damit noch nicht. Im Gegenteil: der gattungsvergleichende Aspekt I Heinzes - hier Elegie, dort Epos - führte zu einer Fehldeutung des 8 Werkcharakters, deren Folgen heute noch nicht ganz überwunden sind: gegenüber den Fasten mit ihrem gattungsbedingten elegisch-sentimentalen Grundton erschienen die Metamorphosen als Repräsentation des großen, erhabenen, würdevollen und hochpathetischen Epos. Das bedeutet: als Kunstwerk war das Gedicht nun zwar erkannt, aber seine Aussageabsicht war verkannt - wie sehr, das haben erst die letzten 15 Jahre gezeigt, - anklingen wird es auch heute wieder. Folgenreich war Heinzes Forschungsansatz: die Zusammenspannung von Fasten und Metamorphosen, auch noch in einer anderen Hinsicht: ich meine in der Frage der Werkstruktur. Indem nämlich die Fasten, mit ihrem vergleichsweise einfachen, additiven Aufbau, zum Ausgangspunkt der Stilanalyse gemacht wurden, wurde die Bedeutung der Strukturfrage für das Metamorphosenverständnis von vornherein herabgemindert, und der Eindruck, den Heinze von der Fastenstruktur hatte, übertrug sich auch auf seine Beurteilung der Metamorphosenstruktur. Die Folge war, daß sich die Metamorphosen auch ihm noch als einigermaßen systemloses Kettengedicht darstellten. Diese beiden Fehlbeurteilungen - besonders die zweite, strukturelle - setzten sich fort bei Martini. Er gibt Heinzes stilvergleichender Betrachtung den lite-
572
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
rarhistorischen Unterbau. Die Metamorphosen erscheinen hier als höchste antike Ausprägung jener hellenistischen Epos-Form, die in Kallimachos' Aitia oder Parthenios' Metamorphoseis, in Nikanders Heteroiumena oder in der Leontion des Hermesianax vorgebildet war: Martini prägt 1927 in seinem Aufsatz in der Gedenkschrift Swoboda für diese Epos-Form den berühmt gewordenen Terminus .Kollektivgedicht', - der die Erkenntnis der Metamorphosenstruktur für die nächsten 30 Jahre nachhaltig verhindern sollte. Dies also war die erste Phase des Metamorphosenverständnisses. An ihrem Ende - nach Heinzes und Martinis Büchern - galt das Gedicht als im wesentlichen verstanden: die in 15 Büchern zusammengetragenen rund 250 Sagenerzählungen stellten - so glaubte man - die von einem virtuosen, aber höchst oberflächlichen Geist geschaffene artistisch raffinierte Vollendung einer helleni9 stisch-alexandrinischen Literaturlform im lateinischen Sprachgewande dar; sie waren also eines der mittelmäßigeren römischen Rezeptionsprodukte, sprachlich-stilistisch und besonders rhetorisch exzellent, sonst aber ohne Originalität und tiefere Bedeutung. Tieferblickende Ovidkenner konnte dieses Bild natürlich nicht befriedigen. So gab es denn in der Folge verschiedentliche Widersprüche; der anregungsreichste dürfte der des englischen Gelehrten Higham von 1934 sein, abgedruckt im WdF-Band ,Ovid'. Ganz ohne Wirkung blieben solche Proteste nicht; das zeigte sich an der nächsten großen Gesamtdarstellung, dem RE-Artikel ,Ovid' von Walther Kraus aus dem Jahre 1942. Hier kam nun endlich auch der Mensch Ovid stärker ins Blickfeld, den Higham noch so sehr vermißt hatte. Aber bei aller Anerkennung des psychologischen Einfühlungsvermögens Ovids, seines Strebens nach lebenswahrer Menschenzeichnung und auch schon seines Humors sah Kraus im Dichter der Metamorphosen in erster Linie doch wieder nur den Virtuosen, diesmal unter dem Erscheinungsbild des Zöglings der Rhetorenschule: Ovid - meint Kraus - geht es letztlich nur um rhetorische Effekte, - und die Metamorphosen rücken auf diese Weise in die Nähe einer überdimensionierten rhetorischen Étude. An diesem Punkt griff Hermann Fränkel in die Debatte ein. Er holte zuerst einmal den ungeliebten Neoteriker und Rhetor Ovid aus der Ecke des Technikers ohne Herz, in die ihn die Forschung hineingedrängt hatte, mit Schwung wieder heraus: Charakteristisch dafür ist etwa folgender Satz in Fränkels Buch (98)2:
2 Zitiert nach der deutschen Übersetzung von K. Nicolai (s. den bibliographischen Anhang).
Ovids ,Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
573
(Ovids) „fühlendes Herz wandte sich in brüderlicher Liebe allen Geschöpfen zu, zunächst den Menschen oder denen, die den Menschen gleich waren, aber dann auch den Tieren, und manchmal sogar den Pflanzen. Er war sowohl weltklug als auch verspielt. Er hatte eine kindliche Freude am Sagenhaften, und er I brachte es fertig, Wunder in seiner sanften Art so zu behandeln, daß sie fast natürlich erschienen. Sicher und mit vollkommener Anmut bewegte er sich in dem Zwischenbereich der Halbwirklichkeit. Und schließlich hatte er wertvolle eigene Gedanken, obwohl einige davon nicht gerade klar und deutlich waren."
10
Hier ist nun Ovid als Mensch ernst genommen, - allerdings ein wenig von oben herab. Wir werden sehen, daß dieses ,Von-oben-herab' ein großer Fehler war. Er entstand daraus, daß Frankel Ovid für naiv hielt. Zehn Jahre nach Frankel hat Wilkinson entschieden widersprochen: Ovid ist alles andere als naiv, sagt Wilkinson, er ist pseudo-naiv (159). Wilkinson hat recht. Für naiv konnte Ovid nur jemand halten, der selbst etwas naiv war; und wer Fränkels Ovidbuch gelesen hat, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß Ovid wesentlich hintergründiger, ironischer und gebrochener angelegt war als sein Interpret. Das ist der Grund dafür, daß auch Frankel Ovid und die Metamorphosen immer noch nicht wesensgemäß verstand. Er sah den Menschen und den Künstler - und das war ein großer Fortschritt - , aber er sah beide schief. Das wird besonders deutlich in dem folgenden Urteil, das offenbart, wie die Verkennung des Menschen Ovid die Verkennung des Kunstcharakters seiner Dichtung nach sich zog (82): „Und schließlich mußte Ovid irgendwie einen ernsthaften geistigen Defekt überwinden, nämlich seine Unfähigkeit, sein Material systematisch zu ordnen und seine Gedanken konsequent zu entwickeln. Wie konnte er, durch diesen schwerwiegenden Mangel belastet, es wagen, fünfzehn lange Bücher mit Geschichten, die keinen einzigen Bruch in der Kontinuität zulassen sollten, in ein System zu bringen? Durch eine geniale Leistung verwandelte er seine Schwäche in einen unbestrittenen Triumph. Er machte seine anlagebedingte Schwäche wieder gut durch einen unerschöpflichen Einfallsreichtum im Improvisieren: er wurstelte sich gewissermaßen I sanft durch die ganze ungeheure Weite seines riesigen Epos hindurch, indem er aufs Geratewohl alle Arten von Notbehelfen anwandte, die so glücklich sind, daß sie seine Bewunderer in Entzücken versetzen und selbst seinen bittersten Kritikern Achtung abnötigen."
Diese Auffassung der Metamorphosen als strukturloses und systemloses Produkt zufälliger Improvisation - hier bei Fränkel nicht literarhistorisch begründet wie bei Martini, sondern individualpsychologisch - , diese krasse Unterschätzung Ovids kontrastiert nun aber merkwürdig mit einer Überschätzung der Werkôedeutung. Schon auf der dritten Seite erfahren wir, „daß die Dichtung Ovids eine tiefere Bedeutung hat", und nachdem sich bei der Behandlung der Amores herausgestellt hat, daß Ovids eigentliches Thema die „zweifelhafte oder fließende Identität" (22) ist und daß das Gefühl des Identitätsverlusts für Ovid auf Grund
11
574
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
seiner Zwischenstellung zwischen Heidentum und Christentum eine selbstverständliche Erfahrung ist (ebd.), entpuppen sich die Metamorphosen als ein Gedicht, in dem ein ,.neuer Grenzbereich der Erfahrung" von Ovid „erforscht" wird, nämlich „das Wechselspiel zwischen Andersheit und Selbstheit" (90); mit der Beschreibung von Herkules' Doppelnatur - halb Gott, halb Mensch (für Fränkel ist das eine „Individualitätsspaltung") - nimmt Ovid „das Dogma der beiden Naturen in Christus vorweg" (88). Ovids Geist, so heißt es am Schluß, „war immer gewohnt, die schwierigen Regionen irgendeines Zwischenreiches aufzusuchen" (180), und ganz am Ende des Buches fällt das schwere Wort von der „Sendung Ovids", die darin bestanden haben soll, die kurze Spanne des Übergangs zwischen den beiden Welten, der niedergehenden heidnischen und der heraufziehenden christlichen, zu verewigen (180). Mit dieser Metamorphosendeutung, die weitgehend nur an den Text herangetragen ist, beginnt - wie eingangs gesagt - die zweite Phase des Werkverständnisses. Sie ist ebenso extrem wie die erste. Waren die Metamorphosen dort eine virtuose, aber substanzlose Imitation gewesen, so sind sie nun zur tiefsinnigen, originellen Deutung einer bestimmten historischen Epoche geworden. Beide 12 Wege - auch der zweite, auf dem Fränkel I noch manchen Nachfolger fand, wie etwa Viarre - , beide Wege waren, wie wir heute sehen, falsch. Aber beide waren selbstverständlich nicht umsonst. Beide enthalten, wie es ja stets bei antithetischen Interpretationsansätzen der Fall ist, partiell richtige Einsichten, die aufgenommen und in die weiteren Deutungsbemühungen eingeschmolzen zu werden verdienen. Die eigentliche Werkintention jedoch war nach wie vor noch nicht erkannt. Dies zeigte sich sehr bald an den Kritiken, die Frankels Buch erfuhr, es zeigte sich an Wilkinsons Metamorphosenauffassung und es zeigte sich vor allem an den schon genannten beiden Aufsätzen von Doblhofer und v. Albrecht. In ihnen wird die Interpretation zum ersten Mal so differenziert, so hellhörig und gewitzt, daß man beim Vergleich der Deutung mit dem Original nicht länger das deprimierende Gefühl einer im Grunde unüberbrückbaren Wesensdiskrepanz zwischen Dichter und Deuter hat. Der Geist der Metamorphosen, den man ja beim unbefangenen Lesen seit eh und je schon hier und da für Augenblicke zu spüren meinte, färbt nun endlich auch auf den Ton der Deutung ab. Erreicht wird das durch eine energische Konzentration auf einen Wesenszug der Metamorphosen, den man schon immer gesehen, aber noch niemals für sonderlich bedeutsam gehalten hatte: auf den Humor. Genaue Stelleninterpretationen zeigen nun, daß das ganze Werk aus dem Geiste des Humors geschaffen ist - v. Albrecht nennt es gar eine »Enzyklopädie des Humors' - und daß sich die bis dahin vorwiegend
Ovids , Metamorphosen ' als Spiel mit der Tradition
575
isoliert registrierten Darstellungsmittel .Ironie, Witz, Parodie, Travestie' und ähnliches alle unter der werkprägenden und Einheit stiftenden Grundhaltung des Humors vereinigen und von ihr aus erschließen lassen. Damit beginnt die dritte Phase des Metamorphosenverständnisses. Der Blick der Interpreten ist jetzt so geschärft, der Beobachtungssinn so verfeinert, daß auch die kleinsten Nuancierungen des Tones wahrgenommen werden. Damit zieht nun allerdings eine neue Gefahr auf, die die Interpreten in eine bis dahin in der Ovidforschung unerhörte dritte Extremhaltung drängt: es ist die Gefahr, die Fülle der Nuancen und der Unter-, Ober- und Zwischentöne in den Metamorphosen so hoch anzusetzen, daß eine vollständige Erfassung unmöglich erscheint. Dieser Gefahr haben sich I die Verfasser der beiden letzten großen 13 Ovidbücher gegenübergesehen, Otto Steen Due (1974) und G. Karl Galinsky (1975). Für eine abschließende Beurteilung dieser Bücher ist die Zeit wohl noch nicht reif, aber man hat den Eindruck, daß beide Autoren der gekennzeichneten Gefahr weitgehend erlegen sind. Die Möglichkeit, die Autorintention wirklich zu erkennen und das Werk dann intentionsadäquat zu verstehen, wird in diesen Büchern geradezu geleugnet. Vor Ovids Metamorphosen werden die Waffen gestreckt. Das Gedicht ist nun als Kunstwerk selbst zu einer einzigen in ihrem Variantenreichtum flirrenden und verwirrenden kaleidoskopartigen Dauermetamorphose geworden, zu einem Proteus, der immer wieder neue Gestalten annimmt und den, der ihn fassen will, unaufhörlich foppt und narrt, - ungreifbar also, ein wunderbares Zauberwesen. Due spricht von der „strukturellen Multiplizität" des Gedichts, die unendlich sei und spiegelartig dauernd neue Reflexe produziere, je nachdem, welchen Standpunkt der Leser gerade einnehme, welche Bewegung er gerade vollführe, und er macht am Ende den Vorschlag: „Vielleicht sollten wir das Wort Struktur überhaupt nicht verwenden" (164). Galinsky, dessen Darstellung gleichzeitig und unabhängig entstand, schlägt den gleichen Weg ein, wenn er von der „impressionistischen Einheit" des Gedichtes redet und behauptet:, Jeder, der Ovids Prozedur auf technische Muttern und Bolzen zurückzuführen versucht, wird entweder frustriert werden oder dem Gedicht von außen her Strukturen aufzwingen, die ihm fremd sind" (98 f.). Dies also ist die letzte Auskunft, die die Ovidforschung zu den Metamorphosen anzubieten hat. Der Weg, den wir zurückgelegt haben, begann mit Überheblichkeit gegenüber einem Werk, das simpel und ganz unoriginell erschien, und er endet in Resignation gegenüber einer Schöpfung, die so extrem kompliziert und originell erscheint, daß alle Versuche, ihrer Eigenart habhaft zu werden, von vornherein zum Scheitern verurteilt scheinen.
576
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Müssen wir mit diesem skeptischen Fazit über Ovids Metamorphosen die Akten schließen? Ich glaube nicht. Mir scheint, daß nunmehr, nachdem unsere Sinne für dieses außerordentliche Werk empfänglich gemacht worden sind, - daß 14 nunmehr das Metamorphosenverständnis I erst eigentlich beginnen kann. Die extreme Skepsis der letzten Forschungsphase wird man nicht teilen. Es ist ja nur natürlich, daß die Interpretation in 15 Jahren nicht aufholen kann, was sie in 150 Jahren nicht erreicht hat. Die so plötzlich in ihrem ganzen Umfang erkannte Variabilität des Werkes muß die Interpreten ja zunächst einmal erschlagen. Und daß ein sprachliches Kunstwerk niemals sozusagen zu Ende interpretiert ist, das ist ja kein Spezifikum der Ovidischen Metamorphosen. Man wird also nunmehr, statt zu resignieren, voller Freude über den Erkenntnisgewinn der letzten Jahre von den neuen Forschungsansätzen und -mittein Gebrauch machen. Man wird in den Metamorphosen erneut auf Entdeckungsreise gehen. Vollkommen Neues wird man dabei vielleicht nur selten entdecken, dafür aber den Prozeß der Verstäodmsverfeinerung, der sich in der Gesamtdeutung vollzogen hat, nunmehr vielleicht auch auf das Einzelne übertragen können. Manches, was materiell längst gesehen ist, wird dabei konsequenterweise in neuer Tönung erscheinen. Π Zu diesen Eigentümlichkeiten des Gedichts, die als solche längst gesehen sind, gehört sein Spielcharakter. Kaum ein Wortfeld in den modernen Sprachen dürfte im Zusammenhang mit der Metamorphosendeutung so oft strapaziert worden sein wie das Wortfeld ,Spiel'. Erstaunlich ist dabei nur, wie undifferenziert und unreflektiert die Angehörigen dieses Wortfelds auf die Metamorphosen angewendet werden. Bald ist das Gedicht ein ,Spiel', bald eine .Spielerei', bald Ausdruck einer .Verspieltheit', bald ist es .spielerisch', bald .spielend', bald .gespielt', bald .verspielt' usw. Dieser Tatbestand wiederholt sich in allen modernen Interpretationssprachen. Eine genauere Untersuchung darüber, welcher dieser verschiedenen Ausdrücke denn nun das Gedicht am ehesten charakterisiert, und das bedeutet: eine genauere Untersuchung des Spielcharakters der Metamorphosen, steht m. W. bisher noch aus. Das ist um so bedauerlicher, als kaum zu bezweifeln ist, daß mit dem Begriff 15 .Spiel' etwas sehr Wesentlliches an den Metamorphosen getroffen wird. Ovid spielt in der Tat auch in den Metamorphosen, so wie er in seiner Liebesdichtung spielt. Daß er selbst es so gesehen hat, zeigt seine zweimalige Selbstdefinition als ,tenerorum lusor amorum' in seinem selbstgeschaffenen Grabepigramm (Tr. 3,3,73) und in seiner Selbstbiographie (Tr. 4,10,1), - denn daß er den Dichter
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
577
der Metamorphosen, ebenso wie den der Fasten, von dieser umfassenden Selbstcharakterisierung ausgeschlossen wissen wollte, wird man nicht annehmen können. Die Frage ist nur, welche Bedeutung Ovid mit dem Begriff,Spiel' in der Anwendimg auf sein eigenes Tun verbunden hat. Ginge es nach der modernen Ovidliteratur, dann müßte der Dichter eine sehr abschätzige Auffassung von seinem eigenen Spielen gehabt haben. Denn wohin man auch schaut, fast überall wird .Spiel' als negative Deutungskategorie verwendet.,Spiel' ist gleichbedeutend mit kindischer, bestenfalls kindlicher Tändelei ohne Sinn und Ziel, mit Firlefanz, der eines wahren Mannes und Dichters unwürdig ist. Folglich impliziert .Spiel' in der ersten Phase der Metamorphosendeutung schon das Verdammungsurteil, und in der zweiten und dritten Phase wird geflissentlich versucht, den Spielcharakter des Werks als untergeordnetes Merkmal hinzustellen, um das Gedicht aufwerten zu können. Wie fest dieser negative Spielbegriff in der Metamorphosendeutung sitzt, zeigt sich bei Autoren, die von ihrem ganzen Ansatz her eigentlich gar keinen Anlaß hätten, den spielenden Ovid möglichst zuzudecken. So unterläuft z.B. Doblhofer bei der Paraphrase eines Highamschen Gedankens folgender lapsus: „Wie kommt es, daß Ovid als Dichter zu allen Zeiten die Bewunderung großer Dichter genoß? Er muß doch wohl mehr als ein lusor gewesen sein!" (66f.). Und in Ernst Zinns Gedächtnisrede auf Ovid, die 1958 zur 2000-Jahrfeier Ovids gehalten und 1967 im WdF-Band ,Ovid' abgedruckt wurde, heißt es: „Es wäre also ganz falsch, Ovids Dichtertum nur von der Seite des .Spielerischen' her würdigen zu wollen; gerade die Spannung zwischen dem .Spielerischen' und dem .Enthusiastischen' macht das Eigene und Besondere der ovidischen Dichtung aus" (37). Da wird also ein Gegensatz zwischen .Spielerischem' und .Enthusiastischem' aufgebaut. Und an anderer Stelle wird behauptet, weil Pathos und Ironie I in Ovid untrennbar verschwistert gewe- 16 sen seien, könne „das Spiel, der lusus, nur die eine Komponente dieses Naturells ausgemacht haben" (32). Dies alles wird gesagt, obwohl schon 1942 Waither Kraus in seinem RE-Artikel3 den entscheidenden Hinweis gegeben hatte: Ovids
3
Jetzt S. 158 der Neubarbeitung im Wege der Forschung-Band ,Ovid'. Die wohl einzige Ovid-Arbeit, die im Spiel das entscheidende Charakteristikum der Metamorphosen sieht, Bernbecks .Beobachtungen' (bes. Kap. V, S. 123. 138), hat diesen Hinweis von Kraus nicht aufgegriffen - sehr zu ihrem Schaden, wie mir scheint, weil ihr Spielbegriff dadurch substanzlos bleibt: die Metamorphosen werden als „manieristisches Werk" eingestuft, dessen „Originalität auf dem Gebiet des Formalen liegt" und das „weniger Ziele der religiösen und moralischen Erschütterung und Erziehung als der geistreichen Unterhaltung (verfolgt)" (138). Auch damit ist
578
Ovids ,Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Werk, sagt Kraus dort, „ist in einem weit höheren Grad, als das von aller Kunst gilt, Spiel", - und in Klammern folgt: „Über Dichtung als Spiel s. J. Huizinga, Homo ludens, Amsterdam 1939,192 ff." Folgen wir diesem Hinweis von Kraus, so finden wir bei Huizinga folgende Definition des Spiels: „Es ist eine Handlung, die innerhalb gewisser Grenzen von Zeit, Raum und Sinn verläuft, in einer sichtbaren Ordnung, nach freiwillig angenommenen Regeln, außerhalb der Sphäre materieller Nützlichkeit oder Notwendigkeit. Die Stimmung des Spiels ist Entrücktheit und Begeisterung, und zwar entweder eine heilige oder eine lediglich festliche, je nachdem das Spiel Weihe oder Belustigung ist. Die Handlung wird von Gefühlen der Erhebung und Spannung begleitet und führt Fröhlichkeit und Entspannung mit sich." (129) I
17 Begeisterung also als Spiel element, nicht, wie Zinn meint, als Spielgegensatz. Und wer wüßte nicht auch aus eigener Erfahrung, daß wirkliches Spiel ohne Begeisterung, ohne Enthusiasmus gar nicht möglich ist, vom Versteckspiel über das Tennis bis zum Schachspiel, vom Klavier- und Orgelspiel bis zum Theaterspiel, sei das Spiel auf den Brettern nun Komödie oder Tragödie. Es scheint also durchaus verkehrt, ,Spiel' mit Oberflächlichkeit und Unemst gleichzusetzen, - und den lusor mit dem Playboy. - Als Josef Knecht in Hesses ,Glasperlenspiel' in Waldzell zum ersten Mal aus einem der Gebäude des Vicus lusorum „einen Mann kommen sah, in der Tracht der Glasperlenspieler", da „dachte er bei sich, daß dies nun einer der sagenhaften lusores sei, möglicherweise der Magister Ludi selbst. Mächtig spürte er den Zauber dieser Atmosphäre, alles schien hier alt, ehrwürdig, geheiligt, von Tradition beladen..." (90). Spiel und Tradition gehören bei Hesse zusammen. Das Glasperlenspiel ist nach seiner Definition (126) „eine universale Sprache und Methode, um alle geistigen und künstlerischen Werte und Begriffe auszudrücken und auf ein gemeinsames Maß zu bringen", - es ist also ein Spiel mit sämtlichen überlieferten Wissens- und Bildungsinhalten, ein Spiel mit der Tradition. Gespielt wird es „aus der Freude am Erfinden, Konstruieren und Kombinieren" (127), es ist also eine durchaus schöpferische Tätigkeit, die aus der Kombination des Tradierten Neuartiges hervorbringt. Es scheint, daß von dem Spielbegriff her, wie er hier beschrieben wird, neues Licht auch auf Ovids Metamorphosen fallen könnte. Wir wollen das an zwei konkreten Fällen überprüfen. Tradition umfaßt Hunderte von Einzelelementen. Ich greife zwei davon heraus: die Form - und be-
Ovid unterschätzt. Ein wirklich treffendes Urteil dürfte am ehesten auf der Grundlage einer Synthese zwischen den Ovidauffasssungen von Bembeck und Otis (1970) zu erwarten sein.
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
579
stimmte literarische Gestaltungen des Stoffes. Beide Faktoren sind Ovid vorgegeben. Unsere Frage ist nun: wie spielt er mit ihnen? Ziellos-tändelnd oder schöpferisch? Und zum Schluß wollen wir dann noch fragen: welchen Sinn hat sein Spiel? I III Die literarische Form, in der sich Ovids Metamorphosen realisieren, ist das hexametrische Epos. Diese Literaturform hatte, als Ovid die Metamorphosen zu dichten begann, bereits eine tausendjährige Geschichte hinter sich. Im Laufe dieser Geschichte hatte das Epos, indem es immer wieder neue Themenbereiche an sich zog, eine Reihe verschiedenartiger Strukturtypen entwickelt. Das homerische Heldenepos war zu Ovids Zeit nur noch einer dieser Strukturtypen. Daneben waren ganz anders strukturierte Typen getreten: das Katalog-Epos (vertreten durch Hesiods Ehoien), das praktische oder spekulative Lehr-Epos (vertreten durch Hesiods Erga kai Hemerai bzw. die philosophischen Lehrgedichte des Parmenides, Empedokles, Lukrez), das historische Epos in seinen verschiedenen Varianten (vertreten etwa durch Choirilos von Samos, Rhianos von Bene, Naevius, Ennius, partiell auch durch Vergils Aeneis), schließlich jener Typ, den man das wissenschaftliche (oder pseudowissenschaftliche) Epos nennen kann, vertreten etwa durch Arats Darstellung der Astronomie und Nikanders Versifizierung der Giftkunde und anderer Wissensgebiete. Von der Aufzählung weiterer Typen wollen wir in unserem Zusammenhang absehen. Ovid sah diese Typenvielfalt vor sich. Er konnte sich für einen der tradierten Typen entscheiden, er konnte auch alle als unbrauchbar verwerfen. In jedem Falle aber mußte er sich irgendwie in diese Tradition einordnen. Dies hat er im Proömium getan. Das Epenproömium ist traditionsgemäß die Programmerklärung des Epikers. In ihm offenbart sich zweierlei: erstens der epische Strukturtyp, dem der Autor folgen will, zweitens die spezielle Werkintention des Autors. Diese beiden Informationen werden dem Leser jedoch nicht explizit gegeben, sondern implizit, und zwar eingehüllt in die beiden Grundbestandteile, die jedes Epenproömium enthält: die Thema-Angabe und die Inspirationsbitte. Ovids Metamorphosenproömium macht keine Ausnahme. Wir betrachten die vieldiskutierten vier Verse genauer. Sie lauten: I
18
580 19
Ovids .Metamorphosen' als Spiel milder Tradition In nova fert animus mutatas dicere formas corpora: di, coeptis - nam vos mutastis et illas - 4 adspirate meis primaque ab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen!
Die vorhin genannten beiden Grundbestandteile des Proömiums sind deutlich: im ersten Vers - und mit Enjambement hinübergreifend in den zweiten - die Thema-Angabe, - dann, vom Vokativ ,di' an, das Formelement , Inspirationsbitte'. Die Thema-Angabe besteht - entsprechend der Tradition - aus einem Verb des Sagens und seinem Objekt. Das Verb des Sagens lautet in unserem Falle ,dicere', erweitert durch das vorgeschaltete ,fert animus', - das Objekt lautet .formas', zweimal erweitert, erstens durch das Partizip .mutatas', zweitens durch die logisch erforderliche Ergänzung des Begriffs .mutare' in Form der Resultat-Angabe ,in nova corpora'. Rein begrifflich formuliert lautet also die Thema-Angabe: ,Ich beabsichtige, Formen zu nennen, die in neue Körper verwandelt worden sind'. Wir hatten gesagt, in den beiden expliziten Bestandteilen eines Epenproömiums offenbarten sich Strukturtyp und Intention des gegebenen Werkes. Demnach muß sich auch aus dieser Thema-Angabe schon ein Hinweis auf den 20 Strukturtyp der Metamorphosen entnehmen laslsen. Dies ist natürlich nur auf dem Wege des Vergleichs mit anderen epischen Thema-Angaben möglich. Wir betrachten daher eine Reihe von Epenproömien, die auch Ovid vorlagen, und versuchen, die strukturellen Übereinstimmungen mit Ovids Thema-Angabe herauszufinden.
nias Μήνιν αειδε. .fte.ó, Πηληιάδεω Άχιλήος ούλομενην, ή μυρί' Άχαιοις αλγε' εθηκε, πολλάς δ' ίφθίμους ψυχάς "Ανδι προΐαψεν ηρώων, αυτούς δέ έλώρια τεύχε κύνεσσιν 4 Die Diskussion Uber den .ursprünglichen' Wortlaut (und Umfang) der Parenthese kann hier außer Betracht bleiben. Die teilweise abenteuerlichen Änderungsvorschläge haben die Qualität der oben abgedruckten überlieferten Fassung erst eigentlich erkennen lassen. Die Funktion des umstrittenen ,et' besteht m. E. darin, aus dem Hinweis auf die damalige (illas) Verwandlungstätigkeit der Götter in der Realität des Mythos die Forderung nach Wiederholung dieser Verwandlungstätigkeit in der Fiktivität des Epos abzuleiten; logisch gesehen könnte das ,et' statt vor ,illas' ebenso gut vor ,meis' stehen. Sinn: Götter, ihr habt damals dort verwandelt, so verwandelt denn jetzt mit mir zusammen auch hier!
Ovids , Metamorphosen ' als Spiel mit der Tradition
οίωνόΐσί τε δαιτα- Διός δ' έτελείετο βουλή· έξ οΰ δή τά πρώτα διαστητην έρίσαντε Άτρεΐδης τε αναξ άνδρών και διος Άχιλλεύς.
581
5
Odyssee "Ανδρα μοι εννεπε, Μοΰσα, πολύτροπον, δς μάλα πολλά πλάγχθη, έπεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερσεπολλών δ' ανθρώπων ϊδεν αστεα και νόον έγνω, πολλά δ' ö γ' έν πόντω πάθεν άλγεα δν κατά θυμόν, άρνύμενος ήν τε ψυχήν καί νόστον έταίρων. 5 άλλ' ούδ' ώς έτάρους έρρύσατο, ίέμενός περ· αύτών γαρ σφετέρησιν άτασθαλίησιν ολοντο, νήπιοι, οι κατά βοΰς Τπερίονος Ήελίοιο ήσθιον αύτάρ ό τοίσιν άφείλετο νόστιμον ήμαρ. των άμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, είπέ και ήμίν. I 10 Hesiod, Theogonie Χαίρετε, .τέκνα Διός, δότε δ' ίμερόεσσαν άοιδήν κλείετε δ' άθανάτων ιερόν γένος αίέν έόντων, οι Γης έξεγένοντο καί Ούρανοΰ άστερόεντος, Νυκτός τε δνοφερής, ους θ' αλμυρός έτρεφε Πόντος, [είπατε δ' ώς τά πρώτα θεοί και γαία γένοντο και ποταμοί καί πόντος άπείριτος, οΐδματι θυίων, άστρα τε λαμπετόωντα και ούρανός ευρύς ϋπερθεν.] οί τ' έκ τών έγένοντο θεοί δωτηρες έάων, ώς τ' αφενός δάσσαντο καί ώς τιμάς διέλοντο ήδέ και ώς τά πρώτα πολύπτυχον εσχον Όλυμπον. ταΰτα μοι εσπετε Μοΰσαι 'Ολύμπια δώματ εχουσαι έξ άρχής, και ειπαθ' οτι πρώτον γένετ' αύτών. Apollonios Rhodios, Argonautika 'Αρχόμενος σέο Φοίβε παλαιγενέων κλέα φωτών ανησοααι οι Πόντοιο κατά στόμα καί διά πέτρας
105
110
115
5 82
Ovids, Metamorphosen ' als Spiel mit der Tradition
Κυανέας βασιλήος έφημοσύνη Πελίαο χρύσειον μετά κώας έύζυγον ήλασαν Άργώ. I 22
Arat, Phainomena Έκ Διός άρχώμεσθα. τον ούδέποτ', άνδρες, έώμεν άρρητον μεσταί δέ Διός πάσαι μεν άγυιαί, πάσαι δ' ανθρώπων άγοραί, μεστή δέ θάλασσα και λιμένες· πάντη δέ Διός κεχρήμεθα πάντες. του γάρ και γένος είμέν ô δ' ήπιος άνθρώποισι δεξιά σημαίνει, λαούς δ' έπί έργον έγείρει μιμνησκων βιότοιο, λέγει δ' οτε βώλος άριστη βουσί τε και μακέλησι, λέγει δ' οτε δεξιαί ώραι και φυτά γυρώσαι και σπέρματα πάντα βαλέσθαι. αύτός γάρ τά γε σήματ'έν ούρανω έστήριξεν άστρα διακρίνας, έσκέψατο δ', εις ένιαυτόν αστέρες οί κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν άνδράσιν Ώράων, οφρ' έμπεδα πάντα φύωνται. τω μιν άεί πρώτον τε και ϋστατον ίλάσκονται. χαίρε, πάτερ, μέγα θαύμα, μέγ' άνθρώποισιν ονειαρ, αύτός και προτέρη γενεή. χαίροιτε δέ, Μοΰσαι, μειλίχιαι, μάλα πάσαι. έμοί γε μέν, άστέρας ειπείν
5
10
15
η θέμις, εύχομένω τεκμήρατε πάσαν άοιδήν. Nikander, Theriaka Ρέΐά κέ τοι μορφάς τε σίνη τ' όλοφώια θηρών άπροϊδή τύψαντα λύσιν θ' έτεραλκέα κήδευς, φίλ' 'Ερμησιάναξ, πόλεων κυδίστατε παών, εμπεδα φωνησαυΑΐ' σέ δ' άν πολύεργος άροτρεύς βουκάίός τ' άλέγοι και όροιτύπος, εύτε καθ' ϋλην ή και άροτρεύοντι βάλη επι λοιγόν οδόντα, τοία περιφρασθέντος άλεξητήρια νούσων. I
5
583
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Nikander, Alexipharmaka
23
Ei και μή σύγκληρα κατ' Άσίδα τείχεα δήμοι τύρσεσιν έστήσαντο τέων άνεδέγμεθα βλάστας, Πρωταγόρη, δολιχός δέ διάπροθι χώρος έέργει, ρειά κέ τοι ποσίεσσιν άλέξια φαρμακοέσσαις
5 αύδήσαιμ' α τε φωτάς ένιχριμφθέντα δαμάζει.
Vergil, Aeneis Arma virumque cano. Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus et alto vi superum, saevae memorem Iunonis ob ir am, multa quoque et bello passus, dum conderet urbem inferretque déos Latio, genus unde Latinum Albanique patres atque altae moenia Romae. Musa, mihi causas memora, quo numine laeso quidve dolens regina deum tot volvere casus ... Die Proömien sind absichtlich nicht typologisch, sondern chronologisch angeordnet, so daß zunächst der Eindruck eines überwältigenden Variantenreichtums entsteht. Sehr schnell wird aber deutlich, daß sich die Varianten auf zwei Grundtypen zurückführen lassen. Der eine Grundtyp wird repräsentiert durch Ilias, Odyssee, Argonautika und Aeneis, der andere durch sämtliche übrigen Proömien. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Typen besteht darin, daß in der Kombination ,Verb des Sagens + Objekt' beim ersten Typ das Objekt eine Person, und zwar ein Heros, ist, beim zweiten Typ dagegen eine Sache. In der Odyssee ist das Objekt der ,άνήρ πολύτροπος, ος μάλα πολλά πλάγχθη', also Odysseus, - in der Ilias ist das Objekt die ,μήνις Άχιλήος', das heißt allgemeiner: Achill, gesehen unter einem bestimmten Teilaspekt, seinem Groll, - bei Apollonios bilden das Objekt die ,κλέα φωτών, oí κατά στόμα I Πόντοιο ήλασαν 'Αργώ', das heißt: die Ar- 24 gonauten, - und bei Vergil ist das eigentliche Objekt, wie der erläuternde Relativsatz nach ,virumque' zeigt, natürlich nicht ,arma', sondern der ,vir, qui primus ab oris Troiae Italiam profugit', also Aeneas (die Verschränkung von ,virum' mit ,arma' bildet ja nur programmatisch die im Werk vollzogene Verschränkung der Odyssee mit der Ilias sprachlich nach).
584
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Bei den Epen des zweiten Typs dagegen steht an der strukturell entsprechenden Stelle jeweils ein Sachbegriff: bei Arat,αστέρας', die Sterne, bei Nikander in den Theriaka ,μορφάς τε σίνη τε θηρών' sowie ,λύσιν κήδευς', also .Arten und Bisse von Tieren' sowie .Heilung vom Leiden', und in den Alexipharmaka sind die ,άλέξια' das Objekt, also .Gegenmittel', - nämlich gegen giftige Säfte. Bei Hesiod in der Theogonie ist die Thema-Angabe länger, und es würde zuviel Zeit kosten, den Sachverhalt ausführlich zu explizieren; entscheidend ist hier, daß die Thema-Angabe mehrere Teile umfaßt: erstens5 ,ώς τα πρώτα θεοί καί γαία γένοντο', also die erste Entstehung des Kosmos und der Götter, zweitens ,γένος αίέν έόντων', also das Geschlecht der immerseienden Götter - durch den Relativsatz aufgespalten in verschiedene Unterarten von Göttern - , und drittens ,οι έκ τών έγένοντο θεοί' und ,ώς αφενός δάσσαντο', also die Geburt der olympischen Götter und ihre Taten. Bei Hesiod haben wir also eine Themenaufzählung, das heißt eine additive Struktur der Thema-Angabe, etwa so: Musen, erzählet, wie dies entstand und das, und dann das und wieder das, und dann erzählt noch, wie daraus das entstand, und dann, was daraus wiederum entstand, und was mit dem Entstandenen geschah ... usw. Worin besteht der Unterschied zwischen den Thema-Angaben der beiden Strukturtypen? Die Thema-Angaben des ersten Typs kündigen jeweils eine zusammenhängende, erzählbare Geschichte an, eine Geschichte aus dem Leben einer zentralen Heldengestalt: Achill, Odysseus, Argonauten, Aeneas. I 25 Die Thema-Angaben des zweiten Typs dagegen kündigen die Darlegung eines bestimmten Sachzusammenhangs an: Astronomie, Iologie, Kosmologie, Theologie. Die Epen des ersten Typs lassen sich demnach als narrative Heldenepen bezeichnen, die des zweiten Typs als explizierende Sachepen. Die Heldenepen erzählen eine Geschichte, die sich ein Mal ereignet hat, die Sachepen legen systematisch einen Sachzusammenhang dar, der auf Grund seiner so und nicht anders beschaffenen Kausalstruktur im wesentlichen zeitlos gültig ist. Die Heldenepen sind also diachronisch strukturiert, die Sachepen sind, indem sie eine gegebene Sache systematisch nach allen Richtungen hin ausschreiten, synchronisch strukturiert. Vor diesen Hintergrund stellen wir nun das Metamorphosen-Proömium Ovids: Objekt der Thema-Angabe ist hier .formas', also nicht eine Person, son5
Die Versfolge der Überlieferung scheint mir nicht ursprünglich zu sein [siehe jetzt: J. Latacz, Die griechische Literatur in Text und Darstellung, I: Archaische Periode, Stuttgart (Reclam) 1991, 102-105],
Ovids , Metamorphosen ' als Spiel mit der Tradition
585
dem eine Vielheit von .Formen'. Bei Hesiod steht an der strukturell entsprechenden Stelle γένος, bei Arat αστέρας, bei Nikander μορφάς τε σίνη τε bzw. άλέξια, d. h. entweder ein Kollektivum (γένος) oder ein Plural eines Sachbegriffs. Auch bei Ovid erscheint mit,formas' der Plural eines Sachbegriffs: Ovids Thema-Angabe stimmt also mit den Thema-Angaben der Sachepen zusammen: Mit .formas' kündigen die Metamorphosen als ihr Thema keine einheitliche Heldengeschichte an, sondern eine Vielheit von Einzelphänomenen. Danach können wir unsere erste Folgerung ziehen: Ovids Metamorphosen stehen in der Tradition des Sachepos. Was für eine Sache Ovid explizieren will, ergibt sich aus den Ergänzungen zum Objekt .formas': Verwandlungen, - und zwar, wie die folgende Inspirationsbitte mit ihrer Hinwendung an die ursprünglichen Urheber dieser Verwandlungen - die Götter - zeigt: mythologische Verwandlungen. Die Sache, die Ovid behandeln will, ist also im weiteren Sinne die Mythologie. Danach sieht es so aus, als wolle Ovid sein Werk als mythologisches Sachepos definieren: so wie andere die Kosmologie, die Astronomie oder die Giftkunde systematisch dargestellt haben, so würde er nun einen Teilbereich der Mythologie systematisch darstellen wollen. I Verhielte es sich so, dann allerdings wäre die vorausgeschickte Rede vom 26 schöpferisch spielenden Ovid nur eine leere Spekulation. Ovid wäre dann in der Tat der einfallslose Imitator, als der er in der ersten Phase der Forschung erschien. Es ist natürlich nicht so. Ovid führt nämlich die Thema-Angabe weiter. Bereits die Art, wie er das tut, ist kombinierendes Spiel. Er schiebt nämlich die Fortführung seiner Thema-Angabe in das Strukturelement ,Inspirationsbitte' ein: er sagt - und bei dieser Formulierung spielt er nebenbei noch mit einer von Vergil im Georgica-Proömium (I 40) benutzten Seefahrtsmetapher - , er sagt: , Götter, blast meinem Unternehmen günstigen Fahrtwind zu und führt mein Gedicht vom Urbeginn der Welt kontinuierlich vom hohen Meer hinunter in den Hafen meiner eigenen Zeit'. Er bittet also für die Entfaltung seines Themas um die lenkende Hilfe der Götter. Das ist schon formal eine neuartige Kombination zweier Traditionsmodelle, nämlich der frühepischen Verschmelzung von Thema-Angabe und Inspirationsbitte, wie sie in Ilias und Odyssee vorliegt dort soll die Gottheit die Thema-Explikation vollziehen: ,Μήνιν αειδε, θεά' / ,"Ανδρα μοι εννεπε, Μου σα' - , und der nachhomerischen Trennung von Thema-Angabe und Unterstützungsbitte: hier will der Dichter die Thema-Expli-
586
Ovids ,Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
kation selbst vollziehen, - die Gottheit, die erst anschließend angerufen wird, soll lediglich beistehen6, also graphisch: Modell I Inspirationsbitte [Thema-Angabe]
Modell II (1) Thema-Angabe" (2) Unterstützungsbitte I
ÍMl· Unterstützungsbitte [Thema-Angabe] I 27 Dieses formale Kombinationsspiel ist jedoch nur sprachlicher Ausdruck einer inhaltlichen Kombination. Die in die Unterstützungsbitte eingeschobene Ergänzung der Thema-Angabe lautet nämlich: ,prima ab origine mundi ad mea tempora (deducite carmen', und zwar) ,perpetuum'. Damit ist angekündigt, daß Ovid sein Thema diachronisch entfalten will, und zwar nicht selektiv, nur über eine kurze Zeitstrecke hinweg, sondern universell, über die gesamte Zeitstrecke vom Anbeginn der Welt an hinweg. - Was bedeutet das? Wir hatten gesehen, daß Ovid zunächst, in V. 1, ein Sachepos ankündigt. Die Struktur von Sachepen wird notwendig bestimmt von der Struktur der Sache, die in ihnen dargestellt ist. Die Struktur der Sache wiederum wird bestimmt durch sachimmanente Kausalzusammenhänge. Solche Kausalzusammenhänge sind zeitlos gültig. Die sachimmanenten Kausalzusammenhänge des Ackerbaus etwa sind prinzipiell dieselben im 7. Jahrhundert vor Chr. wie im 1. Jahrhundert vor Chr. oder im 20. Jahrhundert nach Chr. Es sind die wesensmäßig unveränderlichen kausalen Beziehungen zwischen Klima, Wetter, Bodenbeschaffenheit, Ertrag usw. Es gibt natürlich empirische Erkenntnisgewinne, aber worauf diese sich beziehen, das sind eben die unveränderlichen sachimmanenten Kausalzusammenhänge. Aus dieser Eigenart der Sachstruktur, zeitlos gültig zu sein, erklärt sich die Eigenart der vorovidischen Sachepen, grundsätzlich zeitlose Epen zu sein, also die Sache als eigengesetzlichen Kausalkomplex außerhalb der objektiven historischen Zeit darzustellen. Dagegen halten wir nun Ovid. Auch er will, wie wir gesehen haben, eine Sache darstellen, die Mythologie, genauer: ein Teilgebiet der Mythologie, nämlich 6
Näheres zur Struktur der Epenproömien: J. Latacz, Zum Musen-Fragment des Naevius, WüJbb N. F. 2,1976, 131-133 [in diesem Band S. 501-521].
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
587
den Komplex .mythologische Verwandlungssagen'. Was sich für die Darstellung dieser Sache von der literarischen Tradition her anbot, war also die zeitlose Systematisierung; und so waren Ovids Vorgänger - die prosaischen, also die Verfasser mythologischer Handbücher, ebenso wie die poetischen, also etwa Kallimachos in den Aitia und wahrscheinlich Nikander in den Heteroiumena unseres Wissens auch in der Tat verfahren: sie hatten die überlieferten Verwandlungssagen nach sachlichen Gesichtspunkten wie etwa geographischen, aitiolo- 28 gischen oder genealogischen systematisiert. Ovid aber will es, wie wir jetzt sehen, nicht bei der Darstellungsweise seiner Vorgänger belassen, lediglich die Struktur der Sache im Epos widerzuspiegeln, - er will mehr: primaque ab origine mundi / ad mea perpetuimi deducite tempora carmen.
Er will also die an sich historisch zeitlose oder doch nur partiell zeitgebundene Sache .Mythologie' in den Strom der objektiv fließenden historischen Zeit hineinstellen, sie mit der historischen Zeit verschmelzen, und zwar über die gesamte Strecke dieses Zeitstromes hin. Damit bringt Ovid ein neues Element in das Sachepos hinein. Und weil dieses neue Element dem Sachepos von seiner natürlichen Struktur her wesensfremd ist, wird Ovid hier zum Schöpfer eines ganz neuen Strukturtyps des Epos. Es ist ein Kreuzungstyp: das Sachepos, das des Faktors ,Zeit' nicht bedarf, wird gekreuzt mit dem Heldenepos, bei dem der Faktor .Zeit' konstitutiv ist. Die vorhin aufgewiesene Kombination der 77îema-Angaben des homerischen Heldenepos auf der einen und des nachhomerischen Sachepos auf der anderen Seite bildet also tatsächlich nur die strukturelle Kombination der beiden Epentypen sprachlich ab. Dies ist nun schon an sich eine schöpferische Neuerung, die Ovid einen Ehrenplatz unter den Hesseschen lusores sichern würde. Ovid tut aber noch mehr, und hier zeigt sich die Spielhaltung, aus der heraus all dieses Kombinieren von Traditionselementen erfolgt, noch klarer. Ovid weist nämlich nun auch noch ausdrücklich selbst auf seine Neuerung hin, dies aber nicht etwa mit unverhüllten klaren Worten, sozusagen auf der Kommunikationsebene der gebildeten Alltagsrede, sondern durch eine unerhört feine und hintergründige literarische Anspielung. Ich meine das in der Forschung hundertfach hin und hergewendete ,perpetuum'. Daß dieses .perpetuum' ein Kallimachoszitat aus dem Aitien-Prolog ist und daß damit des Kallimachos Absage an ein άεισμα διηνεκές, eine Absage also an ein kontinuierliches carmen, dem Leser in Erinnerung gerufen werden soll, - das ist längst gesehen. I
588 29
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Allerdings hat man das Zitat, soweit ich sehe, regelmäßig als Ausdruck programmatischer Gegnerschaft gegen Kallimachos verstanden: Kallimachos wollte kein kontinuierliches Langepos, Ovid will eines. Ovid also der römische Antikallimachos. So lesen wir es etwa bei Herter7 und bei v. Albrecht8. Kann aber Ovid das wirklich meinen? Kann er wirklich in prinzipieller Gegnerschaft zu Kallimachos ankündigen wollen, daß er, wie Herter es deutet, wieder „die Bahn Homers beschreiten" werde? Man braucht nur zu fragen, welchen Grundtyp des Epos die Metamorphosen dann repräsentieren, um zu erkennen, daß Ovid das nicht meinen kann. Die Metamorphosen sind ja gerade nicht eines von den Epen, die Kallimachos ablehnt, ein Epos auf Vorzeit-Heroen oder auf königliche Majestäten. Sie sind genauso auf eine Vielheit von Einzelphänomenen konzentriert wie Kallimachos' Aitia. Insoweit ist also Ovid durchaus nicht Homeriker und Antikallimacheer, sondern Kallimacheer.
Das Zitat muß also einen anderen Sinn haben. Welchen, - das geht aus der Position des Zitats innerhalb des Metamorphosen-Proömiums hervor: das Zitat ist nicht irgendwo im Ovidischen Metamorphosenproömium untergebracht, sondern es ist genau in den Satz eingeschoben, der das Neue der Ovidischen Konzeption ausdrückt: die Verschmelzung, die Amalgamierung der dargestellten Sache mit der historischen Zeit. Wenn das Kallimachoszitat gerade hier eingefügt wird, dann kann das nur bedeuten, daß Ovid das, was Kallimachos für unmöglich gehalten hatte, für dennoch möglich erklären will, wenn es im Rahmen der von Ovid erfundenen Neuerung geschieht. Konkret gesprochen: Ovid will sagen: das perpetuum carmen ist im Rahmen der Kallimacheischen Sachgedichtkonzeption in der Tat nicht möglich, - aber im Rahmen meiner Sachge30 dichtlkonzeption ist es möglich. Das Zitat polemisiert also gegen Kallimachos nicht mit dem Ziel der Falsifizierung des Kallimacheischen Weges als solchen, sondern mit dem Ziel der Übertrumpfung des Kallimachos. Ovid will nicht der römische Antikallimachos sein, sondern der römische Überkallimachos. Und er glaubte das dadurch sein zu können, daß er der Sachgedichtkonzeption des Kallimachos und aller seiner Nachfolger das neue Element des Historischen hinzufügte. In dem Moment nämlich, in dem eine Sache mit dem Strom der historischen Zeit verbunden wird - also nicht als eigengesetzlicher, geschichtsunabhängiger Sachzusammenhang abgehandelt wird - , in diesem Moment kann die 7
H. Herter, Ovids Kunstprinzip in den Metamorphosen, in: (AJPh 69, 1948 =) WdF ,Ovid' 340-361 (hier 357 f.). 8 Μ. v. Albrecht, Zum Metamorphosenprooem Ovids, RhM 104, 1961, 278, sowie in seiner ergänzten Neuauflage des Metamorphosenkommentars von Haupt-Ehwald, Zürich - Dublin 10 1966, zur Stelle.
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
589
Darstellung dieser Sache in der Tat die Eigenschaft des Fließenden, Ununterbrochenen, Kontinuierlichen bekommen, - die Sache steht ja nun nicht mehr neben der Historie, sondern in der Historie, sie steht nicht mehr an irgendeinem beliebigen Ort des Flußufers, sondern sie ist Teil des Flusses, sie fließt mit dem Fluß dahin. Und da der Fluß kontinuierlich ist, ist auch die Sache und damit die Darstellung der Sache kontinuierlich: das .carmen' wird ein ,perpetuum carmen'. Hesse definierte das Spielen als „Freude am Erfinden, Konstruieren und Kombinieren". Eben diese Kombinationsfreude sehen wir im Proömium der Metamorphosen am Werke. Traditionselemente der verschiedensten Ebenen werden mit souveräner Kennerschaft zu einem literarischen Programm kombiniert, das neu klingt und Neues ankündigt. Und diese Ankündigung macht nun Ovid im Werk selbst wahr. Eine detaillierte Strukturanalyse würde zeigen, wie phantasievoll die neuartige Werkqualität, die Ovid im Proömium als das Charakteristische seines Gedichts deklariert, nämlich die zeitliche Kontinuität, in den Metamorphosen verwirklicht ist. Es würde sich herausstellen, daß die Aufeinanderfolge der Einzelgeschichten nicht Beliebigkeitscharakter hat, sondern daß sie gesteuert wird von zwei Prinzipien, einem kompositionellen und einem chronologischen, und daß Ovid aus der Fülle der tradierten Verwandlungssagen stets solche aussucht, die im Schnittpunkt dieser beiden Prinzipien stehen - oder doch ganz nahe daran. Es würde deutlich werden, daß die Einzelgeschichten I auf diese Weise gewissermaßen zu einzel- 31 nen Häusern zusammengefügt werden - jedes in sich planvoll gebaut, nicht irgendwie zusammengestückt mit spontanen Anbauten und Erweiterungen - und wie dann diese einzelnen Häuser ihrerseits wieder durch vielfaltige thematische und chronologische Verklammerungen zu einem gewaltigen Gebäudekomplex konstruiert werden, zu einer architektonischen Einheit, die nicht etwa als statische Einheit vorgeführt wird, wie sie immer schon bestand und nun etwa von Ovid nur abgebildet würde, sondern die vor unseren Augen, als Neubau sozusagen, dynamisch errichtet wird, in einem fortlaufenden, kontinuierlichen Bauprozeß, so daß der Zeitfluß, der ja das Neue der ovidischen Konzeption bildet, stets spürbar bleibt. Als Ergebnis der Analyse würde klar werden, daß Ovid in der Tat, wie er ankündigt, nicht eine Kollektion von Einzelgeschichten geschaffen hat, kein Kollektionsgedicht also, sondern daß er unter frei kombinierender und z. T. auch frei erfindender Verwendung des tradierten mythologischen Baumaterials und unter Anlegung der perpetuum-Idee als architektonischen Leitgedankens eine Art ,aedificium perpetuum' geschaffen hat - eine gewaltige Palastanlage, die auf den Beschauer schon von außen imponierend wirkt, aber nicht sofort faßbar. Ist der Beschauer dann erst einmal durch den Vorhof eingetreten, so
590
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
wird er von Halle zu Halle geleitet, von Saal zu Saal, von Zimmer zu Zimmer, über viele verwinkelte Gänge und durch viele kleine Kämmerlein, über Treppen und Söller und Erker, bis er nicht mehr recht weiß, wo er sich befindet, zumal an den Wänden überall auch noch Gemälde und Gobelins aufgehängt sind, die betrachtet werden wollen, und schließlich noch zahlreiche Fenster und Veranden zum Ausblick nach außen in den kunstvoll angelegten Park verlocken. Das große Spiel nachzuspielen, in dem Ovid dieses architektonische Gebilde schuf, das er im Epilog mit Recht als ganz neuartige und darum unvergängliche Schöpfung empfunden hat, - dieses große Bauspiel hier im einzelnen nachzuspielen bleibt leider keine Zeit. Keine Zeit bleibt leider auch dafür, Ovids Spiel mit dem Stoff zu zeigen, also nicht - wie bisher geschehen - die Art, wie die überlieferten Form-Elemente neu 32 komponiert, und das heißt: wie die Bausteine zusammengebaut werden, sondern wie die überlieferten Stoff-Elemente, also die Sagen, in sich selbst verändert werden - gedehnt, gekürzt, neu motiviert, neu getönt und moduliert, - mit den Grundtönen des Humors, des Spottes, der Ironie in allen ihren Nuancen - von der mildesten bis zur bittersten - , wie sich also Ovid auch die Bausteine selbst schon, die der Baukasten der mythologischen Tradition für ihn bereithielt, nach seinem eigenen Geschmack zurechtschneidet und zurechtfärbt, um sie seinem Bauplan anzupassen. IV Eine Frage aber müssen wir uns noch stellen und sie - wenn auch nur andeutungsweise - zu beantworten suchen: die Frage nach dem Sinn dieses Spiels. Bisher haben wir ja mit unserer vorwiegend strukturellen Betrachtung nur die Architektur des Gebäudes in den Blick genommen, also die Form. Was fehlt, ist eine Würdigung des Gehalts, also der Zweckbestimmung des Gebäudes, der Bau-Idee. Sollte der Sinn des Bauens wirklich nur in der Schaffung eines bizarren, zauberhaften Phantasiegebäudes liegen? Sicherlich, auch das wäre durchaus schon ein hinreichender Sinn, und ich würde mich weigern, wenn es so wäre, rasch mit Urteilen wie .leeres Virtuosentum' bei der Hand zu sein. Aber es scheint, Ovid wollte noch mehr mit diesem Phantasiegebäude. Das Gebäude soll etwas sagen, es soll etwas mitteilen. Man spricht in der Literatur in diesem Zusammenhang zuweilen von einer .Botschaft Ovids'. Dieses Wort möchte ich nicht aufnehmen. Ich glaube, nichts ist dem Geist Ovids so fremd wie das Verkünden von Botschaften. Wenn Ovid etwas sagen will, dann wird es wohl eher etwas Unpathetisches sein. Sehr häufig stellt sich, wenn diese Frage zur Debatte
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
591
steht, in Büchern und Aufsätzen der Begriff ,humanitas' ein. In der Regel bleibt es dann dem Leser überlassen, sich unter diesem wabernden Tabu-Begriff unserer Wissenschaft etwas Konkretes vorzustellen. ,Die Menschlichkeit Ovids' - , ja, wen da nicht das selige Lächeln des humanistisch gebildeten Weltverstehens überkommt... ! Das muß nicht so sein. Es läßt sich durchaus näher I herankommen an dieses 33 unleugbar vorhandene Ovidische Charakteristikum, das mit ,humanitas' bezeichnet wird, und selbstverständlich sind auch schon zahlreiche Wege geöffnet worden. Einen weiteren solchen Weg möchte ich mit der folgenden Deutung einer Metamorphosenstelle weisen, die mir noch nicht recht verstanden zu sein scheint. Ich meine die Geschichte vom Kentauren- und Lapithenkampf im 12. Buch.9 I Zunächst rasch die Einordnung dieser Geschichte in den Zusammenhang. 34 Von der Urzeit in Buch I an ist Ovid mit ständig wachsender chronologischer und geographischer Konkretisation über die vortrojanische mythologische Zeit in den Büchern II-XI bis zu Troja gelangt. Am Ende des 11. Buches geht er zum Trojanischen Krieg über. Damit steht er vor dem Problem der Homer-Rezeption. Der Trojanische Krieg war in der homerischen Ilias ein für alle Mal fixiert worden. Ein Concours mit Homer - ebenso wie später mit Vergil - war von vornherein aussichtslos und außerdem ganz unnötig. Denn Ovid hatte ein ganz anderes Thema als Homer und Vergil. Er hätte also durchaus geradewegs an Ho9
Vgl. v. Albrecht, Einführung zur Neuauflage des Buches von Lafaye, ΧΠ*: „Bis heute gibt es ... keine umfassende Arbeit über Ovid und Homer" (vgl. Forschungsbericht ,Ovid\ AnzAW 25, 1972, 272: „Ovids Homernachfolge sollte neu untersucht werden"). - Die gleiche Grundauffassung wie hinter der folgenden Gesamtinterpretation (die erstmals 1975 im Rahmen einer Ovid-Vorlesung entwickelt wurde) steht - wie ich jetzt nachträglich sehe - hinter den andeutenden Bemerkungen von R. Coleman, Structure and Intention in the Metamorphoses, CQ 21, 1971, 474. - Β. Otis' Beurteilung des Stückes ist - entsprechend dem Wandel seiner Ovidauffassung im ganzen (vgl. dazu v. Albrecht, AnzAW 25, 1972, 281) - uneinheitlich und offensichtlich mangels genauer Einzelinterpretation noch nicht abgeschlossen: im Vorwort und im Schlußkapitel der 2. Auflage seines Ovidbuches (1970) widerruft er seine ursprüngliche .pathetische' Auffassung („Where I once saw .pathos', I now see rather delightful or at any rate intentional parody or comedy": VIH; „mock-epic": 350; vgl. seine Rezension von Bernbeck im Gnomon 42, 1970, 142: „The burlesque of epic in the Perseus, Meleager and Centaurs-Lapiths narratives seems to me clear"), im Inneren des Buches jedoch heißt es weit weniger sicher: „there is no consistent parody" (283), und das Gesamturteil schwankt und klingt eher abfällig. Ich hoffe zeigen zu können, daß hinter der Schilderung eine Aussageabsicht steht, die Otis' zuletzt erreichte Gesamtauffassung der Metamorphosen (anti-augusteisch im tiefsten Wortsinn; ich würde hinzufügen: weil zutiefst zivil und pazifistisch) voll bestätigt und damit die Konsequenzen, die dieses Buch für Ovids persönliches Lebensschicksal haben mußte, über Vordergründiges hinausgehend verständlich macht.
592
Ovids ,Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
mer und Vergil vorbeigehen können, und das mit weit größerem Recht als etwa Ennius an Naevius vorbeigegangen war. Aber er übergeht Homer und Vergil nicht. Er entscheidet sich dafür, sie in sein Werk einzubeziehen. Wenn er das tut, verfolgt er damit sicher eine Absicht. Welche das ist, wird bereits bei der Einbindung der Ilias in die Metamorphosen klar. Die geschieht nämlich so: Am Ende des 11. Buches wird die Geschichte von der treuen Gattenliebe des Ceyx und der Alcyone erzählt, an deren Ende die Verwandlung beider Gatten in das unzertrennliche Paar der Eisvögel steht. Dann heißt es: Diese Eisvögel sah einstmals ein alter Mann übers Meer streichen, und er lobte ,ad finem servatos amores'. Da sagte sein Nachbar - vielleicht war's auch er selbst, der das sagte (aut idem, si fors tulit 751) - : .Schau mal, der Taucher dort, das war auch mal ein Königssohn. Der hieß nämlich Aisakos und war ein Sohn des Priamos, also ein Bruder Hektors, und wurde aus unerfüllter Liebe und Todessehnsucht zum TauchervogeP. Damit sind wir bei Priamos, - das 12. Buch beginnt: Priamos weiß immer noch nicht, daß sein Sohn Aisakos lebt, und betrauert ihn mit seinen Söhnen; die sind alle anwesend, auch Hektor, nur Paris fehlt, denn der ist gerade dabei, Helena zu entführen, und eintausend Schiffe sind ihm schon auf den Fersen. 35 Diese Überleitung ist oft behandelt worden. Lange I Zeit geschah das ausschließlich unter technischem Aspekt, also im Rahmen von Studien über die Übergangstechnik Ovids. Da erschien dann unsere Stelle als schlagendes Beispiel für Gezwungenheit; an solchen Stellen zeigt sich eben - so meinte man - , zu welchen verzweifelten Mitteln Ovid greifen mußte, nur um ein wenig Abwechslung in seine Übergänge zu bringen10. Diese Ansicht ist noch lange nicht ausgestorben: auch Galinsky (1975) vertritt sie wieder und nennt das Ganze eine „schwache Erfindung" (100 f.). Zwischendurch hatte immerhin Frécaut, also ein für Ovidischen Humor sonst sehr empfänglicher Gelehrter, eine neue Erklärung gefunden: der Übergang sollte durch seine Leichtigkeit die dramatische Spannung und tragische Stimmung der gerade beendeten Ceyx-Alcyone-Geschichte wegwischen 11 . Da wird also dem Übergang wenigstens Funktion zugestanden, allerdings - wie mir scheint - die falsche. In die richtige Richtung weist erstmalig die Deutung von O. Steen Due 1974 (147 mit Anm. 55). Due erkennt näm10 So sinngemäß z. B. R. Schmidt, Die Übergangstechnik in den Metamorphosen des Ovid, Diss. Breslau 1938, 52 f.; Quintilians Rüge der affektierten rhetorischen Übergangstechnik (IV 1, 77: illa vero frìgida et puerilis est in scholis adfectatio, ut ipse transitus efficiat aliquam inique sententiam) hat lange nachgewirkt. 11 J.-M. Frécaut, Les transitions dans les „Métamorphoses" d'Ovide, REL 46,1968, 251 f. (in Frécauts Ovid-Buch von 1972 ist die Stelle nicht behandelt).
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
593
lieh die strukturelle Relevanz dieses Übergangs. Vor ihm hatte man den Übergang allenfalls als Scharnier zwischen der Ceyx-Alcyone-Geschichte und der Aesacus-Geschichte gesehen12. Due sieht, daß der Übergang eine viel größere Bedeutung hat: er verbindet nicht zwei Verwandlungssagen, sondern er verbindet - wie Due formuliert - zwei Welten, nämlich Mythos und Geschichte, und stellt auf diese Weise einen „decisive point" dar. Das ist richtig gesehen. Aber die eigentliche Funktion des Übergangs hat, wie ich meine, auch Due noch nicht erkannt. Seine strukturelle Sichtweise führt ihn auf die Erklärung, die Künst- 36 lichkeit und äußerliche Kapriziosität der Überleitung habe ihren Grund in Ovids Absicht, den Leser über diesen „decisive point", über diese Nahtstelle im Gesamtwerk, mit leichter Hand hinwegzuführen. Diese Auffassung geht, wie mir scheint, immer noch am Wesentlichen vorbei. Zunächst kann ja wohl kaum ein Zweifel daran sein, daß die ganze Formulierung eminent komisch ist: Da fliegen zwei Eisvögel übers Meer, am Ufer steht zufällig irgendein alter Mann und preist ihre unendliche Liebe. Da sagt der Nachbar des alten Mannes (der plötzlich irgendwie da ist) - oder auch der alte Mann selbst, wenn's der Zufall so fügte ... - Das ist komisch. Komisch ist es erstens, weil es sich als biedere gewissenhafte Wahrheitsverbürgung gibt, wie sie bei den Historikern geläufig war (etwa nach dem Livianischen Schema: ,die Quellenlage ist in diesem Punkte unklar'), komisch ist es zweitens, weil es selbstironisch ist; denn Ovid hatte vor dieser Stelle schon mehrmals einen Übergang durch plötzliche Einführung irgendeiner Zuschauerfigur geschaffen, dabei aber immer nur mit einer Person gearbeitet (e quibus unus; nescio quis; alter)13; hier erinnert er nun an diese Stellen; indem er sie aber durch den skrupulösen Zweifel an der Identität dieser an sich doch völlig gleichgültigen Zuschauerfigur noch weit überbietet, ironisiert er seine eigene Übergangstechnik14. Aber das ist nur die erste Ebene. Auf ihr versetzt Ovid den Leser in die gewünschte Stimmung. Die Frage I ist nun aber: Wozu? Ist das Ganze nur ein 37 Witz? Wenn wir uns daran erinnern, welche strukturelle Bedeutung der Übergang hat, - daß durch ihn der ganze dritte Werkteil angebunden wird, und daß dieser dritte Werkteil nun eben mit der Ilias beginnen wird, - dann scheint die 12
Siebe ζ. B. Ludwig, Struktur und Einheit 61. Etwa VI 317. 382. 383 - nach Frécaut (oben Anm. 11) 252. 14 Dieses Phänomen als solches („poetische Selbstironie", „Selbstdistanzierung des Autors von seinem Stoff") hat Doblhofer reich belegt und einfühlsam gedeutet (223-227); darüber hinaus hat er auch bereits gegen Quintilian (oben Anm. 10) hervorgehoben, „daß es gerade auch die Nahtstellen zwischen Haupterzählungen sind, an denen Ovid die vox urbana mit Vorliebe durchklingen läßt (78 mit Anm. 4). Unsere Stelle gehört, denke ich, hierher. 13
594
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
Deutung als flüchtiger Witz ausgeschlossen. Wenn Ovid die Ilias - die er ja, wie wir gesehen hatten, auch ganz hätte weglassen können - , wenn er die Ilias so einführt, dann muß ja doch wohl schon die Art dieser Anbindung ein Signal für den Leser sein dafür, was der Dichter mit Homer vorhat. Diese Überleitung ist ja so grotesk beiläufig und zufällig - über eine Vogelmetamorphose gelangen wir zum König von Troja! - daß ihr Sinn nur sein kann, die ganze Trojasage und speziell ihre epische Darstellung durch Homer in dasselbe Reich mythologischer Phantasie einzureihen wie alles zuvor Erzählte. Damit wird schon von allem Anfang an die Ilias vom Kothurn herabgeholt. Das Heroisch-Ernste und Schwere, das tragisch Konflikthafte der Ilias wird von vornherein ausgeblendet. Dieser Eindruck bestätigt sich beim Weiterlesen Schritt für Schritt: Ovids erster Streich besteht darin, dem Leser, der nun auf die eigentliche Ilias wartet, die eigentliche Ilias vor der Nase wegzuziehen. Als erstes großes Ereignis der Kämpfe um Troja erzählt er nämlich den Zweikampf zwischen Achill und Cygnus - eine Geschichte, die gar nicht bei Homer, sondern in den Kyprien, also in den Antehomerica, stand. Diese Geschichte beginnt nun bei Ovid so (12,71 ff.): und schon wurde rot vom Blute Sigeums Küste, schon hatte in den Tod geschickt Neptuns Sohn Cygnus tausend Männer, schon stand auf dem Wagen Achilleus und streckte mit dem Stoß seiner pelischen Lanze ganze Reihen nieder, und wie er in den Schlachtreihen entweder den Cygnus oder den Hektor sucht, da trifft er den Cygnus (aufs zehnte Jahr ward so verschoben Hektor!)...
Daß Hektor erst im 10. Jahr mit Achill zusammenstieß, ist also ein Zufall. Daß 38 Homers Ilias entstand - so I entstand, wie sie da ist - , demnach auch. Hätte Achill damals den Hektor getroffen, wäre die ganze hochberühmte Ilias - man möchte sagen: die ,Ilias cothurnata' - anders verlaufen. Da sieht man einmal, sagt Ovid, wie so der Zufall sein Spiel treibt. Nach der grotesken Überleitung nun dieses Präludium! Die ganze Trojasage und die ganze klassische Ilias ist damit bereits vom Podest herabgeholt und relativiert. Das ist Ovids erster Streich. Aber man soll nicht denken, er sei ein obtrectator Homeri! Es geht ihm um etwas ganz anderes. Das eben zeigt der nächste große Erzählblock, der Kampf zwischen den Kentauren und Lapithen. Erzählt wird der Kampf von Nestor, am Abend nach dem Cygnuskampf, nachdem die Helden sich den Leib mit Braten vollgeschlagen haben (corpora tosta / carne replent 155) und nun behaglich auf weichen Kissen beim Wein am Lagerfeuer liegen (wir merken schon, wie die heldenhafte Ilias-Szenerie verbürgerlicht wird). Eine
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
595
Frage bewegt alle: warum war Cygnus unverwundbar? Da hebt der alte Nestor an: „Als ich noch jung war, hab' ich einmal einen ähnlichen Fall erlebt. Der Mann damals hieß Caeneus". Das Interesse des Publikums ist geweckt. Achill drängt den Alten schmeichelnd, zu erzählen, - und der beginnt. Allerdings nicht mit Caeneus, sondern mit einer gewissen Jungfrau Caenis, die von Neptun nach einem erzwungenen Schäferstündchen ihren danach sehnlichsten Wunsch erfüllt bekam: ein Mann zu werden, und zwar ein unverwundbarer. Die Spannung des Publikums wächst. Jetzt muß ja gleich die Parallele zu Cygnus kommen. Was aber geschieht? Nestor läßt in V. 209 mit ,Peneia arva pererrat' den frischgebackenen Caeneus fürbaß durchs Tempe-Tal wandern - und beginnt in V. 210 mit,.Duxerat Hippodamen audaci Ixione natus" eine scheinbar ganz andere Geschichte, die Geschichte nämlich von der Lapithenhochzeit. Nicht weniger als 248 Verse wird es nun dauern, bis das Publikum den inzwischen längst verlorengegebenen Caeneus plötzlich wieder auftauchen sieht. Dieser Überraschungseffekt gehört in Ovids Spielanlage. Der Kentauren- und Lapithenkampf wird nämlich auf diese Weise nicht um seiner selbst willen erzählt, sondern als umständliche Vorbereitung einer ganz anderen Geschichte, so daß die Kampfschilderung als solche als eher zufälliges I Beiprodukt der etwas vergeßlichen Redse- 39 ligkeit des en passant kräftig persiflierten homerischen Nestor erscheint. Damit scheint Ovid die Funktion der Kampfschilderung selbst abwerten zu wollen. Ihre Länge - insgesamt 325 Verse, das ist mehr als die Hälfte des ganzen 12. Buches - scheint der Ethopoiie zu dienen, nämlich Nestors Redefluß sich ausreichend verbalisieren zu lassen, um ihn - und damit ein iliadisches Stilelement - implizit persiflieren zu können. Nebenbei - so haben es fast alle Interpreten bisher gesehen - schafft Ovid sich mit dieser Kampfschilderung dann noch die Möglichkeit, sein - mit Frankel (110) - „ehrgeiziges Streben nach Großartigkeit" zu realisieren; er fügt nämlich ab Buch 12 „wuchtige Stücke" ein und „verwendet, sich im wahrhaft heroischen Stil des Epos versuchend, dreihundert Hexameter auf eine Schilderung des blutigen Kampfes zwischen den Lapithen und den Kentauren". Das hätte er - meint Fränkel - besser bleiben lassen sollen; denn mit dem 11. Buch war seine Schöpferkraft verbraucht. Was in den letzten 4 Büchern folgt, macht dem Dichter nur noch Schande. Besonders die makabre Schilderung des Kentauren- und Lapithenkampfes ist - so meint Fränkel - im Grunde unverzeihlich; wie konnte er, der doch nach eigener Aussage den .düsteren Sand' des Gladiatorenkampfplatzes verabscheute (A.a. I 164) sich so weit vergessen, solch gräßliches Morden und Schlachten offenbar genüßlich auszumalen? Das „läßt sich nur erklären" - schreibt Fränkel - „wenn wir annehmen,
596
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
daß er im Augenblick bereit war, Abwechslung des Stils und heroische Härte des Inhalts um jeden Preis zu erkaufen"15.1 40 Kann das - nach allem, was wir bisher schon an Ovidischer Hintergründigkeit beobachtet haben - wirklich die richtige Deutung dieser Stelle sein? Ist der Lapithen- und Kentaurenkampf wirklich nichts anderes als ein ehrgeiziger, aber total mißlungener Imitationsversuch? Schon eine - seit längerem bekannte16 - strukturelle Beobachtung macht stutzig: die Ilias - so hatten wir gesehen - war dem Leser innerhalb der Schilderung des antehomerischen Cygnuskampfes durch einen eleganten Kunstgriff vor den Augen weggezogen worden. Unmittelbar nach dem Cygnuskampf folgt die Nestorerzählung vom Lapithen- und Kentaurenkampf. Und danach? Kommt nun endlich die Ilias? Weit gefehlt - nach der Nestorerzählung geht in V. 579 alles schlafen. Und im Anschluß daran versetzt uns Ovid in V. 584 unmittelbar an das Ende des 10. Kriegsjahrs und läßt Neptun durch Paris Achills Tod einleiten, der in der Ilias gar nicht mehr geschildert war. - Wo ist die Ilias Homers geblieben? Wodurch ist die ganze Iliashandlung ersetzt? Durch den Kentauren- und Lapithenkampf. Dann aber kann die Schilderung dieses Kampfes doch nicht so nebensächlich, so funktionslos sein, wie es zunächst den Anschein hatte. Was also ist ihre wahre Funktion? Wir müssen diese Schilderung wohl oder übel etwas genauer betrachten. Sie ganz vorzuführen fehlt die Zeit. Aber einige Ausschnitte werden hoffentlich schon deutlich machen, was Ovid damit im Sinne hat. Ich beginne mit einer Paraphrase (ab 12,210): „Pirithoos feierte Hochzeit mit Hippodame", erzählt Nestor, „und ich selbst war dabei. Lapithen und Kentauren waren beim Hochzeitsgelage versammelt. Da packte den Kentauren Eurytus die Begierde nach der Braut. Er raubt sie, Theseus stellt sich ihm entgegen und versucht ihn zur Raison zu bringen, aber Eurytus versetzt ihm einen Backenstreich und (234) generosaque pectora pulsat,
und hämmert auf die hehre Brust ein." I
15 Vgl. auch etwa v. Albrecht, Ovids Humor 70 („heroischer Tenor des XII. Buches"; ähnlich S. 51. 68). Lafaye 118 hatte zwar bereits ganz richtig aus dem Gesamtwerk Ovids geschlossen, daß dem Dichter auch bei der Schilderung des Kentauren- und Lapithenkampfes die Abneigung gegen das „widerwärtige Geschäft des Soldaten" die Hand geführt habe, erkannte aber nicht, daß Ovid diese Abneigung in eine künstlerisch voll durchdachte Ablehnung umsetzte; statt dessen warf er ihm „falschen Realismus" und Kriegs-Unkenntnis vor. - Vgl. auch Wilkinson, unten Anm. 19. 16 Siehe ζ. B. Ludwig, Struktur und Einheit 62-65.
Ovids ,Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
597
Und nun folgt eine Stelle, die wir einmal im Zusammenhang lesen müssen, in der Übersetzung Thassilo v. Scheffers lautet sie so (235 ff.):
41
Zufällig stand da just mit erhabenen Bildern ein alter Krug; den gewaltigen hebt gewaltiger noch der Aegide Hoch empor und schleudert ihn Eurytus mitten ins Antlitz. Wein und klumpiges Blut und Gehirn entströmen zusammen Wunde und Hals. Da stürzt im feuchten Sande er rücklings Stampfend nieder, und wild entflammen die Doppelgeschöpfe Über des Bruders Tod. Einstimmig brüllen sie alle: .Waffen, Waffen!' vom Wein ermutigt; geschleuderte Becher Fliegen zuerst im Kampf, zerbrechliche Krüge und runde Kessel, zuvor dem Schmaus, nun dienlich dem Kämpfen und Morden. Amycus, Sohn des Ophion, vermaß sich zuerst, aus des Hauses Heiligtum geweihtes Gerät zu rauben; von oben Riß er die Ampel zuerst, umleuchtet von schimmernden Kerzen, Hob sie dann hoch empor, wie einer den schneeigen Nacken Eines Stieres sich müht zu durchhaun mit dem Beile beim Opfer, Warf sie gegen die Stirn des Celadon, und den Lapithen Ließ mit zermalmtem Gesicht entstellt er hegen am Boden. Auswärts quollen die Augen, und durch die zersplitterten Knochen Sank die Nase zurück und haftete mitten im Gaumen. Pelâtes aber aus Pellae entriß dem Tische aus Ahorn Rasch einen Fuß und zerschmettert das Kinn an Amycus Halse, Und wie er Zähne, vermengt mit schwarzem Blute hervorspie, I Schickt er mit noch einem Streich ihn hinab zu des Tartaros Schatten. Gryneus stand ihm zunächst und schaute mit finsteren Blicken Auf den umrauchten Altar und rief: .Warum denn nicht diesen Nutzen?' und hob mit dem Feuer das schwere Gewicht des Altares, Schleuderte mitten ihn in den Schwann der Lapithen und streckte Zwei zu Boden: Orios und Broteas, doch des Orios Mutter war Mycale, die, wie man wußte, durch Zaubergesänge Oft die sich sträubenden Hörner des Mondes zur Erde gezogen. .Straflos bleibt dir das nicht, wenn ich nur Waffen erlangte! ' Rief Exadius aus, doch an Stelle von Waffen ergriff er Eines Hirsches Geweih, das am Gipfel der Fichte den Göttern Dargebracht; dieses stieß er mit beiden Enden dem Gryneus Tief in die Augen; da hing ein Teil an den Zacken, ein andrer Sickert ihm in den Bart und blieb im Blute da hängen. Siehe, von Pflaumenbaumholz eine lodernde Fackel rafft Rhoetus Mitten vom Opferaltar und schlägt sie an des Charaxus Rechte Schläfe, die rings umwallt von rötlichen Locken. Rasch wie trockene Saat von fressendem Feuer ergriffen Lodert in Flammen sein Haar, und das in der Wunde versengte Blut läßt schrecklich ein Zischen ertönen: so prasselt das Eisen, Wenn es feuerdurchglüht der Schmied mit gebogener Zange Aus der Esse zieht und taucht ins Wasser; da zischt es I
42
598 43
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition Siedend im Trog und läßt die wallende Welle erwärmen. Doch der Verwundete schüttelt die gierige Flamme aus wirrem Haar, entreißt eine Schwelle dem Boden und schultert sie lastend, Wagenschwer, doch hindert gerade die Schwere, den Gegner Richtig zu treffen: dagegen erschlägt die steinerne Masse Seinen Genossen Cometes, weil dieser zu nahe dabei stand. Freudig jubelte Rhoetus ganz unverhohlen: ,Ο möchten', Rief er, .ebenso tapfer sich deine Genossen beweisen!' Abermals traf er die Wunde mit halbverglommenem Holzscheit Dreimal, viermal und sprengte mit wuchtigem Schlage des Schädels Nähte, daß im Gehirn die zerschmetterten Knochen versinken.
Hier ist ja nun die parodische Absicht unverkennbar. Die berühmten Verwundungs- und Todesarten des homerischen Epos werden ins Groteske und Komische übersteigert. Das Ganze wirkt dadurch nicht mehr grauenhaft und erschütternd, sondern geradezu burlesk. Ovid kann sich gar nicht genug tun, epische Elemente aneinanderzureihen und die episch vorgeschriebene Reihenfolge in ihrer normierten Stilisierung zwar streng einzuhalten, diese äußere Form aber mit einem Inhalt zu füllen, der die stilisierte Strenge ad absurdum führt. Wir haben ja hier den homerischen Massenkampfkatalog vor uns, der normalerweise in der Form des sog. Kettenkampfes abläuft, d. h.: A erblickt B, wirft mit der Lanze nach ihm, Β weicht aber aus, die Lanze trifft C, den Tod dieses C will D rächen und wirft nach A, trifft 44 aber E - usw. 17 . Aber das Schema I ist inhaltlich völlig pervertiert. Waffen sind nicht Lanzen und Speere, sondern Krüge, Kessel, Lampen, Tischfiiße, ein Geweih, das sozusagen in der Jägerstube .ganz ungemein putzt', einer reißt sogar eine Steinschwelle aus dem Fußboden. - So weit zu den Waffen. Dann die Kette! Sie wird eine ganze Weile hindurch voll durchgehalten, wobei das homerische .Verfehlen' - also A zielt auf B, trifft aber C - vermieden wird. Man glaubt schon, hier sei Ovid eine Parodiegelegenheit entgangen. Dann aber kommt's faustdick! Charaxus reißt eine Steinschwelle aus dem Boden, um sie auf den Gegner zu schleudern, trifft aber nicht diesen und auch nicht einen anderen Gegner, sondern seinen eigenen Gefährten, - weil dieser zu nahe neben ihm steht! Schließlich die Verwundungen! Schon bei Homer ist da manches wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken erzählt. Das hat aber erst die mo-
17
Analysiert von B. Fenik, Typical Battle Scenes in the Iliad. Studies in the narrative techniques of Homeric battle description, Wiesbaden 1968 (Hermes-Einzelschriften Nr. 21). - Ganz bestimmte Vorbild-Stellen ausfindig machen zu wollen scheint mir unnütz; parodiert wird das .pattern' (so im Prinzip schon Lafaye 115-125, der aber ein bestimmtes Bas-Relief als Modell ansetzen möchte: möglich, aber nicht entscheidend).
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
599
deme Homerforschung herausgebracht18. Daß die Antike es schon so erkannt haben sollte, ist unwahrscheinlich. Ovid parodiert hier geradezu umwerfend. Aber an diesem Punkte merken wir nun auch zugleich, worauf die ganze Parodie eigentlich hinauswill. In dem oben zitierten Stück waren nur einige Verwundungen geschildert. Liest man weiter, so vergeht einem allmählich das Lachen. Zum Beispiel Vers 434 ff.: Der warf einen Klotz, den kaum zwei Stiere bezwängen, Und dem Olenus-Sohne, dem Tectaphos, barst er den Schädel. (Weit war das wirbelnde Haupt gespalten; aus Mund und aus Nase, Aus der Höhlung der Augen und Ohren ergoß sich das weiche I Hirn, wie geronnene Milch vom Geflechte des eichenen Reisigs Abfließt, oder wie Mus aus einem durchlöcherten Durchschlag Quellend, wenn man es preßt, aus der Enge der Öffnungen tröpfelt.)
Ehwald hat diese Stelle in der Teubner-Ausgabe für unecht erklärt. Ich halte das für verfehlt. Ovids Absicht wird damit ganz verkannt. Was Ovid durch solche ekelhaften Abstrusitäten erreichen will, ist doch wohl eine gründliche Verunsicherung des Lesers in seiner gewohnten Haltung gegenüber dem Heldenepos. Ovid zeigt durch übertreibende Verlängerung epischer Modelle, wie inhuman im Grunde die Kampfwelt des Heldenepos ist. Die Parodie wirkt - man soll nicht sagen: entlarvend (das hätte Ovid selbst nicht gewollt, glaube ich), aber: desillusionierend. Das also ist die wahre Funktion des Kentauren- und Lapithenkampfes. Mit ihm wird Ovid nicht - wie Fränkel meinte - sich selbst und seinen Idealen untreu, sondern mit ihm enthüllt er gerade umgekehrt den tieferen Sinn seines Spiels. Selbst die neueste, die dritte Phase der Ovidforschung - mit ihrem unerhört geschärften Sinn für ovidische Eigenart - hat das noch nicht recht erkannt. Otto Steen Due deutet noch 1974 die Schilderung vom Kentauren- und Lapithenkampf als eine Konzession an den zeitgenössischen Publikumsgeschmack und vergleicht sie allen Ernstes mit den „spaghetti-westerns" unserer eigenen Zeit, die - wie er schreibt (150) -,.nicht nur bei der großen Menge populär sind, sondern auch bei einer ansehnlichen Zahl von Intellektuellen, die all das Blut-, Hirn- und Mobiliar-Gespritze als eine Variation der zwar respektableren, aber auch faderen psychologischen Kunst des Films genießen"19.1 18
W.-H. Friedrich, Verwundung und Tod in der Ilias. Homerische Darstellungsweisen, Göttingen 1956; dazu A. Heubeck, Die homerische Frage, Darmstadt 1974, 28-30. 19 Ähnlich vorher schon Wilkinson 162 f. („conscientious attempts at Homeric realism", „Ovid felt that his patchwork would be incomplete without a battle-piece or two", „there would be some at least among his audience whose jaded taste would respond to any novel sensation of gruesomeness he could inflict, like twentieth-century Parisians at the Grand Guignol").
45
600 46
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
In Wahrheit hat Ovid etwas ganz anderes gewollt. Er hat in diesem Hauptstück seines äußerlich scheinbar nur virtuosen Spiels die ganze Ilias gespiegelt und zugleich demontiert, - nicht, um Homer als Künstler zu vernichten, sondern um eine Weltauffassung gegen eine andere zu setzen - die große Welt des Heldenhaften gegen die kleine Welt des unheldisch Privaten. Die Interpretation ließe sich fortsetzen und vertiefen. Am Waffenstreit zwischen Ajas und Odysseus, aber auch an der ganzen Rezeption der vergilischen Aeneis und schließlich an der schillernden Darstellung der römischen Apotheosen von Romulus bis Caesar und Augustus würde deutlich werden, wie Ovid mit seinem großen Spiel die ganze pathetische Kulisse einer Tradition des heroischen, nationalen und imperialen Weltgefühls ironisch demontiert, - nicht um missionarisch eifernd anzuklagen, sondern um durch Relativierung das Inhumane in allen Arten von verfestigten Strukturen wie Dogmen, Ideologien und sozialen Mechanismen (besonders dem Krieg) sichtbar zu machen und an die Stelle dieses Inhumanen das nach seinem Weltgefühl einzig Humane zu setzen: menschliche Liebe als einfaches, echtes, unpathetisches Gefühl. Leider fehlt die Zeit, diese letzte, positive Deutung zu vertiefen. Sollte aber mit ihr wirklich etwas vom tieferen Sinn der Metamorphosen getroffen sein, dann wäre der Spielcharakter des Werks als menschliche und künstlerische Notwendigkeit für Ovid erwiesen. Ein undogmatischer Geist kann, um Dogmen und Ideologien zu decouvrieren, nicht selbst dogmatisch werden. Er würde sich selbst negieren. Darum, so meine ich, mußten Ovids Metamorphosen ein Spiel werden, ein ludus sollemnis, um noch einmal mit Hermann Hesse zu reden, - ein festlichheiteres, unverkniffenes und bei allem Übermut dennoch sinnerfülltes Spiel mit der Tradition. I
Den Teilnehmern eines Metamorphosen-Oberseminars im Sommersemester 1977 bin ich für vielfältige Anregungen zu herzlichem Dank verpflichtet.
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
601
Bibliographischer Anhang (Auswahl) Überblick über die Ovid-Auffassungen des 19. und 20. Jahrhunderts: 1. W. Marg
Rez. von Nr. 9, Gnomon 21, 1949, 44-57
3 Phasen des
Metamorphosen-Verständnisses:
Erste Phase (bis zu Kraus und Frankel) 2. A. Zingerle 3. G. Lafaye 4. R. Heinze 5. E. Martini
6. Ders. 7. T. F. Higham
Ovidius und sein Verhältnis zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern, Innsbruck 1869. Les Métamorphoses d'Ovide et leurs modèles grecs, (Paris 1904) Hildesheim - New York 1971. Ovids elegische Erzählung, Ber. Verh. Sächs. Ak. Wiss. 71, Leipzig 1919. Ovid und seine Bedeutung für die römische Poesie, in: ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ, Heinrich Swoboda dargebracht, Prag 1927, 165-194. Einleitung zu Ovid, Prag 1933. Ovid: Some Aspects of his Character and Aims, CQ 48, 1934,105-116 (deutsch in: WdF ,Ovid\ 40-66).
Zweite Phase (bis zu Doblhofer und v. Albrecht 1963) 8. W. Kraus 9. H. Fränkel 10. L. P. Wilkinson 11.E. Zinn
Ovidius Naso, in: RE XVIII 2 (1942), Sp. 1910-1986 (überarbeitete Fassung in: WdF ,Ovid', 67-166). I Ovid. A Poet between Two Worlds, Berkeley 1945 (deutsch: Darmstadt 1970). Ovid Recalled, Cambridge 1955. Worte zum Gedächtnis Ovids, gesprochen bei der Zweitausendjahrfeier am 5. Februar 1958 in Tübingen, in: WdF,Ovid\ 3-39.
Dritte Phase 12. E. Doblhofer
Ovidius urbanus. Eine Studie zum Humor in Ovids Metamorphosen, Philologus 104, 1960, 63-91. 223-235.
602
Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition
13. Μ. v. Albrecht
14. H.-B. Guthmüller 15. S.Viarre 16. W. Ludwig 17. Brooks Otis 18. E.J. Bernbeck 19. Μ. v. Albrecht/E. Zinn (Hrsgg.) 20. J.-M. Frécaut 21. O. SteenDue 49 22. G. Κ. Galinsky
Ovids Humor. Ein Schlüssel zur Interpretation der Metamorphosen, AU, Reihe 6, Heft 2 (1963) 47-72 (= WdF ,Ovid\ 405-437). Beobachtungen zum Aufbau der Metamorphosen Ovids, Diss. Marburg 1964. L'image et la pensée dans les Métamorphoses d'Ovide, Paris 1964. Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids, Berlin 1965. Ovid as an Epic Poet, Cambridge 1966, London 2 1970. Beobachtungen zur Darstellungsart in Ovids Metamorphosen, München 1967 (Zetemata 43). Ovid, Wege der Forschung Band 92, Darmstadt 1968. L' esprit et Γ humour chez Ovide, Grenoble 1972 (zu den Met.: Kap. IV, 237-269). Changing Forms. Studies in the Metamorphoses of Ovid, Kopenhagen 1974.1 Ovid's Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects, Oxford 1975.
Letzter Forschungsbericht: 23. M. v. Albrecht
Anz. f. d. Altert.-wiss. 25, 1972, 267-290 (Nachträge: 26, 1973, 132 f.).
24. J. Huizinga
Homo ludens (1938). Deutsch: rororo-Taschenbuch (rde) Nr. 21, 1956 u.ö. Das Glasperlenspiel (1943), Suhrkamp Taschenbuch Nr. 79, 1971 u.ö.
25. H.Hesse
26. Ovid, Metamorphosen, verdeutscht von Thassilo von Scheffer, Bremen o.J. (Sammlung Dieterich).
5. Zur griechischen Sprachwissenschaft
Glotta 46, 1968,27-47
άπτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?1 Die Versuche, den Sinn dieser Ausdrücke zu erfassen, sind fast unübersehbar2, eine schlagende Erklärung ist dennoch bisher nicht gefunden worden („it is probably impossible to say with certainty what the poet here [sc. mit απτερος φάτις] meant" resignierend Fraenkel zu Aisch. Ag. 276). Der Grund dafür liegt offenbar darin, daß die bisherige Diskussion über diese Ausdrücke zu sehr am Einzelwort hängengeblieben ist. Eine eindringende Interpretation des jeweiligen Sinnzusammenhangs ist deshalb gefordert. I. απτερος μΰθος Jeder Homerleser, der beim ersten Auftreten des Ausdrucks in ρ 57 bereits etwa hundertmal3 επεα πτερόεντα προσηύδα (αγόρευε) gelesen hat, wird απτερος ganz natürlich als Privativ-Bildung zu πτερόεις auffassen; M. van der Valk hat das unlängst deutlich herausgestellt und dabei zugleich über den Wert der Scholien-Erklärungen (,schnell', .bereitwillig', .erfreulich' u.a.) das Nötige gesagt. Die Frage ist also zunächst: was bedeutet επεα πτερόεντα? Das heißt: was steckt hinter Büchmanns vielzitierten .geflügelten Worten'? Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunächst von den sicheren Ergebnissen auszugehen, die vor einiger Zeit M. Durante4 vorgelegt hat: 1 Für Kritik und Anregungen danke ich Dr. Kannicht und Dr. Schwarz (Wilrzburg) sowie Frau Dr. Voigt (Hamburg). 2 Eine Auseinandersetzung mit sämtlichen vorgetragenen Theorien müßte ein Buch füllen (vgl. P. Groeneboom, Aesch. Agam., Amsterdam 1966, S. 172: „over άπτερος zou een dlissertatie te schrijven zijn"). Die Diskussionen und Literaturangaben bei H. L. Ahrens, Philologus Suppl. 1, 1860, 481-484; Ameis-Hentze zu ρ 57 sowie im Anhang; E. Fraenkel, Aesch. Agam., Oxford 1950, Bd. Π zu V. 276; M. van der Valk, AntCl. 35, 1966, 59-64, ermöglichen einen ersten Überblick. 3 Die Formel erscheint in der Ilias 61 mal, in der Odyssee 64 mal. 4 ΕΡΕΑ PTEROENTA. La parola come .cammino' in immagini greche e vediche, in: Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei 13, 1958, 3-14 (zur Aufnahme in den von der WBG Darmstadt geplanten Sammelband .Indoger-
606
απτερος μΰθος - άπτερος φάιις: ungeflügelte Worte?
(1) Das Bild kann nicht auf einen Vergleich zwischen Wort und Vogel zurückgehen, da a) Vögel bei Homer nie das Epitheton πτερόεις haben (nur πετεηνός), I 28 b) weder bei Homer noch sonst im Griechischen Worte (anders Dichtungen, Lieder, Hymnen) auf irgendeine Weise mit Vögeln verglichen werden. (2) Dagegen kommt πτερόεις bei Homer 4 mal (Δ 117, E 171, Π 773, Y 68) als Epitheton des Pfeils vor, und bildhafte Wendungen wie έπος έκβάλλειν, ίέναι u. a., in denen das Verb ursprünglich die Tätigkeit des Bogenschützen bezeichnet, sind fester Bestandteil der homerischen und auch nachhomerischen Metaphorik. Demnach bedeutet πτερόεις ursprünglich nicht .geflügelt', sondern ,mit Federn versehen', .gefiedert' 5 . Daraus folgt, daß das επος mit dem ιός verglichen wurde, d. h. das επος erschien dem archaischen Menschen als ein ,Ding' - wie ein Pfeil. Soweit ist alles einleuchtend. Die Frage ist jetzt nur, was der Sinn dieses Vergleiches ist. Durante sagt zunächst: (3) „il senso dell'associazione metaforica" sei unklar, weder sei das tertium comparationis einsichtig (nicht Höhe, nicht Schnelligkeit - was dann?) noch der Vorgang, der „nella mente dell'aedo che per primo foggiò la espressione" zu der Metapher führte. Dann aber gibt er doch noch eine Erklärung, und zwar: (4) das tertium comparationis sei die „appropriatezza del discorso" oder „il colpire nel segno", έπεα πτερόεντα seien also .parole che volano ben dirette, che sono adeguate alla situazione' (ähnlich schon vorher J.A.K. Thomson, CQ 30, 1936,1 ff.). Diese Erklärung kann kaum zutreffen, und zwar aus folgenden Gründen: der ιός πτερόεις bleibt immer der gefiederte Pfeil, niemals ist er der .geeignete', ,gut gezielte' oder .ins Ziel treffende' Pfeil, d.h. πτερόεντες als Attribut der Pfeile drückt lediglich aus, daß die Pfeile mit Federn versehen sind, nicht auch zugleich, daß sie ins Ziel treffen; dafür wäre ein besonderes Attribut nötig
manische Dichtersprache' vorgesehen) [in deutscher Sprache erschienen in: R. Schmitt (Hrsg.), Indogermanische Dichtersprache, Darmstadt 1968 (WdF 165), 242-260]. 5 Zur Technik der antiken Pfeilfiederung s. H. Lorimer, Homer and the Monuments, London 1950, S. 302. - Sonst kommt πτερόεις nur noch als Beiwort der merkwürdigen λαισήϊα (E 453 = M 426) vor. Die primär archäologische Frage, was man sich unter ,mit Federn versehenen Schilden' vorzustellen hat, ist offenbar noch ungeklärt, s. Lorimer, a. a. O. 194 ff.
απτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
607
(später: εύστοχος, εΰσκοπος), denn die Befiederung ist zwar eine Voraussetzung für das Treffen des Zieles, ist aber natürlich nicht gleichbedeutend damit: auch ein noch so gut gefiederter Pfeil kann sein Ziel verfehlen. Was aber schon das konkret verwendete Epitheton nicht leisten kann: Befiederung und Treffsicherheit auszudrücken, das I kann auch das metaphorisch verwendete Epitheton 29 nicht leisten (die gleiche Überlegung spricht gegen Durantes .parole che volano ben dirette'). Aber auch die Funktion der Einleitungsformel επεα πτερόεντα προσηύδα macht Durantes Erklärung unwahrscheinlich: nach Durante müßten ja die durch diese Formel eingeleiteten 125 Reden allesamt,situationsangemessen' oder ,ihr Ziel treffend' sein. Diese Auffassung ist ebenso subjektiv und der epischen Formelsprache unangemessen, wie es seinerzeit die Versuche waren, πτερόεντα als ein die Eigenart der folgenden Rede im voraus charakterisierendes Attribut zu verstehen6 (zurückgewiesen von M. Parry, CPh 32, 1937, 59-63). Wenn die Formel 125 Reden verschiedensten Inhalts und verschiedenster Länge einleitet, also immer paßt, so kann das nur bedeuten, daß zwischen ihr und dem Inhalt oder der Eigenart der folgenden Rede keine innere, sondern nur eine funktionale Beziehung bestand: die Formel war neutral. Durantes Erklärung kann also den Kern der Metapher nicht treffen. Es scheint, daß die Entstehung und der Sinn des Bildes vielmehr folgendermaßen zu erklären sind: Der Dichter, der irgendwann einmal den Ausdruck prägte, tat es unter dem Eindruck der Unerklärlichkeit des Phänomens ,Schallausbreitung'. Von Schallwellen usw. wußte er nichts, er sah nur: ein Wort wird .artikuliert', es ertönt, es erreicht den Partner - ein Pfeil wird auf die Sehne gelegt, er wird abgeschossen, er erreicht sein Ziel; wende ich beim Abschießen des Pfeiles mehr Kraft an, fliegt der Pfeil weiter - tue ich das gleiche beim .Artikulieren' des Wortes, durchmißt es ebenfalls größere Entfernungen; will ich mit dem Pfeil ein Ziel erreichen, muß ich darauf zielen - ebenso beim Sprechen (ich wende mich nicht vom Partner ab, sondern ihm zu; will ich jemanden in einiger Entfernung von mir mit meinen Worten erreichen, so rufe ich nicht in die entgegengesetzte Richtung). Die Frage war also offenbar: ,Wie überwinden Worte den Raum?' Der Sänger antwortete, vielleicht sehr alter Tradition folgend: Worte sind Dinge wie die gefiederten Pfeile, επεα πτερόεντα. Das tertium compara6
Diese Charakterisierung der folgenden Rede leistet das vor die Formel gesetzte Partizip (όλοφυρόμενος, λισσόμενος, νεικείων, ύπόδρα ίδών usw.), nicht πτερόεντα; diese Partizipien vertreten hier die Stelle der sonst zuweilen zu έπέεσσι gesetzten qualifizierenden Attribute κερτομίοισ', έκπάγλοισ', κακοΐσ' u. a.; im Gegensatz zu ihnen bezeichnet πτερόεντα keine aktuelle Eigenschaft der Worte, sondern eine habituelle.
608
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
tionis ist also in der Tat weder Höhe noch Schnelligkeit (beides würde die 30 Erlkenntnis des ,Flugcharakters' der Worte bereits voraussetzen), sondern einfach das Fliegen als solches, allerdings kein beliebiges, sondern das .Fliegen wie der gefiederte Pfeil', also das vom Menschen nach Reichweite und Richtung bestimmbare Fliegen, έπεα πτερόεντα sind demnach primär nichts als ,die gefiederten Worte', so wie voi πτερόεντες nichts als ,die gefiederten Pfeile' sind; natürlich hat weder der Sänger noch der Hörer jemals ein .gefiedertes Wort' wirklich gesehen oder gehört, d.h. .gefiedert' ist metaphorisch gemeint: es zwingt den Hörer zur Assoziation: Wort ~ Pfeil7, πτερόεντα ist also ursprünglich ein erklärendes oder erhellendes Epitheton. War jedoch dieser klärende Vergleich einmal Allgemeingut geworden, so konnte πτερόεντα zum stehenden Beiwort werden: zahlreiche Stellen zeigen, daß das έπος schon als solches, ohne Epitheton, als dahinfliegende Wesenheit aufgefaßt wurde; sobald ein Mensch artikulierte (das heißt in diesem Denken anschaulich: Zähne, Lippen, Mund bewegte), entstand ein έπος, das ,das Gehege der Zähne verließ'. Ein έπος ist also grundsätzlich immer hörbar* - darin besteht sein Wesen - , und es ist irreversibel; überschritt es einmal die Lippen, so fliegt es dahin, πτερόεντα gibt also nicht eine bestimmte Eigenschaft bestimmter Worte an, sondern (die Vorstellung des Hörers allerdings in eine ganz bestimmte Richtung lenkend9) die wesenhafte Eigenschaft der έπεα als solcher, wie λαμπρόν bei φάος, έρεβεννή bei νύξ, ύγρόν bei ύδωρ und auch πετεηνοί bei όρνιθες 10 . Genau wie bei diesen 31 Verbindungen wird das Charakteristische durch das beigesetzte Epitheton nur eigens hervorgehoben: das durch den Sprech-Akt zur Existenz gebrachte Wort
7
Es liegt hier eine deijenigen Metaphern (als Kurzform der , similitudo') vor, bei denen ein sinnlich nicht wahrnehmbarer Vorgang (hier das Fliegen des Wortes) mit einer sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung verglichen und so wahrnehmbar gemacht wird (s. Lausberg, Elemente der lit. Rhet., § 402, IH A); vergleichbar ist έρσήεις (έερ-): Ξ 348, h. Merc. 107 von Blumen in der konkreten Bedeutung ,mit Tau versehen' gebraucht, veranlaßt es den Hörer in Ω 419. 757, auf Hektors Leichnam angewandt, zur Assoziation: der Leichnam ist (natürlich nicht,betaut', sondern) taufrisch wie eine Blume. Nur ist dies eine okkasionelle Metapher. 8 Scheinbare Ausnahme unter Hunderten von Belegen für επος ist Β 213: ος ρ' επεα φρεσίν ήσιν άκοσμα τε πολλά τε ήδη: gemeint sind bestimmte (Schimpf-)Worte, die Thersites eben parat hat und die schon oft ausgesprochen wurden. 9 Denn es gab ja auch andere ,Flugobjekte', mit denen das επος verglichen werden konnte, s. Γ 222: επεα νιφάδεσσι έοικότα χειμερίησιν. Damit wird aber eine bestimmte Art von Worten charakterisiert. 10 Siehe Durante, a. a. O. Auch Durante gibt zunächst die Bedeutung .parole pronunciate' an, lehnt sie dann aber zugunsten seiner oben widerlegten Erklärung ab, mit Gründen, die schwerlich überzeugen können.
απτερος μΰθος - άπτερος φάτνς: ungeflügelte Worte?
609
ist ein επος πτερόεν, ein ,wie der gefiederte Pfeil dahinfliegendes' Wort, und das bedeutet: ein ,laut ausgesprochenes' Wort. Es ist danach verständlich, daß die Formel επεα πτερόεντα προσηύδα ausschließlich direkte, laut geäußerte Rede einleitet: ,die wie die gefiederten Pfeile dahinfliegenden Worte' - das können nur hörbare Worte sein. Bei so extensiver Verwendung der Formel, wie sie das Epos bietet, kann nun aber der Hörer kaum noch in jedem Einzelfall die ursprünglich erhellende Funktion des Epithetons, d.h. das Bild des ,pfeilhaften Wortes' realisiert haben; über Parry hinaus ist daher zu vermuten, daß die eigentliche Funktion dieser wie auch anderer ähnlicher Einleitungsformeln in der Sängerpraxis einfach darin bestand, dem Hörer den Beginn direkter Rede zu signalisieren, deren Ende dann stereotyp durch ώς äp' εφη (έφώνησεν o. ä.) bezeichnet wird. Doch ist diese Vermutung für die hier untersuchte Frage nicht entscheidend. Festzuhalten bleibt nur: επεα πτερόεντα sind ,die gefiederten', und das heißt: ,die wie die gefiederten Pfeile dahinfliegenden', und das wiederum bedeutet: ,die laut ausgesprochenen, vernehmbaren Worte'. Nun zu άπτερος μΰθος selbst. ρ 57 = τ 29 = φ 386 = χ 398: ώς αρ' έφώνησεν (Telem. bzw. Eum.)· τη δ' (Pen. bzw. Eurykl.) απτερος επλετο μΰθος. Nach dem Vorangegangenen bleibt nur eine Möglichkeit der Übersetzung: ,So also redete er; ihr aber blieb ungefiedert', also: ,nicht wie der gefiederte Pfeil dahinfliegend', also: .nicht laut ausgesprochen, unausgesprochen - der μΰθος'. Was bedeutet hier μΰθος? Fournier sagt in seiner Wortfelduntersuchung (Les verbes ,dire' en grec ancien, Paris 1946, S. 49): „μΰθος dont on verra in fine le sens duratif de ,pensée qui s'exprime, langage', bien opposée à επεα .paroles, expressions'". Er führt an: ,,α 273 μΰθον πέφραδε πάσι .explique ta pensée', τ 502 εχε σιγή μΰθον .tiens ta langue'" (etwa: .behalte für dich, was du denkst') und andere Beispiele, μΰθος bedeutet also nicht, wie επος, das ausformulierte, in jedem Falle hörbare Einzel wort, sondern zunächst das, woraus die Einzelwörter entstehen, das was einer denkt, den Gedankeninhalt, dann auch die »Geschichte' usw., kurz: den ,Stoff', der sich dann in den einzelnen επεα formt, μΰθοι heißen demgemäß niemals im Epos πτερόεντες (wie umgekehrt ein επος nie απτερον heißt), ein μΰθος ist mehr als ein Einzelwort, er kann nicht I wie ein Pfeil vorgestellt werden. Gerade darum aber ergibt die Verbindung απτερος μΰθος ein sinnvolles Bild. Denn der Ausdruck ,ihr aber blieb unausgesprochen,
32
610
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
was sie dachte' bedeutet dann: der μΰθος wurde nicht zu επεα πτερόεντα, nichts .verließ das Gehege ihrer Zähne': sie sagte nichts, sie blieb stumm. Diese schon häufig vorgetragene, hier nur anders begründete Deutung hatte, so logisch sie scheinen mag (die mit τη δέ bezeichnete Person bleibt ja in der Tat stumm), von Anfang an mit der Auffassung zu kämpfen, μΰθος bezeichne hier die je vorangegangene Rede des Telemach bzw. Eumaios, απτερος bedeute ,ungefiedert' im Sinne von ,das Ziel nicht treffend', und der ganze Ausdruck habe so den Sinn: „the import of the speech, or its full import, was not perceived by the listener"11. Diese Auffassung zu widerlegen12 und die hier vertretene zu stützen scheint nun über das oben Gesagte hinaus ein Mittel geeignet, das in der bisher geführten Diskussion offenbar noch nicht genutzt wurde: die genaue Bestimmung der psychologisch erhellenden Funktion des Ausdrucks. Das Schweigen der Zuhörer nach einer Rede wird im Epos mit einer ganzen Anzahl verschiedenartiger, oft formelhafter Wendungen beschrieben. Bei genauerem Zusehen zeigt sich jedoch, daß jede dieser .Schweigeformeln' eine ganz bestimmte Art des Schweigens beschreibt: die Formeln sind nicht beliebig austauschbar. Wie beredt ganz allgemein das Schweigen im homerischen Epos sein kann, hat kürzlich Siegfried Beßlich gezeigt13. Die oft nur einen oder einen halben Vers füllenden .Schweigeformeln' hat er jedoch wegen seiner andersartigen Zielsetzung nicht mitbehandelt. Für unsere Zwecke genügen einige Beispiele: In beiden Epen zusammengenommen erscheint 16 mal die Formel: ώς εφαθ', oi δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή. Die Arten des mit dieser Formel ausgedrückten Schweigens sind zwar in Nuancen verschieden (es ist z.B. zwiespältig in Γ 95 Η 92. 389 u. ö., bedenklich und unsicher in Κ 213. 313 Ψ 676, bedrückt in I 430. 693, betreten in θ 234, verle33 gen in υ 320, usw.); aber in allen I Fällen drückt die Formel ein absichtliches Schweigen der Zuhörer aus, ein ,nicht wissen, was man sagen soll', ein unentschiedenes Schweigen also.
11
J. Α. K. Thomson, CQ. 30, 1936, 1 ff.; schon vorher (im AnschluB an Scholienerklärungen) M. L. Jacks, CR. 36, 1922, 70 ff., W. Headlam, Aesch. Agam., Cambridge 1925, S. 191, u. a. 12 Van der Valks Gegenargumente gegen diese Auffassung (a. a. O. 63) können in ihrer Subjektivität kaum überzeugen. 13 .Schweigen - Verschweigen - Übergehen', Heidelberg 1966.
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
611
Anders die Formel (2 II. : 2 Od.) θαλερή δέ oi εσχετο φωνή. Sie erscheint zuerst in Ρ 696 (Men. überbringt Antil. die Nachricht von Patroklos' Tod): "Ως εφατ', Άντίλοχος δέ κατέστυγε μΰθον άκούσας, δήν δέ μι ν άμφασίη έπε ων λάβε, τώ δέ oi οσσε δακρυόφι πλήσθεν, θαλερή δέ οί εσχετο φωνή. άλλ' ούδ' ώς Μενελάου έφημοσύνης άμέλησε, βη δέ θέειν ... Das ist ein unabsichtliches Schweigen aus tiefer Erschütterung. Antilochos schweigt nicht, weil er nicht wüßte, was er sagen soll, sondern weil er zu sprechen nicht fähig ist: die Stimme versagt, die Kehle ist ,wie zugeschnürt' 14 . Das gleiche Gefühl beschreibt die Wendung in δ 705 (Medon meldete Penelope soeben den Mordanschlag der Freier gegen ihren Sohn) und in τ 472 (Eurykleia hat soeben Odysseus' Narbe erkannt)15. Schließlich die Formel (α 381 = σ 140 = υ 262) ώς εφαθ', oi δ' άρα πάντες όδάξ έν χείλεσι φύντες Τηλέμαχον θαύμαζον, ö θαρσαλέως αγόρευε, ,die aber alle, mit den Zähnen in die Lippen eingewachsen, Telemach staunten sie an, der kühn gesprochen'.
Schwerlich läßt sich ein Ausdruck denken, der das .verbissene' Schweigen der Freier treffender beschreiben könnte: Wut, Haß, Bestürzung und erzwungenes An-sich-Halten mischen sich hier in einer Weise, die für das Verhältnis der Freier zu Telemach das ganze Epos hindurch charakteristisch ist. Diese Formel ist aber beschränkt auf eben dieses Verhältnis, d. h. sie beschreibt nur die Wirkung von Äußerungen Telemachs auf die Freier. Nun wird auch άπτερος ... μΰθος nur gebraucht, wenn die Wirkung von Reden I Telemachs beschrieben 34 wird. Es scheint also, daß der Dichter solche Formeln zuweilen eigens für bestimmte persönliche Beziehungen geprägt hat. Für das Verständnis des Sinngehalts von απτερος μΰθος kann diese Beobachtung nützlich sein.
14
Vgl. Vergils ,νοχ faucibus haesit', oder etwa Liv. 1,25,4: ,horror ingens spectantes perstrineit et neutro inclinata spe torpebat vox spiritusque' [Sappho 31, 7-9 V.]. An der 4. Belegstelle (Ψ 397) ist das Schweigen dagegen nicht seelisch, sondern ganz naturalistisch körperlich bedingt: Eumelos' Augen füllen sich mit Tränen und seine Stimme versagt, weil er vom Wagen mit dem Gesicht in den Staub gefallen ist. Da liegt eine fast geniale Verfremdung der Formel vor.
612
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
Zunächst die erste Belegstelle: ρ 57
Telemach ist nach seiner langen Reise endlich zurückgekehrt. Eurykleia erblickt ihn als erste in Odysseus' Haus. Weinend läuft sie ihm entgegen, die Mägde kommen hinzu, küssen ihm vor Freude Haupt und Schultern (p 31 ff.). Da eilt Penelope herbei. Sie ist überglücklich:
(38)
άμφί δέ παιδί φίλω βάλε πήχεε δακρύσασα, κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε και αμφω φάεα καλά, καί ρ' όλοφυρομένη επεα πτερόεντα προσηύδα„ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερόν φάος. οϋ σ' έτ' έγώ γε οψεσθαι έφάμην, έπε! οϊχεο νηΐ Πύλονδε λάθρη, έμεΰ άέκητι, φίλου μετά πατρός άκουήν. αλλ' αγε μοι κατάλεξον οπως ήντησας όπωπής."
Die Innigkeit dieser Begrüßung ist unüberhörbar („du bist da, Telemachos - süßes Licht! ich glaubte, ich würde dich nie mehr Wiedersehen - nachdem du weggegangen warst auf dem Schiffe, nach Pylos, heimlich, - ich wollte es nicht ...")» unüberhörbar auch, was in ihr mitgegeben ist: der Kummer über seine plötzliche Abreise, Medons Nachricht vom Mordanschlag der Freier, das Bangen der letzten Wochen, die schlaflosen Nächte, die Tränen, das Hin und Her zwischen Verzweiflung und Hoffnung ... Alles das muß realisiert werden, um zu ermessen, was für Gefühle die distanzierte Kühle der Antwort Telemachs in Penelope hervorrufen muß. Telemach sagt: (46) „μήτερ έμή, μή μοι γόον ορνυθι μηδέ μοι ήτορ έν στήθεσσιν ορινε φυγόντι περ αΐπύν ολεθρον άλλ'... (es folgen Anweisungen). Das ist alles. Kein Wort der Freude, kein Zeichen der Sohnesliebe, ja, noch nicht einmal ein Eingehen auf ihre so gut verständliche Bitte, zu erzählen. Man bedenke: Telemach war fortgegangen, um Kunde über den verschollenen Vater einzuholen: was gäbe es für Penelope Wichtigeres als dies? Telemach aber bleibt harthörig: er gibt sachliche Anweisungen (sie soll in ihre Gemächer gehen, sich umziehen, opfern; er selbst wird sogleich wieder forteilen, um dies und jenes zu erledigen ...). Wer würde nicht die große Enttäuschung Penelopes, ih35 ren Schock verstehen? Dieser kühle, abweisende, fast I fremde Mann - ist das ihr Sohn? 16 Gewiß war sie schon vorher Kühle von ihm gewohnt; er hatte ja 16 Dem möglichen Einwand, diese Interpretation sei zu modern, zu gefühlsbetont, wäre mit dem Hinweis auf das Wiedersehen zwischen Telemach und seinem Vater in π 213 ff. zu begegnen: da kann Telemach den Vater weinend umarmen und sich ganz dem Gefühl überlassen. Die Reserve zeigt er nur gegenüber der Mutter. Diese Haltung ist jedoch sicherlich nicht .Kälte' (so
άπτερος μΰθος - άπτερος φά-ιις: ungeflügelte Worte?
613
auch früher schon den Herrn im Hause herausgekehrt und sie auf ihre weibliche Rolle verwiesen (α 356 u.ö.). Dort hatte es dann von Penelope geheißen (α 360): ή μέν θαμβησασα πάλιν οίκόνδε βεβήκει. Geschwiegen hatte sie also auch dort, aber doch eher erstaunt und verwirrt (θαμβησασα), weil sie dieses plötzliche Aufbegehren des heranwachsenden Knaben nicht recht zu deuten gewußt hatte. Jetzt aber, in dieser einzigartigen Situation, prägt der Dichter einen neuen Ausdruck, in den er das ganze erzähltechnisch vertrackte (und menschlich so komplizierte) Problem dieser Beziehung zwischen Mutter und Sohn komprimiert: (57) ώς αρ' έφώνησεν τη δ' άπτερος επλετο μΰθος: ,So also redete er - ihr aber blieb unausgesprochen, was sie dachte.' Sie erwidert nichts - und geht schweigend fort, wie ihr geheißen. Auch dies ist offenkundig ein absichtliches Schweigen, aber aus ganz anderen Motiven und Gefühlen heraus als in ώς εφαθ', oi δέ άκην έγένοντο σιωπή. Um dieses auch für uns mit sprachlichen Mitteln schwer zu erfassende, überaus komplexe und viel-sagende Schweigen dem Hörer .vernehmbar' zu machen, scheint der Dichter dieser Stelle den Ausdruck neu geschaffen zu haben. Es bildet eine Stütze dieser Interpretation, wenn die Haltung Penelopes kurz darauf so beschrieben wird: ρ 94.
Telem. hat Theoklymenos ins Haus geführt, man hat gebadet und setzt sich nun zu Tisch. „Die Mutter aber setzte sich ihnen neben dem Pfeiler der Halle gegenüber, in einen Sessel gelehnt, und drehte feine Wolle auf der Spindel ... Doch als sie sich das Verlangen nach Speise und Trank vertrieben hatten, da begann unter ihnen die Reden die umsichtige Penelopeia: .Telemachos! nun, so werde ich ins obere Stockwerk hinaufgehen und mich auf das Lager legen, das mir gewirkt ist als ein seufzerreiches, immer befleckt von meinen Tränen, seitdem Odysseus mit den Atreussöhnen nach Ilion hinweggegangen. Gewinnst du es mir doch nicht über dich, ehe die mannhaften Freier zu diesem Hause kommen, mir genau von der Heimkehr deines Vaters zu berichten, ob du wohl davon gehört hast! "' (Schadewaldt). I
Der stumme Vorwurf, wie er in jenem Schweigen lag, bricht hier - beherrscht, 36 aber bitter - hervor. Und nun endlich versteht sich Telemach wenigstens zu einem kurzen Bericht... Es kann also (selbst wenn man von der oben erörterten semasiologischen Unwahrscheinlichkeit der Thomsonschen Auffassung absieht) keine Rede davon
van der Valk, a. a. O. 16. 42); die Gründe liegen woanders, vgl. den Vers π 303, dazu aber auch υ 339-344.
614
άπτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
sein, daß Penelope den Sinn des von Telemach Gesagten nicht verstanden hätte. Die Aussagefunktion der Wendung τη δ' άπτερος επλετο μΰθος liegt offensichtlich nicht im intellektuellen Bereich, sondern im psychologischen17. Es ist nun von vornherein nicht zu erwarten, daß ein Ausdruck, der für eine so außerordentliche, im ganzen Epos singuläre Situation geschaffen wurde, bei Verwendung in anderen Zusammenhängen gleiche Aussagekraft hat. Die Wiederverwendung eines einmal geprägten Ausdrucks geht fast immer mit einem Verlust an Prägnanz einher18. Auch die oben besprochene Wendung θαλερή δέ οί εσχετο φωνή hat ihre größte Prägnanz an der ersten Stelle, für die sie wohl auch geprägt wurde. Ebenso ist im Falle von απτερος ... μΰθος eine gewisse Ähnlichkeit in der Grundsituation zwar gegeben: stets beschreibt die Wendung die Reaktion einer weiblichen Person auf eine (schroffe) Rede Telemachs; die Möglichkeit der Weiterverwendung ist damit erklärt. In demselben Maße jedoch, in dem die weiteren Situationen, verglichen mit der ersten, an Bedeutung verlieren, verblaßt und verändert sich auch der ursprüngliche Sinn der Wendung: aus der originalen Prägung wird die Formel. Am nächsten kommt noch die zweite Stelle: τ 29.
Telem. beauftragt Eurykl., die Frauen in ihrem Gemach zurückzuhalten, bis er die W a f f e n der Freier aus dem Megaron in die Rüstkammer gelegt habe. Die Alte geht sofort darauf ein:
(22)
„Wenn du doch endlich, Kind! Vernunft annähmest, daß du für das Haus sorgen und alle Güter bewahren könntest!" I
37 Immer noch ist Telemach ein halbes Kind für sie; die Zeit ist gar nicht so fem, da sie ihn noch auf den Knien gewiegt hat. So stellt sie auch gleich die fürsorgliche Frage: (24)
„Doch auf! welche soll alsdann vorausgehen und dir das Licht tragen? Den Mägden erlaubst du ja nicht, daß sie herauskommen, die dir leuchten könnten."
Natürlich erwartet sie die Antwort: „Du, Mütterchen! Bist du doch die alte Vertraute des Hauses." Statt dessen die (scheinbar) herrisch-schroffe Antwort
17
Die Kunst des Dichters wäre daher ebenso verkannt, wenn άπτερος hier etwa im Sinne
von ,schnell' gefaßt, μΰθος auf die Rede Telemachs bezogen und die ganze Wendung mit „et pour elle la chose fut immédiate; en d'autres termes, et pour elle la chose dite fut une chose aussitôt faite" wiedergegeben würde (so Mazon, REG 63, 1950, 18). 18
Die Erscheinung ist oft behandelt worden. Van der Valk (a. a. O. 13) faßt zusammen:
„this (sc. die Formelwiederholung) made their (sc. der Sänger) task easier but involved a dangerous tendency. For they might be tempted to employ formulae in connections, where their use was not entirely justified".
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
(27)
615
,,ξείνος οδ'· οΰ γάρ άεργόν άνέξομαι, ος κεν έμής γε χοίνικος απτηται, και τηλόθεν είληλουθώς",
und Eurykleias Reaktion: (29) ώς αρ' έφώνησεν τη δ' απτερος επλετο μΰθος. Auch hier wird die mütterliche Wärme von Telemach kühl ignoriert (weil sie ignoriert werden muß: π 303). Er spricht im Befehlston des Hausherrn, der keinen Widerspruch duldet. Und wieder ist in dem Schweigen alles mitenthalten, was die Schweigende bewegt: die Betroffenheit über seine Kälte („wer in meinem Hause ißt, der muß auch arbeiten. Schmarotzer dulde ich nicht"), die Enttäuschung darüber, daß ihr ein fremder Bettler vorgezogen wird. Eurykleia tut, wie ihr geheißen. Was in ihr vorgeht, behält sie für sich. Wie im ersten Falle beschreibt also die Wendung eine Art Schockwirkung, ausgelöst durch Telemachs abweisende Haltung, durch sein Sich-Entziehen. Diese Schockwirkung bildet die Brücke zwischen den beiden besprochenen Stellen und den beiden folgenden; aber nicht Telemachs Haltung motiviert jetzt das Schweigen, sondern der Inhalt seiner Worte. An beiden Stellen (φ 386 χ 398) beschreibt die Formel das Schweigen Eurykleias als Reaktion auf einen von Telemach erhaltenen Auftrag: an der ersten Stelle soll sie die Türen zum Frauengemach fest verschließen und auch nicht öffnen, wenn Männerstöhnen aus dem Megaron ertöne; an der zweiten Stelle pocht Telemach an die (noch immer verschlossene) Tür des Frauengemachs mit den feierlichen Worten: (395) ,,δεΰρο δή ορσο, γρηΰ παλαιγενές, ή τε γυναικών δμωάων σκοπός έσσι κατά μέγαρ' ήμετεράων, ερχεο - κικλήσκει σε πατήρ έμός, οφρα τι εϊπη." I Von den Vertretern der Auffassung ,ihr aber blieb der (tiefere) Sinn des von 38 Telemach Gesagten verborgen' wurden diese beiden Stellen als Hauptzeugen angeführt. Aber genau besehen, erweisen gerade sie die Unwahrscheinlichkeit dieser Interpretation: gerade Eurykleia ist ja die einzige Person, die Sinn und Bedeutung dieser Aufträge Telemachs überhaupt verstehen kann; denn sie als einzige kennt inzwischen sowohl die Identität des Bettlers (τ 474) als auch seinen Racheplan (τ 488. 496). Seitdem wartet sie auf den Beginn der Vergeltung. Sie muß also den Auftrag Telemachs im φ als eben diesen Beginn verstehen und den im χ als vermutlichen Abschluß des Unternehmens. Eben dieser Sachverhalt aber bestätigt, daß die Auffassung der Wendung τη δ' απτερος επλετο μΰθος als Schweigeformel richtig sein muß. Denn ein Schweigen Eurykleias ist (im Gegensatz zu einem Nichtverstehen) in diesen Situationen ausgezeichnet be-
616
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
gründet: gerade weil Eurykleia die Aufträge versteht, ist sie über eines um so verdutzter: daß diese Aufträge von Telemachos kommen. Denn nachdem ihr Odysseus für den Fall, daß sie ihn verrate, den Tod angedroht hatte (τ 487 ff. 494), muß sie sich mit Recht für seine einzige Mitwisserin halten (Telemachos selbst hatte ihr keinen Grund gegeben, daran zu zweifeln: υ 128 ff.). Nun aber spricht Telemach (in φ 386) so, als stünde das Strafgericht durch Odysseus bereits bevor: kann, darf er wissen, wer der Bettler ist? In χ 398 gibt es dann keinen Zweifel mehr - er weiß es: πατήρ έμός; aber woher weiß er es? Sie sagt nicht, was ihr im Kopf herumgeht, und bleibt stumm vor Schrecken. - Hinzu kommt nun noch die Bedeutung dieser Aufträge: im φ bedeutet der Auftrag den Beginn des Entscheidungskampfes: wie wird es ausgehen? Sie allein von den Frauen weiß, was jetzt im Megaron beginnt, aber der Mund ist ihr verschlossen, sie kann nur hoffen. Im χ dagegen bedeuten die feierlichen Worte Telemachs vielleicht das Ende der Plagen: Telemach pocht, Odysseus läßt rufen, beide also leben - wie ist es ausgegangen? So mag sie jeweils auch vor der Bedeutung und Tragweite des Augenblicks verstummen. Gewisse Parallelen im Formalen (gleiche Personenkonstellation) und Inhaltlichen (Schockwirkung) konnten also den Dichter bestimmen, den einmal geprägten Ausdruck auch in diesen Fällen wieder zu verwenden. Seine Aussagekraft freilich läßt im gleichen Maße nach, in dem die Situation und damit auch die Gefühle der schweigenden Person sich ändern. I II. απτερος φάτις
39
Von hier aus läßt sich nun, wie es scheint, auch die umstrittene Stelle Aisch. Agam. 276 erklären. Fraenkel hatte nach ausführlicher Besprechung der zahlreichen Lösungsversuche resigniert (s. o. S. 605) und schließlich zögernd für απτερος φάτις die Bedeutung ,swift-sped rumour' vorgeschlagen. Van der Valk ist optimistischer; er glaubt, die (schon häufig vorgeschlagene) Bedeutung .pleasant, attractive' treffe den Sinn der Stelle am besten; Aischylos habe die Bedeutung des Wortes απτερος bei Homer nicht mehr verstanden. Diese Annahme ist aus folgendem Grunde unmöglich: Aischylos wendet in seinem überlieferten Werk απτερος noch vier weitere Male an. An drei dieser Stellen hat das Wort mit Sicherheit, an der vierten mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bedeutung ,ohne Gefieder, ungeflügelt': (1)
Eum. 51:
die Prophetis versucht die Erinyen zu identifizieren: wie Frauen sehen sie nicht aus, wie Gorgonen auch nicht; nun erinnert sie sich an ein Bild der Harpyien, aber: απτεροί γε μήν ίδείν / αύται (sc. die Eririyen), also Harpyien können's auch nicht sein.
απτερος μϋθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
617
(2) An den folgenden beiden Stellen bildet άπτερος in der Bedeutung ,ungeflügelt' zusammen mit seinem jeweiligen Bezugswort die von Aristot. Rhet. Γ 6 (1408 a) erwähnte Stilfigur der μεταφορά έκ του άνάλογον (Muster: άλυρον μέλος), eine spezielle Form des Oxymoron: Eum. 250:
die Erinyen über sich selbst: ύπέρ τε πόντο ν άπτέροις πωτήμασιν / ήλθον διώκουσ' (sc. den Orest), also: ,in flügellosen Flügen'.
F. 619 Mette: von den Plejaden: ενθα (sc. am Himmel) νυκτέρων φαντασμάτων / εχουσι μορφάς, δπτεροι Πελ(ε)ιάδες: vgl. Athen. XI491 a: άπτέρους γαρ αύτάς εΐρηκε δια την προς τάς όρνεις όμωνυμίαν (.Plejaden': π ε λ ι ά δ ε ς ,Tauben')19.
(3) An der vierten Stelle: POx. 2256, 59: 17 ... ςιπτερον δάκς>νζ> ist die Bedeutung .ungeflügelt' natürlich nicht mit Sicherheit nachzuweisen, δάκος wird von Aischylos 5mal im Sinne von .gefährliches Untier' verwendet (s. Fraenkel zu Ag. 824, Groeneboom zu Prom. 582), ohne daß immer klar wäre, welches Tier eigentllich gemeint ist. Ein .ungeflügeltes bissiges Tier' 40 wäre jedenfalls vorstellbar, außerdem könnte es sich auch hier um ein Oxymoron handeln. Doch bleibt die Stelle wegen der Unsicherheit der Lesung (das çt könnte auch zu einem vorangegangenen Wort gehören, πτερορ Gen. zu πτερόν sein) für die Beweisführung besser außer Betracht. Es zeigt sich also, daß Aischylos an mindestens 3 Stellen απτερος eindeutig in der eigentlichen Bedeutung ,ohne Gefieder, ohne Flügel' verwendet. Nun steht außer Zweifel, daß Aischylos a) άπτερος innerhalb der Verbindung απτερος φάτις im Gegensatz zu den soeben behandelten Stellen nicht eigentlich meint, b) die weiter oben besprochenen Homerstellen kannte 20 . Das aber bedeutet, daß er απτερος in der homerischen Wendung τη δ' απτερος επλετο μΰθος als Metapher verstanden und die Junktur άπτερος φάτις als Variation zum homerischen άπτερος μΰθος gebildet haben muß, - wobei er lediglich μΰθος durch das Synonym φάτις ersetzte. Dieser Schluß läßt sich, wie es scheint, durch die Interpretation des Kontextes von Agam. 276 als richtig erweisen; zugleich führt diese Interpretation zu einem besseren Verständnis der Szene. Mette (Der verlorene Aischylos, Berlin 1963, S. 196) übersetzt hier: „sie, die stummen .Tauben' (.Pleiaden')". Aber die Bedeutung .stumm' für απτεροι, wohl ebenfalls aus den Homerstellen erschlossen, würde hier dem Wortspiel die Pointe nehmen. [Korr.-Zus.: S. jetzt auch Lesky, AfdA 20,1967, 105]. 20 Gesetzt, er hätte sie nicht gekannt und άπτερος in der eigentlichen Bedeutung .ungeflügelt' selbst gebildet, so hätte er dieses Wort nicht an drei Stellen in dieser eigentlichen Bedeutung, in Agam. 276 aber in so völlig abweichenden Bedeutungen wie .schnell' (Fraenkel) oder .erfreulich' (van der Valk) verwenden können. Auch für diese Bedeutungen hätte er also ein Vorbild haben müssen. Ein solches nicht überliefertes Vorbild anzusetzen ist aber überflüssig, da in άπτερος μΰθος eines existiert.
618
απιερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
Der Wächter hat Klytaimestra die langersehnte Kunde von Trojas Fall übermittelt. Sie hat Freudenopfer dargebracht. Der Chor der Greise zieht ein, voller Erwartung: was hat das alles zu bedeuten ? 85 τί χρέος; τί νέον; τί δ' έπαισθομένη τίνος αγγελίας πειθόι περίπεμπτα θυοσκεις; Ist tatsächlich eine Nachricht eingetroffen, oder sind es wieder nur leere Hoffnungen der Königin? 261
συ δ' ε'ί τι κεδνόν είτε μή πεπυσμένη εύαγγέλοισιν έλπίσιν θυηπολείς, κλύοιμ' αν εϋφρων ούδέ σιγώση φθόνος. I 41 Da beginnt Klytaimestra zu reden. Nach kurzer Einleitung stellt sie lapidar fest: 267
Πριάμου γαρ ήρήκασιν Άργείοι πόλιν.
Der Chorführer ist dermaßen verblüfft, daß er für einen Moment vergißt, mit wem er spricht21: 268
πώς φής;
und sofort, sich fassend und zurücknehmend: πέφευγε τοϋποςέξ α π ι σ τ ί α ς . Damit ist das Stichwort für die folgende Stichomythie gefallen. Mag Klytaimestra auch die Königin sein - sie ist eine Frau, und die Skepsis des Chores gegenüber jeglichem ,Weiberwahn' ist groß (vgl. seine verächtlichen Worte in V. 483 ff.). Woher will sie allein die Kunde haben? Ist sie nicht das Opfer trügerischer Phantasien geworden ? 272
Xo. τί γαρ τό πιστόν; εστι τώνδέ σοι τέκμαρ; Κλ. εστίν τί δ' ουχί; μή δολωσαντος θεοΰ. Χο. πότερα δ' ονείρων φάσματ' εύπειθη σέβεις; Fraenkel hat bereits auf die Schärfe dieser Fragen des Chorführers aufmerksam gemacht (Groeneboom sagt z. St.: ,,τί γαρ τό πιστόν; - ,wat is het eigenlijk, dat u vertrouwen geeft': daraan sluit zieh passend de tweede vraag aan ,hebt ge een bewijs voor wat ge zegt' [wat bijna als een verhoor klinkt]"). Diese Schärfe wird von Klytaimestra in ihrer Erwiderung noch gesteigert: 275 ού δόξαν äv λάκοιμι βριζούσης φρενός. Und darauf nun der Chor: Siehe Groeneboom z. St.
άπτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
276
619
άλλ' ή σ' έπίανέν τις άπτερος φάτις;
worauf Klytaimestra, noch gereizter, repliziert: 277
παιδός νέας ώς κάρτ' έμωμήσω φρένας.
Die gesteigerte Gereiztheit dieser Replik verrät deutlich, daß es das απτερος φάτις des Chorführers ist, was Klytaimestra auf das äußerste provoziert hat (Denniston-Page, Aesch. Agam., Oxford 1957, z. St.: „in the present passage the meaning is uncertain. Clytemnestra's reply shows that the Chorus had used uncomplimentary language"; noch deutlicher Annuendola, Eschilo, Agamennone, Firenze 1955, z. St.: „il tono tra ironico e riprensivo della nuova I domanda è ri- 42 sentito da Clitemnestra, che soggiunge come punta: παιδός ... φρένας"). Die Frage des Verses 276 muß also eine Steigerung der Schärfe gegenüber der Frage des Verses 274 bedeuten. Diese Steigerung sahen die Erklärer bisher fast ausnahmslos in φάτις ausgedrückt: φάτις bedeute hier ,Gerücht', απτερος bedeute ,schnell' (swift-sped rumour, Fraenkel) oder .erfreulich' (pleasant rumour, van der Valk). Der Chorführer würde also fragen: ,Ah! So hat dich ein erfreuliches (schnelles) Gerücht so froh gemacht?' - Könnte aber diese Frage die verzweifelt-gereizte Antwort παιδός νέας ώς κάρτ' έμωμήσω φρένας wirklich erklären? παιδός νέας ώς und φρένας deuten darauf hin, daß Klytaimestra aus der Frage einen Zweifel an ihrer Vernünftigkeit heraushört - ein .erfreuliches' oder .schnelles Gerücht' wäre aber gegenüber den ,leicht-überredenden Traumerscheinungen' des Verses 274 sogar eine Informationsquelle höheren Wahrscheinlichkeitsgehalts; hätte άπτερος φάτις wirklich diese Bedeutung, müßte also Klytaimestra eher aufatmend antworten: ,Nun endlich kommst du der Sache näher!' Entscheidend aber ist, daß diese Auffassung von άπτερος φάτις sprachlich nicht zu rechtfertigen ist: (1) άπτερος bedeutet, wie gezeigt, weder bei Aischylos .schnell', .erfreulich' oder was auch immer, sondern stets ,ungeflügelt', noch hat es irgendwo sonst in der griech. Literatur diese Bedeutungen (s. u. S. 623 Anm. 26), (2) φάτις bedeutet durchaus nicht schon als solches das ,Gerücht', sondern ist von Natur aus wertneutral und bedeutet gerade bei Aischylos so verschiedenes wie .Äußerung, Mitteilung, Sprache, Name, Kunde, Botschaft', kurz: alles .Gesagte'. Demnach muß der Fehler der bisherigen Erklärungsversuche in einer falschen Akzentverteilung liegen: da man das Provozierende der Frage in φάτις sah, mußte φάτις die negative Bedeutung .Gerücht' haben. Die Vermutung, daß gerade darin der Fehler bestand, bestätigt sich, wenn man versuchsweise annimmt,
620
άπτερος μΰθος - άπτερος φάχις: ungeflügelte Worte?
φάτις stände allein da. Dann verstünde Klytaimestra (die doch auf ein Entgegenkommen des Chores geradezu wartet), endlich befreit von dem Zwang zu überzeugen, schnell:, Ah! So hat dich wirklich eine Kunde erreicht?' und würde dies natürlich hastig bejahen, denn eine Kunde war es ja in der Tat, was sie erfreut hat. Betont kann also nicht φάτις sein, betont sein muß απτερος, - und άπτερος muß eine »negative' Bedeutung haben, und zwar eine in solchem Grade 43 negative Bedeutung, daß sie Klytaimestras empörte und gereizte I Antwort motiviert. Zugleich muß aber άπτερος eine Bedeutung haben, welche die vom Chorführer gestellte Frage so absurd klingen läßt, daß sie einem vernünftigen erwachsenen Menschen im Ernst gar nicht gestellt werden kann - es sei denn in der Absicht, diesen Menschen eben durch diese Frage ironisch zum Kind zu degradieren. Nur dann kann Klytaimestra, die Absicht der Frage erfassend (παιδός νέας ώς), eine ebenso unsachliche Antwort geben. Mit anderen Worten: die Frage des Chorführers V. 276 muß auf eine Möglichkeit anspielen, an die der Chor im Ernst selbst nicht glaubt22, weil sie dem Bewußtseinszustand einer erwachsenen Frau und Königin nicht angemessen ist, die er aber, immer weiter fortgerissen durch die zunehmende Schärfe des Wortgefechts, trotzdem ausspricht und die durch seine übergroße απιστία und durch seine Verachtung weiblichen Geredes motiviert ist. Alle diese Anforderungen kann άπτερος nur erfüllen, wenn es, wie an den Homerstellen, hier begrifflich soviel wie .unausgesprochen, stumm' bedeutet. Unterstellt der Chor in V. 274 der Frau, sie hänge ονείρων φάσματ' εύπειθη an, ,leicht-überredenden Traumerscheinungen', und soll V. 276 eine geradezu absurd-ironische Steigerung dieser Unterstellung bringen, so kann απτερος φάτις nur eine .nicht durch Worte vermittelte Botschaft' bezeichnen, es muß also ,stumme Botschaft' bedeuten. Das ist absurd, aber eben als Steigerung durchaus sinnvoll (und liegt als Oxymoron, wenn auch in anderer Weise, auf einer Linie mit den oben angeführten Paradoxa). Der Chorführer fragt also ironisch: 276 ,Ah! So hat dich eine stumme Botschaft wohl so aufgebläht ?' Der Hintergrund der Situation macht nicht nur den guten Sinn dieser Frage, sondern auch ihre kunstvolle Tiefgründigkeit verständlich: Ein Bote kann nicht von Troja gekommen sein. Er wäre nicht unbemerkt geblieben; und wenn, so hätte die Königin ihn jedenfalls sofort als Beweismittel ausgespielt. Also müßte sie 22 Siehe Fraenkel zu άλλ' ή: „Commonly used in .statements or hypotheses to which the speaker wishes to represent himself as driven rather against his will, as if they alone were possible' (Conington on Cho. 774)". S. auch Denniston, Particles 27: άλλ' ή oft ironisch protestierend.
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
621
auf anderem Wege die Kunde erhalten haben. Auf welchem aber? Der Chor kann sich mit Recht keinen anderen vorstellen. Seine Fragen sind daher von Anfang an von άπιστία geleitet: allenfalls übernatürliche Wege erscheinen ihm denkbar. Ein Traum - das wäre eine zwar nicht beweiskräftige, aber noch immerhin akzeptable I Möglichkeit. Als Klytaimestra auch dies verneint, verliert er 44 jede Zuversicht und verfällt in bitteren Hohn: Je nun! Dann vielleicht eine Kunde, die nie ausgesprochen wurde, eine stumme Botschaft - eine Ahnung etwa? 23 Es ist unerheblich, was mit dieser , stummen Botschaft' von Aischylos im einzelnen gemeint gewesen sein mag (eine Ahnung, eine Vision, eine göttliche Inspiration: in einer Tragödie, die auf weite Strecken von Visionen lebt, kann ein solcher Ausdruck nicht verwunderlich erscheinen) - : die Reaktion Klytaimestras wird jetzt jedenfalls voll verständlich: die ironische Unterstellung, ihr Wissen gründe sich auf Irrationales, muß sie um so härter treffen, als sie sich als die von allem Anfang an rational Planende weiß; im Wissen um die in Wahrheit höchste Rationalität des von ihr selbst ersonnenen Informationsweges: der Feuerbotschaft, kann sie den degradierend ironischen Zweifel des Chorführers an ihrer σωφροσύνη (vgl. V. 351) nur als äußerste Provokation empfinden. So hat sie auf die ironisch-unsachliche Frage des Chorführers nur die ebenso unsachliche, gereizte Antwort παιδός νέας ώς κάρτ' έμωμήσω φρένας. Der Chorführer versteht, daß er offenbar zu weit gegangen ist, bricht, immer noch leicht ironisch24, das Spiel ab und kommt zur Sache selbst: 278 ποίου χρόνου δέ καί πεπόρθηται πόλις; Damit ist aber die Interpretation noch nicht vollständig. Das Gewicht des Wortes απτερος ist, wie es scheint, noch größer, seine Funktion ist noch hintergründiger: Es ist bekannt, daß nicht nur ganze Aussagen, sondern auch einzelne Wörter bei Aischylos häufig doppelsinnig sind. So etwa gleich das Partizip έλπίζον in Agam. 11: die Hoffnung Klytaimestras, die der Wächter meint, ist die
Paley, Kennedy und Verrall (zitiert bei Groeneboom z. St.) glossierten απτερος φάτις mit ,a vague presentiment'; Murray kam der Lösung noch näher, wenn er in den Apparat seiner Ausgabe setzte: ,,απτερος] rumor indictus, h.e. praesagitio". 24 Siehe Denniston-Page z. St.: „ποίου signifies contempt, impatience"; ähnlich Groeneboom z. St. - Die ganze Szene erscheint übrigens als kunstvolle Umkehrung der Szene ψ 1 ff.: bei Homer wehrt sich die Gattin gegen den Sog der betörend frohen Kunde, hier der Chor. Auch bei Homer zweifelt der ungläubige Partner (Penelope) an der σαοφροσύνη des gläubigen (Eurykleia). Die Umkehrung dient bei Aisch. auf hintergründige Weise der Charakterisierung Klytaimestras.
622
απτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
45 .gewöhnliche' der wartenden Frau25, dem Hörer jedoch wird nahegelegt, I diese Hoffnung Klytaimestras anders zu beziehen. Der Wächter weiß nicht, wie wahr er in einem höheren Sinne spricht. Ähnlich άπτερος: das gleiche Wort, das in V. 276 mit απτερος näher bestimmt wird, fällt bereits in V. 9: φάτις. Der Wächter sagt dort: και νυν φυλάσσω λαμπάδος το σύμβολον, αύγήν πυρός - φερουσαν έκ Τροίας φάτιν ... Die Botschaft, auf die der Wächter wartet, besteht im Feuerstrahl, in der Fackelkette - und dies ist nun tatsächlich eine άπτερος φάτις, eine nicht durch Worte vermittelte, eine lautlose, eine stumme Botschaft. So hat also der Chorführer in V. 276 mit seiner ironischen Frage ,Ah! So hat dich eine stumme Botschaft wohl so aufgebläht?' unbewußt den wahren Sachverhalt ausgesprochen. Der Hörer aber soll offenbar diesen Doppelsinn erfassen. Warum sonst läßt Aischylos den Chor in V. 489 sagen: „Bald werden wir wissen, ob es mit der Fackelkette etwas auf sich hatte, oder ob dieses funkelnde Licht die Sinne nur getäuscht hat: ich sehe den Boten schon; der Staub bezeugt, ώ ς ο ύ κ α ν α υ δ ο ς οΰτος, ού δαίων φλόγα ϋλης όρείας, σημάνει καπνω πυρός, ά λ λ ' ή τ ό χ α ί ρ ε ι ν μ ά λ λ ο ν έ κ β ά ξ ε ι λ έ γ ω ν ... Dieser Bote wird nicht άναυδος, stumm, mit Feuer Zeichen geben, er wird reden. Nicht auf eine άπτερος φάτις - so scheint es Aischylos zu meinen - wird man angewiesen bleiben, sondern επεα πτερόεντα werden nun ertönen. So ist also der Ausdruck άπτερος φάτις in doppeltem Sinne ironisch, anders im Sinne des Chores, anders im Sinne des Dichters, άπτερος erweist sich als tragender Begriff, dessen Erhellung ein besseres Verständnis der ersten Stichomythie und ihres Beziehungsreichtums ermöglicht. Ist diese Deutung richtig, so stützt sie zugleich auch die oben vorgelegte Interpretation der Odyssee-Stellen: Hat Aischylos das Wort άπτερος, das er in anderen Verbindungen in der etymologisch .richtigen' Bedeutung .ungefiedert' = .ungeflügelt' gebraucht, hier in Agam. 276 innerhalb der Junktur άπτερος φάτις als .unausgesprochen, stumm, lautlos' verwendet, so muß er άπτερος in der sinnverwandten Junktur άπτερος μΰθος bei Homer ebenfalls als .unausgesprochen' aufgefaßt haben: sonst müßte άπτερος φάτις, analog den drei anderen Aischylosbelegen, .ungeflügelte Kunde' bedeuten, und das wäre ebenso unver25 Siehe Schneidewin, Aesch. Agam., Berlin 1856, z. St. Anders interpretieren den Doppelsinn Groeneboom und Ammendola z. St.
άπτερος μΰθος - άπτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
623
ständlich wie ohne Pointe; denn die Feuerlbotschaft war ja gerade wie auf Flügeln von Bergkuppe zu Bergkuppe .geflogen' (vgl. V. 281 ff.). Hat aber Aischylos den Ausdruck άπτερος ... μΰθος bei Homer als Bild verstanden, und zwar im selben Sinne, wie er sich oben für Homer unabhängig von Aischylos' Homerverständnis als höchst wahrscheinlich ergab, dann darf der mit Homer aufs beste vertraute Dichter als Bürge für die Richtigkeit der oben vorgetragenen Interpretation der Odyssee-Stellen gelten; die viel späteren Erklärungsversuche in den Odyssee-Scholien oder gar im Etymologicum Magnum verdienen demgegenüber keinen Glauben26.1 26
Die Angabe der sch. M 2 M 4 , sch. vulg., schol. Barn, zu ρ 57, άπτερος bedeute ταχύς oder έτοιμος, ist wahrscheinlich Folge einer Vermengung der Wörter άπτερος und άπτερέως. Das umstrittene άπτερέως in Hes. fr. 204,84M.-W. (= 96,46 Rz. 3 ): τον δ' (Helenas Freier) άπτερέως έπίθοντο (aufgenommen von Parm. fr. 1,15, dann wieder von Ap. Rh. 4,1765 und von Eudoc. Cypr. 1,24. 202) sollte jedenfalls für die Interpretation der Homerstellen besser außer Betracht bleiben. Van der Valk (a. a. O. 62) möchte die Bed. dieses άπτερέως mit der auch von ihm für άπτερος ρ 57 usw. angesetzten Bed. ,unwinged' gern in Übereinstimmung bringen und paraphrasiert die Hesiod-Stelle: „the suitors ... obeyed without comment. When Tyndareos had spoken, they did not deliver any επεα πτερόεντα, but obeyed". Diese Auffassung kann nicht richtig sein: in V. 78 ff. heißt es: „Tyndareos forderte von allen Freiern glaubwürdige Eide (ορκια πιστά) und befahl ihnen zu schwören und vertragsgültig zu bekräftigen, daß sie ..." Tyndareos' Forderung bezweckt ein Reden, also können doch die Freier nicht .wortlos' gehorchen. τοί δ' άπτερέως έπίθοντο muß also bedeuten: .die aber gehorchten sofort', d.h. sie leisteten den Schwur. - Am besten läßt sich άπτερέως wohl mit,flugs' wiedergeben (so auch Frisk, GrEW I 126), das im Deutschen einem ähnlichen Wortfeld entstammt. Auch an allen anderen oben zitierten Stellen kann άπτερέως nur ,flugs' o. dgl. bedeuten. Dagegen bedeutet das Adj. άπτερος an sämtlichen von den Lexika angegebenen Stellen ,ohne Federn (Gefieder)' bzw. ,ohne Flügel': Aesch. s. o. - Eurip. s. o., dazu noch Here. F. 1039 (von Vogeljungen) - Hdt. 7,92 (von Pfeilen) - Plat. Phaedr. 256 d (Gegensatz: ύπόπτεροι); Def. 415 a (άνθρωπος ζψον άπτερον) - Aristot. HA 523 b 17 und PA 642 b 33 (von Insekten, Gegensatz: πτερωτά) - bei Pausanias stets von der Nike Apteros (= Athena Nike, s. Roscher ΠΙ 1, Sp. 310. 315 ff.): 1,22,4; 2,30,2; 3,15,7 (~ ούκ όντων πτερών); 5,26,6 ( - ούκ εχουσαν πτερά) - Α. Ρ. 9,647,2 (ebenfalls von der Nike Apteros) - A. P. 5,174,2 (vom Liebenden, der sich der Geliebten auf die Lider legen möchte als άπτερος "Υπνος, vgl. o. S. 39, Ziffer 2) - Nonn. Dionys. 4,87 und 35,239 (von Hermes, wenn er entweder in Menschengestalt oder in Gestalt des Dionysos auftritt); 47,658 (von Dionysos selbst, der sich άπτερος, .obwohl ungeflügelt', im Kampfe höher emporreckt als der geflügelte Perseus). Nicht ganz sicher ist die Bed. in Triph. 85 (das hölzerne Pferd sieht so lebensvoll aus, als wolle es sich zu einem άπτερος δρόμος in Bewegung setzen), wo Passow 18415 s. ν. άπτερος nach dem Triphiodor-Herausgeber Wernicke mit ,Lauf ohne Flügel' erklärt (die Wendung wäre dann allenfalls unter die oben S. 617 Ziffer 2 aufgeführten Beispiele einzureihen); aber άπτερον ist hier nur v. 1. für εύπτερον (das Mair in seiner Ausgabe des Oppian, Kolluthos und Triphiodor, London 1958, in den Text setzt). Es bleibt noch die von Pollux 9,152 mit ταχέως, ώς τάχιστα, έν τάχει usw. gleichgesetzte Fügung άπτέρφ τάχει, die Nauck als Trag. Adesp. 429 aufgenommen hat: die Fügung steht nicht in den Hss., sondern nur in der ed. pr., es ist eine byzantinische Wendung, vgl. Nauck z. St. und Wilamowitz, Kl.
624 47
απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte?
Hat d e m n a c h schließlich der Dichter der Odyssee-Stellen in der Tat zu π τ ε ρ ό ε ι ς den Gegensatz α π τ ε ρ ο ς in der Bedeutung u n a u s g e s p r o c h e n ' gebildet ( w o r a u f nun alles hindeutet), dann hat er auch ε π ε α π τ ε ρ ό ε ν τ α als ,(laut) ausgesproc h e n e W o r t e ' verstanden. Die eingangs vorgelegte Deutung von ε π ε α π τ ε ρ ό ε ν τ α w ä r e damit a m E n d e als richtig erwiesen.
Sehr. 1, 195 (Hinweis von Prof. Snell); es kann sich dabei um ein ursprüngliches Oxymoron handeln (,mit flügelloser Schnelligkeit') wie bei απτερα πωτήματα Aesch. Eum. 250 (oben S. 617). Der Tatbestand ist demnach eindeutig: άπτερος bedeutet nirgends nachweislich etwas anderes als .ungefiedert' oder ,ungeflügelt', άπτερέως (und άπτέρως Lyc. Alex. 627) nirgends etwas anderes als ,flugs'. Danach wäre Frisk (GrEW I 126) zuzustimmen, wenn er άπτερος und άπτερέως morphologisch voneinander scheidet und für άπτερέως Entstehung aus a-copulativum + πτερόν ansetzt. Die antike Glossographie hat dann offenbar beides miteinander vermengt. Daß dagegen άπτερέως in der Bed.,flugs' auf eine Fehlinterpretation der Homerstellen durch Hesiod zurückgehe (also ρ 57 gewissermaßen den ,Leumannschen Punkt' darstelle; in diesem Sinne z . B . E.C. Yorke, CQ 30, 1936, 151 f.), ist, wenn auch nicht auszuschließen, weniger wahrscheinlich.
Kratylos 31,1986,110-125
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer Kurt, Christoph: Seemännische Fachausdrücke bei Homer. Unter Berücksichtigung Hesiods und der Lyriker bis Bakchylides. Göttingen, Vandenhoeck& Ruprecht, 1979, gr.-8°, XV, 239 S. (Ergänzungshefte zur Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung, 28.) Brosch. 52 DM.
Die Griechen waren ein seefahrendes Volk. Was das bedeutet, vermag ein Binnenländer kaum zu erfassen. Das halbe Leben spielte sich direkt oder indirekt (durch Verwandte, Freunde oder einfach durch die Zugehörigkeit zur Polis) auf dem Wasser, und das heißt: auf Schiffen, I ab. Seit ihrer Ankunft auf der Balkanhalbinsel waren die Griechen infolge der natürlichen Bedingungen ihres Lebensraumes (erschwerter Landverkehr, Meersicht von fast jedem erhöhten Landpunkt aus, Inselfülle) zur See hin orientiert. Bereits in ihrer ersten Aufschwungsperiode, die wir die mykenische nennen, richteten sie ihre Burgen zum Meer hin aus, trieben Seehandel und legten überseeische Stützpunkte an (Milet; 1. Kolonisation Kleinasiens, s. Hiller/Panagl 325), okkupierten eine ganze fremde Kultur, die minoische von Kreta, zu Schiffe und führten Flottenexpeditionen durch, die eindrucksvoll genug waren, um in Sage und Dichtung nie vergessene Spuren zu hinterlassen (Argonautensage, Ilias). Zu Schiffe scheint sich das Schicksal zumindest eines Teiles der mykenischen Kultur schließlich auch erfüllt zu haben (s. die pylischen ofca-Täfelchen, dazu Hiller/Panagl 326-328). Nach der Zwischenzeit der sog. Dunklen Jahrhunderte - die z. Z. von Jahr zu Jahr heller werden und die jedenfalls die Kontinuität nicht nur der Sprache, sondern auch der wichtigsten Kulturtechniken wie der des Schiffsbaus wahrten gründete sich der zweite große Aufschwung, die sog. Renaissance des 8. Jh.s, auf eine ökonomische Hausse, die wesentlich auf der Schiffahrt beruhte (verstärkte Kommunikation, Konjunktur des nationalen und internationalen Seehandels, Kolonisation). Gehalten und gefestigt endlich wurde die zwischen 800 und 500 erreichte Kulturhöhe durch eine Seeschlacht (Salamis). Ein maritimes Engagement von diesem Ausmaß muß sich in der Sprache eines Volkes niederschlagen. Schon das mykenische Griechisch ist voll von nauti-
626
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
schem Vokabular (das überwiegend bedeutungsgleich weiterlebte). In der Sprache des 8. und 7. Jh.s, die wir in der Spiegelung der frühgriechischen Dichtung fassen, war der Anteil des Nautischen - in fachsprachlicher, aber auch in metaphorischer Funktion - augenscheinlich nicht geringer. Die entstehende Literatur hat ihn eher noch erhöht: die Ilias hat zu ihrem Hintergrund eine gemeingriechische Übersee-Expedition (und im Kampf um Troja, den sie zeichnet, sind allen stets die Schiffe gegenwärtig), die Odyssee präsentiert sich in der Gestalt einer Seefahrergeschichte (Schiffe, Häfen, Seehandel, Navigation; ein ganzes , Seevolk' mit sprechend nautischen Eigennamen wie Nausikaa, Nausithoos, Anchialos, Eretmeus usw. - die Phaiaken - prägt ihre Handlung), Hesiods Loblied auf das Bauernleben (Erga kai Hemerai) bezieht seinen Überzeugungseifer nicht zuletzt aus der Antipathie des Verfassers gegen die Seefahrt (sie ist für ihn die andere Lebensform), und unter den Lyrikern reden manche vom Meer und von den Schiffen fast mehr als vom Lande (Archilochos, Alkaios) oder zeigen einen ausgeprägten Hang zu nautischen Metaphern (Pindar). Vor diesem Hintergrund betrachtet (den der Verf. selbst nicht aufbaut), ver112 dient eine Arbeit über Schiff und Schiffahrt in der frühgrielchischen Dichtung, die sich die Bedeutungsbestimmung der nautischen Termini zum Ziele setzt, die Aufmerksamkeit nicht nur des Sprachwissenschaftlers, sondern auch des Philologen, des Archäologen, des Althistorikers und schließlich des Kulturgeschichtlers. Dies um so mehr, wenn sie etwas zu sagen weiß. Das ist hier der Fall. Diese ursprünglich bereits 1975 eingereichte, von Emst Risch betreute Zürcher Dissertation festigt und vermehrt unser Wissen ganz beträchtlich. Die Entwicklung der griechischen Sprachwissenschaft einerseits (vor allem die Entschlüsselung von Linear B), der stürmische Aufschwung der Ausgrabungsarchäologie andererseits (und hier besonders der Unterwasser-Archäologie) haben frühere Arbeiten zum Thema (Grashof 1834, Chantraine 1928, Hermann 1943) veralten lassen. Das in beiden Disziplinen stark angewachsene Material verlangt eigentlich nach einer Zusammenführung durch einen in beiden Disziplinen gleich gut bewanderten Forscher. Das ist freilich ein Ideal. Man kann nur versuchen, ihm möglichst nahe zu kommen. Auf archäologischer Seite sind in dieser Hinsicht bisher manche Wünsche offengeblieben. In den einschlägigen Arbeiten der letzten 15 Jahre, so fundierend und respektabel sie auch sind (Morrison - Williams 1968, Casson 1971. 31973, Gray 1974), erfolgt die Zuordnung der in den Texten vorgefundenen nautischen Wörter zu den in den Monumenten (Vasenbilder, Kleinkunst, Fresken, Schiffswracks - das 1984 entdeckte Wrack von Kas wird weitere Aufschlüsse bringen) vorgefundenen nautischen Sachen ganz überwiegend nach technisch-funktionalen Gesichtspunkten;
Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdriicke bei Homer, Göttingen 1979
627
die sprachlichen Indizien (Wortgebrauch, Wortbildung, Etymologie), die eine archäologische Hypothese stützen oder widerlegen könnten, bleiben in der Regel ungenutzt (oft wird durch dilettierende Verwertung sogar Schaden angerichtet). Die Doppel- oder gar Dreifachkompetenz (Archäologie, Sprachwissenschaft, Philologie), die gemäß der methodisch optimalen Zielsetzung eines Unternehmens wie der .Archaeologia Homérica' von den archäologischen Bearbeitern der Einzelgebiete aufzubringen wäre, ist in der Realität nun einmal kaum anzutreffen. Wenn daher einer archäologisch so soliden Themabearbeitung, wie es Miss Grays »Seewesen' innerhalb der .Archaeologia Homérica' ist, ein sprachwissenschaftlich so solides Gegenstück wie K.s .Seemännische Fachausdrücke' zur Seite tritt, so ist das ein Glücksfall. Der Verlag hat recht daran getan, beide Werke herauszubringen. Unabhängig voneinander entstanden1 I (K., VI), ergän- 113 zen sie sich so glücklich, daß im folgenden bei der Besprechung der von K. erzielten Ergebnisse Grays Ergebnisse zweckmäßigerweise immer mitherangezogen werden. K.s Untersuchung setzt sich aus einem diachronischen und einem synchronischen Teil zusammen. - Der synchronische Teil behandelt auf 191 Seiten (27— 217) 154 Wörter (Gray nur 93), wobei fast jedes Wort (außer morphologisch eng verwandten Komposita) einen eigenen Abschnitt erhält. Im Aufbau lehnen sich die Abschnitte an das Lexikon des frühgriechischen Epos an (ohne daß das erwähnt würde: das Vorbild ist selbstverständlich geworden): In der , Vollform' (z.B. πρύμνη, 108-110) folgen innerhalb des Abschnitts aufeinander: (1) allgemeine Bemerkungen zu Frequenz, Gebrauchsweise und Stellung in der Wortfamilie, (2) Position im Vers (mit metrischem Schema und Aufzählung aller Belegstellen), (3) Wortbildung (mit regelmäßigen Verweisen auf die Standardwerke wie Risch, Chantraine, Benveniste, Fraenkel usw.), (4) Etymologie (regelmäßige Verweise auf Frisk und DELG), (5) Bedeutungsbestimmung (unter Anwendung aller förderlich erscheinenden Methoden; besonders lobenswert die stetige Berücksichtigung der archäologischen Gegebenheiten sowie der gesamten Wortgeschichte von Linear Β bis in die späte Kaiserzeit), (6) Skizze des Wortgebrauchs in der späteren Literatur (außerhalb des von K. thematisierten Textcorpus). Je nach Materiallage können die Abschnitte entweder zu ' Man darf allerdings fragen, warum K. (wenn er schon keinen Kontakt zu Gray hatte, obwohl deren Arbeit seit 1968 im Verlagsprospekt angekündigt war) nach dem Erscheinen des Gray-Faszikels 1974 weder bis zur Einreichung der Diss, „im Juni 1975" (Κ., IV) noch - mirabile dictu - bis zur Buchveröffentlichung Herbst/Winter 1979 den Versuch einer Einarbeitung der Grayschen Ergebnisse gemacht hat. Vielleicht könnte er wenigstens jetzt noch - in Aufsatzform - die Auseinandersetzung nachholen.
628
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
.Schwundstufen' zusammenschrumpfen oder sich zu .Dehnstufen' ausweiten (z.B. ϊκρια 128-132). - Der diachronische Teil (den K. an den Anfang gestellt hat) zieht auf 20 Seiten (3-24) die Folgerungen, die sich aus den Wort-Analysen für die Sache ergeben; so entsteht eine „Geschichte des ägäisch-griechischen Schiffes vom 3. Jahrtausend bis ca. 500 v. Chr.", mit der Gliederung: Allgemeines - Das ägäische Einbaumschiff - Das minoische Schiff - Das mykenische Schiff - Das geometrische Schiff - Das archaische Schiff - Das griechische Handelsschiff; zusätzlich: Die Konstruktion des griechischen Schiffes - Die σχεδίη des Odysseus. Am Schluß stehen eine sprachwissenschaftliche Zusammenfassung (219-223), ein erklärendes Verzeichnis der verwendeten deutschen Fachausdrücke (sehr nützlich, leider unvollständig) sowie ein Index der behandelten griechischen Wörter (ebenfalls unvollständig: εΰορμος, πάνορμος fehlen ganz - sie sind behandelt S. 190 - , nur unter ihrem Hinterglied aufgeführt und daher für Nicht-Insider schwer zu finden sind die Komposita αίολόπρυμνος 65, δολιχήρετμος 70, έκατόζυγος 67, έν(ν)άλιος 97, έπήρετμος 69, έύζυγος 67, εύήρης 137, εΰπρυμνος 65, έύσσελμος 66, κυανόπρωιρος 57, λεπτόπρυμνος 65, μιλτοπάρηιος 60, πολύγομφος 57, πολύδεσμος 81, πολύζυγος 67, πολυκλήϊς [sic] 68, πρωτόπλοος 55, φερέζυγος 68, φοινικοπάρηιος 60, χαλκεό114 γομφος 97, ώκύπορος 51). Ein Stellenindex fehlt I leider. Den Abschluß bildet eine Schiffsmodell-Skizze (239; zu vergleichen mit der Skizze von W. zu Mondfeld bei Gray 152; K.s Skizze ist instruktiver). Den Hauptteil bilden die Wortanalysen. Die schiffsbaugeschichtlichen Folgerungen des 1. Teils ebenso wie die Skizze basieren auf diesen Analysen. Daher konzentriere ich mich im folgenden auf sie. Dabei übernehme ich aber nicht die Reihenfolge des Verf.s, der - völlig sachangemessen - dem technischen Aufbau des Schiffes folgt (also: Das Schiff als ganzes und seine Epitheta - Die Einzelteile des Schiffes: Rumpf, Riemenantrieb und Steuerung, Takelage, Schiffsgeräte und Fracht - Hafen - Schiffsbauwerkzeuge - Mannschaft), sondern ich ordne meine Bemerkungen nach den von K. behandelten Wörtern alphabetisch an. Damit hoffe ich das Buch - das ja eine Art Lexikon-Ergänzung darstellt über die rein sprachwissenschaftliche Besprechung hinaus auch für Philologen, Archäologen und Historiker ein wenig aufzuschließen. Natürlich kann in diesem Rahmen nur Wichtigeres erörtert werden; nicht bei allen Wörtern, zu denen im folgenden nichts gesagt wird, sind K.s Behandlung und vor allem sein Bedeutungsansatz nach meiner Ansicht über jeden Zweifel erhaben. Vorab ein paar kritische Bemerkungen zu einer grundsätzlichen Schwäche des Buches, der m. E. überholten Auffassung der epischen Epitheta (hinter der
Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdriicke bei Homer, Göttingen 1979
629
eine unzureichende Kenntnis der neueren Entwicklungen in der Homerforschung stehen dürfte). Ich gehe von einem konkreten Beispiel aus: Zu κοίλος ,gewölbt' (vgl. lat. cavus ) stellt K. (3537) fest, das Epitheton werde von Homer „fast nur auf aufliegende, d. h. vollständig auf das Land gezogene Schiffe" angewendet, allerdings gebe es unter den 40 Belegstellen fünf, an denen die mit κόίλαι bezeichneten Schiffe sich ganz gegen diese Regel auf hoher See befinden, diese .Ausnahmen' könne man jedoch damit erklären, daß hier Frachtschiffe gemeint seien, die ebenfalls sinnvoll,bauchig' genannt werden könnten. Dieser Beziehung - .bauchig' von außen, wenn aufgeschleppt, .bauchig' von innen, wenn vollbeladen dahinfahrend - sei sich der Dichter sogar bewußt, denn in Η 381 lasse er den Herold Idaios κοίλας έπί νηας gehen (da sind die νηες aufgeschleppt), und in Η 389 (also 8 Verse später) lasse er den gleichen Idaios sagen, Paris habe die in Sparta geraubten κτήματα übers Meer transportiert κοίληις ένί νηυσίν (und da bargen sie Ladung „im Bauch"). - Mit solchen Versuchen, Kontextsensitivität der Epitheta auch dort noch nachweisen zu wollen, wo der Epithetongebrauch deutlich nur durch Formel-Ökonomie bestimmt ist, sollte aufgehört werden. In Η 389 paßte zwischen dem konsonantisch endenden 'Αλέξανδρος und dem versschließenden ένν νηυσίν aus der Reihe der 34 von K. gesammelten Schiffsepitheta keine feminine Dativform außer κοίληις ins Versmaß; sachliche Erwägungen spielten also bei der Wahl von κοίλος an dieser Stelle keine Rolle. K. (28) erwähnt zwar M. Parrys Überblick über das epische Formelsystem, das νηΰς mit seinen diversen Epitheta bildet, hat aber das Prinzip, nach dem derartige Formelsysteme entstehen und operieren, offensichtlich nicht durchschaut. Parry hat gezeigt (112), daß von den 70 verschiedenen Flexionsformen der 23 homerischen Schiffsepitheta nur zwei (δολιχηρέτμοιο und I κυανοπρώιροιο) metrisch gegeneinander austauschbar sind. Die Epitheta befriedigen also metrische Bedürfnisse, semantisch sind sie (abgesehen davon, daß sie natürlich g r u n d s ä t z l i c h zu ,Schiff' passen müssen) an der jeweiligen Einzelstelle nicht funktional, sondern dekorativ (dazu jetzt ausführlich Paraskevaides, bes. 14-16). Wenn also νηΰς άμφιέλισσα in der Regel (wie es den Anschein hat; aber auch das ist vermutlich Zufall 2 ) „von aufgeschleppten [...] Schiffen gesagt" wird, in Ν 174 = O 549 aber von in Fahrt befindlichen, bedarf es nicht der gequälten Erklärung „die Schiffe sind erst richtig vor Troja angelangt, wenn sie an Land liegen" (41), sondern die Schiffe sind hier deswegen .beidseits rund', weil für die gegebene Versstelle keine andere Epithetonform als άμφιέλισσαι zur Verfügung stand; K.s Erklärungsversuch entspricht dem Homerscholiastengrundsatz ού κόσμου χάριν άλλά πρός τν; ihn hatte schon Aristarch mit ού τότε άλλά φύσει überwunden (zur ganzen Frage s. Homer, 244—251 ). Κ. hätte sich und dem Leser ganze Abschnitte ersparen können, wenn er sich mit diesem Systemcharakter des Epithetongebrauchs in der unseren Epen zugrundeliegenden oral poetry vertraut gemacht hätte. Denn leider führt diese Kenntnislücke folgerichtig auch zur Verwechslung von diachronischer und synchronischer Ebene in der Bedeutungsbestimmung. So wird etwa S. 35 für γλαφυρός (zu γλάφω < γλύφω .furchen') die üblicherweise angenommene Bedeutung .gewölbt, hohl' durch .gefurcht' „präzisiert" und geschlossen: „Das Epitheton γλαφυρός ist somit nicht einfach ein nichtssagendes Füllwort für bequeme Formeln, sondern ein Hinweis auf die (ursprüngliche) Bauweise des griechischen Schiffes" (K. meint den Einbaum). Da ist Etymologie mit Gebrauchswert verwechselt: für den Dichter ist νηι δ' έπί γλαφυρήι, νηας έπί γλαφυράς - [ u u l ] usw. nur eine Formel
2 Schiffe können sich naturgemäß immer nur entweder auf dem Wasser oder auf dem Land befinden; daß ihre regelmäßigen Epitheta sie zuweilen auf dem Land, zuweilen auf dem Wasser .antreffen', ist also pure Notwendigkeit.
630
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
zur Versifikationserleichterung; an die Etymologie denken er und seine Hörer bei γλαφυρός ebensowenig, wie wir beim Lesen der Schadewaldtschen Wiedergabe „zu den gewölbten Schiffen" an got. hvilftrjös ,Sarg' (= zwei ausgehöhlte Einbäume) denken. Zuweilen war K. schon kraft eigener Erkenntnis auf dem richtigen Wege (ζ. B. 50 zu θοός: „allgemeine Eigenschaft, die virtuell auch dem gerade stilliegenden [Schiff] eignet", vgl. 53 zu ποντοπόρος), doch die eingefahrene Denkweise gewinnt immer wieder die Oberhand. Von diesem Fehler ist Gray frei: „Der Gebrauch der Epitheta ist streng formelhaft" (96, im Anschluß an Alexanderson 1970, den auch K. zitiert; es folgt eine instruktive Tabelle); „Die Gruppe der Epitheta um ein Substantiv war eine metrische Notwendigkeit, nicht eine umfassende Beschreibung" (98).
Nur kurz sei erwähnt, daß die Ignorierung der Oral poetry-Forschung auch sonst zu Merkwürdigkeiten geführt hat: das Epitheton κυανόπρωιρος ,einen dunklen Bug habend' (3 mal Ilias, 10 mal Odyssee) soll erstmals in ι 539 gebildet worden sein (58) (der Iliasdichter hatte also offenbar die Odyssee gelesen); Formel- und aneinander anklingende Verse sind auf Schritt und Tritt „voneinander abhängig" (ζ. B. 58, 59); ähnliche Wendungen sind an einer Stelle „älter" als an einer anderen (z.B. 64); Bedeutungsbestimmungen brauchen auf bestimmte Belegstellen deshalb keine Rücksicht zu nehmen, weil diese in „jungen" Passa116 gen stehen (ebenfalls 64; „junge" Passagen sind z.B. die I Schildbeschreibung [64], die Telemachie [116], die Phaiakis [132]). Zwar kann eine allgemeine Abkehr von der analytischen Homerbetrachtung alten Typs ζ. Z. wohl noch nicht erwartet werden (s. aber immerhin schon Heubeck, Gymnasium 89, 1982, 405; vgl. Rez., Perspektiven der Gräzistik, Freiburg 1984), es sollte aber grundsätzlich klar sein, daß Arbeiten über das von den homerischen Epen gebildete Sprachcorpus sich methodisch nicht von den experimentellen Hypothesen der Analyse über die mutmaßliche Abfassungs-Chronologie von Einzelteilen dieser Literaturwerke abhängig machen dürfen, sondern daß sie allenfalls umgekehrt durch Etablierung objektiver Kriterien die Position einer Richt-Instanz anstreben sollten3. 3
Eine weitere (ein wenig peinliche) Schwäche liegt in der nicht gerade souveränen Beherrschung der deutschen Interpunktion und Grammatik sowie in sonstigen sprachlichen Unsauberkeiten, die gerade in einer sprachwissenschaftlichen Arbeit unangenehm auffallen; z.B. „Für ϊκρια als nautischem (sie) Fachausdruck ..." (129); „Parallel zur Bedeutungserweiterung und das (sie) Vordringen von κώπη ..." (139); völlig mißratene Satz-Ungeheuer S. 101, 109; stets wird „zu recht" statt „zu Recht" geschrieben; das (nomen) deminutivum ist für K. „der Deminutiv" (137); die „Année philologique" ist masculini generis (XV); Polyphem ist der „Kyklope" (204), und in der Wortbildungslehre treiben 165 u.ö. „aktive und passive Typen" ihr Unwesen, die man eher in der Disco-Szene vermuten würde. Besonders unschön aber ist, däß andauernd .bedeuten' und .heißen' verwechselt werden (eine Zapfenreihe kann sicherlich auf griechisch γόμφοι h e i ß e n , aber γόμφοι kann ,Zapfenreihe' m.E. nur b e d e u t e n , nicht .heißen'). Über vergessene Wörter und Buchstaben (die Arbeit ist als Typoskript verlegt) breiten wir den Mantel ganz besonderer christlicher Nächstenliebe.
Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer, Göttingen 1979
631
Wir kommen zur Besprechung der Einzelergebnisse. αγκοιναι: In Alk. Fr. 208 a 9 ist mit Bergk (nicht Unger, wie K. nach Page angibt) αγκοιναι (< *αγκον-ια zur Wz. *άγκ-) statt des überlieferten sinnlosen αγκυραι (das E.-M. Voigt im Text hält) zu lesen (168 f.). Die αγκοιναι, die hier χόλαισι ,sich lockern', sind die (als solche stets .gekrümmt' liegenden) Rahfallen (d. h. die zum Hochziehen und Herunterlassen der Rah dienenden Taue). Die Stelle besagt also: die Rah mitsamt dem Segel wird bald herunterkommen. Dadurch wird die Gesamtdeutung dieses Alkaiosliedfragments durch Rösler4 142-148 stark gestützt (wahrscheinlich ist der Sinn von V. 12/13: „die beiden Schothörner [= untere Enden des Segels] bleiben [noch] fest in den Tauen" - s. Κ. 168259 - , „und das ist auch das einzige, was mich noch bewahrt"). ακρα/άκρωτήριον: Ein Blick in Page, Sappho and Alcaeus (K. sonst durchaus vertraut), 267, hätte davor bewahrt, den Plural άκρα in Alk. Fr. 34,9 als eine „aus metrischen Gründen" gewählte Variante zu άκρωτήριον auszugeben und entsprechend mit der Bedeutung .Heckzier' zu belegen (115). Richtig Page: „the peaks of their [...] vessels": Alkaios meint das Elmsfeuer auf Masttopp und Takelage. - Mit Alkaios (und dem Äolischen) hat K. auch sonst Schwierigkeiten: in Alk. 326,6 soll das Wasser im Rumpf „so hoch wie" (119) der Mastkoker stehen; πέρ ... εχει ist aber natürlich das äolische Äquivalent I für att. υ π ε ρ έ χ ε ι (Hamm, Grammatik 111 mit Anm. 242); entsprechend übersetzt Page, Sappho and Alcaeus 186, richtig: „The bilge is up over the masthold". άλιεύς: schöne Beobachtung S. 213, daß .Fischer' eigentlich nicht in die heroische Welt des Epos hineingehören; wenn daher in ω 419 die Leichen der Freier von Fischern auf Booten heimgefahren werden, drückt das „die Verachtung den Freiern gegenüber" besonders deutlich aus (eine ähnlich gute Beobachtung zu Telemachs Selbstvergleich mit einem έμπορος, 215). άμφιέλισσα: Dieses präpositionale Possessivkompositum (,auf beiden Seiten ελιξ = Rundung habend', vgl. άμφί-αλος ,beidseits, ringsum Meer habend') bezieht sich nach K. 39-41 (ursprünglich) nicht auf eine Fahreigenschaft („Beweglichkeit" Gray 97), sondern auf die Bauform (.beidseits gerundet'), und da wieder nicht auf Bug und Heck (Boisacq, Gray 94 zweifelnd), sondern auf den beidseits des Kiels ziemlich gleichmäßig runden Rumpf (die Rundung fällt beim aufgeschleppten, durch έρματα ,Reih-Steine' vor dem Umkippen gesicherten Schiff besonders ins Auge). άρμενα: Das Wort soll in Hes. op. 808 ein Substantiv .Planken' sein (161 f.): ganz unwahrscheinlich. Hesiod meint: man soll Schiffsholz schlagen, „vieles (und) solches, das p a s s e n d für Schiffe ist"; άρμενα also Adjektiv und Attribut zu ξύλα (so auch DELG); Bedeutungsbestimmungen sollten nicht von der Kommasetzung in unseren Texteditionen abhängig gemacht werden: diese zeigt nur das Textverständnis des jeweiligen Herausgebers an. άρμονίη: Was mit diesem Wort (zur Wz. *άρ-,fügen') genau gemeint ist, wurde erst klar bei der Untersuchung griechischer Schiffswracks durch die Unterwasser-Archäologie: es sind ,Federn', d. h. Holz-Verbundstücke, die in zwei aneinanderstoßende Außenhaut-Planken innen nach Vorbohren entsprechender Aufnahme-Öffnungen (Schlitze) eingenutet werden (und infolgedessen beim fertigen Schiff von außen gar nicht sichtbar sind: feinste Spundungstechnik wie
4 W. Rösler, Dichter und Gruppe, München 1980.
632
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
im Möbelbandwerk; genaue technische Beschreibung bei Casson 202 f. und App. 2). K. 98-101 sichert diese Sachbedeutung auch sprachlich ab (Gray 111 ganz verfehlt „Holzpflöcke oder Querplanken ober- und unterhalb der Hauptplanken"; Hainsworth im neuen Odysseekommentar [1982] zu ε 248 in der Floßbauszene gibt keine Erklärung, und Priviteras Übersetzung „chiavarde" [etwas wie .Schließbolzen'] bleibt änigmatisch). K. bringt hier einen deutlichen Fortschritt. άφλαστον: Bisher als Entlehnung aus einer vorgriechischen Sprache aufgefaßt (Frisk, DELG), wird das Wort hier 111 f. m. E. überzeugend als substantiviertes Verbaladjektiv mit -xoSuffix zu (φλάω .stoßen, quetschen, drücken, pressen' gedeutet und als Bezeichnung der Stelle am Heck ausgewiesen, an der die Planken bzw. Barghölzer beider Schiffsseiten mit einer Zwinge o. ä. zusammengepreßt festgehalten wurden, also ,die Pressung' (ungenau Gray 105 .Heckzier': die Heckzier, ein schmückender Knauf, wurde später auf das άφλαστον, die .Pressung', draufgesetzt). βλήτροισι: s. ξυστόν! βοεΰσιν: Dieses Wort (bei Gray nicht besprochen) wird an den Belegstellen β 426 = o 291, h. Αρ. 407 ansprechend als .kontrahiertes' βοέοισιν (sc. ίμάσι; diese Verbindung vom Pferdegeschirr Ψ 324) erklärt (166 256 ). An der Sachbedeutung .Rahfallen' (rindslederne Flechttaue [έυτρέπχοισι β 426 = o 291] zum Hissen und Fieren der Rah) kann kein Zweifel bestehen, γλαφυρός: s. weiter oben zu den Epitheta! I 118 γόμφος: Die Funktion der mit γόμφος bezeichneten Sache war bisher nicht recht klar. K. 101— 103 stellt das Wort zur Wurzel idg. *gembh- .Maul aufreißen' sowie zum Kollektivum aind. jámbha- (.Zähnefletschen' >) .Gezähn, Zahnreihe' und erklärt die γόμφοι als die an der Schiffswand von außen sichtbare ,Zapfenreihe,,Pflockreihe' (eigtl. also ebenfalls ,Gezähn', vgl. das verwandte Wort ,Kamm'). Der einzelne γόμφος ist der bei der Plankenspundung (s. oben άρμονίη) durch Nut und Feder zur Federsicherung hindurchgetriebene .Zapfen'; die bildlichen Darstellungen bestätigen diese Deutung (Gray technisch ungenau: 90, 111, 153 .hölzerner Dübel, Nagel'; immerhin 90 auch: „mittels γόμφοι v e r z a p f t "). έδαφος: Die Besprechung (103 f.) ist sehr kurz geraten. Dahinter mag eine gewisse Besorgnis stehen, längere Analyse könnte die von K. energisch verfochtene Deutung der σχεδίη des Odysseus als ,Boot' (und nicht ,Floß') gefährden; s. dazu unten σχεδίη. ενιεα: s. unten τεύχεα! έπηγκενίδες: LSJ: „long planks bolted to the upright ribs (σταμίνες) of the ship" (so mit vielen z.B. auch noch Marinatos 148); was darunter technisch vorzustellen ist, wurde schon bei Gray 112 klarer: „Planken, die ein horizontales Geländer bilden, indem sie die Spitzen der ϊκρια verbinden"; ganz deutlich Casson 46 19 : „gunwales". Das blieb aber ohne sprachliche Fundierung. K. erklärt jetzt (133 f.) έπηγκενίς einleuchtend als substantivische -ιδ-Bildung zu einem Ableitungskompositum *έπ-α/ηγκένιος (zu άγκών .Ellenbogen') und erwägt mykenische Herkunft, bei morphologischer Analogie zu o-pi-ko-ru-si-ja (< έπί κορύθει) .was auf dem Helm ist', u. a. Dann wäre das Wort ein präpositionales Rektionskompositum (PRK) mit der Bedeutung ,was auf den αγκώνες aufliegt': m. E. unvorteilhaft, weil wir dann ein Schiffsteil αγκώνες ansetzen müßten, das wir (bisher) nicht kennen. Daher wohl besser K.s zweite Deutung , αγκώνες auf sich habend > Armlehne' (Possessivkompositum [PK] mit präpositionalem Vorderglied [?]). Deutsch dann jedenfalls unbedenklich mit .Reling' wiederzugeben (zu mnd. regel .waage-
Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer, Göttingen 1979
633
rechtes Querholz zwischen senkrechten Ständern', vgl. nhd. .Riegel'); ,Handlauf' u. ä. (so K. 133) ist zu untechnisch. έπίκριον: Überzeugend S. 150 f. die Erklärung dieser Bezeichnung der Rah (ε 254,318) als PRK „was sich auf den ϊκρια befindet", zu ικρια in der wahrscheinlichen Grundbedeutung .senkrechte Pfosten', und hier dann speziell .senkrechte Ständer an den beiden Dollborden als Rahgalgen'. Als ϊκρια später zum Kollektivum für .Aufbau' wurde, erhielt die Rah eine andere Bezeichnung (κεραία, κέρας). έπίτονοι: Die aktivische Deutung der verbalen Rektionskomposita πρό-τονοι und έπί-τονοι ,Fock- und Backstagen' (= Taue, die von Bug und Heck aus die Mastspitze festhalten), also eigtl. .Spanner' (165), scheint der passivischen Deutung .Gespannte' (so Risch, DELG) vorzuziehen zu sein. έρετμόν: Das bisher morphologisch dunkle Wort für .Riemen' wird S. 136 ansprechend als ursprüngliches *έρε-σμό-ς (vgl. θεσμός, κλισμός) ,das Geroje', mit sekundär eingeschlepptem x statt σ nach έρέτης ,Rojer' und mit Übergang ins Neutrum als Werkzeugbezeichnung, gedeutet. έφόλκαιον: Vom späteren έφόλκιον (Casson 248 9 3 , 249 9 5 ) .Beiboot' streng zu scheiden (ξ 350 ξεστόν έφόλκαιον). Gray 102, 104 (zweifelnd) hatte .Steuerruder' vorgeschlagen, Marinatos 146 f. in Ausdeutung des Schiffsfreskos von Akrotiri ,Steuenruderbalken' (der zugleich als Abort gedient habe; also dann .Donnerbalken'?). K. 115 f. deutet völlig überzeugend (als substantivierltes Adjektiv mit -ίο-Suffix zu έφολκή .das Schleppen, Nachschleppen') .Schleppbalken' (im Vorschiff, seitlich beidseits herausragend; dient der Schlepptrosse als Halt beim Schleppvorgang; möglicherweise auch Kranbalken beim Ankern). Vgl. auch unten θρήνυς. Gleiche Deutung schon Casson 46 2 0 . θρήνυς: Dieses Wort hatte schon Casson 46 2 0 als Bezeichnung des „after through-beam" gedeutet. Durch Kombination mit den mykenischen fa-ra-nu-Belegen (θρήνυς dort in DeminutivFunktion .Fußstützholz, Fußbank') liefert K. 119-121 die sprachliche Grundlage nach: Bezeichnung (in O 729) des „sieben Fuß langen achteren Querbalkens" (seitlich etwas über die Außenhaut ragend). Gray 99 „sieben Fuß breite Laufplanke vom Achter- zum Vordeck" (nach Leaf), Marinatos 151 „breiteste Ruderbank, mittschiffs" sind damit überwunden. Vgl. oben έφόλκαιον und unten μεσόδμη. ϊκρια: Die gängige Wiedergabe ,Deck' wird S. 128-132 als eine von mehreren Spezialbedeutungen innerhalb einer verzweigten Wortgeschichte ausgewiesen. Das nur als pl. t. erscheinende Wort ist möglicherweise als nautischer Terminus bereits aus dem vorgriechischen Substrat entlehnt und scheint im Kern etwas wie .Stützen einer Plattform', dann diese Plattform selbst zu bezeichnen (vgl. oben έπίκριον). Κ. entscheidet sich für eine allgemeine Bedeutung , Aufbau' (insb. achterer Aufbau); das stimmt mit späteren Spezialbedeutungen in anderen Sachbereichen zusammen (ζ. Β. ϊκρια als Bezeichnung der Zuschauertribüne in der Frühgeschichte des athenischen θέατρον). Inkonsequent ist dann nur K.s Deutung der ικρια, die Odysseus in der Floßbauszene ε 252 „aufgestellt habend m a c h t " (στήσας ... ποίει) als „senkrechte Pfosten außen herum zum Auflegen der Reling" (in diesem Sinne 131): Kalypso hatte Odysseus in ε 163 empfohlen ϊκρια πήξαι έπ' αύτής (σχεδίης) / ύψοΰ, und dieser Empfehlung folgt Odysseus in Vers 252, indem er ϊκρια ... ποίει .macht'.,Pfosten' kann er nicht m a c h e n , indem er sie aufstellt (στήσας), machen kann er so nur einen .Aufbau', und zwar eben ύψοΰ ,hoch oben'. Gray 110 hat mit Verweis auf Huckleberry Finns Floß sowie auf Kon-tiki nahegelegt, daß der Dichter
634
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
sich an der ε-Stelle eben jene .Plattform, erhöht', jenen , Aufbau' vorstellt, den man gerade auf einem Floß braucht; hier müßte K. eigentlich zustimmen. Vgl. unten σχεδίη. ιστία: Der Plural darf nicht dazu verführen, sich auf homerischen Schiffen mehrere Segel vorzustellen; das eine Rahsegel besteht vielmehr aus mehreren Bahnen (so auch schon Gray 106), sowohl wegen der Größe (die rekonstruierte Segelfläche bei W. zu Mondfeld in Gray 152 und 157 umfaßt 129,60 m 2 ) als auch wegen der Reißgefahr (vgl. ζ. Β. ι 170, ε 316). - Sehr nützlich S. 152 die Zusammenstellung der Ausdrücke für (a) Segelsetzen und (b) Segelbergen (-streichen). ιστός: Erhellend ist S. 149 die Verbindung von ιστός „Mast", auch „Weberbaum", mit myk. i-to-we-sa e-ka-ra /histowessa eskhara (ιστόεσσα έσχάρα)/ PY Ta 709 ,Herd mit Ständer darauf zum Aufhängen von Kesseln'; ιστός also entgegen anderen Annahmen sicher deverbativ zu ΐστημι im Sinne von ,Ständer'; daraus beide Termini technici: ,Weberbaum' und ,Schiffsmast'. καρχήσιον: Richtig S. 149 die Präzisierung des gängigen Bedeutungsansatzes ,Masttopp' zu ,Galeerentopp', d. h. „Vorrichtung im Masttopp, durch die die Fallen liefen" (d. h. die Taue zum Hissen und Fieren der Rah): das καρχήσιον (> lat. carchesium > frz. calcet) ist deutlich erkennbar schon auf dem Akrotiri-Schiffsfresko, bes. bei Schiff H; vgl. Marinatos 149. κορωνίς: Es mag sein, daß die ursprüngliche (etymologische) Bedeutung dieses Epithetons 120 (zu κορωνός ,gebogen, eigtl. hakig', oder direkt zu κορώνη I ,Krähe, eigtl. aber Haken', vom Hakenschnabel, danach die Vogelbezeichnung) weder ,gekurvt', ,gehörnt' (von den Bughörnern) noch schnabelförmig' - vom Sporn (so Gray 95) - war, sondern „mit gekrümmtem, schnabelartigem Heck versehen" (so K. 39). Die Gebrauchsbedeutung - wenn überhaupt eine genauere Bedeutung empfunden wurde - dürfte aber nach K.s eigenen Hinweisen (κορώνη häufig .Höhepunkt, Spitze'; vgl. später corona, Krone) eher ,hochaufragend' (sc. aus der Wasserfläche) gewesen sein. - Die .Beobachtung', die Formel νηυσί κορωνίσιν sei „immer mit einem negativen Geschehen oder Zustand verbunden" (K. 38), gehört in die Kuriositätenkammer. μεγακήτης: Spätere Umdeutung dieses ursprünglichen PK .große See-Ungeheuer enthaltend' (so γ 158 vom Meer) in ein Determinativkompositum ,ein See-Ungeheuer seiend' (K. 44) ist nicht unwahrscheinlich (seit dem 8. Jh. waren am Bug seitlich oft zwei große Augen aufgemalt); Gray 96 neigt fälschlich eher zur Verknüpfung mit κήτος .Höhle', die Dichter hätten κήτος ,See-Ungeheuer' später hineingedeutet. μεσόδμη: Gut verdeutlicht ist S. 177 f. die ursprüngliche Bedeutung (zu *δεμ-, δμ- ,Haus'): „verstärkender Querbalken des Rumpfes ungefähr mittschiffs" (also eigtl. .Mittelbau'), θρήνυς + μεσόδμη + έφόλκαιον wären dann die drei Haupt-Querstreben „zur Erhöhung der Querstabilität des Rumpfes"; weniger wahrscheinlich Casson 47 32 ,carling', Gray 99 .Mastkoker' (der Mastkoker hieß ίστοπεδη). οίήϊον: Wird S. 146 f. erhellend als Übertragung aus dem Wagenbau gedeutet: .Deichsel' > .Ruderp i n n e ' (nicht .Ruder'!)· όπλα: Die speziell seemännische Bedeutung von kollektivem όπλα (zu επω .besorgen, betreiben'?) ist .Enden (= Taue und Seile) der Takelage' (und zwar nur der Takelage; Festmacher am Ankerplatz ζ. B. sind nicht mehr όπλα, sondern πείσματα: ζ 268/9). όρμος: Über die gängige Bedeutungsangabe .Ankerplatz' (so auch Casson 362; Gray hat das Wort nicht) kommt K. 191-195 schön hinaus mit der Parallele όρμος : όρμή = πλόκος : πλοκή („das Geflochtene, die Flechtung" : „das Flechten"). Gegenüber όρμή ,das Anstürmen' ergibt
Zu C. Kurt, Seemännische
Fachausdrücke
bei Homer, Göttingen 1979
635
sich dann für όρμος etwas wie ,die Anstürmung, das Angestürmte', also die .Auflaufstelle' (ζ. Β. ι 136 f. im λιμήν εϋορμος), d. h. eine flache Sand- oder Geröllstrandstelle, an der das Schiff (meist heckvoran durch Vorwärtsrudern, προ-ερέσσω) aufgesetzt wurde. ούροί: Κ. greift den traditionellen Bedeutungsansatz ,Kielfurche, Schlippfurche' in Β 153 (zu myk. wo-wo Iworwosl, kork. ôpFoç, att. όρος .Graben, Furche; dann Grenzfurche, Grenze') S. 195 f. mit der Begründung an, Schiffe liefen sonst überall im Epos ohne Schlippfurche auf bzw. gingen ohne sie zu Wasser; statt dessen schlägt er als bezeichnete Sache die (Innenfurche des Schiffs >) Bilge, den Kielraum vor (der eine Reinigung eher verdiene): wenig wahrscheinlich; die Textstelle ist m. E. sachlich singulär genug, um nur hier im gesamten Epos eine Erwähnung von Schlippfurchensäuberung zu rechtfertigen: nur hier liegen Schiffe bereits neun Jahre lang (und schon angefault, wie Agamemnon übertreibend sagt, V. 134 f.) an ein und derselben Stelle; daß bei Flotten-Stadtbelagerung von Anfang an Schlipps angelegt werden, als Vorsichtsmaßnahme, ist nicht unwahrscheinlich. πείραρ: Im Anschluß an Nothdurft, Glotta 56, 1978, wird das Wort in μ 51 = 162 ~ 179 (Anbindung des Odysseus an den Mast) S. 182 f. als .Endstück', evtl. .Knoten' (vgl. aind. párvan- n. .Knoten; Ab-Schnitt; Ziel') gedeultet. „Die Bedeutung .Seil' fällt somit dahin" (183): schwer zu sehen; gemeint sein können doch nur .(Seil-, Schnur-)Enden' (auch im Bild ολέθρου πεΐρατ' έφήπται/-ο Η 402 u. ö.). πούς/πόδες: Die nautische Spezialbedeutung (,Segel-Fuß' > ) .Schote' (Seile, die an den beiden unteren Ecken des Segels an der Fußrah angreifen) muß auch für den (seltenen) Singular an der Stelle κ 32 gelten (richtig Heubeck im neuen Odyssee-Kommentar [1983] .scotta'). Gray 101 hatte mit den Scholien zögernd eine Sonderbedeutung .Steuerruder' angenommen; denn „die Segelleine neun Tage und Nächte zu halten muß Seeleuten absurd vorkommen". Daß .neun Tage und Nächte' eine formelhafte magische Zahl ist, hat Lesky, Horneros, RE Suppl. XI, 1967, 114 f., schön gezeigt, K. macht gut deutlich, daß der Dichter den Odysseus hier permanent die Lee-Schote halten läßt (171). πολύδεσμος: s. σχεδίη! πρότονοι: s. έπίτονοι! ξυστόν: Die ξυστά ναύμαχα, mit denen sich die Griechen in O 338,677 hoch von den Schiffen aus die von ihren Kampfwagen nach oben stoßenden Troer vom Leibe zu halten suchen, hatte Gray 126 noch für .Schiffsspeere' gehalten und die Längenangabe (10 m; aus Teilstangen zusammengeleimt, an den Stößen mit Zwingen, βλήτροισι, zusammengeschraubt') für dichterische Phantasie erklärt (Marinatos 148 bietet eine völlig abwegige Erklärung). K. 177 f. erweist ξυστά ναύμαχα überzeugend als poetische Umschreibung fur die κοντοί .Staken', die normalerweise zum Abstoßen vom Land dienen und hier notgedrungen zweckentfremdet werden. σκέπαρνος/-ον: Die Bedeutungsangabe S. 202 .„Schlichtbeil' zum Glätten von B r e t t e r n " ist eine petitio principii. Der πέλεκυς (μέγας) ε 234 ist eine große Baum-Axt zum Holzfällen, der (das) σκέπαρνος/-ον (έύξοος/-ον) in ε 237 ein (kleines) Beil zum Abhacken von Wipfel, Ästen, zum Glätten usw.; ,Bretter' impliziert das Werkzeug nicht. σπειρον: Die neuere Fehldeutung ,(Anker-)Taue' (GOS 56, Casson362 5 [,cables']) wird zu .eingerolltes Segel' (zu *σπερ- .winden, rollen', also eigtl. ,[Segel-]Tuchrolle') berichtigt (in ε 318 hätte dann Odysseus nach K.s Vorstellung [154] vor dem Sturm rasch noch das Segel auf-
636
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer
gegeit). Die deutschen Odyssee-Ü b e r s e t z u n g e n haben übrigens an den beiden Belegstellen (ε 318, ζ 269) in der Regel bereits richtig mit,Segel' wiedergegeben; K. präzisiert das aber. σταμινες (Akzent unsicher): s. σχεδίη! σχεδίη. Die alte Streitfrage, ob ,Floß' oder ,Boot', wird m. E. auch von K. nicht endgültig gelöst. Etymologisch ergibt sich aus der Beziehung zu σχεδόν ,nahe', α ύ τ ο σ χ ε δ ό ν ,nahkämpfend' usw. für σχεδίη (sc. νηΰς) ohnehin nur eine allgemeine Bedeutung wie ,die Angenäherte' (d. h.: keine .Richtige'), also etwas wie ,Behelfsgefährt' 5 . Auch K.s Wortanalyse beschränkt sich wieder im wesentlichen auf die Bauszene ε 234-261, wie die der meisten vor ihm. Zu berücksichtigen scheint mir aber die gesamte Intention des Dichters: er will Odysseus, den er in diesem Gesang (nachdem er vier Gesänge lang nur indirekt, I mit den Augen der anderen gesehen wurde), erstmals persönlich vorführt, gleich als den zeigen, der er als Typ ist (und in der Weltliteratur blieb): der unendlich Leidensfähige (πολύτλας), aber auch der unendlich Erfindungsreiche (πολύμηιις) (eben .der Mensch'); vgl. Hainsworth im neuen Odyssee-Kommentar [1982], 141. Darum muß Odysseus in fast vollkommener Hilflosigkeit dennoch eine ungeheure Leistung vollbringen (die gegenüber der Ilias n e u e Form der menschlichen Aristie!). Die Ungeheuerlichkeit der ihm zugemuteten Leistung läßt ihn selbst erschrecken (ε 174-176): „Du heißt mich wirklich mittels einer σχεδίη den großen Schlund des Meeres überqueren, den schrecklichen und mühseligen? Den überqueren ja noch nicht einmal die gleichmäßig gebauten, schnellfahrenden νηες!" Der Dichter versteht also unter σχεδιη den absoluten Gegensatz zu ,Schiff', etwas wegen seiner Unangemessenheit (also seiner See-Untüchtigkeit) eigentlich gar nicht Zumutbares. Das muß etwas P r i m i t i v e s sein - und dafür haben wir jedenfalls im Deutschen kein besseres Wort als ,Floß' (,Kahn' o. dgl. ist schon viel zu .entwickelt'). K. 21-24 besteht, wie vor ihm u. a. Casson 217-219, auf ,Boot', weil Odysseus in der Bauszene mit Nut und Feder verfugt (s. oben άρμονίη). Aber läßt ihn der Dichter dieser Stelle nicht vielleicht deswegen diese Bautechnik benutzen, weil er erstens nur sie (als erstaunliche Errungenschaft menschlichen Geistes) kennt und zweitens seinen Odysseus als E x p e r t e n auf jeglichem Gebiet ausweisen will? Gray (die nach wie vor für ,Floß' plädiert) wies S. 110 schon richtig darauf hin, daß keine Rede von einer S ä g e sei (die man natürlich an sich kannte, sie ist schon in Linear B-Ableitungen belegt); und es ist sprachlich wie sachlich ganz unglaubhaft, daß πελεκκησεν δ' αρα χαλκώι (sc. die 20 gefällten Baumstämme) in ε 244 „adzed them into planks" (so Casson 217) bedeuten sollte (wie kann man mit einem πέλεκυς Bretter machen?). Auch σταμΐνες 252 und ικρια 252 widerlegen nicht, daß der Dichter ein Floß meint: σταμίνες ist Hapax (alle späteren Stellen sind, wie K. 126 richtig betont, Kommentare zu der Odyssee-Stelle) und bedeutet von der Etymologie her nur etwas wie .Ständling' (.Spanten', so mit Casson a. O. Kurt 126, ist bloße Vermutung), und ΐ κ ρ ι α spricht ohnehin mehr für ,Floß' als für .Boot' (s. oben unter ϊκρια). Für ,Floß' spricht ferner der Vergleich der Größe der σχεδίη mit der des έδαφος, der ,Bodenfläche', einer φορτίς εύρεια, eines .breiten Frachters', in 249/50 (mit dieser „ B r e i t e " , die auf ein kleines Boot ja nun sicher nicht paßt, hat auch K. 76 [unter ευρεία] Schwierigkeiten; für ein Floß aus 20 Stämmen - Kon-tiki bestand aus nur acht - wäre sie nur normal). Nach alledem ^ Aber vielleicht ist das zu .philosophisch' gedacht? So daß nicht .Improvisation' (so K. 80: „Stegreifboot, Schnellbauboot") assoziiert würde, sondern .Fahrzeug für den Nahverkehr' (vgl. die mesopotamischen Brückenersatz-Flöße, die .Fähren'; Casson 3-5)? Mit solchen .übers hohe Meer' fahren zu sollen ist tatsächlich eine entsetzenerregende Vorstellung (noch heute!).
Zu C. Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer, Göttingen 1979
637
scheint es mir nach wie vor möglich, daß der Dichter der Stelle zeigen wollte, wie ein primitivstmögliches Wasserfahrzeug unter den Händen eines ,Intelligenzlers' wie Odysseus dank fortgeschrittenster Technik die bestmögliche Form erreichen kann (indem sogar die mit dem πέλεκυς zu rechteckigen Balken zugerichteten, ursprünglich natürlich runden Stämme miteinander v e r f u g t werden, πολύδεσμος in ε 33 und η 264 [also in der Floßbau-Anweisung des Zeus an Hermes und ihrer Wiederholung in der Erzählung des Odysseus] bedeutet allerdings m. E. nur , viel verbunden', nicht speziell „mit vielen Federn versehen" [K. 81]; das .vielverbundene' Floß gehört in die uralte Geschichte - in der δεσμός wohl noch die auch in ν 100 noch vorliegende Bedeutung .Strick' [K. 181] hatte; der Dichter der Bauszene im ε verwendet das Wort nicht mehr, weil er die uralte Geschichte .technisch modernisiert'). - Weitere Argumente für das Floß wären in größerem Zusammenhang vorzubringen. τεύχεα: Als -εσ-Ableitung von τεύχω .herstellen, bereiten usw.' bedeutet das Wort (wie εντεα, Κ. 160 f.) nichtterminologisch nur allgemein etwas wie ,Zeug, Gerät' und gewinnt seine terminologische Bedeutung erst aus dem I pragmatischen Kontext (also im kriegerischen Zusammenhang: .Rüstzeug > Waffen', im nautischen: .Schiffszeug' - was immer damit im einzelnen gemeint sei). K.s Polemik 159 gegen Trümpy ist um so überflüssiger, als er selbst in Anm. 233 aus te-u-ke-pi PY Sb 1315 Iteukhephil .Teil der Pferdebeschirrung' ein ursprünglich „weiteres Wortfeld" erschließt. - Nebenbei mache ich auf ein Kuriosum der Schadewaldtschen Odyssee-Übersetzung aufmerksam: Die τεύχεα, die Telemach o 218 bei der Abfahrt von Pylos in sein Schiff hineinschaffen läßt, sind für Sch. „Geräte"; als sie nach der Landung des Schiffes in π 326 wieder herausgeschafft werden, haben sie sich für Sch. in „Waffen" verwandelt. ύπέραι: Schön erklärt K. 169 f. die ϋπέραι (jedenfalls dem Sinne nach) als „die Oberen" (sc. Leinen) im Gegensatz zu den πόδες, den „Fuß-Leinen". Daß damit die Brassen gemeint sind (die beiden an den Rahnocken angreifenden Seile, die die gehißte Rah in die gewünschte Richtung drehen), war an sich längst klar (s. ζ. B. Casson 230). Nur hatte leider Gray 113 den Sinn wieder verdunkelt (Jöhrens im Index zu Gray, 155, gibt dementsprechend die falsche Bedeutung ,Falleinen') und die Existenz von Brassen für das homerische Schiff sogar bezweifelt (101): ohne Brassen ist ein Rahsegel aber gar nicht zu bedienen! φορτίς: s. oben σχεδίη!
Eingangs war von der Selbstverständlichkeit des Umgangs die Rede, den die Griechen mit dem Meer und mit den Schiffen pflogen. Es hat schon etwas Verwegenes, wenn zwei Binnenländer wie der Verf. und der Rez., die nie ein griechisches Schiff der homerischen Zeit betreten haben (im Falle des Rez. noch nicht einmal ein modernes Segelschiff), sich anheischig machen, die hochdifferenzierte nautische Fachsprache der Griechen um 1000 v. Chr. semasiologisch und onomasiologisch zurückzugewinnen. Fehlgriffe sind da wohl unvermeidlich. Wenn nicht alles trügt, ist es K. trotzdem gelungen, unser Verständnis der frühgriechischen Literatur in einem wichtigen Bezirk zu verbessern, zu vertiefen und zu verfeinern. Die große Mühe, die er sich gemacht hat, war nicht umsonst.
638
Über seemännische Fachausdrücke bei Homer Literatur
Alexanderson, B., Homeric Formulae for Ships, Eranos 68, 1970,1-40. Casson, L., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971 u. ö. DELG = Chantraine, P. [u.a.], Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 19681980. GOS = Morrison, J. S./Williams, R. T., Greek Oared Ships 900-322 Β. C., Cambridge 1968. Gray, Dorothea, Seewesen, in: Archaeologia Homérica, Band I, Kap. G, Göttingen 1974. Hiller, S./Panagl, O., Die frühgriechischen Texte aus mykenischer Zeit, Darmstadt 1976 (Erträge der Forschung, 49). I 124 Homer. Tradition und Neuerung, hrsg. v. J. Latacz, Darmstadt 1979 (Wege der Forschung, 463). Marinatos, Sp., Das Schiffsfresko von Akrotiri, Thera, in: Gray, 141-151. Odyssee-Kommentar = Omero, Odissea (im Erscheinen; 6 Bände geplant), Milano 1982 ff. Paraskevaides, Η. Α., The Use of Synonyms in Homeric Formulaic Diction, Amsterdam 1984. Parry, M., The Traditional Epithet in Homer (= Übersetzung der französischsprachigen Diss. 1928), in: The Making of Homeric Verse, ed. by A. Parry, Oxford 1971.
Handbuch der Fachdidaktik. Fachdidaktisches Studium in der Lehrerbildung. Alte Sprachen 1, hrsg. v. Joachim Gruber und Friedrich Maier, München 1979,193-221
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik Vorbemerkungen zu Begriff und Darstellungsmethode Zum Begriff .Schulgrammatik' bezeichnet eine auf die speziellen Bedürfnisse der Schule zugeschnittene Grammatik, und zwar als Wissensgebiet (Lehr- und Lernfach) im weiteren, als Lehrbuch im engeren Sinne.1 Der Begriff .Schulgrammatik' bezeichnet also nicht eine bestimmte Sehweise von Grammatik (wie ζ. B. historische Grammatik, funktionelle Grammatik, Dependenzgrammatik, Transformationsgrammatik usw.), sondern einen bestimmten Verwendungsraum. Theoretisch könnte somit jede der genannten Grammatik-Sehweisen auch als Schulgrammatik auftreten, - vorausgesetzt, daß dabei deren wesenhafte Zielsetzung nicht beeinträchtigt würde. Die Zielsetzung der Schulgrammatik wird bestimmt von invariablen und variablen Determinanten. Die wichtigste invariable Determinante ist die „Kenntnis des Objekts selbst"2, d. h. die Aneignung der Gebrauchsnormen der betreffenden Sprache (der Muttersprache oder einer Fremdsprache), zu welchen weitergehenden Zwecken auch immer.3 Die wichtigste variable Determinante ist das jeweils herrschende intellektuelle Klima mit seinen bildungs- und schulpolitischen Vorstellungen und Vorgaben (.Richtlinien'; vgl. z.B. griechisches γυμνάσιον : römische Grammatikschule : frühmittelalterliche Klosterschule : städtische Bür-
1
Eine Adressatendifferenzierung zwischen Schülern und Lehrern ist im Begriff nicht enthalten. Die historische Entwicklung geht aber beim Lehrbuch eindeutig von der Schüler- zur Lehrergrammatik, von der mehr pädagogisch angelegten Εισαγωγή zum perfektionistischen StoffReservoir; die häufige Gleichsetzung von ,Schulgrammatik' mit engl. ,paedagogical grammar' geht daher fehl: der in Deutschland übliche Typ der Schulgrammatik ist eher unpädagogisch. 2 Arndt 1968 [1], 5. 3 Dazu Menzel 1972 [10], 80-108.
640
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
gerschule der Renaissance : humanistisches Gymnasium der Neuzeit : heutige sog. Gesamtschule).4 I 194 Das jeweilige Ziel wird erreicht durch Zusammenführung zweier ihrerseits variabler Grundkomponenten: a) der materiellen Komponente (was wird gelehrt), b) der (lern-)psychologischen (methodisch-didaktischen) Komponente (wie wird gelehrt). Die materielle Komponente (der Stoff) ist quantitativ variabel (allerdings tendiert die Schulgrammatik zur Kanonisierung einer bestimmten Stoffquantität), die (lern-)psychologische Komponente (der Vermittlungsprozeß) ist qualitativ variabel (die Darbietungsform variiert von Schulgrammatik zu Schulgrammatik). Aufgrund dieser durch die schulpraktischen Erfordernisse bedingten stofflichen und methodischen Variabilität steht die Schulgrammatik in dauerndem notwendigen Gegensatz zu der ausschließlich auf möglichst vollständige Faktenermittlung und -systematisierung abzielenden, von pädagogischen Rücksichten freien Grammatik als solcher (.wissenschaftlichen Grammatik'). Zur Methode der vorliegenden Darstellung Eine Geschichte der griechischen und lateinischen Schulgrammatik ist ein Desiderat. Die folgende Darstellung kann daher nicht Kompendium, sondern nur Planskizze sein. Für deren Gestalt waren folgende Überlegungen maßgebend: a) Die Berücksichtigung der lernpsychologischen Komponente ist mangels historisch orientierter Vorarbeiten5 und mangels ausreichender eigener Kompetenz nicht möglich. b) Die infolgedessen allein zu behandelnde materielle Komponente kann wegen der natürlichen Abhängigkeit der Schulgrammatik von der „Grammatik als solcher" sinnvoll nur in Form einer Entwicklungsgeschichte der „Grammatik als solcher" dargestellt werden. c) Für die Zeit bis zur Renaissance (ca. 1500) ist die eben erwähnte .Abhängigkeit' im wesentlichen gleichbedeutend mit .Identität'; die zentrale Frage nach den Einflüssen und Auswirkungen der .Grammatik als solcher' auf die Schulgrammatik braucht daher erst für die Zeit seit ca. 1500 gestellt zu werden. d) Die Einflüsse und Auswirkungen der .Grammatik als solcher' auf die Schulgrammatik in der Zeit von ca. 1500 bis zur Gegenwart können für be4 5
Grundsätzlich dazu Marrou [9], 1-6, vgl. 486-490; einzelnes bei Menzel 1972 [10], 18-20. Vgl. Arndt 1969 [2], 6.
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
641
stimmte Zeiträume nur summarisch umrissen werden. Ihrer konkreten Bestimmung steht der Mangel an einschlägiger Einzelforschung entgegen. Einzelforschung dieser Art hätte analog der Handschriftenstemmatologie sämtliche gedruckten Schulgrammatiken (α) nach Autor, Umfang, Inhalt und kulturellem Kontext zu beschreiben, (ß) anhand der Erscheinungsdaten (Wiederauflagedaten), Vorreden, Literaturangaben, Fußnoten usw. ihr gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis mit dem Ziel eines Stemmas zu klären, (γ) anhand einer Inhalts-, Aufbau- und Darstellungsanalyse den Grad ihrer Traditionalität bzw. Originalität zu bestimmen (Beispiele: Barwick 1922 [46] für die lateinische, Vorlat 1975 [72] für die englische, Erlinger 1969 [4] für die deutsche Grammatikgeschichte). Nach den Ergebnissen der eben genannten vergleichbaren Untersuchungen zu schließen, würde allerdings das im folgenden skizzierte Bild durch eine derartige Grammatiken-Stem- 195 matologie zwar nuanciert, aber in den Grundlinien kaum verändert werden: die bisher vorliegenden (wenn auch nur einen Teil des Materials erfassenden) einschlägigen Arbeiten lassen schon jetzt die Feststellung von Hamp 1974 ([18], Sp. 258) als gerechtfertigt erscheinen: „Roughly from the 15th century to World War II [...] the version of grammar available to the western public (together with its colonial expansion) remained basically that of Priscian with only occasional and subsidiary modifications." Der Charakter der griechischen (und lateinischen) Schulgrammatik als Ergebnis ihrer Entstehungsweise Die erste (Schul-)Grammatik des Abendlandes in Lehrbuchform, die des Dionysios Thrax, beginnt mit folgender Selbstdefinition: Γραμματική έστιν έμπειρία των παρά ποιηταις τε καν συγγραφεΰσιν ώς έπί τό πολύ λεγομένων: „Grammatik ist die Kunde des bei den Dichtern und Prosaikern in der Regel Gesagten". Das Wissensgebiet Grammatik wird damit definiert nach a) Gegenstand und b) Methode. Der Gegenstand wird enger eingegrenzt, als es die bloße Fachbezeichnung (γραμματική, sc. τέχνη) ausdrückt: nicht allgemein Kunde des „Geschriebenen" (γράμματα) - worunter dann alles Geschriebene fiele - , sondern Kunde von dem, was bei Dichtern und Prosaikern gesagt wird: das bedeutet Einengung auf die schriftlich fixierte Hochsprache (Literatursprache); ferner: nicht Kunde von allem, was bei Dichtern und Prosaikern gesagt wird, sondern Kunde von dem,
642
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
was meistenteils (~ in der Regel) bei Dichtern und Prosaikern gesagt wird: das bedeutet Einengung auf die Norm. Die Methode wird durch die Gleichsetzung des Wissensgebiets mit,Kunde', ,Kundigsein' (Γραμματική έστιν έμπειρία) mitdefiniert: Kundigsein setzt ausgebreitete und gründliche Kenntnis des Gegenstands voraus; der Gegenstand ist die Sprachnorm der Literatursprache; die Methode muß danach in der (vergleichenden) Observation des literarischen Sprachgebrauchs bestehen. Dionysios Thrax definiert also die Grammatik als eine aus vergleichender Observation des literarischen Sprachgebrauchs geschöpfte Kunde der hochsprachlichen Sprachnorm. Die erste (Schul-)Grammatik des Abendlandes ist damit definiert als empirische Sprachnormkunde, nicht als philosophische, logische, mathematische etc. Sprachgrundlagenforschung einerseits oder als rein positivistisch registrierende, norm-uninteressierte Sprachtatsachensammlung andererseits.6 Diesen Charakter, der für die geistige Erfassung gegebener Einzelsprachen (z.B. Indianersprachen) auch heute noch Grammatikziel ist, hat sich die 5c/i«/grammatik des Griechischen und Lateinischen im wesentlichen bis zur Gegenwart bewahrt. Sie ist daher im Laufe der Zeiten bei andersgerichteten Sprachforschungsinteressen immer wieder einmal unmodern geworden, niemals aber unbrauchbar. Sie ist vielmehr infolge präziserer Observation und daraus re196 sultierender präziserer .Kunde', I gemessen an ihrer eigenen Zielsetzung, immer brauchbarer geworden. Da der Präzisierung der Observation grundsätzlich keine Grenzen gesetzt sind, ist sie auch für die Zukunft unbegrenzt verbesserungsfähig. Da jedoch die Grundbeobachtungen, auf denen sie aufbaut (wie Flexion, Kasuslehre, Redeteile), für diejenigen Objekte, an denen sie gemacht sind (die griechische bzw. lateinische Literatursprachnorm), augenscheinlich zutreffen, ist eine Verbesserung der Schulgrammatik durch radikalen Umbau ihres gesamten Systems nicht zu erwarten (s. u. S. 663 f.). Bevor Grammatik als Kunde von Observationsdaten definiert werden konnte, mußten Observation und Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse bereits über längere Zeit hinweg stattgefunden haben. Das Grammatik-Lehrbuch des Dionysios Thrax hat demgemäß eine lange Vorgeschichte. Ihren exakten Beginn und ihren exakten Verlauf kennen wir nicht. Wir verfügen für die Rekonstruktion der vordionysischen Grammatikgeschichte lediglich über zeitlich und räumlich isolierte Einzelpunkte, an denen Sprachobservation und Sprachreflexion jeweils für einen Moment faßbar werden. Als notwendige und sinnvolle Bestandteile eines 6
Barwicks ([46], S. 215-225) Deutung dieser Definition („Kritik und Exegese der Autoren": 216) ist schon wegen des ώς έπί τό πολύ unmöglich. Vgl. auch u. S. 651 mit Anm. 17.
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
643
Ganzen erweisen sich diese Punkte erst vom Endpunkt der Entwicklung, vom Werk des Dionysios Thrax (und seiner unmittelbaren Nachfolger), her. Trotz aller Dissoziation des Materials lassen sich jedoch zwei Stadien in der Grammatik-Vorgeschichte unterscheiden: das erste Stadium zeigt gänzlich unzusammenhängende Beobachtungen auf den disparatesten Gebieten der späteren .Grammatik', ohne erkennbaren Systematisierungswillen des jeweiligen Observanten: wir bezeichnen es hier als .Entdeckungsperiode'; das zweite zeigt deutliche Ansätze zu Ausbau und Erläuterung von Einzelbeobachtungen und zu deren Synthese zu größeren System-,Inseln' und gipfelt schließlich in der Zusammenfüigung dieser Inseln - mit möglichen eigenen Ergänzungen und .Füllungen' - zu einem Gesamtsystem durch Dionysios Thrax: dieses zweite Stadium nennen wir hier die .Systematisierungsperiode'. Alle danach folgenden Perioden sind Perioden der Übertragung (auf das Lateinische), des Ausbaus und der (meist analogischen) Systemergänzung. Entwicklungsgeschichte der griechischen und lateinischen Schulgram matik Die einzelnen Entwicklungsstadien (vgl. die graphische Übersicht S. 644) 1. Die Entdeckungsperiode Die frühesten Spuren einer Objektivierung der Sprache bieten die homerischen Epen. Dies scheint nur natürlich, da die Weitergabe der komplizierten Technik hexametrischen Improvisierens von Sängergeneration zu Sängergeneration in den Jahrhunderten vor Homer schwerlich rein imitativ, ohne jede Sprachreflexion erfolgt sein kann; gewisse Grundeinsichten müssen sich während des langen Tradierungsprozesses zumindest in der Prosodie ergeben haben, sind aber wegen der Feinheit semantischer und syntaktischer Differenzierungen innerhalb der epischen Sprache auch für die Wortkunde (im weitesten Sinne) anzunehmen. Direkt faßbar wird uns solche Objektivierung in der Etymologie: Namensableitungen wie Odysseus von όδύσσομαι (Od. 19,407-9) oder Aphrodite von άφρός in Hes. Theog. I 195-7 7 zeigen, daß bereits lange vor 700 v.Chr. (wohl schon 198 vor Einführung der Buchstabenschrift) die Wörter als sinnhafte Einheiten begriffen und zum Gegenstand verknüpfenden Nachdenkens gemacht worden waren.
7
Zu weiteren Beispielen siehe Pfeiffer [37], 19 mit Anm. 7.
644
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
197
Graphische Übersicht Zeitraum
Hauptperioden der Grammatik-Entwicklung
ca. 700-350 v. Chr.
I. Entdeckungsperiode 1. Dichter und Rhapsoden 2. Philosophen (Vorsokratiker) 3. frühe Rhetoren 4. Sophisten 5. Piaton II. Systematisierungsperiode 1. Aristoteles 2. Stoiker und Pergamener 3. Alexandriner a) Dionysios Thrax b) Apollonios Dyskolos (2. Jh.n.) III. Übertragungs- und Anpassungsperiode 1. Varrò 2. Remmius Palaemon 3. Donat (Charisius, Diomedes u. a.) 4. Priscian IV. Reproduktionsperiode 1. Donat- und Priscian-Reproduktion a) Alcuin b) Aelfric c) Alexander de Villa Dei und Eberhardus von Béthune d) byzantinische Grammatiker
ca. 350-100 v. Chr.
ca. 150 v. Chr. -500 n. Chr.
ca. 5 0 0 - 1450
2. Modistae ca. 1450- 1850
ca. 1850 bis zur Gegenwart
V. Observationsperiode 1. Humanistengrammatik (Beispiel: Sanctius)
Bedeutung für die Schulgrammatik
Systembildung (=Entstehung der ersten abendländischen Muttersprachengrammatik)
>
(wenig veränderte) Übernahme der Fremdsprachen- als Muttersprachengrammatik (unveränderte) Übernahme der Muttersprachen- als Fremdsprachengrammatiken inhaltliche Theologisierung erster Anreiz zur Grundlagenreflexion (nomina : res) .Scientia recte loquendi et scribendi' (Rückgang auf die Klassik)
2. Grammaire générale (= .universale' oder .philosophische' Grammatik)
universale, philosophische Perspektive
3. Deskriptive synchronische Großgrammatik des 18. und 19. Jh.
Stoff-Erweiterung (bes. Aufbau der Syntax); Übergang der Schulgrammatik zum Handbuch
VI. Periode der Verwissenschaftlichung 1. Vergleichende und Historische Grammatik 2. Moderne .linguistische' Grammatik
diachronische Perspektive Zwang zur Uberprüfung der Grundlagen: Präzisierung
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
645
Elementare Einsichten auf den später .Phonologie' und .Morphologie' genannten Gebieten muß dann der mit der Schrifteinführung verbundene (private) Lese- und Schreibunterricht gebracht haben 8 : Wahrscheinlich sind dabei nicht nur Anzahl und Qualität der Laute festgelegt worden (darauf führt die traditionelle Bezeichnung der Laute als γράμματα statt φωνήματα), sondern es sind auch schon die unterschiedlichen Wortausgänge zumindest des Nomens zur Einheit des späteren παράδειγμα zusammengesehen worden: ein ArchilochosFragment (70 D.) wiederholt den Namen Λεώφιλος viermal innerhalb von zwei Versen in der wahrscheinlichen Reihenfolge Nom. - Gen. - Dat. - Akk. 9 , und ein Anakreon-Fragment (3 D. = 303 Page) bietet die Reihe Κλεοβούλου μενεγωγ'έρέω, Κλεοβούλ ω ι δ' έπιμαίνομαι, Κλεό βουλ ο ν δέ διοσκέω. Daß dies nur Ausdruck spontanen Vergnügens an spielerischer Formenvariation sein soll 10 , ist weniger wahrscheinlich, als daß es sich um den Reflex eines im Elementarunterricht schon des 7. Jahrhunderts zusammengestellten Nominalflexionsmusters handelt. 11 Dem Elementarunterricht lag von Anfang an Homer zugrunde; Sprachreflexion begegnet daher auch fernerhin vorzugsweise in Verbindung mit der Homerinterpretation. Träger sind während des 7. und 6. Jahrhunderts die Rhapsoden, die ja ex officio ständig zur Einzelerklärung und damit zu differenzierender Observation gezwungen waren (vgl. Piatons Ion); spätere Berichte über frühe Homerglossare 12 oder gar über frühe Schriften zur Sprachnorm Homers 13 bestätigen insoweit nur, was wir ohnedies anzunehmen hätten. Neben solcher .technischer' Observation (Buchstaben, Laute, Silben 14 , Wörter, Wortformen, Wortbedeutungen, Bedeutungswandel) stehen früh auch schon
8 Der natürlich nicht erst um 550 begann (so ζ. B. Marrou [9], 70), sondern simultan mit der Einführung der Schrift. [Siehe jetzt W. Burkert, Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, Heidelberg 1984, 31 f.]. 9 Vgl. Pfeiffer [37], 30. 10 So Pfeiffer [37], 31; vgl. dort auch 105 Anm. 112. 11 So E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, München 2 1953, 6; Π, München 1950, 54. 12 Also Erklärungen von Wortfossilien. Damit könnte vielleicht die Erkenntnis des Sprachwandels verbunden gewesen sein, die dann Piaton ausspricht, ζ. B. Crat. 421 d. 13 Pfeiffer [37], 27. 14 In prägnanter Bedeutung scheint der Begriff zum ersten Mal bei Aischylos aufzutreten: Sept. (aus dem Jahr 467) V. 468: γραμμάτων έν ξυλλαβάίς.
646
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
weitreichende sprachphilosophische Ansätze: Parmenides baut sein ganzes System auf der Deutung des doppelsinnigen (Vollverb: Kopula) έστιν auf und begründet mit seiner Behauptung (VS 28 Β 8, 38-41), bestimmte Wörter seien von den Menschen „gesetzte" (κατέθεντο) ονόματα, die nicht αληθή seien (d. h. 199 denen nichts I Reales entspreche), die in der Grammatikgeschichte periodisch wiederkehrende φύσις-νόμος-Debatte (, spiegelt die Sprache die Natur oder deutet sie sie?') Große Bedeutung für die Erweiterung praktischer Sprachkenntnis hatte die Rhetorik, die im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel zur Demokratie obligatorisches Lernfach für die geistige Elite wurde; hier entstanden die ersten systematischen Lehrbücher, die Sprache (wenn auch noch nicht unter speziell grammatischem Aspekt) zum Gegenstand machten. Verbunden mit der Rhetorik und teilweise aus ihr hervorgewachsen ist die Sophistik, deren Bildungsziel, die παιδεία, ohne ausreichende Sprachkompetenz gar nicht zu erreichen war. Folgerichtig legten die Sophisten seit Protagoras besonderen Wert auf die όρθοέπεια („richtiges Sprechen", vgl. das spätere Grammatikziel der scientia recte loquendi et scribendi, s. unten S. 660). Damit beginnt die normierende grammatische Systembildung. Protagoras entdeckt die drei grammatischen Geschlechter (er nennt sie noch άρρενα, θηλυκά und σκεύη, das dritte also „sächlich"), damit verbunden die Genuskongruenz von Substantiv und Adjektiv, und er unterscheidet als erster zwischen vier (intentional) verschiedenen „Grundformen" des Satzes: Wunsch-, Frage-, Antwort-, Befehlssatz; das wird später zur Differenzierung der Modi verbi führen. Prodikos pflegte die praktische Semantik; seine subtilen Synonymendifferenzierungen dienten schon Aristophanes zum Gespött (Ran. 1181 ff.). Das Ausmaß der grammatischen Entdeckungen der Sophisten ist wegen des fast vollständigen Verluste ihrer Werke schwer abzuschätzen, dürfte aber eher größer gewesen sein, als gemeinhin angenommen: Piaton legt im Kratylos (verfaßt zwischen 388 und 366) den „in diesen Dingen Erfahrenen" (424 c 7 u.ö.) einen eindrucksvollen Katalog von Erkenntnissen in den Mund: in der Phonologie die Unterscheidung zwischen Vokalen (φωνήεντα) und Konsonanten (άφωνα- 393 e 1), und bei den Konsonanten zwischen Mutae und Liquidae (424 c 6-8), in der Morphologie den Aufbau des Einzel worts aus Lauten (στοιχεία) und Silben (συλλαβαί: 424 c 6) sowie die Unterscheidung zwischen Nomen und Verbum (όνομα: ρήμα: 425 a 1 und bes. 426 e 2/3), - in der Syntax die Definition des Wortes (όνομα) als „kleinster sinnhafter Teil des Satzes" (385 c7/8; ebenso später Dionysios Thrax, s. u. S. 652) sowie die Definition des Satzes als σύνθεσις aus όνομα und ρήμα (431 c 1), - in der Wortbildung zumin-
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
647
dest ansatzweise den Begriff der Wurzel (422 b). Piatons eigenes Interesse gilt im ,Kratylos' und andernorts (bes. im .Sophistes') der sprachphilosophischen φύσις-θέσις-Problematik, also dem Ursprungsproblem; die Erkenntnis des Zeichencharakters der Sprache, zu der er dabei kommt (σημείον: Soph. 262 a6; vor allem aber Crat. 434 e 6-8), könnte seine eigene Leistung sein.15 Spätestens in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts ist die Entdeckungsperiode abgeschlossen. Die große Zahl isolierter und heterogener Observationen und Spekulationen verlangt jetzt nach einer ordnenden Hand. I 2. Die Systematisierungsperiode Eingeleitet wird die Synthese der bis dahin zerstreuten Wissenselemente durch Aristoteles. Seine Leistung liegt wie auf anderen Gebieten weniger in der Entdeckung von Neuem (in der Lautlehre bringt er ζ. B. kaum einen Fortschritt) als in der methodisch konsequenten Organisation des verfügbaren Materials. Die von ihm perfektionierte Darstellungsart der auf- und absteigenden Definitionssystematik ist nach ihm auch für die Disziplin .Grammatik' kanonisch geworden. Als Beispiel diene der Anfang des sog. linguistischen Kapitels der ,Poetik' (Kap. 20, 1456 b 20 ff.): „Της δέ λέξεως άπάσης τάδ' έστί τά μέρη· στοιχεΐον συλλαβή σύνδεσμος ονομα ρήμα άρθρον πτώσις λόγος, στοιχεΐον μεν οΰν έστιν ... (folgt Definition und Differenzierung), συλλαβή δέ έστιν ... σύνδεσμος δέ έστίν ..." usw.: „Der sprachliche Ausdruck im ganzen hat folgende Teile: Element, Silbe, Verbindung con-iunctio?), Nomen, Prädikat (zu ρήμα s. unten), Glied (~ articulus?), „Abänderung" (πτώσις), Satz. - Das Element ist ein Laut, der nicht weiter geteilt werden kann (φωνή αδιαίρετος) ... Dessen Arten sind der Vokal (τό φωνήεν) einerseits, der Halbvokal (τό ήμίφωνον) und der Nicht-Vokal (to αφωνον) andererseits. Davon sind: der Vokal derjenige Laut, der ohne Anschlag (sc. eines Stimmwerkzeugs, wie Zunge, Gaumen) hörbaren Ton hat, - der Halbvokal derjenige Laut, der mit Anschlag hörbaren Ton hat, wie z.B. das s oder das r, - der Nicht-Vokal aber derjenige Laut, der mit Anschlag zwar für sich allein keinen Ton hat, zusammen mit tontragenden Lauten aber hörbar wird, wie ζ. B. das g oder das d. Diese unterscheiden sich voneinander (1) durch Stellungen und Stellen des Mundes (~ Öffnungsgrad und Artikulationsstelle), (2) durch Behauchtheit oder Unbehauchtheit (δασύτητι και ψιλότητι, das ist der Unterschied zwischen tenues, mediae und aspiratae, s.u. S. 652f.), (3) durch 15
Gemeinhin wird diese Entdeckung erst Aristoteles zugewiesen, so ζ. B. Pfeiffer [37], 102.
648
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Länge und Kürze (geht auf die Vokale, s. u. S. 652), (4) durch Höhe, Tiefe und Mittellage (= Berücksichtigung des musikalischen Akzents im Griechischen)." Das hier deutlich werdende Streben nach Lückenlosigkeit der Materialerfassung, verbunden mit der Präzision der analytischen Definitionsmethode, ist für die Verfasser grammatischer Lehrwerke nach Aristoteles zur Richtschnur geworden. Materiell mutet uns das Aristotelische System natürlich fremdartig an: die uns vertrauten Ebenen der Phonologie, Morphologie und Syntax (dazu im weiteren bei Aristoteles noch Wortbildung und Stilistik) gehen in der Aufzählung der λέξις-Teile .durcheinander'. Der Grund ist, daß das ganze .linguistische' Kapitel natürlich nicht Teil einer (noch nicht existierenden!) Grammatik, sondern einer Poetik (d. h. also: Dichtungskunde) ist; die λέξις wurde in 1450 a9 als dritter der nach Aristoteles sechs Teile der Tragödie eingeführt; infolgedessen wird sie an unserer Stelle aus der Perspektive des Dichters bzw. Literarkritikers behandelt. Wenn diese Behandlung dennoch z.T. bereits deutlich .technischen' Charakter annimmt, so ist das das Ergebnis des starken Systematisierungswillens des Aristoteles. Was auf diese Weise entsteht, ist keine Poetik mehr und noch keine Grammatik: eine unschätzbare Zwischenstufe auf dem Weg zur autonomen 201 Γραμματική Τέχνη. I Die wichtigsten materiellen Einzelerkenntnisse bei Aristoteles (ob referiert oder selbstentdeckt): zwei weitere Redeteile (σύνδεσμος und άρθρον; die genaue Bedeutung bei Aristoteles ist unklar); unter ρήμα wird nicht mehr nur das Verb verstanden, sondern auch die nominale Satzaussage (De interpr. 20b 1), damit rückt ρήμα in die Nähe von .Prädikat'; das Verb wird erstmalig als .Zeitwort' definiert (1457 a 14: φωνή συνθετή σημαντική μετά χρόνου: „Ein zusammengesetzter bedeutungshaltiger Lautkörper mit Zeitangabe]"; als Beispiel werden eine Präsens- und eine Perfektform von βαδίζω angeführt). Der Begriff πτώσις, den Dionysios Thrax später auf die Nominalflexion einschränken wird, hat noch die allgemeine Bedeutung „Abänderung" und wird zur Bezeichnung folgender Formvariationen verwendet: Deklination (nicht Konjugation), Tempus- (wohl auch Modus-)Bildung vom Präsens aus, Numerusbildung, Genusbildung, Komparation, Adverbbildung vom Adjektiv aus, Bildung denominativer Adjektiva, Bildimg der Grund-Satzarten .Frage' und .Befehl' vom Aussagesatz aus. Diese Vielfalt der Verwendungsarten (die ein bestimmtes sprachphilosophisches Konzept verrät, dem wir dann klarer ausgeprägt in der Stoa wiederbegegnen, s. u. S. 650), bedeutet natürlich zugleich Kenntnis der jeweiligen grammatischen Phänomene als Einheiten (z.B. der Einheit .Komparation').
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
649
Die Nomina werden sowohl strukturell (in „einfache" und „vielfache" = Simplicia und Komposita) als auch semantisch-funktionell differenziert (in κύρια ~ „eigentliche", μετα-φορά ~ „übertragene", γλώσσα ~ „dialektale" usw.; s. dazu unten bei der Stoa, S. 650). Das grammatische Geschlecht der Nomina wird nach dem Nominativauslaut bestimmt (bis zur Entdeckung von Wurzel und Stamm im 19. Jahrhundert unverändert tradiert): männlich (άρρενα) sind die auf ν, ρ und ς (und auf Doppelkonsonant mit ς : ψ und ξ), weiblich (θήλεα) die auf η, ω und α, „dazwischen" (τά δέ μεταξύ) sind die auf ι υ ν und ς. Auf eine Muta endigt kein Nomen. Fazit: Zu Aristoteles' Zeit, also um 350 v.Chr., war der größte Teil der elementaren Laut- und Formenlehre bekannt und zu System-Einheiten zusammengefaßt; die Syntax dagegen war noch wenig ins Blickfeld gekommen. Das Übergewicht der Laut- und Formenlehre in den griechischen und lateinischen Schulgrammatiken bis um 1800 hat hier seinen Ursprung. Die rund 250 Jahre zwischen Aristoteles und dem in Alexandreia geborenen Aristarch-Schüler Dionysios Thrax (im folgenden: D.T.) müssen trotz vorzüglicher Aufhellungsbemühungen (speziell von Barwick und Dahlmann) immer noch als ,»Dunkle Jahrhunderte" der Grammatikgeschichte gelten. Sicher ist, daß die grammatischen Studien vom Peripatos auf die Stoa einerseits, und - nach der Gründung des Μουσείον (um 300) - auf die alexandrinische Philologie andererseits übergingen. Als drittes Zentrum trat in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts Pergamon hinzu. Im geistigen Wettbewerb dieser drei mediterranen Kulturzentren des Hellenismus - Athen, Alexandreia, Pergamon - ist (neben vielem anderen) die griechische Nationalgrammatik und mit ihr unsere Schulgrammatik entstanden. Aus dieser Genese erklärt sich der Mischcharakter, den die Schulgrammatik bis zum heutigen Tage aufweist: einerseits die formalistisch-strukturale Ausrichtung nach dem alexandrinischen Leitprinzip der Analogie, andererseits der philosophisch-universale Einschlag als Erbteil der stoischen Philosophie (Pergamon stand I durch seinen Repräsentanten Krates von Mallos auf stoi- 202 scher Seite). D. T. hat diese beiden unterschiedlichen Ansätze der Sprachbetrachtung zu einem Bastard-System zusammengearbeitet, dessen innere Unlogik in vielen Punkten bis heute spürbar geblieben, in anderen Punkten gar nicht mehr empfunden wird. Als Beispiel zwei Ergebnisse der äußerst komplizierten einschlägigen Untersuchungen Karl Barwicks: 1. Tempussystem. Der Begriff , Aorist' löst beim Griechischlernenden bekanntlich regelmäßig einen Verblüffungseffekt aus. Barwick hat gezeigt ([39], S. 51 ff.), daß D.T. diesen Begriff aus dem stoischen Tempussystem, in dem er als Bezeichnung einer Aktionsart seinen höchst sinnvollen Platz hatte, herausge-
650
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
brochen und als Bezeichnung eines Tempus seinem eigenen System höchst sinnlos einverleibt hat - womit er die exzellente stoische Unterscheidung zwischen Tempus und Aktionsart für nahezu zwei Jahrtausende verschüttete. 2. Flexion. Die Komparation der Adjektiva erscheint in unseren Schulgrammatiken traditionell unter dem Oberbegriff .Nominalflexion' oder .Deklination'. Das ist nach unserem Deklinationsbegriff unlogisch, da es sich bei der Komparation nicht um .Beugung', sondern um suffixale Stammerweiterung handelt. Anspruchsvollere Schulgrammatiken konstatieren die Unlogik, erklären sie aber nicht, sondern rechtfertigen sie mit „praktischen Gründen" (so z. B. Zinsmeister [119], S. 79). Auch diese Unlogik geht auf eine Vermengung der stoischen mit der alexandrinischen (d.h. der inhaltsbestimmten mit der formbestimmten) Sprachauffassung durch D. T. zurück: Die stoische Auffassung unterschied zwischen einer rein formalen „zufälligen" oder „sich ergebenden" (συμ-βεβηκότα ~ accidentia) Formenbildung ohne Bedeutungsveränderung des Grundbegriffs und einer Formenbildung mit Bedeutungsveränderung des Grundbegriffs (Ableitungen, Komposita). Beide Arten der Formenbildung nannten die Stoiker κλίσις ( ~ declinatio). Zur ersten Art rechneten sie die κλίσις nach dem Genus, Numerus und Kasus, aber auch durch Verkleinerung (genus declinationis minuendi bei Varrò, ling. 8,52) und durch Steigerung (genus declinationis augendi ebd.). Unter diesem κλίσις-Begriff (der auf Aristoteles' πτώσις-Begriff zurückgeht, s. o. S. 648), war die Zusammenstellung der Kasusdeklination mit der Komparation höchst sinnvoll. D.T. engte den stoischen κλίσις-Begriff auf die Flexion nach Genus, Numerus und Kasus ein, ließ aber die Komparation an ihrem alten Platz stehen, - wo sie nun systemwidrig heute noch steht. Der besonders von der modernen linguistischen Kritik wieder unterstrichene Mangel an logischer Konsequenz ist nach Ausweis schon dieser wenigen Beispiele durchaus nicht als unausweichliche Folge einer grundsätzlich naiven und dilettantischen Sprach-Observation in unsere Schulgrammatik hineingekommen, sondern großenteils als eher zufälliges Ergebnis einer bestimmten wissenschaftshistorischen Konstellation. Unter den Händen eines überlegeneren Geistes, als es D. T. war, hätte die erste Systematisierung der um 100 v. Chr. verfugbaren grammatikalischen Erkenntnisse vermutlich größere Homogenität gewonnen. So jedoch wurde die Techne des D.T. - wohl nicht zuletzt gerade wegen ihrer vereinfachenden formalisierenden Grundtendenz - zum Standardwerk und damit zum Modell nicht nur für die griechische, sondern auch für die lateinische Nationalgrammatik. Fürs Griechische blieb sie - immer wieder abge203 schrieben, bearbeitet, kommentiert I - die Summa grammaticae bis zu den byzantinischen Grammatikern des Mittelalters, und durch deren Bearbeitungen
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
651
hindurch (und an ihnen vorbei) sogar bis zu Melanchthon; ihr Autor heißt bis zur Renaissance oft einfach ό τεχνικός, wie Homer ό ποιητής heißt. Fürs Lateinische wurde sie - nachdem sich Varros primär stoisches System wohl vor allem für den Schulgebrauch als zu kompliziert erwiesen hatte (s. u. S. 655 f.) durch teilweise wörtliche Übersetzungen voll adaptiert. Damit gingen ihre Sprachbetrachtungsweise, ihre Methode, ihr äußerer Aufbau und ihre Terminologie (diese in oft künstlicher Wort-fiir-Wort-Übersetzung, mit allen daraus resultierenden Konnotationsverlusten) direkt ins Lateinische und vom Lateinischen später in die europäischen Nationalsprachen über (meist wiederum mit Wort-für-Wort-Übersetzungen, z.B. άντ-ωνυμία ~pro-nomen ~ Für-wort). Es kann danach festgehalten werden, daß die Kulturnationen des Abendlandes über den Schulunterricht (Grammatik leitete seit dem Ausgang der Antike das .Trivium' ein) seit ca. 100 ν. Chr. Sprache (und damit Welt) mit den Augen des Dionysios Thrax sehen gelernt haben. Bei dieser Bedeutung des Werks ist eine Skizze seiner Anlage wohl nicht unangebracht. Die Anlage der Τέχνη Γραμματική des Dionysios Thrax16 Die älteste erreichbare Fassung der Techne umfaßt in der textkritischen Ausgabe Uhligs [79] 395 Zeilen; das wären ohne Apparat 10 Seiten. Davon ist ein Fünftel der Lautlehre, der Rest der Formenlehre gewidmet. Eine Syntax enthielt das Werk nicht. Auf die (I) Definition der Grammatik (s.o. S. 641) folgen (II) Prolegomena; darin wird zunächst die Grammatik in 6 Sektionen gegliedert, vom prosodisch richtigen und textsortenangemessenen Lesen über Figuren-, Glossen- und Etymologien-Erklärung sowie Formenbestimmung bis zur ästhetischen Wertung („die das Schönste von allem in der Techne ist"). Dieser .literaturwissenschaftliche' Grammatikbegriff der Prolegomena deckt sich nicht mit dem rein .linguistischen' der Definition; er könnte eine .VorwegVerteidigung' gegen stoische Angriffe sein 17 (im folgenden wird von D. T., wenn überhaupt, nur einer der 6 .Teile' behandelt: der .linguistische' [Formenbestimmung]). - Es folgen 3 Zei-
Aufbau-Analyse und Bibliographie bei Fuhrmann [42]. - Den griech. Termini sind in Klammern die kanonisch gewordenen lat. Grammatiker-Übersetzungen beigefügt. 17 In den Augen der Stoiker, die in der Grammatik nur ein Teilglied eines umfassenden philosophischen Welterklärungsuntemehmens sahen (vgl. Pfeiffer [37], 297), galten die alexandrinischen Philologen und Grammatiker als Handwerker; Krates provozierte den γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς Aristarchi, indem er sich stolz κριτικός nannte (vgl. Pfeiffer 199. 295 mit Anm. 60). Wenn der ,literaturwissenschaftliche' Abschnitt der Prolegomena mit seiner Betonung der κρίσις ποιημάτων daher überhaupt von D. T. stammen soll, muß er apologetisch gemeint sein.
652
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
len über die 3 Akzente und 6 Zeilen über die 3 Interpunktionszeichen. - Nach einem (wohl unechten) Einschub über die Etymologie von ραψ-ωδία folgt die (III) Lautlehre (Περί στοιχείου): Es gibt 24 Buchstaben (γράμματα, s.o. S. 645), von α bis ω; davon sind 7 φωνήεντα (~ vocales): α ε η ι ο υ ω (sie heißen so, weil sie ihren Ton selbst tragen; s. o. S. 647 zu Aristoteles; 2 von ihnen 204 sind immer lang: I η und ω, 2 kurz: ε und o, 3 sind δίχρονα [.doppelzeitig', d.h. kurz oder lang]: α ι υ; sie treten zu 6 δί-φθογγοι [~ diphthongi] zusammen: αι αυ ει ευ οι ου), die übrigen 17 sind σύμ-φωνα (~ con-sonantes, con-sonae) ... (es folgen Aufzählung und Definition); davon sind 8 ήμί-φωνα (~ semi-vocales): ζ ξ ψ λ μ ν ρ σ , 9 α-φωνα (~ mutae): β γ δ κ π τ θ φ χ ; von diesen sind 3 ψιλά (~ tenues): π τ κ, 3 δασέα (~ aspiratae): φ θ χ, 3 μέσα (~ mediae): β δ γ (sie heißen μέσα, weil sie zwischen behaucht und unbehaucht stehen). Drei der σύμφωνα sind διπλά (~ [consonantes] duplices ~ ,Doppelkonsonanten'): ζ (,,έκ του σ και δ"), ξ (,,έκ του κ καί σ"), ψ (,,έκ του π καί σ"), 4 sind ά-μετά-βολα oder ύγρά (~ liquidae): λ μ ν ρ. [ - Hier ist eingeschoben eine vollständige Aufzählung der Laute, auf die griech. Wörter enden können, mit Beispielen.] - Es folgt eine 25 Zeilen umfassende (TV) Silbenlehre (Definition der συλ-λαβή ~ syl-laba, Erklärung der Länge bzw. Kürze von Silben durch die Scheidung zwischen φύσει ~ natura und θέσει ~ positione, Erklärung des Gesetzes ,vocalis ante vocalem corripitur', Erklärung der Silbenkürze vor Muta cum liquida). Diese Akzent-, Interpunktions-, Laut- und Silbenlehre leitet in nahezu unveränderter Form auch heute noch unsere Schulgrammatiken ein, vgl. z.B. Zinsmeister [119], Bornemann-Risch [120]. Der gesamte folgende Teil, die (V) Formenlehre, steht unter dem Titel Περί λέξεως (λέξις ~ vox [articulata] oder dictio). D.T. beginnt mit der (1) Definition des Wortes (λέξις έστί μέρος ελάχιστον του κατά σύνταξιν λόγου ~ dictio est pars minima orationis constructae, id est in ordine compositae; Prise. II 53,8) sowie der (2) Definition des Satzes und geht dann zu den (3) Redeteilen über: Του δέ λόγου μέρη έστίν όκτώ (- partes orationis quot sunt? Octo!: Donat., Ars minor 355,2), όνομα (~ nomen), ρήμα (~ verbum), μετ-οχή (~ partieipium; Definition: Μετοχή έστι λέξις μετ-έχουσα της των ρημάτων καί της των ονομάτων ιδιότητος ~ partieipium est [...] dicta, quod partem capiat nominis, partem verbi: Donat., Ars minor 387,18), άρθρον (~ articulus, bei den lat. Grammatikern wegen der Artikellosigkeit des Lateinischen in der Regel durch die interiectio ersetzt), άντ-ωνυμία (~ pro-nomen), πρό-θεσις (~ prae-positio), έπί-ρρημα (~ ad-verbium), σύν-δεσμος (~ con-iunctio). Im folgenden werden diese 8 Redeteile in der gleichen Reihenfolge in 8 Unterabschnitten abgehandelt. Den größten Raum nehmen naturgemäß Nomen und
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
653
Verbum ein; dabei werden die rein formalen Daten (Genus-, Numerus-, Kasusbildung; Tempus-, Modus-, Diathesenbildung) mit inhaltlichen (~ stoischen) Betrachtungskategorien vermischt: beim Nomen wird ζ. B. einleitend in Appellativa und Eigennamen geschieden, es werden ,proto-typische' Nomina (Γή) von .abgeleiteten' (παρ-άγωγα: Γαιήϊος) abgesetzt (dasselbe beim Verb: άρδω-άρδεύω), die Adjektiva werden in .Seelisches bezeichnende' (σώφρων), .Körperliches bezeichnende' (ταχύς) und .Äußerliches bezeichnende' (πλούσιος) gegliedert, u. a. m. Diese stoischen Elemente, die auch in die lat. Grammatiktradition übergingen und vielfach erst in der Neuzeit von der Formenlehre abgetrennt worden sind, verhindern jedoch nicht die vollständige Deskription aller rein morphologischen Erscheinungen. An Einzelheiten seien erwähnt: beim Genus heißt das 3. Geschlecht nunmehr ούδ-έτερον (~ ne-utrum); bei den άριθμοί (~ numeri) werden I nicht nur ένικός (~ singularis), (δυϊκός (~ dualis) und πληθυντικός 205 (~ pluralis) aufgezählt, sondern es werden auch die Singularia mit Pluralbedeutung (,Kollektiva') wie δήμος (und vice versa: Άθηναι; αμφότεροι) genannt, der spätere ,Nominativus' heißt hier noch [πτώσις] όρθή (~ [casus] rectus); die übrigen sind πλάγιαι ~ obliqui: γενική ~ genitivus, δοτική ~ dativus, αιτιατική ~ accusativus, κλητική ~ vocativus; bei den Modi (έγ-κλίσεις ~ diversae inclinationes animi: Prise. VIII 421,17) erscheint neben der οριστική (~ definitivus oder indicativus), προστακτική (~ imperativus), εύκτική (~ optativus), υποτακτική (~ sub-iunetivus bei Prise. VIII 421,19, aber con-iunctivus schon bei Donat) auch die απαρέμφατος (~ infinitivus); bei den συ-ζυγίαι (~ con-iugationes) wird bereits nach dem Stock-Auslaut in Verba vocalia (pura und contracta getrennt) und consonantia (muta und liquida getrennt) geschieden. Die Übereinstimmung auch der Formenlehre mit unserer Schulgrammatik fällt ohne weiteres ins Auge. Über die Regeln, die bei der »Zusammenstellung' der Wörter zum Satz (= σύνταξις) wirksam sind, war vor D. T. offensichtlich noch wenig nachgedacht worden (vgl. o. S. 649 zu Aristoteles); auch D. T. selbst sah in der σύνταξις kaum mehr als eine selbstverständliche Sprachgegebenheit (vgl. seine Definition des Wortes, o. S. 652) und thematisierte sie infolgedessen nicht. Das mußte bei der Modellfunktion seines Abrisses zur Etablierung eines syntaxlosen Grammatiktyps führen; dieser Typ, der zur Norm sowohl der griechischen als auch der in ihrem Gefolge entstandenen lateinischen Schulgrammatik wurde, hielt sich bis ins 18. Jahrhundert hinein (s. auch u. S. 660). Daran änderte auch das Lebenswerk jenes Sprachforschers nicht viel, der sich als erster und einziger antiker Grammatiker schöpferisch der Syntax widmete:
654
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Apollonios Dyskolos v. Alexandreia (2. Jh. n. Chr., unter Antoninus Pius zeitweilig in Rom). Seine Werke - ca. 30 Spezialabhandlungen über einzelne Redeteile (z.B. Όνοματικόν, 'Ρηματικόν); erhalten sind nur drei kleinere Schriften über das Pronomen, das Adverb und über die Konjunktionen, außerdem die vier Bücher Περί συντάξεως - erschienen zu einem Zeitpunkt, als sich das Werk des D. T. bereits seit rund 250 Jahren in den Händen der Griechisch- und durch Übertragungen und Bearbeitungen auch der Lateinlehrer befand; da sie zudem keine Lehrbücher waren, sondern echte Forschungsarbeiten („ich frage mich, ob ...", „ich erkläre mir das so ..."), konnten sie niemals die gleiche Wirkung erreichen wie das Kompendium des D.T. Daß zumindest das Hauptwerk des Apollonius, die .Syntax', Eingang in die abendländische Grammatiktradition fand, verdanken wir vor allem Priscian, der sie - in ζ. T. wörtlicher Übersetzung - als Bücher 17 und 18 seinen ,Institutiones grammaticae' anfügte. Apollonios behandelt im wesentlichen das, was wir die »Syntax des erweiterten Einzelsatzes' nennen würden (die nächsthöhere Stufe: Klassifikation der Sätze und Analyse des Satzgefüges, haben Antike und Mittelalter noch nicht erreicht). Dabei geht er von den einzelnen Redeteilen aus und zählt für jeden von ihnen die Veränderungen auf, die er durch die σύν-ταξις mit anderen Satzgliedern erleidet. Dieses enumerative Verfahren, das die übergeordnete Einheit des Satzganzen als ,auftraggebende' Instanz kaum in den Blick kommen läßt, hat 206 sich bis I in die modernen Schulgrammatiken hinein erhalten. Ansätze zu einer funktionalen Auffassung, bei der umgekehrt nach den verschiedenen ,Besetzungs'möglichkeiten der Hauptpositionen des Satzes - Subjekt, Prädikat, Ergänzung - gefragt wird, finden sich erst in jüngster Zeit (ζ. B. bei Rubenbauer-Hofmann-Heine [166], ζ. B. S. 122). Bei Priscian (XI1) heißt Apollonios „maximus auctor artis grammaticae". Diese Hochschätzung ist berechtigt. Methode und Ergebnisse des Apollonios imponieren heute noch, vielfach sind sie erstaunlich modern. Mit der ,Syntax' des Apollonios hat die antike Grammatik ihren schöpferischen Höhepunkt erreicht.18 Entdeckung und Systematisierung sind nun abgeschlossen (die Zusammenfügung von Phonologie, Morphologie und Syntax durch Priscian wird ein im wesentlichen mechanischer Akt sein, s. u. S. 657). Es beginnt die traditio, die bis heute andauert.
18
Apollonios' Sohn Herodian widmete sich vornehmlich der Prosodie. Seine im engeren Sinne grammatischen Arbeiten (alle verloren) scheinen nur Ergänzungen gebracht zu haben.
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
655
3. Die Übertragungs- und Anpassungspenode Die für uns früheste nicht-fragmentarisch erhaltene Grammatik des Lateinischen ist die des Marius Plotius Sacerdos (Artes grammaticae; 3. Jh. n. Chr.; bei Keil GL VI 427-546). Sie selbst und alle aus späterer Zeit erhaltenen Artes (Charisius, Diomedes, Donat, Marius Victorinus, Dositheus, Martianus Capeila, Priscianus usw.) sind bereits keine schöpferischen Übertragungen aus dem Griechischen mehr, sondern mehr oder weniger intelligente Kompilationen aus verschiedenen grammatischen Lehrbüchern zweier Hauptstränge der lateinischen Grammatik-Rezeption: (1) der frühesten römischen .Schulgrammatik', die im 2. Jh. v. Chr. entstand, und (2) einer .gelehrten', argumentierenden Anpassungsbemühung, die mit Varrò beginnt und etwa bis zu Flavius Capers (2. Jh. nach Chr.) ,De latinitate' (verloren) reicht. Von rund 200 n.Chr. an wird das Erreichte nur noch „mit geringeren oder stärkeren Modifikationen von einem Geschlecht an das andere vererbt [...], darin modernen Schulgrammatiken vergleichbar" (Barwick [46], 89). Beide Hauptstränge basieren auf der Grundüberzeugung: maxima ex parte Romanus (sc. sermo) inde (sc. a Graeco sermone) conversus est (Quint, inst. I 5,58). Spezifische Eigenheiten des Lateinischen werden daher als idiomata nostri sermonis (Remmius Palaemon bei Charisius 291 f.) aufgefaßt und teilweise gewaltsam an das griechische System angepaßt (die Artikellosigkeit, der ,Überschuß' eines Kasus, die andersartige Zeitauffassung des lat. Verbsystems, usw.). Die Übernahme beginnt innerhalb des 1. Hauptstranges (.Schulgrammatik'): primus igitur, quantum opinamur, Studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallotes (Suet. gramm. 2, 1). Das war im J. 168 v.Chr. Möglicherweise hat Krates nicht nur Vorlesungen gehalten (plurimas acroasis subinde fecit: Suet, a. O.), sondern auch bereits eine pergamenische Bearbeitung des stoischen Grammatiklehrbuch-Typs Περί φωνής τέχνη nach Rom gebracht. Sicher ist das für Diogenes von Babylon, den Nachfolger Chrysipps in der Leitung der Stoa; vermutlich hat ein Mitglied des Scipionenkreises (Panaitios war Diogenes' Schüler) die Diogenes-Schrift Περί φωνής τέχνη ins Lateinische übertragen (Diogenes I besuchte 155 Rom). Die Übertragung wurde offenbar zur Grundlage 207 der lat. Schulgrammatik, d.h.: die lat. Schulgrammatik entstand noch vor dem Erscheinen der Τέχνη γραμματική des D.T. (der, wie oben S. 649 gezeigt, seinerseits auf den Grammatikstudien der Stoiker fußte, möglicherweise [so Barwick 93] ebenfalls auf Diogenes v. Babylon). Noch Varrò hat sich in De lingua latina und in seiner Ars grammatica (= Disciplinarum lib. I) eng an die stoischpergamenische Richtung angelehnt. Gleichzeitig beginnt aber schon bei ihm im
656
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Zuge seiner gelehrten Anpassungsbemühungen der Einfluß des inzwischen erschienenen Lehrbuchs des D.T. wirksam zu werden. Dieser Einfluß setzt sich dann ca. 50 Jahre später in der (verlorenen) Ars grammatica des Remmius Palaemon (unter Tiberius und Claudius), einem offenbar hochgelehrten und ideenreichen Werk, gegenüber der stoischen Grammatik-Basis so stark durch, daß vom stoischen System nach Palaemon im wesentlichen nur noch die formale Lehrbuchgliederung in 3 Teile Übriggeblieben ist: I. Definition und Lautlehre II. Formenlehre - III. (1) Sprachnormlehre: άρεταί tccd κακίαι λόγου ~ virtutes et vitia orationis (έλληνισμός; βαρβαρισμός, σολοικισμός ~ latinitas; barbarismus, soloecismus), (2) Figurenlehre (rhetorisch): περί τρόπων και σχημάτων ~ de tropis et schematibus. Davon bewahrt nur noch Teil III (den D. T. bei der Abfassung seiner Τέχνη weggelassen hatte) in stärkerem Umfang stoisches Gut, die Teile I und II lehnen sich sowohl in den allgemeinen Kategorien der Sprachbetrachtung wie in der Terminologie engstens (meist in wörtlicher Übersetzung, s.o. S. 651) an D.T. an. Soweit die grundsätzliche Andersartigkeit des Lateinischen eine Anpassung an das griechische System (und damit dessen Modifikation) unumgänglich machte, scheint diese vornehmlich von Remmius Palaemon geleistet worden zu sein: Er hat sowohl beim lat. Verbum als auch beim lat. Nomen vier ordines eingeführt, beim Verbum nach dem Ausgang der 2. Pers. Sg. Ind. Präs. Akt. (-äs, -es, -Is, -is), beim Nomen nach dem Gen. Sg.-Ausgang (-ae, -Ί, -is, -üs; -ei subsumierte er als Appendix dem 3. ordo, später wurden die Wörter auf -es, -ei zur 5. Deklination zusammengestellt); beide Einteilungen sind bis heute bewahrt worden. Andere hervorragende Einfalle wie der Ansatz eines casus septimus (~ separativus) haben sich nicht durchgesetzt; auch von seinen Syntax-Ansätzen (z.B. Entwurf einer consecutio temporum) hat sich wenig bei seinen Nachfolgern erhalten. Die Kompilationen seit Sacerdos erscheinen in drei Grundformen: 1. als Elementargrammatiken: Äußerst knapp, in Anlehnung an die stoische Περί φωνής τέχνη und an D.T.' Τέχνη γραμματική, entsprechen sie der Schulgrammatik als ,Schülergrammatik' für den Anfangsunterricht; Beisp.: Donatus, Ars minor, 2. als Elementargrammatik mit erläuternden Zusatzabschnitten (~ Schulgrammatik als Schüler- + Lehrergrammatik für den gesamten Grammatikunterricht; Beisp.: Charisius; Donat, Ars maior),
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
3.
657
als ausführliche, argumentierende .wissenschaftliche' Grammatik (anknüpfend an Varrò, Remmius Palaemon, Caper, Terentius Scaurus usw. vor allem Priscian).
Die gleichen drei Grammatik-Typen kennen auch wir noch. I Den Abschluß der antiken Grammatik stellt die Zusammenfassung aller ver- 208 fügbaren Kenntnisse in den 18 Büchern .Institutiones grammaticae' des aus Caesarea in Mauretanien stammenden, unter Anastasios I. (491-518) und Justinian (527-565) in Konstantinopel lehrenden Priscianus dar. Das Werk ist die vollständigste deskriptive Grammatik des Lateinischen bis hin zu den großen wissenschaftlichen Grammatiken des 19. Jahrhunderts; es bildet infolgedessen (über Donat hinaus) die Hauptquelle für sämtliche lateinischen (Schul-)Grammatiken des Mittelalters und der Renaissance. Unmittelbar als Schulgrammatik war es jedoch wegen seiner Detail- und Zitatenfülle sowie wegen seiner anspruchsvollen Argumentation nicht verwendbar; seine Kenntnis wurde im Mittelalter erst beim Abschlußexamen des Universitätsstudiums (Lizentiat) vorausgesetzt. Priscian ist sich des Kompilationscharakters seiner Arbeit bewußt, s. z. B. Vorrrede zu Buch V: „pleraque quidem a doctissimis viris, paucula tarnen et a me pro ingenii mediocritate inventa exponam". - Den Inhalt des Werkes gibt er selbst im Widmungsschreiben so an: B. I: De voce et litera. - Β. II: De syllaba. De dictione. De oratione et de octo partibus orationis. De nomine (Appellativa, Adiectiva, Derivativa, Patronymica, Possessiva). - Β. ΠΙ: De comparativis et superlativis. De diminutivis. - Β. IV: De denominati vis. - Β. V: De generibus. De numeris. De figuris. De casu. - Β. VI: De nominativo et de genitivo. - Β. VII: De ceteris obliquis casibus. - Β. VIH: De verbo. - Β. IX: De regulis generalibus omnium coniugationum. - Β. X: De praeterito perfecto. - Β. XI: De participio. - Β. XII u. ΧΙΠ: De pronomine. - Β. XIV: De praepositione. Β. XV: De adverbio et interiectione. - Β. XVI: De coniunctione. - Β. XVII u. XVIII: De construction sive ordinatione partium orationis inter se (= Apollonios Dyskolos, s. o. S. 654).
Dank der Bildungskontinuität im Oströmischen Reich (insbes. Universität von Konstantinopel) und der Übernahme des Schulwesens durch die Kirche im westlichen Reichsteil ist die Priscian- und damit die allgemeine Grammatikkenntnis auch während der periodischen Bildungszusammenbrüche im Europa der Völkerwanderungszeit niemals ganz abgerissen; durch die Mission wurde sie nach Nordwesteuropa (Irland, Schottland, England) exportiert und hat von dort aus über die karolingische Renaissance wieder auf Kontinentaleuropa zurückgewirkt. 4.
Die
Reproduktionsperiode
Zwischen Priscian und der Renaissance werden in der lateinischen und griechischen Grammatik keinerlei neue Entdeckungen gemacht. Der Grammatikunter-
658
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
rieht in den Kloster- und Kathedral- bzw. (im Ostreich) Patriarchatsschulen basiert im Griechischen auf D. T. und Apollonios, im Lateinischen auf Donat (die Schüler lernen .ihren' Donat, so wie in der Neuzeit .ihren' Landgraf-Leitschuh). Obwohl der Grammatikunterricht des Lateinischen (im Westreich später auch des Griechischen) nunmehr Fremdsprachenunterricht ist, werden die antiken Grammatik-Lehrbücher didaktisch nicht verändert. Übertragungen in die europäischen Nationalsprachen bleiben Ausnahmen (z.B. die auf englisch abgefaßte lat. Grammatik des Aelfric um 1000); die Regel bilden die überaus zahlreichen lateinisch geschriebenen, für den Schulgebrauch abgekürzten Donat- und Priscian-Fassungen. Unter diesen nehmen nach den Grammatiken des Alcuin (Ende des 8. Jahrhunderts) und des Franken Hrabanus Maurus (um 830) als Lehrbücher den ersten Platz ein das .Doctrinale' des Alexander de Villa Dei (= Alexandre de Villedieu in der Normandie, später Minorit in Paris), zuerst er209 schienen um I 1200 und bis ca. 1500 in 50 Auflagen und ca. 230 kommentierten Ausgaben in ganz Europa verbreitet, sowie der .Graecismus' (so benannt von den zahlreichen griechischen Wörtern) des Eberhardus von Béthune (Nähe Lille), erschienen 1212 und ebenfalls sehr stark benutzt. Beide Werke sind zur Lemerleichterung in Versen abgefaßt (Alexander: 2645, Eberhardus: 4440 leoninische, d. h. binnengereimte, Hexameter). Das Niveau dieser Reimgrammatiken ist durchaus un verächtlich; als Beispiel diene aus dem .Syntax'-Teil des .Doctrinale' die Behandlung der Attractio relativi: Quando relativum generum casus variorum inter se claudunt, qui rem spectant ad eandem, per genus hoc poterit utrilibet equiperari: Est pia stirps iesse quem Christum credimus esse. Wie schwierig allein das Verständnis der Verse (ohne die Sache) war, zeigen die Kommentare, die nicht etwa nur Erklärungen der jeweils behandelten grammatischen Erscheinung mit Beispielen und Diskussion der Literatur geben, sondern durch übergeschriebene Interlinearglossen das elementare Textverständnis zu sichern bemüht sind.
Die Sterilität des reproduktiven Grammatikbetriebs wird seit etwa der Mitte des 12. Jahrhunderts durchbrochen durch die folgenreiche Bewegung der Modistae (so genannt nach dem üblichen Titel ihrer grammatischen Werke ,De modis significandi'; am bekanntesten ist die dem Duns Scotus zugeschriebene um 1300 erschienene .Grammatica speculativa sive De modis significandi'). Die Bewegung erwächst aus der Neubegegnung der Scholastik mit der griechischen Philosophie, insbesondere mit Aristoteles, im Gefolge der Kreuzzüge mit ihren byzantinischen, arabischen (Averroes, Avicenna) und jüdischen Wissenschaftseinflüssen. Ziel der Bewegung ist die logische Begründung der gramm. Regeln
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
659
durch ihre Zurückführung auf universallogische Prinzipien; Ausgangspunkt ist Aristoteles, De interpretatione 1: „Wie die Schrift, so ist auch die Sprache nicht dieselbe bei allen Völkern. Aber die geistigen Vorgänge als solche, von denen die Wörter vornehmliche Zeichen sind, sind dieselben für die ganze Menschheit". Sprache wird dementsprechend von den Modistae als Reflex, Abbildung (speculum Grammatica speculativa) der Wirklichkeit über das vermittelnde Zwischenglied von Vorstellungen (conceptus, conceptiones) aufgefaßt, und in betontem Gegensatz zur eindimensionalen (die Beziehungen der Wörter untereinander untersuchenden) traditionellen Deskriptionsgrammatik wird versucht, eine zweidimensionale Erklärungsgrammatik (Beziehungen zwischen Wörtern und Dingen, nomina et res) zu schaffen. Mit dieser Zielsetzung, innerhalb deren z. B. die Unterscheidung von .Oberflächen-' und .Tiefenstruktur' selbstverständlich ist, gehen die Modistae in die gleiche Richtung wie die spätere .Grammaire raisonnée' oder .Grammatica universalis' und die moderne .Transformationsgrammatik'. Daß die Modistae, wohl vorwiegend über die Renaissance-Grammatik (z.B. über Scaliger [149] und Sanctius [153]) tatsächlich auf die Universale Grammatik (z. B. von Port-Royal) und über sie auf die neuere Schulgrammatik einwirkten, ist nach der früher üblichen Geringschätzung der ganzen Richtung („unnütze Subtilitäten und [...] Scheinwissen": Bursian [15], 89) in neuester Zeit besonders von Padley gezeigt worden. 19 I Auf den zeitgenössischen Grammatikunterricht hatten die Sprachtheorien der 210 Modistae allerdings so gut wie keinen Einfluß; in den Schulen und weithin auch Universitäten behaupteten für das Lateinische weiterhin Donat, Priscian, Alexander und Eberhardus das Feld, und auch für das Griechische wurde die antike Tradition - hier von den byzantinischen Gelehrten - lediglich fortgeführt (Grammatiken von Manuel Moschopoulos, um 1300; Manuel Chrysoloras, um 1375; Theodoros v. Gaza, um 1450; Konstantin Laskaris, 1476; Demetrios Chalkondyles, 1493, u. a.). 5.
Die Observationsperiode (ca. 1450-1850)
Die Wiederentdeckung der Antike in der europäischen Renaissance des 14.16. Jahrhunderts führte zu einer Neubelebung auch der grammatischen Studien. Im Anschluß an grammatische Werke italienischer Humanisten (bes. Laurentius Valla, 1444 [137]) entstehen unter Auswertung der wiederentdeckten nichtchristlichen antiken Autoren insbesondere nach der Erfindung des Buchdrucks Padley [68], besonders die Kapitel 4 und 5 sowie S. 260-263, aufbauend auf Robins [23], 17.
660
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
in ganz Europa Unmengen20 von Schulgrammatiken, die dem im Mittelalter etwas heruntergekommenen Grammatikunterricht an den nun überall aus dem Boden schießenden Bürgerschulen eine neue, solide Grundlage geben. Das grammatische System der Antike wird dabei von den Humanisten unverändert gelassen; die Fortschritte liegen (1) in der Wiederherstellung der klassischen Sprachreinheit durch Zurückdrängung der theologischen (Bibel- und Kirchenväter-)Texte und durch strenge Observation des Sprachgebrauchs der lateinischen und griechischen Klassiker, (2) in der wesentlich verbesserten didaktischen Aufbereitung des Stoffes (durchgehend Prosa-Lehrbücher; Vereinfachungen, klarere Definitionen, besser ausgewählte Beispiele, größere Übersichtlichkeit durch differenzierendes Druckbild, Tabellen u.dgl.). Ihren Impetus beziehen die Verfasser der Schulgrammatiken vornehmlich aus ihrer Frontstellung gegen das .Doctrinale' mit seiner theologischen Grundausrichtung, in geringerem Maße auch gegen die universallogische Tendenz der Modistae. Grammat i k ^ / ist die auf präziser Observation beruhende .scientia recte scribendi et loquendi' (s. unten zu Frischlin). Der Humanistenhang zu ausgedehnter Polemik führt zu vielen äußerlichen Verbesserungen der Schulgrammatik, das System bleibt unangetastet (nennenswerte sachliche Fortschritte fast nur in der Grammatik des Griechischen: Aussprachegesetze, Erkenntnis der Kontraktionsregeln). Die frühen Humanistengrammatiken zeichnen sich durch außerordentliche Kürze (um die 30 Seiten), Klarheit und Einfachheit aus.21 Die Syntax nimmt in den Grammatiken beider Sprachen getreu der alten Tradition (s.o. S. 653) nur sehr geringen Raum ein und wird zunächst nur in separaten Abhandlungen erörtert (z.B. J. Varennius, 1522 [97]). Eine (durchaus beherzigenswerte) Begrün211 dung I dafür lautet bei N. Clenardus 1530 [102], S. 104: „De Graecorum constructione tantum praecipienda sunt ea, in quibus nobiscum non consentiunt". In der Regel wird aber der Verzicht auf die Syntax mit deren Kompliziertheit und hohem Subjektivitätsgrad begründet: Syntax kann nur durch vieles Lesen, Schreiben und Sprechen erlernt werden, nicht durch jahrelanges Regelstudium, das das erklärte Lernziel - flüssiges Schreiben und Sprechen in der Fremdspra20
Nicodemus Frischlin sagt in der Vorrede zu seiner ,Strigilis Grammaticae... ', Straßburg 1594: „Nam hodie ferme tot sunt Grammaticae quot sunt illustriores scholae, in universo Christiano orbe". 21 Ζ. Β. die erste griech. Schulgrammatik Deutschlands, das .Elementare Introductorium in idioma graecanicum', Erfurt 1501 (Verf. unbekannt), aber auch die griech. und lat. Schulgrammatiken Melanchthons, 1518 bzw. 1526, immer wieder aufgelegt und bis weit ins 18. Jh. hinein gebräuchlich.
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
661
che - nur hinauszögern würde. Die Kürze der Humanistengrammatik hat dieselbe Ursache: die Grammatik soll den Lehrer, der Zentrum des Unterrichts ist, unterstützen, nicht ersetzen oder behindern; daher beschränkt sich die Schulgrammatik auf die Grundtatsachen, stellt also eine Art,Fibel' dar; genauere Erläuterungen, oft auch didaktische Hinweise, enthalten die regelmäßig beigegebenen Appendices für den Lehrer (siehe unten zu Sanctius' Minerva). - Oft erscheinen die Humanistengrammatiken noch in der antiken und mittelalterlichen (dort mnemotechnisch bedingten) Frage-Antwort- (= Έρωτήματα-)Ροπη, die erst mit der wachsenden Selbstverständlichkeit des Buches allmählich verschwindet (ζ. Β. N. Frischlin, 1585 [152]: „Quid est grammatica? - Grammatica est recte seu pure loquendi scientia ..." usw. Die Reihenfolge der Fragen und Antworten entspricht dem traditionellen Grammatikschema). Als Beispiel für die Anlage der humanistischen Schulgrammatik beider Sprachen möge die bis ins 19. Jahrhundert hinein hochberühmte lateinische Schulgrammatik des F. Sanctius dienen (Salamanca 1587 u.ö.), bekannt unter dem Namen ,Minerva'. Die Schulgrammatik umfaßt 37 Seiten (Oktavformat). Der Aufbau ist einfach: I. De partibus orationis. - II. De quantitate syllabarum. - HL De constructione. - Teil I ist noch einmal unterteilt in 1. Induktion der grammatischen Grundbegriffe ,Laut, Silbe, Wort usw.' und 2. Regeln. Die partes orationis werden in Teil 11 in folgender lapidarer Kürze induziert: Grammatica est ars recte loquendi: cuius finis est congruens oratio. Oratio constat ex vocibus: voces ex syllabis: syllaba ex literis. Litera est individui toni comprehensio: estque Vocalis aut Consona. Vocalis est litera, quae per se syllabam efficit; ut a, e, i, o, u. Ex his quatuor ñunt Diphthongi: ae, oe, au, eu; ut aes, poena, laurus, eurus: & yi Graeca; ut Harpyia. - Consona sine vocali syllabam non efficit. Sunt autem quindecim (folgt Aufzählung und Einteilung mit näheren Bemerkungen; dann:) Syllaba est... (Definition, Einteilung in kurze, lange und ancipites). Vox seu dictio est, qua unumquodque vocatur. Cui accidunt Accentus, Figura, Species (folgen die Definitionen). Voces omnes aut numeri participes sunt aut expertes. Numerus est differentia vocis secundum unitatem aut multitudinem (Einführung von .Singular' und .Plural'). Voces numeri participes sunt: Nomen, Verbum, Participium, - expertes numeri: Praepositio, Adverbium, Coniunctio. Quae partes orationis appellantur. Darauf folgt der Regelteil. Sämtliche Genusregeln mit Beispielen werden z. B. auf 2 Seiten untergebracht, sämtliche Deklinationsregeln der 5 Deklinationen mit Beispielen und den wichtigsten Regelabweichungen auf 4 1/2 Seiten. - Im Teil ΙΠ werden behandelt: Kongruenz, reflexive und nicht-reflexive Possessiv-Pronomina, die gesamte Kasus-Rektion, Aktiv und Passiv, Transitivität und Intransitivität, Verba Impersonalia, Verba substantiva, Partizip, Gerundium und Gerundivum, Supinum (nur I; mit Induktion des Inf. Fut. Pass, -tum iri), der Gebrauch der Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen - alles auf 14 Seiten. Eine Syntax des erweiterten Satzes wird nicht gegeben (s. dazu o. S. 653).
662
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Der eigentlichen .Grammatica' geht eine 466 umfassende gelehrte Begründung für den Lehrer voraus: die .Minerva' (nach Ilias V: Athene macht Diomedes se212 hend). In dieser berühmten Abhandlung, die in späteren Schulgrammatiken I bis ins 19. Jahrhundert hinein den Schülern zumindest der Oberklassen zur Lektüre empfohlen wird 22 , sucht Sanctius nach dem Vorgang J.C. Scaligere [149] in dauernder kritisch-polemischer Auseinandersetzung mit der gesamten vor ihm liegenden Grammatiktradition seit Platon (1) eine rationale Begründung der lateinischen Sprachregeln zu geben („causas rationesque", S. 2) und (2) diese rationale Begründung nicht mit Grammatiker-Ansichten zu belegen („improbantes ... illud Ipse dixit", S. 4), sondern mit dem Sprachgebrauch der klassischen Autoren selbst („testimonia", „exempla", „usus", S. 4/5). Mit dieser doppelten Zielsetzung führt Sanctius, wie sich leicht sehen läßt, die Intention der Modistae mit der des Humanismus zusammen. In der Folgezeit haben sich die beiden Stränge wieder getrennt: die rationalisierende Richtimg wurde von der (philosophischen), Grammaire raisonnée' oder .Grammatica universalis' (ζ. Β. der von Port-Royal23) fortgeführt, die positivistische (empirische) von den griechischen und lateinischen Schulgrammatiken des 17. und 18. Jahrhunderts, die immer stärker zu monströsen Beispielsammlungen anschwollen.24 Die Wiedervereinigung der beiden Stränge erfolgt (von Humboldt abgesehen) speziell für die Grammatik der Alten Sprachen theoretisch in einer ProgrammErklärung F. A. Wolfs im ,Organon der Alterthumswissenschaft' (in: .Museum der Alterthumswissenschaft', Bd. 1, 1807), praktisch in den großen wissenschaftlichen Grammatiken von Buttmann [113], Matthiä [114] und Kühner [115] und anschließend in den von ihnen abhängigen Schulgrammatiken des 19. Jahrhunderts.25 Insgesamt gesehen bringen die rd. 400 Jahre der Observationsperiode für die Schulgrammatik eine starke Erweiterung und Verfeinerung, jedoch keine Ände22 Ζ. B. in Schellers .Ausführlicher lat. Sprachlehre oder sogenannten Grammatik', Leipzig 1790, XV. 23 S ahlin bei Brekle [61], Χ, XV; Donzé [62], 26 f. 24 Ζ. B. Scheller [158], Broeder [160], Das 17. Jh. hatte nach dem ersten Abschluß der Editions- und Kommentierungstätigkeit den Aufschwung der .Realien-' oder , Antiquitäten'-Studien gebracht; die materielle Aufschwemmung der Schulgrammatiken im 18. Jh. ist eine Folge davon (so ζ. B. Broeder: 500 Seiten, schon mit den später obligatorisch gewordenen Anhängen über Metrik, rhetorische Figuren und den Kalender [nur die Maße und Gewichte fehlen noch]; in der Vorrede Betonung der Vollständigkeit und des Chrestomathie-Charakters sowie der Eignung für das Erlernen der fftnübersetzung). 25 Einzelheiten bei Latacz 1974 [19]. 3
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
663
rung des Systems und der grammatischen Sehweise (auch die .Grammaire raisonnée' findet nur an wenigen Systemstellen Eingang in die Schulgrammatik, allerdings an wichtigen; s. Latacz 1974 [19]). Wirklichen Gewinn zieht die Schulgrammatik aus der Stoff-Erweiterung speziell des 18. Jahrhunderts nur in der bis dahin stets stiefmütterlich behandelten Syntax. In dem auf aktive Sprachbeherrschung ausgerichteten Latein- und Griechisch-Unterricht der Antike, des Mittelalters und der Renaissance mußte ein ausgebreiteter Syntax-Teil als entbehrlich erscheinen (s.o. S. 660f.). Der im 17. Jahrhundert einsetzende und im 18. Jahrhundert sich verstärkende Rückgang der Sprechpraxis, I der Latein und Griechisch zu .toten' Sprachen macht, führt 213 nun notwendig zu einer Zunahme syntaktischer Regeln. Dieser Trend hält bis heute an. Die immer feiner werdenden syntaktischen Differenzierungen fuhren seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts dazu, daß der Grammatikunterricht im Lateinischen und Griechischen, anders als in den modernen Fremdsprachen, zur theoretischen Sprachreflexion wird und so die Entstehung eines neuen Bildungsziels des altsprachlichen Grammatikunterrichts begünstigt: der .(formalen) Denkschulung' (vgl. o. S. 647 ff.). 6. Die Periode der Verwissenschaftlichung (ca. 1850 bis zur Gegenwart) Die Entdeckung der indogermanischen Sprachenverwandtschaft durch W. Jones (1786) und F. Bopp (1816) und die daraufhin einsetzende Historisierung der wissenschaftlichen Grammatik läßt zwar auch die Schulgrammatik nicht unberührt, der Einfluß ist jedoch aufs Ganze gesehen nicht sehr tiefgreifend. Regelrechte sprachwissenschaftliche Schulgrammatiken (wie z.B. Sommer [165], Rubenbauer/Hofmann [166], Zinsmeister [119] bleiben die Ausnahme. Im Hauptstrom der Grammatikproduktion werden sprachgeschichtliche Zusammenhänge dort, wo sie erhellend wirken können (bes. in der Laut- und Wortbildungslehre), erwähnt, aber nicht zum Ausgangspunkt der Darstellung gemacht. Schulgrammatiken wie die von Kaegi [117] und Landgraf [163] mit ihrer traditionellen Anlage leben in immer neuen Auflagen und Bearbeitungen bis in die Gegenwart fort. 26
Der alte Materialbestand wird je nach den Erfordernissen der Grammatikdiskussion modernisiert; in den Vorreden wird die jeweils moderne Terminologie salvatorisch komprimiert (s. ζ. B. das Vorwort des 1974 von Bayer-Lindauer neugestalteten .Landgraf-Leitschuh': in wenigen Zeilen präsentiert sich durch Aneinanderreihung modernster Grammatiktermini ein dynamisch-weltoffenes, scheinbar jugendfrisches Werk: „deskriptiv-synchronisch", „funktional", „kontrastiv", „auch zahlreiche Hinweise diachronischer Art", „statistische Erhebungen", „graphisch differenziert", „Zeichencharakter der Sprache", „neueren linguistischen Vorstellun-
664
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Auch gegenüber modernen linguistischen Strömungen wie ζ. B. dem Strukturalismus (seit ca. 1900) oder der Transformationsgrammatik (seit ca. 1960), die ihre Originalität mangels ausreichender grammatikhistorischer Kenntnisse lange Zeit zu überschätzen pflegten (s. dazu z.B. Latacz 1974 [19]), hat sich die Schulgrammatik des Griechischen und Lateinischen dank ihrer in Jahrhunderten erprobten Beharrungskraft bisher behauptet. Allerdings hat der Zwang zur Auseinandersetzung mit diesen Richtungen, wie bisher jedesmal in der Geschichte der Schulgrammatik (vgl. die Auseinandersetzungen mit den Modistae und der .Grammaire raisonnée'), auch diesmal wieder zu einer heilsamen Steigerung des Problembewußtseins sowie der Bereitschaft zu Selbstreflexion und Ideen-Übernahme geführt. In der Konfrontation mit der immer rigoroser werdenden Wissenschaftlichkeit der .Grammatik als solcher' (s.o. S. 640) hat auch die Schulgrammatik an Präzision gewonnen. Indessen: Daß das traditionelle System der griechischen und lateinischen Schulgrammatik als Folge der aktuellen Auseinandersetzung tiefgreifend oder gar grundlegend umgestaltet werden müßte, steht auf I Grund der trotz aller Mängel relativ hohen Erklärungsadäquatheit dieses Systems (s. o. S. 642) kaum zu erwarten.27
Literatur Zum Verhältnis .Wissenschaftliche Grammatik - Schulgrammatik' 1 2 3 4
Arndt, H., Linguistische und lerntheoretische Grundaspekte des Grammatikunterrichts im Englischen, Der fremdsprachliche Unterricht 2, 6 (1968), 3-39. Arndt, H., Wissenschaftliche Grammatik und pädagogische Grammatik, Neusprachliche Mitteilungen 22 (1969), 65-76. Bünting, K. D., Wissenschaftliche und pädagogische Grammatik (Sprachwissenschaft und Sprachlehre), Linguistische Berichte 5 (1970), 73-82 (auch in Nr. 13). Erlinger, H. D., Sprachwissenschaft und Schulgrammatik. Strukturen und Ergebnisse von 1900 bis zur Gegenwart. Düsseldorf 1969 [nur zur Grammatik des Deutschen],
gen gebührenden Raum gegeben" - aber bei allem: „wertvolles Traditionsgut der lat. Schulgrammatik bewahrt"). Die sachlich oft entbehrliche, pädagogisch aber geradezu unsinnige Meta-Terminologisierung des derzeitigen Grammatik-Schuluntenichts (.Linguisten-Chinesisch', oft unfreiwillig komisch, ζ. Β. ,rekodieren' für .übersetzen') stößt bei Praktikern zunehmend auf Ablehnung (s. z.B. Froesch, H., Wo die Strukturbäume in den Himmel wachsen. In: FAZ ν. 27.11.78): als Lernerleichterung gemeint, wirkt sie sich in der Unterrichtspraxis als weitere Distanzvergrößerung zwischen Lernendem und Lernobjekt und damit als Lernerschwemis aus.
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik 5 6 7
8
665
Halliday, M. A. K./Mclntosh, A./Strevens, P., The Linguistic Sciences and Language Teaching. London 1964. Hausmann, F. J., Linguistik und Fremdsprachenunterricht. Tübingen 1975. Jung, L., Linguistische Grammatik und Didaktische Grammatik. Frankfurt/Main 1975 [Versuch einer Umsetzung moderner Grammatiktheorien in die Schulgrammatik des Englischen am Beispiel des englischen Gerundiums], Luther, W., Die neuhumanistische Theorie der „formalen Bildung" und ihre Bedeutung für den lateinischen Sprachunterricht der Gegenwart, AU V 2 (1961), 5-31 (auch in Nr. 12).
9 10 11 12 13
Marrou, H.-I., Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum, hrsg. v. R. Harder. Freiburg - München 1957. München (dtv) 1977. Menzel, W., Die deutsche Schulgrammatik. Kritik und Ansätze zur Neukonzeption. Paderborn 1972. Nickel. R., Altsprachlicher Unterricht. Dannstadt 1973 (bes. Kap. VII; dort weitere Literatur). Nickel, R. (Hrsg.), Didaktik des altsprachlichen Unterrichts. Deutsche Beiträge 1961— 1973. Darmstadt 1974 (WdF 461). Rötzer, H.G. (Hrsg.), Zur Didaktik der deutschen Grammatik. Darmstadt 1973 (WdF 276). I
Übersichtsdarstellungen zur Grammatik-Geschichte 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
Arens, H., Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. Freiburg - München 1955. Bursian, C., Geschichte der classischen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. München - Leipzig 1883. Bursill-Hall, G.L., A Short History of Grammar in Ancient and Mediaeval Europe, Speculative Grammars etc. (s. Nr. 52), 15-36. Gerth, K., Artikel ,Grammatik' in: Pädagogisches Lexikon, hrsg. von H. H. Groothoff und M. Stallmann, Stuttgart - Berlin 2 1964. Hamp, E. P., Artikel „Grammar" in: The New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia. Vol. 8, 1974, Sp. 265-274. Latacz, J., Klassische Philologie und moderne Linguistik, Gymnasium 81 (1974), 67-89. [in diesem Band S. 671-694] Mounin, G., Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle. Paris 1967. Pedersen, H., The Discovery of Language. Bloomington 1962. Reich, G., Muttersprachlicher Grammatikunterricht von der Antike bis um 1600. Weinheim 1972 (Pädagogische Studien, Bd. 19) [Gliederung: Grammatikunterricht bei den Griechen, Römern, Deutschen. Sehr guter Überblick], Robins, R. H., Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe. With particular reference to modern linguistic doctrine. London 1951. 2 1971. Robins, R. H., Dionysius Thrax and the Western Grammatical Tradition, Transactions of the Philological Society (Oxford) 9 (1957), 67-106. Robins, R. H., The Development of the Word Class System of the European Grammatical Tradition, Foundations of Language 2 (1966), 3-19. Robins, R. H., A Short History of Linguistics. London 1967.
215
666 27 28 29 30 31 32
216
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik Robins, R. H., Ideen- und Problemgeschichte der Sprachwissenschaft. Frankfurt/Main 1973. Sandys, J. E., History of Classical Scholarship I. Cambridge 3 1921. Johann, H.-Th. (Hrsg.), Erziehung und Bildung in der heidnischen und christlichen Antike. Darmstadt 1976 (WdF 377). Lersch, L., Die Sprachphilosophie der Alten. Bonn 1838-41. Schoemann, G. F., Die Lehre von den Redetheilen nach den Alten. Berlin 1862. Steinthal, H., Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Berlin 1863. 2 1890/91 (= ND Hildesheim 1961). I
Zur 1. Periode 33 34 35 36 37
Classen, J., De grammaticae Graecae primordiis. Bonn 1829. Forbes, P. Β. R., Greek Pioneers in Philology and Grammar, Class. Rev. 47 (1933), 105112. Glinz, H., Die Begründung der abendländischen Grammatik durch die Griechen und ihr Verhältnis zur modernen Sprachwissenschaft, Wirkendes Wort 7 (1957), 129-135. Koller, H., Die Anfänge der griechischen Grammatik, Glotta 37 (1958), 5-40. Pfeiffer, R., Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Reinbek 1970. München 2 1978.
Zur 2. Periode 38 39 40 41 42 43 44 45
Barwick, K., Remmius Palaemon ... (s. Nr. 46). Barwick, K., Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, Abh. Akad. Wiss. Leipzig 49 (3), 1957. Dahlmann, H„ Varrò ... (s. Nr. 48). Di Benedetto, V., Dionisio Trace e la Techne a lui attribuita, Ann. Scuoi. Norm. Sup. Pisa 27 (1958), 169-210 und 28 (1959), 87-118. Fuhrmann, M., Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike. Göttingen 1960 (zu Dionysios Thrax 29-34). Pohlenz, M., Die Begründung der abendländischen Sprachlehre durch die Stoa, NGG ΠΙ 6 (1939), 151-198. Robins, R. H., Dionysius Thrax ... (s. Nr. 24). Schmidt, R., Stoicorum Grammatica. Halle 1939.
Zur 3. Periode 46 47 48 49 50
Barwick, K., Remmius Palaemon und die römische Ars grammatica. Leipzig 1922 (Philologus Suppl.-Bd. XV 2). Colson, F. H„ The Grammatical Chapters in Quintilian 14-8, CQ 8 (1914), 33-47. Dahlmann, H., Varrò und die hellenistische Sprachtheorie. Berlin 1932. Froehde, O., Die Anfangsgründe der römischen Grammatik. Leipzig 1892. Jeep, L., Zur Geschichte der Lehre von den Redeteilen bei den lateinischen Grammatikern. Leipzig 1893. I
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
667
Zur 4. Periode 51 52 53 54 55 56 57 58
217
Baebler, J. B., Beiträge zur Geschichte der lateinischen Grammatik im Mittelalter. Halle 1885. Bursill-Hall, G. L., Speculative Grammars of the Middle Ages. Den Haag - Paris 1971. Hunt, R.W., Studies in Priscian in the 11"1 and 12th Centuries, Mediaeval and Renaissance Studies 1 (1941/43), 194-231; 2 (1950), 1-56. Paetow, L. J., The Arts Course at Mediaeval Universities with special reference to Grammar and Rhetoric. Urbana 1910. Pinborg, J., Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter. Münster - Kopenhagen 1967. Pinborg, J., Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick. Stuttgart - Bad Cannstatt 1972. Rotta, P., La filosofia del linguaggio nella patristica e nella scolastica. Turin 1909. Voltz, L., Zur Überlieferung der griechischen Grammatik in byzantinischer Zeit, Fleckeisens Neue Jahrbücher 139 (1889), 579-599.
Zur 5. Periode 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Allen, C. G., The Sources of „Lily's Latin Grammar", in: The Library 5.9.1954, 85-100. Breitinger, H., Zur Geschichte der französischen Grammatik 1530-1647. Frauenfeld 1867. Brekle, E., Einleitung zur Neuausgabe der Grammatik von Port-Royal (s. Nr. 156). Donzé, R., La Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Contribution à l'histoire des idees grammaticales en France. Bern 1967. 2 1971 (Bibliographie 234—236). Funke, O., Die Frühzeit der englischen Grammatik. Bern 1941. Jellinek, M. H., Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung. 2 Bde., Heidelberg 1913/14. Kukenheim, L., Contributions à l'histoire de la grammaire grecque, latine et hebraïque à l'époque de la Renaissance. Leiden 1951. Leser, E., Geschichte der grammatischen Terminologie im 17. Jh. Diss. Freiburg 1912. Meech, S. B., Early Application of Latin Grammar to English, Publications of the Modern Language Association 50 (1935), 1012-1032. Padley, G. Α., Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700. The Latin Tradition. Cambridge 1976. Reich, G., Muttersprachlicher Grammatikunterricht... (s. Nr. 22). Shaw, A. E., The Earliest Latin Grammars in English, Transactions of the Bibliographical Society 5 (1899), 39-65.1 Svoboda, Ch., La Grammaire Latine depuis le moyen âge jusqu'au commencement du X K e siècle, REL 3 (1925), 69-77. Vorlat, E., The Development of English Grammatical Theory 1586-1737. With special reference to the theory of parts of speech. Leuven 1975 (bes. 1—IC 420-439). Watanabe, S., Studien zur Abhängigkeit der frühneuenglischen Grammatiken von den mittelalterlichen Lateingrammatiken. Münster/Westf. 1958. Watson, F., The English Grammar Schools to 1960: their Curriculum and Practice. Cambridge 1908.
218
68
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
Verzeichnis der herangezogenen Grammatiken I. Bibliographien 75 76 77
78
Marsden, William, A Catalogue of dictionaries, vocabularies, grammars, and alphabets. London 1796. Vater, J. S., Literatur der Grammatiken, Lexika und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde. Berlin 1815. 2 1847. Enslin, Th. Chr. Fr., Bibliotheca philologica, oder Verzeichniss deijenigen Grammatiken und anderer Werke, welche zum Studium der ... todten Sprachen gehören und vom Jahre 1750 an (zum Theil auch früher)... in Deutschland erschienen sind. Berlin 1826 u. ö. Padley, G. Α., Grammatical Theory (s. Nr. 68), 268-274.
Π. Griechische (Schul-)Grammatiken Die ζ. T. äußerst langen Titel sowie die Erscheinungsorte sind aus Raumgründen weggelassen. 79 um 100 v. Chr. 80 um 180 n. Chr. 81 um 200 82 um 600 83 6.Π. Jh. 84 um 1300 85 um 1375 86 um 1450 87 1476 88 1493 89 1501 90 1512 91 1515 92 1516 93 1517 94 1518 95 1520 96 1522 97 1522 98 99 100 101
1524 1526 1529 1530 102 1530
Dionysios Thrax (ed. G. Uhlig, Leipzig 1883 = Grammatici Graeci I 1) Apollonios Dyskolos (ed. R. Schneideret G. Uhlig, Leipzig 1878 = Gramm. Graeci Π 1) Herodianos Isidorus von Sevilla Choiroboskos Manuel Moschopoulos Manuel Chrysoloras Theodoras v. Gaza Konstantinos Laskaris Demetrios Chalkondyles Anonymos (Elementare Introductorium, s.o. S. 660 Anm. 21) G. Simler I Aldus Manutius Erasmus von Rotterdam (Übers, des Theodoras) O. Luscinius (= Nachtigall) Ph. Melanchthon, Institutiones Graecae Grammaticae G. Budé J. Ceporinus (= Wiesendanger) J. Varennius, Syntaxis Graecae Linguae (mit Zusätzen von Camerarius öfter aufgelegt) Rithaemerus J. Camerarius Metzler Macropedius N. Clenardus
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik 103 104 105 106 107 108 109 110 111
1536 1536 1539 1563 1589 1589 (1590 1635 1655
112 113 114 115 116 117 118 119 120
1732 1807 1812 1834/35 1845/46 1884 1947 1954 1973
669
Loniceras Lopadius Micyllus M. Crusius J. Posselius, Syntaxis Graeca (öfter aufgelegt) Ν. Frischlin J. Sylburg gibt den Apollonios Dysk. mit lat. Übers, heraus) Jacob Weller (öfter aufgelegt) C. Lancelot, Nouvelle Méthode pour apprendre facilement la langue grecque (viele Übersetzungen in andere Sprachen) Ch. T. Damm Matthiä Buttmann Kühner (später bearbeitet von Gerth) Krüger Kaegi Früchtel Zinsmeister (/Lindemann/Färber) BomemannRisch
III. Lateinische (Schul-)Grammatiken 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
(Vgl. die Vorbemerkung unter Π) l . J h . v.Chr. Vano l . J h . η. Chr. Remmius Palaemon l . J h . n.Chr. (Quintiiianus) um 350/400 Charisius, Diomedes, Donatus u. a. (s. o. S. 656) I um 425 Macrobius, De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi 220 um 500 Priscianus um 600 Isidorus von Sevilla um 700 Bonifatius um 700 Beda um 800 Alcuin um 830 Hrabanus Maurus um 1000 Aelfric (Priscian auf englisch) um 1150 Petrus Helias ν. Paris (Kommentar zu Priscian) um 1200 Alexander de Villa Dei, Doctrinale (ed. D. Reichling. In: Mon. Germ. Paed. XII, Berlin 1893) 1212 Eberhardus v. Béthune, Graecismus um 1300 Duns Scotus, Grammatica speculativa si ve De modis significandi 1444 Laurentius Valla, Elegantiae Latini sermonis 1468 Perottianus (= Perotti), Rudimenta Grammatices 1480 Nebrija (Aelius Antonius Nebrissensis) 1501 Aldus Manutius 1506 Henrichmannus 1508 J. Brassicanus 1511 Erasmus von Rotterdam, De octo partium constructione
670
221
Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik
144 145 146 147
1512 1513 1513 1526
148 149
1538 1540
150 151 152 153 154
1563 1576 1585 1587 1628
155
1656
156
1660
157 (1677 158 1779 159 1780 160 1787 161 1795 162 1843 163 1878/79 164 1891 165 166
1920 1928
Thomas Linacer, Rudimenta grammatices Colet/Lily-Erasmus (Murmellius, Pappa puerorum [lat. Gesprächsbuch]) Melanchthon, Grammatica latina (nur Formenlehre). Syntaxis linguae Latinae (seit 1532 beide Werke verbunden) N. Clenardus Julius Caesar Scaliger, De causis linguae Latinae (1. philosophische' Humanistengrammatik) M. Crusius P. Ramus, Rudimenta grammaticae Latinae N. Frischlin F. Sanctius, Minerva sive De causis linguae Latinae C. Scioppius (= Schoppe), Grammatica philosophica sive Institutiones grammaticae Latinae C. Lancelot, Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue latine A. Amauld/C. Lancelot, Grammaire générale et raisonnée (= Grammatik von Port-Royal) (hrsg. von E. Brekle, Stuttgart - Bad Cannstatt 1966) Chr. Cellarius, Antibarbarus latinus) I. J. G. Scheller, Ausführliche lateinische Sprachlehre Ders., Kurzgefaßte lateinische Sprachlehre C. G. Breeder, Praktische Grammatik der lat. Sprache I Ders., Kleine lat. Grammatik J. N. Madvig Kühner (später bearbeitet von Stegmann) Landgraf (später bearbeitet von Leitschuh; 1974 neugestaltet von Bayer und Lindauer) Sommer Rubenbauer/Hofmann (1971: /Heine)
Gymnasium 81, 1974, 68-89
Klassische Philologie und moderne Linguistik* Das Verhältnis der Klassischen Philologie zur Sprachwissenschaft ist seit der Abspaltung der Sprachwissenschaft von der Klassischen Philologie vor rund 150 Jahren nie sonderlich eng gewesen. Bereits im Jahre 1909 stellte der Indogermanist Meillet bedauernd fest: „Die Klassische Philologie blieb" (im Gegensatz zu den aufstrebenden neueren Philologien) gegenüber der 1816 von Bopp begründeten Vergleichenden Sprachwissenschaft „lange widerspenstig" und „noch heute" (d.h. also 1909) „ignorieren manche Klassische Philologen die vergleichende Grammatik oder, wenn sie sich damit befassen, eignen sie sich die Methode nur oberflächlich an". An diesem Zustand hat sich in der Universitätspraxis bis heute gemeinhin nicht allzuviel geändert. Weitgehend dürfte zutreffen, was der Romanist Weinrich 1965 monierte, daß nämlich „die Studenten der klassischen Philologie" bestenfalls „mit Mühe in ein, zwei Pflichtvorlesungen über griechische oder lateinische Sprachgeschichte geschickt" würden, womit dann das linguistische Soll in der Regel als erfüllt gelte. Als Begründung für diese Abstinenzhaltung wird (wenn überhaupt) der Unterschied der Zielsetzungen der I beiden Wissenschaften angeführt, und insbesondere die daraus fol- 68 gende angeblich nur geringe Verwendbarkeit sprachwissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse im klassisch-philologischen Lehr- und Forschungsbetrieb. Es ist kein Wunder, daß sich dieses Argument gegen die relativ junge, in Deutschland noch vor 10 Jahren meist als Exoticum bestaunte moderne Linguistik in noch weit höherem Maße richtet als gegen die altehrwürdige historische Sprachwissenschaft. Denn die moderne Linguistik erscheint dem herkömmlich ausgebildeten Klassischen Philologen, der sich nicht schon von ihrem hohen formalen Exaktheitsanspruch und ihrem lange Zeit kultivierten Antitraditionalismus abschrecken läßt, entweder als mechanisch klassifizierende Analy* Öffentliche Probevorlesung, gehalten am 3.7.1972 an der Universität Würzburg. Der exoterische Charakter der Darstellung erklärt sich aus dem Anlaß und aus der primär protreptischen Zielsetzung. - Hervorhebungen in Zitaten stammen von mir. - Zu dem im laufenden Jahrgang dieser Zeitschrift erschienenen Beitrag von Beyer und Cherubim s. Nachtrag u. S. 686 f.
672
Klassische Philologie und moderne Linguistik
setechnik oder als universallogische Sprachtheorie, in jedem Falle aber als autonome und zweckfreie Funktionenbeschreibung, deren Verwendbarkeit für seine philologischen Zwecke ihm zunächst gar nicht einsichtig sein kann. Attacken gegen die angebliche sprachwissenschaftliche Agonie der Klassischen Philologie, wie sie seit der bekannten Philippika Weinrichs auf der Tagung des D. Α. V. 1965 in Münster beinahe schon zum guten linguistischen Ton gehören, - solche Attacken werden infolgedessen so lange müßig bleiben, wie sich mit ihnen nicht der Nachweis praktischer Brauchbarkeit und womöglich größerer Effizienz der neueren linguistischen Methoden beim Spracherlemungs-, Sprachverwendungsund Forschungsprozeß innerhalb der Klassischen Philologie verbindet. Ein solcher Nachweis ist aber bisher von linguistischer Seite weder konkret geführt worden noch in absehbarer Zeit zu erwarten, da die angewandte Sprachwissenschaft, wie Zabrocki 1969 feststellte, als eine neue sprachwissenschaftliche Disziplin „erst im Begriff ist, ihre eigene Methodologie sowie ... ihre eigene Theorie auszuarbeiten" und „noch um ihren eigenen Status ringt." Trotzdem gibt es Ansätze zur Applikation der modernen Linguistik heute auch schon in der Klassischen Philologie, allerdings - weit einseitiger als in den neueren Philologien - bisher fast ausschließlich innerhalb der Schuldidaktik (die einschlägigen Arbeiten s. im Literatur-Anhang, Nr. 9-22). Die Universitäten hat diese Strömung in unserem Fach bisher noch kaum erreicht. Hier beschränkte sich die Anwendung neuerer linguistischer Methoden bisher umgekehrt auf den Bereich der Forschung, doch auch dies nur sporadisch und dann mit wenig attraktiven Ergebnissen. Dafür nur zwei Beispiele: Bestimmte Grundthesen in Weinrichs strukturalistisch orientiertem Tempus-Buch .Besprochene und erzählte Welt' (1964), die eine angemessenere Erklärung auch des lateinischen 69 und griechischen Tempus- und Aspektsystems liefern solllten, konnten von Strunk und Fajen durch den Nachweis erschüttert werden, daß Weinrich die eigentlich erhellenden diachronischen Fakten ignoriert oder unterschätzt hatte, und die anspruchsvollen ,Strukturalgrammatischen Beiträge' zu Homer und Herodot aus der Feder des Jerusalemer Linguisten Rosén scheiterten schon - wie Ruijgh und wiederum Strunk gezeigt haben - an den unzureichenden Griechischkenntnissen des Verfassers. Solche und ähnliche Beispiele lehren zweierlei: Erstens, daß es augenscheinlich nicht sachgerecht ist, sprachliche Zeichensysteme, für die eine über zweitausendjährige Verstehenstradition vorliegt, vom gleichen Standpunkt der Voraussetzungslosigkeit aus erklären zu wollen, wie er etwa gegenüber gerade erst entdeckten schriftlosen Indianersprachen - die noch der primären Dekodierung bedürfen - angebracht erscheint. Zweitens aber ma-
Klassische Philologie und moderne Linguistik
673
chen solche Beispiele deutlich, daß Fehlleistungen dieser Art durch die Abstinenz der Klassischen Philologen selbst provoziert werden, die es nämlich zulassen, daß auf ihrem Fachgebiet ein für fachfremde Linguisten verlockendes Forschungsvakuum entsteht. Wie groß das Ausmaß der fachinternen Indifferenz gegenüber der modernen Linguistik dabei ist, zeigt die Tatsache, daß sogar der in Fachkreisen als revolutionärer Mahner bekannte Konstanzer Latinist Fuhrmann in seinem 1970 publizierten Generalangriff auf den traditionellen Lehr- und Forschungsbetrieb der Klassischen Philologie über allem /tterafarwissenschaftlichen Reformeifer die Linguistik so gut wie unbeachtet läßt. Nun ließe sich diese Abwehr- oder Abwartehaltung theoretisch gerade mit dem Scheitern bisheriger Applikationsversuche und generell mit der Unausgereiftheit der in ständigem Fluß befindlichen modernen Linguistik rechtfertigen. Dieser Ausweg wird aber in letzter Zeit in wachsendem Maße verstellt, und zwar durch die Alltagspraxis des Lehrbetriebs. Um die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der modernen Linguistik zu begründen, bedarf es heute nämlich gar nicht mehr fachtaktischer Erwägungen, wie sie in der gegenwärtigen Grundlagendiskussion der Klassischen Philologie eine große Rolle spielen etwa in Gestalt des von Fuhrmann verwendeten fragwürdigen Begriffs eines ,Modernitätsdefizits' der Klassischen Philologie. Es bedarf auch nicht mehr des appellierenden Hinweises auf die allgemeine geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Relevanz der modernen Linguisük als eines heuristischen und wissenschaftspropädeutischen Arbeitsinstruments - eine Motivation, die ohnehin auf einer so praxisfernen Abstraktionsebene liegt, daß ihr Überzeugungswert nur sehr gering ist. Es genügt vielmehr, ganz pragmatisch von der gegenwärtigen Studierlsituation Klassischer Philologen in den Philosophischen Fakultäten bzw. 70 Fachbereichen auszugehen. Diese Situation ist in der Bundesrepublik gekennzeichnet durch eine vergleichsweise immense Zunahme der Fächerverbindung Latein-Neuphilologie. Die Folge ist, daß immer mehr Studenten die latinistischen Seminarübungen mit ihrem in den neuphilologischen Lehrveranstaltungen erworbenen linguistischen Begriffsapparat .infiltrieren'. Bei unseren naturgemäß herkömmlich philologisch ausgebildeten Übungsleitern stoßen sie damit in der Regel auf Unverständnis oder Ablehnung. Das führt zu Kommunikationsschwierigkeiten und Unsicherheiten auf beiden Seiten, die Arbeitsatmosphäre leidet. - Aus dieser unbefriedigenden Situation kann es m. E. nur einen Ausweg geben: die Klassischen Philologen - soweit ihnen die Einarbeitung noch zugemutet werden kann - müssen sich heute der modernen Linguistik ebenso aufschließen, wie sie sich seinerzeit der Vergleichenden Sprachwissenschaft aufschließen mußten, und sie werden die Frage nach der Verwertbarkeit moderner
674
Klassische Philologie und moderne Linguistik
linguistischer Begriffe, Methoden und Erkenntnisse, da es andere für sie nicht oder nur unbefriedigend tun können, nunmehr selbst stellen und beantworten müssen. Andernfalls wird sich die übliche Suggestivkraft des Neuen im gleichen Maße in unseren Studentenzahlen bemerkbar machen, in dem den Studierenden nun nicht mehr nur der Stoff unseres Faches als ,alt' erscheint, sondern zusätzlich auch noch unser bisher weithin geschätztes Methodenrepertoire. In Konsequenz dieser Situation und der daraus abgeleiteten Forderungen ist es das Ziel meiner Ausführungen, in Form eines ersten Versuches sowohl fachinteme Reserven abzubauen als auch Möglichkeiten praktischer Anwendung der modernen Linguistik innerhalb der Klassischen Philologie aufzuweisen, und zwar in Lehre und Forschung. Ein solcher Versuch kommt nicht ohne zwei Voraussetzungen aus: er muß erstens die Entwicklungsgeschichte der modernen Linguistik zugrundelegen wenn auch nur in stark vereinfachender Form - , und er muß zweitens die traditionelle klassisch-philologische Grammatiktradition mit der modernen Linguistik wenigstens punktuell konfrontieren, mit dem Ziel, festzustellen, wo die neue Richtung substanziell Neues geschaffen hat und wo sie - durchaus verdienstlich - Altbekanntes etwa nur formalisiert oder präzisiert. Der Nachdruck soll im folgenden auf der zweiten Voraussetzung liegen, also auf der Kontrastierung. Zuvor aber noch der methodisch unumgängliche Überblick über die Genese der modernen Linguistik. Dem linguistischen Experten wird damit zwar kaum Neues geboten, aber um ihn geht es hier ja gerade nicht. 71 In der Geschichte der Sprachforschung folgten drei deutlich unterlscheidbare Phasen aufeinander: (1) die sog. traditionelle Grammatik, (2) die Vergleichende und Historische Sprachwissenschaft (Indogermanistik) und (3) die moderne Linguistik. Die uns allen vertraute traditionelle Grammatik wurde nach den Bedürfnissen der Dichter-Erklärung von den griechischen Philologen im hellenistischen Alexandria des 3. vorchristlichen Jahrhunderts entworfen, von der hellenistischen Philosophenschule der Stoa aus theoretischem Interesse verfeinert, vom griechischen Grammatiker Dionysios dem Thraker um 100 v. Chr. in Lehrbuchform gebracht, von Apollonios Dyskolos unter Hadrian um einen - übrigens noch heute lesenswerten - Syntax-Teil bereichert und von römischen Grammatikern der späten Kaiserzeit, vor allem Priscian, teilweise mechanisch auf die lateinische Sprache übertragen. Diese Grammatik, bestehend aus einer Art Phonologie, einer Morphologie, einer Syntax der Wortarten und Satzteile und einer rudimentären Stilistik, bildete durch alle sprachphilosophischen Spekulationen des Mittelalters hindurch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts den im wesentlichen unan-
Klassische Philologie und moderne Linguistik
675
gefochtenen Standard des Sprachverständnisses. Sie erlitt auch durch die Entdeckung der indoeuropäischen Sprachenverwandtschaft um 1800 zunächst keine wesentlichen Veränderungen - heute darf man sagen: glücklicherweise. Sie erlebte vielmehr in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine hoffnungsvolle Wiederbelebung, von der noch zu sprechen sein wird. Aber die Faszination der von Bopp, Grimm und Pott begründeten neuen Vergleichungsmethode ließ die gerade begonnene Weiterarbeit an der traditionellen Grammatik zunächst in den Hintergrund treten. Moderne Sprachwissenschaft war nun nicht mehr gleichbedeutend mit Grammatik und Philologie, sondern mit Sprachenvergleichung. Das Ziel war dabei nach der Entdeckung der Gesetze historischen Lautwandels die Zurückführung der einzelsprachlich vergleichbaren Wortkörper auf eine gemeinsame indogermanische Urform. Im Mittelpunkt dieser ständig verbesserten Rekonstruktionsmethodik, die ihre Aufgabe in der Erklärung eines Sprachzustandes durch Aufweis seiner Genese sah, stand nicht mehr das Funktionieren des Systems, sondern das Gewordensein seiner Teile. Daraus resultierte eine Konzentration auf die historische Phonologie und Morphologie sowie auf die Etymologie, und damit zugleich auf das Wort, nicht mehr auf den Satz. Das Ungenügen an den häufig noch recht irrationalen Lautgleichungen führte dann in den 70er Jahren zur Forderung nach ausnahmsloser Geltung jedes Lautgesetzes. Es bildete sich der Kreis der sog. Junggrammatiker mit seinen Hauptvertretern Brugmann, Osthoff und Paul. Damit war der in der zeitgenössischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft erhobene Exaktheitsanspruch auch in die 72 Sprachwissenschaft eingeführt, - aus der er bis heute nicht mehr verschwinden sollte. Aus der Junggrammatiker-Bewegung gingen hervor die Begründer der modernen Linguistik, Georg von der Gabelentz und Ferdinand de Saussure. Eine frühe Arbeit über den indogermanischen Vokalismus führte den BrugmannSchüler de Saussure zu der Erkenntnis, daß natürliche Sprachen statische Systeme aufeinander bezogener, einander determinierender Zeichen sind, in denen jede Veränderung eines Einzelelements, wie beim Schachspiel, eine Veränderung der Gesamtkonstellation bewirkt. Die Sprachwissenschaft habe demzufolge die primäre Aufgabe, das synchronische Funktionieren dieser Systeme zu erklären. - Damit war die moderne Linguistik geboren, die sich nunmehr für rund 50 Jahre in verschiedenen Schulen der synchronischen Sprachenbeschreibung widmete. Die nordamerikanische Indianersprachen-Erforschung mit ihren ethnographischen Erfordernissen verstärkte de Saussures Postulat nach Priorität der Synchronie vor der Diachronie. Durch immer exaktere Distinktionsmethoden wurden in der Phonologie und Morphologie grundlegende Einsichten in Natur
676
Klassische Philologie und moderne Linguistik
und Funktion der Phoneme und Morpheme gewonnen. In der Syntax gelang es, das Wesen der syntaktischen Beziehungen durch genauere Analyse der primären Satzkonstituenten Subjekt - Prädikat - Objekt besser zu begreifen. Die Struktur von Sätzen wurde durch formale Notationstechniken wie den sog. Satz-Stammbaum oder Phrase-Marker anschaulicher gemacht (einige Beispiele im LiteraturAnhang, Nr. 44). Diese ganze Richtung, deren Ziel die Aufhellung der Sprachstruktur war, begriff sich als ,strukturale Sprachwissenschaft' oder kurz .Strukturalismus'. In den 50er Jahren begann sich allmählich herauszustellen, daß die vom Strukturalismus betriebene formale Satzanalyse, indem sie von der Bedeutung als von einem sog. mentalistischen, angeblich für die Sprachstruktur nur wenig relevanten Faktor möglichst absah, grundlegende Sprachtatsachen nicht zu erklären vermochte. Die bloße Konstituentensegmentierung war ζ. B. außerstande, die für jeden Sprecher und Hörer selbstverständliche Sinnverwandtschaft zwischen .Paulus Iuliam amat' und Julia a Paulo amatur' zu erfassen, sie war außerstande, syntagmatisch bzw. semantisch bedingte Sinn-Ambiguitäten zu erklären. Der Strukturalismus, so zeigte sich, war auf die Oberfläche beschränkt geblieben, er war eindimensional. Im Jahre 1957 veröffentlichte der amerikanische Strukturalist und ursprüngliche Hebraist Chomsky sein Buch .Syntactic Structures', das eine (zuweilen etwas übertrieben als .Chomskysche Revolution' bezeichnete) Neu-Orientierung 73 der strukturalen Sprachwissenschaft brachte. I Chomsky arbeitete ein psycholinguistisches Satzentstehungsmodell aus, das auf der - im Grunde uralten - Erkenntnis basierte, daß gesprochene und geschriebene Äußerungen nur variable Realisationen zugrundeliegender nicht-artikulierter, also präverbaler Sinnbeziehungen sind. Den zugrundeliegenden Sinn nannte Chomsky metaphorisch die .Tiefenstruktur', seine phonemischen Realisationen die .Oberflächenstruktur'. Der Grammatik stellte er demgemäß die Aufgaben, (1) die für die Formation der Tiefenstruktur und deren Transformation in die Oberflächenstruktur verantwortlichen Regeln einer gegebenen Sprache möglichst exakt und vollständig zu erfassen, (2) die universell verbreitete menschliche Sprachkreativität zu erklären, d. h. die menschliche Fähigkeit, nach Kenntnisnahme einer nur begrenzten Anzahl von Sprachäußerungen unendlich viele nie zuvor gehörte allgemein verständliche Sätze zu bilden. Eine solche Grammatik, die erklärt, wie Sinn erzeugt - ,generiert' - und danach in die verbale Oberfläche überführt - .transformiert' - wird, nannten Chomsky und seine Anhänger .generative Transformationsgrammatik'. Mit ihr war die Eindimensionalität des taxonomisch, d. h. katalogisierend orientierten Strukturalismus überwunden, und die Semantik begann nun
Klassische Philologie und moderne Linguistik
677
auch in der linguistischen Theorie wieder die Schlüsselrolle zu spielen, die sie in der Sprachpraxis besitzt. Chomsky's Grammatikmodell wurde und wird von ihm selbst und anderen laufend erweitert und modifiziert, zur Zeit gilt es aber noch weithin als die relativ adäquateste Form der synchronischen Sprachbeschreibung. So weit der Überblick über die Entwicklung der modernen Linguistik. Gegenüber oft allzu emphatischen Selbstdarstellungen von linguistischer Seite konnte er vielleicht die Proportionen ein wenig zurechtrücken: die moderne Linguistik, so zeigt sich, bedeutet durchaus keinen radikalen Bruch mit den herkömmlichen Kategorien sprachwissenschaftlicher Forschung, sie kann vielmehr als organische Weiterentwicklung junggrammatischer Prinzipien gelten. Die Vergleichende Sprachwissenschaft ist durch sie nicht ersetzt, sondern ergänzt worden. Wie schon Schwyzer 1939 in seiner Griechischen Grammatik betont hat - übrigens durchaus in Kenntnis der damals neuesten Theorien eines de Saussure, Hjelmslev, Jespersen, Trubetzkoy, Jakobson, Sapir, Bloomfield und anderer und wie neuestens wieder Sprachwissenschaftler aller Schulen wie etwa Szemerényi, Strunk, Neumann, Coseriu hervorheben, bilden beide Betrachtungsweisen zusammen, die diachronische und die synchronische, erst das Ganze der Sprachwissenschaft, - so wie I ihr Objekt, die Sprache, eine Einheit diachronisch 74 gewachsener synchronisch funktionierender Werte ist. Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftshistorischen Skizze dürfte die Erörterung der zweiten vorhin genannten Voraussetzung, also die Bewertung des Originalitätsgrades neuerer linguistischer Methoden und Erkenntnisse, größere Transparenz gewinnen. Auch zu diesem Komplex gibt es bereits eine umfangreiche linguistische Spezialliteratur, die - von Chomsky selbst angeregt, besonders durch seine Bücher ,Cartesianische Linguistik' (1966) und ,Sprache und Geist' (1968) - heute vornehmlich von Coseriu und Brekle gepflegt wird. Die „endgültige und umfassende Geschichte der .traditionellen Grammatik'" ist gleichwohl - wie Lyons 1971 betont hat - „noch nicht geschrieben worden." Und gerade hier hätte die Klassische Philologie, deren Stimme in der Debatte bisher noch fehlt, mancherlei Bedeutsames beizusteuern. Im vorliegenden Zusammenhang möchte ich als Beispiele die folgenden drei Komplexe herausgreifen: (1) Das Begriffspaar ,Synchronie-Diachronie', (2) das Begriffspaar ,Tiefenstruktur-Oberflächenstruktur' und (3) eine etwas speziellere Frage: die sog. Translationstheorie der Tesnièreschen Dependenzgrammatik. (1) Die Unterscheidung zwischen Synchronie und Diachronie gilt in der heutigen communis opinio als Errungenschaft der modernen Linguistik. Den vor de
678
75
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Saussure entstandenen grammatischen Werken wird entweder eine einseitig diachronische Ausrichtung oder eine unreflektierte Vermengung diachronischer und synchronischer Erklärungsprinzipien vorgeworfen, so z.B. ausführlich bei Glinz in seinen .Linguistischen Grundbegriffen'. Das trifft in dieser Zuspitzung jedoch noch nicht einmal auf die Germanistik zu, und wenn hier immer wieder mit Pauls berühmtem Diachronie-Bekenntnis exemplifiziert wird, so sollte daran erinnert werden dürfen, daß es eine germanistische Grammatiktradition auch vor Paul schon gegeben hat. - Mit besonderem Nachdruck aber muß dieser Vorwurf für die Klassische Philologie zurückgewiesen werden. Schon de Saussure hatte hervorgehoben: „Es ist sonderbar, feststellen zu müssen, daß der Gesichtspunkt der traditionellen Grammatiker" (seil, im Gegensatz zu den historischen) „bezüglich dieser Frage völlig einwandfrei ist. Ihre Arbeiten zeigen klar, daß sie Zustände beschreiben wollen; ihr Programm ist streng synchronisch", und er belegte das mit der jetzt von Chomsky als Archetypus der .Generativen Grammatik' wiederentdeckten Grammatik von Port-Royal vom Jahre 1660. De Saussure hätte aber auch jede griechische, lateinische oder deutsche Grammatik anführen können, die in den Jahrzehnten vor 1850 entstanden war. Ich greife als Beispiel die 17. Auflage I von Heyses .Deutscher Schulgrammatik' aus dem Jahre 1851 heraus. Da heißt es in der Vorrede: „Der Schüler soll seine Muttersprache in ihrem gegenwärtigen Zustand verstehen ... Dieser Zweck wird durch die Darlegung der Geschichte der Sprache ... nimmermehr erreicht". Und dann weiter, ganz im Sinne der heute wieder modernen Tendenzen: „Vielmehr muß die Schulgrammatik ... von dem gegenwärtigen Sprachstande ausgehen, diesen aber durch Zurückführung auf den älteren Zustand der Sprache überall dort erläutern ... wo er dunkel ... geworden ist". Und in der Vorrede noch zur 2. Auflage von Madvigs ,Griechischer Syntax' von 1884 heißt es: „ ... das syntaktische System läßt sich da am klarsten ergreifen und durchschauen, wo es ... zu Festigkeit und relativer Ruhe gekommen ist". Das sind deutliche Plädoyers für den Vorrang der Synchronie. Und gerade in der klassisch-philologischen Wissenschaftstradition brachte der Zwang, einen Text mangels befragbarer Informanten nur aus sich selbst heraus zu verstehen, wie bei jeder Korpus-Sprache, eine Fülle ausschließlich synchronisch ausgerichteter Arbeitsmittel hervor, insbesondere Lexika und Grammatiken zu zeitlich begrenzten Sprachperioden, wie ζ. B. die Griechische und Lateinische Grammatik von Kühner. Der Gräzist und Latinist hat sich dementsprechend seit jeher und bis zum heutigen Tage zunächst immer eine zeitlich begrenzte Sprachkompetenz erworben (gewissermaßen eine griechische bzw. lateinische Gegenwartssprache), von der aus er dann anschließend mit Hilfe entsprechender Erklärungsmittel diachronisch zu
Klassische Philologie und moderne Linguistik
679
früheren bzw. späteren Sprachzuständen vorstieß. Das bedeutet aber: wissenschaftsmethodisch wird in der Klassischen Philologie die Forderung der modernen Linguistik nach Priorität der Zustandsanalyse vor der Zustandsgenese schon seit jeher sowohl immanent wie auch als explizit formuliertes Prinzip erfüllt. (2) In seinem Buch .Sprache und Geist' von 1968 legt Chomsky an der Grammatik von Port-Royal dar, daß die Unterscheidung zwischen Tiefen- und Oberflächenstruktur erstmalig in der sog. philosophischen oder universalen Grammatik des 17. Jahrhunderts getroffen wurde, dann aber - so wörtlich „verschwand, fast ohne Spuren zu hinterlassen, als sich die moderne Linguistik gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte." - Auch hier muß Einspruch erhoben werden: in der Klassischen Philologie kann von einem Verschwinden dieser Unterscheidung keine Rede sein. Der Beweis läßt sich in diesem Falle ganz konkret führen: In der .Griechischen Grammatik' von Matthiä (1807), der ersten wissenschaftlichen Grammatik des Griechischen überhaupt, steht in der Vorrede eine längere Darlegung über die Vorzüge einer .philosophischen Betrachtung' der Grammatik; dabei heißt es: „Oft finden bei I dem Ausdrucke ein 76 und desselben Gedankens verschiedene Rücksichten statt, wodurch die Constructionen zwar äußerlich und grammatisch verschieden, aber ihrem Wesen nach übereinstimmend sind." Forscht man nach dem Ursprung dieser Einsicht, so stößt man im 5seitigen Quellenverzeichnis Matthiäs auf die Angabe: „Mehrere gute Bemerkungen in einer lichtvollen Klarheit enthält die Grammatik der Mess, de Port Royal, Paris 1655 ... ". Die Filiation ist deutlich. Und Matthiäs Grammatik bildet nicht etwa ihren Endpunkt. Doch bevor wir diesen Faden weiterverfolgen, nehmen wir einen zweiten auf: Ihren Höhepunkt fand die von PortRoyal ausgehende philosophische Grammatik bekanntlich in den sprachphilosophischen Werken W. v. Humboldts. Zu der hier behandelten Frage schreibt Humboldt 1822 in einem Brief an A.W. Schlegel: „Daß alle Sprachen in Absicht der Grammatik sich sehr nahe stehen, wenn man sie nicht oberflächlich, sondern tief in ihrem Innern untersucht, ist unläugbar". Nun hat Brekle in einer Besprechung von Chomskys ,Cartesianischer Linguistik' darauf aufmerksam gemacht, daß diese und ähnliche Gedanken Humboldts konsequent weitergedacht sind in den Werken des heute fast vergessenen, zu seiner Zeit jedoch hochberühmten K. F. Becker, eines Zeitgenossen Humboldts, und Brekle empfiehlt den Vertretern der modernen Linguistik besonders angelegentlich die Lektüre des Beckerschen .Organism der Sprache' (1827), aus dem sie - so Brekle - manches für ihre Theorien verwenden könnten. Wir haben also nunmehr in der Frage der Tiefen- und Oberflächenstruktur zwei Tradierungsstränge: einen von Port-Royal zu Matthiä, und einen zweiten
680
Klassische Philologie und moderne Linguistik
von Port-Royal über Humboldt zu Becker. Beide Stränge - und hier schließt sich der Kreis - sind nun aber vereinigt in den Griechischen und Lateinischen Grammatiken von Kühner - Grammatiken, die als unersetzte Standardwerke nach wie vor die Grundlage der sprachlichen Ausbildung Klassischer Philologen nicht nur in Deutschland bilden. Kühners Griechische Syntax beginnt mit dem folgenden Satz: ,JDie Sprache ist der Ausdruck der Gedanken. Ein Gedanke entsteht in unserer Seele dadurch, daß Begriffe teils aufeinander, teils auf den Redenden bezogen und zu einer Einheit verbunden werden": da haben wir - freilich noch unterminologisiert - die Tiefenstruktur. Dann heißt es weiter: „Tritt der Gedanke in die Erscheinung und nimmt gleichsam einen Körper an, d. h. wird der Gedanke durch die Sprache ausgesprochen, so werden die Begriffe durch Wörter bezeichnet" usw.: da haben wir die Oberflächenstruktur. Als Quellen für diese durch und durch generative Auffassung der Sprache erscheinen nun in den Fußnoten u. a. - Beckers ,Organism der Sprache' und Matthiäs Griechi77 sehe I Grammatik. Und auch die weiteren Quellen, wie Heyses .System der Sprachwissenschaft' (1856) und Michelsens .Philosophie der Grammatik' (1843), lassen sich eindeutig auf Port-Royal, Humboldt und Becker zurückführen. Da nun Kühners Grammatiken, wie erwähnt, in keiner Phase unserer Wissenschaft etwa als .überholt' beiseitegelegt wurden, hat die klassisch-philologische Grammatiktradition die in der Phase der .philosophischen Grammatik' ausgebildete Unterscheidung zwischen dem, was wir heute Oberflächen- und Tiefenstruktur nennen, niemals vergessen. Diese Unterscheidung und der ganze mit ihr verbundene sprachtheoretische Ansatz ist zwar zeitweilig unter dem Einfluß der alles überschattenden Vergleichenden Sprachwissenschaft in den Hintergrund getreten, er ist aber als Basis des in der Klassischen Philologie tradierten Grammatikverständnisses stets präsent geblieben. (3) Im Jahre 1959 veröffentlichte der französische Sprachlehrer Tesnière eine scheinbar ganz neuartige Theorie der Satzstruktur. Seine umfangreichen .Éléments de syntaxe structurale' übten starken Einfluß sowohl auf Strukturalisten wie etwa Weinrich und Heringer als auch auf spezielle Transformationalisten wie etwa Bechert und Lakoff aus. Besondere Beachtung fand Tesnière bei Schulpraktikern und in Datenverarbeitungszentren, bereits 1965 wurde eine 2. Auflage erforderlich. Tesnières Thesen zeichnen sich durch bestechende Einfachheit aus. Im Kern lassen sie sich auf zwei zurückführen: erstens: Die 7 oder 8 Wortarten der traditionellen Grammatik sind auf 4 sog. .volle' Wortklassen reduzierbar: Substantiv, Verb, Adjektiv und Adverb; die anderen sind sog. .leere' Wörter, die nur syntaktische Hilfsfunktionen zu erfüllen haben, vor allem die, Wörter aus einer der 4 Grundklassen in Wörter einer anderen Grundklasse
Klassische Philologie und moderne Linguistik
681
zu überführen, zu .transferieren' (in Tesnières Terminologie). So transferieren z.B. die Präpositionen Substantive zu Adverbien; ,im Zimmer4 ist z.B. eine präpositionale Junktur, die im Satzbauplan die Stelle des Adverbs (,dort', .hier' usw.) einnimmt. Solche Überführungen nennt Tesnière .Translationen'. - Zweitens: Sämtliche Nebensätze sind nach Tesnière lediglich Stellvertreter der drei Grund-Wortklassen Substantiv, Adjektiv oder Adverb, ihre einleitenden Konjunktionen sind nur Dependenz-Signale, genannt .Translative'. Die mit ihrer Hilfe bewirkten Ersetzungen, ζ. B. die Ersetzung (oder Umschreibung, Paraphrase) eines Adjektivs durch einen Relativsatz, nennt Tesnière konsequenterweise »Translationen zweiten Grades'. Es ist evident, daß diese Theorie, besonders ihr zweiter Teil, eine Stütze des Chomskyschen Satzerzeugungsmodells darstellt, denn sie I impliziert ja die Zu- 78 rückführbarkeit unterschiedlicher Oberflächenstrukturen wie etwa ,vir bonus' und .vir, qui bonus est' auf eine gemeinsame Tiefenstruktur. Tesnières Theorie fand denn auch bei Linguisten und Neuphilologen überwiegend begeisterte Aufnahme. Als Beispiel zitiere ich aus einem Aufsatz von Rothe, einem Mitarbeiter Weinrichs: „Wir haben auch bisher schon gewußt, was ein Objektsatz ist, und Relativsätze werden in der Terminologie mancher Sprachen schon immer , Adjektivsätze' genannt. Das Neue und Erregende an Tesnière ist nun aber, daß er aus diesen sporadisch auftretenden tieferen Erkenntnissen der traditionellen Grammatik ein lückenloses ... System gemacht hat", - und kurz danach heißt es weiter: „Man beachte, was bei diesem System gewonnen ist..." usw. Solcher Euphorie muß der Klassische Philologe die nüchterne Feststellung entgegensetzen, daß Tesnières System bereits seit 150 Jahren das Grundgerüst der traditionellen griechischen und lateinischen Syntaxlehre bildet. - In den Jahren 1821 bis 1830 veröffentlichte der Frankfurter Gymnasialprofessor Herling eine heute vergessene ,Syntax der deutschen Sprache', in der er, wie ein von mir vorgenommener Vergleich ergab, bis in die Einzelheiten hinein die gleiche Satztheorie begründete. Statt der Einzelheiten, die hier nicht vorgeführt werden können, zitiere ich nur folgenden Passus aus Herling: „Die Nebensätze werden ... nach eben den Satztheilen benannt, welche sie gleichsam vertreten. Sie sind demnach (1) Substantivsätze, wenn sie Substantive, (2) Adjektivsätze, wenn sie Adjektive, (3) Adverbialsätze, wenn sie Adverbien eines anderen Satzes vertreten oder als deren Umschreibungen angesehen werden müssen. Diese Eintheilung erschöpft die ganze Sphäre der Nebensätze." - Die Übereinstimmung mit Tesnière ist sinnfällig. Zu ergänzen ist lediglich, daß diese Nebensatztheorie Herlings, mit gleicher Konsequenz wie bei Tesnière, nur die Folgerung aus einer
682
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Wortarten-Theorie ist, die Punkt für Punkt, ζ. T. bis in die Terminologie und in die Auswahl der Beispiele hinein, mit der Tesnièreschen übereinstimmt. Es wäre nun leicht, diesen ganzen Nachweis als kuriosen antiquarischen Fund abzutun, wenn nicht Herlings Theorie in ihrer Bedeutung von seinen Zeitgenossen sofort erkannt und zum Gemeingut der alt- und neusprachlichen zeitgenössischen Grammatiken gemacht worden wäre - , von wo aus sie unverfälscht in die synchronischen und später auch in die diachronischen Standardgrammatiken des Lateinischen und Griechischen übernommen wurde. Eine Vorstellung von der damaligen raschen Verbreitung der Herlingschen Theorie vermittelt das Stemma 79 im Literatur-Anhang (Nr. 78). Die griechische und die lateinische Synltax von Kühner bauen in ihrer je ca. 400 Seiten umfassenden Einzeldarstellung des sog. Satzgefüges systematisch auf Herlings Theorie auf, aber auch Debrunners vorwiegend diachronische Darstellung der griechischen Syntax von 1950 basiert noch auf diesem System. Der modernen Linguistik im ganzen sind diese (auch von Klassischen Philologen kaum realisierten) Zusammenhänge offenbar weithin unbekannt geblieben. Das zeigt nicht nur Tesnière, der zumindest in diesem Punkte den Nachweis seiner Vorgänger führt, sondern auch das bislang wohl einzige einschlägige linguistische Werk, das systematisch eine Übertragung der Chomskyschen und Tesnièreschen Theorien auf ein Teilgebiet der lateinischen Syntax versucht, R. Lakoffs Abhandlung über die lateinischen Ergänzungssätze von 1968. Die amerikanische Autorin, für die die lateinische Grammatiktradition nahezu ausschließlich durch Ernouts .Syntaxe latine' (1953) repräsentiert wird, baut ihre Arbeit auf der für einen Klassischen Philologen geradezu grotesken Behauptung auf: „Die Sprachwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts versuchten niemals ernsthaft über den Satz zu arbeiten, sie befaßten sich nur mit den kleineren Elementen, den Phonemen, Morphemen und Wörtern. Daher diskutierten traditionelle Werke, die sich .Syntax' nannten, die Zusammensetzung der Sätze überhaupt nicht, es sei denn als Ansammlung von Morphemen." Hätte die Verfasserin wenigstens Kühner-Gerth und Kühner-Stegmann fortlaufend berücksichtigt, wären weite Teile ihres Buches vermutlich ungeschrieben geblieben. Hier wird unweigerlich der Einwand kommen, daß auch die Wiederentdeckung einer alten Wahrheit zu den wichtigsten Erkenntnisschritten einer Wissenschaft gehöre (so Weinrich brieflich). Gewiß - aber wiederentdecken läßt sich nur, was verloren war. Daß Herlings von Tesnière wiederentdeckte Theorie nicht nur in der Klassischen Philologie nicht verlorengegangen war, zeigt komprimiert das folgende Zitat aus dem Grammatikteil des Rechtschreibe-Dudens von 1954:,Jeder Nebensatz ist die Umschreibung eines Satzteiles".
Klassische Philologie und moderne Linguistik
683
Welche Folgerungen soll der Klassische Philologe aus solchen und ähnlichen Nachweisen ziehen? Als wichtigstes Ergebnis ergibt sich ihm zwangsläufig eine gewisse .Entzauberung' der modernen Linguistik. Dieser Effekt muß um so willkommener sein, als er die Mär von der Unzugänglichkeit der modernen Linguistik widerlegt und so die Rezeptionsbereitschaft unter den Klassischen Philologen zu erhöhen geeignet ist. Dem Philologen wird deutlich, daß die moderne Linguistik lange Zeit dazu neigte und offenbar teilweise noch heute dazu neigt trotz I warnender Stimmen aus den eigenen Reihen - , die Originalität ihrer Er- 80 kenntnisse zu überschätzen, und daß gerade die Ignorierung der vorindogermanistischen Grammatiktradition, wie sie vornehmlich innerhalb der deutschsprachigen Klassischen Philologie lebendig geblieben ist, nicht unerheblich dazu beigetragen hat. Diese iynchronisch orientierte Grammatiktradition ist, wie sich hier zeigte, durch den Einbruch der Vergleichenden Sprachwissenschaft Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht aufgehoben, sondern nur suspendiert worden. Durch den Rückgriff auf diese ältere Tradition wäre also die Klassische Philologie bei einigem Selbstvertrauen heute durchaus in der Lage, gegenüber der modernen Linguistik in gewissen Grundsatzfragen sogar die Funktion einer Kontroll-Instanz zu übernehmen. Die substanziellen, nicht bloß terminologischen Fortschritte, die die moderne Linguistik in der Durchleuchtung der Sprachstruktur unzweifelhaft erreicht hat und die gerade der Klassische Philologe auf die Dauer nicht ignorieren kann, würden sich dadurch nur um so schärfer profilieren. Damit komme ich zum Zielpunkt dieser Ausführungen, zur Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten der modernen Linguistik innerhalb der Klassischen Philologie. Die Antwort, die hier nur umrißhaft gegeben werden kann, hängt ab von der allgemeinen Zielsetzung der Klassischen Philologie. Unstreitig ist die eigentliche Aufgabe unserer Wissenschaft die Interpretation der überlieferten Texte, sei es als τέλος, sei es als όργανον. Kenntnis der Sprache, in der diese Texte abgefaßt sind, ist zwar die erste unter den Voraussetzungen des Textverständnisses, aber eben nur eine Voraussetzung. Die möglichst exakte Analyse der Aischyleischen Syntax und Semantik etwa kann für den Philologen nicht Selbstzweck, sondern nur Hilfsmittel zur Sinndeutung der Aischyleischen Dramen sein. Der linguistische Ansatz allein - und sei es auch in den am weitesten fortgeschrittenen Formen modemer Textlinguistik - kann zu dieser Sinndeutung ebensowenig verhelfen wie der nur literaturwissenschaftliche Ansatz. Unerläßlich sind vielmehr auch extralinguistische Kenntnisse in allen jenen sog. Hilfs-
684
Klassische Philologie und moderne Linguistik
disziplinen, die die Klassische Philologie nach einem Worte Boeckhs zur ,Polymathie' - oder nach einer neueren Deutung des französischen Linguisten Mounin zur .Ethnographie des Vergangenen' machen, also: Textkritik, Paläographie, Metrik, Geschichte, Religion und Mythologie, Archäologie usw. usf. Der Text selbst als das Bezeichnende ist nur die Oberfläche, darunter liegt durch zwei Jahrtausende von uns getrennt und kaum jemals völlig ausschöpfbar - die Tiefe des Gemeinten. - Von daher bestimmt sich die Funktion der 81 Sprachwissenschaft allgemein und damit I auch der modernen Linguistik innerhalb der Klassischen Philologie: willkommen wird uns alles sein, was sie zur Erweiterung und Differenzierung der Sprachkompetenz des Philologen beitragen kann. - Innerhalb des Philologiestudiums ist nun der Ort für den Erwerb dieser Sprachkompetenz jene vielverkannte und vielgeschmähte Form der Lehrveranstaltungen, die wir traditionell .Stilübungen' nennen. Denn hier geht es - nun gerade nicht um ,Stil', sondern primär darum, „den Gedanken" - wie Schopenhauer einmal formulierte - „von allen Worten, die ihn jetzt tragen, gänzlich zu entblößen, so daß er nackt dasteht im Bewußtsein, wie ein Geist ohne Leib, den man dann wieder mit einem neuen, ganz anderen Leibe bekleiden muß". Hier wird also bei der bewußten Zurückführung der muttersprachlichen Oberflächenauf die universale Tiefenstruktur und bei deren anschließender Transformation in die Oberflächenstruktur der Zielsprache äußerste analytische und synthetische Anstrengung in einem verlangt. Einsichten in das Wesen des Transformationsprozesses als solchen könnten hier von großem Nutzen sein. Wirkliche Sprachkompetenz erschöpft sich aber nicht in der Beherrschung des Sprach^yííemí, sondern erfordert darüber hinaus umfassende Kenntnis der Sprachnorm - oder, wie Coseriu formuliert: „Es genügt nicht zu wissen, was man in einer Sprache sagen könnte, man muß auch wissen, was normalerweise in bestimmten Situationen gesagt wird." Der transformationelle Ansatz mit seiner normativen Idealisierung des Sprecher-Hörers und des Satzes reicht da nicht aus; auch mit Hilfe Hunderter von nacheinander operierenden kontextsensitiven Transformationsregeln würde der semantisch, stilistisch und situationeil bedingte Nuancenreichtum einer Platonischen Dialog-Passage nicht generiert werden können. - Hier treten andere Strömungen der modernen Linguistik ein, vor allem die letzthin in den neueren Sprachen stark ausgebaute Kontrastive Grammatik. Die Stilübungen sind der gegebene Ort für eine fruchtbare Auseinandersetzung auch mit dieser Richtung; denn kontrastive Grammatik wird in ihnen unbewußt schon seit jeher praktiziert, bewußt mindestens seit der Begründimg der sog. Komparativen Stilistik durch Nägelsbach im Jahre 1846. Zwar brachte die Historische Sprachwissenschaft auch hier wieder die obligate Interessenver-
Klassische Philologie und moderne Linguistik
685
Schiebung - in diesem Falle von der deskriptiven Stilistik Nägelsbachs zur sog. Historischen Stilistik eines Schmalz und eines Sommer - , aber Nägelsbachs kontrastive Methode ist in der Praxis unserer Stilübungen niemals mehr ganz vergessen worden. Anders als in den neueren Philologien, wo synchronische Methoden wie die Kontrastive Grammatik als Neuentdeckungen erscheinen könnten, bedeuten also solche I Methoden für die Klassische Philologie mit ihrer 82 jahrhundertealten vorhistoristischen Sprachlehrpraxis nur eine Aufforderung, alte Fäden wiederaufzunehmen und mit neuen zu verweben. Und hier liegt nun auch die Aufgabe für die klassisch-philologische Sprach/orschung. Von ihr könnte die Anwendung moderner linguistischer Methoden in unseren Stilübungen (und darüber hinaus) vornehmlich durch zwei konkrete Leistungen gefördert werden: erstens durch Neubearbeitungen der Kühnerschen Grammatiken - und besonders der für die Stilübungen nach wie vor unentbehrlichen Repetitorien der griechischen und lateinischen Syntax und Stilistik von Menge. Wenn es bislang an einem Anstoß zu diesen längst überfälligen Neubearbeitungen mangelte, so ist er spätestens jetzt, durch die Provokation der modernen Linguistik, gegeben. Speziell Menges Repetitorien, deren lOOjähriges Dienstjubiläum wir in diesem Jahre feiern dürfen, könnten bei einer Bearbeitung im hier vertretenen Sinne kritischer Aufnahmebereitschaft ihren Katechismusund Kollektaneen-Charakter zugunsten einer durchgehenden konfrontativen Zielsetzung aufgeben, deren Basis durchaus eine allgemeine Einführung in die transformationelle Satzentstehungstheorie bilden könnte. - Zweitens hätte sich die griechische und lateinische Sprachforschung in Weiterführung der von de Saussure über Trier, Weisgerber, Domseiff und Snell reichenden sog. Wortfeldforschung um die Schaffung einer dringend benötigten vergleichenden Semantik des Deutschen, Lateinischen und Griechischen zu bemühen. Die letzte entfernt vergleichbare Arbeit, Schmidts Synonymik aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist heute so gut wie unbrauchbar. Zusammenarbeit zwischen Klassischen Philologen und Linguisten könnte hier zu einem Werk führen, das sich den großen diachronischen Lexika von Frisk und Chantraine würdig an die Seite stellen ließe. Mit diesen notwendig kurzen Andeutungen sind nur einige - durchaus realisierbare - Anwendungsmöglichkeiten der modernen Linguistik in der Klassischen Philologie umrissen. Weitere würden sich im Laufe der Rezeption der modernen linguistischen Begriffe und Methoden von selbst ergeben. Die Klassische Philologie hat - alles in allem - keinerlei Anlaß, in falschem Minderwertigkeitsgefühl der Moderne nachzujagen. Aber eines scheint mir sicher: eine
686
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Klassische Philologie, die die Herausforderung der modernen Linguistik in der hier vorgeschlagenen schöpferischen Weise annähme, hätte in einem m. E. zentralen Bereich an die Stelle mehr oder minder gequälter Selbstrechtfertigungsbemühungen die überzeugende Tat gesetzt. I 83 Nachtrag: Der im Gymnasium 80, 1973, 25 Iff. veröffentlichte Diskussionsbeitrag von Beyer und Cherubim besteht aus (1) allgemeiner Protreptik zur Rezeption der modernen Linguistik und zur Kooperation zwischen Linguisten und Klassischen Philologen, (2) Polemik gegen Neumann, Klowski und Pfister, (3) in Frageform gekleideter Negation der Existenzberechtigung von Griechisch und Latein als Schulsprachen. Zwischen den im ersten Teil vorgetragenen Ansichten und meinen eigenen Intentionen besteht grundsätzliche Übereinstimmung: darin äußert sich eine augenscheinlich sachbedingte Konvergenz der Lagebeurteilung aus linguistischer und klassisch-philologischer Sicht. Die Abstinenzhaltung der Klassischen Philologie gegenüber der modernen Linguistik beginnt allerdings erfreulicherweise zu weichen; im Jahre 1972 trat die Auseinandersetzung vor allem dank dem Engagement der beiden Spitzenverbände der deutschen Altertumswissenschaft in ein neues Stadium: Happs Vortrag über die funktionale Sprachwissenschaft auf der Bochumer Tagung der Mommsen-Gesellschaft sowie Steinthals beherztverständnisvoller Applikationsvorschlag auf der Kieler Tagung (Gymnasium 80, 1973, 101 ff.) offenbaren eine gesteigerte Rezeptionsbereitschaft. - Auf die im zweiten Teil gegen Neumann, Klowski und Pfister gerichtete Polemik werden die Angesprochenen erforderlichenfalls selbst zu antworten wissen. Der Ton der Kritik ist nicht dazu angetan, den angestrebten protreptischen Effekt zu erhöhen. - Der dritte Teil erscheint mir als der schwächste: Die Existenzberechtigung eines Unterrichtsfaches nur unter dem Gesichtspunkt der in KMK-Beschlüssen sich niederschlagenden zeitbedingten Utilität zu beurteilen, bedeutet kritiklose Unterwerfung unter intellektuelle Präferenz-Strömungen. Wie jede universalistisch orientierte Wissens-Erweiterung im Primärstadium bezieht die moderne Linguistik ihren revolutionären Impetus (und Enthusiasmus) aus ihrer hohen Spezialisierung und der damit verbundenen Interessenverengung. Für den linguistischen Erkenntnisprozeß sind diese Restriktionen ein Gewinn, für die pädagogisch und bildungspolitisch anzustrebende Interessenvielfalt dagegen sind sie eine Gefahr. Nicht nur die Klassische Philologie, sondern sämtliche Philologien werden der modernen Linguistik zur Erhaltung einer breiten LernzielSkala die Anerkennung ihres Anspruches, als Entelechie des Fremdsprachenunterrichts zu gelten, versagen müssen. Sollten die neueren Philologien diese
Klassische Philologie und moderne Linguistik
687
Widerstandskraft künftig (wie leider zu befürchten) nicht mehr hinreichend aufbringen, so entstünde damit eine neue pädagogische und bildungspolitische Motivation des Griechisch- und Latein-Unterrichts: Lingu i sti k- wòmdireitende Lernziele und Bildungswerte würden dann nur noch in diesen Unterrichtssprachen angeboten (die bereits heute bestehende Lernzielvielfalt des altsprachlichen Unterrichts führen folgende Veröffentlichungen aus der Curriculum-Forschung vor Augen: Materialien zur Curriculum-Entwicklung im Fach Latein, herausgegeben vom Ausschuß für didaktische Fragen im DAV, Augsburg 1971; Westphalen, Allgemeine Lernziele für den Altsprachlichen Unterricht, Anregung 18, 1972, 229-234; Bayer, Ciasen u. a., Katalog von Fachleistungen - Latein, Mitteilungsblatt des Deutschen Altlphilologenverbandes 15 (3), 1972, 1-4; Schön- 84 berger, Lernziel-Matrix für den Griechisch-Unterricht, Vervielfältigung Würzburg 1972; den Nur-Linguisten werden diese Ziele freilich ebensowenig überzeugen wie seinerzeit den Nur-Indogermanisten, zumal wenn er - paradoxes Vorrecht modemer Linguisten - den durchgängigen Surrogat-Chaiakiet von Übersetzungen nicht anerkennt). Die ganze Vordergründigkeit des von den Verf. so anspruchsvoll vertretenen Standpunktes verrät sich aber in ihrer Forderung, auch bei einer nachgewiesenen gleichgroßen Linguistik-vorbereitenden Effizienz der alten Sprachen müßten diese den neueren Sprachen wegen ihrer praktischen Unbrauchbarkeit weichen; wie ,oberflächenhaft' hier der Praxisbegriff aufgefaßt ist, zeigt das folgende (in seiner Blickverengung natürlich ebenfalls problematische) Zitat aus Weinrichs Aufsatz ,9 Jahre Englisch - 11 Tage Russisch' in der FAZ ν. 5.2.72: „Daß die lateinische Sprache etwa besonders logisch sei oder andere ausgezeichnete Qualitäten habe, die an anderen Sprachen nicht oder nicht in vergleichbarem Maße anzutreffen seien, ist ein Mythos, der heute nur noch von Nicht-Linguisten geglaubt und verbreitet wird. Daraus aber die Folgerung abzuleiten, die lateinische Sprache aus dem Fächerkanon zu streichen, erschiene mir höchst leichtfertig und unangebracht. Es ist ja nicht zu übersehen, daß die lateinische Sprache zwar nicht mehr als Sprache, jedoch mit großen Teilen ihres Vokabulars nach wie vor einen sehr hohen Verkehrswert hat, insbesondere in der wissenschaftlichen oder wissenschaftlich fundierten Kommunikation. Es wäre unökonomisch, die lateinische Terminologie bei jeder wissenschaftlichen Fachsprache neu zu lernen. Es ist daher eine richtige Entscheidung, die lateinische Sprache weiterhin zu lehren, jedoch mit deutlicherer Akzentuierung als Fachsprache bzw. als Fundament anderer Fachsprachen sowie flexibel in bezug auf die Sprachenfolge."
688
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Literatur in der Reihenfolge der Erwähnung: 1 2
A. Meillet, Einführung in die Vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Leipzig und Berlin 1909 (279). F. Bopp, Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, Frankfurt a. M. 1816.
Haupt-Angriff der modernen Linguistik gegen die Klassische Philologie: 3
H. Weinrich, Die lateinische Sprache zwischen Logik und Linguistik, Gymnasium 73, 1966, 147-163 (150) (= Vortrag Münster 1965).
Zum Problem der Anwendbarkeit der Linguistik: 4
5 6
7 8
L. Zabrocki, Grundfragen der konfrontativen Grammatik, Probleme der kontrastiven Grammatik, Düsseldorf 1970 (37) (= Schriften des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, Jahrbuch 1969, 4). D. Wunderlich, Unterrichten als Dialog, Sprache im technischen Zeitalter 32, 1969, 263287.1 G. Heibig, Zur Anwendbarkeit moderner linguistischer Theorien im Fremdsprachenunterricht und zu den Beziehungen zwischen Sprach- und Lerntheorien, Sprache im technischen Zeitalter 32, 1969, 287-305. B. Sowinski, Möglichkeiten und Grenzen strukturalistischer Sprachbetrachtung in der Schule, Wirkendes Wort 19, 1969, 163-175. H. Bühler und Mitarb., Linguistik I. Lehr- und Übungsbuch zur Einführung in die Sprachwissenschaft, Tübingen 2 1971 (= Germanistische Arbeitshefte 5). - Vgl. auch folgenden Abschnitt.
Zur modernen Linguistik im Latein- und Griechisch-Unterricht: 9 10 11 12 13 14 15 16
Η. v. Hentig, Linguistik-Schulgrammatik-Bildungswert. Eine neue Chance für den Lateinunterricht, Gymnasium 73, 1966,125-146. H. Steinthal, Grammatische Begriffsbildung dargestellt an der Lehre von Gerundium und Gerundivum, Gymnasium 74,1967, 227-251. G. Röttger, Autonomer Sprachunterricht, Der Altsprachliche Unterricht (AU) X 4, 1967, 22-48. L. Schmüdderich, Überlegungen zum Gebrauch des sog. Praesens historicum, AU XI 2, 1968, 61-67. R. Pfister, Strukturalismus und Lateinunterricht, Gymnasium 76,1969,457-472. T. L. Cracas, Four Linguistic Models for the comprehension of the Latin Sentence, The Classical World 62,1969, 255-260. D. J. Morton, The Cambridge School Classics Project - an experiment, AU ΧΠΙ 2, 1970, 5-15. E. Hermes, Latein als Wahlpflichtfach in einem reformierten Lehrplan, AU ΧΠΙ 2, 1632.
Klassische Philologie und moderne Linguistik
689
17
R. Pfister, Thesen zu Linguistik und Sprachunterricht, Gymnasium 77, 1970, 4 0 5 - 4 0 7 .
18
J. Untermann, Zu Raimund Pfisters .Thesen zu Linguistik und Sprachunterricht', Gym-
19
G. Dette, Latein für Studienanfänger der Realschullehrerlaufbahn ..., Gymnasium 78,
20
H. Roemer, Zur Reform des altsprachlichen Lehrbuchs, Gymnasium 78, 1971, 3 6 3 - 3 7 2 .
nasium 78, 1971, 177-182. 1971, 3 5 0 - 3 6 2 . 21
H. Steinthal, Zum Aufbau des Wortschatzes im Lateinunterricht, AU X I V 2, 1971, 2 0 50.
22
J. Klowski, Was ist die generative Transformationsgrammatik und welche Bedeutung könnte sie für den altsprachlichen Unterricht haben? AU X I V 2, 1971, 5 - 1 9 (vgl. dazu: W. Hartmann, Unterrichtsbeispiele zur Arbeit mit der generativen Grammatik im Deutschunterricht, Wirkendes Wort 19, 1969, 2 8 9 - 3 1 0 ) . Vgl. ferner die Lit.-Angaben im Fachbericht von B . Borecky, Die Altertumswissenschaft in der Tschechoslowakei seit dem zweiten Weltkriege, Gymnasium 74, 1967, 2 5 5 - 2 5 8 .
Zur modernen Linguistik in der klassisch-philologischen Forschung: 23 24
H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 1964. K. Strunk, .Besprochene und erzählte Welt' im Lateinischen? Eine Auseinandersetzung mit H. Weinrich, Gymnasium 76, 1969, 289-310.
25
F. Fajen, Tempus im Griechischen. Bemerkungen zu einem Buch von Harald Weinrich, Glotta 49, 1971, 34^*1.
26
H. Fajen, Der .Irrealis' im Griechischen. Bemerkungen zu einem Buch von Harald Weinrich, Gymnasium 78, 1971, 4 4 2 - 4 4 6 . I
27
H. B . Rosén, Eine Laut- und Formenlehre der herodotischen Sprachform, Heidelberg
28
H . B . Rosén, Strukturalgrammatische Beiträge zum Verständnis Homers, Amsterdam
29
C. J. Ruijgh, Rezension von Nr. 28, Mnemosyne 21, 1968, 295.
1962. 1967. 30
Κ. Strunk, Rezension von Nr. 28, Indogermanische Forschungen 75, 1970, 3 1 5 - 3 2 2 .
31
C. J. Ruijgh, A propos d'une nouvelle application de méthodes structuralistes à la langue homérique, Mnemosyne 21, 1968, 113-131. Vgl. ferner unten Nr. 76.
Zur Grundlagendiskussion der Klassischen Philologie: 32
M. Fuhrmann, Zur gegenwärtigen Situation der Klassischen Philologie, in: Wie klassisch ist die klassische Antike? Zürich und Stuttgart (Artemis) 1970, 5 - 2 2 und 4 5 - 5 3 (dazu P.R. Schulz, Gymnasium 7 8 , 1 9 7 1 , 4 6 0 f f . ) .
Zur Geschichte der modernen Linguistik: 33
Dionysii Thracis ars grammatica. Ed. G. Uhlig, Leipzig 1833 (repr. Hildesheim 1965) (= Grammatici Graeci I I ) .
34
Apollonii Dyscoli quae supersunt. Ree. R. Schneider et G. Uhlig, Leipzig 1 8 7 8 - 1 9 1 0 (repr. Hildesheim 1965) (= Gramm. Gr. Π 1-3).
690
Klassische Philologie und moderne Linguistik
35
Des Apollonios Dyscolos vier Bücher über die Syntax. Übersetzt und erläutert von
36
Prisciani Grammatici Caesariensis institutionum grammaticarum libri X V I I I . Ree.
37
J. Grimm, Deutsche Grammatik, Göttingen 1819-1865.
38
Α. F. Pott, Etymologische Forschungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen
39
K. Brugmann-H. Osthoff, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiet der indoger-
A. Buttmann, Berlin 1877. M. Hertz, Leipzig 1 8 5 5 - 5 9 (repr. Hildesheim 1961) (= Grammatici Latini Π. ΠΙ).
..., Lemgo 1833-1836. manischen Sprachen, Leipzig 1878-1910. 40
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1880. 'Tübingen 1970.
41
F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipzig 1879. 2 Paris 1887.
42
F. de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Lausanne et Paris 1916.
2
1922. -
Deutsch: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1931. 1 9 6 7 . 2
43
G. von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig 1891. 2 1 9 0 1 ( 4 6 3 ^ 7 0 ; vgl. Coseriu, Nr. 55, S. 54).
44
Konstituenten-Analyse und Notationstechniken: a) bei Herling 1827 (unten Nr. 78), Bd. I S. 409: (1) Er / besang / den Sieg / bei Prag (2) Er / besang / den Sieg bei Prag: Sinn-Ambiguität erkannt, durch Abtrennung verdeutlicht; b) bei Bierwisch 1966 (,Strukturalismus', Kursbuch 5 , 1 9 6 6 , 1 0 8 f.): Satz
(1) Adverb
Subjekt
Hilfsverb Artikel
Später
wurde
der
(2)
Substantiv
Brief
Verb Attribut Präp.
Subst.
von
Klaus
Satz Verb
Adverb
Später
verlesen
wurde
Art.
Subst.
Präp.
der
Brief
von
Subst. Klaus
verlesen
Klassische Philologie und moderne Linguistik
691
Sinn-Ambiguität durch Stammbaum (phrase-marker) veranschaulicht; c) bei Lakoff 1968 (unten Nr. 76), S. 75: Die beiden Sätze (1) .Volo Marcum ire' und (2) .Impero ut Marcus eat' haben die gleiche Tiefenstruktur, veranschaulicht durch den phrase-marker:
Objekt-Nominalphrase
45 46 47 48 49 50 51 52
N. Chomsky, Syntactic Structures, The Hague 1957. 41964. L. Bloomfield, Language, New York 1933. London 1934 u. ö. E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, München 1939. 41968 (= Handbuch der Altertumswissenschaft Π 1, 1) (11). O. Szemerényi, Trends and Tasks in Comparative Philology, London 1962. O. Szemerényi, Einführung in die Vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt 1970 (24). Κ. Strunk, Historische und deskriptive Linguistik bei der Textinterpretation, Glotta 49, 1971, 191-216. G. Neumann, Neue Fragestellungen und Ergebnisse der Sprachwissenschaft, Gymnasium 78, 1971, 334-349. E. Coseriu, Pour une sémantique diachronique structurale, Travaux de linguistique et de littérature Π 1, Strasbourg 1964,139-186.
Zur Kontrastierung der traditionellen Grammatik mit der modernen Linguistik: 53 54 55 56
N. Chomsky, Cartesianische Linguistik. Ein Kapitel in der Geschichte des Rationalismus, Tübingen 1971 (= Cartesian Linguistics, New York 1966). N. Chomsky, Sprache und Geist, Frankfurt/M. 1970 (= Language and Mind. New York etc. 1968) (36). I E. Coseriu, Einführung in die Transformationelle Grammatik, Vervielfältigung, Tübingen 1970. E. Coseriu, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Eine Übersicht, Teil I Tübingen 1969, Teil Π (Von Leibniz bis Rousseau) Tübingen 1972.
88
692 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77
78
Klassische Philologie und moderne Linguistik Grammatica Universalis. Meisterwerke der Sprachwissenschaft und der Sprachphilosophie. Eing. u. hrsg. v. H. E. Brekle, Stuttgart 1968 ff. J. Lyons, Einführung in die moderne Linguistik, München 1971. H. Glinz, Linguistische Grundbegriffe und Methodenüberblick, Frankfurt a. M. 1970. 3 1971 (11^40). A. Arnauld/C. Lancelot, Grammaire générale et raisonnée ou La Grammaire de PortRoyal, Paris 1660 (repr. Stuttgart 1966). J. C. A. Heyse's deutsche Schulgrammatik oder Kurzgefaßtes Lehrbuch der deutschen Sprache, Hannover 171851 (XI). J. N. Madvig, Syntax der griechischen Sprache, besonders der attischen Sprachform, Braunschweig 1847. 2 1884 (VE). R. Kühner, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, Hannover 1834/35. R. Kühner, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Hannover 1878/79. A. Matthiä, Ausführliche Griechische Grammatik, Leipzig 1807. 3 1835 (Bd. Π p. V/VI; Bd. I S. 19). Mess, de Port-Royal, Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue grecque, Paris 1655. W. v. Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, Humboldt-Studienausgabe Bd. ΙΠ, Darmstadt 3 1969. H. E. Brekle, Rezension von Nr. 53, Linguistische Berichte 1,1969, 52-66 (63 Anm. 4). K. F. Becker, Organism der Sprache, als Einleitung zur Deutschen Grammatik, Frankfurt a. M. 1827. 2 1841. - Dazu: G. Haselbach, Grammatik und Sprachstruktur. Karl Ferdinand Beckers Beitrag zur Allgemeinen Sprachwissenschaft in historischer und systematischer Sicht, Berlin 1966. K. W. L. Heyse, System der Sprachwissenschaft, Berlin 1856. C. Michelsen, Philosophie der Grammatik, Berlin 1843. L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris 1959. 2 1965. H.-J. Heringer, Theorie der deutschen Syntax, München 1970. H.-J. Heringer, Deutsche Syntax, Berlin 1970 (Göschen 1246/1246 a). J. Bechert und Mitarb., Einführung in die generative Transformationsgrammatik, München 1970 (Linguistische Reihe, Bd. 2). R. T. Lakoff, Abstract Syntax and Latin Complementation, Cambridge Mass. and London 1968 (3 f.). - Dazu: G. Calboli, II latino o della grammatica, Lingua e stile 5, 1970, 107-36. W. Rothe, Traditionelle und moderne französische Sprachlehre, Lebende Sprachen 6, 1965, 181-185 (= Langenscheidt-Mitteilungen für den Philologen, Sonderheft 5, 17-31; hier 27. 29). S. H. A. Herling, Die Syntax der deutschen Sprache. Zweiter Theil: Der Periodenbau der deutschen Sprache, Frankfurt a. M. 2 1827 (18). I
693
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Herling 1821 (Abh. des frankfurtischen Gelehrten Vereins für deutsche Sprache, m . Stück, Frankfurt 1821)
(4)
Bernhardt 1825 (Deutsche Grammatik)
79
80 81 82
Krüger 1826 (Erörterung der gramm. Eintheilung ... etc.)
Kühner 1834/35 (Gr. Gr. Π 1, 3 1898, S. 9, Anm. 1) Kühner 1878/79 (Lat. Gr. Π 2, 1879 S. 765 Anm. 1) I I
Heyse 1849 (Lehrbuch d. deutschen Sprache, Bd. 2, S. 45, Anm.)
Modifizierung u. Verfeinerung der Theorie Herlings (Tesnières): W. Härtung, Die zusammengesetzten Sätze des Deutschen, Berlin 1964 (= Studia Grammatica IV); vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik. Ein Leitfaden, Ffm. 1968, §§ 192-201 (Fischer-Buch 6051). E. Schwyzer-A. Debrunner, Griechische Grammatik, Π (Syntax und synt. Stilistik), München 1950. 3 1966 (639 ff.). A. Ernout-F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 1951. 2 1953. G. Mounin, Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München 1967 (111) (= Teoria e Storia della Traduzione, Turin 1965).
Zu den Anwendungsmöglichkeiten der modernen Linguistik in der Klassischen Philologie: 83 84 85 86 87
88 89 90
E. Coseriu, Über Leistung und Grenzen der kontrastiven Grammatik, in Nr. 4 (s.o.), S. 9 - 3 0 (28). Κ. H. Wagner, Probleme der kontrastiven Sprachwissenschaft, Sprache im technischen Zeiteiter 32,1969, 305-326. H. Glinz, Die Sprachen in der Schule. Skizze einer vergleichenden Satzlehre für Latein, Deutsch, Französisch und Englisch, Düsseldorf 2 1965. K. F. v. Nägelsbach, Lateinische Stilistik, Nürnberg 1846. 9 1905 (repr. Darmstadt 1963). J. H. Schmalz, Lateinische Stilistik, in: Stolz-Schmalz, Lateinische Grammatik Π, Nördlingen 1885, 365 ff. (jetzt: Hofmann-Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, im Handbuch der Altertumswissenschaft II 2,2, München 1965. 2 1972, 685-842). F. Sommer, Vergleichende Syntax der Schulsprachen, Leipzig - Berlin 1921. H. Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, Wolfenbüttel 1873. 10 1914. " 1 9 5 3 (bearbeitet von A. Thierfelder; letzter Nachdruck 1968). H. Menge, Repetitorium der griechischen Syntax, Wolfenbüttel 1878. 9 1961 (bearb. von A. Thierfelder und U. Gebhardt).
89
694
Klassische Philologie und moderne Linguistik
Zur Wortfeldforschung: 91 92 93 94
J. H. H. Schmidt, Synonymik der griechischen Sprache, 4 Bände, Leipzig 1876-1886. J. H. H. Schmidt, Handbuch der lateinischen und griechischen Synonymik, Leipzig 1889. - Dazu: J. Latacz, Zum Wortfeld ,Freude' in der Sprache Homers, Heidelberg 1966, 16f. J. Latacz, Gnomon 41,1969, 347-353; Gnomon 42, 1970, 143-147.
6. Epilog
Die alten Sprachen im Unterricht 4/1990, 20-24
Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel am 29.6.1990 in der Martinskirche zu Basel Liebe Maturae und Maturi! Herr Rektor! Verehrte Kollegen vom Humanistischen Gymnasium und von der Universität! Verehrte Inspektionsmitglieder! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich vor fast 10 Jahren in Mainz den Ruf auf den Basler Lehrstuhl für Griechische Philologie erhielt und annahm, da habe ich von den engen Beziehungen zwischen dem Basler Griechisch-Lehrstuhl und dem Basler Humanistischen Gymnasium noch nichts gewußt. Das hat sich rasch geändert. Seit 8 Jahren nehme ich nun schon als Experte an der Griechisch-, zuweilen auch Latein-Matur teil, ich bilde manchen Absolventen des HG zum Griechisch-Lehrer aus, und einige meiner Studenten sind bereits wieder Lehrer am HG. Zwischen dem Lehrstuhl für Griechische Philologie und dem Humanistischen Gymnasium spielen vielfältige Beziehungen, auch personeller Art, hin und her, und ich nehme am Geschick dieser Schule starken Anteil. Darum hat mich die Einladung der Schulleitung, heute hier zu sprechen, sehr gefreut. Sie hat mich aber auch aus einem anderen Grunde sehr gefreut: Sie gibt mir Gelegenheit, gerade jetzt, in dieser erregenden Zeit des endlich Wirklichkeit gewordenen europäischen Wiederaufbruchs, hier in Basel, das lange Zeit zu den großen europäischen Geisteszentren gehört hat, ein paar grundsätzliche Gedanken zu äußern zum Thema .moderne Bildung' und speziell zur Position der Alten Sprachen in der modernen Bildung. Ich will gleich hinzufügen: Es sind ausschließlich meine persönlichen Gedanken, herangereift in 30 Jahren universitärer Lehre und Forschung, Jahre, in denen ich mit Bildungsinstitutionen aller Art und jeder Ebene in vielen Ländern der Welt zu tun hatte und noch täglich zu tun habe, - und es sind die Gedanken eines Universitätslehrers, der trotz mancher anderen beruflichen Verlockung sein Leben ganz in den Dienst dieser einen Sache gestellt hat: Menschen aller Schichten und jeden Alters mit dem Beginn unseres europäischen Weges bei den Griechen vor rund 2700 Jahren bekannt und vertraut zu machen - das heißt: Menschen der Gegenwart in der Vergangenheit,
6 9 8 Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel
die ihre Heimat ist, heimisch zu machen, damit sie ihre Gegenwart noch besser durchschauen und gestalten können. Ich wende mich zuerst an diejenigen, die heute im Mittelpunkt stehen: an die 38 Maturanden. Ich weiß, daß Ihnen in diesen Minuten der Sinn nach anderem steht als gerade nach Latein und Griechisch. .Darüber' - so denken Sie gewiß .darüber haben wir doch nun genug geschwitzt - warum schon wieder dieses Thema?' Und mancher denkt vielleicht noch Schlimmeres - .Nie wieder Cicero!' zum Beispiel, oder .Caesar auf den Mond!' - Ich will Ihnen gern gestehen, daß ich bei meiner eigenen Abiturfeier, vor 37 Jahren, in Halle an der Saale, ganz ähnlich dachte. Doch das sind Augenblicksgedanken. Nach ein paar Monaten (zuweilen Jahren) stellt sich unweigerlich das Bedürfnis ein, für das, 21 was man auf dem Gymnasium getan hat, Rechtfertigung zu finden, vor I sich selbst und vor den anderen. Der Mensch kann nicht leben, wenn er, was er getan hat, nicht bejahen kann. Lassen Sie mich Ihnen für diesen Zeitpunkt, der eines Tages da sein wird, schon heute ein paar Überlegungen anbieten. Erstens: Lassen Sie sich von niemandem einreden, der Besuch eines altsprachlichen Gymnasiums und das Erlernen der Alten Sprachen Latein und Griechisch sei zu nichts nütze gewesen. Denken Sie daran, daß unter diesem Nützlichkeitsbegriff für die allermeisten von Ihnen in ein paar Jahren auch die Kurvendiskussion, Molieres .L'Avare' und die Schlacht bei Sempach völlig nutzlos erscheinen werden! Der Nutzen des Gymnasiums ist nicht identisch mit der Berufsverwertbarkeit fachlichen Einzelwissens. Das Gymnasium - man kann auch sagen: .die Oberschule', ,das Liceo', ,das College' usw. - ist eine Ausbildungsstätte für künftige Intellektuelle, wie sie jedes Land braucht. Solche Ausbildungsstätten sind in der ganzen Welt keine Wissens-Abfüllstationen, sondern Denkschulen! Alles, was methodisch denken lehrt und Kreativität verheißt, ist da willkommen - Naturwissenschaften, Mathematik, musische Fächer und eben auch - Sprachen. Wohlgemerkt alle Sprachen - erstens als logische Systeme, zweitens als Fenster zu fremden Denk- und Lebensweisen. Wenn die beiden alten Sprachen auch darunter sind, ist dies kein Schaden, sondern eine Horizonterweiterung. Griechisch und Latein sind die europäischen Grundsprachen. Auch sie zu kennen - oder doch wenigstens in sie ,hineingerochen' zu haben - ist gerade heute eine Chance zu noch besserem und schnellerem Verstehen unserer hochkomplizierten gesellschaftlichen Systeme. Die Welt der modernen Kommunikation baut zunehmend auf Latein und Griechisch als Basissprachen auf. Sie finden Griechisch und Latein in steigenden Prozent-Anteilen im heutigen internationalen Englisch wieder. Computersprachen greifen zunehmend auf Griechisch und Latein zurück, in der unausgesprochenen Voraussetzung, daß
am 29.6.1990 in der Martinskirche zu Basel
699
dies nun einmal die moderne internationale Universalsprache sei, die schließlich jeder Manager verstehe - all over the world. Hätten wir diese Basissprache nicht - wir müßten eine neue, künstliche, erfinden. Die Folgen dieser Entwicklung im Welt-Bildungswesen sind bereits erkennbar. Latein wird überall allmählich wieder nachgefragt. Die ost- und südeuropäischen Länder - heute endlich vom Zwang zu kultureller Selbstverleugnung befreit - führen das altsprachliche Gymnasium wieder ein, wie ich bei einem internationalen Kongreß in London vor wenigen Wochen erfahren konnte1: Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, die DDR 2 , verstärkt auch Jugoslawien. In China ist vor wenigen Jahren ein eigenes Universitäts-Institut für Griechisch und Latein gegründet worden, das voriges Jahr seine ersten Absolventen als Multiplikatoren an andere Universitäten des Landes entlassen hat3 ... Ich breche hier die Beispielreihe ab. Was deutlich werden sollte, ist auch so schon klar: Die moderne Bildung braucht Mathematik, Physik, Chemie, Biologie - gar keine Frage - , sie braucht auch Englisch, Französisch, Italienisch, wenn möglich Russisch - selbstverständlich! - aber: sie lehnt von ihrer inneren Natur her auch Griechisch und Latein nicht ab, im Gegenteil: sie greift sehr gern danach! Sie - die Maturanden des Jahres 1990 - haben also keinerlei Anlaß, sich der Alten Sprachen etwa zu schämenl Das ist das erste, was zu sagen war. i 1
Colloquium Didacticum Classicum ΧΙΠ Londiniense, Kings's College London, 2.-6. April 1990. 2 Die Rede wurde am 29.6.1990 gehalten. (Anm. d. Red.) 3 IHAC = The Institute for the History of Ancient Civilisations, Northeast Normal University, C H A N G C H U N 130024, P. R. China (mit Instituten für Klassische Philologie und Alte Geschichte, Assyriologie, Ägyptologie, Hethitologie; im Juni 1989 konnten neben 18 B. A.s auch 4 M. A.s und 1 Ph. D. verliehen werden. Das 1979 gegründete Institut ist mit personeller und finanzieller Hilfe aus Europa und den USA inzwischen gut ausgebaut worden; aus der Bundesrepublik Deutschland haben zuletzt - für jeweils 1 Jahr oder länger - lehrend und aufbauend dort mitgewirkt Prof. Dr. B. Kytzler (FU Berlin) und Prof. Dr. F.-H. Mutschier (Univ. Heidelberg). Das Institut gibt ein Mitteilungsblatt .NEWS' heraus. In Nr. 7/8 dieses Blattes vom 15.9.89 hatte der Vizedirektor des Instituts, Prof. Yang Zhi, geschrieben: „Every newsletter I usually make an appeal for your help [...] I will do so again because some of you (rightfully) think that what happened in June [das Studenten-Massaker auf dem ,Platz des Himmlischen Friedens' in Peking] merits censure. To extend this to our institute, I firmly believe the converse. We must go on." Und in Nr. 9 vom 15.6.1990 begegnet derselbe Kollege westlichem Erstaunen über die Ambitionen des Instituts so: „What we are trying to do is, of course, impossible - in the same way circumnavigating the world was six centuries ago. I am always surprised when people ask why would China be interested in studying Hittite or Sumerian or Egyptian. No one asks the same of Britain, or France, or ... you name it. Having one's own remarkably long history does not preclude the study of others." - China muß uns zeigen, was für ein Kapital wir in der klassischen Bildung besitzen; Europa wirft es zum Fenster hinaus.
7 0 0 Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel
22
Und nun das zweite: Lassen Sie sich von niemandem einreden, da Sie ein altsprachliches Gymnasium besucht und Alte Sprachen gelernt hätten, seien Sie etwas Besonderes - entweder etwas besonders Ausgefallenes oder aber etwas besonders Herausgehobenes und hätten dann vielleicht sogar Grund, auf andere hinabzusehen! Da steht sofort das Stichwort .elitär' im Raum. Glauben Sie diese Unterstellungen nicht - treten Sie ihnen entgegen! Nicht der Besuch eines altsprachlichen Gymnasiums hebt Sie über andere hinaus, sondern der Besuch eines Gymnasiums überhaupt! Hebt Sie aber auch primär nicht sozial heraus, sondern intellektuell. Sie haben etwas lernen dürfen, was die meisten Ihres Altersjahrgangs nicht lernen konnten. Das ist kein Anlaß zu stolzgeschwelltem Selbstgefühl, sondern zu besonderer Leistungsbereitschaft und zu besonderem Verantwortungsbewußtsein. Insofern sind Sie in der Tat Teil einer Elite - aber diese Elite (das müssen wir ja sehen!) wird heute dringender denn je gebraucht! Unsere Welt ist ja mitten in einem Prozeß des Umdenkens begriffen. Der Weg, der vor 2700 Jahren bei den Griechen begann, hat in unserem Jahrhundert für alle sichtbar in eine Aporie geführt. Um diese Aporie zu überwinden, die die Griechen seinerzeit natürlich nicht voraussehen konnten, brauchen wir heute neue Ideen, in allen Bereichen - im Freund-Feind-Denken, in der Rettung unserer natürlichen Umwelt, in der Meisterung des Nord-Süd-Gefalles. Wo sollen diese neuen Ideen herkommen, wenn nicht von den intellektuellen Eliten? Wir brauchen heute ganz besonders umfassend gebildete Führungspersönlichkeiten, kritische Köpfe, die nicht weniger, sondern mehr wissen und können müssen als ihre Vorgänger in den Leitungspositionen. Denn sie müssen nicht mehr nur fortsetzen, wie meistens in den letzten 150 Jahren, sondern sie müssen Weichen stellen, neue Wege finden. Wer behaupten wollte, Latein und Griechisch seien dabei überflüssig, der müßte schon viel Mut besitzen. Latein und Griechisch sind mit Sicherheit nicht unentbehrlich bei der Lösung der anstehenden Weltprobleme - in derart lächerlicher Weise werden wir uns gewiß nicht überschätzen! - , aber unsere Zeit hat auch keine Veranlassung, auf diese Fächer im Bildungsangebot etwa zu verzichten^. Unsere Zeit muß vielmehr froh sein, daß ein kleiner Teil unserer Jugend bereit ist, diese Fächer nach wie vor kennenzulemen und damit die Anfänge unserer geistigen Herkunft - stellvertretend für die Gesamtgesellschaft - im kollektiven Bewußtsein zu halten! Soviel wollte ich Ihnen, den Maturanden, sagen - und die Jüngeren, die die Matur noch vor sich haben, ebenso wie die Eltern, die ja den Gang der öffentlichen Bildung durch ihr Erziehungsrecht stets mitbestimmen, werden das, was für sie verwendbar ist, sicherlich schon mitgehört haben.
am 29.6.1990
in der Martinskirche
zu Basel
701
So hätte ich denn nur noch eine große und herzliche Bitte, eine Bitte an die Lehrer dieser Schule: Lassen Sie sich durch die oft tagespolitisch bestimmte und darum oft kurzsichtige Bildungsdiskussion nicht verunsichern und womöglich sogar gegeneinander ausspielen! Vor allem lassen Sie sich nicht einreden, wer für ein altsprachliches Gymnasium sei, der sei ein Ewiggestriger. Es ist in Wahrheit gerade umgekehrt. Wer in einer modernen pluralistischen Gesellschaft von den zahlreichen wählbaren Bildungsangebolten ein ganz bestimmtes beschnei- 23 den oder gar eliminieren will, der macht sich verdächtig, um vordergründiger Interessen willen die immensen Ansprüche unserer Zeit gar nicht zu erkennen! Darin läge aber ja das Ewiggestrige! Es kann ja niemals um Wert oder Unwert von Personen oder Haltungen gehen, sondern nur um den Wert oder Unwert von Institutionen. Die Institution »Altsprachliches Gymnasium' ist aber heute nicht weniger wertvoll als früher, sondern eher mehr! Diese Institution nur deswegen beseitigen zu wollen, weil sie zu bestimmten Zeiten von scheinbar nicht zeitgemäßen Kräften oder Haltungen bestimmt wird, das hieße handeln wie jene Revolutionäre während der russischen Oktoberrevolution, die die Institution .Eisenbahn' abschaffen wollten, weil die Bourgeoisie damit gefahren sei! Lenin konnte diesen Unsinn damals gerade noch verhindern (was freilich sein System auch nicht gerettet hat, wie wir heute sehen - aber daran war nicht die Eisenbahn schuld). Sie sind Lehrer an einem altsprachlichen Gymnasium. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Niemand kann Sie zwingen, an einem altsprachlichen Gymnasium zu wirken. Wenn Sie aber an einer Schule dieses Typs tätig sind, dann würde ich vorschlagen, daß Sie auch dazu stehen - ob als Griechisch-, Latein·, Mathematik-, Englisch-, Französisch- oder Zeichenlehrer. Alle sollten das Konzept dieser Schule mittragen. Das schließt Kritik nicht aus, macht sie sogar notwendig, damit angepaßt, verbessert werden kann, zum Nutzen der jungen Menschen und der Gesellschaft. Aber wenn Kritik, dann sollte es Kritik auf dem Boden des Konzepts sein. Sie alle arbeiten ja doch zusammen, um Schüler auszubilden, die - aus welchen Gründen auch immer - gerade dieses Konzept gewählt haben. Diese Wahl muß ja doch wohl honoriert werden! Sie wird honoriert, indem in klarer Sachlichkeit in allen Fächern die Eigenart des altsprachlichen Gymnasiums betont wird - ganz ebenso, wie an einem musischen Gymnasium in allen Fächern das Musische betont wird oder an einem mathematischnaturwissenschaftlichen das Mathematisch-Naturwissenschaftliche. Wenn in dieser Grundsatzfrage kein Konsens besteht, dann gerät der geistige Kern einer Bildungsgemeinschaft in die Gefahr, sich selbst ad absurdum zu führen. Darum erlauben Sie mir - der ich selbst einmal Lehrer an einem altsprachlichen Gym-
702
Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel
nasium war und viele altsprachliche Gymnasien im ganzen deutschsprachigen Raum recht gut kenne - den in aufrichtiger Kollegialität gegebenen Ratschlag: Halten Sie zusammen! Es wird den Schülern guttun, den Eltern, der öffentlichen Meinung und nicht zuletzt Ihnen selbst! Ich komme zum Schluß. Das Jahr 1990 scheint in der europäischen, vielleicht sogar in der Weltgeschichte ein besonderes Jahr zu werden. Europa besinnt sich wieder auf seine kulturelle Identität - von Warschau über Budapest, Leipzig und Prag bis nach Paris, London und Dublin. Zu dieser kulturellen Identität dazu gehört unser gemeinsamer Beginn bei den Griechen - die uns vor 2700 Jahren die Schrift gegeben haben, die Literatur, die Wissenschaft, die Politik - und auch das Prinzip der Leistung für die Gemeinschaft. Vom Griechenland des 8. Jh. s ν. Chr. spannt sich über Rom und die Renaissance ein großer Bogen bis zu uns. Diese Gesamtentwicklung als ein Ganzes 24 in den Blick zu bekommen ist heute, I wo ihre Bedenklichkeiten sichtbar werden, besonders nötig. Dem altsprachlichen Gymnasium wächst hier eine neue, eine europäische, eine Integrationsaufgabe zu. Damit gewinnt das altsprachliche Gymnasium auch eine neue Aktualität. Es kann heute nicht mehr heißen ,Warum heute noch Latein und Griechisch?' Es kann nur heißen: ,Warum heute wieder Latein und Griechisch?' Ein paar Antwortmöglichkeiten habe ich zu skizzieren versucht. Viele von Ihnen werden darüber zur Tagesordnung übergehen. Mancher wird aber vielleicht auch daran weiterdenken. Mehr war nicht zu erreichen. Ich wünsche den Maturanden 1990 einen guten Start in die Selbstverantwortung und dem Humanistischen Gymnasium Basel eine glückliche Entwicklung.
Anhang
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs* I. Bücher 1. Zum Wortfeld .Freude' in der Sprache Homers, Heidelberg: Winter, 1966 (= Diss FU Berlin 1963). 2. Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, München: Beck, 1977 (= Zetemata, 66). 3. Homer. Tradition und Neuerung, hrsg. v. J. Latacz, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979 (Wege der Forschung, Bd. 463). [vgl. u. Nr. 42-44 b], 4. Homer. Der erste Dichter des Abendlands, München - Zürich: Artemis, 1985. 2 1989. 4a. Omero. Il primo poeta dell'Occidente, Roma - Bari: Laterza, 1990 (Biblioteca Universale Laterza, 314). 4b. Horneros. De eerste dichter van het avondland, Nijmegen: SUN, 1991. 5. Griechische Literatur in Text und Darstellung, I: Archaische Periode (Von Homer bis Pindar), hrsg. [sowie eingeleitet, übersetzt und kommentiert] v. J. Latacz, Stuttgart: Reclam, 1991. 6. Homer. Die Dichtung und ihre Deutung , hrsg. v. J. Latacz , Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991 (Wege der Forschung, Bd. 634). 7. Zweihundert Jahre Homerforschung. Rückblick und Ausblick, hrsg. v. J. Latacz, Stuttgart: Teubner, 1991 (Colloquia Raurica, Bd. 2). 8. Klassische Autoren der Antike. Literarische Porträts von Homer bis zu Boëthius [zusammen mit B. Kytzler und K. Sallmann], Frankfurt/M.: Insel, 1992. 9. Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993 (UTB 1745).
* Die in die vorliegende Sammlung aufgenommenen Aufsätze sind halbfett numeriert; hinter der bibliographischen Angabe stehen in eckigen Klammern die Seitenzahlen in diesem Band.
706
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
II. Artikel im ,Lexikon des frühgriechischen Epos' (A) größere 10. 11. 12. 13.
άνθρωπος: άνήρ άπας άμύνω
Sp.877-905 Sp. 824-843 und 866-868 sowie Gesamtredaktion Sp. 993-1000 LfgrE, Sp. 650-657
(Β) kleinere 14-29.
αμμες - άμύντωρ - άμύω - άμφαδά - άμφαδίην - άμφάδιος - άμφαδόν - αμφίβολος - άμφιπολεύω - όμφίπολος - άνασταδόν - άναφανδά - άναφανδόν - άνδροτητα αντρον - απτερος.
III. Aufsätze und größere Besprechungen 30. άνδροτητα, Glotta 43,1965,62-76. 31. απτερος μΰθος - απτερος φάτις: ungeflügelte Worte? [in der Odyssee und in Aisch. Agam.], Glotta 46, 1968,24-47. [605-624] 32. Rezension zu: A. Corlu, Recherches sur les mots relatifs à l'idée de prière, d'Homère aux tragiques, Paris 1966, und zu: A. Citron, Semantische Untersuchung zu σπένδεσθαι σπένδειν - εΰχεσθαι, Winterthur 1965, Gnomon 41, 1969, 347-353. 33. Rezension zu: H. Schwabl, Hesiods Theogonie. Eine unitarische Analyse, Wien 1966, Gymnasium 76,1969,75-79. 34. Rezension zu: C. Moussy, Recherches sur τρέφω et les verbes grecs signifiant .nourrir', Paris 1969, Gnomon 42,1970,143-147. 35. Noch einmal zum Opferbetrug des Prometheus [in Hesiods Theogonie], Glotta 49,1971, 27-34. [227-233] 36. Klassische Philologie und moderne Linguistik, Gymnasium 81, 1974, 67-89.[671-694] 37. Zur Forschungsarbeit an den direkten Reden bei Homer (1850-1970). Ein kritischer Literaturüberblick, Grazer Beiträge 3, 1975, 395-422. 38. Rezension zu: A. W. James, Studies in the Language of Oppian of Cilicia, Amsterdam 1970, Gnomon 47, 1975, 422-449. 39. Zum Musen-Fragment des Naevius, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N. F. 2,1976,119-134. [501-521]
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
707
40. Rezension zu: Claude Sandoz, Les noms grecs de la forme, Bern 1972, Kratylos 21, 1977, 123-133. 41. Zu Caesars Erzählstrategie (BG I 1-29: Der Helvetierfeldzug), Der Altsprachliche Unterricht 21, H. 3,1978, 70-87. [523-545] 42. Einfuhrung zum Wege-der-Forschung Band .Horner' (s. o. Nr. 3), Darmstadt 1979,1-23. [13-35] 43. Tradition und Neuerung in der Homerforschung. Zur Geschichte der Oral poetry-Theorie, in: Homer (s.o. Nr. 3), 1979, 2 4 ^ 4 . 44. Spezialbibliographie zur Oral poetry-Theorie in der Homerforschung, in: Homer (s. o. Nr. 3), 1979,573-618. 44 a. Übersetzung von: G. Hermannus, De iteratis apud Homerum, Leipzig 1840, ins Deutsche, in: Homer (s.o. Nr. 3), 1979, 47-59. 44 b. Übersetzung von: J. A. Russo, Homer against his Tradition, 1968, ins Deutsche, in: Homer (s.o. Nr. 3), 1979, 403^27. 45. Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition, in: Dialog SchuleWissenschaft. Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 12, 1979, 5-49 (Bayerischer Schulbuch-Verlag München). [569-602] 46. Die Entwicklung der griechischen und lateinischen Schulgrammatik, in: Handbuch der Fachdidaktik. Fachdidaktisches Studium in der Lehrerbildung. Alte Sprachen 1, hrsg. v. Joachim Gruber und Friedrich Maier, München: Oldenbourg, 1979, 193-221. [639-670] 47. Homer, Der Deutschunterricht 31, 1979, H. 6, 5-23. 48. Ovids .Metamorphosen' als Spiel mit der Tradition [Neufassung], Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N. F. 5, 1979, 133-155. 49. Horazens sogenannte Schwätzersatire, Der Altsprachliche Unterricht 23, 1980 (H. 1), 5-22. [547-568] 50. Rezensionsaufsatz zu: Herbert Eisenberger, Studien zur Odyssee, Göttingische Gelehrte Anzeigen 232,1980, 2 9 ^ 2 . 51. Die rätselhafte .große Bewegung'. Zum Eingang des Thukydideischen Geschichtswerks, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N. F. 6 a (= Festschrift Erbse), 1980,77-99. [399^126] 52. Zeus' Reise zu den Aithiopen (Zu Ilias I, 304-495), in: Gnomosyne. Menschliches Denken und Handeln in der frühgriechischen Literatur. Festschrift für Walter Marg zum 70. Geburtstag, hrsg. v. G. Kurz, D. Müller und W. Nicolai, München: Beck, 1981, 53-80. [175-203] 52. Zum gegenwärtigen Stand der Thalysien-Deutung (Theokrit I 7) [zusammen mit Tamara Choitz], Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N.F. 7, 1981, 85-95.
708
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
54. Der Planungswille Homers im Aufbau der Ilias, Die alten Sprachen im Unterricht 28, 1981, H. 3, 6-16. 55. Zusammenfassender Literaturbericht für die Jahre 1951-1980. Griechische Sprache (Altgriechisch): 1. Teil, Glotta 80,1982,137-161. 56. Das Menschenbild Homers, Gymnasium 91, 1984, 15-39 [Vortrag DAV-Tagung 1982], [71-94] 57. Funktionen des Traums in der antiken Literatur, in: Der Traum als universales Phänome, hrsg. v. Therese Wagner-Simon u. Gaetano Benedetti, Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 1984,10-31 [Ringvorlesung Univ. Basel WS 1982/83]. [447^67] 57a. Nachgedruckt in: Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N.F. 10, 1984,23-339. 58. Klassische Philologie auf neuen Wegen, Neue Zürcher Zeitung 12./ 13.5.84, 68. 59. Perspektiven der Gräzistik, Freiburg - Würzburg: Ploetz, 1984 (Sonderdruck der Stiftung »Humanismus heute' des Landes Baden-Württemberg). 60. Realität und Imagination. Eine neue Lyrik-Theorie und Sapphos φαίνεται μοι κήνος-Lied. Museum Helveticum 42,1985, 67-94. [313-344] 61. Aktuelle Tendenzen der gräzistischen Lyrik-Interpretation, in: Dialog Schule-Wissenschaft. Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 19, München: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1985, S. 27-49. 61a. Neufassung unter dem Titel: Zu den pragmatischen Tendenzen der gegenwärtigen gräzistischen Lyrik-Interprtation, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft N.F. 12, 1986, 35-56. [283-307] 62. Das Plappermäulchen aus dem Katalog (Zur Bitte des Philitas), in: Catalepton. Festschrift für Berhard Wyss zum 80. Geburtstag, hrsg. v. Christoph Schäublin, Basel 1985,77-95. [427^46] 63. Rezension zu: Christoph Kurt, Seemännische Fachausdrücke bei Homer. Unter Berücksichtigung Hesiods und der Lyriker bis Bakchylides, Göttingen 1979, Kratylos 31,1986,110-124. [625-638] 64. Neues von Troja, Uni Nova (Mitteilungen aus der Universiät Basel) 46, 1987,18-24. 64 a. Kürzere Fassung von 64, Neue Zürcher Zeitung (= NNZ) vom 18./ 19.7.1987, 51-52. 65. Frauengestalten Homers, in: Die Frau in der Gesellschaft, hrsg. v. E. Olshausen, Humanistische Bildung (Stuttgart) 11, 1987, 43-71. [95— 124]
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
709
65 a. Wiederabgedruckt in: Jahrbuch des Theodor-Heuss-Gymnasiums Heilbronn 11, 1987,5-38. 66. Neues von Troja (Gesamtdokumentation der Korfmann-Expedition 1981-1986, mit 8 Tafeln und 15 Text-Abbildungen), Gymnasium 95, 1988, 385-413 (+ Tafeln XVII-XXIV). 66 a. Dasselbe in Englisch, Berytus 34, 1986 [1988], 97-127. 66 b. Dasselbe in Neugriechisch, ΠΛΑΤΩΝ 40, 1988,40-51. 67. Alfred Heubeck und die deutsche Gräzistik, Gymnasium 94, 341-345. 68. Zu Umfang und Art der Vergangenheitsbewahrung in der mündlichen Überlieferungsphase des griechischen Heldenepos, in: Colloquia Raurica I, Stuttgart 1988,153-183. [37-69] 69. Troja, Tenedos und die Κρατήρες 'Αχαιών. Antike Autoren und moderne Evidenz, in: Akten des ,6 th International Colloquium on Aegean Prehistory, 30. Aug.-5. Sept. 1987 Athens', im Druck. 70. Neuere Erkenntnisse zur epischen Versifikationstechnik, Studi italiani di filologia classica, 3 a serie, Vol. X, Fase. I-II (1992) [1993] [= Vortrag 9 o congresso della FffiC, Pisa, 24.-30.8.1989]. [235-255] 71. Die Funktion des Symposions für die entstehende griechische Literatur, in: Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den Griechen, hrsg. v. W. Kulimann u. M. Reichel, Tübingen 1990 (ScriptOralia 30), 227-264. [357-395] 72. Phönizier bei Homer, in: Die Phönizier im Zeitalter Homers., hrsg. v. U. Gehring u. H. G. Niemeyer, Mainz 1990, 11-21. (Bibliographie: 253). [125-135] 73. Hauptfunktionen des antiken Epos in Antike und Moderne, in: Dialog Schule-Wissenschaft. Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 25, 1991, 88-109.[257-279] 74. Dasselbe als Neufassung, Der altsprachliche Untericht 34/3,1991, 8-17. 75. Die Erforschung der Ilias-Struktur, in: Zweihundert Jahre Homerforschung (s. Nr. 7), Stuttgart 1991, 381-414. [137-174] 76. Homers Ilias und die Folgen. Wie der Mythos Troia entstand, in: Troia Brücke zwischen Orient und Okzident, hrsg. v. I. Gamer-Wallert, Tübingen 1991, 201-218. 77. Das Problem der politisch-militärischen Macht: Das Beispiel Athen (5. Jh. v. Chr.), in: Schriftenreihe des Förderkreises der Wissenschaftlichen Regionalbibliothek Lörrach e. V., Heft 9,1991.
710 78.
79.
80. 81.
82.
83.
84. 85.
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
„Freuden der Göttin gibt's ja für junge Männer mehrere ..." - Zur Kölner Epode des Archilochos (Fr. 196 aW.), Museum Helveticum 49, 1992, 3-12 (Festnummer Delz). [345-356] Lesersteuerung durch Träume. Der Traum Penelopes im 19. Gesang der Odyssee, in: Kotinos. Festschrift Erika Simon, Mainz 1992 [1993], 7689. [205-226] Between Troy and Homer. The So-Called Dark Centuries of Greece, in: Festschrift Marcello Gigante, im Druck [1993]. Reflexionen Klassischer Philologen auf die Altertumswissenschaft der Jahre 1900-1930, in: Altertumswissenschaft in den zwanziger Jahren, hrsg. v. H. Flashar [Tagung Bad Homburg 1992], im Druck [1994], Rudolf Pfeiffers Bedeutung innerhalb der Klassischen Philologie, in: Philologia Perennis. Colloquium zu Ehren von Rudolf Pfeiffer, hrsg. v. Marion Lausberg, im Druck. Fruchtbares Ärgernis: Nietzsches .Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik' und die gräzistische Tragödienforschung (Vortrag NietzscheKolloquium in Sils-Maria vom 30.9.-3.10.1993) [469-498 Originalbeitrag]. Achilleus. Wandlungen eines europäischen Heldenbildes. (Lectio Teubneriana, III), im Druck. .Grammatik': Eine griechische Erfindimg und ihre Wirkungsmacht bis heute (Vortrag DAV 7.4.94), erscheint in .Gymnasium').
IV. Miszellen und kürzere Besprechungen 86. Zum homerischen Apollonhymnus, V. 81, Rheinisches Museum 111, 1968, 375-377. 87. Rezension zu: F. Codino, Einführung in Homer, Berlin 1970, Gymnasium 78, 1971,464-466. 88. Rezension zu: E. Heitsch, Epische Kunstsprache und homerische Chronologie, Heidelberg 1968, Mnemosyne 24, 1971,304-306. 89. Rezension zu: H. Weigel, Der Trojanische Krieg. Die Lösung, Darmstadt 1970, Gymnasium 78, 1971,563-565. 90. Konferenzbericht über die .Conference on Oral Literature and the Formula' in Ann Arbor/Michigan, 11.-13. Nov. 1974, Gnomon 47. 1975, 638 f. 91. Rezension zu: A. Heubeck, Die homerische Frage, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, Gymnasium 83, 1976, 353-355.
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
711
92. Rezension zu: W. Rösler, Dichter und Gruppe, München 1980, Gymnasium 89, 1982,337-339. [309-312] 93. Nachwort zu: »Aristophanes, Die Vögel. Für das Theater übersetzt von Christoph Jungck', Basel 1983, 60-66 (Augster Theatertexte, 1). 94. Theater. Komödie. Die Vögel. Programm der Aufführung von Aristophanes' .Vögeln' 1983 im Römischen Theater Äugst. 95. Ernst Siegmann f (Nachruf), Gnomon 55,1983,280-284. 96. Anzeige von: A. Heubeck, Schrift, Archaeologia Homérica, Kap. X, 1979, Museum Helveticum 39,1982, 316. 97. Anzeige von: Yuko Furusawa, Eros und Seelenruhe in den Thalysien Theokrits, Würzburg 1980, Museum Helveticum 39,1982, 322. 98. Theater und Universität Hand in Hand, Uni Nova (Mitteilungen aus der Universiät Basel) 31,1983,12-14. 99. Das Schöne Haus in Basel, in: 125 Jahre Seminar für Klassische Philologie Basel, Basel 1987, 49-55. 100. Omero. Odissea. Introduzione, testo e commento. Traduzione di G. Aurelio Privitera. Introduzioni e commenti a cura di A. Heubeck/ S. West/J.B. Hainsworth/A. Hoekstra/J. Russo/M. Galiano, Vol. I-VI. Milano 1981-1986, Gymnasium 95,1988, 432-^34. 101. Schliemann wird oft in einem zu negativen Licht gesehen, Basler Magazin (Beilage zur Basler Zeitung), 5.1.1991. 102. Rede zur Verabschiedung der Maturanden des Humanistischen Gymnasiums Basel vom 29.6.1990, Martinskirche Basel, Die Alten Sprachen im Unterricht 37, 1990,20-24. [697-702] 103. An den Wurzeln europäischer Kultur: Griechische Philosophie, Uni Nova (Mitteilungen aus der Universität Basel) 69,1993,50 f. V. Herausgebertätigkeit 1.
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, Neue Folge, hrsg. v. Joachim Latacz - Günther Naumann ( - Ernst Siegmann), Würzburg: Schöningh, 1975 ff. - [Redaktor aller Bände: Joachim Latacz]
Bd. 1 Bd. 2: Bd. 3: Bd. 4: Bd. 5: Bd. 6a
(Festschrift Siegmann):
(Festschrift Erbse):
1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980.
712
Verzeichnis der Schriften Joachim Lataczs
Bd. 6b: 1980. Bd. 7: 1981. Bd. 8 (Vergil-Jahrbuch 1982): 1982. Bd. 9: 1983. Bd. 10: 1984. Bd. 11: 1985. Beiheft 1 (Festschrift Hölscher) 1985. Bd. 12: 1986. Bd. 13 (Festgabe Kullmann): 1987. Bd. 14: 1988. Bd. 15: 1989. Bd. 16: 1990. Bd. 17: 1991. Bd. 18: 1992. Ergänzungsheft 1: Wissenschaft und Existenz. Symposion München zum 70. Geburtstag von Uvo Hölscher. Mit Beiträgen von H.G. Gadamer, W. Pannenberg, V. Pöschl, H. Strasburger, W.Killy u.a.-1985. B. Herausgabe von Sammelbänden Ernst Siegmann, Vorlesungen über die Odyssee, bearbeitet von J. Latacz, hrsg. v. J. Latacz - A. Schmitt - E. Simon, Würzburg 1987. C. Herausgabe von Reihen Colloquia Raurica (Zusammen mit J. v. Ungem-Stemberg, Hj. Reinau, J. FreyClavel): seit 1988 (bisher 3 Bände). Studia Troica (zusammen mit M. Korfmann): seit 1990 (bisher 3 Bände).
Indizes [aus technischen Gründen konnten die Fußnoten bei der Indizierung nicht berücksichtigt werden] 1. Personennamen (Antike und Mitti
Iter, auch mythologische)
Achill(eus) 19 20 27-34 53 59 87 92 100 102 117 128 130 164 169 181 182 186-188 192-198 200 201 206-209 232 316 375 381 382 441 459 460 461 583 584 594 595 Aedon 211 Aelfric 644 669 Aelian 157 Aeneaden 20 Aeneas s. Aineias Aesacus 593 Agamemnon 19 20 28-34 55 80 81 90 92 100 102 121 129 130 164 181 182 188 194 195 206 208-210 213 230 381 441459 461635 Agis 418 Aias 100 195 Aineias, Aeneas 247 512 584 Aisakos 592 Aischylos 459 474 477 478 481 482 485 489 497 498 616 617 619 621 622 623 Aithon 117 Ajas 600 Alcuin 644 658 669 Alcyone 592 593 Alexander der Große 148 449 Alexander de Villa Dei 644 658 659
Alexandriner 369 375 436 444 644 Alexandras s. Paris Alighieri s. Dante Alkaios, Alcaeus 55 138 283 287 292 299 301-303 310-312 318-320 324 373 375-377 382 383 388 485 626 631 Alkinoos 53 107 108 110-112 142 Alkman 47 258 288 369 370 432 Allione 223 Ambrosia 453 Amphiaraos 443 Amycus 597 Anakreon 444 Anastasios I. 657 Anchialos 626 Andromache 92 105 116-119 123 Antimachos 427 434 440 Antimenidas 311 Antiope 438 Aphrodite 100 121 288 303 304 320 327 328 338 373 439 440 643 Apoll(on) 29 31 32 53 185 188-192 198 206 316 461474 488 489 Apollonios Dyskolos 644 654 658 668 Apollonios Rhodios 235 262 271 581 583 Arat 268 269 579 582 584
714
Indizes
Archilochos 55 261 283 288 345 354 355 367 373 626 Ares 93 316 378 Arete 105 107-111 124 Argonauten 55 264 584 Arignota 300 338 Ariovist 527 Aristandros 449 Aristarch 155 429 Aristipp 440 Aristophanes comicus 261 349 497 498 Aristophanes v. Byzanz 155 Aristoteles 13 27 33 137 138 145 148-150 152-155 157 158 169 209 272 296 374 450 451 458 482 483 492 554 644 648-650 652 653 658 659 Arsinoe 440 Artabanos 453 Artemidor 449 460 Artemis 101 131 Arybas 130 Asklepios 453 Athenaios 428 Athene 23 25 31 101 106-108 111 113 116 119 127 132 187 206 211 215 474 485 486 Atreus 28 461 Atriden 461 Atthis 339 374 Augustus 600 Avien 269 Axylos 247 Bakchylides 261 332 625 Battis s. Bittis Beda 669
Bittis (Battis) 427-432 435-437 439 441 443-445 Bonifatius 669 Briseis 20 32 102 188 Broteas 597 Byblis 440 Caeneus 595 Caenis 595 Caesar 518 600 Caesius Bassus 511 520 Cäsar 523-544 Caper, Flavius 655 657 Casticus 537 Catull 300 318 323 444 Celadon 597 Ceyx 592 593 Charaxus 597 598 Charisius 644 655 656 669 Choirilos von Samos 269 474 519 579 Choiroboskos 668 Chryseis 20 30 32 102 189 190 192 Chryses 29 30 Chrysipp 655 Cicero 157 531 Claudian 269 Claudius 656 Corinna 445 Corippus 260 Cygnus 594 595 Dante 73 270 Daphnis 440 Deiphobos 140 Demodokos 52 53 139-142 180 263 373 374 Demokrit 458 Dido 512 Diogenes von Babylon 655
1. Personennamen (Antike und Mittelalter)
Diomedes 86 89 230 316 644 655 Dionysios Thrax 641-644 646 648 649 651 Dionysos 474 476 482 489 491 Diviciacus 539 Donat 644 655-659 Dositheus 655 Dumnorix 537-539 Duns Scotus 658 669 Eberhardus von Béthune 644 658 659 669 Echeneos 108 110 111 Eëtion 117 Eidothea 441 Eleaten 261 Empedokles 579 Ennius 262 268 269 297 503 513 516 517 531 579 Eoie 441 Ephoros 113 Epikur 458 Eretmeus 626 Erinyen 617 Eumaios 102 129-132 610 Eumelos 195 268 Euneos 128 Euripides 54 438 459 476-478 489 497 498 Eurybates 182 188 Eurykleia 106 211 244 611 612 615 616 Eurymedusa 378 Eurypylos 168 437 439 Eurytus 596 597 Eustathios von Thessalonike 154-156 Exadius 597 Gallus 444
715
Gellius 512 Glaukos 147 Gryneus 597 Harpyien 616 Hekabe 116 127 Hekataios416 Hektor 19 32 86 92 116-118 120 122 127 168 169 201 206 441 460 592 594 Helena 20 55 89 92 100 105 106 115 116 118-123 127 147 592 Helios 200 Hephaistos 144 352 353 Hera 93 101 119 316 351 352461 Heraklit 147 345 451 457 Hermes 269 320 327 328 373 637 688 Hermesianax von Kolophon 428 429 436 440-442 445 572 Hermione 116 Herodot 405 414 416 453 459 519 528 672 Hesiod 29 50 51 61 74 82 86 227 228 232 233 235 261 265 267-269 286 332 340 366 367 375 437 438 441 486 509 510 513-515 579 581 584 585 625 626 631 Hippodame 596 Hippokrates 439 456 Hipponax 292 373 379 Homer 13-19 21 26-29 35 61 71-83 85-93 95-97 99 100-105 115-119 121 123-125 127 134 135 139 148 149 151-160 163 164 167 169 170 172 178 180 184 206 207 210 239 248 257 258 260-262 265-267 269-273 293 296 332 334 345 352 360 362 366 375 414 416 429 438
716
Indizes
441 459 460 461 474 480 486 508 509 512 517 588 591 592 594 598 600 606 622 623 629 643 645 651 672 Horaz 23 155 261 296 297 300 301 547 550 551 553 555-558 560-564 569 Hrabanus Maurus 658 669 Hypsipyle 128 Iason 128 435 Ibykos 288 Idaios 629 Idmon 190 Idomeneus 133 247 Ikarios 212 Iphigenie 154 Iris 198 Isidorus von Sevilla 668 669 Itylos 211 Iuno 449 Justinian 657 Kalchas 189-191 461 Kallimachos 155 261 266 269 429 430 433-436 444 572 587 588 Kallinos 288 317 367 369 Kalypso 106 109 110 633 Kapaneus 443 Kinesias 349 Kirke 100 106 316 Kleis 326 Klytaimestra 440 618-622 Krates von Mallos 649 655 Kronos 228 Kyklopen 110 Laërtes 132 214 333 Leukippos 440 Liscus 539
Livius, Titus 493 526 Livius Andronicus, Lucius 505-508 514 517 520 Longin 296 Lucan 73 258 268 269 519 Lucilius 553 Lukrez 258 268 270 273 569 579 Lykambes 355 369 Lykurg von Ionien 157 Lysistrate 349 Machaon 168 Macrobius 222 Marius Plotius Sacerdos 655 Marius Victorinus 655 Mars 441 Martianus Capeila 655 Medea 435 441 Medon 611 612 Megakles 311 Melanchros 311 Melantho 102 Menander 444 Mene 438 Menelaos 55 106 116 120-122 129 140 Mentes 23 Meriones 247 Mimnermos 292 369 371 373 375 427 433 434 Minos 264 Musaios 438 Mycale 597 Mynes von Lyrnessos 103 Myrrha 440 Myrrhine 349 Myrsilos 311
1. Personennamen (Antike und Mittelalter)
Naevius 262 268 269 502-504 508517 519 520 579 Nausikaa 105 107 109 111-115 124 206 335 431 459 626 Nausithoos 626 Neptun 595 Nestor 32 80 92 119 147 168 195 208 360 461 594 595 596 Nikander 268 269 572 579 582-585 Nonnos 260 271 Ödipus 489 Odysseus 23 52 53 58 59 80 87 92 100 102 105-112 114 115 119 129 130 132 133 139-142 147 151 191 198 208 210-214 216-221 244 316 333 335-337 360 362 373 431 443 583 584 600 611 612 616 628 633 635-637 643 Ophion 597 Orgetorix 536-538 Orios 597 Orpheus 428 Ovid 268 271 273 428 432 435 440445 569-580 584-596 598-600 602 Panaitios 655 Paris, Alexandres 20 116 120 121 127 316 592 629 658 Parmenides 268 270 579 Parthenios 572 Pasiphae 440 Patroklos 86 316 611 Peisistratos 157 4 7 3 ^ 7 5 Pelâtes 597 Pelias 476
717
Penelope, Penelopeia 23 25 92 100 102 105 106 114 115 130 206 210221 262 438 441 459 611—613 Pentheus 476 Penthilos, Penthiliden 311 Petron(ius) 23 569 Petrus Helias ν. Paris 669 Phemios 262 Philitas 427-432 434^137 439^141 444 445 Philoktet 443 Phoibos s. Apollon Phoinix 360 Phrynichos 54 474 497 Phthia 441 Pindar 261 283 288 292 626 Pirithoos 596 Pittakos 311 312 Piaton 149 358 451 4 5 7 ^ 5 9 644-647 662 Plautus 444 Plutarch 139 157 554 562 Podargos 117 Polydeukes 121 Polyphem 440 Porcius Licinus 514 515 Porphyrio 558 Poseidon 474 Pratinas von Phleius 497 Priamos 19 55 92 100 116 121 206 459 592 Priscian(us) 644 654 655 657 659 669 Prometheus 227 228 233 486 487 489 Properz 444 Quintiiianus 669 Quintus v. Smyrna 249 Remmius Palaemon 644 656 657 669
718
Indizes
Rhianos von Bene 579 Rhoetus 597 598 Romulus 600 S allusi 528 Sappho 55 163 283 287 288 294 300 303 304 320-329 331-340 342 369 370 373-375 386 432 444 485 631 Scipio Africanus 553 Seflënos, Silen 482 Semonides 292 368 371 373 Serapis 453 Silen s. Seilênos Simonides 294 Skylla 440 Smerdis 311 Sokrates 457 489 Sophokles 459 476-478 483 489 497 498 Sotades 292 Stesichoros 261 288 Stobaios 431 Talthybios 182 188 Telemach(os) 23-25 105 106 129 213 214 217 262 610-616 63 1 637 Telemos 316 Terentianus Maurus 268 Terentius Scaurus 657 Terenz 444 Terpander 47 Theognis 288 332 340 Theoklymenos 24 613
Theokrit 155 261 432 436 440 Theophrast 554 556 Thersites 119 194 195 Theseus 264 596 Thespis 474—476 497 Thestor 190 Thetis 33 182-184 188 193 194 197 198 200 375 Thoas 128 Thukydides 297 400 403 405 408 410 412-417 420-422 424-426 528 Tiberius 656 Tibull 444 Tyrtaios 288 293 295 317 367 371 373 Tzetzes 155 Varius 562 Varrò 444 516 644 650 651 655 657 669 Vergil 20 73 157 257 258 262 266 268 269 272 273 444 449 459 512 519 520 569 579 583 591 592 Viscus 562 Xanthos 117 Xerxes 453 Zenodot429 Zeus 23 28-30 34 50 51 53 93 108 181-183 188 193-196 198-200 202 208 209 227 228 230 233 262 303 316 375 438 461 474 485 637
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance, auch fiktive) Addivinola 343 Adkins 92 376 394 Adorno 291 Ahrens 286 Albert 394
v. Albrecht 395 570 574 588 602 Aldus Manutius 668 669 Alexanderson 630 638 Alfonsi 429 446 Allatius 157
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance)
Allen 667 Alpers 364 385 390 Ameis 184 194 Ammendola 619 Amory(-Parry), A. 63 222 223 Andersen 391 Andreae 173 Arend 181 Arens 665 Arnauld 670 692 Arndt 664 Assmann 391 Athanassakis 223 d'Aubignac 158 165 Austin 223 Bächli 223 Baebler 667 Bagg 342 Baiter 551 Barchiesi 511 Barner 297 298 395 Barwick 641 649 655 666 Bayer 80 687 Beattie 342 Bechert 680 692 Beck 391 Becker 679 680 692 Benoit de Sainte-Maure 156 Bentley 157 158 Benveniste 627 Bergk 286 288 429 631 Bembeck 602 Beßlich 171 173 181 610 Beyer 686 Bickel 90 Bielohlawek 357 360 392 Bierwisch 690
Binswanger 221 Bizer 406 407 410 416 Björck 221 Blackwell 159 Biegen 45 Bloomfield 677 691 v. Blumenthal 446 429 441 Boccaccio 156 Boeckh 289 684 Boedeker 37 57 Böhme 90 92 Boileau 269 Boisacq 631 Bonanno 377 395 Bonelli 343 Bopp 663 671 675 688 Borecky 689 Bornemann 652 669 Bouché-Leclercq 221 Bowcott 222 Bowie 371 394 Bowra 27 178 180 393 Brassicanus 669 Braun 180 Breitinger 667 Β rekle 667 677 679 692 Bremer 343 393 394 Brillante 390 391 Brilliante 221 Broeder 670 Brugmann 675 690 Buchholz, E. 78 Buchholz, H.-G. 135 Büchmann 605 Büchner 223 551 568 Büchsenschütz 221 Budé 668
720
Indizes
Bühler 300 313 688 Bünting 664 Burkert 63 88 135 348 350 361 391 394 Burnett 377 393 395 Bursian 659 665 Bursill-Hall 665 667 Burzacchini 351 355 393 Buttmann 662 669 690 Calarne 292 307 Camerarius 668 Cantilena 391 Casson 626 632-638 Cataudella 431 446 Cavallini 377 395 Cellarius 670 Ceporinus 668 Cerri 390 Cesarotti 164 Chalkondyles, Demetrios 156 659 668 Chantraine 333 626 627 638 685 Chaucer 156 Cherubim 686 Chomsky 676 677 679 681 682 691 Christ 485 Chrysoloras, Manuel 156 659 Ciasen 687 Classen 402 417 666 Clenardus 660 668 670 Coldstream 135 Colson 666 Coserai 677 684 691 693 Cracas 688 Croce 293 Crusius 669 670 Curtius 14 15 D'Angelo Capra 429 446
Dahlmann 649 666 Damm 669 de' Pazzi 157 Debrunner 682 Degani 351 355 376 380 Del Como 222 Del Grande 342 Denniston 619 Derrida 272 Desmarets 269 Detienne 392 Dette 689 Devereux 223 343 Di Benedetto 666 Diehl 288 292 Dihle 364 365 Doblhofer 570 574 577 Donzé 667 Dornseiff 685 Dörpfeld 45 Dover 350 351 371 Drerup 180 Droysen 490 Duentzer 238-241 244 Durante 605 606 607 Ebeling 329 Ebener 437 Ehwald 599 Eisenberger 393 Ellenberger 437 Ellendt 238 Engelmann 470 471 487 Enslin 668 Erasmus von Rotterdam 668 670 Erbse 410 411 421 Erlinger 641 664 Ernout 682 693
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance)
Evans 343 Faesi 195 Fajen 672 689 Fantuzzi 390 Fenik 171 173 Finsler 78 89 157 158 166 173 Flashar 173 Foley 391 392 Forbes 666 Fournier 609 Fowler 376 394 Fraenkel, Ed. 547 563 564 568 605 616-619 Fraenkel, E. 627 Frankel, H. 91 283 291 292 298 300 301 309 322-324 342 364 368 377 378 395 570 572-574 595 599 601 Frécaut 592 602 Freud 205 216 448 449 452 453 Frisch 223 Fri schiin 660 661 670 Frisk 627 632 685 Fritzsch 471 Froehde 666 Früchtel 669 Fuhrmann 158 173 666 673 689 Funke 667 Gabelentz 675 690 Gadamer 291 Gagarin 391 Galinsky 575 592 602 Gallavotti 433 434 Gärtner 81 Gebhardt 693 Gelzer 393 Gentiii 38 39 173 292 299 307 314 363 365 383 388 390-392 394
721
Georgiades 223 Gerth 665 682 Glinz 666 678 692 693 Göbel 200 Goethe 25 8 269 448 Goody 390 391 Görgemanns 395 Gourevitch 221 Grafton 165 173 Grashof 626 Gray 626-628 630-638 Grillone 222 Grimm 675 690 Groeneboom 617 618 Gundert 89 91 92 292 Guthmüller 571 Habermas 291 Hainsworth 57 113 133 139 140 173 245 632 636 Halliday 665 Hamann 448 Hamilton 359 Hamm 631 Hamp 641 665 Händel 436 441 445 446 Hansen 63 391 Happ 686 Harder 181 298 Hardmeier 391 Hartmann 689 Härtung 693 Haselbach 692 Haug 394 Haupt 184 Hausmann 665 Havelock 362 363 365 390 391 Hebel 191
722
Indizes
Heinze 550 568 571 572 Heitsch 227 Heibig 688 Heltzer 135 Henrichmannus 669 Henüg 688 Hentschke 294 Hentze 184 194 201 Herder 13 15 159 265 448 458 Hering 551 552 568 Heringer 680 692 Herington 370 374 394 Herling 681 682 690 692 Hermann 14 15 145 235-238 242 244 245 251 255 286 437 626 Herter 357 393 588 Hertz 690 Hesse 578 589 Heubeck 42 63 89 90 91 146 154 166 170 171 173 179 181 184 361 364 385 390 391 630 635 Hey 221 Heyne 17 159 160 161 166 Heyse 678 680 692 Higham 572 577 Hiller 625 638 Hjelmslev 677 Hoekstra 57 245 Hofmann 663 670 Hollis 434 435 446 Holoka 146 166 173 Hölscher 181 495 Hopfher 222 Homeffer 410 Housman 432 Howald 433 446 Huizinga 578
Humboldt 159 662 679 680 692 Hundt 222 Hunt 432 667 Jachmann 170 173 179 Jaeger 290 305 493 495 Jahn 92 235 241 243 244 247 491 Jakobson 677 Jeep 666 Jeffery 390 Jellinek 667 Jespersen 677 Johann 666 Johnston 391 392 Jöhrens 637 Jung 665 Kaegi 663 Kaiser 273 Kakridis 146 Kannicht 370 390 394 411 421 Keil 655 Kerschensteiner 139 140-142 173 Kessels 222 223 Kiessling 550 568 Kirkwood 309 Klopstock 258 270 Klowski 686 689 Knoche 548 549 552 568 Koch 229 Koer 436 437 439 443 444 Kohl 227-231 Koller 666 Koniaris 342 Korfmann 264 Körte 436 446 Korzeniewski 380 Koster 173 Kraus 570 572 577 578
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance)
Krischer 171 173 Krüger 669 Kuchenmüller 427^131 435 437 444 446 Kühner 662 669 670 678 680 682 685 692 Kukenheim 667 Kullmann 146 171 Kurt 625-638 Lachmann 15 145 166 184 Lafaye 571 601 Lakoff 680 682 691 Lämmert 170 173 184 186 187 189 190 191 199 200 209 268 Lampadio 512 Lancelot 669 670 692 Landgraf 663 670 Landmann 410 Lanig 85 Laskaris, Konstantinos 659 668 Lausberg 503 504 513 Leaf 633 Lefkandi 42 Laurentius Valla s. Valla, Laurentius Lejay 550-552 558 568 Lennig 223 Leo 507 511 Lersch 666 Leser 667 Lesky 63 80 87 91 157 166 174 179 181 184 430 635 Lessing 143 158 Linacer 670 Lipinski 135 Lloyd-Jones 446 Lobel 307 432 Lohmann 171 174
Lord 16-18 Loretto 223 Luck 442 Ludwig 602 Luppe 393 Luscinius 668 Luther 665 Maas 433 434 Macropedius 668 Madvig 670 678 692 Maehler 174 307 Manfredi 342 Manieri 343 Marcovich 343 393 Marenghi 223 Marg 174 178 181432 570 601 Marinatos 632-635 638 Mariotti 509 Marrou 665 Marsden 668 Martin 309 314 357 392 Martina 292 307 Martini 571-573 Marzullo 179 Mattes 140 174 181 Matthiä 662 679 680 692 Maurach 377 395 Mayer 509 McEvilley 324 334 343 Mededovió 27 Meech 667 Meier 180 Meillet 671 688 Melanchthon 651 668 670 Menge 685 693 Menzel 665 Merkelbach 342 348
724 Messer 222 223 Meyerhoff 375 394 Michelsen 680 692 Michenaud 222 Micyllus 669 Milne 433 434 Milton 270 Mirezza 222 Mocker 509 zu Mondfeld 628 634 Moor 377 Moreau 392 Morel 511 Morris 223 Morrison 626 638 Morton 688 Moschopoulos, Manuel 659 668 Most 165 173 Mounin 665 684 693 Muhlack 294 Muhly 135 Mülder 146 166 Müller, K. 0 . 483 485 486 Müller, L. 508 509 516 Murmellius 670 Murray 63 391 395 Muth 298 390 Nägelsbach 684 685 693 Nagler 57 Nagy 57 Nannini 343 Nesselrath 446 Neuberger-Donath 334 343 Neumann 677 686 691 Nickau 174 Nickel 665 Nicolai 171 174
Indizes Nieddu 363 391 Niemeyer 135 Nietzsche 86 167 169 469-472 479496 Nothdurft 635 Notopoulos 16 Ong 391 392 Oppenheim 221 Oppermann 525 550 551 552 568 Orelli 551 Orosbakow 27 Ossian 269 Osthoff 675 690 Otto 90 Padley 659 667 668 Paetow 667 Page 286 288 292 307 309 322 324 325 328 331 332 342 377 395 619 631 Paioni 391 Palm 222 Panagl 625 638 Paraskevaides 629 638 Parker 393 Parry, A. s. Amory Parry, M. 15-18 25 46 56 57 59 60 63 146 178 180 238 241 243-245 252 254 255 294 607 609 629 638 Parsons 446 Patzer 405-411 421 425 Paul 675 678 690 Pavese 391 Pedersen 665 Pellizer 393 394 Perizonius 157 Perottianus 669 Perrault 158
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance)
Pestalozzi 146 Pfeiffer 290 434 435 446 666 Pfister 686 688 689 Pfohl 390 Pilato 156 Pinborg 667 Podlecki 394 Pohlenz 406 436 493 666 Pöhlmann 363 392 Pope 159 269 Pöschl 495 496 Posselius 669 Pott 675 690 Powell 431 437 446 Prato 292 293 307 Privitera 324 342 632 Puelma 433 446 Raible 392 Rambaud 525 Ramus 670 Rankin 223 Rapin 157 Raubitschek 362 364 390 Regenbogen 91 Reibnitz 472 483 486 Reich 665 667 Reider 224 Reinhardt 146 154 164 171 174 178 181 184 189 191 197 294 493^96 Reitzenstein 392 431 432 446 Risch 626 627 633 652 669 Rissmann 343 Rithaemerus 668 Ritsehl 469 470 491 Robbins 343 Robins 665 666 Roemer 689
725
Rohde 90 471 479 492 Röllig 135 Rosén 672 689 Rösler 299-303 309-312 313-315 318-322 374 377 386 391-395 631 Rossbach 484 Rossi 245 247 267 Rothe 166 181 681 692 Rotta 667 Röttger 688 Rötzer 665 Röver 550 551 552 568 Rubenbauer 663 670 Rudd 551 553 563 568 Ruijgh 672 689 Russo 57 223 Rüter 181 Rydbeck 342 Sanctius 659 661 670 Sandys 666 Sapir 677 S aras tro 562 de Saussure 675 677 678 685 690 Scaliger 516 659 662 670 Schadewaldt 22 140 146 147 154 164 166-172 174 179-181 184 290 323 327 334 335 339 342 405^108 421 489 490 613 630 637 Scheffer 597 602 Scheller 670 Schiller 258 Schlegel 679 Schleiermacher 448 Schliemann 45 Schmalz 685 693 Schmidt, J.H.H. 685 694 Schmidt, R. 666
726
Indizes
Schmüdderich 688 Schneider, R. 668 689 Schneidewin 286 Schoemann 666 Schönberger 687 Schopenhauer 684 Schoppe s. Scioppius Schröder 179 Schubert 395 Schulz 689 Schwabl 91 Schwartz 402-408 Schwinge 147 152 154 164 172 174 Schwyzer 677 691 693 Scioppius (Schoppe) 670 Segal 343 Setti 322 324 342 Shaw 667 Simler 668 Simon 42 Slater 393 Slings 346-351 353 393 394 Snell 90-92 241 242 244 290 307 309 323 324 334 335 342 368 685 Snodgrass 266 Sommer 663 670 685 693 Sowinski 688 Spenser 271 Spitteier 258 Staehelin 223 Stahl 402 Staiger 13 446 Steen Due 575 592 593 599 602 Stegmann 682 Steiner 222 Steinthal 666 686 688 689 Steup 401 402 417
Strasburger 63 82 86 410 Strunk 672 677 689 691 Strzelecki 501 Stuhrmann 221 Suerbaum515 Susemihl 446 Svoboda 667 S woboda 572 Sylburg 669 Szemerényi 677 691 Tarditi 292 307 Tasso 269 Tedeschi 393 Tesnière 677 680-682 692 Theiler 170 174 179 Theodoras ν. Gaza 659 Thierfelder 693 Thomas 693 Thomson 606 613 Tichy 254 353 Tieck 187 Trautmann 180 Treu 283 298 310 323 326 342 368 378 Trier 685 Trubetzkoy 677 Trumpf 393 Trümpy 637 Tsagarakis 314 343 393 Turolla 551 552 568 Turyn 334 335 342 Uhlig 651689 Ullrich 400-406 408 416 Unger 631 Untermann 689 Vahlen 516 Väisänen 393
2. Personennamen (etwa seit der Renaissance)
Valla, Laurentius 659 669 van der Valk 605 616 619 van Ε φ Taalman Kip 343 394 van Lieshout 221 Varennius 660 668 Vater 668 Vester 223 Vetta 292 307 393 Viarre 574 Vida 271 Visser 57 59 60 63 235 244 246 247 251252 254 263 367 392 Vogt 493 Voigt 287 307 309 432 631 Volpi 550 Voltaire 269 Voltz 667 Von der Mühll 170 174 179 184 357 393 458 Vorlat 641 667 Voss 22 Wagner, K.H. 693 Wagner, R. 471 484 485 488 489 490 Warning 394 Wartenburg 483 485 Watanabe 667 Wathelet 135 Watson 667 Watt 390 Weinreich 222 Weinrich 325 336 671 672 680-682 687-689 Weisgerber 685 Welcker 286 Weller 669 West 228 232 264 289 307 324 343 346-348 353 355 371 390 432 433
727
Westphal 484 Westphalen 687 Wetzel 222 Wickert-Micknat 96 97 101 Wickham 551 Wieland 258 Wijsenbeek-Wijler 222 v. Wilamowitz-Moellendorff, U. 90 146 158 159 166-170 174 179 184 196 290 294 305 321-324 329 331-334 364 374 431 432 434 436 439 441 442 445 446 490^*95 Wili 549 552 568 Wilkinson 573 574 Williams 626 Wills 342 Wimmel 391 446 Witte 238 241 Wolf 14 15 17 137 145 153 155 158168 170 174 235-238 242 244 255 298 480 662 Wood 159 Woolley 41 Wunderlich 688 Wyss 430 446 Zabrocki 672 688 Zetzel 165 173 Ziegler 424 Zielinski 184 Zingerle 601 Zinn 577 578 601 Zinsmeister 650 652 663 669
728
Indizes
3. Orts- und Völkernamen (auch mythologische) Achaier 27-34 53 55 80 100 102 117 121 127 140-142 190-193 195 211 230 262 461 Ägypten, Ägypter 125-127 132 Afrika 132 Aithiopen 183 199 200 202 Akarnanen 425 Akropolis (Athen) 452 Al Mina 41 42 362 Alexandreia 649 654 Aramäer 125 Argiver418 Argos 30 82 100 264 370 Ariost 269 Askraier 438 Assyrer 125 Athen 148 423 425 453 473 476 481 649 Athener 412 419 420 425 474 Attika41 128 473 Augsburg 687 Aulis 20 55 316 Basel 235 470 483 490 Beirut 126 Belgier 528 529 531 541 Berlin 483 Boioter 438 Bonn 469 Breslau 483 Byblos 126 Byzanz 156 Caesarea 657 Chalkidier 42 Chios 46 99 Chryse 102 185 187 188-192 197199 201
Dardanellen 20 128 Delos 425 Delphi 457 474 Deutschland 157 373 Dodona214 457 Dresden 489 England 157 657 Epeier 133 Ephesos 295 Epidamnos 408 Epidauros 453 Etrurien 41 42 Euboia41 42 128 Europa 125 258 259 271 299 658 660 Florenz 156 157 Frankreich 157 Gallien 528 529 531 532 534 536 537 538 540 542 Gallier 528 531 533-535 541 543 Gardasee 318 Genf536 Germanen 527 531-535 541 542 543 Golf von Neapel 41 Griechen, Hellenen 22 28 30-32 4143 45 48 50 79 80 99 100 125-127 130 134 181 182 198 208 261 263 358 362 405 420 425 447 448 451 457 459 460 469 479 483 485 488 507 625 635 637 Griechenland, Hellas 13 17 18 40 44 46 79 98 99 100 157 358 403 408 423 425 426 435 453 457 473 475 491 Griechentum 473 494 Haeduer 537 538 Halle an der Saale 160 480
3. Orts- und Völkernamen
Helikon 29 Helvetier 536-538 540-543 Hisarlik 264 Holland 157 Ilios 20 270 Iolkos 45 Ionien 361 Ionier 99 Irland 657 Ischia 41 362 Italien 157 283 292-294 373 423 425 Ithaka 23 102 106 115 129 132 210 231438 Ithaker 132 Jugoslawien 17 Karer 46 79 Karthager 79 Karthago 512 520 Kas 626 Kephallenia 425 Kerkyra 408 425 Kleinasien 46 79 264 625 Knossos 48 50 Kolchis 128 Konstantinopel 657 Korinth 423 474 Korkyra 423 Kos 439 Kreta 17 79 126 128 214 264 625 Kroatien 271 Kypros, Kupros, Zypern 79 126 264 Lakedaimon, Lakedaimonier s. Sparta, Spartaner Leipzig 469-471 Lemnos 128 Lesbos 46 331 375 Libanon 126 130
729
Libyen 132 Lille 658 Lyder 79 Lykier 46 79 Lyons 677 692 Marathon 269 Mauretanien 657 Megaris419 Messenien 370 Mieza 154 Milesier 261 Milet 99 473 625 Minoer 126 Mitteleuropa 42 Mykalessos 419 Mykene 28 45 48 100 Myrmidonen 209 Mysier 79 Mytilenäer 312 Mytilene 300 311 Nemea 474 New York 43 Niederlande 271 Nordägäis 126 128 Nordwesteuropa 657 Normandie 658 Ogygia 109 Olmütz 449 Olymp(os) 23 25 101 121 182 183 1-98 199 304 316 461 Olympia 474 Ontario 359 Paros 370 Pellae 597 Peloponnes 419 425 474 Peloponnesier 412 Pergamon 649
730
Indizes
Perser 473 Phaiaken 52 106 107 110 113 114 147 626 Phönizien 127 128 132 133 449 Phönizier, Phoiniker 41 42 125-134 Phryger 46 79 Piräus 420 Pithekussai 41 42 Port-Royal 659 662 692 Portugal 271 Potidaea 408 Propyläen s. Akropolis Punier 520 Pylos 24 45 48 612 637 Rhein 531 542 Rhodos 264 Rom 13 20 443 503 505 512 515 520 521 532 536-538 654 655 Römer 40 444 447 451 459 520 Saida s. Sidon Salamanca 661 Salamis 269 416 625 Samos 46 100 519 Sardinien 126 Scheria 106 109 111 Schottland 657 Schweiz 271 Sequaner 537 538 Sidon 126-128 130 Sidonien 133 Sidonier, Sidoner 127-131 133 Sizilien 126 420 423 425 473 Smyrna 99 Spanien 126 271 Sparta, Lakedaimon 20 106 121 127 129 288 295 423 629 Spartaner, Lakedaimonier 425 426
Sybota417 Syrië 102 Taphier 130 Tartaros 597 Thasos 126 128 Theben 45 48 51 264 288 316 476 Thesproten 214 Thessalien 28 Tiryns 45 Tomis 442 Troas 20 30 55 316 Troer, Trojaner 32 34 79 80 120 182 461 462 Troia 140 142 206 208 210 262 264 Troja 20 45 49 50-53 55 80 81 99 100 110 116 121 127 128 191 192 201 288 316 460 521 594 618 620 626 629 Tschechoslowakei 271 Tyros, Tyrus 126 449 Unteritalien 79 473 Urbino 38 292 USA 294 Würzburg 42 Zakynthos 425 Zypern s. Kypros
Lebenslauf von Joachim Latacz Joachim Latacz, geboren 1934 in Kattowitz (Oberschlesien). Abitur 1953 an der Latina der Franckeschen Stiftungen in Halle a. d. Saale. Studium der Klassischen Philologie, Indogermanistik, Alten Geschichte und Klassischen Archäologie 1953-1956 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 19561960 der Klassischen Philologie, Alten Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin. 1960 Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Höheren Schulen. 1960-1966 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thesaurus Linguae Graecae (LfgrE) unter Bruno Snell und Hartmut Erbse an der Universität Hamburg, daneben 1962-1966 Lateinlehrer an privatem Abendgymnasium in Hamburg. 1963 Promotion zum Dr. phil. bei Uvo Hölscher an der FU Berlin. 19661972 wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Klassische Philologie der Universität Würzburg. Dort Habilitation für Klassische Philologie 1972. Nach Privatdozentur und außerordentlicher Professur in Würzburg 1978 Berufung zum ord. Professor für Klassische Philologie (Gräzisitk) an der Universität Mainz. 1981 Berufung auf den gesetzl. Lehrstuhl für griechische Philologie an der Universität Basel. Derzeit Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel.







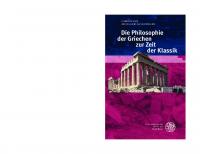
![Wege und Abwege der Ideen: Studien zur politischen Geistesgeschichte der Deutschen. Kleine Schriften I [1 ed.]
9783428584673, 9783428184675](https://dokumen.pub/img/200x200/wege-und-abwege-der-ideen-studien-zur-politischen-geistesgeschichte-der-deutschen-kleine-schriften-i-1nbsped-9783428584673-9783428184675.jpg)
