Die Straßen-Namen Berlins
156 69 108MB
German Pages 120 Year 1885
Polecaj historie
Table of contents :
Die Strassen-Namen Berlins
title_page
Vorwort
Einleitung
A
B
C
D
E
F
G
H
I/J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Berichtigung
Register der früheren, jetzt nicht mehr vorhandenen Straßen-Namen
imprint
Citation preview
Schriften des
Vereins für die Geshi guter alter Bolksschöpfung Lebewohl sagen zu sollen, und nur ein einziger Punkt macht uns bei der Vertheidigung des Neuen bedenklich, ob nämlich auch die gerühmte „WeiSheit auf der Gasse" den Umzug in die Straßen mitmachen werde."
Ganz so schlimm, wie der Verfasser dieses Aussakzes es sich gedacht hat, ist es nicht geworden. Von den im Jahre 1862 vorhandenen 47 Gassen ist infolge Verbreiterung, besserer Bebauung und Beseitigung nicht mehr zutreffender Bezeichnungen (wie 3. B. die Scheunen-Gassen), die Hälfte verschwunden, das heutige. Verzeichniß weist aber immer noch die Zahl von 23 Gassen auf, eine Zahl, welche sich wohl nicht bald vermindern dürfte.
Wie schon gesagt, hat sich Berlin in neuerer Zeit mächtig ver-
größert. Die Stellung als Hauptstadt des Deutschen Reiches veranlaßte hier eine Bauthätigkeit, wie sie Berlin vordem nie erlebt hatte.
Die
nach dem letzten Kriege entstandene sogenannte Gründerzeit schuf eine Masse Baugesellschaften, deren jede große Terrains, welche vorher noch
AFerland waren, erwarb, hier Straßen anlegte und pflasterte und die Baustellen entweder selbst bebaute oder an Bauunternehmer verkaufte.
Durch diese Bauthätigkeit nahm die Anzahl der Straßen so zu, daß sie heut die stattlihe Zahl von 700 nachweist, welche sich in folgender
Weise zusammenstellt:
519 Straßen, 56 Plätze, 23 Gassen, 7 Märkte, 24 User, 9 Alleen, 8 Höfe, 1 Kommunikation, 5 Graben, 6 Brüden, 3 Kirchen, 5 Wege, 5 Dämme, 2 Berge, 2 Kire der August-Straße gebaut hatte.
*) Nach der Ansicht de3 Herrn Ferdinand Meyer ist der Name „ArmesünderGasse“ dadur< entstanden, daß sich von den Jahren 1701--1718 hier und zwar auf den heutigen Grundstücken Nr. 69 und 70 der August-Straße auf einem Sand-
hügel das Hochgericht befunden haben soll (er. Bär, XT. Jahrgang Nr. 35 vom
30. Mai 1885).
GEE
EEB
Jm Jahre 1723 hieß sie bereits die „Kleine Straße", welcher Name später sich im umgekehrten Verhältniß in „Kleine Gasse" verwandelte.
Am 12. Januar 1862 beantragte der Eigenthümer Schulze die Umänderung in „Kleine Angust-Straße". Dieser Antrag wurde genehmigt und der heutige Name durch das Königl. Polizei-Präsidium am 29. Mai 1862 publizirt.
B.
Bad-Straße hat ihren Namen von dem im Jahre 1701 von König Friedrich I. entdeckten, im Jahre 1799 zu Ehren der hochseligen
Königin Luise „Luisenbad'" genannten Gesundbrunnen erhalten.
Bärwald-Straße empfing ihren Namen zum Andenken an den ver-
storbenen Berwaltungsdirektor der städtischen Gasanstalten C. F. Bär-
wald.
Bahnhofs-Straße, am Anhaltischen Bahnhof belegen und nach diesem
benannt, wurde im Jahre 1847 neu angelegt. Der Name wurde durch das Königl. Polizei-Präsidium am 22. Mai 1847 publizirt.
Bandel-Straße (Straße Nr. 14a Abth. VI11 des Bebauungsplans) erhielt durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 29. November 1876 ihren Namen zum Andenken an den Bildhauer Joseph Ernst v. Bandel, den Schöpfer des Hermannsdenkmals auf der Grottenburg bei Detmold. Barnim- Straße. Dieselbe ist von dem Geheimen Rechnungsrath Samekki, dem Besiker des an der Straße belegenen Bauterrain8 anu-
gelegt worden. Durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 16. November 1830 wurde bestimmt, daß diese Straße den Namen „SamezfkiStraße" führen solle, wenn Samekki das zu sämmtlichen in seinem
1830 vorgelegten Bebauungsplan projektirten Straßen erforderliche
Terrain an den Straßenfiskus abtreten würde. Da dies jedoch theilweise nicht geschehen war, unterblieb die Benennung. Der heutige Name wurde durch das Königl. Polizei-Präsidium am 15. August 1845 =- in welchem Jahre die Bebauung anfing =- publizirt.
Bartel-Straße, vorher „Kurze Sheunen-Gasse" (von den Scheunen,
welche hier standen), wurde unter der Regierung Friedrichs des
Großen zuerst bebaut. Jm Jahre 1848 beantragten die Eigenthümer, dieser Straße den
Namen Schul-Straße oder Kleine Linien-Straße oder auch BülowStraße, „da der Schwiegervater des Stadtverordneten Bartel, Namens Bülow, das erste Haus in dieser Straße gehabt habe", zu
2;
geben. Der Magistrat stimmt letzterem Vorschlage bei, da „einestheils der erste Bewohner und Bebauer der Straße „Bülow“ hieß,
anderntheils weil der Name „Bülow“ in der vaterländischen Geschichte einen guten Klang hat und namentlich den Bewohnern Berlins aus der Zeit der Schlacht von Großbeeren, welche unmittelbar vor den Thoren der Stadt geschlagen worden, bekannt ist". Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 4. April 1857 wurde nunmehr der Name
„Bülow-Straße" genehmigt.
Nach Benennung der Bülow-Straße vor dem Potsdamer Thore schlug der Magistrat im Jahre 1864 für diese Straße die neue Be-
zeichnung „Steinwehr - Straße" vor, nach dem verstorbenen General v. Steinwehr, „welcher sich durch Gründung einer bedeutenden milden
Stiftung um das Kommunalwesen verdient gemacht hat“.
Durch
Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 31. Oktober 1864 wurde jedoch der
Straße nach dem Stadtverordneten und Gutsbesitzer Bartel der Name
„Bartel-Straße" beigelegt.
Baruther Straße -- vorher Straße Nr. 31 Abth. 11 des Bebauungs-
plans = wurde im Jahre 1863 von dem Bauunternehmer Linden-
berg gepflastert. Leßterer wünschte hierfür die Namen Liegnitzer-, Frühling8- oder Lindenbergs-Straße. Magistrat schlug den Namen „Liegnitzer Straße" und, da diese Bezeichnung vom Polizei-Präsidium abgelehnt wird, später „Frühling8-Straße“ vor. Durch Allerhöchste
Kabinets-Ordre vom 25. Januar 1864 wurde nach dem Orte Bäruth
diese Straße „Baruther Straße“ benannt.
Bauhof- Straße, im Jahre 1710 über das Terrain des 1696 ent-
standenen Bauh ofs (späteren Schiffsbauplates) angelegt, hieß vorher
„Bauhofs-Gasse"“ und empfing laut Allerhöchster Kabinet8-Ordre vom 28. März 1863 die Bezeichnung „Bauhof-Straße".
Belforter Straße (Straße Nr. 5, Abth. XI] des Bebauungsplans) ist vom Aktien-Bauverein Königstadt angelegt worden und empfing ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 25. Juni 1875
zur Erinnerung an die Uebergabe von Belfort am 15. Februar 1871. Beethoven- Straße. Dieselbe wurde im Jahre 1868 vom Maurer-
meister Lorenz angelegt und sollte nach dem Wunsche der angrenzenden
Besizer den Namen „Lovenz- Straße" bekommen. Das PolizeiPräsidium schlug im Jahre 1872 mit Rücksicht auf die Nähe der
Beerschen Besitzung, in welcher Meyerbeer einige Opern komponirt haben soll, den Namen „Meyerbeer-Straße" vor. Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom selbigen Jahre wurde jedoch der Name „Beet-
hoven-Straße" zum Andenken an den großen Tondichter Ludwig
„it
CTFw
van Beethoven (geb. 17. Dezember 1770 zu Bonn, gest. 27. März 1827 zu Wien) bestimmt. Behren- Straße hat ihren Namen von dem Kurfürstlichen Jugenieur Behr, der 1647 zu Schleiz geboren, 1685 nach Berlin kam. Er war Gehülfe Nehrings beim Bau der Friedrichstadt und baute besonder8 1696 die Behren- und Französische Straße und 1701 die
Jerusalemer und Leipziger Straße. Behr schrieb 1712 ein Werk über die „Kriegsbaukunst" und ist 1717 gestorben. Bellealliance-Platz entstand im Jahre 1734 nach Verlegung des Landwehrgrabens und hieß „Das Rondeel am Halleschen Thore."
Durch Allerhöc-Straße. Dieselbe ist im Jahre 1866 auf früher fiskalischem Terrain angelegt und empfing zu Ehren des Reichskanzlers Fürsten v. Bismar> ihren Namen laut Allerhöchster Kabinet8-Ordre vom
15. Dezember 1866. Bezüglich dieser Benennung war schon vorher folgende Kabinet8-Ordre erlassen worden: „F< bestimme hiermit, daß eine der in der Gegend der Alsen-Brücke angelegten, nunmehr zu benennenden Straßen mit der Bezeichnung „Bis8mar>- Straße" versehen werde, und will Jhrem Berichte darüber, welcher dieser Straßen mit dem exwähnten Namen zu belegen sein wird, binnen Kurzem entgegensehen. Bis dahin soll die in Jhrem Berichte vom 2. d. Mts. beantragte ablehnende Bescheidung der Haus-
eigenthümer Pant und Genossen auf das Gesuch wegen Umänderung des Namens „Wasserthor- Sträße" in „Bis8mar>Straße" noch ausgesetßt bleiben. Berlin, den 23. April 1866.
An den Minister für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
'
|
Wilhelm,"
=“
42
, gest. 12. September 1820 zu
Kriblowik. Blumen-Straße, einer der ältesten Feldwege Berlins, hieß früher „Lehm-Gasse". Durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 17. August 13816 wurde ihr auf Antrag der Bewohner wegen des Boucheschen
Blumengartens (Nr. 11) der heutige Name beigelegt. Blumenthal- Straße (Straße G., Abth. II des Bebauungsplans)
wurde im Jahre 1874 von dem Berliner Bankverein angelegt und erhielt ihren Namen laut Allerhöchster Kabinet3-Ordre vom 24. Oktober 1874 zum Andenken an General Leonhard v. Blumenthal, geb. den 30. Juli 1810, in den Jahren 1866 und 1870 Generalstabs-
Chef der Armee des Kronprinzen von Preußen. Blumeshof ist vom Banquier Blume im Jahre 1864 über das ehe-
mals Jungbluthsche Grundstü> als Privat-Straße angelegt worden. Blume wünschte die Bezeichnung Lehniner Straße. Auf Befehl des Ministers für Handel 2c. wurde durch Verfügung des Königl. PolizeiPräsidiums vom 26. Juni 1864 gestattet, die Straße „Blumeshof“
zu nennen.
Bö>kh-Straße (Straße Nr. 5, Abth. II des Bebauungsplans). Diese Straße ist bei der Separation des Urban neu angelegt worden und empfing ihren Namen laut Allerhöchster Kabinet8s-Ordre vom 14. Oktober 1874 zur Erinnerung an Professor August Bö>h, geb. 24. November 1785, gestorben 3. August 1867.
ZBopp-Straße (Straße Nr. 8, Abth. Il des Bebauungsplans8), ebenso wie vorige Straße bei der Separation des Urban angelegt, erhielt ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 1. Dezember 1875 zum Andenken an Professor Franz Bopp (den berühmten Sanskritforscher), geb. 14. September 1791, gest. 22. Oktober 1867. Borsig-Straße ist vom Grafen v. Pourtale8-Gorgier auf ehemaligem Juvalidenhausa>er im Jahre 1859 angelegt worden und bekam ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 1. Februar 1860 auf Antrag des Magistrats vom 20. Dezember 1859 wegen des an ihr
liegenden Borsigschen Etablissements.
Boxhagener Straße, ein früherer alter Feldweg, ist erst in neuester Zeit zur Straße erhoben worden. Sie hat ihren Namen von dem Borwerk Boxhagen (früher Bogshagen), einer der ältesten Besitungen der Stadt.
FEE
3
1
Fee
Boyen-Straße. Dieselbe, im Jahre 1866 auf ehemaligem FnvalideihausSacker angelegt, sollte nach Vorschlag des Magistrats den Namen „Scillftraße“ erhalten.
Durc< Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom
19. Mai 1866 wurde ihr nach dem auf dem nahen Jnvaliden-
tirchaus Spandauer Straße Nr. 14 besaß =- im
18. Jahrhundert Klander8-Gasse, später Kalanders-Gasse,
auch Kalands8-Gasse. Auf Antrag der Hausbesizer wurde die Kalander-Gasse durch Allerhöchste Kabinet8s-Ordre vom 15. März 1822 „Branhaus-Gasse" (nach dem früheren alten Brauhause, jetzt
Nr. 1 belegen und der Marien- und Nikolaikirche gehörig) und durch Allerhöchste Kabinet8s-Ordre vom 18. Juni 1860 „Brauhaus-Straße“ benannt.
Breite Straße.
Sie hieß im 17. Jahrhundert und früher „Große
Straße.“ Ihren heutigen Namen führt sie seit Anfang ves 18. Jahrhunderts, weil sie zu jener Zeit die breiteste Straße
Berlins war.
Bremer Straße, vorher Straße Nr. 6, Abth. VIU des Bebauungsplans, empfing ihren Namen durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 29. November 1876.
Breslauer Straße ist im Jahre 1844 neu angelegt worden. Der Name wurde durch das Königliche Polizei-Präsidium am 25. August 13844 publizirt. Britzer Straße wurde im Jahre 1861 nen angelegt. Der erste Er-
bauer „Winkler“ beantragte für dieselbe den Namen „Winkler-Straße“,
wurde aber abgewiesen. Durc< Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 23. Dezember 1861 wurde der Straße nach dem nahe belegenen
Dorfe Britz der heutige Name beigelegt. Bromberger Straße, vorher Straße Nr. 13, Abth. XV des Be-
bauungsplans, hat ihren Namen durch Allerhöchste Kabinets - Ordre vom 17. Juli 1876 empfangen.
EEE
2m
Brücken-Allee, vorher „Schöneberger Wiesenweg", auch „Moabiter Damm" genannt, erhielt laut Bekanntmachung des Königl. Polizei-
Präsidiums vom 1. Dezember 1832 ihren Namen. ZBrücken- Straße, über das Terrain des „Holzmarktes des Prinzen
von Preußen" angelegt, bekam auf Allerhöchsten Befehl durch Berfügung des Königl. Polizei- Präsidiums vom 8. Mai 1825 ihren
Namen wegen der an ihrem Ende angelegten Jannowitz-Brücke. Brüder-Straße, Der älteste Theil derselben =- zwischen NeumannsGasse und Petri-Plaß -- hat seinen Namen von dem hier belegenen
Konvent der Dominikaner -Brüder, welche sich im Jahre 1297 in
in dieser Straße niederließen. Der übrige Theil hieß früher „Nach
dem neuen Stifte", nach der 1469 erfolgten Erhebung der
Dominikanerkirche zum Neuen Domstifte. Ju einem Lehnbriefe des
Kurfürsten Joachim Sigismund wird sie „Dom-Gasse“ genannt.
Seit dem Großen Kurfürsten hat die ganze Straße ihren heutigen
Namen.
Brunnen-Straße empfing ihren Namen nach dem Gesundbrunnen,
welcher 1701 entde>t und 1760 von Dr. Böhm allgemein nußbar gemacht worden war.
Buchen-Straße ist durch Gärtner Kielgan angelegt worden und erhielt ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 11. Juni 1870
wegen ihrer Bepflanzung mit Buchen-Bäumen. Buchholzer Straße, vorher Straße Nr. 17 Abth. X11 des Bebauungsplans, ist erst in neuester Zeit bebaut worden und erhielt ihren Namen nach dem Dorfe Französisch-Buchholz. Bülow -Straße, westlich von der Pot3damer Straße durch die BauvereinSbank (Wäsemann), östlich durch den Berliner Bankverein an-
gelegt, hat nach einem Vorschlage des Polizei-Präsidiums vom Fahre 1864, nach welchem die ganze Gürtelstraße von Rixdorf nac< Charlottenburg wegen der Nähe des Denkmals am Kreuzberg mit einzelnen
Namen berühmter Feldherren aus den Befreiungskriegen benannt werden sollte, durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 31. Oktober 18364 ihren Namen empfangen und zwar zu Ehren des Generals v. Bülow,
welcher „durch seine Siege bei Großbeeren und Dennewitz die drohende
feindlihe Jnvasion Berlins abwandte und dieser Straßentheil die
Landstraße nach Großbeeren begrenzt“.
Büschings-Platz erhielt seinen Namen laut Bekanntmachung des Königl.
Polizei- Präsidiums vom 30. Juli 1833 zu Ehren des 1793 verstorbenen Direktors des Berlinischen Gymnasiums Dr. Anton Friedrich
Büsching.
zz
215
.-
Büsching-Straße, zum größten Theil erst in der Zeit von 1861 bis 1874 bebaut, erhielt, ebenso wie der Büsching -Platz, nach dem ver-
storbenen Direktor Büsching ihren Namen, welcher durch das PolizeiPräsidium am 30. Juli 1833 publizirt wurde.
Buckower Straße wurde im Jahre 1861 durch das Grundstück des Kaufmanns Schulze (in Berlin als „Graupenschulze“ bekannt) an-
gelegt und hieß zuerst „verlängerte Waldemar-Straße“. Später wurde die Straße nach dem Vorschlage des Königl. Polizei-Präsidiums
-„Sculzes Hof“ genannt. Behufs definitiver Benennung wurde sodann seitens des Magistrats der Name „Kleine Waldemar-Straße“ und seitens des Polizei- Präsidiums die Bezeichnung „Schulzen-, Buckower oder Nudower Straße“ vorgeschlagen und durch Allerhöchste
Kabinet8-Ordre vom 13. Januar 1864 der heutige Name genehmigt.
Burggrafen- Straße (vorher Straße 26a Abth. IV des Bebauungsplans) ist vom Aktienbauverein Thiergarten angelegt worden und empfing ihre Benennung mit Rücksicht auf die daran stoßende Kur-
fürsten-Straße.
Burg-Straße war bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts ein enger
Gang an der Spree, welcher „Hinter der Heiligen Geist-Straße“
benannt wurde. Den Namen „„Burg-Straße bekam die Straße Ende
des 17. Jahrhunderts nach der Kurfürstlichen Burg (dem heutigen Schloß) und zwar von der langen Brücke bis zur kleinen Burg-
Straße. Dex andere Theil hieß noch 1730 „Hinter dem Wurfst-
hofe“. Der Theil, welcher die Häuser Nr. 1 bis 7 umfaßt, hieß Ende des vorigen Jahrhunderts „An der langen Brü>e am Wasser“.
Burg-Straße, Kleine. Dieselbe hieß früher das „Spree-Gäßlein“ und im Jahre 1644 auch „Frauen-Gäßlein“ (wegen der in ihr
wohnenden „an der Unehre sitzenden“ Frauen). Jm Jahre 1657
wurde die Lage der Straße von dem Hofrentmeister Michael Mathias, Besitzer der Häuser Heilige Geist-Straße Nr. 10 und 11 verändert. Zu dieser Zeit wurde sie „Wasser-Gasse“ genannt. Ende des
vorigen Jahrhunderts hatte sie den bloßen Namen „Durchgang“.
C.
Tantian-Platz, nac< dem Königl. Baurath und Stadtältesten Cantian (geb. 23. Juni 1794, gest. 19. April 1366) benannt. Vondiesem
Plaß bis zur Friedrichs-Brüce (zwischen Mehl-Brüce und dem
Welperschen Badehause) ging bis zur Erbauung der Nationalgallerie
„>
6
-
längs der Spree eine Straße, welche früher die Bezeichnung „Communikation“ over „Weidendamm“ führte, laut Bekanntmachung
ves Königl. Polizei-Präsidiums vom 5. Januar 1839 aber „Cantian-
Straße“ genannt wurde. Charite-Straße, als Zugangsstraße zu der im Jahre 1710 als Pesthaus angelegten, im Jahre 1726 ihrer heutigen Bestimmung übergebenen Königl. Charite entstanden, hat von dieser ihren Namen empfangen.
Charlotten-Straße, zwischen Behren- und Koch-Straße bei Erbauung
ver Friedrichstadt entstanden, empfing ihren Namen zum Andenken an vie 1705 verstorbene Königin Sophie Charlotte von Preußen. Der Theil von den Linden bis zur Dorotheen -Straße hieß einige Zeit „Stall-Straße“ wegen ver an ihr liegenden Ställe der Gardes du Corps. Der Theil zwischen Koch-Straße und Enke-Plaß ist im Jahre 1844 angelegt worden. Thaussee-Straße hat nace (geb. 23. September 1791), Direktor der Berliner Sternwarte. Die Benennung wurde durc< das Königl. Polizei-
Präsidium am 13. März 1844 publizirt. Engel-Ufer. Das Polizei- Präsidium beantragte am 14. Mai 1848
die Benennung „Köpeni>er Boulevard", worauf ohne nähere Meoti-
virung durch Allerhöchste Kabinet38-Ordre vom 24. März 1849 die
Straße den Namen „Engel-Ufer" erhielt, wahrscheinlich zu Ehren des Erzengels Michael, des Patrons der nahen, damals schon pro-
jektirten Michaelkirhe. (Einer unverbürgten Nachricht zufolge soll
die Straße nach dem in dortiger Gegend gestandenen Engelschen
Fabriketablissement |Wachstuche 2c.] ihren Namen erhalten haben.)
Ererzier - Straße, bei der Parzellirung des damals in der Feldmark
Reini>kendorf belegenen Magistratslandes im Jahre 1827 angelegt, erhielt ihren Namen nach dem Artillerie-Exerzirplalz, welcher sich au dieser Stelle befand. (Ueberreste des auf diesem Exerzir- Platz an-
gelegten Ravelins sind heut noc< vorhanden und in neuen Plänen Berlins als „Schanze“ vermerkt.)
XF.
Falkonier-Gasse hat ihren Namen von Häusern, welche in dieser Gasse im 17. Jahrhundert für Jagdfalken und deven Diener, die Falkoniere, errichtet waren.
Fehrbelliner Straße (Straße 67 Abth. XI des Bebauungsplans) er-
hielt ihre Benennung auf Vorschlag des Magistrats durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 30. März 1863 nach der Stadt Fehrbellin.
Feilner-Straße war schon im 17. Jahrhundert vorhanden und hieß
nach dem Kurfürstlichen Hasenheger, welcher in dieser Straße wohnte, „Hasenheger-Straße“. Laut Bekanntmachung des Königl. Polizei-
Präsidiums vom 10. Februar 1848 wurde ihr der heutige Name
beigelegt zum Andenken an die Verdienste, welche sich der in dieser Straße wohnende Ofenfabrikant Feilner um die Berliner Juvdustrie erworben hatte.
Feld-Straße. Für „den südlich der ehemaligen Gerichtsstätte (GartenPlat) in der Oranienburger Vorstadt belegenen Verbindungsweg
zwischen Garten- und A>er-Straße" wurde durch das Königl. PolizeiPräsidium am 2. September 1858 die heutige Bezeichnung publizirt.
995
Fenn-Straße, bei Parzellirung der Weddingsländereien im Jahre 1827 angelegt, erhielt ihren Namen von den Fennen (sumpfigen Terrains), welche sich zu beiden Seiten der Straße befanden. Am &Sestungsgraben (Gebäude der Singakademie und des Königl. Finanzministeriums) hat seine Bezeichnung von dem an diesen beiden Gebäuden vorbeifließenden (in neuester Zeit zugeschütteten) alten Festungs3- oder grünen Graben. Fichte- Straße (vorher Straße 10, Abth. Il des Bebauungsplan3) empfing ihren Namen durch Allerh. Kabinet8-Ordre vom 14. Oktober 1874 zum Andenken an den Philosophen Joh. Gottlieb Fichte, geb. 19. Mai 1762, gest. 29. Januar 1814.
Fischer-Brü>e, Die erste Anlage der Fischer-Brücke erfolgte im Jahre
1683. Es wurde der Berlinische und Cöllnische Fischmarkt dort angelegt. Der Verkauf ging bald wieder ein, und 1699 wurde die
Erlaubniß gegeben, rechts Krambuden anzulegen, welche vorn eine Bogenlaube hatten. Zuerst durfte man dort noer Thor" und zwischen Petri- und Grün-Straße „Hinter der Mauer an der Lapp-Straße". Der übrige Theil bis zur Spree-
Straße hatte keinen besonderen Namen. Die Gesammtbezeichnung „Friedrich38- Gracht" erhielt die Straße in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts.
Friedrichshain, Am (vorher Straßen 25, 2 und 32 Abth. XT11? des Bebauungsplans8), empfing den Namen laut Allerhöchster KabinetsOrdre vom 6. September 1880 wegen ihrer Lage an dem im Jahre
1845 angelegten FriedrichsShain. Friedrich-Straße (Große), bei Bebauung der „Neuen Auslage" zuerst zwischen Weidendammer Brücke und Behren-Straße entstanden, führte für diese Stree den Namen „Der Damm" und später „Quevr-
straße (weil sie sämmtliche älteren Straßen der Dorotheenstadt durchschnitt). Der später entstandene Theil zwischen Weidendammer Brücke und Oranienburger Thor hieß „Damm-Straße". Der Theil
zwischen den Linden und der Behren-Straße führte die Bezeichnung „An der Pot38damer Brücke". Vor der Erbauung der Friedrichstadt war über den in der Richtung der jezigen Behren- Straße befindlichen Graben eine Brücke, über welche die alte Straße nach Pot8dam führte. An dieser Stelle lag eine Militär- Hauptwache, welche in den Wachtrollen des Militärs „Die Wache an der Pots8damer Brücke“ hieß. Als unter Friedrich Wilhelm 1. die Straße bis zum Bellealliance-Platz durt und für die Bebauung freigelegt. Jm Anfange führte die
Straße die Bezeichnung „Linie“, woraus später der heutige Name
entstand. Dex Theil zwischen Prenzlauer und Neuer König-Straße
führte nach dem Nr. 5 und 6 belegenen Schükenplate, welcher im
Jahre 1747 hier angelegt wurde, den Namen „Neue SchütßenStraße".
Durc< Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom Mai 1821,
publizirt durch die Königlich Preußische Regierung 1. Abtheilung zu Berlin am 14. Mai 1821, wurde lettgenannter Straßentheil eben-
salls „Linien-Straße" benannt.
LinP-Straße wurde im Jahre 1845 neu angelegt und erhielt laut
Bekanntmachung des Königl. Polizei-Präfidiums vom 22. Januar 1845
(4 5.“
==
den Namen „Link-Straße" zu Ehren des Professor8 und Direktors
des botanischen Gartens, Heinrich Friedrich Link, geb. 2. Februar 1767, gest. 1. Januar 1851.
Jm Bolk8smunde wird der Name dieser
Straße, welche gewöhnlich „Link8-Straße" genannt wird, daher erklärt,
daß hier die Hausnummern nicht, wie bei den anderen Straßen an
der rechten Seite, sondern links anfangen.
Lothringer Straße. Zwischen Rosenthaler und Schönhauser Straße
wurde dieser Straße, welche vorher ein Weg außerhalb der Stadtmauer war, durc< Bekanntmachung des Königl. Polizei- Präsidiums
vom 11. Juni 1832 der Name „Wollank-Straße“, nacenwalde.
Lübbener Straße (Straße Nr. 2 Abth. 1 des Bebauungsplans). Diese Straße wurde im Jahre 1872 durch den Kaufmann Paul
Haberkern angelegt.
Derselbe wünschte hierfür die Benennung
„„Fndustrie- oder Motten - Straße“.
Magistrat schlug „Grünauer
oder Halbe'r Straße“ und das Polizei-Präsidium „Lübbener Straße“
vor.
Letktere Bezeichnung wurde durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre
vom 22. Juli 1872 genehmigt. KübeFer Straße (Straße Nr. 13a Abth. VIII des Bebauungsplans) empfing durch Allerhöchste Kabinet8s-Ordre vom 29. November 1876
ihre Benennung.
ihren Anfang.
Die Bebauung der Straße nahm im Jahre 1884
Lüneburger Straße (Straße Nr. 21 Abth. VI1 des Bebauungs8plans) empfing im Mai 1874 ihren Namen mit Beziehung auf den in der Nähe liegenden Lehrter Bahnhof nach der Stadt Lüneburg.
Lürzow-Platz (Plaß G Abth. IV des Bebauungsplans) erhielt auf Vorschlag des Polizei-Präsidiums wegen des daran liegenden Lützower
Ufers und der Lützow-Straße seine Benennung durch Allerhöchste
Kabinet3-Ordve vom 6. November 1869.
58
Lützow- Straße hieß früher „Liehower Weg-Straße“, nach dem Orte Lietzow bei Charlottenburg. Dem Theile zwischen Pots8damer und Flottwell-Straße, welcher vorher „Lüßower Weg" hieß, wurde dur< Bekanntmachung des Königl. Polizei-Präsidiums vom 10. Juli 1342 der Name „Lüßzower Weg-Straße" beigelegt. Durch Aller-
höchste Kabinets-Ordre vom 4. Mai 1867 empfing die Straße in
ihrer ganzen Ausdehnung die heutige Bezeichnung.
Lützower Ufer, bei Anlage des Schifffahrt8kanals neu entstanden,
erhielt den Namen laut Allerhöchster Kabinet8-Ordre vom 6. No-
vember 1849.
Luisen-Platz, im Jahre 1837 neu angelegt, erhielt wegen der an ihm
liegenden Luisenstraße seine Benennung, welche durch das Königl. Polizei-Präsidium am 5. Januar 1838 publizirt wurde.
Luisen - Straße wurde im Jahre 1827 neu angelegt und empfing
durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom April 1827 ihren Namen zum Andenken an Königin Luise, Gemahlin Friedrich Wilhelms 111. von
Preußen.
Luisen-Ufer, im Jahre 1849 bei Anlage des Schifffahrt8kanals neu entstanden, empfing laut Allerhöchster Kabinet8-Ordre vom 24. März 1849 seine Benennung ebenfalls zum Andenken an Königin Luise von Preußen. Zustgarten, Am. Der Lustgarten wurde im Jahre 1573 durch den Hofgärtner Desiderius Corbianus als Obst- und Küchengarten eingerichtet und bis zum Jahre 1620 als solcher gepflegt. Jmdreißigjährigen Kriege verwilderte der Garten, und erst 1645 wurde derselbe
durch Baumeister Menthardt und Lustgärtner Michael Hauff wieder
angelegt und verschönert, bis unter Friedrich Wilhelm I. sämmtliche Anlagen entfernt und der Plas zum Paradeplatz für die Berliner
Garnison eingerichtet wurde. Erst nach Erbauung des Museums (1828) entstanden wieder Gartenanlagen, welche in neuerer Zeit sich zu der heutigen Pracht emporgeschwungen haben.
W.
Maaßen- Straße, von dem Gärtner Kielgan neu angelegt, empfing
durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 11. Juni 1870 ihren Namen
zum Andenken an den General-Steuerdirektor und späteren Finanz-
minister Maaßen.
59
DTagazin - Straße war bis 1740 ein Weg zwischen Gärten.
In
diesem Jahre wurde hier ein Heu- und Strohmagazin erbaut, welches, 1780 vergrößert und massiv hergestellt, heut noch zur Aufbewahrung der Fourage für die hiesige Garnison dient. Bei Anlage dieses Magazins entstand die Straße, welche hiervon auch ihren Namen erhielt. Magdeburger Platz wurde im Jahre 1872 angelegt und empfing im Jahre 1873 seinen Namen wegen der an ihm liegenden Magdeburger
Straße. Magdeburger Straße (Straße Nr. 1 Abth. IV des Bebauungsplans)
hieß anfangs „Berlängerte Bendler-Straße“. Jm Jahre 1871
schlug das Königl. Polizei-Präsidium die Bezeichnungen Grunewaldoder Zehlendorfer Straße und später Zwölf Apostel- oder Magdeburger Straße vor. Lekterem Vorschlage trat der Magistrat bei, und wurde dieser Name durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 18. Sep-
tember 1872 genehmigt. Manstein - Straße (Straße K Abth. I11 des Bebauungsplans) vom Berliner Bankverein auf den Schöneberger Niederland-Enden angelegt, empfing ihren Namen laut Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 24. Oktober 1874 zum Andenken an General v. Manstein, 1870/71 Kommandeur des 9. Armeekorps.
Manteuffel- Straße wurde bei der Separation des Köpni>er Feldes
neu angelegt und erhielt laut Allerhöchster Kabinet8-Ordre vom
24. März 1849 den Namen „Eisenbahn-Straße" (von der Köpnier bis zur Skaliter Straße). Auf Antrag des Bezirksvorstehers
erhielt die Straße im Jahre 1852 -- Bekanntmachung des Königl.
Polizei-Präsidiums vom 22. Mai 1852 --- den Namen „Manteuffel-
Straße“ zum Andenken an den Ministerpräsidenten Freiherrn v. Man-
tleuffel. Die Verlängerung dieser Straße außerhalb der Stadtmauer zwischer Kottbuser Ufer und Skalitzer Straße (vorher Straße Nr. 4 Abth. 1 des Bebauungsplans) erhielt dieselbe Benennung durch Aller-
höchste Kabinet8-Ordre vom 11. November 1861.
WMargarethen-Straße. Für diese, durch Allerhöchste Kabinets-Oxrdre vom 7. April 1856 genehmigte neue Straße schlug das Königl.
Polizei-Präsidium im Jahre 1868 den Namen Kronprinz-Straße vor. Durch Allerhöchste Kabinet8- Ordre wurde ihr im Jahre 1872 der Name Margarethen-Straße zu Ehren der Prinzessin Margarethe von
Preußen, jüngsten Tochter des Kronprinzen von Preußen, beigelegt,
60
WMarheineke-Platz (Straße Nr. 27 und Plaz > Abth. 11 des Be-
bauungsplans). Für denselben schlug das Königl. Polizei-Präsidium
den Namen „„Mendelssohn - Platz“ (nach Moses Mendelssohn) vor.
Magistrat wünschte nach dem Prediger Philipp Marheineke, geb.
1. Mai 1780, gest. 31. Mai 1846, welcher auf dem nahen Drei-
saltigkeit8-Kir-Straße, vorher „Mula&>-Gasse“, wurde im Jahre 1699 angelegt und erhielt ihren Namen nach dem Erbauer des Ekhauses an der Schönhauser Straße: Jakob Mula>. Durch Allerhöchste Kabinets - Ordre vom 1. Januar 1862 wurde ihr die Bezeichnung
Mula>-Straße beigelegt. Jm Jahre 1869 petitionirten die Besitzer, „da der Name in einen üblen Ruf gekommen", um die Bezeichnung
von Winter- oder von Bernuth-Straße, wurden aber abschläglich be-
schieden.
Muskauer Straße, im Jahre 1871 neu angelegt, empfing auf Vor-
schlag des Königl. Polizei-Präsidiums ihren Namen durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 18. September 1871 nach der Stadt Muskau.
*) Dasselbe stand auf dem Plate, wo jeht das Viktoriatheater steht. xx) Mit dieser Verfügung nehmen die Akten des Magistrats, betreffend die Benennung der Straßen, Pläße und Stadttheile und die Numerirung ver Häuser,
ihren Anfang.
5
66
NY.
L7gunyn-Straße, bei der Separation des Köpnicker Feldes intra muros
neu ausgewiesen, hieß anfänglich „Dennewib-Straße".
Jhren
jekigen Namen bekam sie durch Allerhöchste Kabinets - Ordre vom 31. Oktober 1864 zum Andenken an den Bürgermeister, Regierungs-
rath Naunyn. Dieser hatte als Spezialfommissar der Generalkommission in den Jahren 1841--46 die Separation des Köpnicker Feldes geleitet. L7azarethkir-Platz (Plaz M Abth. X? des Bebauungsplans) erhielt im April 1884 seine Benennung zum Andenken an Joachim Nettelbe>,
welcher sich 1807 bei der Belagerung von Kolberg verdient ge-
macht hat.
Yeue Gasse, ein kleines Verbindungsgäßchen zwischen Kloster-Straße und Marienkircke (1749) und Neuanlage des Monbijouplaßes (1764) entstanden, erhielt ebenso
wie die vorige Straße ihren Namen nach dem Stadtpräsidenten
Kircheisen.
Prenzlauer Allee, vorher „Prenzlauer Chaussee", der alte Heerweg nach Prenzlau, erhielt ihre heutige Bezeichnung durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 30. Dezember 1878.
Prenzlauer Straße entstand Ende des 17. Jahrhunderts bei Verlegung des alten Heerweges nach Prenzlau. Mitte des vorigen Jahrhunderts führte die Straße den Namen „Heiner8dorfer Straße". Jhren heutigen Namen hat sie seit dem Jahre 1788, in welchem Jahre das Prenzlauer Thor erbaut wurde. Prinzen-Allee wurde im Jahre 1827 bei Parzellirung der Ländereien des Luisenbades neu angelegt.
Prinzen-Gasse hat ihren Namen von dem Freiherrn v. Prinzen, welcher im Jahre 1738 das Haus Schinkelplaß Nr. 3 besaß, erhalten. Prinzen-Straße, bei der Separation des Köpni>er Feldes 1841-46 neu angelegt, empfing ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 24. März 1849,
I Ti:
=“
Prinzessinnen-Straße, vorher ein Theil der Stallschreiber-Straße, erhielt ihre Benennung mit Beziehung auf die nahe liegende PrinzenStraße durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 3. Januar 1855.
Pritzwalker Straße (Straße Nr. 14 6 Abth. VU des Bebauungsplans), von der Baugesellschaft am kleinen Thiergarten im Jahre 18382 neu angelegt, erhielt ihren Namen nach der Stadt Pritzwalk im Januar 1883.
Probst-Straße hieß noch Anfang des vorigen Jahrhunderts nach einem
Besikßer „Kannegießer-Gasse", im Jahre 1723 aber schon „ProbstGasse" (nach der in ihr belegenen Probstei, dem Wohnhause des Probstes der St. Nikolaikirche). Der Theil gegenüber der Kirche, „Am Nikolai-Kiren der Mula>k-Straße und an einer E>e der
Linien- Straße, dem Garnisonkirchauses an der Alten Sce des Lustgartens im Anfange des 17. Jahrhunderts erbauten Münzthurm mit einer Wasserkunst) genannt wurde. Nach der Bebauung hieß die Straße „Die Freiheit zwischen der Hundebrücke (heutige Schloß-Brüce) und der Mühle". 1723 führte sie den kurzen Namen „Die Freyheit".
Schloß-Platz, früher einige Zeit „Dom-Plaß“ (nach der hier früher gestandenen im Jahre 1747 abgebrochenen Domkirche) genannt. Den
Namen hat der Platz von dem an ihm liegenden Königlichen Schlosse, zu welchem der Grundstein am 31. Juli 1443 gelegt wurde, erhalten.
Schmale Gasse hieß früher „Bullenwinkel“ und „NosmarinGasse“. Jhre heutige Bezeihnung wurde durch das Königl. PolizeiPräsidium am 27. August 1837 publizirt.
Schmid-Straße wurde im Jahre 1849 neu angelegt und erhielt ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8s-Ordre vom 24. März 1849. Schöneberger Straße ist im Jahre 1843 neu angelegt worden und
empfing ihre Benennung laut Bekanntmachung des Königl. PolizeiPräsidiums vom 25. April 1843.
Sie war vorher ein nac< Alt-
Schöneberg führender Feldweg und erhielt deshalb ihren heutigen Namen.
Schöneberger Ufer entstand nach Neuanlegung des Scifffahrtskanals
und empfing seinen Namen durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 6. November 1849. Jm Jahre 1860 trug der Königliche Hofschauspieler v. Lavallade darauf an, diesem Ufer den Namen „Prinzeß Augusta-Promenade“ oder „Prinzessinnen-Promenade“ zu geben. Es wurde dies Gesuch aber aus verschiedenen Gründen abgeschlagen.
S5
Schönhauser Allee war der alte Weg nac< Pankow und hieß bis zum
Jahre 1841 noch „Pankower Chaussee“. Der jekige Name wurde dur< das Königl. Polizei - Präsidium
publizirt.
am 27. Dezember
1841
Schönhauser Straße, Alte, bestand schon Mitte des 17. Jahrhunderts und führte als Straße nach Schönhausen die Benennung „Steinweg nac< Schönhausen“. Nach ihrer im Jahre 1699 erfolgten vollständigen Bebauung wurde sie „Pankower Straße“ genannt. Ihren heutigen Namen bekam die Straße nach erfolgter Anlegung
der Neuen Schönhauser Straße. Schönhauser Straße, Lreue, wurde an der südlichen Seite im Jahre 1750 und an der nördlichen Seite Ende des vorigen Jahrhunderts
bebaut und erhielt als Fortsezung der Alten Schönhauser Straße ihren heutigen Namen. Schönholzer Straße (Straße Nr. 39 Abth. XI des Bebauungsplans) wurde im Jahre 1862 neu angelegt.
Die Besitzer baten um den
Namen „Viktor-Straße“, Magistrat schlug aber nach dem Dorfe Schönholz bei Berlin die Bezeichnung „Schönholzer Straße“ vor. Qebteres wurde genehmigt und der Name durch das Königl. PolizeiPräsidium am 29. Mai 1862 publizirt.
Schönlein-Straße (Straße Nr. 4 Abth. 11 des Bebauungsplans) erhielt laut Allerhöcs-
Geßlein" oder „Kakernakel ".
Jhren heutigen Namen hat die
Gasse im vorigen Jahrhundert erhalten.
Schürzen-Straße entstand Anfang des 18. Jahrhunderts bei Anlegung der Friedrichstadt.
Jhren Namen soll sie von den in der Linden-
Straße belegenen alten Köllnischen Schüßzenplätzen erhalten haben. Schützen- Straße, Alte, (1723 Schüßzen-Gasse) ist Anfang des
18. Jahrhunderts an dem alten Berliner Schükenplatz, welcher sich bis zum Jahre 1708 hier befand, angelegt worden und hat von
demselben ihren Namen erhalten.
Schul-Straße wurde im Jahre 1827 bei Parzellirung der WeddingsHeideländereien neu angelegt und erhielt ihren Namen nach der hier belegenen, im Jahre 1821 erbauten ersten Gemeindeschule auf dem
Wedding.
86
Schulzendorfer Straße (Straße Nr. 56 Abth. X? des Bebauungs8plans) wurde im Jahre 1868 angelegt und erhielt ihren Namen nach dem Dorfe Schulzendorf bei Tegel. Sc8-Gasse" nach dem Besitzer des Hauses Nr. 17, Visitator Georg Mudric, und ist im Jahre 1695 angelegt worden. Ihren heutigen Namen empfing
sie auf Antrag mehrerer Bewohner durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 2. Dezember 1823 zum Andenken an den am 2. März 1822
verstorbenen Professor Franz Daniel Friedrich Wadzet, welcher in
dieser Straße am 3. August 1819 eine Erziehungsanstalt für ver-
lassene Kinder eröffnete.
7
e von der Noß-
Straße bis zur Waisenbrücke hieß Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts „Sirop8-Gasse“ wegen der hier im Fahre 1749
eingerichteten ersten Zuckersiederei (Wall-Straße Nr. 55).
Warschauer Straße (Straße Nr. 11 Abth. XIV des Bebauungsplans)
erhielt mit Beziehung auf den nahe liegenden Ostbahnhof ihren Namen
im Jahre 1874. Wartenburg-Straße wurde im Jahre 1867 von dem Pianofortefabrifanten Stö>er angelegt, und bat derselbe zu Ehren des Feldmarschalls York v. Wartenburg um die Benennung „„WartenburgStraße“. Magistrat schlug im Dezember 1867, „da das Terrain ehemals dem Ordens-Comthur zu Tempelhof gehörte“, den Namen „Comthur - Straße“ vor.
Durch Allerhöchste Kabinets - Ordre vom
12. Februar 1868 wurde die heutige Bezeichnung angeordnet.
99
Wasser-Gasse war ursprünglich ein schmaler, über Wiesen führender Weg. Jm Jahre 1740 wurde der Weg verbreitert und als Gasse angelegt. Jhren Namen führt die Gasse von den Ueberschwemmungen, welchen diese Gegend vor Anlegung des Festungsgrabens vielfach ausgesebt war.
Wasserthor-Straße, bei der Separation des Köpnic>er Feldes (1841 bis 1846) neu angelegt, empfing ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 24. März 1849 nach dem an ihrem Ende be-
legenen sogenannten Wasserthor.
Waßmann-Straße, vorher „Waßmanns8-Gasse“, war bereits im vorigen Jahrhundert bebaut und hat ihren Namen von einem Zimmermann David Waßmann, durch dessen in der Großen Frankfurter
Straße belegenes Grundstü> die Straße durchgelegt wurde, erhalten.
Laut Bekanntmachung des Königl. Polizei - Präsidiums vom
19. September 1831 wurde die „Gasse“ zur „Straße“ erhoben.
Waterloo-Ufer ist im Jahre 1866 angelegt worden. Magistrat schlug
„im Anschluß an die Bellealliance-Straße und -Platz" am 9. Februar 1866 den heutigen Namen vor, welcher durch Allerhöchste KabinetsOrdre vom 21. März 1866 genehmigt wurde. Weber - Straße, früher ein Theil der im Jahre 1705 abgesteckten
„Linien-Straße", erhielt ihren Namen durc< Allerhöchste Kabinets-
Ordre vom 7. Januar 1821, „da die Straße von einer sehr großen Zahl von Webern, Seidenwirkern, Strumpfwirkern, Tuchmachern und
anderen mit der Weberei beschäftigten Gewerbetreibenden bewohnt ist". Wedding-Platz hieß früher „Kirer Straße (Straße Nr. 59 Abth. XI des Bebauungsplans) erhielt auf Vorschlag des Magistrats vom 1. August 1863 nach der Stadt Zehdeni> ihren Namen durch Allerhöchste Kabinet8-Ordre vom 23. September 1863.
Zelten, In den, bekam den Namen laut Bekanntmachung des Königl. Polizei - Präsidiums vom 1. Dezember 1832. Jm vorigen Jahrhundert waren die „Gezelte" am „Platz der sieben Kurfürsten" der
Sammelplakz der eleganten Welt Berlins. (Ein Kupferstich Chodowiecis zeigt uns die Hofequipagen und Karossen der Aristokratie,
Kavaliere mit wohlgepuderten Perrücken und Damen in bauschigen Kleidern mit hohem Lo>enbau auf dem Kopf.) Jm Jahre 1745
erhielt der Refugis Thomassin zuerst die Königliche Genehmigung,
Erfrischungen in einem einfachen Leinwandzelt verabfolgen zu dürfen.
Ein zweites Zelt errichtete Dortu, und 1769 waren bereits deren
sechs vorhanden. Eins dieser Zelte, welches der Restaurateur Monrier errichtet hatte, war ausnahmsweise aus Brettern erbaut.
Dies Zelt
trug ein Schild, auf welchem eine goldene Gans mit der Unterschrift: „Mon oie sait tout“ abgebildet war. Später gingen diese Zelte in Privateigenthum über und wurden, nachdem sie massiv neu errichtet waren, die besuchtesten Restaurationslokale Berlins.
Zeughause, Zinter dem, Mitte des vorigen Jahrhundert8 bebaut, empfing den Namen von dem Zeughause (s. Platz am Zeughause). -
Zeughof- Straße erhielt ihre Benennung durch Allerhöchste Kabinets-
Ordre vom 24. März 1849 nach dem an ihr belegenen „Armaturund Train-Magazin". Ziegel-Straße wurde im Jahre 1698 auf dem Kurfürstlichen Vorwerksgarten angelegt und erhielt ihren Namen von der auf dem
Terrain der heutigen Königlichen Klinik früher bestandenen Ziegelei.
Sie hieß ursprünglich zwischen Friedrich8- und Artillerie - Straße
„Gasse am Garten nach der Ziegelscheune" und später „Große Kalkscheunen-Gasse". Der Theil zwischen Artillerie-Straße und dem Garten des Schlosses Monbijou hieß bis zum Jahre 1837 „Flatows8-Gasse" nach einem Hofrath dieses Namens, welcher hier einen Garten besaß. Die gemeinsame Bezeichnung „Ziegel-Straße“ wurde durch das Königl. Polizei-Präsidium am 12. Mai 1837 be-
kannt gemacht.
--
104
--
Zieten -Platz, vorher ein Theil des Wilhelms8-Platze8, erhielt seinen Namen laut Bekanntmachung des Königl. Polizei- Präsidiums vom 4. April 1849 nach dem an ihm stehenden Denkmal des Generals Hans Joachim v. Zieten (geb. 18. Mai 1699 zu Wustrau, gest. 26. Januar 1786 zu Berlin).
Zieten - Straße (Straße Nr. 10a Abth. IV des Bebauungsplans) erhielt im Jahre 1883 ihren Namen zum Andenken an General
Hans Joachim v. Zieten. Zimmer- Straße, bei der Anlegung der Friedrichstadt entstanden und im Jahre 1734 in ihrer jehzigen Lage vollständig angelegt, soll ihren Namen von Zimmerpläten erhalten haben, welche sich hier befanden. Zionskir

![Die Straßennamen Berlins [1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/die-straennamen-berlins-1nbsped.jpg)
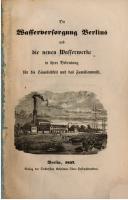
![Das Feuerlöschwesen Berlins [1]](https://dokumen.pub/img/200x200/das-feuerlschwesen-berlins-1.jpg)
![Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins [33]](https://dokumen.pub/img/200x200/schriften-des-vereins-fr-die-geschichte-berlins-33.jpg)

![Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins [84-87]](https://dokumen.pub/img/200x200/mitteilungen-des-vereins-fr-die-geschichte-berlins-84-87.jpg)



