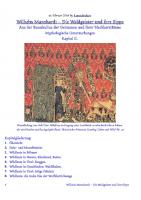Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition 9783111017419, 9783111014265
The translations of the complete dramas of William Shakespeare now known as the "Schlegel/Tieck" translations
337 114 23MB
German Pages 348 Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Vorwort
Grußwort zur Tagung
Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
Der Nachlass August Wilhelm Schlegels an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung. Ein Plädoyer für die Digitalisierung der Dresdner Quellen zur Romantik
Über das Schöne und das Unschickliche bei Shakespeare. Romantische Übersetzungsfragen im Kontext zivilisationsgeschichtlicher Sensibilitätsveränderungen
„Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ August Wilhelm Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
Fragwürdige Gestalten und Haarbuschige Gesellen. Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in August Wilhelm Schlegels Hamlet-Übertragung
Schattenbeschwörung. Eine unbekannte Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe im Kontext
Eine „höhere Stufe der Vollendung“? August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung im Horizont poetischer und politischer Ambitionen
„Glauben Sie mir, ich habe viel über diese Dinge nachgedacht.“ August Wilhelm Schlegel und die Bearbeitung und Kommentierung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus. Britische und deutsche Shakespeare-Rezeption im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
Praxis, Materialität, Aneignung. Ludwig Tiecks Marginalien und Notizen zu Shakespeare
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare: Notat; Exzerpt; Paratext; Fragment
Wolf von Baudissin als Diarist
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen. Brentanos Überlegungen zum Übersetzen vor dem Hintergrund frühromantischer Dichtungs- und Übersetzungstheorie
Spieltext – Lesetext – Edierter Text. Dramenedition auf dem Prüfstand
Die Edition von Übersetzungen: Grundsatzfragen, Zielsetzungen und ein Vorschlag für eine relationale Edition. Mit einem Blick auf die Rahmen einer Edition des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplexes
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises
Hamlet – digital ediert
Anschriften
Citation preview
B E I H E F T E
Z U
Herausgegeben von Winfried Woesler
Band 53
Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises Kontext – Geschichte – Edition Herausgegeben von Claudia Bamberg, Christa Jansohn und Stefan Knödler in Zusammenarbeit mit Carolin Geib und Robert Craig
De Gruyter
ISBN 978-3-11-101426-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-101741-9 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-101785-3 ISSN 0939-5946 Library of Congress Control Number: 2023935227 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston Satz: Carolin Geib, Trier Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com
Inhalt
Claudia Bamberg, Christa Jansohn und Stefan Knödler Vorwort ..................................................................................................................
IX
Katrin Stump Grußwort zur Tagung ............................................................................................ XIX Christa Jansohn Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben ...........................................................................
1
Thomas Haffner und Thomas Stern Der Nachlass August Wilhelm Schlegels an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden ...........................
37
Thomas Bürger Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung. Ein Plädoyer für die Digitalisierung der Dresdner Quellen zur Romantik ............
43
Günter Oesterle Über das Schöne und das Unschickliche bei Shakespeare. Romantische Übersetzungsfragen im Kontext zivilisationsgeschichtlicher Sensibilitätsveränderungen ....................................................................................
59
Olivia Varwig „Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ August Wilhelm Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur ................................................................................................
71
Claudine Moulin Fragwürdige Gestalten und Haarbuschige Gesellen. Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in August Wilhelm Schlegels Hamlet-Übertragung ..............................................
91
VI
Inhalt
Frieder von Ammon Schattenbeschwörung. Eine unbekannte Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe im Kontext .... 115 Nikolas Immer Eine „höhere Stufe der Vollendung“? August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung im Horizont poetischer und politischer Ambitionen ................................................................. 131 Stefan Knödler „Glauben Sie mir, ich habe viel über diese Dinge nachgedacht.“ August Wilhelm Schlegel und die Bearbeitung und Kommentierung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck .......................................... 147 Tim Sommer Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus. Britische und deutsche Shakespeare-Rezeption im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert .............................................................. 165 Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann Praxis, Materialität, Aneignung. Ludwig Tiecks Marginalien und Notizen zu Shakespeare ..................................... 179 Jochen Strobel Ludwig Tieck umkreist Shakespeare: Notat; Exzerpt; Paratext; Fragment ........... 201 Roger Paulin Wolf von Baudissin als Diarist .............................................................................. 219 Cornelia Ilbrig Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen. Brentanos Überlegungen zum Übersetzen vor dem Hintergrund frühromantischer Dichtungs- und Übersetzungstheorie ........................................ 227 Bodo Plachta Spieltext – Lesetext – Edierter Text. Dramenedition auf dem Prüfstand ......................................................................... 241 Rüdiger Nutt-Kofoth Die Edition von Übersetzungen: Grundsatzfragen, Zielsetzungen und ein Vorschlag für eine relationale Edition. Mit einem Blick auf die Rahmen einer Edition des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplexes ......................... 263
Inhalt
VII
Katrin Henzel Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises ....................... 281 Claudia Bamberg und Thomas Burch Hamlet – digital ediert ........................................................................................... 299 Anschriften ............................................................................................................ 325
VIII
Inhalt
Im vorliegenden Band werden folgende Siglen verwendet: Böcking August Wilhelm Schlegel: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Eduard Böcking. Leipzig 1846–47. KAV August Wilhelm Schlegel: Kritische Ausgabe der Vorlesungen. Hrsg. von Wolfgang Braungart, begründet von Ernst Behler, in Zusammenarbeit mit Frank Jolles. Paderborn 1989ff. KAWS August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz. Hrsg. von Jochen Strobel und Claudia Bamberg. Bearbeitet von Claudia Bamberg und Olivia Varwig in Zusammenarbeit mit Cornelia Bögel, Ruth Golyschkin, Bianca Müller, Radoslav Petkov, Christian Senf, Friederike Wißmach u.a. Dresden, Marburg, Trier 2014–2021; https://august-wilhelm-schlegel.de. KFSA Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jaques Anstett und Hans Eichner. Paderborn, München, Wien 1959ff.
Anmerkung zur gendergerechten Sprache: In allen Beiträgen wird das generische Maskulinum verwendet und bezieht sich somit auf alle Geschlechtsidentitäten. Die Verwendung der maskulinen Form dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit und impliziert keinerlei Wertung.
Vorwort
Der vorliegende Band versammelt die Beiträge der Tagung Die Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition, die in Zusammenarbeit mit der Kommission für die Edition von Texten seit dem 18. Jahrhundert in der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition und mit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) vom 13. bis 16. Juni 2022 im Klemperer-Saal der SLUB stattfand. Die Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und des Kreises um Ludwig Tieck – als ‚Schlegel-Tieck‘ bald kanonisiert – ist erstmals vollständig zwischen 1825 und 1833 im Verlag von Georg Andreas Reimer in Berlin erschienen.1 Jedoch ist der ‚Schlegel-Tieck‘ nicht die Gemeinschaftsarbeit, die sein Doppelname suggeriert: Schlegel hat sie 1797 allein als eine geplante vollständige Übersetzung aller Stücke Shakespeares begonnen, die bei Johann Heinrich Unger in Berlin erschien. Nach acht Bänden mit je zwei Stücken stockte das Unternehmen 1801, neun Jahre später folgte noch ein Band mit Richard III.2 Erst 15 Jahre später wurde aus diesem Torso auf Drängen des Verlegers Georg Andreas Reimer, der mittlerweile die Rechte an Schlegels Übersetzung erworben hatte, der ‚Schlegel-Tieck‘, der wiederum erst weitere acht Jahre später, 1833, in seiner ersten Gestalt abgeschlossen vorlag. In dieser Ausgabe wurden die von Schlegel nicht übertragenen Stücke unter dem Namen Ludwig Tiecks sowie Schlegels eigene Übersetzungen, von Tieck ‚korrigiert‘, veröffentlicht. Weitere vier Auflagen – 1839/41, 1843/44, 1850 und 1852 – folgten bis zu Tiecks Tod im Jahr 1853. Der ‚Schlegel-Tieck‘ wurde für die deutsche Shakespeare-Rezeption im 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus maßgeblich. August Wilhelm Schlegel indessen hatte zu der vom Tieck-Kreis ergänzten und überarbeiteten Ausgabe kaum noch etwas beigetragen; er distanzierte sich sogar – nach anfänglicher Zustimmung – gegenüber Reimer ausdrücklich von Tiecks bereits in den zwanziger Jahren begonnener Unternehmung und beschwerte sich über die von Tieck vorgenommenen Eingriffe in seine Texte.3 Tieck übersetzte die verbliebenen Stücke Shakespeares nicht selbst, sondern delegierte diese Arbeit an seine Tochter Dorothea und an Wolf Heinrich von Baudissin. Reimer hielt es aus verkaufsstrategischen Gründen allerdings für sinnvoll, 1
2
3
William Shakespeare: Dramatische Werke. Uebersetzt von A. W. Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. 9 Bde. Berlin 1825–1833. William Shakespeare: Dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1797–1801, 1810. Vgl. hierzu Schlegels Korrespondenz mit Georg Andreas Reimer, etwa Schlegels Brief vom 15. März 1825. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/683.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-001
X
Vorwort
zwei bekannte ‚romantische‘ Namen auf den Titel zu setzen4 – die wirklichen Übersetzer, Wolf Heinrich von Baudissin und Dorothea Tieck, wurden also bewusst verschwiegen. Zwar behielt Tieck die Oberaufsicht, aber eindeutig ihm zuzuweisen ist lediglich die Kommentierung der einzelnen Stücke. Einen ‚Schlegel-Tieck‘ hat es folglich de facto nie gegeben; der Titel ist irreführend und täuscht über die wahren Entstehungsumstände hinweg. Das Unternehmen ist somit kein Gemeinschaftsprojekt beider Autoren, das im Austausch oder auch nur zeitgleich entstanden wäre, sondern die Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises stellen – bis auf kleine Ausnahmen – jeweils eigenständige Publikationen dar, die nacheinander entstanden und gedruckt wurden und darüber hinaus auch nicht auf denselben Übersetzungsprinzipien beruhen. Bis heute fehlt eine historisch-kritische Edition, ja überhaupt eine Ausgabe, die der komplizierten Entstehungs- und Publikationsgeschichte des ‚Schlegel-Tieck‘ nur ansatzweise Rechnung trüge. Die wenigen Einzelstudien dazu sind vor allem älteren Datums und stammen durchweg aus der Germanistik.5 Eine wissenschaftliche Ausgabe aber ist unabdingbare Voraussetzung für jede weitere und differenzierte Beschäftigung mit diesem Werkkomplex. Ebenso ist die Rezeptionsgeschichte noch nicht vollständig aufgearbeitet6 und findet sowohl in der germanistischen als auch in der anglistischen Forschung kaum bzw. gar keine Berücksichtigung. Dabei ist gerade jetzt der Zeitpunkt für eine neue und umfassende Auseinandersetzung günstig: Zahlreiche Quellen insbesondere zu August Wilhelm Schlegel sind in 4
5
6
Vgl. dazu Christine Roger: Von „bequemen und wohlfeilen Nebenbuhlern“: die ‚Schlegel-Tiecksche‘ Shakespeare-Übersetzung und die Konkurrenz. In: „lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn! –“. Ludwig Tieck (1773–1853). Hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin unter Mitarbeit von Heidrun Markert. Bern u.a. 2004 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge. 9), S. 277–296, hier S. 295. Vgl. im Folgenden eine Auswahl der Beiträge: Michael Bernays: Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare. Leipzig 1872; Rudolph Genée: A. W. Schlegel und Shakespeare: Ein Beitrag zur Würdigung der Schlegelschen Übersetzungen; mit drei faksimilierten Seiten seiner Handschrift des Hamlet. Berlin 1903; Peter Gebhardt: A. W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257); Kenneth E. Larson: The Origins of the „Schlegel-Tieck“ Shakespeare in the 1820s. In: The German Quarterly 60, 1987, Nr. 1, S. 19–37; Christa Jansohn und Bodo Plachta: „Blicken wir in die Originalausgabe!“ Michael Bernays als „Anwalt“ von Goethe und Shakespeare. In: editio 35, 2021, S. 120–141; Christine Roger: Die Shakespeare-Rezeption in Deutschland (1815–1850). Verbreitung und Einbürgerung eines fremden Paradigmas. In: Recherches germaniques 33, 2003, S. 59–80; Dies. (Anm. 4), S. 277–296; Roger Paulin: Shakespeare im 18. Jahrhundert. Göttingen 2007, S. 19–37; Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48, sowie die folgenden Anmerkungen. Vgl. Philipp Ajouri und Christa Jansohn: Shakespeare-Ausgaben der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1867 bis zur Jahrhundertwende. In: IASL (Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur) 45, 2020, Bd. 2, S. 386–396.
Vorwort
XI
den letzten Jahren neu erschlossen worden, dies gilt für seine Korrespondenz ebenso wie für seine Vorlesungen.7 Die Bibliothek von Ludwig Tieck, deren Erschließung für ein differenziertes Verständnis der Shakespeare-Übersetzungen aus dem Tieck-Kreis unabdingbar ist, wird derzeit von einer Wiener Arbeitsgruppe um Achim Hölter erschlossen.8 Zugleich bietet gerade das digitale Medium und damit die digitale Editionsphilologie erweiterte, neue Möglichkeiten der Erschließung und der Edition, die es zu nutzen und anzupassen gilt. Auf der Basis dieser neuen Arbeiten möchte der vorliegende Band Forschungslücken schließen und Möglichkeiten aufzeigen, auch weitere Fehlstellen anzugehen. Die Perspektive auf das Phänomen ‚Schlegel-Tieck‘ ist dabei so breit wie möglich gewählt: In den Blick geraten also nicht nur die Übersetzungen selbst, sondern auch Schlegels und Tiecks sonstige Arbeiten über und zu Shakespeare – Aufsätze, Abhandlungen, Vorlesungen, Vorreden, Exzerpte und Notizen, schließlich narrative Texte wie Tiecks Shakespeare-Erzählungen – und darüber hinaus die dazugehörigen Debatten ihrer Zeit wie auch späterer Generationen. Schließlich richtet sich der Blick in die Zukunft: Es geht um die Frage, wie die Texte des ‚Schlegel-Tieck‘ heute am sinnvollsten ediert werden könnten, welche philologischen Anforderungen dabei zu beachten sind und welche digitalen Verfahren bei einer solchen dringend notwendigen Edition zum Einsatz kommen müssen. Die Übersetzungen von Schlegel und des Tieck-Kreises, ihre Bedingungen, ihr Kontext und ihre Rezeption, Forschungserträge und Forschungsdesiderate werden in diesem Band interdisziplinär, von Anglisten und Germanisten, Literaturwissenschaftlern und Linguisten, Editionswissenschaftlern und Vertretern der Digital Humanities angegangen und diskutiert. Eröffnet wird der Band mit dem Beitrag von Christa Jansohn (Bamberg): Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben. Ausgehend von einem Überset-
7
8
So sind die Korrespondenzen August Wilhelm Schlegels, die bis dato nicht einmal zur Hälfte veröffentlicht waren, in einer Online-Edition zugänglich (August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [KAWS]. Hrsg. von Jochen Strobel und Claudia Bamberg. Dresden, Marburg, Trier 2012–2021, http://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/); auch sind in den Digitalen Sammlungen der SLUB Dresden, die den Hauptnachlass Schlegels und damit auch seine Shakespeare-Manuskripte verwahrt, einige von diesen einsehbar (vgl. das Hamlet-Manuskript, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/11745/1/0/, sowie die beiden Manuskripte zum Sommernachtstraum, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/101737/1/0/ und https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/101902/1/0/). Eine Ausgabe von Schlegels Hamlet-Manuskript liegt ebenfalls vor: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100). Vgl. auch die Kritische Ausgabe von Schlegels Vorlesungen (hrsg. von Georg Braungart. Paderborn 1989ff.), in deren Rahmen jüngst die von Stefan Knödler herausgegebenen Bände II/2: Vorlesungen über Ästhetik (1798–1827), 2016, und IV/1: Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur (1809–1811), Tl. 1: Text, 2018, erschienen sind. Ludwig Tiecks Bibliothek. Anatomie einer romantisch-komparatistischen Büchersammlung (Laufzeit: 1.10.2014 bis voraussichtlich 30.9.2023), https://tieck-bibliothek.univie.ac.at (alle Webseiten im Vorwort wurden am 24.1.2023 gesehen).
XII
Vorwort
zungsvergleich (Hamlet, III.1.83–88) werden vier Forschungsfelder vorgestellt, die bisher zu wenig Beachtung gefunden haben, und zwar 1. die bibliographische Bestandsaufnahme, 2. die Dokumentation der Instabilität der ausgangssprachlichen und zielsprachigen Texte, 3. der Shakespeare-Kanon und 4. die Überlieferungsgeschichte. Im Anschluss daran führen Thomas Haffner und Thomas Stern, Mitarbeiter und Referatsleiter Handschriften, Seltene Drucke und Kartensammlung in der Handschriftenabteilung der SLUB Dresden, in den dort befindlichen Nachlass August Wilhelm Schlegels und in seine Geschichte ein und stellen einige der für die Geschichte seiner Shakespeare-Übertragung wichtigen Bestände vor. Auch Thomas Bürger (Dresden) widmet sich in seinem Beitrag Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung. Ein Plädoyer für die Digitalisierung der Dresdner Quellen zur Romantik den lokalen Zusammenhängen in Dresden: August Wilhelm Schlegels Die Gemählde. Gespräch (1799) in der Dresdner Galerie, den einschlägigen Archivbeständen der SLUB zu Schlegel, Tieck und Baudissin und der berühmten Accademia Dantesca des Prinzen (und späteren Königs) Johann von Sachsen (Philaletes) zur Übersetzung und Kommentierung von Dantes Göttlicher Komödie, die in Schloss Pillnitz bei Dresden ihren Ort hatte. Zugleich plädiert er – mit der reichhaltigen Expertise als langjähriger Generaldirektor der SLUB – für eine kuratierte Digitalisierung sämtlicher einschlägiger Dresdner Bestände in ihrem Zusammenhang, um sowohl eine umfassende Grundlage als auch die dazugehörige digitale Infrastruktur für anschließende digitale Editionen zu schaffen. Günter Oesterle (Gießen) diskutiert in seinem Beitrag Über das Schöne und das Unschickliche bei Shakespeare. Romantische Übersetzungsfragen im Kontext zivilisationsgeschichtlicher Sensibilitätsveränderungen den Umgang der frühromantischen Übersetzung und insbesondere diejenige August Wilhelm Schlegels mit unschicklichen und anstößigen Stellen bei Shakespeare; und er macht deutlich, dass eine wesentliche Voraussetzung der frühromantischen Übersetzungskonzeption ein gegenüber dem Sturm und Drang verändertes Shakespeare-Bild ist. Shakespeare wird nun nicht mehr als wildes Genie wahrgenommen, dessen Werke man umdichten und verändern könne, sondern als „tiefsinniger Künstler“ (August Wilhelm Schlegel), der jede Tonlage zu treffen weiß; daraus ergibt sich das unhintergehbare Postulat der treuen poetischen Übersetzung. Dabei arbeitet Oesterle heraus, dass in der romantischen Übersetzung auch für die Zeitgenossen ‚unschicklich‘ anmutende, tabuverletzende Stellen, Passagen und Wörter durch die „poetische Versifikation“ und die daraus entstehende „ästhetische Distanz“ bewahrt, ja sogar verschönert werden. Durch diese Art der romantischen Aneignung der shakespeareschen Dramen werde die „poetische Wahrhaftigkeit“ des Ausgangstextes nicht nur erhalten, sondern auch virtuos gesteigert. Olivia Varwig (Wuppertal) geht in ihrem Aufsatz „Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ August Wilhelm Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur anhand der jüngst erschlossenen Quellen zu August Wilhelm Schlegel (vor allem der Korrespondenz) der Frage nach, wie Schlegels
Vorwort
XIII
Englischkenntnisse und sein Verhältnis zur englischen Sprache und Kultur einzuschätzen sind. Dazu wirft sie einen näheren Blick auf seine früheste, bereits in seiner Heimatstadt Hannover gemachte und sodann durch seine Lehrer und Mentoren Christian Gottlob Heyne und Gottfried August Bürger intensivierte Beschäftigung mit der englischen Sprache und Literatur und geht seinen Kontakten im englischen Sprachraum nach. Obwohl kaum englischsprachige Dokumente von Schlegels Hand vorliegen und sein Verhältnis zum Englischen zeitlebens äußerst ambivalent blieb, wie die Zeugnisse zeigen, kann man davon ausgehen, dass er die Sprache im zeitgenössischen Vergleich hervorragend beherrschte, wenn es ihm auch missfiel, darin zu schreiben oder gar zu publizieren. Claudine Moulin (Trier) gibt in ihrem Beitrag „Fragwürdige Gestalten“ und „Haarbuschige Gesellen“. Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in August Wilhelm Schlegels ‚Hamlet‘-Übertragung einen sprachhistorischen Einblick in Schlegels Arbeitswerkstatt, indem sie die Dynamiken der Entstehung der Hamlet-Übersetzung ausgehend vom Hamlet-Manuskript9 (u.a. von den darin enthaltenen Änderungen, Durchstreichungen, Ergänzungen, Überschreibungen und Einschüben) in den Fokus rückt – mit Blick auf die Vorgängerübersetzungen von Wieland und Eschenburg sowie auf den Erstdruck von 1798. Moulin fragt nach dem Zusammenhang von poetischem Übersetzen und lexikalischer Kreativität bei August Wilhelm Schlegel und zeigt anhand eines close reading des Hamlet-Manuskripts, wie das Verfahren der sprachkontaktinduzierten lexikalischen Innovation Schlegels Übersetzung des Hamlet prägt. Dabei macht sie auch deutlich, wie wichtig diese Erkenntnisse für die Darstellung des interkulturellen Transfers in einer Übersetzungsedition sind. Frieder von Ammon (München) präsentiert in seinem Beitrag Schattenbeschwörung. Eine unbekannte Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe im Kontext einen bedeutenden Handschriftenfund: eine in der Leipziger Stadtbibliothek aufgetauchte handschriftliche Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe zu einer Abschrift seines Aufsatzes Über Shakespeares ‚Romeo und Julia‘. Neben dem Erstdruck dieses aufschlussreichen Dokuments eruiert Ammon seinen Kontext im Spannungsfeld zwischen der Jenaer Frühromantik und den Weimarern Goethe und Schiller. Auch der Aufsatz von Nikolas Immer (Trier), Eine „höhere Stufe der Vollendung“? August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung im Horizont poetischer und politischer Ambitionen, beschäftigt sich mit den literaturpolitischen Aspekten von Schlegels Shakespeare-Übertragungen und untersucht die mannigfachen Verflechtungen, in denen Schlegels Shakespeare-Übersetzung in den 1790er Jahren entstand; darüber hinaus geht er auf das Konzept von Schlegels übersetzungspoetischer Neuorientierung und dessen Beurteilung in der zeitgenössischen Literaturkritik ein. Stefan Knödler (Tübingen) untersucht in seinem Beitrag „Glauben Sie mir, ich habe viel über diese Dinge nachgedacht.“ August Wilhelm Schlegel und die Bearbeitung und Kommentierung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck Schlegels Umgang mit der Fortsetzung seiner Fragment gebliebenen Übersetzung sämtlicher 9
SLUB Dresden, Msc.Dresd.e.90,XXII,1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/11745/1.
XIV
Vorwort
Dramen Shakespeares durch Ludwig Tieck und seinen Kreis. Es ist die Geschichte einer Arbeitsverweigerung, die er nur selten aufgibt. Aber seine sporadische Beschäftigung mit den Arbeiten seiner Nachfolger – besonders seine Korrekturen zu den von Tieck vorgenommenen Eingriffen in seinen Text sowie zu dessen Kommentaren zu den von ihm übertragenen Stücken – ist sprechend genug: Die Konzeption eines ‚SchlegelTieck‘ als eine harmonische Einheit lehnte Schlegel ab. Tim Sommer (Passau) weitet in seinem Beitrag Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus. Britische und deutsche Shakespeare-Rezeption im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert den Blick und beleuchtet im britisch-deutschen Vergleich zwei Dimensionen des Shakespeare-Übersetzens, die bislang wenig beachtet wurden: „die Auseinandersetzung im Modus der aemulatio“ sowie „die kulturpolitische Aufwertung Shakespeares“ durch die Auszeichnung seiner Werke als Weltliteratur. Anhand ausgewählter Beispiele diskutiert Sommer Shakespeares Bedeutung in diesem Diskurs und geht dabei auch auf die Rezeption von Schlegels Shakespeare-Übersetzung in England ein, die wie in Deutschland als mustergültige Übertragung des Barden angesehen wurde. Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann (Wien) stellen in ihrem Beitrag Praxis, Materialität, Aneignung. Ludwig Tiecks Marginalien und Notizen zu Shakespeare einige Erträge aus dem vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderten Projekt Ludwig Tiecks Bibliothek. Anatomie einer romantisch-komparatistischen Büchersammlung (https://tieck-bibliothek.univie.ac.at/) vor. Anhand des Katalogs zur Versteigerung seiner Bibliothek, die Tieck selbst in die Wege geleitet hatte, sowie der tatsächlich in ganz Europa verstreuten Exemplare aus Tiecks Besitz rekonstruieren die drei Verfasser die Bedeutung der Shakespeariana-Sammlung für seine Übersetzungen und für seine Lektüren (die eigene wie die der berühmten Vorleseabende). Dies tun sie auch durch die zahlreichen Marginalien, die Tieck in seinen Büchern hinterlassen hat; dabei zeigen sie, dass er in den Verkauf seiner Shakespeariana sogar schöpferisch eingriff. Auch die Untersuchung von Jochen Strobel (Marburg), Ludwig Tieck umkreist Shakespeare: Notat; Exzerpt; Paratext; Fragment, geht dieser eigenwilligen Art und Weise Ludwig Tiecks nach, sich mit Shakespeare (nicht) zu beschäftigen, indem er die Gesamtheit der Auseinandersetzung mit Shakespeare in den Blick nimmt. Strobel beschreibt diese mit der Metapher des „Umkreisens“ und beleuchtet die weitgehend als Fragment bleibenden Texte Tiecks näher, zu denen Einzelübersetzungen, Abhandlungen, Vorreden, Exzerpte, Kommentare, Notate und Erzählungen, aber auch die Beschäftigung mit den Zeitgenossen gehören. Der Verdacht, es handle sich dabei um Ausweichbewegungen vor dem Großen, Vollständigen – der Werkausgabe, der Biographie, der vollständigen Übersetzung sämtlicher Dramen – liegt nahe. Roger Paulin (Cambridge) untersucht in seinem Aufsatz Wolf von Baudissin als Diarist die Tagebücher Wolf Heinrich von Baudissins aus der Zeit von 1830 bis 1840 mit Blick auf dessen Shakespeare-Übersetzungstätigkeit. Sie geben weitreichende Aufschlüsse über die Zirkel in Dresden und den hier gepflegten Lebensstil, vor allem aber enthalten sie Informationen über die sogenannte ‚Corrigirstunde‘ Ludwig Tiecks, die
Vorwort
XV
Baudissin und Dorothea Tieck eine Zeitlang fast täglich besuchten. Von großem Glück ist, dass Paulin die Tagebücher 1974 in Kiel noch einsehen und aus ihnen exzerpieren konnte, da sie heute nicht mehr auffindbar sind. Baudissins vereinzelte Bemerkungen zu Tiecks ‚Verbesserungen‘ geben nicht nur einen Einblick in den Entstehungs- und Schaffensprozess des großen Unternehmens ‚Schlegel-Tieck‘, sondern auch in die Einsichten und Gedanken, die in Tiecks Konversationen fallen, etwa zum elisabethanischen Theater, zur Revision des ‚Schlegel-Tieck‘ um 1840 und nicht zuletzt zum Buch über Shakespeare. Cornelia Ilbrig (Hamburg) widmet sich mit ihrem Beitrag Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen. Brentanos Überlegungen zum Übersetzen vor dem Hintergrund frühromantischer Dichtungs- und Übersetzungstheorie dem weiteren Kontext von Schlegels frühen Übersetzungen (Shakespeares wie anderer Dichter) und zeigt damit, dass die Theorie der frühromantischen Übersetzung keine einheitliche war. Ausgehend von Gesprächen in Clemens Brentanos Roman Godwi oder das steinerne Bild der Mutter von 1801 rekonstruiert sie dessen von Skepsis geprägte Überlegungen zur „Theorie vom romantischen Mittlertum“. Bodo Plachta (Münster) widmet sich in seinem Aufsatz Spieltext – Lesetext – Edierter Text. Dramenedition auf dem Prüfstand erstmals systematisch dem Komplex der Dramen-Edition und nutzt den sich in jüngster Zeit abzeichnenden „Perspektivenwechsel“,10 grundsätzlich über die Edition von Theatertexten nachzudenken, wobei wissenschaftsgeschichtliche, methodische und editionspraktische Aspekte im Vordergrund stehen, um zu zeigen, dass Theatertexte als historische multimediale Werke zu edieren sind. Rüdiger Nutt-Kofoth (Wuppertal) diskutiert in seinem Beitrag Die Edition von Übersetzungen: Grundsatzfragen, Zielsetzungen und ein Vorschlag für eine relationale Edition. Mit einem Blick auf die Rahmen einer Edition des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplexes die Anforderungen, die eine Edition von Übersetzungen, insbesondere wenn sie als eine historisch-kritische fungieren will, zu berücksichtigen hat und inwiefern sie sich von denjenigen einer ‚herkömmlichen‘ historisch-kritischen Ausgabe unterscheiden. Das betrifft zunächst das editorische Objekt selbst und damit verbunden die Frage nach der Gültigkeit oder Modifikation der leitenden Kategorien ‚Autor‘, ‚Autorisation‘ und ‚Authentizität‘. Des Weiteren gibt Nutt-Kofoth einen Forschungsabriss zur Konzeption von Übersetzungseditionen und zeigt ferner, wie bislang mit Übersetzungen in historisch-kritischen Ausgaben umgegangen wurde. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass einzig die Marburger Büchner-Ausgabe ein an die Anforderungen an eine Übersetzung angepasstes und ausdifferenziertes Editionskonzept entwickelt hat. Auf dieser Grundlage erarbeitet Nutt-Kofoth einen Anforderungskatalog für zukünftige Übersetzungseditionen und diskutiert diese für eine mögliche Edition der romantischen Shakespeare-Übersetzungen.
10
Katrin Henzel: Epitextuelle Bühnenanweisungen unter besonderer Berücksichtigung des Regiebuchs. In: editio 32, 2018, S. 63–81, hier S. 77.
XVI
Vorwort
Auch Katrin Henzel (Kiel) befasst sich in ihrem Aufsatz Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises mit der Frage, wie eine Edition von Übersetzungen konkret aussehen könnte und welche Besonderheiten für den ‚Schlegel-Tieck‘ hierbei zu berücksichtigen sind. Dabei gilt es zuvorderst in den Blick zu nehmen, welche philologischen Anforderungen an eine solche Ausgabe überhaupt zu stellen sind. Ferner zeigt sie, dass ein solches Unternehmen nur im digitalen Medium realisierbar ist und erörtert die mannigfachen möglichen Perspektiven auf das umfangreiche Material. Hierfür setzt sie die drei Aspekte „Intertextualität“, „das literarische Feld“ und „Performativität“ in den Fokus und diskutiert auch die Frage nach den Zielgruppen der Edition. Sie plädiert schließlich für eine „Metaedition“, in die verschiedene Einzelprojekte zu Shakespeare eingehen und die es nach Henzel erst möglich machen, das ‚kulturelle Konzept‘ Shakespeare darzustellen und zu vermitteln – und damit letztlich in Gänze verständlich machen. Claudia Bamberg und Thomas Burch (Trier) reflektieren im abschließenden Beitrag ‚Hamlet‘ – digital ediert gleichfalls und mit dem Schwerpunkt auf die Praxis die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer digitalen Edition des ‚Schlegel-Tieck‘. Am Beispiel der Hamlet-Übersetzung zeigen sie, wie eine solche Edition aussehen könnte und welche Texte hierbei Berücksichtigung finden müssen; auf der Grundlage der Diskussionen dieses Bandes entwerfen sie ein erstes Editionskonzept: Wie kann man einer digitalen Edition mit Blick auf den ‚Schlegel-Tieck‘ der Gattung ‚Übersetzung‘ am ehesten gerecht werden – welche Modifikationen gegenüber konventionellen Editionen sind nötig und wie lassen sich jene als Born-Digital-Editionen umsetzen? Welche Aufschlüsse über die jeweiligen Übersetzungsverfahren kann eine solche Edition geben? Dabei legen sie ferner dar, wie das Datenmodell konzipiert sein muss, inwiefern virtuelle Forschungsumgebungen und Editionswerkzeuge zum Einsatz kommen und zeigen in einem ersten Modell, wie Präsentation und Usability im Frontend aussehen könnten. Die Herausgeber des Bandes möchten sich bei den Institutionen und Personen, ohne die dieses Tagungs- und Buch-Projekt nicht möglich gewesen wäre, herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Der Fritz Thyssen Stiftung sei für die großzügige Förderung der Tagung gedankt, ebenso der SLUB Dresden und stellvertretend der Generaldirektorin Dr. Katrin Stump, die uns als Kooperationspartnerin herzlich willkommen geheißen hat. Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Tagung an dem Ort stattfinden konnte, an dem auch die Übersetzungsmanuskripte verwahrt werden – einen passenderen Ort hätten wir uns nicht wünschen können. Für die Einrichtung und Präsentation der Ausstellung zu den Übersetzungen aus den Beständen der SLUB danken wir herzlich Thomas Stern, Dr. Thomas Haffner und Dominik Stolz. Prof. Dr. Thomas Bürger, Generaldirektor a.D. der SLUB Dresden, gebührt unser herzlicher Dank für die so hilfund ideenreiche Unterstützung bei den Planungen für die Tagung. Der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition gilt ebenfalls unser großer Dank für die Kooperation und Winfried Woesler für die Möglichkeit, den Tagungsband in die Reihe Beihefte zu
XVII
Vorwort
editio aufzunehmen. Dem De Gruyter-Verlag und insbesondere Dr. Anja-Simone Michalski, Jessica Bartz und André Horn danken wir vielmals für die sehr gute Zusammenarbeit. Für die Einrichtung der Konferenz-Website danken wir dem Referenten für Internet-Kommunikation Joachim Drescher und für die Herstellung des Programms Lukas Norbert Schuhmann, der wie auch Valerie Grassow (alle Bamberg) bei der Einrichtung und Korrektur der Beiträge beteiligt war. Schließlich gilt unser großer Dank Carolin Geib vom Trier Center for Digital Humanities (Trier) für die stets umsichtige Redaktionsarbeit, unterstützt durch Dr. Robert Craig (Bamberg), der zudem eine große Hilfe bei der Vorbereitung der Konferenz war. Auch Jana Esser (Trier) ist herzlich zu danken, die uns besonders beim Endspurt der Bandredaktion noch zusätzlich geholfen hat.
Trier, Bamberg und Tübingen, im März 2023 Claudia Bamberg, Christa Jansohn und Stefan Knödler
Grußwort zur Tagung
Sehr geehrte Frau Professorin Jansohn, sehr geehrte Frau Dr. Bamberg, sehr geehrter Herr Dr. Knödler, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Professor Bürger, es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie alle hier in Dresden und in unserer Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) begrüßen zu dürfen. Das ist nicht einfach so dahingesagt, denn dies ist die erste wissenschaftliche Tagung, zu der ich Sie begrüßen darf. Zum 1. Mai habe ich die Leitung dieses wunderbaren Hauses übernommen, und ich versuche seitdem eine steile Lernkurve hinzulegen, um mir die außerordentliche Themenvielfalt dieser wunderbaren Bibliothek zu erschließen und zugleich ihre einzigartigen Bestände kennenzulernen. Veranstaltungen wie diese Tagung sind dafür geradezu ideale Anlässe. Unsere SLUB bewahrt seit Jahrhunderten wertvolle Bestände für die Nachwelt und die wissenschaftliche Forschung auf. Und sie hat frühzeitig – unter der Leitung ihres Generaldirektors Professor Bürger – damit begonnen, einzigartige Bestände zu digitalisieren und so weltweit für die wissenschaftliche Forschung nutzbar zu machen. Auch das Sammeln von Nachlässen hat an der SLUB Tradition: die ersten Familienarchive kamen bereits im 17. Jahrhundert in unsere Bibliothek. Heute bewahrt die Handschriftenabteilung rund 500 Nachlässe von bedeutenden Gelehrten und Personen der Literatur-, Musik- und Geistesgeschichte auf. So kam z.B. 1854 der Nachlass des bekannten Altphilologen und Chronisten der Goethezeit, Karl August Böttiger, in die Bibliothek. Bereits seit 1873 befindet sich der größte Teil des schriftlichen Nachlasses des Gelehrten, Kritikers und Übersetzers August Wilhelm Schlegel (1767–1845) in unserem Haus. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Philosophen und Schriftsteller Friedrich Schlegel, dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte und den Dichtern Ludwig Tieck und Novalis prägte er in besonderem Maße eine Epoche, die als Romantik in die Kulturgeschichte eingegangen ist. August Wilhelm Schlegel war übrigens seit 1794 häufig zu Gast in Dresden und in der Königlichen Bibliothek, die zu seiner Zeit bereits öffentlich zugänglich war. Sein Nachlass, der 1873 durch einen Ankauf ins Haus kam – die Bibliothek war zu
https://doi.org/10.1515/9783111017419-002
XX
Katrin Stump
dieser Zeit im Japanischen Palais beheimatet –, umfasst große Teile seiner Korrespondenz mit Gelehrten und Literaten seiner Zeit, Manuskripte zu Gedichten, Übersetzungen – auch von Shakespeare-Stücken – sowie Vorlesungen und Kritiken. 1945 wurde die Bibliothek bei einem Bombenangriff durch Wassereintritt in den Tiefkeller des Japanischen Palais schwer beschädigt, so dass demzufolge viele Bestände in Mitleidenschaft gezogen wurden. In den Jahrzehnten nach dem Krieg erfolgte eine Neukatalogisierung des Schlegelschen Nachlasses, der somit seit den 1980er Jahren wieder vollständig nutzbar war. 1998 konnte sein Nachlass durch eine Ersteigerung bei Christie’s in London schließlich erweitert werden um einige Korrespondenzen, die bereits 1929 in einem Schloss am Genfer See gefunden worden waren. Mit dem Aufbau des Digitalisierungszentrums der SLUB und der kooperativen Entwicklung eines Digitalisierungsworkflows auch für Nachlässe und Briefe waren schließlich die besten Voraussetzungen geschaffen für eine Erschließung des Nachlasses nach neuesten technologischen und editorischen Methoden. Das in den Jahren 2012 bis 2020 von der DFG geförderte Projekt zielte auf die Verzeichnung, Digitalisierung und Edition aller in Dresden und andernorts liegenden Briefe von und an Schlegel. Im Ergebnis sind nunmehr ca. 2.900 gedruckte Briefe, 3.400 Dresdener Schlegel-Autografen sowie Autografen aus 40 weiteren internationalen Institutionen in der Digitalen Edition recherchierbar. Der Erfolg dieser anspruchsvollen Unternehmung ist im besonderen Maß das Verdienst von Professor Jochen Strobel vom Institut für Neuere deutsche Literatur an der Universität Marburg und von Professor Thomas Bürger als damaligem Generaldirektor der SLUB, die gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum – Trier Center for Digital Humanities diese digitale Edition verantworteten. In Ihrer Tagung stehen nun die Shakespeare-Übersetzungen Schlegels im Mittelpunkt, durch die Shakespeare „zum dritten deutschen ‚Klassiker‘ avancierte“, wie es in der Tagungseinladung heißt. Neben der Diskussion um die Bedeutung der Übersetzungen innerhalb des frühromantischen Programms sowie innerhalb der literaturpolitischen Debatten um 1800 wollen Sie auch der Frage nachgehen, wie die Schlegelschen Übersetzungen heute sinnvoll historisch-kritisch ediert werden könnten, welche philologischen Anforderungen zu beachten sind und welche digitalen Verfahren verwendet werden müssen. Gerade diese Aspekte sind für unser Haus, das durch digitale Methoden und Infrastrukturen die Wissenschaft bestmöglich unterstützen möchte, von besonderem Interesse. Insofern sind wir gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Tagung, die in diesem Tagungsband festgehalten werden. Die Tagungsorganisatoren, denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte, haben für ein anregendes wissenschaftliches Programm gesorgt. Um das Rahmenprogramm hat sich Professor Bürger besonders verdient gemacht – auch ihm sei herzlich gedankt. Danken möchte ich zudem meinem Kollegen Thomas Stern, der als besonderer Kenner unserer Nachlässe die kleine Ausstellung vorbereitet hat. Ein herzlicher Dank gilt auch all meinen Kollegen, die im Hintergrund tatkräftig gewirkt haben, damit Sie sich hier vor Ort wohl fühlen und bei guten Rahmenbedingungen
Grußwort
XXI
einen konstruktiven wissenschaftlichen Diskurs pflegen können. Ich wünsche Ihnen also anregende und produktive Tage hier an unserer SLUB und in der Stadt Dresden, die sich wettertechnisch von ihrer besten Seite zeigt, so dass Sie an den anstehenden lauen Sommerabenden Ihren wissenschaftlichen Austausch an der Elbe sitzend fortsetzen können. Vielen Dank! Dresden, 13. Juni 2022
Katrin Stump
Christa Jansohn Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben Übersetzung ist eine ungenaue Wissenschaft, ein immer neu nicht zum Scheitern, aber zur Unvollkommenheit verdammter Versuch. Auf dem Weg von einer Sprache zur anderen stößt das Schiff auf Hindernisse, denen es trotzt oder die es umschifft, auf Wogen oder leicht bewegter See, Strömungen, die tragen, und Gegenströmungen. Es ist eine Überquerung mit einem Ausgangs- und einem Ankunftspunkt, aber das Dazwischen, die Reise und ihre Hindernisse, kennt nur die Person, die alle Zwischenetappen durchlaufen hat.1
1. Einführung: Besser als das Original? Shakespeare, so lautete lange ein von Gebildeten zuweilen artikulierter Topos, sei im Deutschen dank August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises besser als im Original.2 Als Beleg dafür pflegt gern der „Sein oder Nichtsein“-Monolog zitiert zu werden, besonders die Stellen, wo der Dänenprinz über die Lähmung seiner Entschlusskraft nachsinnt: And thus the native hue of resolution Is sicklyʼd o’er with the pale cast of thought; Der angebohrnen Farbe der Entschließung Wird des Gedankens Blässe angekränkelt; Hamlet, III.1.84–853
1 2
3
Cécile Wajsbrot: Nevermore. Aus dem Französischen übersetzt von Anne Weber. Göttingen 2021, S. 9. So schreibt etwa Novalis am 30. November 1797 an Schlegel: „Es gehört poetische Moralität, Aufopferung der Neigung, dazu, um sich einer wahren Übersetzung zu unterziehn – Man übersezt aus ächter Liebe zum Schönen, und zur vaterländischen Litteratur. Übersetzen ist so gut dichten, als eigne Wercke zu stande bringen – und schwerer, seltner. Am Ende ist alle Poësie Übersetzung. Ich bin überzeugt, daß der deutsche Shakespeare jezt besser, als der Englische ist.“, KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/4161 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 15.7.2022 gesehen). Zitiert nach: The Plays of William Shakspeare. Accurately printed from the text of Mr. Malone’s edition with select explanatory notes. Vol. 7. London: Printed for C. Bathurst etc 1786, hier S. 70, und: William Shakespeare: Hamlet, Prinz von Dänemark. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1800, hier
https://doi.org/10.1515/9783111017419-003
2
Christa Jansohn
Wohlklingend bringt dieser Satz, so scheint es, die tragische Empfindlichkeit des Hamlet auf den Punkt, in der sich daraufhin Generationen deutscher Grübler schmerztrunken bespiegeln konnten. In Wahrheit aber ist die Wendung mindestens ebenso „infidèle“ wie „belle“; sie ist geradezu ein Musterbeispiel, nicht nur für die sprachliche Schönheit, sondern geradezu auch für die interpretierende Einebnung, die der Wirkung des teilweise durchaus härteren, ruppigeren Shakespeare’schen Textes durch August Wilhelm Schlegels Eindeutschung zuteilgeworden ist. Ganz offensichtlich und wohl unausweichlich ist zunächst einmal die physische Konkretheit der Metapher reduziert. Der Text Shakespeares „And thus the native hue of resolution/ Is sicklyʼd o’er with the pale cast of thought“ versinnbildlicht immerhin „resolution“ als „native hue“, als frische blutvolle, d.h. gerötete Gesichtsfarbe, Zeichen des sanguinischen Temperaments, welche nun aber von „thought“ wie von weißem Verputz fahl überklatscht ist (der Ausdruck „cast“ in diesem Sinn entstammt bekanntlich dem Baugewerbe). Der Hamlet’sche Konflikt zwischen „resolution“ und „thought“ ist also verbildlicht als Gegensatz von blühendem und fahlem Antlitz, von rot und weiß, von Blut und Auszehrung, von leuchtendem Backsteinmauerwerk und trübem Verputz, von Gesundheit und Krankheit. Die dichte Gemischtheit der Metapher ist bei Schlegel auf die vergleichsweise wenig konkrete Opposition „Farbe“ / „Blässe“ und die damit verbundene Krankheitsanspielung („angekränkelt“) reduziert. Mit anderen Worten: Die Übersetzung führt die enorm suggestive Bildlichkeit auf einen allgemeineren Kern zurück und profiliert so den abstrakten Sinn – hier den Gegensatz „Entschließung“ – „Gedanke“. Bei Schlegel lässt sich eine solche Entmetaphorisierung, ein solches „abstrahierendes Verdichten“ durchgehend konstatieren;4 verglichen mit Shakespeares Text ist derjenige Schlegels also selbst von des Gedankens Blässe angekränkelt. Denn nicht nur die Metaphorik, sondern auch die sonstige stilistische Expressivität, mit der Shakespeares Text das Hamlet-Dilemma aufwirft, wird bei Schlegel eingeebnet. Das gilt für die Wortwahl, mit der Shakespeare Mehrsilbigkeit und Einsilbigkeit, und zugleich das germanische und das romanische Element der englischen Sprache, gegeneinander ausspielt – Dinge, für die nach Ausweis von Sprachmeistertraktaten seiner Zeit die Sensibilität durchaus vorhanden war. Schon die Polarität der sinntragenden Kernwörter ist so markiert: dem mehrsilbigen, romanischen „resolution“ steht die Einsilbigkeit des germanischen „thought“ gegenüber, und Entsprechendes gilt jeweils für ihre bildgenerierende Umgebung: „native hue of resolution“ – „pale cast of thought“. Der Gegensatz ist ein klanglicher: Dem durch die vorwiegend liquiden und stimmhaften Konsonanten erzeugten Wohlklang des ersten Ausdrucks steht die plosive
4
S. 105. Der Monolog in den beiden Quarto-Ausgaben (Q1, 1603), (Q2, 1604–1605) und in der First Folio (F1, 1623) sowie in acht deutschen Versionen von Christoph Martin Wieland bis Hans Rothe ist abgedruckt in: Der deutsche Shakespeare. Mit Beiträgen von Walter Muschg, Hans Schmid u.a. Basel 1965, S. 51–57. Vgl. Peter Gebhardt: A. W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257), S. 167.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
3
Härte des zweiten gegenüber. Und er manifestiert sich durch den Vers: Auf die schön regelmäßigen Jamben der einen Zeile – „And thús the nátive húe of résolútion“ – folgt die Durchbrechung des jambischen Metrums inmitten des nächsten Verses, der somit gegen den Strich gesprochen wird und zudem, anders als der vorausgehende, männlich endet: „Is sícklyʼd ó’er with the pále cást of thoúght“. Gar nichts von alledem bei Schlegel – nichts von dieser ausdrucksstarken Zuspitzung des Gegensatzes und damit des Hamlet-Dilemmas, was auch dann bedauerlich bleibt, wenn man die Grenzen des im Deutschen verfügbaren sprachlichen Materials in Rechnung stellt. Shakespeares hochdramatische Kontrastwirkung erhält durch Schlegel in beiden Versen völlig regelmäßige Jamben mit beidesmal weiblichen Versenden eine gleichförmige und sonore Würde: „Der ángebóhrnen Fárbe dér Entschliéßung/Wird dés Gedánkens Bláesse ángekränkelt“. Doch damit ist die Liste der Schlegel’schen Defekte allein bei dieser Stelle noch lange nicht erschöpft. So gut wie gar nichts vermittelt sie von der merkwürdigen KlangSinn-Ambivalenz, die sich hier bei Shakespeare einstellt. Denn paradoxerweise teilt sich ausgerechnet die Vorstellung der „native hue of resolution“, der natürlichen Entschlusskraft, in den sanfteren, weicheren, mehrsilbigen und romanischen Tönen mit, während umgekehrt das, was mit „thought“ zu tun hat, was also die Entschlusskraft morbide beeinträchtigt, hart, abrupt, peitschend, den Vers irritierend daherkommt. Natürlich sind solcherlei Klanginterpretationen immer ein wenig suspekt; die Feststellung, dass hier der Klang den Sinn infrage stellt, ließe sich zur Not auch bestreiten, wenn man die rhythmische Ebenmäßigkeit der „resolution“-Zeile als Zeichen der gesunden Norm und die Abruptheit der „thought“-Zeile als „krankhafte“ Normdurchbrechung empfinden möchte. Aber etwas Irritierendes hat die klangliche Tönung des „resolution“-„thought“-Gegensatzes allemal; sie bewirkt eine Ambiguisierung dieses Gegensatzes; ob „resolution“ durch den Klang negativiert und „thought“ entsprechend positiviert ist oder umgekehrt, ist eine offene, aber vorhandene Alternative, die zu entscheiden, wenn schon nicht dem Buchinterpreten, so doch dem Schauspieler aufgegeben ist. Denn offen bleibt in der Tat die genaue Bedeutung dessen, was mit „resolution“ einerseits und mit „thought“ andererseits genau gemeint ist, mithin auch der Sinn der Opposition von beidem und somit die Natur des von ihr bezeichneten Dilemmas. Diese ambivalente Offenheit wird auch nicht durch den rhetorischen Kontext geklärt, sondern im Gegenteil bestätigt. Die bisher zitierten zwei Zeilen hängen ja von der Hamlet-typisch verallgemeinernden Aussage des vorausgehenden Verses ab, deren Amplifikationen sie sind: Thus conscience does make cowards of us all; And thus the native hue of resolution Is sickly’d o’er with the pale cast of thought; Hamlet, III.1.83–85
Der rhetorische Zusammenhang wird durch die fast-anaphorische Wiederholung des „thus“ unterstrichen, das freilich bei Schlegel unter den Tisch fällt. Das Wort
4
Christa Jansohn
„conscience“ also ist es, was dann mit „the pale cast of thought“ amplifizierend aufgenommen wird. Nun aber ist, wie man weiß, „conscience“ bei Shakespeare semantisch nicht eindeutig; es kann sowohl „Gewissen“ als auch „Bewusstsein“ bedeuten. Mit anderen Worten kennzeichnet „conscience“ (und dementsprechend das sinnparallele „pale cast of thought“) einen Hamlet, dessen „resolution“ entweder durch moralische Skrupel oder aber durch intellektuelle Reflexion beeinträchtigt wird. Der ShakespeareText lässt die Entscheidung (für einen moralisch-sensiblen oder einen intellektuellmorbiden Hamlet) durchaus offen,5 und die Offenheit wird durch die vorhin konstatierte anschließende Sinn-Laut-Ambivalenz noch vermehrt. Schlegels Wiedergabe „So macht Gewissen Feige aus uns allen“ – auch wenn sie von der usuellen modernen Bedeutung von „conscience“ diktiert sein mag und Schlegel die Ambiguität gar nicht gesehen hat – beseitigt die Offenheit des Textes, lenkt die Interpretation – und verzichtet auf die daraufhin entbehrliche Sinn-Laut-Ambivalenz der Zeilen 84–85. Vom Verständnis von „conscience“ und des damit parallelisierten „thought“ hängt nun aber auch das des Gegenbegriffs „resolution“ ab. Setzt man bei „conscience“ bzw. „thought“ einen moralischen Akzent (im Sinne von ‚schlechtes Gewissen‘, ‚Skrupel‘), so müsste der sich auf ein moralisch negativ verstandenes „resolution“ (etwa im Sinne von unkontrollierter Überheblichkeit) beziehen. Fasst man dagegen „conscience“ und „thought“ als moralisch neutral auf (als ‚Bewusstsein‘, ‚Mitwissen‘, ‚reflektierendes Nachdenken‘), so wäre auch „resolution“ nichts Anstößiges. Eindeutigkeit lässt sich aber auch darin dem Text nicht abringen, wie die nachfolgenden drei Verse bezeugen: And enterprizes of great pith and moment, With this regard, their currents turn awry, And lose the name of action. – […] Hamlet, III.1.86–88
Denn dies ist ja nochmals eine amplifizierende Variation des Ausgangsgedankens. „Conscience“ wird neutral mit „this regard“ aufgenommen, während nun „resolution“ durch „enterprizes“ und „action“ näher definiert und in etwa zu dem Sinn „entschlossen handelnde Tatkraft“ gebündelt wird. Indes, der Zusatz zum Wort „enterprizes“ – „enterprizes of great pith and moment“ erzeugt wiederum Ambivalenz; „pith“ suggeriert eher stolz-hochfliegende Überheblichkeit; „moment“ suggeriert eher solide Wichtigkeit. Freilich beruht die Ambivalenz in diesem Fall auch auf der unsicheren Textüberlieferung: „pitch“ (Höhe) ist die heute allgemein akzeptierte Lesart des zweiten Quarto (1604), wo die First Folio (1623) „pith“ (Wichtigkeit) hat,6 was mit „moment“ besser 5
6
Hierzu die anregenden Ausführungen von Maximilian Schell: …Deutschland ist nicht Hamlet. Probleme der Übersetzung und Interpretation aus der Sicht des Praktikers. In: Deutsche Shakespeare-Gesellschaft West. Jahrbuch 1982, S. 10–26, hier S. 21f. Hierzu vgl. die Anmerkung III.1.85 zu „pitch“ in der Arden-Ausgabe (Third Series) von Hamlet. Hrsg. von Ann Thompson and Neil Taylor. London 2006: „pitch: height, scope […] the 1676, 1683, 1695 and
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
5
harmonisieren würde und der Schlegel’schen Übersetzung zugrunde lag. Doch für die Ambiguisierung des „resolution“/„enterprizes“/„action“-Komplexes ist außerdem durch die Einkleidung seines Sinnes in die „currents“-Metapher gesorgt, die die ohnehin gemischte Metaphorik der Stelle noch weiter verkompliziert: Die Behinderung von Tatkraft durch „thought“ ist wie die Irreleitung einer Strömung („their currents turn awry“). „Currents“ aber können bei Schlegel einerseits kräftige natürliche Meeresströmungen sein, etwa die Gezeiten (vgl. Julius Caesar, IV.3.221); andererseits hat Hamlet selbst gerade von „a sea of troubles“ (III.1.59) gesprochen, und wenig später gebraucht Claudius das „currents“-Bild zur Kennzeichnung des verfaulten, ausgehöhlten Zustands der Welt, „the corrupted currents of this world“, dem er seine Schuld zuordnet (III.3.57). Kurz, der „resolution“/„enterprises“/„action“-Komplex ist ebenso wenig eindeutig wie der ihm entgegenstehende „conscience“/„thought“-Komplex. In der deutschen Übersetzung aber erscheint das eine ebenso disambiguiert wie das andere: Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, Verlieren so der Handlung Namen. – […] Hamlet, III,1.86–88
Bei Schlegel erhält also die im Quarto-Text offene Wendung „of great pitch and moment“ wegen der Folio-Lesart heroische Eindeutigkeit; die ambivalente „currents“-Metapher entfällt zusammen mit dem Rest der sinnfälligen Metaphorik. An unserem Beispiel lässt sich Folgendes resümieren: Die bei Schlegel angeblich besser als im Original gelungene Hamlet-Stelle – und sie ist für Schlegels Übersetzungspraxis durchaus charakteristisch – hat zu einer ganz erheblichen Reduktion des Originals geführt: Auf der Strecke geblieben sind die assoziative Komplexität der gemischten Metaphorik, die dramaturgisch effektive Nervosität der Verse, die klangliche Zuspitzung und gleichzeitige Infragestellung der zentralen Sinnopposition und schließlich ein Gutteil der Ambiguität und Interpretationsoffenheit. Dies ist ein hervorstechendes Charakteristikum sowohl der Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und des Tieck-Kreises wie auch von anderen späteren Übersetzern, die dazu neigen, die Offenheit für alternative Interpretationen fest zu schließen.7 Dabei verblassen besonders in literarisch ambitionierten Übersetzungen die eingeschriebenen Regiesignale oftmals stark, welche von der metaphorischen, stilistischen, klanglichen und rhythmischen Orchestrierung des englischen Textes ausgehen. So moniert Hans Rothe zu Recht, dass in der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung die Dramen Shakespeares „von der offenen in die geschlossene Form überführt [wurden]“; und es war – so der Theaterpraktiker und Übersetzer –, vor allem die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft, die mit ihrer Favorisierung der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung den „Anspruch der
7
1703 Quartos ‘have, contrary to their custom’ followed F in reading ‘pith’ (meaning importance, gravity) here, ‘which may possibly indicate that “pith” was the reading according to the stage tradition’“. Vgl. hierzu Hans Rothe: Shakespeares offene Form. In: Ders.: Shakespeare als Provokation. Sein Leben und sein Werk. Sein Theater und seine Welt. Seine Freunde und Feinde. München 1961, S. 185–189.
6
Christa Jansohn
Endgültigkeit“ proklamierte, sich gegenüber den Vorwürfen der Fehlerhaftigkeit, der Bühnenferne und der überholten Romantik erfolgreich behauptete und somit ihre Dauerhaftigkeit durchzusetzen versuchte. In seinem Beitrag Friedrich Theodor Vischer und die deutsche Shakespeare-Rezeption im 19. Jahrhundert fasst Werner Habicht diese Entwicklung wie folgt zusammen: […] Geriet doch der ‚Schlegel-Tieck Shakespeare‘, so sehr er sich schon gegen etliche Konkurrenzübertragungen durchgesetzt hatte, in den 1860er-Jahren erneut in die Kritik. Er galt nun als zu romantisch, als zu undurchsichtig im Ausdruck, auch als fehlerhaft. Dem wurde mit teils revidierten Ausgaben, teils glättenden Neuübersetzungen entgegengewirkt. Das betraf weniger die um 1800 von August Wilhelm Schlegel mit formaler Treue übersetzten Stücke (darunter, nebst Romeo und Julia und Hamlet, alle englischen Geschichtsdramen), wohl aber die danach von Tieck verantworteten Übersetzungen durch dessen Tochter und Wolf Graf Baudissin. Ihnen gilt auch Vischers besondere Missbilligung. So sind ihm Dorothea Tiecks Übersetzungen von Macbeth oder Coriolan zu nahe am Ausgangstext und deshalb „ungenießbar“; für das erstere Drama bemüht er sich um eine eigene revidierende Neuübersetzung, für das letztere benützt er die Übertragung von Adolf Wilbrandt. Baudissins Antonius und Kleopatra-Übersetzung, die ihm „in ihrem befangenen Anschluss an das Original unerträglich hart“ dünkt, verbessert er mit Hilfe derjenigen von Paul Heyse. Keine jener Neuübersetzungen freilich hat, anders als der alte ‚Schlegel-Tieck‘, das 19. Jahrhundert überdauert.8
Schon ein isoliert betrachtetes Beispiel wie das obige kann an einige der üppigen Probleme heranführen, derentwegen die Geschichte der deutschen Shakespeare-Übersetzung zwar oft genug impressionistisch skizziert und punktuell illustriert worden ist, aber der umfassenden Darstellung auf der Grundlage empirischer Analysen und im Kontext der Rezeptionsbedingungen weiterhin harrt. Die Schlegel-Tieck-Ausgaben überlebten freilich auch noch das 20. Jahrhundert und bis auf den heutigen Tag findet man sie auf dem Buchmarkt, wobei es sich fast ausschließlich um überarbeitete Ausgaben oder schlicht um Nachdrucke handelt, ganz nach der Devise Thomas Walkleys in seinem Begleitschreiben zur Quarto-Ausgabe von Othello (1622): „the Authors name is sufficient to vent his worke“. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Forschung mit der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung heute kaum mehr beschäftigt, wie dies die im April 2019 von der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft durchgeführte Jahrestagung zum Thema „Shakespeare und Übersetzung“ suggeriert, welche sich weder kritisch mit den von ihr einst favorisierten Übertragungen noch mit deren Rezeptionsgeschichte auseinandersetzte.9 Indes 8
9
Werner Habicht: Friedrich Theodor Vischer und die deutsche Shakespeare-Rezeption im 19. Jahrhundert. In: Friedrich Theodor Vischer. Leben – Werk – Wirkung. Hrsg. von Barbara Potthast und Alexander Reck. Heidelberg 2011 (Beihefte zu Euphorion. Zeitschrift für Literaturwissenschaft. 61), S. 119– 135, hier S. 133. Eine Auswahl der Konferenzbeiträge ist abgedruckt im Shakespeare Jahrbuch 156, 2020. Das Shakespeare Jahrbuch 92, 1956, versammelt zahlreiche Abhandlungen zum Themenkomplex „Übersetzung“;
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
7
liegen zur Shakespeare-Rezeption in Deutschland eine Reihe vorzüglicher Studien ausländischer Kollegen vor, allen voran Roger Paulins und Christine Rogers wegweisende Arbeiten.10 Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, einige Forschungsfelder kurz vorzustellen, welche bei der Diskussion um die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises bisher zu wenig berücksichtigt wurden: – – – –
Die bibliographische Bestandsaufnahme Dokumentation der Instabilität der ausgangssprachlichen und zielsprachigen Texte Der Shakespeare-Kanon Zur Überlieferungsgeschichte
Die Erforschung dieser Themen verlangt aufgrund ihrer Diversität oft unterschiedliche Kompetenzen, etwa bibliographische und literaturwissenschaftliche aus der Anglistik, Germanistik, Vergleichenden Literaturwissenschaften, Theaterwissenschaften, der praktischen Theaterarbeit, der Buch- und Verlagsgeschichte sowie der Editionswissenschaft und der Digital Humanities. Auch wird zu berücksichtigen sein, dass außer der sprachlichen Kompetenz der Übersetzer auch andere Fragestellungen Berücksichtigung finden müssen,11 zumal die Untersuchung der deutschen Versionen August Wilhelm Schlegels und Dorothea Tiecks sowie Wolf Graf von Baudissins12 sowie der Rolle Caroline Schlegels bei den Korrekturen gleichermaßen bestimmt wurde durch die Überlieferungsgeschichte ihrer Arbeiten sowie durch die unterschiedlichen englischen Vorlagen und den daraus resultierenden wissenschaftlichen und literaturästhetischen Erkenntnissen, die sich seit Beginn der Übersetzungsarbeit durch Schlegel bis zur Fertigstellung durch den Tieck-Kreis rasant entwickelten und unterschiedlich in deren Übersetzungen und Revisionen einflossen.
10
11
12
informativ sind u.a. die Beiträge von: Siegfried Korninger: Shakespeare und seine deutschen Übersetzer, S. 19–44; Käthe Stricker: Deutsche Shakespeare-Übersetzungen im letzten Jahrhundert (etwa 1860–1950), S. 45–89; Irmentraud Candidus und Erika Roller: Der Sommernachtstraum in deutscher Übersetzung von Wieland bis Flatter, S. 128–146. Roger Paulin: The Critical Reception of Shakespeare in Germany: 1682–1914. Native Literature and Foreign Genius. Hildesheim 2003; Christine Roger: La réception de Shakespeare en Allemagne de 1815 à 1850. Propagation et assimilation de la référence étrangère. Bern 2008. Vgl. auch: Simon Williams: Shakespeare on the German Stage. Volume I: 1586–1914. Cambridge 1990, sowie: Shakespeare as German Author. Reception, Translation Theory, and Cultural Transfer. Hrsg. von John A. McCarthy. Leiden 2018. Vgl. hierzu u.a. die Beiträge in dem vorliegenden Band von Stefan Knödler, Roger Paulin und dem Autorenteam Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann. Zu Baudissin vgl. den Werkindex und Dorothea Tiecks Briefe (im Original und Transkription), in denen er erwähnt wird: Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800, https://www.berliner-intellektuelle.eu/entity?p2323+de, sowie die Dissertation von Bernd Goldmann: Wolf Heinrich Graf Baudissin. Leben und Werk eines großen Übersetzers. Hildesheim 1981, und hier bes. zu den ShakespeareÜbersetzungen S. 119–133; John Sayer: Wolf Graf Baudissin (1789–1878). Sein Leben – seine Zeit. Ein Übersetzen. Berlin 2015, bes. S. 93–109; und Roger Paulins Beitrag in diesem Band.
8
Christa Jansohn
Extern wirkte auf die Shakespeare-Übersetzung im 19. Jahrhundert und die zahlreichen Schlegel-Tieck-Revisionen auch die Entwicklung des Textverstehens ein. So wissen wir, dass Tieck das Wörterbuch A Compleat Vocabulary, English and German (1757) von Theodor Arnold (1683–1771), extensiv benutzte.13 Mit insgesamt fünf Auflagen erfreute es sich großer Beliebtheit, weshalb man Theodor Arnold, Lexikograf und Übersetzer in Leipzig, zu Recht „zu den bedeutendsten deutschen Mittlern der englischen Kultur in der deutschen Aufklärung“ zählen kann.14 Dazu kommen im Laufe des 19. Jahrhunderts weitere Speziallexika, wie etwa die von Nicolaus Delius15 und Alexander Schmidt16 und nicht zuletzt das seit 1884 immer wieder neu aufgelegte Oxford English Dictionary (OED). Neuere Grammatiken und Konkordanzen des späten 19. Jahrhunderts ermöglichten weitere systematische Einsichten, engten freilich auch die Übersetzerphantasie ein.17 Die Kenntnisnahme philologischer Funde hatte bei den translatorischen Arbeiten gewiss zu Sensibilisierungen etwa für Polysemien, Sinnalternativen und mitschwingenden Nebenbedeutungen im Shakespeare’schen Sprachgebrauch geführt. Als berühmtes Beispiel gilt hier Gertrudes Äußerung über Hamlets körperliche Verfassung nach dem Kampf, welche im englischen Text mit „Heʼs fat, and scant of breath“ (V.2.274) umschrieben und bei Schlegel mit „Er ist fett und kurz von Athem“ wiedergegeben wird. Der Nachweis bei Hamlet, dass „fat“ den Sinn „schweißgebadet“ haben kann,18 hat die 13 14
15
16
17
18
Vgl. den Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann in diesem Band. Hierzu Jennifer Willenberg: Arnold (Pseud. Aldinor), Theodor. In: Sächsische Biografie. Hrsg. vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V., http://www.isgv.de/saebi/. Nicolaus Delius: Shakspere-Lexikon. Ein Handbuch zum Studium der Shaksperischen Schauspiele. Bonn 1852. Alexander Schmidt: Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary. A Complete Dictionary of All the English Words, Phrases, and Constructions in the Works of the Poet. 2 Vols. Berlin and London 1875. Schmidts Lexikon, von Georg Reimer und dem britischen Verleger Williams & Norgate gemeinsam herausgegeben, wird auch heute noch mangels Alternativen in der internationalen Shakespeare-Forschung zu Rate gezogen. Einen guten Überblick bieten: Friederike Klippel: Englischlernen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Geschichte der Lehrbücher und Unterrichtsmethoden. Münster 1994, und Rita Seifert: Englischunterricht im Deutschland des 18. Jahrhunderts. In: „Shakespeare, so wie er ist“. Wielands Übersetzung im Kontext ihrer Zeit. Hrsg. von Peter Kofler. Heidelberg 2021 (Wieland im Kontext. Oßmannstedter Studien. 7), S. 218–239, bes. S. 232–239 zu Lehrbüchern, Grammatiken und Wörterbücher. Vgl. hierzu den ausführlichen Kommentar zu „fat“ in: A New Variorum Edition of Shakespeare. Hrsg. von Horace Howard Furness. Vol. I: Text. Tenth Edition. Philadelphia [1877], S. 446. Auf dieser Grundlage kommentiert Alois Brandl in seiner Ausgabe: „Hot (wohl richtiger als das übersetzte fat) und short of breath, heiß und außer Atem“, lässt aber die Originalübersetzung Schlegels stehen, während Schücking in seiner Ausgabe zu „Er ist in Schweiß und außer Atem“ korrigiert, ohne dies in seiner Einzelausgabe des Dramas eigens in seinen Anmerkungen zu erläutern. Vgl. Shakespeare’s Dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Hrsg. von Alois Brandl. Leipzig und Wien 1897–1899 (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden). Bd. 4, S. 261, Anm. 1. William Shakespeare: Hamlet. Englisch und deutsch. Mit Einleitung und Anmerkungen. Hrsg. von L.L. Schücking. Leipzig 1941 (Sammlung Dieterich. 82), S. 339. Im „Vorwort“ heißt es, es sei „versucht worden, die Ergebnisse der Forschung, die sich namentlich im letzten Jahrzehnt so eingehend mit den Fragen der Überlieferung des Hamlet-Textes beschäftigt hat, in vorsichtiger Weise zur Herstellung eines Wortlauts
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
9
Vorstellung von der feisten Konstitution des Dänenprinzen zwar nicht ganz ausgeräumt,19 so doch relativiert. Nicht von ungefähr haben sich denn auch sowohl Neuübersetzungen bzw. grundlegende Revisionen der Schlegel-Tieck-Version, wie etwa die von Alois Brandl (1855–1940), Hermann Conrad (1845–1917) und Wolfgang Keller (1873–1943),20 als auch Übersetzungsanalysen mit besonderer Hingabe der auf Polysemien beruhenden, offenen oder verdeckten, harmlosen oder hintergründigen Shakespeare’schen Wortspieleffekte angenommen, vor denen Schlegel und der Tieck-Kreis (oft freilich aus Anstand) absichtsvoll kapitulierten. Schließlich wäre darüber hinaus genauer die Rolle Ludwig Tiecks zu untersuchen,21 dann der Verleger Johann Friedrich Unger (1753–1804) und Johann Friedrich Cotta (1764–1832)22 und insbesondere die Bedeutung Georg Andreas Reimers (1776–1842), ohne dessen „zähes Festhalten an dem einmal gefaßten Plan, die Schlegel’sche Übersetzung in seinem Verlag weiterführen zu lassen“, das Projekt voraussichtlich nie zu Ende geführt worden wäre.23 Auch ein Blick auf die Konkurrenz-Verlage bestätigt den nicht gerade zimperlichen Umgang der Mitstreiter, die sich durch Schlegels allzu schleppende Fertigstellung seiner Shakespeare-Übersetzungen geradezu angespornt fühlten, Konkurrenz-Ausgaben – wie etwa die Voßʼschen Übertragungen – zügig auf den Markt
19 20
21
22
23
auszuwerten, der der Niederschrift des Dichters möglichst nahe zu kommen sucht. Für die Übersetzung stand nur Schlegels klassische Fassung zur Wahl. […] sie ist so wenig wie möglich angetastet worden […]“, Vorwort, S. vii–viii, hier S. vii. Hierzu Schell 1982 (Anm. 5). S. 25. Hansjürgen Blinn und Wolf Gerhard Schmidt: Shakespeare – deutsch. Bibliographie der Übersetzungen und Bearbeitungen. Zugleich Bestandsnachweis der Shakespeare-Übersetzungen der Herzogin-AnnaAmalia-Bibliothek Weimar. Berlin 2003, Eintrag: C 1050 (Brandl, 10 Bde., 1897–1899), C 1140 (Conrad, 5 Bde. [1905]) und C 1210 (Keller, 5 Bde. 1912). Hierzu kürzlich: Theresa Mallmann: Von der Hörbühne am Altmarkt zum „Theater der Dichtung“. Ludwig Tieck und Karl Kraus als Shakespeare-Vorleser im 19. und 20. Jahrhundert. Dresden 2021 (TieckStudien. 4). Unbedingt einer weiteren Untersuchung wert sind „Tiecks Anmerkungen zu Shakespeares dramatischen Werken“ (NL-Tieck 15) und ggf. auch zu „Shakespeares Sonette“ (NL-Tieck 16). In: Der handschriftliche Nachlass Ludwig Tiecks und die Tieck-Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Katalog. Bearbeitet von Lothar Busch. Wiesbaden 1999, S. 65f. Zu Cotta vgl. den entsprechenden Abschnitt „Shakespeare heimatlos“. In: Stefan Knödler und Claudia Bamberg: Der Briefwechsel zwischen August Wilhelm Schlegel und Johann Friedrich Cotta. In: Archiv für die Geschichte des Buchwesens 74, 2019, S. 106–108. Vgl. Doris Reimer: Reimer als Verleger romantischer Literatur. In: Dies.: Passion & Kalkül: Der Verleger Georg Andreas Reimer (1776–1842). Berlin 1999, S. 253–419, hier S. 261. Besonders wichtig ist der separate Abschnitt zu „Shakespeare“, S. 316–325. Vgl. auch: Doris Reimer: „der ich nie mich im Handel und dergleichen zu benehmen wußte“. Ludwig Tiecks Beziehung zu seinem Berliner Verleger Georg Andreas Reimer. Eine Analyse anhand der Reimerschen Hauptbücher. In: „lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn! –“. Ludwig Tieck (1773–1853). Hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin unter Mitarbeit von Heidrun Markert. Bern u.a. 2004 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge. 9), S. 277–296, hier S. 259–276.
10
Christa Jansohn
zu bringen.24 Hier steht bis heute ein Vergleich der Absatzzahlen aus, die konkrete Hinweise auf die Popularität der diversen Shakespeare-Ausgaben geben könnten. In diesem Kontext wären auch Ulrich Suerbaums Thesen unbedingt erneut zu hinterfragen, zumal mittlerweile fünfzig Jahre seit seiner Zwischenbilanz vergangen sind. 1972 machte er als „sichtbarste[s] Hemmnis für einen Neuansatz“ im 20. Jahrhundert die Schlegel-Tieck-Übersetzung verantwortlich, „deren Einfluß so stark ist, daß wohl die meisten unbefangenen Leser einen Großteil der modernen Übersetzungen nicht ins 20. Jahrhundert datieren würden.“ Auch habe das Theater durch seine zögerliche Haltung, wirklich neue deutsche Versionen zu spielen, dazu beigetragen, dass sich die alten so beharrlich hielten.25 Darüber hinaus wurde bisher der 1864 gegründeten Deutschen Shakespeare-Gesellschaft zu wenig Beachtung geschenkt. Diese favorisierte zwar bis weit ins 20. Jahrhundert fast einhellig die Schlegel-Tieck’sche Übersetzung, überarbeitete aber seit 1867 in regelmäßigen Abständen teils grundlegend die Texte26 und trug so zur Flut von revidierten Schlegel-Tieck-Editionen bei, die man grob unterteilen kann in dilettantische LiebhaberAusgaben, einfache Lese- und Schulausgaben, Studienausgaben, illustrierte Editionen, Bühnen- und Familienausgaben bis hin zum Versuch einer historisch-kritischen Ausgabe. Gerade eine systematische Untersuchung der diversen Editionstypen sollte in Zukunft auf der Agenda der Schlegel-Tieck-Forschung stehen.27 Wenn bereits 1964 der renommierte Münchner Anglist Wolfgang Clemen (1909–1990) in seinem Beitrag Wo stehen wir in der Shakespeare-Forschung? feststellt, dass eine „Aufzählung der verschiedenen Gebiete und Probleme, mit denen sich die Shakespeare-Wissenschaft befaßt hat und noch heute beschäftigt, […] fast einem Katalog aller Methoden und Fragenstellungen [gleicht], die zur Philologie im weitesten Sinne überhaupt gehören“,28 so kann man dies auch für unseren Forschungsgegenstand konstatieren. Das macht die Schwierigkeit und gleichzeitig seinen Reiz aus.
24
25
26
27
28
Am Beispiel der Voßʼschen Übersetzungen zeigt dies Christine Roger: Der deutsche und der fremde Shakespeare. Die Voß’sche Shakespeare-Übersetzung im Kontext ihrer Zeit. In: Voß’ Übersetzungssprache. Voraussetzungen, Kontexte, Folgen. Hrsg. von Anne Baillot, Enrica Fantino und Josephine Kitzbichler. Berlin, Boston 2015, S. 113–124, hier S. 119f., und Lesley Drewing: Die ShakespeareÜbersetzung von Johann Heinrich Voß und seinen Söhnen. Eutin 1999. Ulrich Suerbaum: Shakespeare auf deutsch – Eine Zwischenbilanz. In: Deutsche Shakespeare-Gesellschaft West. Jahrbuch 1972. Hrsg. im Auftrage der Gesellschaft von Hermann Heuer u.a., S. 42–66, hier S. 60. Beispiele aus dem 19. Jahrhundert führen an: Philipp Ajouri und Christa Jansohn: Shakespeare-Ausgaben der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1867 bis zur Jahrhundertwende. In: IASL (Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur), 45, 2020, Bd. 2, S. 386–396. Zum Spektrum der Editionstypen vgl. Bodo Plachta: Editionswissenschaft. Handbuch zu Geschichte, Methode und Praxis der neugermanistischen Edition. Stuttgart 2022, S. 11–27. Wolfgang Clemen: Wo stehen wir in der Shakespeare-Forschung? In: Shakespeare Jahrbuch 100, 1964, S. 135–148, hier S. 135.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
11
2. Die bibliographische Bestandsaufnahme Wer sich die Übersetzungs- sowie Theater- und damit oft gleichzeitig die Editionsgeschichte des Schlegel-Tieck’schen Shakespeares kometengleich vorstellen will, hat es mit einem nicht nur ganz enormen, sondern auch diffus komplizierten Schweif zu tun, der zudem von keinem festen Kern ausgeht. Tatsächlich wirft die Kometenbetrachtung genügend Probleme auf, für deren Lösung zum Teil noch die Voraussetzungen fehlen. Schwierigkeiten macht erstens schon die Identifizierung der Schweif-Komponenten, d. h. die bibliographische Bestandsaufnahme: Dass die Bibliographie literarischer Übersetzungen aus dem Englischen überhaupt im Argen liegt, ist keine Neuigkeit. Dass davon auch Shakespeare betroffen ist, liegt indes auch in der Natur des Textmaterials selbst. Deutsche Shakespeare-Ausgaben besonders des 19. Jahrhunderts sind oft undatiert; Neuauflagen sind stillschweigend geändert; Einzelwerk-Übersetzungen verschiedener Herkunft sind in unterschiedlichen Zusammenstellungen zu Gesamtausgaben gebündelt. Namentlich von der Schlegel-Tieck-Übertragung sind die Interrelationen der zahlreichen Nachdrucke, der Prachtausgaben und Volksausgaben, der durchgesehenen, philologisch revidierten, theatergerecht arrangierten und familientauglich expurgierten Editionen nur schwer und jedenfalls nicht ohne aufwendige Autopsie zu entwirren. Dazu kommen die vielen älteren und neueren Theaterübersetzungen, die, bibliographisch kaum fassbar, bei Bühnenverlagen, in Dramaturgien und zuweilen in verbrauchten Programmheften, Theatersammlungen und anderen Archiven schlummern, wie dies zum Beispiel eine kurze Recherche im Archiv der Digitalen Bibliothek bestätigt.29 Erste Versuche einer deskriptiven Bestandsaufnahme u.a. von Ernst Balde, Paul Hermann Sillig und Rudolph Genée stammen aus den Jahren 1852, 1854 und 1870.30 Sie wurden durch die Jahresbibliographien im Jahrbuch der Deutschen ShakespeareGesellschaft zunächst kompetent und kontinuierlich,31 dann eher eklektisch weitergeführt. Diese Bibliographien gründlich zu erneuern und fortzuschreiben, stand vor zwanzig Jahren im Mittelpunkt der Arbeit von Hansjürgen Blinn, was ob der Fülle an Übertragungen kein leichtes Unterfangen war.32 Zudem wurden durch die Fokussierung auf 29 30
31
32
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/journal/archiv/. [Ernst Balde]. Die Shakspeare-Literatur in Deutschland: Vollständiger Catalog sämmtlicher in Deutschland erschienenen Uebersetzungen Shakspeares sowohl in Gesamt- als Einzel-Ausgaben […]. Von 1762 bis Ende 1851. Supplement zu allen Uebersetzungen und Erläuterungsschriften W. Shakspear’s. Cassel 1852; Die Shakespeare-Literatur bis Mitte 1854. Zusammengestellt und hrsg. von P. H. Sillig. Ein bibliographischer Versuch eingeführt von D. H. Ulrici. Leipzig 1854 und Rudolph Genée: Geschichte der Shakespeare’schen Dramen in Deutschland. Leipzig 1870. Besonders gut: Gisbert Freiherr von Vincke: Zur Geschichte der deutschen Shakespeare-Uebersetzungen. In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 16, 1881, S. 254–273, und: Gesamtverzeichnis für die Bände 1–99 des Shakespeare Jahrbuchs. Hrsg. im Auftrage der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft West von Hermann Heuer, Ernst Theodor Sehrt und Rudolf Stamm. Bearbeitet von Marianne Rohde. Heidelberg 1964. Blinn/Schmidt 2003 (Anm. 20). Diese Bibliographie stellte eine Ergänzung einer früheren dar, und zwar von: Hansjürgen Blinn: Der deutsche Shakespeare. Eine annotierte Bibliographie zur Shakespeare-Rezeption des deutschsprachigen Kulturraums (Literatur, Theater, Film, Funk, Fernsehen, Musik und bildende Kunst). Berlin 1993.
12
Christa Jansohn
die vorhandenen Übertragungen der 1864 in Weimar gegründeten Shakespeare-Bibliothek, die mittlerweile Teil der Anna Amalia Bibliothek ist,33 weitere wichtige Bibliotheksbestände außer Acht gelassen: Besonders der Katalog des Theatermuseums der Universität Köln, die Theaterstückesammlung Pfetten der Universitätsbibliothek München, die Shakespeariana der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart,34 der Bestand in der Österreichischen Nationalbibliothek sowie die Kataloge der British Library, London, der Folger Shakespeare Library, Washington, D.C., der Shakespeare Bibliotheken in Stratford-upon-Avon und der Birmingham Shakespeare Memorial Library sowie die World Shakespeare Bibliography Online35 würden weitere fehlende Übersetzungen, Bearbeitungen und Sekundärliteratur zu Tage fördern. Eine annotierte Bibliographie sowohl aller Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises als auch ihrer Verarbeitungen ist demnach immer noch ein Desiderat.
3. Dokumentation der Instabilität der ausgangssprachlichen und zielsprachigen Texte Zu den notwendigen und noch fehlenden Grundlagen gehört darüber hinaus die Dokumentation der Instabilität der ausgangssprachlichen und zielsprachigen Texte. Zu wissen, welche englische Shakespeare-Edition (oder -Editionen) welcher Übersetzung zugrunde liegt, ist, eingedenk substantieller und nicht substantieller Textunterschiede und unterschiedlicher Konjekturfreude bei den einzelnen Ausgaben, im dringenden Interesse objektiver Übersetzungsvergleiche. Dies umso mehr als hinter den Textunterschieden sich wandelnde Editionsprinzipien und Texttheorien stehen.36 Es ist auch für die jeweilige Übersetzung relevant, ob, wie bis ins 19. Jahrhundert, die Erste Folio (1623) als Basistext für Ausgaben galt, oder ob, wie bis Mitte des 20. Jahrhunderts, durch 33
34
35 36
Michael Knoche: Das andere Weimarer Shakespeare-Denkmal. Die Bibliothek der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. In: Weimar Kultur Journal, April 1993, S. 30f., und die Bestandsbeschreibung von Werner Habicht: Shakespeare-Bibliothek. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa. Hrsg. von Bernhard Fabian. Digitalisiert von Günter Kükenshöner. Hildesheim 2003, https://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Herzogin_Anna_Amalia_Bibliothek. So auch Schreiber, der in seiner 12-seitigen Besprechung einige interessante Beispiele anführt. Vgl. Klaus Schreiber: Übersetzungen in Deutsche. In: Informationsmittel (IFB): Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft 12:1, 2004, o. S., https://swbplus.bsz-bw.de/cgi-bin/result_rekla.pl?item=qs&mode=source&eid=IFB_04-1_151. http://www.worldshakesbib.org/. Einen sehr guten und konzisen Überblick mit weiterführender Literatur bietet: Suzanne Gossett: Shakespeare and Textual Theory. London 2022. Vgl. auch: Andrew Murphy: Shakespeare’s Editors from the Eighteenth to the Twenty-First Century. In: The Arden Research Handbook of Shakespeare and Textual Studies. Hrsg. von Lukas Erne. London 2021, S. 168–187, und Marcus Walsh: Editing and publishing Shakespeare. In: Shakespeare in the Eighteenth Century. Hrsg. von Fiona Ritchie and Peter Sabor. Cambridge 2012, S. 21–40, sowie die Beiträge in: Reading Readings. Essays on Shakespeare Editing in the Eighteenth Century. Hrsg. von Joanna Gondris. Madison 1998.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
13
Rückschlüsse aus allen divergenten Originaldrucken (also Quartos und Folios) die Rekonstruktion des idealen Originals (eines vom Autor gewollten Originals) erstrebt wurde, oder aber ob die Originaltextdivergenzen als Symptom einer tatsächlichen instabilen Offenheit der Textgestalt selbst gesehen werden. Mit dem bewussten oder unbewussten Niederschlag der Textauffassung der benutzten Ausgabe(n) auf die Übersetzung ist durchaus zu rechnen. Schon zwischen Wieland, Eschenburg sowie Schlegel und dem Tieck-Kreis sind, wie man weiß, Übersetzungsunterschiede zum Teil dadurch bedingt, dass der eine Alexander Popes rationalistische, der zweite Steevensʼ (1773) kompilatorische und Schlegel Malones im Ansatz historisch-kritische Edition zugrunde legte,37 während sich Dorothea Tieck und Wolf Heinrich Graf Baudissin weiterer Ausgaben aus Ludwig Tiecks Bibliothek bedienen konnten.38 Dieser besaß im Gegensatz zu Schlegel eine viel umfangreichere Bibliothek, u.a. mit Ausgaben von Samuel Johnson und George Steevens (1778, 1785, 1793, 1800). Als Arbeitsexemplar für die Übersetzung gilt indes die 23-bändige Edition von Johann Jakob Tourneisen, zumal sie die meisten Lesespuren und Randmarginalien aufweist.39 Der Bücherbestand Schlegels und des Tieck-Kreises bestimmte bzw. förderte demnach auch die unterschiedliche Arbeitsweise, wie Roger Paulin prägnant formuliert: […] [M]an kann davon ausgehen, dass Schlegel und Caroline die Shakespeare-Übersetzung mithilfe von lediglich zwei annotierten Ausgaben und den Lexika von Johnson und Arnold geleistet haben. Schlegel steht hierin in denkbar starkem Gegensatz zu Eschenburg und Tieck, deren Ausrichtung historisch-kritisch war (‚höhere Kritik‘, wenn man will), Schlegels dagegen rein sprachlich. 40
37
38
39
40
Hierzu Schlegels „Vorerinnerung“ in der von Johann Friedrich Unger publizierten Ausgabe: Shakspeareʼs dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1997, S. III–VI, hier S. V: „In Ansehung des englischen Textes habe ich mich hauptsächlich an eine Ausgabe: London 1786 [d.i. The plays of William Shakspeare. Accurately printed from the text of Mr. Maloneʼs edition. With select explanatory notes. London 1786], gehalten, worin er aus der Malone’schen abgedruckt ist, zugleich aber auch die ältere Ausgabe von Johnson und Steevens zu Rathe gezogen.“ Vgl. auch Schlegel an Carl August Böttiger, 25.11.1796: „[...] welche [d.i. Malones Ausgabe] aller erst für die Kritik des Textes etwas befriedigendes geleistet, und nach vielen vergeblichen Konjekturen die ächte Leseart hergestellt hat“, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-20/letters/view/3174. Vgl. hierzu: FWF-Projekt Ludwig Tiecks Bibliothek (P 26814 und P 32038, Projektleitung: Prof. Achim Hölter, Laufzeit: 01.10.2014 bis voraussichtlich 30.9.2023), Datenbank: https://tieck-bibliothek.univie. ac.at. Es handelt sich um einen Raubdruck des Schweizer Verlegers und Buchdruckers J.J. Tourneisen (1754–1803): The Plays of William Shakspeare. With the Corrections and Illustrations of Various Commentators. To which are added Notes by Samuel Johnson and George Steevens. A New Edition. Revised and Augmented by the Editor of Dodsleyʼs Collection of Old Plays. 23 Bde. Basil [1799]–1802. Tiecks Exemplar befindet sich in der British Library unter der Sign.: C.134.dd.1. Vgl. den Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann in diesem Band. Roger Paulin: Der kosmopolitische Büchersammler. Zu August Wilhelm Schlegels „Verzeichniß meiner Bücher im December 1811“. In: Kooperative Informationsinfrastrukturen als Chance und Herausforderung. Thomas Bürger zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Achim Bonte und Juliane Rehnolt. Berlin 2018, S. 317–325, hier S. 320.
14
Christa Jansohn
Auch wirkten sich bei späteren Revisionen der Schlegel-Tieck’schen Ausgabe die Kommentierungen mancher Herausgeber des englischen Textes auf die Übersetzung aus, ja flossen in diese ein, besonders, wenn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die verbreitete Delius-Ausgabe mit ihren deutschsprachigen Wort- und Sacherklärungen den englischen Ausgangstext hergab.41 Manche Übersetzer, wie etwa Friedrich Bodenstedt und seine Mitstreiter, nahmen daher den Delius-Text als Ausgangstext für ihre „poetische Verdeutschung“, in dem sie hauptsächlich aus der Schlegel-Tieck-Übersetzung, also aus zweiter Hand, übersetzten. So schreibt Bodenstedt 1871 im „Vorwort“: In der That liefert Schlegel ein Meisterwerk der Uebersetzungskunst […]. In den sechzig Jahren, welche verflossen sind seit Schlegel sich von seinen Shakespeare-Arbeiten zurückgezogen, ist die deutsche Sprache nicht stehen geblieben, sondern hat sich, besonders unter dem befruchtenden Einflusse der germanistischen Studien, rüstig fortentwickelt; und es thut dem Ruhme Schlegel’s keinen Abbruch, wenn behauptet wird, daß auf dem von ihm angebahnten Wege bei reichern Hilfsmitteln die poetische Uebersetzungskunst Fortschritte gemacht hat. 42
Hier wird man fragen, ob in diesem Fall überhaupt von einer Neuübersetzung gesprochen werden kann oder ob es sich eher um einen „verbesserten“ bzw. revidierten Schlegel-Tieck handelt. Wie wird man diesen Ausgabentyp bei einer historisch-kritischen Neuedition der Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzung berücksichtigen? Diese und ähnliche Fragen sollten in Zukunft genauer untersucht werden.43 Die soeben skizzierten Textverhältnisse samt ihren widerstreitenden Tendenzen zur Destabilisierung des Originals einerseits und zur Integration des deutschen Shakespeare in nationalliterarische Zusammenhänge andererseits wären der Prüfung im Einzelnen wert.44 41
42
43
44
Shakspere’s Werke. Herausgegeben und erklärt von Nicolaus Delius. 7 Bde. Elberfeld 1864. Der englische Text wurde 1877 für den sogenannten „Leopold Shakspeare“ übernommen, was die weite Akzeptanz von Delius’ Ausgabe unterstreicht. Vgl. The Leopold Shakspere: The Poet’s Works, in Chronological Order, from the Text of Professor Delius, with „The Two Noble Kinsmen“ and „Edward III.“. An Introduction by Frederick James Furnivall. London, Paris, New York 1877. Einen guten Überblick bietet die Münsteraner Dissertation von Michael Hiltscher: Shakespeares Text in Deutschland. Textkritik und Kanonfrage von den Anfängen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 1993. Friedrich Bodenstedt: Vorwort. In: William Shakespeare’s Dramatische Werke. Uebersetzt von Friedrich Bodenstedt, Nicolaus Delius, Ferdinand Freiligrath, Otto Gildemeister, Georg Herwegh, Paul Heyse, Hermann Kurz und Adolf Wilbrandt. Nach der Textrevision und unter Mitwirkung von Nicolaus Delius. Mit Einleitungen und Anmerkungen von Friedrich Bodenstedt. Bd. 1. Leipzig 1871, S. I–VI, hier S. IV–V. Das Werk erschien im Brockhaus-Verlag. Hierzu vgl. auch Klaus Reichert: Deutschland ist nicht Hamlet. Bemerkungen zur Hamlet-Übersetzung von Friedrich Bodenstedt. In: Der deutsche Shakespeare. Mit Beiträgen von Walter Muschg, Hans Schmid u.a. Basel 1965, S. 95–101. Ein ehrgeiziges Projekt an der Universität Bochum scheint ins Stocken geraten zu sein. Vgl. hierzu die überzeugenden Ausführungen von Julia Jennifer Beine: Die Re- bzw. Dekonstruktion des „SchlegelTieck-Shakespeare“ anhand der kritischen Edition des „Hamlet“. In: forsch! – Studentisches OnlineJournal der Universität Oldenburg 1, 2017, S. 75–86, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1201705056862.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
15
Beim Übersetzungsvergleich wäre darüber hinaus die Abhängigkeit Schlegels und des Tieck-Kreises von früheren Übersetzungen, namentlich von Wieland und Eschenburg (und hier auch von deren englischen Vorlagen) herauszuarbeiten. Hier könnte die Kollationierung und textkritische Durchleuchtung etwaiger Mehrfachfassungen Einsichten in Prinzipien und Prozesse des Übersetzens gewähren. Das gilt etwa schon für die drei Druckfassungen der Eschenburg-Übersetzung und natürlich besonders für die Schlegel-Tieck’sche Übertragung. So liegt zum Beispiel zur recht komplizierten Genese der 17 durch Schlegel übersetzten Dramen derzeit nur Michael Bernaysʼ Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare aus dem 19. Jahrhundert (Leipzig 1872) vor, wo auf Seite 3 der „schon mehrfach laut gewordene […] Wunsch“ […] geäußert wird, „das Manuskript des Schlegelschen Shakespeare möge bald der Bibliothek einer deutschen Hochschule einverleibt, und so der Wissenschaft erhalten, dem wissenschaftlichen Gebrauche für immer zugänglich bleiben.“45 Genauso sieht es ein Rezensent und führt seine Begeisterung für Bernaysʼ Arbeit weiter aus: Was aus diesem Rohstoff der Manuscripte für ein Gewinn zu Gunsten einer gesunden Textkritik, aber auch zum Ruhme der Sorgfalt des Uebersetzers gewonnen werden könne, hat der Verf. sinnig nachgewiesen. So viel ist gewiß, der wahre Schlegel’sche Shakespeare, welchen wir bisher noch nicht besessen haben, ist erst von einer kritischen Bewerthung der vorliegenden Handschriften zu hoffen.46
Diese realisierte bekanntlich Bernays selbst in seinen beiden Shakespeare-Editionen.47 Weitere Schriften des Literaturkritikers, etwa sein Aufsatz Zum Studium des deutschen und englischen Shakespeare,48 führten freilich zu einer großen Welle von Unmutsbekundungen sowohl in der Presse als auch in den Vorstandssitzungen der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Diese bisher nicht ausgewerteten gedruckten und handschriftlichen Dokumente, Zeitungsartikel, Korrespondenzen und Pamphlete befinden sich im Bestand 148 der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft im Goethe- und SchillerArchiv – Klassik Stiftung Weimar und sollten in Zukunft bei der Schlegel-Tieck-Forschung mitberücksichtigt werden.49 Hier sei aus Platzgründen lediglich der kurze Überblick von Max Koch wiedergegeben. Er schreibt: 45 46
47
48
49
In diesem Kontext ist auch die vorzügliche Dissertation von Gebhardt 1970 (Anm. 4) heranzuziehen. Besprechung der Habilitationsschrift von Regierungsrath Rudloff in Frankfurt a.d.O.: Der Schlegelʼsche Shakespeare. In: Theologisches Literaturblatt 17, 1873, Sp. 403–405, hier Sp. 404, http://idb.ub.unituebingen.de/diglit/thlblb_1873/0211. Hierzu Christa Jansohn und Bodo Plachta: „Blicken wir in die Originalausgabe!“ Michael Bernays als „Anwalt“ von Goethe und Shakespeare. In: editio 35, 2021, 120–141, bes. S. 128–141. In: Schriften zur Kritik und Litteraturgeschichte. Bd. 3. Aus dem Nachlaß hrsg. von Georg Witkowski. Leipzig 1889, S. 135–183. Hierzu vgl. GSA 148/112: Erörterungen neuer Shakespeare-Übersetzungen durch Christian Eidam, 1901–1902, 55 Blatt; GSA 148/113: Zur Schlegel-Tieckʼschen Shakespeare-Bearbeitung, 1903–1912, 104 Blatt; GSA 148/114: Zur Schlegel-Tieckʼschen Shakespeare-Bearbeitung, 1907–1909, 294 Blatt. Zu Conrad und Eidam vgl. Angela Hünig: Übersetzung im Schatten des Kanons: Untersuchungen zur Deutschen Shakespeare-Übersetzung im 19. Jahrhundert am Beispiel des Coriolanus. Erfurt, Dissertation 1999, S. 14, Anm. 24, S. 23–33, S. 160–166, S. 177–180.
16
Christa Jansohn
Alois Brandl hat 1897 in seinem Neudruck der Schlegel-Tieckschen Arbeit sich auf den gleichen Standpunkt wie Bernays gestellt. Dem gegenüber forderte Christian Eidam in seinem Programm „Bemerkungen zu einigen Stellen Shakespearescher Dramen sowie zur Schlegelschen Übersetzung“ ein Weiterschreiten in der Richtung, die bereits in den Jahren 1867 bis 1871 von der deutschen Shakespeare-Gesellschaft eingeschlagen worden war. Indem Eidam seine Überzeugung von der Notwendigkeit einer Nachbesserung der Arbeit Schlegels weiter verfocht, während Brandl und Rudolf Genée sich gegen jede Veränderung aussprachen, erreichte er es, daß Hermann Conrad von der deutschen Shakespeare-Gesellschaft mit einer Nachprüfung der Schlegelschen Übersetzung betraut wurde, über deren Grundsätze Conrad im XXXVIII. und XXXIX. Bande des Shakespeare-Jahrbuches Rechenschaft ablegte.50
Diese Ausgaben einer kritischen Analyse zu unterziehen, wäre genauso notwendig wie die Auswertung von Bernaysʼ äußerst ertragreichen Ausführungen über Shakespeare und die Werke des Bardens in seinem handschriftlichen Nachlaß. Mehrere Hefte zu Shakespeare werden im Archivordner VII im Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel verwahrt und harren der Bearbeitung. Seit den Arbeiten von Bernays und Gebhardt haben lediglich zwei weitere sich mit den Manuskripten Schlegels näher auseinandergesetzt, und zwar Frank Jolles in seiner 1967 publizierten Edition der Erstfassung des Sommernachtstraums51 und 51 Jahre später Kaltërina Latifi in ihrer Faksimile-Edition des Hamlet-Manuskripts. Ihre Arbeit wirft freilich mehr Probleme und Fragen auf, als sie zu lösen vermag.52 Zum einen handelt es sich nicht um eine „Kritische Ausgabe“, wie es im Titel heißt, sondern ausschließlich um eine diplomatische Transkription des Originals, welches auf der gegenüberliegenden Seite als schwarz/weiß-Faksimile wiedergegeben wird. Damit bietet diese Ausgabe zwar Einblick in Schlegels Arbeitsweise, verpasst aber die Chance, das Manuskript in den Übersetzungsprozess und in die komplexe Publikationsgeschichte einzuordnen. Im Weiteren sind eine Reihe gravierender Mängel anzuführen, die in fast allen Besprechungen Erwähnung finden.53 So beklagt Peter Goßens zu Recht das „verhängnisvolle Problem vieler moderner Editionen, dass sie der materiellen Qualität eines 50
51
52
53
[Max Koch]: Vorwort. In: Shakespeares Dramatische Werke. Nach der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, Philipp Kaufmann und Voß. Neu durchgesehen, teilweise umgearbeitet und mit Einleitungen hrsg. von Max Koch. Bd. 1. Stuttgart 1882–1884, (Cotta’sche Bibliothek der Weltliteratur. Shakespeare), S. 1–9, hier S. 4f. A. W. Schlegels Sommernachtstraum in der ersten Fassung vom Jahre 1789 nach den Handschriften hrsg. von Frank Jolles. Göttingen 1967. August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100). Hierzu vgl. die Besprechungen von Peter Goßens. In: Das Achtzehnte Jahrhundert 44, 2020, H. 1, S. 132–134; Nikolas Immer. In: Informationsmittel (IFB). Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, 2010, http://informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=9823; Kai Kauffmann. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 30, 2020, H. 1, S. 201–279; Roger Paulin. In: Modern Language Review 114, July 2019, Nr. 3, S. 588–590, und den Artikel von Claudia Bamberg: Prolegomena zu einer künftigen Edition der Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und dem Tieck-Kreis. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 256, 2019, H. 2, S. 421–435.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
17
Faksimiles und der Lesehilfe durch die diplomatische Umschrift mehr vertrauen als einer übersetzungsgenetischen Analyse, die u.a. das Faksimile zum editorischen Standard gemacht hat“.54 Darüber hinaus gibt Roger Paulin zu bedenken: In order to establish the status of this text, one needs to have the printed version of 1798 to hand. It would be a work of supererogation on the part of a reviewer to compare these page for page, yet spot checks do reveal a general closeness to 1798, but with variants, these often crossed out, that represent divergences or second thoughts. Identifying these is surely the primary purpose of this edition – or at least it should be, since we are given no assistance towards that end. One might imagine instead a notional critical edition of Schlegel’s Shakespeare – a task hitherto so shamefully neglected by scholars, about which much could be said – reproducing as editio princeps the printed Hamlet text of 1798, with the variants of 1800, plus the manuscript variants (perhaps even digitally the English original, which is of necessity different from those of today). Such clustering around an editio princeps ought not to be beyond modern digital editorial scholarship. The manuscript, instead of being reproduced as here in its totality, might be reduced to a number of sample pages notably illustrative of its texture and feel. As it is, one could question the decision to do a diplomatic edition of a text whose legibility is compromised by a marginal fold. Could the SLUB’s conservation programme not envisage breaking open Eduard Böcking’s bindings to get at the full Schlegel? These are questions to which one would require an answer were a full critical edition of Schlegel’s Shakespeare to be envisaged. But it cannot be stressed too much that Latifi’s approach is not the way to proceed.55
Auch wenn Latifi keine textkritische Edition bietet, hat ihre Transkription – wie die Vielzahl an Besprechungen bekräftigt – zumindest den Ruf nach einer zuverlässigen Ausgabe der Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzung lauter werden lassen. Um die Dringlichkeit dieses Forschungsdesiderats noch einmal vor Augen zu führen, sei aus Roger Paulins Schlegel-Biographie zitiert: „If one wishes to cite Shakespeare according to Schlegel, it is Unger’s and Reimer’s originals that one must return. There has never been a full reissue of Schlegel’s text since 1823, which is a national disgrace.“56 Um diese Edition Schlegels und natürlich auch des Tieck-Kreises sowie weitere übersetzungsgenetische Untersuchungen der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung in Zukunft effizienter realisieren zu können, sollten die Digitalisierung und gleichzeitige Transkription der Übersetzungsmanuskripte sowie weiterer Texte im Nachlass von August Wilhelm Schlegel in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) vorangetrieben werden.57 Derzeit liegen dort unter der Signaturengruppe Mscr.Dresd.e.90,XXII,1–1458 lediglich die folgenden vier Manuskripte als Digitalisat vor, und zwar: 54 55 56
57 58
Goßens 2020 (Anm. 53), hier S. 134. Paulin 2019 (Anm. 53), hier S. 589f. Roger Paulin: The Life of August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 529, https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0069. Hierzu vgl. auch den Beitrag von Thomas Bürger in diesem Band. Hierzu vgl. auch den Beitrag von Thomas Haffner und Thomas Stern in diesem Band (mit Faksimiles).
18
Christa Jansohn
– Hamlet – Mscr.Dresd.e.90, XXII, 1 – Shakespeareʼs Romeo und Julia: übersetzt von Aug. Wilh. Schlegel. Von diesem eigenhändig durchcorrigierte Abschrift – Mscr.Dresd.e.90, XXII, 10 – Sommernachtstraum – Mscr.Dresd.e.90, XXII, 11 – Sommernachtstraum – Mscr.Dresd.e.90, XXII, 12 Die anderen acht erhaltenen Handschriften sind noch nicht digitalisiert, geschweige denn transkribiert worden (Stand: Juni 2022). Hierbei handelt es sich um: König Heinrich IV., König Heinrich V., König Johann, Julius Caesar, Der Kaufmann von Venedig, Richard II., Der Sturm und Was ihr wollt. Handschriftlich nicht überliefert sind bekanntlich: Wie es euch gefällt, Heinrich VI (1. – 3. Teil) und Richard III. In der SLUB werden darüber hinaus unter der Signatur Mscr.Dresd.e.93 Wolf Graf von Baudissins Manuskripte verwahrt, und zwar unter dem Titel: „Uebersetzungen von Shakespeare: Die lustigen Weiber, Othello, König Lear, The London Prodigil, Ende gut, Alles gut – Der Wiederspenstigen Zähmung, Antonius und Cleopatra, Maß für Maß, Die Comödie der Irrungen, Troilus und Cressida – Titus Andronicus – König Heinrich der Fünfte (Nov. 1803) – Liebes Leid und Lust – Viel Lärmen um nichts“.59 Es fehlt demnach lediglich Heinrich der Achte. Baudissins Manuskripte sollten ebenso zügig wie die Schlegel’schen Handschriften digitalisiert, transkribiert und schließlich vor allem erneut untersucht werden, unter anderem etwa im Kontext der Arbeiten von Michael Bernays, der sich im 19. Jahrhundert als erster extensiv mit den Handschriften Schlegels und Baudissins beschäftigte: So konzentrierte er sich in seiner Habilitationsschrift Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare auf die primären, also vom Autor Schlegel stammenden Varianten des Übersetzungsmanuskripts, um der Entstehung (und den Veränderungen) des Textes bis zur editio princeps nachzuforschen. […] Bernays ermöglichte es erstens, die Lücken und Korruptelen, die dem ersten, nicht von Schlegel selbst korrigierten Druck seiner Übersetzung anhafteten, aus erster Hand – quasi mit und durch Schlegel selbst – zu ergänzen und zu verbessern. Zweitens dokumentierten seine Forschungen zu den durchkorrigierten Manuskripten mit ihren zahlreichen Abweichungen von dem späteren redigierten Text den kontinuierlichen Bearbeitungsprozeß, in dessen Verlauf Schlegel sich der englischen Vorlage kongenial genähert hatte. Schließlich durfte diese Schrift den Anspruch erheben, einen wichtigen Beitrag zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der sogenannten Romantischen Schule geleistet zu haben.60
59
60
4 Bde. fol. 2 Bde. 4°. Die Angaben zu den Bänden finden sich in Manuscripta Mediaevalia: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj40185931. Dort auch der Link auf den gedruckten Handschriftenkatalog, aus dem die Daten stammen: http://digital.slub-dresden.de/id275356337/48. Baudissins Übersetzungen. Als Anmerkung sei angefügt, dass die Bände unterschiedliche Formate haben, auch wenn alles mit Quart katalogisiert wurde. Michael Schlott: Michael Bernays (1834–1897). In: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts. Hrsg. von Christoph König, Hans-Harald Müller und Werner Röcke. Berlin, New York 2000, S. 69–79, hier S. 71.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
19
Abschließend sei nochmals betont, dass eine Digitalisierung der vorhandenen Manuskripte immer gleichzeitig sowohl mit deren Transkription als auch mit deren sorgfältiger Kommentierung einhergehen sollte. Dies betrifft ebenfalls die bereits vollständig im Netz abrufbare Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels mit 5322 Briefen,61 welche eine unentbehrliche Quelle für die nähere Beschäftigung mit den Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises ist. Leider sind die spärlichen, teils unvollständigen Annotationen ein großes Manko dieser Edition, was auch einer der Herausgeber zugibt, wenn er prägnant und richtig konstatiert: „‚Erschließen‘ darf ‚Kommentieren‘ nicht ersetzen, die Klage über den Rückgang der Kommentaranteile in digitalen Editionen ist berechtigt.“62 Aus diesem Grund sollten die Anmerkungen in dieser Ausgabe unbedingt durch umfassende und vollständige Kommentierungen erweitert werden, die klar „über die bloße Identifizierung von Personen, Orten und Werken“ sowie Wort- und Sacherläuterungen hinausgehen.63 Auch wenn das digitale Medium durchaus „neue Formen der Auszeichnung und der Registererstellung, neue Konzepte der semantischen Erschließung sowie zahlreiche Möglichkeiten der Visualisierung“ ermöglicht,64 darf dies kein Grund sein, konventionelle Kommentierungsformen gedruckter Editionen für digitale Versionen fallen zu lassen. Diese zu implementieren, erleichtert zum einem der Fachwelt zukünftiges philologisches Arbeiten, zum anderen werden auch einem größeren Nutzerkreis notwendige Hilfen angeboten. Zihlmann-Märkis vernünftige Äußerungen und ihre berechtigte Kritik in ihrem Beitrag „Kommentierung in gedruckten und digitalen Briefausgaben“ lassen sich sowohl auf die Kommentierung der SchlegelKorrespondenz als auch auf zukünftige gedruckte bzw. digitale Editionen der Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises anwenden. Der Mehrwert eines Onlineportals darf demnach nicht auf die Zusammenführung verstreuter Texte reduziert werden, vielmehr besteht ihr Mehrwert in dem digitalen Angebot, „Befund“ und „Kommentar“ gleichermaßen anzubieten. Kern der Annotationen sollten einerseits umfangreiche Überblickskommentare [sein], welche den edierten Textbestand in den zeitgenössischen Kontexten verorten sowie die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte aufarbeiten, andererseits umfassende Stellenerläuterungen zum Text. Letztere enthalten sprachliche und realienkundliche Erklärungen und legen intertextuelle Bezüge sowie Anspielungen auf Ereignisse und Diskussionen offen, […].65
61 62
63
64
65
KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/. Jochen Strobel: A. W. Schlegels Korrespondenz – kollaborativ! Zu einer Theorie der Praxis digitaler Briefedition. In: editio 35, 2021, S. 142–167, hier S. 165. Patricia Zihlmann-Märki: Kommentierung in gedruckten und digitalen Briefausgaben. In: Beihefte zu editio 47, 2020, S. 159–174, hier S. 163. Claudia Bamberg: „Schreiben Sie mir ja über alles“. Wozu eine digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels? In: Vom Nutzen der Editionen. Zur Bedeutung moderner Editorik für die Erforschung von Literatur- und Kulturgeschichte. Hrsg. von Thomas Bein. Berlin 2015 (Beihefte zu editio. 39), S. 19–26, hier S. 20. Zihlmann-Märki 2020 (Anm. 63), S. 163.
20
Christa Jansohn
Aufgrund der unterschiedlichen Informationsbedürfnisse des Benutzerkreises wird man sich über die angemessene Breite und Tiefe der Kommentare und deren Darstellung im digitalen Bereich weitere Gedanken machen müssen.
4. Der Shakespeare-Kanon: Englisch und Deutsch Bisher wurde in den obigen Ausführungen vor allem auf die Instabilität des englischen Textes und der Übersetzungen und die damit verbundenen Folgen für die Überlieferung hingewiesen. Diese Instabilität betrifft freilich auch den Kanon Shakespeares selbst. Besonders Ludwig Tieck und seinem Kreis ist es zu verdanken, zahlreiche Werke elisabethanischer Dramatiker einer kritischen Revision zu unterwerfen und deutlich zu machen, dass auch das Œuvre Shakespeares ein historisch gewachsenes und sicherlich kein festes Textkorpus darstellt. Schon allein die Aufnahme von sieben weiteren Dramen „never before Printed in Folio“ in der Dritten Folio (1664) und Vierten Folio (1685) und danach mit unterschiedlichen Texten in englischen und deutschen Ausgaben ist ein beredter Beleg dafür.66 Das Studium des Barden bestimmte Tiecks Schaffensjahre von 1790 bis 1840; zwischen 1810 und 1820 war es beinahe ausschließlicher Gegenstand seiner literarischen Bemühungen. Tiecks Arbeiten lagen – wie bereits oben erwähnt – unter anderem der Schweizer Raubdruck der 23-bändigen Johnson and Steevens-Ausgabe67 sowie die Zweite, Dritte und Vierte Folio zugrunde.68 Letztere erhielt er bereits als zwanzigjähriger Student im Herbst 1793 durch die Vermittlung Johann Joachim Eschenburgs. Bei seiner Lektüre der Vierten Folio annotierte er u. a. das apokryphe Drama Locrine,69 wobei seine Anmerkungen charakteristisch für den späteren Theatermann Tieck sind, 66
67 68
69
Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories, and Tragedies. Published according to the true Original Copies. The third Impression. And unto this Impression is added seven Playes, never before Printed in Folio. viz. London 1664: Folgende Dramen wurden abgedruckt: Pericles, The London Prodigal, The History of Thomas Lord Cromwell, Sir John Oldcastle Lord Cobham, The Puritan Widow, A Yorkshire Tragedy, The Tragedy of Locrine. Vgl. https://internetshakespeare.uvic.ca/Library/facsimile/book/SLN SW_F3/4/index.html%3Fzoom=850.html. Vgl. auch den Appendix: Shakespeare-Apokryphen in englischen und deutschen Ausgaben: Eine bibliographische Übersicht: 1664–1997. In: Christa Jansohn: Zweifelhafter Shakespeare. Zur Geschichte der Shakespeare-Apokryphen und ihrer Rezeption von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert. Münster 2000, S. 94–113. Allgemein zur Geschichte der Shakespeare-Apokryphen vgl. Peter Kirwan: Shakespeare and the idea of Apocrypha: Negotiating the Boundaries of the Dramatic Canon. Cambridge 2015, und zu Tieck: Christa Jansohn: Ludwig Tieck as the Champion of Shakespeare Apocrypha in Germany. In: Cahiers Elisabéthains 48, 1995, S. 45–51. The Plays of William Shakspeare. Basil [1799]–1802. (Anm. 39). Die Folio-Ausgaben befinden sich in der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. Vgl. hierzu Günter Brosche, Shakespeare in der Österreichischen Nationalbibliothek. Ein Postskriptum zum Shakespearejahr. In: Biblos 14, 1965, S. 179–193 und Achim Hölter und Paul Ferstl: Ludwig Tieck’s Book Collection. The Holdings of the Austrian National Library (ÖNB). In: Taking Stock. Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. Hrsg. von Norbert Bachleitner, Achim Hölter und John A. McCarthy. Leiden 2020, S. 90–118, hier bes. S. 101f. Seine Anmerkungen wurden von Brosche 1965 (Anm. 68) transkribiert und in seinem Aufsatz vorgestellt.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
21
der die Dramen immer auch in Verbindung mit ihrer Realisierung auf der Bühne sieht. Außer diesen korrekten philologischen Anmerkungen liegen Tiecks Verdienste freilich nicht unbedingt auf dem Gebiet wissenschaftlicher Kritik, wovon seine weiteren Randbemerkungen in der Malone-Ausgabe ein gutes Zeugnis abgeben, obgleich man diese spontanen Reaktionen auch nicht überbewerten sollte.70 Wichtiger ist vielmehr die Tatsache, dass durch die Beschäftigung mit zahlreichen Dramen, die nicht in der First Folio waren, Verleger auch schon recht früh die Aufnahme nicht-kanonischer Werke in das Gesamtwerk der Schlegel-Tieck’schen Ausgabe begünstigten. So brachte bereits zwischen 1810 und 1811 der Wiener Verleger Anton Andreas Pichler (1770–1823) die vorhandenen Übersetzungen Schlegels mit deutschen Versionen anderer Übersetzer in 20 Bänden (inklusive zweier Supplementbände mit Apokryphen) unautorisiert unter Hinzuziehung der Übersetzungen aus dem Hitzig-Verlag auf den Markt,71 um „den Englischen Dichter in dieser Ausgabe mit der größten Vollkommenheit“ anzubieten.72 Die beiden Supplementbände (1812) enthielten acht Apokryphen, darunter auch Pericles, Fürst von Tyrus in der Übersetzung von Ludwig Tieck, ein Drama, das in verschiedenen Quartos (1609, 1611, 1619, 1630 und 1635) mit Shakespeare als Verfasser publiziert wurde, nicht aber in die First Folio (1623), sondern erst in der Third Folio (1664) aufgenommen wurde. Erst Edmond Malone nahm Pericles. Prince of Tyre in den Shakespeare’schen Kanon auf,73 und mit Ludwig Tiecks Übertragung wurde das Drama auch in Deutschland eingeführt. In diesem Zusammenhang ergibt sich die essentielle Frage, wie man in einer historisch-kritischen Edition der Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und des Tieck-Kreises mit diesen Übertragungen umgehen soll. Da Pericles von der heutigen Forschung einmütig Shakespeare zugeschrieben wird, könnte man in einer Neuauflage der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung auch dieses Drama durchaus berücksichtigen. Weitere Anwärter wären Arden of Faversham, welches Dorothea Tieck übersetzte,74 und mittlerweile ebenfalls von einigen Editoren dem Shakespeare-Kanon 70
71
72
73
74
In der vorzüglichen von Roger Paulin betreuten Dissertation von Elisabeth Neu werden die meisten Randbemerkungen Tiecks transkribiert und kommentiert. Vgl. Kap. I: The Marginalia on Shakespeare. In: Elisabeth Neu: Tieck’s Marginalia on the Elizabethan Drama. The Holdings in the British Library. Cambridge unpubl. PhD October 1987, S. 11–110, hier S. 69–76. Bei Comedy of Errors entdeckt er die „alte Manier, die an Locrin, Lear, u. einige Sonette erinnert.“ (S. 70); zu Mucedorus meint er: „die einzelnen Stellen […] haben was von Sh. alter Art.“ (S. 73). Zum Beispiel die dreibändige Ausgabe aus dem Verlag von Julius Eduard Hitzig: Shakespeare’s von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke. Übersetzt von mehreren Verfassern. Berlin 1809–1810, http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00023D9600000000, und Roger 2015 (Anm. 24), S. 113–124, hier S. 114f. Shakspear’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm Schlegel und J. J. Eschenburg, 20 Bde., Wien 1811–1812; Dazu kamen Übersetzungen von Hans Carl Dippold, Georg Wilhelm Keßler, Ludwig Krause, Ludwig Tieck und Heinrich Voß. Vgl. hierzu Suzanne Gossett: Shakespeare and Textual Theory. London 2022, und dort das 11. Kapitel: Textual Theories and Difficult Cases: Hamlet and Pericles, S. 185–212. Hierzu vgl. mein Kapitel: Dorothea Tiecks Übersetzung von Arden of Faversham (Jansohn 2000 [Anm. 66]), S. 177–190. Vgl. auch: Christian Smith, Translation and Influence: Dorothea Tieck’s
22
Christa Jansohn
zugeordnet werden,75 und vor allem Edward III., über das Ludwig Tieck richtig anmerkt: „Es ist mir höchst wahrscheinlich, dß dser Edw. III. von Sh. ist. Kein anderes St. hat so sehr seinen Ton, muß auch schon später, etwa 90 geschrieben sein.“76 Herausgegeben und übersetzt wurde Edward III. allerdings von Max [Leopold] Moltke (1819–1894), der sich als Dichter, Übersetzer und Publizist mit Begeisterung „dem Studium seines Lieblingsdichters, Shakespeareʼs [widmete… und] eigene und von ihm bearbeitete Uebersetzungen Anderer der Werke Shakespeareʼs heraus[gab], die ihm den Ruf eines beachtenswerthen Shakespeare-Forschers eintrugen, der oft um seinen Rath angegangen wurde.“77 1869 edierte Moltke auf Wunsch seines Verlegers Bernhard Tauchnitz in der Reihe „Collection of British Authors. Tauchnitz Edition, vol. 1041“ Edward III. im Original.78 1875 folgte Moltkes Übersetzung als Einzelausgabe beim Reclam-Verlag und ein Jahr später in einer Shakespeare-Gesamtausgabe, und zwar im ersten Band von William Shakspereʼs Dramatische Werke in drei Bänden. Uebersetzt von Schlegel, Benda und Voß in der Reihe „Philipp Reclamʼs billigste Classiker-Ausgaben“.79 Schließlich sollten die Äußerungen Schlegels und Tiecks zu anderen Dramen, die nicht in Shakespeares Gesamtwerk aufgenommen wurden, aber mittlerweile dem Shakespeare-Kanon zugerechnet werden, zumindest in einem Supplement-Band Berücksichtigung finden. Dazu gehört vor allem Two Noble Kinsmen, über das Schlegel sich folgendermaßen äußerte: Eine besondere Erwähnung verdienen die zwei edlen Vettern (the two noble kinsmen), weil sie von Shakespeare und Fletcher gemeinschaftlich herrühren sollen. Ich sehe keinen Grund, dies zu bezweifeln; das Stück ist zwar erst nach dem Tode beider erschienen, aber in welcher
75
76 77
78
79
Translations of Shakespeare. In: Borrowers and Lenders. The Journal of Shakespeare and Appropriation 11, 2018, Nr. 2, S. 1–29, https://borrowers-ojs-azsu.tdl.org/borrowers/article/view/251/499. Vgl. Anonymous and William Shakespeare: The Tragedy of M. Arden of Faversham; or, The Tragedy of Arden of Fevershame. Hrsg. von Terri Bourus and Gary Taylor. In: Gary Taylor, John Jowett, Terri Bourus, and Gabriel Egan: The New Oxford Shakespeare. The Complete Works. Oxford 2016, Vol. 1: Modern Critical Edition, S. 117–187. Zur Forschungslage vgl. Christa Jansohn: Arden of Faversham. Critical Reflections and Further Studies. In: Studying English Literature in Context. Critical Readings. Hrsg. von Paul Poplawski. Cambridge 2022, S. 101–116. Neu 1987 (Anm. 70), S. 70f. Siegfried Moltke, Maximilian Leopold. In: Allgemeine Deutsche Biographie 52, 1906, S. 458–462. Zitiert nach der Online-Version: https://www.deutsche-biographie.de/sfz64991.html. Doubtful Plays of William Shakespeare. In One Volume. Stuttgart 1869. Folgende Dramen wurden aufgenommen: King Edward III., Thomas Lord Cromwell, Locrine, A Yorkshire Tragedy, The London Prodigal, The Birth of Merlin, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10749853?page=,1. William Shakspereʼs Dramatische Werke in drei Bänden. Uebersetzt von Schlegel, Benda und Voß. Leipzig, 1876, Bd. 1. Dazu sein Vorwort: „[...] mithin sämmtliche siebenunddreißig Stücke der englischen Original-Ausgaben und als berechtigte Zugabe oder vielmehr Einschaltung auch noch die von mir selbst beigesteuerte Uebersetzung des Dramaʼs ‚König Eduard der Dritte‘, dessen Aechtheit als ein Erzeugnis der Shakspeareʼschen Muse zwar noch der Beglaubigung durch literaturgeschichtliche Urkunden ermangelt, gleichwol aber auf Grund äußerer Anzeichen und innerer Kenzeichen bis zur Evidenz bewiesen werden kann und demzufolge auch unter englischen und deutschen Shakspere-Kennern von Jahr zu Jahr mehr Anerkenner findet.“ (Einleitendes Vorwort, Bd. 1, o. P.)
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
23
Absicht hätte der Herausgeber oder Drucker dies betrügerischer Weise vorgeben sollen, da Fletcherʼs Name damals eben so berühmt, oder noch berühmter, als der Shakespeareʼs war.80
Die oben genannten Dramen sind im besonderen Maße ein Beweis dafür, dass der Kanon von Shakespeares Werken im Original und in der Übersetzung keine feste Größe darstellt, sondern, im Gefolge wechselnder Auffassungen über Zuschreibung, Autorschaft und Lesererwartung, deutlichen Schwankungen unterworfen ist. Lange Zeit enthielten die gängigen Gesamtausgaben deshalb außer den 36 Dramen der First Folio noch Pericles, bis, etwa im Laufe der letzten Jahre, The Two Noble Kinsmen, Pericles, Edward III. und Teile von Arden of Faversham in den Kreis der kanonischen Dramen Shakespeares aufgenommen wurden. Dass bereits Schlegel und der Tieck-Kreis im 19. Jahrhundert durch Übersetzungen und zahlreiche Interpretationen dieser apokryphen Stücke zu deren Rezeption beitrugen, verdient größere Beachtung als bisher in der fast ausschließlich germanistischen Forschung.
5. Zur Überlieferungsgeschichte Die Kanonfrage wird man schließlich auch im Kontext der Publikationsgeschichte der Schlegel-Tieck-Übersetzung sehen und deuten müssen. Wie Knödler und Bamberg in „Shakespeare, heimatlos“ zeigen,81 war Schlegel über die Nachdrucke seines nicht mehr lieferbaren ersten Bandes durch seinen Verleger Johann Friedrich Unger sehr erzürnt, zumal er offensichtlich, wie aus einem Brief Schlegels an Unger vom 23. April 1801 hervorgeht, „gleich nach Vollendung meiner Übersetzung des Shakspeare eine ganz durchgearbeitete und anders geordnete Ausgabe davon im Sinne hätte“.82 Den von ihm angestrebten Rechtsstreit verlor Schlegel schließlich und verfolgte danach nicht mehr den Plan einer Gesamtübersetzung. So kam es nie zu einer Neuordnung von Schlegels Übertragung und auch nicht zu einem abschließenden Band mit einigen apokryphen Dramen, auf den Ludwig Tieck von Schlegel am 7. Mai 1801 hingewiesen wird: „Der Vertrag müßte auf die sämtlichen 13 Bände (die es nach dem 8ten [mit den Spurious plays] noch werden, und die in 5–6 Jahren fertig seyn können) sogleich eingegangen werden.“83 Darüber hinaus ignorierte Schlegel den gutgemeinten Vorschlag Carolines, bekanntere Dramen, darunter Macbeth, Othello und Lear, zu übersetzen, um die Verkaufszahlen zu steigern.84 Es ist aber nicht nur der finanzielle Aspekt, vielmehr 80 81 82
83
84
Zitiert nach Sillig 1854 (Anm. 30), S. 34. Knödler/Bamberg 2019 (Anm. 22), S. 55–118, hier S. 106–108, bes. S. 107. Brief Schlegels an Unger vom 23. April 1801, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-0122/briefid/2202. August Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck, 7. Mai 1801, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/898. Vgl. den Brief Caroline Schlegels an August Wilhelm Schlegel vom [25. Mai] 1801: „Wenn es wahr seyn sollte, daß von den leztern Theilen des Shakespear wenigere verkauft wurden, könnte nicht die
24
Christa Jansohn
trug Schlegel mit seiner Stückauswahl selbst zur geringeren Rezeption seiner Texte bei, und so beklagt Richard Flatter zu Recht: Es ist sehr zu bedauern, daß Schlegel seine Zeit und seine hohe Kunst an Stücke verschwendete, die selten oder gar nicht gespielt werden (an König Johann, an drei Teile von Heinrich VI. und an Heinrich V.) daß er aber weder Macbeth übersetzte, noch Lear, noch Othello. Von den sechsunddreißig Stücken, die uns die Erste Folio als Shakespeare Gesamtwerk vorlegt, sind also lediglich siebzehn – nicht einmal die Hälfte – von Schlegel übertragen worden. Rechnet man jene fünf, kaum je gespielten Stücke ab, so verbleiben gar nur zwölf.85
Noch bedauernswerter ist freilich, so Flatter weiter, „daß Schlegel, der vielbeschäftigte, niemals die Zeit fand, die zum Druck gehenden Abschriften endgültig durchzusehen oder, während des Druckes, Korrekturen zu lesen.“86 Vielmehr gab Schlegel seine Übersetzungen direkt nach ihrer Fertigstellung in den Druck, überließ wichtige Korrekturen seinem Verleger Johann Friedrich Unger sowie Friedrich Schlegel und forderte gar im ersten Band sein Publikum auf, kleinere Versehen selbst zu korrigieren: Geringere Versehen gegen die richtige Interpunktion und Orthographie, z.B. Apostrophe nach den Wörtern solch und welch, nach manchen Dativen und Imperativen, die nicht nothwendig ein e am Ende haben müssen, u.s.w. wird der Leser leicht selbst verbessern können.87
Das, was hier so simpel klingen mag, ist eine Herausforderung für jeden Editor, zumal noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Wahl der Satzzeichen keinen strengen Regeln unterliegt, sondern vielmehr „Ausdruck einer individuellen stilistisch-syntaktischen Stilphysiognomie“ ist und „sich auch für das spezifische Verständnis literarischer ‚Rede‘ als zentral“ erweist.88
85
86 87
88
Wahl der Stücke darauf Einfluß gehabt haben? Versteht das dumme Volk diese historische Reihe? Du hättest so nach der Schnur weg Macbeth, Othello, Lear und alles, was einmal in Besitz war, nehmen sollen, und nimm ja ums Himmelswillen jetzt keine verkannten Meisterstücke als Oldcastle usw.“, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3811. Richard Flatter: Schlegel und Schlegel-Tieck. In: Richard Flatter: Triumph der Gnade. Shakespeare Essays. Wien, München, Basel 1956, S. 70–83, hier S. 70. Flatter 1956 (Anm. 85), hier S. 70. Vgl. den Anhang „Druckfehler im ersten Theile“. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1797, o. S. [S. 291f., hier S. 292]. Alexander Nebrig und Carlos Spoerhase: Für eine Stilistik der Interpunktion. In: Poesie der Zeichensetzung: Studien zur Stilistik der Interpunktion. Hrsg. von Alexander Nebrig und Carlos Spoerhase. Bern 2012. (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik N.F. 2012, 25), S. 11–31, hier S. 12f. (mit weiterführender Literatur in Anm. 4).
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
25
Während die Bereinigung ausschließlich offensichtlicher Fehler in allen Ausgabentypen realisiert werden kann,89 sollte in einer historisch-kritischen Ausgabe tunlichst auf Veränderungen in der Orthographie (etwa durch Modernisierung) bzw. in der Interpunktion (statt historische Interpunktion Anwendung heutiger Regeln zur besseren Lesbarkeit) verzichtet werden, denn nur so wird das Lesepublikum für „das Verständnis für die Historizität“ des Textes sensibilisiert.90 Besonders bei den Schlegel-Übersetzungen muss man zusätzlich bedenken, dass dessen englische Textgrundlage, die MaloneEdition von 1786, bereits beträchtliche Änderungen durch die modernisierte Orthographie und Interpunktion, die Versifikation und Vers-Abteilung aufweist, die Schlegel nicht mit den Quartos oder der First Folio abglich. Zwischen 1797 und 1801 veröffentlichte Schlegel seine Übersetzung von sechzehn Shakespeare-Dramen; als Nachzügler folgte 1810 der Text von Richard III., „ohne eine systematische Reihenfolge einzuführen, außer daß er [Schlegel] die Königsdramen nach der geschichtlichen Chronologie vornahm.“91 Nach der Übernahme der weiteren Übersetzungen durch Dorothea Tieck und Graf von Baudissin erschien die SchlegelTieckʼsche-Ausgabe erstmals vollständig zwischen 1825 und 1833 und erlebte zu Lebzeiten der Übersetzer insgesamt acht Auflagen sowie 1800 einen Einzeldruck des Hamlet. Bereits 1842 betont der bekannte Shakespeare-Forscher Alexander Schmidt in seiner Vorrede zu seinen Sacherklärenden Anmerkungen zu Shakespeare’s Dramen die prominente Rolle der Schlegel-Tieckʼschen Übersetzungen, die „sich eine weite Bahn gebrochen und uns den Dichter so nahe gebracht, daß seine darin gegebene Form bei uns klassische Geltung besitzt“; und fünf Jahre später führt der Literaturhistoriker Robert Eduard Prutz an, man habe mit der Übersetzung von Schlegel und Tieck nun einen Shakespeare, „der zugleich so englisch und doch so deutsch, so fremd und doch so vertraut ist, und um den selbst die Engländer uns beneiden müssen.“92 Und schließlich meint 89
90
91
92
Scheibes Definition von ‚Textfehler‘ sollte bei der praktischen Umsetzung als Ausgangspunkt dienen. Danach sind „Eingriffe in die Textgestalt […] nur dann zulässig, wenn eindeutige Druckfehler […] vorliegen, die ebenfalls eindeutig zu korrigieren sind. Als Fehler in dieser Bedeutung ist anzusehen, was für sich und im engeren Kontext keinen Sinn zuläßt, der vom Autor tatsächlich gemeint ist.“ Siegfried Scheibe: Zum editorischen Problem des Textes. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 101, 1982. Sonderheft. Probleme neugermanistischer Edition. 1982, S. 12–29, hier S. 25. Vgl. auch die Ausführungen in Plachta 2022 (Anm. 27), S. 148–156, S. 148f. Plachta 2022 (Anm. 27), S. 18. In der anglistischen Editionswissenschaft verfährt man teilweise anders und verändert besonders in Shakespeare-Ausgaben Interpunktion, Schreibweise usw. Alois Brandl: Die Aufnahme Shakespeares in Deutschland und die Schlegel-Tiecksche Übersetzung. In: Shakespeares Dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Hrsg. von Alois Brandl. Bd. I. Leipzig 1897, S. 46–76, hier S. 59. Die Übersetzungen wurden wie folgt veröffentlicht: Bd. I, 1797: Romeo und Julia – Sommernachtstraum; Bd. II, 1797: Julius Cäsar – Was ihr wollt; Bd. III, 1798: Sturm – Hamlet; Bd. IV, 1799: Kaufmann von Venedig – Wie es euch gefällt; Bd. V, 1799: König Johann – Richard II, Bd. VI, 1800: Heinrich IV., Teil 1 und 2; Bd. VII, 1801: Heinrich V. – Heinrich VI., Teil 1; Bd. VIII, 1801: Heinrich VI., Teil 2 und 3; Bd. IX, 1810: Richard III. Beide Zitate entnommen aus: Christine Roger: Von „bequemen und wohlfeilen Nebenbuhlern“. Die ‚Schlegel-Tiecksche‘ Shakespeare-Übersetzung und die Konkurrenz. In: Institut für deutsche Literatur 2003 (Anm. 23), S. 277–296, hier S. 295f. Identisches Quellenmaterial und ähnliche Argumentation
26
Christa Jansohn
Karl Kraus sogar: „Ein Schlegelʼscher Irrtum im ‚Hamlet‘ ist wertvoller und dem Original gemäßer als die tadelloseste Übersetzung, in der er beseitigt erscheint.“93 Dieser extremen Haltung von Karl Kraus stehen freilich die vielen Versuche besonders der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft gegenüber, die wenige Jahre nach ihrer Gründung im April 1864 ganz verschiedene Ausgabentypen der SchlegelTieck’schen Übersetzung aus dem Verlagshaus Reimer betreute.94 Die Editionen reichen von einer zwischen 1867 und 1871 in mehreren Auflagen herausgegebenen, sorgfältig durchgesehenen zwölfbändigen Ausgabe mit Einleitungen und Anmerkungen von Hermann Ulrici95 über eine mehrbändige Familien- und Bühnen-Ausgabe (1870–1878)96 bis hin zu einer einbändigen wohlfeilen Gesamtausgabe, die 1891 auch illustriert auf den Markt kam und sich sehr gut verkaufte. Alle Ausgaben basierten mehr oder weniger auf der Schlegel-Tieckʼschen Übersetzung aus dem Hause des Verlegers Georg Reimer, wobei besonders in den von Tieck übersetzten Dramen so viele Fehler festgestellt wurden, dass „von den neunzehn Stücken, die sie umfaßt, eine Anzahl ganz
93
94 95
96
finden sich bereits in meinem Artikel: The Making of a National Poet. Shakespeare, Carl Joseph Meyer and the German Book-Market in the Nineteenth Century. In: The Modern Language Review 90, 1995, S. 545–555. Karl Kraus: Vor „Macbeth“ (Einleitung zu Bd. II von Shakespeares Dramen). In: Die Fackel, Nr. 908, Mai 1935, S. 1–16, hier S. 5. Krausʼ Übersetzungsmethode kommt in dieser Passage gut zum Ausdruck. Vor der in unserem Haupttext zitierten Äußerung heißt es: „Ein schwierigeres Beginnen stellt der hier unternommene Versuch (einer Nach- und Umdichtung) dar: Werte vorhandener Verdeutschungen, aus denen sich gleichsam die Rohübersetzung ergab, zusammenzustellen und deren Unwerte abzuändern, damit alles jenem Schlegelschen Gepräge angepaßt sei, das oft von Baudissin, Dorothea Tieck und Mommsen, nicht immer von Schlegel selbst erreicht wurde. Welche Übersetzung man — von den ‚Revisionen‘ der Shakespeare-Gesellschaft abgesehen, die für philologische Werte unfehlbar die poetischen preisgeben — zum Vergleich mit der entstandenen Fassung heranziehe, es wird alles übernommen scheinen und kaum etwas unverändert sein. Wenn die Welt, soweit sie liest, nicht Wichtigeres zu besorgen hätte, das Wichtigste wäre der Vergleich einer solchen Arbeit mit den deutschen Macbeths wie auch mit dem Original, auf die Gefahr hin, für einen shakespeareschen Vers keine Gemäßheit des Sinns aufzufinden, woran, einem höchst unsichern Text gegenüber, nur Vergötzung oder Wissenschaftlerei Anstoß nehmen könnte. (Es gibt eine Stelle im ‚Lear‘ — zu Edmunds Verhaftung —, wo ein von keinem Übersetzer bemerkter logischer Absprung dem Gegenteil weichen mußte; öfter auch in den Sonetten. Wer kann sagen, was von Shakespeare ist? Und warum sollte, wenn’s der Gedanke gebietet, verboten sein, selbst den Homer — mitunter — aufzuwecken? Ein Schlegel’scher Irrtum im ‚Hamlet‘ ist wertvoller und dem Original gemäßer als die tadelloseste Übersetzung, in der er beseitigt erscheint.)“ Hierzu vgl. Ajouri/Jansohn 2020 (Anm. 26). Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Sorgfältig revidirt und theilweise neu bearbeitet, mit Einleitungen und Noten versehen, unter der Redaction von H. Ulrici. Hrsg. von der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 12 Bde. Berlin 1867–1871. Eine zweite, nochmals überarbeitete Auflage kam 1876 und 1877, eine weitere 1897 auf den Markt. William Shakespeare: W. Shakespeare’s dramatische Werke. Nach den Schlegel-Tieck’schen Übersetzungen für die deutsche Bühne bearbeitet von Wilhelm Oechelhäuser, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 27 Bände. Berlin: 1870–1878: die Bände 1 bis 14 erschienen bei Asher. Die Bände 15 und 16 im Berliner Verlag Cohn, während die Bände 17 bis 27 in Weimar bei Huschke publiziert wurden.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
27
neu zu übersetzen, die übrigen nicht nur zu verbessern, sondern stellenweise umzugestalten“ waren.97 Die Schlegel-Tieckʼsche Übersetzung ist ein chamäleonartiges Konstrukt des 19. Jahrhunderts, an dem die Bearbeiter, Verlage und besonders die Vertreter der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft einen enorm hohen Anteil hatten. Eigentlich betrieb man mit den permanenten Schlegel-Tieck-Revisionen nur reine „Fassadenverehrung“ und war letztendlich dafür verantwortlich, dass sich „[g]estützt auf ihre Autorität, […] die Epidemie der Textverbesserung mit unzulänglichen Mitteln“ ausbreitete und so den eigentlichen Text verwässerte und verzerrte.98 Nach Hans Rothe ging es der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft vornehmlich darum, „die Herrlichkeit der Schlegel-TieckÜbersetzung vor aller Augen [zu] rücken und bohrte sie im gleichen Moment von allen Seiten an“. Despektierlich, aber dennoch richtig, fährt er seine Invektive fort: Jeder, der eine Metzgersäge zu handhaben weiß, löst bis auf den heutigen Tag zuckende Teile aus dem Leib des Schlegel-Tieck-Werks, verbindet sich – bis auf den heutigen Tag! – mit stereotypen Phrasen aus dem eigenen ärmlichen Wortschatz, auch wenn er nur oben drüber schreibt [sic!]: von Schlegel, oder von Ludwig Tieck […], dann ist gewahrt und erfüllt, was die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft 1867 gewollt hat, als sie ihre verworrene Ausgabe auf den Markt brachte.99
Sicherlich hat die permanente Revision des Schlegel-Tieckʼschen Textes durch Vertreter der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft auch andere Bearbeiter und Verlage motiviert, diese Übersetzungen als Grundlage ihrer eigenen Überarbeitungen bzw. Neuübersetzungen zu benutzen. Methodisch lassen sich hier grob zwei Gruppen unterscheiden: „die einen wollten, man solle die Schlegelschen Texte zwar belassen, aber ‚verbessern‘, die andern wollten sie durch neue ersetzt haben.“100 Zu Recht stellt Ludwig Fulda, Bühnenautor und selbst Shakespeare-Übersetzer, bereits 1901 die berechtigte Frage, wer eigentlich diese „Restaurierungsarbeiten“ durchführen könne bzw. dürfe. Umgehend erfolgt seine dezidierte Absage an Gelehrte, denn diese hätten lediglich „das Recht, festzustellen, was
97
98 99
100
Hierzu das „Vorwort“ des Präsidiums der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. In: Schlegel/Tieck 1797 (Anm. 87), Bd. 1, S. V–VIII, hier S. VII. Weiter heißt es: „Für die Revision, die Verbesserung und die theilweise neue Bearbeitung des Textes wie für die Ausstattung desselben mit Einleitungen und Anmerkungen ist es uns gelungen anerkannte Meister der Uebersezungskunst zu gewinnen.“ (S. VIII). Genannt werden: Wilhelm Herzberg, Alexander Schmidt, Friedrich-Karl Elze, Friedrich August Leo und Georg Herwegh. Nicolaus Delius beriet bei textkritischen Fragen. Rothe 1961 (Anm. 7), S. 426. Rothe 1961 (Anm. 7), S. 426. Die Äußerung Rothes wird man freilich vor den Aktivitäten der Gesellschaft gegenüber dem Übersetzer sehen müssen. Hierzu als erster Überblick Ruth Freifrau von Ledebur: Der Fall Rothe: „Gegen Rothe streiten, heißt für Shakespeare kämpfen“. In: Dies.: Der Mythos vom deutschen Shakespeare. Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft zwischen Politik und Wissenschaft 1918–1945. Weimar 2002, S. 214–233. Hierzu auch der umfangreiche Bestand im Goethe- und SchillerArchiv – Klassik Stiftung Weimar unter der Signatur: GSA 148/115: Hans Rothe, Übersetzung: 1936–1940, 116 Blatt. Richard Flatter: Eine Einleitung. In: Shakespeare. Neu übersetzt von Richard Flatter. Bd. 1. Wien 1952, S. 9–25, hier S. 10.
28
Christa Jansohn
falsch und ungenau“ wäre. Die künstlerische Umgestaltung indes wäre ausschließlich „Sache eines Dichters“. Schließlich lehnt Fulda insgesamt eklektische Übersetzungsrevisionen ab, zumal eine alte Übersetzung nur durch ein „vollkommeneres Kunstwerk verdrängt, aber nicht im Einzelnen verbessert werden“ könne.101 Genau diese Vorgehensweise ist aber symptomatisch für den Umgang mit dem Schlegel-Tieckʼschen Shakespeare, wo der Text oft hier und da restauriert wird, um ihn so als monumentales, formvollendetes Kunstwerk vor dem Verfall zu retten. Die Schwierigkeit bzw. gleichzeitig der Reiz für künftige Forschungen besteht in der Erstellung eines möglichst authentischen Textes einerseits und detaillierter Analysen einzelner Weiterverarbeitungen bzw. Revisionen der Schlegel-Tieckʼschen-Übersetzungen andererseits, die von der Motivation der Bearbeiter bzw. Verleger bis hin zur Aufnahme beim Lesepublikum reichen sollten. Eine gewichtige Sonderstellung sowohl innerhalb der Editionsgeschichte als auch der Rezeptionsgeschichte bilden die Habilitationsschrift sowie die beiden Ausgaben von Michael Bernays, zumal er außer offensichtlichen Korrekturen für die erste Auflage seiner zwölfbändigen Edition (1871–1873) die von ihm entdeckten zwölf Manuskripte Schlegels und für die zweite Auflage (1891) auch die Manuskripte Baudissins bei seiner Arbeit berücksichtigte.102 Ob dies im Sinne der Übersetzer gewesen ist, darüber sollte weiter nachgedacht werden, zumal vor allem Schlegel seine ShakespeareÜbertragungen als eigenständiges Kunstwerk betrachtete,103 und für ihn jede Revision bzw. willkürliche Korrektur von fremder Hand gleichbedeutend mit der Veränderung eines Originalwerkes war, weshalb er sich bekanntlich sehr erbost über textliche Veränderungen durch Ludwig Tieck äußerte, sich gleichzeitig aber selbst nicht in der Lage sah, seine Übertragungen sorgfältig zu überwachen und alle Dramen ins Deutsche zu übertragen.104 Und so schreibt er am 30. November 1839 an seinen Verleger Reimer: Als Sie im August 38 hier waren, hatte ich meine Übersetzung in so langen Jahren nicht angesehen, daß ich in der Tat nicht wußte, wie vieler Verbesserungen sie noch bedürftig sein möchte. Die bloße Wegräumung der Druckfehler und der Tieckschen Veränderungen hätte 101
102
103
104
Brief Ludwig Fuldas an Alois Brandl vom 24. März 1901. Wiedergegeben in Alois Brandl: Ludwig Fulda, Paul Heyse und Adolf Wilbrandt über die Schlegel-Tiecksche Shakespeare-Übersetzung. In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 37, 1901, S. XXXVIII–LV, hier S. XLIV. Jansohn/Plachta 2021 (Anm. 47), S. 138f. Vgl. auch Goldmann 1981 (Anm. 12), zu den ShakespeareÜbersetzungen vgl. S. 119–133; Sayer 2015 (Anm. 12), bes. S. 93–109, und Roger Paulins Beitrag in diesem Band. Hierzu Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40, hier S. 25. Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl, und Philip Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48, hier S. 46 und S. 48.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
29
ein verständiger Korrektor mittels Vergleichung der ersten Drucke ohne allen Aufenthalt besorgen können. Sie werden sich wohl erinnern, daß ich sowohl von der übergroßen Eile als Wohlfeilheit abriet. Gute Waare ist ihren Preis wert. Gut Ding will Weile haben.105
Schlegel mochte sich zwar „als der Autor eines neuen Textes“106 verstanden haben; die finale Textkonstitution seiner Shakespeare-Übertragungen überließ er trotzdem anderen, zumal er nicht die Zeit hatte und auch nicht die Mühe des eigenen Korrekturlesens auf sich nehmen wollte. So schreibt er am 18. November 1840 an seinen Verleger Reimer: Anbei sende ich Ihnen den Entwurf eines Vertrages über die neue Ausgabe des Shakespeare, den Sie mir bei Ihrem vorletzten Besuche in Bonn zurückliessen. Sie werden sich wohl der Einwürfe erinnern, die ich nach reiferer Überlegung dagegen machte. Als ich nun Hand an die Durchsicht legte, fand ich, dass sie, um gründlich zu sein, sehr viel Zeit und Mühe kosten müsse. Ich äusserte demnach, 10 Frd’or. für jedes Stück würde mir angemessen scheinen, worauf Sie beistimmten. Da ich aber die Durchsicht auf denselben Fuss nicht habe fortsetzen können, so trug ich Bedenken bei Ihrem letzten Besuche hier das für diese drei Stücke insbesondre mir angebotene Honorar anzunehmen. […] Ich empfing bis jetzt von der neuen Ausgabe Band I–III, und dann VII–XII. Ich hatte noch nicht Zeit, irgend etwas zu vergleichen. Ich hoffe, dass die historischen Stücke vollständig enttieckt sind. Dasselbe wünsche ich auch von den übrigen. Unter Tiecks Veränderungen mag sich einiges gute finden, aber es wäre mühsam es herauszusuchen.107
Diese ‚enttieckte‘ Version erschien 1839 bis 1840 in zwölf Bänden und erfuhr in rascher Folge weitere Auflagen.108 Bereits ein Jahr später äußerte Schlegel gegenüber seinem Verleger Georg Andreas Reimer den Wunsch, später einmal seine eigenen Stücke nochmals korrigieren zu wollen.109 Ein Jahr später (8. Dezember 1842) erkundigt er sich erneut bei Georg Ernst Reimer, ob dieser glaube, „dass irgend einmal eine dritte Ausgabe des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare nötig werden könne? und nach dem Verhältnisse des bisherigen Absatzes in welchem Zeitpunkte etwa?“110 Dazu kam es freilich nicht. Offensichtlich wollte bzw. konnte der damals 75-Jährige seiner Shakespeare-Übersetzung nicht mehr seine wache Aufmerksamkeit schenken, denn sie gehörte
105 106
107
108
109
110
KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4614. Rüdiger Nutt-Kofoth: Autor oder Übersetzer oder Autor als Übersetzer? Überlegungen zur editorischen Präsentation von ‚Übertragungen‘ am Beispiel Stefan George. In: editio14, 2000, S. 88–103, hier S. 89. Johann Imelmann: Briefe A. W. Schlegels an Georg Andreas Reimer. In: Zeitschrift für Vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur N.F. 2, 1889, S. 445f., hier S. 445, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3833. Hansjürgen Blinn und Wolf Gerhard Schmidt: Shakespeare – deutsch. Bibliographie der Übersetzungen und Bearbeitungen. Zugleich Bestandsnachweis der Shakespeare-Übersetzungen der Herzogin-AnnaAmalia-Bibliothek Weimar. Berlin 2003, C 370(*). Die 6. Octav-Ausgabe erschien 1863–1865. So schreibt Schlegel am 29. November 1841 an Reimer: „Wenn mir Gott Leben und Gesundheit verleihet, so wünschte ich wohl, die sämtlichen von mir übersetzten Stücke Shakspeareʼs durchzucorrigiren. Es ist eine Arbeit, die sich recht gut zu schlaflosen Nachtstunden schickt.“ KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/783. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-04-20/letters/view/2745.
30
Christa Jansohn
eindeutig dem Dichter und damit einer früheren Lebensphase an. Als Gelehrter hat Shakespeare ihn nie interessiert; die englische Shakespeare-Forschung war ihm, anders als etwa Eschenburg, nur rudimentär bekannt, auch an einen Kommentar oder gar einen zweisprachigen, textkritischen Abdruck hat er nie gedacht.111
Ohne das Engagement seines Verlegers Georg Andreas Reimer, Schlegels Frau Caroline, deren aktiver Anteil an der Übersetzung ihres Mannes zwar bekannt, aber bisher noch nicht extensiv genug analysiert wurde,112 aber vor allem ohne die Fortführung der Übersetzung ab 1825 durch Dorothea Tieck und den Grafen Wolf von Baudissin unter der umtriebigen Ägide Ludwig Tiecks wäre eine Gesamtübersetzung sicherlich nie zustande gekommen. Die erste Gesamtausgabe erschien – wie bereits erwähnt – 1833, eine zweite folgte 1839/40 und eine dritte 1843/44. Während die Rekonstruktion eines möglichst authentischen Texts aufgrund einer nicht geringen Anzahl von Varianten innerhalb der oben genannten Editionen bisher nur eklektisch vorgenommen wurde und editorisch kein leichtes Unterfangen ist, ist die Zusammenstellung einer „Liste der Übersetzungen von Schlegel, D. Tieck und Baudissin“ unproblematisch. Die folgende Zusammenstellung von Armin-Gerd Kuckhoff (1912–2002), dem renommierten Theaterwissenschaftler und Rektor der Theaterhochschule Leipzig, macht auf einen Blick den zeitlichen Rahmen sowie die Beteiligung der beiden Übersetzer und Dorothea Tiecks deutlich; nachzutragen wäre noch die Beteiligung Caroline Schlegels. 1. 2. 3. 4.
König Johann Richard II. 1/Heinrich IV. 2/Heinrich IV.
111
Knödler (Anm. 104), S. 43. Zu Schlegels Umgang mit seinen Texten vgl. auch Schlegels Brief an Reimer von Ende Dezember 1837/Anfang Januar 1838, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-0721/letters/view/4825. Zitiert in Auszügen in: Jansohn/Plachta 2021 (Anm. 47), S. 141f., Anm. 93. In diesem Kontext sollte auch die anonyme Besprechung des ersten Bandes der Schlegel-Übersetzung (1797) detaillierter analysiert werden, wo es heißt: „Einen Commentar hat Hr. S. nicht geben wollen, nicht einmal irgendwo eine erklärende Note beygefügt. Wenn dies einerseits beweiset, wie viel er auf die innere Klarheit und Richtigkeit seiner Uebersetzung rechnen konnte, so scheint er auch dabey auf den fernen Gebrauch der Eschenburgischen Uebersetzung gerechnet zu haben, welche jetzt zum zweytenmale gedruckt wird; ein Zug edler Denkart, welche die Arbeit eines ruhmwürdigen Vorgängers, indem man sich bewusst ist sie übertroffen zu haben, darum nicht für unbrauchbar erklären will.“ Zitiert nach: N.N.: Shakspeare’s dramatische Werke übersetzt von August Wilhelm Schlegel. – Erster Theil. 1797 Vl u. 200 S. 8 (Auf geglättetem Velinpapier, sauber broschirt 1 Rthlr. 16. gr.; auf Schreibpapier 1 Rthlr.). In: Allgemeine Literatur-Zeitung, Nr. 347, Berlin, 1. November 1797, Sp. 273–282, hier Sp. 282. Hierzu Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel. Paderborn 2017, S. 74: „Obwohl Carolines Handschrift auf vielen Manuskripten zu finden ist, hat Schlegel Carolines Mitarbeit mit keiner Silbe erwähnt. Sogar der egozentrische Ludwig Tieck, als er viel später seine Shakespeare-Übersetzungen, die sogenannte ‚Schlegel-Tieck’sche‘, publizierte, erklärte in der Vorrede, ein ‚Freund‘ (seine Tochter Dorothea) habe mitgewirkt. Nicht einmal das hat Schlegel fertiggebracht. Der Gerechtigkeit halber hätte auf dem Titelblatt stehen sollen: ‚Übersetzt von August Wilhelm Schlegel unter Mithilfe von Caroline Schlegel‘.“ In der englischen Version von Paulins Schlegel-Biographie (Anm. 56) findet sich als Beispiel ein Faksimile der Manuskript-Seite von Romeo und Julia (1797) in Carolines Hand (Akt II, Szene 1), S. 97.
112
SCHLEGEL SCHLEGEL SCHLEGEL SCHLEGEL
1799 1799 1799 1799
31
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
5. Heinrich V. 6. 1/Heinrich VI. 7. 2/Heinrich VI. 8. 3/Heinrich VI. 9. Richard III. 10. Heinrich VIII. 11. Romeo und Julia 12. Hamlet 13. Othello 14. Titus Andronicus 15. Julius Cäsar 16. Coriolan 17. Antonius und Cleopatra 18. König Lear 19. Macbeth
SCHLEGEL SCHLEGEL SCHLEGEL SCHLEGEL SCHLEGEL Baudissin SCHLEGEL SCHLEGEL Baudissin Baudissin SCHLEGEL Dorothea Tieck Baudissin Baudissin Dorothea Tieck
1800 1801 1801 1801 1809 1818 1797 1793 1832 1831 1797 1831 1831 1832 1833
Die Übersetzung des Macbeth wurde von Schlegel begonnen, aber dann nicht weitergeführt. In die späteren Ausgaben nach 1840 wurden die von Schlegel übersetzten Stellen wiederaufgenommen, statt der Baudissin’schen Übersetzung. Es sind dies folgende Szenen: I.1 – die 32 ersten Verse von I.2 – der Hexenchor in IV.1. 20. Timon von Athen 21. Troilus und Cressida 22. Komödie der Irrungen 23. Liebes Leid und Lust 24. Die beiden Veroneser 25. Ein Sommernachtstraum 26. Der Kaufmann von Venedig 27. Der Widerspenstigen Zähmung 28. Viel Lärm um nichts
Dorothea Tieck Baudissin Baudissin Baudissin Dorothea Tieck SCHLEGEL SCHLEGEL Baudissin Baudissin
1832 1832 1831 1833 1832 1797 1799 1831 gedruckt 1830
Viel Lärm um nichts gilt jedoch als die erste Übersetzung eines Shakespeare-Dramas durch Baudissin. 29. Die Lustigen Weiber von Windsor 30. Was Ihr wollt 31. Wie es Euch gefällt 32. Ende gut, alles gut 33. Maß für Maß 34. Cymbeline 35. Wintermärchen 36. Der Sturm
113
Baudissin SCHLEGEL SCHLEGEL Baudissin Baudissin Dorothea Tieck Dorothea Tieck SCHLEGEL
1832 1797 1799 1832 1831 1833 1832 1798113
Armin-Gerd Kuckhoff: Das Drama William Shakespeares. Berlin 1964 (Schriften zur Theaterwissenschaft. Schriftreihe der Theaterhochschule Leipzig. 3/I), Tabelle auf S. 833f.
32
Christa Jansohn
6. Einige Schlussgedanken: Die Schlegel-Tieck’sche Shakespeare-Übersetzung: Forschung und kein Ende? Jede Uebersetzung ist eine unbestimmte, unendliche Aufgabe.114 In dem vorliegenden Artikel konnten nur einige Forschungsdesiderata und Probleme vornehmlich aus persönlicher (und anglistischer) Sicht grob angerissen werden: Diese haben nicht nur Wolfgang Clemens eingangs zitierte Anmerkung bestätigt, dass eine „Aufzählung der verschiedenen Gebiete und Probleme, mit denen sich die Shakespeare-Wissenschaft befaßt hat und noch heute beschäftigt […] fast einen Katalog aller Methoden und Fragenstellungen [gleicht], die zur Philologie im weitestem Sinne überhaupt gehören.“115 Ja, man kann sagen, dass weitere theoretische und praktische Ansätze hinzugekommen sind – hier seien nur die der Digital Humanities genannt –,116 was freilich nicht immer die Forschungssituation begünstigt, vielmehr sogar beeinträchtigen kann. Die von mir angeführten Themenkomplexe, denen meines Erachtens in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, müssen durch die in den anderen Beiträgen genannten Desiderata ergänzt werden. Sie reflektieren auch die stetig wachsende Spezialisierung innerhalb der einzelnen philologischen Fächer. Diese wird man darüber hinaus mit den diversen fachinternen Erwartungen v.a. an den wissenschaftlichen Nachwuchs in Verbindung bringen müssen, hat sie zumindest in meinem Fach dazu geführt, dass zum Beispiel seit Jahrzehnten theaterhistorische bzw. manuskriptologische, vor allem aber editionswissenschaftliche Fragestellungen für den beruflichen Werdegang wenig förderlich waren. Selbst Qualifikationsarbeiten im Bereich der Renaissance nehmen stetig ab, wie die wenigen Bewerbungen für freie Stellen zeigen. Diese Entwicklung findet ihren Fortgang im schulischen Curriculum. So wurden die Werke Shakespeares und ihre deutsche Rezeption in den Schulen schon lange vom Lehrplan ausgemustert; vielmehr werden hier meist nur noch Auszüge besprochen, die in kulturwissenschaftliche Fragestellungen eingebettet werden. Als stellvertretendes Beispiel wird im Folgenden aus dem Kernlehrplan von NRW zitiert, wo Shakespeares Œuvre mit folgenden Kompetenzerwartungen verknüpft wird. So gilt für den Leistungskurs: Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Text- und Medienkompetenz in exemplarischer und kritischer Auseinandersetzung mit einem repräsentativen und geschlechtersensibel ausgewählten Spektrum soziokulturell relevanter [...] literarischer Texte [...] dramatische
114
115 116
Friedrich Schlegel: Zur Philologie. II. In: KFSA, Bd. XVI: Schriften aus dem Nachlaß. Fragmente zur Poesie und Literatur. Erster Teil. Hrsg. von Hans Eichner. Paderborn 1981, S. 60 [18]. Clemen 1964 (Anm. 28). Hierzu vgl. etwa den Beitrag von Claudia Bamberg und Thomas Burch sowie die mehr theoretischen Ausführungen von Rüdiger Nutt-Kofoth und Katrin Henzel in diesem Band.
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
33
Texte: Auszüge aus einem oder aus verschiedenen Shakespeare-Dramen, ein zeitgenössisches Drama, Auszüge aus einem Drehbuch.117
Im Grundkurs steht Shakespeare indes gar nicht mehr unter den literarischen Texten, sondern nur noch unter der Rubrik „medial vermittelter Texte“, wo unter „auditive Formate: ein Spielfilm, Auszüge aus einer Shakespeare-Verfilmung, documentary/feature, news“ angegeben ist.118 Aber auch das Theater, wo Shakespeare nach wie vor eine dominante Rolle spielt, hat sich schon lange – in der ehemaligen Bundesrepublik etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts – vom Schlegel-Tieck’schen Text verabschiedet. Heißt es noch 1964 im Bühnenbericht 1963 der gerade gespaltenen Deutschen Shakespeare-Gesellschaft West: „Noch immer erreicht die Schlegel-Tieck’sche Übertragung, die allerdings oft bearbeitet wird, mit 60 Inszenierungen noch 60,8 % aller Inszenierungen“,119 so liest man wenige Jahre später im Bühnenbericht 1970: Unsicherheit herrscht weit mehr noch als zuvor in der Frage der zu wählenden Übersetzung, und sie veranlaßt sicher manche Bühne, Shakespeare nicht zu spielen. Insgesamt 36 Übersetzer werden genannt. Dazu kommen die Bearbeiter, die nicht nur Schlegel-Tieck umarbeiten, sprachlich modernisieren und zeitgemäßer machen. […] Nicht mehr ein Fünftel von 108 verglichenen Inszenierungen folgte Schlegel-Tieck (20). Dabei wird geschieden zwischen den Übersetzungen A.W. Schlegels, zu denen man sich eher entschließt, und denen von Dorothea Tieck und vor allem Wolf Graf Baudissin, die als besonders bearbeitungsbedürftig angesehen werden.120
Die Zahlen für die Bühnen der ehemaligen DDR müssten hier freilich zum Vergleich hinzugezogen und weiter analysiert werden. Heute spielt der Anteil der SchlegelTieck’schen Übertragungen im Theater also keine nennenswerte Rolle mehr, wie die Katalogsuche unter dem wichtigen Branchenportal, www.theatertexte.de, bestätigt, wo mit 35 Treffern die Übersetzungen von Frank Günther zahlenmäßig am häufigsten vertreten sind, während die Katalogsuche zu Shakespeare und Schlegel nur noch 5 Treffer, Baudissin 2 und Tieck gar keinen Treffer erzielt.121
117
118
119 120
121
Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Englisch (Heftnummer 4704), S. 43, https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/e/KLP_GOSt_Englisch.pdf. Kernlehrplan für die Sekundarstufe II (Anm. 116), S. 34: medial vermittelter Texte / auditive Formate: podcasts, radio news, songs / audiovisuelle Formate: ein Spielfilm, Auszüge aus einer ShakespeareVerfilmung, documentary/feature, news / digitale Texte: blogs, Internetforenbeiträge. Klaus Brinkmann: Bühnenbericht 1963. In: Shakespeare Jahrbuch 100, 1964, S. 232–247, hier S. 233. Klaus Brinkmann: Bühnenbericht 1970. In: Deutsche Shakespeare-Gesellschaft West. Jahrbuch 1971, S. 191–205, hier S. 198. Siehe https://www.theatertexte.de/nav/2/2/1.
34
Christa Jansohn
Man wird es vor diesem Hintergrunde schwer haben, gegenüber dem anglistischen Fachkollegium, Schulministerien sowie dem an Shakespeare interessierten Laien und Theaterbesuchern arbeitsintensive Forschungen im Bereich der Shakespeare-Übersetzung Schlegels und des Tieck-Kreises zu rechtfertigen. Noch diffiziler ist zudem die Rekrutierung besonders jüngerer Forscher aus der Anglistik, zumal hier nur noch wenige die Kompetenzen mitbringen, die zur Bearbeitung der in dem vorliegenden Artikel angesprochenen Forschungslücken notwendig sind. Dies mag in der Germanistik anders sein, wo sich momentan eine stärkere Hinwendung zur Romantik feststellen lässt. Für Vertreter meines Fachs und für die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft bedeutet die Beschäftigung mit der Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzung oft nur eine nostalgische Hinwendung zur Shakespeare-Begeisterung im 19. Jahrhundert. Will man diese für die Forschung und den allgemein interessierten Laien nutzbar machen, so ist der Ruf nach einer bisher fehlenden historisch-kritischen Ausgabe – sei sie gedruckt oder digital – sicherlich nachvollziehbar und richtig. Allerdings haben meine Ausführungen sicherlich auch gezeigt, wie schwierig es sein wird, einen möglichst authentischen Text zu konstituieren, zumal bereits zu Lebzeiten August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises deren Übersetzung einer permanenten, teils radikalen Revision unterworfen wurde. Wir haben es quasi mit einem stets sich wandelnden Text zu tun, was sowohl mit der Textsorte der Übersetzung (Sprachwandel etc.) als auch mit dem instabilen Original zu erklären wäre. Damit stellt sich die Frage nach der eigentlichen Authentizität einer Übertragung überhaupt. Anders als beim Original mit einem möglichst festen Ausgangstext ist eine Übersetzung grundsätzlich und stets einem Wandel unterworfen, vor allem dann, wenn der Übersetzer oder die Übersetzerin im Laufe der Zeit selbst kein genuines Interesse mehr an der Arbeit zeigt und Dritte in die deutschen Versionen eingreifen. Selbst die Textkonstitution wirft demnach mehr Fragen und Probleme als Antworten auf, sondern unterstreicht nur, dass die Beschäftigung mit der Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzung ein mühevolles Unterfangen ist, das die Fachkompetenz verschiedenster Disziplinen verlangt, was wiederum eine Herausforderung bedeutet. Forschung und kein Ende? wird man sich evtl. nach der Lektüre der in diesem Band abgedruckten Beiträge fragen. Wie wird es nun weitergehen, kann es überhaupt weitergehen? Eine ähnliche Frage stellte sich 1964 auch Hans Mayer, der anlässlich des Jubiläumsjahres Shakespeares eine mehrteilige Radiosendung im WDR anbot. Seine Bemerkung in der letzten Sendung sollte auch Motto für unsere Beschäftigung mit der Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzung sein: Wie wird es weitergehen? Immer wieder Shakespeare und die Deutschen. Seit das Werk dieses großen britischen Stückeschreibers über den Kanal auf den Kontinent gelangte und auch nach Deutschland, seit sich die Übersetzer – Geschlecht auf Geschlecht – daran machten, Shakespeares Werk für unsere Sprache zu gewinnen, wobei auch jede Art der Nachdichtung zur literarischen Selbstaussage wurde, ist eine große deutsche Literatur aus diesen Keimen entstanden. Der Vielfalt der Formen entsprach die Vielfalt der Themen. Hier entstand große deutsche Kritik und Essayistik, erwuchs shakespearisierende Epik und Lyrik, entstand – von Goethes Götz bis zum Spätwerk Bertolt Brechts – immer wieder genuine Dramatik in
Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben
35
der Auseinandersetzung mit Shakespeares Schatten. Shakespeare und kein Ende? Auch die dramatische Skizze eines Günter Grass zum Thema Coriolan oder die Hamlet-Reflexion Martin Walsers wird hier kein Ende bedeuten. Shakespeare und die Deutschen. Davon wird noch oft die Rede sein.122
Und ich möchte hinzufügen: Auch über den Schlegel-Tieck’schen Shakespeare ist das letzte Wort noch nicht gefallen.
122
Hans Mayer: Shakespeare und die Deutschen. Eine Sendefolge von Hans Mayer (WDR: 7. Juni bis 16. Juli 1964). Hrsg. von Christa Jansohn. Mit einer Einleitung von Heinrich Bleicher. Münster 2023, S. 117f.
Thomas Haffner und Thomas Stern
Der Nachlass August Wilhelm Schlegels an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) geht letztlich auf die von Kurfürst August von Sachsen (1526–1586) gegründete Bibliothek zurück.1 Die auf dem Einband geprägte Jahreszahl 1556 auf Büchern aus der Sammlung des Fürsten gilt als Gründungsjahr. Neben der Sammlung gedruckter Bücher hat auch das Sammeln von Handschriften und Nachlässen in der SLUB und ihren Vorgängerinstitutionen eine lange Tradition. Ende des 16. Jahrhunderts waren rund 200 Handschriften vorhanden,2 die ersten Familienarchive gelangten im 17. Jahrhundert in die Bibliothek. Heute werden in der Abteilung Handschriften, Alte Drucke und Landeskunde über 15.000 Manuskripte, ca. 370.000 Autographen und rund 500 Nachlässe von Künstlern, Literaten, Wissenschaftlern und Musikern mit überwiegend sächsischem Bezug bewahrt, erschlossen und der Forschung zugänglich gemacht. Zum Bestand gehören auch etwa 700 mittelalterliche abendländische Handschriften, etwa 1.000 orientalische Handschriften und eine Stammbuchsammlung mit etwa 450 Exemplaren. Mit Luthers Psalmenkommentar, seinem Manuskript zu einer der ersten Vorlesungen über die Psalmen an der Universität Wittenberg,3 oder den Dresdner Corvinen, zwei Handschriften von insgesamt 216 weltweit erhaltenen Büchern aus der Sammlung des ungarischen Königs Matthias Corvinus,4 beinhaltet die Sammlung der SLUB Stücke, die mittlerweile zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehören. Darüber hinaus bewahrt die Bibliothek eine von vier noch bekannten Maya-Handschriften, den Codex Dresdensis,5 der dauerhaft in der Schatzkammer der SLUB ausgestellt wird. Seit 2005 entwickelt die Bibliothek zudem eine einzigartige kulinarische Sammlung mit mittlerweile über 50.000 Medien, darunter Menükarten, Kochbücher, Fotografien und weiterführende Literatur zur Esskultur, und gliedert sich in die lange Tradition der Kochkunst und Esskultur am Dresdner Hof sowie die sächsischen Publikationen zur Kulinarik ein.
1
2 3 4
5
Vgl. grundsätzlich: Das ABC der SLUB, Lexikon der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Dresden 2006 (Schriftenreihe der SLUB. 11); Konstantin Hermann, Roman Rabe: Zur Geschichte des Dresdner Bibliothekswesens. In: Dresdner Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Leipzig 2014, S. 9–36. Inventarii über die Churfürstliche Sächsische Librarey zu Dreszden (Bibl.Arch.I.Ba,Vol.28/30). Martin Luther: Commentarius in psalmos Davidis (Mscr.Dresd.A.138). Roberto Valturio: De re militari (Mscr.Dresd.R.28.m); Marcus Tullius Cicero: Epistulae ad familiares (Mscr.Dresd.Dc.115). Codex Dresdensis (Mscr.Dresd.R.310).
https://doi.org/10.1515/9783111017419-004
38
Thomas Haffner und Thomas Stern
Von den gegenwärtig etwa 370.000 Autographen im Bestand der SLUB befindet sich der weitaus größte Teil in den schriftlichen Nachlässen. Neben anderen bedeutenden Nachlässen verwahrt die Bibliothek auch den größten Teil des schriftlichen Nachlasses des Kritikers und Übersetzers August Wilhelm von Schlegel (1767–1845),6 der nach dessen Tod vorerst an seinen ebenfalls in Bonn wirkenden Freund Eduard Böcking (1802–1870) überging. Seit 1794 besuchte Schlegel häufig Dresden und auch die Kurfürstliche bzw. Königliche Bibliothek und stand seit dieser Zeit in Verbindung zu Dresden. Daher bemühte sich die Bibliothek nach Böckings Tod um die Übernahme des Nachlasses und konnte diesen 1873 erwerben. Den Grundstock des Bestandes bilden unter der Signatur Mscr.Dresd.e.90 rund 650 Briefe von (vgl. Abb. 3) und 3.100 Briefe an Schlegel (vgl. Abb. 4a und 4b), Gedichte und Übersetzungen, Vorlesungsmanuskripte sowie Aufzeichnungen zu wissenschaftlichen Forschungen. Unter der Signaturengruppe Mscr.Dresd.e.90,XXII,1 bis 14 findet man Schlegels Originalmanuskripte seiner Shakespeare-Übersetzungen (vgl. Abb. 2). Überliefert sind Hamlet, König Heinrich IV., König Heinrich V., König Johann, Julius Caesar, Der Kaufmann von Venedig, Richard II., Romeo und Julia, Ein Sommernachtstraum, Der Sturm sowie Was ihr wollt. Vor 1945 war der Nachlass durch Otto Fiebiger (1869–1946), einen langjährigen Mitarbeiter der Handschriftensammlung der Königlichen Öffentlichen Bibliothek, in einem Spezialkatalog erschlossen worden. Bei der Bombardierung Dresdens am 2. März 1945 erlitt der Nachlass Schlegels zusammen mit anderen kostbaren Handschriften erhebliche Wasserschäden im durchnässten Tiefkeller des Japanischen Palais, in dem sich die Bibliothek seit 1786 befand. Die ungebundenen Teile wurden auseinandergeschwemmt und der Spezialkatalog Fiebigers zerstört. Die Nachlassteile wurden im April 1945 auf Schloss Weesenstein getrocknet. Die anschließende Ordnung erfolgte durch den ehemaligen Bibliotheksdirektor und Ruheständler Martin Bollert (1876–1968) mittels 77 Gruppen-Überschriften Fiebigers, die erhalten geblieben waren. In den 1960er Jahren übernahm Helmut Deckert (1913–2005) die Weiterführung dieser Tätigkeit und schloss sie mit einem rekonstruierten Spezialkatalog7 zum Nachlass im Jahr 1981 ab. 1998 konnte der Nachlassbestand noch einmal durch die Erwerbung von 585 Briefen erweitert werden, die bereits 1929 auf Schloss Coppet am Genfer See aufgefunden wurden und seitdem unter der Signatur Mscr.Dresd.App.27128 bewahrt werden. Von 2012 bis 2020 wurde neben den Dresdner Nachlassteilen die gesamte überlieferte Korrespondenz August Wilhelm Schlegels in einem von der Deutschen
6
7
8
Vgl. Perk Loesch: Der Nachlass August Wilhelm Schlegels in der Handschriftensammlung der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. In: Dichternachlässe. Literarische Sammlungen und Archive in Regionalbibliotheken von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Frankfurt a.M. 2009, S. 183–193. Rekonstruierter Spezialkatalog des Nachlasses von August Wilhelm von Schlegel, – Mscr.Dresd.e.90. Dresden 1981, http://digital.slub-dresden.de/id286087677 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 30.11.2022 gesehen). Spezialkatalog zum schriftlichen Teilnachlaß August Wilhelm Schlegel, – Mscr.Dresd.App.2712. Dresden 2000, http://digital.slub-dresden.de/id286071053.
Der Nachlass August Wilhelm Schlegels an der SLUB Dresden
39
Forschungsgemeinschaft geförderten Kooperationsprojekt zwischen der PhilippsUniversität Marburg, dem Trier Center for Digital Humanities und der SLUB Dresden in einer digitalen Edition9 zusammengefasst. Damit sind über 5.000 Briefe von über 750 Korrespondenten online zugänglich und indexiert.
Katalog:
Abb. 1: Shakspeareʼs dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Bd. 1 (Romeo und Julia. Ein Sommernachtstraum). Leipzig: Unger 1797, Signatur: D.O.283,1,8-1 (Foto: SLUB/Deutsche Fotothek).
Das Exemplar aus der Sammlung „Deutsche Originalausgaben“ im Bestand der SLUB enthält zu Beginn der 3. Szene des 2. Aufzugs des Sommernachtstraums ein selten erhaltenes ausfaltbares Notenblatt mit der Vertonung des Liedes der Elfen von Johann Friedrich Reichardt (1752–1814). Der Jurist, Musiker, Musikschriftsteller, Komponist und preußische Hofkapellmeister Reichardt erwarb 1794 einen Garten in Giebichenstein bei Halle, wo sich bedeutende Musiker und Literaten der Romantik trafen. Seine ca. 1.500 Lieder basieren zumeist auf zeitgenössischer Dichtung. Zu Shakespeares Sturm komponierte er eine Oper und zu Macbeth eine Schauspielmusik.
9
KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de.
40
Thomas Haffner und Thomas Stern
Abb. 2: August Wilhelm Schlegel: Sommernachtstraum, Mscr.Dresd.e.90,XXII,11, S. 18/19 (S. 38/39), (http://digital.slub-dresden.de/id406368066/42, und http://digital.slub-dresden.de/ id406368066/43).
Während die Elfenkönigin Titania mit ihrem Gefolge im Erstdruck zu Beginn der 3. Szene des 2. Aufzugs auftritt, geschieht dies im Autograph zu Beginn der 5. Szene. Das hier als „Feenlied“ bezeichnete Elfenlied wird von männlichen Feen statt Elfen gesungen. Der Wortlaut des Manuskripts mit etlichen Korrekturen unterscheidet sich erheblich vom gedruckten Text.
Der Nachlass August Wilhelm Schlegels an der SLUB Dresden
41
Abb. 3: Brief August Wilhelm Schlegels an Georg Andreas Reimer, Bonn 7. April 1835, Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.18,Nr.61, S. 1, http://digital.slub-dresden.de/idDE-611-35028/219: „Die unter Tiecks Leitung vervollständigte Übersetzung des Shakspeare ist jetzt seit zwei Jahren beendigt. Ich kann mich nicht rühmen, sie ganz gelesen, geschweige denn, sie genau mit dem Originale verglichen zu haben. Doch haben, wie es scheint, die Gehilfen meines Freundes lobenswerthe Arbeiten geliefert.“
42
Thomas Haffner und Thomas Stern
Abb. 4a und 4b: Brief Ludwig Tiecks an August Wilhelm Schlegel, Berlin [12. Dezember 1797], Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.28,Nr.60, S. 3–4, http://digital.slub-dresden.de/idDE-611-36934/241, http://digital.slub-dresden.de/idDE-611-36934/242: „Ihre Uebersetzung, wenn sie vollendet ist, wird es den Deutschen erst möglich machen, den Shakspeare zu verstehn und zu achten.“
Thomas Bürger
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung Ein Plädoyer für die Digitalisierung der Dresdner Quellen zur Romantik
Nach der Digitalen Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels mit 5.322 Briefen1 liegt es nahe, nun den ganzen schriftlichen Nachlass dieses großen europäischen Literaturvermittlers zu digitalisieren, weit zu öffnen für Anglistik, Romanistik und Germanistik, für die Komparatistik und die Indologie, für die Geschichte der Wissenschaften und des literarischen Lebens in Europa um 1800. Der im Krieg 1945 stark beschädigte Dresdner Autorennachlass ist erst seit den 1980er Jahren nach langjähriger Restaurierung wieder zugänglich.2 In der Marbacher Ausstellung Weltliteratur. Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes3 vor 40 Jahren waren die Dresdner Manuskripte der Shakespeare- und Dante-Übersetzungen nicht vertreten, wohl aus konservatorischen Gründen, aber auch der deutschen Teilung geschuldet, die gemeinsame Forschungsunternehmen erschwerte oder blockierte. Nach der digitalen Edition der Korrespondenz sollte deshalb baldmöglichst eine vollständige Digitalisierung des gesamten Nachlasses als nachholende Forschungsermöglichung erfolgen. Dabei gebührt den Manuskripten der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels höchste Priorität, repräsentieren sie doch die einflussreichste und bis heute wohl schönste poetische Übersetzung Shakespeares in Deutschland. Im Rahmen der in diesem Sammelband dokumentierten Tagung fand eine Exkursion zu einem der sehenswerten literarischen Orte im Umkreis von Dresden statt, dem chinesischen Pavillon im Schlossgarten der Sommerresidenz Pillnitz. Seit den 1830er Jahren kam an diesem Ort ein Kreis von Gelehrten zur Lesung der Dante-Übersetzung König Johanns von Sachsen zusammen, die Accademia Dantesca, der auch die Shakespeare-Übersetzer Ludwig Tieck und Wolf Heinrich Graf von Baudissin angehörten. Die Handschriften der Übersetzungen Shakespeares durch Schlegel und Dantes durch König Johann sind in der Königlich Öffentlichen Bibliothek und heutigen Säch-
1
2
3
Stand Januar 2022 (Version-01-22) nach Beendigung der 7,5-jährigen Förderung durch die DFG. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 16.10.2022 gesehen). Helmut Deckert: Rekonstruierter Spezialkatalog des Nachlasses von August Wilhelm von Schlegel. Dresden 1981, http://digital.slub-dresden.de/id286087677. Weltliteratur. Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. Hrsg. von Reinhard Tgahrt u.a. Marbach 1982 (Marbacher Kataloge. 37), bes. Kap. 25: Schlegel und Tieck, S. 497–522 und Kap. 27: Italienische Dichter, S. 563–574.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-005
44
Thomas Bürger
sischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden erhalten. Sie laden dazu ein, die Kunst- und Musikmetropole Dresden auch als ein Zentrum literarischer Übersetzung und Vermittlung wahrzunehmen. Eine Reihe originaler Schauplätze und Sammlungen sind in den preußisch-sächsischen und in den napoleonischen Kriegen sowie im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Um so mehr Aufmerksamkeit verdienen die erhaltenen historischen Orte, Sammlungen und Werke, als städtebauliche Denkmale, kulturelle Überlieferung und wissenschaftliche Quellen. Verlorene oder vergessene Werk- und Sammlungszusammenhänge, verlorene oder umgenutzte Gebäude könnten und sollten in Zukunft virtuell rekonstruiert, in ihren Zeitschichten und Funktionen, Wechselbeziehungen und Wirkungen – interdisziplinär und multimedial – veranschaulicht werden. Die folgenden Überlegungen werben dafür, die Digitalisierung von Text-, Bildund Musiksammlungen zur Romantik auszubauen und mit dem Ziel ihrer Vernetzung noch konsequenter als bisher Institutionen und Sparten übergreifend, die verschiedenen Disziplinen und Medienformen verbindend zu denken. In den letzten zwanzig Jahren haben Bibliotheken und Archive, Museen und Kunstsammlungen, Denkmalämter und Wissenschaftssammlungen umfangreiche Bestände in zumeist medientypologisch organisierten Sammlungen digital präsentiert, z.B. Handschriften und Drucke, Briefe und Nachlässe, Zeitungen und Zeitschriften, Zeichnungen, Grafiken und Gemälde, Fotografien und audiovisuelle Medien, Partituren und Theaterzettel oder Artefakte und wissenschaftliche Objektsammlungen. Diese enormen Reservoire digitalisierter Quellen für Kontextualisierungen zu nutzen, Bezugsquellen systematisch (über Normdaten) zu verbinden und dabei die Möglichkeiten von Visualisierungen, Rekonstruktionen und auch Simulationen einzubeziehen, ist ein Anliegen der folgenden Anregungen.
1. Die Dresdner Manuskripte der Shakespeare-Übersetzungen Seit 1823 gibt es keine vollständige Neuauflage von Schlegels Shakespeare-Übersetzungen, schreibt Roger Paulin in seiner Biografie über August Wilhelm Schlegel: „Damit wird man Deutschlands größtem Übersetzer nicht gerecht. […] das ist zweifellos eine nationale Blamage.“4 Die deutliche Mahnung des besten Kenners des Kosmopoliten A. W. Schlegel sollte beherzigt werden. Mit den Worten Goethes ist die Übersetzung fremder Werke „für eine Nation ein Hauptschritt zur Kultur“,5 indem „der Autor einer fremden Nation zu uns herüber gebracht“ wird oder „wir uns zu dem Fremden
4
5
Roger Paulin: The Life of August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 529; dt. Übersetzung: August Wilhelm Schlegel. Biografie. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Philipp Multhaupt. Paderborn 2017, S. 321. Johann Wolfgang Goethe: [Rez. zu Johann Peter Hebel:] Allemannische Gedichte. 1804. In: Ders.: Sämtliche Werke. Bd. 14. Zürich 1977, S. 436–444, hier S. 441.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
45
hinüber begeben und uns in seine Zustände, Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen“.6 Wenn mit seinen Worten also „Übersetzer als Vermittler zu verehren“7 sind, dann ist die beste Form der Anerkennung eine gut zugängliche zeitgemäße Ausgabe. Um die Genese von Schlegels Übersetzungen – die von ihm anerkannten und rezipierten Übersetzungen Wielands und Eschenburgs ebenso wie die späteren Fortsetzungen durch Ludwig und Dorothea Tieck sowie den Grafen Baudissin – zu vermitteln, ist eine digitale Präsentation der handschriftlichen und gedruckten Quellen geeignet, die gute Lesbarkeit der Volltexte, die Überprüfbarkeit an den originalen Manuskripten und kontextualisierende Dokumentationen übersichtlich verbindet und so ein breiteres Lesepublikum ebenso wie spezialisierte Nutzergruppen anspricht. In der Wohngemeinschaft der Jenaer Frühromantik (mit seiner Frau Caroline, seinem Bruder Friedrich, mit Schelling u.a.) veröffentlichte Schlegel – neben der gemeinsamen Herausgabe der programmatischen Zeitschrift Athenaeum mit seinem Bruder Friedrich und weiterer Werke – in einem produktiven Schaffensrausch zwischen 1797 und 1801 in schneller Folge sechzehn Shakespeare-Übersetzungen in acht Bänden, mit aktiver Mitwirkung seiner Frau Caroline.8 Ein verheimlichter Nachdruck dieser Übersetzungen durch seinen Berliner Verleger Johann Friedrich Unger hatte die einschneidende, „nie wieder gut zu machende[n] Unterbrechung“ zur Folge, die dem Übersetzer den poetischen Schwung nahm und – mit den Worten Josef Körners – das „großartige Übersetzungswerk“ zum „Torso“ werden ließ.9 Es folgt die lange „traurige Geschichte“10 der Schlegel-Tieck-‚Fiktion‘, hatte Ludwig Tieck in der Fortsetzung der Ausgabe doch die eigentliche Übersetzungsarbeit weiterer sechs Stücke an seine Tochter Dorothea und weiterer 13 Stücke an den Grafen Baudissin delegiert, ohne deren Erwähnung in den Druckausgaben (zum Tieck-Kult siehe Abb. 1).11 6
7
8
9
10
11
Johann Wolfgang Goethe: Zu brüderlichem Andenken Wielands. 1813. In: Ders.: Sämtliche Werke. Bd. 12. Zürich 1977, S 693–716, hier S. 705. Johann Wolfgang Goethe an Johann Heinrich Voß, 22.7.1821. In: Ders.: Sämtliche Werke, Bd. 21. Zürich 1977, S. 454. Shakespeareʼs dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1797–1810: Romeo und Julia, Ein Sommernachtstaum (Bd. 1, 1797), Julius Cäsar, Was ihr wollt (Bd. 2, 1797), Der Sturm, Hamlet (Bd. 3, 1798), Der Kaufmann von Venedig, Wie es euch gefällt (Bd. 4, 1799), König Johann, König Richard II. (Bd. 5, 1799), König Heinrich IV., I u. II (Bd. 6, 1800), König Heinrich V., König Heinrich VI.,I (Bd. 7, 1801), König Heinrich VI., II u. III (Bd. 8, 1802); Bd. 9 (König Richard III.) erschien dann erst 1810. Briefe von und an August Wilhelm Schlegel. Gesammelt und erläutert durch Josef Körner. Bd. 2: Die Erläuterungen. Zürich u.a. 1930, S. 61, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/30126/1. Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48, die Zitate S. 43 und 45. Ölgemälde 1834. Museum der Bildenden Künste Leipzig, Inv.-Nr. I 475, Foto: Punctum Fotografie Bertram Kober, https://www.akg-images.de/archive/David-d%E2%80%99Angers-modelliert-die-Buste-Ti2UMDHU6VN47C.html.
46
Thomas Bürger
Abb. 1: Carl Christian Vogel von Vogelstein (1788–1868): Der Bildhauer David dʼAngers modelliert die Monumentalbüste des Dichterfürsten Ludwig Tieck (Museum der Bildenden Künste Leipzig). Der Hofmaler und Porträtist der Dresdner Romantik, Vogel von Vogelstein, verewigt sich in der Szene auch selbst. Neben Tieck der Malersohn und Tochter Dorothea Tieck, im Hintergrund Graf Baudissin, Baron Stackelberg und Carl Gustav Carus, Ölgemälde 1834, Erstfassung. Siehe auch Abb. 4 im Beitrag von Achim Hölter et al.
Kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag 1817 sah Schlegel „nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit“, dass er selbst die Ausgabe noch vollenden werde, und begründete dies in einem Brief aus Paris an den Verleger Reimer: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“, er sei „der Poesie mehr entfremdet, u. meine herrschende Neigung, ja Leidenschaft ist wissenschaftliches Forschen geworden.“ Er habe sich „einen Europäischen Ruf erworben“, im eigenen Land aber sehe er „keine Zeichen der Anerkennung“ und habe „einigen Grund zur Verstimmung gegen das Deutsche Publicum“.12 12
August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, Paris, 14. April 1817. In: KAWS: https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3730.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
47
Schlegel hatte sich in Paris neuen Studien – über das Altprovenzalische und über das Sanskrit – zugewandt und war zur Fortsetzung seiner durch Reimer 1816–1818 neu aufgelegten Shakespeare-Übersetzungen „nicht mehr imstande […]. Unklugerweise willigte er in den Vorschlag seines Verlegers ein, dass Tieck das Werk vollenden sollte“.13 Eine digitale Präsentation der Schlegel-Manuskripte und der Druckausgabe letzter Hand in Verbindung mit dem Volltext könnte seine unvergleichliche poetische Leistung, seine intensive Arbeit am Text im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führen. Eine digitale Schlegel-Tieck-Gesamtausgabe wiederum erforderte eine modulare Erweiterung um die Handschriften und Druckausgaben der späteren Zeit und könnte auch die übergangenen Leistungen aller Mitwirkenden sichtbar machen. Schlegels Shakespeare-Manuskripte haben – ungeachtet der Wasserschäden aus dem Krieg – ihre Schönheit und Strahlkraft nicht eingebüßt, die Verletzungen verdeutlichen die ständige Gefährdung kultureller Überlieferung und die Notwendigkeit und Chance, mit der konservatorischen Sicherung des Originalmanuskripts immer auch eine hochauflösende digitale Kopie anzufertigen und diese weltweit verfügbar zu machen (vgl. Abb. 2).14 Schlegel brach seine Arbeit am deutschen Shakespeare ab und wandte sich der Übersetzung des Calderón zu, wie zuvor seine Hinwendung zu Shakespeare die Arbeit am Dante abrupt beendet hatte. Im Jahr 1791 hatte er Dante zu seinem „Lieblingsdichter“ erklärt und sein Vorhaben erläutert, mit einer neuen Übersetzung die Göttliche Komödie „bekannter […] unter uns [zu] machen“.15 Dies erreichte er mit der eleganten Versform seiner „Schlegel-Terzinen“, durch „flüssige Lesbarkeit“ und eine „Verbindung von Auswahlübersetzung, Zusammenfassung und Erläuterung“.16 Schlegels Übersetzung von etwa einem Fünftel der Göttlichen Komödie in vier Folgen 1795 trug maßgeblich zum Erfolg von Schillers neuer Literaturzeitschrift Die Horen bei und brachte „den fernen Text nah ans deutsche Publikum“: „Keine spätere Gesamtübersetzung der Commedia“ erreichte „eine solche Prominenz im literarischen Feld“ wie Schlegels Übersetzung.17 Bruder Friedrich Schlegel erhob in einem seiner bekannten Athenaeum-Fragmente aus dem Jahr 1798 Dante, Shakespeare und Goethe zum Dreiklang der modernen Poesie: „Dante’s prophetisches Gedicht ist das einzige System der transzendentalen Poesie, immer noch das höchste seiner Art. Shakspeare’s Universalität ist wie der Mittelpunkt der romantischen Kunst. Goethe’s rein poetische Poesie ist die vollständigste Poesie der Poesie. Das ist der große Dreyklang der modernen Poesie, der innerste und allerheiligste Kreis unter allen engern und weitern Sphären der kritischen Auswahl der Klassiker der neuern Dichtkunst.“18 Hätte August Wilhelm Schlegel den ganzen Dante und den 13 14 15
16
17 18
Paulin 2016 (Anm. 4), S. 320. SLUB Dresden: Mscr. Dresd. e.90,XXII,11, Digitalisat: http://digital.slub-dresden.de/id406368066. August Wilhelm Schlegel: Ueber des Dante Alighieri göttliche Comödie. In: Akademie der schönen Redekünste 1.3, 1791, S. 239–301, die Zitate S. 240, http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1046953850/phys_0022. Stefan Matuschek: Dante als deutscher Klassiker? In: Dante, ein offenes Buch. Hrsg. von Edoardo Costadura und Karl Philipp Ellerbrock. Berlin u.a. 2015 (Publikation anl. der Ausstellung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar), S. 29–45, die Zitate S. 42. Matuschek 2015 (Anm. 16), S. 42. Fragmente. In: Athenaeum 1, 1798, Stück 2, S. 68, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb 10858561?page=256.
48
Thomas Bürger
ganzen Shakespeare übersetzt, wären seine von den Zeitgenossen so geschätzten Übersetzungen auch heute noch auf dem Buchmarkt präsent und erfolgreich. Stattdessen hat er zahlreiche weitere literaturhistorische Pioniertaten vollbracht, die durch gedruckte und digitale Ausgaben ebenfalls neue Publizität verdienen.19
Abb. 2: Schlegels Übersetzung des Sommernachtstraums, kriegsbeschädigtes Manuskript in der SLUB Dresden.
19
Vgl. Jochen Strobel: August Wilhelm Schlegel. Romantiker und Kosmopolit. Darmstadt 2017.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
49
2. Die Dresdner Manuskripte der Dante-Übersetzungen Dass Prinz Johann von Sachsen, seit 1854 sächsischer König, in jungen Jahren seine Liebe zu Dante entdeckte, ist nicht der romantischen Literaturtheorie und der Übersetzung Schlegels, sondern einer zufälligen Erwerbung auf seiner ersten Italienreise zu verdanken: Ende 1821 fand der 20-jährige Prinz in den Gassen der alten Universitätsstadt Pavia in einer der Verkaufsbuden für die Studenten […] im Vorübergehen einen Dante von Biagioli. Das war der Anfang meiner Vorliebe für diesen Dichter, denn von da an las ich täglich während des Fahrens einen oder ein paar Gesänge mit Hilfe eines sehr unvollkommenen Handdictionnaires und des gute Anleitung gebenden Commentars und brachte bis zum Schluß der Reise das ganze Inferno fertig.20
Bald begann er selbst zu übersetzen und veröffentlichte in Privatdrucken 1828 die ersten zehn Gesänge des Inferno, die weiteren 24 Gesänge dann 1833.21 Es folgten 1839 eine revidierte Ausgabe, 1840 und 1849 die Übersetzungen des Purgatorio und des Paradiso. Seit 1839 sind die Ausgaben, verlegt durch Arnold in Dresden und Teubner in Leipzig, auch im freien Buchmarkt erschienen, 1865/66 folgte eine Gesamtausgabe, die – vor und nach dem Tod des königlichen Übersetzers im Dezember 1873 – mehrfach nachgedruckt wurde. Für den sächsischen Prinzen und König war die Dante-Übersetzung ein sinnstiftendes Lebenswerk, zu Recht ging er als gelehrter König in die Geschichte ein und wollte als solcher auch gesehen werden: Das Ölporträt von 1855 zeigt ihn ein Jahr nach seiner Thronbesteigung als Regenten und Übersetzer, die Büste des lorbeerbekränzten Dichters steht neben den Manuskripten und Büchern seiner Übersetzung (siehe Abb. 3).22 Das sechs Meter hohe Reiterdenkmal des Königs von Johannes Schilling, seit 1889 die gestalterische Mitte des Dresdner Theaterplatzes vor der Semperoper, behielt seinen prominenten Platz auch in der DDR-Zeit, als viele Fürstendenkmale abgeräumt oder auf Nebenschauplätze verbannt wurden. König Johann, Sohn einer Prinzessin von Parma, wurde als Literaturvermittler respektiert. Mit seiner Übersetzung, dem Aufbau einer Dante-Spezialbibliothek durch seinen Bibliothekar Julius Petzoldt seit den 1830er Jahren23 und der Gründung der Deutschen
20
21
22 23
Lebenserinnerungen des Königs Johann von Sachsen. Eigene Aufzeichnungen des Königs über die Jahre 1801–1854. Hrsg. von Hellmut Kretzschmar. Göttingen 1958 (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts. 42), S. 64f. Handschrift im Hauptstaatsarchiv Dresden; Digitalisat der Erstveröffentlichung 1958, http://digital.slub-dresden.de/id172862844X. Danteʼs Göttliche Comoedie. Hoelle [Gesänge I–X]. Übersetzt von Philalethes. Dresden 1828; Gesänge XI–XXXIV. Ebd. 1833. Gemälde K/671/2002, Inv.: GM001366, https://www.stadtmuseum.leipzig.de/. Die im Auftrag des Königs aufgebaute Dante-Bibliothek dokumentierte der Bibliothekar Julius Petzoldt mit einem gedruckten Catalogus Bibliothecae Danteae Dresdensis […]. Leipzig 1882, https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/3763915796/13/LOG_0002/.
50
Thomas Bürger
Dante-Gesellschaft in Dresden 1865 hatte er ein neues Kapitel deutscher DanteRezeption eröffnet.24 Aus seinen bis zur Thronbesteigung 1854 geführten Lebenserinnerungen wird deutlich, wie stark Dantes Vita das Leben des Prinzen und Königs in seiner Rolle als Philalethes beeinflusste. Er suchte die Nähe zu Kultur und Wissenschaft, seine Übersetzungen ließ er durch Ludwig Tieck im Kreis vertrauter Gelehrter vorlesen und besprechen, unter ihnen der Arzt, Naturwissenschaftler und Maler Carl Gustav Carus, Graf Baudissin und Baron Rumohr, der bei den Lesungen „in seiner Eigenschaft als Gastronom […] für ein treffliches Gabelfrühstück“25 sorgte. Carus begleitete als Leibarzt die königliche Familie alljährlich in die Sommerresidenz Pillnitz, wo sich „das kleine Dante-Comité auch ein paar mal im Sommer“ im chinesischen Pavillon versammelte (vgl. Abb. 4 und 5):26 „Freund Tieck fuhr dazu mit Graf Baudissin in den warmen Vormittagsstunden heraus, und da saßen wir denn […] jeder mit seinem Dante bewaffnet […] und hörten von Tieck’s sonorer Stimme aufmerksam die von einem Fürsten verdeutschten Verse des Dichterfürsten vortragen.“27 Im Revolutionsjahr 1848 – Johann war noch nicht Regent, aber politisch aktiv – schloss er seine Übersetzung des Paradiso ab: Im Sommer 1848 mitten unter den großen politischen Wirren hatte in Pillnitz, und zwar in dem Gartenpavillon am großen Teich, die Vorlesung dieses letzten Teiles […] statt gefunden. Mein Areopag war freilich sehr zusammengeschmolzen. Besonders war Tieck damals nach Berlin übergesiedelt, und die Function des Vorlesers übernahm der vielgebildete Eduard Devrient.28
24
25
26
27
28
Vgl. Frank-Rutger Hausmann: Die Deutsche Dante-Gesellschaft im geteilten Deutschland. Stuttgart 2012, bes. S. 76–81. Die im Rahmen des langjährigen konstruktiven Deutsch-russischen Bibliotheksdialogs geplante und begonnene Digitalisierung von Teilen der 1945 nach Moskau verlagerten Dresdner Handschriften und Bücher ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und die antieuropäische Propaganda jäh unterbrochen worden. Über die Dante-Bibliothek in Moskau: Karina A. Dmitrieva und Nikolaj N. Zubkov: Die Dantea-Sammlung von König Johann. In: Dante v vekach. La Divina Commedia v kul’turnoj tradicii Evropy i Rossii. Moskau 2022, S. 238–247 (russ. Originaltitel: Данте в веках: La Divina Commedia в культурной традиции Европы и России. Москва: Центр Вознесенского, 2022. стр. 238–247; dt. Titel: Dante über die Jahrhunderte. Die Göttliche Komödie in der kulturellen Tradition Europas und Russlands). Kretzschmar 1958 (Anm. 20), S. 145. Der Kunsthistoriker und Gastrosoph Carl Friedrich von Rumohr (1785–1843) wohnte einige Jahre in Dresden nahe der königlichen Villa im Wachwitzer Weinberg, wo er 1832 die zweite Auflage seines Buchs Geist der Kochkunst bearbeitete. Sein von Gottfried Semper gestaltetes Grab auf dem Inneren Neustädter Friedhof in Dresden stiftete König Christian VIII. von Dänemark. Abb. 4: Außenansicht, Foto: Thomas Bürger, Juni 2022; Abb. 5: Innenansicht, Foto: Jürgen Karpinski. In: Dirk Welich: Der Chinesische Pavillon und Garten im Schlosspark Pillnitz. 2. Aufl. Dresden: Schlösser und Gärten 2003, 63 S. mit zahlr. Ill., das Foto S. 2 (Innentitel), https://de.wikipedia.org/wiki/Datei: Schloss_Pillnitz_Chinesischer_Pavillon_Dresden-1.jpg. Carl Gustav Carus: Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Bd. 3. Leipzig 1866, S. 81, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10062279?page=85. Kretzschmar 1958 (Anm. 20), S. 227, https://sachsen.digital/werkansicht?tx_dlf%5Bid%5D=294099& tx_dlf%5Bpage%5D=231.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
Abb. 3: Porträt von Friedrich Gonne: König Johann von Sachsen als Dante-Übersetzer, 1855 (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. Foto: Hans Dieter Kluge).
51
52
Thomas Bürger
Abb. 4 und 5: Chinesischer Pavillon im Schlossgarten Pillnitz, Ort der Dante-Lesungen.
König Johann hatte seinen Dante-Ausgaben zahlreiche Pläne, Grundrisse und Karten sowie selbst erstellte Zeitübersichten zu den Handlungsabläufen hinzugefügt. Mit seiner Übersetzung, den Erläuterungen und Grafiken ist ein Dante-Kompendium des 19. Jahrhunderts entstanden, das – aufbauend auf seinen überlieferten Manuskripten29 – in Form einer digitalen Edition übersichtlich präsentiert werden könnte. An den vielen bildkünstlerischen Übersetzungen der Göttlichen Komödie beteiligte sich auch Carl Gustav Carus, um sich, wie er in seinen Lebenserinnerungen 1865 schrieb, gegen den wunderbaren Geist Dantes auf irgendeine Weise productiv […] zu verhalten! Dies nun ist es denn, was die vielfältigen Uebersetzungsversuche veranlaßt, dies ist es, was so viele darüber geschriebene Commentare und Auslegungen bedingte, dies, was so manchen Künstler, von Michel Angelo an bis zu Koch, Flaxman und Pinelli, veranlaßte, seine gedankenhaften Gestalten durch Zeichnungen oder Bilder zu verwirklichen, und dieser Drang war es also auch, der jenen Plan schuf, den ich später lithografiren und manchen Dantophilen habe zukommen lassen.30
Für die Brüder Schlegel wie für Schelling stand die Göttliche Komödie so einzig da, dass „sie als eine eigene Welt auch ihre eigne Theorie fodert“: Die Gleichzeitigkeit von Individualität und Universalität erhebe Dante zum „Schöpfer der modernen Kunst“,
29
30
Zwölf Handschriften und eine Briefsammlung: Mscr.Dresd. e91, Bd. 1–13, https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1577766253, und https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/261615/1. Carus ließ 1829 eine Lithographie zum Inferno „in Form einer großen gothischen Fensterrose“ drucken, vgl. Carl Gustav Carus: Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Bd. 2. Leipzig 1865, S. 255f., http://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11425610?q=Dantophilen&page=261; Abb. in: Costadura und Ellerbrock 2015 (Anm. 16), S. 171.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
53
„vorbildlich für die ganze moderne Poesie“.31 August Wilhelm Schlegels herausragende, 1795 so erfolgreiche poetische Übersetzung blieb die „Unvollendete“ in der Vielzahl verschiedener Übersetzungen, unter denen sich keine als kanonisch durchsetzen konnte, von denen jedoch die königliche des Johann von Sachsen aufgrund der guten, aber unübersichtlichen Quellenlage und der kollektiven Mitwirkung der illustren Accademia Dantesca eine digitale Edition verdiente.
3. „Wechselberührung der Künste“ – die Dresdner Kunstgespräche Im Sommer 1798 traf sich die Jenaer Gruppe der Frühromantik in Dresden, um in der „Hauptstadt der bildenden Kunst in Deutschland“32 die Antikensammlung und die Gemäldegalerie zu besichtigen und über Kunst zu philosophieren. August Wilhelm und Friedrich Schlegel, der in finanzieller Not zeitweilig bei seiner Schwester Charlotte in Dresden gelebt hatte, reisten aus Berlin, Novalis aus dem nahen Freiberg, Caroline Schlegel mit ihrer Tochter Auguste sowie die Professoren Schelling und Fichte aus Jena an. Die Gemäldegalerie war von 1747 bis 1855 im Obergeschoss des Stallgebäudes zu besichtigen, dem repräsentativen Renaissancebau auf dem Neumarkt neben der Frauenkirche (und heutigen Johanneum), in dessen Erdgeschoss seit 1794 die Mengs’sche Abgusssammlung der Antiken aufgestellt war. Ausgangspunkt der Kunstexkursion aber war das auf der rechten Elbseite gelegene, seit 1786 für ein breiteres Publikum geöffnete Japanische Palais mit der Antikensammlung im Erdgeschoss und der Königlich Öffentlichen Bibliothek im Obergeschoss. Im Athenaeum 1799 veröffentlichte August Wilhelm Schlegel unter dem Titel Die Gemählde. Ein Gespräch von W. das Dresdner Kunstgespräch, „der bedeutendste Beitrag der Jenaer Frühromantik zum Genre der modernen Kunstkritik“.33 Er wählte die Form des Dialogs zwischen Waller (August Wilhelm Schlegel) und Louise (Caroline Schlegel), beginnend im Antikensaal. Dort treffen sie den Maler Reinhold beim Zeichnen eines Torsos und schon sind sie mitten im Gespräch über die Möglichkeiten der Kunstbeschreibung und des Übersetzens: „Ach, wenn meine Zeichnung eine Uebersetzung wäre!“34 Louise und Waller wollen mit ihrem Gespräch „Statuen und Gemählde, die für sich ewig stumm sind, auch einmal reden lehren“, sie wollen „die Künste einander nähern und Uebergänge aus einer in die andre suchen“: „Gemeinschaft und gesellige Wechselberührung ist die Hauptsache“.35
31
32
33 34
35
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Ueber Dante in philosophischer Beziehung. In: Kritisches Journal der Philosophie 2, 1802, S. 36, 38 und 50, http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2096399_002/337 /#topDocAnchor. Lothar Müller: Nachwort. In: August Wilhelm Schlegel: Die Gemählde. Gespräch. Hrsg. von Lothar Müller. Dresden 1996 (Fundus-Bücher. 143), S. 165–196, hier S. 166. Müller 1996 (Anm. 32), Nachwort S. 166. [August Wilhelm und Caroline Schlegel:] Die Gemählde. Ein Gespräch von W. In: Athenaeum 2, 1799, Stück 1, S. 39–151, hier S. 44, https://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/PPN632104015/47/. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 49.
54
Thomas Bürger
Das eigentliche Gespräch findet jedoch nicht vor den Skulpturen und Gemälden statt, sondern in der freien Natur, auf den Elbwiesen zwischen Antikensammlung und Gemäldegalerie: „Hier, dächte ich, ließen wir uns nieder: wir können keinen bequemeren und anmuthigeren Sitz finden. Vor uns der ruhige Fluß; […] dort unten spiegelt sich die Stadt mit der Kuppel der Frauenkirche im Wasser […].“36 Sie sprechen über die Kunst der Kunstbeschreibung, über Vasari, Diderot, Forster, spöttisch über Mengs; über Landschaftsbilder und Porträts; über Correggio („vielleicht war nie ein Künstler harmonischer als Corregio“37); über Leonardo, der „rastlos nach der Wahrheit gräbt, und sie von innen heraus an das Licht bringt“:38 „Sein Forschungsgeist war durchaus romantisch, bizarr und mit Poesie tingiert“;39 über Rubens, dessen „Liebhaberey für das Wilde […] nur als dichterische Lizenz entschuldigt werden kann“.40 Schließlich vergleichen sie Poussin und Veronese, der „nach seiner Weise bizarr, modig und doch romantisch zu verzieren […] gewußt hat“:41 „Bey diesem ist alles modern, aber alles aus Einem Stücke; bey jenem ist alles antiquarisch, allein es paßt nicht zu einander. […] Paul mahlte frisch, was er sah und erlebte, Poussin schöpfte mühsam aus alten Denkmälern und Büchern.“42 „Und von dem Raphael wollen Sie schweigen, vor dem ich Sie doch Stunden lang stehen sah?“, fragt schließlich Waller Louise: „Ich habe mir nicht getraut, etwas darüber aufzuschreiben […]. Aber wie soll man der Sprache mächtig werden, um das Höchste des Ausdruckes wiederzugeben?“ Sie habe den Raffael in der Galerie niemals an der Wand „in der Reihe der andern Gemählde“, also in der flächendeckenden Hängung nach Divisionen,43 sondern immer herausgehoben „für die Schüler auf der Staffeley“ gesehen.44 Während Louise versucht, ihre Empfindungen, das Unaussprechliche nun doch in Worte zu fassen, antwortet Waller mit acht Gedichten, mit poetischen Übersetzungen auf die bekanntesten christlichen Kunstwerke der Galerie, gipfelnd im Sonett Die Mutter Gottes in der Herrlichkeit.45 „Das Verhältniß der bildenden Künste zur Poesie hat mich oft beschäftigt“, erklärt Waller: „Ohne gegenseitigen Einfluß würden sie alltäglich“, und fügt hinzu: Die Poesie „soll immer Führerin der bildenden Künste seyn, die ihr wieder als Dollmetscherinnen dienen müssen.“46
36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46
Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 54. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 94. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 99. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 106. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 109. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 112. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 119. Zur Hängung seit 1754 vgl. Claudia Brink: Der Name des Künstlers. Ein Raffael für Dresden. In: Raffael. Die Sixtinische Madonna. Geschichte und Mythos eines Meisterwerks. Hrsg. von Claudia Brink u.a. München, Berlin 2005, S. 53–92, hier S. 68–70. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 124f. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 142. Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 136.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
55
Die ausführlichen Bildcharakteristiken, von Schlegel selbst als „Vorlesungen“ und „geschriebene Gallerien“47 bezeichnet, haben ihre Wirkungen auf den Publikumsgeschmack und auf das Ansehen des Museums nicht verfehlt. Die lange Zeit „abseitige Hängung der Sixtinischen Madonna in der inneren Galerie des Stallgebäudes“48 wurde allerdings erst 1816 geändert. Das Bild Raffaels erhielt nun den prominenten Platz der Madonna des heiligen Georg von Corregio und dessen Heilige Nacht, das gefeierte Hauptwerk der Galerie im 18. Jahrhundert, rückte an den Platz am äußeren Rand (vgl. Abb. 6).49
Abb. 6: Innenansicht der Gemäldegalerie, seit 1816 mit einer hervorgehobenen Hängung der Sixtinischen Madonna an der Mitte der Stirnseite, Kupferstich 1830.
47 48 49
Schlegel/Schlegel 1799 (Anm. 34), S. 106. Brink 2005 (Anm. 43), S. 53–92, hier S. 70. Abb. der Innenansicht der Gemäldegalerie ebd., S. 83. Unbekannter Künstler: Vue d’une partie de la Galerie royale de Dresde (appellée Galerie interieur ou italienne) comme elle était à l’an 1830. Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Inv.Nr. A 131532; mit freundlicher Genehmigung der SKD Dresden.
56
Thomas Bürger
Die beispiellose Wirkungsgeschichte der Sixtinischen Madonna hatte Winckelmann mit seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst von 1755 eingeleitet, ein Jahr nach der Überführung des Altarbildes von Piacenza nach Dresden: „Sehet die Madonna mit einem Gesichte voll Unschuld und zugleich einer mehr als weiblichen Größe, in einer seelig ruhigen Stellung, in derjenigen Stille, welche die Alten in den Bildern ihrer Gottheiten herrschen liessen. Wie groß und edel ist ihr ganzer Contour!“50 Der Bewunderung im Geiste des Klassizismus folgte die Verehrung im Geiste der Romantik: Schlegel wollte – als Höhepunkte des Kunstgesprächs – die in Prosa gehaltenen Charakteristiken des Kritikers in die höhere Form der Poesie überführen. Im Rückblick zeichnet sich in ihnen eher der Weg des mit diesem Text mächtig einsetzenden Raffael-Kultes in den Kitsch ab. Das Remedium dagegen ist die sukzessive Auflösung der romantischen Raffael-Legenden in der Kunstgeschichtsschreibung des frühen 19. Jahrhunderts.51
Die Bekanntheit der Sixtinischen Madonna war den hymnischen Beschreibungen Winckelmanns, Goethes und Schlegels, ihre Omnipräsenz und Popularität aber den Möglichkeiten technischer Reproduktionen zu verdanken. Winckelmann lebte in seinen Dresdner Jahren 1748 bis 1754 als Bibliothekar des Grafen Bünau und danach in Rom als Aufseher der Altertümer mitten unter den Skulpturen und Gemälden, Goethe und Schlegel hingegen studierten die wichtigsten Kunstwerke anhand von Kupferstichen. Seit dem 16. Jahrhundert wurden Bilder nach Bildern gedruckt, Raffaels Gemälde war seit 1780 in zahlreichen Reproduktionsstichen zugänglich. Die technische Reproduzierbarkeit hatte neue Voraussetzungen der Übersetzung und Vermittlung von Literatur und Kunst geschaffen und neue Möglichkeiten ihrer wechselseitigen Erhellung eröffnet.
4. Digitalisierung und Digitalität – Medium für „Wechselberührungen“ Die romantischen Kunstgespräche am Ende des 18. Jahrhunderts führen mit den Worten Lothar Müllers durch eine „imaginäre Galerie der Gemälde“: Die Kunstwerke werden nicht gemeinsam besichtigt, sondern in der Erinnerung vor das innere Auge gerufen. Die retrospektive Synthetisierung zahlreicher Besuche der Galerie, nicht die Fiktion des Spaziergangs durch ihre Räume gibt dem Gespräch seine charakteristische Form.52
Will man die einflussreichen kunsttheoretischen Abhandlungen Winckelmanns oder die Gemäldegespräche der Romantiker heute kontextualisieren und vermitteln, wäre 50
51 52
Johann Joachim Winckelmann: Gedanken ueber die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst. 2. verm. Aufl. Dresden, Leipzig 1756, S. 26, https://doi.org/10.11588/diglit.5803#0032. Müller 1996 (Anm. 32), Nachwort S. 194f. Müller 1996 (Anm. 32), Nachwort S. 174.
Übersetzung, Vermittlung, Digitalisierung
57
ein digitaler Zugang, eine virtuelle Rekonstruktion der historischen Antikensammlung und Gemäldegalerie äußerst hilfreich, um sich die Werke, ihre historische Aufstellung und Anordnung vor Augen zu führen. Die meisten bekannten Kunstwerke können einzeln inzwischen digital gefunden und betrachtet werden, in den Online-Kollektionen der Museen und Forschungseinrichtungen oder auf nationalen und internationalen Plattformen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek oder der Europeana. Die jeweiligen Präsentationen und Treffermengen unterscheiden sich erheblich, alle zusammen bieten sie immer bessere Voraussetzungen für virtuelle Rekonstruktionen erinnerungskulturell oder kunstgeschichtlich relevanter Sammlungen und Gebäude. Kuratierten digitalisierten Kunstsammlungen, etwa zur Archäologie, Denkmalpflege,53 zur Kunst- und Museumsgeschichte, entsprechen auf dem Feld schriftlicher Überlieferung digitale Editionen zur Erschließung und Wiedergabe von Texten und Textsammlungen. Erst das Erschließende, Kuratierende, Edierende, das kritisch Sichtende und Auswählende macht aus einem kontingenten Sammelsurium eine analoge oder digitale Sammlung und Edition nach definierten Kriterien und Standards. Die Wünsche an digitale Präsentationen und Editionen sind je nach Erwartungshaltung denkbar unterschiedlich. Die Gedächtniseinrichtungen wollen ihre Bestände in Form digitaler Reproduktionen in hoher technischer Qualität nachhaltig sichtbar und direkt zugänglich machen und erschließen sie deshalb nach institutionellen und medientypologischen Standards. Die Philologien wiederum benötigen zuverlässige Quellen, die sie deshalb nach disziplinären oder interdisziplinären Standards erschließen, konstitutieren, für Studium und Forschung präsentieren. Nur gemeinsam aber können sie erfolgreich das kulturelle und wissenschaftliche Erbe sichern und für Forschungen nutzbar machen, vermitteln für Bildung und Ausbildung, an Schulen und Hochschulen, an eine breite Öffentlichkeit. Im Unterschied zur bewährten und nach wie vor attraktiven Buchform (einem gedruckten Sammlungskatalog, einer gedruckten Werkedition) bietet die digitale Präsentation und Edition mehr Flexibilität und Offenheit, sie unterstützt modulare Erschließungs- und Veröffentlichungsformen, vor allem aber: Sie ermöglicht unterschiedliche, sich ergänzende Zugänge (Lektüre, Vollextrecherche u.a.), verbindet analog getrennte und oftmals schwer zugängliche und verstreute Publikationen, Objekte, Bilder im Direktzugriff miteinander (durch Metadaten und Normdatenverknüpfungen z.B. für Personen, Orte, Werke) und überbrückt Barrieren wie Institutionen-, Medien- oder Gattungsgrenzen. Die digitale Kunst- und Text(re)produktion reiht sich einerseits ein in die Folge von Erfindungen technischer Medien (Buchdruck, Reproduktionsgrafik, Fotografie), transformiert sie zugleich grundlegend zu einer datenbasierten Informationsund Wissensressource, die weiterhin mit vertrauten Methoden, darüber hinaus aber auch mit technisch neuen Methoden der Digital Humanities bearbeitet werden kann.
53
Das Digitale und die Denkmalpflege. Bestandserfassung, Denkmalvermittlung, Datenarchivierung, Rekonstruktion verlorener Objekte. Hrsg. von Birgit Franz und Gerhard Vinken. Heidelberg 2017 (Veröffentlichungen des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. 26), https://books.ub.uniheidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/263.
58
Thomas Bürger
Nach über zwanzig Jahren Digitalisierungserfahrung zeigt sich, dass zu groß angelegte Projekte (etwa überdimensionierte EU-Time Machine-Vorhaben54) ebenso zur Frustration führen können wie unambitionierte und unterdimensionierte Ziele (z.B. Scheintransformationen wie eine simple digitale Kopie analoger Vorlagen ohne Ausschöpfung virtueller Mehrwerte). Digitale Editionen der deutschen Übersetzungen Shakespeares und Dantes sind ebenso wie digitale Rekonstruktionen literarischer und künstlerischer Orte und Sammlungen (z.B. einer Galerie oder Bibliothek) sehr ambitioniert, aber angesichts vieler geleisteter Vorarbeiten (im Falle August Wilhelm Schlegels zählt dazu auch die KAWS, die Digitale Edition seiner Korrespondenz) durchaus erreichbar und zielführend. Notwendig sind inhaltlich, technisch und organisatorisch abgestimmte Strukturen und Methoden, sind definierte Schritte und Module. Mit überschaubaren Umfängen, anschluss- und erweiterungsfähig durch Datennormierung und Open Source-Technologien, werden neue Qualitäten der Vernetzung, eine wechselseitige Erhellung der Künste, vielleicht auch eine „retrospektive Synthetisierung“, in jedem Falle kooperative, interdisziplinäre und internationale Forschungs- und Vermittlungsziele sowie kreative „Wechselberührungen“ wirksam unterstützt. Notwendig dafür ist die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen im Team: Fachwissenschaften, Gedächtniseinrichtungen (Archiv, Bibliothek, Museum) und Kompetenzzentren für Digitalisierung und Digital Humanities müssen dauerhaft, vertrauensvoll und eng zusammenarbeiten, strukturbildend in jeder Phase eines Projekts, bei Planung, Durchführung, nachhaltiger Sicherung und Anschlussermöglichung. Im Jahr 2007 widmete David Weinberger, Internetforscher in Harvard, den Bibliothekaren sein Buch Everything is Miscellaneous. The Power of the New Digital Disorder.55 Tatsächlich ist wahrscheinlich, dass Künstliche Intelligenz überkommene Ordnungen („Schubladisierungen“) aufbrechen und aus Unordnungen, Kontingenzen und Sammelsurium neue Erkenntnisse und Kreativität generieren kann. Für die historischen Wissenschaften sind die Entwicklungen von Ordnungen und Vermittlungsstufen, die permanenten Umordnungen des Wissens und der Überlieferung, die Vergegenwärtigungen von Kanonisierung, Vergessen und Vernachlässigung jeweils substantielle Erkenntnisschritte, die durch digitale Rekonstruktionen und Editionen unterstützt werden können. Eine Übersetzung, eine digitale Edition einer Übersetzung löst „eine unwiderstehliche Neigung nach dem Original“56 aus, die Digitalisierung soll deshalb nicht zuletzt den respektvollen Umgang mit der Überlieferung und die Bewahrung der schutzbedürftigen, durch Klimawandel, Kriege, Vernachlässigung gefährdeten Originale stärken.
54
55
56
Vgl. die Berichterstattung zum Venedig-Projekt 2019: https://de.wikipedia.org/wiki/Venice_Time_Machine. David Weinberger: Everything is Miscellaneous. The Power of the New Digital Disorder. New York 2007; dt. Übersetzung: Das Ende der Schublade. Die Macht der neuen digitalen Unordnung. Aus dem Amerikanischen von Ingrid Proß-Gill. München 2008. Johann Wolfgang Goethe: Maximen und Reflexionen. Aus Kunst und Altertum. In: Goethe: Sämtliche Werke. Bd. 9. Zürich 1977, S. 504–542, hier S. 531.
Günter Oesterle
Über das Schöne und das Unschickliche bei Shakespeare Romantische Übersetzungsfragen im Kontext zivilisationsgeschichtlicher Sensibilitätsveränderungen
1. Aufstieg des Übersetzers vom Gelehrten oder Dilettanten zum Virtuosen Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts gab es zwei Übersetzungsvorhaben, die in der Beachtung beim gebildeten Publikum und in ihrer Tragweite und Wirkmächtigkeit alle bisher gewohnten Dimensionen überschritten. Neu und ungewöhnlich war, dass ausgerechnet zwei Übersetzungsprojekte eine derartige, den Kreis der Experten überschreitende Beachtung fanden. Diese beiden Übersetzungsunternehmen sind mit den Namen Johann Heinrich Voß und August Wilhelm Schlegel verbunden. Die Mäkelei verschiedener Rezensenten an den späteren Jahrgängen der von Schiller herausgegebenen Horen kann die zeitgenössische Wertschätzung von Übersetzungen gut illustrieren.1 Die Tatsache, dass in den Horen von Jahr zu Jahr mehr Übersetzungen aufgenommen wurden, werteten besagte Rezensenten als Zeichen für den Niedergang und das baldige Ende der Zeitschrift. Übersetzen war bislang die Beschäftigung von Gelehrten und Dilettanten gewesen; es galt als eine „brodlose Kunst, ein undankbares Handwerk“ – wie August Wilhelm Schlegel noch 1827 in einem Artikel der von ihm herausgegebenen Indischen Bibliothek betonte.2 Mit der Ankündigung von zwei Übersetzungsgroßprojekten zu Homer und Shakespeare sah alles danach aus, dass Übersetzungskunst aufschließen konnte zu zwei anderen verwandten Disziplinen, die in derselben Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, unter romantischer Ägide sich ebenfalls ein neues Profil gaben: der Literaturkritik und der Literaturgeschichte. Der Aufstieg in der Wertschätzung der Übersetzungskunst um 1800 lässt sich an zwei markanten Indizien ablesen. Da ist einmal zu beobachten, dass die neuen Übersetzer, zum Beispiel August Wilhelm Schlegel und Heinrich Voß, sich den Ehrentitel eines Virtuosen zusprachen.3 Die Übersetzungskunst profitierte auch von dem
1
2
3
Günter Schulz: Schillers Horenpolitik und Erziehung. Analyse einer deutschen Zeitschrift. Heidelberg 1960; Rolf Michaelis: Schillers Titanic. In: Die Horen. Geschichte einer Zeitschrift. Weimar 2000. August Wilhelm Schlegel: Ueber die Bhagavad-Gita. Mit Bezug auf die Beurtheilung der Schlegelschen Ausgabe im Pariser Asiatischen Journal. Aus einem Briefe von Herrn Staatsminister von Humboldt. Nebst Vorerinnerung und Anmerkungen des Herausgebers. In: Indische Bibliothek 2, 1827, S. 218–258, hier S. 254. Vgl. den Brief von Heinrich Voß an Karl Solger vom 15. Mai/1. Juni 1804. In: Briefe von Heinrich Voß an Karl Solger. Hrsg. von Sophie Zeil und Johanna Preusse in Zusammenarbeit mit Anne Baillot. In:
https://doi.org/10.1515/9783111017419-006
60
Günter Oesterle
besonders im Umfeld der Romantik wachsenden Interesse an formpoetischen Fragen wie Metrum- und Rhythmuskunde. Der Bedeutungszuwachs der Fragen zu Metrum, Rhythmus, Wohlklang, Euphonie (Annehmlichkeit der Worte betreffend) und Eurythmie (die Anordnung und Bewegung der Worte) schlägt sich im Umfang der Behandlung in August Wilhelm Schlegels 1798 in Jena gehaltener Vorlesung zur „Kunstlehre“ nieder: Sie umfassten erstaunlicherweise etwa die Hälfte des Semesters.4 Das war eine zwingende Voraussetzung, dass der Übersetzer August Wilhelm Schlegel in neuartige lyrische und dramatische Sprechfelder vordringen konnte. Der Übersetzer war, so gesehen, nicht mehr der ‚Übertragungsknecht‘ von einer Sprache in die andere, sondern der Entdecker neuer Sprachschätze: Der ächte Uebersetzer […] ist ein Herold des Genius, der über die engen Schranken hinaus, welche die Absonderung der Sprachen setzte, dessen Ruhm verbreitet, dessen hohe Gaben vertheilt. Er ist ein Bote von Nation zu Nation, ein Vermittler gegenseitiger Achtung und Bewunderung, wo sonst Gleichgültigkeit oder gar Abneigung Statt fand.5
2. Zwei innovative Übersetzungsprojekte um 1800: Johann Heinrich Voßʼ Homer und August Wilhelm Schlegels Shakespeare Um was für Übersetzungsprojekte handelt es sich aber? Und warum hatten sie eine derart kulturverändernde Wirkung? Da ist einmal das Projekt von Johann Heinrich Voß zu nennen, die Epen des Homer in einem am Original orientierten Metrum und Rhythmus, nämlich in Hexametern auch in deutscher Sprache erklingen zu lassen – ein Unterfangen, das man allgemein, gerade auch unter Experten für undurchführbar hielt. Die deutsche Sprache sei, so die Vorannahme, dazu konstitutionell unfähig. Als dann aber Voß an praktischen Übersetzungsbeispielen zu demonstrieren begann, zu welchen Schönheiten die deutsche Sprache fähig war, erbrachte er den schlagenden Beweis, dass die seit langer Zeit national und international tradierte minderwertigkeitsauslösende Meinung zur hölzernen und unschönen deutschen Sprache ein Vorurteil war, das revidiert werden konnte.6 Das hatte noch weitere Effekte. Wie ein Kartenhaus fiel die zeitgenössisch dominante Sprachdiagnose des Sprachkritikers Johann Christoph Adelung zum Beispiel und vieler vornehmlich französischer Linguisten in sich zusammen: Sie gingen auf dogmatische und normative Weise von einem feststehenden fixierbaren
4
5 6
Voß’ Übersetzungssprache. Voraussetzungen, Kontexte, Folgen. Hrsg. von Anne Baillot, Enrica Fantino, Josefine Kitzbichler. Berlin, München, Boston 2015, S. 161–258, hier S. 194: „Du hast noch nicht die Gewandtheit des Virtuosen, bei dem man gar nicht daran denkt, dass er sich vergeigen könnte“. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über philosophische Kunstlehre [Jena 1798–1799]. In: KAV, Bd. I: Vorlesungen über Ästhetik I [1798–1803]. Mit Kommentar und Nachwort hrsg. von Ernst Behler. Paderborn u.a. 1989, S. 1–177, hier S. 43–166. Schlegel 1827 (Anm. 2), S. 255. Günter Häntzschel: Johann Heinrich Voss. Seine Homerübersetzung als sprachschöpferische Leistung. München 1977; vgl. Homer und die deutsche Literatur. In Zusammenarbeit mit Hermann Korte hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München 2010 (Text und Kritik. Sonderband VII/10).
Romantische Übersetzungsfragen
61
Korrektheitskriterium jeder Sprache aus. Nun öffnete sich ein freier Blick auf eine dynamisch sich verändernde Sprache. Nach dieser neuen Sicht ist plausibel, dass das erste programmatische Votum in Schlegels Vorlesung von 1798 lautete: „Die Poesie spricht das aus, was noch nicht ausgesprochen worden ist; dies ist ihr hoher Zweck; sie darf daher nicht im Sprachgebrauche fixiert werden“.7 Konnte man das, was für die Neuübersetzung Homers zutreffend sein mochte, am Ende des 18. Jahrhunderts auch noch für Shakespeares Werk in Anspruch nehmen? War doch lange vor der Romantik bei Gotthold Ephraim Lessing, Jacob Michael Reinhold Lenz, bei Gottfried August Bürger und Christoph Martin Wieland, erst recht aber bei dem Shakespeareübersetzer Johann Joachim Eschenburg Shakespeares Innovationskraft für die deutsche Literaturentwicklung unbestritten. Und doch wagten es die romantischen Schriftsteller zu behaupten, dass erst mit ihrem Übersetzungsansatz Shakespeares Werk in völlig neuem Format sichtbar und erfahrbar geworden sei. Ohne Skrupel behauptet der damals noch relativ unbekannte August Wilhelm Schlegel in seiner 1798 in Jena gehaltenen Vorlesung: „Erst jetzt in der neueren Zeit hat man ihn [Shakespeare] in einem richtigen Lichte zu betrachten angefangen“.8 Dieser aus der Perspektive der vorromantischen Adaption anmaßend zu nennende Anspruch der Romantik, ein neuartiges Bild Shakespeares aufzeigen zu können, deutet darauf hin, dass die Wahl, Shakespeare zu übersetzen, aus Sicht der Romantik nicht beliebig, sondern auch für sie selbst notwendig und unersetzbar war. Shakespeare war im Urteil von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck eine Ausnahmeerscheinung, die weit über das Maß eines Genies hinausreichte. Shakespeare habe nämlich nicht in einer mehr oder weniger eng umrissenen „Manier“ seine Kreativität entfaltet.9 Es sei ihm gelungen, in jedem seiner 36 Dramen eine je spezifische und unverwechselbare Besonderheit zu schaffen: „Jedes Stück Shakspeare’s ist immer aus einer eigenen, schönen, poetischen Stimmung entstanden, aus einer eigenen Ansicht der Welt“,10 schreibt Ludwig Tieck „nach 1796“, und August Wilhelm Schlegel argumentiert in seiner Jenenser Vorlesung von 1798 auf vergleichbare Weise: „Jedes Stück hat seinen eignen Stil, sein eignes Kolorit.“11 Mit dieser 36-fachen Einzigartigkeitssammlung habe Shakespeare einen poetologisch beschreibbaren einzigartigen und exemplarischen Kosmos der Poesie erschaffen. Die von der Romantik postulierte Universalpoesie war mit Blick auf Shakespeares übersetztes Werk nicht mehr nur programmatisch behauptet, sondern evident und erfahrbar und in romantischen Sinne populär12 gemacht worden. Shakespeare 7 8 9
10
11 12
KAV, Bd. I, S. 33. KAV, Bd. I, S. 114. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur [1809–1811]. In: KAV, Bd. IV/1. Hrsg. und kommentiert von Stefan Knödler. Erster Teil: Text. Paderborn 2008, S. 312. Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig Tieck. Aus seinem Nachlaß. Hrsg. von Henry Lüdeke. Halle a.S. 1920 (Neudrucke deutscher Literaturwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1), S. 372. KAV, Bd. I, S. 116. Günter Oesterle: Konzeptionen der Popularität in Aufklärung und Romantik. In: Laboratorium Aufklärung – Reden und Vorträge. Bd. 4. Jena 2013, S. 15–30; Günter Oesterle: The Conception of Popularity in the Enlightenment and Romanticism. In: Romantik. Journal for the Study of Romanticisms 2, 2013, S. 37–52.
62
Günter Oesterle
braucht verschiedene Stile, Versarten, mischt Reime, Lieder usw. ein; denn seine Gattungen erforderten es, sich nicht auf einen bestimmten Stil der Darstellung einzuschränken. Hier zeigen sich feine Spuren von künstlerischem Sinne und jedes Stück hat seine Nuancen, und hat Universalität.13
Aus einem derart hohen Anspruch lassen sich gleich mehrere Konsequenzen ziehen. 1. Wenn Shakespeares umfassendes Werk die Präsenz und Repräsentanz einer Universalpoesie darstellt, dann lässt er sich nicht eingrenzen auf eine Nation; der britische Dichter muss stattdessen als kosmopolitischer Poet eingestuft werden. Aus dieser kosmopolitischen Perspektive leiteten die deutschen Romantiker auch ab, Shakespeare als „ganz unser“ nennen zu dürfen.14 2. Die Übersetzung des Shakespeareschen Werkes ist nicht nur eine praktische Anwendung einer schon vorhandenen und vorgegebenen romantischen Theorie. Die romantische Gesamtkonzeption einer Universalpoesie entsteht und vollendet sich erst mit der angemessenen Übersetzung des Gesamtwerkes Shakespeares. Der übersetzte Shakespeare ist also auch ein Geburtshelfer der Romantik. Es ist demnach folgerichtig, dass alle romantischen Übersetzungen Shakespeares begleitet werden von ästhetischen und formkritischen Studien: Ludwig Tieck ergänzt seine frühe Übersetzung des Sturm durch einen Essay über das Wunderbare.15 August Wilhelm Schlegel veröffentlicht seine verdeckt programmatische Ankündigung einer neuartigen Shakespeareübersetzung unter dem literaturkritisch anspruchsvollen Titel Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters und einem die romantische Sichtweise auch im poetologischen Detail vorführenden Exkurs: Über den dramatischen Dialog. Selbst die in der Spätromantik geführte innerromantische Kontroverse zwischen Schlegel und Tieck über einen angemessenen Kommentar einer deutschen Shakespeare-Übersetzung diskutiert trotz aller Details die Grundlagen einer philologisch oder ästhetisch dominierten universalpoetischen Ausrichtung.16
3. Die Differenz zwischen der Vorromantik und der Romantik: der Wettstreit um die Vorzüge eines prosaischen oder poetischen Dialogs Den Unterschied zwischen der vorromantischen und romantischen Sichtweise auf Shakespeare bringt August Wilhelm Schlegel in einem Satz auf den Punkt: „Ich wage zu behaupten, dass eine solche [poetische, G.OE.] Übersetzung in gewissem Sinne noch
13 14
15
16
KAV, Bd. I, S. 116. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters (1796). In: August Wilhelm Schlegel: Sprache und Poetik. Hrsg. von Edgar Lohner. Stuttgart 1962 (Kritische Schriften und Briefe. 1), S. 88–122, hier S. 99. Ludwig Tieck: Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakespeare, für das Theater bearbeitet nebst einer Abhandlung über Shakespeares Behandlung des Wunderbaren. In: Ludwig Tieck: Schriften 1789–1794. Hrsg. von Achim Hölter. Frankfurt a.M. 1991, S. 681–723. Vgl. August Wilhelm Schlegels Schreiben an Herrn Buchhändler Reimer in Berlin. In: Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 260–267, bes. S. 265.
Romantische Übersetzungsfragen
63
treuer als die treueste prosaische sein könnte.“17 Die bislang favorisierten prosaischen Übersetzungen von Shakespeares Werk hätten, das ist die Überzeugung der einschlägig übersetzerisch tätigen Romantiker, das Wichtigste, die poetische Diversität übersehen, verdrängt und eliminiert. Ludwig Tieck kritisiert den vorgängigen Shakespeareübersetzer Eschenburg, es fehle bei dieser prosaischen Übertragung jegliche poetische Inspiration, „alles“ sei „ohne Perspective, ohne Licht und Schatten gezeigt“.18 Am Fatalsten sei , dass die Prosaübersetzer „diese Mängel gerade für Vorzüglichkeit halten.“19 Wer das Fluidum der Poesie, den Rhythmus, den die Romantik bezeichnenderweise als „Pulsschlag ihres Lebens“20 charakterisiert, den „bunten Wechsel verschiedener Stile“,21 den vielsagenden Wechsel von Poesie und Prosa in einem Theaterstück22 sowie die Vielfalt der Wortspiele außer Acht lässt, verfehlt sowohl die Nuancen als auch den „Gesamteindruck“.23
4. Das vorromantische und das romantische Shakespearebild: „wildes Genie ohne Geschmack“ oder ein „tiefsinniger Künstler“ Um Schlegels These nachvollziehen zu können, dass die poetische Übersetzung auch im Blick auf Treue der prosaischen überlegen sei, bedarf es einer Vorabklärung, nämlich einer romantischen Neujustierung der Vorstellung eines Genies. Der vorromantische Geniebegriff war ausgerichtet auf der Exploration einer naturnahen und daher unkontrollierbaren Kreativitätsemphase.24 Die für die Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts etwas anrüchigen sprachlich-witzigen Exzesse eines Aristophanes oder Shakespeare waren mit dieser Formel des kreativen Kontrollverlustes der Genies entschuldbar.25 Im Gegenzug formuliert August Wilhelm Schlegel: „Mir ist er [Shakespeare] ein tiefsinniger Künstler, nicht ein blindes wildlaufendes Genie“.26 Die Vorlesungsstunde über Shakespeare in Jena 1798 beendete er laut Nachschrift mit der provokanten Aussage: „bei Shakespeare [ist] alles der Kunst unterworfen“.27 Anstelle des wilden, maßlosen Shakespeare, der im Sturm und Drang für Ausdruckswerte des Pathetischen und Schauerlichen stand, entdecken die Romantiker bislang übersehene Qualitäten, den leise be-
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 116. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 411. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 411. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 112. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 105. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 106. Schlegel 1962 (Anm. 16), S. 265f. Johann Georg Schlosser: Vorerinnerung. In: Ders.: Die Frösche. Ein Lustspiel aus dem Griechischen des Aristophanes. Basel 1783, S. 2–13, hier S. 8; vgl. Katja Lubitz: Obszönes Übersetzen. Aristophanes in deutscher Sprache. Berlin, Boston 2020, S. 109. Vgl. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 411. KAV, Bd. IV/1, S. 196. KAV, Bd. I, S. 117.
64
Günter Oesterle
ginnenden, spielerischen, nuancenreichen mit „zarte[n] Abschattungen des Ausdrucks“28 arbeitenden Shakespeare. Sein „feine[r] […] künstlerische[r] Sinn“29 zeugt nicht von ursprünglicher Naturnähe, sondern von der Beherrschung eines „ächten und feinen Welttons“.30 Die poetologischen und übersetzungskritischen Folgerungen dieser neuartigen romantischen Sicht auf Shakespeares Werk sind umfassend und tiefgreifend. Die vorromantische Einschätzung, Shakespeares Werke seien ein Produkt von naturhaft genialer Wildheit „ohne Geschmack“, schien den Zeitgenossen zu erlauben, in den Dramen Shakespeares alle Arten von gravierenden Veränderungen vornehmen zu dürfen – also zu kürzen und zu streichen, umzustellen und hinzuzudichten. Ludwig Tieck spricht diese ungenierte Vorgehensweise seiner Übersetzungsvorgänger kritisch an: „Sh.[akespeares] Umarbeiter sind alles sehr dreist mit seinen Kunstwerken umgegangen, sie haben ihm immer zu wenig Gedancke und Zweck bei seinen Planen zugetraut“.31 Diese Umschriften sind allesamt dem Zeitgeschmack der Übersetzer geschuldet. Tieck und Schlegel rügen extreme Veränderungen und Streichungen u.a. des Schauspielers Garrick, der Hamlet am Ende der gleichnamigen Tragödie überleben lässt oder alle Wortspiele aus der Tragödie Romeo und Julia eliminiert.32 Man kann das gesamte romantische Übersetzungsprojekt auf die Anstrengung hin lesen, die Anpassung der Shakespearschen Vorlage an den Zeitgeschmack der damaligen Gegenwart im Zeichen des ‚Verschönerns‘33 zu korrigieren und zu revidieren.
5. August Wilhelm Schlegels romantische Übersetzungskonzeption: eine Kombination aus Treue und Grazie Die romantische Akzentverschiebung von der Charakteristik Shakespeares als „wildes Genie ohne Geschmack“ zum tief- und kunstsinnigen Dramatiker hat zur Folge, dass August Wilhelm Schlegel eine spannungsreiche Übersetzungskonzeption entwerfen kann. Er fordert einerseits gegenüber dem vorgegebenen Textkorpus ein Maximum an Treue.34 Allerdings muss dieses erste Übersetzungsprinzip zwingend begleitet werden von einem nicht weniger anspruchsvollen zweiten: der durch Studium abgesicherte, präzis und treu rekonstruierte Text darf, um seinen poetischen „Schwung“ nicht zu verlieren, niemals „schwerfällig“35 präsentiert werden. Der romantische Übersetzungsschlüssel fordert also die Verbindung von Treue und Grazie, von Wissen und Ästhetik. Die kulturgeschichtliche und philologische Recherche sichert die Treue ab, die Beachtung des „Verhältnisses 28 29 30 31 32
33 34 35
Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 100. KAV, Bd. I, S. 116. KAV, Bd. IV/1, S. 289. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 184. Vgl. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 33; August Wilhelm Schlegel: Über Shakespeares Romeo und Julia (1797). In: Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 123–140, hier S. 136. Vgl. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 118. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 116. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 117.
Romantische Übersetzungsfragen
65
der Teile“, des „raschen Wechsels der Szenen“, der „theatralischen Perspektive“ und der durchgehenden „Leichtigkeit“ garantiert den ästhetischen „Gesamteindruck“.36
6. Romantische Hausaufgabe: nicht nur die „charakteristischen Schönheiten“, sondern auch „die mißfallenden Eigenheiten“ des Shakespearschen Stils zu bewahren Die Pointe freilich ist, dass Schlegel diese von ihm konzipierte komplexe Verschränkung von Details, Nuancen und schöner Gesamtanlage noch einem besonderen Härtetest aussetzt. Um die geforderte Treue zu erreichen, muss nämlich der zeitgenössische Übersetzer nicht nur die „charakteristischen […] Schönheiten“37 des zum Übersetzen vorliegenden Werkes einfangen, sondern „auch“ die keineswegs leichter zu bewerkstelligende Aufgabe leisten, „die mißfallenden Eigenheiten seines Stils“ „in unserer Sprache“38 zu bewahren. Mit dieser romantischen Anforderung, auch die Unschicklichkeiten in älterer Poesie nicht zu tilgen noch zu „verschönern“, ist man an eines der heikelsten Übersetzungsprobleme der Romantik geraten. Die romantische Hausaufgabe war im Gegenzug zur zeitgenössischen Übersetzungspraxis des Abmilderns und Verschönerns der Shakespearschen Texte, das darin seltsam Bizarre und Anstößige nicht zu streichen, aber auch nicht historistisch zu konservieren. Bei der Übersetzung vieler Wortspiele, Zoten, Flüche, dunkler Stellen lässt sich das keineswegs einheitliche, sondern oftmals innerromantisch strittige Ringen39 um das Austarieren des gegenwärtigen Anspruchs an zivilisierten Feinsinn und des fremdanmutenden Vergangenen detailliert beobachten. Verallgemeinernd lässt sich dieses Problem in Form einer Frage formulieren. Welche Möglichkeit hat ein Übersetzer, die durch Mentalitätsdifferenz zweier Kulturen auftauchenden Anstößigkeiten und Peinlichkeiten ohne sie zu tilgen für seine Zeitgenossen erträglich und tolerabel zu machen? Die vorromantischen Übersetzer haben im Blick auf die delikaten Monita bei Shakespeare, insbesondere gegenüber seinen Zoten, seinen frivol-frechen Wortspielen, seinen Fluchkaskaden sowie seinen ins Handgreifliche übergehenden gemeinen Zänkereien ein ganzes Repertoire an Umgehungsversuchen, als da sind Streichen, Umstellen, mildernd Umschreiben sowie Verfängliches in Kommentare auszulagern, erprobt. Im Namen der Autonomie der Kunst und des ästhetisch notwendigen Freisinns haben die romantischen Übersetzer eine Zensur frivoler Stellen aus moralischen Gründen abgelehnt. Umso dringlicher stellte sich bei ihnen das ästhetische Problem des Undelikaten, Abgeschmackten und Gemeinen. 36 37 38 39
Schlegel 1962 (Anm. 16), S. 265. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 116. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 116. In einem Brief, den Karl August von Weimar-Eisenach an Friedrich Schiller am 9. Juli 1795 über Goethes unschickliche Freizügigkeit in den Römischen Elegien schreibt, werden die zeitgenössisch gebräuchlichen und geforderten Umgehungstaktiken gut charakterisiert. Vgl. Michaelis 2000 (Anm. 1), S. 45. Vgl. die präzise Zusammenstellung und Analyse der verschiedenartigen Abschwächungsversuche des Anstößigen in den Poetiken der Aufklärung: Lubitz 2020 (Anm. 24), S. 66–120.
66
Günter Oesterle
7. Die innerromantische Debatte um die Zulässigkeit der shakespeareschen Wortspiele Die innerromantische Debatte um das Problem des Unästhetischen in Shakespeares Werk konzentrierte sich auf die Lizenz für freche und frivol-anspielungsreiche Wortspiele vornehmlich mitten in schönen und erhabenen Stellen.40 Ludwig Tieck brachte die Bandbreite der Diskussion um Shakespeares Wortspielgebrauch auf die Formel: virtuose Kunst der Wortspiele versus banale „Witzelei“.41 Entsprechend trennt er in kritischer Absetzung von seinen vorgängigen Shakespeareübersetzern den komisch gutmütigen tölpelhaften Clown von Shakespeares Narrendarstellungen. Letztere sind mit ihrem nonsense, ihren „Wortverdrehungen“ und „vorsätzlichen Mißverständnissen“ in den Augen Tiecks „für unser Zeitalter unausstehlich“.42 August Wilhelm Schlegels langjährige Beschäftigung mit der poetologischen und übersetzungstechnischen Problematik der Shakespeareschen Wortspiele kann als ein Emanzipationsprozess gelesen werden. In seiner Jenenser Vorlesung von 1798 steht er noch teilweise unter dem Eindruck der Polemik Schillers gegen Gottfried August Bürgers Verwendung angeblich vulgärer Onomatopoesien.43 Und doch zeigen sich auch dort schon erste sprachund gattungstheoretische Versuche einer Rechtfertigung von Wortspielen.44 Mit zunehmender Übersetzungstätigkeit stößt er vornehmlich in der Wiener Vorlesung Über dramatische Kunst und Litteratur zu einer Verteidigung kühner, ja exzessiver Wortspiele Shakespeares vor.45 Trotz der generellen poetologischen Legitimierung von Shakespeares Wortspielen distanziert sich Schlegel ganz im Sinne Tiecks weiterhin von Passagen, in denen den zu Lebzeiten Shakespeares beliebten „witzelnden Gesprächen“46 gefrönt wurde. Im Blick auf die Unübersetzbarkeit mancher Wortspiele erlaubt er sogar dem Übersetzer, diese zu überspringen, allerdings mit der Auflage, „dass keine Lücke sichtbar würde“.47 Mit dieser Technik des „Umschiffens“ erntet Schlegel freilich bei vielen Kennern wie Jean Paul und den Brüdern Voß scharfe Kritik.48 Ludwig Tieck wagt es sogar auf höchst feinsinnige Weise in seiner Einleitung des Phantasus, Schlegels Emendation eines frivolen Wortspiels in dessen Hamlet-Übersetzung öffentlich zu tadeln.49 Diese innerromantische übersetzungsrelevante Kontoverse um die Wortspiel-
40
41 42 43 44 45 46 47 48
49
Vgl. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 34: „Romeo und Julia gehört zu seinen schönsten, Sprache, Situationen, Charaktere schön, nur zuweilen von Plattheiten und Wortspielen unterbrochen“. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 276, 278 („falscher Witz“). Tieck 1920 (Anm. 10), S. 210. KAV, Bd. I, S. 9f. KAV, Bd. I, S. 16, 96. KAV, Bd. IV/1, S. 289f., 302f. KAV, Bd. IV/1, S. 289. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 117. Brief von Jean Paul an Heinrich Voss vom 30. August 1818. In: Briefwechsel zwischen Heinrich Voss und Jean Paul. Hrsg. von Abraham Voss. Heidelberg 1833, S. 142. Ludwig Tieck: Einleitung. In: Ders.: Phantasus. Hrsg. von Manfred Frank. Frankfurt a.M. 1985 (Schriften. 6), S. 11–101, hier S. 92f.
Romantische Übersetzungsfragen
67
verwendung Shakepeares führt trotz der gelegentlichen Kritik an ihrem Missbrauch generell zu der Einsicht in deren unverzichtbares Kunstpotential und insbesondere deren Bühnenattraktivität.50 Die Sorge überwiegt, dass die zeitgenössische Manie, „in jedem dreisten Witz eine Sünde“ zu wittern, „der Kühnheit“ von Shakespeares Darstellung „den größten Abbruch“ tut.51 Insofern ist es konsequent, dass Schlegel die bösartige und hinterhältige Ausdrucksweise Jagos gegenüber Othello – eine Ausdrucksweise, „wovor die Sittsamkeit erschrickt“ – unter dem Aspekt der gesteigerten Poetizität und Performativität gegenüber dem Geschmack seiner Zeitgenossen zu verteidigen weiß: „Hätte Shakespeare heut zu Tage geschrieben, so würde er sie sich vielleicht untersagt haben, aber gewiß zum Nachtheil der Wahrheit seiner Darstellung“.52 Der Einsicht, dass Zoten, freche Wortspiele, Flüche und provokante Zänkereien auf der Bühne die Zuhörbereitschaft des Publikums steigern, verdanken die romantischen Übersetzer einer sprachkritisch hochbedeutsamen Entdeckung. In Shakespeares Dramen mache der gekonnte Einsatz „gemeiner Worte statt der edlen“ „die Sprache weit energischer und eine pathetische Stelle noch pathetischer“.53 Auf der Suche nach den Ursachen der energetischen Qualitäten Shakespearscher Dramatik stoßen die romantischen Übersetzer in ästhetisches Neuland vor. Sie erkennen in Shakespeares dramatischer Darstellungsweise nicht nur eine seltene, anschauliche Plastizität, sondern „eine gewisse Fühlbarkeit in der Scene, die dargestellt noch grössere Wirkung thun muß“.54
8. Das Dilemma mit dem unzumutbaren Anstößigen am Beispiel von Shakespeares Darstellung von Frauenrollen Es ist zweifelsfrei den romantischen Übersetzern gelungen, viele der für ihr zeitgenössisches Publikum delikaten Unschicklichkeiten in Shakespeares Werk poetologisch und performativ zu rechtfertigen und entsprechend treu und graziös zu übersetzen. Und doch bleibt auch bei ihnen um 1800 ein Rest an Unzumutbarkeit bestehen. Diese Vorbehalte lassen sich am besten in den handschriftlich überlieferten Aufzeichnungen Ludwig Tiecks nachlesen. Diese nicht hinwegzudiskutierenden Übersetzungsschwierigkeiten entstehen bezeichnenderweise nicht im moralischen Bereich, sondern in den unterschiedlichen Sprechlizenzen zwischen den Geschlechtern. Ludwig Tieck notiert sich zum Beispiel, die Darstellung der Mägde sei in Shakespeares Werk häufig geschwätzig und widrig;55 viele der gebildeten Frauen seien dreist und zu männlich gezeichnet. In der Komödie Viel Lärmen um Nichts sei das Auftreten Beatrices nicht akzeptabel: „Für unser Zeitalter ist übrigens in diesem Charakter vieles zu hart und zu rauh […]; viele von Beatricens witzigen
50 51 52 53 54 55
Vgl. Nathalie Vienne-Guerrin: The Anatomy of Insults in Shakespeare’s World. Bloomsbury 2022. KAV, Bd. IV/1, S. 290. KAV, Bd. IV/1, S. 332. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 360f. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 100. Vgl. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 40.
68
Günter Oesterle
Einfällen sind gemein, ihr ganzer Charakter ist überhaupt etwas zu männlich gerathen“.56 Generell tadelt Tieck, dass Shakespeare die notwendige Grenze zwischen Streit und Zänkerei „besonders in Frauenzimmerrollen“ nicht angemessen berücksichtigen würde.57 Wie kann der souverän sich dünkende romantische Übersetzer mit derartig unzumutbarem Anstößigen angemessen umgehen? Um die Lösung dieses Problems zu verstehen, erfordert es noch einmal einen Blick auf die Ausgangsbehauptung Schlegels, die poetische sei der prosaischen Übersetzung grundsätzlich überlegen.
9. Wie das unzumutbare Anstößige durch eine romantische Erfindung neutralisiert wird oder die Stärke des „Gesamteindrucks“ als „geistiger Hauch“ Die romantische Übersetzungsorientierung am poetischen Dialog geht von der Erfahrung aus, dass der prosaische Dialog dazu neige, „in die Nähe der gewöhnlichen Wirklichkeit, der einheimischen und der heutigen Sitte“58 heranzurücken. Im Gegenzug zu dieser Tendenz eröffnet die poetische Versifikation die Option, nicht nur das Fremde, Seltsame, exotisch Anmutende und Bizarre eines vor Jahrhunderten entstandenen Textes in eine gewisse ästhetische Distanz zu bringen und so zu bewahren, sondern es erlaubt auch das für die eigene Zeit Anstößige nicht abzuschwächen, nicht zu „verschönern“59 und nicht zu tilgen. Um dies erreichen zu können, ist allerdings eine Erweiterung des Wirkungsradius der bislang schon eingeführten Kombination von Treue und Grazie unumgänglich. Die Grazie als in Bewegung geratene Anmut und Schönheit verfügt nämlich über ein ästhetisches Ferment, das in ihrer atmosphärischen Ausrichtung auf den zu erreichenden „Gesamteindruck“60 des jeweiligen Werkes von den Romantikern in immer neuen begrifflichen Anläufen charakterisiert wird. Zu den nachhaltigen bis Eduard Mörike und Thomas Mann wirksamen romantischen Errungenschaften gehört, wofür August Wilhelm Schlegel berühmt wurde, der bei der Übersetzung gewonnene Einsatz einer Diaphanie, in der der ursprüngliche Text zwar im Einzelnen treu, in seiner Stimmung und Atmosphäre aber weder in aufdringlicher Gegenwartsprosa noch in historistischer Kopie, sondern als „Anstrich“61 oder „Kolorit“62 oder „geistiger Hauch“63 präsent wird. Der Übersetzer Schlegel überträgt das hermeneutische Buchstabe-Geist-Schema in ein romantisch getöntes stilistisches Fluidum. Entgegen kommt ihm dabei die Überzeugung, dass „alles
56 57 58 59 60 61 62 63
Tieck 1920 (Anm. 10), S. 298. Tieck 1920 (Anm. 10), S. 93. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 119. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 112, 118. Schlegel 1962 (Anm. 16), S. 265f. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 118. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 117. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 101.
Romantische Übersetzungsfragen
69
Alte […] nicht immer veraltet ist“,64 so dass „ein ganz leichter Anstrich des Alten in Wörtern und Redensarten“65 diesen poetischen Effekt einer zarten und doch körperlich fühlbaren Verlebendigung zu bewirken vermag. Diese von ihm erfundene subtil übersetzende Formatierung hat Schlegel treffsicher in eigene konjunktivisch wägende Worte gebracht: Und wenn es nun möglich wäre, ihn [den Shakespearschen Text, G.OE.] treu und zugleich poetisch nachzubilden, Schritt für Schritt dem Buchstaben des Sinnes zu folgen, und doch einen Teil der unzähligen, unbeschreiblichen Schönheiten, die nicht im Buchstaben liegen, die wie ein geistiger Hauch über ihm schweben, zu erhaschen.66
Man spürt bei der Lektüre solcher Sätze, wie die romantischen Übersetzer in immer wieder neuen Anläufen mal intermedial, mal lebensphilosophisch inspiriert die Aura des Vergangenen als Einfärbung und Kolorit, als Tonlage oder Anstrich bzw. als alles durchdringenden oder über allem schwebenden „Hauch“ einzufangen gewillt sind – immer mit der Anstrengung, weder in eine historistische Imitation noch in eine oberflächliche Dekorationskunst des Vergangenen verfallen zu wollen. Damit gelingt der Romantik das übersetzungsartistische Kunststück, das als außerästhetisch disqualifizierte Anstößige in Shakespeares Werk (wohlgemerkt für den Zeitgeschmack um 1800) in seiner poetischen Wahrhaftigkeit zu erhalten. Die Außergewöhnlichkeit und Subtilität dieser romantischen Übersetzungsambition hat Ludwig Tieck in einer den Begründer dieser neuen Übersetzungsmanier souverän charakterisierenden Form und in einem dem Leser bekannten Vokabular zusammengefasst. Diese 1825 publizierte Hommage auf den Übersetzer August Wilhelm Schlegel soll daher am Ende dieses Beitrags stehen: Wenn wir Deutschen unter allen Nationen am meisten und mit dem größten Fleiße übersetzt haben, wenn wir Vers, Ton, Sinn, Wortspiel und Zufälligkeit, ja einen gewissen geistigen Hauch, der sich kaum noch bezeichnen läßt, haben wiedergeben und nachahmen wollen, so steht als echter Künstler W.v. Schlegel […] unter allen deutschen Virtuosen oder gründlichen Arbeitern oben an; denn ihm wurde von der Natur jenes geistige feine Ohr verliehen, welches auch das leiseste vernimmt, sowie jener zarte Geschmack (der in unsern Tagen abzusterben droht), um nie der Sprache, der Grazie, oder dem Wohllaut Gewalt anzuthun. [Seine] Meisterschaft ist so groß, daß jede neue Wendung oder Form, die er versuchte, dreist nachgeahmt werden darf, denn alle diese Neuerungen sind [durch] eben so viele musterhafte Vorbilder, durch welche unsre Sprache außerordentlich ist, bereichert worden. Von allem aber, was diesem Übersetzungskünstler gelungen ist, muß man die Uebertragung des Shakspeare als ein vollendetes Werk anerkennen.67
64 65 66 67
Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 101. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 101. Schlegel 1962 (Anm. 14), S. 101. L. T. [Ludwig Tieck]: Vorrede. In: Shakespeareʼs dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Erster Theil. Berlin 1825, S. III–VIII, hier S. IV.
Olivia Varwig
„Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ August Wilhelm Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
„Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ Auf deutsch: Ich bin der englischen Sprache nicht mächtig genug, um in ihr korrekt zu schreiben. Dies antwortet August Wilhelm Schlegel 1833, also lange nach der ersten Publikation seiner epochemachenden Shakespeare-Übersetzungen, der Royal Society of Literature of the United Kingdom,1 die ihn gebeten hatte, einen Artikel zu ihren Transactions beizutragen. Er traute sich also nicht zu, einen Aufsatz auf Englisch zu veröffentlichen? – Oder es handelt sich hierbei um ein vorgeschobenes Argument und er wollte aus anderen Gründen nicht auf Englisch publizieren? Ähnlich hatte er sich schon 1826 gegenüber John G. Lockhart geäußert, der ihn um Beiträge für die Zeitschrift The Quarterly Review gebeten hatte: Je ne me fie pas à la correction de mon style anglois quoique je parle cette langue avec facilité. J’écrirai de préférence en françois me croyant plus sûr de cette manière d’être traduit exactement. L’allemand est par sa construction une langue très-difficile pour vos compatriotes et j’ai quelque fois fait l’expérience que des traducteurs fort habiles ont manqué le sens de mes phrases.2
Er zog es also vor, einen in England zu veröffentlichenden Aufsatz auf Französisch vorzuformulieren und dann ins Englische übersetzen zu lassen, statt der direkten Übersetzung des Deutschen ins Englische. Ihn selbst auf Englisch zu formulieren scheint gar keine nennenswerte Option gewesen zu sein. Dies erstaunt angesichts der Tatsache, dass Schlegel heute einem breiteren Publikum hauptsächlich für seine Shakespeare-Übersetzungen bekannt ist, die er zwischen 1797 und 1810 veröffentlicht hat. Ein Blick in Schlegels nun in digitaler Edition vorliegende Gesamtkorrespondenz (KAWS) zeigt tatsächlich, dass die Zahl der von ihm auf Englisch verfassten Briefe verschwindend gering ist. Seine internationale Korrespondenz hielt er auf
1
2
Brief vom 2.2.1833. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2949 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 1.8.2022 gesehen). Brief vom 17.1.1826. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/824.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-007
72
Olivia Varwig
Französisch. Engländern schrieb er auf Französisch und diese antworteten auf Englisch. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen: Eine bildet die 1808 in Wien mit der Gesellschaftsdame Elisabeth Wilhelmine van Nuys gepflegte intime Korrespondenz, die in erotisch konnotierter Weise zwischen Deutsch und Englisch changiert.3 Die zweite ist die mit der Bankiersgattin Juliet Smith, von der zwei Briefe aus dem Jahr 1790 erhalten sind – sowie ein englisches Konzept von Schlegels Hand an sie.4 Dazu später mehr. 1790 bemühte er sich folglich noch, einen Brief auf Englisch zu verfassen; später lehnte er dies ab und schrieb nur noch auf Französisch. Zu einem Brief von 1829 an die East India Company, den er auf Englisch ausfertigte, hat sich ein französisches Konzept erhalten,5 d.h. Schlegel schrieb den Brief zunächst auf Französisch vor, um ihn dann ins Englische zu übersetzen oder auch übersetzen zu lassen. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich dabei von seinem Schüler, dem Norweger Christian Lassen, helfen ließ, der sich lange in London aufgehalten hatte und über den Schlegel 1838 urteilte: „Er hat vielfältig Unterricht für Engländer im Deutschen, und für Deutsche in der Englischen Sprache ertheilt, deren er vollkommen mächtig ist“.6 Schlegel selbst scheint sich des Englischen nicht „vollkommen mächtig“ gefühlt zu haben und hatte anscheinend Hemmungen, schriftlich auf Englisch zu formulieren. Ferner äußerte er sich sogar immer wieder abfällig über die englische Sprache und Kultur, so z.B. im Brief an Ludwig Tieck vom 11. Dezember 1797, also in dem Jahr, in dem er den ersten Band seiner Shakespeare-Übersetzungen veröffentlichte: Ich hoffe, Sie werden in Ihrer Schrift [gemeint sind die Briefe über Shakespeare, O.V.] unter anderm beweisen, Shakspeare sey kein Engländer gewesen. Wie kam er nur unter die frostigen, stupiden Seelen auf dieser brutalen Insel? Freylich müssen sie damals noch mehr menschliches Gefühl und Dichtersinn gehabt haben, als jetzt.7
Auch gegen Ende seines Lebens äußerte er sich immer wieder abwertend über die englische Sprache, wie z.B. aus einem Brief des Chemikers Andrew Ure, den er 1841 in Berlin traf, hervorgeht. Dieser knüpft an ein Gespräch der beiden an:
3
4
5 6
7
KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=36_absender.LmAdd. personid17:1303+OR+36_adressat.LmAdd.personid17:1303. Vgl. dazu näher: Sophia Victoria Krebs: Codierte Nähe. Von Codes, Blumen und Bildern in Privatnachrichten des 19. und 21. Jahrhunderts. In: Soziales Medium Brief. Sharen, Liken, Retweeten im 18. und 19. Jahrhundert. Neue Perspektiven auf die Briefkultur. Hrsg. von Markus Bernauer, Selma Jahnke, Frederike Neuber und Michael Rölcke. Darmstadt 2023, S. 155–169, hier S. 166f. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=36_absender.LmAdd. personid17:7708+OR+36_adressat.LmAdd.personid17:7708. Brief vor dem 23.9.1829. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1322. August Wilhelm Schlegel an Georg Wilhelm Freytag, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 30.3.1838. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2963. August Wilhelm Schlegel an Ludwig Tieck, 11.12.[1797]. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/878.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
73
I regret exceedingly being from home when you did me the honour to call here yesterday, as I wished to express to you my sentiments concerning the opinion you entertain of the English language being incapable of representing those deeper or finer tones of feeling and thought which distinguish the German mind, and are well exhaled through their mother tongue.8
Nach Ure ist allerdings – kaum verwunderlich – „the language of Shakspere [sic], Burke & Byron […] as copious as that of any German writer, and as capable of exhibiting every combination and modification of the reasoning & sentient powers of man.“ Roger Paulin fasst Schlegels gelegentlich geäußerten Vorurteile gegenüber dem Englischen zusammen als „English coldness and superficiality, their inadequate system of education, their commercial mentality, the ‚impurity‘ of their language. The list may be extended.“9 Eine Sonderstellung in der englischen Kultur hat allerdings Shakespeare für Schlegel. Bei Paulin heißt es weiter: „But then there was Shakespeare: the ‚mixed‘ language would be worth learning for his sake.“10 Allerdings gibt es auch andere Quellen, in denen er die englische Sprache als „edel“ bezeichnet11 und außerdem „die große Uebereinstimmung“ zwischen dem Deutschen und dem Englischen betont.12 In seiner politischen Schrift Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède von 1813 schreibt er über England: „Comme elle le doit, elle combat d’abord pour son propre salut: mais convenons avec candeur qu’elle combat aussi avec un noble dévouement pour la cause européenne.“13 England verkörpere also „die uneigennützigste, für die Freiheit Europas kämpfende Macht“, wie Walter F. Schirmer 1939 interpretiert.14 Noch dazu wurde Schlegel von Zeitgenossen immer wieder für seine virtuose Eloquenz in der englischen Konversation gerühmt. So schreibt z.B. Germaine de Staël kurz nach ihrem ersten Kennenlernen 1804 aus Berlin an ihren Vater: J’ai rencontré ici un homme qui en littérature a plus de connaissances et d’esprit que presque personne à moi connu: c’est S[ch]legel. Benjamin te dira qu’il a de la réputation en Allemagne, mais ce que Benj[amin] ne sait pas, c’est qu’il parle le français et l’anglais comme un Français et un Anglais, et qu’il a tout lu dans ce monde, quoiqu’il n’ait que trente-six ans.15 8 9
10 11
12
13
14
15
Brief vom 14.8.1841. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2969. Roger Paulin: The Life of August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 22. Vgl. auch August Wilhelm Schlegel an Johannes Schulze, 20. bis 29.2.1824. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/678. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 22. Z.B. August Wilhelm Schlegel an Christian Gottlob Heyne, 2.7.1791. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/400. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters (1796). In: Böcking, Bd. 7, S. 24–70, hier S. 62. August Wilhelm Schlegel: Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède. Hamburg 1813, S. 64f., https://www.google.de/books/edition/Sur_le_syst%C3%A8me_continental_et_sur_ses_r/ BiDQn9e6GT4C?hl=de&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover. Walter F. Schirmer: August Wilhelm Schlegel und England. In: Shakespeare Jahrbuch 75, 1939, S. 77–107, hier S. 77. Brief an Necker vom 23.3.[1804]. In: Germaine de Staël: Correspondance Générale. Bd. 5, Teil 1: France et Allemagne. 1er aout 1803 – 19 mai 1804. Hrsg. von Béatrice W. Jasinski. Paris 1982, S. 284. Vgl. zur Schreibweise von „Slegel“: ebd., Anm. 6.
74
Olivia Varwig
Laut de Staël – zugegebenermaßen selbst keine englische Muttersprachlerin, aber durchaus anglophil16 – sprach Schlegel also Englisch wie ein Engländer – und dass zu einer Zeit, in der er – abgesehen von seinem Aufenthalt in Amsterdam – noch nie deutschsprachigen Boden verlassen hatte. John Hobhouse, ein englischer Politiker und enger Freund von Lord Byron, bestätigte Schlegel, den er 1816 im Coppeter Kreis traf, im Gegensatz zu den anderen im Kreis gute Englischkenntnisse: „He is a little thin man with a largish sharp face, thin grey hair, intelligent-looking, talks English well.“17 Allerdings berichtet er auch, dass Schlegel sehr empfindlich war, wenn es um seine englische Aussprache ging.18 So kam es mit dem italienischen Schriftsteller Ludovico di Breme zu einer Konfrontation: „Schlegel was one day talking English to Miss Randall. Brême said, ‚It seems to me that the English, for a man that does not understand it, is rather a hard language.‘“ Schlegel fühlte sich persönlich angegriffen und beschwerte sich bei de Staël: „there is a conspiracy in your house against me; everybody is resolved to offend me.“ Breme versuchte sich daraufhin zu erklären, aber Schlegel war sich sicher: „any one could see you meant to laugh at my way of pronouncing English.“19 Viel später, 1828, besuchten Samuel Taylor Coleridge und William Wordsworth Bonn. Sie trafen dort alle „illuminati of Bonn – Niebuhr, Becker, Augustus Schlegel, and many others“. In den Memoiren des beim Treffen anwesenden Schauspielers Charles Mayne Young heißt es: Schlegel was the only one of those I have named who spoke English, so that his were the only remarks I recollect, and they hardly worth repetition [sic]. […] He talked admirably, yet not pleasingly, for whatever the topic, and by whomever started, he soon contrived to make himself the central object of interest.20
Der Schauspieler paraphrasiert die weitere Unterhaltung über Literatur, gibt aber zu, noch nie eine Zeile von Schlegel oder Coleridge gelesen zu haben.21 Er saß meist nur dabei „trying hard to look intelligent, though I did not feel so“.22 Wie zuverlässig diese Gespräche wiedergegeben werden, ist also fraglich; klar ist jedoch, dass Schlegel ohne Scheu auf Englisch Konversation machte – im Gegensatz zu seinen Bonner Kollegen. An anderer Stelle in den Erinnerungen heißt es über Coleridge:
16 17
18 19 20
21 22
Vgl. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 22 und Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 78. Lord Broughton (John Cam Hobhouse): Recollections of a Long Life. With Additional Extracts from his Private Diaries. Hrsg. von Lady Dorchester. Bd. 2. London 1909, S. 15. Vgl. zu Schlegels Aussprache im Englischen Anm. 27. Hobhouse 1909 (Anm. 17), S. 42f. Charles Mayne Young: A memoir. With extracts from his son’s journal. Hrsg. von Julian Charles Young. 2. Aufl. London 1871, S. 117f. Young 1871 (Anm. 20), S. 59. Young 1871 (Anm. 20), S. 118.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
75
The German tongue he knew au fond. He had learned it gramatically, critically, and scientifically at Göttingen: yet so unintelligible was he when he tried to speak it, that I heard Schlegel say to him one evening, „Mein lieber Herr, would you speak English? I understand it: but your German I cannot follow.“23
Schlegel sprach also lieber Englisch statt Deutsch mit ungeübten Sprechern. Fest steht, dass die „Erlernung der Sprachen“ im Allgemeinen, nicht nur des Englischen, „eine sehr glückliche Leichtigkeit“ für ihn darstellte, wie sein Bruder Karl August Moritz 1816 befand.24 Um 1800 übersetzte er schließlich nicht nur aus dem Englischen (beispielsweise Horace Walpoles Historische, kritische und unterhaltende Schriften), sondern auch aus dem Griechischen, Spanischen, Italienischen und Portugiesischen ins Deutsche, womit er versuchte, wie Claudia Bamberg formuliert, „bislang weniger beachtete Zeugnisse aus der Geschichte der europäischen Literatur zu kanonisieren und in ihrer historisch-kulturellen Eigenart zu würdigen.“25 Später setzte er bekanntlich den Fokus auf seine indologischen Studien und damit das Sanskrit. In seiner Korrespondenz finden sich fast 20 verschiedene Sprachen, darunter auch Niederländisch, Arabisch, Persisch und sogar Koptisch. Welchen Stellenwert hatten also im Besonderen die englische Sprache und Literatur – über Shakespeare hinaus – für Schlegel? Ein näherer Blick auf seine frühesten Kontakte mit der englischen Sprache und Literatur soll hier Aufschlüsse bieten.
1. Englischer Einfluss während Schlegels Schulzeit in Hannover Schlegel kam bereits in seiner Hannoveraner Schulzeit in regen Kontakt mit der englischen Kultur. Gelehrt wurden auf dem Ratsgymnasium als Fremdsprachen Latein, Griechisch und Hebräisch, seit 1761 auch Französisch und seit 1773 Englisch.26 Nach eigenen Angaben lernte Schlegel seit seinem 13. Lebensjahr Englisch.27 Wir können davon ausgehen, dass er sich früh mit der für ihn erreichbaren englischen Literatur vertraut machte – auch immer angeregt durch seinen älteren, literaturbegeisterten Bruder
23 24
25
26 27
Young 1871 (Anm. 20), S. 121. [Karl August Moritz Schlegel:] August Wilhelm und Friedrich Schlegel. In: Zeitgenossen. Bd. 1, Abt. 3, 1816, S. 179–186, hier S. 180. Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40, hier S. 34. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 28f. So schreibt Thomas Campbell am 9.6.[1820] aus Bonn an Freunde in England: „Schlegel was very happy to see me, and is very obliging; but his trick of lecturing, in conversation, appears to have increased with his appointment. He is ludicrously fond of showing off his English to me – accounting for his fluency and exactness in speaking it by his having learnt it at thirteen. This English, at the same time, is, in point of idiom and pronunciation, what a respectable English parrot would be ashamed of.“ Life and Letters of Thomas Campbell. Hrsg. von William Beattie. Bd. 2. New York 1855, S. 109.
76
Olivia Varwig
Karl August (1761–1789) – und später durch den intensiven Austausch mit dem jüngeren Bruder Friedrich.28 Natürlich wird sein umfassend gebildeter Vater Johann Adolf Schlegel (1721–1793) ebenfalls dazu beigetragen haben, der im Übrigen mit dem Shakespeare-Übersetzer Johann Joachim Eschenburg freundschaftlich verkehrte.29 Sein Onkel Johann Elias Schlegel (1719–1749) hatte bereits 1741, anlässlich der ersten veröffentlichten Shakespeare-Übersetzung ins Deutsche von Kaspar Wilhelm von Borcke (nach französischem Vorbild in Alexandrinern)30 eine Vergleichung Shakespears und Andreas Gryphs bey Gelegenheit einer Uebersetzung von Shakespears Julius Caesar (Berlin 1741) vorgelegt, und sein anderer Onkel Johann Heinrich Schlegel hatte einige dänische Schriften und englische Dramen übersetzt, darunter James Thomsons Sophonisba (1758) in Blankversen. Shakespeares Stücke wurden damals häufig auf deutschen Bühnen gespielt, v.a. Friedrich Ludwig Schröders Bühnenadaptationen, basierend auf David Garricks Vorlagen und Wielands Prosaübersetzungen. Schlegel sah Schröder „in den Rollen des Shylock, Hamlet, Lear“, wie er in seinem Wilhelm Meister-Essay schreibt,31 vermutlich bei Gastspielen in Hannover im Winter 1785/1786, also kurz vor dem Beginn seines Studiums in Göttingen, wie Thomas G. Sauer eruiert.32 Das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg war seit 1714 mit der britischen Krone eng verknüpft. Es ist also davon auszugehen, dass man im Stadtbild von Hannover überdurchschnittlich häufig englischen Muttersprachlern begegnete – allerdings wohl mehr Militärangehörigen, die profanes Alltagsenglisch sprachen, als Gelehrten oder Literaten. Der erwähnte ältere der Schlegel-Brüder, Karl August, schloss sich mit 21 Jahren der Hannoverisch-britischen Armee an und ging mit ihr nach Indien. Von ihm stammt der früheste erhaltene Brief von 1782 an den damals 14-jährigen August Wilhelm. Er schreibt ihn „An Bord des Farmers“, also auf See, und rät dem Jüngeren eindringlich, u.a. Alexander Popes Gedicht Eloisa to Abelard zu lesen.33 Die englische Literatur spielte also schon früh eine wichtige Rolle in Schlegels persönlichem Leben. Sein Bruder starb sieben Jahre später in Indien an den Folgen einer Tropenkrankheit.34 Schlegel wird durch einen dortigen Freund seines Bruders über dessen Tod informiert. 28
29
30 31 32
33 34
Die Briefe Friedrichs an August Wilhelm, aus denen die intensive Beschäftigung mit europäischer Literatur und immer wieder auch mit Shakespeare hervorgeht, sind ab 1791 erhalten. Die Gegenbriefe existieren leider nicht mehr. Vgl. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search? query=36_absender.LmAdd.personid17:4644+OR+36_adressat.LmAdd.personid17:4644. Vgl. dazu Frank Jolles’ Einleitung in: A. W. Schlegels Sommernachtstraum in der ersten Fassung vom Jahre 1789. Hrsg. von Frank Jolles. Göttingen 1967, S. 9–54, hier S. 22. Vgl. auch August Wilhelm Schlegel an Johann Joachim Eschenburg, 15.2.1788. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/395. Versuch einer gebundenen Uebersetzung des Trauerspiels von dem Tode des Julius Cäsar. Berlin 1741. Schlegel 1796 (Anm. 12), S. 66, dortige Anm. 2. Thomas G. Sauer: A. W. Schlegel’s Shakespearean Criticism in England, 1811–1846. Bonn 1981, S. 2, vgl. auch S. 151, Anm. 9. Brief vom 26.6.1782. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4646. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 28f. Vgl. ferner Olivia Varwig: Hannover. In: August Wilhelm Schlegel: Aufbruch ins romantische Universum. Katalog zur Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt a.M. Hrsg. von Claudia Bamberg und Cornelia Ilbrig. Göttingen 2017, S. 13–26, hier S. 20f.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
77
Dieser zitiert die englische Todesanzeige aus dem Madras Courier und ein dort anonym abgedrucktes sehr persönliches, im Stil aber historisierend-frühneuenglisch, fast schon shakespearisch angehauchtes Gedicht mit dem Titel Lines written on the death of Lieutenant Schlegel, bezeichnet als „effusions of a heart that felt for the loss of a dear and respected friend“.35 Die Verbindung seiner Hannoveraner Heimat mit der britischen Krone erwähnt Schlegel übrigens später, 1813, dem österreichischen Hofbeamten Franz von Sickingen gegenüber, als es um die Frage seiner Staatszugehörigkeit geht: Ich bin ein Hannoveraner, gebohrener Unterthan des Königs von Grossbritannien, der meinem Vater immer besondere Achtung bezeugt hat. Ich weiss, dass der Prinz-Regent geäussert, er werde nie seine Rechte auf die deutschen Erbstaaten seines Hauses aufgeben. Ich darf also hoffen, nicht ohne ein Vaterland zu seyn; und wenn ein freygesinnter Mann nicht mehr in Deutschland athmen kann, so bin ich gewiss, in dem glücklichen England einen Zufluchtsort und gute Aufnahme zu finden.36
Dass er sich hier als „Unterthan des Königs von Grossbritannien“ bezeichnet, ist aber wohl eher in praktikabler als in patriotischer Weise zu verstehen. In den Kriegswirren der Napoleonischen Ära konnte auch für den Kosmopoliten August Wilhelm Schlegel die Frage der Staatsangehörigkeit lebensnotwendig werden.37
2. Studienjahre in Göttingen Nach seiner Schulzeit ging Schlegel zum Studium der klassischen Philologien nach Göttingen. Sein erster Brief von dort ging im Mai 1786 an seinen Bruder Johann Carl Fürchtegott. Er beschreibt darin die Reise von Hannover dorthin – seine erste ‚Fernreise‘ – und die für ihn neuen Landschaftseindrücke erwecken in ihm sofort allerlei literarische Assoziationen: „Es drangen Ideen auf mich ein aus Götz von Berlichingen, Otto von Wittelsbach, und Oberon. Weiter hin verlor ich mich im Homer und Ossian.“38 – Macphersons fingierte Poems of Ossian reihen sich also wie selbstverständlich neben Homer, Goethe, Wieland und den heute weniger bekannten Joseph Marius von Babo.
35
36
37 38
August von Honstedt an August Wilhelm Schlegel, 15.1.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/396. Brief vom 14.1.1813 (Datum erschlossen). In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-0122/letters/view/7163. Zur Frage des Adressaten sowie zur Datierung siehe: Josef Körner: August Wilhelm Schlegel und Metternich. In: Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 43, 1929, S. 123–125. Vgl. Varwig 2017 (Anm. 34), S. 24f. Brief vom 4.5.1786. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/393. Später nennt Schlegel Ossian ein „empfindsame[s], gestaltlose[s], zusammengeborgte[s], moderne[s] Machwerk, über dessen absoluten Unwerth ich mich nicht stark genug auszudrücken weiß“. Aus: August Wilhelm Schlegel: Bürger (1800). In: Böcking, Bd. 7, S. 64–139, hier S. 135.
78
Olivia Varwig
Die 1737 vom britischen König Georg II. gestiftete Göttinger Universität besaß schon damals eine beachtliche Sammlung englischer Schriften und wurde aufgrund der Verbindung nach Großbritannien von verhältnismäßig vielen britischen Studierenden und Reisenden besucht.39 Auch Schlegel hatte dort als Student einige englische Freunde, z.B. den Juristen Josiah Dornford, der zunächst Rechtswissenschaften in Oxford studiert hatte und schließlich nach Göttingen gewechselt war. Nach seinem Aufenthalt in Deutschland veröffentlichte er englische Übersetzungen von deutschsprachigen juristischen Schriften. Von ihm haben sich zwei englische Briefe an Schlegel erhalten. Im ersten heißt es: I often regret that I did not pass the younger years of my life at Göttingen instead of Oxford, because an ambitious mind is gratified there by being reputed studious, whilst with us a man who devotes his time to books is too frequently treated with contempt.40
Dies verstärkte sicher Schlegels Vorurteile über das zeitgenössische England. Er scheint ihm übrigens auf Deutsch geantwortet zu haben, wie aus dem Postskriptum zu diesem Brief hervorgeht: „I write in English for the same reason you profess to write in German & I believe most people express their sentiments best in their native language“. Dornford und Johann Georg Zimmermann vermittelten Schlegel einen 15-jährigen englischen Bankierssohn, den Schlegel ein gutes halbes Jahr als Hofmeister betreute: George Thomas Smith strebte eine Militärkarriere an und wollte in Göttingen Persisch und Arabisch lernen. Zimmermann preist gegenüber einem englischen Freund der Familie den jungen Schlegel an, „qui a un desir extreme de voir Angleterre, dʼy vivre en conduisant les etudes de quelque jeune homme de merite et puis de voyager avec lui“.41 Das Verhältnis zu dem Teenager gestaltete sich allerdings als schwierig; dieser beschwerte sich anscheinend bei seinem Vater über Schlegel und dessen nachlässige Erziehungsmethoden. Schlegel las den Brief, „he having left the first copy of it lying open in his room“42 und schrieb einen Rechtfertigungsbrief an dessen Mutter. Das siebenseitige Konzept dazu mit vielen Korrekturen und Umformulierungen hat sich im Nachlass erhalten und ist, wie eingangs erwähnt, eines der wenigen komplett auf Englisch verfassten Schreiben Schlegels. Man merkt deutlich an einigen Wendungen, dass er hier, anstatt genuin englische Formulierungen zu verwenden, oft Wort für Wort aus dem Deutschen übersetzt. Seine Sprache ist an einigen Stellen die eines Ausländers, der bislang noch wenig Kontakt zu ‚native speakers‘ hatte und seine Kenntnisse eher einer Buchgelehrsamkeit verdankt. Als besonders ‚unenglische‘ oder zumindest ungewöhnliche Formulierungen seien beispielsweise genannt: 39 40 41
42
Vgl. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 22. Brief vom 22.8.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2511. Johann Georg Zimmermann an William Hutton, 21.5.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4139. August Wilhelm Schlegel an Juliet Smith, [Sommer 1790]. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/817.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
79
„I need not be afraid of talking to you about You spare not Your sons failings, Madam – You called him extremely indolent and he is so indeed and therefore wants somebody to exact excite him to constant occupation.“ „if he form should happen to form bad connexions“ „It would be a very easy thing to chain him to my side“ „students of the wilder class“ „You will make me leave Young Mr Smith by the least hint that you wish me to do so“ „I shall give you warning soon enough to make other regulations“43
Er rechtfertigt sich gegen alle Kritikpunkte des jungen Mannes und stellt dessen Mutter frei, das Mentorenverhältnis zu beenden, was sie allerdings verneint, wie ihre Antwort zeigt: Shall I confess to you, Sir, that your letter surprised me more than the young Manʼs? in his, I discoverʼd the impatience of Youth to throw off the restrain[t] of a Governor, in yours, I observed a degree of Anger, which I think on reflection, you will deem unworthy of you, when you consider, that all Boys are eager to become Men, over-rate their own abilities, & think themselves capable of regulating their Conduct & Affairs, – long before they are.44
Dass er den Brief des Jungen an den Vater gelesen hat, empfindet sie allerdings als „not quite consistent with that delicate sense of Honour, I should have expected from you“. Mit Schlegels liberalen Erziehungsmethoden ist sie jedoch einverstanden: „The liberty you have allowʼd my Son, meets both with Mr. Smithʼs & my approbation, so long as Geo[rge] does not abuse it – let him enjoy it – it will qualify him the better to become his own Master hereafter.“ Der junge Smith blieb noch bis zum Anfang des nächsten Jahres bei Schlegel in Göttingen. Übrigens waren auch später noch, in Schlegels Zeit als Professor in Bonn, häufig englische Studenten in seiner Obhut, z.B. die Söhne seiner späteren Freunde Henry Thomas Colebrooke und Alexander Johnston. Außerdem besuchten immer wieder ausländische, vorwiegend englische Studierende seine Vorlesungen in Bonn.45
43
44
45
August Wilhelm Schlegel an Juliet Smith (Anm. 42). Ich danke an dieser Stelle dem passionierten Englischlehrer Th. Varwig für die kritische Lektüre des Briefs. Juliet Smith an August Wilhelm Schlegel, 11.10.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1462. Vgl. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 465, 470.
80
Olivia Varwig
3. „An den Sommernachtstraum habʼ ich euch heute nicht erinnern wollen“46 – Schlegels Begegnung mit Gottfried August Bürger in Göttingen Während der Studienzeit in Göttingen intensivierte sich Schlegels Beschäftigung mit der europäischen und auch mit der englischen Literatur – und daran hatten seine akademischen Lehrer Christian Gottlob Heyne, Professor und Direktor der dortigen umfangreichen Bibliothek, und vor allem Gottfried August Bürger maßgeblichen Anteil. Den größten Einfluss auf Schlegel als Shakespeare-Übersetzer hatte mit Sicherheit letzterer. Bürger hatte sich in den 1770er Jahren vornehmlich Werken der klassischen Antike gewidmet und in den 1780er Jahren die englische Literatur für sich entdeckt, wobei er eine Vorliebe für metrische Übertragungen entwickelt hatte.47 Schlegel dürfte Bürger bereits seit seinem ersten Semester 1786 gekannt haben. „Eine enge Freundschaft hat sich spätestens im Wintersemester 1788/89 entwickelt“, heißt es bei Frank Jolles.48 Schlegel beschreibt später diese Zeit mit ihren „täglichen Spaziergängen“, bei denen die Poesie der beständige Gegenstand unserer Unterredungen war, da Bürger oft ganze Nachmittage bei mir zubrachte, in meinem Zimmer an seinen Liedern arbeitete, oder auch scherzhafte Aufgaben der Versifikation mit mir um die Wette ausführte […].49
Gegenüber einem Bekannten schreibt Bürger im Januar 1789, Schlegel sei „mein poetischer Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe!“50 Zwei Monate später heißt es: „Ich habe ihn jetzt förmlich zu meinem Jünger auf- und angenommen.“51 Durch seine Vermittlung konnte Schlegel erste Texte veröffentlichen, z.B. in dem von Bürger mitherausgegebenen Göttinger Musenalmanach, aber auch in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, vor allem Besprechungen von dichterischen und gelehrten Werken aus dem englischen, französischen, italienischen und natürlich auch aus dem deutschen Schrifttum – „schöngeistige Literatur, historische Werke, Reiseberichte, Zeitschriften, Übersetzungen, Sprachlehren und Wörterbücher“.52 Daneben entstanden Übersetzungen,53 größtenteils Sonette aus dem Italienischen. „Bürger hatte das Sonett wie-
46
47 48 49 50
51
52 53
August Wilhelm Schlegel an Gottfried August Bürger, 11.6.1791. In: KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/3705. Vgl. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 25. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 27. Schlegel 1800 (Anm. 38), S. 68, Anm. 2. Gottfried August Bürger an Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, 12.1.1789. In: Briefe von und an Gottfried August Bürger. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Hrsg. von Adolf Strodtmann, Bd. 3: Briefe von 1780–1789. Berlin 1874, S. 211. Gottfried August Bürger an Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, 1.3.1789. Strodtmann 1874 (Anm. 50), S. 217. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 25. Vgl. hierzu Paulin 2016 (Anm. 9), S. 46ff.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
81
derentdeckt und wetteiferte nun mit Schlegel um die höchste Formvollendung in dieser Gattung“,54 heißt es bei Jolles. Schlegels erste Übersetzungen von poetischen Texten kamen also „durch Anregung und unter Anleitung G.A. Bürgers zustande.“55 „Die Beschäftigung mit dem Übersetzen“, also insbesondere mit dem metrischen Übersetzen, „war für Schlegel eine Verschmelzung seiner kritischen Fähigkeiten mit seinem dichterischen Talent“ und „Hingabe an das fremde Werk und dessen Aneignung im Übersetzungsvorgang“, wie Jolles es treffend formuliert, und bot eine „greifbare Möglichkeit zur Überbrückung des Gegensatzes zwischen dem Gelehrten und dem Dichter in Schlegel“.56 Hier konnte er seine „schöpferische Begeisterung“ mit „wissenschaftlicher Vertiefung“ vereinen,57 auch wenn er (z.B. im Gegensatz zu Eschenburg) kein dezidierter Shakespeare-Philologe war, wie Paulin darlegt.58 Neben diesen publizistischen und den in Bezug auf seine Hofmeisterstelle erwähnten pädagogischen Tätigkeiten führte Schlegel für Christian Gottlob Heyne Hilfsarbeiten aus; so fertigte er für dessen Virgilius-Edition beispielsweise die Register an, wie wir aus einem Brief von Dornford wissen.59 Heyne bat ihn ferner um Übersetzung seiner Ankündigung des Prorectorat-Wechsels ins Englische, aber Schlegel antwortete: Ich bin zwar der Englischen Sprache nicht genug mächtig, um mit völliger Sicherheit darin zu schreiben, indessen hat vielleicht ein besserer Kenner derselben, etwan Herr Kirchner, die Gefälligkeit, meine Arbeit durchzusehen.60
Seine Bedenken treffen sich interessanterweise fast im Wortlaut mit dem eingangs erwähnten französischen Zitat von 1833: „Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“61 – „Ich bin […] der Englischen Sprache nicht genug mächtig, um mit völliger Sicherheit darin zu schreiben“. Dazwischen liegen 40 Jahre, in denen Schlegel seine Fähigkeiten im Französischen so perfektioniert hat, dass er in dieser Sprache bedenkenlos schreibt und veröffentlicht; das Englische scheint ihm aber immer ein letztes Stück verschlossen geblieben zu sein und das sogar in der Zeit seiner intensiven Shakespeare-Übersetzungstätigkeit. D.h. die Übersetzungsrichtung ist damals immer vom Englischen ins Deutsche, niemals umgekehrt. In der Göttinger Zeit entstand Schlegels erste Fassung der SommernachtstraumÜbersetzung gemeinsam mit Bürger, die 1967 von Jolles nach den Handschriften ediert
54 55 56 57 58 59
60 61
Jolles 1967 (Anm. 29), S. 25. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 31. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 25. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 31. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 92. Josiah Dornford an August Wilhelm Schlegel, 22.8.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2511. Brief vom 6.1.1791. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1. August Wilhelm Schlegel an Royal Society of Literature of the United Kingdom, 2.2.1833. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2949.
82
Olivia Varwig
worden ist.62 Sie zeigt noch eine „uneinheitliche[] Vielfalt von Stilproben“63 und ist geradezu ein Übersetzungsexperimentierfeld. Es gibt freiere und wörtlich übersetzte Teile, Passagen in Prosa sowie in Versen – und hierbei mit unterschiedlichen Versmaßen. Die Mitwirkung Bürgers an diesen ersten Versuchen „kann nur ungefähr festgelegt werden.“64 Bürger erwähnt die Sommernachtstraum-Übersetzung nicht in seiner Korrespondenz, woraus Jolles schließt, dass „diese Aufgabe seinem Herzen nicht am nächsten lag“ und dass wohl Schlegel die Übersetzung größtenteils alleine anfertigte und sie daraufhin „gemeinsam durchgesprochen“ worden sei. „Man kann also den Hauptteil der Übersetzungsarbeit Schlegel zuschreiben und dennoch das Werk als eine Zusammenarbeit der beiden Dichter im wahrsten Sinne betrachten“, fasst Jolles zusammen.65
4. Der erste Auslandsaufenthalt: Amsterdam 1791 ging Schlegel als Hauslehrer nach Amsterdam. Dazu ein kleiner Exkurs: In seiner Amsterdamer Zeit hatte Schlegel auch Niederländisch so gut erlernt, dass ihm die dortigen Bekannten nach seiner Rückkehr aus Bequemlichkeit lieber in ihrer Muttersprache schrieben – in der er inzwischen zum Meister geworden sei.66 Nach vier Wochen in Amsterdam nennt er die holländische Sprache scherzhaft in einem Brief an Bürger „dieß süße Geflister der kaufmännischen Musen und Grazien“ und schlägt – wohl ebenfalls scherzhaft – vor, dort derzeit viel diskutierte religiöse Schriften ins Deutsche zu übersetzen.67 Hier zeigt sich Schlegels damalige Übersetzungswut: Schon nach knapp einem Monat in den Niederlanden erwog er, sich auch als Niederländisch-Übersetzer zu betätigen – was er später tatsächlich auch tat.68 Wenige Monate darauf heißt es allerdings: Möchten Sie etwas von Holländischer Litteratur hören? Ich weiß auf Ehre nichts davon zu sagen. Die Sprache ist mir so zuwider, daß mir davor eckelt ein Holländisches Buch nur in die Hand zu nehmen; und eins auszulesen, das übersteigt beynah meine Kräfte.69
62
63 64 65 66
67
68
69
Diese Übersetzungsversuche werden auch diskutiert bei Michael Bernays: Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare. Leipzig 1872, S. 29–44. Das Manuskript befindet sich im Schlegels Nachlass in der SLUB Dresden (Mscr.Dresd.e.90,XXII,11). Jolles 1967 (Anm. 29), S. 51. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 29. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 29. Z.B. Hendrik Muilman an August Wilhelm Schlegel, 22.9.1795. In: KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/2074. Brief vom 11.06.1791. In: KAWS. Aus: Strodtmann 1874 (Anm. 50), https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3705. Joachim Rendorp: Geheime Nachrichten zur Aufklärung der Vorfälle während des letzten Krieges zwischen England und Holland. [Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel.] Leipzig 1793. August Wilhelm Schlegel an Gottfried August Bürger, 19.11.1791. In: KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/4660.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
83
Gegenüber Heyne äußert er sich etwas moderater und fragt sich, ob der unedle Ruf des Holländischen gerechtfertigt sei: „Und warum ist das Englische, dem das Holländische so viel näher verwandt ist als das Deutsche, wieder so edel? Oder ist das alles nur Vorurtheil und Gewöhnung?“70 Hier bezeichnet er also das Englische, über das er sich an anderen Stellen so abfällig äußert, im Vergleich als „edel“. Im selben Brief heißt es, er „rede auch die Sprache noch wenig, weil ich fast immer mit Leuten bin, mit denen ich Französisch oder Englisch sprechen kann“. 1795, nach seiner Rückkehr aus Amsterdam, nahm sich Schlegel die alten Shakespeare-Übersetzungsmanuskripte wieder vor, um sie nun völlig umzugestalten. Zunächst hielt er sich in Braunschweig auf, wo ihm die „ganze vortreffliche Bibliothek“ von J.J. Eschenburg offenstand, wie er an Heyne schreibt.71 Es ist davon auszugehen, dass die Bibliothek des einstigen Prosa-Übersetzers von Shakespeares Dramen viel enthielt, was Schlegel für seine neuerlichen Übertragungen nützlich war.72 Ein Jahr später legte Schlegel in seinem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters seine neuen Einsichten in das poetische Übersetzen dar73 und wiederum ein Jahr später erschien der erste Band seiner Shakespeare-Übertragungen mit Romeo und Julia sowie dem Sommernachtstraum. Im Vorwort geht Schlegel auf seine acht Jahre alten Übersetzungsversuche mit Bürger ein, betont aber, dass „nicht das geringste von der Hand meines verstorbenen Freundes“ in die aktuelle Ausgabe eingeflossen sei:74 Meine Einsichten über die Art, wie man Shakspeare’s Darstellungen in unsre Sprache übertragen müsse, hatten sich in dem beträchtlichen Zeitraume seit jenem ersten Versuche […] so wesentlich verändert, daß ich mich genöthigt sah, theils meine eigene damalige Arbeit ganz umzuschmelzen, theils die wenigen von Bürger noch freyer übersetzten Stellen bey Seite zu legen.75
5. Schlegels Amerika-Pläne In seiner Göttinger Zeit hatte Schlegel also regelmäßigen Kontakt zu Muttersprachlern, befasste sich intensiv mit der englischen Literatur und verfertigte erste Übersetzungen. In Amsterdam unterhielt er sich vornehmlich auf Englisch und Französisch. Allerdings hatte er sich bis dato noch nie in einem englischsprachigen Land aufgehalten – auch wenn das, wie aus dem oben genannten Brief von Zimmermann hervorgeht, ein großer
70 71 72
73 74
75
Brief vom 2.7.1791. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/400. Brief vom 24.9.1795. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1144. Dass Schlegel zu Shakespeare arbeitet, eröffnete er Eschenburg während seines Aufenthalts allerdings wohl nicht. Vgl. dazu den Beitrag von Nikolas Immer in diesem Band, Kapitel 1, Anm. 30. Schlegel 1796 (Anm.12), vgl. Jolles 1967 (Anm. 29), S. 30. August Wilhelm Schlegel: Vorerinnerung. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1797, S. III–VI, hier S. III und IV. Schlegel 1797 (Anm. 74), S. IV.
84
Olivia Varwig
Wunsch von ihm gewesen ist.76 Um eine Sprache wirklich sicher zu beherrschen, müsse man einen längeren Aufenthalt im Ausland getätigt haben, heißt es heutzutage oft. Schauen wir uns also an, wie es darum in Schlegels Leben bestellt war. In zwei verschiedenen Lebensphasen erwog er ernsthaft, nach Amerika auszuwandern.77 Hierbei wird zwar nie näher spezifiziert, ob eine Reise nach Nord- oder Südamerika geplant war, allerdings ist die Ausreise in die inzwischen unabhängigen und größtenteils englischsprachigen Vereinigten Staaten doch am wahrscheinlichsten – auch wenn für ihn dabei natürlich sicher nicht der Spracherwerb im Vordergrund stand. Der erste Plan datiert von 1795, gemeinsam mit Caroline;78 sein Bruder Friedrich ist alarmiert und befürchtet, „daß das Land nicht recht für Dich paßt.“ August Wilhelms Antwort hierauf ist leider nicht erhalten, es scheint aber weiterhin um transatlantische Reisepläne gegangen zu sein, denn einen Monat später schreibt Friedrich: Ueber den Vorschlag nach Amerika kann ich nicht ganz urtheilen, weil Du mir das wie, nach Deiner löblichen Art nicht geschrieben hast, und ich kenne das Land ja nur aus ein paar Reisebeschreibungen. Aber wenn Du Eigenthum erwerben willst, ohne Handels- und oekonomische Kenntniße, so müssen die Aussichten sehr sicher seyn. – Allerdings ist es ein freyes Land, und das ist unschätzbar.79
Die Idee zerschlug sich, die Gründe sind nicht überliefert. 1809/1810 gab es erneut sehr ernsthafte Pläne, mit Germaine de Staël nach Amerika zu emigrieren. Die Planungen waren so weit vorangeschritten, dass sogar die Zeitungen darüber berichteten.80 Clemens Brentano schreibt darüber an Joseph Görres: „A.W. Schlegel wird mit der Stael nach Amerika gehn. Adieu Shakespear und Calderon, bald werden wir amerikanische Sonette lesen und machen müssen.“81 Interessant hierbei ist, nebenbei bemerkt, dass er nicht nur „lesen“, sondern auch „machen“, ja sogar „machen müssen“ schreibt. Das heißt, er sieht Schlegel immer noch als den musterhaften Vorbildgeber, der die Richtung der deutschen Literatur maßgeblich mitbestimmt: Wenn Schlegel „amerikanische Sonette“ macht, müssen alle anderen Dichter mittun, ob sie wollen oder nicht. Auch aus diesen Reiseplänen und damit aus Schlegels amerikanischen Sonetten wurde nichts. Wie sich sein Leben – und sein Verhältnis zur englischen Sprache – dort gewandelt hätten, ist indes ein spannendes Gedankenexperiment. Interessant hierzu sind übrigens Schlegels Äußerungen in seinem bereits erwähnten Essay Sur le système continental, 76
77
78 79 80
81
Johann Georg Zimmermann an William Hutton, 21.5.1790. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4139. Vgl. dazu auch: Harold von Hofe: August Wilhelm Schlegel and the New World. In: The Germanic Review, Bd. 35, 1960, Nr. 4. S. 279–287, hier S. 279. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 69. Brief vom 16.6.1795. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3612. Vgl. z.B. Friederike Helene Unger an August Wilhelm von Schlegel, 2.5.1810. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1684 und: Karl August Moritz Schlegel an August Wilhelm von Schlegel, 14.07.1810. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/348. [Anfang 1810]. In: Frankfurter Brentanoausgabe (FBA). Bd. 32, Briefe IV. Hrsg. von Sabine Oehring. Stuttgart 1996, S. 248.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
85
in dem er voraussagt, dass die nun unabhängigen Vereinigten Staaten dem Alten Europa womöglich bald den Rang ablaufen könnten: N’oublions pas qu’il existe déjà une Europe au delà de l’Océan; nos langues, nos mœurs, nos lumières y ont été transportées; cette Europe américaine n’est qu’ébauchée, parce qu’elle a été négligée ou mal administrée: la partie devenue indépendante s’est développée avec une étonnante rapidité. S’il n’y a pas quelque heureux retour pour nous autres Européens, bientôt la jeunesse vigoureuse de la nouvelle Europe pourra faire honte à la décrépitude de la mèrepatrie.82
6. Schlegels Englandreisen 1814, 1823 und 1832 Im April/Mai 1814 kam es – nach ausgedehnten Reisen mit Germaine de Staël durch ganz Europa (veranlasst durch die Verfolgung de Staëls durch Napoleon) – zu einem ersten Aufenthalt in einem englischsprachigen Land, nämlich in Großbritannien. Es waren nur knapp 14 Tage, gemeinsam mit de Staël, die ihn in der Hautevolee Londons einführte.83 Über diese Zeit wissen wir nicht viel. Schlegel reiste alleine über Calais ein, wahrscheinlich am 30. April,84 und sie verließen London gemeinsam bereits wieder am 8. Mai, um am 12. in Paris anzukommen.85 Roger Paulin hat die wenigen Zeugnisse, die es dazu gibt, zusammengetragen.86 Nur eins davon sei hier genannt: Schlegel erwähnt 1838/39 in seinem Brief an den Verleger Reimer, wie er im April 1814 „mit dem ersten englischen Packetboot in Dover“ landete: Hier war Alles in Bewegung, die Stadt mit Menschen angefüllt: Ludwig der achtzehnte [der in Frankreich nach der Abdankung Napoleons mit der Restauration die Monarchie zurückbrachte, O.V.] ward eben erwartet. Er war überall auf seiner Rückreise vom Volke mit dem grösten Jubel empfangen worden.87
Schlegel erinnert sich daraufhin der ihm passend erscheinenden Verse aus Shakespeares King John: Have I not heard these islanders shout out, Vive le Roi! As I have bank’d their towns?88
82 83 84 85 86 87
88
Schlegel 1813 (Anm. 13), S. 63. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 22. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 376. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 377. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 376f. August Wilhelm Schlegel: Schreiben an Herrn Buchhändler Reimer in Berlin. Bonn, im December und Januar 1838 u. 39. In: Böcking, Bd. 7, S. 281–302, hier S. 295. Vgl. auch: August Wilhelm Schlegel: Berichtigung einiger Mißdeutungen. 1828. In: Böcking, Bd. 8, S. 220–284, hier S. 254–255. Schlegel 1838/39 (Anm. 87), S. 295.
86
Olivia Varwig
Diese trug er in Gesellschaft des Tory-Politikers Lord Harrowby vor. „Jedermann fand die Beziehung frappant, der gelehrte Lord stieß nur an bei dem Worte bank’d, das in der Bedeutung, die es hier hat, ‚längs dem Ufer hinfahren‘, veraltet ist.“ Schlegel konnte also einem ehrwürdigen Lord den Shakespeare erklären, was er noch 14 Jahre später gerne und stolz erzählte. Über seine zweite Englandreise von September bis November 1823 und die dritte von März bis April 1832 wissen wir erheblich mehr. Sie fallen in seine Zeit als Bonner Professor und Sanskritforscher, und diese Forschungsreisen unternahm Schlegel hauptsächlich, um die in London befindliche beträchtliche Zahl von Sanskrit-Manuskripten zu untersuchen.89 Diese Reisen liegen allerdings lange nach den in diesem Band im Mittelpunkt stehenden Shakespeare-Übersetzungen und sind bei Paulin hinreichend beschrieben.90 Viele Zeugnisse und Dokumente dazu, auch seine Reisepässe und Hotelrechnungen, finden sich in seinem Nachlass in der SLUB Dresden.91 Neben den Besuchen in den Bibliotheken nahm er fast täglich am gesellschaftlichen Leben teil. In seinem Nachlass haben sich etliche Dinner-Einladungen der ‚High Society‘ erhalten.92 Diese Zeugnisse widersprechen der These von Schirmer, der schreibt: „es gelang Schlegel nicht, in englische Gesellschaftskreise zu dringen, wie das in Deutschland, in Wien und auch in Paris und Stockholm gelungen war“.93 Aus dieser Zeit sind viele Briefe überliefert. Interessant in Bezug auf seine Eindrücke über die Situation des englischen Bildungssystems ist beispielsweise Schlegels Brief an Johannes Schulze vom Preußischen Ministerium der geistlichen-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten vom Februar 1824.94 Im Jahr 1828 wurde Schlegel eingeladen to visit England at any season of the year most convenient for yourself […] and to deliver a course of lectures, either in French or in English, upon any branch of literature most suited to your own taste, you would not only confer upon our University [University of London, O.V.] an unspeak-able obligation, but render a most valuable service to letters in general.95
89
90 91
92
93 94 95
Oftmals schickte er allerdings auch seinen Schüler Christian Lassen zur Kollationierung der Handschriften nach England, wie aus dem Briefwechsel hervorgeht. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=36_absender.LmAdd.personid17:743+OR+36_adressat. LmAdd.personid17:743. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 497–504, 509–515. Beispielsweise: Mscr.Dresd.e.90,I,2. https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/174153/10, 11, 13 und https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/304487/257, 259, 263. Den britischen Zollbehörden in Dover von 1823 verdanken wir übrigens die einzige erhaltene offizielle Beschreibung von Schlegels äußerer Erscheinung: „5 feet 6 Inches [also 1,67 cm]. Grey Hair / Fresh Complex[io]n. Grey Eyes“. Mscr.Dresd.e.90,I,4. Vgl. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 499. Mscr.Dresd.e.90,VB. https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/174153/88, 114, 140, 152, 168, 170, 172, 182, 184. Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 86. Brief vom 20. bis 29.2.1824. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/678. Henry Brougham Brougham and Vaux an August Wilhelm Schlegel, 12.8.1828. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2412. Vgl. James Mackintosh an AWS, 29.8.1828. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2413.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
87
Von diesem Schreiben hat sich nur eine Abschrift von Schlegels Hand erhalten, die dieser stolz an seinen Bonner Kollegen Philipp Joseph von Rehfues gesandt hatte.96 Er erzählte es offenbar „jedermann“, wie es bei Schirmer heißt.97 Schlegel war geschmeichelt – und wollte freilich am liebsten über indische Literatur, seinem Hauptforschungsgegenstand in jener Zeit, und zwar auf Französisch sprechen, was wohl auf weniger Begeisterung gestoßen wäre. Die Idee zerschlug sich und diese Vorlesungen kamen nicht zustande.98
7. „Zum Sprachenlernen scheine ich recht vom Schicksal bestimmt zu seyn“: ein Fazit Im ganzen kann man Schlegels Kenntnis der englischen Literatur dahin zusammenfassen: wirklich gründlich und einzigartig war seine Kenntnis Shakespeares, groß, wenn auch nicht ohne Lücken die Kenntnis des älteren englischen Dramas, eklektisch die Belesenheit in der übrigen Dichtung und ganz schwach die Kenntnis der Prosa.99
So schreibt Walter F. Schirmer 1939 im Shakespeare Jahrbuch. Er bezeichnet Schlegels Verhältnis zu England als „unglückliche Liebe“, die „nicht die erhoffte Erwiderung fand“.100 Das trifft m.E. jedoch nicht den Kern. Am ehesten könnte man von Hassliebe sprechen. Schlegels Verhältnis zur englischen Sprache blieb zeitlebens in höchstem Maß ambivalent. Werturteile findet man in beide Richtungen: die Rühmungen des „edlen“ Englischen,101 viel häufiger aber die Verunglimpfung desselben. Die teilweise Aversion galt sowohl der englischen Sprache als auch der Mentalität und der zeitgenössischen englischen Kultur. Man kann dennoch davon ausgehen, dass Schlegel hervorragend Englisch ‚konnte‘, womit er sich von seinen zeitgenössischen Landsleuten deutlich abhob. Dass er es rezipierend vollkommen beherrschte und durchdrungen hatte, zeigt sich allein an der Tatsache, dass und vor allem wie virtuos er Shakespeare übersetzte – diese Leistung ist aber sicher zu einem Großteil auch seiner Meisterschaft im Deutschen geschuldet. Dass er in der mündlichen Konversation sehr eloquent und flüssig sprach, – also im ‚real life‘ und nicht nur ‚im stillen Kämmerlein‘ mit der Sprache vertraut war, – davon zeugen viele der zitierten Zeugnisse. Paulin nennt ihn „manifestly fluent and idiomatic in English“.102 Er hatte im zeitgenössischen Vergleich und bedingt durch seine spätere Tätigkeit als Sanskritforscher außergewöhnlich viele Kontakte im englischen Sprach96 97
98 99 100 101
102
Brief vom 11.9.1828. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3126. Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 86. Vgl. z.B. auch August Wilhelm Schlegel an Friedrich Schlegel, 19.9.1828. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/letters/view/2411. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 514. Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 83. Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 77. Vgl. August Wilhelm Schlegel an Christian Gottlob Heyne, 2.7.1791. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/400. Paulin 2016 (Anm. 9), S. 514.
88
Olivia Varwig
und Kulturraum. Allein schreiben mochte er in dieser Sprache nicht – sei es aufgrund von Hemmungen oder tatsächlicher Angst vor Fehlern, schließlich hatte er einen ausgesprochen hohen Anspruch an sprachliche Präzision, oder sei es aus mangelnder Sympathie für die Sprache und Bevorzugung des Französischen als Konversationssprache. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem mit dem Schwerpunkt auf letzterem.103 Erstaunlich hierbei ist, dass er, wie gezeigt wurde, 1833 fast dieselbe Formulierung wählt wie 1791, um eine Publikation auf Englisch abzulehnen. Sein Verhältnis zur englischen Sprache hat sich offenbar in über 40 Jahren kaum geändert. August Wilhelm Schlegel ist freilich nicht nur Shakespeare-Übersetzer, sondern ein universeller Literatur- und Sprachgelehrter. „Zum Sprachenlernen scheine ich recht vom Schicksal bestimmt zu seyn“, schreibt er bereits 1791 an Heyne.104 Seine intensive Beschäftigung mit der englischen Sprache in den 1780er und 90er Jahren und die daraus resultierenden frühen Shakespeare-Übersetzungen sind einer der Grundsteine für seinen weiteren Weg und die literarischen und sprachwissenschaftlichen Studien, denen er sich widmet, aber sie sind späterhin nicht mehr sein Hauptinteressengebiet. Die Shakespeare-Übersetzungen entstanden aus einer anfänglich allgemeinen, nicht nur auf das Englische begrenzten Übersetzungswut zu Beginn seiner Karriere, kamen ab 1801 durch die Reisen mit Germaine de Staël und andere Projekte ins Stocken und rückten zugunsten anderer Interessen immer mehr in den Hintergrund – auch wenn ihre Unvollständigkeit und Unvollkommenheit ihn Zeit seines Lebens belasteten und ihm „auf dem Herzen“ drückten „wie Marmelsteine“, wie er bereits 1806 an Friedrich de la MotteFouqué schreibt.105 Dass dies Zeit seines Lebens so blieb, geht aus seiner Korrespondenz, insbesondere mit seinen Verlegern, hervor, in denen die Shakespeare-Übersetzungen bis in die 1840er Jahre Thema bleiben.106 Noch 1841 schreibt er an Georg Andreas Reimer: Wenn mir Gott Leben u[nd] Gesundheit verleihet, so wünschte ich wohl, die sämtlichen von mir übersetzten Stücke Sh[akespeares] durchzucorrigiren. Es ist eine Arbeit die sich recht gut zu schlaflosen Nachtstunden schickt.107
103
104 105 106
107
Schirmers These, dass „nur hohe Selbstanforderung und die eitle Furcht, sich etwas zu vergeben“, Schlegel dazu bewogen habe, seine Korrespondenzen auf Französisch zu halten, halte ich für zu kurz gegriffen. Vgl. Schirmer 1939 (Anm. 14), S. 79. Brief vom 21.5.1791. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/399. Brief vom 12.03.1806. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3269. Nachzulesen ist diese Entwicklung in der KAWS sowie ausführlich bei Stefan Knödler: „Am Shakespeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48. Brief vom 29.11.1841 (Datum erschlossen). In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-0122/letters/view/2535.
A. W. Schlegels Berührungen mit der englischen Sprache und Kultur
89
Aufschlussreich wäre hier sicher eine detaillierte Untersuchung, die systematisch alle von Schlegel in Shakespeares Werken ungenau übersetzten Stellen überprüft, um herauszufinden, ob es sich hierbei um Fehlerhaftigkeit oder absichtliche, poetisch gewollte Veränderungen handelt. Dazu bieten sich Ludwig Tiecks Texteingriffe und Schlegels Rücknahmen derselben an.
Claudine Moulin
Fragwürdige Gestalten und Haarbuschige Gesellen Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in August Wilhelm Schlegels Hamlet-Übertragung Das Werkzeug der Poesie ist Sprache.1
1. Poetisches Übersetzen und linguistische Erschließung Der folgende Beitrag nähert sich Schlegels Konzept des poetischen Übersetzens aus linguistischer Sicht und lotet Verfahren der lexikalischen Kreativität anhand der Hamlet-Übersetzung als exemplarischer Textgrundlage aus. Die Motivation, Schlegels Shakespeare-Übersetzungen auch gezielt linguistisch in den Blick zu nehmen, lässt sich in einer Forschungspraxis verankern, die insbesondere für die Frühe Neuzeit zunehmend auch Praktiken der lehnwörtlichen Kreativität im Rahmen von literarischen und fachsprachlichen Übersetzungspraktiken in den Fokus nimmt.2 Die hierbei entwickelten Methoden sollen vor dem Hintergrund des von August Wilhelm Schlegel geschaffenen Konzepts des ‚poetischen Übersetzens‘3 erkundet bzw. entsprechend angepasst
________________________ 1
2
3
August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über philosophische Kunstlehre [Jena 1798–1799]. In: KAV, Bd. I: Vorlesungen über Ästhetik I [1798–1803]. Mit Kommentar und Nachwort hrsg. von Ernst Behler. Paderborn u.a. 1989, S. 1–177, hier S. 5. Für Anregungen und Hinweise möchte ich Claudia Bamberg, Matthias Rein, Nikolaus Ruge sowie Georg Schelbert danken. Vgl. etwa Sabine Arndt-Lappe, Angelika Braun, Claudine Moulin, Esme Winter-Froemel: Expanding the Lexicon: At the Crossroads of Innovation, Productivity, and Ludicity. In: Expanding the Lexicon. Linguistic Innovation, Morphological Productivity, and the Role of Discourse-Related Factors. Hrsg. von Sabine Arndt-Lappe, Angelika Braun, Claudine Moulin und Esme Winter-Froemel. Berlin, Boston 2018, S. 1–12; Claudine Moulin: Ludicity in Lexical Innovation (II) – German. In: Ebd., S. 261–285; Claudine Moulin: lebendig mit farben mahlen: Verfahren der lexikalischen Innovation in Philipp von Zesens Übersetzung von Willem Goeree, Anweisung zur allgemeinen Reis- und Zeichenkunst (1669). In: athe in palice, athe in anderu sumeuuelicheru stedi. Raum und Sprache. Hrsg. von Andreas Nievergelt und Ludwig Rübekeil. Heidelberg 2019, S. 261–278. Zum Konzept der Poetisierung und des poetischen Übersetzens bei August Wilhelm Schlegel vgl. Héctor Canal: Romantische Universalphilologie. Studien zu August Wilhelm Schlegel. Heidelberg 2017, S. 199–219; Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40. Zur frühromantischen Übersetzungskonzeption siehe Annette Kopetzki: Beim Wort nehmen. Sprachtheoretische und ästhetische Probleme der literarischen Übersetzung. Stuttgart 1996, S. 68–78, 301–303; Jochen Bär: Sprachreflexion der deutschen Frühromantik. Konzepte zwischen Universalpoesie
https://doi.org/10.1515/9783111017419-008
92
Claudine Moulin
werden. Insbesondere die Vielfältigkeit der Übertragungsprozesse und das Spannungsfeld zwischen Ausgangs- und Zielsprache stellen vor dem Hintergrund komplexer Überlieferungslagen und anspruchsvoller ausgangssprachlicher Vorlagen mitsamt ihren verschiedenen Interpretationsebenen eine Herausforderung dar, die eigene Formen der Auswertung erfordern, etwa das ständige Mitdenken der metrischen Verhältnisse. Tiefergehende und detaillierte Erkenntnisse zum Gesamtkomplex der Schlegel-Tieckʼschen-Shakespeare-Übersetzungen, sowohl aus literatur- als auch sprachwissenschaftlicher Sicht, werden sicherlich erst durch entsprechend dynamisch aufgebaute digitale Editionsvorhaben erreicht werden können.4 Meine Ausführungen sind wie folgt gegliedert: Zunächst wird das Konzept des poetischen Übersetzens bei Schlegel mit linguistischen Gesichtspunkten und insbesondere mit dem Phänomen der lexikalischen Kreativität in Verbindung gebracht. In einem weiteren Schritt sollen die Hauptbereiche des Einsatzes von auffälligen Wortbildungsprodukten in der poetisierenden Übersetzungspraxis Schlegels dargelegt werden, bevor anhand eines ausgewählten Fallbeispiels – der adjektivischen Komposition im Hamlet – eine eingehende linguistische Untersuchung des Sprachmaterials im Hinblick auf sprachkontaktinduzierte Innovationen und Phänomene der lexikalischen Kreativität vor dem Hintergrund des poetisierenden Übersetzens vorgenommen wird. Dabei werden sowohl der Erstdruck von 1798, die Dresdener HamletHandschrift als auch die Vorgängerübersetzungen durch Wieland und Eschenburg herangezogen. Als Ausgangspunkt der Überlegungen stütze ich mich bewusst auf literaturwissenschaftliche Zugriffe, um bei der linguistischen Analyse eine Brücke zu interdisziplinären Fragestellungen schlagen zu können. Eine rein linguistische Herangehensweise an das Textmaterial – ohne Rückbindung an den literaturwissenschaftlichen Diskurs – wäre zwar ebenfalls denkbar, aber letztendlich nicht ohne Weiteres für eine Anwendung im vorliegenden Rahmen geeignet.
2. Poetisches Übersetzen und lexikalische Kreativität Peter Gebhardt5 hat in seiner Untersuchung die einzelnen Etappen eines poetisierenden Übersetzens am Beispiel des Hamlet aus literaturwissenschaftlicher Sicht herausgearbeitet. Dabei wird besonders der iterative Charakter des Übersetzungsprozesses in den Fokus genommen, der ein zweifacher sei, nämlich ein Übersetzen ersten Grades (eine Art vorlagengerechte Vorstufe, die das Prinzip der Treue gewährleistet) und ein Über-
________________________ 4
5
und Grammatischem Kosmopolitismus. Mit lexikographischem Anhang. Berlin, New York 1999, S. 257–275, 310–315. Zu Zielen und Aufgaben einer solchen Edition siehe insbesondere die Beiträge von Claudia Bamberg und Thomas Burch, Katrin Henzel und Rüdiger Nutt-Kofoth im vorliegenden Band. Peter Gebhardt: A. W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257).
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
93
setzen zweiten Grades, das die Transformation des Stoffes in eine poetische Form vollzieht. Diese Binarität kann zwar durch neuere Zugänge zur literarischen Übersetzung relativiert bzw. kontextualisiert werden,6 sie bietet jedoch einen interessanten Einstieg in das Verstehen und die linguistische Analyse der Schlegelʼschen Übersetzungspraxis: Da die poetische Übersetzung ein Kunstgebilde sein will, das mit dem Nachbilden des Originals (Treueprinzip, interlineares Verfahren) zugleich sich selber bildet (Poetisierung, nachdichtendes Verfahren), ist ihr auch nur eine Betrachtungsweise angemessen, welche zwischen beiden Standpunkten vermittelt.7
Dieser oszillierende Blick zwischen beiden Ebenen des Übersetzens ist als Verschränkung der verschiedenen Übersetzungsebenen zu verstehen, die eher komplementär als antithetisch zu denken sind, nämlich in dem Sinn, dass sie keine unabhängig voneinander sich konstituierenden Größen bilden.8 Beide Ebenen des Übersetzens sind zudem für die linguistische Analyse von Bedeutung: Die Ebene der formalen Nachbildung betrifft nicht nur Versform und Metrik, sondern alle sprachlichen Ebenen, von der Phonologie, Morphologie, Syntax bis hin zur Lexik. Für die zweite Ebene arbeitet Gebhardt – basierend auf Schlegels eigenen theoretischen Schriften – folgende zentrale Poetisierungsmittel heraus, die z.T. im Spannungsverhältnis zur Sinntreue operieren: die getreue metrische Nachbildung sowie die Veredelung der Diktion mitsamt Nivellierung des Anstößigen und der niederen Sprachstile sowie den Gebrauch von ungewöhnlichen Wörtern, etwa Neologismen oder Archaismen zwecks lebendiger „Restauration“ des älteren, fremdsprachlichen Ausgangstextes. Hinzu kommen eine gesteigerte Dynamisierung durch sprachliche Mittel sowie das Ideal der Leichtigkeit im Sinne von Mäßigkeit, Geschmeidigkeit und poetischer Abstraktion. Gebhardt systematisiert die von ihm beschriebenen sprachlichen Phänomene nur punktuell unter linguistischen Gesichtspunkten; seine Beobachtungen und die illustrierenden Beispiele liefern aber vielfältige Anknüpfungspunkte, um auch den Blick eines empirisch-linguistischen Zugangs zum poetischen Übersetzen auf allen sprachlichen Ebenen schärfen zu helfen. Auffallend ist die wiederkehrende Rolle der lexikalischen Ebene, sprich die Wahl der passenden Wortform bzw. – wie ich es nennen möchte – der kreativen Wortformung in der Zielsprache. Dies mag zwar in einer Übersetzungssituation nicht überraschend sein, es ist aber umso mehr eine Herausforderung, als Schlegels Übersetzungsergebnis eben kein wörtliches ist, sondern ein die materielle Ausdrucksseite der Ausgangssprache transzendierendes, ergo ein poetisches. Besonders von Interesse sind Verfahren der lexikalischen Kreativität, die auf eine multidirektionale „Spracharbeit“ im Hinblick auf die englische Vorlage einerseits und auf das Ziel einer poetischen Übersetzung andererseits hinführen. Die in einem solchen
________________________ 6
7 8
Vgl. Norbert Greiner, Felix C. H. Sprang: Europäische Shakespeare-Übersetzungen im 18. Jahrhundert: Von der Apologie zum ästhetischen Programm. In: Übersetzung. Translation. Traduction. Bd 3. Hrsg. von Harald Kittel u.a. Berlin, Boston 2011, S. 2453–2468. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 236. Vgl. hierzu Bär 1999 (Anm. 3), S. 310–318.
94
Claudine Moulin
Kontext greifbaren lexikalischen Phänomene betreffen verschiedene Ebenen, wie etwa die Wiedergabe einer analytischen Nominalgruppe im Englischen durch ein synthetisch gebildetes Kompositum im Deutschen oder die Entscheidung für Lehnübertragung anstatt einer Lehnübersetzung. Auffällig ist, dass es sich bei all diesen Verfahren, denen Gebhardt (wenn auch unsystematisch) entsprechende formale oder poetische Funktionen zuweisen konnte, im Hinblick auf die ausdrucksseitige Realisierung im Deutschen vielfach um Wortbildungsprodukte handelt, so dass die These formuliert werden darf, dass Schlegel dieses Mittel bei der Übertragung der englischen Vorlage durchaus bewusst einsetzt. Schlegel reflektiert mehrfach in seinen theoretischen Schriften über die Wortbildung und betont dabei das besondere Potential der deutschen Sprache: Dieß führt mich auf einen Hauptvorzug unsrer Sprache, der freylich gar sehr mit ihrer Ursprünglichkeit zusammenhängt. Dieß ist nämlich die Fähigkeit, durch Ableitung und Zusammensetzung immerfort neue Wörter zu bilden. Das erste geschieht durch Sylben, welche nicht aufgehört haben allgemein verständlich zu seyn, vermittelst deren hauptsächlich Adjective und Substantive zu Stande kommen. Ferner werden Zeitwörter zusammengesetzt mit Präpositionen, und durch eine Art Vorsetzungssylben, welche aus Präpositionen abgekürzt scheinen, nun aber untrennbar sind, und unendlich prägnante Bestimmungen enthalten, als: be, ge, er, ver, ent, u.s.w. Mit Recht bemerkt Klopstock, dieß sey ein ganz eingenthümlicher Vorzug, und es finde sich in keiner andern Sprache etwas ähnliches. Endlich werden selbstständige Hauptbegriffe, und nicht bloß zwey sondern auch drey bis vier zu einem einzigen Wort verknüpft. Dieß gewährt nicht bloß den Vortheil einer bedeutenden Kürze, sondern die Einheit des Verknüpften wird auch für die Fantasie besser dargestellt, und der Nachdruck des Begriffs oder Bildes nimmt nach dem Verhältnisse der Multiplication der einzelnen Bestandteile zu.9
Die Stelle ist zentral für das Verständnis des Konzepts des poetischen Übersetzens aus linguistischer Sicht, denn sie hebt neben dem grundlegenden Aspekt der Univerbierung (vgl. „bedeutende Kürze“) und der bildlich-inhaltlichen Komprimiertheit („Nachdruck des Begriffs oder Bildes“) eine ganz besondere Dimension von Wortbildungsprozessen hervor, nämlich die Rolle der Phantasie. Phantasie betrifft nicht nur die Ebene der Wortbildungserzeugung durch die Anwendung produktiver Wortbildungsregeln (bzw. deren Verletzung oder Abänderung), sondern auch die Wortbildungsdekodierung – also das ausdrucks- und inhaltsseitige ‚Entziffern‘ der komplexen Bildungen auf der Rezipierendenseite. Dieser Schritt ist integraler Bestandteil der Kreativität sprachlicher Tätigkeit, deren allgemeine Wesensbestimmung auch Thema des sprachtheoretischen und -philosophischen Diskurses des 17. und 18. Jahrhunderts war.10 Während die prinzipielle Veranlagung zu sprachlicher Kreativität als menschliche Universalie betrachtet
________________________ 9
10
August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über Encyklopädie [1803]. In: KAV, Bd. III. Kommentiert und hrsg. von Frank Jolles und Edith Höltenschmidt. Paderborn u.a. 2006, S. 334; vgl. ähnlich auch KAV, Bd. I (Anm. 1), S. 28. Vgl. insbesondere die seit Descartes bis hin zu Noam Chomsky geführten Diskussionen: Georg Bossong: Über die zweifache Unendlichkeit der Sprache. Descartes, Humboldt, Chomsky und das Problem der
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
95
werden kann,11 ist der bewusste Einsatz dieser „sprachschöpferischen Fähigkeit“12 zum Zweck der Erzeugung bestimmter Effekte im Sinne einer individuell verankerten Kreativität besonders im Bereich der belles lettres und des Wortspiels zu verzeichnen. Hier kommen dann auch Verfahren der lexikalischen Kreativität in Form von sprachlichen Neuschöpfungen zum Tragen, denn auch sie greifen in der Regel auf bewusste Wortformungsprozesse zurück.13 Der französische Linguist Louis Guilbert hebt das Poetische an sich in der Betrachtung der stilistisch bedingten lexikalischen Kreativität hervor: Il existe une autre forme de création lexicale fondée sur la recherche de l’expressivité du mot en lui-même ou de la phrase par le mot pour traduire des idées non originales d’une manière nouvelle, pour exprimer d’une façon inédite une certaine vision personnelle du monde. Cette forme de création, à proprement parler poétique, par laquelle on fabrique une matière linguistique nouvelle et une signification différente du sens le plus répandu, est liée à l’originalité profonde de l’individu parlant, à sa faculté de création verbale, à sa liberté d’expression, en dehors des modèles reçus ou contre les modèles reçus. Elle est le propre de tous ceux qui ont quelque chose à dire, qu’ils sentent bien à eux, et qu’ils veulent dire avec leurs mots, leurs agencements de mots, elle est le propre des écrivains.14
Im Rahmen eines sprachhistorischen Zugangs, der auch dynamische und pragmatische Gesichtspunkte miteinbezieht, erscheint eine Definition von lexikalischer Kreativität angebracht, die eine möglichst umfassende Behandlung des Phänomens erlaubt – wie sie etwa von Körtvélyessy, Štekauer und Kačmár in Abwägung zu anderen existierenden Ansätzen formuliert wurde:
________________________
11
12
13
14
sprachlichen Kreativität. In: Zeitschrift für romanische Philologie 95, 1979, S. 1–20; Gerda Haßler, Cordula Neis: Lexikon sprachtheoretischer Grundbegriffe des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin, New York 2009, S. 140–147, 185–198, 315–335, 771–779, 1063. Vgl. Elke Ronneberger-Sibold: Volksetymologie und Paronomasie als lautnachahmende Wortschöpfung. In: Historische Wortbildung des Deutschen. Hrsg. von Mechthild Habermann, Peter O. Müller und Horst Haider Munske. Tübingen 2002, S. 105–127, hier S. 115: „Die grundlegende kreative Fähigkeit selbst ist Teil der vollständigen Sprachkompetenz eines jeden ‚native speaker‘“. Ronneberger-Sibold 2002 (Anm. 11), S. 115. Vgl. bereits Gilles Ménage: Observations sur la langue françoise. 2ème éd. Paris 1675, S. 454: „Et moi je dis, qu’il est permis à tout le monde, mais qu’il n’est pas donné à tout le monde, de faire des mots nouveaux“. August Wilhelm Schlegel selbst betont die Bedeutung der Wortbildungskraft für die poetische und philosophische Sprache und setzt sie der präskriptiven Grammatik seiner Zeit entgegen: „Es ist daher ganz verkehrt, wenn einige Grammatiker dieß einschränken wollen; wie z.B. Adelung die Compositionen verwirft, bey welchen, wie er meynt, eine Präposition ausgelassen ist, da sie doch ganz nach der Analogie andrer von alten Zeiten her in der Sprache vorhandener gebildet sind. Klopstock hat hingegen diese Seite der Sprachbildung vortrefflich verstanden und verdienstlich gefördert, und der beste Beweis gegen die bornirte Lehre der Grammatiker ist das allgemeine Wohlgefallen, womit diese so kräftig mahlenden Beywörter in der Poesie aufgenommen worden sind. Aber nicht bloß für den poetischen, auch für den philosophischen Gebrauch ist diese Synthesis selbstständiger Begriffe von großem Werthe, und zum Theil auch mit deswegen können wir behaupten, daß unsre Sprache ausgezeichnete philosophische Anlage hat.“ (Schlegel [1803] [Anm. 9], S. 334f.). Zur Debatte um den Stellenwert von lexikalischen Neuschöpfungen im 17. und 18. Jahrhundert vgl. auch Haßler/Neis 2009 (Anm. 10), S. 1462–1470. Louis Guilbert: La créativité lexicale. Paris 1975, S. 41.
96
Claudine Moulin
[…] we understand word-formation creativity as one of many areas of creative performance, as a manifestation of this creative potential in coining new complex words. We understand it as the ability of any and all language speakers to form a new complex word in response to the specific need of a speech community to give a name to a new object of extralinguistic reality or a new name to an already named object. It is assumed that every act of naming is a creative act that employs a language speaker’s cognitive abilities in order to select and employ one of a number of possible naming strategies. The creativity of word formation in this sense is manifested at each level of the naming process, i.e., at the conceptual level, the onomasiological level and the onomatological level.15
Ein solcher Zugang ist insbesondere für die Untersuchung im Rahmen von Übersetzungspraktiken im sprachhistorischen Kontext geeignet, da diese einen onomasiologischen Zugang par excellence darstellen.16 Im Rahmen der Erforschung von Sprachkontakterscheinungen sind zudem unterschiedliche Strategien im Hinblick auf sprachliche Innovation mit Bezug auf die Ausgangssprache möglich, die auch für Übersetzungsphänomene anwendbar sind. Die in einem solchen Kontext greifbaren lexikalischen Innovationen können als „sprachkontaktinduzierte Innovationen“17 aufgefasst werden, wobei die in der Zielsprache geschaffenen neuen Bezeichnungen entweder durch Übernahme des ausgangssprachlichen Lexems (Fremd- oder Lehnwort), als formal analoge Bildung (Lehnprägung) oder als eigene lexikalische Innovation (formal unabhängige Eigenschöpfung) realisiert werden können.18 Im Rahmen literarischer Übersetzungen kommen direkte Entlehnungen (als Fremd- oder Lehnwörter in der Zielsprache) eher selten vor und müssen im jeweiligen Kontext eigens gedeutet werden. Auch für die Schlegelʼschen Shakespeare-Übersetzungen bilden die beiden anderen Haupttypen der sprachkontaktinduzierten lexikalischen Innovation die relevanteren Kategorien, die von der hohen Varianz und Produktivität der Wortbildungsmöglichkeiten im Deutschen
________________________ 15
16
17
18
Lívia Körtvélyessy, Pavol Štekauer, Pavol Kačmár: On the role of creativity in the formation of new complex words. In: Linguistics 59, 2021, S. 1017–1055, hier S. 1021, https://doi.org/10.1515/ling-20200003 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 21.02.2023 gesehen). Man vgl. die Überlegungen zur lexikalischen Kreativität im Spannungsfeld der Dichotomie von „rule-governed behavior“ bzw. „rule-changing behavior“ (insbesondere im Rahmen der Generativen Grammatik) bei Wolfram Wilss: Zur Produktion und Rezeption von Wortbildungserscheinungen. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 13, 1985, S. 278–294, hier S. 285f.; sowie die dort besprochene Unterscheidung von Eugenio Coseriu „zwischen nichtkreativen Handlungen, die eine schon gegebene Dynamik bloß anwenden, und der schöpferischen Tätigkeit, die der Dynamik vorausgeht“ (Eugenio Coseriu: Semantik, innere Sprachform und Tiefenstruktur. In: Folia linguistica 14, 1970, S. 53–63, hier S. 55). Vgl. zum Spannungsfeld Semasiologie/Onomasiologie für frühneuzeitliche Übersetzungskulturen und der Analyse von Wortbildungsprodukten Moulin 2019 (Anm. 2), S. 273–275. Esme Winter: Zum Verhältnis sprachkontaktinduzierter Innovationen, lexikalischer Entlehnungen und fremder Wörter – zugleich ein Beitrag zu ‚Lehnschöpfung‘ und ‚Scheinentlehnung‘. In: Romanistisches Jahrbuch 56, 2005, S. 31–62, hier S. 45–48; vgl. auch Esme Winter-Froemel: Entlehnung in der Kommunikation und im Sprachwandel. Theorie und Analysen zum Französischen. Berlin, Boston 2011, S. 53–58. Winter-Froemel 2011 (Anm. 17), S. XVI, 303; vgl. ferner Alexander Onysko: Anglicisms in German. Borrowing, Lexical Productivity, and Written Codeswitching. Berlin, New York 2007, S. 31–34; Moulin 2019 (Anm. 2).
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
97
besonders profitieren können. Schlegel selbst hat diese inhärent-kreative Veranlagung der deutschen Sprache betont, die eine Sprache sei, die „die reichsten Quellen der Wortbildung, ja auch der immer neuen Gestaltung in sich selbst“19 habe.
3. Wortbildung und Poetisierung in Schlegels Hamlet-Übersetzung Bevor Verfahren der sprachkontaktinduzierten lexikalischen Innovation anhand einer Fallstudie näher beleuchtet werden, sollen die beiden von Gebhardt unterschiedenen Ebenen der formalen Nachbildung sowie der poetisierenden Übersetzung mit einigen Beispielen aus dem Bereich der Wortbildung illustriert werden, um deren zentrale Rolle in der Übersetzungspraxis und der sprachkontaktinduzierten lexikalischen Innovation in der Hamlet-Übersetzung zu exemplifizieren. Die hier aufgeführte Tabelle fasst die wichtigsten linguistischen Verfahren im Bereich der Wortbildung für beide Ebenen zusammen.20 Beide Ebenen weisen, wie die Beispiele zeigen, sowohl Überlappungen innerhalb der einzelnen Spalte als auch Überschneidungen untereinander auf. So wird etwa das substantivische Determinativkompositum Denkkraft sowohl der Ebene der formalen Nachbildung im Sinne der abstrahierenden Verdichtung zugeordnet, bei der aus einer analytischen Nominalgruppe in der Ausgangssprache (engl. large discourse) ein synthetisches Wortbildungsprodukt in der Zielsprache entsteht, als auch der Ebene der poetisierenden Übersetzung, bei der das Übersetzungsergebnis gleichsam eine „poetisierende“ Abstraktbildung gegenüber der Ausgangssprache hervorbringt. Das deutsche Lexem stellt eine Neubildung des 18. Jahrhunderts dar und gilt als inhaltlich-pointierendes „Schlüsselwort des Schlegelschen Hamlet“,21 das mit konstantem Zweitelement ein antithetisches Spannungsfeld zu Tatkraft eröffnet.22 Interessant ist in diesem Zusammenhang die (eventuell metrisch bedingte) Wahl der Variante Denkkraft anstatt der zeitgenössischen synonymen Bildung Denkungskraft;23 Friedrich Schlegel thematisiert
________________________ 19
20
21
22
23
August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über die romantische Literatur [1803–1804]. In: KAV, Bd. II/1: Vorlesungen über Ästhetik [1803–1827]. Textzusammenstellung von Ernst Behler. Mit einer Nachbemerkung von Georg Braungart. Paderborn u.a. 2007, S. 1–194, hier S. 22. Die deutschen Belege werden nach der Typisierung bei Gebhardt 1970 (Anm. 5) und nach der ersten Druckfassung der Hamlet-Übersetzung angegeben; vgl. August Wilhelm Schlegel: Shakspeare’s dramatische Werke. Dritter Theil. Berlin 1798, S. 135–364; die englischen Belege aus der Ausgabe von Edmond Malone, vgl. The plays and poems of William Shakspeare. Volume the Ninth. Containing Romeo and Juliet. Hamlet. Othello. [Hrsg. von Edmond Malone.] London 1790. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 72; vgl. www.woerterbuchnetz.de/DWB/denkkraft (DWB1), www.woerterbuchnetz.de/GWB/Denkkraft (Goethe-Wörterbuch). Vgl. hierzu Michael Gamper: „daß Ich meinen Zweck fast ganz und gar vergesse“ – Unentschlossenheit und Laune als ethische und ästhetische Konzepte der Frühromantik. In: Athenäum 9, 1999, S. 9–38, hier S. 11f. Vgl. www.woerterbuchnetz.de/DWB/denkungskraft (DWB1), www.woerterbuchnetz.de/DWB2/denkungskraft (DWB2).
98
Claudine Moulin
seinerseits in einem Brief vom 11. November 1791 an seinen Bruder die Denkungsart des Hamlet.24 Ebene der formalen Nachbildung
Ebene der poetisierenden Übersetzung
Lautliche Nachbildung:
Veredlung der Diktion
engl. -ly > dt. -lich
cabin (V,2) / Schlafgemach
(Abstrahierendes) verdichtendes Übersetzen: (engl. Nominalgruppe > dt. Kompositum /Ableitung)
Gesteigerte Bewegung (Präfixverben, substantivierte Infinitive)
leave and favour (I,2) / Vergünstigung pickers and stealers (III,2) / Diebeszangen mirth in funeral (I,2) / Leichenjubel large discourse (IV,4) / Denkkraft your desire to know (I,5) / Die Neugier Expansion: engl. Simplex > dt. komplexe Zusammensetzung/Ableitung
grow (I,2) / aufschießen; cuff (II,2) / herumzausen; rouse (I,2) / anklingen thoughts, and whispers (IV,5) / Wähnen und Vermuten Ideal der Leichtigkeit, poetisierende Abstraktion large discourse (IV,4) / Denkkraft
writer (II,2) / Komödienschreiber u.a.
u.a.
„Wörtliches Übersetzen“ (Lehnwort, Lehnübersetzung, Lehnübertragung, u.a.):
Ungewöhnlicher Wortgebrauch (Archaismen, Idiotismen, Neologismen)
questionable (I,4) / fragwürdig (Lehnübertr., Neologismus) this effect, defective (II,2) / dieser Defektiv-Effekt (Lehnwort, Okkasionalismus)
heavy-headed (I,4) / schwindelköpfig; muddy-mettled (II,2) / schwachgemuter; whoreson mad fellow (V,1) / Blitzkerl; whorson dead body (V,1) / Blitzleiche
u.a.
u.a.
Tabelle: Übersetzungsverfahren nach Gebhardt (1970) und Wortbildung in August Wilhelm Schlegels Hamlet-Übersetzung (1798)
________________________ 24
„Hamlets Art über die Dinge zu denken scheint mir das Hauptziel des ganzen zu seyn; diese wird immer mehr entwikkelt durch mancherley Begebenheiten und hebende Contraste hindurch, bis die Wirkung, die diese Denkungsart, je deutlicher sie sich entfaltet, in dem Hörer hervorbringt, in der Scene wo die verwirrte Ophelia singt, in Verzweiflung des Gefühls und endlich in der Todtengräber-Scene in die höchste Verzweiflung des Verstandes übergeht, und nun ihren Gipfel erreicht hat. Werden Sie mich der Spitzfindigkeit beschuldigen, wenn ich auch die Albernheiten des Polonius bedeutend finde?‘ etc. – Freilich ist dieß nur zu sehr Skizze; ich habe nur angedeutet daß ich die Denkungsart des Hamlet für den eigentlichen Mittelpunkt halte; sie zu entwickeln und dem Gange des ganzen Stückes zu folgen würde mich zu einer Abhandlung führen.“ KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-0122/briefid/3457; mit der Abhandlung ist der im Jahr 1795 fertiggestellte Aufsatz Über das Studium der griechischen Poesie gemeint.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
99
Insbesondere die unter der Kategorie „wörtliches Übersetzen“ mitgefassten Phänomene der sprachkontaktinduzierten Lehnwortbildung (Tabelle, linke Spalte) sind stets mit dem „ungewöhnlichen Wortgebrauch“ (Tabelle, rechte Spalte) zusammenzudenken, dessen auswahlartige Belegsammlung bei Gebhardt fast ausschließlich aus Wortbildungsprodukten in der Zielsprache besteht. Die Häufung dieser „ungewöhnlichen Wörter“ sind Friedrich Schlegel bei der Durchsicht von Entwürfen bzw. Buchstücken der Hamlet-Übersetzung seines Bruders im Jahr 1793 aufgefallen und in einem Brief an ihn vom Juni desselben Jahres thematisiert worden: Deine Uebersetzung aus dem Hamlet finde ich sehr gut, bis auf einige Kleinigkeiten, als ‚gnädge Frauʻ. Doch weiß ich kein schicklicheres Wort. Und dann eine allgemeine Critik – vorausgesetzt, daß Du den Hamlet ganz so übersetzen wolltest, und für unsre Nation bestimmtest. Es sind fast in jeder Zeile ungewöhnliche Worte. Du hast Dich beym Dante daran etwas gewöhnt, wo es am rechten Orte war. Du könntest in Gefahr kommen, nur für Gelehrte zu dichten!25
Gebhardt26 weist darauf hin, dass Schlegels Hamlet in dieser Hinsicht wohl noch unter dem Einfluss seines Lehrers Gottfried August Bürger steht und als eine seiner frühen Shakespeare-Übersetzungen reicher an solchen Sprachformen als die späteren Übersetzungen sei. Diese Einschätzung wäre im Gesamtkontext der Schlegel-Tieck’schen Übersetzung zu prüfen, ein Vorhaben, das am besten mit Methoden der digitalen Geisteswissenschaften in Angriff genommen werden kann.
4. Fallstudie: Komplexe Adjektive und lexikalische Kreativität Bereits bei einer ersten Auswertung des Textmaterials – systematisch durchforstet habe ich den Erstdruck des Schlegel’schen Hamlet aus dem Jahr 1798 sowie die Dresdener Handschrift – ist eine Vielzahl an sprachlich interessanten Auffälligkeiten zu verzeichnen, die gezielt Einblicke in die Textkonstitution und den Übersetzungsvorgang an sich erlauben. Für den Bereich der lehnwörtlichen Kreativität fällt die große Anzahl an komplex gebildeten Adjektiven ins Auge; sie soll im Folgenden ausführlicher dargelegt werden. Das Vorkommen solcher Adjektive ist aus dem alphabetischen Verzeichnis im Anhang ersichtlich. Verzeichnet werden die einschlägigen Lexeme27 mit Szenenangabe und Seitenzahl im Druck von 1798 unter Angabe der englischen Stelle aus der Ausgabe
________________________ 25
26 27
Vgl. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3451; vgl. auch KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3636: „Deine Fragmente aus Hamlet und Romeo zeigte ich C.[aroline] in den ersten Tagen unsrer Bekantschaft. Sie gefielen ihr, doch fand sie auch, was ich Dir sagte, Du hättest Dich beym Dante an veraltete Worte und Stellungen zu sehr gewöhnt“ (9. Oktober 1793). Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 228. Nicht erfasst wurden ältere, bereits lexikalisierte Bildungen wie etwa heimlich, jungfräulich, wandelbar, ehrwürdig usw.; mitaufgenommen wurden Adjektivkomposita in adverbieller bzw. prädikativer Verwendung.
100
Claudine Moulin
von Edmond Malone (1790),28 die Schlegel neben anderen Ausgaben zur Verfügung hatte. Alle Belege wurden zudem mit den jeweiligen Stellen in den früheren Übersetzungen von Wieland (1766 = W)29 und Eschenburg (1777 = E)30 verglichen. Die Befundauswertung zeigt, dass nur einige Bildungen bereits bei den Vorgängerübersetzungen vorhanden waren. Dies betrifft die gängige Wiedergabe von engl. incestuous durch blutschänderisch, bettläg(e)rig für engl. bed-rid sowie milchweiss für engl. milky (sowohl bei Wieland als auch Eschenburg); spitzfindig für engl. picked findet sich bereits bei Wieland.31 Eschenburg übersetzt ebenfalls engl. incorporal mit körperlos, penetrable mit durchdringlich, odd mit überzählig sowie ominous (horse) mit unglückschwanger. Beide Vorgänger zeichnen sich insgesamt durch eine größere Nähe zur formalgetreuen Nachbildung bzw. zur Lehnübersetzung aus, während Schlegel die englische Vorlage ganz im Sinne einer poetisierenden Übertragung erarbeitet. Es finden sich Expansionen (sweaty > schweißbetrieft u.a.), Verdichtungen (analytisch > synthetisch: needs be pity’d > erbarmenswerth; Not a mouse stirring > Alles mausestill; with trains of fire > feuergeschweift u.a.) sowie die Tendenz, eher Lehnübertragungen (heaven-kissing hill > himmelnahe Höhn) bzw. Lehnschöpfungen anstelle von wörtlichen Lehnübersetzungen zu bilden (man vgl. für das letzte Beispiel die Bildungen bei Wieland/Eschenburg Himmel küssenden Hügel/ himmelküssenden Hügel). Die in der Hamlet-Übersetzung ermittelten adjektivischen Bildungen können in einem weiteren Schritt im Hinblick auf ihr allgemeines Vorkommen im Wortschatz der Zeit beleuchtet werden. Eine Auswertung von lexikographischen Ressourcen zur deutschen Sprache anhand des Trierer Wörterbuchnetzes,32 das insbesondere das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB1/DWB2), das Goethe-Wörterbuch sowie das Grammatisch-Kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801) von Johann Christoph Adelung als auch andere für den relevanten Zeitraum einschlägige Nachschlagewerke enthält, sowie des fünfbändigen Wörterbuchs der deutschen Sprache (1807–1811) von Joachim Heinrich Campe33 ergibt folgenden Befund: Von den 51 unterschiedlichen ermittelten adjektivischen Bildungen (types) weisen fünf (schweißbetrieft, feuergeschweift, heilvergessen, haarbuschig, halbgeartet) keinen Eintrag im Wörterbuchnetz oder bei Campe auf; einige dieser komplexen Adjektive können als von Schlegel gebildete Okkasionalismen
________________________ 28 29 30
31
32 33
Vgl. Malone 1790 (Anm. 20.) Shakespear. Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. Bd. 8. Zürich 1766. William Shakespear’s Schauspiele. Neue Ausgabe. Von Johann Joachim Eschenburg. Bd. 12. Zürich 1777. Zum Lehnwortschatz in Wielands Übersetzungen vgl. Kyösti Itkonen: Die Shakespeare-Übersetzung Wielands (1762–1766). Ein Beitrag zur Erforschung englisch-deutscher Lehnbeziehungen. Jyväskylä 1971. Vgl. https://www.woerterbuchnetz.de. Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der Deutschen Sprache. Bd. 1: A–E, Bd. 2: F–K, Bd. 3: L–R, Bd. 4: S–T, Bd. 5: U–Z. Braunschweig 1807–1811.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
101
eingestuft werden. Nur bei Campe verzeichnet sind müßiggängerisch34 und unschuldvoll.35 Ferner sind vier Bildungen (furchtergriffen, neugeheckt, schreckbefangen, wohlgenommen) alleinig im DWB1 durch die betreffende Hamlet-Stelle vertreten, wo sie offenbar als lemmawürdige Okkasionalismen eingestuft wurden.36 Dazu kommt der bekannte, von Schlegel gebildete Neologismus fragwürdig, der eine Lehnübertragung von engl. questionable ‚of whom questions may be asked‘ in der betreffenden Hamlet-Stelle (I,4: in so fragwürdiger Gestalt / in such a questionable shape) darstellt.37 Das Adjektiv ist mittlerweile standardsprachlich, wobei ein Bedeutungswandel von ‚des Fragens würdig‘ (der Bedeutung in der betreffenden Hamlet-Stelle) zu ‚fraglich, problematisch, zweifelerweckend/verdächtig, zwielichtig‘ zu verzeichnen ist, der eventuell bereits zeitgenössisch durch die Schlegel’sche Übertragung selber induziert wurde und somit auch eine Nebenbedeutung mittransportiert, die seit dem 17. Jahrhundert für das Englische (‚doubtful, which may be called in question‘) bereits nachgewiesen ist.38 Zudem lassen sich 22 Bildungen39 dem Wortschatz des (späten) 18. Jahrhunderts zuweisen; Schlegel greift also auf zeitgenössisches (insbesondere literarisches) Sprachmaterial zurück, was wiederum als Zeichen für die Modernität der Übertragungsstrategie ganz im Sinne einer „Repoetisierung“ gedeutet werden kann.40 Hinzu kommt eine
________________________ 34
35 36
37
38
39
40
Campe III (Anm. 33), S. 374, mit der Kennzeichnung als Neologismus; vgl. die heutige Kennzeichnung „gehoben“, etwa bei Duden: https://www.duden.de/rechtschreibung/muesziggaengerisch. Campe V (Anm. 33), S. 185, mit Belegen aus der zeitgenössischen Belletristik. Die Bildungen sind nicht bei Campe (Anm. 33) verzeichnet. Ebenfalls nur mit der Hamlet-Stelle im DWB1 nachgewiesen ist das Lexem oberherrlich, das aber im Deutschen Rechtswörterbuch seit dem 16. Jahrhundert (https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=oberherrlich), bei Adelung sowie Campe (III, S. 535) aufgeführt ist. Die Bildung wohlgenommen wird im DWB1 noch in einer anderen Bedeutung (‚gesetzlich, rechtlich erworben‘) mit einem Einzelbeleg nachgewiesen. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S.194, kennzeichnet in diesem Zusammenhang Schlegels Neologismen als „vielfach das Ergebnis eines anglisierenden, metaphrasierenden Übersetzens“. Peter F. Ganz: Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz 1640–1815. Berlin 1957, S. 76; vgl. Trübners Deutsches Wörterbuch. Bd 2: C–F. Berlin 1940, S. 425; Gebhardt 1970 (Anm. 5), S.194f. Das Lexem ist nicht bei Campe (Anm. 33) verzeichnet. blutschänderisch, dienstgefällig (Campe I [Anm. 33], S. 718: Neubildung des gehobenen Stils), durchdringlich, geschmackvoll, grundehrlich, himmelnah (Campe II [Anm. 33], S. 696: dichterisch), körperlos (Campe II [Anm. 33], S. 1021: Neubildung des gehobenen Stils), marklos (DWB1 mit Hamlet-Stelle), nothgedrungen, palmenreich (DWB1: Hamlet-Stelle als ältester Beleg), parteylos, qualvoll (Campe III [Anm. 33], S. 716: belletristische Neubildung), schaudervoll (DWB1 u.a. Hamlet-Stelle), schlangenartig, schwachgemuth (DWB1: „18. Jh. neu belebt“; Belege: Tieck / Hamlet-Stelle), schwindelköpfig (DWB1 mit Hamlet-Stelle als ältestem Beleg), spitzbübisch, unabgestumpft (DWB1: ältester Beleg: Hamlet-Stelle), unglücksschwanger (Campe V [Anm. 33], S. 168: belletristische Neubildung; DWB1: zwei Belege: Herder / Hamlet-Stelle), unverschanzt (DWB1: 2 Belege: Blum / Hamlet-Stelle), verzweiflungsvoll, wesenlos. Vgl. auch den Eintrag körperlos im Goethe-Wörterbuch, wo u.a. auf Schlegels Einfluss für die Übersetzung von engl. unsubstantial in Goethes Übersetzung von Romeo und Julia hingewiesen wird; GoetheWörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/GWB?lemid=K03546.
102
Claudine Moulin
Gruppe mit 16 Lexemen, die auch vor dem 18. Jahrhundert mehr oder weniger gut lexikographisch dokumentiert ist.41 Im Hinblick auf die morphologische Struktur fällt insbesondere das Vorkommen komplexer Bildungen mit Substantiv + Partizip II auf (nothgedrungen, schreckbefangen, schweißbetrieft, feuergeschweift, furchtergriffen, heilvergessen), ein Wortbildungsmuster, das für das Deutsche seit dem Mittelalter42 bezeugt ist und in Konkurrenz zu entsprechenden analytischen Syntagmen steht (furchtergriffen – mit/durch Furcht ergriffen). Es war in der Barockdichtung beliebt und wird insbesondere in der Empfindsamkeit und im Sturm und Drang plötzlich und stark ansteigend – vornehmlich im Bereich des Gefühlswortschatzes – produktiv.43 Hans Werner Eroms vermutet im Hinblick auf die hohe Produktivität in der Gegenwartssprache, dass es gerade die Literatursprache ab der Mitte des 18. Jahrhunderts war, die „dem Typ zur Durchsetzung verholfen hat.“44 Das reihenbildende Muster führt angesichts des kreativen Potentials zu vielen okkasionellen Bildungen, wie auch etliche der obigen Hamlet-Belege bezeugen. Gleichfalls wird es – einhergehend mit der auffälligen Beliebtheit – in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsprechend stilistisch moniert.45 Neben den Konstruktionen vom Typ Substantiv + Partizip II sind im Hamlet-Korpus ferner Partizipialbildungen mit präfixoiden Adjektiven/Adverbien als Erstglied (halbgeartet, neugeheckt, wohlgenommen), Negationsbildungen mit un- (unverschanzt, ungebeichtet, unabgestumpft) sowie eine komplexe Bildung mit Partizip I (hochgebietend) belegt. Auch die Zunahme von adjektivischen Bildungen mit Suffixoiden wie -los, -schwanger, -reich, -voll zur (graduierten) Bezeichnung von Beschaffenheit bzw. Qualitätseinschätzung (vgl. palmenreich / körperlos, marklos, parteylos, wesen-
________________________ 41
42
43
44
45
bettläg(e)rig, bitterkalt (DWB2 mit Hamlet-Stelle), eng(e)brüstig, handfest, hochgebietend, lustsiech (DWB1 mit Hamlet-Stelle; interessanterweise bei Campe III [Anm. 33], S. 175 als Neubildung des gehobenen Stils markiert), mausestill, milchweiss, mitternächtig, nichtswürdig, erbarmenswerth, spitzfindig, überzählig, ungebeichtet (DWB1 mit Hamlet-Stelle; nicht bei Campe), ungestalt (DWB1 mit Hamlet-Stelle), wunderwürdig (DWB1 mit Hamlet-Stelle; nicht bei Campe). Vgl. etwa mhd. gotgeformet, frnhd. gottgelassen; siehe zu solchen frühen Bildungen Hans-Werner Eroms: „Was man nicht bespricht, bedenkt man nicht“. Bemerkungen zu den verbalen Präfixen in der Wortbildung. In: Neuere Forschungen zur Wortbildung und Historiographie der Linguistik. Festgabe für Herbert E. Brekle zum 50. Geburtstag. Hrsg. von Brigitte Asbach-Schnitker und Johannes Roggenhofer. Tübingen 1987, S. 109–122, hier S. 117. Vgl. Eroms 1987 (Anm. 42), S. 117; Peter von Polenz: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd 2: 17. und 18. Jahrhundert. Bearbeitet von Claudine Moulin unter Mitarbeit von Dominic Harion. Berlin, Boston 2013, S. 238. Eroms 1987 (Anm. 42), S. 117. Zur Produktivität des Bildungstyps in der Gegenwart siehe Wolfram Wilss: Semiotische Analyse von deutschen Syntagmen des Typs Substantiv + Partizip II. In: Folia Linguistica 15, 1981, S. 409–435; Maria Pümpel-Mader, Elsbeth Gassner-Koch und Hans Wellmann: Adjektivkomposita und Partizipialbildungen (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen. 2). Berlin, New York 1992 (Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck. V). Vgl. Eroms 1987 (Anm. 42), S. 118, mit u.a. Hinweis auf Johann Christoph Adelung, Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache. Bd. 2. Leipzig 1782, S. 25: „Eine Schönheit kann das unmöglich seyn.“
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
103
los / geschmackvoll, qualvoll, schaudervoll, unschuldvoll, verzweiflungsvoll / unglückschwanger) ist kennzeichnend für das 18. Jahrhundert.46 Einige Bildungen sind zweifellos von den ausgangssprachlichen Lexemen und Konstruktionen angeregt worden (vgl. furchtergriffen / fear-surprized; schreckbefangen / wonder-wounded; neugeheckt / new-hatched; halbgeartet / demi-natured; unverschanzt / unfortified; wesenlos / bodyless). Eine hohe lexikalische Kreativität, unter anderem im Bereich von komplexen adjektivischen bzw. partizipialen Wortbildungen, zeichnete bereits die Sprache Shakespeares aus.47 Die Zunahme der Produktivität dieses Wortbildungstyps ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fällt besonders bei den deutschen ShakespeareÜbersetzungen auf; sie lässt sich bereits bei Wieland nachweisen.48 In diesem Zusammenhang kann die Musterhaftigkeit des Wortbildungstyps selber als sprachkontaktinduziertes Lehnphänomen gedeutet werden.
5. Spuren der lexikalischen Kreativität in der Hamlet-Handschrift Wie intensiv die Textarbeit im Sinne eines experimentellen Labors sich gestaltete, in dem zwischen der formalen, inhaltlich-prosaischen Ebene und der Ebene der Poetisierung des Textes – mitsamt ihren schöpferischen Dimensionen – experimentiert wurde, zeigt ein Blick in die handschriftliche Überlieferung der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels. Die Dresdener Hamlet-Handschrift49 (datiert wohl Anfang 1798) befindet sich auf halbem Weg zwischen ersten Entwürfen aus den Vorjahren und der (nicht überlieferten) endgültigen handschriftlichen Fassung der Druckvorlage, die ihrerseits noch weitere Veränderungen vornimmt.50 Gebhardt ordnet die Dresdener Handschrift als Dokument der zweiten, den Poetisierungsprozess vollziehenden Übersetzungsphase
________________________ 46 47
48 49
50
Vgl. Von Polenz/Moulin 2013 (Anm. 43), S. 314f. Vgl. Ulrich Busse, Beatrix Busse: The language of Shakespeare. In: The History of English. Volume 4. Hrsg. von Alexander Bergs und Laurel J. Brinton. Berlin, Boston 2017, S. 309–332, hier S. 316f. (mit Hinweis auf 3.179 verzeichnete Neologismen in Shakespeares Texten); Vivian Salmon: Some functions of Shakespearian word-formation. In: Shakespeare Survey 23, 1970, S. 13–26; Terttu Nevalainen: Shakespeare’s New Words. In: Reading Shakespeare’s Dramatic Language: A Guide. Hrsg. von Sylvia Adamson, Lynette Hunter, Lynne Magnusson, Ann Thompson und Katie Wales. London 2001, S. 237–255; Terttu Nevalainen: An Introduction to Early Modern English. Edinburgh 2006, S. 45–72. Zu den Bildungen des Typs Substantiv + Part. II im Englischen siehe etwa Hans Marchand: The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-Diachronic Approach. 2. Aufl. München 1969, S. 91–94. Itkonen 1971 (Anm. 31), S. 44f., 304–306. Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr.Dresd.e.90,XXII,1, https://digital.slubdresden.de/werkansicht/dlf/11745/1. Vgl. ferner August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100); Kaltërina Latifi: Übersetztes Sein (oder Nichtsein). Shakespeares Hamlet als kulturontologisches Paradigma bei August Wilhelm Schlegel und Theodor Fontane. In: Angermion. Jahrbuch für britisch-deutsche Kulturbeziehungen 11, 2018, S. 1–29, hier S. 10–16, 21–23 mit Faksimilierungen von Stellen mit interlinearen und marginalen Korrekturen. Vgl. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 130f.; Latifi: Hamlet-Manuskript 2018 (Anm. 49), S. 411f.
104
Claudine Moulin
ein; sie enthält auch Spuren von der Hand von Schlegels Frau Caroline.51 Die Handschrift zeigt für eine ganze Reihe der obigen adjektivischen Wortbildungen, dass sie das Ergebnis bewusster Wortformungsprozesse sind, die zum Teil über mehrere Annäherungsversuche an die im poetologischen Sinn möglichst treffende Realisierung in der Zielsprache verlaufen und die im Sinne der Poetisierung auch weg vom ausgangssprachlichen Ausgangspunkt (im Sinne einer wörtlichen Übersetzung) weisen können, und zwar ganz im Sinne eines ausgangstextlich begründeten, frühromantischen Konzepts der „Übersetzung als Bearbeitung.“52 Dabei zeigt die Handschrift mitsamt ihren Korrekturspuren, die sich in Form von Durchstreichungen, interlinearen Hinzufügungen und Marginalien manifestieren, auch, dass eine solche Textarbeit keineswegs streng linear von einer vorlagennahen, wortgetreuen Übersetzung als erster Stufe hin zu einer poetisierenden Überarbeitungsstufe verläuft, sondern dass die Ebenen als work in progress ineinandergreifen. Knapp ein Drittel der oben verzeichneten komplexen Adjektivbildungen der Druckfassung (1798) können als Ergebnis entsprechender Textarbeit in der Handschrift dokumentiert werden. Die relevanten Stellen zeigen u.a. Phänomene der Verdichtung (analytisch > synthetisch), der Expansion (Simplex > Wortbildungsprodukt), des Experimentierens mit synonymen Lexemen oder Wortbildungsmitteln und der Entstehung von okkasionellen Bildungen. Dabei spielen sowohl metrische Erfordernisse als auch das Zusammenspiel der Vorschläge mit dem restlichen Textverlauf eine Rolle. Ferner sind gelegentlich (nicht systematisch ausdrücklich gekennzeichnete53) intertextuelle Bezüge zu Vorgängerübersetzungen erkennbar, deren Varianten in die Textarbeit eingebaut, umgeändert und/oder wieder getilgt werden. Mitzudenken ist ferner die Benutzung von Wörterbüchern und Texterläuterungen zur englischen Vorlage. Im Folgenden sollen einige Stellen beispielhaft besprochen werden; alle Vorkommen sind im Anhang entsprechend der hier entwickelten ‚Formel‘54 konzise zusammengefasst und mit den Varianten in der Druckfassung sowie bei Wieland und Eschenburg vergleichbar.
________________________ 51
52 53
54
Vgl. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 133–135, mit Nachweis von zehn Stellen im Hamlet-Manuskript mit Änderungen von Carolines Hand. Diese betreffen keine im vorliegenden Beitrag behandelten Stellen; Latifi: Übersetztes Sein 2018 (Anm. 49), S. 17. Bär 1999 (Anm. 3), S. 309. Latifi: Übersetztes Sein 2018 (Anm. 49), S. 15, weist auf sieben Stellen im Manuskript hin, wo Eschenburgs Variante (gekennzeichnet mit „E.“) explizit erwähnt wird. Zusätzlich hierzu sind noch weitere implizite Bezüge herstellbar. Die hier vorgeschlagene „Formel“ ersetzt nicht den Vergleich mit der Originalhandschrift bzw. dem Faksimile bei Latifi: Hamlet-Manuskript 2018 (Anm. 49), sondern soll die Textarbeit verdeutlichen. Die Reihenfolge der interlinearen und marginalen Bearbeitungsspuren ist in der Regel nicht zweifelsfrei feststellbar; wenn nicht eindeutig erkennbar, werden zunächst die Randnotizen, dann die Interlineareinträge angegeben. Es werden folgende Siglen verwendet: [Ms] = ursprünglicher Eintrag in der Handschrift, [R] = Randeintrag/Marginalie, [IL] = Interlineareintrag, in der Regel über der Zeile; hinter „>“ steht das Korrekturergebnis unter Einbeziehung der Durchstreichungen, in runden Klammern wird der Wortlaut im Druck 1798 angegeben; [E] = Eschenburg, [W] = Wieland; Zeilenumbrüche sind mit || gekennzeichnet. Die Lesungen wurden anhand der Edition von Latifi: Hamlet-Manuskript, 2018 (Anm. 49) ermittelt und im Digitalisat nochmals geprüft.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
105
Bezüglich der bereits oben erwähnten Neubildung fragwürdig erlaubt die Handschrift ein Nachvollziehen des Ringens um eine ideale Übersetzung des englischen Adjektivs questionable an dieser schwierigen Shakespeare-Stelle, deren Bedeutung Schlegel sehr wohl erfasst hatte.55 In der Handschrift (fol. 13v) stand ursprünglich [Ms] in solcher lockenden Gestalt; am Rand wurden die Varianten [R] solch einladender // fragbaren // so fragwürdiger; interlinear wurde unterhalb der Zeile unter solcher lockenden [IL] so fragwürdiger eingetragen (und zwar aus fragwürdigen korrigiert); dabei wurde solcher lockenden im Basistext durchgestrichen; der Druck übernimmt die korrigierte Fassung in so fragwürdiger Gestalt. Ms. fol. 13v: [Ms] in solcher lockenden Gestalt [R] solch einladender || fragbaren || so fragwürdiger [IL] so fragwürdiger > in so fragwürdiger Gestalt (= Druck 1798)
Im Hinblick auf das Zweitelement fällt der intertextuelle Bezug zu Wielands missdeuteter Wiedergabe von questionable durch ehrwürdig auf, die wohl selber wiederum Auslöser der entsprechenden Stelle in Goethes Wilhelm Meister (1795/96; „du kommst in einer so würdigen Gestalt“56) gewesen ist. Das Zweitelement -würdig wird also von Schlegel beibehalten, quasi als palimpsestartige Tradierung der Wieland’schen und Goethe’schen Bildungen, das dann mit einem den Sinn der englischen Vorlage auffangenden Erstelement verbunden wird. Einen weiteren Blick in die Neologismenwerkstatt und das Ringen um eine poetisch-adäquate Wiedergabe einer schwierigen Stelle des Ausgangstextes (a robustious perriwig-pated fellow) ermöglicht die Entstehung der komplexen Adjektivbildung haarbuschig:57 Malone notiert in seiner Ausgabe als Erläuterung zu perriwig-pated: This is a ridicule on the quantity of false hair worn in Shakspeare’s time, for wigs were not in common use till the reign of Charles II. In the Two Gentlemen of Verona, Julia says – „I’ll get me such a colour’d periwig“. […] Players, however, seem to have worn them most generally.58
In der Handschrift (fol. 38v) steht zunächst [Ms] ein handfester || Perückenhans, wobei das Substantivkompositum an sich eine recht treffende Neubildung darstellt; das Wort wird schließlich verworfen und durchgestrichen. Am Rand steht Kerl mit falschem Haar auf dem Kopf, was eine sehr nahe, wörtliche Annäherung an die englische Vorlage unter Umschreibung des Lehnwortes Perücke mitsamt Einbeziehung der Semantik
________________________ 55
56
57 58
Siehe zu dieser Stelle auch ausführlich Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 194f. Eschenburg übersetzt mit leutselig; Wieland mit ehrwürdig. Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (5. Buch, 11. Kap.). 5. Aufl. München 1988, S. 346; vgl. zu dieser Stelle im Wilhelm Meister Susan Bernofsky: Foreign Words: Translator-Authors in the Age of Goethe. Detroit 2005, S. 24f. Gebhardt 1970 (Anm. 5), S. 225, verzeichnet irrigerweise haarburschig. Malone 1790 (Anm. 20), S. 296f.
106
Claudine Moulin
von engl. pated darstellt (> ‚perücken-köpfig‘).59 Auch diese Variante wird durchgestrichen. Interlinear steht oberhalb der Zeile haarbuschiger Geselle, mitsamt interlinearer Ergänzung von solch vor ein handfester, das in der Zeile davor steht. Ein zweites interlineares solch oberhalb von ein handfester wurde durchgestrichen. Als Ergebnis ist solch ein handfester haarbuschiger Geselle zu lesen, was ebenfalls im Druck übernommen wurde. Ms. fol. 38v: [Ms] ein handfester || Perückenhans [R] Kerl mit falschem Haar || auf dem Kopfe [vertikal durchgestr.] [IL] solch [IL] solch [IL] haarbuschiger Geselle > solch ein handfester haarbuschiger Geselle (= Druck 1798)
Das von Schlegel neugebildete Adjektiv haarbuschig kann als Ableitung des Substantivs Haarbusch gesehen werden, das Campe60 als Neubildung des gehobenen Stils markiert. Das deutsche Substantiv (und das davon abgeleitete Adjektiv) haben ferner eine interessante kulturhistorische Komponente: Zu Haarbusch verzeichnet das DWB1 neben der allgemeinen Bedeutung ‚dichtes haar das wie ein busch auf dem kopfe steht‘ noch die Bedeutung ‚ein hoch hinauf gekämmtes gewirr sowol natürlicher als künstlicher locken‘, mit Verweis auf Frauenfrisuren des 17. und 18. Jahrhunderts sowie Männerfrisuren der französischen Nachrevolutionszeit: „die männertoilette zu anfang des 19. jahrh. kennt den natürlichen haarbusch, den tituskopf, ein wild über haupt und stirn starrendes haar“.61 Der so genannte Tituskopf (franz. cheveux / coiffure à la Titus) ist nach dem französischen Schauspieler François Joseph Talma (1763–1826) benannt, der 1791 – eine Anregung des Malers Jacques Louis David aufgreifend – eine entsprechend gestaltete Frisur in der Rolle des Titus in Voltaires Tragödie Le Brutus trug.62 Der antikisierende, stufige Kurzhaarschnitt mit Locken um den Kopf herum löste in republikanischen Kreisen eine entsprechende Modewelle aus, die rasch auch von Frauen übernommen wurde.63 Auch wenn eine Verbindung der hier übersetzten Stelle mit der zum Zeitpunkt der Übersetzung Schlegels beliebten Haarmode nicht überbewertet werden sollte, so fällt zumindest der Zusammenhang der Hamlet-Stelle, die sich ja unmittelbar auf Praktiken der Schauspielerei bezieht, auf. Auch schätzte Schlegel, dessen frühe
________________________ 59
60
61 62
63
Engl. periwig (später abgekürzt wig) ist eine Entlehnung des 16. Jahrhunderts aus altfranz. perrucque ‚Perücke‘; vgl. periwig, n., Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/141111?rskey =jvxx6V&result=1; engl. pated in der Bedeutung ‚having a head (esp. the crown of the head) or mind of a specified kind‘, vgl. pated, adj., Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/138715?redirectedFrom=pated. Campe II (Anm. 33), S. 498: ‚ein Busch oder Büschel Haare, d. h. eine Menge neben einander stehender oder auch zusammengebundener Haare, besonders am Ende einer Sache‘. www.woerterbuchnetz.de/DWB/haarbusch. Carol Rifelj: Coiffures: Hair in Nineteenth-century French Literature and Culture. Newark 2010, S. 34–40; Jessica Larson: Usurping Masculinity: The Gender Dynamics of the coiffure à la Titus in Revolutionary France. Bachelor-Thesis der University of Michigan 2013, S. 12, 23f., https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/98928/jjlars.pdf?sequence=1. Vgl. Rifelj 2010 (Anm. 62), S.35: „In 1802, according to the Journal de Paris, more than half of elegant women were wearing their hair or wig ‚à la Titus‘. Critics railed against the style.“
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
107
Porträts durchaus Bezüge zum Tituskopf erkennen lassen,64 den Schauspieler und Hamlet-Darsteller Talma, den er persönlich als Schauspieler in Paris erlebt hat.65 Diese beiden Analysebeispiele stehen stellvertretend für den Reichtum der sprachlichen Auswertungsmöglichkeiten des Hamlet-Manuskripts im Hinblick auf die Etablierung des gedruckten Textes. Die Handschrift zeigt ferner noch weitere Spielarten der Textarbeit, etwa Korrekturergebnisse und/oder letztendlich zurückbehaltene Formulierungen im Haupttext, die nicht in den Druck übernommen wurden. Im Hinblick auf die hier untersuchten adjektivischen Wortbildungsprodukte interessant sind solche Fälle, in denen die handschriftliche Textarbeit ein Kompositum enthielt, das aber dann letztlich nicht für den Druck beibehalten wurde, wie etwa aussatzartig [R] (Ms. 15v und Druck 1798, 179: Das schwärende Getränk), langgestreckt [R] (Ms. 26v und Druck 1798, 209: gespreizten Helden), todswürdig [R] (Ms. 65r und Druck 1798, 310: so peinlicher Natur), gränzenlos [Ms] (Ms. 67v [IL] und Druck 1798, 316: keine Gränzen), zähnklappend [R] (Ms. fol. 75v und Druck 1798, 335: heulend). In zwei Fällen werden Änderungen vorgenommen, die auch die Getrennt- und Zusammenschreibung betreffen: schwarz und tiefgefärbt [Ms fol. 51v] (Druck 1798, 274, mit Umstellung der Adjektive: tief und schwarz gefärbt) sowie mit einem wohlgeführten Stoß [Ms fol. 67v] (Druck 1798, 317: mit einem wohl geführten Stoß); hier können durchaus auch metrische Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden.66
6. Worte, Worte, Worte – Ein Ausblick In diesem Beitrag wurden anhand einer Fallstudie in der Hamlet-Übersetzung August Wilhelm Schlegels Verfahren der lexikalischen Kreativität auf der Hintergrundfolie seines Konzepts des poetischen Übersetzens ausgelotet. Sowohl die Auswertung des Erstdruckes aus dem Jahr 1798 als auch des – eine Vorstufe zum Endergebnis darstellenden – Hamlet-Manuskripts haben gezeigt, wie vielschichtig eine Analyse aus linguistischer Sicht ausfällt. Die lexikographische Beschäftigung mit Schlegels Shakespeare-Wortschatz hat zudem den Blick darauf gelenkt, dass Teile dieses Wortschatzes (mitsamt den Sätzen, die ihn tragen) ihren ursprünglichen Ort – den übersetzten Text – verlassen und andere Aufbewahrungsorte gefunden haben. So ist bei den exzerpierenden Vorarbeiten zum vorliegenden Beitrag die große Dichte von Zitaten aus der Schlegel’schen Shakespeare-Übersetzung im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm
________________________ 64
65
66
Vgl. auch die Überlegungen von Fritz Stahl: Wie sah Goethe aus?. Berlin 1904, S. 6: „Goethe hat nicht nur sehr lange gelebt, sondern in seine Lebenszeit fallen grundlegende Wandlungen der Tracht: der Übergang vom Kostüm des 18. zu dem des 19. Jahrhunderts, oder, um das Ganze recht deutlich durch einen Teil zu bezeichnen, vom gepuderten Zopfe zum Tituskopf.“ Vgl. etwa August Wilhelm Schlegel an Auguste Louis de Staël-Holstein, 16.6.1809, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/308. Drei von diesen Bildungen (aussatzartig, zähnklappend und tiefgefärbt) sind nicht im Wörterbuchnetz nachweisbar; langgestreckt, tod(e)swürdig sowie grenzenlos lassen sich dem Wortschatz des 18. Jahrhunderts zuordnen.
108
Claudine Moulin
Grimm aufgefallen – einerseits als Belegstellen für reine Okkasionalismen, die dennoch mitsamt der Shakespeare-Stelle als lemmawürdig erachtet wurden, andererseits als sprachliche Zeugen für einen allgemeinen bzw. typischen Wortschatz des 18. Jahrhunderts. Alleine von den oben ermittelten Adjektivkomposita sind mehr als ein Drittel im DWB1 oder DWB2 mitsamt der entsprechenden Hamlet-Stelle nachgewiesen. Der Umfang der Vorkommen von Shakespeare-Zitaten im Deutschen Wörterbuch und in anderen lexikographischen Nachschlagewerken kann insgesamt hoch eingeschätzt werden; es bedarf noch einer systematischen Auswertung nicht nur im Hinblick auf die lexikalische Beschaffenheit, sondern auch bezüglich der benutzten Textausgaben. Was die Beschäftigung mit den Überlieferungsträgern selbst betrifft, kann im Hinblick auf eine weitere linguistische Erschließung sowie Aufgaben und Herausforderungen einer zukünftigen digitalen Edition festgehalten werden: Insbesondere für das Hamlet-Manuskript wäre es lohnenswert, alle Stellen mit Überarbeitungsspuren im Hinblick auf sprachliche Phänomene auf allen linguistischen Ebenen zu durchforsten. Eine solche Analyse kann prinzipiell auf zweierlei Weise geschehen: Die Handschrift kann einerseits als selbstständiges Einzelartefakt betrachtet werden und intralingual sowie intratextuell (d.h. alleinig auf die Sprache des Manuskripts mitsamt dessen Überarbeitungsspuren hin) untersucht werden. Das wäre insofern legitim, als der Text an sich selbstständig bestehen kann, und der Blick für die innere Textarbeit – wie bei meinen obigen Beispielen geschehen – geschärft wird. Andererseits kann (und muss) der Text der Handschrift – im epistemischen Sinn als dynamisch-fließendes Übersetzungszeugnis sowie im Sinne einer Schlegel-Philologie – interlingual und intertextuell (d.h. relational rückblickend im Hinblick auf den Schaffensprozess) untersucht werden, und zwar unter Berücksichtigung der englischen Vorlagen als Ausgangstexte, von Hilfsmitteln wie Wörterbüchern usw. (die Handschrift enthält auch ein paar englische Marginalien) sowie relational projektiv im Hinblick auf das Schaffensergebnis (d.h. die entsprechende deutsche Druckfassung), auch wenn die Handschrift nicht die Druckvorlage war. Ferner ist die Handschrift mitsamt ihrem „Beiwerk“ Teil einer größeren Überlieferungsgeschichte des Textes selbst, die es zu beschreiben gilt. Das gleiche gilt prinzipiell auch für jede Beschäftigung mit den Druckfassungen des Schlegel-Tieck-Kreises: Denn in dieser Form hat der deutsche Text durch die Medien Buch und Bühne auf die Rezipierenden gewirkt und auch Eingang in das kollektive Gedächtnis, in die Vorstellungswelten sowie die oben erwähnten Wörterbücher gefunden. All diese Zugangsweisen – auch im Sinne der multiplen Lesarten und Rollen, die diese Quellen für uns Forschende einnehmen – haben unmittelbare Konsequenzen für Editionsvorhaben, angefangen von einer rein buchstabengetreuen Textwiedergabe bis hin zur idealen Umsetzung in einer dynamisch modellierten und vielschichtig gestalteten digitalen Edition des Schlegelʼschen Hamlet. Eine solche Edition kann konsequenterweise nur interdisziplinär gelingen.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
109
Anhang Komplexe Adjektivbildungen in der Hamlet-Übersetzung (1798) von August Wilhelm Schlegel. Eine alphabetische Zusammenstellung der Entstehung der Bildungen unter Berücksichtigung der englischen Vorlage nach Malone, der deutschen Übersetzungen von Wieland (1766, = W) und Eschenburg (1777, = E) sowie der Dresdener Handschrift (= Ms.) mitsamt Seiten- bzw. Blattzahl. Die Reihenfolge der interlinearen und marginalen Bearbeitungsspuren in der Dresdener Handschrift ist in der Regel nicht zweifelsfrei feststellbar. Wenn nicht eindeutig erkennbar, werden zunächst die Randnotizen, dann die Interlineareinträge angegeben. Es werden folgende Siglen verwendet: [R] = Randeintrag/Marginalie, [IL] = Interlineareintrag, in der Regel über der Zeile; hinter „>“ steht das Korrekturergebnis unter Einbeziehung der Durchstreichungen, dann der Wortlaut im Druck 1798 angegeben.
bettlägrig: bettlägrig (I,2; 150) / bed-rid (197), (W 18 bettlägerig; = E 170), Ms ./. bitterkalt: ʼS ist bitterkalt (I,1; 140) / ’tis bitter cold (184), (W 6 Es ist bitterlich kalt; = E 161), Ms ./. blutschänderisch: In ein blutschänderisches Bett (I,2; 156) / to incestuous sheets (205), (W 24 in ein blutschänderisches Bette; E 177 auf ein blutschändrisches Lager), Ms ./. blutschänderisch: Ja, der blutschänderische Ehebrecher (I,5; 178) / Ay, that incestuous, that adulterate beast (230), (W 49 dieser ehrlose blutschändrische Unmensch; E 195 dieser blutschändrische, dieser ehebrechrische Unmensch), Ms ./. blutschänderisch: In seines Betts blutschänderischen Freuden (III,3; 268) / in the incestuous pleasures of his bed (328), (W 144 mitten in den blutschänderischen Freuden seines Bettes; E 273 in den Freuden seines blutschändenden Lagers), Ms ./. blutschänderisch: Hier, mördrischer, blutschändrischer, verruchter Däne! (V,2; 359) / Here, thou incestuous, murd’rous, damned Dane (420), (W 227 Hier, du blutschändrischer, mördrischer, verdammter Dähne; E 346 Hier, du blutschändrischer, mördrischer, verdammter Däne); Ms fol. 84r: [Ms] Hier, mördrischer, blutschändrischer, verruchter Däne! (= Druck 1798), [R] Hier, du blutschändrischer || mörderischer || Verruchter Däne! dienstgefällig: Die Hand dem Mund dienstgefäll’ger nicht (I,2; 151) / The hand more instrumental to the mouth (197), (W 19 noch dem Mund der Dienst der Hand; = E 171), Ms ./. durchdringlich: Wenn es durchdringlich ist (III,4; 271) / If it be made of penetrable stuff (332), (W 148 ./.; E 275 Wenn es irgend noch durchdringlich ist), Ms ./. engbrüstig: In dieser feisten, engebrüst’gen Zeit (III,4; 277) / in the fatness of these pursy times (341), (W 154 in dieser verdorbnen Zeit; E 281 zu unsern verderbten Zeiten); Ms fol. 53r: [Ms] In dieser feisten, engbrüst’gen Zeit [R] u engbrüst’gen > In dieser feisten, engbrüst’gen Zeit (= Druck 1798)
110
Claudine Moulin
erbarmenswerth: Ihr Zustand ist erbarmenswerth (IV,5; 295) / Her mood will needs be pity’d (357), (W 172 ihr Zustand verdient Mitleiden; E 294 Ihr Zustand verdient Mitleid); Ms fol. 59v: [Ms] Ihr Zustand ist zum Jammern. [R] Ihr Zustand ist erbarmenswerth. > Ihr Zustand ist erbarmenswerth (= Druck 1798) feuergeschweift: feu’rgeschweifte Sterne (I,1; 146) / stars with trains of fire (190), (W 13 Sterne zogen Schweiffe von Feuer nach sich; E 166 Sterne hatten feurige Schweife), Ms ./. fragwürdig: in so fragwürdiger Gestalt (I,4; 172) / in such a questionable shape (223), (W 43 die Gestalt die du angenommen hast, ist so ehrwürdig …; E 190 du kömmst in einer so leutseligen Gestalt; mit Anm: „Das Englische Beywort : questionable, bezeichnet eigentlich einen, der bereitwillig ist, sich Fragen vorlegen zu lassen.“); Ms. fol. 13v: [Ms] in solcher lockenden Gestalt; [R] solch einladender || fragbaren || so fragwürdiger; [IL] so fragwürdiger > in so fragwürdiger Gestalt (= Druck 1798) furchtergriffen: Vor ihren starren, furchtergriffnen Augen (I,2; 159) / By their oppress’d and fear-surprized eyes (208), (W 28 vor ihren von Furcht starrenden Augen; =E 180), Ms ./. geschmackvoll: von sehr geschmackvoller Erfindung (V,2; 347) / of very liberal conceit (410), (W ./.; E 338 trefflich ausgedacht), Ms ./. grundehrlich: Grundehrlich (I,5; 184) / true-penny (237) (W 55 ./.; E 200 guter Freund), Ms ./. haarbuschig s. handfest handfest, haarbuschig: ein handfester haarbuschiger Geselle (III,2; 240) / a robustious perriwig-pated fellow (296), (W 114 einen breitschultrichten Lümmel in einer grossen Perüke; E 249 einen baumfesten Kerl mit einer grossen Perüke); Ms. fol. 38v: [Ms] ein handfester || Perückenhans; [R] Kerl mit falschem Haar || auf dem Kopfe [vertikal durchgestr.]; [IL] solch; [IL] solch; [IL] haarbuschiger Geselle; > solch ein handfester haarbuschiger Geselle (= Druck 1798) halbgeartet: Als wär’ er einverleibt und halbgeartet // Mit diesem wackern Thier (IV,7; 314) / As he had been incorps’d and demy-natur’d // With the brave beast (377), (W 191 er schien mit seinem Pferd zusammengewachsen, und wie ein Centaur, halb Mensch und halb Pferd zu seyn; E 311 als ob er diesem wackern Thiere einverleibt, und mit ihm Ein Geschöpf wäre), Ms ./. heilvergessen: heilvergeßne Pred’ger (I,3; 165) / ungracious pastors (212), (W 35 ungeheiligten Seelen=Hirten; E 184 ruchlose Prediger); Ms fol. 10v: [R] ungerathne || unbekehrte; [Ms] heilge heilvergeßne (= Druck 1798) himmelnah: auf himmelnahe Höhn (III,4; 272) / on a heaven-kissing hill (335), (W 149 auf einen himmelküssenden Hügel; E 276 auf einen den Himmel küssenden Hügel), Ms ./. hochgebietend: Die edle hochgebietende Vernunft (III,1; 238) / that noble and most sovereign reason (295), (W 111 der schönste Geist; E 247 jenen edeln und vorzüglichen Verstand), Ms ./. körperlos: mit der körperlosen Luft (III,4; 275) / with the incorporal air (339), (W 152 mit der unkörperlichen Luft; E 279 mit der körperlosen Luft), Ms ./.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
111
lustsiech: viele lustsieche Leichen (V,1; 331) / many pocky corses (392), (W 206 manche Leichen; = E 324), Ms ./. marklos: sehr marklos (IV,7; 310) / much unsinew’d (374), (W 187 die […] weniger Stärke haben; E 308 sehr unbedeutend), Ms ./. mausestill: Alles mausestill (I,1; 140) / Not a mouse stirring (184), (W 6 Es hat sich keine Maus gerührt; E 161 Keine Maus hat sich gerührt); Ms fol. 1r: [Ms] Keine Maus || Hat sich geregt; [IL] Alles mausestill (= Druck 1798). milchweiß: Milchweißes Haupt (II,2; 221) / the milky head (276), (W 95 das milchweisse Haupt; E 233 Milchweisses Haupt), Ms ./. mitternächtig: aus mitternächt’gem Kraut (III,2; 254) / of midnight weeds (314), (W 130 aus mitternächtlichen Kräutern; E 262 aus Kraut der Mitternacht), Ms ./. müßiggängerisch: Ein müßiggängerischer Hang (I,2; 157) / A truant disposition (206), (W 26 Ein Anstoß von Landstreicherey; E 178 Ein Hang aus der Schule zu bleiben), Ms ./. neugeheckt: Von jedem neugeheckten Bruder (I,3; 166) / Of each new-hatch’d unfledg’d comrade (214), (W 36 jeder neuausgebruteten, unbefiederten Bekanntschaft; E 185 jeder neu ausgeheckten, jeder noch unbefiederten Bekanntschaft), Ms ./. nichtswürdig: welch ein nichtswürdiges Ding (III,2; 261) / how unworthy a thing (321), (W 138 was für ein armseliges Ding; E 267 was für ein armseliges Geschöpf), Ms ./. nothgedrungen: legten wir eine nothgedrungne Tapferkeit an (IV,6; 308) / we put on a compell’d valour (373), (W 186 entschlossen wir uns zur Gegenwehr; E 306 entschlossen wir uns aus Noth zur Gegenwehr); Ms fol. 64v: g in nothgedrungne aus anderem Buchstaben korrigiert. oberherrlich: Das oberherrliche Geheiß (IV,3; 290) / Our sovereign process (353), (W 167 unsern Auftrag; E 291 unsern vornehmsten Anschlag), Ms ./. palmenreich: Im höchsten palmenreichsten Stande Roms (I,1; 146) / In the most high and palmy state of Rome (190), (W 13 In dem höchsten und siegreichesten Zeit=Punkt der Römischen Republik; E 166 In dem besten und siegreichsten Zeitpunkte Roms), Ms ./. parteylos: parteylos zwischen Kraft und Willen (II,2; 221) / like a neutral to his will and matter (276), (W 95 der zwischen seinem Willen und dem Gegenstand im Gleichgewicht schwebt; E 233 der zwischen That Und Willen steht), Ms ./. qualvoll: den schweflichten, qualvollen Flammen (I,5; 176) / to sulphurous and tormenting flames (227), (W 46 in peinigende Schwefel=Flammen; E 193 mich marternden Schwefelflammen), Ms ./. schaudervoll: O schaudervoll! o schaudervoll! höchst schaudervoll! (I,5; 180) / O, horrible! O, horrible! most horrible! (233), (W 50 O, es ist entsezlich, entsezlich, höchst ensezlich!; E 197 O! das ist schrecklich! schrecklich! – aüsserst schrecklich!); Ms fol. 16r: O fürchterlich ([IL] schaudervoll)! o fürchterlich ([IL] schaudervoll)! höchst fürchterlich ([IL] schaudervoll)! [R] *schaudervoll > O schaudervoll! o schaudervoll! höchst schaudervoll! (=Druck 1798)
112
Claudine Moulin
schlangenartig: der schlangenart’ge Leumund (IV,1; 283) / viperous slander (348), (W 160 ./.; E 285 die Verlaümdung), Ms ./. schreckbefangen: schreckbefangne Hörer (V,1; 336) / wonder-wounded hearers (396), (W 212 von Erstaunen gefesselt; = E 328); Ms fol. 75v: [Ms] Wie ([IL] schreckbefangne) Hörer, krank vor Staunen? [R] schreckbefangne || staunen > Wie schreckbefangne Hörer staunen? (Druck 1798: Wie schreckbefangne Hörer? – ) schwachgemuth: Und ich, || Ein blöder schwachgemuther Schurke (II;2; 226) / A dull and muddy-mettled rascal (281), (W 100 und ich, träger schwermüthiger Tropf; E 237 Und ich, ein träger, schwerfälliger Tropf), Ms fol. 33r: [Ms] Und ich, || Ein (blöder, mattgeherzter) Schurke [IL] schwachgemuther [IL] schüchterner mattherziger > Und ich, || Ein blöder, schwachgemuther Schurke (= Druck 1798, ohne Komma hinter blöder) schweißbetrieft: diese schweißbetriefte Eil (I,1; 144) / this sweaty haste (188), (W 12 die schwitzende Eilfertigkeit; E 165 = W), Ms ./. schwindelköpfig: Dieß schwindelköpf’ge Zechen (I,4; 171) / This heavy-headed revel (220), (W 42 Diese taumelnden Trink=Gelage; =E 189); Ms fol. 13r: [Ms] Dieß schwindelköpf’ge Schwärmen; [IL] Zechen; [R] taumelköpf’ge || |Zechen > Dieß schwindelköpf’ge Zechen (= Druck 1798) spitzbübisch: spitzbübische Munkeley (III,2; 248)/ miching mallecho (308), (W 123 Poz Stern; E 256 geheime Bosheit), Ms ./. spitzbübisch: ein spitzbübischer Handel (III,2; 253) / a knavish piece of work (313), (W 129 ein schelmisches Stük Arbeit; E 261 ein bübisches Ding), Ms ./. spitzfindig: so spitzfindig (V,1; 329) / so picked (392), (W 204 so spizfündig; E 323 so spitzig), Ms ./. überzählig: die überzähligen Stöße (V,2; 349) / the odd hits (412), (W ./.; E 339 die überzähligen Stösse), Ms ./. unabgestumpft: unabgestumpft (Werkzeug) (V,2; 358) / Unbated (420), (W 227 ohne Knopf; = E 346), Ms ./. ungebeichtet: Ohne Nachtmahl, ungebeichtet, ohne Ölung (I,5; 179) / Unhousel’d, disappointed, unanel’d (232), (W 50 ohne Vorbereitung, ohne Sacrament, ohne Fürbitte; E 196 ohne Sakrament, ohne Vorbereitung, ohne letzte Oelung); Ms fol. 16r: [Ms] Ohne ([IL] Ohn) Nachtmahl, ungebeichtet, ungesalbt; ([IL ohne Ölung;]) || [Ms] Ohn Nachtmahl, ohne Beicht’ u letztes Oel; [R] *heil’ges [R] ungeölt [R] letzte Oelung || [Ms] Ohn Abendmahl und Beicht’ u letztes Oel; || > Ohne Nachtmahl, ungebeichtet, ohne Ölung (= Druck 1798) ungestalt: ihre ungestalte Art (IV,5; 295) / the unshaped use of it (357), (W 172 ./.; E 295 ihr Mangel an Zusammenhang); Ms fol. 59v: [Ms] Doch führt ihr unzusammenhängend Wesen; [R] Doch leitet ihre ungestalte Art > Doch leitet ihre ungestalte Art (= Druck 1798) unglückschwanger: im unglückschwangern Roß (II,2; 220) / in the ominous horse (275), (W 94 im Bauch des fatalen Pferdes; E 232 des unglückschwangern Rosses (mit Anm.: „Des Trojanischen Pferdes“), Ms ./.
Lexikalische Kreativität und poetische Übersetzung in A. W. Schlegels Hamlet-Übertragung
113
unschuldvoll: Von unschuldvoller Liebe (III,4; 272) / of an innocent love (332), (W 149 einer rechtmäßigen Liebe; E 276 einer unschuldigen Liebe), Ms ./. unverschanzt: Ein unverschanztes Herz (I,2; 154) / A heart unfortify’d (201), (W ./.; E 173 eines schwachen Herzens); Ms fol. 6v: [R] Ein wehrlos Herz; [Ms] ein unverschanztes Herz (= Druck 1798; auch andere Teile des Syntagmas überarbeitet) verzweiflungsvoll: Verzweiflungsvolle Hand (V,1; 334) / desperate hand (394), (W 210 gewaltthätige Hand; E 326 mit verzweifelnder Hand); Ms fol. 75r: [Ms] Verzweiflungsvoll[e] Hand an sich gelegt; [R] Verzweifelnd || an sich selber Hand gelegt || [R] Verzweiflungsvoll || Hand an sich selbst gelegt > Verzweiflungsvolle Hand an sich gelegt (= Druck 1798) wesenlos: In dieser wesenlosen Schöpfung (III,4; 277) / This bodiless creation (340), (W 153 ein unwesentliches Geschöpf; E 280 ein körperloses Geschöpf); Ms fol. 52v: [Ms] In dieser Wesenlosen Schöpfung; [R] körperlosen > In dieser Wesenlosen Schöpfung (= Druck 1798, mit kleingeschriebenem Adjektiv) wohlgenommen: für wohlgenommne Müh (II,2; 198) / for your well-took labour (248), (W 70 für eure glüklich angewandte Bemühung; E 211 für Eure wohl angewandte Bemühung), Ms ./. wunderwürdig: wie bedeutend und wunderwürdig (II,2; 212) / how express and admirable (262), (W 85 wie vollendet und bewundernswürdig; E 223 wie vollendet und bewundernswerth), Ms. ./.
Frieder von Ammon
Schattenbeschwörung Eine unbekannte Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe im Kontext*
Im Frühjahr 2019 ist in der Leipziger Stadtbibliothek ein Kästchen aufgetaucht, das wertvolle Handschriften enthält, darunter mehrere, die – wie es auf einer beiliegenden Übersicht des ehemaligen Bibliotheksdirektors Johannes Hofmann heißt – „von Goethes eigener Hand geschrieben“ worden waren.1 Dabei handelt es sich um die Handschriften von drei Zahmen Xenien und einem Gelegenheitsgedicht, die alle aus den 1820er Jahren stammen. Dass diese Handschriften jetzt wieder vorliegen, ist erfreulich, denn sie erlauben interessante Beobachtungen: Bei einer der Xenien (Warum, o Steuermann) hat Goethe zum Beispiel das im Text thematisierte Sinken eines Schiffes durch das Absinken der Schrift auf der Seite nachvollzogen. Da die Handschrift der Forschung bis jetzt nicht zugänglich war, konnte Goethes proto-konkretistisches Spiel mit der Materialität der Schrift jedoch nicht als solches erkannt werden.2 Aber das Kästchen enthält nicht nur Handschriften Goethes: Hinzu kommt die Abschrift eines Briefes von Goethe an Eckermann vom 9. August 1830 durch Goethes Schreiber John, das Kuvert eines Briefes von Zelter an Goethe, das insofern bedeutsam ist, als es mit einem Siegel versehen ist, das Goethe selbst für seinen Freund entworfen hatte,3 die Abschrift eines für die Totenfeier am 29. März 1832 im Dresdner Hoftheater bestimmten Epilogs zu Goethes Tod von Tieck durch Goethes Schreiber Kräuter sowie einige Briefe Ottilie von Goethes und weiterer Personen aus Goethes Weimarer Umfeld. Außerdem befindet sich in dem Kästchen eine handschriftliche Widmung August Wilhelm Schlegels an Goethe, die von einem besonderen Interesse ist, nicht nur, weil sie der Forschung bisher unbekannt war, sondern auch und vor allem deshalb, weil sie *
1
2
3
Der Verfasser dankt der Direktorin der Leipziger Städtischen Bibliotheken, Susanne Metz, und ihren Mitarbeiterinnen Heike Scholl und Korina Kilian für ihre Hilfe. Gedankt sei auch Dr. Yvonne Pietsch und Dr. Héctor Canal Pardo von der Historisch-Kritischen Ausgabe der Briefe Goethes am Goethe und Schiller-Archiv in Weimar. Eine Kurzfassung dieses Beitrags ist erschienen in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 290 vom 13. Dezember 2022, S. 12. Im Katalog der Stadtbibliothek ist das Kästchen als ‚Leipziger Goethe-Kästchen‘ unter der Signatur Sax. 2628 verzeichnet. Vgl. dazu Frieder von Ammon, Edith Zehm: Trouvaillen aus dem Leipziger Goethe-Kästchen. In: Goethe-Jahrbuch 136, 2019, S. 263–272. Vgl. dazu von Ammon/Zehm 2019 (Anm. 2), S. 267–272.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-009
116
Frieder von Ammon
neue Einblicke in August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung gewährt, genauer: in die Konstellation, innerhalb derer dieses Projekt publizistisch Konturen gewonnen hat.
1. Zunächst aber zu dem Kästchen selbst. Bei den in ihm enthaltenen Handschriften handelt es sich – wie es in der bereits zitierten Übersicht heißt – um „Manuscripte aus dem Besitz von Friedrich Zarncke“. Zarncke (1825–1891) war ein an der Universität Leipzig (deren Rektor er mehrfach war) lehrender Germanist, der sich Verdienste zumal auf dem Gebiet der Goethe-Forschung erworben hat,4 vor allem durch seine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Goethe-Bildnisse.5 Nach seinem Tod ging die „Sammlung Zarncke“ an die Stadtbibliothek Leipzig über, wo sie fortan verwahrt und im Rahmen einer Sonderausstellung (Goethe im Bild und seine Zeit im Buch) anlässlich des GoetheJahres 1932 öffentlich gezeigt wurde. Bei den Vorarbeiten zu dieser Ausstellung stieß der damalige Direktor Hofmann auf die Handschriften, die – wie er berichtet – „mitten unter den Bildern“ lagen.6 Hofmann ließ sich die Echtheit der Handschriften vom Goethe und Schiller-Archiv in Weimar bestätigen und fertigte daraufhin die Übersicht an. Als die Leipziger Stadtbibliothek in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1943 dann aber bei einem Bombenangriff schwer getroffen wurde, wurde die „Sammlung Zarncke“ fast vollständig zerstört. Von der Vernichtung verschont geblieben ist damals einzig jenes Kästchen, das seitdem unbeachtet in einem Tresor der Stadtbibliothek lag, bis es im Frühjahr 2019 gefunden, geöffnet und im Oktober 2019 schließlich der Öffentlichkeit als ‚Leipziger Goethe-Kästchen‘ im Rahmen einer kleinen Ausstellung vorgestellt wurde.
2. Damit zu Schlegels Widmung: Wie man schon auf den ersten Blick sieht (vgl. Abb. 1 und 2), hat Schlegel sie mit besonderer Sorgfalt auf die beiden Seiten eines weißen Quartblattes mit schmalem Falz und gebrochenem weißen Rand geschrieben. Die Schriftzüge sind elegant, gleichmäßig geschwungen und so auf den beiden Seiten verteilt, dass kein unnötiger Leerraum entsteht und der Lesefluss nicht unterbrochen wird. Nur am Zeilenende reicht der Platz manchmal nicht ganz. Schön und würdig sieht diese 4
5
6
Zu Zarncke vgl. Red[aktion]: Art. Zarncke, Friedrich. In: Internationales Germanistenlexikon 1800–1950. Hrsg. von Christoph König. Bearbeitet von Birgit Wägenbaur u.a., Bd. 3. Berlin, New York 2003, S. 2083–2086. Zur „Sammlung Zarncke“ vgl. Sabine Haupt: Leipziger Goethe-Sammler. In: Goethe-Jahrbuch 123, 2006, S. 188–205, hier S. 192f. Johannes Hofmann: Eine unbekannte Widmung A. W. Schlegels an Goethe. In: Zeitschrift für Bücherfreunde II, 1932, S. 34f., hier S. 35.
Schattenbeschwörung
117
Widmung aus, wie es bei einer Widmung an Goethe allerdings auch nicht anders zu erwarten ist. Der Text der Widmung ist unter die Überschrift Über Shakspeare’s Romeo und Julia gestellt, unter ihr steht die Widmungsformel „An Göthe“. Am Ende folgen drei Asterisken. Die Autorangabe „v. Schlegel“ wie auch die Paginierung am rechten oberen Rand der Vorderseite hingegen stammen nicht von Schlegels Hand. Sie wurden erst später hinzugefügt, möglicherweise von Zarncke.
Abb. 1: Widmung an Goethe, aus der „Sammlung Zarncke“, Vorderseite; Leipziger Städtische Bibliotheken.
118
Frieder von Ammon
Abb. 2: Widmung an Goethe, aus der „Sammlung Zarncke“, Rückseite; Leipziger Städtische Bibliotheken.
Wie aus dem Text der Widmung hervorgeht, bezieht sie sich auf zwei Objekte: erstens auf das (wohl verlorene) Manuskript des in der Überschrift genannten Aufsatzes Schlegels, dem die Widmung vorangestellt gewesen zu sein scheint – darauf lassen die bei einer Widmung unübliche Überschrift und die Asterisken am Ende schließen –, und zweitens auf den im Mai 1797 erschienenen ersten Band von Schlegels ShakespeareÜbersetzung. Die Widmung führt also mitten hinein in die Phase, in der Schlegels Projekt einer neuen Shakespeare-Übersetzung, die bis dahin nur in Auszügen publiziert worden war, erstmals buchförmig und in Gestalt zweier vollständig übersetzter Dramen (Romeo und Julia und Der Sommernachtstraum) an die Öffentlichkeit gelangte.
Schattenbeschwörung
119
Zwar ist die Widmung undatiert und enthält auch keine Ortsangabe, doch beides lässt sich rekonstruieren. Aufbauen kann man dabei auf eine kurze Miszelle, die Hofmann 1932 in der Zeitschrift für Bücherfreunde veröffentlicht hat.7 Die Miszelle enthält eine (allerdings fehlerhafte) Transkription der Widmung und knappe Angaben zu ihren Entstehungsumständen. Der Beitrag scheint von der damaligen Schlegel-Forschung jedoch nicht zur Kenntnis genommen worden zu sein, ansonsten wäre die Widmung heute nicht unbekannt. Angesichts des für die germanistische Forschung abgelegenen Publikationsortes und des damals nur schwach ausgeprägten Interesses an August Wilhelm Schlegel – zumal im Goethe-Jahr 1932 – ist das jedoch nicht überraschend. Offenbar hat sich auch Hofmann selbst für seinen Fund nicht recht begeistern können, seine Miszelle wirkt eher wie eine bibliothekarische Pflichtübung, als dass sie von Finderglück beseelt wäre. Auf die Widmung selbst geht Hofmann jedenfalls so gut wie gar nicht ein – das aber ist unverständlich, denn man hat es dabei nicht nur mit einem werkpolitisch und poetologisch relevanten und schon allein deshalb signifikanten historischen Dokument zu tun, sondern auch mit einem ästhetisch faszinierenden Text. Insofern ist es höchste Zeit, der Widmung die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient hat. Um dies in angemessener Weise tun zu können, ist es allerdings unumgänglich, sie in die Kontexte einzuordnen, aus denen sie hervorgegangen ist und in die hinein sie geschrieben wurde. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, an dieser Stelle einen kurzen Blick auf die ihr vorausgegangenen Ereignisse zu werfen.
3. Als Einstiegspunkt eignet sich der Moment, in dem Schlegel mit dem Projekt seiner neuen Shakespeare-Übersetzung zum ersten Mal an die Öffentlichkeit trat. Dies geschah im dritten Stück des 1796er-Jahrgangs der Horen, das am 25. März 1796 bei Cotta in Tübingen erschien. Den redaktionellen Usancen der Zeitschrift entsprechend erschien der Beitrag anonym, erst in dem im letzten Heft des Jahrgangs enthaltenen Gesamt-Inhaltsverzeichnis wurde der Name Schlegels genannt. Zunächst konnten also nur Insider wissen, wer jener ambitionierte Übersetzer war, der hier Scenen aus Romeo und Julie von Shakespeare als Probe einer neuen, metrischen Uebersetzung dieses Dichters vorlegte.8 Zweifellos hatte Schlegel genau überlegt, mit welchen Szenen er sein Projekt öffentlich vorstellen würde. Entschieden hat er sich für die drei ersten Szenen des zweiten Aktes, darunter die ikonische ‚Balkonszene‘, die schon damals die berühmteste Szene dieses Dramas war. In der Tat konnte Schlegel mit dieser Szene die Vorzüge seiner neuen und – wie es im Titel seiner Probe ja ausdrücklich hervorgehoben wird – metrischen Uebersetzung besonders gut unter Beweis stellen. Es muss an dieser Stelle nicht eigens betont werden, wie anders sich dieselbe Szene etwa in der Überset-
7 8
Hofmann 1932 (Anm. 6). Die Horen 5, 1796, Stück 3, S. 92–104.
120
Frieder von Ammon
zung Johann Joachim Eschenburgs liest. Im Vergleich damit muss es den zeitgenössischen Lesern so vorgekommen sein, als ginge mit Julia zugleich die „holde Sonn’“9 eines neuen, kongenialen Shakespeare-Übersetzers auf – und ohne jeden Zweifel war genau dies der von Schlegel intendierte Effekt. Wenn man die folgenden mit seiner Shakespeare-Übersetzung in Zusammenhang stehenden Publikationen Schlegels in der Reihenfolge ihres Erscheinens liest, wird deutlich, wie geschickt er die Veröffentlichung des ersten Bandes seiner Übersetzung publizistisch vorbereitet hat.10 Als Herausgeber der Horen unterstützte Schiller ihn dabei, indem er etwa dafür sorgte, dass die Proben zuerst erschienen, damit, wie er an Schlegel schrieb, „die That dem Raisonnement vorhergeht“.11 Das „Raisonnement“ folgte dann im nächsten, vierten Stück der Horen, das Ende April 1796 erschien, also einen Monat später, in Gestalt der Abhandlung Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters.12 Auch auf diesen einschlägigen – nach Roger Paulin sogar ‚klassischen‘13 – Text, in dem Schlegel die Poetik seiner Übersetzung entwickelt, muss hier nicht weiter eingegangen werden. Im Hinblick auf die Widmung an Goethe ist aber zu betonen, dass diese Abhandlung bereits auf Goethe hin perspektiviert ist, insofern sie die in Wilhelm Meister enthaltene Hamlet-Episode zum Ausgangspunkt für eigene Überlegungen nimmt, wobei Schlegel nicht an Lob für Goethe spart, der von ihm nicht nur zu einem sowohl in theoretischer als auch theaterpraktischer Hinsicht kongenialen Shakespeare-Interpreten, sondern auch zu einem diesem ebenbürtigen Autor erhoben wird. Schlegel machte Goethe auf diese Weise gewissermaßen schon im Voraus zum Schutzpatron seiner Shakespeare-Übersetzung. Insofern muss es auch von größter Bedeutung für ihn gewesen sein, dass Goethe ihm – wie Schlegel in einem Brief an Georg Joachim Göschen vom 24. Juni 1796 berichtet – Beifall spendete, nachdem er ihm seine Romeo und Julia-Übersetzung in Jena vorgelesen hatte.14 Und wieder folgte das nächste Ereignis auf dem Fuß: An demselben 24. Juni erschien das sechste Stück der Horen, das eine weitere Probe von Schlegels Übersetzung enthielt, diesmal aus einem anderen Drama – Der Sturm –,15 dessen Wahl wiederum alles andere als zufällig war: Zum einen konnte Schlegel auf diese Weise die Überlegenheit seiner Übersetzung gegenüber der kurz zuvor erschienenen Tiecks beweisen, zum anderen konnte er sich, indem er aus diesem Stück unter anderem das berühmte Ariel-Lied Full Fathoms Five auswählte, als einen Übersetzer präsentieren, der auch den Shakespeare-Songs mit ihren ganz besonderen Herausforderungen gewachsen war.16 9 10
11
12 13 14 15 16
Die Horen 1796 (Anm. 8), S. 94. Vgl. dazu Roger Paulin: The Life of August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 91–99. Friedrich Schiller, August Wilhelm Schlegel: Der Briefwechsel. Hrsg. von Norbert Oellers. Köln 2005, S. 76 [Nr. 18]. Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112. Paulin 2016 (Anm. 10), S. 99. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/412 (gesehen 10.10.2022). Die Horen 6, 1796, Stück 6, S. 61–82. Vgl. dazu Paulin 2016 (Anm. 10), S. 93.
Schattenbeschwörung
121
Das nächste Ereignis, das an dieser Stelle Erwähnung finden muss, steht auf den ersten Blick in keinem direkten Zusammenhang mit Schlegels Shakespeare-Übersetzung, aber eben nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten erweist es sich als durchaus dazu gehörig: Die Rede ist von den Xenien Goethes und Schillers, die im Juni 1796, als Schlegel Goethe seine Übersetzung vorlas, schon fast fertig waren, aus strategischen Gründen aber zu diesem Zeitpunkt noch geheim gehalten wurden und erst drei Monate später, Ende September 1796, in Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1797 erschienen.17 Dieser Zyklus von 414 satirischen Epigrammen in der Form des Monodistichons ist bekanntlich ein Rundumschlag, im Rahmen dessen Schiller und Goethe mit allen abrechneten, die sich damals nicht auf ihrer Seite befanden – und mit noch einigen anderen mehr –, womit sie einen der größten Skandale der deutschen Literaturgeschichte auslösten.18 Am Ende des Zyklus begeben sich die auch als Figuren in Erscheinung tretenden „Xenien“ in die Unterwelt, wo sie eine Reihe von Gesprächen führen, die den Gesprächen des Odysseus mit den Seelen der verstorbenen mythischen Helden im 11. Gesang der Odyssee nachgebildet sind. In den Xenien besteht der Witz allerdings darin, dass hinter den mythischen fast immer zeitgenössische, ganz und gar unheldenhafte Figuren zum Vorschein kommen, die allein schon durch den Kontrast zu ihren Vorbildern aus dem antiken Mythos ins Lächerliche gezogen werden. Eine Ausnahme ist Herakles – denn hinter ihm verbirgt sich Shakespeare: Hercules. Endlich erblickt’ ich auch den gewaltigen Hercules! Seine Uebersetzung! Er selbst leider war nicht mehr zu sehn.19
Wie man sieht, geht es hier von Anfang an um den Aspekt der Übersetzung, der durch das starke Enjambement sogar besonders hervorgehoben wird – und Schiller (von dem dieser Abschnitt des Zyklus stammt) lässt keinen Zweifel daran, dass die Übersetzung des Hercules alias Shakespeare so weit vom Original abweicht, dass dieses gar nicht mehr erkennbar ist. Die Leser, die dies im September 1796 oder kurz danach lasen, können – von einigen wenigen Insidern abgesehen – dabei nicht an Schlegel gedacht haben, dessen Übersetzung, mit Ausnahme der erwähnten wenigen Proben, ja noch gar nicht erschienen war. Vielmehr dürfte es allen klar gewesen sein, dass die Satire auf Eschenburg zielte. Wenn man aber die Korrespondenz Schillers mit Schlegel liest, zeigt sich, dass Schiller in diesem Zusammenhang durchaus auch an Schlegel dachte, und zwar nicht in einem bösartigen, sondern vielmehr in einem wohlwollenden Sinn. So 17
18
19
Musen-Almanach für das Jahr 1797. Hrsg. von Friedrich Schiller. Tübingen 1796, S. 197–203 [recte: 302]. Zu den Xenien und dem ‚Xenien-Streit‘ vgl. Frieder von Ammon: Ungastliche Gaben. Die Xenien Goethes und Schillers und ihre literarische Rezeption von 1796 bis in die Gegenwart. Tübingen 2005 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte. 123) und zuletzt Norbert Christian Wolf: Kriegsführung – Anonymität – Autonomie. Die Polemik der Xenien im Strukturwandel des literarischen Feldes. In: Goethe-Jahrbuch 138, 2021, S. 30–45. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller: Xenien. Eine Auswahl. Hrsg. von Frieder von Ammon und Marcel Lepper. Stuttgart 2022, S. 39 [Nr. 390].
122
Frieder von Ammon
schreibt er am 11. März 1796 etwa als Reaktion auf die ersten Proben von Schlegels Übersetzung an diesen, der Himmel werde es ihm lohnen, dass er „uns von dem traurigen Eschenburg befreyen“ wolle.20 Die ersten Proben der neuen Übersetzung hatten Schiller also umso deutlicher gemacht, was von Eschenburgs Übersetzung zu halten war. Und er fuhr fort: Mit diesem [Eschenburg] sind Sie glimpflicher umgegangen als ers verdient […]. Man sollte diese Erzphilister, die doch Menschen zu seyn sich einbilden, nicht so gut traktieren. Käme es auf die und ihre Hohlköpfe an, sie würden alles genialische in Grundsboden zertreten und zerstören.21
Seine Kritik an Eschenburg hatte durch die gerade entstehende Übersetzung Schlegels demnach neue Nahrung erhalten. Mehr noch: Schlegels Shakespeare-Übersetzung bildete für ihn von diesem Zeitpunkt an die Norm der Shakespeare-Übersetzung, an der er fortan alle anderen Versuche auf diesem Gebiet maß. Und als Herausgeber der Horen verschaffte er der neuen Norm zudem auch publizistisch Geltung. In den folgenden Epigrammen geht es auch um andere Aspekte der ShakespeareRezeption, so zum Beispiel das Problem der „Heracliden“, womit wohl epigonale Shakespeare-Imitatoren gemeint sind. Mit den „Tragöden“ und „Dramaturgen“ kommt hier außerdem die zeitgenössische Theaterpraxis in den Blick: Heracliden. Rings um schrie, wie Vögelgeschrey, das Geschrey der Tragöden, Und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn.22
In dem sich anschließenden Dialog zwischen Hercules/Shakespeare und dem (an dieser Stelle einzelnen) Sprecher der „Xenien“ entwirft Schiller ex negativo eine veritable Dramen-Poetik: Er. Welche noch kühnere That, Unglücklicher, wagest du jetzo? Zu den Verstorbenen selbst niederzusteigen, ins Grab! Ich. Wegen Tiresias mußt’ ich herab, den Seher zu fragen, Wo ich den guten Geschmack fände, der nicht mehr zu sehn. Er. Glauben sie nicht der Natur und den alten Griechen, so hohlst du Eine Dramaturgie ihnen vergeblich herauf.
20 21 22
Schiller/Schlegel 2005 (Anm. 11), S. 76 [Nr. 18]. Schiller/Schlegel 2005 (Anm. 11), S. 76 [Nr. 18]. Goethe/Schiller 2022 (Anm. 19), S. 40 [Nr. 391].
Schattenbeschwörung
123
Ich. O die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder, Splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt. Er. Wie? So ist wirklich bey euch der alte Kothurnus zu sehen, Den zu hohlen ich selbst stieg in des Tartarus Nacht? Ich. Nichts mehr von diesem tragischen Spuk. Kaum einmal im Jahre Geht dein geharnischter Geist über die Bretter hinweg. Er. Auch gut! Philosophie hat eure Gefühle geläutert, Und vor dem heitern Humor fliehet der schwarze Affekt. Ich. Ja, ein derber und trockener Spaß, nichts geht uns darüber, Aber der Jammer auch, wenn er nur naß ist, gefällt. Er. Also sieht man bey euch den leichten Tanz der Thalia Neben dem ernsten Gang, welchen Melpomene geht? Ich. Keines von beyden! Uns kann nur das christlichmoralische rühren, Und was recht populär, häuslich und bürgerlich ist. Er. Was? Es dürfte kein Cäsar auf euren Bühnen sich zeigen, Kein Anton, kein Orest, keine Andromacha mehr? Ich. Nichts, Man siehet bey uns nur Pfarrer, Kommerzienräthe, Fähndriche, Sekretairs oder Husarenmajors.23
An Shakespeare, der in der Perspektive der Xenien in der deutschen Gegenwart des Jahres 1796 aufgrund der Minderwertigkeit der vorliegenden Übersetzungen und Inszenierungen kaum mehr als er selbst erkennbar sei, wird hier also sowohl die deutsche Dramenproduktion als auch die deutsche Theaterpraxis der Zeit gemessen – und für erbärmlich befunden. Dass mit Schlegels Übersetzung eine neue Epoche der deutschen Shakespeare-Rezeption eingeleitet werden würde, muss Schiller damals bereits klar gewesen sein.
23
Goethe/Schiller 2022 (Anm. 19), S. 40–42 [Nr. 393–404].
124
Frieder von Ammon
Und damit vom September 1796, in dem Goethe und Schiller die Xenien veröffentlichten und so allgemeine Empörung auslösten, in den Mai 1797, also den Monat, in dem der erste Band von Schlegels Shakespeare-Übersetzung, dessen Veröffentlichung Schlegel publizistisch so sorgsam vorbereitet hatte, endlich erschien. Doch das Verhältnis Schillers zu Schlegel war damals bereits getrübt, und schon kurz darauf, am 31. Mai 1797, kam es zum Bruch. Wie der entscheidende Brief des tief gekränkten Schiller an Schlegel zeigt, spielte auch dabei dessen Shakespeare-Übersetzung eine Rolle: Es hat mir Vergnügen gemacht, Ihnen durch Einrückung Ihrer Uebersetzungen aus Dante und Shakespear in die Horen zu einer Einnahme Gelegenheit zu geben, wie man sie nicht immer haben kann, da ich aber vernehmen muß, dass mich H. Frid. Schlegel zu der nehmlichen Zeit, wo ich Ihnen diesen Vortheil verschaffe, öffentlich deßwegen schilt, und der Uebersetzungen zu viele in den Horen findet, so werden Sie mich für die Zukunft entschuldigen.24
Zwar versuchte Schlegel daraufhin mit allen Mitteln, den Bruch abzuwenden, doch es gelang ihm nicht. Schillers Kränkung saß zu tief. Immerhin konnten noch weitere Texte Schlegels in den Horen erscheinen, darunter eine dritte Probe der Shakespeare-Übersetzung (diesmal aus Julius Caesar).25 Doch das änderte nichts an der Tatsache, dass das Tischtuch zwischen Schiller und Schlegel zerschnitten war.
4. Es war diese Situation, in der Schlegel die Widmung schrieb, um die es hier geht. Alles deutet darauf hin, dass er sie am 8. Juni 1797 (also knapp eine Woche nach dem Bruch mit Schiller) Goethe in Jena persönlich überreichte, zusammen mit, wie gesagt, erstens einem Exemplar des ersten Bandes seiner Shakespeare-Übersetzung und zweitens dem Manuskript seines Aufsatzes Ueber Shakespeares Romeo und Julia, dem die Widmung ja aller Wahrscheinlichkeit nach vorangestellt war. Dass er diesen Aufsatz Goethe zukommen ließ, und nicht, wie seine früheren Beiträge zu den Horen, deren Herausgeber Schiller, lässt sich durch das erwähnte Zerwürfnis erklären. In dieser Situation, in der Schlegel noch versuchte, den Bruch rückgängig zu machen, wäre es für ihn nicht möglich gewesen, Schiller einen neuen Beitrag für die Horen zuzuschicken. Goethe hingegen konnte als Mittelsmann fungieren, und das tat er auch. In seinem Tagebuch vermerkte er am 8. Juni: „Spaziren mit Rath Schlegel dessen Abhandlung Romeo.“26 Die Widmung erwähnte er nicht. In jedem Fall schickte er am 10. Juni das Manuskript des
24 25 26
Schiller/Schlegel 2005 (Anm. 11), S. 84 [Nr. 24]. Die Horen 1796 (Anm. 12), S. 17–42. Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag der Stiftung Weimarer Klassik hrsg. von Jochen Golz. Unter Mitarb. von Wolfgang Albrecht, Andreas Döhler und Edith Zehm. Bd. II.1: 1790–1800. Text. Hrsg. von Edith Zehm. Stuttgart, Weimar 2000, S. 116.
Schattenbeschwörung
125
Aufsatzes mit seinen Anmerkungen an Schiller,27 der weitere Anmerkungen dazu machte, die Goethe am 14. Juni zusammen mit dem Manuskript an Schlegel übermittelte. Schlegel setzte die Anmerkungen unverzüglich um und sandte den überarbeiteten Aufsatz mit einem Begleitbrief an Schiller noch an demselben Tag zurück an Goethe, der beides an Schiller weiterleitete,28 sodass der Aufsatz schließlich im August im sechsten Stück der Horen erscheinen konnte – allerdings ohne die Widmung.29 Warum sie im Druck fehlt, ist nicht klar. Möglich ist, dass Goethe sie gar nicht erst an Schiller weitergegeben hatte, weil sie ihm zu persönlich war oder ihm ihre Veröffentlichung angesichts des Zerwürfnisses zwischen Schlegel und Schiller nicht ratsam erschien. Möglich ist auch, dass Schiller den Druck der Widmung verhinderte. Möglicherweise war sie von Schlegel aber auch gar nicht für die Veröffentlichung vorgesehen gewesen. Dafür spricht zum einen die Tatsache, dass die Beiträge in den Horen, wie gesagt, anonym erschienen und eine Widmung dieser Art dort deshalb ungewöhnlich gewesen wäre. Zum anderen spricht dafür der Bezug auf den ersten Band der Shakespeare-Übersetzung am Beginn der Widmung, der für die Leser des Aufsatzes in den Horen nicht ohne weiteres nachvollziehbar gewesen wäre. Genauso denkbar ist aber auch, dass Schlegel die Widmung in den Horen veröffentlichen wollte. Dafür spricht – neben ihrer ästhetischen Qualität und ihrer werkpolitischen sowie poetologischen Relevanz – die Tatsache, dass sie in der Handschrift unter die Überschrift des Aufsatzes gestellt, also als dessen Bestandteil markiert ist. Wäre die Widmung für den Druck bestimmt gewesen, dann hätten Goethe, Schiller oder sie beide die Veröffentlichung verhindert und man hätte es demnach mit einem unterdrückten Text zu tun. Möglicherweise bezieht sich ein Satz in dem Brief Schlegels an Schiller vom 14. Juni 1797 auf die (vielleicht von Schiller verlangte) Streichung der Widmung: „Die Weglassung des Einganges schien mir keine Veränderung des Anfanges nöthig zu machen.“30 Dieser Satz könnte jedoch auch auf eine andere Eingangspassage bezogen sein. Weil das Manuskript des Aufsatzes verloren ist, wird sich das wohl nicht mehr klären lassen. Eine wichtige werkpolitische Funktion der Widmung hat sich aber schon gezeigt: Unter anderem diente sie dazu, sicherzustellen, dass Schlegel die Horen auch über seinen Bruch mit Schiller hinaus als Plattform für die publizistische Flankierung seiner Shakespeare-Übersetzung nutzen konnte. Und dieses Kalkül ist auch aufgegangen.
27
28 29 30
Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe: Ihre Briefe sind meine einzige Unterhaltung. Briefwechsel in den Jahren 1794 bis 1805. Hrsg. von Manfred Beetz. 2 Bde. München, Wien 1990. Bd. 1, S. 355 [Nr. 324]. Schiller/Goethe 1990 (Anm. 27), S. 356 [Nr. 327]; Schiller/Schlegel 2005 (Anm. 11), S. 98 [Nr. 27]. Die Horen 1796 (Anm. 15), S. 18–48. Schiller/Schlegel 2005 (Anm. 11), S. 98 [Nr. 27].
126
Frieder von Ammon
5. Damit zu der Widmung selbst, deren Transkription31 an dieser Stelle eingeschaltet sei: Über Shakspeare’s Romeo und Julia. An Göthe. Sie wollten den Romeo in meiner Übersetzung auf die Bühne befördern: hier ist er, ich kann ihn keiner bessern Führung übergeben. Es würde mir ein angenehmer Lohn meiner Bemühungen seyn, wenn dieses Beyspiel auf mehren Theatern Nachfolge fände, und wenn man sich in Deutschland allmählig gewöhnte, Shakspeare in seiner ächten Gestalt, als Dichter, zu sehn und willkommen zu heißen. Dieß sind freylich mehr Wünsche als Hoffnungen; ich kenne die Größe der Schwierigkeiten, die sich für jetzt noch allen solchen Unternehmungen entgegenstellen. Das bürgerliche Leben will nichts als den Wiederhall seiner Alltäglichkeit von der Bühne herab vernehmen: Poësie auf ihr erscheinen lassen, heißt beynah einen unbekannten Schatten beschwören. Doch bis zur großen Auferstehung der Kunst, die endlich gewiß erfolgen muß, ist es schon keine geringe Befriedigung ihr dann und wann ein reineres Opfer gebracht zu haben. Den zarten Rührungen zu lieb, die Ihnen Romeo bey der Vorlesung erregte, werden Sie die Zugabe, womit ich mir ihn zu begleiten erlaube, nicht zurückweisen. Nächst dem unmittelbaren Genusse eines schönen Werkes ist mir nichts so werth, als ihn durch Mittheilung wiederhohlen. Indem wir das Eigenste und Geheimste der empfangnen Eindrücke auszusprechen versuchen, sichern wir sie uns und fesseln ihre schwindende Flüchtigkeit; das Gefühl, durch ansprechende Übereinstimmung bestätigt, kehrt reicher in unser Gemüth zurück. Und wo dürfte man eher hoffen, das Empfundne zur Erkenntniß aufzuhellen, als im Umgange mit einem Geiste, der immer bildend und selbstthätig Tiefen der Kunst aufschloß, von denen unsre bisher geltende Theorie nichts argwohnt? – Gewiß war Shakspeare nicht so sehr instinktmäßig dichtender Natursohn, so wenig denkender Künstler, daß er seine Werke bloß hingestellt hätte, ohne Rechenschaft von seinem Verfahren geben zu können; aber die vielfach veränderte Bezeichnung der Ideen würde es vielleicht unmöglich machen, sich darüber vollkommen mit ihm zu verständigen, wenn er wieder ins Leben zurückkehrte. Sie haben ihn in Ansehung eines seiner misverstandensten Werke bey unserm Zeitalter vertreten, und indem ich meine Bewunderung für ein andres Ihnen zueigne, glaube ich Shakspeare’n selbst näher zu seyn. Sey es nun, daß meine Ansicht des Romeo Sie nicht ganz unbefriedigt läßt, oder daß meine unvollkommnen Gedanken tiefer eindringende veranlassen, der Gewinn dieser Mittheilung wird immer auf meiner Seite seyn.
Es ist unverkennbar, dass Schlegel hier jeden Satz, ja jedes Wort mit Bedacht gewählt hat. Umso stärker fallen Stellen ins Auge, die man zumindest undiplomatisch nennen muss und die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass Goethe die Widmung zurückhielt. Das gilt schon für die Widmungsformel „An Göthe“. Lapidarer hätte sie nicht ausfallen können. Das aber ist nicht selbstverständlich. Vielmehr muss man sich vor Augen führen, was Schlegel hier alles weggelassen hat – allen voran Goethes Titel. 31
Die Transkription Hofmanns (Anm. 6) wurde zum Vergleich herangezogen, sie weist mehrere Fehler und Ungenauigkeiten auf.
Schattenbeschwörung
127
Freunde Goethes wie Schiller (in dem Gedicht An Goethe als er den Mahomet des Voltaire auf die Bühne brachte) und Friedrich Heinrich Jacobi (in der gedruckten Widmung der zweiten Fassung seines Romans Woldemar) konnten sich das herausnehmen, doch sie waren eben mit Goethe befreundet. Heinrich von Kleist hingegen hat seinen berühmten Brief an Goethe, mit dem er ihm das erste Heft des Phöbus zusandte, wie es sich gehörte, mit „Hochwohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimerath“ eingeleitet.32 Anders als Kleist und anders auch als Goethe selbst, der Schlegel in seinem bereits zitierten Tagebucheintrag bezeichnenderweise als „Rath“ tituliert, ignoriert Schlegel die geforderte Titulatur jedoch, und dies als ein bürgerlicher Autor, zwischen dem und Goethe also nicht nur im Hinblick auf Ansehen und Alter (Schlegel war damals 29 Jahre alt, Goethe 47) ein Verhältnis der Asymmetrie bestand. Mit anderen Worten: Schlegel ließ es an Respekt fehlen. Das indes erlaubt sich nur jemand, der über ausreichend Selbstbewusstsein verfügt. Und genau das signalisierte Schlegel: Er erschien vor Goethe nicht – um noch einmal den Brief Kleists zu zitieren – auf den „Knieen“ seines Herzens,33 sondern trat ihm auf Augenhöhe entgegen. Selbstbewusst bis an die Grenze der Unhöflichkeit ist auch der erste Satz: „Sie wollten den Romeo in meiner Übersetzung auf die Bühne befördern […].“ Die Direktheit dieser Einleitung, die Goethe ohne Umschweife an ein offenbar nach Schlegels Lesung geäußertes Vorhaben erinnert, und insbesondere auch das darauf folgende „hier ist er“, mit dem er Goethe sein Buch regelrecht vor die Füße zu werfen schien, geben zu erkennen, wie viel Schlegel daran gelegen war, dass Romeo und Julia in seiner Übersetzung auf die Bühne gelangte, also kein Lesedrama blieb, wie es angesichts der Theaterpraxis der Zeit zu befürchten war. Schlegel muss darauf gehofft haben, dass eine Weimarer Aufführung von Romeo und Julia in seiner Übersetzung und in Goethes Regie eine Musteraufführung werden würde, an der sich in der Zukunft weitere deutsche Theater orientieren könnten. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Unvermitteltheit, mit der er Goethe dessen Vorhaben in Erinnerung rief, an Unhöflichkeit grenzte. Immerhin wird dies dadurch etwas gemildert, dass er Goethe auch an die „zarten Rührungen“ erinnerte, denen dieser nach Schlegels Lesung offenbar ebenfalls Ausdruck verliehen hatte. Insgesamt versuchte Schlegel also, zwischen seinem berechtigten Übersetzerstolz, seinen Erwartungen an Goethe und der in dieser Situation erforderlichen Höflichkeit die Balance zu halten. Ob ihm das aus der Sicht des Meisterdiplomaten Goethe gelungen ist, muss offenbleiben. Bemerkenswert sind die Metaphern, auf die Schlegel bei seiner Beschreibung der gegenwärtigen Lage der deutschen Shakespeare-Rezeption zurückgreift: Shakespeare als „Dichter“ – gemeint ist: in einer „metrischen Übersetzung“, wie Schlegel sie vorgelegt hatte – auf die Bühne zu bringen, hieße, „beynah einen unbekannten Schatten zu beschwören“. Abgesehen davon, dass dies ein suggestives Bild ist, kommt man bei der Metapher von der Schattenbeschwörung wie auch zuvor schon bei der des Opferbringens nicht umhin, an den 11. Gesang der Odyssee zu denken, wo Odysseus am Eingang 32 33
Heinrich von Kleist: Sämtliche Briefe. Hrsg. von Dieter Heimböckel. Stuttgart 1999, S. 415f. [Nr. 116]. Kleist 1999 (Anm. 32), S. 416.
128
Frieder von Ammon
zum Hades ein Totenopfer bringt, um auf diese Weise die Seelen der Toten zu beschwören. Zugleich damit muss man aber auch an die erwähnte Passage am Ende der Xenien denken, in der die „Xenien“ sich ihrerseits in die Unterwelt begeben, um dort mit den Toten zu sprechen, denn diese Passage ist der Nekyia ja bis ins Detail nachgebildet. Entsprechend wird auch in den Xenien ein Opfer gebracht – nämlich eine zeitgenössische Ovid-Übersetzung: „Hekate! Keusche! dir schlacht ich die Kunst zu lieben von Manso, / Jungfer noch ist sie, sie hat nie was von Liebe gewußt.“34 An die Xenien erinnert darüber hinaus Schlegels Formulierung „Das bürgerliche Leben will nichts als den Widerhall seiner Alltäglichkeit von der Bühne herab vernehmen“ – denn ein ganz ähnlicher Vorwurf war im Rahmen des Dialogs der „Xenien“ mit Hercules/Shakespeare erhoben worden: „Uns kann nur das christlichmoralische rühren, / und was recht populär, häuslich und bürgerlich ist.“35 Allem Anschein nach spielt Schlegel hier also ganz bewusst auf die Xenien an, deren Erscheinen damals noch nicht lange zurücklag und die noch immer in aller Munde waren. Goethe dürften diese Anspielungen nicht entgangen sein. Auf diese Weise machte Schlegel sich indirekt zu einem Bündnispartner Goethes und Schillers. Bemerkenswert ist auch die christlich gefärbte Formulierung von der „großen Auferstehung der Kunst“. Was immer Schlegel sich genau darunter vorgestellt haben mag – offenkundig ist der Begriff der Kunst im Kollektivsingular hier bereits genauso voll ausgeprägt wie das Konzept der Kunstreligion. Bemerkenswert ist des Weiteren, wie Schlegel im zweiten Teil der Widmung seinen Aufsatz über Romeo und Julia zu legitimieren versucht. Er tut das, indem er die Funktion von Sekundärliteratur generell als die – angelehnt an seine Worte – ‚Aufhellung des Empfundenen zur Erkenntnis‘ bestimmt. Gemeint ist damit, den „unmittelbaren Genusse eines schönen Werkes“, also das subjektive, sinnliche Erlebnis der Kunstrezeption zu objektivieren und in rationale Erkenntnis zu überführen, die wiederum auf das Empfundene zurückwirkt, indem sie es vertieft und zugleich der Vergänglichkeit entreißt. Das aber ist eine philologische Poetik in nuce, und dass sie an Emil Staigers Formel vom ‚Begreifen, was uns ergreift‘ erinnert, spricht allenfalls gegen Letzteren. Nicht übergangen werden darf schließlich Schlegels Verweis auf die Hamlet-Kapitel in Wilhelm Meister, mit der Goethe Shakespeare – in Schlegels Formulierung – bei ihrem Zeitalter „vertreten“ habe. Indem er Goethe dies in Erinnerung rief, konnte er seinen eigenen Aufsatz über Romeo und Julia als ein dem Goetheschen Vorbild nacheiferndes Seitenstück dazu präsentieren. Rhetorisch ist das durchaus geschickt – genau wie Schlegels impliziter Widerspruch gegen Schiller, der darauf folgt. Schiller hatte in seiner zwei Jahre zuvor in den Horen erschienenen Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung bekanntlich sowohl Shakespeare als auch Goethe als naive Dichter eingestuft. Ohne Schillers Namen zu nennen, widerspricht Schlegel dieser These in der Widmung aber ausdrücklich, wenn er schreibt, Shakespeare sei
34 35
Goethe/Schiller 2022 (Anm. 19), S. 28 [Nr. 335]. Goethe/Schiller 2022 (Anm. 19), S. 42 [Nr. 402].
Schattenbeschwörung
129
„[g]ewiß“ „nicht so sehr instinktmäßig dichtender Natursohn“ gewesen, „so wenig denkender Künstler, daß er seine Werke bloß hingestellt hätte, ohne Rechenschaft von seinem Verfahren geben zu können.“ Schlegel macht Shakespeare gegen Schiller hier also zu einem sentimentalischen Dichter. Und indirekt macht er das mit Goethe auch, der sich dadurch geschmeichelt gefühlt haben dürfte, nicht zuletzt weil er auf diese Weise wiederum auf eine Ebene mit Shakespeare gestellt wurde. Zugleich wurde seine Rolle als Schutzpatron der Schlegelschen Shakespeare-Übersetzung so bekräftigt. Dass Goethe dieser Rolle jedoch allenfalls teilweise entsprach und es auch zu der von Schlegel erhofften Weimarer Aufführung von Romeo und Julia in seiner Übersetzung und in Goethes Regie erst am 1. Februar 1812 kam, noch dazu in einer stark bearbeiteten Form, die Schlegel nicht gefallen haben kann,36 das steht auf einem anderen Blatt.
6. Auf demselben Blatt steht aber die Tatsache, dass der nächste Text, den Schlegel bald darauf an Goethe schickte, wiederum eine Widmung war, diesmal allerdings eine gänzlich anderer Art. Die Rede ist von dem Gedicht Zueignung des Trauerspiels Romeo und Julia, das Schlegels Brief an Goethe vom 16. Juli 1797 beilag und dann in Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1798 gedruckt wurde.37 Ein zweites Mal innerhalb von kurzer Zeit machte Schlegel Romeo und Julia also zum Gegenstand einer Widmung. Doch in dieser zweiten Widmung ist alles anders: Es handelt sich nunmehr eben um ein Widmungsgedicht, und das Objekt dieser Widmung ist kein Exemplar von Schlegels Übersetzung des Dramas und auch nicht das Manuskript eines Aufsatzes darüber von ihm, sondern das Drama selbst. Zudem ist der Adressat der Widmung nicht mehr Goethe, er ist es sogar demonstrativ nicht. Denn folgendermaßen beginnt die Zueignung: „Nimm dies Gedicht, gewebt aus Lieb und Leiden, / Und drück’ es sanft an deine zarte Brust.“38 Von Anfang an war damit markiert, dass die Widmung an eine Frau gerichtet war. Ursprünglich war dies Caroline Schlegel gewesen, die ihren Mann auch bei der Arbeit an der Übersetzung von Romeo und Julia unterstützt hatte. Für den Druck hatte Schlegel die Widmung aber anonymisiert. Was blieb, war eine in einem von Schiller herausgegebenen Periodikum veröffentlichte Widmung von Romeo und Julia aus seiner Feder. Vielleicht kann man daraus schließen, dass es doch Schlegels Wunsch gewesen war, die Widmung an Goethe in den Horen zu veröffentlichen. In jedem Fall ist es höchste Zeit, ihr endlich die Beachtung zu schenken, die sie verdient hat.
36
37
38
Vgl. dazu den Kommentar in Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Hrsg. von Friedmar Apel u.a. 1. Abteilung. Bd. 12: Bezüge nach Außen. Übersetzungen II. Bearbeitungen. Hrsg. von Hans-Georg Dewitz. Frankfurt a.M. 1999 (Bibliothek deutscher Klassiker. 166), S. 1508–1539. Musen-Almanach für das Jahr 1798. Hrsg. von Friedrich Schiller. Tübingen 1798, S. 175–178. Vgl. zu diesem Gedicht Paulin 2016 (Anm. 10), S. 106–109. Musen-Almanach für das Jahr 1798 (Anm. 37), S. 175.
Nikolas Immer
Eine „höhere Stufe der Vollendung“? August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung im Horizont poetischer und politischer Ambitionen
Als der knapp 60-jährige August Wilhelm Schlegel im Februar 1828 die Vorrede zu seinen Kritischen Schriften verfasst, vermerkt er darin mit einem gewissen Unmut, seine Kräfte in der Vergangenheit zu häufig „am einzelnen und unbedeutenden ver[sch]wendet zu haben“.1 Konkret blickt er auf jene Periode zurück, in der er sich „ausschließend dem Schriftsteller-Berufe widmete“ und die sich „vom Sommer 1795 bis zum Frühling 1804“ erstreckt habe.2 Beachtenswert ist hier das Anfangsdatum, das Schlegel zufolge den Beginn seiner hauptamtlichen Arbeit als Schriftsteller bezeichnet: Im Sommer 1795 war er nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Hauslehrer aus Amsterdam nach Deutschland zurückgekehrt, um sich an einem Ort niederzulassen, der etwa in dem topographisch ausgerichteten Schlegel-Katalog Aufbruch ins romantische Universum (2017) als eigene Station ausgespart worden ist.3 Gemeint ist die niedersächsische Stadt Braunschweig, in der sich Schlegel bis zu seiner Übersiedlung nach Jena gut zehneinhalb Monate aufhalten wird. Sein Bruder Friedrich empfiehlt ihm schon bald eine „Schriftstellerdiät“, damit er sich dort publizistisch nicht zerstreue und seine Energien auf ein größeres Vorhaben ausrichte.4 Auch wenn August Wilhelm Schlegel dem ‚Diätplan‘ seines Bruders nur bedingt Folge leistet, legt er in seiner Braunschweiger Zeit den Grundstein für ein ambitioniertes Arbeitsprojekt: nämlich den für seine Übersetzung der Werke William Shakespeares. Im Folgenden wird der Fokus auf die Anfänge dieses Vorhabens gerichtet, die zunächst im Kontext von Schlegels strategischer Kooperation mit Schiller und dessen bündnispolitischen Absichten betrachtet werden. Daran anschließend wird im Hinblick auf die Gestalt der Übersetzung sowohl nach Schlegels poetischen Ambitionen als auch nach den Reaktionen in der zeitgenössischen Literaturkritik gefragt. Die Rolle von 1 2 3
4
August Wilhelm Schlegel: Kritische Schriften. 2 Bde. Berlin 1828. Bd. 1, S. XIII. Schlegel 1828 (Anm. 1), Bd. 1, S. XIII. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Aufbruch ins romantische Universum. Katalog zur Ausstellung im Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt a.M. Hrsg. von Claudia Bamberg und Cornelia Ilbrig. Göttingen 2017. Auch die Zeittafel, die am Ende der Schlegel-Biographie von Jochen Strobel zu finden ist, verzeichnet die Station Braunschweig nicht. Vgl. Jochen Strobel: August Wilhelm Schlegel. Romantiker und Kosmopolit. Darmstadt 2017, S. 184. Brief Friedrich Schlegels vom November 1795 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3442 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 22.11.2022 gesehen).
https://doi.org/10.1515/9783111017419-010
132
Nikolas Immer
Christian Gottfried Schütz, die dieser für die frühe Wahrnehmung und Beurteilung von Schlegels Übersetzung spielt, wird dabei eigens berücksichtigt.
1. Bündnispolitik. Zwischen Schiller und Eschenburg Die Annäherung zwischen August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schiller verläuft nicht gerade spannungsfrei.5 Bereits Mitte Oktober 1791 wird Schlegel von Schiller ermuntert, „als Mitarbeiter zu Zeiten Theil an seinem Journal zu nehmen“.6 Doch die angedachte Beteiligung an Schillers Zeitschrift Thalia, die ab 1792 unter dem Titel Neue Thalia fortgeführt wird, kommt nicht zustande. Die zentrale Ursache für die zunächst ausbleibende Zusammenarbeit darf in Schillers berüchtigter Rezension Über Bürgers Gedichte (1790) gesehen werden, in der er Schlegels Göttinger Lehrer und Mentor aufs Heftigste kritisiert hatte.7 Noch in seinem ersten Brief an Schiller wird Schlegel auf diese Rezension zu sprechen kommen und anmerken, dass Schiller mit seiner Autorität „vielleicht manchen Lesern diesen Dichter verleidet“ habe.8 Doch zu diesem Zeitpunkt ist Schlegel bereits auf dem besten Wege, ein wichtiger Beiträger für die Horen zu werden. Denn im Januar 1795 hatte Christian Gottfried Körner ein Manuskript Schlegels über Dantes Inferno an Schiller weitergeleitet, der es sogleich im dritten Stück seines ersten Horen-Bandes unter dem Titel Dante’s Hölle abdrucken ließ.9 Davon ermutigt, wendet sich Schlegel knapp ein halbes Jahr später
5
6
7
8
9
Vgl. Nikolas Immer: Mobilmachung der Musen. Ästhetische Oppositionen zwischen Friedrich Schiller und August Wilhelm Schlegel. In: Schiller und die Romantik. Hrsg. von Helmut Hühn, Nikolas Immer und Ariane Ludwig im Auftrag des Schillervereins Weimar-Jena e.V. Weimar 2018, S. 29–46, sowie Friedrich Schiller – August Wilhelm Schlegel: Der Briefwechsel. Hrsg. von Norbert Oellers. Köln 2005. Brief Georg August Wilhelm von Papes vom 13. Oktober 1791 an August Wilhelm Schlegel. In: Schillers Werke. Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs, des SchillerNationalmuseums und der Deutschen Akademie. Hrsg. von Julius Petersen und Gerhard Fricke [1948ff.: Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs und des Schiller-Nationalmuseums. Hrsg. von Julius Petersen † und Hermann Schneider. 1961ff.: Begründet von Julius Petersen †. Hrsg. im Auftrag der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv) und des Schiller-Nationalmuseums in Marbach von Lieselotte Blumenthal und Benno von Wiese. 1979ff. Hrsg. von Norbert Oellers und Siegfried Seidel †; seit 1992: Hrsg. im Auftrag der Stiftung Weimarer Klassik und des Schiller-Nationalmuseums Marbach von Norbert Oellers.] Weimar 1943ff., Bd. 34 II, S. 186. Diese ‚Ermunterung‘ erfolgt vermittelt über Schlegels Jugendfreund Pape, an den sich Schiller zuvor gewendet hatte. Vgl. York-Gothart Mix: „Sein Ruhm ist eine natürliche Tochter des Scandals.“ A. W. Schlegels Positionierung im literarischen Feld um 1800 (Bürger, Schiller, Voß). In: Der Europäer August Wilhelm Schlegel. Romantischer Kulturtransfer – romantische Wissenswelten. Hrsg. von York-Gothart Mix und Jochen Strobel. Berlin 2010, S. 45–56; Klaus Damert: Rufmord klassisch: Gottfried August Bürger. Volksdichter und radikaler Demokrat. Münster 2012. Brief August Wilhelm Schlegels vom 4. Juni 1795 an Friedrich Schiller. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 35, S. 216. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Dante’s Hölle. In: Die Horen 1, 1795, Stück 3, S. 22–69 [Böcking, Bd. 3, S. 230–275]; Immer 2018 (Anm. 5), S. 34.
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
133
erstmals brieflich an Schiller und betont, dass seine Dante-Arbeiten „nirgends vorteilhafter noch in einer gewählteren Gesellschaft erscheinen [könnten] als in den Horen“.10 Schlegels zusätzlicher Hinweis, dass der abgedruckte Text ein Fragment aus „[s]einer Schrift über Danteʼs Leben und Werke“ sei,11 soll Schiller selbstverständlich auch darauf aufmerksam machen, dass er von seinem neuen publikationswilligen Mitarbeiter weitere Beiträge für die Horen erwarten dürfe. Und tatsächlich erscheinen in rascher Folge noch drei weitere Dante-Artikel in Schillers Zeitschrift.12 Wie die Korrespondenz beider Kooperationspartner belegt, bildet sich zwischen Schiller und Schlegel eine symbiotische Beziehung heraus: Während Schiller einen fleißigen Textproduzenten sowohl für seine Horen als auch für seine Musenalmanache gewinnt, profitiert Schlegel von der Unterstützung Schillers, der ihm unter anderem zur einträglichen Mitarbeit an der Allgemeinen Literatur-Zeitung verhilft. Das hat beispielsweise auch zur Folge, dass Schlegel die Horen in einer Gefälligkeitsrezension recht ausführlich in der Allgemeinen Literatur-Zeitung bespricht.13 Nachdem Schlegel am 19. Januar 1796 seine Freude darüber geäußert hat, dass Schiller diese Rezension „nicht missfallen“ habe, deutet er geheimnisvoll an, was jener demnächst von ihm erwarten dürfe: „Vielleicht biete ich Ihnen schon für das Märzstück der Horen einen kleinen Aufsatz von anderm Inhalte an.“14 Tatsächlich legt Schlegel seinem Folgebrief vom 26. Februar 1796 diesen Aufsatz bei, der bald unter dem Titel Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters (1796) im vierten Stück des sechsten Horen-Bandes gedruckt wird.15 Dieser Brief ist auch deswegen höchst bedeutsam, weil Schlegel darin erstmals detailliert Auskunft über seine laufende Shakespeare-Übersetzung gibt:
10
11 12
13
14
15
Brief August Wilhelm Schlegels vom 4. Juni 1795 an Friedrich Schiller. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 35, S. 215. Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 35, S. 214. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Dante’s Hölle. Fortsetzung. In: Die Horen 2, 1795, Stück 4, S. 1–13; ders.: Dante. Fortsetzung. In: Die Horen 3, 1795, Stück 7, S. 31–49; ders.: Dante. Ugolino und Ruggieri. Fortsetzung. In: Die Horen 3, 1795, Stück 8, S. 35–74. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Rez. ‚Die Horen 1795, 1. bis 10. Stück‘. In: Allgemeine Literatur-Zeitung (4. Januar 1796), Nr. 4, Sp. 25–32; (5. Januar 1796), Nr. 5, Sp. 33–38; (6. Januar 1796), Nr. 6, Sp. 41–47 [Böcking, Bd. 10, S. 59–90]; Günter Oesterle: Friedrich Schiller und die Brüder Schlegel. In: Monatshefte 97, 2005, Nr. 3, S. 461–467, hier S. 464. Schlegels Rezension bezieht sich auf das erste bis zehnte Stück der Horen des Jahres 1795, in denen auch seine Dante-Serie erschienen ist, die er aber – um nicht seine eigenen Arbeiten zu rezensieren – mit keinem Wort erwähnt. Das provoziert wiederum folgende Reaktion, die ihm sein Bruder Friedrich schildert: „Endlich, liebster Bruder, habe ich Deine Rezension gelesen. Es gab zu einer ziemlich komischen Szene Anlaß. Ich traf sie bey [Wilhelm Gottlieb] Beckern, der sie aus Neid über die H.[oren] nicht wollte gelten lassen, und in der Unschuld seines Herzens fand er es besonders boshaft, daß Deines Dante gar keine Erwähnung geschehn.“ (Brief Friedrich Schlegels vom Februar 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/3436). Brief August Wilhelm Schlegels vom 19. Januar 1796 an Friedrich Schiller; Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 36 I, S. 86 und 88. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112 [Böcking, Bd. 7, S. 24–70].
134
Nikolas Immer
Sie werden von selbst errathen, daß ich mich mit einer poëtischen Übersetzung Shakespearischer Stücke beschäftige. Schon vor vielen Jahren unternahm ich einmahl den Sommernachtstraum, worin Bürger auch einige der Lieder und gereimten Szenen gemacht. Jetzt, da sich meine Ideen über eine solche Übersetzung beträchtlich verändert, und auch meine Kräfte, wie ich mir schmeichle sich mehr entwickelt haben, mußte ich sie bey der Durchsicht fast ganz umschmelzen. Den Romeo habe ich in diesem Winter neu übersetzt.16
Schlegel verweist nicht nur auf die frühere Übersetzung des Sommernachtstraums, die Bürger und er größtenteils im Wintersemester 1788/89 angefertigt hatten,17 sondern auch auf seine laufende Übersetzung der Tragedy of Romeo and Juliet, die 1766 von Christoph Martin Wieland übersetzt, 1768 von Christian Felix Weiße adaptiert und 1777 von Johann Joachim Eschenburg erneut übersetzt worden war. Während Schlegel an Schiller schreibt, werden im Hintergrund bereits Verhandlungen mit dem Herausgeber Wilhelm Gottlieb Becker sowie mit dem Verleger Salomon Michaelis geführt, die aber letztlich ergebnislos verlaufen.18 Daher leitet Schlegel einen Auszug aus seiner Übersetzung an Schiller weiter, den dieser unter dem Titel Scenen aus Romeo und Julie von Shakespeare (1796) im dritten Stück des fünften Horen-Bandes veröffentlicht.19 Nach weiteren Auszügen aus seinen Übersetzungen von The Tempest und Julius Caesar publiziert Schlegel schließlich auch den Aufsatz Ueber Shakespeare’s Romeo und Julia in den Horen, bevor das gleichnamige Trauerspiel als erster Teil (1797) seiner Shakespeare-Übersetzung bei Johann Friedrich Unger erscheint.20 Angemerkt sei, dass 16
17
18
19
20
Brief August Wilhelm Schlegels vom 26. Februar 1796 an Friedrich Schiller; Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 36 I, S. 129. Vgl. Frank Jolles: A. W. Schlegels Sommernachtstraum in der ersten Fassung vom Jahre 1789. Göttingen 1967, S. 9. Vgl. Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel. Biografie. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Philipp Multhaupt. Paderborn 2017, S. 73. Schiller sind Schlegels Publikationsabsichten durchaus bewusst, so dass er empfiehlt, den Horen-Abdruck einiger Scenen aus Romeo und Julie von Shakespeare als Werbung anzusehen: „Sie können, da es nur ein sehr kleiner Theil des Ganzen ist, das ganze Schauspiel abdrucken laßen, sobald Sie wollen.“ (Brief Friedrich Schillers vom 11. März 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 28, S. 199). Vgl. August Wilhelm Schlegel: Scenen aus Romeo und Julie von Shakespeare. In: Die Horen 5, 1796, Stück 3, S. 92–104. Dieser Auszug stellt zugleich Schlegels erste Shakespeare-Publikation dar. Dass dieser Auszug zeitlich noch vor dem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters veröffentlicht wird, geht auf Schiller zurück, der Schlegel mitteilt: „Eine vorausgeschickte Probe der neuen beßeren Uebersetzung Shakespears in den Horen wird selbst für Ihren Aufsatz gut seyn, denn immer ist es gut, wenn die That dem Raisonnement vorhergeht, und der Leser, dem jene Proben noch in frischem Gedächtniß sind, ergreift die Abhandlung mit um so größerer Begierde.“ (Brief Friedrich Schillers vom 11. März 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 28, S. 199). Vgl. August Wilhelm Schlegel: Ueber Shakespeare’s Romeo und Julia. In: Die Horen 10, 1797, Stück 6, S. 18–48 [Böcking, Bd. 7, S. 71–97]; [William] Shakespeare: Dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil[: Romeo und Julia. Ein Sommernachtstraum]. Berlin 1797. Caroline Schlegel, die August Wilhelm Schlegel am 1. Juli 1796 geehelicht hatte, ist Mitautorin des Aufsatzes Ueber Shakespeare’s Romeo und Julia. Vgl. Martin Reulecke: Caroline Schlegel-Schelling. Virtuosin der Freiheit. Eine kommentierte Bibliographie. Würzburg 2010, S. 88, Nr. 66. Zu Caroline Schlegels
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
135
Schlegel in der „Vorerinnerung“ zu seiner Buchausgabe fast wörtlich auf den Brief vom 26. Februar 1796 zurückgreifen wird.21 Schiller seinerseits verleiht in seinem Antwortbrief vom 11. März 1796 nicht nur der Hoffnung Ausdruck, dass man „die ganze Unternehmung, den Shakespear zu übersetzen“, wohl in Kürze mündlich in Jena besprechen könne.22 Vielmehr bemüht er sich auch darum, Schlegel parteipolitisch auf seine Seite zu ziehen, indem er hinzusetzt: „Der Gedanke ist sehr glücklich, und der Himmel lohn es Ihnen, dass Sie uns von dem traurigen Eschenburg befreyen wollen.“23 Schillers Rede vom „traurigen Eschenburg“ überrascht an dieser Stelle, hatte jener doch zwischen 1775 und 1777 eine umfangreiche Neuübersetzung der Werke Shakespeares vorgelegt.24 Tatsächlich schließt Schiller mit seiner abwertenden Charakterisierung an eine Einschätzung Schlegels an, der ihm kurz zuvor geschrieben hatte, dass man Eschenburgs Übersetzung „nicht ohne Ekel ansehn“ könne.25 Doch auch die Schärfe von Schlegels Formulierung wirkt einigermaßen erstaunlich, vor allem wenn berücksichtigt wird, wie sehr sich Eschenburg für ihn engagiert hatte. Denn Eschenburg hatte Schlegel nicht nur die einträgliche Stelle als Hauslehrer
21
22
23 24
25
Reflexionen über Romeo und Julia vgl. auch ihren Brief vom Herbst 1797 an August Wilhelm Schlegel. In: Caroline [Schlegel-Schelling]: Briefe aus der Frühromantik. 2 Bde. Nach Georg Waitz vermehrt hrsg. von Erich Schmidt. Leipzig 1913, Bd. 1, S. 429–432. Zu der ursprünglich diesem Aufsatz vorangestellten Goethe-Widmung Schlegels vgl. den Beitrag von Frieder von Ammon in diesem Band. Am 20. Februrar 1796 schreibt Schlegel an Schiller: „Jetzt, da sich meine Ideen über eine solche Übersetzung beträchtlich verändert, und auch meine Kräfte, wie ich mir schmeichle sich mehr entwickelt haben, mußte ich sie bey der Durchsicht fast ganz umschmelzen.“ (Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 36 I, S. 129; Hervorhebungen von NI) Dementsprechend heißt es gut ein Jahr später in Schlegels „Vorerinnerung“: „Meine Einsichten über die Art, wie man Shakspeare’s Darstellungen in unsre Sprache übertragen müsse, hatten sich […] so wesentlich verändert, daß ich mich genöthigt sah, theils meine eigne damalige Arbeit ganz umzuschmelzen, theils die wenigeren von Bürger noch freyer übersetzen Stellen bey Seite zu legen.“ (Shakespeare/Schlegel 1797 [Anm. 20], S. IV, Hervorhebungen von NI). Brief Friedrich Schillers vom 11. März 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 28, S. 199. Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 28, S. 199. 1782 folgte noch die Übersetzung von Pericles. Vgl. die Auflistung bei Carolin Roder: Der treue Sammler. Eschenburg und die Tücken der Shakespeare-Übersetzung. In: Johann Joachim Eschenburg und die Künste und Wissenschaften zwischen Aufklärung und Romantik. Netzwerke und Kulturen des Wissens. Hrsg. von Cord-Friedrich Berghahn und Till Kinzel. Heidelberg 2013, S. 267–282, hier S. 273. Zu Eschenburgs umfangreichem Engagement für Shakespeare, das schon in den 1770er Jahren beginnt und dessen Höhepunkt neben seiner Übersetzungstätigkeit die Monographie Ueber W. Shakspeare (1787) bildet, vgl. Till Kinzel: Johann Joachim Eschenburg als Fortsetzer, Überarbeiter und Vollender der Shakespeare-Übersetzung von Christoph Martin Wieland. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 71, 2021, H. 1, S. 17–32, hier S. 18–20. Zu Eschenburgs text- und quellenkritischen Bemühungen um Shakespeare vgl. Roger Paulin: Shakespeare, Eschenburg und Weimar. In: Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen 158, 2006, H. 1, S. 82–95, hier S. 88. Brief August Wilhelm Schlegels vom 1. März 1796 an Friedrich Schiller. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 36 I, S. 136.
136
Nikolas Immer
in Amsterdam vermittelt,26 sondern ihn auch im Juli 1792 eingeladen, ans Braunschweiger Collegium Carolinum zu kommen.27 Gut drei Jahre später berichtet Schlegel gegenüber Christian Gottlob Heyne von der gastlichen Aufnahme Eschenburgs: „Bey meinem einstweiligen Aufenthalte hier erfahre ich viel zuvorkommende Güte von den hiesigen Gelehrten, besonders von H. Eschenburg, dessen ganze vortreffliche Bibliothek mir offen steht.“28 Diese Freigebigkeit bestätigt auch Schlegels baldige Gattin Caroline Böhmer, die bereits im April 1795 zu ihrer Mutter nach Braunschweig geflüchtet war: „Er [Eschenburg] ist recht gut – er lobt mein Kind und schickt mir seine ganze Bibliothek.“29 Es verdient eigens hervorgehoben zu werden, dass Schlegel, als er im Winter 1795 gemeinsam mit Caroline die Shakespeare-Übersetzung beginnt, offenbar grundsätzlich die Möglichkeit hat, eine Privatbibliothek zu nutzen, die einem der gelehrtesten Shakespeare-Kenner des ausgehenden 18. Jahrhunderts gehört.30 Welcher Bestand an „Schriften von und über Shakespeare“ dort verfügbar war, mag das Bücherverzeichnis veranschaulichen, das nach dem Tod von Eschenburg erstellt wird.31 Wohl auch aufgrund dieses besonderen Privilegs, das Schlegel genießen darf, würdigt er Eschenburg in seinem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters als einen „unserer gelehrtesten und geschmackvollsten Litteratoren“,
26 27
28
29
30
31
Vgl. Cornelia Bögel: Amsterdam. In: Bamberg/Ilbrig 2017 (Anm. 3), S. 40–45, hier S. 40f. Vgl. den Brief Johann Joachim Eschenburgs vom 14. Juli 1792 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1652. Vor Schlegels Eintreffen in Braunschweig hatte sich seine Mutter noch Hoffnungen gemacht, dass er am Collegium Carolinum die Nachfolge des am 19. März 1795 verstorbenen Schriftstellers und Übersetzers Johann Arnold Ebert antreten könne. Vgl. den Brief Johanna Christiane Erdmuthe Schlegels vom 14. April 1795 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2353. Brief August Wilhelm Schlegels vom 24. September 1795 an Christian Gottlob Heyne. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1144. Später will sich auch Friedrich Schlegel die Kenntnisse Eschenburgs zunutze machen, indem er folgende Bitte an seinen Bruder richtet: „Kannst Du nicht in Br.[aunschweig] vielleicht von Eschenburg erfahren, ob eine gute Uebersetzung des Sallustius und des Vellejus existirt?“ (Brief Friedrich Schlegels vom 15. Januar 1796 an August Wilhelm Schlegel; KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3605). Brief Caroline Böhmers vom 20. Mai 1795 an Luise Gotter. In: Schlegel-Schelling 1913 (Anm. 20), Bd. 1, S. 359. Ob und inwieweit Schlegel die Privatbibliothek Eschenburgs tatsächlich für seine Shakespeare-Übersetzung genutzt hat, lässt sich nicht rekonstruieren. Wahrscheinlich ist, dass es dazu kaum oder gar nicht gekommen ist, da Schlegel seine translatorische Tätigkeit vor Eschenburg verheimlicht zu haben scheint. Denn rückblickend vermerkt Eschenburg: „[ich] hätte ihm [Schlegel] selbst Alles, was ich dazu längst sammelte und änderte, gern überlassen, wenn er mir während seines mehr als jährigen Hierseyns [in Braunschweig] auch nur Eine Sylbe von seinem Vorhaben entdeckt hätte!“ (Brief Johann Joachim Eschenburgs vom 24. November 1797 an Christian Gottfried Schütz. In: Friedrich Karl Julius Schütz: Christian Gottfried Schütz. Darstellung seines Lebens, Charakters und Verdienstes nebst einer Auswahl aus seinem litterarischen Briefwechsel mit den berühmtesten Gelehrten und Dichtern seiner Zeit. 2 Bde. Halle 1834/35, Bd. 2, S. 85). Auch Schlegel betont gegenüber Georg Andreas Reimer rückblickend – ohne jedoch eine genaue Bezugszeit anzugeben –, dass er damals „nicht gehörig mit Hülfsmitteln ausgerüstet war. Ich hatte keine Shakspeare-Bibliothek, wie Eschenburg sie besaß“ (Brief vom Dezember 1838 und Januar 1839 an Georg Andres Reimer. In: Böcking, Bd. 7, S. 286). Vgl. Anonym: Verzeichniß derjenigen Bücher aus dem Nachlasse […] [von] Joh. Joachim Eschenburg […]. Braunschweig 1822, S. 90–95.
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
137
der Shakespeare „mit gründlicher Sprachkunde, seltnem Scharfsinn im Auslegen, und beharrlicher Sorgfalt“ übersetzt habe.32 Doch Schlegels öffentliche Anerkennung von Eschenburgs translatorischem Verdienst kontrastiert in eklatanter Weise mit seiner eigentlichen Einschätzung, die er kurz darauf seinem Briefpartner Schiller mitteilt: Ich hätte das Bedürfniß einer neuen Übersetzung als noch viel dringender zeigen können, wenn ich mit aller Strenge von der vorhandnen [Eschenburgs] hätte reden wollen. In der That, wer das Original selbst kennt, kann sie nicht ohne Ekel ansehn: der beste Dienst, den sie verrichten kann, ist, daß der Anfänger im Englischen sie als einen fortlaufenden Kommentar benutzt. Ich stehe indessen in Verbindung mit Eschenburg und mochte einem sonst verdienten Manne […] unnöthiger Weise keinen Verdruß verursachen.33
Schiller seinerseits teilt diese Auffassung ganz und gar nicht, da er es geradezu darauf anlegt, Eschenburg „Verdruß“ zu bereiten. Schillers Einstellung dürfte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass seine Jugenddramen in Eschenburgs Dramatischer Bibliothek (1793) nicht sonderlich wohlwollend besprochen worden waren.34 Zum anderen hatte Eschenburg diese Dramen bereits 1784 als „Nachahmungen Schakespeare’s in seiner schlechtern Manier“ bezeichnet.35 In Schlegel meint Schiller nun einen Bündnispartner gefunden zu haben, mit dem sich eine Allianz gegen Eschenburg schmieden lasse. Davon zeugt insbesondere die überraschend drastische Wortwahl seines Antwortbriefs: […] der Himmel lohn es Ihnen, dass Sie uns von dem traurigen Eschenburg befreyen wollen. Mit diesem sind Sie glimpflicher umgegangen als ers […] bey seiner lächerlichen Anmassung als Critiker und Aesthetiker verdient. Man sollte diese Erzphilister, die doch Menschen zu seyn sich einbilden, nicht so gut traktieren. Käme es auf sie und ihre Hohlköpfe an, sie würden alles genialische in Grundsboden zertreten und zerstören.36
32
33
34
35
36
Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 78. Auffällig ist, dass Schlegel den Namen Eschenburgs an dieser Stelle verschweigt. Ohnehin taucht der Name Eschenburgs in diesem Aufsatz nur einmal kurz auf, und zwar zu Beginn in einer Fußnote. Vgl. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 59, Anm. *. Brief August Wilhelm Schlegels vom 1. März 1796 an Friedrich Schiller. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 36 I, S. 136. Vgl. Alexander Košenina: Eschenburgs Beitrag zur Theatergeschichte. In: Berghahn/Kinzel 2013 (Anm. 24), S. 115–124, hier S. 118. Fr. [= Johann Joachim Eschenburg]: Rez. ‚Friedrich Schiller: Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Mannheim 1784‘. In: Allgemeine deutsche Bibliothek 58, 1784, Stück 1, S. 477– 480, hier S. 478. Zu Eschenburgs Autorschaft dieser Rezension vgl. Till Kinzel: Bibliographie der Schriften von Johann Joachim Eschenburg. In: Berghahn/Kinzel 2013 (Anm. 23), S. 401–447, hier S. 423, Nr. 362. Brief Friedrich Schillers vom 11. März 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 28, S. 199.
138
Nikolas Immer
Doch Schlegel ist keineswegs geneigt, sich dieser Diffamierung anzuschließen.37 Während Eschenburg von Schiller und Goethe in den Xenien verspottet wird,38 bedauert es Schlegel durchaus, Eschenburg mit seiner Neuübersetzung des Shakespeare einen „schlimmen Dienst“ erwiesen zu haben.39 Gleichwohl verbindet er mit seiner Übersetzung einen grundsätzlich anderen ästhetischen Anspruch als sein Vorgänger.
2. Übersetzungspolitik. Zwischen Eschenburg und Schütz Nicht unerheblich für Schlegels Übersetzungsleistung ist zunächst, dass er gegenüber Christian Gottlob Heyne am 6. Januar 1791 einräumt: „Ich bin […] der Englischen Sprache nicht genug mächtig, um mit völliger Sicherheit darin zu schreiben“.40 Auch wenn sich noch mehr als 40 Jahre später eine fast wortidentische Formulierung in einem Brief Schlegels findet,41 darf davon ausgegangen werden, dass sich seine Kenntnisse der englischen Sprache im Zuge der Übersetzungsarbeit weiter vertiefen. Außerdem wird zu Beginn des Jahres 1796 in seinen Briefen Samuel Johnsons Dictionary of the English Language erwähnt, das 1794 in zehnter Auflage vorlag.42 Darüber hinaus
37
38
39
40
41
42
In seinem Antwortbrief heißt es: „Da ich selbst eine neue Übersetzung Shakespeares unternehme, so konnte ich es nicht über mich erhalten die vorhandne prosaische zu tadeln: die Vergleichung wird es jedem Leser leicht machen sie gehörig zu würdigen.“ (Brief August Wilhelm Schlegels vom 23. April 1796 an Friedrich Schiller; Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 36 I, S. 190). Vgl. die auf Eschenburg gemünzten Xenien Beyspielsammlung und Hercules. In: Schillers Werke 1943ff. (Anm. 6), Bd. 1, S. 326 und 357; Bd. 2 II A, S. 505 und 593. Zur Ablehnung Eschenburgs von Goethe und Schiller vgl. auch Claudia Olk: „die angenehmsten, lehrreichsten Geschäfte und Erholungen meines Lebens“. J.J. Eschenburg und der deutsche Shakespeare. In: „Shakespeare, so wie er ist“. Wielands Übersetzung im Kontext ihrer Zeit. Hrsg. von Peter Erwin Kofler. Heidelberg 2021, S. 297–318, hier S. 300. Brief August Wilhelm Schlegels vom 17. November 1796 an Georg Joachim Göschen. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4130. Brief August Wilhelm Schlegels vom 6. Januar 1791 an Christian Gottlob Heyne. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1. Noch zu Beginn des Jahres 1796 betont Schlegel, dass die englische Sprache nur von wenigen Zeitgenossen professionell beherrscht wird: „Wie sehr sich auch die Kenntniß derselben in Deutschland verbreitet hat, so ist sie doch selten genug in dem Grade, der erfodert wird, um von der Menge der Schwierigkeiten nicht beständig im Genusse unterbrochen, oder gar von der Lesung des Dichters abgeschreckt zu werden. Wie Wenige giebt es wohl wieder unter denen, welche ihn im Ganzen [...] ohne Anstoß lesen können“ (Schlegel 1796 [Anm. 15], S. 80f.). „Je ne suis pas assez maître de la langue Anglaise pour l’écrire correctement.“ (Brief August Wilhelm Schlegels vom 2. Februar 1833 an die Royal Society of the United Kingdom. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2949). Vgl. hierzu den Beitrag von Olivia Varwig in diesem Band. Vgl. den Brief Johann Carl Fürchtegott Schlegels vom 8. Januar 1796 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2132; Samuel Johnson: A dictionary of the English language: in which the words are deduced from their originals, explained in their different meanings, and Authorized by the Names of the Writers in whose Works they are found. Abstracted from the folio edition […]. To which is prefixed, A grammar of the English language. The tenth edition. London MDCCXCIV [1794].
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
139
konnte er auf kommentierte Shakespeare-Editionen zurückgreifen: z.B. auf die englische Ausgabe von Edmond Malone (1790) und ab 1797 auch auf die von Karl Franz Christian Wagner (1797–1801).43 Schließlich nutzte er spätestens für seine HamletÜbersetzung auch Eschenburgs Ausgabe,44 die nicht nur erläuternde Fußnoten, sondern auch nachgestellte literaturhistorische Abhandlungen zu jedem der behandelten Stücke enthält. Schlegel dagegen ist von Anfang an keineswegs gesonnen, eine solche ‚gelehrte‘ Übersetzung vorzulegen, wie er Carl August Böttiger Ende 1796 mitteilt: „allein ich gestehe, daß ich mich nicht entschließen kann, meine Übersetzung dadurch [d.h. durch Fußnoten] zu entstellen, weil ich einen abgesagten Haß gegen Noten zu einem schönen Geisteswerke in der Muttersprache habe.“45 Dass Schlegel grundsätzlich bestrebt ist, eine versifizierte Shakespeare-Übersetzung zu bieten, legt er in seinem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters ausführlich dar, den Roger Paulin als sein „Übersetzungsmanifest“ bezeichnet hat.46 Nach einem Exkurs über Wilhelm Meisters Hamlet resümiert Schlegel in literaturgeschichtlicher Hinsicht die translatorischen Leistungen Wielands und Eschenburgs.47 Diese Ausgaben bilden wiederum den Anlass, um über den Anspruch einer Shakespeare-Übersetzung nachzudenken: „Soll und kann Shakespeare nur in Prosa übersetzt werden, so müßte es allerdings bey den bisherigen Bemühungen so ziemlich sein Bewenden haben.“48 Doch Schlegels Ambitionen gehen über diese „bisherigen Bemühungen“ zweifellos hinaus, wie seine nachfolgende 43
44
45
46 47
48
Zu den von Schlegel benutzten Ausgaben vgl. Michael Bernays: Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare. Leipzig 1872, S. 217–223; Peter Gebhardt: A. W. Schlegels ShakespeareÜbersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257), S. 81 f.; Claudia Bamberg: Prolegomena zu einer künftigen Edition der ShakespeareÜbersetzungen von August Wilhelm Schlegel und dem Tieck-Kreis. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 256, 2019, H. 2, S. 421–435, hier S. 429f. Vgl. auch William Shakespeare: The Plays and Poems. 10 Bde. Collated verbatim with the most authentick copies, and revised; with the corrections and illustrations of various commentators […] by Edmond Malone. London 1790; William Shakespeare: The Dramatic Works. 8 Bde. Brunswick 1797–1801 sowie Schlegels eigene Angaben im ersten Band seiner Shakespeare-Übersetzung (Shakespeare/Schlegel 1797 [Anm. 20], S. V). Bekanntlich zeugen die Abkürzungen „E.“ oder „Esch.“ auf dem Hamlet-Manuskript von Schlegels Nutzung der Übersetzung Eschenburgs. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100), S. *413. Brief August Wilhelm Schlegels vom 25. November 1796 an Carl August Böttiger. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4666. Vgl. auch seinen Brief vom Dezember 1838 und Januar 1839 an Georg Andres Reimer, in dem er im Rückblick auf die Relevanz eines erläuternden Kommentars bekennt: „Doch einen solchen Kommentar zu schreiben fühlte ich mich nicht berufen: mir war es einzig darum zu thun, den Dichter in seiner wahren Gestalt aufzustellen“ (Böcking, Bd. 7, S. 286). Paulin 2017 (Anm. 18), S. 73. Vgl. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 78f. Auch Gotthold Ephraim Lessings Rolle als Popularisator Shakespeares wird in diesem Zusammenhang thematisiert. Vgl. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 76. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 81. Zur vorangehenden Diskussion im deutschen Raum über die Übersetzbarkeit Shakespeares vgl. Beatrice Berselli: Zur Übersetzungstheorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts. In: Kofler 2021 (Anm. 38), S. 171–196, hier S. 184–186.
140
Nikolas Immer
rhetorische Frage belegt: „Wenn es nun möglich wäre, ihn [Shakespeare] treu und zugleich poetisch nachzubilden?“49 An dieser harmlos erscheinenden Frage sind drei Aspekte hervorzuheben: Erstens unterschlägt Schlegel an dieser Stelle bewusst, dass Eschenburg die Tragödie Richard III. (1776) bereits in Versform übersetzt hatte.50 Eschenburg ist es dabei gelungen, die „Versform des Originals […] rhythmisch klar [zu] übertr[agen] und deren Energie […] in seine Übersetzung hinüberzuretten“.51 Zweitens ist auch Schlegels Verständnis von einer ‚werktreuen‘ Übersetzung bereits bei Eschenburg vorgeprägt. Denn im vierten Band seines Brittischen Museums für die Deutschen (1779) hatte Eschenburg in einer längeren Besprechung die Normen des Übersetzens diskutiert und in diesem Zuge betont: „Treue ist die erste und vornehmste Pflicht des Uebersetzers“.52 Das heißt konkret, dass einzelne Mängel verzeihlich sind, sofern es dem Übersetzer gelingt, „die zentralen Lehren des Textes in die Zielsprache zu vermitteln“.53 Diese Vorgabe weist schon recht deutlich in Schlegels Richtung, der eine wörtliche Übersetzung gleichermaßen ablehnt und vielmehr den „poetisch-geistigen Gehalt“ der Vorlage möglichst treu nachzugestalten versucht.54 Drittens bildet das Stichwort des ‚Poetischen‘ für Schlegel den Anlass, um sich ausführlicher mit dem dramatischen Dialog zu befassen. Diesen Textabschnitt wird er im Rahmen seiner Kritischen Schriften (1828) daher auch unter dem neuen Titel Ueber den dramatischen Dialog abdrucken.55 In seinem Shakespeare-Aufsatz von 1796 macht Schlegel vor allem geltend, dass es die Versifikation erlaube, den dramatischen Dialog adäquater wiederzugeben und „sich dem Dichter in seiner Gedrungenheit, seinen Auslassungen, seinen kühnen und nachdrücklichen Wendungen und Stellungen weit näher anzuschmiegen.“56 Diese ‚Anschmiegung‘, die durch eine Vers-Übertragung erreicht würde, verbindet Schlegel schließlich mit einem gesteigerten Begriff der ‚Treue‘: „Ich wage zu behaupten, daß eine solche Uebersetzung in gewissem Sinne noch treuer als die treueste prosaische seyn könnte.“57
49 50
51
52
53 54 55 56 57
Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 82. Schlegel teilt Schiller mit, dass er aus Rücksicht auf Eschenburg „Stillschweigen“ darüber gewahrt habe, „daß der Sommernachtstraum und Richard poëtisch übersetzt sind; ich hätte sonst hinzufügen müssen, daß sie keineswegs meinen Forderungen gemäß sind.“ (Brief August Wilhelm Schlegels vom 1. März 1796 an Friedrich Schiller. In: Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 36 I, S. 136). Eine Ausnahme macht Schlegel allerdings: „Nur die Burleske von Pyramus und Thisbe im Sommernachtstraum, die sich noch von Wieland herschreibt, ist unübertrefflich.“ (Schillers Werke 1943ff. [Anm. 6], Bd. 36 I, S. 137). Roder 2013 (Anm. 24), S. 274. Zur Bedeutung von Eschenburgs Übersetzung für Schlegel vgl. Norbert Greiner: Shakespeare und seine Übersetzer. In: Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760–1820. Hrsg. von Horst Glaser und György M. Vajda. Amsterdam 2001, S. 613–632, hier S. 627. [Johann Joachim Eschenburg:] Rez. ‚Isaiah. A new Translation […] by Robert Lowth. London 1778‘. In: Brittisches Museum für die Deutschen 4, 1779, S. 197–228, hier S. 209. Roder 2013 (Anm. 24), S. 272. Bamberg 2019 (Anm. 43), S. 425. Vgl. Schlegel 1828 (Anm. 1), Bd. 1, S. 365–379. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 110. Schlegel 1796 (Anm. 15), S. 110. Zu Schlegels in diesem Zusammenhang entfalteter Übersetzungspoetik vgl. auch Olk 2021 (Anm. 38), S. 303f.
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
141
In einem Zusatz, den Schlegel 1827 anlässlich des Wiederabdrucks seines ShakespeareAufsatzes von 1796 verfasst hat, schildert er rückblickend, dass sich sein versifizierter Shakespeare nicht nur gegenüber den vorliegenden Übersetzungen, sondern auch gegenüber der am Ende des 18. Jahrhunderts noch bestehenden Prädominanz der Prosastücke durchsetzen musste.58 Doch gar so schwer, wie Schlegel es andeutet, hatte es seine Übersetzung keineswegs.59 Nach dem Erscheinen des ersten Teils der Schlegelschen Shakespeare-Übersetzung greift der Altphilologe Friedrich Eberhard Rambach die Wortwahl Schlegels auf und schreibt am 5. August 1797 im Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten: „Mit besonderer Kunst schmiegt sich der Uebersetzer an die kleinste Sonderbarkeit seines Originals, stellt die eigenthümliche Sprache jedes Characters […] in Versen und Prosa immer wechselnd dar.“60 Mit seiner letzten Aussage bezieht sich Rambach auf den Wechsel von Versund Prosapartien, der schon in Shakespeares Tragedy of Romeo and Juliet vorgegeben ist. In der Allgemeinen Literatur-Zeitung erscheint knapp ein Vierteljahr später eine weitaus umfassendere Rezension von Christian Gottfried Schütz.61 Nach einem Verweis auf die Übersetzungen von Wieland und Eschenburg deutet Schütz sogleich an, dass mit Schlegels Übersetzung eine „höhere Stufe der Vollendung“ erklommen worden sei.62 Zur Begründung bietet er einen detaillierten Übersetzungsvergleich, der wiederholt zu Ungunsten von Eschenburg ausfällt. Darüber hinaus merkt er an, als er auf den zweiten Aufzug von A Midsommer nights dreame eingeht: Wir besitzen von dieser Stelle eine Abschrift der Bürgerschen Uebersetzung, der vor ungefähr acht Jahren mit Hn. Schlegel gemeinschaftlich an einer Nachbildung des Sommernachtstraums arbeitete, die wir hier unsern Lesern zur Vergleichung mittheilen.63
58 59
60
61
62 63
Vgl. Schlegel 1828 (Anm. 1), Bd. 1, S. 380–386. Zur euphorischen Aufnahme der Übersetzung vgl. Paulin 2017 (Anm. 18), S. 75. Gleichwohl gibt es aber auch kritische Stellungnahmen wie etwa die von Wieland oder Bürger. Vgl. Stefan Knödler: Shakespeare in Wielands Korrespondenz. In: Kofler 2021 (Anm. 38), S. 273–296, hier S. 282f.; Kinzel 2021 (Anm. 24), S. 31. [Friedrich Eberhard Rambach:] Rez. ‚Shakespeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1797‘. In: Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten (5. August 1797), Nr. 124, S. 1120f., hier S. 1121. Kurz darauf schreibt Friedrich Schlegel am 26. August 1797 an August Wilhelm Schlegel: „Drollig ists, daß die Rec.[ension] des Shak[espeare] in dem Hamb.[urger] Corr.[espondenten] von Rambach verfaßt ist.“ (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3597). Vgl. [Christian Gottfried Schütz:] Rez. ‚Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1797‘. In: Allgemeine Literatur-Zeitung (1. November 1797), Nr. 347 und 348, Sp. 273–282. Anfang November 1797 schreibt Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel: „Die Rec[ension] des Sh[akespeare] [in der Allgemeinen Literatur-Zeitung] ist ja recht vernünftig ausgefallen.“ (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3522). Schütz 1797 (Anm. 61), Sp. 273. Schütz 1797 (Anm. 61), Sp. 278.
142
Nikolas Immer
Michael Bernays und Frank Jolles zufolge soll es Schlegel selbst gewesen sein, der diese Abschrift an Schütz weitergeleitet habe.64 Schütz seinerseits nutzt den Vergleich mit der Übersetzung Bürgers, um hervorzuheben, dass Schlegel „mit größerer Treue“ gearbeitet habe, „ohne durch diesen Zwang an Schönheit einzubüßen“.65 Am Ende seiner Besprechung legt Schütz das Fehlen jeglichen Kommentars in der Neuübersetzung auf die denkbar gutwilligste Weise für Schlegel aus: Einen Commentar hat Hr. S. nicht geben wollen, nicht einmal irgendwo eine erklärende Note beygefügt. Wenn dies einerseits beweiset, wie viel er auf die innere Klarheit und Richtigkeit seiner Uebersetzung rechnen konnte, so scheint er auch dabey auf den fernern Gebrauch der Eschenburgischen Uebersetzung gerechnet zu haben, welche jetzt zum zweytenmale gedruckt wird; ein Zug edler Denkart, welche die Arbeit eines ruhmwürdigen Vorgängers, indem man sich bewusst ist sie übertroffen zu haben, darum nicht für unbrauchbar erklären will.66
Unabhängig von aller berechtigten Würdigung, die Schütz in seiner Rezension vorbringt, grenzt seine Unterstellung, Schlegel habe bewusst auf einen Kommentar und Fußnoten verzichtet, um Eschenburgs Shakespeare-Ausgabe nicht entbehrlich zu machen, fast schon an eine Verdrehung der Tatsachen. Auch Novalis fällt auf, dass der Rezensent ein recht „gutmeynender Mensch“ sei.67 Diese Gutwilligkeit dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass Schütz ‚seinen‘ höchst produktiven Kritiker Schlegel um keinen Preis verlieren wollte, der bis dahin schon mehr als 70 Rezensionen für die Allgemeine Literatur-Zeitung geliefert hatte.68 Vor allem Schlegels Briefe an Eschenburg belegen in diesem Zusammenhang, dass es jenem mit seiner Übersetzung darum geht, „Eschenburg zu übertreffen und konkurrenzunfähig zu machen“.69 Und
64 65 66 67
68
69
Vgl. Bernays 1872 (Anm. 43), S. 53; Jolles 1967 (Anm. 17), S. 29. Schütz 1797 (Anm. 61), Sp. 279. Schütz 1797 (Anm. 61), Sp. 282. Brief von Novalis vom 30. November 1797 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4161. Vgl. Schlegels eigene Aufstellung seiner in der Allgemeinen Literatur-Zeitung publizierten Rezensionen; August Wilhelm Schlegel: Vollständige[s] Verzeichniß meiner zur Allg. Lit. Zeit. beygetragenen Rezensionen. In: Athenaeum 3, 1800, Stück 1, o.P. Zu dieser Liste vgl. auch Cornelia Ilbrig: Stufen der Besucheraktivierung – Ein Ausstellungsentwurf zur frühromantischen Programmzeitschrift Athenaeum. In: Transitzonen zwischen Literatur und Museum. Hrsg. von Matteo Anastasio und Jan Rhein. Berlin/Boston 2021, S. 65–92, hier S. 75–77. Paulin 2017 (Anm. 18), S. 73f. Es wundert daher nicht, dass Eschenburg, als ihm Schlegel den ersten Band seiner Übersetzung am 25. Mai 1797 übersendet, mit einer „gewisse[n] Verstimmung“ (Olk 2021 [Anm. 38], S. 303) reagiert. Diese Haltung kommt in den Briefen zum Ausdruck, die Eschenburg 1797 und 1798 mit Schlegel wechselt und die zuerst von Michael Bernays ediert worden sind. Vgl. Bernays 1872 (Anm. 43), S. 255–260. Zur Bewertung von Eschenburgs Position in dieser Korrespondenz vgl. schon Achim Hölter: August Wilhelm Schlegels Göttinger Mentoren. In: Mix/Strobel 2010 (Anm. 7), S. 13–29, hier S. 24. Eschenburg dürfte bereits Ende 1796 erfahren haben, dass die Shakespeare-Beiträge in den Horen von Schlegel stammen, da am Ende eines jeden Jahrgangs die Verfasserschaft der Beiträge publik gemacht wurde.
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
143
ebenso hatte der Abdruck zahlreicher Auszüge aus der neuen Übersetzung die literaturpolitische Funktion, die Marktstellung von Schlegels Shakespeare-Ausgabe frühzeitig zu festigen – z.B. gegenüber Ludwig Tiecks bereits 1796 publizierter Bearbeitung von The Tempest.70 Eschenburg wiederum ist über die Rezension von Schütz nicht sonderlich erbaut und teilt diesem am 24. November 1797 mit: „Ich dächte doch, das Lob in dieser Beurtheilung […] hätte etwas weniger auf meine Kosten ertheilt werden können.“71 Im Folgesatz spricht Eschenburg zudem von „einseitige[n] und gehässige[n] Parallelen“ sowie von „schiefe[n] und schielende[n] Komplimente[n]“.72 Wie schon Fritz Meyen dargelegt hat, erstaunt es daher kaum, dass Eschenburg, als er 1806 eine Neuauflage seiner Schrift Ueber W. Shakspeare (1787) herausbringt, im Kapitel über die „Deutsche[n] Uebersetzungen“ Schlegels Übertragung mit keiner Silbe erwähnt.73 Im Unterschied zur Rezension von Schütz fallen die nächstfolgenden Besprechungen nicht uneingeschränkt positiv aus. Während in der Oberdeutschen allgemeinen Litteraturzeitung missbilligend auf das Fehlen von Erläuterungen hingewiesen wird, meint der Kritiker der Neuen Allgemeinen deutschen Bibliothek, dass er nicht entscheiden könne, ob der Übersetzung Eschenburgs oder der Schlegels der Vorzug zu geben 70
71
72
73
Vgl. William Shakespeare: Der Sturm. Ein Schauspiel […] für das Theater bearbeitet von Ludwig Tieck. Nebst einer Abhandlung über Shakspears Behandlung des Wunderbaren. Berlin, Leipzig 1796. In seinem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters verweist Schlegel bereits indirekt auf Tieck, wenn er von „einem Verehrer Shakespeare’s“ (Schlegel 1796 [Anm. 15], S. 112) spricht. Vgl. Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48, hier S. 34f. An gleicher Stelle schreibt Schlegel aber im Anschluss an seine zuvor formulierten Forderungen an eine vollendete Übersetzung: „allein ich möchte einem Verehrer Shakespeare’s, der, wie ich weiß, es mit einigen Stücken versucht hat, keinen sehr willkommenen Dienst thun, indem ich durch den aufgestellten Begriff einer Vollendung, die vielleicht gar nicht erreicht werden kann, seine Arbeit schon im Voraus unter ihren wahren Werth herabsetze.“ (Schlegel 1796 [Anm. 15], S. 112) Entgegen seiner Beteuerung scheint aber Schlegel genau darauf abzuzielen, Tiecks Übersetzung ‚im Voraus herabzusetzen‘, damit sie seiner eigenen keine Konkurrenz machen kann. Ein möglicher Reflex auf diese Rivalität mag noch in Tiecks Briefen über W. Shakespeare (1800) gesehen werden, die im ersten Band seines Poetischen Journals erscheinen. Darin verteidigt der fiktive Briefschreiber Schlegels Übersetzung zwar emphatisch, jedoch reagiert er damit auf die zuvor formulierte Kritik seines Korrespondenzpartners, mit der die Passage eingeleitet wird: „Daß dir Schlegels neue Uebersetzung des Shakspeare nicht ganz zusagen will, ist mir unerwartet“ (Ludwig Tieck: Briefe über W. Shakspeare. In: Poetisches Journal 1, 1800, Stück 1, S. 18–80, hier S. 34). Brief Johann Joachim Eschenburgs vom 24. November 1797 an Christian Gottfried Schütz. In: Schütz 1834/35 (Anm. 30), Bd. 2, S. 85. Schütz 1834/35 (Anm. 30), Bd. 2, S. 85. Unabhängig von dieser Kränkung hat schon Bernays am Beispiel von A Midsummer nightʼs dreame nachgewiesen, dass Eschenburg bei der Neuausgabe seiner Übersetzung wiederum von Schlegel profitiert hat. Vgl. Bernays 1872 (Anm. 43), S. 44, Anm. 46. Vgl. Joh.[ann] Joach.[im] Eschenburg: Ueber W. Shakspeare. Neue Auflage. Zürich 1806, S. 497–523; Fritz Meyen: Johann Joachim Eschenburg 1743–1820, Professor am Collegium Carolinum zu Braunschweig. Kurzer Abriß seines Lebens und Schaffens nebst Bibliographie. Braunschweig 1957, S. 49; Hölter 2010 (Anm. 69), S. 24f.
144
Nikolas Immer
sei.74 Eine der ausführlichsten Besprechungen erscheint schließlich in der Belletristischen Zeitung, in der ein anonymer Kritiker sich dem fünften Band von Schlegels Übersetzung (1799) widmet.75 Während der Rezensent Schlegel zunächst attestiert, Shakespeare nachempfinden zu können und in dieser Nachempfindung selbst ein Dichter zu sein, kommt er im Rahmen seiner Einzelkritik auf jene Stellen zu sprechen, die seiner Ansicht nach „ganz verfehlt oder doch sehr entstellt“ seien.76 An einem Beispiel demonstriert er zudem, dass Eschenburg vermeintlich korrekter übersetzt habe, woraus er den schwerwiegenden Vorwurf ableitet, „daß Hr. Schl.[egel] […] nicht einmal die Arbeiten seiner Vorgänger überall verglichen und benutzt hat.“77 Dieser Fundamentalkritik begegnet Schlegel wiederum mit einer Gegenrezension, die im letzten Stück des Athenaeum erscheint.78 Neben einer Reihe kleinerer Entgegensetzungen besteht Schlegels eigentlicher Vorwurf, den er dem anonymen Rezensenten macht, in „philologischer Unwissenheit“.79 Denn nur weil dieser eine unzulängliche, in ihrer Textgestalt längst überholte Shakespeare-Ausgabe verwendet habe, sei es ihm überhaupt möglich gewesen, jene vermeintlichen Abweichungen vom Original zu entdecken. Im Gegenzug verlangt Schlegel von dem Rezensenten, sich eingehend mit der „kritische[n] Geschichte des Textes“ zu befassen.80 Diese Forderung verbindet er schließlich mit einer recht drastischen Drohung: „Unternimmt der Rec. aber bey gleicher Unwissenheit wieder den Kritiker zu spielen, so verdient er billig, daß ihm […] die belletristischen Ohren ohne Umstände auf den Tisch genagelt werden.“81
74
75
76 77 78
79 80 81
Vgl. Anonym: Rez. ‚Shakespear’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster bis dritter Theil. Berlin 1797/98‘. In: Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung, 23. August 1799, S. 378–382, hier S. 380; Anonym: Rez. ‚Shakespeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Dritter bis Fünfter Theil. Berlin 1799; Hamlet. Aus dem dritten Bande besonders abgedruckt: William Shakespeare’s Schauspiele. Neue ganz umgearbeitete Ausgabe, von J.J. Eschenburg. Bd. 3. Zürich 1799‘. In: Neue allgemeine deutsche Bibliothek 35, 1800, Stück 1, S. 47–52, hier S. 48. Vgl. Anonym: Rez. ‚Shakespeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Fünfter Theil. Berlin 1799‘. In: Belletristische Zeitung, 15. März 1800, Stück 11, S. 81–86; 22. März 1800, Stück 12, S. 89–95. Knapp zwei Monate später erscheint in der Belletristischen Zeitung außerdem eine Rezension der Einzelausgabe des Hamlet (1800), die ebenfalls kritisch beurteilt wird. Vgl. [William] Shakespeare: Hamlet. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1800; Anonym: Rez. ‚Shakspeare’s Hamlet. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1800‘. In: Belletristische Zeitung, 3. Mai 1800, Stück 18, S. 142–144, hier S. 154f. Anonym 1800 (Anm. 75), S. 91. Anonym 1800 (Anm. 75), S. 93. August Wilhelm Schlegel: Belletristische Zeitung. In: Athenaeum 3, 1800, Stück 2, S. 327–334 [Böcking, Bd. 12, S. 133–140, hier unter dem Titel: „Abfertigung eines unwißenden Recensenten der schlegelschen Uebersetzung des Shakspeare“]. Schlegel 1800 (Anm. 78), S. 330. Schlegel 1800 (Anm. 78), S. 333. Schlegel 1800 (Anm. 78), S. 333f.
Eine „höhere Stufe der Vollendung“?
145
3. Literaturpolitik. Zwischen Schütz und Schelling Bevor Schlegel im Athenaeum auf die Kritik der Belletristischen Zeitung reagiert, bezieht er sich in seiner Stellungnahme auf die emphatische Rezension von Schütz, die er allerdings überaus deutlich zurückweist. Ihre Ursache hat diese Zurückweisung in den Turbulenzen der Jahre 1799 und 1800, bei denen es nicht zuletzt um Schlegels Shakespeare-Übersetzung geht. Schon im April 1799 moniert er gegenüber Gottlieb Hufeland, dem Mitherausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung, dass „die neue Ausgabe des Eschenburgischen [Shakespeare], unmittelbar nach der Erscheinung, angepriesen [worden ist], und zwar so als ob meine Übersetzung gar nicht vorhanden wäre, so daß jenes dadurch so gut wie zurückgenommen ist.“82 In seinem Antwortbrief deutet Hufeland nicht nur an, dass Schütz der Verfasser dieser Rezension ist, sondern auch, dass sich Eschenburg einen weiteren Übersetzungsvergleich ausdrücklich verbeten habe.83 Schlegel seinerseits, der bereits wegen der wachsenden Ablehnung gekränkt ist, die die Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung gegenüber dem Athenaeum erkennen lassen,84 wertet dieses Verhalten als einen Affront. Am 30. Oktober 1799 erklärt er öffentlich seinen „Abschied“ von dem Publikationsorgan – nicht ohne maliziös darauf hinzuweisen, dass er sich wegen der Nachbarschaft so mancher darin abgedruckter Rezensionen „schon oft zu schämen hatte“.85 Als Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zu Beginn des Jahres 1800 seine Streitschrift mit dem harmlosen Titel Ueber die Jenaische Allgemeine Literaturzeitung veröffentlicht, sieht sich Schütz genötigt, ausführlich auf diesen Angriff zu reagieren.86 Weil Schelling in seiner Schrift auch auf die Rolle Schlegels als Rezensent eingeht, entscheidet sich Schütz, einige Briefe aus seiner Privatkorrespondenz im Rahmen seiner Stellungnahme abzudrucken. Diese Briefe beziehen sich unter anderem darauf, dass Schütz im Herbst 1799 – wie Caroline Schlegel berichtet – „einen Prolog im Geschmack des Kotzebueschen Stücks“ Der hyperboräische Esel (1799) bei sich hatte aufführen lassen.87 In diesem Prolog sei ein aufgeblasener junger Gelehrter aufgetreten, der in einer Schrift behauptet hätte: „Schlegel habe den Shak[e]speare nur mittelmäßig 82
83
84 85
86
87
Brief August Wilhelm Schlegels vom April 1799 an Gottlieb Hufeland. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3948. Vgl. den Brief Gottlieb Hufelands vom 2. Mai 1799 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/467. Vgl. Cornelia Ilbrig: Jena. In: Bamberg/Ilbrig 2017 (Anm. 3), S. 50–64, hier S. 55f. August Wilhelm Schlegel: Abschied von der Allg. Lit. Zeitung [30. Oktober 1799]. In: Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung, 13. November 1799, Nr. 145, Sp. 1179 [Böcking, Bd. 11, S. 427]. Vgl. [Friedrich Wilhelm Joseph] Schelling: Ueber die Jenaische Allgemeine Literaturzeitung. Erläuterungen. (Aus dem ersten Heft der Zeitschrift für spekulative Physik besonders abgedruckt.) Jena, Leipzig 1800; Christian Gottfried Schütz: Vertheidigung gegen Hn. Prof. Schellings sehr unlautere Erläuterungen über die A.L.Z. In: Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung, 30. April 1800, Nr. 57, Sp. 465–480; 10. Mai 1800, Nr. 62, Sp. 513–520. Brief Caroline Schlegels vom 22. November 1799 an Ludwig Ferdinand Huber. In: Schlegel-Schelling 1913 (Anm. 20), Bd. 1, S. 578. Vgl. Paulin 2017 (Anm. 18), S. 100. Zur Aufführung von Kotzebues Stück vgl. Die ästhetische Prügeley. Streitschriften der antiromantischen Bewegung. Hrsg. von Rainer Schmitz. Göttingen 1992, S. 318.
146
Nikolas Immer
übersetzt.“88 Ohne den satirischen Kontext weiter zu berücksichtigen, reagiert Schlegel in seinem Antwortbrief äußerst verstimmt und wendet den Vorwurf der Mittelmäßigkeit implizit auf Eschenburgs Übersetzung.89 Doch damit kann sich Schütz längst nicht mehr einverstanden erklären: In seiner nachgestellten Erläuterung kritisiert er Schlegels „Undankbarkeit gegen einen so verdienstvollen Vorgänger […], ohne dessen Arbeit er gar nicht im Stande war, seine Übersetzung zu liefern“.90 Das eigentlich Pikante an der Stellungnahme von Schütz ist, dass er nicht nur einige Briefe aus der privaten Korrespondenz mit Schlegel publiziert, sondern überdies ein spezifisches Krankheitsbild bei ihm diagnostiziert: „Nach und nach glaubte ich immer mehr zu bemerken, […] daß Hr. Prof. Schlegel mit einer Krankheit behaftet sey, die man einen Wurm nennt.“91 Zur Erklärung zitiert Schütz die Definition aus Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798): Was man einen Wurm nennt, ist mehrentheils ein an Wahnsinn gränzender Hochmuth eines Menschen, dessen Ansinnen, daß Andere sich selbst in Vergleichung mit ihm verachten sollen, seiner eignen Absicht (wie die eines Verrückten) gerade zuwider ist […].92
Angesichts dieses rufschädigenden Angriffs versucht Schlegel, sich juristisch zur Wehr zu setzen, während Schelling sogar die drastische Hoffnung äußert, Schütz zwischen sich und Schlegel „vollends klein u. todt zu reiben“.93 Noch 28 Jahre später wird Schlegel im Vorwort zu seinen Kritischen Schriften auf die „Cabalen“ zu sprechen kommen, welche die Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung gegen ihn geschmiedet hatten. Weitaus wichtiger als diese Abwertung durch Schütz dürfte ihm aber die Aufwertung durch einen „Engländer von sehr gebildetem Geschmack“ gewesen sein, dessen Urteil er an gleicher Stelle zitiert: Denn dieser hatte ihn zu einem „Ultra-Shakespearisten“ erklärt.94
88
89
90 91 92
93
94
Schütz 1800 (Anm. 86), Sp. 515. Schütz gibt hier seinen Brief vom 20. Oktober 1799 an August Wilhelm Schlegel wieder. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3953. Schütz 1800 (Anm. 86), Sp. 516. Schütz gibt hier August Wilhelm Schlegels Antwortbrief vom 21. Oktober 1799 wieder. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3955. Schütz 1800 (Anm. 86), Sp. 517. Schütz 1800 (Anm. 86), Sp. 477. Schütz 1800 (Anm. 86), Sp. 477. Vgl. Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Königsberg 1798, S. 125f. Brief Friedrich Wilhelm Joseph Schellings vom 6. Juli 1800 an August Wilhelm Schlegel. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3846. Zum juristischen Nachspiel, in das sogar Goethe schlichtend eingreifen muss, vgl. insbesondere August Wilhelm Schlegels zwischen dem 1. und 23. Mai 1800 verfassten Brief an Christoph Gottlob Heinrich, den damaligen Prorektor der Universität Jena. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2618. Schlegel 1828 (Anm. 1), Bd. 1, S. VII.
Stefan Knödler
„Glauben Sie mir, ich habe viel über diese Dinge nachgedacht.“ August Wilhelm Schlegel und die Bearbeitung und Kommentierung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
Man kann die Geschichte der Shakespeare-Übersetzung, die wir heute ‚SchlegelTieck‘ nennen und die man den großen Texten der deutschen Literatur als eines der wenigen Beispiele einer klassischen gewordenen Übersetzung an die Seite stellt, anhand der Briefwechsel der beiden Namensgeber mit dem Verleger Georg Andreas Reimer als die Geschichte zweier alternder, seit langem in Zuneigung und Konkurrenz verbundener Literaten erzählen, die grundsätzlich zu viele unterschiedliche Projekte begonnen und sich zu viel Arbeit zugemutet haben, und gerade zu dieser, zu der sie sich auch bereit erklärt hatten, keine rechte Lust oder Zeit aufbringen konnten. – Der eine, August Wilhelm Schlegel, zögerte das Zugesagte zunächst hinaus, erledigte es halbherzig und nur zum kleinsten Teil, um es dann ganz sein zu lassen; der andere, Ludwig Tieck, machte nach seiner Zusage lange schlicht gar nichts, delegierte die Arbeit schließlich an andere und beschränkte seinen Anteil weitgehend auf die Endredaktion sowie die Kommentierung der Stücke, die das erste und einzige sein sollte, was die Rezeptionsgeschichte am ‚Schlegel-Tieck‘ preisgegeben hat. Auf der anderen Seite dieser Geschichte stand der Verleger Reimer, der zu Recht geglaubt hatte, mit Tieck als Vollender der von Schlegel begonnenen Übersetzung einen gleichwertigen Ersatz gefunden und so zwei große Namen der bereits zu Ende gehenden romantischen Epoche für sein Projekt gewonnen zu haben, nun aber miterleben musste, wie sich beide über Jahre hinweg seinen zunehmend dringlicher und flehender werdenden Bitten widersetzten und die Fertigstellung der Ausgabe und ihrer Nachfolger um Jahre verzögerten. Reimer, der jüngste der drei Beteiligten, starb als erster. Es ist tatsächlich verwunderlich, dass bei der Halbherzigkeit und Wurstigkeit, die die beiden Namensgeber an den Tag gelegt haben, der ‚Schlegel-Tieck‘ den klassischen Status erreichen konnte, den er heute hat. Fast nichts, was Schlegel und Tieck nach 1819 daran gearbeitet haben, hat dazu beigetragen, denn der Ruhm des ‚SchlegelTieck‘ bleibt das Verdienst des jungen Schlegel, seiner Frau Caroline sowie Tiecks zunächst verborgenen Mitstreitern, Dorothea Tieck und Wolf Heinrich von Baudissin – und natürlich das Verdienst Georg Andreas Reimers, ohne dessen unermüdliches Insistieren es diese Ausgabe nicht gegeben hätte. Zur Erinnerung: Bereits am Ende seines 1796 in Schillers Zeitschrift Die Horen erschienenen Aufsatzes Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm
https://doi.org/10.1515/9783111017419-011
148
Stefan Knödler
Meisters entwarf Schlegel, ohne noch dabei seinen eigenen Namen ins Spiel zu bringen, das Programm einer „poetische[n] Uebersetzung“1 der Dramen Shakespeares, die so getreu wie möglich die Form wie den poetischen Gehalt von Shakespeares Dramen wiedergeben sollte. Bereits im Folgejahr erschien der erste Band seiner natürlich diesem Programm entsprechenden eigenen Übersetzung, dem bis 1801 acht Bände mit 16 Stücken folgten. Ein Rechtsstreit mit seinem Verleger Unger unterbrach dann jedoch deren Erscheinen und erst im Zuge der Drucklegung seiner in Wien gehaltenen Vorlesungen Über dramatische Kunst und Litteratur und der Überarbeitung der Passagen über Shakespeares Dramen darin, kam 1810 noch ein neunter Band mit König Richard der dritte heraus, einem Stück, dessen Übertragung Schlegel wohl schon vor der Unterbrechung der Ausgabe weitgehend fertiggestellt hatte.2 Fortan weigerte Schlegel sich, die Arbeit an seiner Shakespeare-Übersetzung wieder aufzunehmen – sehr zum Kummer ihres neuen Verlegers Georg Andreas Reimer, der sie nach dem Tod von Ungers Witwe übernommen hatte.3 Reimer musste ein großes Interesse an der Fertigstellung der Ausgabe haben, denn die Konkurrenz wartete nicht: Bereits waren Raubdrucke erschienen, die Schlegels Übersetzungen einfach mit den älteren von Wieland und Eschenburg komplettierten, auch hatten andere, etwa Johann Heinrich Voß und seine Söhne, damit begonnen, die von Schlegel noch nicht übertragenen Stücke zu übersetzen.4 Im November 1819 schrieb Schlegel – seit einem Jahr Professor für Literatur und Kunstgeschichte an der neugegründeten Universität Bonn – jedoch an Reimer, „daß ich für jetzt keine Möglichkeit sehe, meine Übersetzung der dramatischen Werke Shakspeareʼs zu Ende zu bringen“.5 Er sei daher froh, dass sein „vortrefflicher Freund, Ludwig Tieck“, bereit sei, die von ihm noch nicht übersetzten Stücke zu übernehmen. Aber zum Unglück Reimers lieferte Tieck nichts; Schlegel, der seinen Freund kannte, hatte es geahnt. Fünf Jahre später schrieb ihm Reimer: „Ihre Vorhersagung wegen Tieck hat sich leider nur zu sehr bestättigt, und unerachtet in der That zwei Stücke: Macbeth und
1
2
3 4 5
August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112, hier S. 109; vgl. zur Rechtfertigung seines Entwurfs ebd., S. 109–112. Vgl. Christine Roger: La réception de Shakespeare en Allemagne de 1815 à 1850. Propagation et assimilation de la référence étrangère. Bern 2008; Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48. Vgl. Knödler 2015 (Anm. 2), S. 35f. Vgl. Knödler 2015 (Anm. 2), S. 38f. August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 24. November 1819. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/646 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 16.10.2022 gesehen).
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
149
der Liebe Mühe ist umsonst fast fertig seit Jahren bei ihm liegen, ist er nicht dahin zu bewegen, diesen die letzte Feile zu geben.“6 Zunächst erschienen daher nicht die Bände mit den neuen Übersetzungen Tiecks, sondern die mit Schlegels alten, übrigens in einer grundsätzlich neuen Reihung, beginnend mit den history plays, und zum Teil mit neuen Titeln: 1825 der erste Band mit König Johann, König Richard der Zweyte und den beiden Teilen von König Heinrich der Vierte; 1826 der zweite Band mit König Heinrich der Fünfte und den drei Teilen von König Heinrich der Sechste; ebenfalls 1826 der vierte Band mit Heilige-DreyKönigs-Abend, oder Was ihr wollt (bei Schlegel Was ihr wollt!), So wie es euch gefällt (bei Schlegel Wie es euch gefällt!), Der Kaufmann von Venedig und Der Sturm; 1830, vier Jahre später, schließlich der dritte Band mit König Richard der Dritte, König Heinrich der Achte, Ein Sommernachtstraum und Viel Lärmen um Nichts, der nun – nämlich mit König Heinrich der Achte und Viel Lärmen um Nichts – erstmals zwei nicht von Schlegel übersetzte Stücke enthielt; Coriolanus, Antonius und Cleopatra und Maaß für Maaß folgten im fünften Band 1831. Die bis 1833 erschienenen insgesamt neun Bände dieser Ausgabe tragen folgenden Titel: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von A. W. von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck.7
Das ist interessant, weil Schlegel hier – übrigens auf Tiecks Betreiben hin – ausdrücklich den Primat der Übersetzer zugesprochen bekommt. Das „ergänzt“ ist dabei ambivalent: Es kann meinen, dass Tieck – die tatsächlichen Übersetzer werden nicht genannt, auch weil Tieck ja zunächst vorhatte, die Stücke selbst zu übersetzen – die restlichen, von Schlegel noch nicht übersetzten Dramen ergänzt hat, oder aber auch, dass er von Schlegel nicht übersetzte Passagen in den einzelnen Stücken ergänzt hat. Beides ist der Fall. – Und Tieck hat in den Text von Schlegels Übersetzungen sogar noch gravierender eingegriffen: Bereits vor dem Vertragsabschluss8 mit Schlegel und dem Erscheinen der ersten Bände hatte Reimer Schlegel brieflich mitgeteilt, dass Tieck für die neue Ausgabe „kleine Abänderungen im Ausdruck“ vorgenommen, „auch einige 6
7
8
Georg Andreas Reimer an August Wilhelm Schlegel, 9. August 1824. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2398. Reimer schlägt den Titel Schlegel am 24. Februar 1825 vor (vgl. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/682); dabei ist es geblieben. Der auf den 18. August 1825 datierte Verlagsvertrag ist abgedruckt in: Briefe von und an August Wilhelm Schlegel. Gesammelt und erläutert durch Josef Körner, Bd. 2: Die Erläuterungen. Zürich, Leipzig, Wien 1930, S. 187–189.
150
Stefan Knödler
6füßige Verse in das rechte Maaß gebracht; auch an einigen Stellen, wo die Uebersetzung mehr Verse enthielt, wie das Original, diese auf die ursprüngliche Zahl zurückgeführt“ habe.9 Schlegel verbat sich solche Eingriffe in seinen Text, ohne sie noch gesehen zu haben, in einem ungewöhnlich scharfen Brief, der von Reimer eine Ausgabe verlangt, in der seine Arbeit und die Tiecks (der ja noch gar keine eigene Übersetzung geliefert hatte) klar voneinander getrennt werden, und der in der Drohung gipfelt, Reimer zu verklagen, wenn die Ausgabe mit Tiecks Änderungen gedruckt werden sollte.10 Reimers Bemühen, den ‚Schlegel-Tieck‘ als ein geschlossenes Werk zu realisieren, war damit eine klare Absage erteilt. Reimer versprach Schlegel nun, „daß alles dasjenige was nach genommener Einsicht Ihnen nicht genügen sollte, umgedruckt werden soll, und in der alten oder der von Ihnen bezeichneten Gestalt hergestellt“ werden solle.11 Aber Schlegel fand nicht die Zeit und Lust, diese Arbeit zu unternehmen und Tiecks Eingriffe zu sichten. So formuliert der Verlagsvertrag für die erste Ausgabe des ‚Schlegel-Tieck‘ einen merkwürdigen Kompromiss: Da die von Hrn. L. Tieck mit dem Texte besagter Übersetzungen vorgenommenen Veränderungen aus Mangel an Zeit von Hrn. A. W. von Schlegel nicht vorläufig haben geprüft werden können, so erkennt Hr. Reimer an, daß dessen Einwilligung zu deren Einrückung nur provisorisch für die gegenwärtige Auflage gilt, und daß der ursprüngliche Übersetzer sich das Recht vorbehalten hat, in Zukunft eine Durchsicht oder Umarbeitung der bisher von ihm übersetzten Schauspiele vorzunehmen.12
Tiecks „Vorrede“13 im 1825 erschienenen ersten Band der vom ihm verantworteten Ausgabe versucht mit dieser komplizierten Gemengelage umzugehen: Zum einen lobt Tieck Schlegel als ein Vorbild, als ein „Muster“, das er „nicht erreichen kann“.14 Dennoch habe er sich „hier und da Aenderungen erlaubt“: neue Lesarten verbessert, Druckfehler korrigiert, Mißverständnisse entfernt, „vor welche[n] auch der Gelehrteste nicht
9
10
11
12 13
14
Georg Andreas Reimer an August Wilhelm Schlegel, 24. Februar 1825. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/682. Vgl. August Wilhelm Schlegel: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/683. Auf diesen Brief reagiert, wohl von Reimer angestoßen, auch Ludwig Tieck: Sein Brief an Schlegel vom 26. März 1825 (vgl. Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel. Hrsg. von Edgar Lohner. München 1972, S. 181–183) ist der letzte zwischen den beiden gewechselte, in dem Shakespeare genannt wird; danach wird das schwierige Thema auffällig vermieden. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/684 (im Original ist die Stelle unterstrichen). Briefe von und an August Wilhelm Schlegel (Anm. 8), Bd. 2, S. 188f. (§ 8). L. T. [Ludwig Tieck]: Vorrede. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Erster Theil. Berlin 1825, S. III–VIII. Tieck 1825 (Anm. 13), S. III; vgl. auch ebd., S. IV: „Wenn wir Deutschen unter allen Nationen am meisten und mit dem größten Fleiße übersetzt haben, wenn wir Vers, Ton, Sinn, Wortspiel und Zufälligkeit, ja einen gewissen geistigen Hauch, der sich kaum bezeichnen läßt, haben wiedergeben und nachahmen wollen, so steht als ächter Künstler W. v. Schlegel, nach meiner Einsicht, unter allen deutschen Virtuosen oder gründlichen Arbeitern oben an […].“
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
151
immer gesichert ist“;15 auch habe er seine Übersetzung durch die Erforschung der „Alterthümer der Engländer“ auf eine neue Grundlage gestellt.16 Als Schlegel die beiden ersten Bände bekam,17 zeigte er sich mit „Tiecks Erklärung in der Vorrede […] mehr als zufrieden“, gab aber gleichzeitig zu, „[d]ie Correctheit des Drucks“ und „die neuen Lesearten“ noch nicht mit „den alten“ verglichen zu haben.18 Die Geschichte des ‚Schlegel-Tieck‘ ist, was die beiden Namensgeber angeht, eine Geschichte der Arbeitsverweigerung. Zwischen 1826 und 1830 erschienen keine weiteren Bände. Weil Tieck sich nicht rührte, überlegte Reimer sogar, mit ihm zu brechen19 und ihn durch Schlegels Bonner Kollegen Friedrich Christian Diez zu ersetzen.20 Gleichzeitig widerstand Schlegel weiterhin allen Versuchen Reimers, ihn dazu zu bringen, die Ausgabe selbst fortzusetzen. Immerhin ließ er sich zwar nicht zu neuen Übersetzungen, aber doch zu den versprochenen Korrekturen von „Tiecks Correkturen“ in König Johann, König Richard II. und König Heinrich IV. bringen, die er Reimer „aber nur mündlich und im Vertrauen mittheilen“21 wollte – weshalb wir zunächst leider nichts darüber erfahren, uns aber einiges über deren Inhalt denken können. Das war im Frühjahr 1827; Schlegels Korrekturen im König Johann – die von ihm genannten oder erst später durchgeführten – sollten erst 1839, also zwölf Jahre später, umgesetzt werden. Dazwischen bot Tieck mit dem 1830 erschienenen dritten Band der Ausgabe noch einmal Grund zu Schlegels Ärger, denn dieser enthielt zum einen eine „Vorrede“, in der Tieck die Rechtfertigung seiner Eingriffe in Schlegels Text bereits weniger defensiv formulierte, etwa, wenn er davon schreibt, dass „Aenderungen“ in Übersetzungen zwar „Fehler und Mißverständnisse tilgen“ könnten, „aber nicht Colorit, Sprache und das Wesen der Arbeit selbst“, oder wenn es heißt, auch wenn er sie gerade davor noch einmal in Schutz nimmt, dass man „Schlegels Arbeit nicht mehr für unverbesserlich will gelten lassen“.22 Zum andern stehen in diesem dritten Band des ‚Schlegel-Tieck‘ nun Tiecks „Anmerkungen“ zu den von Schlegel übersetzten Stücken der ersten drei 15 16 17
18
19
20
21
22
Tieck 1825 (Anm. 13), S. V. Tieck 1825 (Anm. 13), S. V. Vgl. Georg Andreas Reimer an August Wilhelm Schlegel, 16. Mai 1825. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3022. August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 5. bis 12. Juni 1825. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/689. Vgl. Georg Andreas Reimer an August Wilhelm Schlegel, 30. November 1826: „In der Angelegenheit mit dem Shakspeare geht es leider immer noch nicht besser. Ich habe daher Tieck einen Termin gesetzt bis zu Ostern, und wenn bis dahin nichts Erklekliches geschehen seyn sollte, so habe ich ihm erklärt, daß ich das Verhältniß als abgebrochen betrachte.“ KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version01-22/briefid/3028. Vgl. Georg Andreas Reimer an August Wilhelm Schlegel, 5. Januar 1826. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/696. August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 14. März 1827. In: KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/705. L. Tieck: Vorrede zum dritten Theil. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Dritter Theil. Berlin 1830, S. [III]–VI, hier S. V.
152
Stefan Knödler
Bände.23 Sie sind durchaus eine Enttäuschung: Für zwölf Stücke umfassen sie 19 Seiten. Jeder Abschnitt beginnt mit Angaben zur Datierung, dem folgen dann Erläuterungen einzelner Stellen, oft nur einer, oft auch gar keiner. Manches ist schlicht banal – etwa, wenn es vom ersten Teil von Heinrich der Vierte heißt: „Wenn der zweyte Richard eine rührende Elegie und prophetische Einleitung zu den Bürgerkriegen ist, die später das Land verwüsteten, so sind diese beiden Theile des vierten Heinrich, vorzüglich aber der fünfte, große historische Lustspiele, munter erfreuende Heldengedichte zu nennen.“24 Diesen Eindruck ändern auch die Anmerkungen in den folgenden Bänden nicht, wobei man sagen muss, dass Tiecks Anmerkungen zu den vier Stücken im vierten Band immerhin 21 Seiten umfassen und also wesentlich ausführlicher sind.25 Wie gesagt: Es vergingen zwölf Jahre, bis Schlegel sich wieder mit seinen Shakespeare-Übersetzungen beschäftigt hat. Am 23. November 1839 schickte er Reimer den von ihm – offenbar erneut – „sehr gründlich und mühselig durchgesehen[en] und verbessert[en]“26 König Johann.27 Wenig später folgte ein ausführlicher Brief Schlegels nach, den sein Nachlassverwalter Eduard Böcking für so wichtig hielt, dass er ihn als Schreiben an Herrn Buchhändler Reimer in Berlin. Bonn, im December und Januar 1838 u. 3928 in die von ihm besorgte Werkausgabe aufgenommen hat. Schlegel selbst wird den Text später „mein Manifest, ich meine meinen langen Brief an Sie, über die tragikomische Geschichte meines Shakespeare“29 nennen. Dieses Schreiben enthält implizit und explizit folgende Forderungen an seinen Verleger: 1.
23 24 25
26 27
28
29
30
Die Rückgängigmachung von Tiecks Korrekturen.30 Für den ersten Band hat Schlegel Tiecks Korrekturen selbst überarbeitet – wie, dazu gleich –, für alle an-
Vgl. Shakespeare 1830 (Anm. 22), S. 339–357. Shakespeare 1830 (Anm. 22), S. 342. Vgl. die „Anmerkungen zum vierten Bande“. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Vierter Theil. Berlin 1826, S. [301]–322. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/759. Die anderen Korrekturen folgten erst viel später: Zwar meldete Schlegel am 7. Februar 1839, dass er „in Henry IV, P. 1 mit dem vierten Act beinahe fertig“ sei (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/761), aber erst am 26. Februar 1840 schickte er Reimer seine „längst geschriebenen Anmerkungen zu Richard II (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3832); am 9. August 1841 bat er um das Honorar für die offenbar abgeschlossene „Durchsicht der ersten drei Stücke meines Shakespeare“ KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2854), wobei sich aus den erhaltenen Briefen nicht ergibt, ob dabei beide Teile von König Heinrich der vierte gemeint sind. August Wilhelm Schlegel: Schreiben an Herrn Buchhändler Reimer in Berlin. Bonn, im December und Januar 1838 u. 39. In: Böcking, Bd. 7. Leipzig 1846, S. 281–302. In der Handschrift in Schlegels Nachlass zunächst auf „29–31sten Dec. 38“ datiert; die Überschrift hat Schlegel offenbar später hinzugefügt. August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 30. November 1839. In: KAWS, https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4614; Unterstreichung im Original. Vgl. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 283.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
2.
3.
4.
153
deren seiner Übersetzungen hat der Verlag dann Tiecks Eingriffe nach den Ungerschen Erstausgabe rückgängig gemacht – wie sorgfältig, mag eine künftige kritische Ausgabe zeigen. Den Verzicht auf Tiecks Vorrede in der kommenden Auflage, mit der Schlegel sich ja zunächst einverstanden erklärt hatte, besonders den Passus, wo Tieck, „zwar in sehr mildernden Ausdrücken“, behaupte, „er könne meine Uebersetzung nicht nur verbeßern, sondern auch ‚berichtigen‘, weil er den Sh. sprachlich besser verstehe.“31 Die Vorrede wird in den kommenden Ausgaben nicht mehr abgedruckt. Schlegels Name solle nicht nur auf dem Titelblatt, sondern auch vor jedes der von ihm übersetzten Stücke gesetzt werden.32 Auch das wird in den folgenden Ausgaben umgesetzt. Die Entfernung von Tiecks Anmerkungen zu seinen Stücken. Schlegel schreibt: „Mich dünkt, man durfte von einem Manne wie Tieck etwas weit Bedeutenderes erwarten. Ich finde das Allgemeine unbefriedigend, und das Einzelne großentheils unzweckmäßig.“33 Dabei ist Schlegel sehr für Anmerkungen, denn „[d]er gemeine Leser, der über hundert halb oder gar nicht verstandene Stellen gedankenlos hinweg liest, würde dadurch aus seiner Dumpfheit geweckt“.34 Eine „philologische Kritik“ als „Wortkritik“35 wie Tieck sie betreibe, sei jedoch sinnlos und für das deutsche Publikum, das kaum Englisch verstehe, uninteressant.36 Am Ende wird er polemisch: Tieck erklärt alle bisherigen Sh.s, die seit einem Jahrhundert erschienen sind, für schlecht, und sagt, es sei endlich Zeit, aus der Verderbniß den ächten Text zu sehen. Er behauptet mit Zuversicht, er verstehe die englische Sprache weit beßer als alle jene gelehrten Engländer. Nun, wenn er dieses auf einem öffentlichen Kampfplatze, ich meine, durch eine englisch abgefaßte und in England gedruckte Schrift durchfechten kann, so wünsche ich ihm Glück dazu.37
Dementsprechend werden in der zweiten Ausgabe des ‚Schlegel-Tieck‘ die von Schlegel übersetzten Stücke ohne Anmerkungen gedruckt, die unter Tiecks Namen übersetzten jedoch mit. Schlegels Schreiben an Reimer endet mit einigen „Anmerkungen zu Tiecks Anmerkungen zum deutschen Sh. und zu einigen Stellen des englischen Texts“,38 in dem er einige der Anmerkungen Tiecks als irrtümlich und falsch zurückweist. Sie betreffen vor allem den ersten Band, enthalten in einigen nicht ausformulierten Notizen aber
31 32 33 34 35 36 37 38
Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 284. Vgl. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 284f. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 285. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 286. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 289. Vgl. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 290. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 290f. Vgl. auch Schlegel an Reimer, 7. Februar 1839 (Anm. 27). Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 292–302.
154
Stefan Knödler
auch die Kritik einiger Stellen in Tiecks Bearbeitungen von Schlegels Stücken wie in den neuen Übersetzungen. Sowohl Tiecks Korrekturen als auch Schlegels Korrekturen von Tiecks Korrekturen bzw. seine Neufassung einiger Stellen bei der erneuten Durchsicht zwischen der ersten und zweiten Auflage des ‚Schlegel-Tieck‘ betreffen vor allem das allererste in dieser Ausgabe abgedruckte Stück, König Johann. Zwar ist Hamlet sicherlich das wichtigste, weil bedeutendste Stück Shakespeares, das interessanteste Stück des ‚Schlegel-Tieck‘ ist jedoch König Johann, eben weil es im Verlauf der verschiedenen Ausgaben und Auflagen das mit großem Abstand am stärksten veränderte Stück ist. Dieser Umstand zeigt indes auch den jeweils stark nachlassenden Elan sowohl Tiecks als auch Schlegels bei der Durchsicht der weiteren Stücke nach dem allerersten; keiner von beiden brachte es über sich, die Schlegelsche Übersetzung grundsätzlich und konsequent als ein Ganzes wieder bzw. neu herzustellen. Im Folgenden sollen ein paar exemplarische Beispiele für Tiecks Eingriffe und Schlegels Reaktionen darauf folgen: Sie stammen alle aus König Johann. Was Tiecks Korrekturen angeht, so betreffen sie tatsächlich das von ihm Angekündigte: Herstellung der korrekten Verszahl, wo Schlegel davon abweicht, Korrekturen von tatsächlichen oder scheinbaren Fehlern, metrische Anpassungen. Nichts davon ist wirklich spektakulär, nichts davon ist – sowohl von Tieck als auch dann von Schlegel –, konsequent durchgeführt. Auch betreffen die Änderungen nur rund 10 bis 15 Prozent des Textes.
1. In Schlegels Übersetzung von 1799 wird ein Wortwechsel zwischen König Johann und dem Bastard zu Beginn der zweiten Szene des dritten Aktes wie folgt wiedergegeben: König Johann. Hubert, bewahr den Knaben. – Philipp, auf! Denn meine Mutter wird in unserm Zelt Bestürmt, und ist gefangen, wie ich fürchte. Bastard. Ich habe sie gerettet, gnäd’ger Herr, Sie ist in Sicherheit, befürchte nichts. Doch immer zu, mein Fürst! denn kleine Müh Bringt dieses Werk nun zum beglückten Schluß.39
39
Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. 9 Bde. Berlin 1797–1810. Bd. 5. Berlin 1799, S. 69.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
155
Schlegel braucht sieben Verse gegenüber den sechs im Shakespeare’schen Original,40 weil er den dort auf zwei Sprecher verteilten zweiten Vers nicht halten kann. Tieck stellt in seiner Übersetzung das originale Versverhältnis wieder her: K. Joh. Hubert, bewahr’ den Knaben. – Phillip, auf! Denn meine Mutter wird im Zelt bestürmt.41 Bast. Ich befreite sie. Sie ist in Sicherheit, befürchtet nichts. Doch immer zu, mein Fürst! denn kleine Müh Bringt dieses Werk nun zum beglückten Schluß.42
Für die zweite Ausgabe des ‚Schlegel-Tieck‘ stellt Schlegel seine originale Fassung wieder her.43 Das ist der Regelfall bei Schlegels Umgang mit Tiecks Verbesserungsversuchen seiner Übersetzung.
2. Salisbury. Sir Richard, was denkt ihr? Saht ihr wohl je, Las’t, oder hörtet, oder konntet denken, Ja denket ihr beynah, wiewohl ihrs seht, Das was ihr seht? Konnt’ ohne diesen Vorwurf Sich seines Gleichen der Gedanke bilden? Dieß ist die eigentliche Höh’, die Spitze, Der Gipfel, ja vom Gipfel noch der Gipfel Von Mordes Gewalt; die blutigste Verruchtheit, Die wildeste Barbarey, der schnöd’ste Streich, Den je Felsäugige, starrseh’nde Wuth Des sanften Mitleids Thräne dargeboten.44
Auch Schlegels Übertragung dieser Rede des Salisbury aus der dritten Szene des vierten Akts von König Johann hat gegenüber dem Shakespeareschen Original45 einen Vers zu viel. Tieck stellt auch hier das Versverhältnis wieder her: 40
41
42 43
44 45
Vgl. William Shakespeare: King John. Hrsg. von Jesse M. Lander und J.J.M. Tobin, London 2018 (The Arden Shakespeare. Third Series), S. 236. Hervorhebung vom Autor. Die Fettungen markieren hier wie im Folgenden die Stellen der Übersetzungen, die besonders stark voneinander abweichen. Shakspeare’s dramatische Werke, Erster Theil, 1825 (Anm. 13), S. 36. Vgl. Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Bd. 1. Berlin 1839, S. 46. Shakespeare 1799 (Anm. 39), S. 107. Vgl. Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 286f.
156
Stefan Knödler
Sal. Sir Richard, was denkt ihr? Saht ihr wohl je, Las’t, oder hörtet, oder konntet denken, Ja denket ihr fast jetzt, wiewohl ihr’s seht, Das, was ihr seht? Konnt’ ohne diesen Anblick Ihn schaffen der Gedank’? Dieß ist die Spitze, Höh, Gipfel, ja vom Gipfel noch der Gipfel Von Mords Gewalt; die blutigste Verruchtheit, Die wild’ste Barbarey, der schnöd’ste Streich, Den je felsäugige, starrseh’nde Wuth Des sanften Mitleids Thränen dargeboten.46
Tieck gibt V. 4f. dieser Passage – bei Shakespeare: „Could thought, without this object, / Form such another!“47 –, zumindest was den ersten Teilvers angeht, metrisch übereinstimmend wieder, und den ganzen Fragesatz, anders als Schlegel, in einer Knappheit, die der des Originals entspricht. Auch andere Eingriffe erlaubt er sich: aus „beynah“ wird, ohne dass eine Verbesserung erkennbar wäre, „fast jetzt“; andere Korrekturen haben offensichtlich metrische Gründe: „Mords“ für „Mordes“, „wild’ste“ für „wildeste“. „Thränen“ für „Thräne“ entspricht dem englischen Plural „tears“. Eine echte Verbesserung ist das nun kleingeschriebene und als Adjektiv erkennbare „fels-äugige“. In der von Schlegel revidierten Fassung der zweiten Auflage des ‚Schlegel-Tieck‘ liest sich die Stelle dann so: Salisbury. Sir Richard, was denkt ihr? Saht ihr wohl je, Las’t, oder hörtet, oder konnten denken, Ja, denkt ihr jetzt beinah, wiewohl ihrs seht, Das, was ihr seht? Wer könnte dieß erdenken, Läg’ es vor Augen nicht? Es ist der Gipfel, Der Helm, die Helmzimier am Wappenschild Des Mordes; ist die blutigste Verruchtheit, Die wildste Barbarei, der schnödste Streich, Den je felsäugige, starrsehnde Wuth Des sanften Mitleids Thränen dargeboten.48
Schlegel akzeptiert den Rückbau auf zehn Verse und die metrischen Korrekturen: Allerdings streicht er die Apostrophe, wie auch sonst in der Ausgabe. Tiecks „fast jetzt“ behält er nur zum Teil, „jetzt beinah“ verbindet seine ursprüngliche Fassung mit der Tiecks, die nötige Silbe spart er ein, indem er aus „denket“ „denkt“ macht – das temporale „jetzt“ findet sich bei Shakespeare, wo es schlicht „almost“ heißt, nicht. Einen weitaus gravierenderen Eingriff erlaubt sich Schlegel in der von Tieck gekürzten Stelle. Bei Shakespeare heißt sie: „This ist the very top, / The height, the crest, or crest 46 47 48
Shakespeare 1825 (Anm. 42), S. 56. Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 286. Shakespeare 1839 (Anm. 43), S. 72.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
157
unto the crest, / Of murder’s arms.“49 Schlegel hatte den Satz ursprünglich, mit den drei Synonyma und der dreifachen Wiederholung des letzten, recht wörtlich, allerdings unter Aufgabe der Verstreue wiedergegeben: „Höh’, […] Spitze, / Der Gipfel, ja vom Gipfel noch der Gipfel“; Tieck gelingt die Kürzung des Ganzen vor allem durch das Weglassen der Artikel. In der zweiten Fassung behält Schlegel nun lediglich den „Gipfel“ bei, den er jetzt an den Anfang stellt, um mit dem „Helm“ und seinem schmückenden Aufsatz, dem „Zimier“, nun ein völlig anderes gelagertes Bild einzubringen, dass sich auch aus Shakespeares Text nicht ergibt, wohl aber aus Schlegels Vorliebe für die Heraldik.50 Seine weitaus schwerer verständliche Neufassung verfehlt die Prägnanz der Bildlichkeit sowohl von Shakespeares Text als auch von seiner eigenen früheren Übersetzung.
3. In einer längeren Rede King Johns in der zweiten Szene des vierten Akts unterbricht ihn Hubert mit einem kurzen „My Lord–“.51 Schlegel lässt diesen Einwurf in der ersten Ausgabe seiner Übersetzung weg:52
49 50
51 52
Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 286f. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über die romantische Literatur [1803–1804]. In: KAV, Bd. II/1: Vorlesungen über Ästhetik [1803–1827]. Textzusammenstellung von Ernst Behler. Mit einer Nachbemerkung von Georg Braungart. Paderborn u.a. 2007, S. 1–194, hier S. 78–80. Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 281. Shakespeare 1799 (Anm. 39), S. 102.
158
Stefan Knödler
Tieck dagegen fügt ihn an der richtigen Stelle ein:53
Schlegel indes kann auch diese Ergänzung nicht unkorrigiert passieren lassen, zumal sie gegenüber dem Original eine Silbe zu viel aufweist; bei ihm heißt es:54
53 54
Shakespeare 1825 (Anm. 42), S. 54. Shakespeare 1839 (Anm. 43), S. 69.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
159
4. Der letzte Dialog zwischen dem Dauphin Lewis und dem Bastard in der zweiten Szene des fünften Akts endet mit folgendem couplet: DAUPHIN Strike up our drums to find this danger out. BASTARD And thou shalt find it, Dauphin, do not doubt.55
Schlegels übersetzte das 1799 so: Louis. Rührt unsre Trommeln, sucht die Heersmacht auf. Bastard. Du wirst die finden, Dauphin, haue drauf.56
Jeweils die zweite Vershälfte ist problematisch, weil dort zwar der Reim erhalten wird, Schlegel aber in beiden Fällen nicht wörtlich verfährt, wobei dies im ersten Vers noch als allerdings sehr freie, aber sinnvolle Übersetzung durchgehen könnte. Der zweite jedoch verfehlt den Sinn bei Shakespeare: ‚zweifle nicht‘ und „haue drauf“ sind zweierlei. Auch das deiktische „die“ im ersten Versteil ist zumindest auffällig (zumal das geläufigere „sie“ metrisch nichts geändert hätte). Tieck behält zwar das eigenartige „die“ bei, ihm gelingt aber eine wörtliche und überzeugende Übersetzung des ganzen Verspaares: Louis. Rührt unsre Trommeln, sucht denn die Gefahr. Bast. Du wirst die finden, Dauphin, das bleibt wahr.57
Schlegel zeigt sich ausnahmsweise zufrieden und lässt Tiecks Fassung für die zweite Auflage des ‚Schlegel-Tieck‘ passieren.58
5. Ein letztes Beispiel: Eine Passage aus dem langen Monolog des Bastards in der ersten Szene des Stücks:
55 56 57 58
Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 312. Shakespeare 1799 (Anm. 39), S. 126. Shakespeare 1825 (Anm. 42), S. 66. Shakespeare 1839 (Anm. 43), S. 85.
160
Stefan Knödler
’Tis too respective and too sociable For your conversion. Now, your traveller, He and his toothpick at my worship’s mess, And when my knightly stomach is sufficed, Why then I suck my teeth and catechize My picked man of countries: […]59
Schlegel übersetzt die schwierige Stelle zunächst wie folgt: Es ist aufmerksam und zu gesellig Für die Verwandlung. Dann mein Reisender, An meiner Gnaden Tisch die Zähne stochernd; Und ist mein ritterlicher Magen voll, So saug’ ich an den Zähnen, und befrage Den schmucken Gast um Länder. […]60
Nicht alles daran ist befriedigend, aber alles in allem eine Übersetzung, die das Shakespearesche Englisch in ein verständliches Deutsch bringt. Für Tieck, der die Passage fast vollständig neu fasst, gilt ähnliches, aber er leistet sich einen eindeutigen Fehler: Für vornehmes Gespräch wärs viel zu höflich, Viel zu gesellig. – Dann mein Reisender, Er und Zahnstocher an Ihr Gnaden Tafel – Und hat mein Rittermagen die Genüge, Nun dann saug’ ich am Zahn, examinire Den zieren Mann in Ländern. […]61
Bei Tieck wird der „toothpick“ zu einer Person – das Wortspiel mit dem „An-denZähnen-Saugen“ funktioniert damit nicht mehr. Für die zweite Auflage des ‚SchlegelTieck‘ überarbeitet Schlegel die Passage wie folgt: Es ist zu aufmerksam und zu vertraulich Für unseren Hofton. – Dann mein Reisender, An meiner Gnaden Tisch die Zähne stochernd. Und ist mein ritterlicher Magen voll, So saug’ ich an den Zähnen, und befrage Den Schönbart aus der Fremde. […]62
Die ersten fünf Verse stellt Schlegel mit leichten Abänderungen wieder her. Bei der Übersetzung von „conversion“ hat er sich nun entschieden, nicht mehr „Verwandlung“
59 60 61 62
Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 157. Vgl. auch den Kommentar ebd. Shakespeare 1799 (Anm. 39), S. 17. Shakespeare 1825 (Anm. 42), S. 8. Shakespeare 1839 (Anm. 43), S. 10.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
161
zu verwenden, sondern das Wort im Sinne von „conversation“ mit „Hofton“ wiederzugeben – beide Möglichkeiten gibt das Original her,63 die letztere ist sicherlich die leichter verständliche. Auch löst Schlegel nun die Frage elegant, wie das „catechize […] of countries“ zu übersetzen sei, das er selbst – vielleicht nicht ganz glücklich – mit „befrage […] um Länder“, Tieck – gleichfalls nicht völlig befriedigend – mit „examinire […] in Ländern“ wiedergegeben hatte. Der Verzicht auf die Präpositionalkonstruktion durch die Wiedergabe des letzten Verses, „My picked man of countries“, mit „Den Schönbart aus der Fremde“ umgeht das Problem und findet eine hübsche Lösung. Diese wenigen, sowohl typischen als auch besonders sprechenden Fälle können nur einen Ausblick geben auf das, was eine zukünftige (digitale) Edition des gesamten Komplexes des ‚Schlegel-Tieck‘ dann en détail zeigen und anschaulich machen könnte.64 *** Was Schlegel in den rund dreißig Jahren der Geschichte des ‚Schlegel-Tieck‘ dazu beigetragen hat, ist nicht die vom Verleger gewünschte Zusammenarbeit der beiden noch lebenden großen Namen der romantischen Epoche; es kann kaum von einer Mitarbeit Schlegels an diesem Unternehmen die Rede sein, für dessen Ganzes er kein Interesse aufbrachte. Den Anteil Tiecks und seiner Mitarbeiter, die er immerhin lobte,65 nahm er kaum wahr. Er trug nichts aktiv bei, er reagierte nur. Diese Reaktionen waren Selbstverteidigungen, ein Kampf um Werkherrschaft; es ging ihm dabei allein um die Unversehrtheit der von ihm übersetzten Stücke, alles Weitere kümmerte ihn nicht. Das einzige Mal, dass er kurz davor gewesen zu sein scheint, die Weiterarbeit an der Shakespeare-Übersetzung in Angriff zu nehmen, war bezeichnenderweise der Moment, als Reimer ihm als Lockmittel eine Prachtausgabe seiner vollständigen Übersetzung in Aussicht stellte, die, so Schlegel „denn doch eine Art von Denkmal seyn würde“.66 Schlegels Reaktionen auf die Eingriffe Tiecks lassen sich als die Verteidigung seines ursprünglichen Übersetzungsprogramms verstehen, das er für Shakespeare schon früh in den Horen entworfen hatte, das er im Anschluss aber auch auf andere Literaturen – die italienische, die spanische oder die altindische – angewendet hat. Shakespeare war jetzt nur noch einer unter anderen. Dass Schlegel sich ihm jetzt – in der Verteidigung seiner Prinzipien und des Werks, in dem sie angewendet werden –, nur widerwillig widmete, liegt auch daran, dass er in den späten 1830er Jahren längst
63 64
65
66
Vgl. den Kommentar zu der Stelle in: Shakespeare 2018 (Anm. 40), S. 157. Vgl. dazu insbesondere die Beiträge von Rüdiger Nutt-Kofoth, Katrin Henzel, Claudine Moulin sowie Claudia Bamberg und Thomas Burch in diesem Band. Vgl. August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 7. April 1835. In: KAWS,; https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/750: „Doch haben, wie es scheint, die Gehilfen meines Freundes lobenswerthe Arbeiten geliefert.“ August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer, 16. Juni 1828. In: KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/721.
162
Stefan Knödler
mit anderen Dingen befasst war; seine Übersetzung des Shakespeare war seit mindestens 30 Jahren unangetastet geblieben. Wenn er an Reimer schreibt: „Glauben Sie mir, ich habe viel über diese Dinge nachgedacht“ – dann ist das zweifellos richtig, aber eben auch schon sehr lange her. Schlegel besteht jedoch auf der poetischen Leistung seiner Übersetzung. In dem Schreiben an Reimer verweist er auf eine Passage in seinem Aufsatz Ueber die Bhagavad-Gita in seiner Zeitschrift Indische Bibliothek aus dem Jahr 1826. Dort heißt es: Ich könnte nun sagen, ich habe durch so viele Mühe nur die Ueberzeugung gewonnen, das Uebersetzen sei eine zwar freiwillige, gleichwohl peinliche Knechtschaft, eine brodlose Kunst, ein undankbares Handwerk; undankbar, nicht nur weil die beste Uebersetzung niemals einem Original-Werke gleich geschätzt wird, sondern auch, weil der Uebersetzer, je mehr er an Einsicht zunimmt, um so mehr die unvermeidliche Unvollkommenheit seiner Arbeit fühlen muß. Ich will aber lieber die andre Seite hervorheben. Der ächte Uebersetzer, könnte man rühmen, der nicht nur den Gehalt eines Meisterwerkes zu übertragen, sondern auch die edle Form, das eigenthümliche Gepräge zu bewahren weiß, ist ein Herold des Genius der über die engen Schranken hinaus, welche die Absonderung der Sprachen setzte, dessen Ruhm verbreitet, dessen hohe Gaben vertheilt. Er ist ein Bote von Nation zu Nation, ein Vermittler gegenseitiger Achtung und Bewunderung, wo sonst Gleichgültigkeit oder gar Abneigung Statt fand.67
Es mag noch ein anderer Aspekt eine Rolle gespielt haben: In den 1830er Jahren war Schlegel sicherlich einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit – ein ShakespeareGelehrter dagegen ist er nie gewesen. Bereits im Horen-Aufsatz äußerte er sich abfällig über „Warburtons Erläuterungen“,68 über die gesamte englischen Shakespeare-Forschung noch einmal ausführlicher auch in den Wiener Vorlesungen.69 Anders als Eschenburg70 und Tieck verfügte Schlegel über keine Shakespeare-Bibliothek; der Auktions-Katalog seiner Bibliothek (der allerdings sicher nicht vollständig ist) enthält 62 Titel zur englischen Literatur, darunter nur 19 Shakespeare betreffende, worunter jedoch lediglich vier Titel über Shakespeare sind;71 bei Tieck sind es 752 Titel zur englischen Sprache und Literatur und 109 Shakespeare-Titel, darunter zahlreiche 67
68 69
70
71
August Wilhelm Schlegel: Ueber die Bhagavad-Gita. Mit Bezug auf die Beurtheilung der Schlegelschen Ausgabe im Pariser Asiatischen Journal. Aus einem Briefe von Herrn Staatsminister von Humboldt. Nebst Vorerinnerung und Anmerkungen des Herausgebers. In: Indische Bibliothek 2, 1826, H. 2., S. 218–258, hier 254f. Schlegel 1796 (Anm. 1), S. 58. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur [1809–1811]. In: KAV, Bd. IV/1. Hrsg. und kommentiert von Stefan Knödler. Erster Teil: Text. Paderborn 2008, S. 286–312 passim. Vgl. Schlegel 1838/39 (Anm. 28), S. 286: „Ich hatte keine Shakspeare-Bibliothek, wie Eschenburg sie besaß; die Anschaffung einer solchen hätte leicht das Doppelte oder Dreifache des Honorars für die Uebersetzung verschlungen“. Vgl. Katalog der von August Wilhelm von Schlegel, Professor an der Königl. Universität zu Bonn, Ritter etc., nachgelaßenen Büchersammlung, welche Montag den 1ten Dezember 1845 und an den folgenden Tagen Abends 5 Uhr präcise bei J. M. Heberle in Bonn öffentlich versteigert […] wird. [Bonn 1845], S. 79–82 bzw. 81f.
A. W. Schlegel und die Bearbeitung seiner Shakespeare-Übersetzung durch Ludwig Tieck
163
mehrbändige Ausgaben.72 Zu Recht also verwies Tieck in seiner „Vorrede“ darauf, dass er seine Übersetzung durch die Erforschung der „Alterthümer der Engländer“ auf eine neue Grundlage gestellt habe.73 So mag hinter Schlegels Weigerung, seine Übersetzung zu vollenden oder sich überhaupt noch einmal damit zu beschäftigen, die Einsicht stehen, dass dazu eine nachholende Beschäftigung mit der seit dem Erscheinen der Ungerschen Ausgabe weitaus umfangreicher gewordenen englischen wie deutschen Shakespeare-Forschung nötig gewesen wäre. Schlegel beschränkte sich in der Zeit des ‚Schlegel-Tieck‘ auf sein Verdienst als Impulsgeber. Die Form dieses Impulses, die zwischen 1797 und 1810 erschienenen Bände der von ihm übersetzten Dramen Shakespeares, wollte er erhalten wissen und er verteidigte sie gegen fremde Eingriffe. Sein Blick auf die eigene Leistung ist dabei aber nicht mehr der eines Dichters, sondern der eines Historikers seiner selbst.
72
73
Vgl. Catalogue de la bibliothèque célèbre de M. Ludwig Tieck qui sera vendue à Berlin le 10. Décembre 1849 et jours suivants par MM. A. Asher & Comp. Neudruck Niederwalluf bei Wiesbaden 1970, S. 65–95 bzw. 85–90. Asher & Comp. (Anm. 72), S. V.
Tim Sommer
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus Britische und deutsche Shakespeare-Rezeption im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
1. Übersetzung, aemulatio und Weltliteratur um 1800 Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist mit Recht oft als Shakespeare-Renaissance beschrieben worden. In Großbritannien, und ganz ähnlich auch im Sturm und Drang und der deutschen Frühromantik, beginnt man in Abkehr von der klassizistischen Regelpoetik, die vermeintliche Ungebundenheit, Urwüchsigkeit und Radikalität Shakespeares zu feiern. Im britischen Kontext lassen sich solche Lektüren in ersten Ansätzen bereits in Samuel Johnsons Vorwort zu seiner 1765 publizierten Werkausgabe feststellen; in Deutschland finden sich radikalere Versionen derartiger Vorstellungen etwa in Goethes jugendlicher Rede Zum Shäkespears Tag (1771) oder in Herders ShakespeareAufsatz im 1773 erschienenen Band Von Deutscher Art und Kunst. Neben dieser neuen kritisch-publizistischen Strömung rückt gleichzeitig ein anderer Aspekt der Beschäftigung mit Shakespeare in den Vordergrund: die Entwicklung der Shakespeare-Forschung, mit ihrem historischen Nachspüren der Autorbiographie und insbesondere mit ihrem Streben nach einem ‚korrekten‘ Text der Stücke und Gedichte. In England ist das späte 18. Jahrhundert damit die Geburtsstunde der modernen Textkritik, der analytical bibliography und der Editionsphilologie (bei Figuren wie Johnson und George Steevens, insbesondere aber auch bei deren Nachfolger Edmond Malone, dessen 1790 erschienene 10-bändige Werkausgabe neue Standards setzte).1 Mit diesem neuen Verständnis von Shakespeare als genialischem Barden auf der einen Seite und einer neuen Methode der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit seinem Werk auf der anderen Seite sind zwei ebenso zentrale wie wohlbekannte Aspekte der Rezeption um 1800 kurz angeschnitten. Im Folgenden soll es hingegen um zwei andere, weniger unmittelbar offensichtliche Dimensionen dieser Rezeptionsgeschichte gehen: zum einen um die Auseinandersetzung mit Shakespeares Texten im Modus der aemulatio, zum anderen um die kulturpolitische Aufwertung Shakespeares
1
Vgl. zur Geschichte der Shakespeare-Edition im 18. Jahrhundert Sonia Massai: Shakespeare and the Rise of the Editor. Cambridge 2007; Marcus Walsh: Editing and Publishing Shakespeare. In: Shakespeare in the Eighteenth Century. Hrsg. von Fiona Ritchie und Peter Sabor. Cambridge 2012, S. 21–40; und Margreta de Grazia: Shakespeare Verbatim. The Reproduction of Authenticity and the 1790 Apparatus. Oxford 1991.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-012
166
Tim Sommer
durch die Betonung seiner internationalen Wirkung und seines weltliterarischen Potenzials. In beiden Kontexten ist die Idee des Übersetzens zentral. Bevor im Weiteren der Blick auf einige der konkreten Ausformungen dieser Gedanken in Texten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gerichtet wird, sollen an dieser Stelle zunächst einige Bemerkungen zu den beiden genannten Stichworten aemulatio und Weltliteratur als einleitende Überlegungen vorangestellt werden. Unter dem Begriff aemulatio wird gemeinhin ein klassisches poetologisches Prinzip verstanden, das sich im Kern um die Verbesserung – und damit um die wettbewerbsmäßig verstandene Überbietung – von bereits Bekanntem dreht. Dabei beschreibt aemulatio allgemein das „Verhältnis literarischer und künstlerischer Produktion zu ihren Vorbildern, von denen sie sich auf schöpferische Weise zu lösen such[t]“.2 Darunter fällt noch im 18. Jahrhundert beispielsweise die Wahl eines bereits von Autoren der klassischen Antike bearbeiteten Dramenstoffs, wie sie etwa im englischen Neoclassicism oder der Weimarer Klassik anzutreffen sind. Ausgehend von der komplexen, über solche Beispiele hinausweisenden Geschichte und Semantik des Konzepts soll in der Folge ein weiter aemulatio-Begriff zugrundegelegt werden, der sich nicht bloß auf die „agonale Metaphorik“ eines kompetitiven Übertreffens eines gewählten Vorbilds beschränkt, sondern eine Reihe verschiedener Formen des Ver- und Ausbesserns beschreiben kann.3 Im Sinn des etymologischen Ursprungs von ζῆλος (zēlos) – des griechischen Pendants von aemulatio – lassen sich damit unterschiedliche Spielarten des Eiferns fassen (vom Korrigierfuror des Editors bis hin zum am Original orientierten, aber in betrügerischer Absicht betriebenen Nacheifern des Fälschers). Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts heißt dies in Bezug auf Shakespeare konkret: Seine Texte sollen durch Aneignung, Ab- und Anverwandlung ‚besser‘ gemacht und damit wahlweise zu ihren Quellen zurückgeführt, von vermeintlichen Schlacken befreit, den Erfordernissen der modernen Theateraufführung angepasst, von Unschicklichem bereinigt oder durch die Übertragung in eine andere Sprache auf eine höhere Ebene gehoben werden. Dabei sind Praktiken des Korrigierens, Kommentierens, Umschreibens, Zensierens und Übersetzens bis hin zum Fälschen zentral. Im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Herausgabe von Shakespeares Texten erscheint die aemulatio-Idee vor allem im Gewand der emendatio (Malone etwa versprach den Lesern seiner kritischen Ausgabe einen Text auf Grundlage der „most authentick copies, […] revised with the corrections […] of various commentators“).4
2
3 4
Till R. Kuhnle: Tradition – Innovation. In: Ästhetische Grundbegriffe. 7 Bde. Hrsg. von Karlheinz Barck u. a. Stuttgart 2000–2005, Bd. 6, S. 74–117, hier S. 79. Vgl. auch Barbara Bauer: Aemulatio. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. 12 Bde. Hrsg. von Gert Ueding u.a. Tübingen 1992–2015, Bd. 1, Sp. 141–187, und Heinz Entner: Imitatio. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 3 Bde. Hrsg. von Klaus Weimar u.a. Berlin 1997–2003, Bd. 2, S. 133–135. Bauer 1992–2015 (Anm. 2), Sp. 142. William Shakespeare: The Plays and Poems of William Shakspeare, in Ten Volumes; Collated Verbatim with the Most Authentick Copies, and Revised with the Corrections and Illustrations of Various Commentators; to which Are Added, An Essay on the Chronological Order of His Plays; An Essay Relative to Shakspeare [sic] and Jonson; A Dissertation on the Three Parts of King Henry VI.; An Historical
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
167
Im Theaterkontext des 18. Jahrhunderts heißt aemulatio im hier gemeinten weiteren Sinn der liberale Umgang mit Shakespeares Texten mit Blick auf die Einrichtung für die Praktikabilitäten der Bühne. Hierunter fallen zum Beispiel die Bearbeitungen William Davenants und Nahum Tates, deren Entstehung zwar noch in das späte 17. Jahrhundert fällt, die aber teilweise bis ins 19. Jahrhundert hinein die Aufführungspraxis bestimmen. Zensiert und für den Hausgebrauch eingerichtet werden die Stücke Anfang des 19. Jahrhunderts von Thomas Bowdler, dessen zuerst 1807 erschienener und 1818 erweiterter Family Shakspeare versprach, eine Werkausgabe zu liefern, „in which nothing is added to the original text; but those words and expressions are omitted which cannot with propriety be read aloud in a family“.5 Ein Beispiel für die Vorstellung des Shakespeare-Übersetzens als einer Art aemulatio des Originals findet sich in Novalis’ Brief an August Wilhelm Schlegel vom 30. November 1797, in dem jener nicht nur schreibt, „Übersetzen“ sei „so gut dichten, als eigne Wercke zu stande bringen“, sondern noch darüber hinausgeht mit seiner Behauptung, „daß der deutsche Shakespeare jezt besser, als der Englische ist.“6 Mit der Übersetzung Shakespeares und mit seiner kontinentaleuropäischen Resonanz ist das zweite Leitmotiv des vorliegenden Beitrags angesprochen: die Frage nach Shakespeares Bedeutung im britisch-deutschen Weltliteraturdiskurs des frühen 19. Jahrhunderts. Es sei hier einleitend bloß kurz angedeutet, in welcher Form sich die dem Weltliteraturkonzept zugrundeliegenden Ideen im Zusammenhang mit Shakespeare äußern. Die zeitgenössischen deutschen Übertragungen von und kritischen Texte zu Shakespeare, allen voran diejenigen Schlegels, sind von zahlreichen britischen Kommentatoren aufgegriffen worden. Dabei sind zwei Grundannahmen zu konstatieren, die besonders für Goethes Vorstellung des kulturellen Mehrwerts von Weltliteratur zentral sind: erstens die Annahme, ausländische Rezipienten hätten einen besseren, weil unvoreingenommenen, Blick auf die eigene Literatur; zweitens die damit verbundene Hoffnung, einheimische Leser könnten von diesen Einsichten selbst profitieren und
5
6
Account of the English Stage; and Notes. 10 Bde. Hrsg. von Edmond Malone. London 1790. Im Folgenden werden alle nicht standardisierten Schreibweisen von Shakespeares Namen im Original wiedergegeben und nicht gesondert gekennzeichnet. William Shakespeare: The Family Shakspeare, in Ten Volumes; in which Nothing is Added to the Original Text; but those Words and Expressions Are Omitted which Cannot with Propriety be Read Aloud in a Family. 10 Bde. Hrsg. von Thomas Bowdler. London 1818. Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hrsg. von Paul Kluckhohn (†) und Richard Samuel. Zweite, nach den Handschriften ergänzte, erweiterte und verbesserte Aufl. in vier Bänden und einem Begleitband. Bd. 4: Tagebücher, Briefwechsel, Zeitgenössische Zeugnisse. Hrsg. von Richard Samuel in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz. Mit einem Anhang: Bibliographische Notizen und Bücherlisten, bearb. von Dirk Schröder. Stuttgart 1975, S. 237. In seiner „Vorrede“ zum 1825 publizierten ersten Band der Schlegel-Tieck-Übersetzung spricht Ludwig Tieck in einem ähnlichen Sinn Übersetzungen implizit Werkcharakter zu, wenn er Schlegel als „Virtuosen“ und „Uebersetzungskünstler“ tituliert. Anders als Novalis kommt Tieck allerdings zu dem Schluss, Schlegel reiche in letzter Instanz nicht an Shakespeare heran, dessen Texte „mannichfaltiger, willkührlicher und seltsamer“ seien, als es eine Übersetzung nachbilden könne. Ludwig Tieck: Vorrede. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Willhelm Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Erster Theil. Berlin 1825. S. III–VIII (hier S. IV, IV, V).
168
Tim Sommer
durch sie einen neuen Zugang zu Altbekanntem gewinnen (auch hierbei spielt der aemulatio-Gedanke eine Rolle, wie unten ausführlicher argumentiert wird). Diese beiden Aspekte der Shakespeare-Rezeption um 1800 – die Logik der aemulatio und die kosmopolitische Rhetorik von weltliterarischem Austausch – lassen sich an zwei Fallbeispielen aufzeigen, die im weiteren Verlauf genauer besprochen werden sollen. Fragen nach Texttreue, Korrektur und Überbietung gehe ich im Zusammenhang mit William Henry Ireland (1775–1835) nach, der ab 1794 eine ganze Reihe von Shakespeare-Fälschungen anfertigte, die in der britischen literarischen Öffentlichkeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts breit rezipiert und diskutiert wurden. Im Mittelpunkt soll hier Irelands Produktion ‚korrigierter‘ Fassungen kanonischer Stücke stehen – allen voran sein King Lear, der nach einer sprachlichen Bereinigung und ‚Poetisierung‘ strebte und Shakespeare dabei zu seinem vermeintlich ‚authentischen‘ Stil zurückbringen sollte. Die britisch-deutschen Wechselwirkungen der Shakespeare-Rezeption und -Übersetzung sollen anschließend am Beispiel des schottischen Publizisten George Moir (1800–1870) deutlich gemacht werden, der in den 1830er Jahren das Ziel verfolgte, die Übertragungen und kritischen Schriften Schlegels einem englischsprachigen Publikum bekanntzumachen. Obwohl er sich dabei nicht ganz Novalis’ Argument zu eigen machte, der „deutsche Shakespeare“ sei besser als das englische Original, betont Moir doch den Nutzen der wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen Eigenem und Fremden und rät seinen Lesern vor diesem Hintergrund ausdrücklich, die Bekanntschaft mit Schlegels deutschen Versionen der Stücke zu machen. Diese beiden Beispiele ermöglichen einen kulturvergleichenden Blick auf eine Reihe verschiedener Formen der Shakespeare-Bearbeitung und -Aneignung zwischen den 1790er und den 1830er Jahren, also im Zeitraum der Entstehung der Schlegel-Tieck-Übersetzungen, die im Folgenden wenn nicht unmittelbar so jedenfalls indirekt, und zwar in Form ihres Kontexts und ihrer eigenen Rezeption, behandelt werden sollen.
2. Fälschung als Übersetzung und philologische aemulatio (William Henry Ireland) Das Fälschen von Handschriften ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts die wohl unkonventionellste Spielart des Umgangs mit Shakespeare und seinen Werken. Die in diesem historischen Zusammenhang zentrale Figur war William Henry Ireland, der Mitte der 1790er Jahre, kaum 20-jährig, im großen Stil vermeintliche Manuskripte Shakespeares fabrizierte. (Das Genre der literarischen Fälschung war in Großbritannien in der zweiten Jahrhunderthälfte bereits durch die Ossian-Dichtungen des Schotten James Macpherson und die mittelalterlich angehauchten Imitationen Thomas Chattertons populär geworden.) Zunächst schulte Ireland sich durch die Nachahmung von originalen Signaturen unter notariellen Dokumenten, es folgte jedoch schon bald darauf ein erstaunliches Korpus verschiedenster Artefakttypen (erfundene Briefe von und an Shakespeare, Abrechnungsdokumente aus dem Theaterkontext, imaginierte Buchannotationen, angebliche Originalfassungen von King Lear und einzelner Szenen aus Hamlet
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
169
und schließlich auch eine Reihe eigener, als vergessene Shakespeare-Originale ausgegebener Stücke). Eine entscheidende Rolle als Inspiration für diese Fälschungen, wenn auch vermutlich nicht als aktiver Komplize, spielte Irelands Vater Samuel, der als Sammler künstlerisch-literarischer Kuriositäten und als fanatischer Verehrer Shakespeares bekannt war. Dieser Enthusiasmus übertrug sich auf den Sohn, der durch den Umgang mit seinem Vater antiquarisch vorgebildet war und diesem genau die Dokumente lieferte, nach denen er als Privatgelehrter und Amateurphilologe suchte.7 Transkriptionen von einigen der aufsehenerregendsten von William Henry Ireland generierten Dokumente wurden von seinem Vater zum Jahreswechsel 1795–1796 unter dem Titel Miscellaneous Papers and Legal Instruments under the Hand and Seal of William Shakspeare. Including the Tragedy of King Lear, and a Small Fragment of Hamlet, from the Original MSS. publiziert. Im Vorwort zu dieser Ausgabe umschreibt Ireland senior das, was hier eingangs als aemulatio im weiten Sinn skizziert worden ist. Die von seinem Sohn vorgelegte handschriftliche Fassung von King Lear müsse schon allein deshalb authentisch sein, argumentiert Ireland hier, weil sie stilistische Unstimmigkeiten in den gedruckten Fassungen des Stücks als spätere textuelle Korrumpierungen entlarvten und damit einen Zugriff auf den eigentlichen, ‚reineren‘ und ‚besseren‘, Shakespeare ermöglichten: To the man of taste, and lover of simplicity, to the sound Critic, it is conceived, upon collating them, it will appear, that the alterations made in the printed copies of Lear are manifestly introduced by the players, and are deviations from that spontaneous flow of soul and simple diction, which so eminently distinguish this great Author, this Child of Nature; and that the additions and alterations interspersed […] have not unfrequently been introduced at the expence of the natural course of the narrative, the regular detail of the fact, and uniformity of the author’s style […]. These […] are amongst the reasons that have persuaded the Editor, that these papers are genuine; for, it is presumed, the MS. here presented to the Public must have been the original, and, probably, the only one by the author.8
Die hier von Ireland formulierten Kriterien für die Beurteilung der Echtheit von Manuskripten fassen in wenigen Worten zentrale Dimensionen des Shakespeare-Bilds des ausgehenden 18. Jahrhunderts zusammen. Gemäß den Leitsätzen der Genie-Ästhetik wird Shakespeare hier zum „Child of Nature“ stilisiert, dessen Schreiben vor allem durch einen „spontaneous flow of soul“ und eine „simple diction“ charakterisiert sei. Das auf wundersame Weise aufgetauchte Autograph von King Lear beinhaltet demnach 7
8
Ausführliche Darstellungen des Ireland-Falls finden sich beispielsweise bei Samuel Schoenbaum: Shakespeare’s Lives. Oxford 1993, S. 135–167, und Jonathan Bate: Faking It. Shakespeare and the 1790s. In: Essays and Studies 46, 1993, S. 63–80. Vgl. auch allgemeiner zur Kulturgeschichte des Phänomens der Shakespeare-Fälschung Richard D. Altick: The Scholar Adventurers. New York 1966, S. 142–175. Samuel Ireland: Preface. In: Miscellaneous Papers and Legal Instruments under the Hand and Seal of William Shakspeare. Including the Tragedy of King Lear and a Small Fragment of Hamlet, from the Original MSS. in the Possession of Samuel Ireland, of Norfolk Street. London 1796, S. V–XIX, hier S. X.
170
Tim Sommer
das Versprechen einer Annäherung an dieses Ideal der empfindsamen Unmittelbarkeit. Ireland spricht an gleicher Stelle unzweideutig von dem „improvement“, das vor diesem Hintergrund die Handschrift gegenüber den bekannten Quarto- und Folio-Fassungen des Stücks darstelle.9 Hieran wird deutlich, dass der aemulatio-Gedanke gegen Ende des 18. Jahrhunderts nicht in starrer Opposition zum Genie-Konzept,10 sondern im Gegenteil als eng mit diesem verwoben zu verstehen ist. Steht insbesondere Shakespeare (neben Figuren wie Homer und Ossian) einerseits für eine Abkehr von der klassizistischen Poetik des Kopierens und Übertreffens, schreiben sich im Ideal der ‚Verbesserung‘ seiner Texte anderseits die ästhetischen Grundsätze der aemulatio fort, wenngleich unter den umgekehrten Vorzeichen einer Betonung von Shakespeares eigener schöpferischer Spontaneität (statt seiner Kenntnisse älterer Autoren und Texte). Der Schwindel um die fingierten Shakespeare-Manuskripte flog schon bald nach der Veröffentlichung der Miscellaneous Papers auf und William Henry Ireland selbst erläuterte daraufhin die Hintergründe für seine Fälscheraktivitäten im Rahmen zweier gedruckter ‚Geständnisse‘. Im ersten dieser beiden Texte, dem schon 1796 publizierten Authentic Account of the Shaksperian Manuscripts, beschreibt Ireland Schicklichkeit und Stilhöhe als die beiden Schwerpunkte seiner selbstverantworteten Verbesserungskampagne. Es war ihm also einerseits, ähnlich wie wenig später Bowdler mit seinem Family Shakspeare, um das Ausmerzen von, wie Ireland es nennt, „ribaldry“ (also Derbheit, Anzüglichkeit oder Zotigkeit) zu tun.11 Zum anderen ging es ihm nach eigenem Bekunden um das Ausschmücken, und damit das Korrigieren, von Passagen, die seiner Meinung nach nur auf nicht von Shakespeare selbst autorisierten Verderbungen des Urtexts, besonders in den sogenannten bad quartos, beruhen konnten. Ob diese von Ireland nach der Deauthentifizierung seiner Fälschungen genannten Motive tatsächlich die ursprünglichen Hintergründe für seine Tätigkeit darstellten oder nicht eher biographische und ökonomische Interessen eine stärkere Rolle gespielt haben, mag hier dahingestellt bleiben. Entscheidend ist, dass seine ex post facto gelieferte aemulatio-Argumentation um 1800 plausibel genug erschien, um sie einem breiten Lesepublikum als philologische Legitimation seines Handelns zu präsentieren. Als ein Beispiel für seine Ambitionen, „[to] make alterations where I thought the lines beneath him“, führt Ireland an einem zentralen Punkt seines Authentic Account die Schlussszene von King Lear an, in der er zwei vom Grafen von Kent gesprochene Verse durch eine blumigere, vermeintlich shakespeareʼschere Rede ersetzt hatte.12 Die beiden durch die Quarto- und Folio-Fassungen fast wortgleich überlieferten Zeilen „I
9 10
11 12
Ireland 1796 (Anm. 8), S. XVII. Vgl. hierzu etwa Barbara Bauers Erläuterungen zur Krise der aemulatio-Logik im Sturm und Drang: „Die Einbildungskraft des Genies wurde von den Theoretikern als Gegenpol zur produktiven Aneignung fremder Muster durch imitatio und A[emulatio] bewertet. Das Genie sollte sich über Regeln und Muster hinwegsetzen.“ Bauer 1992 (Anm. 2), Sp. 177. William Henry Ireland: An Authentic Account of the Shaksperian Manuscripts, &c. London 1796, S. 18. Ireland 1796 (Anm. 11), S. 18.
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
171
have a journey, Sir, shortly to go, / My master calls, and I must not say no“13 hatte Ireland kurzerhand zu folgender Passage umgeformt: Thanks, Sir, but I go to that unknown land, That chains each pilgrim fast within it’s [sic] soil, By living men most shunned most dreaded, Still my good master this same journey took, He calls me, I am content, and straight obey; Then farewell world, the busy scene is done, Kent lived most true, Kent dies most like a man.14
Irelands Authentic Account verfolgt, genau wie seine etwa zehn Jahre später publizierten Confessions of William-Henry Ireland. Containing the Particulars of His Fabrication of the Shakspeare Manuscripts, eine doppelte Zielsetzung. Die beiden publizistisch wirksam in Szene gesetzten Geständnisse sind einerseits Schuldbekenntnis, andererseits Rechtfertigung. So behauptet Ireland, der von ihm ‚ausgebesserte‘ Text des Stücks sei in bester Absicht gefälscht worden und habe zumindest kurzzeitig das Angestrebte, nämlich die stilistische Bereinigung von King Lear und die Verteidigung von Shakespeares Ruf, erreicht. „By such alterations the world supposed that all the ribaldry in his other plays was not written by himself but foistered in by the players and printers“, resümiert Ireland und behauptet weiter: „herein it cannot be said I injured the reputation of Shakspear, on the contrary, the world thought him a much more pure and even writer than before“.15 Diesen letzten Aspekt betreffend waren indes nicht alle zeitgenössischen Kommentatoren mit Ireland einer Meinung. Dem eingangs erwähnten Shakespeare-Forscher 13
14 15
Ireland 1796 (Anm. 11), S. 18. Die von Ireland zitierte Passage liefert in modernisierter Schreibung die Version des Erstdrucks der Fälschung in Ireland 1796 (Anm. 8), S. 155. Nach eigener Auskunft arbeitete Ireland bei der Anfertigung seiner Fälschung mit der originalen Quarto-Ausgabe des Stücks von 1608 (ein Exemplar davon befand sich angeblich im Besitz seines Vaters). Kents Verse sind dort gedruckt als „I haue a iourney sir, shortly to go, / My maister cals, and I must not say no“; in der Folio-Ausgabe von 1623 lauten sie, geringfügig abweichend: „I haue a iourney Sir, shortly to go, My Master calls me, I must not say no“. William Shakespeare: King Lear. Hrsg. von R. A. Foakes. London 1997, S. 76f. Ireland 1796 (Anm. 11), S. 19 (Hervorhebungen im Original). Ireland 1796 (Anm. 11), S. 19 (Hervorhebung im Original). In seinen ausführlicheren Confessions aus dem Jahr 1805 schildert Ireland die Vorgänge ganz ähnlich: „As it was generally deemed extraordinary that the productions of Shakspeare should be found so very unequal […], I determined on the expedient of rewriting, in the old hand, one of his most conspicuous plays, and making such alterations as I conceived appropriate. […] As I scrupulously avoided, in copying the play of Lear, the insertion of that ribaldry which is so frequently found in the compositions of our bard, it was generally conceived that my manuscript proved beyond doubt that Shakspeare was a much more finished writer than had ever before been imagined. It was also further suggested, that the numerous passages unworthy the sublime genius of Shakspeare which appear throughout all his dramas, were merely introduced in the representation, by the players of that period, and afterwards inserted in the playhouse copies of his productions; from which they were literally printed“. William Henry Ireland: The Confessions of William-Henry Ireland. Containing the Particulars of His Fabrication of the Shakspeare Manuscripts; Together with Anecdotes and Opinions (Hitherto Unpublished) of Many Distinguished Persons in the Literary, Political, and Theatrical World. London 1805, S. 115–119.
172
Tim Sommer
und -Herausgeber Edmond Malone schienen die von Ireland interpolierten Verse keineswegs „pure and even“, sondern im Gegenteil das Werk eines jugendlichen Stümpers zu sein. In seiner ebenfalls 1796 publizierten Inquiry into the Authenticity of Certain Miscellaneous Papers […] Attributed to Shakspeare, die maßgeblich zur Aufdeckung der Affäre beitrug, bemerkte Malone in diesem Zusammenhang: The speech of Kent in the last scene of this play having been thought by the commentators too short and bald, in vamping this piece, two lines which the poet has allotted to him have been beaten out and amplified into seven; and though the verses which have been supplied are not better than any school-boy who had ever composed a line of poetry could write, for want of better arguments they have been quoted as teeming with energy and pathos.16
Hier kommen erneut die bereits von Irelands Vater bemühten zentralen Vokabeln des zeitgenössischen Genie-Diskurses zum Tragen: die Vorstellung von Shakespeares urwüchsiger Kraft („energy and pathos“) und seiner natürlichen Simplizität („pure and even“).17 Bei Irelands Fälschungen ging es im Kern um die Wiederherstellung dieser Werte, also nicht um ein genuines Übertreffen von Shakespeare, sondern um eine Rückführung zu dem vermeintlich eigentlich von ihm Geschriebenen und Intendierten. Für dieses Ideal der rückwirkend auktorialen aemulatio war Ireland im Gegenzug bereit, das Prinzip der philologisch abgesicherten Texttreue über Bord zu werfen und durch eine Praxis zu ersetzen, die sich am treffendsten als ästhetische Konjektur bezeichnen ließe. Im Mittelpunkt steht hier ein Konflikt zwischen Geist und Buchstabe, der auch in der frühromantischen Übersetzungstheorie eine wichtige Rolle spielt. Der Fall Ireland war in den 1790er Jahren auch deutschen Intellektuellen ein Begriff.18 16
17
18
Edmond Malone: An Inquiry into the Authenticity of Certain Miscellaneous Papers and Legal Instruments, Published Dec. 24, MDCCXCV and Attributed to Shakspeare, Queen Elizabeth, and Henry, Earl of Southampton: Illustrated by Fac-Similes of the Genuine Hand-Writing of that Noblemen, and of Her Majesty; a New Fac-Simile of the Hand-Writing of Shakspeare, Never before Exhibited; and other Authentick Documents: In a Letter Addressed to the Right Hon. James, Earl of Charlemont. London 1796, S. 308f. In Malones eigener Ausgabe von 1790 sind die beiden Verse Kents gedruckt als „I have a journey, sir, shortly to go; / My master calls, and I must not say, no“. Shakespeare 1790 (Anm. 4), Bd. 8, S. 688. Samuel Ireland selbst wiederholte im Rahmen einer später von ihm betriebenen Rufmordkampagne gegen Malone diese Attribute und lobte weiterhin ausdrücklich die Fassungen seines Sohnes, zu einem Zeitpunkt, als diese von Malone bereits öffentlich als Fälschungen demaskiert worden waren: „[H]e who compares this emendation with the following speech of Kent, as it exists in the other editions, […] and does not pronounce it to be replete with pathos and energy, must resign all pretensions to critical discernment as well as poetical taste. The above passage [d.h. die von seinem Sohn ergänzte, T.S.] has received the commendations of all who have read it; and it is much more easy, after the specimen he has given us of his taste and erudition, to suppose that Mr. Malone is not endued with the slightest particle of either, than that the best scholars of the age should have given their suffrage in favor of lines, which any school boy might have written.“ Samuel Ireland: An Investigation of Mr. Malone’s Claim to the Character of Scholar, or Critic, Being an Examination of His Inquiry into the Authenticity of the Shakspeare Manuscripts, &c. London [1797], S. 145f. Johann Joachim Eschenburg, Schlegels Vorgänger als Übersetzer Shakespeares, hatte beispielsweise bereits 1797 eine umfangreiche, eng an Malones Inquiry orientierte Streitschrift zu den Fälschungen vorgelegt. Vgl. Johann Joachim Eschenburg: Ueber den vorgeblichen Fund Shakspearischer Handschriften.
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
173
3. Übersetzen als kosmopolitische Kommunikation (Schlegel, Novalis, Carlyle, Goethe) Das von Ireland gleichermaßen praktisch umgesetzte wie theoretisch legitimierte freie, ‚poetische‘ Rekonstruieren und Nachschöpfen von Shakespeares Texten ist in diesem Sinn der Beschreibung der Aufgaben des literarischen Übersetzens nicht unähnlich, die Schlegel gegen Ende seines 1796 in den Horen publizierten Aufsatzes Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters liefert. Im Unterschied zu Ireland betont Schlegel zwar seine Verpflichtung dem buchstäblichen Text Shakespeares gegenüber;19 auf dieser textuellen Grundlage verfährt er jedoch frei, um das Ideal „[e]ine[r] poetische[n] Übersetzung“ zu realisieren, die „noch treuer als die treueste prosaische sein könnte“.20 Wenn Novalis nach der Lektüre des ersten Bands von Schlegels Übersetzungen in seinem Brief vom November 1797 davon spricht, er sei „überzeugt, daß der deutsche Shakespeare jezt besser, als der Englische ist“, schwingt damit also ebenfalls eine implizite aemulatio-Vorstellung mit, die Ähnlichkeiten mit derjenigen Irelands aufweist.21 Auch hier geht es um eine Annäherung an den unterstellten ‚eigentlichen‘ poetischen Gehalt von Shakespeares Werken, der – so die Annahme – erst durch Formen der schöpferischen Aneignung (Um- und Weiterschreiben im Fall Irelands, linguistischer Transfer im Fall Schlegels) freigelegt werden könne. Novalis macht in seinem Brief allerdings noch eine weitere Bemerkung, die über eine solche Verbesserungslogik hinausgeht und auf eine dem Übersetzen zugrundeliegende kulturelle Dynamik hinweist. Er konstatiert, es gebe „fast keinen deutschen Schriftsteller von Bedeutung[,] […] der nicht übersezt hätte, und warlich darauf soviel
19
20
21
Leipzig 1797. Vgl. zu Eschenburgs Kenntnis des Falls Christoph Ehland: Johann Joachim Eschenburg und William-Henry Irelands Shakespeare-Fälschungen. In: Johann Joachim Eschenburg und die Künste und Wissenschaften zwischen Aufklärung und Romantik. Netzwerke und Kulturen des Wissens. Hrsg. von Cord-Friedrich Berghahn und Till Kinzel. Heidelberg 2013, S. 283–296. In der Vorerinnerung zum ersten Band seiner Übersetzungen demonstriert Schlegel etwa unter Verweis auf seine Benutzung von Malones Ausgabe, auf dem aktuellsten Stand der philologischen Forschung zu sein: „In Ansehung des englischen Textes habe ich mich hauptsächlich an eine Ausgabe: London 1786, gehalten, worin er aus der Malone’schen abgedruckt ist, zugleich aber auch die ältere Ausgabe von Johnson and Steevens zu Rathe gezogen.“ August Wilhelm Schlegel: Vorerinnerung. In: Shakespeare’s dramatische Werke. Erster Theil. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Berlin 1797, S. III–VI, hier S. V. Als Replik auf eine Kritik seiner Shakespeare-Übersetzungen in der Belletristischen Zeitung hob Schlegel drei Jahre später in einem Beitrag für das Athenaeum seine Kenntnis der „kritische[n] Geschichte des Textes“ der Werke Shakespeares hervor und stellt sich in diesem Zusammenhang sogar über den Philologen Malone. August Wilhelm Schlegel: [Notizen.] In: Athenaeum 3, 1800, S. 327–334, hier S. 333. Roger Paulin hingegen betont, Schlegel sei im Unterschied zu Eschenburg und Tieck „not a Shakespearean scholar“ gewesen („The editions that Schlegel is known to have used […] were made-up sets and of no particular textual distinction […].“). Roger Paulin: The Life of August Wilhelm Schlegel. Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge 2016, S. 92. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112, hier zitiert nach August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare. Bei Gelegenheit Wilhelm Meisters [1796]. In: August Wilhelm Schlegel: Kritische Schriften. Hrsg. von Emil Staiger. Zürich, Stuttgart 1962, S. 51–91, hier S. 88f. Novalis, Bd. 4, 1975 (Anm. 6), S. 237.
174
Tim Sommer
sich einbildet, als auf Originalwercke“.22 Dieses von ihm als „national[er] […] Hang“ und „Trieb“ charakterisierte Phänomen liest er als „eine Indication des sehr hohen, ursprünglichen Karacters des deutschen Volks. Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualitaet gemischt.“23 Das Übersetzen wird somit gleichzeitig zu einem Akt nationalkultureller Selbstvergewisserung und zu einer Form des weltliterarischen Interesses am Fremden und dem der eigenen „Individualitaet“ Entfernten.24 Sowohl Novalis’ Diagnose eines zeitgenössischen deutschen „Triebs“ zum Übersetzen als auch sein Verständnis von Übersetzung allgemein als Ausdruck kosmopolitischer Gesinnung sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien aufgegriffen worden. Der mit Novalis’ Werk vertraute Thomas Carlyle etwa hebt in seinem einflussreichen Aufsatz State of German Literature aus dem Jahr 1827 die zentrale Bedeutung von Übersetzungen für die Entwicklung der neueren deutschen Literatur hervor. Er bewundert die weitreichenden Interessen deutscher Autoren und benennt insbesondere die ausgedehnte Rezeption Shakespeares als ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal: The Germans study foreign nations in a spirit which deserves to be oftener imitated. It is their honest endeavour to understand each, with its own peculiarities, in its own special manner of existing; not that they may praise it, or censure it, or attempt to alter it, but simply that they may see this manner of existing as the nation itself sees it, and so participate in whatever worth or beauty it has brought into being. Of all literatures, accordingly, the German has the best as well as the most translations; men like Goethe, Schiller, Wieland, Schlegel, Tieck, have not disdained this task. Of Shakspeare there are three entire versions admitted to be good; and we know not how many partial, or considered as bad. In their criticisms of him, we ourselves have long ago admitted that no such clear judgment or hearty appreciation of his merits had ever been exhibited by any critic of our own.25
In der Annahme, die Deutschen verständen Shakespeare besser als die Engländer selbst, manifestiert sich ein zentraler Gedanke des um etwa die gleiche Zeit herum von Goethe formulierten Weltliteraturkonzepts (das selbst wiederum bekanntlich aus Goethes Auseinandersetzung mit Carlyle und dessen Schiller-Biographie sowie seiner Übersetzungen der Wilhelm Meister-Romane hervorging): die Vorstellung, dass ein der eigenen Nationalliteratur und dem eigenen Kulturraum ‚fremder‘, externer kritischer Blick auf das Eigene unvoreingenommen und darum unweigerlich klarer und schärfer als jeder 22 23 24
25
Novalis, Bd. 4, 1975 (Anm. 6), S. 237. Novalis, Bd. 4, 1975 (Anm. 6), S. 237. Claudia Bamberg hat gezeigt, wie eng Schlegels eigene Konzeption des Übersetzens mit solchem weltliterarischen Gedankengut zusammenhängt, und dabei treffend betont, dass seine Kommentare zu dieser Thematik, vergleichbar denen von Novalis, „zwischen nationaler und kosmopolitischer Ausrichtung changieren“. Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40, hier S. 36. Thomas Carlyle: State of German Literature. In: Edinburgh Review 46, 1827, S. 304–351, hier zitiert nach Thomas Carlyle: State of German Literature [1827]. In: Thomas Carlyle: The Works of Thomas Carlyle. 30 Bde. Hrsg. Henry Duff Traill. London 1896–1899, Bd. 26, S. 26–86, hier S. 55.
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
175
inländische sei. Die eigentlichen Stärken Shakespeares, seine „merits“, treten Carlyle zufolge also erst durch deutsche Kritik und deutsche Übersetzungstätigkeit zutage, weshalb wiederum ein Studium dieser kontinentalen Impulse auch und gerade für britische Leser gewinnbringend sei.26
4. (Rück-)Übersetzung. Die britische Shakespeare-Schlegel-Rezeption (George Moir) Dieser Gedanke findet sich in der britischen Wahrnehmung der deutschen ShakespeareRezeption auch später häufig wieder, wofür nun abschließend ein besonders exponiertes Beispiel näher betrachtet werden soll. Während seiner Zeit als Professor für „Rhetoric and Belles Lettres“ an der Universität Edinburgh verfasste Carlyles Zeitgenosse und Bekannter George Moir eine Serie von insgesamt sechs umfangreichen kritischen Essays, die unter dem Titel Shakspeare in Germany 1835 und 1836 in Blackwood’s Edinburgh Magazine erschienen. Darin macht Moir, nacheinander die Gattungen Tragödie, Historiendrama und Komödie behandelnd, sein britisches Publikum mit aktuellen deutschen Shakespeare-Übersetzungen und -Kommentaren vertraut.27 Eine besondere Rolle kommt dabei Schlegels Übertragungen zu, die Moir unter Übernahme des frühromantischen Programms des ‚poetischen‘ Übersetzens bespricht und seinen 26
27
In State of German Literature propagiert Carlyle ganz allgemein das Ideal des weltliterarischen Austauschs und zelebriert dessen Beförderung eines modernen interkulturellen Verständnisses zwischen den Nationen. An einer Stelle bemerkt er in diesem Sinn etwa: „the commerce in material things has paved roads for commerce in things spiritual, and a true thought, or a noble creation, passes lightly to us from the remotest countries, provided only our minds be open to receive it“. Carlyle 1896–1899 (Anm. 25), S. 30. Carlyle greift hier Goethes Wort vom weltliterarischen Kontakt als einem „freie[n] geistige[n] Handelsverkehr“ auf, das Goethe in einem Brief an ihn vom 20. Juli 1827 verwendet hatte und später erneut in seinem Vorwort zur deutschen Übersetzung von Carlyles Schiller-Biographie aus dem Jahr 1830 einfließen ließ. Johann Wolfgang Goethe: [Einleitung.] In: Thomas Carlyle: Leben Schillers. Frankfurt a.M. 1830, S. VII–XXIV, hier zitiert nach Johann Wolfgang Goethe: Thomas Carlyle, Leben Schillers. Aus dem Englischen. Eingeleitet durch Goethe [1830]. In: Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 133 Bände in 143. Weimar 1887–1919, Abt. I, Bd. 42.1, S. 185–206, hier S. 187. Vgl. allgemein zum Austausch zwischen Goethe und Carlyle Rosemary Ashton: The German Idea. Four English Writers and the Reception of German Thought, 1800–1860. Cambridge 1980, S. 76–91. Vgl. spezieller zu den weltliterarischen Aspekten des Themas Tim Sommer: Material Exchange, Symbolic Recognition. Weltliteratur as Discourse and Practice in Goethe, Carlyle, and Emerson. In: Publications of the English Goethe Society 90, 2021, S. 53–71. 1827, also im gleichen Jahr wie Goethe und Carlyle, greift auch Schlegel weltliterarisches Gedankengut auf, wenn er in der von ihm selbst herausgegebenen Indischen Bibliothek davon spricht, der Übersetzer sei „ein Bote von Nation zu Nation, ein Vermittler gegenseitiger Achtung und Bewunderung, wo sonst Gleichgültigkeit oder gar Abneigung Statt fand.“ August Wilhelm Schlegel: [Anmerkungen des Herausgebers.] In: Indische Bibliothek 2, 1827, S. 254–258, hier S. 255. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Anne Bohnenkamp: Universelle Poesie oder Weltliteratur? Anmerkungen zu August Wilhelm Schlegel und Goethe. In: August Wilhelm Schlegel und die Philologie. Hrsg. von Matthias Buschmeier und Kai Kauffmann. Berlin 2018 (Sonderhefte der Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 137), S. 55–70. George Moir: Shakspeare in Germany. In: Blackwood’s Edinburgh Magazine 37, 1835, S. 236–255, S. 523–533, S. 747–758; 39, 1836, S. 699–716; 40, 1836, S. 139–148, S. 427–436.
176
Tim Sommer
Landsleuten emphatisch zur Lektüre empfiehlt. Zentral ist dabei sein an Goethes Idee des interkulturellen Mehrwerts von weltliterarischem Austausch orientiertes Argument, „the criticisms and translations of Shakspeare in foreign languages“ führten zu einem positiv verfremdeten Blick auf kanonische Texte und zu einer Wiederbelebung von deren „original force“.28 Wie Moir war auch Carlyle mit den kritischen Schriften der Schlegel-Brüder vertraut und übernahm einiges von ihren Gedanken im Rahmen seiner eigenen Auseinandersetzung mit Shakespeare.29 Überhaupt waren die britischen Romantiker (neben Carlyle Figuren wie Samuel Taylor Coleridge, Charles Lamb, William Hazlitt und Thomas De Quincey) in ihrer ausgedehnten Beschäftigung mit Shakespeare zentral von deutschen Debatten geprägt.30 Moir greift diesen doppelten Bezugsrahmen (die britische Rezeption der deutschen Shakespeare-Rezeption) auf und buchstabiert ihn offen aus. Seine eigene Vertrautheit mit deutscher Literatur und Kritik kam dabei nicht von ungefähr. Wie der fünf Jahre ältere Carlyle war auch Moir selbst zunächst als Übersetzer in Erscheinung getreten. Nach einem absolvierten Jurastudium hatte er Ende der 1820er Jahre in Edinburgh einige ausgewählte Übertragungen von Schillers Stücken und historischen Schriften publiziert.31 Als er 1835 den Rhetorik-Lehrstuhl in Edinburgh übernahm, begann er sich eingehender mit literaturgeschichtlichen, theoretischen und kritischen Fragestellungen auseinanderzusetzen.32 In diese Zeit fällt auch seine intensive Lektüre Schlegels, die in der Essayreihe von 1835–1836 ihren Niederschlag gefunden hat. 28 29
30
31
32
Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 237. Anfang der 1830er Jahre bediente Carlyle sich sowohl bei Friedrich Schlegels Wiener Vorlesungen über die Geschichte der alten und neuen Literatur (1812) als auch bei August Wilhelms Schlegels Vorlesungen Über dramatische Kunst und Litteratur (1809–1811) beim Schreiben seiner zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen History of German Literature. Auch bei der Vorbereitung seiner eigenen literaturhistorischen Vorlesungsreihen, die er in den späten 1830er Jahren in London hielt, spielten die Brüder Schlegel eine Rolle. Vgl. Thomas Carlyle: Carlyle’s Unfinished History of German Literature. Hrsg. von Hill Shine. Lexington, Kentucky 1951, S. 121f. Vgl. als klassische Diskussion des Einflusses der Schlegels auf Carlyle René Wellek: Carlyle and the Philosophy of History. In: Philological Quarterly 23, 1944, S. 55–76, hier S. 62f., sowie für eine neuere Betrachtung Elizabeth M. Vida: Romantic Affinities. German Authors and Carlyle. A Study in the History of Ideas. Toronto 1993, S. 9–22. Vgl. zu Carlyles eigenen Shakespeare-Lektüren auch Tim Sommer: Shakespearean Negotiations. Carlyle, Emerson, and the Ambiguities of Transatlantic Influence. In: Thomas Carlyle and the Idea of Influence. Hrsg. von Paul E. Kerry, Albert D. Pionke und Megan Dent. Madison, New Jersey 2018, S. 129–143. Vgl. besonders zur Wirkung Schlegels Thomas G. Sauer: A. W. Schlegel’s Shakespearean Criticism in England, 1811–1846. Bonn 1981, und Stephanie Dumke, Nicholas Halmi: The Reception of A. W. Schlegel in British Romanticism. In: Serapion. Zweijahresschrift für europäische Romantik 1, 2020, S. 89–103. Vgl. zur Bedeutung von Schlegels Shakespeare-Übersetzungen und -Deutungen für Coleridge und Hazlitt auch den in dieser Hinsicht noch immer informativen Aufsatz von Walter F. Schirmer: August Wilhelm Schlegel und England. In: Shakespeare Jahrbuch 75, 1939, S. 77–107, hier S. 91–97. Friedrich Schiller: Schiller’s Piccolomini and Wallenstein. Übersetzt von George Moir. Edinburgh 1827; Friedrich Schiller: Schiller’s Thirty Years’ War. 2 Bde. Übersetzt von George Moir. Edinburgh 1828. Einen Überblick über Moirs biographische Stationen und seine literarischen Aktivitäten liefert ein in Blackwood’s erschienener Nachruf. Vgl. Anon.: The Late George Moir. In: Blackwood’s Edinburgh Magazine 109, 1871, S. 109–117. Vgl. zur Geschichte der 1760 eingerichteten und 1762 von George III. zum „Regius Chair of Rhetoric and Belles Lettres“ erhobenen Professur Winifred Bryan Horner: Nine-
Übersetzung, aemulatio, literarischer Kosmopolitismus
177
Die weltliterarische Dimension von Moirs Argument zeigt sich besonders deutlich im ersten seiner sechs Aufsätze. Darin erscheint beispielsweise die oben bereits in Ausschnitten zitierte Passage, in der von einem positiven Verfremdungseffekt von Übersetzungen die Rede ist: [A] source of freshness and novelty is gradually becoming more and more available to us, derived from the criticisms and translations of Shakspeare in foreign languages. Every one must have felt how often a favourite author actually becomes more intelligible to him, or at least the full force and meaning of many passages are more palpably brought home to him, by reading in a foreign language those ideas which, by repetition, had become matter of rote, and ceased to strike with their original force, in our own. Like flowers which, from being too much handled, have begun to lose their scent and bloom, but which revive again when plunged into water, so ideas and images, which from familiarity had lost their charm, regain their freshness and vigour in the new element of translation.33
Ausländische Übersetzung und Kritik erscheinen hier als eine Art Verjüngungskur für die eigene Literatur, die einer Abnutzung durch für selbstverständlich genommene Bekanntschaft (eine „matter of rote“, also etwas stumpf Auswendiggelerntes) entgegenwirkt. Shakespeare versteht Moir also im engen nationalen Kontext nicht als lebendig tradiertes Kulturgut, sondern als abgegriffenes Museumsstück („too much handled“), als konserviertes, vertrocknetes Relikt. Ein frischer Blick wird demnach erst durch das aktive Wahrnehmen kontinentaler Perspektiven, insbesondere von Übersetzungen („the new element of translation“), möglich. Moir lässt diesen Bemerkungen ein allgemeines Lob für die Deutschen folgen, wenn er schreibt: „Of all the continental critics on Shakspeare, Germany has certainly furnished incomparably the most original, the most profound, and the most eloquent; indeed, we may say, the only critics who have studied Shakspeare in the right spirit“.34 Der eröffnende Aufsatz liefert im Anschluss daran einen Überblick über deutsche Shakespeare-Übersetzungen, von denen Johann Joachim Eschenburgs über die von Johann Heinrich Voß und seinen Söhnen besorgten bis hin zu denjenigen des heute weniger bekannten Johann Wilhelm Otto Benda. Auch Ludwig Tieck findet hier am Rande Erwähnung, allerdings nicht in erster Linie als Übersetzer, sondern als ShakespeareKritiker und -Exeget.35 Das überschwänglichste Lob für die Übersetzung des Werks
33 34 35
teenth-Century Rhetoric at the University of Edinburgh with an Annotated Bibliography of Archival Materials. In: Rhetoric Society Quarterly 19, 1989, S. 365–375, sowie ausführlicher Winifred Bryan Horner: Nineteenth-Century Scottish Rhetoric. The American Connection. Carbondale, Illinois 1993, S. 54–70. Zu Moirs verhältnismäßig kurzer Amtszeit bemerkt Horner: „Moir had broad-ranging interests and successfully managed to publish widely in both law and belles lettres; but possibly because he found himself spread too thinly, he resigned the chair after only five years.“ Horner 1993, S. 62. Carlyle hatte sich 1834 selbst Hoffnungen auf die Besetzung des vakanten Lehrstuhls gemacht. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 236f. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 237. Moir nennt Tieck neben Schlegel als einen der wichtigsten deutschen kritischen Shakespeare-Kommentatoren der Zeit, wobei er feststellt, Schlegel sei in Großbritannien wohlbekannt, Tieck hingegen fast
178
Tim Sommer
Shakespeares hebt sich Moir für Schlegel auf, der es geschafft habe, „a translation at once faithful and poetical“ zu erreichen und darum „entitled […] to the very proudest elevation yet awarded to any European translator“ sei.36 Besonders im direkten Vergleich von Schlegels Übersetzungen mit denen von Voß zeigt sich für Moir die kongeniale Leistung Schlegels: „Voss’s translation“, befindet er, „looks more like an exact echo of Shakspeare, but, like other echos, fainter and weaker than the original: in Schlegel’s, we think we hear the voice of Shakspeare himself.“37 Moir unterscheidet also, wie Schlegel selbst, zwischen Geist- und Buchstabentreue und favorisiert das Prinzip der freieren Übertragung aufgrund seines Versprechens einer Annäherung an die unverstellte Autorintention („the voice of Shakspeare himself“).38 Damit sind wir abschließend wieder beim aemulatio-Gedanken des späten 18. Jahrhunderts angelangt, der am Ausgangspunkt dieser Überlegungen als ein komplexes „Verhältnis literarischer […] Produktion zu ihren Vorbildern“ beschrieben wurde.39 Auch Moir geht von der impliziten Annahme aus, die bekannten, gedruckten Fassungen der Stücke Shakespeares seien defizitär und einer Verbesserung bedürftig. Während sich dies bei Ireland in Form eines aktiven Eingreifens in den englischen Originaltext äußert, scheint es bei Moir in einer kosmopolitischen Betonung des interkulturellen Werts von Übersetzungen auf. Erst die Lektüre von Schlegels poetischen Übertragungen macht ihm zufolge den ‚eigentlichen‘ Shakespeare greifbar. Daher sind Schlegels Übersetzungen für Moir, ähnlich wie für Novalis, „besser“ als die Originale, die wiederum jene zu ihrer eigenen Vervollständigung benötigen. Das Übersetzen wird hier also nicht bloß als eine pragmatische Notwendigkeit verstanden, sondern ganz im Sinn der deutschen Frühromantik, deren europäische Reichweite hierin deutlich wird, als eine eigenständige Kunstform profiliert.
36
37 38
39
überhaupt nicht. An einigen Stellen fasst Moir Shakespeare-Lektüren Tiecks zusammen (etwa seine Interpretation von Hamlet), kann diesen in der Regel allerdings nicht viel abgewinnen. Vgl. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 247–252. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 242. Moirs ausführlichere Begründung dieses Urteils liest sich wie folgt: „His translation approaches, as nearly as we can conceive any translation can, to an absolute transcript of the original; […] which, when the reader is tolerably familiar with German, not unfrequently lead him almost to forget that he is not perusing Shakspeare himself.“ Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 242f. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 243. Moir war nicht nur mit den Übersetzungen Schlegels, sondern auch mit seinen kritischen Schriften bestens vertraut. Im zweiten Teil seiner Essayserie, in dem er sich Romeo and Juliet widmet, zieht er ausführlich Schlegels 1797 in den Horen erschienenen Aufsatz Ueber Shakespeare’s Romeo und Julia heran und übersetzt seitenweise daraus. Sauer bezeichnet Moirs Text dementsprechend als „little more than a stringing together of quotations from Schlegel’s essay on the play“. Sauer 1981 (Anm. 30), S. 135. Moirs Quelle war dabei der Wiederabdruck von Schlegels Aufsatz im ersten Band der Charakteristiken und Kritiken (1801), die er seinen britischen Lesern beschreibt als „[a] joint work by the two brothers, which has never been translated into English, and is comparatively little known in this country“. Moir 1835–1836 (Anm. 27), S. 527. Kuhnle 2000–2005 (Anm. 2), S. 79.
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
Praxis, Materialität, Aneignung Ludwig Tiecks Marginalien und Notizen zu Shakespeare
1. Einleitung Gemeinsam mit August Wilhelm Schlegel begründete Ludwig Tieck eine der mächtigsten Handelsmarken in der Geschichte der Shakespeare-Zirkulation, ein quasi eingetragenes Gütezeichen, das bis heute in zahllosen Aufführungen deutschsprachiger Bühnen für die Basis der Textadaptionen steht. Bekanntlich war Tiecks Anteil an dem fertigen Produkt nicht eben groß, so dass man ihn, bei Licht besehen, als Übersetzer Shakespeares nur sehr eingeschränkt buchen kann. Hingegen ist seine lebenslange intensive Beschäftigung mit dem Briten eine Tatsache, und die Summe seiner Beschäftigungen mit ihm umso gewichtiger, je sorgfältiger man das Ganze in den Blick nimmt und je mehr man vom Ideal eines buchgewordenen Resultats abrückt zugunsten einer Bilanz, die auch alle anderen Modi rezeptiver und produktiver Aktivität anerkennt. Kurz: Die angemessene Methode zur Erfassung von Tiecks Shakespeare-Arbeit im Allgemeinen wie auch seines Anteils am buchgestaltigen ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘ im Besonderen ist die Praxeologie. In ihrem Horizont konstatieren wir, dass das Arbeitspensum in Tiecks jahrzehntelang betriebenem Shakespeare-Laboratorium sich zusammensetzte aus einem breiten Spektrum spezifischer Aktivitäten, als da waren: sammeln (kaufen, kompilieren, kollationieren), lesen (interpretieren, memorieren, rezitieren), exzerpieren, kommentieren, transferieren (übersetzen, bearbeiten), kommunizieren (diskutieren, korrespondieren), verarbeiten (kritisieren, korrigieren, inszenieren, spekulieren) und nicht zuletzt: poetisieren, dramatisieren, erzählen, fiktionalisieren. Im Rahmen dieses Beitrags kann dies nicht alles proportional abgebildet werden; indes sollen mit Fokus auf den sog. ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘ im Folgenden die Praktiken des Sammelns, des Transformierens und des Lesens als Paradigmen der Tieckschen Shakespeare-Rezeption ausführlich behandelt werden. Obwohl die eigentliche Übersetzungsarbeit von Wolf von Baudissin und Dorothea Tieck geleistet wurde, sah Tieck beim Erscheinen der ersten Edition (1825–1833) kein, im Falle späterer Auflagen ein nur geringfügiges Problem darin, die indirekte Urheberschaft der ersten vollständigen deutschen Versübersetzung von Shakespeares Dramen
https://doi.org/10.1515/9783111017419-013
180
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
für sich zu beanspruchen.1 Jenseits seines realen Anteils am Entstehen der Übersetzungen dürfte Tieck auf Basis seiner lebenslangen Beschäftigung mit Shakespeare und dessen Werk mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein davon ausgegangen sein, eine Art Anrecht auf die literaturgeschichtliche Verknüpfung seines Namens mit dem des Briten beanspruchen zu dürfen. Seine Shakespeare-Praxis als Kritiker, Gelehrter, Herausgeber, Übersetzer, Dramaturg, (Vor)Leser und Sammler umfasste Tiecks gesamtes Leben. Ein prominenter Platz kam Shakespeare nicht nur in ersten literarischen Arbeiten Tiecks zu, sondern auch in den unveröffentlichten, von ihm hinterlassenen handschriftlichen Aufzeichnungen sowie innerhalb seines materiellen Literaturbesitzes, seiner Bibliothek, und beim konfliktträchtigen Verkauf derselben. Während der Tieck-Forschung des zwanzigsten Jahrhunderts nur die umfangreichen Bestände Tieckscher Provenienz an der British Library bekannt und zugänglich waren, hat es die voranschreitende digitale Erfassung internationaler Bibliotheksbestände möglich gemacht, große Teile von Tiecks 1849 in einer Auktion verkauften Büchersammlung und damit auch die enthaltenen Spuren seiner Shakespeare-Studien an weiteren Bibliotheken in ganz Europa zu lokalisieren. Basierend auf dem Auktionskatalog und auf einer Auswertung seiner Briefwechsel wurde Tiecks materieller Buchbesitz, der einst etwa 17.000 Bände umfasste, in den vergangenen Jahren in einer Datenbank rekonstruiert.2 Im Fall von rund 5.000 Bänden, deren heutiger Aufbewahrungsort ermittelt werden konnte, wurden die bibliographischen Daten und im autoptischen Verfahren wesentliche materielle Eigenschaften erfasst, darunter auch alle Arten von Leseund Besitzspuren. Anstreichungen und Marginalien finden sich auffallend häufig innerhalb von Tiecks Shakespearesammlung, obwohl diese zwar einen gewichtigen, jedoch nicht den einzigen Schwerpunkt seiner Bibliothek bildete. Weder in den heute bekannten Teilen seiner Sammlung von Originaldrucken spanischer Dramen, die mehr als 1.500 wertvolle Exemplare aus dem Siglo de Oro umfasste, noch in Tiecks Ausgaben von Werken der deutschen Literatur der frühen Neuzeit, sind Marginalien vergleichbaren Umfangs enthalten, und zwar nicht etwa aus Respekt vor der Aura der alten Drucke. Der Forschung ist dies bereits vor der digitalen Rekonstruktion der Bibliotheca Tieckiana aufgefallen; so gab es schon im zwanzigsten Jahrhundert wissenschaftliche Bemühungen um einige marginalienreiche Bände aus Tiecks Bibliothek an der British Library. Ein Überblick über die Werke zum elisabethanischen Drama aus den dortigen Beständen, in denen Marginalien Tiecks enthalten sind, liegt in zwei Beiträgen von
1
2
Baudissins Anteil an den Übersetzungen würdigte Tieck bereits im Nachwort zur zweiten, revidierten Ausgabe von 1839/40, wohingegen Dorothea Tieck weiterhin nur als „anderer Übersetzer, der sich nicht nennen will“ bezeichnet wird. Erst fünfzehn Jahre später wurde mit dem Erscheinen von Rudolf Köpkes Tieck-Biografie auch ihr Anteil an den Übersetzungen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt (vgl. Rudolf Köpke: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen. Bd. 2. Leipzig 1855, S. 61f.). FWF-Projekt Ludwig Tiecks Bibliothek (P 26814 und P 32038, Projektleitung: Prof. Achim Hölter, Laufzeit: 1.10.2014 bis voraussichtlich 30.9.2023), Datenbank: https://tieck-bibliothek.univie.ac.at (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 16.1.2023 gesehen).
Praxis, Materialität, Aneignung
181
Harvey Hewett-Thayer vor.3 Eine erste summarische Übersicht über Werke der englischen Literatur und besonders von und zu Shakespeare innerhalb der Bibliothek Tiecks beinhaltete Edwin H. Zeydels 1932 veröffentlichte Monographie über Tieck und England.4 Eine exemplarische Rekonstruktion von Tiecks philologischer Arbeitsweise hat Walther Fischer anhand einer Auswahl der Notizen Tiecks in den beiden dort befindlichen Werkausgaben Ben Jonsons durchgeführt.5 Die bislang umfangreichste Auseinandersetzung mit Tiecks Marginalien ist Elisabeth Neus Dissertation aus dem Jahr 1986,6 in der exemplarische Marginalien aus den beiden Jonson-Ausgaben sowie aus Tiecks 23-bändiger Shakespeare-Edition von Johnson und Steevens und aus zwei Werken von Shakespeare-Forschern des neunzehnten Jahrhunderts transkribiert und kommentiert werden.7 Bislang kannte die Tieck-Forschung aber allein die Marginalien in den Beständen der British Library und die im Nachlass enthaltenen Handschriften. Die TieckBestände in der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) und in anderen Bibliotheken wurden erst im Zuge der Rekonstruktion von Tiecks Bibliothek wiederentdeckt und waren bislang noch kein Gegenstand systematischer Untersuchungen. In eine Erfassung von Tiecks Sammel-, Lektüre- und Studienpraxis zu Shakespeare sind jedoch unbedingt auch diese Werke miteinzubeziehen.
2. Paradigma 1: Sammeln – Tiecks Shakespeare-Bibliothek Ludwig Tiecks wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Shakespeare war von Beginn an mit der Sammlung und Kollation von dessen Werken verbunden. Neben zahlreichen raren Editionen des siebzehnten Jahrhunderts erwarb Tieck bis ins hohe Alter 3
4
5
6
7
Harvey W. Hewett-Thayer: Tieck’s Marginalia in the British Museum. In: Germanic Review 9, 1934, S. 9–17 und ders.: Tieck and the Elizabethan Drama. His Marginalia. In: The Journal of English and Germanic Philology 34, 1935, Nr. 3, S. 377–407. Erwin H. Zeydel: Ludwig Tieck and England. A Study in the Literary Relations of Germany and England During the Early Nineteenth Century. Princeton 1931. Walther Fischer: Zu Ludwig Tiecks elisabethanischen Studien. Tieck als Ben Jonson-Philologe. In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 62, 1926, S. 98–131. Fischer behandelt einige Marginalien in den von der British Library erworbenen Ben Jonson-Ausgaben BT 1933 (BT bezeichnet hier und im Folgenden die Losnummer im Katalog der Bibliotheca Tieckiana): Ben Jonson: The Works. London 1692, British Library, C.61.f.1. und BT 1934: The Works. 9vol. London 1816, British Library, C.182.a.1. sowie das Exzerpt eines Auszugs aus Giffords Memoirs of Ben Jonson aus Tiecks Nachlass (Preußische Staatsbibliothek, Ms. Germ. Fol. 833, 28re bis 31vs.). Elisabeth Neu: Tieck’s Marginalia on the Elizabethan Drama. The holdings in the British Library. Dissertation. Cambridge 1986. In der Dissertation werden neben BT 1933 (Anm. 5) und BT 1934 (Anm. 5) folgende Titel, die im Rahmen der Auktion der Bibliotheca Tieckiana in den Besitz der British Library gelangten, untersucht: BT 2152: The Plays of William Shakspeare. With the corrections and illustrations of various commentators. To which are added, notes by Samuel Johnson and George Steevens. A new edition. 23vol. London 1800; BT 7033: Lectures on the Dramatic Literature of the Age of Elizabeth. Second Edition. London 1821, British Library, C.182.aa.5.; BT 1927: Characteristics of Women, moral, poetical, and historical. London 1833, British Library, C.28.g.11.; BT 6997: The History of English Dramatic Poetry to the Time of Shakespeare: and annals of the stage to the Restoration. London 1831, British Library, C.182.aa.1.
182
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
hinein systematisch Neuerscheinungen aus der Shakespeare-Forschung und verfolgte die Veröffentlichungen der englischen Shakespeare-Society. Einen Überblick darüber, welche Werke er zu seinem Shakespeare-Korpus zählte, bietet der Auktionskatalog, der anlässlich der Versteigerung im Winter 1849/50 unter dem Titel Catalogue de la bibliothèque célèbre de M. Ludwig Tieck qui sera vendue a Berlin le 10. Décembre 1849 et jours suivants par MM. A. Asher & Comp. (Berlin 1849) veröffentlicht wurde. Die Sparte ‚Langue et Litérature [sic!] Anglaise‘ umfasst darin 743 Titel (BT 1620–2362). Der Unterkategorie ‚Shakespeare. – Écrits – Vie – Critiques – Traductions etc.‘ wurde etwa ein Siebtel, nämlich 110 dieser Titel, zugeordnet (BT 2144–2253). Die Sektion bildet nicht nur die materielle Grundlage von Tiecks Shakespeare-Philologie und -Kritik ab, sondern lässt auch erkennen, wie gründlich Tieck mit der Professionalisierung der englischen Shakespeare-Edition im Verlauf des achtzehnten Jahrhunderts vertraut war. Für sieben in der Shakespeare-Sparte enthaltene Titel verzeichnet der Auktionskatalog Marginalien Tiecks; so sind die Nummern 2144, 2145, 2146, 2152, 2183, 2204 und 2210 mit einem Asterisk gekennzeichnet. Vier dieser Titel wurden von der K.K. Hofbibliothek erworben und befinden sich heute an der ÖNB, darunter die zweite, dritte und vierte Folio,8 die zwar nur an wenigen Stellen Marginalien, jedoch alle Einträge Tiecks zur Provenienz oder zum Erwerbszeitpunkt auf den vorderen Seiten enthalten. Die First Folio besaß Tieck hingegen nur in einer – der ersten je erschienenen und von Francis Douce verlegten – Faksimile-Edition.9 Die vierte Folio von 1685 erhielt Tieck, so sein Eintrag auf dem Vorsatz, durch Johann Joachim Eschenburg bereits „im Herbst 1793 von London in Göttingen“. Die Ausgabe enthält darüber hinaus nur einige wenige Anmerkungen aus Tiecks Hand zum apokryphen Locrine. (Abb. 1) Neben seinen Folio-Ausgaben besaß Tieck eine Reihe von Shakespeare-Editionen des achtzehnten Jahrhunderts.10 Ebenfalls von Eschenburg, und zwar posthum aus der Versteigerung von dessen Bibliothek im Jahr 1822 erwarb Tieck Edward Capells Kommentarwerk Notes and various readings to Shakespeare,11 wie wiederum seinem Eintrag auf dem Vorsatz des heute an der ÖNB befindlichen Werkes zu entnehmen ist.
8
9
10
11
BT 2144: Comedies, Histories and Tragedies. Published according to the true Originall copies. London 1632, ÖNB, 51.P.8.; BT 2145: Comedies, Histories, and Tragedies. Published according to the true Original Copies. And unto this Impression is added seven Playes, never before printed in Folio. London 1664, ÖNB, 51.P.9.; BT 2146: Comedies, Histories, and Tragedies. Published according to the true Original Copies. Unto which is added, Seven Plays, Never before Printed in Folio. London 1685, ÖNB, 51.P.10. BT 2158: Comedies, histories and tragedies. Published according to the True Originall copies. London 1623, I. Iaggard and C. Blount, Reprint 1807. BT 2147: The works. 6 Bde. London 1709, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, Fb 379.; BT 2148: The works in six volumes by Alexander Pope. 6 Bde., London 1725 (aus der Auktion von der Königlichen Bibliothek Berlin erworben, späterer Kriegsverlust der Staatsbibliothek Berlin, Zc 5670); BT 2149: Twenty of the plays of Shakespeare. 4 Bde. London 1766, ÖNB, 23715-B.1-4., BT 2155: Comedies, Histories and Tragedies. 10 Bde. London [1768], ULB Bonn, Fb 379. Zu den englischen Shakespeare-Editionen des achtzehnten Jahrhunderts vgl. Marcus Walsh: Editing and publishing Shakespeare. In: Shakespeare in the Eighteenth Century. Hrsg. von Fiona Ritchie und Peter Sabor. Cambridge 2012. BT 2210: Notes and various readings to Shakespeare. 4 Bde. London 1779–1780, ÖNB, 23707-C.4.
Praxis, Materialität, Aneignung
183
Jene Edition, die Tieck am intensivsten als Grundlage seiner Studien nutzte, ist im Auktionskatalog in einem mehrzeiligen Kommentar als Marginalien-Exemplar „de la plus grande importance“ gekennzeichnet. (Abb. 2)
Abb. 1: Besitzeintrag Tiecks in BT 2146, Vorsatz verso: Dieses Exempl. erhielt ich durch Eschen-/burgs Bemühung schon im Herbst 1793. / von London in Göttingen. Die beige- / schriebenen Bemerkungen [eingefügt: zum Locrin] sind von mir. / L. Tieck.
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Catalogue de la bibliothèque célèbre de M. Ludwig Tieck, S. 85 mit Los-Nr. 2152, Tiecks 23-bändiger marginalienreicher Studienausgabe von Shakespeares Werken.
Es handelt sich um eine Auflage von Samuel Johnsons und George Steevens erstmals 1778 in London erschienener Variorum-Ausgabe von Shakespeares Dramen. Die Erstausgabe besaß Tieck nicht; vielmehr diente ihm die zwischen 1799 und 1802 in Basel von Johann Jakob Thurneysen verlegte Ausgabe in 23 Oktav-Bänden als Arbeitsexemplar.12 Die Edition wurde von Tieck als „brauchbarste Ausgabe Shakspear[s]“13 12
13
BT 2152: The Plays. With the corrections and illustrations of various commentators. To which are added, notes. 23 Bde. Basel 1799–1802, British Library, C.134.dd.1. Aufsatz über Shakespeare (6 Bl), Goethe und Schiller Archiv Weimar (GSA), 28/916, zit. n. James Trainer: Some Unpublished Shakespeare Notes of Ludwig Tieck. In: The Modern Language Review 54, 1959, Nr. 3, S. 371.
184
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
bezeichnet und konnte von der Bibliothek des British Museum erworben werden, womit sich die in der Zeitschrift Notes & Queries formulierte Hoffnung, das Los möge in englische Hände gehen, erfüllte.14 Neben den genannten Werkausgaben findet sich eine Reihe einzelner Stücke und Apokryphen überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert im englischen Original oder in deutschen Übersetzungen im Katalog (BT 2188–2204), darunter eine annotierte, jedoch heute verschollene Ausgabe des Arden of Feversham15 sowie einschlägige kritische, biographische und bibliographische Werke, etwa Johann Joachim Eschenburgs Schrift Ueber den vorgeblichen Fund Shakspearischer Handschriften,16 James Halliwell-Phillipps’ Katalog der Shakesperiana17 und William Hazlitts Characters of Shakespear’s plays.18
3. Paradigma 2: Transferieren I – Arbeit an und mit Übersetzungen Auch der Stand der deutschen Shakespeare-Übersetzungen bis zur Auktion 1849 findet sich im Katalog weitgehend abgebildet. Den Beginn der intensiveren goethezeitlichen Rezeption Shakespeares19 in deutscher Sprache markierten die Übersetzungen Christoph Martin Wielands, der zwischen 1762 und 1766 22 Stücke Shakespeares ins Deutsche übertrug. Wieland nutzte William Warburtons unautorisierte Shakespeare-Edition von 1747 als Grundlage seiner Übersetzungen, die nicht in Tiecks Bibliothek enthalten war; sehr wohl ist jedoch die deutsche Erstübertragung Wielands in acht Bänden vorhanden, für die der Auktionskatalog keine Marginalien oder Besonderheiten verzeichnet.20 Selbstverständlich besaß Tieck auch die Erstausgabe der von Eschenburg in der
14
15
16
17
18 19
20
„The following lot, comprising an edition, we believe, not very generally known, and containing the manuscript notes and comments of so profound a critic as Ludwig Tieck, ought to find an English purchaser.“ In: Notes & Queries 3, 17.11.1849, Nr. 1, S. 44–45. BT 2204: The lamentable and true tragedie of M. Arden of Feversham in Kent. London 1770. Von der Königlichen Bibliothek Berlin aus der Auktion erworben und als Nr. 88728 im Akzessionsverzeichnis enthalten, gegenwärtiger Standort unbekannt. BT 2220: Ueber den vorgeblichen Fund Shakspearischer Handschriften. Leipzig 1797, British Library, 11762.d.3. Es geht darin um die Fälschungen von William Henry Ireland. Vgl. den Beitrag von Tim Sommer in diesem Band. BT 2226: Shaksperiana. A Catalogue of the early editions of Shakespeare’s Plays, and of the commentaries and other publications illustrative of his works. London 1841, Bibliothèque royale de Belgique, C.L 584. BT 2227: Characters of Shakspearʼs plays. London 1818. Vgl. Günther Erken: Deutschland. In: Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch – Das Werk – Die Nachwelt. Hrsg. von Ina Schabert. Stuttgart 2000, S. 635–660; Klaus P. Steiger: Die Geschichte der Shakespeare-Rezeption. Stuttgart u.a. 1987, bes. S. 91–95. BT 2176: William Shakespeare: Theatralische Werke. 8 Bde. Zürich 1762–1766.
Praxis, Materialität, Aneignung
185
Nachfolge Wielands überarbeiteten und fortgesetzten ersten vollständige Prosa-Übersetzung21 sowie spätere Auflagen des Wieland-Eschenburg-Shakespeares,22 wobei keine der Editionen Anmerkungen Tiecks enthalten dürfte. Eine der wenigen Lücken der Bibliotheca Tieckiana scheint Caspar Wilhelm von Borcks Versuch einer gebundenen Uebersetzung des Trauerspiels von dem Tode des Julius Cäsar, Aus dem Englischen Wercke des Shakespeare gewesen zu sein, das 1741 als erste deutsche Shakespeare-Übersetzung überhaupt die Rezeption des Elisabethaners einläutete. Ebenfalls nicht im Tieckschen Versteigerungskatalog enthalten ist die erste neun Bände umfassende Auflage von Shakespeare’s dramatischen Werken in der Übersetzung Schlegels (Berlin: Unger 1797–1801, 1810), von der man annehmen müsste, Tieck habe sie besessen. Möglich, dass die Ausgabe ob der markanten Stellung, die ihr in Tiecks Biographie zukam, auch nach der Auktion in seinem Besitz verblieb. Verkauft, und zwar an die Bibliothek des British Museum, wurde hingegen die in der Zeitspanne zwischen dem Stillstand der Schlegelschen Übersetzung und deren Fortsetzung durch den Tieck-Kreis veröffentlichen Übertragungen von Hans Carl Dippold, Georg Wilhelm Keßler und Ludwig Krause, die unter dem Titel Shakspeare’s von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke, übersetzt von mehreren Verfassern bei Julius Hitzig in drei Bänden in Berlin erschienen war. Band zwei und drei enthalten einige Anstreichungen und Notabene-Kürzel, die vermutlich von Tieck stammen.23 Auch der zeitgleich erscheinende erste Band der Übertragungen von Abraham und Heinrich Voß, der ebenfalls noch nicht von Schlegel in Versform gebrachte Stücke enthielt, findet sich im Auktionskatalog wieder.24 Gemeinsam mit der zwischen 1818 und 1820 (mit dem Vater Johann Heinrich Voß) vollendeten vollständigen Übersetzung25 befinden sich diese vor bzw. während der Arbeit an den Übersetzungen des Tieck-Kreises erschienenen Editionen heute an der British Library. Lesespuren, die Tiecks harsche, in der Vorrede zum ersten Band der Schlegel-Tieck-Übersetzung formulierte Kritik an diesen Übertragungen widerspiegeln, sind darin jedoch nicht enthalten.26 Von der 1810 gedruckten ersten Ausgabe ist nur ein Band erhalten. Er trägt einen Besitzeintrag Dorothea Tiecks (Abb. 3), weist jedoch darüber hinaus keinerlei Lesespuren auf, die annehmen ließen, dass die Übersetzerin die Ausgabe bei ihrer eigenen Arbeit konsultiert hätte. Spuren einiger Textarbeit Ludwig Tiecks finden sich hingegen in einer 1806 erschienenen Ausgabe der Übersetzungen von Othello und König Lear 21 22 23
24
25
26
BT 2177: William Shakespeare: Schauspiele. 13 Bde. Zürich 1775–1782. BT 2178 und BT 2179: Schauspiele. Neue ganz umgearbeitete Ausgabe. 12 Bde. Zürich 1798–1805. BT 2183: Shakspeare’s von Schlegel noch unübersetzte dramatische Werke. Übersetzt von mehreren Verfassern. 4 Bde. Berlin 1810, British Library, 11762.e.8. BT 2180: Schauspiele von William Shakspeare. Übersetzt von Heinrich Voß und Abraham Voß. Erster Theil. Tübingen 1810–1815, British Library, 11762.e.6. BT 2181: Shakspeare’s Schauspiele von Johann Heinrich Voß und dessen Söhnen Heinrich Voß und Abraham Voß. Mit Erläuterungen. Leipzig 1818–1829, British Library, 11762.e. Vgl. die Vorrede zum ersten Band, in der Tieck schreibt, die Voß-Übersetzung stammle „in einem niemals gesprochenen Deutsch schwer und unverständlich Zufälligkeiten des Dichters nach […], die sich selbst im Originale nicht finden.“ Zit. n. Uwe Schweikert: Ludwig Tieck, Bd. 3. München 1971 (Dichter über ihre Dichtungen), S. 74.
186
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
von Johann Heinrich Voß.27 In beiden Stücken wurden zahlreiche Stellen seitlich markiert, umgestellt, gestrichen oder mit kurzen Anmerkungen versehen.
Abb. 3: Titelblatt von BT 2180, British Library Sig. 11762.e.6. mit Besitzeintrag Dorothea Tiecks.
27
BT 2196: Othello und König Lear. Übersetzt von Dr. Johann Heinrich Voß. Mit fünf Compositionen. Jena 1806, British Library, 11762.b.2.
Praxis, Materialität, Aneignung
187
Das für Tiecks Lektüre- und Übersetzungspraxis wohl wichtigste Nachschlagewerk dürfte Theodor Arnolds Vocabulary28 gewesen sein. Auf die Existenz des durchschossenen und mit unzähligen Ergänzungen und Anmerkungen Tiecks versehenen Exemplars an der British Library hat bereits Harvey Hewett-Thayer hingewiesen, der das Werk als „eloquent witness to Tieck’s thorough and unwearied study of the English tongue“29 bezeichnete. Weitere Wörterbücher finden sich zwar im Auktionskatalog, weisen jedoch keine Annotationen auf. Ergänzend zu den Marginalien in Arnolds Vocabulary führte Tieck ein eigenes Wortregister zu Shakespeare, das in seinem Nachlass erhalten ist.30 454 Kleinoktav-Blätter zeugen von der Betätigung Tiecks als Glossator Shakespeares. Die Kartei enthält Worterläuterungen, Parallelen und Vermutungen zur Bedeutung, wobei Tiecks Interesse primär den Bereichen Etymologie, Fachsprachen, Phraseologie und Stilistik galt.31 Jedem Begriff ist dabei der Verweis auf das entsprechende Shakespeare-Drama zugeordnet. Bestehende deutsche Übersetzungen, Wörterbücher und Nachschlagewerke dürften in den Jahren 1824 bis 1833 auch im Zuge der ‚Corrigirstunden‘, in denen die Shakespeare-Übersetzungen Wolf von Baudissins und Dorothea Tiecks vorgelesen und geändert wurden, von den Mitgliedern des Tieck-Kreises konsultiert worden sein. (Abb. 4) Wie sowohl aus Aufzeichnungen Wolf von Baudissins als auch Dorothea Tiecks hervorgeht, waren derartige Vorleserunden elementarer Bestandteil des Arbeitsprozesses bei der Entstehung des ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘.32 Über einige wenige Briefstellen hinausgehende Selbstzeugnisse oder handschriftliche Notizen, Entwürfe oder Marginalien Dorothea Tiecks, die ihre Arbeit als Übersetzerin dokumentierten, sind kaum erhalten, sieht man von der Reinschrift ihrer Übersetzung der Sonette in Tiecks Nachlass ab.33
28 29 30
31 32
33
BT 1631: A Compleat Vocabulary, English and German. Leipzig 1757, British Library, C.134.b.14. Hewett-Thayer 1934 (Anm. 3), S. 16. Staatsbibliothek zu Berlin, NL-Tieck 20, Wortregister zu Shakespeare, 455 Bl. 17-19x10-11cm, 1817 von Tieck handschriftlich in London angelegt. Vgl. Achim Hölter: Ludwig Tieck. Literaturgeschichte als Poesie. Heidelberg 1989, S. 199. Vgl. https://www.berliner-intellektuelle.eu/manuscript?Brief08DorotheaTieckanUechtritz+de#1 und H. von Langermann: Ein Brief des Grafen Wolf Baudissin über die Vollendung der Schlegel-Tieckschen Shakespeare-Übersetzung. In: Shakespeare Jahrbuch 71, 1935, S. 107–109 sowie Hermann von Friesen: Ludwig Tieck. Erinnerungen eines alten Freundes aus den Jahren 1825–1842. Bd. 1. Wien 1871, S. 12. Staatsbibliothek zu Berlin, NL-Tieck 17, Shakespeares Sonette übersetzt von Dorothea Tieck, 140 Bl., Dresden 1824. Von Dorothea Tieck sind nur einige wenige Äußerungen in Briefen erhalten, in denen sie über ihre Übersetzungsarbeit schreibt. Diese sind in der Forschung bereits vielfach bemüht worden, vgl. z.B. Käthe Stricker: Dorothea Tieck und ihr Schaffen für Shakespeare. In: Shakespeare Jahrbuch 72, 1936, S. 79–92.
188
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
Abb. 4: Carl Christian Vogel von Vogelstein: David dʼAngers modelliert die Büste Ludwig Tiecks. (Öl auf Leinwand, 1836, Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum / David Hall). Das einzige existierende Bildnis der Übersetzergemeinschaft: rechts hinter dem sitzenden Tieck seine Tochter Dorothea. Hinter dem Porträtisten Vogel ist Wolf von Baudissin abgebildet. Siehe auch den Abdruck der Erstfassung des Gemäldes im Beitrag von Thomas Bürger, Abb. 1.
Etwas umfangreicher hingegen sind die Zeugnisse vom mehrstufigen Prozess der Textgestaltung bei der gemeinsamen Arbeit an den Übersetzungen, die sich von Seiten Wolf von Baudissins erhalten haben.34 Sein Biograph Bernd Goldmann35 sah vor Jahrzehnten seine Tagebücher ein; an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden werden unter dem Titel Übersetzungen des W. G. v. Baudissin elf Bände mit Handschriften aus dem Besitz Baudissins aufbewahrt.36 Sie umfassen – sieht 34
35
36
Vgl. u.a. W. Schulz: Der Anteil des Grafen Baudissin an der Shakespeareübersetzung Schlegel-Tiecks. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 60, 1935, S. 52. Bernd Goldmann: Wolf Heinrich Graf Baudissin. Leben und Werk eines großen Übersetzers. Hildesheim 1981, zu den Shakespeare-Übersetzungen vgl. S. 119–133. Vgl. auch John Sayer: Wolf Graf Baudissin (1789–1878). Sein Leben – seine Zeit. Ein Übersetzen. Berlin 2015, bes. S. 93–109. SLUB Dresden, Sign. Mscr. Dresd. E. 93.
Praxis, Materialität, Aneignung
189
man von König Heinrich der Achte ab – Übersetzungsmanuskripte zu allen von Baudissin übersetzten Stücken. Mit Viel Lärmen um Nichts und Der Widerspenstigen Zähmung liegen zudem auch von zwei Stücken Zeugnisse vor, die gemeinsam mit Dorothea Tieck übersetzt wurden und in denen die jeweiligen Anteile an der Übersetzung nachvollzogen werden können. In den 1920er Jahren hat Henry Lüdeke diese Übersetzungshefte für sein Werk über Tieck und das alte englische Theater37 einer genaueren Betrachtung unterzogen. Er betrachtet die Übersetzungsmanuskripte als Beleg dafür, dass die Übersetzungen tatsächlich „Zeile für Zeile und fast Wort für Wort durchkorrigiert“38 wurden und dass Tiecks Anteil dabei so gewichtig war, dass diese trotz der die reale Aufgabenverteilung doch verschleiernden Subsumption Baudissins und Dorotheas unter seinen Namen als legitimes Hauptwerk seiner Shakespeare-Beschäftigung angesehen werden könnten. Dorothea Tieck weist Lüdeke dabei eine unter Tiecks Genie und Baudissins „treibenden Geist“39 untergeordnete Rolle zu. Eine Einschätzung, die mangels Zeugnissen von Dorothea Tiecks Übersetzungstätigkeit vielleicht allzu leichtfertig getroffen wurde, zumal sie mit den zu Dorotheas und auch noch zu Lüdekes Lebzeiten verbreiteten Rollenbildern korrespondiert, nach denen ‚Schaffenskraft‘ und ‚Produktivität‘ primär als männliche Kompetenzen galten. Eine zeitgemäße Edition des ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘ sollte diese Perspektive nicht fortschreiben, sondern mindestens versuchen, auf die Leerstellen hinzuweisen, die aus den fehlenden materiellen Zeugnissen von Dorothea Tiecks Übersetzertätigkeit und dem biografisch und qua Geschlechterrolle bedingten Mangel an Egodokumenten resultieren.
4. Paradigma 2: Transferieren II – Shakespeare bei Tiecks Vorleseabenden Was Tiecks Einfluss auf die Übersetzungsarbeiten Dorothea Tiecks und Wolf von Baudissins geprägt haben dürfte, war nicht nur seine intensive Lektüre und sein immenses Vorwissen zu Shakespeare, das auf dem dargestellten Materialkorpus basierte, sondern auch seine Erfahrungen als Theatermann und als Vorleser der Shakespeare’schen Dramen. Von 1825 bis 1842 war Tieck als Dramaturg am Dresdner Hoftheater beschäftigt und setzte sich dafür ein, einen neuen, anti-illusionistischen Stil durchzusetzen und Shakespeare auf die Dresdner Theaterbühne zu bringen.40 Mit den Dramen des Briten konnte sich das Dresdner Publikum auch bei Tiecks teils mehrmals wöchentlich abgehaltenen
37
38 39 40
Henry Lüdeke: Ludwig Tieck und das alte englische Theater. Ein Beitrag zu Geschichte der Romantik. Frankfurt a.M. 1922. Lüdeke 1922 (Anm. 37), S. 241. Lüdeke 1922 (Anm. 37), S. 249. Waren vor 1820 nur sieben Stücke Shakespeares in Dresden aufgeführt worden, erhöhte sich dessen Präsenz im Dresdner Spielplan seit Tiecks Ankunft 1820 merklich. Vgl. Peter Reinkemeier: Der Dramaturg. In: Ludwig Tieck. Leben – Werk – Wirkung. Hrsg. von Claudia Stockinger und Stefan Scherer. Berlin, Boston 2011, S. 408–423, hier S. 411.
190
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
Vorleseabenden vertraut machen.41 Auch wenn Tiecks Vorleserepertoire Autoren von der Antike bis zur Gegenwart umfasste, war es doch vor allen anderen Shakespeare, dem eine dominante Stellung bei den Vorleseabenden zukam. Tiecks Betätigung als Vorleser eigener und fremder literarischer Werke war in der Zeit zwischen 1820 und 1840 fester Bestandteil des Dresdner Kulturlebens und trug wesentlich zu seiner Berühmtheit und zur Formation einer treuen Anhängerschaft um ihn bei. Seinen Shakespeare-Lesungen lag die Überzeugung zugrunde, dass die Werke des Elisabethaners eher auf der Vorlese- denn auf der Theaterbühne realisierbar seien – eine Auffassung, die bereits Goethe in Shakespeare und kein Ende! vertreten hatte.42 In der Zeitspanne, in der die Übersetzungen in der Nachfolge Schlegels verfasst wurden, dürfte es die Hörbühne seines Salons am Altmarkt gewesen sein, die als der Ort fungierte, an dem der Effekt gesprochener dramatischer Sprache für Tieck erfahrbar wurde. Translatorische Prinzipien wie das Vermeiden handlungshemmender Breiten oder das Bemühen um Knappheit und die Beibehaltung der shakespeareschen Wortregie stellen für die Hörbühne noch dringlichere Erfordernisse dar als für die Theaterbühne, muss erstere doch die Aufmerksamkeit des Publikums mit rein akustischen Mitteln an sich binden. So verwundert es kaum, dass gerade solche Charakteristika für die Übersetzungen des Tieck-Kreises konstatiert wurden und dass es als Leistung Tiecks betrachtet wird, ein Augenmerk auf die Bühnentauglichkeit des gesprochenen Textes gelegt zu haben, was schließlich zur Durchsetzung des ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘ in der theatralischen Praxis beitrug.43 Welche Textfassungen es waren, die die Grundlage der Shakespeare-Vorlesungen bildeten, ist nicht exakt ermittelbar. Weder sind Bücher aus Tiecks Bibliothek als Vorleseexemplare erkennbar, noch finden sich in seinem Nachlass Manuskripte, von denen anzunehmen ist, dass sie als Textgrundlage der Vorleseabende dienten. Fest steht, dass Tieck sowohl die neu erscheinenden Versübersetzungen wie auch die Wieland-Eschenburg’schen Prosaübersetzungen vortrug. So berichtet Ludwig Rellstab von einer Vorlesung im Jahr 1821, bei der Tieck „ein jetzt erst wieder in Deutschland zu seinem Recht gekommenes Stück, ‚die gezähmte Widerbellerin‘; [...] mit einigen freien Abänderungen nach der Eschenburgschen Uebersetzung“44 vortrug. Der Schriftsteller August Klingemann erinnert sich in seinen Memoiren wiederum an eine Vorlesung Tiecks 41
42
43
44
Die hohe Frequenz, mit der Tieck bisweilen Shakespeare vorlas, wird etwa durch die Erinnerungen zweier seiner internationalen Gäste bezeugt, so durch die des US-amerikanischen Hispanisten George Ticknor, der sich zu Beginn des Jahres 1836 längere Zeit in Dresden aufhielt und allein für den Monat Februar seine Teilnahme an drei Shakespeare-Lesungen in seinem Reisejournal festhielt (vgl. George Ticknor: Life, letters, and journals of George Ticknor. Vol. 1. Boston 1909, S. 473–486) sowie durch die des britischen Schriftstellers Henry Crabb Robinson (vgl. Henry C. Robinson: Diary, reminiscences, and correspondence of Henry Crabb Robinson. Vol. II. London 1872, S. 445). Vgl. Johann W. von Goethe: Shakespeare und kein Ende!. In: Ders.: Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche in vierzig Bänden. Bd. 19: Ästhetische Schriften 1806–1815. Hrsg. von Friedmar Apel. Frankfurt a.M. 1998, S. 475–477. Vgl. Marek Zybura: Ludwig Tieck als Vermittler der englischen Literatur in Deutschland. In: LenauForum 18, 1992, S. 162. Ludwig Rellstab: Aus meinem Leben. Bd. 2. Berlin 1861, S. 48.
Praxis, Materialität, Aneignung
191
in Jena „in einer interessanten Abendgesellschaft bei A. W. Schlegel“, bei der er Tieck Schlegels „damals eben vollendete Uebersetzung des Hamlet, auf eine in der That geniale Weise vortragen hörte.“45 Dass die Übersetzungen des Tieck-Kreises im Rahmen der Lesungen ihre ‚Uraufführung‘ erfuhren, legen die Memoiren von Carl Gustav Carus nahe, der sich an eine Lesung der Macbeth-Übersetzung Dorothea Tiecks erinnert: „Im Dramatischen endlich war eben die neue Uebersetzung des ‚Macbeth‘ durch Dorothea Tieck beendet worden, und wir hörten eine vortreffliche Lesung derselben durch Tieck selbst […].“46 Neben diesen Erinnerungen fand Tiecks Vorlesetätigkeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Eingang in zahllose Briefe, Tagebücher und Memoiren von Zeitgenossen, an denen sich ablesen lässt, dass Tieck als Vorleser entscheidende Impulse auf die Shakespeare-Rezeption einer deutschen Leser-, Zuhörer- und Zuschauerschaft ausübte, einen wesentlichen Beitrag zu dessen Verankerung im Kanon des entstehenden deutschen Bürgertums leistete und dabei gleichzeitig theaterpraktische, theoretische und wirkungsästhetische Positionen zu Shakespeare vermittelte. Spätere Shakespeare-Vorleser wie Tiecks Schüler Karl von Holtei, die Schauspieler Heinrich Anschütz und Eduard Devrient am Ende des 19. und Karl Kraus im 20. Jahrhundert sind wiederholt in der Tradition Tiecks verortet worden.47
5. Paradigma 3: Lesen – Der Shakespeareʼsche Lektürekosmos Tiecks Bereits als Schüler des Friedrichswerderschen Gymnasiums hatte Tieck zumindest passive Englischkenntnisse erwerben können. Systematisch vertiefen konnte er diese anschließend in den drei Semestern an der Göttinger Universität 1792 bis 1794, in denen er auch umfangreiche Studien zur englischen Literatur betrieb. Die Göttinger Universitätsbibliothek war aufgrund der Personalunion Kurhannovers mit der britischen Krone zu dieser Zeit mit einer beispiellosen Sammlung englischer Literatur ausgestattet. Sie besaß nicht nur viele alte und wertvolle Drucke, sondern schaffte auch systematisch Fachliteratur an und war mittels eines Realkatalogs gut erschlossen.48 Einen Einblick in Tiecks Lektüre in einer Lebensphase, in der ihm nur geringe Ressourcen für den Erwerb eigener Bücher zur Verfügung standen – eine Ausnahme bildet die über Eschenburg im Jahr 1793 erlangte vierte Folio BT 2146 –, erlaubt das Ausleihregister der Göttinger Bibliothek. Ihm lässt sich entnehmen, dass Tieck bereits unmittelbar nach seiner Immatrikulation verschiedene Editionen von Shakespeares Dramen entlehnte.49 Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt las Tieck die Dramen nicht nur, sondern betrieb intensive Studien der englischen Kommentatoren, exzerpierte, kopierte und verglich 45 46 47
48 49
August Klingemann: Kunst und Natur. Bd. 1. Braunschweig 1819, S. 39f. Carl G. Carus: Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Bd. 1. Leipzig 1865, S. 368. Zu Tieck und Kraus als Vorleser und zur Wirkungsgeschichte der Dresdner Lesungen vgl. Theresa Mallmann: Von der Hörbühne am Altmarkt zum „Theater der Dichtung“. Ludwig Tieck und Karl Kraus als Shakespeare-Vorleser im 19. und 20. Jahrhundert. Dresden 2021 (Tieck-Studien. 4). Vgl. Hölter 1989 (Anm. 31), S. 27. Vgl. Hölter 1989 (Anm. 31), S. 210.
192
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
Textstellen ebenso wie Noten. Im Wintersemester 1792/93 professionalisierte Tieck seine Shakespeare-Studien und entlehnte zahlreiche Werke der englischen Shakespeare-Kritik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, darunter auch Edward Capells 1822 schließlich auch für die eigene Bibliothek erworbenes Werk Notes and various readings to Shakespeare (London 1774).50 Im Sommersemester 1794 wandte er sich schließlich den Quellen Shakespeares zu. Neben John Stowes Annales or a general Chronicle of England, continued and augmented by Edmund Howes (London 1631)51 sowie dessen 1599 erschienene Survey of London52 und Thomas Percys Reliques of Ancient English Poetry (1765)53 – alle Titel erwarb Tieck in späteren Jahren für seine Bibliothek – entlehnte er mit Holinsheds Chronicles (1577) eine der wichtigsten Quellen Shakespeares und anderer Renaissance-Autoren.54 Mit Ben Jonson galten intensive Bibliotheksstudien und -ausleihen Tiecks einem der bedeutendsten Zeitgenossen Shakespeares. Die Jonson-Folio von 1692 entlehnte er im Herbst 1793, weitere Ausgaben, darunter die für seine Lektüre so bedeutende Whalley-Edition, im Frühjahr 1794. Auch mit den Werken von Francis Beaumont und John Fletcher, Philip Massinger und Robert Dodsley machte er sich bereits während seiner Göttinger Studienzeit vertraut, worauf Ausleihbelege zu entsprechenden Werkausgaben schließen lassen. Auf Werke anderer Shakespeare-Zeitgenossen wie Christopher Marlowe, John Webster und Thomas Kyd hatte Tieck zu diesem Zeitpunkt über die Göttinger Bibliothek noch keinen Zugriff, sondern kannte sie nur aus Literaturgeschichten und Anthologien. Nur ersterer war später mit zwei Ausgaben in seiner Bibliothek vertreten.55 Wie die Ausleihbelege verdeutlichen, ist es, um Tiecks Lektüre- und Studienkosmos zu Shakespeare in seiner Gesamtheit zu erfassen, unbedingt notwendig, auch die anderen Sparten des Auktionskatalogs seiner Bibliothek jenseits der dezidiert als solche gekennzeichneten Shakespeareana zu beachten. Voraussetzung für das tiefere Verständnis von Shakespeares Werk sei, schreibt Tieck in der Vorrede zum Alt-Englischen Theater, „jene Werke kennen zu lernen, die vor und neben ihm existierten“.56 Entsprechend lückenlos sind die Autoren des Elisabethanischen Zeitalters in Tiecks Bibliothek repräsentiert. In der Sparte ‚Langue et Litérature [sic!] Anglaise‘ finden sich Ausgaben von Geoffrey Chaucer,57 John Lyly58 und Francis Meres59 aus dem 16. Jahrhundert, knapp 50 Titel von englischen Autoren, die im 17. Jahrhundert erschienen und etwa 50 51 52
53
54
55
56 57 58 59
Vgl. Hölter 1989 (Anm. 31), S. 216. BT 6439, Erstausgabe mit Marginalien Tiecks, Standort nicht ermittelt. Mit BT 6440 konnte Tieck auf seiner Englandreise 1814 eine spätere Edition des Werks (London 1633) erwerben. Standort: ÖNB, 40611-D. Mit BT 2048, 2049 und 2050 besaß Tieck Editionen aus den Jahren 1794, 1839 und 1850, jedoch nicht die Erstauflage von 1765. Von keiner der Editionen ist der gegenwärtige Aufbewahrungsort bekannt. Vgl. Alexander Gillies: L. Tieck’s English studies at the University of Göttingen 1792–1794. In: Journal of English and Germanic Philology 36, 1937, S. 218f. BT 1973: Works. London 1826; BT 1974: Doktor Faustus. Tragödie. Berlin 1818, British Library, 11771.b.22. Ludwig Tieck: Alt-Englisches Theater oder Supplemente zum Shakspear. Bd. 1. Berlin 1811, S. XV. BT 1712: The Workes. London [1542], ÖNB, 23638-C. BT 1966: Euphues and his England. London 1586. BT 1988: Palladis Tamia. London 1598 (Provenienz: Horace Walpole).
Praxis, Materialität, Aneignung
193
100 Werke in jüngeren Editionen, die Tiecks Lektürekosmos zu Shakespeare und zum Drama der Renaissance zuzurechnen sind. Die Werke Philip Massingers besaß Tieck ausschließlich in Editionen des 19. Jahrhunderts.60 Francis Beaumont und John Fletcher sind hingegen mit der zweiten Folioausgabe61 ihrer Werke vertreten sowie mit Editionen des 18. und 19. Jahrhunderts,62 ebenso Thomas Heywood mit Erstausgaben von A Mayden-head well lost (1634)63 und von Englands Elizabeth (1631)64 sowie Philip Sidney mit drei Ausgaben der Arcadia, davon zwei frühen deutschen Übersetzungen, eine davon aus dem Hause Elsevier65 und mit einer englischen Edition aus dem Jahr 1633, die Marginalien Tiecks und Querverweise auf Shakespeare enthält.66 Werke von John Webster und Thomas Dekker hingegen waren zum Zeitpunkt ihres Verkaufs offenbar nicht in der Bibliotheca Tieckiana enthalten. Eine mit Tiecks Shakespeare-Marginalien vergleichbare Fülle an Annotationen und Querverweisen auf andere Werke findet sich in Tiecks Ben Jonson-Ausgaben, daneben existieren Exzerpte und Notizen zu Jonson in Tiecks Nachlass. Tieck besaß eine Reihe einzelner Dramen Jonsons aus dem 17. Jahrhundert (BT 1936–1946), die alle von der Wiener Hofbibliothek erworben wurden, sowie mit BT 1935 einen Druck aus dem Jahr 1838. Intensiv genutzt wurden von ihm jedoch bekanntlich die beiden Werkausgaben BT 1933 und 1934 (vgl. Anm. 5), die an die British Library gelangten. Anhand dieser beiden Editionen Ben Jonsons aus Tiecks Besitz – einer Folio-Ausgabe von 1692 und einer 1816 erschienenen neunbändigen Werkausgabe – hat Walther Fischer vor knapp einem Jahrhundert gezeigt, dass Tiecks Auseinandersetzung mit der Altenglischen Dramatik auf „solidester philologischer Kleinarbeit“67 basierte. Ebenso findet sich bei Fischer im Ansatz skizziert, was für Tiecks gesamte Auseinandersetzung mit den Werken Shakespeares charakteristisch ist: die Verknüpfung der philologischen Arbeit mit der Anfertigung umfangreicher Exzerpte anhand geliehener und erworbener Ausgaben, Notizen und Markierungen in Büchern aus der eigenen Bibliothek verbunden mit dem unaufhörlichen „bibliomanischen“ Streben um deren Erweiterung.68 „[Z]u den Büchern, welche den Dichter [Shakespeare, T.M.] erklären können“, zählte Tieck
60
61 62
63 64
65
66 67 68
BT 1980: Plays. 4vol. London 1805, BT 1981: Plays. 4vol. London 1813; BT 1982: Plays, London 1840; BT 1983: The dramatic works. London 1839. BT 1649: Fifty Comedies and Tragedies. All in one Volume. London 1679, ÖNB, 51.P.12. BT 1650: Dramatic works. London 1778, 10vol., UB Wrocław, 035553 u. WLB Stuttgart, Fr.D.oct.61; BT 1651: Dramatic works. 3vol. London 1811; BT 1652: Beauties. Birmingham [1834]; BT 1653: Dramatische Werke. Hrsg. von K. L. Kannegiesser. 2 Bde. Berlin 1808, British Library, 1346.b.41. BT 1892: A pleasant comedy, called a Mayden-head well lost. London 1634, ÖNB, 23.998-B. BT 5489: Englands Elizabeth. Her Life And Troubles, During Her Minoritie, from the Cradle to the Crowne. London 1631, Staatsbibliothek zu Berlin, Tr 7424. Außerdem besaß Tieck einen weiteren Titel in einer jüngeren Edition, vielleicht über die Shakespeare-Society bezogen: BT 1893: The fair maid of the Exchange, a comedy, and Fortune by land and sea, a tragicomedy. London 1846. BT 2265: Arcadia der Gräfin von Pembrock. Frankfurt a.M. 1629 und BT 2266: Arcadia der Graffin von Pembrock. Leyden 1642, British Library, 12603.a.24. BT 2264: The Countesse of Pembrokes Arcadia. London 1633, ÖNB, 23640-C. Fischer 1926 (Anm. 5), S. 99. Fischer 1926 (Anm. 5), S. 99–102.
194
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
im Jahr 1819 neben Jonson etwa „Spenser, Drayton und Daniel“.69 So ist Spenser denn auch mit drei Werkausgaben70 sowie zwei von Tieck annotierten Ausgaben der Faerie Queen vertreten, in denen teils umfassende handschriftliche Querverweise auf Shakespeare enthalten sind.71 Werkausgaben von Michael Drayton und Samuel Daniel sind im Tieckschen Auktionskatalog ebenso angeführt.72 Auch John Taylor fügt Tieck an selber Stelle seiner Auflistung hinzu, in dessen Werk „man viele Seltsamkeiten der Zeit“ fände. Das im Katalog als Marginalientitel gekennzeichnete Werk zählt sicherlich zu den prominentesten Erwerbungen, die die Wiener Hofbibliothek bei der Versteigerung tätigen konnte. Unter den zahlreichen Marginalien und Querverweisen auf Shakespeare finden sich auch Notizen Tiecks, die mit seinem Kommentar zur deutschen Versübersetzung korrespondieren. Auf dem Vorsatz hielt er fest (Abb. 5): Diese Sammlung ist für den Sprachforscher so wie für den, der die Sitten jener Zeit studiert, von der höchsten Wichtigkeit. Die Engländer haben es noch bei Weitem nicht genug beachtet. […] Wie oft ich es durchgesehn und wie zu verschiedenen Zeiten können die geschriebenen Anmerkungen bezeugen die alle von mir herrühren. Seit 1811. ist dieses Buch in meinem Besitz. L. Tieck73
Nicht nur im Fall Taylors dürften es textkritische Erwägungen gewesen sein, die die besondere Stellung einzelner Werke innerhalb von Tiecks Shakespeare-Bibliothek begründeten. Über seine mit zahllosen Marginalien versehene Werkausgabe von Beaumont und Fletcher74 schreibt Tieck etwa: „die beste Ausg. wird immer noch die von 1778 sein, welche die frühere von Siward verbessert hat“75 und so ist es auch genau diese Edition, in der sich zahllose Marginalien Tiecks finden. In diesem ebenso wie in zahlreichen weiteren Fällen bezeugen Tiecks Marginalien die besondere Fokussierung auf Shakespeareparallelen und Wendungen, die ihm aus Dramen des Elisabethaners bekannt waren.76 69 70
71
72
73
74
75 76
Aufsatz über Shakespeare (6 Bl.), GSA 28/916, zit. n. Trainer 1959 (Anm. 13), S. 371. BT 2289: Poetical works. Boston 1839; BT 2290: The poetical works. With observations of his life and writings. London 1840; BT 2291: The poetical works. 5 Bde. London 1842, Bibliothèque royale de Belgique, Sig. C.L 73. BT 2292: The Faerie Queen. The Shepheards Calender. u.a., London 1611, 1612, 1617, Wien ÖNB, Sig. 23641-C. und BT 2293: The Faerie Queene. 4 Bde. London 1759, UB Wrocław, Sig. 037999 (nur Bd. 2 vorhanden). BT 1789: Poems. Collected into one volume. London 1637; BT 1790: The works. Being all the writings of that celebrated author now first collected into One Volume. London 1748, ÖNB, Sig. 23644-D; BT 1773: The Poetical Works. To which is prefix’d, Memoirs of his life and writings. London 1718, British Library Sig. 11607.b.2. BT 2306: All the workes of John Taylor, the water poet, being 63 in number, collected into one volum [sic] by the author with sundry new additions, corrected, revised, and newly imprinted. London 1630, ÖNB, 23637-C. BT 1650: The dramatick works. Collated with all the former editions, and corrected with notes, critical and explanatory, by various commentators. 10 Bde. London 1778, WLB Stuttgart, Fr.D.oct.61-2 und UB Wrocław 035553. Aufsatz über Shakespeare (6 Bl.), GSA 28/916, zit. n. Trainer 1959 (Anm. 13), S. 371. Vgl. auch Hewett-Thayer 1935 (Anm. 3), S. 377–407.
Praxis, Materialität, Aneignung
195
Abb. 5: Besitzeintrag Tiecks in BT 2306: John Taylor: All the workes of John Taylor, the water poet. London 1630, ÖNB, 23637-C., Vorsatz verso.
6. Die Reproduktion von Marginalien Tiecks Die Bedeutung, die der Dichter selbst seinen Marginalien zuwies, lässt sich bereits daraus ermessen, dass ein Großteil der Randbemerkungen der Johnson-und-Steevens-Ausgabe zunächst mit Bleistift angefertigt, danach aber mit Tinte nachgezogen wurden.77 Besondere Bedeutung kam ihnen schließlich im Zuge des Verkaufs seiner Bibliothek 1849 zu. Wiederholt hatte Tieck ab den 1790er Jahren angekündigt, ein 77
Vgl. Neu 1986 (Anm. 6), S. 5, 11, und 14. Das Verfahren, Bleistiftkorrekturen nachzuziehen, um so eine endgültige Textversion zu bestätigen, kam auch im Rahmen des Korrekturprozesses bei der Herstellung der Übersetzungen des Tieck-Kreises zur Anwendung, wie sich den Übersetzungsheften von Wolf von Baudissin entnehmen lässt. Vgl. Lüdeke 1922 (Anm. 37), S. 241.
196
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
Schlüsselwerk zu Shakespeare vorzulegen. Publikationsfähige Gestalt nahm seine Shakespeare-Studie jedoch nie an.78 1849 dürfte für den bereits 76-jährigen Tieck bereits klar absehbar gewesen sein, dass sein Buch über Shakespeare nicht zur Vollendung gelangen würde. Gepaart mit Ashers buchhändlerischem Sinn für die erfolgreiche Vermarktung der Bibliothek, führte dies dazu, dass Tiecks Marginalien zu Shakespeare im Zuge der Auktion geradezu Werkcharakter erhielten. Tiecks stark annotierte Shakespeareausgabe BT 2152 ist im Auktionskatalog mit dem Zusatz „Ces notes […] forment le texte du grand ouvrage sur Shakspeare, promis depuis si longtemps“ versehen – eine deutliche Übertreibung, wie bereits E. Zeydel bei Ansicht der Bände in der British Library konstatierte,79 sind Tiecks Notate doch, schon aus Platzgründen, überwiegend eher Stichworte, maximal Anmerkungen in parataktischer Kurzform und nehmen an keiner Stelle kohärente Textgestalt an. Tieck selbst, der sie am Ende seines Lebens als die Zeugen seiner jahrzehnteumfassenden ShakespeareStudien ansah, mag ihnen jedoch hohen Wert zugeschrieben haben, der in der Auktion mit dem Versuch korrelierte, nun auch hohen materiellen Profit aus ihnen zu schlagen. Dies führte im Fall gleich mehrerer Titel zu einer selbst in der an Kuriositäten und zwielichtigen Angeboten nicht armen Geschichte des Antiquariatsbuchhandels eigenartigen Geschäftspraktik: Tieck und Asher verkauften Bücher mit Marginalien Tiecks nicht nur einmal, sondern reproduzierten die Marginalien in auflagengleichen oder zumindest ähnlichen Titeln, um sie an weitere Käufer zu veräußern. Der sonst für Besitzspuren gebräuchliche Begriff der Exemplarspezifika im Sinne unikaler Besitzspuren greift im Fall von Tiecks Shakespeare-Marginalien somit manches Mal ins Leere. Eine gewisse Vorstellung von der Singularität des Originals scheint beim Erstellen der Kopien durchaus eine Rolle gespielt zu haben, wurden die Stellen, an denen die Marginalien platziert wurden, und deren Zeilenspiegel doch in den Kopien exakt beibehalten. Wenn Tiecks Marginalien nicht bereits ab ihrer Verschriftlichung von exozentrischer Natur, also auf ihre potentielle Außenwirkung ausgerichtet waren, so verloren sie spätestens mit ihrer planvollen Reproduktion jeden endozentrischen Charakter.80 78
79 80
Erst 1920 wurden umfangreiche Materialien aus Tiecks Nachlass und aus Briefen aus der Zeit zwischen 1793 und 1821 posthum von Henry Lüdeke unter dem Titel Das Buch über Shakespeare zu einem möglichen Ganzen zusammengestellt und herausgegeben (Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig Tieck. Aus seinem Nachlaß. Hrsg. von Henry Lüdeke. Halle a.S. 1920 [Nachdrucke deutscher Literaturwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1]). Den ersten und umfangreichsten Teil bildet ein undatierter Kommentar zu Shakespeares Schauspielen, der vermutlich in den 1790er Jahren verfasst, von Lüdeke als „Erster Entwurf: Kommentar zu Shakespeare“ betitelt wurde und heute an der Zentral- und Landesbibliothek Berlin aufbewahrt wird (Ludwig Tieck: Kritisches über Shakespeare [Manuskripttitel], o.D. – 1 Buch [334 Seiten], Zentral- und Landesbibliothek Berlin, EH 6959, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-1-12522492). Vgl. dazu auch den Beitrag von Jochen Strobel in diesem Band. Vgl. Zeydel 1931 (Anm. 4), S. 136. Zu einer Systematik von Autorenmarginalien in Autorenbibliotheken vgl. Claudine Moulin: Endozentrik und Exozentrik. Marginalien und andere sekundäre Eintragungen in Autorenbibliotheken. In: Autorschaft und Bibliothek. Sammlungsstrategien und Schreibverfahren. Hrsg. von Stefan Höppner und Caroline Jessen. Göttingen 2018, S. 227–240.
Praxis, Materialität, Aneignung
197
Reproduziert wurden Tiecks Marginalien von der 23-bändigen Johnson- und SteevensDramenausgabe81 in die 15-bändige, 1793 erschienene vierte Auflage dieser Edition. Diese ist als BT 2154 ebenfalls 1849 im Auktionskatalog enthalten, freilich ohne einen Zusatz, der sie als Marginalienexemplar auswiese – das sie zum Zeitpunkt der Katalogisierung auch noch nicht gewesen sein dürfte. Möglich, dass sie 1849 noch keinen Käufer fand, denn in einem Barsortimentskatalog der Firma Asher aus dem Folgejahr wird der Titel erneut als Nr. 494 zum Preis von 40 Francs angeboten.82 Spätestens dann dürfte sie jedoch als willkommene materielle Grundlage für eine Reproduktion von Tiecks Marginalien erkannt worden sein. Gesichert ist, dass Tieck im Auftrag des schlesischen Grafen Ludwig Yorck von Wartenburg (1805–1865) bereits im Zuge der Auktion 1849 Bücher aus der eigenen Bibliothek ‚zurückkaufte‘ und in den nachfolgenden Jahren noch eine umfangreiche zweite Bibliothek zusammenstellte. In einem Vertrag vom 19. Mai 1852 wird die gewiss schon früher zwischen Yorck und Tieck getroffene Vereinbarung festgehalten, dass Tieck alle erworbenen Bücher zu Lebzeiten zum Nießbrauch behalten durfte und diese nach seinem Tod am 28. April 1853 in die Schlossbibliothek des Grafen in Klein Oels, dem heutigen Oleśnica Mała nahe Breslau, überführt werden sollten.83 In den verbleibenden Bestandsresten dieser Adelsbibliothek, die u.a. an der Majakowski-Stadtbibliothek in St. Petersburg aufbewahrt werden, finden sich in 14 der 15 Bände nicht nur Besitzstempel des Grafen, sondern auch handschriftliche Bemerkungen Tiecks, die exakt jenen in der an der British Library befindlichen Edition entsprechen.84 Tieck und Asher dürften zuvor sogar versucht haben, zumindest ein weiteres Exemplar des Johnson-Steevens-Shakespeare mit kopierten Marginalien auf den Markt zu bringen, denn einem unbekannten Interessenten wird in einem Brief einem britischen Geschäftspartner Ashers, dem Buchhändlers David Nutt, vom Februar 1850 als Ersatz für das bereits an die British Museum Library verkaufte Marginalienexemplar BT 2152 zum Preis von £ 40 angeboten: „Mr. Tieck will make an accurate copy of all his notes in another Copy of the Books“.85 Im gleichen Zusammenhang berichtet ein offenbar in die Geschäfte Nutts eingebundener H. B. Macleod einem unbekannten weiteren Interessenten Details zu den Hintergründen dieser Offerte: 81 82
83
84
85
BT 2152 (Anm. 12). A. Asher & Co.: Catalogue d’une collection précieuse de livres rares et curieux provenants en partie de la bibliothèque célèbre de M. Ludw. Tieck, en vente, aux prix marqués, chez A. Asher & Co. libraires. Berlin 1850, Nr. 494, S. 21. Zur Geschichte der yorckschen Bibliothek und der darin enthaltenen Bände aus dem Besitz Tiecks vgl. Achim Hölter, Paul Ferstl, Theresa Mallmann: Traces of a Bibliophile Romantic Book Collection in Polish Libraries. The Dispersion of Ludwig Tieck’s Library and of the Klein Oels Manor Library. In: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi / Studies into the History of the Book and Book Collections 14, 2020, Nr. 4, S. 675–696. BT 2154: The plays. In fifteen volumes: With the corrections and illustrations of various commentators, To which are added, notes. 15 Bde. London 1793, Zentrale Öffentliche W. W. Majakowski Stadtbibliothek, Sig. Англ S 53. David Nutt: Brief an unbekannten Empfänger. London, 18 Feb 1850. In: Konvolut von Briefen des Buchhändlers David Nutt, dem Catalogue 1849, Oxford University of Oxford Library, VET.GER. III. B.420, beigebunden.
198
Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann
His correspondent at Berlin says that M. Tieck is very old & infirm. The case seems to be this that the original copy is sold but that tempted by your offer probably Tieck has persuaded the Purchaser to let it stay a sufficient time in his hands to make another copy of the notes.86
Das Geschäft scheint nicht zustande gekommen zu sein – zumindest ist bislang kein weiteres Exemplar mit deckungsgleichen Marginalien Tiecks in England bekannt. Eingehalten wurde jedoch offenbar die Abmachung, dass Tiecks Marginalienexemplar nicht gemeinsam mit den anderen vom British Museum erworbenen Büchern nach London verschifft wurde, sondern noch etwas länger in seiner Obhut verbleiben konnte, um die Notizen zu kopieren, wie die marginaliengleiche 1793er Edition in St. Petersburg beweist. Die Geschäftspraktik kam auch noch bei einem weiteren berühmten Los zur Anwendung, der neunbändigen Werkausgabe Ben Jonsons, die Tieck auf seiner London-Reise erworben hatte und die heute ebenfalls in doppelter Ausführung an der British Library und mit Provenienz Graf Yorck von Wartenburg an der Majakowski Stadtbibliothek St. Petersburg87 zu finden ist. Gleiches gilt außerdem für eine 1778 erschienene zehnbändige Werkausgabe von Beaumont und Fletcher,88 durchgehend mit Marginalien Tiecks versehen, im Auktionskatalog mit einem Asterisk gekennzeichnet und 1849 von der Königlichen Landesbibliothek Württemberg erworben, wobei wiederum für die Majoratsbibliothek Klein Oels ein marginaliengleiches Exemplar angefertigt wurde.89 Man kann die Reproduktion der Marginalien in diesen drei Ausgaben als ungewöhnliche, jedoch rein buchhändlerische, auf Gewinnmaximierung abzielende Geschäftspraxis ansehen. Verdeutlicht man sich jedoch, dass diese nur bei Titeln der Elisabethanischen Literatur zur Anwendung kam und welchen Stellenwert das Studium Shakespeares und seiner Zeitgenossen in Tiecks Leben einnahm, müssen die reproduzierten Marginalien als wichtige Biographeme, als Zeugnisse des Versuchs des betagten Tieck angesehen werden, sein ungeschriebenes Werk zu Shakespeare zumindest in fragmentarischer Form für die Nachwelt zu erhalten. Zu diesem resignativen Schritt motiviert haben könnte ihn das Erscheinen von Nicolaus Delius’ Die Tieck’sche Shakespearekritik 1846, das bis zur Auktion in seiner Bibliothek enthalten war.90 Darin zieht Delius ein vernichtendes Resümee zum Kommentar des ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘, der als „das bedeutendste Ergebniß der Shaksperestudien unseres deutschen Kritikers“
86
87
88 89
90
H.B. Macleod (vermutlich Sir George Husband Baird MacLeod FRSE, 1828–1892) an unbek. [Brooke], London. Febr.21.1850. BT 1934: The Works of Ben Jonson, in nine volumes. With notes critical and explanatory, and a biographical memoir. Hrsg. von W. Gifford. 9 Bde. British Library, Sig. C.182.a.1. und Zentrale Öffentliche W. W. Majakowski Stadtbibliothek, Sig. Англ J 76. Vgl. Anm. 74. BT 1650: Dramatic works, collated with all the former editions and corrected, with notes by various comentators. 10 Bde. London 1778, UB Wrocław, 035553 (Bd. 7 nicht erhalten) und WLB Stuttgart, Fr.D.oct.61-1-10. BT 2217: Die Tieck’sche Shaksperekritik. Bonn 1846.
Praxis, Materialität, Aneignung
199
bezeichnet wird, zumindest – so der Seitenhieb auf das nach wie vor im Ankündigungsmodus stagnierende Buch über Shakespeare – „bis daß sein seit 1811 versprochenes größeres Werk über Shakspere endlich erscheinen wird“.91
7. Schluss Die Eckpunkte von Delius’ Kritik sind von nachfolgenden Forschergenerationen im Wesentlichen wiederholt worden: die fragwürdige Datierung von Stücken, Tiecks Tendenz, auf Basis teils gewagter Argumentationen Shakespeares Autorschaft auch für Stücke zu postulieren, die von britischen Kennern längst als Apokryphen bestimmt worden waren, seine teils herablassende Position gegenüber der englischen Kritik und manch philologisch fragwürdige Begründungen bei der Übertragung von Sprachbildern und Redensarten. Gerade die Grundlagen solcher Übersetzungsentscheidungen werden unter Berücksichtigung der korrespondierenden Marginalien Tiecks zu einzelnen Wendungen in Werken Shakespeares und in denen seiner Zeitgenossen sowie in den von Tieck konsultierten Nachschlagewerken für Außenstehende jedoch weitaus nachvollziehbarer, als im knappen Kommentar zum ‚Schlegel-Tieck-Shakespeare‘ ersichtlich und sollten bei künftigen Editionsvorhaben Berücksichtigung erfahren. Bislang waren der Tieck-Forschung nur die Marginalien in den Beständen der British Library und die im Nachlass enthaltenen Handschriften zugänglich, wohingegen die Tieck-Bestände in der ÖNB und in anderen Bibliotheken bislang noch kein Gegenstand systematischer Untersuchungen waren. Bereits der Blick auf Tiecks Werkausgabe John Taylors von 1630 zeigt jedoch, dass eine umfassende Untersuchung Tiecks philologischer Studien zu Shakespeare einer bibliotheksübergreifenden Erfassung und Kontextualisierung seiner Marginalien bedarf. Das gilt ebenso für Tiecks unzählige Notizen und Ergänzungen in Theodor Arnolds Compleat Vocabulary und sein handschriftliches Wortregister zu Shakespeare. Eine entscheidende Grundlage für die eingehende Erforschung von Tiecks Shakespeare-Studien mit Fokus auf seine Marginalien konnte in den vergangenen Jahren durch die Lokalisierung großer Teile seiner Bibliothek und die Erfassung der enthaltenen Marginalien geschaffen werden, wurden doch allein von den 110 Titeln der Shakespeare-Sparte bislang 29 ausgeforscht, autopsiert und in die Datenbank Ludwig Tiecks Bibliothek aufgenommen. Eine zeitgemäße Edition der Übersetzungen des Tieck-Kreises müsste diese Marginalien und Notizen ebenso berücksichtigen, wie die Übersetzungshefte Wolf von Baudissins und die darin enthaltenen Zeugnisse des mehrstufigen Arbeitsprozesses der Übersetzergemeinschaft.
91
BT 2217 (Anm. 90), S. IX.
Jochen Strobel
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare: Notat; Exzerpt; Paratext; Fragment
1. Tiecks Shakespeare Wenn Ludwig Tieck aus dem Spannungsfeld zwischen Geleistetem oder besser: Überliefertem und (vermeintlich) Geplantem, Zugesagtem heraus gelesen und bewertet zu werden pflegt, dann hat er in Briefen, aber auch in publizierten Vorreden vielleicht allzu oft selbst diesen Topos bedient.1 Henry Lüdeke wird als Herausgeber jener Nachlassmaterialien, deren Buchedition er inkorrekt Das Buch über Shakespeare betitelt,2 nicht müde, Tiecks Scheitern und Unfähigkeit herauszustreichen, als sei er, der ein sehr stattliches, vielseitiges und vielfach auch innovatives Œuvre hinterlassen hat, der einzige Autor, der deutlich mehr geplant, angekündigt, entworfen als abschließend publiziert hat. Wenn Lüdeke den nüchternen Historiker Tieck gegen den enthusiastischen Dichter ausspielt, 3 weist er ihm psychologisierend den biedermeierzeitlichen Stempel der Zerrissenheit4 oder gar der Persönlichkeitsspaltung zu, um das Disparate der Überlieferung nicht anerkennen zu müssen: „Was dieser [der Historiker Tieck] notdürftig aufbaute, verwarf jener [der Dichter Tieck] als unzulänglich, während er ganze Kapitel des Werkes demjenigen, der hören wollte, stundenlang vortrug, da noch kein Wörtchen davon auf dem Papier stand.“5 Die mit dem Vorleser Tieck stets verbundene Mündlichkeit findet offenkundig geringere Anerkennung als Schriftlichkeit, das Fragmentarische gilt weniger als Vollständigkeit. Die von der geistesgeschichtlichen Romantikforschung betriebene Normierung des Ganzen (namentlich im Begriff des ‚Geistes‘6) – die ja wenigstens einer frühromantischen Poetik zuwiderläuft – wirkt im Falle Tieck lange Zeit
1
2
3 4
5 6
Verwiesen sei exemplarisch auf den Briefwechsel Tiecks mit seinem Leipziger Verleger Heinrich Brockhaus, der vom harschen Workflow der modernen Taschenbuchproduktion einerseits, Tiecks zugleich bekräftigender und dilatorischer Manier andererseits bestimmt ist: vgl. Aus Tiecks Novellenzeit. Briefwechsel zwischen Ludwig Tieck und F. A. Brockhaus. Hrsg. von Heinrich Lüdeke von Möllendorff. Leipzig 1928 (Aus dem Archiv F. A. Brockhaus. 3). Erst der Untertitel schafft Klarheit: Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig Tieck. Aus seinem Nachlaß. Hrsg. von Henry Lüdeke. Halle a.S. 1920 (Neudrucke deutscher Literaturwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1). Vgl. Henry Lüdeke: Einleitung. In: Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. XI–XXVI, hier S. XI. Zu diesem längst anachronistischen literaturgeschichtlichen Konzept vgl. Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. 3 Bände. Stuttgart 1971–1980. Lüdeke 1920 (Anm. 3), S. XI. Vgl. etwa: Hermann August Korff: Geist der Goethezeit. Bde. 3 und 4. Leipzig 1940/1953.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-014
202
Jochen Strobel
weiter. Hier ist es das von Lüdeke insinuierte „umfassende[] Geistes- und Kulturgeschichtswerk“,7 im Vergleich zu dem das Vorliegende wie ein bloßer „Torso“8 erscheinen muss. Sehr rasch ist dann von Scheitern die Rede, in Bezug auf das ShakespeareBuch sogar vom „größte[n] Mißerfolg“.9 Das 1903 von Hans von Müller herausgegebene Kreislerbuch,10 das freilich autorisierte Texte Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns, namentlich die Kreisler-Passagen aus dem Murr-Roman, in eine chronologisch erzählte Heldenbiographie zu bringen versuchte, verkannte Hoffmanns Kompositionsprinzip. Wäre es bei Tieck ähnlich? Sollte lebenslang Unpubliziertes nicht schlicht als das, was es war, als Arbeitsmaterial, das der Entstehung von Publiziertem dienlich war, Anerkennung finden? Dem steht ein weiterer Topos des Mangels im Wege, der die Tieck-Forschung kennzeichnet: die mäßige Editionslage bei komplexer Überlieferungslage, verbunden mit dem guten Willen, Abhilfe zu schaffen. Hierzu entgegengesetzt präsentiert sich die Forschung, namentlich die zu ‚Tieck und Shakespeare‘, als sei alles schon gesagt. Roger Paulin konnte schon 1997 mit der rhetorischen Figur der Praeteritio das, wie er meinte, bereits allseits Bekannte zum Ausgangspunkt seines Grundsatzbeitrages machen.11 In vorliegendem Beitrag soll es um die zugängliche Überlieferung gehen, nicht um das vermeintlich ‚Fehlende‘. Die Aufzählung im Titel impliziert daher mikrologische und partikulare Befunde. Erst im weiteren Verlauf sollen mögliche Fluchtpunkte von Tiecks produktiver Beschäftigung mit Shakespeare angesprochen werden, also Biographie, Edition, Übersetzung, Roman. Die Schlegel-Tiecksche Übersetzung steht hier bewusst in einer Reihe; sie mag ‚vollendet‘ worden sein, doch ist sie nur zum geringen Teil Tiecks geistiges Eigentum. Ohne Tieck anklagen oder ihn verteidigen zu wollen, sei noch eins vorausgeschickt, was das rasche Veralten von Tiecks philologisch-historischem Gestus angeht, nämlich dass für ihn nun einmal auch Literaturgeschichte „Poesie“ (Hölter) war, wie für ihn auch Philologie Poesie war, und dass bei ihm zwischen dem Entdecken, Empfinden und Fortschreiben von Poesie einerseits und ihrer Historisierung, Edition, Nachdichtung und Übersetzung (noch) keine klare Trennlinie zu ziehen ist, ihm also aus der
7 8
9 10
11
Lüdeke 1920 (Anm. 3), S. XI. Achim Hölter: Ludwig Tieck. Literaturgeschichte als Poesie. Heidelberg 1989 (Beihefte zum Euphorion. 24). Lüdeke 1920 (Anm. 3), S. XI. Vgl. Das Kreislerbuch. Texte, Compositionen und Bilder. Zusammengestellt von Hans von Müller. Leipzig 1903. Vgl. Roger Paulin: Tieck und Shakespeare. In: Ludwig Tieck. Literaturprogramm und Lebensinszenierung im Kontext seiner Zeit. Hrsg. von Walter Schmitz. Tübingen 1997, S. 253–264; diesem Beitrag ging freilich Paulins Standardwerk zu Tieck voraus: Ludwig Tieck. Eine literarische Biographie. München 1988 (OA Oxford 1985). Neben Paulins brillanten, kenntnisreichen Texten seien auch die etwas vorläufigen einschlägigen Handbuchartikel genannt: Ruth Petzoldt-Neubauer: Tieck als Übersetzer. In: Ludwig Tieck. Leben – Werk – Wirkung. Hrsg. von Claudia Stockinger und Stefan Scherer. Berlin, Boston 2011, S. 377–388; Christian Sinn: Englische Dramatik. In: Ebd., S. 219–233.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
203
Perspektive des 19. und erst recht des 20. Jahrhunderts leichthin gelehrter Dilettantismus nachgesagt werden kann,12 zumal bei ihm eine Theorie des Übersetzens fehlt.13
2. Arbeitsbereiche14 Verglichen mit den Zeitgenossen sticht nicht nur die Quantität von Tiecks produktiver Shakespeare-Rezeption heraus,15 sondern auch die Vielzahl an Textgattungen, an Speicher- und Publikationsformaten. Dies zeigt eine chronologische Übersicht über die Highlights, der es darum zu tun ist, die Breite des Betätigungsspektrums zu veranschaulichen, nicht etwa Vollständigkeit anzustreben: – 1789, mit 16 Jahren, verfasst Tieck das Dramolett Die Sommernacht, in dem der junge Shakespeare in einem Traum vom Reich der Elfen zum Dichter erwacht; den Text publiziert Tiecks Vertrauter Eduard von Bülow 1851, also kurz vor Tiecks Tod.16 – 1793/94 entsteht das Gros der Notizen, das Henry Lüdeke 1920 als Das Buch über Shakespeare publiziert; zugeordnete Entwürfe (also: Stichworte, kurze Fließtexte in Kapitellänge, Notate, ein Werkverzeichnis Shakespeares) datiert er auf die Zeit von ca. 1797 bis 1815.17 – 1796 erscheint Tiecks deutschsprachige Bearbeitung Der Sturm zusammen mit der Abhandlung Über Shakespeareʼs Behandlung des Wunderbaren mit dem Plan einer Monographie von etwa 12 weiteren Studien.18 Die Abhandlung kann als Einleitung
12
13
14
15 16
17 18
Vgl. Hölter 1989 (Anm. 8), S. 248f., 295. Zu den Romantikern als Philologen vgl. Friedrich Schlegel und die Philologie. Hrsg. von Ulrich Breuer, Armin Erlinghagen und Remigius Bunia. Paderborn 2013 (Schlegel-Studien. 7); Héctor Canal Pardo: Romantische Universalphilologie. Studien zu August Wilhelm Schlegel. Heidelberg 2017 (Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte. 80); Antonia Magen: Der Philologe (Sammeltätigkeit, Werkkonzepte, Herausgeberschaften). In: Tieck 2011 (Anm. 11), S. 424–440; August Wilhelm Schlegel und die Philologie. Hrsg. von Matthias Buschmeier und Kai Kauffmann. Berlin 2018 (Zeitschrift für Deutsche Philologie. Sonderheft zum Bd. 137). Im Unterschied etwa zu August Wilhelm Schlegel: vgl. Jochen Strobel: Blumensträuße für die Deutschen. August Wilhelm Schlegels produktive Rezeption der romanischen Poesie als Übersetzer und Literaturhistoriker. In: Der Europäer August Wilhelm Schlegel. Romantischer Kulturtransfer – romantische Wissenswelten. Hrsg. von York-Gothart Mix und Jochen Strobel. Berlin, New York 2010 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte. 62), S. 159–183. Einen umfassenderen chronologischen Einblick zu den übersetzerischen Projekten bietet: Marek Zybura: Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber. Zur frühromantischen Idee einer „deutschen Weltliteratur“. Heidelberg 1994, S. 73–122. Vgl. Hölter 1989 (Anm. 8), S. 59. Vgl. Ludwig Tieck: Die Sommernacht. In: Ders.: Schriften in zwölf Bänden. Bd 1. Hrsg. von Achim Hölter. Frankfurt a.M. 1991, S. 11–25; 819–831 (Kommentar). Vgl. Lüdeke 1920 (Anm. 3), S. XXI–XXVI. Vgl. Ludwig Tieck: Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, für das Theater bearbeitet nebst einer Abhandlung über Shakspear’s Behandlung des Wunderbaren. In: Tieck 1991 (Anm. 16), S. 681–791; 1211–1265 (Kommentar).
204
–
–
–
– –
–
19
20
21 22
23
Jochen Strobel
und somit als Paratext zum Drama gelesen werden. Der anonyme und dem Verfasser noch persönlich unbekannte Rezensent August Wilhelm Schlegel moniert die kreativen Anteile Tiecks an der Übersetzung und Bearbeitung von The Tempest, sie widersprächen dem Geist des Dramas.19 Schlegel hegt also offenbar eine andere Vorstellung von übersetzerischer Treue. 1800 erscheinen in Tiecks Athenaeum-Fortsetzung, dem einmalig publizierten Poetischen Journal, zwei Briefe über Shakespeare, die dem Genre des philosophischen Briefs angehören.20 Frühestens 1800 und spätestens 1809 übersetzt Tieck Teile von Love’s Labour’s Lost, sie werden erst posthum publiziert. Roger Paulin bemerkt dazu, das Ergebnis zeige, „daß er der Aufgabe nicht gewachsen war. Das gilt für den größeren Teil seiner Übersetzungarbeit überhaupt.“21 1811 erscheint in zwei Bänden Alt-englisches Theater, ein Sammelband mit sieben Dramenübersetzungen aus Shakespeares Zeit, d.h. hier ist Tieck als Übersetzer selbst am Werk. Er erwägt die Zuschreibung der Dramen zu Shakespeare, irrt sich darin aber gewaltig.22 Etwa 1813 entstehen Entwürfe zu Übersetzungen von einigen Sonetten Shakespeares.23 1823/29 erscheint Shakespeares Vorschule. Es handelt sich wiederum, von Tieck bevorwortet, um apokryphe Stücke, die Tieck gern Shakespeare selbst zuschreiben möchte; diesmal übersetzen Wolf Graf von Baudissin und Tiecks Tochter Dorothea. Zwischen 1824 und 1831 entstehen drei Novellen, die nach Erscheinen der dritten als Trilogie lesbar sind, zwei Teile Dichterleben (Teil 1 erstmals in Brockhausʼ Taschenbuch Urania auf das Jahr 1826, Teil 2 1831 im Almanach Novellenkranz) mit dem in Buchform, im Gewand einer Novellen-Werkausgabe, erschienenen Präludium Das Fest zu Kenelworth (1828). Die drei in höchst unterschiedlichen Publikationsformaten erschienenen und keineswegs in der chonologisch-biographischen Abfolge entstandenen Texte sind erstmals als ‚Ganzes‘ 1844 im 18. Band der Werkausgabe versammelt. [August Wilhelm Schlegel:] [Sammelrezension zweier Shakespeare-Übersetzungen von Tieck und von Bube.] Rezensiert werden: 1. Shakspeare, W.: Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, für das Theater bearbeitet. Nebst einer Abhandlung über Shakspears Behandlung des Wunderbaren v. L. Tieck. Berlin, Leipzig: Nicolai 1796 2. Shakespeare, W.: Shakespear, für Deutsche bearbeitet. Abt. 1. [Bearb. v. W. von Bube]. Altona: Verlagsgesellschaft; Halle: Ruff 1796. In: Allgemeine Literatur-Zeitung 1797, S. 619–624, https://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf[id]=https%3A%2F%2Fzs.thulb.uni-jena.de%2Fservlets%2FMCRMETSServlet%2Fjportal_derivate_00084819%2FALZ_1797_Bd1u2_312.tif%3FXSL. Style%3Ddfg (gesehen 12.9.2022). Vgl. [Ludwig Tieck]: Briefe über Shakspeare. In: Ders.: Kritische Schriften. Bd 1. Leipzig 1848, S. 133–184 [EA 1800]. Paulin 1988 (Anm. 11), S. 224. Zu den Apokryphen vgl. Christa Jansohn: Zweifelhafter Shakespeare. Zu den Shakespeare-Apokryphen und ihrer Rezeption von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert. Münster 2000 (Studien zur englischen Literatur. 1), S. 56–72, dort auch das Zitat S. 60. Vgl. Christa Jansohn: Ludwig Tiecks Übersetzung von Shakespeares Sonetten 1 und 2 in MS Add 69 866; British Library. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 228, 1991, S. 86–89.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
205
– 1825/26 erscheinen in Buchform die in der Dresdner Abend-Zeitung publizierten Theaterkritiken als Dramaturgische Blätter. Hier spielen Shakespeares Dramen, spielen deren Londoner und Dresdner Inszenierungen immer wieder eine Rolle. Die beiden im Rahmen der Kritischen Schriften erneut vorgelegten Bände bieten ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die den journalistischen Produktionsbedingungen abgerungenen Provisorien zu einem ‚System‘, hier: Tiecks ‚Dresdner Dramaturgie‘, umgeschmiedet werden.24 – 1825 bis 1833 erscheinen erstmals unter Tiecks Mitwirkung Shakspeare’s dramatische Werke – in den ersten Bänden sind das erneut Schlegels Übersetzungen, durch Tieck revidiert, es schließen sich die von Baudissin und Dorothea Tieck unter ständiger Begleitung Tiecks neu übersetzten Dramen an. – 1836 werden Vier Schauspiele von Shakespear publiziert – weitere apokryphe Stücke, Übersetzer ist wohl weitestgehend Baudissin. – 1843 kommt es noch zu einem grundlegenden Rollenwechsel: Tieck inszeniert den Sommernachtstraum im Schlosspark von Sanssouci mit der Bühnenmusik Felix Mendelssohns – im Auftrag seines Gönners Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen.25 ‚Arbeitsbereiche‘ heißt nicht gleich ‚Publikationsausstoß‘ und Publikation bedeutet nicht, dass Tieck allein oder auch nur vorwiegend als Urheber zählt. Auffallend ist ein editorischer Schwerpunkt – es kommt vor allem auf die Vorreden an, zu denen sich die Texte beinahe wie Belege verhalten –, hingegen ist seine Beteiligung an Übersetzungen im Klein- und Großformat eher zurückhaltend. Fragmenthaftes, Vorläufiges sticht ins Auge, zumal die große Bedeutung des Paratext-Typs ‚Vorrede‘.
3. Voraussetzungen und Interessen Seit den Übersetzungen Wielands und Eschenburgs, vor allem seit den hymnischen Texten Goethes, Lenzʼ und Herders zu Shakespeare, war ein Säulenheiliger entstanden, zu dem die Verehrer seiner Verehrer sich zu verhalten hatten.26 Eine zweite Voraussetzung ist Tiecks bei Friedrich August Wolf in Halle (und wohl bei Christian Gottlob Heyne in Göttingen) genossene philologische Ausbildung.27 Sein text- und quellenkritisches Interesse ist unübersehbar. Tieck kennt die Shakespeare-Editionen des 18. Jahrhunderts, nutzt wohl vor allem Steevensʼ 15-bändige Edition, und er kennt die Übersetzungen ins Deutsche und in andere Sprachen – der zweite Entwurf aus den Buch
24
25 26
27
Vgl. Ludwig Tieck: Kritische Schriften. Bde. 3 und 4: Dramaturgische Blätter. Erster und zweiter Theil. Leipzig 1852. Vgl. Paulin 1988 (Anm. 11), S. 293f. Vgl. Roger Paulin: The Critical Reception of Shakespeare in Germany 1682–1914. Native Literature and Foreign Genius. Hildesheim 2003. Vgl. Hölter 1989 (Anm. 8), S. 18–38.
206
Jochen Strobel
über Shakespeare-Notizen von ‚nach 1796‘ liefert eine Auflistung der Editionen und der Übersetzungen.28 Insbesondere die Kritik an der Hölzernheit der englischen Kommentatoren – die auch Schlegel in seinen Wiener Vorlesungen intoniert29 – findet sich immer wieder.30 Statt von etwelchen vorgegebenen Regeln auszugehen, sucht Tieck den induktiven Weg, nämlich aus Shakespeares Werk „eine vollständige Ästhetik des Schauspiels [zu] entwickeln“31 (so 1815) und somit Regeln für Dramatiker abzuleiten. Auch das Genie folgt Regeln, aber seinen eigenen, die es aus der „Erfahrung abstrahiert“,32 nachdem es sein Publikum studiert hat, für das es schreibt. Ähnlich wie es Schlegel mit seinen Berliner literaturgeschichtlichen Vorlesungen hält, zielt die Historie auf eine zukünftige Praxis ab, welche die für Poesie dürftigen Zeiten endlich ablösen möge.33 Der Weg zu diesem Ziel ist das Studium des Briten in Lektüre und Bühneninszenierung. Nicht zuletzt der Dresdner Dramaturg Tieck fühlt sich hier in den 1820er Jahren in der Pflicht. Wie Köpke mitteilt, hatte Tieck schon in Göttingen 1793/94 erkannt: „[D]ie Welt lag in Shakespeare“, die „Geschichte […] der abendländischen Poesie“ ergebe sich aus Shakespeare.34 Das ist mehr als Schlegel in seinen Wiener Vorlesungen behauptet, die sich immerhin auf 100 Seiten Shakespeare widmen.35 Auch historisiert Schlegel den britischen Dramatiker als Vorbild für Zeitgenossen und Nachwelt, ordnet ihn in seine Zeit ein, während Tieck ihn in Gegensatz zu dieser setzt. Aber auch Schlegel schließt sich den Spekulationen über die apokryphen Stücke an, versucht also eine Grenze um den großen Mann zu ziehen.36 Auch sein Genre der Vorlesung taugt nicht zur Gesamtdarstellung, sondern wahrt das improvisierende Moment, das sich gleichfalls durch Tiecks sämtliche Bemühungen hindurchzieht. Tiecks primäres Interesse gehört der Rekonstruktion einer Werkbiographie, Fragen der Datierung, der Werkchronologie, der Autorschaftsattribution, der intertextuellen Beziehungen zu Vorgängern und Zeitgenossen; schließlich denkt der Theatermann Tieck stets an die Bühnenpräsenz der Dramen, an die altenglischen Theaterverhältnisse. Den Kanon der Shakespeare zugeschriebenen Dramen erweitert er deutlich auf bis zu 62 Texte und stellt eine Chronologie her, die qualitativ einen Weg von der Jugendsünde zur Vollendung nachzeichnet.37
28 29
30 31 32 33
34
35 36 37
Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 365. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur [1809–1811]. In: KAV, Bd. IV/1. Hrsg. und kommentiert von Stefan Knödler. Erster Teil: Text. Paderborn 2008, S. 286. Vgl. Paulin 1997 (Anm. 11), S. 256. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 412. Tieck, Schriften 1991 (Anm. 16), S. 686. Vgl. August Wilhelm Schlegel: Allgemeine Übersicht des gegenwärtigen Zustandes der deutschen Literatur. In: KAV, Bd. I: Vorlesungen über Ästhetik I [1798–1803]. Mit Kommentar und Nachwort hrsg. von Ernst Behler. Paderborn u.a. 1989, S. 484–544, S. 484–544. Rudolf Köpke: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen. Bd 1. Leipzig 1855, S. 145. Vgl. KAV, Bd. IV/1, S. 285–378. Vgl. KAV, Bd. IV/1, S. 365–369. Vgl. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 406.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
207
Hinter dem weiteichenden philologischen steckt also ein originär ästhetisches Interesse am Vervollkommnungsprozess des idealen Dichters. Dieses lebenslange Bemühen wie auch vieles andere zielt durchaus darauf ab, Shakespeare als Ganzes zu konstituieren und nachzuempfinden. Dies muss aber nicht in einer umfangreichen Monographie oder einem dickleibigen Roman à la Scott geschehen, sondern könnte sich in jedem Format, vielleicht in vielen kleinen Exzerpten und Notizen je aufs Neue vollziehen. Shakespeare ist für Tieck der geborene Dichter, der dennoch auf die Umstände seiner Zeit, namentlich die des Theaterbetriebs, reagieren musste – mehr als das: Er kannte sein Publikum, denn „er schrieb […] für sein Volk“.38 Die kultur- und theatergeschichtlichen Voraussetzungen, und das heißt auch die Voraussetzungen für den schon zeitgenössischen Erfolg von Shakespeares Dramen, sind für Tieck essentiell, die Differenz zu den zeitgenössischen Autoren ist entscheidend, da diese, so Tieck, Kinder ihrer Zeit gewesen seien, Shakespeare aber für sich stehe und nichts als eigenständig sei – „der Mittelpunkt lag in ihm“.39 Tieck formuliert seinen singulären Anspruch in den Briefen über Shakespeare 1800 freimütig, wie so häufig mit der Metapher des totalisierenden Bildes verbrämt: „Niemand aber hat ihn sich ausdrücklich als das Bild alles Vollendeten in der Kunst ausgewählt und alle seine Werke im Zusammenhange dargestellt“.40 Doch auch Tieck umkreist dieses Bild, schweift ab und landet bei Ben Jonson: „Es wird mir schwer, auf den eigentlichen Punkt unsers Briefwechsels zurückzukommen.“ Jonsons Texte – diese Argumentationsfigur ist nicht selten – seien „ein indirekter Commentar zum Shakspeare“, sie sagen, „was er nicht ist“, nämlich einfach das Produkt seiner Zeit.41 Man müsse auch Jonson übersetzen, um die Irrwege der Zeit aufzuzeigen, und das hatte Tieck mit seiner 1798 erschienenen Bearbeitung/Übersetzung des Volpone ja auch bereits getan,42 freilich durchaus mit Sympathie für den Dichter und sein Werk.43 Auch hier verbirgt sich hinter dem philologischen ein ästhetisches Argument.
4. Viele Teile und kein Ganzes: Tiecks Anfänge und Das Buch über Shakespeare Statt den Mythos vom unvollendeten Hauptwerk zu pflegen, wird hier von einer frühzeitig gespurten Dreiheit von partikularer Textpräsentation (in der Sturm-Bearbeitung), ausgearbeiteten Texten zu Einzelfragen (das Wunderbare) und einem Materialreservoir
38 39 40 41 42
43
Tieck, Schriften 1991 (Anm. 16), S. 686. Ludwig Tieck: Briefe über Shakspeare. In: Tieck 1848 (Anm. 20), S. 133–184, hier S. 152. Tieck 1848 (Anm. 20), S. 159. Tieck 1848 (Anm. 20), S. 182. Vgl. Ludwig Tieck: Ein Schurke über den andern, oder die Fuchsprelle. In: Ders.: Schriften 1991 (Anm. 16), S. 543–637; 1100–1136 (Kommentar). Vgl. Ludwig Tieck: Vorbericht zur dritten Lieferung. In: Ludwig Tieck‘s Schriften. Bd. 11. Berlin 1829, S. VII–XC, hier S. XVIII–XXIX.
208
Jochen Strobel
ausgegangen, mit dem das durch Lüdeke etwas voreilig als „Kommentar zu S[h]akespeares Dramen“44 bezeichnete Notizenkonvolut von 1793/94 gemeint ist. Roger Paulin nennt es die Quelle so mancher späterer Publikation,45 von vernetztem Schreiben zwischen Text und Text wäre also auszugehen – Kontiguitätsbeziehungen zwischen vielen Exzerpten, Notaten, ausformulierten Passagen ließen sich nachzeichnen. Und eines kommentiert, spiegelt oder relativiert das andere, wie etwa die Novellen die Vorrede zur Sammlung Shakespeares Vorschule.46 In der Exzerpt- und Notatsammlung von 1794 schreibt Tieck zum Sommernachtstraum: „[J]e mehr Wunderbares hinzukömmt, je mehr wird das Wunderbare wahrscheinlich.“47 Das steht ähnlich im 1796 erscheinenden Aufsatz über das Wunderbare bei Shakespeare. Der Kommentarbegriff sollte nicht verabsolutiert werden; er kommt einerseits von Eschenburg her (der sein Buch nur „eine Art von literarische[m] Apparat“48 nennt), andererseits gebraucht ihn Tieck für die Namen und Sachen erklärenden, vor allem aber textkritischen Anhänge der von ihm verantworteten, bei Reimer um 1830 erschienenen Bände. Der Titel „Erster Entwurf: Kommentar zu Shakespeare“ für das Notizenkonvolut von 1794 stammt offenkundig von Lüdeke,49 während die Handschrift selbst lediglich von fremder Hand die durchaus zutreffende Überschrift „Kritisches über Shakespeare“ aufweist.50 Es mag sein, dass Tieck zunächst für eine große Monographie sammelte, doch ist die Systematik des Ganzen eher die einer dem jeweiligen Text – es geht um 21 Dramen – Seite für Seite folgenden Exzerpt- und Notatsammlung, die man vielfach funktionalisieren kann. Es wäre Material, auf das man leicht Zugriff hat, sofern man sich am Einzeltext und an der Einzelstelle orientiert. Allerdings beginnen die Aufzeichnungen pro Drama oft mit Bemerkungen zu Entstehung, Datierung und mit Tiecks Bewertung. Grundsätzlich unterscheiden sich Tiecks „Kommentare“ in der Reimerschen Ausgabe der Schlegel-Tieckschen Shakespeare-Übersetzung nicht von den Inhalten des frühen Notizenkonvolutes. Kurze Einführungen zu Entstehung, Datierung, Rezeption, zu Quellen, sprachliche Erläuterungen, Hinweise auf dunkle Stellen (somit auch auf übersetzerische Zweifelsfälle) enthalten auch die Jahrzehnte später veröffentlichten Stellenkommentare. Doch sind diese primär philologisch motiviert, begründen Emendationen und Konjekturen, die wiederum übersetzerischen Entscheidungen zugrunde liegen. Die Notate aus den 90er Jahren umfassen auch Anmerkungen hermeneutischer und wertender Art (und zwar nach den Kriterien ‚Natürlichkeit‘, ‚organische Ganzheit des Stückes‘ und ‚Angemessenheit‘ hinsichtlich der Gattungseinteilung), sie verweisen weiterhin auf Parallelstellen. Die belegenden Seitenzahlen zu Beginn linksbündig und 44 45 46
47 48 49 50
Lüdeke 1921 (Anm. 3), S. XI. Paulin 1988 (Anm. 11), S. 211. Hierauf verweist Henry Lüdeke: Ludwig Tieck und das alte englische Theater. Frankfurt a.M. 1922, S. 317. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 27. Johann Joachim Eschenburg: Ueber W. Shakspeare. Zürich 1787, o.P. Vgl. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 1. Lüdeke 1920 (Anm. 3), S. XXII.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
209
rechts am Ende des Notats verweisen auf zwei Typen von Prätexten: den jeweiligen Primärtext – meist in der Übersetzung Eschenburgs oder gelegentlich in der Ausgabe Steevensʼ –, sodann aber auf Steevensʼ Kommentar, der seinerseits ältere Kommentare einarbeitet – Tieck nennt auch u.a. Warburton, Pope, Malone. Anders als ein Stellenkommentar öffnet manche Notiz den Horizont auf den ‚ganzen‘ Shakespeare und seine Zeit; es sind gleichsam Aphorismen, die aber bei allem Anregungscharakter jeweils zu Shakespeare zurückfinden. Eine Anmerkung wie „Zur Note“51 dürfte besagen, dass beim Lesen und Exzerpieren Eschenburg (der in Form von Fußnoten selbst bei entsprechender Namensnennung Thesen der britischen Kommentatoren einbringt) stets aufgeschlagen vor Tieck liegt, Steevens nicht immer zur Verfügung steht, aber auch nicht im Detail zitiert werden muss; knappe Exzerpte genügen. Tiecks kritische Haltung gegen die englischen Kommentatoren hebt sich von Eschenburgs erkennbar affirmativer Auswahl ab, d.h. Tieck ist selbstständiger, origineller im Exzerpieren, somit auch im Urteilen. Damit gehören Tiecks Notate der zeitgenössischen Avantgarde des Überganges von unselbstständigen zu eigenständigen Formen des Exzerpierens an. Repräsentiert wird die sich von traditioneller, vormoderner Gelehrsamkeit emanzipierende Praxis etwa durch Johann Joachim Winckelmann, dessen spätere Exzerpte sich zu immer eigenständigeren Texten entwickeln.52 Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde das Exzerpieren ein Tummelplatz der kritischen Revision von Wissen, statt bloßer Reproduktion (gewiss nach Durchlaufen von Prozessen der Selektion und Kombination) zu dienen: Shaftesbury hatte statt der Kollektaneen „launenhaft-originelle Miszellaneen“53 zu Papier gebracht. Nicht organische Einheit des Texts, sondern eine komplexe Textur in einem offen zu denkenden System von Wissen stand im Vordergrund. Dass, wie HansGeorg von Arburg für den Exzerptor Georg Christoph Lichtenberg geltend macht, aus dem Exzerpieren heraus Individualität entsteht,54 zeigt sich auch an Tiecks ExzerptNotat-Hybrid, der sich aus mehreren Quellen speist und möglicherweise den Werkstattcharakter schlicht beibehalten durfte, auch wenn das hehre Ziel, ein Buch über Shakespeare zu schreiben, in vielfältiger Weise mit dem lebenslang aufbewahrten ‚Schatz‘ in Beziehung stand. Gewiss sollten oder könnten Notiz- und Exzerptsammlungen zu ‚Werken‘ führen oder zu ihnen beitragen, doch kann eine End- oder Zwischenstufe das Exzerpt des Exzerpts und somit ein Registersystem sein, wie man es wiederum bei Jean Paul beobachten kann.55 Tiecks Notate indessen ließen sich aufgrund der doppelten Seitenverweise auf Eschenburg und auf Steevens als ein Register oder besser vielleicht
51 52
53
54 55
Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 30. Vgl. Elisabeth Décultot: Winckelmanns Lese- und Exzerpierkunst. Übernahme und Subversion einer gelehrten Praxis. In: Wissensräume. Bibliotheken in der Literatur. Hrsg. von Mirko Gemmel und Margrit Vogt. Berlin 2013, S. 137–165, hier S. 145 und 149f. Hans-Georg von Arburg: „Ja über alles seine Meinung [aufzuschreiben] mit so vielen Zusätzen von neuem als möglich“ – das Aufschreibesystem des Exzerptors Lichtenberg. In: Lichtenberg-Jahrbuch 2017, S. 155–170, hier S. 156–158, Zitat S. 158. Vgl. Von Arburg 2017 (Anm. 53), S. 165. Vgl. Götz Müller: Nachwort. In: Ders.: Jean Pauls Exzerpte. Würzburg 1988, S. 318–347, hier S. 318f.
210
Jochen Strobel
eine Konkordanz des zu Shakespeare in deutscher und in englischer Sprache erreichten Wissensstandes lesen. Die hier formulierten Beobachtungen und Vermutungen, die zeitgenössische Parallelen einbeziehen, setzen sich gegen die Vermutung zur Wehr, es handle sich um Paralipomena zu einem gescheiterten Projekt. Wie beim jungen Tieck bilden Winckelmanns Exzerpte gleichsam eine eigene Bibliothek, ersetzen die Bücher, die (noch) zu teuer sind. Der manische Büchersammler Tieck hatte es, so lässt sich gleich schlussfolgern, nicht nötig, Notatkonvolute in der Art des frühen auch später noch anzulegen. Ähnlich wie Jean Pauls wesentlich umfangreichere Exzerpthefte sind Tiecks Shakespeare-Notate „Ideenfundus“, denn Gelesenes regt zum Widerspruch und zum eigenständigen Kommentieren an.56 Beispiel ist etwa der Geist von Hamlets Vater: „Manche Kritiker haben den Geist ganz überflüssig gefunden, aber sehr mit Unrecht.“57 Nicht immer erkennen die Leser auf den ersten Blick, ob Tiecks Notate eigene Thesen oder Exzerpte sind, auch wenn letztere in der Regel durch Seitenzahlen belegt und in Lüdekes Kommentar zusätzlich nachgewiesen sind.58 Die Grenzüberschreitung zwischen mehr oder weniger verdecktem Zitat im Exzerpt einerseits und Ideenmagazin andererseits lief aus der Sicht des späten 18. Jahrhunderts natürlich noch längst nicht Gefahr, in die Nähe eines Plagiats zu geraten.59 Zwei fast willkürlich aus der Notizenmasse herausgegriffene Beispiele für den aphoristischen, durchaus im frühromantischen Sinn ‚fragmenthaften‘ Charakter mancher Notate Tiecks seien hier vorgestellt; eins klingt auch in der besagten Abhandlung über das Wunderbare an, das zweite betrifft den bekannten Hamlet-Monolog: Das unbegreifliche Wunderbare verliehrt sich immer bei Sh., er giebt immer dem Zuschauer ein Mittel, den Zufall zu verstehen.60 Die Gedanken sind erhaben, er hat das Gepräge eines Gemüths, das sich hier in die entferntesten Irrgänge verlohren hat. Reißt man aber diesen Monolog aus seinem Zusammenhange und stellt ihn einzeln hin, so verliehrt er fast alle seine Schönheiten, denn diese versteht man nur und sie entspringen aus dem Charakter Hamlets.61
Im aphoristischen Schreiben der frühromantischen Fragmentsammlungen – neben den Fragmenten des Athenaeum ist an Novalisʼ Blüthenstaub-Fragmente oder an sein Allgemeines Brouillon zu denken – entsteht ein universalistischer Anspruch sowohl im 56
57 58
59
60 61
Vgl. Angela Steinsiek: „Ich hob aus allen Wissenschaften meine Rekruten aus.“ Jean Pauls Exzerptenbibliothek und ihre Verwendung. In: Gemmel/Vogt 2013 (Anm. 52), S. 167–186, hier S. 171. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 56f. Tieck bezieht zum Puck im Sommernachtstraum Erläuterungen Johnsons, Steevensʼ und Tyrwhitts ein, doch Lüdeke weist ausdrücklich auf Tiecks Anteile hin: „Die etymologische Erklärung ist sein Eigentum.“ (Lüdeke 1920 [Anm. 2], S. 457 [Kommentar des Hrsg.].) Dass etwa Reminiszenzen an Racine oder gar Schillers Räuber Tiecks Zutat sind, versteht sich von selbst (vgl. ebd., S. 30). Vgl. Elisabeth Décultot: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften. Ein Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Ruhpolding [2004] (Stendaler Winckelmann-Forschungen. 2), S. 31. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 7. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 73.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
211
einzelnen Fragment als auch in der Relationalität der Fragmente zueinander.62 Letzteres wird man für die heterogenen Notate Tiecks zu Shakespeare nicht, Ersteres durchaus behaupten können. Hinter den Fragmenten steht mit Shakespeare, in dem ja laut Tieck die Welt selbst lag, ein auch im Kleinsten nachzuempfindendes Ganzes. Fragen nach der Gültigkeit des Wunderbaren oder nach der Entfremdung des modernen Subjekts vom Leben (Hamlet) überschreiten bloße Texthermeneutik. Das zweite Fragment problematisiert die Stellenlektüre (versus die ‚ganzheitliche‘ Lektüre eines Texts), die um 1800 und im Grunde bis heute einerseits im Verdacht steht, Kontexte und Kotexte zu vernachlässigen. Hatte die frühneuzeitliche Gelehrtenkultur des Stellenlesens (und Exzerpierens) sich selbst genügt, war eine Lesetechnik des Blätterns und Auswählens noch allgemein anerkannt gewesen, so warnen um 1800, wie Harun Maye gezeigt hat,63 einflussreiche Theoretiker wie Friedrich Ast, Friedrich Schlegel oder Friedrich Schleiermacher vor Einzelstellenlektüren, die ohne Verständnis des Ganzen zustande kommen. Andererseits favorisieren zumindest die beiden letzteren im frühromantischen Fragment eine Schreib- und Lektüreweise, die verspricht, ausgerechnet in der Einzelstelle Vollendung aufscheinen zu lassen.64 Tieck bewegt sich mit seiner Arbeitsweise genau zwischen beiden (nun zu vermittelnden) Positionen: Jedes einzelne Notat ist einem einzigen Fluchtpunkt, einer Annäherung an das Genie Shakespeares, verpflichtet; doch bleibt es, nicht nur vorläufig, weitgehend bei den Notaten, die vom Zitat, dem unselbstständigen Exzerpt, dem Inhaltsreferat bis hin zum Aphorismus reichen. Man könnte – bringt man Mayes Auffassung von der Kontinuität von Blättern und Zapping in Anschlag – an die ganz unromantische These denken, „die Summe der Teile ist mehr als das Ganze“.65 Dies aber wäre eine mögliche Umschreibung für den Textbefund zu ‚Tieck und Shakespeare‘, der vor allem Diskontinuierliches und Disparates offenbart. Exzerpt, Notat, Kommentar, Vorrede, ‚kleine‘ Taschenbuchnovelle, Bearbeitung und fragmenthaftes Übersetzen stehen hier auch gegen die Werkausgabe, die Biographie, die Übersetzung des Gesamtwerks. Exzerptbücher wie Almanache und Taschenbücher sind Marktplätze des Austauschs und der immer wieder neuen Zusammenstellung von Elementen des Wissens66 – im Unterschied zu großen
62
63
64
65 66
Vgl. Johannes Weiß: Das frühromantische Fragment. Eine Entstehungs- und Wirkungsgeschichte. Paderborn 2015 (Laboratorium Aufklärung. 27), S. 93–145. Vgl. Harun Maye: Blättern/Zapping. Studien zur Kulturtechnik der Stellenlektüre seit dem 18. Jahrhundert. Zürich 2019, S. 7–14, hier S. 9, sowie S. 78–95. So das Athenaeum-Fragment 206: „Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel.“ (Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente. In: KFSA, Bd. II: Charakteristiken und Kritiken I. 1796–1801. Hrsg. von Hans Eichner. München u.a. 1967, S. 165–255, hier S.195). Maye 2019 (Anm. 63), S. 8. Zur Metapher des Marktplatzes vgl. Nicola Kaminski, Volker Mergenthaler: Zur Einleitung: die Marktszene. Literarisches, publizistisches, literaturwissenschaftliches Deutungsmodell. In: Stephanie Gleißner, Mirela Husić, Nicola Kaminski und Volker Mergenthaler: Optische Auftritte. Marktszenen in der medialen Konkurrenz von Journal-, Almanachs- und Bücherliteratur. Hannover 2019, S. 7–24.
212
Jochen Strobel
Leben-Werk-Zusammenhängen, wie sie in jener Zeit schon die Verwaltung des Ruhmes von Großautoren wie Lessing, Wieland, Goethe evoziert.67
5. Techniken und Formate des Umkreisens Damit ist es an der Zeit, die Metapher des ‚Umkreisens‘68 noch etwas präziser auf Tiecks Praxis zu beziehen. Wörtlich ist es ja die Äquidistanz haltende permanente Bewegung eines Subjekts um ein statisches Zentrum, also etwa ein Zentralgestirn. Das Subjekt beobachtet das Objekt von allen Seiten, kommt ihm aber weder näher noch entfernt es sich irgendwann. Für Tiecks Shakespeare-Rezeption könnte dies u.a. Folgendes besagen: erstens die rhetorische Distanzierung bei gleichzeitigem Schüren oder Erhalten einer Erwartungshaltung; zweitens eine im hohen Maß rezeptive oder auch reproduktive Praxis diesseits des eigentlich Kreativen und, wie schon gezeigt, der Gebrauch bestimmter, für den Erweis von Totalität ungünstiger Textformate; drittens die Vielfalt der Publikationsformate; viertens die Spiegelung des Subjekts im Objekt, die Rückprojektion der an diesem erkannten Qualitäten auf die eigenen Positionen. Daneben bleiben Fluchtpunkte und Zielprojektionen kenntlich, die das ‚große Ganze‘ nach wie vor verhandeln. Erstens finden sich Absichtsbekundungen und deren Revisionen zuhauf. In einer großen Captatio benevolentiae beteuert Tieck im wohl chronologisch letzten Ansatz zu einem umfangreicheren Einleitungsteil des Shakespeare-Buches, entstanden 1815, dem Beginn wie auch dem Abschluss des Manuskriptes nahe zu sein; mit diesem Manuskript verknüpft Tieck sein gesamtes Leben, reklamiert also, ein Lebens-Werk zu schreiben oder geschrieben zu haben. Dabei nimmt er die subjektive, gleichsam tagebuchartige Perspektive desjenigen ein, der mit dem Schreiben beginnt. Er bemerkt anscheinend nicht, dass der Leser und die Leserin dieser Zeilen eigentlich das ganze Buch vor sich liegen haben werden. Ein autobiographischer Rückblick wird ergänzt um die Dokumentation der heiklen Schreibszene des Neubeginns, des Sitzens vor dem leeren Blatt Papier: Indem ich ein längst begonnenes Werk nach vielen Jahren wieder vornehme, um endlich eine Arbeit zu beendigen, die mich einen großen Theil meines Lebens mit fast ausschließlicher Vorliebe beschäftigt hat, fühle ich das Bedürfniß um so deutlicher, in der Darstellung und Entwickelung der Werke dieses großen Dichters einen tiefen Zusammenhang mit der Vorzeit und seiner Nachwelt zu begründen […].69
67
68 69
Vgl. Peter-Henning Haischer: Historizität und Klassizität. Christoph Martin Wieland und die Werkausgabe im 18. Jahrhundert. Heidelberg 2011 (Ereignis Weimar – Jena. 28); Erika Thomalla: Anwälte des Autors. Zur Geschichte der Herausgeberschaft im 18. und 19. Jahrhundert. Göttingen 2020. Hierzu siehe das Zitat aus Michael Neumanns Handbuchbeitrag zur Novellistik Tiecks (Anm. 76). Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 408.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
213
Erwartungsgemäß kündigt Tieck das Buch auch Verlegern an, etwa Georg Andreas Reimer, dem Verleger der Shakespeare-Übersetzung, so geschehen am 27. Februar 1814: „[M]ein Werk über Shaksp. nähert sich seiner Erscheinung immer mehr, auch liegt mir die kritische Ausgabe dieses Dichters sehr am Herzen“.70 Noch 1846 macht Tieck gegenüber Heinrich Brockhaus geltend, sowohl seine Memoiren als auch das Shakespeare-Buch seien im Geiste längst fertig.71 Alle diese und viele weitere Äußerungen nehmen immer wieder die Diskrepanz zwischen projektiertem Ganzen und einem als misslich empfundenen, sich aber verewigenden Zwischenstand auf. Zweitens ist Tiecks Beschäftigung mit Shakespeare eine in hohem Grad rezeptive, er nennt es das „Studium“.72 Neben lesen meint dies exzerpieren, annotieren, kommentieren. Entstehende Textformen sind etwa die Liste (schon in der frühen Abhandlung eine Auflistung von zwölf geplanten Aufsätzen, wovon der vorliegende und einzig ausgeführte der siebente ist73), der Paratext, der punktuelle Stellenkommentar aus Worterklärung, Emendation, Übersetzungshilfe. Drittens lassen die Publikationsformate nicht den Eindruck des Ganzen, Umfassenden aufkommen. Hier seien zwei im Grunde ephemere Formate herausgegriffen, deren Produkte Tieck zu Lebzeiten dann allerdings noch der Buchform zuführte: die theoretisch ambitionierte Theaterkritik und die historische Novelle. Um 1825 finden wir Tieck als Hofdramaturgen in Dresden wieder, wo er eine Bühnenreform betreiben und u.a. Shakespeare auf die Bühne bringen will. 1825/26 werden seine Theaterkritiken zusammen mit einem Reisebericht zum englischen Theater der Gegenwart erst in der Abend-Zeitung, dann als Dramaturgische Blätter in Buchform publiziert – wiederum tritt Shakespeare im kleinen Format ganz groß auf. Tiecks Sammlung ist von vornherein ein Exempel der Formauflösung.74 Spontane Thesenbildung in nuce, abgeschlossenes Detail, Reisebericht, Entwurf des idealen Theaters, oft auf dem Niveau der recht kleinteiligen Tageskritik – es ist improvisiertes, fragmenthaftes Schreiben. Tiecks Zentralgestirn Shakespeare tritt in den meisten theaterbezogenen Texten auf. Das liegt nicht nur an der Vorbildlichkeit dieses universalen Dramatikers gerade für die charakterlich dem Englischen benachbarten Deutschen und der Einzigartigkeit seiner Leistung, sondern auch an deren Offenheit: Shakespeare könne, und das ist nach wie vor romantisch gedacht, nie beendet werden; keines seiner Werke sei als das
70
71 72
73 74
Ungedruckte Briefe an Georg Andreas Reimer. Mitgeteilt von Georg Hirzel. In: Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der Gegenwart 18, 1893, H. 4, S. 242. Zitiert nach: Dichter über ihre Dichtungen. Ludwig Tieck. Bd. 9/II. Hrsg. von Uwe Schweikert. München 1971, S. 127. Vgl. Ludwig Tieck an Heinrich Brockhaus am 9.1.1846. In: Novellenzeit 1928 (Anm. 1), S. 156. Zur Notwendigkeit dieses Studiums vgl. Ludwig Tieck: Vorrede zum ersten Theil. In: Alt-Englisches Theater. Supplemente zum Shakspear. Übersezt und hrsg. von Ludwig Tieck. Bd. 1. Berlin 1811, S. I–XXIII, hier S. XV; siehe auch das Zitat weiter unten (Anm. 89). Vgl. Tieck 1991 (Anm. 16), S. 721f. Zu den theaterkritischen Zusammenhängen vgl. Jochen Strobel: Romantische Theaterkritik. Ludwig Tieck, der Dramatiker, Dramaturg, Publizist und Editor. In: Beiträge zur Geschichte der Theaterkritik. Hrsg. von Gunther Nickel. Tübingen 2007 (Mainzer Forschungen zu Drama und Theater), S. 89–116.
214
Jochen Strobel
höchste erkennbar, alle würden stets fortgeschrieben werden.75 Sollte die Rede über ihn abschließbar sein? Bieten wenigstens Tiecks Shakespeare-Novellen, die bereits nach Walter Scotts Durchbruch auch bei deutschen Lesern erscheinen, den perfekten und ganzen Shakespeare? Michael Neumanns treffliche Formulierung lautet, Tieck umkreise ihn „in scheuer Distanz“.76 Das Fest zu Kenelworth stellt uns den elfjährigen Knaben als romantisches Wunderkind vor; es ist eine Initiationsgeschichte, die als Prophetie zu lesen ist wie die des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Im höfischen Fest – Dichter brauchen Mäzene, Förderer – kommt zum angeborenen Genie und der in autodidaktisch-frühreifer Lektüre erworbenen Bildung die Anschauung hinzu. Nun hat er „mit Augen gesehen“,77 was er nur aus Büchern kannte. Poetischer Sinn, historische Kenntnis, Beobachtungsgabe und Einbildungskraft wirken zusammen in einem ersten höfischen Auftritt – Leser und Leserin erfahren: Dichter müssen auch rezitieren können und Schauspieler sein. Der erste Teil von Dichterleben ist aufgebaut wie ein analytisches Drama: eine unscheinbare Nebenfigur im London so bedeutender Dramatiker wie Robert Greene und Christopher Marlowe erweist sich am Ende als der Mensch der Zukunft, der, wie Erzähler und Leser wissen, einst mit Romeo und Julia berühmt werden wird. Charakterisiert wird er indirekt und in Relation zu den anderen, den zu ihrer Zeit bekannteren. Im zweiten Teil, Der Dichter und sein Freund, sind erneut philologische Erläuterung und fiktionaler Text verschränkt, denn die Entstehung der Sonette aus einer unglücklichen Liebesgeschichte heraus ist philologische Spekulation. Dass hier der alte Shakespeare in einer langen Binnenerzählung seine Biographie mündlich vorträgt, nähert diesen Teil der ‚Novelle‘ einer Shakespeare-Biographie an, die Tieck so natürlich nie schrieb. Umgekehrt ist die Vorrede zu Shakspeares Vorschule mit der Biographie des Autors verknüpft; der Zusammenhang wird im ersten Teil von Dichterleben entfaltet.78 Es gilt wie für alle Shakespeare-Biographica: Da wir über die Biographie des Autors kaum etwas wissen, sind biographische Versuche gleichsam Konjekturen, da sie aus den Werken trotz fehlender positiver Zeugnisse folgern wollen, wie Shakespeare gelebt habe, was für ein Mensch er gewesen sei. Die Novellen bieten weit ausgeführte biographische Spekulationen, die aus Tiecks philologischer und ästhetischer Interessenlage heraus erklärt werden können. Zugleich handelt es sich wiederum um Fragmente, die das Leben eines Großen als kleine Ausschnitte präsentieren. Dass Tieck Shakespeare umkreist, zeigt viertens auch die Spiegelung von dessen großen Stärken im eigenen Werk, in der eigenen Praxis. Tieck interessiert am großen Genie auch das schlicht Handwerkliche, und zwar in produktionsästhetischer Hinsicht 75
76 77
78
Vgl. Ludwig Tieck: Die Anfänge des deutschen Theaters. In: Kritische Schriften 1 1848 (Anm. 20), S. 323–388, hier S. 359. Michael Neumann: Dresdner Novellen. In: Tieck 2011 (Anm. 11), S. 551–567, hier S. 563. Ludwig Tieck: Das Fest zu Kenelworth. Prolog zum Dichterleben. In: Ludwig Tieck’s Schriften. Bd. 18: Ludwig Tieck’s gesammelte Novellen. Bd. 2. Vollständige auf’s Neue durchgesehene Ausgabe. Berlin 1853, S. 3–44, hier S. 19. Vgl. Hölter 1990 (Anm. 8), S. 317.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
215
beispielsweise die Schwächen bei der Charakterzeichnung, andererseits ist er, der Theatermann, wirkungsästhetisch interessiert. Je ein Beispiel folgt: Im angeblich zweiten Entwurf seines Buchs von ‚nach 1796‘ expliziert Tieck Shakespeares Genie mit der Metapher des Blicks: Das Genie, das ein „tiefes Ergreifen des Ganzen“ auszeichne, führe „eine hohe Ansicht der Welt“ vor. Wie macht es das? „Er sieht die Welt mit seinem weiten grossen Blicke an, und eine solche idealisierte Natur liefert er.“79 Der Blick idealisiert das Geschaute, das im Text schließlich zu leben beginnt. Diese Überlegung ragt in Tiecks eigenes poetisches Werk hinein. Norman Kasper hat gezeigt, wie in William Lovell, ex negativo, und dann im Sternbald positiv die Produktivität des Sehens als erkenntnistheoretisches Problem verhandelt wird. In der positiven Ästhetik des Optischen im Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderungen ist die „Fülle sinnlicher Wahrheit“ Merkmal eines natürlichen Weltverhältnisses.80 Auch das zweite Beispiel, die Abhandlung über den Gebrauch des Wunderbaren betreffend, laut Günther Erken „die erste eingehende dramaturgisch-technische Analyse“ Shakespeares überhaupt,81 könnte man auf Tiecks Werk zurückspiegeln. Es geht ihm um die Frage, wie es Shakespeare schafft, die Phantasie des Zuschauers so sehr zu fesseln, dass dieser seinen Verstand vollkommen ausschaltet. Tiecks Antworten lauten u.a.: indem er eine vollständige wunderbare Welt wie im Sturm darstellt und perfekte Illusion schafft, indem er schnell zwischen Lächerlichem und Grauenhaftem wechselt oder Musik zur Unterstützung heranzieht.82 Er reklamiert ähnliche Wirkung auch für den Sommernachtstraum, „die Täuschung eines Traums“,83 obgleich verwickelte Spielim-Spiel-Szenarien die Illusion eher brechen als bestätigen (was Tieck als Autor von Beinahe-Lesedramen wie Der gestiefelte Kater oder der Die verkehrte Welt ja selbst vorführt). An Zielprojektionen des ‚großen Ganzen‘ mangelt es nicht. Es hätte auch ein romantisches Buch entstehen können, also ein Roman, so Tieck jedenfalls im Frühjahr 1802 an den Jenaer Verleger Carl Friedrich Ernst Frommann zur Fortsetzung der Briefe über Shakspeare: „[D]ie Anlage und der Ton darinn führt […] nothwendig auf einen Roman“.84 Statt des Romans könnten die Werkausgabe oder eine große Biographie Ergebnis der Bemühungen sein. Wie aber steht es mit der umfassenden Übersetzung? Übersetzungen sind, das hat sich gezeigt, für Tiecks Produktionen zum englischen Theater marginal oder: Er lässt übersetzen. Es geht ihm in seinen eher Editionen als Übersetzungen zu nennenden Sammlungen zum englischen Theater um 1600 fast mehr um seine Einleitungen als um die Texte. Die Einleitung zum Alt-Englischen Theater bekundet präzise die primär philologische Absicht, die im Sammeln von Handschriften 79 80
81
82 83 84
Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 368. Norman Kasper: Ahnung als Gegenwart. Die Entdeckung der reinen Sichtbarkeit in Ludwig Tiecks frühen Romanen. Paderborn 2015, S. 29. Günther Erken: Die Rezeption Shakespeares in Literatur und Kultur: Deutschland. In: ShakespeareHandbuch. Hrsg. von Ina Schabert. 4. Aufl. Stuttgart 2000, S. 635–660, hier S. 648. Vgl. Tieck 1991 (Anm. 16), S. 689, 702f., 707f. Lüdeke 1920 (Anm. 2), S. 27. Zitiert nach Tieck 1971 (Anm. 70), S. 124.
216
Jochen Strobel
und seltenen zeitgenössischen Drucken ihren Ausdruck findet.85 Diese Texte einem deutschsprachigen Publikum zuzuführen hat die Edition des englischsprachigen Texts schon mangels Sprachkompetenz und somit Verkaufschancen von vornherein wohl nicht in den Blick rücken lassen, wenngleich das Projekt einer Shakespeare-Ausgabe Tieck am Herzen lag. Dort, wo es funktional ist, passagenweise bereits in seiner Abhandlung zum Wunderbaren selbst und natürlich in der bei Carl August Nicolai erschienenen Buchausgabe, in der sie die Bearbeitung des Sturm einleitet, übersetzt Tieck selbst einmal. Dass Shakspeares Vorschule nicht von ihm selbst übersetzt ist, sagt er ganz offen. Er habe die Texte „durchgesehen und manches verbessert“.86 Mehrfach findet er Worte des Lobes für Schlegels Übersetzung und sieht auch hier das Ganze, denn ein Übersetzer müsse, so Tieck 1800, „in jeder Stelle den ganzen Dichter ahnden“, ja er „muss den Dichter gleichsam neu erschaffen“.87 Das sei aber Schlegel gelungen. Es fällt auf, dass die Anfänge der Korrespondenz zwischen Tieck und August Wilhelm Schlegel weitgehend Shakespeare gewidmet sind, Tieck aber, in Anerkennung der Übersetzung des Älteren, stets philologische Detailfragen aufs Tapet bringt, etwa Konjekturen vorschlägt. Als Tieck 1825 den Schlegelschen Shakespeare kapert und zu Ende führt, leistet er bei seinem berühmten Freund sogleich Abbitte, eröffnet aber Reimer um die Jahreswende 1829/30, als endlich neues Material zu liefern ist, den Werkstattcharakter der von ihm verantworteten Übersetzung: Tieck, Meister der Mündlichkeit, behält als Nicht-Übersetzer die Kontrolle in regelmäßigen Team Meetings.88 Dies gibt er übrigens auch in der Vorrede zu Band III 1830 zu erkennen: „[D]ie Übersetzungen jüngerer Freunde, die ihre ganze Muße diesem Studium widmen können“, sehe er durch, „und wo es nötig ist, […] verbessere“ und annotiere er sie.89 Das Stichwort ‚Mündlichkeit‘ ist schon gefallen: Was „in der Hauptsache nur in Tiecks Kopf vorhanden war“, pflegte er vorzutragen.90 Sein „stupendes Gedächtnis“, so Roger Paulin, sei ihm bei seiner Beteiligung an der Übersetzung zugutegekommen.91 Hier deutet sich dialogische Übersetzerschaft an mit Tieck als Beteiligtem.
85 86
87 88
89
90 91
Vgl. Tieck 1811, Vorrede (Anm. 72), passim. Ludwig Tieck: Vorrede. In: Shakspeare’s Vorschule. Hrsg. und mit Vorreden begleitet von Ludwig Tieck. Bd. 1. Leipzig 1823, S. V–XLII, hier S. XLII. Tieck 1848 (Anm. 20), S. 147. Vgl. Ludwig Tieck an Georg Andreas Reimer, ca. Ende 1829/Anfang 1830. In: Letters of Ludwig Tieck Hitherto Unpublished 1792–1853. Hrsg. von Edwin H. Zeydel, Percy Matenko und Robert Herndon Fife. New York, London 1937, S. 338. Ludwig Tieck: Vorrede zum dritten Theil. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel. Ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Dritter Theil. Berlin 1830, S. III–VI, hier S. III. Lüdeke 1920, Einleitung (Anm. 3), S. XXI. Paulin 1988 (Anm. 11), S. 225.
Ludwig Tieck umkreist Shakespeare
217
6. Fazit und editorische Schlussfolgerungen Der junge Tieck hatte Shakespeare unterstellt, das Wunderbare dadurch erfolgreich einzusetzen, dass er die Zuschauer mit allen gebotenen Mitteln daran hindere, ihren Verstand zu gebrauchen. Die Illusion darf nicht gebrochen werden. Analog ist Tiecks Blick auf Shakespeare stets diskret genug, um bei allem Ehrgeiz, Rätsel zu lösen, zu Shakespeare letzte Distanz zu wahren; die Illusion seiner Größe bleibt unangefochten. Alle Rätsel zu lösen könnte die Aura,92 könnte den „Glauben“ 93 an die Poesie zerstören. Tieck benennt einige Rätsel um Shakespeare, erspart sich und seinen Lesern aber einen systematischen Zugriff, der in perfekter Einfühlung aus dem Notatwerk beispielsweise eine poetologische Grammatik Shakespeares hätte herauslösen müssen. Vielsagende Bruchstücke dürfen auf das große Ganze, das Geheimnis des Genies, verweisen, ohne dass es ausgesprochen werden kann. Den schöpferischen Augenblick hatte Tieck zusammen mit seinem Freund Wackenroder in den Herzensergießungen, anhand von Raphaels Erscheinung, kunstreligiös auszufabulieren verstanden – Künstlergeschichte als Heiligenlegende war das, nicht Philologie. Die Sprache der Jenaer Frühromantik aber bleibt in Tiecks Texten über Shakespeare erhalten.94 In Tiecks Berliner Nachlass befinden sich 455 Blätter mit einem Wortregister zu Shakespeare mit Fundstellen sowie Parallelstellen in anderen Texten Shakespeares und seiner Zeit.95 Damit wäre der Schritt von der Notatsammlung zum Zettelkasten vollzogen, wie er zeitgenössisch für einen Autor wie Jean Paul zum Arbeitsinstrument wie auch zum Element der Romanpoetik wird.96 Diese Stellensammlung, die neue Stellenlektüren und damit semantische Querverbindungen von Text zu Text impliziert, ist die beste Vorlage für die semantische Organisation einer hypertextuell ausgerichtete Edition zu ‚Tiecks Shakespeare‘ – womit alle mehr oder weniger selbstständigen Textzeugen zu Tiecks Shakespeare-Rezeption von der Novelle, den redaktionellen und kommentierenden Anteilen an der Schlegel-Tieckschen Übersetzung bis hin zu Notat und Stellenverzeichnis gemeint sind. Nur eine vollständige Edition aller Zeugen, nicht etwa nur der von mehreren Personen (A. W. Schlegel, Caroline Schlegel, Ludwig Tieck, Dorothea Tieck, Wolf Graf von Baudissin) betreuten Übersetzung, böte eine befriedigende Lösung. Zusammengehalten und benutzbar gemacht würde eine solche Edition über mehrere digitale Register, einerseits ein Werkregister mit Shakespeares Texten,
92
93 94 95
96
Vgl. Walter Schmitz: Ludwig Tiecks Autorschaft. Zur Kontinuitätskonstruktion eines poetischen Lebens. In: Ludwig Tieck. Werk – Familie – Zeitgenossenschaft. Hrsg. von Achim Hölter und Walter Schmitz. Dresden 2021, S. 1–44, hier S. 1. Tieck 1853 (Anm. 77), S. 20. Vgl. Paulin 1988 (Anm. 11), S. 213. Vgl. Lothar Busch [Bearb.]: Der handschriftliche Nachlass Ludwig Tiecks und die Tieck-Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Katalog. Wiesbaden 1999, S. 72: „Jedem Begriff ist die Fundstelle, d.h. hier der Verweis auf das jeweilige Shakespeare-Drama bzw. auf Parallelstellen in anderen Dramen der Shakespeare-Zeit beigegeben.“ Man denke an den Romantitel Leben des Quintus Fixlein aus funfzehn Zettelkästen gezogen.
218
Jochen Strobel
andererseits ein Glossar aus Stich- und Schlagwörtern, die zu allen Text- und Publikationsformaten vergeben werden. Eine solche Edition ähnelt der eines Zettelkastens und nimmt die Tatsache ernst, dass Tieck sich lebenslang und mit quantitativ erklecklichem Ausstoß produktiv mit Shakespeare befasst, mit thematischen Rekurrenzen und zweifellos auch mit thematischen Schwerpunkten – dass er aber weitgehend bei der mikrologischen Form verharrt und dass ausgerechnet die vermeintlich großen ‚Stücke‘, Shakespeares Werke in Übersetzung also, nicht oder nur am Rande und vor allem in Gestalt der kleinen Form der Kommentarstelle, der Emendation, der Konjektur, Tieck selbst zugehören. Schaltstelle einer solchen Edition wäre, neben dem Inhaltsverzeichnis von Shakespeares Texten, mit dem besagten Glossar selbst eine Liste, die der Orientierung des Users im Hypertext dient. Das Prinzip der Linearität – das, wie im zweiten Abschnitt dieses Beitrags gezeigt, dem Problem äußerlich bleibt – würde also zugunsten eines indexikalischen Prinzips aufgegeben. Tiecks Exzerpte und Notate, seine oft nur knappen thesenhaften Texturen, seine manchmal im fiktionalen Text versteckten hermeneutischen und wertenden Anmerkungen kämen zu Ehren. Oberste Priorität einer solchen Edition besäßen weder Autorisation noch Autorwille und auch nicht die Dokumentation nachgelassener, heute noch zugänglicher Materialien,97 sondern die letztlich unzusammenhängende Vielfalt der Ideen und der Wissenspartikel, wie sie nicht nur die Überlieferung kennzeichnet, sondern, wie wohl behauptet werden darf, auch Tiecks Denken.
97
Zu den Prinzipien des literaturwissenschaftlichen Edierens vgl. Bodo Plachta: Editionswissenschaft. Handbuch zu Geschichte, Methode und Praxis der neugermanistischen Edition. Stuttgart 2020, S. 2f.
Roger Paulin
Wolf von Baudissin als Diarist
Zur Vorgeschichte. Auf die Baudissin-Tagebücher wurde ich zuerst aufmerksam durch den Hinweis bei Henning von Rumohr: Schlösser und Herrenhäuser im Herzogtum Schleswig (1968).1 Im Abschnitt ‚Drült‘, zum Landsitz des Verfassers, erfuhr ich, die Baudissin-Tagebücher befänden sich in seinem Besitz. Im Sommer 1974, im Zuge meiner ersten Forschungsreise zu Ludwig Tieck, durfte ich die Tagebücher in der Landesbibliothek in Kiel einsehen und ausführliche Notizen und Fotokopien machen. Zwei weitere Forscher, Bernd Goldmann (1981)2 und John Sayer (2015),3 haben die Tagebücher seitdem benutzt und exzerpiert. Die Tagebücher selbst gelten heute allerdings als verschollen, ein empfindlicher Verlust für die Dresden-, Tieck- und ShakespeareForschung. Was ich hier referiere, geht also auf meine Aufzeichnungen aus dem Jahre 1974 und auf die damals angefertigten Fotokopien zurück. Die Bedeutung dieser Tagebücher brauche ich bei einer Tagung zum ‚SchlegelTieck‘ nicht erst hervorzuheben. Baudissin hat bei diesem literarischen Unternehmen bekanntlich dreizehn der von Schlegel nicht übersetzten Stücke von Shakespeare übertragen. Leider umfassen die Tagebücher nur die Jahre 1832–1841, und während dieser Zeit ist Baudissin von Dresden auch häufig abwesend. Die große Arbeit am ‚SchlegelTieck‘ ist also schon geleistet, als die Tagebücher einsetzen, so dass wir nur spärliche Einblicke in die Werkstatt des Übersetzers gewinnen. Aber auch diese sind von großem Interesse. Kurz zu Baudissin selbst. Durch seine Herkunft (holsteinischer Uradel), seine amtliche Tätigkeit im dänischen Diplomatendienst und sein späteres Privatgelehrtendasein in Dresden fällt Baudissin eine wichtige Rolle zu als Vermittler und Bindeglied zwischen den Kreisen um August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck. Als Student besucht er Schlegels Berliner Vorlesungen (1801–1804), wo von Shakespeare eher sporadisch die Rede ist; in Heidelberg kommt er mit der Übersetzerfamilie Voss in Berührung, in Stockholm, später in Paris, mit Germaine de Staël und Schlegel. Seine Übertragung von König Heinrich VIII. (1818) zeigt den Einfluss von Heinrich Voß sowie von Schlegel selbst. Seine Mitarbeit am ‚Schlegel-Tieck‘ wird von Tieck nur in einer
1
2
3
Henning von Rumohr: Schlösser und Herrenhäuser im Herzogtum Schleswig. Frankfurt a.M. 1968, S. 105. Bernd Goldmann: Wolf Heinrich Graf Baudissin. Leben und Werk eines großen Übersetzers. Hildesheim 1981. John Sayer: Wolf Graf Baudissin (1789–1878). Life and Legacy. Zürich 2015.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-015
220
Roger Paulin
Notiz in Band 3 der Ausgabe der Öffentlichkeit bekanntgegeben.4 Ebenso anonym ist seine Teilnahme an Tiecks Vier Schauspiele von Shakspeare (1836),5 während Baudissins Ausgabe Ben Jonson und seine Schule (ebenfalls 1836)6 unter seinem eigenen Herausgeber- bzw. Übersetzernamen erscheint. Sein Aufenthalt in Dresden, das er 1827 zu seinem Wohnsitz macht, bringt ihn mit Tieck und dessen Kreis in engsten Kontakt, ebenfalls mit dem städtischen Hochadel und dem sächsischen Hof. Er gehört wie Tieck, Carl Gustav Carus und Friedrich Förster zu der ‚Accademia Dantesca‘ von Philalethes, dem Prinzen Johann von Sachsen.7 Die Tagebücher geben Aufschluss über alle diese Dresdner Kreise und sind insofern von hohem historischen sowie menschlichen Interesse. Für meine Tieck-Biographie (1985)8 waren sie von großem Nutzen, nicht zuletzt wegen ihres Anekdoten- und Medisancenschatzes zum Tieck-Kreis und zum Hof. Hier ist Tieck nicht ‚der Heilige von Dresden‘: Er redet frei, unverblümt und ‚inoffiziell‘. Namen wie – in beliebiger Reihenfolge – Johan Clausen Dahl, Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, George Ticknor, John Kemble, Clara Wieck, Louis Daguerre und Pierre-Jean David d’Angers geben Einblicke in die verschiedensten Zirkel Dresdens und ihre intellektuellen und künstlerischen Anliegen. Diese Kreise sind wichtig, auch für die Übersetzungskultur Dresdens, auf die ich noch zu sprechen komme. Denn als Graf hat Baudissin überall Zutritt; Tieck, immerhin eine der Zelebritäten Dresdens, genießt eine solche Freiheit nicht. Ein Beispiel: Am 19. Juli 1839 fährt Baudissin mit Tieck in die Sommerresidenz Pillnitz, wo beide an einer Korrekturstunde zu Prinz Johanns Dante-Übertragung teilnehmen; danach zieht sich Baudissin in einem Wirtshaus um zu einem Hofdinner im Beisein des Königs von Bayern und des Kronprinzen von Preußen, um sich sodann erneut umzuziehen und an dem artistisch-literarischen Kreis bei Carus teilzunehmen. Die Accademia Dantesca und der gesellige Zirkel um den Prinzen sind zwar privat, aber die Teilnahme geschieht trotzdem auf allerhöchstem Befehl. „Wir [Baudissin und Tieck] hatten den Abend bey den Lüt[tichaus] seyn sollen, daraus ward aber nichts, weil eine Einladung des Prinzen dazwischen kam“, heißt es im Tagebuch am 15. Januar 1833. Tiecks berühmte Leseabende sind für alle Stände und Ränge offen. Seines gehobenen Standes halber kann der Prinz dort jedoch nicht erscheinen, so dass Tieck gelegentlich aufgefordert wird, bei Hof zu lesen. Baudissin gehört quasi zum Tieck’schen Familienkreis: Die „Corrigirstunde“ zu Shakespeare geht öfter in Geselligkeit über.
4
5 6
7 8
Shakespeareʼs dramatische Werke. Uebersetzt von August Wilhelm von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Bd. 3. Berlin 1830, S. 29. Vier Schauspiele von Shakspeare. Uebersetzt von Ludwig Tieck. Stuttgart, Tübingen 1836. Ben Jonson und seine Schule, dargestellt in einer Auswahl von Lustspielen und Tragödien. Übersetzt und erläutert durch Wolf Grafen von Baudissin. Leipzig 1836. Vgl. hierzu den Beitrag von Thomas Bürger in diesem Band. Roger Paulin: Ludwig Tieck. A Literary Biography. Oxford 1985. Vgl. auch ders.: „Höfisches Biedermeier“. Ludwig Tieck und der Dresdner Hof. In: Literatur in der sozialen Bewegung. Aufsätze und Forschungsberichte zum 19. Jahrhundert. Hrsg. von Georg Häntzschel, Georg Jäger und Alberto Martino. Tübingen 1977, S. 207–227.
Wolf von Baudissin als Diarist
221
Tieck und Baudissin treffen sich, wie schon erwähnt, in den artistischen Zirkeln um Dahl und Carus, wo sich Baudissin besonders wohl fühlt. Das zur Einführung. Für die Übersetzungskultur Dresdens und nicht zuletzt für die dort gepflegten Shakespearestudien haben diese Umstände bestimmte Folgen. Wer übersetzt? An der Spitze dieser noch sehr hierarchisch gegliederten Residenzstadt steht Philalethes, Prinz Johann von Sachsen, dessen Göttliche Comödie bereits 1830 erscheint und die mehrere Editionen erlebt.9 Bei Hofe herrschen eindeutig andere Übersetzungsprinzipien als bei den Altromantikern Schlegel und Tieck. Denn Philalethes übersetzt Dante in Jamben, eigentlich ein Unding, seit Schlegel in bahnbrechender Weise schon 1795 in Schillers Horen die ersten Auszüge aus Dante in Terzinen publiziert hatte und Karl Friedrich Ludwig Kannegießer (1809–1821), Carl Streckfuss (1824–1826) und bald August Kopisch (1841) den ganzen Dante metrisch in terza rima übersetzt hatten bzw. übersetzen sollten. „Wenn nur der Prinz nicht so gar holprige Verse machte“, seufzt Baudissin am 25. Dezember 1833. Zu Philalethesʼ Dante ist allerdings zu sagen, dass diese Übersetzung, anders als Tiecks oder Baudissins Shakespeare oder Jonson, über einen ausführlichen, ja überschwänglichen Kommentarund Fußnotenapparat verfügt, einzigartig in der Geschichte der deutschen DanteÜbertragungen, und dass die eigens dazu berufene Accademia Dantesca einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch garantiert.10 Prinz Johann berücksichtigt dabei die Vorschläge seines Komitees.11 Bei Ludwig Tieck, Dorothea Tieck und Wolf von Baudissin als Übersetzer herrschen andere Maßstäbe. Denn für Shakespeare gilt nach wie vor Schlegels apodiktische Übersetzungsmaxime aus dem Jahre 1796 „Alles im Deutschen Thunliche“,12 womit die Wiedergabe im Metrum des Originals intendiert ist. Schlegels Spruch beschränkte sich allerdings auf die textliche Wiedergabe. Fragen der textuellen Lesarten waren für ihn eher unerheblich oder jedenfalls nicht vordergründig. Für Baudissin, den Übersetzer und Diaristen in der Revisionsphase des sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘ nach 1833, war es nicht so einfach: Übersetzungsfragen (Richtigkeit der Wiedergabe) waren nunmehr von Überlegungen zu Textvarianten (Authentizität der textuellen Überlieferung) nicht zu trennen. Das war die Grundlage der bei Reimer publizierten Ausgaben, jenen von 1825–1833 und 1839–1840. Für Tieck den Vorleser hat das auch Folgen: Wir dürfen davon ausgehen, dass er bei seinen berühmten Leseabenden die ‚korrigierten‘ Versionen von Richard II., dem ersten Teil von Heinrich IV., Wie es Euch gefällt,
9
10
11
12
Vgl. Sebastian Neumeister: Philalethes – König Johann als Dante-Übersetzer. In: Zwischen Tradition und Modernität. König Johann von Sachsen (1801–1873). Hrsg. von Winfried Müller und Martina Schattowsky. Leipzig 2004 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde. 8), S. 202–216. Vgl. Vorwort zur früheren Ausgabe der Hölle (1839). In: Dante Alighieri’s Göttliche Comödie. Metrisch übertragen und mit kritischen und historischen Erläuterungen versehen von Philalethes. Erster Theil: Die Hölle. Leipzig 1871, S. VIIf. Vgl. Elisabeth Stopp: Unveröffentlichte Aufzeichnungen zu Purgatorio VI–XXIII anläßlich der deutschen Übersetzung von Philalethes, ediert und erläutert. In: Deutsches Dante-Jahrbuch 60, 1985, S. 7–72. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Böcking, Bd. 7. Leipzig 1846, S. 62.
222
Roger Paulin
Sommernachtstraum, also in der Fassung von 1825–33, geboten hat, nicht in Schlegels ursprünglichen Versionen. In der „Correctur“, der „Corrigirstunde“, von der häufig bei Baudissin die Rede ist, wird Baudissins und Dorotheas Übersetzungen (von Macbeth, Cymbeline und den Veronesern ist die Rede) der Stempel von Tiecks Autorität aufgedrückt. Tieck hat also absolute Deutungshoheit. Privat (im Tagebuch) sträubt sich Baudissin gelegentlich gegen dieses diktatorische Ansinnen, gibt aber schließlich nach. Ob das andere Tieck-Baudissin’sche Unternehmen von 1836 so streng überwacht wurde, Vier Schauspiele von Shakspeare (Eduard III., Cromwell, Oldcastle, Londoner Verlorener Sohn), darüber geben die Tagebücher keinen Aufschluss, auch ist mir keine Studie zur Sprachgestalt dieser von der Kritik oft übersehenen Übersetzungen bekannt.13 Vermutlich wurden sie vor Beginn der Tagebücher, also schon vor 1832, angefangen.14 Stichproben erbringen Indizien von Baudissins übersetzerischer Akribie, obwohl hierzu gleich zu sagen ist, dass diese apokryphen Stücke die Sprachvielfalt und Komplexität des ‚kanonischen‘ Shakespeare nicht erreichen. Ein weiteres Übersetzungswerk Baudissins, ebenfalls 1836 erschienen, bedarf hier der Erwähnung: Ben Jonson und seine Schule, Tieck gewidmet, ihm stark verpflichtet und von ihm auch durchgesehen. Bei Ben Jonson, Massinger, Fletcher usw. darf Baudissin als Übersetzer offenbar weniger streng verfahren als bei Shakespeare. Denn er gesteht in der Vorrede, er habe „manches gemildert und weggelassen“, auch „die ängstliche Beobachtung der gleichen Verszahl nicht durchführen zu müssen geglaubt“.15 Das heißt im Klartext, bei Shakespeares Zeitgenossen, aber nicht bei Shakespeare selbst, seien gewisse Laxitäten zulässig, Verstöße gegen das Feingefühl der Leser können verschönert werden (wie gleich auf der ersten Seite von Ben Jonsons Der Alchemist nachzulesen ist).16 Nur Shakespeare, so scheint es, verdiene die Akribie und Einfühlungskraft einer hohen Übersetzungskunst. Dies passt auch zu Tiecks vielfach belegter und öffentlich geäußerter Grundeinstellung.17 Als Jonson-Übersetzer und -Philologe – er exzerpiert bekanntlich Giffords Ausgabe von 181618 – geht Tieck immer von der Vorrangstellung Shakespeares aus. Ja er versteigt sich 1833 (allerdings privat, im Tagebuch) zu der Behauptung, die gegen Jonson gerichtete und Robert Greene zugeschriebene Satire Satiromastix von 1599 müsse, so heißt es bei Baudissin, teilweise von Shakespeare sein (Tagebuch, 2. November 1833). Jonson ist für ihn der Rhetor, der Manierist. Am 21. Dezember 1833 notiert Baudissin den leicht drastischen 13
14 15 16 17
18
Jedenfalls ist Tieck bei der einzigen von ihm angefertigten Übersetzung der apokryphen Werken Shakespeares oder seines Umkreises, Altenglisches Theater (1811), relativ textgetreu verfahren. Vgl. Christa Jansohn: Ludwig Tieck as the Champion of Shakespeare’s Apocrypha in Germany. In: Cahiers Élisabéthains, 1995, S. 45–51, hier S. 46. Goldmann 1981 (Anm. 2), S. 135. Ben Jonson und seine Schule 1836 (Anm. 6), Bd. I, S. XIV. Jonson: „I fart at thee“. Baudsissin: „ich schere mich / Den Henker drum“, S. 5. Vgl. Ludwig Tieck: Schriften. Bd. 11. Berlin 1829, S. XVIII–XXV („Vorbericht zur dritten Lieferung“) sowie Shakspeare’s Vorschule. Hrsg. und mit Vorreden begleitet von Ludwig Tieck, Bd. I. Leipzig 1823, hier S. XXXIIf. Vgl. die ältere Arbeit von Walter Fischer: Zu Ludwig Tiecks elisabethanischen Studien. Tieck als Ben Jonson-Philologe. In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 62, 1927, S. 98–131.
Wolf von Baudissin als Diarist
223
Vergleich: „Er verglich seinen [Jonsons] lateinischen compacten Styl mit einem festgestopften Pudding: d Gleichniß läßt sich im Gegensatz zu dem lebendigen Organismus d Shakspear noch weiter ausführen.“ Jede Annäherung etwa Jonsons an Shakespeare, erst recht jede Gleichstellung, erscheint ihm demnach von vornherein suspekt. So will Tieck auch Passagen in Baudissins Vorwort zu Ben Jonson und seine Schule gestrichen wissen: Baudissins (allerdings leicht hinkende) Vergleiche zwischen Raffael und Shakespeare und zwischen Jonson und Michelangelo. Der Wettstreit zwischen Shakespeare und Jonson soll auch unerwähnt bleiben; Baudissin lässt diese Passagen aber stehen. Gleichwohl liest Tieck bei seinen Abendlektüren aus Ben Jonson und seine Schule vor. Für ihn ist eine solche Shakespearevergötterung selbstverständlich und sinnvoll; echte Dichterverehrung, auf höherer Ebene situiert, ist eine Sache; eine ganz andere jedoch ist Carus’ („Übertriebene Adoration von Carus für Göthe“, Tagebuch, 30. Januar 1833), Zelters oder gar Bettinas „Goethe-Adoration“ (Baudissin zitiert hier Tieck). Hinter all diesen Bemerkungen und Bemühungen, einschließlich des sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘, steckt – ich zitiere Baudissins Vorrede zu Ben Jonson und seine Schule – Tiecks „versprochene[r] Vorsatz, ein umfangreiches Werk über Shakspeare, seine Zeitgenossen und Nachfolger, zu schreiben“,19 das sogenannte Buch über Shakespeare, schon 1802 Reimer versprochen, 1811 angekündigt,20 an dessen Existenz Baudissin noch glaubt und zu dessen Vollendung er Tieck auch drängt.21 Was hat das Buch über Shakespeare, jener Schemen, der durch Tiecks schöpferische Existenz geistert, mit dem sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘ und seinen Umkreis zu tun? Ich meine, eigentlich alles. Denn wir dürfen das große Bild nicht aus den Augen verlieren. Der ‚Schlegel-Tieck‘ und seine Revisionen, die drei Übersetzungen in Tiecks Namen (zwei von ihnen von Dorothea Tieck und eine von Baudissin) der Shakespeare zugeschriebenen Stücke – Shaksperes Vorschule, Alt-Englisches Theater und Vier Schauspiele von Shakspeare – und das Buch über Shakespeare gehören zu einem einzigen Komplex. Am 17. Oktober 1833, im Erscheinungsjahr des letzten Bandes des ‚Schlegel-Tieck‘, überbringt Baudissin Tieck „das Buch über Shakspere“ und schreibt, „er [Tieck] sollte billig diesen Winter darauf anfangen“. Waren es Notizen oder Entwürfe? Wir erfahren nichts Klares darüber. Baudissins Tagebücher registrieren die alten vertrauten Töne, die wir von Henry Lüdekes rekonstruiertem Text her kennen. Etwa zu Shakespeares Anfängen: „Shaksp. hält Tieck für den ersten der uranfänglichen Erzeuger des engl. Theaters, u er glaubt dß er noch vor Marlow und Green geschrieben.“ Tieck macht sich ebenfalls Gedanken über das gesamte Leben und Werk 19 20
21
Ben Jonson und seine Schule 1836 (Anm. 6), Bd. I, S. Vf. Alt-Englisches Theater. Oder Supplemente zum Shakspear. Übersetzt und hrsg. von Ludwig Tieck. Bd. I. Berlin 1811, S. XVf. Vgl. Charles Knight (1841): „[H]e promised a larger and more complete work upon the life and character of Shakspere – a promise, though frequently repeated, he has unfortunately not yet fulfilled“. In: The Pictorial Edition of the Works of Shakspere. Hrsg. von Charles Knight. Bd. 7: Doubtful Plays. London 1841, S. 418. Vgl. dazu auch die Beiträge von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann sowie von Jochen Strobel in diesem Band.
224
Roger Paulin
Shakespeares; es gilt, die beiden Seiten in Einklang zu bringen. Zu Hamlet heißt es bei Baudissin: Tieck meynt, unbegreifl auch fast am Wahnsinn gränzende Verblendungen habe Shakspear sehr bestimmt dabey vorgeschwebt, u seit diesem tragischen Vorfall sey der heitre epische Ton aus seinem Werk für immer verschwunden. Denn What You Will ist bekanntlich vorher gedichtet. – ds. aber sagte er hätte in meinem Brief über Shakespear vorkommen sollen. [Was damit gemeint ist, bleibt unklar, R.P.]
Es ist der Gedanke, den Georg Gottfried Gervinus, Andrew Cecil Bradley, Sigmund Freud und viele andere artikulieren, einer ‚dritten Periode‘ in Shakespeares Werk, umdüstert, traumatisiert und ohne die Leichtigkeit und Lieblichkeit von vorher. In dem sogenannten „4. Entwurf von 1810“ in Lüdekes Edition des Buchs über Shakespeare behandelt Tieck diese „dritte völlige Umwandlung des Dichters“.22 Das sind nur zwei Beispiele unter vielen. Überhaupt zeigt die Koexistenz des ‚Schlegel-Tieck‘ und der vielen anderen Bemühungen Tiecks und Baudissins um das große Bild (Vorgänger, Zeitgenossen, mutmaßliche Stücke), wie eigentlich alles in dem Buch über Shakespeare koaleszieren sollte. Baudissin formuliert dies nicht mit so vielen Worten, aber man darf es aus seinen Aufzeichnungen extrapolieren. Auch Baudissins Ben Jonson und seine Schule darf man durchaus hierzu rechnen. Tieck hat seine Vorstellungen von der elisabethanischen Bühne nie vollständig oder konsequent formuliert. Aus den Ben Jonson und seine Schule beigebundenen Kupferstichen vom Fortune-Theater in London werden sie jedoch anschaulich.23 Bei Tiecks Bestreben um den ganzen Shakespeare tun sich jedoch Dichotomien auf, die er nie richtig zu bewältigen vermag. Im Zeichen des Geniegedankens, mit dem er aufgewachsen ist, steht vorrangig der Dichter Shakespeare und das seit Pope, Johnson und Steevens für authentisch gehaltene kanonische Werk (Histories, Comedies, Tragedies). Tieck ist aber ebenfalls Erbe und Nutznießer der seit Capell und Malone gängigen Inthronisierung des sogenannten apokryphen Shakespeare. In der neueren Forschung24 – ich habe mich 1985 noch auf Tucker Brookes altes Standardwerk von 1908 verlassen müssen25 – sind die Grenzen zwischen dem kanonischen und dem apokryphen Shakespeare fließend geworden. Sie waren es schon bei Schlegel und um 1830 auch: Baudissin äußert sich kritisch zu Schlegels Zuordnung der Two Noble Kinsmen zu Shakespeare und ganz ablehnend zu William Spalding: A Letter on Shakespeare’s Authorship of the Two Noble Kinsmen, 1833.26 Ich würde 22
23 24
25 26
Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig Tieck. Aus seinem Nachlaß. Hrsg. von Henry Lüdeke. Halle a.S. 1920 (Neudrucke deutscher Literaturwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1), S. 405. Im Anhang zu Ben Jonson und seine Schule 1836, Bd. 2 (Anm. 6). Vgl. bes. Peter Kirwan: Shakespeare and the Idea of Apocrypha. Negotiating the Boundaries of the Dramatic Canon. Cambridge 2015. Zu Tieck siehe bes. S. 45–48. Paulin 1985 (Anm. 7), S. 246–249. William Spalding: A Letter on Shakspeare’s Authorship of The Two Noble Kinsmen; A Drama Commonly Ascribed to John Fletcher. Edinburgh, London 1833.
Wolf von Baudissin als Diarist
225
meine 1985 und seitdem geäußerte Skepsis gegen Tiecks großzügige – übergroßzügige – Parteinahme für den apokryphen Shakespeare jetzt etwas abmildern und folgende Position vertreten: Wollte man die Tieck’sche Shakespeare-Übersetzung historisch verorten, so müsste man die Trennwand zwischen dem sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘ und etwa Vier Schauspiele von Shakspeare niederreißen, das kommerzielle Unternehmen (‚Schlegel-Tieck‘ für Reimer) und das quasi-wissenschaftlich-antiquarische (Vier Schauspiele für Brockhaus) einander annähern, wie es in Wirklichkeit nie geschehen ist. Wie das editorisch zu realisieren wäre, überlasse ich der jüngeren Forschergeneration. Ein englischer Zeitgenosse von Tieck, Charles Knight, hat in seiner Pictorial Edition of the Works of Shakespere (1838–1841) die ‚Doubtful Plays‘ in einem Zusatzband angehängt. Bei Tieck müsste man sicher ganz anders verfahren. Nach Baudissins Aussagen wird die Revision des ‚Schlegel-Tieck‘ energisch vorangetrieben, ja Baudissin wird von Tieck damit beauftragt. Reimer drängt und sendet sogar eigene Korrekturvorschläge, die Baudissin ablehnt, mit der Bitte, solches Ansinnen zu unterlassen (22. Januar 1839). Schlegels Entrüstung über die ‚Verbesserungen‘ an seinen Versionen lässt Tieck und Baudissin kalt: [H]ernach sich mit ganz andern Dingen beschäftigt u die Studien zum Shakspeare längst vergessen hat, zürnt sich nun so: dies ist recht abgeschmackt. Tieck zu dem ich um 12 mit dem Reimerschen Brief ging, wird seine Anmerkungen nicht zurück nehmen, u im Gegentheil noch ein paar Stellen hervorheben wo Schlegel sich geirrt. (26. Oktober 1838)
Ein paar kurze Schlussbemerkungen zu den Englischkenntnissen beider, Tiecks wie Baudissins, wie sie die allerdings sporadischen Einblicke in die Werkstatt der Übersetzer in den Tagebüchern gewähren. Diese sind immerhin vielsagend. Es geht aus den Tagebüchern hervor, dass die Übersetzer des ‚Schlegel-Tieck‘ sich mehrere Varianten durch den Kopf gehen lassen, bevor sie sich auf die Endfassung fixieren. Am 29. November 1833 notiert beispielsweise Baudissin: „Tieck gab mir einen Beweis seiner großen englischen Sprachkunde, indem er to rifle gleich richtig wie gestern Noel [?] dieß wetteifern, vielleicht auch balgen erklärte.“ Nur leider ist das nicht lexikalisch belegt und muss als pure Erfindung gelten. An der einzigen Stelle in Shakespeares Werk, wo von „rifle“ die Rede ist (Veroneser, 4. Akt, 2. Szene, Vers 49), übersetzt der ‚SchlegelTieck‘ es richtig mit „ausplündern“. Vielleicht lag hier eine Gedankenassoziation mit dem deutschen „raufen“ zugrunde. Auch mit Schlegel setzt man sich auseinander und meint, es gelegentlich besser zu wissen. Am 26. Oktober 1838 notiert Baudissin: Im ersten Teil von Heinrich IV. (2. Akt, 1. Szene, Vers 67) stehe „a pair of gallows“. Schlegel, so Baudissin, hätte es mit „ein Paar Galgen“ wiedergeben sollen. Aus dem Kontext geht aber eindeutig hervor, dass, um Falstaff zu hängen, „zwei Galgen“, zwei einzelne, nötig wären. Schlegels Version wird in der Druckfassung trotzdem belassen. Auch Tieck kommt unter die kritische Lupe. Privat (am 19. Januar 1833) äußert Baudissin Bedenken über Tiecks Lesarten im Timon: „Mantel“ für „cloud“ ist ihm suspekt. Er akzeptiert gleichwohl Tiecks Version, und Tieck hat mit „cloud“ im Sinne von Verhüllung oder Verkleidung moderne Editoren auf seiner Seite (im ‚Schlegel-
226
Roger Paulin
Tieck‘ steht „er geht in einer Wolke fort“). „Leg“ im selben Stück als „Kniebeugung“ will Baudissin auch nicht gefallen: Tiecks Vorschlag ist aber richtig. „Flouting“ (21. Februar 1833) in der 2. Szene von Macbeth wird auf Tiecks zutreffenden Vorschlag hin von „flattern“ in „spotten“ geändert (Dorothea Tieck muss das wohl hinnehmen): „Wo Norwegs Fahnen nun der Lüfte spotten“ ist eine sinnvolle Revision. Bei einem Vorschlag jedoch geht Baudissin, und mit ihm Tieck, völlig in die Irre, mit Konsequenzen für den Shakespeare’schen Text. Es handelt sich um eine Stelle in Der Widerspenstigen Zähmung (4. Akt, 2. Szene, Vers 61). Am 23. März 1839 schreibt Baudissin: [W]ie durchgreifend unsere Correcturen sind, mag daraus hervorgehn, dß wir mit dem besten Effect heut von der Welt Pinsel statt Engel gesetzt haben. Die Stelle At last I spied an ancient angel coming down the hill muß nämlich wahrscheinlich enghle heißen, ein altes Wort für un niais.
Zugegeben: Im Deutschen gäbe „Engel“ wenig Sinn. Die Kommentatoren sind sich darüber einig, dass hier „angel“ so etwas heißt wie „Mann von altem Schrot und Korn“, nach der alten Münze „an angel“, also ein „Biedermann“, wie im ‚Schlegel-Tieck‘ auch richtig steht. In der Reimer’schen Revision wird das aber geändert: Mindestens bis 1867 ist dort „Pinsel“ („un niais“) nachzulesen. Unnötig zu sagen, dass diese Lesart in den englischsprachigen Kommentaren zu The Taming of the Shrew kein Echo gefunden hat.
Cornelia Ilbrig
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen Brentanos Überlegungen zum Übersetzen vor dem Hintergrund frühromantischer Dichtungs- und Übersetzungstheorie
Eine der wohl am häufigsten zitierten Romantikdefinitionen Brentanos lautet: „Das Romantische selbst ist eine Übersetzung.“1 Dieser apodiktische Satz findet sich am Schluss des achten Kapitels im zweiten Band des 1801 erschienenen Romans Godwi oder das steinerne Bild der Mutter.2 Das Kapitel erweist sich als überraschend ergiebig im Hinblick auf Modellierungen von Theorien zum Romantischen und zum Übersetzen. Es werden verschiedene Spielarten des Übersetzens aufgezeigt und rückgebunden an eine Typologie der zu übersetzenden Dichter; zudem erfolgt in diesem Kapitel eine augenfällige Engführung der Begriffe ‚romantisch‘ und ‚das Romantische‘ mit dem des ‚Übersetzens‘, die sich in anderen Formulierungen und Gewichtungen vor allem auch bei Novalis3 findet. Zudem wird die Identifikation des Romantischen mit der Übersetzung durch das Pronomen „selbst“ verstärkt. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist Brentanos Bestimmung des Romantischen. So heißt es vom fiktiven (männlichen) Herausgeber Maria, der Godwi begleitet, um seiner und seines Vaters Familiengeschichte nachzuspüren, zu Beginn des achten Kapitels: „Alles, was zwischen unserm Auge und einem entfernten zu Sehenden als Mittler steht, uns den entfernten Gegenstand nähert, ihm aber zugleich etwas von dem seinigen mitgiebt, ist romantisch.“4 Diese Erklärung bringt das Romantische in eine unerwartete Nähe zum Übersetzen, für das sich im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS) folgende Bedeutungsbeschreibung findet: „1. jemanden mit einem Boot oder einer Fähre ans andere Ufer fahren“ und 2. „einen Text schriftlich oder mündlich in eine andere Sprache übertragen“.5
1
2 3 4 5
Clemens Brentano: Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Ein verwilderter Roman [2 Teile, 1800/1801.] Frankfurter Brentanoausgabe (FBA). Bd. 16. Hrsg. von Werner Bellmann. Stuttgart 1978, S. 319 (Hervorhebung von C.I.). Brentano 1978 (Anm. 1). KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4161. Vgl. S. 1, Anm. 2. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 314. https://www.dwds.de/wb/%C3%BCbersetzen (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 21.8.2022 gesehen). Auch im Deutschen Wörterbuch finden sich sprachliche und räumliche semantische Beschreibungen als wesentliche Bedeutungsangaben (Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=U01823, Bd. 23, Sp. 552).
https://doi.org/10.1515/9783111017419-016
228
Cornelia Ilbrig
Beide Bedeutungen, sowohl die sprachliche als auch die räumliche, treffen sich auch mit dem Romantischen, wie es Brentano charakterisiert: Ein Mittler, ein Medium, etwas Mittelndes oder auch Vermittelndes ist dann romantisch, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens steht dieses (Ver-)Mittelnde zwischen „unserm Auge“ und „einem entfernten zu Sehenden“. Zweitens führt es den entfernten Gegenstand an uns heran. Drittens verleiht das Mittelnde bzw. Vermittelnde dabei diesem Gegenstand etwas von sich selbst und transformiert ihn somit. Kurz darauf folgt die wohl bekannteste Romantikdefinition Brentanos: „das Romantische ist also ein Perspectiv oder vielmehr die Farbe des Glases und die Bestimmung des Gegenstandes durch die Form des Glases.“6 Damit ergänzt Godwi die Ausführungen Marias, indem er die Aktivität des Mediums näher charakterisiert: Es wirkt als Perspektiv, das den zu vermittelnden Gegenstand in seinem Format auswählt, einfärbt und transformiert. Mit dem „Perspektiv“ nimmt Brentano Bezug auf eine medientechnische Innovation des 17. Jahrhunderts, die in der Folgezeit von Reisenden und Malern genutzt wurde, um ein Landschaftserlebnis hervorzurufen: die vom Landschaftsmaler Claude Lorrain entworfenen sogenannten Claude-Gläser, in Form und Tönung präparierte Hohlspiegel,7 die genau das leisten, was Brentano in seiner Erklärung des Romantischen beschreibt: Bei Betrachtung der Landschaft durch diese Spiegel definieren diese durch ihre Färbung und Form das entstehende Bild. Auf diese Weise bestimmt Brentano sowohl das Romantische als auch die Übersetzung dynamisch – als Einfärbungs- und Transformationsprozess, der durch das Medium respektive Perspektiv möglich wird. Schwerpunkt des ersten Abschnitts wird im Folgenden die Typologie der drei Übersetzungsarten sein, die im achten Kapitel des Romans vorgestellt wird. Im nächsten Schritt wird diese in Bezug zur frühromantischen Dichtungs- und Übersetzungstheorie gesetzt, um am Schluss aufzuzeigen, wie Brentano die beiden Bedeutungen des Übersetzens, die sprachlich-textuelle und die räumliche als die ursprüngliche, vortextliche Übersetzungsform, ausbaut und aufeinander bezieht.
1. Im Roman Godwi ist die Absicht eines „Haber“ genannten Übersetzungsanfängers Anlass zur Reflexion verschiedener Übersetzungsmöglichkeiten. Angespielt wird dabei auf den von Brentano nicht besonders wertgeschätzten Jenaer Studenten Johann Diederich Gries. Haber löst mit seiner unvermittelt wirkenden Ankündigung einer Übersetzung von Tassos Befreitem Jerusalem8 eine Diskussion über die Möglichkeiten und
6 7
8
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 314. Vgl. z.B. Harald Schmidt: Die psychotische und ästhetische Struktur der Naturschilderungen in Georg Büchners Lenz. Wiesbaden 1994, S. 80. Torquato Tasso: Das befreite Jerusalem. Übersetzt von J. D. Gries. 2. Teile. Leipzig 1800/1803.
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
229
Spielarten literarischen Übersetzens aus. Die Resultate der drei möglichen Übersetzungsarten werden von Godwi und Maria bildlich 1. als „Gypsabdr[ü]ck[e]“9, 2. als gezähmte „Adler“10 und 3. als „[t]ransportierte Eichen“11 bezeichnet. Der „Gypsabdruck“, ins Verhältnis zum originalen Marmor gesetzt, ist das Bild für die Übersetzung eines sogenannten „reinen schönen Kunstwerks“, das „seinen Gegenstand bloß darstellt“.12 Mit dem etwas überraschenden Bild des „Gypsabdrucks“ spielt Brentano auf die Antikensäle in Mannheim und Dresden an,13 die statt Originalen Gipsabgüsse antiker Kunstwerke präsentierten, deren Evidenzcharakter dennoch unstrittig war. Die ‚reinen‘, oder auch klassischen Dichter (wie z.B. Homer, Ovid, Sophokles) sind, so Maria, „etwas weiter von uns entfernt“, vor allem aber hebe „diese Entfernung jedes Medium zwischen ihm und uns auf[], welches sie uns unrein reflectieren könnte. Die Bedingniß ihres Übersetzers“, so Maria weiter, ist bloße Wissenschaftlichkeit in der Sprache und dem Gegenstande, er darf bloß die Sprache übersetzen, so muß sich seine Übersetzung zu dem Original immer verhalten, wie der Gypsabdruck zu dem Marmor. Wir sind alle gleichweit von ihnen entfernt, und werden alle dasselbe in ihnen lesen, weil sie nur darstellen, ihre Darstellung selbst aber keine Farbe hat, weil sie Gestalt sind.14
Die zeitliche und kulturelle Entfernung lasse also eine enge individuell-persönliche Beziehung zwischen Kunstwerk und Rezipienten nicht zu. Bemerkenswert ist, dass Brentano hier das Bild des Gipsabdrucks für diese Übersetzungen verwendet – und damit Übersetzungen mit Vervielfältigungen gleichsetzt, die – anders als das Original in Marmor – leichter händelbar und damit konsumentenfreundlicher sind und ihren Vervielfältigungs-/Übertragungs-/Übersetzungscharakter vergessen machen können. Gips als Material ist also sehr wohl ein Medium, und zwar eines, das ganz anders als das Perspektiv dem Original keine eigene Färbung mitgibt, sondern im Gegenteil den Vervielfältigungen in den Augen der Rezipienten Evidenz verleiht. Das moderne, romantische Kunstwerk hingegen, das „seinen Gegenstand nicht allein bezeichnet, sondern seiner Bezeichnung selbst noch ein Colorit giebt“,15 stelle eine ganz andere Herausforderung an seinen Übersetzer dar. Denn, so Maria, „dem Uebersetzer des Romantischen wird die Gestalt der Darstellung selbst ein Kunstwerk, das er übersetzen soll.“16 Die den Dichtern eigentümliche Sprache sowie ihr Sprachrhythmus, die, gepaart mit individuellen Haltungen und Einstellungen, die Darstellung eines Gegenstandes und damit das Kunstwerk prägen, verlangen vom Übersetzer, selbst 9 10 11 12 13
14 15 16
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 317. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 318. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316. Wiebke Hoheisel: Goethes Geschichtsdenken in seinen autobiographischen Schriften. Berlin, Boston 2013, S. 170. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316f. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316.
230
Cornelia Ilbrig
„entsetzlich, viel zu übersetzen, ehe er an die Uebersetzung selbst kömmt“.17 Das Problem des Übersetzens romantischer Kunstwerke beschreibt Brentano als eine hermeneutische Spiralbewegung: Es gibt keinen direkten, von einem sicheren Standort ausgehenden und zielführenden Weg zum Sinn eines Textes (und damit auch nicht zu dessen Verstehen und Übersetzen); der Interpret bzw. Übersetzer befindet sich stattdessen (wenn es gut läuft) in einer unendlichen Annäherungsbewegung hin zum zu übersetzenden oder zu interpretierenden Text, oder dreht sich (wenn es schlecht läuft) nur im Kreise.18 Am Beispiel von Tassos Epos Das befreite Jerusalem führt Maria aus: mit was hat der neue rhythmische Uebersetzer zu ringen, entweder muß er die Religiosität, den Ernst und die Glut des Tasso selbst besitzen, und dann bitten wir ihn herzlich, lieber selbst zu erfinden, hat er dieses alles aber nicht, oder ist er gar mit Leib und Seele ein Protestant, so muß er sich erst ins Katholische übersetzen, und so muß er sich auch wieder geschichtlich in Tassos Gemüth und Sprache übersetzen19.
Für denjenigen – und hier ist Haber alias Gries gemeint –, der ein solches Unternehmen dennoch wagt, hat Godwi folgenden Rat: Wie übersetzt man einen italienischen Adler ins Deutsche? – Antwort – Recipe eine Papiertute, ziehe sie ihm über den Kopf, so ist er aus dem Wilden ins Zahme übersetzt, wird dich nicht beißen, ja er ist der nämliche Adler und zwar recht treu übersetzt.20
Und Maria fügt hinzu: „Recht getreu, sagte ich, denn er sitzt nun unter den deutschen Hühnern recht geduldig und getreu, wie ein Hausthier.“21
17 18 19 20
21
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316. Vgl. z.B. Radegundis Stolze: Hermeneutik und Translation. Tübingen 2003, S. 83. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 316. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 317. Die von Brentano so gescholtene Gries-Übersetzung von Tassos Befreitem Jerusalem fand einige Wertschätzung bei seinen Zeitgenossen (vgl. ebd., S. 723). Brentano muss in der Entstehungszeit des Godwi die Übersetzungsprobe vorgelegen haben, die 1798 in Wielands Zeitschrift Neuer Teutscher Merkur erschienen und von Wieland rezensiert worden war (vgl. Elena Polledri: Die Aufgabe des Übersetzers in der Goethezeit. Deutsche Übersetzungen italienischer Klassiker von Tasso bis Dante. Tübingen 2010, S. 110). Brentano 1978 (Anm. 1), S. 318. Hintergrund von Brentanos Unterscheidung zwischen klassischen wissenschaftlich übersetzbaren Autoren und modernen romantischen Autoren ist u.a. Friedrich Schlegels Essay Über das Studium der griechischen Poesie (1797, KFSA, Bd. I/1: Studien des klassischen Altertums. Hrsg. von Ernst Behler Paderborn u.a. 1979) entnommen, in dem dieser die „vollständige Schönheit“ (S. 217) der klassischen Kunst der Darstellung des „Charakteristischen, Individuellen und Interessanten“ (S. 228) in der romantischen Literatur entgegensetzt. Das bezeichnende Merkmal für diese ist das „rastlose unersättliche Streben nach dem Neuen, Piquanten und Frappanten, bei dem dennoch die Sehnsucht unbefriedigt bleibt.“ (S. 228) Die Entgegensetzung von klassischer Kunst (als der „Kunst des Besitzes“) und romantischer Kunst als Poesie „der Sehnsucht“, die „sich zwischen Erinnerung und Ahnung“ „der inneren Entzweiung“ bewusst sei, soll dann auch August Wilhelm Schlegel bei der Vorlesungsreihe Über dramatische Kunst und Litteratur, die er 1808 in Wien hielt, beschäftigen (August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur [1809–1811]. In: KAV, Bd. IV/1. Hrsg. von Stefan Knödler. Paderborn 2018, S. 16f.).
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
231
Der Übersetzungsvorgang eines romantischen Textes (wie des Befreiten Jerusalems von Tasso) muss demnach doppelt ausgerichtet sein: einmal historisch in die Vergangenheit: Der langwierige Übersetzungsprozess ist polyperspektivisch; die Einfärbungen bzw. Perspektiven wie beispielsweise Katholizismus, feuriges Gemüt, italienische gebundene Sprache, historischer Renaissancekontext muss der Übersetzer jeweils übersetzen. Das Resultat wäre damit eine potenzierte Übersetzung. Zweitens steht der Übersetzer vor der Aufgabe, diese heroische Renaissancezeit (für die das Bild des Dichters Tasso als Adler steht) in die kleinbürgerliche Gegenwart zu übertragen. Wenn der Übersetzer unfähig ist – und dafür hält Brentano Johann Diederich Gries –, dann wird aus dem Adler durch das Medium der Schrift (die Papiertüte über dem Kopf) ein Papieradler, die Karikatur des wilden starken Adlers, der nun in der Gestalt eines treuen Haushahns zwischen Hühnern sitzt. Grundsätzlich unterscheidet Brentano hier zwischen zwei Arten von Kunstwerken, von denen eines wegen seiner klassizistisch geprägten Gestaltevidenz leicht übersetzbar, das andere wegen seines modern-romantisch geprägten Kolorits nicht übersetzbar ist. Es gibt für Brentano allerdings noch einen zweiten Typus moderner Autoren, und zwar solche, die eben so über ihrer Sprache [stehen], wie über ihrer Zeit. Sie haben mehr Leidenschaft als Worte, und mehr Worte als Töne. Sie stehen riesenhaft in ihren Sprachen da, und ihre Sprache kann sie nicht fesseln, da ihrem Geiste kaum die Sprache überhaupt genügt, und man kann sie wol wieder in einen anderen wackeren Boden versetzen.22
Zu diesen Autoren zählt Brentano Dante und Shakespeare; für ihre Werke findet er das Bild der „transportirte[n] Eichen“. Allenfalls, so Maria, müsse man noch ein paar der „kleinen Wurzeln wegschneiden […], um sie in eine neue Grube zu setzen.“23 Dieses Bild vereint nun beide Bedeutungen des Wortes ‚Übersetzen‘, die sprachliche und die räumliche. Brentano beschreibt Dante und Shakespeare als ihrer Sprache und ihrer Zeit, ihrer eigenen Kultur enthobene Dichter, deren Werke überall sonst auch auf fruchtbaren Boden fallen können, und schließt sich so der frühromantischen Auffassung von Shakespeares Universalismus an: „Shakespeares Universalität ist wie der Mittelpunkt der romantischen Kunst“,24 schreibt Friedrich Schlegel beispielsweise im 247. Athenaeumsfragment. Von den klassischen Dichtern unterscheiden sie sich durch ihre Individualität, von romantischen Dichtern wie Tasso und Petrarca durch die von den Eigentümlichkeiten der Sprache und Kultur unabhängigen Stärke ihres Geistes, ihrer Leidenschaft und ihrer Worte.
22 23 24
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 318. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 318. KFSA, Bd. I/2: Charakteristiken und Kritiken I. 1796–1801. Hrsg. von Hans Eichner. Paderborn u.a. 1967, S. 206.
232
Cornelia Ilbrig
Zieht man Brentanos Theorie vom romantischen Mittlertum25 als Analyseinstrumentarium auf die zwei Übersetzungstypen romantischer Kunstwerke heran, ergibt sich zusammengefasst folgendes Bild: Die Übersetzerin bzw. der Übersetzer haben es bei den Texten von Tasso und Petrarca mit Kunstwerken zu tun, die medial durch eine ihnen eigentümliche Perspektive geprägt sind. Der mit glühendem Eifer vertretene Katholizismus ist beispielsweise das Perspektiv, durch das die Welt im Tasso gesehen und in Sprache übersetzt wird. Übersetzungen romantischer Kunstwerke wären also potenzierte Übersetzungen, die vom Übersetzer eine vielfache Übersetzungsleistung verlangen: für Brentano nahezu ausgeschlossen, zumal er auch vom Begriff des „poetische[n] Übersetz[ens]“,26 wie ihn August Wilhelm Schlegel vorschlägt, keinen Gebrauch macht. Im zweiten Fall ist der entfernte Gegenstand, das zu übersetzende Kunstwerk nicht durch eine den Autoren eigentümliche Perspektive gebrochen und so übermächtig und stark, dass seine Ausstrahlung bis zu den Rezipienten reicht und der ‚Transport‘, die räumliche Übersetzung kaum noch Mühe kostet. Eine gelingende Übersetzung innerhalb der Moderne stützt sich bei Brentano auf zwei Bedeutungen: die räumliche und die sprachliche. Allerdings dürfte es sich bei Übersetzungen Shakespeares und Dantes, da ihr Universalismus Medium und Perspektive obsolet machen, nach Brentanos Verständnis gerade nicht um romantische Übersetzungen handeln. Auf der Metaebene betrachtet allerdings sind die von Brentano entworfenen Bilder zu seiner Übersetzungstypologie auch wieder durch die Mittler (Maria oder Godwi) – und damit perspektivisch – ‚gefärbt‘. Die verschiedenen hermeneutischen Vorgänge bei der Übersetzung moderner romantischer Autoren werden am zugehörigen Bild explizit durchexerziert. Das Verfahren der romantischen Ironie wird besonders deutlich am mittleren Beispiel: Der italienische Text wird in das Bild des Adlers übersetzt, welcher wiederum durch das Bild der Papiertüte um- bzw. überschrieben wird. Diese papierne Karikatur eines Adlers ist blind; außerdem zahm und treu „wie ein Hausthier“. Das dürfte auch eine ironische Anspielung auf die Übersetzungstreue sein, die sowohl Wieland und Eschenburg (mit Schwerpunkt auf der Nachbildung des Wortschatzes) als auch August Wilhelm Schlegel (mit Schwerpunkt auf Sprachstil, Bildlichkeit und Versform) als wichtiges Ziel gilt. Eine Übersetzung, die einen wilden Adler in einen treuen Haushahn verwandelt, darf jedoch – und damit führt Brentano im eigenen Bild das Ziel der Übersetzungstreue ad absurdum – als vollständig gescheiterter hermeneutischer Vorgang gelten.
25 26
Vgl. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 314. August Wilhelm Schlegel: Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112, hier S. 76.
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
233
2. Es wird kaum ein Zufall sein, dass Brentano ausgerechnet für den dritten Übersetzungstypus das Bild der „Eiche“ als des deutschen Wappenbaums wählt, der schon im heidnischen Glauben der Germanen eine besondere Rolle spielte.27 Es geht demzufolge nicht nur um Übertragung, sondern um Aneignung. Damit schließt sich Brentano im Hinblick auf die Rezeption Shakespeares in Deutschland der Emphase der frühromantischen Gruppe um August Wilhelm Schlegel und Novalis an.28 Eine weitere offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen Brentano und Novalis besteht in der Engführung von Übersetzung und romantischer Poesie: „Am Ende ist alle Poesie Übersetzung“, leitet Novalis den letzten Absatz seines Briefs an Schlegel vom 30. November 179729 ein und kommt damit Marias Feststellung im Godwi, „Das Romantische selbst ist eine Übersetzung“, sehr nahe.30 Doch unterscheiden sich die Übersetzungstheorien und -hypothesen von Schlegel und Novalis einerseits von Brentanos Übersetzungsverständnis andererseits fundamental. Shakespeare scheint Schlegel (anders als Brentano) nicht allein als universaler Autor, der sich grundsätzlich für Übersetzungen eignet, sondern umgekehrt hält er die deutsche Sprache und Kultur für am besten geeignet, Skakespeares Geist und Leidenschaft widerzuspiegeln.31 Dieser nahezu uneingeschränkte Übersetzungsoptimismus, was die Aufnahmefähigkeit des Deutschen 27 28
29 30
31
Vgl. Jacob Grimm: Deutsche Mythologie. Bd. 2. Göttingen 1844, S. 617. Dass Brentano August Wilhelm Schlegel hinsichtlich kultureller Einflüsse auch noch später als Vorbild betrachtet, zeigt sich an folgender Bemerkung in einem Brief an Joseph Görres von 1810: „A.W. Schlegel wird mit der Stael nach Amerika gehn. Adieu Shakespear und Calderon, bald werden wir amerikanische Sonette lesen und machen müssen.“ (Clemens Brentano an Joseph Görres [Anfang 1810]. In: Frankfurter Brentanoausgabe (FBA). Bd. 32, Briefe IV. Hrsg. von Sabine Oehring. Stuttgart 1996, S. 248. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4161. Begeistert von Schlegels erstem Band der Shakespeare-Übersetzung fügt Novalis hinzu: „Ich bin überzeugt, daß der deutsche Shakespeare jetzt besser als der englische ist“. (KAWS, https://august-wilhelmschlegel.de/version-01-22/briefid/4161). Bei dieser Einschätzung spielt es wohl eine große Rolle, dass die von Schlegel entworfene Programmatik der poetischen Übersetzung die Ansprüche erfüllt, die die Frühromantiker an die moderne Poesie stellen. Jede Poesie soll zugleich „Poesie der Poesie“ sein, heißt es im 238. Athenaeumsfragment (KFSA, Bd. I/2 [Anm. 24], S. 204), und in diesem Sinne ist eine gelungene poetische Übersetzung – dem virtuosenästhetischen Konzept der Frühromantiker entsprechend – potenzierte Poesie. Damit steht er in einer langen Tradition seit Lessings Hamburgischen Dramaturgie (vgl. Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgische Dramaturgie. Bd. 12, Stück 12, vom 9. Juni 1767. Hamburg, Bremen 1769, S. 89–96). So schreibt Schlegel 1797 an Tieck: „Ich hoffe, Sie werden in Ihrer Schrift [Briefe über Shakespeare, C.I.] unter anderm beweisen, Shakespeare sey kein Engländer gewesen. Wie kam er nur unter die frostigen, stupiden Seelen auf dieser brutalen Insel? Freylich müssen sie damals noch mehr menschliches Gefühl und Dichtersinn gehabt haben, als jetzt.“ (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/878.) Im Essay Etwas über William Shakespeare, bey Gelegenheit Wilhelm Meisters heißt es: „Bildsamkeit ist der ausgezeichnetste Vorzug unsrer Sprache, und sie hat in dieser Art schon vieles geleistet, was andern Sprachen misglückt oder weniger gelungen ist: man muß an nichts verzweifeln“ (vgl. Schlegel 1796 [Anm. 26], S. 82). Im Brief vom 30. November 1797 bestärkt Novalis diese These: „Außer den Römern sind wir die einzige Nation, die den Trieb des Übersetzens so unwiederstehlich […] gefühlt. Dieser Trieb ist eine Indication des sehr hohen, ursprünglichen Karacters des
234
Cornelia Ilbrig
(der Sprache, Mentalität und Kultur) für fremde Nationalpoesien anbelangt, spiegelt sich vor allem in August Wilhelm Schlegels im vierten Athenaeumsheft 1799 veröffentlichter Nachschrift des Uebersetzers an Ludwig Tieck zur Übersetzung des „Eilften Gesangs“ von Ariosts Rasendem Roland wider. Hier heißt es: Nur die vielseitige Empfänglichkeit für fremde Nationalpoesie, die wo möglich bis zur Universalität gedeihen soll, macht die Fortschritte im treuen Nachbilden von Gedichten möglich. […] Meine Absicht ist, alles in seiner Form und Eigentümlichkeit poetisch übersetzen zu können, es mag Namen haben wie es will: antikes und modernes, klassische Kunstwerke und nationale Naturprodukte.32
Ganz in diesem Sinne versammelt Schlegel 1804 in der Lyrikanthologie Blumensträuße italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie mit Erstübersetzungen von lyrischen, dramatischen und epischen Texten der Renaissance von Dante, Petrarca, Tasso, Boccaccio, Ariost, Cervantes, Guarini, Montemayor und Camões „die ganze Bandbreite romantischen Formenreichtums“:33 Sonett, Madrigal, Stanze, Sestine, Kanzone und Glosse. Auch Schlegel ist sich natürlich bewusst, dass die Übersetzungen poetischer Texte sich nur asymptotisch an die Originale annähern können. Priorität hat dabei für ihn erstens die Übertragung der poetischen Form,34 zweitens schlägt er vor, dem „Buchstaben des Sinnes nach“35 zu übersetzen – den Sinn also auszubuchstabieren. Auf eine solche Diskussion lässt sich Brentano gar nicht erst ein; Schlegels Konzept poetischen Übersetzens, das er als interessierter Teilhaber an zeitgenössischen Diskursen vermutlich kannte, bleibt bei ihm eine Leerstelle. Zwei wesentliche Punkte lassen sich an Brentanos Überlegungen vor dem Hintergrund frühromantischer Übersetzungstheorien erkennen: 1. Übersetzungen ebnen für ihn nicht den Weg zum Kosmopolitismus; Nationalliteraturen bleiben immer Nationalliteraturen, und 2. steht die Aussage „Das Romantische selbst ist eine Übersetzung“ seltsam bezuglos im Raum, wenn romantische Kunstwerke in der Regel keine Übersetzungen von einer Sprache in eine andere sein können. Was genau lässt sich denn stattdessen als gelungene romantische Übersetzung bezeichnen?
32 33
34 35
deutschen Volks. Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt. Nur für uns sind Übersetzungen Erweiterungen gewesen…“ (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4161). Friedrich und August Wilhelm Schlegel: Athenaeum 2, 1799, Stück 2, S. 247–285, hier S. 280f. August Wilhelm Schlegel: Blumensträuße italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie (1804). Nach dem Erstdruck hrsg. von Jochen Strobel. Dresden 2007, Klappentext. Schlegel 1796 (Anm. 26), S. 109f. Schlegel 1796 (Anm. 26), S. 82.
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
235
3. Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn man sich von der strengen Definition der Übersetzung als Übertragung von einer Sprache in die andere löst und den Übersetzungsbegriff in zweifache Richtung erweitert. So ist es erstens weder eine Verlegenheitslösung noch Zufall, dass Brentanos wenige Übersetzungen in einem Band mit seinen Bearbeitungen stehen. Bezeichnend für Brentanos gesamtes Schaffen sind seine intertextuellen Bezugnahmen – sowohl auf eigene als auch auf Fremdtexte; seine Arbeitsweise ist „eigentümlich reproduzierend[], stets von Quellen und Vorlagen bestimmt[]“.36 Brentanos Texte zeichnen sich so durch eine starke Hybridität aus, sowohl hinsichtlich „ihrer Offenheit und ihrer Durchlässigkeit gegenüber anderen Texten, als auch hinsichtlich der Gattungen und der Autorschaft.“37 Auch diese intertextuellen Textgefüge sind, wie vom 238. Athenaeumsfragment eingefordert, „Poesie der Poesie“.38 Sowohl Bearbeitungen (auch im erweiterten Sinne) als auch Übersetzungen lassen sich somit als Quellenadaptationen beschreiben, die durch inter-, para-, meta-, hyper- und architextuellen Verfahrensweisen potenzierte Poesie sind. Zum zweiten lohnt sich ein erneuter Blick auf die zwei Bedeutungen des Wortes ‚Übersetzen‘: die räumliche und die sprachliche. Der eigentliche Bezugstext des Satzes „Das Romantische selbst ist eine Übersetzung“ findet sich nämlich nicht in dem eben analysierten Übersetzungskapitel des Godwi, sondern im Kapitel davor. Auch bei Flamettas intermedialer Aufführung der mythologischen Geschichte um Cypariss aus Ovids Metamorphosen handelt es sich um eine Übersetzung, zumal ihr Godwi, Maria und Haber durch einen Spiegel zuschauen. Kurz zur Geschichte: Der Jüngling Cypariss war mit einem zahmen Hirsch befreundet. Aus Versehen erschießt Cypariss den Hirsch, als dieser sich gerade im Schatten ausruht, und leidet unter seiner Tat so sehr, dass er den Sonnengott Apoll um den erlösenden Tod bittet und daraufhin in eine trauernde Zypresse verwandelt wird.39 Flamettas szenische, mit zahlreichen Kulissen ausgestattete Aufführung beginnt erst nach dem Tod des Hirschs. Cypariss beweint den selbst verschuldeten Tod seines besten Freundes.40 Die von Flametta aufgeführte Geschichte ist geprägt von Freundschaftspathos, endlosem Verlustschmerz und Todessehnsucht, 36
37
38 39
40
Jürgen Behrens, Wolfgang Frühwald, Detlev Lüders: Zum Stand der Arbeiten an der Frankfurter Brentano-Ausgabe. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, 1969, S. 398–426, hier S. 406. Vgl. Clemens Brentano: Gedichtbearbeitungen I. In: Frankfurter Brentanoausgabe (FBA) (Anm. 1). Bd. V/1. Hrsg. von Sabine Gruber. Stuttgart 2011, S. 222. Da dieses intertextuelle Verfahren kennzeichnend für Brentanos lyrisches, dramatisches sowie für sein Prosawerk ist, ist es kaum möglich, einzelne Beispiele besonders herauszugreifen. Der Hybridcharakter der Texte Brentanos wird aber (von den dezidierten, in FBA 5,1, versammelten Gedichtbearbeitungen abgesehen) besonders augenfällig bei der Sammlung Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn, den Märchensammlungen Mährchen vom Rhein und Italiänische Märchen, sowie den dramatischen Texten wie Gustav Wasa, Ponce de Leon, Aloys und Imelde und Die Gründung Prags. KFSA, Bd. I/1 (Anm. 21), S. 204. Vgl. Anm. 30. P. Ovidii Metamorphosis oder wunderbarliche und seltsame Beschreibung von den Menschen, Thieren, und anderen Creaturen Veränderung. Frankfurt a.M. 1631, S. 330f. (10. Buch, 106–142). Brentano 1978 (Anm. 1), S. 309–313.
236
Cornelia Ilbrig
die den Text einfärben und ihm eine neue sprachliche Form geben. Ergänzt wird Ovids Geschichte dann aber um eine lange Passage des Wechselspiels von Täuschung und Enttäuschung: Nachdem jeder Versuch scheitert, Cypariss zu trösten, verwandelt ihn Apoll schließlich aus Mitleid in eine trauernde Zypresse.41 Bei dieser Metamorphose handelt es sich um eine allegorische Übersetzung: Ein Mensch, der nur und ausschließlich für den Schmerz lebt, wird zu einem Begriff der Trauer und des Schmerzes in Gestalt des Zypressenbaums verdichtet. Diese allegorische Übersetzung wird durch Flametta theatralisch übersetzt. Das Perspektiv dieser Übersetzung in den Raum ist dessen dekorative Ausstattung, in der das Sonnenlicht gebrochen wird: Die Sonne hatte recht gut dekoriert. Im Anfange schien sie ganz heiß auf den Wasserfall und zog dann mit dem Gesange davon. Sie ging von der Seite des Phöbus, so daß Cypariß nach und nach ganz in den Schatten kam und auch der Saal viel düstrer ward.42
Die Modellierung der Übersetzungstypologie im anschließenden achten Kapitel findet also im Dunkeln statt; am Ende dieses Kapitels wird der Saal wieder beleuchtet: „Wie sind wir auf die Übersetzungen gekommen?“ sagte Godwi. – „Durch das romantische Lied Flamettens“, sagte ich. „Das Romantische selbst ist eine Übersetzung“ – In diesem Augenblick erhellte sich der dunkle Saal, es ergoß sich ein milder grüner Schein von dem Wasserbecken, das ich beschrieben habe. „Sehen Sie, wie romantisch, ganz nach Ihrer Definition. Das grüne Glas ist das Medium der Sonne.“43
Denken wir nun an die Typologie zur Übersetzung klassischer Kunstwerke zurück, haben wir es mit einem Mischtypus zu tun. Zeitlich und kulturell weit genug entfernt vom originalen antiken Mythos gelingt die Übersetzung, allerdings eben nicht als Vervielfältigung, sondern romantisiert. Zugleich reagiert Brentano im Roman Godwi auf Friedrich Schlegels Forderung nach einer „neuen Mythologie“,44 und zwar mit dem Entstehungsmythos zum Echo des 41
42 43 44
Vgl. Bellmanns Kommentar zu Brentanos Ovid-Rezeption in Brentano 1978 (Anm. 1), S. 721f. Yvonne Pauly: Gespinste. Ovid mit Brentano gelesen. In: Gegen/Gewalt/Schreiben. Dekonstruktion von Geschlechts- und Rollenbildern in der Ovid-Rezeption (Philologus. Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption). Hrsg. von Melanie Möller. Göttingen 2021, S. 96f. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 313. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 319. Schon in den 1790er Jahren hatte der Göttinger Altphilologe und Lehrer der beiden Schlegel-Brüder Christian Gottlob Heyne die These aufgestellt, die griechische Mythologie sei der den Griechen eigentümliche Ausdruck ihrer Phantasie. Karl Philipp Moritz schließt sich dieser These in seinen mythologischen Studien an. Vgl. Karl Philipp Moritz: Götterlehre und andere mythologische Schriften. In: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische und kommentierte Ausgabe. Bd. 4: Schriften zur Mythologie und Altertumskunde, Teil 2: II: Kommentar. Hrsg. von Moritz Disselkamp. Berlin, Boston 2018, S. 475–482, insbes. S. 480–82. Friedrich Schlegel stellt in diesem Zusammenhang in seiner Rede über die Mythologie, die im Frühjahr 1800 im fünften Athenaeumsheft erschien, die Forderung nach einer „neuen Mythologie“ (Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie [1800]. In: KFSA, Bd. II: Charakteristiken und Kritiken I. 1796–1801. Hrsg. von Hans Eichner. München u.a. 1967, S. 312). Darauf reagiert Brentano kurze Zeit später im 18. Kapitel des zweiten Teils im Godwi: eine neue Mythologie sei „so ohnmöglich, wie eine
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
237
sagenumwobenen Felsens Lurley. Das Gedicht Zu Bacharach am Rheine im 36. Kapitel45 wird von Violetta gesungen, der 15-jährigen Tochter einer Gräfin, mit der Godwi kurzfristig ein Verhältnis beginnt. Die drei fahren in einem Kahn um den Teich, die Gräfin rudert, Violetta singt das Lied von der schönen Lore an einem Ort namens Lay und führt auf diese Weise den Rheinfelsen den im Boot Sitzenden vor Augen. Das Lied wird so zum Medium zwischen Godwi und der Gräfin einerseits und der Landschaftsformation andererseits. Der markante Felsen galt als eine der gefährlichsten Stellen im Rhein, an dem viele Schiffsunglücke passierten, für die Zwerge, Elfen und Berggeister verantwortlich gemacht wurden. Zu Bacharach am Rheine verbindet verschiedene Mythologeme der Antike,46 u.a. das der Medusa, deren Anblick bei jedem Mann zum Tod führt, und vor allem das der Echo-Gestalt, die von Hera mit Stimmentzug bestraft worden war und immer nur das letzte Wort ihres Gesprächspartners wiederholen konnte. Aus Liebe zu Narziß verliert sie zudem ihre Körperlichkeit und erstarrt zu Stein; nur ihre das letzte gesprochene Wort des Gegenübers wiederholende Stimme bleibt. In Zu Bacharach am Rheine kehrt Brentano den Mythos um: Das Echo entsteht durch drei der schönen Loreley verfallene und ihr vom Felsen nachstürzende Ritter. Bei Ovid ist Echo eine Figur, die wegen eines Mannes stirbt und zum Felsen wird, bei Brentano existiert der Felsen schon, und das Echo entsteht durch die Rufe der drei von ihm herabstürzenden Ritter. Das Gedicht erfüllt alle Ansprüche, die Brentano an das Wesen des Romantischen stellt; es übererfüllt sie sogar. Einmal übersetzt Brentano antike Mythologeme in einen neuen Mythos: Die Medusa wird zur unglücklich verliebten, wider Willen mit extrem starker Verführungskraft gesegneten Zauberin, deren Schicksal auch eine Vorausdeutung auf das traurige Schicksal von Violetta ist; das Echo hingegen existiert als unabhängige Gestalt gar nicht. Noch viel wichtiger aber scheint mir, dass Brentano für die Begründung des modernen Mythos den Übersetzungsvorgang nicht allein räumlich medialisiert im Kahn auf dem Teich verortet, sondern ihn ausweitet – vom Modus des ästhetisch Sprachlichen auf den Modus des landschaftlich Topographischen. Er übersetzt eine Felsformation mit akustischen Eigenheiten, das Echo, in ein Lied und gibt dieser Felsformation eine poetische Geschichte. Der moderne Mythos wird landschaftsästhetisch rückgebunden; diese topographische Rückbindung wird zugleich onomastisch aufgeladen: Erstens versetzt Brentano seine Lore aus dem an der Mosel gelegenen Ort Lay an den Rhein; zweitens schafft Brentano durch Verschränkung des Felsnamen „Lurley“ mit dem Namen des Mädchens „Lore Lay“ und ihrer traurigen Geschichte einen neuen Mythos.47 Es scheint, als habe das Rheinland als besonders mythenfähige Landschaft Brentano dazu inspiriert, für die Modellierung seines
45 46 47
alte, denn jede Mythologie ist ewig“ heißt es von der Godwi-Figur, worauf Maria antwortet: „Mythen sind Ihnen also nichts anderes als Studien der dichtenden Personalität überhaupt, und eine Mythologie wäre dann so viel, als eine Kunstschule“ (Brentano 1978 [Anm. 1], S. 380). Brentano 1978 (Anm. 1), S. 535–539. Pauly 2001 (Anm. 41), S. 96f. Vgl. dazu auch Wolfgang Bunzel: Clemens Brentano – Die Loreley und Bacharach. Hrsg. vom Verein für die Geschichte der Stadt Bacharach und der Viertäler e.V. Bingen, Rüdesheim 2013.
238
Cornelia Ilbrig
Übersetzungsbegriffs den schon im ersten Beispiel angedeuteten eigenen Weg konsequent weiter zu verfolgen: weg von der rein sprachlichen, seines Erachtens vom Problem des hermeneutischen Zirkels (oder der hermeneutischen Spirale) belasteten Bedeutung des Übersetzens hin zum textuell und räumlich-landschaftlichen Übersetzen. An einer Stelle im Roman Godwi setzt Brentano das Prinzip des Mediums und des Perspektivs außer Kraft. Es handelt sich um einen autobiographischen Bericht der Erzählerfigur Maria über ein durch die Erhabenheit der Rheinlandschaft überwältigendes Erlebnis. Maria sitzt, so berichtet er, „höher als der höchste Berg der Gegend, auf der Spitze eines jungen Baums“ und „über Untiefen von Wald, die wie Katarakte und stürmende Heere unter meinem Blick auf und nieder stürzten, brauste der herrliche Fluß des üppigen Friedens und der trotzigen Ruhe“.48 Marias Betrachterposition ist hier noch eindeutig. Um den Höhenunterschied zu überwinden, bedarf es in dem Falle keines Perspektivs, keines Mediums, da die Landschaft an sich schon überwältigend ist. Damit verhält es sich zunächst ähnlich wie bei den Übersetzungen Shakespeares und Dantes, deren Übertragung aufgrund ihrer Universalität keiner weiteren Medialität bedarf. Im Folgesatz aber beschreibt Maria eine Totalitätserfahrung als Resultat dieser Überwältigung, die zur Vertauschung von Standpunkt und Fluchtpunkt (die entfernte Umgebung) führt: Ringsum weit die Städte und Flecken hingesäet, viele tausend Blicke auf meinen Standpunkt gerichtet, in tiefer Einsamkeit, Vor- und Nachwelt um mich aufgelöst in ein unendliches Gefühl des Daseyns.49
Mit dem Wechsel vom Standpunkt zum Fluchtpunkt der anderen Blicke tauscht Maria die Rolle des sehenden und vermittelnden Subjekts mit der Rolle des passiven ruhenden Objekts und wird dadurch „zur Ferne des Anderen“.50 Die „Anderen“, die „Städte und Flecken“ weit unter ihm, werden zu viel- bzw. tausendäugigen Betrachtern. Danach verwandelt sich Maria in einen Baum: „mein Körper wuchs in den Stamm, der mich trug, und meine Arme streckten sich wie Zweige in die Luft.“51 Mit der Schilderung dieser Metamorphose überträgt Maria den antiken Daphne-Mythos: Hier werden Apollo und Daphne von unterschiedlichen Pfeilen des Eros getroffen. Während Apollo sich unsterblich in Daphne verliebt, ihr hinterherrennt und seine Liebe sexuell ausleben will, war Daphne, von einem Pfeil mit gegensätzlicher Wirkung getroffen, völlig unempfänglich für seine Liebe geworden und flieht. Aus Angst bittet sie ihren Vater um eine neue Gestalt – er verwandelt sie in einen Lorbeerbaum. Brentano verkehrt diesen Mythos nicht nur, indem hier eine männliche Gestalt (den Herausgeber Maria) in einen Baum verwandelt und die Gemütslage Marias derjenigen Daphnes entgegengesetzt wird: „Ich hatte ein trauriges Herz voll verschmähter 48 49 50
51
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 394. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 394. Anja Oesterhelt: Perspektive und Totaleindruck. Höhepunkt und Ende der Multiperspektivität in Christoph Martin Wielands Aristipp und Clemens Brentanos Godwi. München, Paderborn 2010, S. 185. Brentano 1978 (Anm. 1), S. 395.
Gipsabdrücke, gezähmte Adler, transportierte Eichen
239
Liebe da hinauf getragen“.52 Entscheidender ist, dass Maria den Mythos nicht vorträgt oder aufführt, sondern als Folge ihrer Totalitätserfahrung in dem Mythos aufgeht und sich selbst in den Baum verwandelt, der ihm vormals als Aussichtspunkt gedient hatte. Da Erfahrungen von Totalität Perspektiven und Positionen auflösen, verlieren auch Vermittlungs- und Übersetzungsvorgänge an Bedeutung. Von der Metaebene aus betrachtet ist die gesamte Passage allerdings doch wieder eine Übersetzung im Sinne Brentanos: eine Übersetzung einer Totalitätserfahrung in den ästhetisch-sprachlichen Modus, bei der eine Erzählerstimme eine eigentlich kaum vermittelbare Erfahrung aus eigenem Blickwinkel der Leserschaft poetisch vergegenwärtigt.
52
Brentano 1978 (Anm. 1), S. 394f.
Bodo Plachta
Spieltext – Lesetext – Edierter Text Dramenedition auf dem Prüfstand
1. Bühnentauglich? Goethes Trauerspiel Egmont fiel am 31. März 1791 bei seiner Erstaufführung auf dem Weimarer Hoftheater durch, nachdem schon 1789 Aufführungen in Mainz und Frankfurt nicht von Erfolg gekrönt waren. In Weimar gab es nur eine einzige Vorstellung, danach verschwand das Stück für Jahre vom Spielplan. Nicht allein die Leistung der Schauspieler und ihre erschreckenden „Ausbrüche der dramatischen Kunst“ schlugen negativ zu Buche,1 sondern Publikum und Kritik hatten schon an der Bühnentauglichkeit des Egmont gezweifelt, als er drei Jahre zuvor im Druck erschienen war: „Dieses Stück ist offenbar nicht für die Aufführung bestimmt, beym Lesen aber unendlich anziehend, und voll großer origineller Schönheiten, wie alles, was von der Hand dieses Meisters kommt.“2 Goethe teilte diese Skepsis nicht, er glaubte fest an Egmont als Bühnenstück. Auch Schillers Verriss, in dem dieser einen fehlenden „dramatische[n] Plan“ bemängelte und Egmont als „eine bloße Aneinanderstellung mehrerer einzelner Handlungen und Gemälde“ betrachtete,3 änderte nichts an dieser Einstellung. Goethe ließ es trotzdem zu, dass ausgerechnet Schiller das Drama 1796 für eine Wiederaufnahme in Weimar überarbeitete. Schiller veränderte das Stück tiefgreifend, straffte die Handlung und nahm dem Drama Irrationalitäten wie die Traumerscheinung Clärchens in Egmonts Kerker, die er in seiner Rezension bereits als „Salto mortale in eine Opernwelt“4 kritisiert hatte. Schiller machte aus dem Geschichtsdrama und seinem heroisch verklärten Protagonisten ein aktionsreiches Theaterstück. Er führte zudem ein Personal vor, des-
1 2 3
4
Annalen des Theaters, 1791, H. 8, S. 80. Gothaische Gelehrte Zeitungen, 6. September 1788, Stück 72, S. 585. Allgemeine Literatur-Zeitung, Bd. 3, 20. September 1788, Nr. 227a; Schillers Werke. Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs, des Schiller-Nationalmuseums und der Deutschen Akademie. Hrsg. von Julius Petersen und Gerhard Fricke [1948ff.: Im Auftrag des Goethe- und SchillerArchivs und des Schiller-Nationalmuseums. Hrsg. von Julius Petersen † und Hermann Schneider. 1961ff.: Begründet von Julius Petersen †. Hrsg. im Auftrag der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv) und des Schiller-Nationalmuseums in Marbach von Lieselotte Blumenthal und Benno von Wiese. 1979ff. Hrsg. von Norbert Oellers und Siegfried Seidel †; seit 1992: Hrsg. im Auftrag der Stiftung Weimarer Klassik und des Schiller-Nationalmuseums Marbach von Norbert Oellers.] Weimar 1943ff., Bd. 22, S. 200. Schillers Werke 1943ff. (Anm. 3), Bd. 22, S. 208f.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-017
242
Bodo Plachta
sen Handlungsweisen in einer krisenhaften Zeit durch individuelle, moralische und politische Selbstüberschätzung unweigerlich in die Katastrophe führen. Die Aufführung war ein unerwarteter Erfolg, der zweifellos auch dem Schauspieler August Wilhelm Iffland zu verdanken war, der in der Rolle des Egmont glänzte. Trotz des Erfolges blieb Schiller zurückhaltend; er bezeichnete seine Bearbeitung geschickt als ein „gemeinschaftliches Werk“ aus seiner und Goethes Feder.5 Schillers Egmont-Adaptation blieb lange in Weimar auf dem Spielplan und wurde auch auf vielen anderen Bühnen gespielt. Seinen Durchbruch erlebte Egmont jedoch erst 1810, als das Stück erstmals in Wien mit der Schauspielmusik Beethovens aufgeführt wurde; später spielte man sogar Schillers Adaptation mit Beethovens Egmont-Musik. Goethe behielt also Recht: Egmont war bühnentauglich, obwohl er sich nie fragte, welche Version des Egmont dafür verantwortlich war. Er hielt unbeirrt am Ursprungstext fest, nahm ihn in die Ausgabe letzter Hand auf und passte nach Schillers Tod dessen Bearbeitung in zentralen Passagen für weitere Aufführungen in Weimar an die Ursprungsversion an. Er machte die Theaterfassung damit wieder literarischer und gleichzeitig bühnenuntauglicher. Akzeptierte Goethe im Theateralltag einen pragmatischen, durchaus als vorsichtig offen zu charakterisierenden Umgang mit seinem Text, der Eingriffe, Adaptationen für die Bühne oder die öffentliche Deklamation und musikalische Ergänzungen zuließ, war er in seiner Werkpolitik strikt und kanonisierte die Lesefassung des Egmont-Textes. Nur einmal verstieß er gegen dieses Prinzip, als er die Weimarer Theaterbearbeitung des Götz von Berlichingen zusätzlich zum Lesetext in die Ausgabe letzter Hand aufnahm, aber die stammte auch von ihm selbst. Spätere Editoren folgten Goethes Werkpolitik und präsentierten Egmont ausschließlich in der Lesefassung. Damit blendeten sie die unterschiedlichen Funktionen des Textes als Lesedrama, Bühnentext, Text für eine Schauspielmusik und als komprimierte inhaltliche Begleitung von Musik im Konzertsaal aus. Zwar wurde im Laufe der Editionsgeschichte des Egmont diskutiert, ob nicht Goethes Text und Schillers Bühnenversion gemeinsam ediert werden müssten, doch solchen Überlegungen wurde stets eine Absage erteilt. In der Weimarer Goethe-Ausgabe wurde kategorisch festgehalten: „Die Schillersche Bühnenbearbeitung des Egmont hat in den Werken Goethes nicht ihren Platz.“6 Diese Auffassung liegt bis auf den heutigen Tag allen Goethe- und Schiller-Editionen zugrunde. Nebenbei bemerkt: Die Edition von Beethovens Egmont-Musik kommt in der Beethoven-Gesamtausgabe sogar ohne Goethes Gesamttext aus.7 Schillers Egmont-Version galt lange ‚nur‘ als eine Bearbeitung, die allenfalls etwas über seine dramaturgischen Fähigkeiten aussagt, wohingegen der Aspekt einer sich
5 6
7
Schillers Werke 1943ff. (Anm. 3), Bd. 28, S. 210. Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 133 Bde. in 143. Weimar 1887–1919, Abt. I, Bd. 8, S. 343. Beethoven. Werke. Gesamtausgabe. Begründet von Joseph Schmidt-Görg. Hrsg. von Sieghard Brandenburg und Ernst Herttrich im Auftrag des Beethoven-Archivs Bonn. Abt. IX, Bd. 7: Musik zu Egmont und andere Schauspielmusiken. Hrsg. von Helmut Hell. München 1998.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
243
schon mit der Egmont-Bearbeitung intensivierenden Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller erst in der letzten Zeit akzentuiert wurde.8 Als ich 2019 eine Studienausgabe mit dem Goethe-Text, mit Schillers Bearbeitung, einem Faksimile des Klavierauszugs von Beethovens Egmont-Musik sowie einer von Goethe hochgelobten Deklamationsfassung des heute vergessenen Friedrich Mosengeil samt einer Bearbeitung dieses Textes durch Grillparzer herausgebracht habe, schien dies noch immer ein Wagnis.9 Der Egmont-Komplex war nun als „Geflecht“10 unterschiedlicher Texte erstmals in einer Edition zugänglich. Egmont kann als Ergebnis verschiedener Transformationsprozesse und nicht auf mehrere Editionen verteilt zur Kenntnis genommen werden, wobei auch zu verfolgen ist, wie Texte durch andere Kontexte und Anlässe neue Texte generieren.11 Dass dieser Plan aufging, war nicht ausgemacht, doch die Reaktionen waren positiv: Hans-Joachim Hinrichsen zeigt sich in seiner Rezension davon überzeugt, dass diese Edition nicht nur eine „Fundgrube“ für Literatur- und Musikwissenschaftler sei, sondern dass das hier zusammengefügte Text-Ensemble „Synergie-Effekte“ ermögliche, die sich bei einer „Kooperation, Konfrontation oder gar Kollision“ autonomer Künste ereignen können.12 Auch Frieder von Ammon sah in der Präsentation des Egmont als „signifikante TextKonstellation“ einen editorischen Mehrwert.13
2. Überlieferung und Texttransformation Die Überlieferung von Theatertexten und die damit verbundenen Texttransformationen – das sollte dieses einführende Beispiel zeigen – ist keineswegs einfach zu greifen oder problemlos editorisch zu präsentieren.14 Die germanistische Editionswissenschaft, die ich vornehmlich im Blick habe, hat sich kaum mit diesen Fragen beschäftigt und ebenso wenig die Diskussion in den Nachbardisziplinen – etwa der Shakespeare-Philologie – zur Kenntnis genommen. Wenn ich im Folgenden – wieder nur aus germanistischer Perspektive und stark auswählend – die Dramenedition und insbesondere die Konstitu-
8
9
10
11 12 13 14
Vgl. Steffan Davies: Goethes „Egmont“ in Schillers Bearbeitung – ein Gemeinschaftswerk an der Schwelle zur Weimarer Klassik. In: Goethe-Jahrbuch 123, 2006, S. 13–24. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven, Friedrich Mosengeil, Franz Grillparzer: Egmont. Hrsg. von Bodo Plachta. Stuttgart 2019 (Stuttgarter Studienausgaben. 3). Jörg Krämer: Text und Paratext im Musiktheater. In: Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen. Hrsg. von Frieder von Ammon und Herfried Vögel. Berlin 2008 (Pluralisierung & Autorität. 15), S. 45–78, hier S. 45. Zu Beispielen aus dem Musiktheater vgl. Krämer 2008 (Anm. 10), S. 69–73. In: Arbitrium 39, 2021, H. 1, S. 86–94, hier S. 86f. In: Goethe-Jahrbuch 137, 2020, S. 246–248, hier S. 246. Vgl. Bodo Plachta: „Krähe mit Pfauenfedern“ oder: Warum spielen Bühnenbearbeitungen kaum eine Rolle in Dramenedition und Dramenkanon? In: Kanon und Edition. Hrsg. von Jörn Bohr, Gerald Hartung und Rüdiger Nutt-Kofoth. Berlin, Boston 2021 (Beihefte zu editio. 49), S. 123–136, hier bes. S. 127–131, worauf sich dieser Abschnitt stützt.
244
Bodo Plachta
tion von Dramentexten betrachte (die Gestaltung von Apparaten bleibt einstweilen ausgeklammert), dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auf Material aus einem Spannungsfeld treffen, das zwischen Literarizität und Performativität angesiedelt ist, wobei die Grenzen permanent überschritten werden und Texte sich in ihrer Substanz, Funktion und Medialität verändern. Einerseits haben wir es mit stabilen Lesetexten, andererseits mit fluiden Textbearbeitungen15 zu tun, die einer Aufführung dienen, diese aber allenfalls rudimentär wiedergeben. Im Fall von Lesedramen dürfen wir davon ausgehen, dass wir Texten begegnen, die eng an den Autor gebunden sind, obwohl sie überwiegend erst nach einer Aufführung gedruckt wurden. Trotzdem ist auch bei Lesedramen Vorsicht geboten, denn die damalige Produktion war nicht nur im Fall von Dramentexten bis ins 19. Jahrhundert hinein alles andere als autorhörig, weil viele Akteure ihre Hände im Spiel hatten und die Nachfrage nach dramatischem Lesestoff befriedigt werden wollte. Doppeldrucke, Parallelausgaben und Raubdrucke sind Ausdruck dieser Gemengelage, in der der Autor und seine Arbeit am Text nicht ausreichend konkret zu fassen sind. Herauszufiltern, welcher Text auf den Autor, die Theatermacher oder die Setzer zurückgeht, und einzuschätzen, welche sozialen und ökonomischen Interessen oder kulturellen Modernisierungsschübe bei der Herausgabe von Dramen eine Rolle spielten, ist oftmals kein einfaches Unterfangen. Aber nicht nur konzeptionelle Fragen und editorische Zielsetzungen sind zu hinterfragen, sondern auch ganz praktische Probleme zeitgenössischer Buchherstellung: Wie etwa ging der Satz eines Dramentextes vonstatten? Dramendrucke waren schon immer Artefakte mit eigener Semantik, die handwerkliches Geschick erfordern – und dies nicht nur in der Frühzeit des Buchdrucks mit seinen komplizierten Produktionsprozessen, denn auch heutzutage sind Drameneditionen schwieriger zu setzen als Roman- oder Gedichtausgaben. Doch letztlich wird alles von einer prinzipiellen Frage überlagert: Wie kann es gelingen, in einer kritischen Dramenedition neben einem intuitiv lesbaren und natürlich auch zitierbaren Text die „überlieferungsmäßig erschließbaren Spielsituationen“16 zu präsentieren, um Literarizität und Performativität gleichermaßen zu bewahren? Sowohl Bühnenbearbeitungen als auch (in geringerem Maße) Lesedramen enthalten Momente der Unsicherheit, denn eine Theateraufführung, für die sie geschaffen wurden oder auf die sie reagieren, ist ein ephemeres Ereignis, das sich aus interagierenden Elementen wie Text, Bühnenbild, Kostümen, Requisiten, Beleuchtung, Raum, Musik, Gesang, Spiel und Gestik zusammensetzt.17 Der Text einer Sprechtheater-, aber auch einer Musiktheateraufführung ist eben nur ein Element unter anderen und die Mitwirkung des 15
16
17
Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. München 1977, S. 25, bezeichnet die „Bühnenrealisierung“ im Vergleich mit dem literarischen Text als „relativ variabel“. Johannes Janota: Auf der Suche nach gattungsadäquaten Editionsformen bei der Herausgabe mittelalterlicher Spiele. In: Tiroler Volksschauspiel. Beiträge zur Theatergeschichte des Alpenraumes. Im Auftrag des Südtiroler Kulturinstitutes und des Bundes Südtiroler Volksbühnen. Hrsg. von Egon Kühebacher. Bozen 1976 (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstitutes. 3), S. 74–87, hier S. 76. Erika Fischer-Lichte: Aufführung. In: Metzler Lexikon Theatertheorie. Hrsg. von Erika Fischer-Lichte, Doris Kolesch und Matthias Warstat. 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. Stuttgart, Weimar 2014, S. 15–26. Vgl. auch Umberto Eco: Semiotik der Theateraufführung. In: Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Hrsg. von Uwe Wirth. Frankfurt a.M. 2002, S. 262–276, hier
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
245
Autors ist höchst ungewiss. Sein Anteil an einer Theaterproduktion ist meistens nur dann abschätzbar, wenn einschlägige Dokumente vorliegen.18 Und auch dann repräsentieren diese Texte nur einen Ausschnitt, ein Durchgangsstadium oder sind ein „Kollektivprodukt von Autor, Theaterleitung und Schauspielern“.19 Allein die Vielfalt unterschiedlichster Textträger, die Bühnenfassungen überliefern, ist für einen oft prekären Textstatus verantwortlich. Librettodrucke, Dirigierbücher, Soufflierbücher, Rollenbücher, Inspizientenbücher, Bücher für den Bühnendienst, Zensurmanuskripte sowie Probenprotokolle oder Tonbandmitschnitte können auktorialen Text überliefern.20 Trotzdem vermitteln solche Materialien nur rudimentär die Theaterrealität und bilden sie nie komplett ab. Auch die Überarbeitung von Lesedramen, sofern sie auf eine Aufführung reagieren, basieren auf wechselnden Strategien; einerseits wird der Text bei einer Neuausgabe stärker literarisiert und es werden typisch bühnenwirksame Aspekte wie schnell aufeinanderfolgende Repliken vermieden oder umgangssprachliche Wendungen zurückgedrängt – ich denke hier z.B. an die Überarbeitung der frühen Lustspiele Lessings für seine späteren Sammlungen –, andererseits kann die Erfahrung einer Aufführung zur Justierung der dramaturgischen Stringenz beitragen, ja sogar einen Textsortenwechsel (z.B. von Libretto zu Lesedrama oder von Hörspiel zu Bühnentext) veranlassen. Aufgeführter und veröffentlichter Text beanspruchen einerseits als jeweils eigenständiger Texttypus Autonomie, sind aber andererseits genetisch komplex miteinander verknüpft.21 Ein Blick in die Überlieferungsgeschichte von Theatertexten geht daher mit einem permanenten Dilemma einher, wie ihr Status zu beurteilen ist, denn nicht immer geben Handschriften und Drucke ihre Informationen preis, geschweige denn ihre Geheimnisse. Dramenausgaben enthalten nicht selten Textkonstrukte, weil das Material einfach nicht mehr hergibt. Unsere Kenntnis der klassischen antiken Theatertexte von Aischylos, Sophokles und Euripides etwa geht auf Editionen der alexandrinischen Philologen zurück, die wiederum auf das legendäre, von Lykurg in Auftrag gegebene „Staatsexemplar“ (etwa 330 v. Chr.) zurückgreifen konnten, in dem die attischen Theatertexte in einer kanonischen
18
19
20
21
S. 264, wo Eco eine Theateraufführung als semiotisches Gesamtgefüge begreift, das aus „Stimmbeugung, Gesichtsmimikry, Gesten, Körperbewegungen, Schminke, Haartracht, Kostüm, Accessoires, Bühnenbild, Beleuchtung, Musik und Geräuschen“ besteht. Auch Versuche, diesen Anteil zu rekonstruieren, bleiben letztlich Interpretationen. Hierzu u.a. Peter Kofler: Zur Frage der Bühnentauglichkeit von Wielands ‚Sturm‘, oder: Der Text als Tiefenstruktur der miseen-scène. In: Wieland-Studien 8. Hrsg. von Klaus Manger, der Christoph Martin Wieland-Stiftung und dem Wieland-Forschungszentrum Oßmannstedt. Heidelberg 2013, S. 27–39. Horst Nahler: Zur editorischen Bedeutung von Bühnenfassungen und Rollenhandschriften. Forschungsprobleme und Darbietungsmöglichkeiten in einer Ausgabe von Schillers „Fiesko“-Drama. In: editio 3, 1989, S. 98–113, hier S. 110. Hierzu Katrin Henzel: Epitextuelle Bühnenanweisungen unter besonderer Berücksichtigung des Regiebuchs. In: editio 32, 2018, S. 63–81, bes. S. 69–78. Ergänzend auch aus der Perspektive der ‚critique génétique‘ Jean-Marie Thomasseau: Les Manuscrits de théâtre. Essai de typologie. In: Littérature 138, 2005, Théâtre: le retour du texte?, S. 97–118, und Genesis 26, 2005, Théâtre. Vgl. Almuth Grésillon: La mise en œuvre. Itinéraires génétiques. Paris 2008, S. 246.
246
Bodo Plachta
Textgestalt festgehalten wurden, die bei Wiederaufnahmen verbindlich war.22 Es gab zwar schriftliche Aufzeichnungen von besonders populären Stücken, die in Athen als Lesedramen zirkulierten, sowie Regiebücher und Rollenauszüge für Schauspieler oder Abschriften, die für die Bewerbung zur Teilnahme am Wettstreit (Agon) eingereicht wurden. Diese sind jedoch nicht überliefert, dürften aber punktuell bzw. sogar in größerem Umfang in das „Staatsexemplar“ interpoliert worden sein. Die Tragödientexte sind offenkundig eine Mischung aus Lese- und Aufführungstext, und auch spätere Handschriften enthalten regelmäßig Varianten oder Ergänzungen, deren Herkunft im Theaterbetrieb zu suchen ist. Doch wo der Gebrauchscharakter dieser Quellen beginnt oder endet, ist nicht immer ersichtlich. Er bietet mannigfachen Anlass für Deutungen, und die Variantendokumentation ist für Editor und Leser gleichermaßen eine Mühsal. Eine ähnlich uneindeutige Überlieferung zeigen mittelalterliche und frühneuzeitliche Spiele, und zwar unabhängig davon, ob sie weltliche oder religiöse Themen behandeln, regionale Traditionen repräsentierten, mit oder ohne Musik aufgeführt wurden oder Teil des jahreszeitlichen Festkalenders waren.23 Handschriften, sofern sie überhaupt erhalten geblieben sind, dokumentieren zumeist den Text einer einzelnen Aufführung, wobei es nicht leicht ist, diese zweifelsfrei zu ermitteln, und auch der Textzustand ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung oft prekär. Für die Bühnengeschichte dagegen sind sie eine wichtige Quelle. Dann wieder gibt es Mehrfachüberlieferungen und Spielkreise bzw. -traditionen, die hypothetisch auf ein ‚Urspiel‘ zurückgehen können. Ihre Übernahmen und Varianten repräsentieren aber immer eine eigenständige Aufführung, für die der Text eingerichtet wurde. Jeder Spieltext ist ein authentischer Gebrauchstext mit eigenem Inszenierungskontext; Dieter Trauden hat daher mit Recht von einem „Aufführungs-Original“ gesprochen.24 Daneben existieren handschriftliche Textbücher, die der dauerhaften Textsicherung dienten oder auf den privaten Gebrauch, die persönliche Erbauung oder Unterhaltung abzielten und aus denen nicht ohne Weiteres hervorgeht, welche Aufführung oder Bühnenrealität dem Text zugrunde liegen. Hinzu kommen noch Materialien, die aus dem Umfeld einer Aufführung und der an ihr Beteiligten stammen und im günstigsten Fall Informationen zur Textüberlieferung geben, ja sogar Text enthalten können.25
22
23
24 25
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Einleitung in die griechische Tragödie. Berlin 1907, S. 120–219; Hartmut Erbse: Überlieferungsgeschichte der griechischen klassischen und hellenistischen Literatur. In: Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel. Hrsg. von Herbert Hunger, Otto Stegmüller, Hartmut Erbse, Max Imhof, Karl Büchner, Hans-Georg Beck, Horst Rüdiger. Mit einem Vorwort von Martin Bodmer. München 1975, S. 207–307, hier S. 217f.; Egert Pöhlmann: Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur. Bd. 1: Altertum. Darmstadt 1994, S. 12, 22–24. Beispiele u.a. bei Dieter Trauden: Archetyp oder Aufführung? Überlegungen zur Edition mittelalterlicher Dramen. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 37, 1993, S. 131–145, hier S. 136–142; Janota 1976 (Anm. 16), S. 77–79. Trauden 1993 (Anm. 23), S. 134. Helmut Thomke: Materialität und deren prinzipielle Grenzen in Drameneditionen der Frühen Neuzeit. In: Materialität in der Editionswissenschaft. Hrsg. von Martin Schubert. Berlin, New York 2010 (Beihefte zu editio. 32), S. 359–368, hier S. 368, nennt folgende Quellen, aus denen einschlägige Informa-
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
247
Vom Repertoire der Wanderbühnen kennen wir ebenfalls nur Bruchstücke, die zudem einem noch stärkeren Transformationsprozess unterlagen, sodass uns das Spielmaterial nur in Textderivaten zur Verfügung steht. Was im Druck auf uns gekommen ist, dokumentiert nur „eine Art Rückblick auf das Wirken einer Truppe oder eines bedeutenden Schauspielers“; zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gehörten diese Stücke schon längst nicht mehr zum Bühnenrepertoire.26 Grundsätzlich gilt aber, dass seit der Mitte des 17. Jahrhunderts Theatertexte erst dann gedruckt wurden, nachdem sie aufgeführt worden waren. Aufführungen konnten durchaus Textrevisionen zur Folge haben. Für die dramatische Produktion von Hallmann, Gryphius oder Lohenstein etwa haben sich sowohl Aufführungs-Szenare27 als auch die Texte selbst erhalten. Ihre von Druck zu Druck erfolgte Überarbeitung in Hinblick auf die „Ausgestaltung des Schauplatzes“ oder die „äußerst detaillierten Regieanweisungen“ sind Indizien, die auf aufführungspraktische Erfahrungen schließen lassen.28 Das ‚Schlesische Kunstdrama‘, wie es mit diesen Autoren verbunden wird, ist daher keineswegs nur ein Buch- und Lesedrama, wie lange angenommen wurde. Mit der Zurückdrängung des Theaters der Wanderbühnen, den epochalen Umbrüchen in der Theaterlandschaft samt neuen Theaterbauten, einer zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung, einer Theaterpraxis im Wandel (Schauspielerausbildung) sowie der Durchsetzung des Literaturtheaters veränderte sich die Quellenlage grundlegend. Im Verlauf dieser Entwicklung vergrößerte sich die Kluft zwischen Lesedrama und aufgeführtem Schauspiel, was sich vielleicht an der Tatsache erkennen lässt, dass kaum ein Drama am Ende des 18. Jahrhunderts in den großen Theatern ohne Musik auf die Bühne kam, ein Phänomen, das in den Lesedramen von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht sichtbar ist.29 Gleichzeitig stieg die Zahl überlieferter Bühnentexte markant an. Theaterstücke waren nur bis zu ihrer Publikation tan-
26
27
28
29
tionen gewonnen werden können: „Angaben in den Texten der Handschriften oder Drucke selbst, gelegentlich in Abschriften von Mitspielern; Holzschnitte und Stiche; Ratsprotokolle; Schulratsprotokolle; Missivenbücher; Dokumente von Zünften oder Bruderschaften; Chroniken; Tagebücher von Spielern oder Zuschauern; Briefe; Berichte von Aufsehern im Auftrag weltlicher oder geistlicher Behörden; Berichte von Gesandten oder Behörden anderer Gemeinwesen; Säckel- oder Schatzmeisterrechnungen; Dokumente von Bauämtern; alte Pläne von Spielstätten; archäologische Funde.“ Spieltexte der Wanderbühne. Hrsg. von Alfred Noe. 6 Bde. Berlin, New York 1970–2007 (Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts), hier Bd. 6, S. XXVII. Gerhard Spellerberg: Szenare zu den Breslauer Aufführungen Gryphischer Trauerspiele. In: Daphnis 7, 1978, S. 235–165; ders.: Szenare zu den Breslauer Aufführungen Lohensteinscher Trauerspiele. In: Daphnis 7, 1978, S. 629–645; Das Breslauer Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert. Einladungsschriften zu den Schulactus und Szenare zu den Aufführungen förmlicher Comödien an den protestantischen Gymnasien. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Konrad Gajek. Tübingen 1994 (Rara ex Bibliothecis Silesis. 3). Gerhard Spellerberg: „Schlesisches Kunstdrama“ – Fragen und Probleme der Edition der Dramen Lohensteins und Hallmanns. In: editio 3, 1989, S. 76–89, hier S. 86f. Reinhart Meyer: Das Musiktheater am Weimarer Hof bis zu Goethes Theaterdirektion 1791. In: Der theatralische Neoklassizismus um 1800. Ein europäisches Phänomen? Hrsg. von Roger Bauer in Verbindung mit Michael de Graat und Jürgen Wertheimer. Bern u.a. 1986 (Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A. 18), S. 127–167, hier S. 155.
248
Bodo Plachta
tiemenfrei. Autoren konnten ihre Texte nur bis zu einer Drucklegung vermarkten, indem sie Theatern oder Schauspielgesellschaften Theaterfassungen gegen Honorar anboten. Schiller etwa war auf dem Gebiet der Bühnenfassungen ausgesprochen geschäftstüchtig und erzielte mit ihnen ansehnliche Honorare, indem er den Druck seiner Stücke so lange herauszögerte, wie es ökonomisch vertretbar war.30 Im Falle seiner Übertragung von Shakespeares Macbeth spannte er sogar seinen Verleger Cotta ein, der Aufführungen in Stuttgart und Frankfurt vermittelte, wo man dann mit Material arbeitete, das Schiller zur Verfügung gestellt hatte. Obwohl Schiller viele seiner Texte „theaterfertig“ lieferte,31 griff er für die Ausgabe seiner Theaterstücke32 nicht auf Bühnenfassungen zurück, obwohl einige von ihnen bereits im Druck vorlagen, wie seine für die Publikation (1782) überarbeitete Mannheimer Uraufführungsfassung der Räuber.33 Nach einer Drucklegung hatten Autoren meistens keinen Einfluss mehr auf die Gestalt der gespielten Texte. Die weit verbreiteten Bearbeitungen etwa durch Karl Martin Plümicke waren vielen Autoren ein Ärgernis. Schiller nannte dessen Fiesko-Fassung schlichtweg eine „Verhunzung“,34 konnte aber nicht verhindern, dass sie gespielt wurde. Da die Bühnenfassungen in den Theatern weiter zu Materialien für den Theaterbetrieb verarbeitet und verwahrt wurden, sodass sie für spätere Aufführungen in Gebrauch blieben, haben sich auf vielen Textträgern über einen langen Zeitraum mehrere Bearbeitungsschichten abgelagert, die nicht immer zweifelsfrei voneinander zu trennen sind. Auch die Autorisation, die mit dem übersandten Bühnenmanuskript noch gegeben war, nahm durch die Arbeit am Text im Theater rapide ab, sodass hier ebenfalls textkritische Vorsicht geboten ist. Wiederum ganz andere Produktionsbedingungen begegnen uns im Wiener Volkstheater. Die Stücke Johann Nestroys waren typische „Theater-Ware“ und ihr „Textcharakter“ entsprach den Produktions- und Aufführungsbedingungen, die kaum Rücksicht auf die Intention des Autors nahmen, aber desto mehr auf die Unterhaltung des Publikums ausgerichtet waren und daher eine große Zahl unterschiedlichster, häufig situations- bzw. aufführungsbedingter Textträger zur Folge hatte.35 Mit diesen Textträgern trieben Theateragenten sogar einen regen Handel. Eine besondere Rolle spielen Zensurmanuskripte, deren Texte von Versionen abweichen, die der Autor eigens für die Aufführung angefertigt hat. Soufflierbücher z.B. enthalten immer wieder Auszeichnungen Nestroys mit roter Tinte oder eingekringelte Textsegmente, die die Theaterzensur nie passiert hätten und entsprechend in den offiziellen Zensurmanuskripten fehlen.36 30
31 32
33 34 35 36
Vgl. Karl-Heinz Hucke: Jene „Scheu vor allem Mercantilischen“. Schillers „Arbeits- und Finanzplan“. Tübingen 1984 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 12), S. 48–52. Schillers Werke 1943ff. (Anm. 3), Bd. 4, S. 252. Theater von Schiller. 5 Bde. Tübingen 1805–1807. Schiller konzipierte die Ausgabe noch zu Lebzeiten, erschienen ist sie erst nach seinem Tod. Friedrich Schiller: Die Räuber. Studienausgabe. Hrsg. von Bodo Plachta. Stuttgart 2009, S. 247–345. Schiller an Christian Gottfried Körner, 3. Juli 1785; Schillers Werke 1943ff. (Anm. 3), Bd. 24, S. 10. Jürgen Hein: Aspekte der Nestroy-Edition. In: editio 3, 1989, S. 114–124, hier S. 114. Friedrich Walla: Die Theaterzensur am Beispiel des Lumpacivagabundus. In: Vom schaffenden zum edierten Nestroy. Beiträge zum Nestroy-Symposium im Rahmen der Wiener Vorlesungen 28.–29. Oktober 1992. Hrsg. von W. Edgar Yates. Wien 1994, S. 45–68, hier S. 50–52.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
249
Diese Markierungen dienten dazu, den Text während der Aufführung wegzulassen, wenn die Theaterpolizei anwesend war, um zu prüfen, ob der aufgeführte Text mit dem zuvor von der Zensur approbierten Text übereinstimmte. Es liegt auf der Hand, dass diese Bearbeitungen einen authentischeren Bühnenwert haben als die zensurkonformen, inhaltlich und in Richtung Hochsprache geglätteten Theatertexte, die Nestroy selbst zum Druck gab.37 Diese wenigen, sicherlich das Problem nicht erschöpfenden Beispiele illustrieren das editorische Dilemma, wie mit solchen Überlieferungen und damit mit der Spannung zwischen Lesedrama und Bühnenbearbeitung generell oder im Einzelfall umzugehen ist und welche Fassungen sich überhaupt als Basis für Edierte Texte eignen. Wie ist mit einem Theaterautor wie Bertolt Brecht zu verfahren, der seine Stücke – z.B. Leben des Galilei – als Reaktion auf Politik und Zeitgeschichte mehrfach umschrieb und damit ein ausgesprochen dynamisches Kontinuum variierender Fassungen hinterließ?38 Wie soll editorisch mit einem solchen Theaterautor umgegangen werden, der gleichzeitig Regisseur seiner eigenen Stücke war und meinte: „Ohne das Ausprobieren durch eine Aufführung kann kein Stück fertiggestellt werden“.39 Für die Modellinszenierung am Berliner Ensemble (1955/56) revidierte Brecht den Galilei-Text ein drittes Mal, auch ließ er von der Probenarbeit Tonbandmitschnitte anfertigen, die neuerliche Textveränderungen dokumentieren. Elisabeth Hauptmann nahm diese Änderungen 1957 zumindest punktuell in die von ihr nach Brechts Tod betreute Sammlung der Stücke (Bd. 8) auf.40
3. ‚Typographisches Dispositiv‘ Drama Zum Arbeitsauftrag eines Drameneditors gehört nicht nur, die Überlieferung kritisch zu sichten und daran anschließend die Auswahl von Textgrundlagen zu organisieren.
37
38
39
40
Vgl. Jürgen Hein: Sind Johann Nestroys Possentexte autorisiert und authentisch? In: Autor – Autorisation – Authentizität. Beiträge der internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition. Hrsg. von Thomas Bein, Rüdiger Nutt-Kofoth und Bodo Plachta. Tübingen 2004 (Beihefte zu editio. 21), S. 277–285. Vgl. Bodo Plachta: Der ‚Stückschreiber‘ als Regisseur. Editorische Konsequenzen aus Brechts Regiearbeit am Galilei. In: Textkonstitution bei mündlicher und bei schriftlicher Überlieferung. Basler Editoren-Kolloquium 19.–22. März 1990, autor- und werkbezogene Referate. Hrsg. von Martin Stern unter Mitarbeit von Beatrice Grob, Wolfram Groddeck und Helmut Puff. Tübingen 1991 (Beihefte zu editio. 1), S. 197–208. Zitiert nach: Gerhard Seidel: Bertolt Brecht – Arbeitsweise und Edition. Das literarische Werk als Prozeß. Berlin 1977, S. 102. Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in acht Bänden. Hrsg. vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann. Frankfurt a.M. 1967. – Ludwig Tieck nutzte öffentliche Leseabende und „Corrigierstunden“ mit Dorothea Tieck und Wolf Baudissin dazu, den Text ihrer Shakespeare-Übersetzungen zu prüfen und zu überarbeiten. Vgl. Theresa Mallmann: Von der Hörbühne am Altmarkt zum „Theater der Dichtung“. Ludwig Tieck und Karl Kraus als Shakespeare-Vorleser im 19. und 20. Jahrhundert. Dresden 2021 (Tieck-Studien. 4), S. 33–38.
250
Bodo Plachta
Ein wichtiger, für die Dramenedition (und die Edition überhaupt) entscheidender Aspekt besteht darin, die Materialität und Medialität – sowohl der handschriftlichen als auch der gedruckten Textträger – zu analysieren und zu dokumentieren. Material und Medium haben in der Editionswissenschaft mittlerweile viel Aufmerksamkeit gefunden,41 denn jede „Überlieferungsform verändert einen Text, interpretiert ihn.“42 Beim ersten Blick auf einen Dramentext ist dieser aufgrund seines ‚typographischen Dispositivs‘43 unmittelbar als spezifische Textsorte erkennbar. Das Layout zeigt eine „flächentypographische Anordnung der verschiedenen Textelemente“,44 die wir verallgemeinernd (in Anlehnung an Roman Ingarden) als Haupt- und Nebentext bezeichnen,45 also von Sprecherbezeichnungen und Bühnen- oder Regieanweisungen einen signifikanten Prozess der Ausdifferenzierung durchlaufen haben, der lange unterbewertet wurde.46 Hinzu kommen verschiedene, den Text auszeichnende Schrifttypen zur Markierung von „Akt- und Szenenzählung, Beschreibungen von Ort, Zeit, Situation und Requisiten, Anmerkungen zum Handeln der Akteure, Hinweise zur Ausdrucksqualität des Sprechens, Anzeige von Sprecherwechseln (Figurennamen) und schließlich die eigentliche dramatische Rede.“47 Dieses Auszeichnungsverfahren hat sich schon früh als Mittel zur übersichtlichen visuellen Organisation unterschiedlicher Textebenen im Drama herausgebildet. Obwohl im griechischen Drama die Figurenrede als Haupttext vorherrscht, war es doch bald in griechischen Papyri, aber auch in mittelalterlichen Dramenhandschriften und in barocken Drucken üblich, Sprechernamen und Sprecherwechsel differenziert zu markieren, einmal mit Buchstaben, dann wieder mit Abkürzungen.48 Wenn in den oftmals opulent gestalteten barocken Dramendrucken die Buchseite zu einem „Schauplatz der Schrift“ wird und der gedruckte Texte in einem „quasi-
41
42
43
44 45
46
47
48
Vgl. u.a. Rüdiger Nutt-Kofoth: Text lesen – Text sehen. Edition und Typographie. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 78, 2004, S. 3–19; Per Röcken: Was ist – aus editorischer Sicht – Materialität? Versuch einer Explikation des Ausdrucks und einer sachlichen Klärung. In: editio 22, 2008, S. 22–46, hier S. 39–41; Schubert 2010 (Anm. 25). Hans Joachim Kreutzer: Über Geschicke der Kleist-Handschriften und über Kleists Handschrift. In: Kleist-Jahrbuch, 1981/82, S. 66–85, hier S. 85. Hierzu grundlegend Susanne Wehde: Typographische Kultur. Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studie zur Typographie und ihrer Entwicklung. Tübingen 2000 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 69), S. 119–126. Wehde 2000 (Anm. 43), S. 123. Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk. Mit einem Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel. 4. Aufl. Tübingen 1972, S. 220. Hierzu Anke Detken: Im Nebenraum des Textes. Regiebemerkungen in Dramen des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2009 (Theatron. 54), S. 1–40. Wehde 2000 (Anm. 43), S. 123. Vgl. auch zusammenfassend Gerrit Brüning, Dietmar Pravida: Dramatische ‚mise en page‘ in Handschrift und Druck. Beobachtungen zu Dramen Goethes in den Schriften (1787–1790), vor allem zu Torquato Tasso. In: editio 24, 2020, S. 123–141, hier S. 126f. Vgl. Klaus-Ulrich Wahl: Sprecherbezeichnungen mit griechischen Buchstaben in den Handschriften des Plautus und Terenz. Diss. Tübingen 1974, S. 1–14; Rainer Falk: Das typographische Dispositiv des Dramas: Konvention – Varianz – Interpretation. In: Typographie & Literatur. Hrsg. von Rainer Falk und Thomas Rahn. Frankfurt a.M. 2016 (Text: Kritische Beiträge. Sonderheft), S. 34–50, hier S. 40.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
251
theatralen Modus“ als Verlängerung des festlich-spektakulären Theaterereignisses erscheint,49 hat sich mit der Kanonisierung von Lesedramen um 1800 für den Dramendruck eine typographisch schlichtere, bis auf den heutigen Tag gültige ‚mise en page‘ eingebürgert. Durch solche ‚typographischen Dispositive‘ werden nicht nur Dramentexte, sondern auch Lyrik und Prosa zuerst als „visuelle Gestalt“ und erst dann als „sprachlich-inhaltlich[e]“ wahrgenommen.50 Leseweise und Lektüreprozess werden so gesteuert. ‚Typographische Dispositive‘ sind Bestandteile des Textes, deren Ausgestaltung – Susanne Wehde spricht von „Binnendifferenzierung“ –51 in die Verantwortung von Verlegern, Setzern und Autoren fällt und trotz aller Konvention immer wieder neue oder nationale (Fraktur/Antiqua), kulturelle und ästhetische (Kursive, Kapitälchen, Buchschmuck) Akzente setzen und insgesamt singulär, steuernd und bedeutungstragend sind.52 In welchem Maß poetische Normsetzungen Einfluss auf ‚typographische Dispositive‘ haben können, ist an Beispielen in Gottscheds Sammlung Die Deutsche Schaubühne (6 Bde., 1741–1745) zu sehen, wo Dramentexte in gebundener Rede typographisch anders behandelt werden als Versdramen (Abb. 1 und 2).53 Der Verstext zeichnet sich durch mittelaxiale Anordnung aus und auch die Sprechernamen stehen mittig, demgegenüber sind die Sprechernamen beim Prosatext linksbündig angeordnet.54 Autoren wie Lessing, Goethe und Schiller haben sich sogar in ihren Handschriften an diese Konvention gehalten und sich um eine entsprechende ‚mise en page‘ bemüht.55 Lessing machte für den Druck von Nathan der Weise detaillierte Vorschläge für ein großzügiges Format, gutes Papier und ein luftiges Layout. Nach einem Probesatz sah er allerdings ein, dass das vom Drucker vorgeschlagene Oktav-Format und ein kompaktes Layout ohne Buchschmuck die sinnvolle Lösung für einen Dramensatz war, bei dem sogar längere Verszeilen nur ganz selten gebrochen werden mussten.56 Zudem war diese Lösung die preisgünstigere. Goethe sicherte seinem Verleger Göschen zu, dass er beim Satz seiner Dramen „blos 49
50 51 52 53
54
55 56
Thomas Rahn: Schautext/Lesetext. Theatralität und Eigenlogik der Typographie in Dramendrucken des 17. Jahrhunderts. In: Zur Druckgeschichte und Intermedialität frühneuzeitlicher Dramen. Hrsg. von Alexander Weber. Berlin 2018 (Literaturwissenschaft. 13), S. 113–146, hier S. 116f. Vgl. auch mit vielen Beispielen Julie Stone Peters: Theatre of the Book 1480–1880. Print, Text, and Performance in Europe. Oxford 2000. Wehde 2000 (Anm. 43), S. 125. Wehde 2000 (Anm. 43), S. 122. Beispiele bei Falk 2016 (Anm. 48). Abbildungen entnommen aus: Die Deutsche Schaubühne nach den Regeln und Exempeln der Alten. Erster Theil, nebst einer Vorrede, und des Erzbischofs von Fenelon Gedanken von der Tragödie und Comödie ans Licht gestellet von Joh. Christoph Gottscheden. Leipzig 1742, S. 175, 243. Vgl. Wehde 2000 (Anm. 43), S. 122; Falk 2016 (Anm. 48), S. 44, wobei die Behauptung, hier liege eine Differenzierung nach Gattungen (Trauerspiel/Lustspiel) vor, nicht zutrifft, wie Brüning/Pravida 2020 (Anm. 47), S. 127, Anm. 20, zu Recht monieren. Brüning/Pravida 2020 (Anm. 47), S. 127–139. Vgl. Lessings Brief an seinen Bruder Karl Lessing vom 30. Dezember 1778 sowie die Antwort des Bruders vom 15. Januar 1779; Gotthold Ephraim Lessings sämtliche Schriften. Hrsg. von Karl Lachmann. Dritte auf’s neue durchgesehene und vermehrte Aufl. Besorgt durch Franz Muncker. 23 Bde. Stuttgart, Leipzig, Berlin 1886–1924, Bd. 18, S. 300f., Bd. 21, S. 241. Vgl. auch Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise. Hrsg. von Bodo Plachta. Stuttgart 2023 (Stuttgarter Studienausgaben. 6), S. 223f.
252
Bodo Plachta
dem Geschmack des Herrn Verlegers“ folgen wolle,57 doch ganz traute er ihm offenbar nicht, wie die penible Textanordnung und typographische Gestaltung seiner Reinschriften und Druckvorlagen sowie ihre Eins-zu-eins-Umsetzung im späteren Druck zeigen.58 Verleger und Setzer nahmen zwar regelmäßig die Wünsche ihrer Autoren entgegen, am Ende entschieden sie jedoch eigenständig und achteten immer öfter auf ein für ihren Verlag typisches „corporate design“.59 Insgesamt hatten sich am Ende des 18. Jahrhunderts neben dem Oktavformat für die Belletristik,60 typographische Muster und qualitative Merkmale wie die „Glätte des Papiers, die Qualität des Schriftschnitts, die Schwärze der Druckerfarbe, die Einrichtung des Satzspiegels und die Komposition der Illustration“ durchgesetzt,61 und das galt nicht nur für die damals zu den „geistigen Genüssen der Zeit“62 zählenden Prachtausgaben. Ein „typographischer guter Geschmack und Sauberkeit“ – findet Friedrich Justin Bertuch – sei ein wesentlicher Maßstab für die Beurteilung der belletristischen Buchproduktion.63 Das ‚typographische Dispositiv‘ ist daher als Teil von Materialität und Medialität bei der Überlieferung von Dramen in einer Edition zu berücksichtigen. Ob dies bei der Gestaltung des Edierten Textes erfolgt oder mit Hilfe einer Abbildung oder diskursiv, muss am Einzelfall geprüft und diskutiert werden.
57
58 59
60
61
62 63
Goethe an Georg Joachim Göschen, 2. September 1786. Quellen und Zeugnisse zur Druckgeschichte von Goethes Werken. Hrsg. vom Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Bearb. von Waltraud Hagen, Inge Jensen, Edith Nahler und Horst Nahler. 4 Bde. Berlin 1966–1986, Bd. 1, S. 32f. Beispiele zu Goethes Torquato Tasso und Egmont bei Brüning/Pravida 2020 (Anm. 47), S. 129–139. Peter-Henning Haischer und Charlotte Kurbjuhn: Faktoren und Entwicklung der Buchgestaltung im 18. Jahrhundert. In: Kupferstich und Letternkunst. Buchgestaltung im 18. Jahrhundert. Hrsg. von PeterHenning Haischer, Charlotte Kurbjuhn, Steffen Martus und Hans-Peter Nowitzki. Heidelberg 2016 (Wieland im Kontext. 2), S. 13–93, hier S. 74. Christian Gottlob Täubel: Orthotypographisches Handbuch; oder: Anleitung zur gründlichen Kenntniß der Buchdruckerkunst, welche allen Schriftstellern, Buchhändlern, besonders aber denen Correctoren unentbehrlich sind. Nebst einem Anhange eines typographischen Wörterbuches […]. Halle, Leipzig 1785, S. 258 empfiehlt: „Witzige Schriften, Romane, Gedichte, Comödien, und andre schöngeisterische Bücher werden meistentheils im kleinsten Octav-Formate gedruckt, weil man solche manchmal beym Spatzierengehn, in Gärten, auf Reisen, u.s.w. bey sich zu führen pflegt, und die daher bequemer und leichter zu transportiren seyn müssen.“ Prachtausgaben. Literaturdenkmale in Quart und Folio. Bearb. von Diana Mazzoni. Marbach am Neckar 1991 (Marbacher Magazin. 59), S. 3. Journal des Luxus und der Moden 24, Dezember 1809, S. 791. Friedrich Justin Bertuch: Ueber den Typographischen Luxus mit Hinsicht auf die neue Ausgabe von Wielands sämmtlichen Werken. In: Journal des Luxus und der Moden 8, November 1793, S. 599–608, hier S. 599.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
Abb. 1: Gottsched: Der sterbende Cato.
253
254
Bodo Plachta
Abb. 2: Molière: Der Menschenfeind, übersetzt von Luise Adelgunde Victorie Gottsched.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
255
4. Editorische Konsequenzen Lange galt es zumindest in der germanistischen Editionspraxis als selbstverständlich, dramatische Texte als literarische Lesetexte zu behandeln, nur sie waren kanonisch und auch die Literaturwissenschaft konzentrierte sich auf das Lesedrama.64 Dramentexte wurden gattungsunabhängig, aber unter Beachtung des Autorwillens nach philologischen Kriterien ediert, ihre Edition galt nicht als Sonderfall. Ihre je eigene Realisation auf der Theaterbühne sollte Gegenstand der Interpretation und nicht der Edition sein; die Edition von Bühnenbearbeitungen war daher eine Ausnahme. Die textspezifische Überlieferung, Medialität oder Materialität spielten im Diskurs keine Rolle. Während neuere Editionen von Dramenhandschriften kaum mehr ohne Faksimile auskommen, sind Faksimiles von gedruckten Dramentexten unüblich oder werden in separate Sammlungen ausgelagert.65 Jede Dramenedition verfuhr nach Gutdünken und normierte meist nach Vorgabe der Verlage das Erscheinungsbild ihrer Texte, wobei die Begründungen überwiegend knapp ausfielen.66 In der Edition der Räuber im Rahmen 64
65
66
„Der literarische Kanon“, konstatiert Reinhart Meyer, „enthält Werke, deren Bühnenwirksamkeit gering, deren literarischer Lese- und Interpretationswert aber ausgesprochen hoch veranschlagt wird. Der poetische Wert vieler bühnenwirksamer Werke dagegen ist oft auffällig niedrig. Diese Diskrepanz hat der Literaturwissenschaft nur wenig Kopfzerbrechen gemacht. Für sie ist das Drama eine literarische Gattung neben anderen, die nach der Druckfassung, nicht nach ihrer Inszenierung, ihrer Bühnenfassung interpretiert wird.“ (Bibliographia dramatica et dramaticorum. Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart. Tübingen 1986, 1. Abt., Bd. 1, S. XXVIII). Vgl. etwa für Büchners Leonce und Lena die Druckfaksimiles in Georg Büchner: Leonce und Lena. Hrsg. von Burghard Dedner. Kritische Studienausgabe, Beiträge zu Text und Quellen. Frankfurt a.M. 1987. Auch neuere Editionen wie z.B. die Brandenburger Kleist-Ausgabe, die Marburger Büchner-Ausgabe oder die Wiener Horváth-Ausgabe, die hinsichtlich ihrer methodischen Anlage als innovativ gelten, verfahren bei der typographischen Gestaltung von Überschriften, Sprechernamen und Spielanweisungen normierend: „Die Seitengestaltung und die typographische Einrichtung des Satzes gilt für alle konstituierten Dramentexte der BKA. Ihre Wahl hat ausschließlich funktionale Gründe. […] Mit dem Stand von Regieanweisungen wurde keine semantische Option verknüpft; dennoch wurde darauf geachtet, daß er weitestgehend demjenigen der Vorlage entspricht“; H.v. Kleist: Sämtliche Werke. Berliner, [seit 1992:] Brandenburger Ausgabe. Hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle. Basel, Frankfurt a.M. 1988–2010, Bd. I/4, S. 145. – „[…] normiert wurde […] die Typographie von – Akt- und Szenenüberschriften: zentriert und in der Regel mit zwei vorausgehenden und einer folgenden Leerzeile, jedoch ohne Leerzeile innerhalb mehrzeiliger Szenenüberschriften; – Regieanweisungen zur Angabe von Personenauftritt in einer fortlaufenden Szene: je nach Befund in den Drucken entweder ohne Leerzeile oder mit halber Leerzeile vor bzw. nach der Regieanweisung“; Georg Büchner: Sämtliche Werke und Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit Quellendokumentation und Kommentar (Marburger Ausgabe). Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Hrsg. von Burghard Dedner und Thomas Michael Mayer, [seit 2005:] hrsg. von Burghard Dedner, mitbegründet von Thomas Michael Mayer. 10 Bde. Darmstadt 2000–2013, Bd. 6, S. 550. – „Folgende Normierungen finden statt: Regie- und Szenenanweisungen erscheinen kursiv, Figurennamen in Kapitälchen (innerhalb von Regie- oder Szenenanweisungen nur dann, wenn sie vom Autor graphisch hervorgehoben wurden, ansonsten bleiben sie ohne Auszeichnung)“; Ödön von Horváth: Wiener Ausgabe sämtlicher Werke. Historisch-kritische Edition. Am Österreichischen Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Hrsg. von Klaus
256
Bodo Plachta
der Schiller-Nationalausgabe heißt es lapidar und durchaus verallgemeinerbar: „Unsere Textwiedergabe ist bestrebt, die Vorlage bis zur Grenze des Zulässigen buchstabengetreu darzubieten. […] Es schien im übrigen ratsam, die Uneinheitlichkeit in der formalen Behandlung der Spielanweisungen beizubehalten und durch keine nachträgliche Normierung den auch solchen Nebensächlichkeiten innewohnenden Reiz des Ursprünglichen zu schmälern.“67 Allerdings zeigt sich, dass im Vergleich mit dem Originaldruck und der Umsetzung in der Edition gerade die Spielanweisungen anders als in der Vorlage behandelt werden. Man entfernte die Klammern und kursivierte konsequent Spiel- und Bühnenanweisungen. Erst mit einer stärker am Befund orientierten Edition wurden Prinzipien für die Dramenedition entwickelt, allerdings haperte es lange an einer entsprechenden Umsetzung. Obwohl Hans Werner Seiffert bereits 1969 festgestellt hat, dass das „Problem der ‚Theaterbearbeitung‘“ einer „eigene[n] textkritische[n] Untersuchung wert“ sei, und ausdrücklich auf die Bearbeitungen von Schiller, Goethe und Brecht verwies,68 blieben Bühnenbearbeitungen eine editorische „Randerscheinung“.69 Nur wenige Editoren hatten, registriert Klaus Kanzog noch 1991, ein Interesse, neben dem Lesetext eines Dramas noch Textalternativen zu fixieren, die einen auf der Bühne realisierten Text repräsentieren.70 Dieses Desinteresse oder vielleicht besser die Skepsis gegenüber Textkomplexen, die im Verhältnis zum Dramentext „per se keinen festen Status haben“,71 hatte Tradition, denn die großen paradigmatischen Editionen des 19. Jahrhunderts zu den prominenten Theaterautoren Lessing, Goethe und Schiller oder Grillparzer widmeten sich diesem Phänomen gar nicht oder allenfalls punktuell. Bei der Diskussion der Editionsgrundsätze für die Weimarer Goethe-Ausgabe lehnte Gustav von Loeper (23. Februar 1889) gegenüber Bernhard Suphan eine Edition der Bühnenfassung von Goethes Götz (1804) kategorisch (wenn auch letztlich vergeblich) ab: „Ich halte die Verbindung der […] Ausgabe von 1804 mit dem Götz von 1773 und 1787 für ganz unzulässig; es sind verschiedene Einheiten, ganz verschiedene Werke, wenn auch
67 68
69
70 71
Kastberger. Berlin, New York 2009ff., Bd. 4, S. 575. – Die digitale Schnitzler-Ausgabe normiert ebenfalls das typographische Erscheinungsbild der Edition, ergänzt die Lesetexte jedoch um Faksimiles der Originaldrucke, sodass die Unterschiede deutlich werden. Ansonsten werden typographische „Differenzen“ nur im Einzelfall berücksichtigt (vgl. die Hinweise zu den Druckvarianten für die Komödie der Verführung, https://www.schnitzler-edition.net/emendtext/10049, gesehen 29.9.2021). – Die digitale Faust-Ausgabe dagegen stellt fest: „Vom typographischen Erscheinungsbild der einzelnen Drucke wird abstrahiert“ (http://www.faustedition.net/transcription_guidelines; gesehen 29.9.2021). Schillers Werke 1943ff. (Anm. 3), Bd. 3, S. 348. Hans Werner Seiffert: Untersuchungen zur Methode der Herausgabe deutscher Texte. Berlin 1963 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. 28), S. 89, Anm. 1. Klaus Kanzog: Fixierter Text – realisierter Text. Über eine vernachlässigte Aufgabe der Editionsphilologie. In: Edition als Wissenschaft. Festschrift für Hans Zeller. Hrsg. von Gunter Martens und Winfried Woesler. Tübingen 1991 (Beihefte zu editio. 2), S. 5–16, hier S. 5. Kanzog 1991 (Anm. 69), S. 5. Henzel 2018 (Anm. 20), S. 66.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
257
das zweite aus dem ersten hervorgegangen.“72 Noch 1980 befand Siegfried Scheibe, dass Theaterfassungen und Bühnenmaterial nur dann überlieferungsgeschichtliche Relevanz haben, wenn die Mitarbeit des Autors nachzuweisen ist.73 Scheibe sieht in den Texten, die etwa aus Anlass einer Aufführung entstanden, „faktisch eine getrennte Überlieferung“,74 die kaum editorische Relevanz hat und die das Lesedrama allenfalls ergänzt. Sie sind als Teil der Textgenese ebenso zu behandeln wie Vorabdrucke von Romanen, Erzählungen oder Gedichten in Periodika und erfordern mithin „keine kategorial anderen editorischen Verfahrensweisen“.75 Schon gar nicht sind sie editorisch zu privilegieren, indem man sie als eigenständige Fassung betrachtet. Dreh- und Angelpunkt dieser, heutzutage dogmatisch anmutenden Editionsauffassung ist das auf den Autor bezügliche Werk in der Vorstellung, im Buchdruck verfestigen sich Werk und Autorintention. Insofern bestimmt stets die Kategorie Autor, in welchem Kontext die tatsächlich relevante „Faktizität der Texte“76 zum Tragen kommt. In der editorischen Realität bedeutet dies das Ausblenden wesentlicher Performanzaspekte eines Dramentextes wie Regiebemerkungen, Hinweise zum Bühnenbild, „theatralische Konstellationen“77 oder aufführungsspezifische Textänderungen, die ja ebenfalls Teil dieser Faktizität sind. Die Editionswissenschaft, beklagt Kanzog, legt sich damit unnötigerweise selbst „Fesseln“ an.78 Katrin Henzel hat zu Recht gefordert, dass bei der Edition von Theatertexten noch immer ein „Perspektivenwechsel“ dringend nötig ist!79 Es gibt dennoch Anzeichen für die Einsicht, eine Dramenedition müsse das Ziel verfolgen, „die Texte als selbständig und gleichzeitig als abhängig zu behandeln“.80
72
73
74 75
76
77
78 79
80
Zitiert nach Silke Henke: „Ich habe mich zu einem Versuch verführen lassen, meinen Götz von Berlichingen aufführbar zu machen.“ Zur Überlieferung der Bühnenbearbeitungen von Goethes „Götz von Berlichingen“ im Goethe- und Schiller-Archiv. In: Das Goethe- und Schiller-Archiv 1896–1996. Beiträge aus dem ältesten deutschen Literaturarchiv. Hrsg. von Jochen Golz. Weimar, Köln, Wien 1996, S. 175–193, hier S. 181. – Diese Ablehnung war umso erstaunlicher, als Jacob Baechthold bereits 1882 und 1888 eine synoptische Edition von Goethes Götz herausgebracht hatte, die neben der Handschrift den Erstdruck und die Bühnenbearbeitung enthielt; Goethes Götz von Berlichingen. In dreifacher Gestalt hrsg. von Jacob Baechtold. Zweite Ausgabe. Freiburg/Br. 1888. Siegfried Scheibe: Benötigen wir eine eigene Theorie der Edition von Dramen? Einige Bemerkungen zur Einheit der Textologie. In: editio 3, 1989, S. 28–40, hier S. 32f. Scheibe 1989 (Anm. 73), S. 31. Rüdiger Nutt-Kofoth: Editorik und Gattung. In: Handbuch Gattungstheorie. Hrsg. von Rüdiger Zymner. Stuttgart, Weimar 2010, S. 48–50, hier S. 48. Herbert Kraft: Die Aufgaben der Editionsphilologie. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 101, 1982, Sonderheft: Probleme neugermanistischer Edition, S. 4–12, hier S. 5. Peter-André Alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit. 2 Bde. 2., durchgesehene Aufl. München 2004, Bd. 2, S. 382. Kanzog 1991 (Anm. 69), S. 6. Henzel 2018 (Anm. 20), S. 77; vgl. auch Katrin Henzel: Texte ‚behind the scenes‘. Regiebuch und Drehbuch im Kontext von Film- und Dramenedition. In: Kritische Film- und Literaturedition. Perspektiven einer transdisziplinären Editionswissenschaft. Hrsg. von Ursula von Keitz, Wolfgang Lukas und Rüdiger Nutt-Kofoth. Redaktionelle Mitarbeit: Ulrich Rummel. Berlin, Boston 2022 (Beihefte zu editio. 51), S. 191–202, bes. S. 191f., 201f. Paul-Gerhard Völker: Schwierigkeiten bei der Edition geistlicher Spiele des Mittelalters. In: Kolloquium über Probleme altgermanistischer Editionen. Marbach am Neckar, 26. und 27. April 1966. Referate und
258
Bodo Plachta
Am konsequentesten ist dies in der mediävistischen Spieleedition zu beobachten, aber auch für die Edition barocker Theatertexte gibt es interessante, wenn auch umstrittene Versuche. Das in der Mediävistik lange favorisierte Prinzip, aus der Überlieferung einen archetypischen Text zu rekonstruieren oder alternativ einen Text auf Grundlage einer Leithandschrift herzustellen,81 wird der Überlieferung von Spieltexten und ihrer Funktion als Gebrauchstexte nicht gerecht. Aus ihnen ein ‚Urspiel‘ zu generieren, würde bedeuten, einen Text herzustellen, der so nie existiert und außerdem das Manko hätte, dass Varianten sich inkongruent gegenüber stünden. Die Auswahl nur eines Textes auf Grundlage einer Leithandschrift würde den Text einer Aufführung absolut setzen und den spezifischen Aufführungscharakter der übrigen Texte in Einzelvarianten marginalisieren. Zusätzliche Probleme verursachen die Handschriften, die mehreren Aufführungen als Grundlage dienten und daher sich überlagernde Fassungen enthalten, die neben dem Text auch die Bühnengestaltung und Inszenierung betreffen können. Mit der Orientierung am überlieferten Textmaterial, dem Verzicht auf die Rekonstruktion von vermeintlichen Urtexten und einem Interesse am Gebrauchscharakter und der Rezeptionssituation von Quellen verlor die Alternative „Archetyp oder Aufführung“ für die Edition von Spieltexten ihre Schärfe. Die Frage, wie „gattungsadäquate Editionsformen“ für den Komplex der Spieltexte beschaffen sein müssten, beherrschte die Diskussion, nachdem darüber Konsens erzielt war, dass das „Original eines mittelalterlichen Dramas“ „seine Aufführung“ ist.82 Ein Mix an Editionsformen – diplomatisch, synoptisch oder am Prinzip der Leithandschrift orientiert – wurde ausprobiert, wobei die neuen Medien die Bandbreite der Editionsformen um digitale bzw. hybride Anteile erweitern oder ergänzen können. Wie es sinnvoll mit analogen Mitteln gelingen kann, inhaltlich verwandte, aber komplett anders überlieferte Spieltexte in einen „textlichen Zusammenhang“ zu stellen, sodass besonders die „Grauzonen“ der „Spiellandschaften“ ausgeleuchtet werden, zeigt die synoptische Edition einer Gruppe von hessischen Passionsspielen.83 Es wurde ein Leittext ausgewählt, dem die anderen überlieferten Spieltexte mit ihren jeweils eigenen Traditionen als normierte und zitierfähige Lesetexte parallel zur Seite gestellt sind; Fußnotenapparate dokumentieren Varianten, Ergänzungen bzw. Marginalien und textkritische Entscheidungen. Der Leittext wird um ein Faksimile der Handschrift und um eine diplomatische Umschrift ergänzt.
81
82
83
Diskussionsbeiträge. Hrsg. von Hugo Kuhn, Karl Stackmann und Dieter Wuttke. Wiesbaden 1968 (Forschungsberichte. 13), S. 160–168, hier S. 162. Karl Konrad Polheim: Die Edition von Volksschauspielen. Auch ein Entwurf für das mittelalterliche Drama. In: editio 3, 1989, S. 41–75, hier S. 53–55. Hansjürgen Linke: Die Gratwanderung des Spieleditors. In: Methoden und Probleme der Edition mittelalterlicher deutscher Texte. Bamberger Fachtagung 26.–29. Juni 1991, Plenumsreferate. Hrsg. von Rolf Bergmann und Kurt Gärtner unter Mitwirkung von Volker Mertens, Ulrich Müller und Anton Schwob. Tübingen 1993 (Beihefte zu editio. 4), S. 137–155, hier S. 137. Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. Hrsg. von Johannes Janota. 5 Bde. Tübingen 1996–2008, Bd. 1: Frankfurter Dirigierrolle. Frankfurter Passionsspiel, S. IX.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
259
Für kontroverse Diskussionen sorgten Editionen von Barock-Texten, die entweder ganz oder teilweise in Fraktur gedruckt wurden,84 und sich damit gegen die verbreitete Ansicht stellten, eine Edition habe Schriften ihrer Vorlagen wie die Fraktur zu „transgraphier[en]“,85 also in heute gebräuchliche Antiqua-Schrift umzuwandeln. Abgesehen davon, dass Frakturschrift heute ein Rezeptionshindernis ist, wurden die Vor- oder Nachteile eines Einsatzes von Fraktur in Editionen nie endgültig geklärt, ihr Einsatz ist allerdings nach wie vor editorische Realität und tangiert die Grundsatzfrage: Was edieren wir, einen Text oder einen Textträger? Die seit 2005 erscheinende Ausgabe der Sämtlichen Werke von Daniel Casper von Lohenstein präsentiert zwar die Texte in Antiqua, um die „verlegerische Verwertbarkeit“ nicht zu gefährden, normiert die Sprechernamen, behält aber die „Differenzierung von Schaft-s und Rund-s“ bei, reproduziert die „historischen Umlautkennzeichnungen“ mit Superskripten, wohingegen spezifische Frakturphänomene wie „tz-Ligatur“ und die „zwei Formen des r“ ignoriert werden.86 Während also einzelne Elemente der Druckschrift nachgebildet werden, spielt das opulente historische Layout kaum eine Rolle bei der editorischen Umsetzung. Emendationen und Varianten werden jeweils gesondert in einem Fußnotenapparat nachgewiesen und komplettieren das Bild einer modernen Edition, die den Spagat wagt, den „Informationsverlust“ zwischen Vorlage und Edition zu minimieren87 und sich damit zwangsläufig Inkonsequenzen aussetzt. Solche Inkonsequenzen können wohl nur von Editionsformen aufgefangen werden, die mit Faksimiles arbeiten. Wie eine befundorientierte Dramenedition ohne einen Rückgriff auf Faksimiles für neuere Theaterstücke aussehen kann, der durch das Publikationsformat von vornherein enge Grenzen gesetzt sind und die sich zudem an ein nicht nur akademisches Publikum wendet, soll an der „Kritischen Studienausgabe“ von Goethes Iphigenie auf Tauris gezeigt werden, die Rüdiger Nutt-Kofoth für den Reclam-Verlag erarbeitet hat.88 Seit der Weimarer Goethe-Ausgabe publizierten die meisten, heute gängigen GoetheEditionen die Iphigenie-Fassungen entweder in unterschiedlichen Bänden oder ließen sie unmittelbar hintereinander folgen; auch die Textkonstitution folgt häufig der der Weimarer Ausgabe und ihren heute als problematisch angesehenen Prinzipien.89 Die zu lösende Aufgabe bestand nun darin, nicht nur einen philologisch abgesicherten Text zu bieten, sondern sowohl die handschriftlich überlieferte Prosa-Fassung von 1779 als
84
85
86
87 88
89
Beispiele bei Gerrit Brüning: Fraktur oder Antiqua? Typographie und Zeichentreue als editorisches Problem. In: Falk/Rahn 2016 (Anm. 48), S. 335–348. Ulrich Joost: „Als müßte ich es mir übersetzen“ – Prolegomena zu einer editionskritischen Untersuchung der deutschen Zweischriftigkeit. In: Text und Edition. Positionen und Perspektiven. Hrsg. von Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, H.T.M. van Vliet und Hermann Zwerschina. Berlin 2000, S. 353–368, hier S. 365. Siehe z.B. Daniel Casper von Lohenstein: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. von Lothar Mundt, Wolfgang Neuber und Thomas Rahn. Berlin, New York 2005ff., Abt. II, Bd. 2.1, S. 592. Brüning 2016 (Anm. 84), S. 348. Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Rüdiger NuttKofoth. Stuttgart 2014. Zur Editionsgeschichte vgl. Nutt-Kofoth 2014 (Anm. 88), S. 199–203.
260
Bodo Plachta
auch die 1787 erstmals in den Schriften veröffentlichte Blankversfassung in einer synoptischen Edition zusammen zu führen, sodass zwei für die deutsche Literaturgeschichte herausragende „Crystallisation[en]“ 90 in ihrer unterschiedlichen ästhetischen Konzeption im „direkte[n] Vergleich“91 zur Kenntnis genommen werden können. Bewahrt werden sollten außerdem die „Historizität der Überlieferung und der Dokumentcharakter der Handschrift“.92 Der Edierte Text folgt den Vorlagen zeichengetreu, in der typographischen Gestaltung werden deutsche und lateinische Schrift in der Prosafassung differenziert, Auszeichnung und Position von Sprechernamen, Spielanweisungen sowie Akt- und Auftrittsangaben werden für beide Fassungen entsprechend den Layoutvorgaben des Verlags normiert, im diskursiven Teil der Edition jedoch ausführlich beschrieben und die gewählte Umsetzung damit als Teil des „editorischen Informationssystems“93 problematisiert. Varianten, genetische Phänomene (Streichungen, Korrekturen, Ergänzungen), Emendationen und textkritische Zweifelsfälle werden in einem Fußnotenapparat dokumentiert und erläutert; sie sind durch diese Anordnung als konstitutiver Teil des Textes anzusehen. Die Edition von Dramentexten, so kann abschließend resümiert werden, erfordert eine Offenheit in methodischer und praktischer Hinsicht.94 Eine „allgemeine Theorie der Edition“, wie sie Scheibe in seinen Bemerkungen zur Dramenedition forderte,95 90 91 92 93
94
95
Goethe an Herder, 14. Oktober 1786; Goethes Werke 1887–1919 (Anm. 6), Abt. IV, Bd. 8, S. 32. Nutt-Kofoth 2014 (Anm. 88), S. 199. Nutt-Kofoth 2014 (Anm. 88), S. 202. Rüdiger Nutt-Kofoth: Typographie als Informationssystem. Zum Layout der neugermanistischen Edition. In: Falk/Rahn 2016 (Anm. 48), S. 349–368, hier S. 351. – Friedrich Forssman, der maßgeblich an der Gestaltung von Layout und Typographie der Reclam-Textausgaben beteiligt war, warnt vor „Illusionen“ beim Versuch, historische Typographie vollständig zu reproduzieren: „Weder ist eine gänzlich neutrale typographische Textabbildung möglich, noch kann eine quasi faksimilierende Editionstypographie im vollen Sinne die Wiederauferstehung der verlorenen Materialität bewirken“; Friedrich Forssman, zusammen mit Thomas Rahn: Gemäßigte Mimesis. Spielräume und Grenzen einer eklektischen Editionstypographie. In: Falk/Rahn 2016 (Anm. 48), S. 369–386, hier S. 370. Für die Oßmannstedter Wieland-Ausgabe hat Forssman – keinesfalls ein Gegner historischer Typographie – ebenfalls Layout und Typographie entworfen und folgt dabei diesen allgemeinen editorischen Prinzipien: „Die graphische Vielfalt der Handschriften, Einzel- und Sammeldrucke, die unterschiedlichen Formate und Ausstattungen, in denen Wielands Werke in ihrer Zeit überliefert sind, wären lediglich in FaksimileAusgaben nachzubilden. Die kritische Neuedition von Wielands Werken sucht demgegenüber einen tragfähigen Kompromiß zwischen einem modernen homogenen Druckbild der Gesamtausgabe sowie der Wiedergabe der historischen und semantisch relevanten Druckauszeichnungen zu erzielen. Fraktur und Antiqua der historischen Drucke werden generell in eine moderne ‚klassizistische‘ Prillwitz-Antiqua umgesetzt. Sperrdruck kennzeichnet muttersprachliche Hervorhebungen, Kursivdruck Hervorhebungen fremdsprachlicher Partien. Es werden also nicht die unterschiedlich realisierten Auszeichnungsarten der historischen Drucke abgebildet, sondern die Auszeichnungen als solche, gegebenenfalls in ihrer hierarchischen Stufung, typographisch vereinheitlichend reproduziert“, https://www.glw.uni-jena.de/ arbeitsstelle-wieland-edition (gesehen 31. 9. 2021). Im anglo-amerikanischen Sprachraum gibt es für Shakespeares Werke sogenannte „Acting Editions“, die eine lange Tradition haben, mit instruktiven Kommentaren zur Aufführungspraxis versehen sind und u.a. im akademischen Unterricht und für die Schauspielausbildung genutzt werden. Vgl. Abigail Rokison-Woodall: Editing Hamlet for Performance. In: Actes des congrès de la Société française Shakespeare 39, 2021, http://journals.openedition.org/shakespeare/6059 (gesehen 23.4.2022). Scheibe 1989 (Anm. 73), S. 29.
Spieltext – Lesetext – Edierter Text
261
scheint ebenso wenig eine Lösung zu sein wie eine starre Standardisierung von Verfahren. Diese wäre angesichts der variantenreichen Überlieferung und der heutigen medialen Präsentationsmöglichkeiten ohnehin kontraproduktiv, wohingegen es sinnvoll ist, über eine sich aus editorischen Vorgängermodellen und textkritischem Diskurs ergebende ‚best practice‘ nachzudenken.96 Die Dramenedition ist keineswegs als Sonderfall zu betrachten, denn das philologische Instrumentarium, das uns zur Verfügung steht, reicht aus, um textkritisch geprüfte und historisch abgesicherte Texte auch vor dem Hintergrund einer spezifischen Überlieferung zu erarbeiten. Die Feststellung Gerhard Seidels, eine Edition müsse „funktions- und gegenstandsbedingt“ sein,97 hat nichts von ihrer Sinnhaftigkeit verloren, sie entspricht einer solchen ‚best practice‘. Vier Empfehlungen sind daher als Fazit dieser Überlegungen denkbar: 1.
Dramentexte in ihrer Ausprägung als Lese- und Bühnentexte sollten als selbstständige Fassungen und in ihren spezifischen Funktionen (Autortext/Theatertext) ediert werden.
2.
Die Überlieferung von Dramentexten ist zu dokumentieren, zu beschreiben und zu analysieren.
3.
Die Materialität und Medialität der Textträger sind zu dokumentieren, zu beschreiben, oder durch Visualisierung zu vermitteln. Wo immer möglich oder sinnvoll sind sie im Satzbild der Edition umzusetzen.
4.
Aufführungskontexte sollten durch Quellen detailliert dokumentiert und/oder diskursiv erläutert werden.
96
97
Ein anderes, konsequent kollaboratives Modell skizziert Jochen Strobel: A. W. Schlegels Korrespondenz – kollaborativ! Zu einer Theorie der Praxis digitaler Briefedition. In: editio 35, 2021, S. 143–167, bes. S. 163f. Seidel 1977 (Anm. 39), S. 19.
Rüdiger Nutt-Kofoth
Die Edition von Übersetzungen: Grundsatzfragen, Zielsetzungen und ein Vorschlag für eine relationale Edition Mit einem Blick auf die Rahmen einer Edition des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplexes
1. Zur literaturgeschichtlichen Relevanz von Übersetzungen Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Übersetzungen bedient einen eher kleinen Teil der Fachaufmerksamkeit. Das hat nicht zum Geringsten damit zu tun, dass sich die Literaturwissenschaft zuallererst um das literarische Werk in seiner originalen Sprache, verfasst durch seinen ursprünglichen Autor, kümmert. Denn das Charakteristikum des sprachlichen Kunstwerks in Verbindung mit seiner historischen Authentizität, gebunden also an seinen originalen Autor und seine originale Sprache, begründet ganz wesentlich den in seine Historizität eingebundenen Wert des literarischen Texts. Ließe sich aus dieser strikten Perspektive die Übersetzung daher immer als literarischer Text zweiten Grades begreifen, so hat Ralph-Rainer Wuthenow schon 1969 deutlich gemacht, welchen literaturgeschichtlichen Wert die Übersetzung für die Zielsprachenliteratur hat: „als Glied des literarischen Corpus ist Übersetzung, wie die Kritik, die Geschichtsschreibung, ein Teil der Nationalliteratur.“ Wuthenow begründet diese Perspektive nicht nur durch die inhaltliche Bereicherung der Zielsprachenliteratur, sondern insbesondere auch durch den sprachlichen Zugewinn für die Zielsprache: „Die Übersetzung aber bereichert die sogenannte Nationalliteratur nicht nur um neue Inhalte, Motive und formale Schemata. Die Ausdrucksformen selbst werden durch sie verändert, erweitert, bereichert, geschmeidigt und präzisiert.“1 Solche literaturgeschichtliche Bedeutungszuweisung hat die deutsche Literatur selbst schon an markanter Stelle ausgestellt, ja sie noch einmal potenziert. Novalis hatte 1
Ralph-Rainer Wuthenow: Das fremde Kunstwerk. Aspekte der literarischen Übersetzung. Göttingen 1969 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 252), S. 17. Dazu auch das Kapitel „Übersetzen und Sprachwandel: Die Beeinflussung der Zielsprache durch die Übersetzertätigkeit“ bei Jörn Albrecht: Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung. Darmstadt 1998, S. 139–160. Siehe auch die Bemerkung von Christa Jansohn: Autor, Verleger und Übersetzer. Zur wissenschaftlichen Dokumentation der Textkonstitution und des interkulturellen Texttransfers am Beispiel von D.H. Lawrences Sons and Lovers und Women in Love sowie den deutschen Übersetzungen. In: editio 19, 2005, S. 122–154, hier S. 123, dass „Übersetzung als extreme Form der poetischen Hermeneutik die Zielsprache stets verändert und damit zur sich erneuernden Wirkung des Originals beiträgt und gleichzeitig das Fortleben des Autors außerhalb der Nationalliteratur garantiert.“
https://doi.org/10.1515/9783111017419-018
264
Rüdiger Nutt-Kofoth
gegenüber August Wilhelm Schlegel formuliert: „Übersetzen ist so gut dichten, als eigne Wercke zu stande bringen – und schwerer, seltner. / Am Ende ist alle Poësie Übersetzung.“2 Mit dieser Aufwertung der Übersetzung, ja gar ihrer Überbietung des ausgangssprachigen Originalwerks wurde ihr eine herausragende Position unter den literarischen Textgenres zugewiesen. Ohne Zweifel darf diese Einschätzung nicht pauschalisiert werden, gehört sie doch – literaturgeschichtlich verortet – explizit in den Rahmen des frühromantischen Dichtungskonzepts.3 Auch wenn die Übersetzung damit quasi epochenspezifisch funktionalisiert ist, lässt sich aus einer solchen Hochschätzung doch eine Vergleichsperspektive zum Umgang der Literaturwissenschaft mit dem Textgenre Übersetzung gewinnen, und zwar in einem der literaturwissenschaftlichen Basisbereiche, nämlich dem der zur Grundlagenforschung zu rechnenden wissenschaftlichen Edition. Welche anders- oder auch neuartigen Aufgaben sich ihr mit dem Editionsobjekt ‚Übersetzung‘ insbesondere in Form ihres höchstrangigsten Typus, der historischkritischen Ausgabe, stellen, sei im Folgenden aus systematisch-methodischer Perspektive bedacht. Der unter dem Label ‚Schlegel-Tieck’sche Shakespeare-Übersetzung‘4 bekannte Beispielsfall sei dabei im Hintergrund mitbedacht, weil sich an ihm in besonderer Verdichtung eine Sachlage zeigt,5 die geeignet erscheint, an vielen Stellen als Belegmaterial für die Notwendigkeit einer – zumindest teilweise sichtbaren – eigenständigen Konzeption für die Edition von Übersetzungen zu dienen.
2
3
4
5
Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hrsg. von Paul Kluckhohn (†) und Richard Samuel. Zweite, nach den Handschriften ergänzte, erweiterte und verbesserte Aufl. in vier Bänden und einem Begleitband. Bd. 4: Tagebücher, Briefwechsel, Zeitgenössische Zeugnisse. Hrsg. von Richard Samuel in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz. Mit einem Anhang: Bibliographische Notizen und Bücherlisten, bearb. von Dirk Schröder. Stuttgart 1975, S. 237 (Brief von Novalis an August Wilhelm Schlegel vom 30.11.1797). Siehe zur Funktion der Übersetzung innerhalb des romantischen Dichtungsverständnisses zusammenfassend Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40, hier S. 26–29. Bibliografische Verzeichnungen der deutschen Shakespeare-Übersetzungen, darunter auch sämtliche zum Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplex, finden sich bei Hansjürgen Blinn, Wolf Gerhard Schmidt: Shakespeare – deutsch. Bibliographie der Übersetzungen und Bearbeitungen. Zugleich Bestandsnachweis der Shakespeare-Übersetzungen der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar. Berlin 2003, die von Schlegel und Tieck stammenden vielbändigen Dramenausgaben dort S. 28–36. Die Bedeutung von Schlegels Shakespeare-Übersetzung hat schon Jean Paul in der Vorschule der Aesthetik hervorgehoben: „In Schlegels Shakespeare und in Vossens Uebersetzungen läßt die Sprache ihre Wasserkünste spielen, und Beider Meisterstück geben dem Wunsche des Verfassers Gewicht: daß überhaupt die Uebersetzer wissen möchten, wie viel sie für Klang, Fülle, Reinheit der Sprache, oft sogar mehr, als selber der Urschriftsteller, zu leisten vermögen, da ihnen, wenn dieser über die Sache zuweilen die Sprache vergißt, die Sprache eben die Sache ist“; Jean Paul: Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. von Helmut Pfotenhauer und Barbara Hunfeld. Bd. V,2: Vorschule der Aesthetik nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Parteien der Zeit. Zweite Abtheilung. Hrsg. von Florian Bambeck. Berlin, München, Boston 2015, S. 233.
Die Edition von Übersetzungen
265
Novalis selbst hatte seine zitierte Äußerung von 1797 ebenfalls in diesen Kontext gestellt, nämlich in den der gerade mit dem Erscheinen beginnenden Shakespeare-Dramenübersetzung August Wilhelm Schlegels, und dann das Urteil gefällt: „Ich bin überzeugt, daß der deutsche Shakespeare jezt besser, als der Englische ist“.6 Das von Novalis als Überbietungserfolg propagierte Übersetzungsergebnis stellt damit auch einen Musterfall der Kategorie „Übersetzungen als (bedeutendste) Form transnationaler Verflechtungen“7 dar – insbesondere hinsichtlich der im 19. Jahrhundert national grundierten Gedanken zur kulturellen Eindeutschung Shakespeares.8
2. Zu den Ansätzen einer Theorie der Übersetzungsedition Die Editionswissenschaft selbst hat sich bisher nur punktuell mit der Frage der Edition von Übersetzungen befasst. Immerhin ist vor mehr als 20 Jahren eine Plenartagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition der Fragestellung gewidmet gewesen (Lingen 2000). Der daraus entstandene Sammelband trägt den Titel Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers.9 Das ist insofern bemerkenswert, als mit dem Untertitel eine prägnante Formel für die spezifische Aufgabe der Edition dieses Textgenres gefunden ist. Dennoch sind aus der Tagung kaum Beiträge entstanden,10 die diese methodisch-theoretische Umakzentuierung der traditionellen Aufgabenstellung der literaturwissenschaftlichen historisch-kritischen Edition systematischer reflektieren.11 Insofern ist es hilfreich, noch einmal genauer auf die Formulierung des Untertitels zu schauen. Wenn zur zentralen Aufgabe der Edition von Übersetzungen die „Dokumentation des interkulturellen Texttransfers“ erhoben wird, ist damit nämlich eine Verschiebung des traditionellen Editionsobjekts 6 7
8
9
10
11
Novalis, Bd. 4, 1975 (Anm. 2), S. 237. Katrin Henzel: August Wilhelm Schlegels Vorlesungen im Kontext der „Letteratura comparata“. Versuch einer Neuperspektivierung auf die Anfänge der Komparatistik als Wissenschaftsdisziplin: In: Biagi/Rispoli 2021 (Anm. 3), S. 41–54, hier S. 49. Vgl. Mark-Georg Dehrmann: Urgermanisch oder eingebürgert? Wie Shakespeare im 19. Jahrhundert zum ‚Deutschen‘ wird. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitwirkung von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 15–31. Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, 8. bis 11. März 2000. Hrsg. von Bodo Plachta und Winfried Woesler. Tübingen 2002 (Beihefte zu editio. 18). – Bodo Plachta sei auch für Hinweise zum vorliegenden Beitrag gedankt. Siehe zusätzlich zum Sammelband (Anm. 9) auch die in den Bänden editio 14, 2000, und 15, 2001, publizierten Plenarvorträge der Tagung. Ausnahmen sind etwa Horst Turk: Edition und Übersetzung. In kulturenvergleichender und kontaktgeschichtlicher Sicht. In: Plachta/Woesler 2002 (Anm. 9), S. 5–20, und Winfried Woesler: Zur wissenschaftlichen Edition von Übersetzungen. In: Ebd., S. 31–42. Knappe allgemeine Überlegungen finden sich auch bei Sigurd Paul Scheichl: Übersetzungen als Fingerübungen – Und wie man sie edieren sollte. Am Beispiel norbert c. kasers. In: Ebd., S. 195–205, hier S. 203f.
266
Rüdiger Nutt-Kofoth
und der traditionellen Editionsaufgabe verbunden. Diese gilt im Regelfall ja der historisch-kritischen Präsentation und Erschließung des originalen Autortexts. Die Übersetzungsedition setzt sich dagegen das Ziel, einen Vorgang sichtbar zu machen: die Übermittlung, die Weitergabe eines Textes über eine kulturelle, im Wesentlichen also – aber eben nicht nur – sprachlich bedingte Grenze. Das hat Auswirkungen auf die zentralen Kategorien der Edition und ihre damit verbundenen Konzepte, ganz im Sinne der von Gerhard Seidel geprägten Formel von der je spezifischen „Funktions- und Gegenstandsbedingtheit der Edition“.12 Das Editionsobjekt, das für die literaturwissenschaftliche Edition traditionell das Werk eines Autors in seiner autorisierten und authentischen Form ist, ist von diesen Auswirkungen ebenso betroffen wie die eng damit verbundene Frage nach dem Autor bzw. seiner klassifikatorischen Rolle im Literatursystem, der Autorfunktion. Im Fall der Übersetzung sind nämlich – mindestens – zwei Personen beteiligt, wenn man von dem Sonderfall absieht, dass ein Autor selbst Mehrsprachenversionen seiner Werke herstellt, wie z.B. Samuel Beckett.13 Gehört im Regelfall also der Autor des Werks dem Bereich der Ausgangssprache an, stammt der Übersetzer in aller Regel aus dem Bereich der Zielsprache. Betont der zielsprachige Übersetzer dabei seine Autorfunktion in besonderer Weise, weil dies zu seinem Autorkonzept gehört, kann das dazu führen, dass sich dessen Funktion als ‚Übersetzer‘ stark in Richtung ‚Autorfunktion‘ verschiebt. Dieses Phänomen ist häufiger dann zu beobachten, wenn der Übersetzer zugleich literarischer Autor ist. Solche Rollen- oder Funktionsüberschneidungen können bei besonders starker Akzentuierung der Autorfunktion des Übersetzers dazu führen, dass die Übersetzung vom Übersetzer als neues, eigenständiges Werk verstanden wird, für das der Übersetzer dann als Autor fungiert. Ein extremer Fall für ein solches Verständnis findet sich bei Stefan George, der seine Übersetzungen etwa von Gedichten Baudelaires oder Shakespeares in eigenen mit seinem Autornamen gekennzeichneten Bänden seiner autorisierten Werkausgabe publizierte.14 Die Frage, wessen Text in der Edition präsentiert wird, derjenige vom „Autor oder Übersetzer oder Autor als Übersetzer“, lässt sich in diesem Fall wohl eher als „derjenige vom Übersetzer als Autor“ beantworten.15 Im Regelfall verschieben allerdings Übersetzer ihre Funktion auch dann, wenn sie ansonsten als literarische Autoren tätig sind, nicht gänzlich vom Pol ‚Übersetzer‘ in Richtung ‚Autor‘, sondern nehmen verschiedene Zwischenstellungen ein. Für den ‚Schlegel12
13
14
15
Prägnant schon im Titel von Gerhard Seidel: Die Funktions- und Gegenstandsbedingtheit der Edition. Untersucht an poetischen Werken Bertolt Brechts. Berlin 1970 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. 46. Reihe E: Quellen und Hilfsmittel zur Literaturgeschichte); später erneut als Ders.: Bertolt Brecht – Arbeitsweise und Edition. Das literarische Werk als Prozeß. Stuttgart 1977. Als Beispiel für den – selteneren – Fall des sich selbst übersetzenden literarischen Autors angeführt z.B. bei Klaus Gerlach: Zu Problemen der Edition von Bearbeitungen und Übersetzungen. In: Zu Werk und Text. Beiträge zur Textologie. Hrsg. von Siegfried Scheibe und Christel Laufer (Redaktion). Berlin 1991, S. 105–110, hier S. 108f. Siehe Rüdiger Nutt-Kofoth: Autor oder Übersetzer oder Autor als Übersetzer? Überlegungen zur editorischen Präsentation von ‚Übertragungen‘ am Beispiel Stefan George. In: editio 14, 2000, S. 88–103. Nutt-Kofoth 2000 (Anm. 14), Titel und S. 102.
Die Edition von Übersetzungen
267
Tieck’schen Shakespeare‘ wäre diese Position noch genauer auszuloten, wobei zu bedenken wäre, dass ja gerade im Rahmen des frühromantischen Dichtungskonzepts die Übersetzung eine explizite Aufwertung erfährt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch Überlegungen z.B. August Wilhelm Schlegels, beginnend etwa mit seinem Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters in Schillers Horen-Zeitschrift,16 solche Positionierungen von Übersetzerseite theoretisch begleitet werden. Die neugermanistische Editionswissenschaft muss jedenfalls für die Edition von Übersetzungen ihr Werk- und ihr Autorkonzept als Rahmen der Edition modifizieren. Weder geht es bei der Edition von Übersetzungen um das authentische Autorwerk an sich, noch hat der Autor, der in der traditionellen literaturwissenschaftlichen Autorgesamtwerkedition gerade die Begrenzungsfunktion der Werkauswahl und der in die Ausgabe aufgenommenen autorisierten Textträger ausübt, eine solch starke Position inne. Stattdessen stehen für die Übersetzungsedition aufgrund der ihr editionswissenschaftlich schon vorformulierten Aufgabe, den interkulturellen Texttransfer zu dokumentieren, idealtypisch zwei Texte im editorischen Fokus: der originale Autortext der Ausgangssprache und der Übersetzertext der Zielsprache, wobei je nach Verständnis auch letzterer Werkfunktion haben kann. Dann wäre analog zum Originalautor hinsichtlich seines ursprünglichen Werks auch der Übersetzer als Autor der Übersetzung zu verstehen. Damit greifen die textkritischen Strukturelemente der Autorisation bzw. Authentizität sowie die Ordnung von Text und Varianten bzw. Textgenese nicht mehr in ihrer gängigen Form, sondern müssen den spezifischen Aufgaben der Edition von Übersetzungen gemäß neu zugeschnitten werden. Klaus Gerlach hat eine solche Verschiebung schon angedeutet, als er 1991 mit Blick auf Übersetzungen dafür plädierte, dass in der Scheibe’schen Definition der ‚Textfassung‘ das Merkmal der Identität durch jenes der Äquivalenz erweitert werden müsse: Textfassungen sind vollendete oder nicht vollendete Ausführungen eines Werkes, die voneinander abweichen. Sie sind durch Textidentität oder Textäquivalenz aufeinander beziehbar und durch Textvarianz voneinander unterscheidbar.17
16
17
[August Wilhelm Schlegel:] Etwas über William Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112, hier S. 75–112. Gerlach 1991 (Anm. 13), S. 110, Hervorhebung von R.N.-K. – Siegfried Scheibe: Editorische Grundmodelle. In: Scheibe/Laufer 1991 (Anm. 13), S. 23–48, hier S. 25, hat dieses Spezifikum der Übersetzungsedition dann auch in seine Definition integriert: „Textfassungen heißen vollendete oder nicht vollendete Ausführungen eines Werkes, die voneinander abweichen. Sie sind durch Textidentität (bei Übersetzungen: durch Textäquivalenz) aufeinander beziehbar und durch Textvarianz voneinander unterscheidbar.“ Siehe zuvor die gleiche Definition ohne den auf Übersetzungen bezogenen Äquivalenzbegriff bei Siegfried Scheibe: Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe. In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Hrsg. von Gunter Martens und Hans Zeller. München 1971, S. 1–44, hier S. 17, und Siegfried Scheibe: Zum editorischen Problem des Textes. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 101, 1982, Sonderheft: Probleme neugermanistischer Edition. Besorgt von Norbert Oellers und Hartmut Steinecke, S. 12–29, hier S. 28.
268
Rüdiger Nutt-Kofoth
Das war editionskonzeptionell aber noch in Hinblick auf den Zusammenfall von Autor und Übersetzer bei mehrsprachigen Werkfassungen gedacht. Für den üblicheren Fall der – vielfach auch erst postumen – Übersetzung durch eine andere Person als den Originalautor sind nun die editorischen Kategorien von Autor, Autorisation und Authentizität neu zu justieren. Der Begriff der Textäquivalenz für den Fassungsvergleich gibt aber den wichtigen Hinweis auf die Art und Weise, in welcher der interkulturelle Texttransfer in der Edition dokumentiert werden kann. Gert Vonhoff hat 2002 die Doppelperspektive der Übersetzungsedition auch literaturtheoretisch begründet: Nicht auf das neu entstandene Werk ist hier das Augenmerk zu richten, sondern auf zwei Texte, auf die Übersetzung und auf deren fremdsprachliche Vorlage. Beide Texte sind auf das Engste miteinander verbunden, die Ausgabe hat die Aufgabe, diese Beziehung Zeile für Zeile, Vers für Vers sichtbar zu machen und in ihren beiderseitigen, sich überblendenden Bedeutungshorizonten zu erläutern. […] das materiale Artefakt ist bei Übersetzungen […] ein zweifaches, das ästhetische Objekt darum ein komplexeres als bei originären literarischen Werken. Oder anders gesagt: bei der Edition von Übersetzungen hat es der Herausgeber mit einer doppelten hermeneutischen Herausforderung zu tun.18
Allerdings ist festzuhalten, dass sich diese doppelte Herausforderung nicht gleichmäßig verteilt, sondern die Übersetzung als Zielpunkt des interkulturellen Texttransfers das primäre Editionsobjekt bildet, während der originale Ausgangstext nur eine sekundäre Funktion innehat. Das heißt für die Übersetzungsedition im Wesentlichen Folgendes: Im Zentrum der Edition steht nicht der originale Autortext, sondern der übersetzte Text. Er wird (1) nach den üblichen textkritischen Verfahren, also auch unter Anwendung eventuell nötiger Emendationen und Konjekturen, konstituiert und durch Darstellung der Textgenese bzw. seiner überlieferten unterschiedlichen Fassungen in Gänze dokumentiert, (2) aufgrund aller ermittel- und auswertbaren Dokumente mit einer Entstehungsgeschichte19 versehen sowie (3) durch einen übersetzungsspezifischen Kommentar20 erschlossen. Der originale Autortext spielt innerhalb der Textpräsentation der Edition zwar ebenfalls eine Rolle, allerdings eine, die auf das Editionsobjekt Übersetzung und die Zielsetzung der Übersetzungsedition, nämlich die Dokumentation des interkulturellen Texttransfers, ausgerichtet ist. Im Prinzip nimmt der Ausgangstext, also der das eigentliche Autororiginal repräsentierende Text, innerhalb der Übersetzungsedition die Funktion einer Quelle ein, allerdings in spezifisch aufgewerteter Form. Denn der
18
19
20
Gert Vonhoff: Wie ediert man Übersetzungen als ästhetische Objekte? Grundsätze, entwickelt an Beispielen aus Freiligraths Übersetzungen. In: Plachta/Woesler 2002 (Anm. 9), S. 435–445, hier S. 435. Siehe dazu auch die Hinweise bei Armin Paul Frank, Harald Kittel: Der Transferansatz in der Übersetzungsforschung. In: Die literarische Übersetzung in Deutschland. Studien zu ihrer Kulturgeschichte in der Neuzeit. Im Auftrag des Sonderforschungsbereichs 309 Die literarische Übersetzung hrsg. von Armin Paul Frank und Horst Turk. Berlin 2004 (Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung. 18), S. 3–67, hier S. 39–46 (Abschnitt: „Das Feststellen der übersetzerischen Fakten“). Siehe auch die für den editorischen Kommentar abgleichbaren Hinweise bei Frank/Kittel 2004 (Anm. 19), S. 46–61 (Abschnitt „Übersetzerische Transformation: Normen, Abweichungen, kulturbildendes Potential“).
Die Edition von Übersetzungen
269
Ausgangstext diente ja zum einen dem Übersetzer als – bloße – Vorlage, zum anderen ist er der eine Pol innerhalb des interkulturellen Texttransfers. In der ersteren, der reinen Quellenfunktion ordnet sich daher der originale Autortext – in der speziellen vom Übersetzer herangezogenen, also nicht unbedingt autorisierten Ausgabe – für die Edition der Übersetzung unter (resultative Perspektive), in der letzteren Funktion als Element der Texttransfer-Dokumentation ist er dagegen ein – annähernd – gleichwertiger Teil in Hinsicht auf das Editionsziel (prozessuale Perspektive). Die prozessuale Perspektive ließe sich editionstheoretisch mit Horst Turks „Konzept der ‚generischen Edition‘“ zusammenführen, das er 2002 als „Diskussionsanregung“ vorgestellt hat.21 Turks Überlegungen gründen darauf, dass „[b]ei der Edition der Übersetzung eines Textes […] primär Fragen der Interlingualität, Intertextualität, Interkulturalität, Intersozialität und Interhistorizität einschlägig“ seien.22 Das ‚Inter‘, das ‚Zwischen‘, führt nach Turk zu einer spezifischen Form der Erschließung von Übersetzungen: Dann „lägen die Hauptaufgaben des editorischen und übersetzungswissenschaftlichen Kommentars im Bereich der komparativen generischen, nicht der historischen genetischen Annotierung.“23 Das bezöge sich schließlich aber nicht nur auf Kommentar und Erläuterungen der Übersetzungsedition, sondern es ließe sich mit Turk ganz grundsätzlich an eine „generische Edition“ zu Vergleichszwecken anstelle der „genetischen Edition“ zu Autorisierungszwecken denken. Die „generische Edition“ müßte die „genetische“ nicht verdrängen, sondern diese bliebe in Kraft […]. Das Register der philologischen Verstehens- und Überzeugungsgrundlagen würde lediglich um einen temporär vernachlässigten Sektor erweitert und operativ um die erforderlichen Vorleistungen ergänzt.24
Turks Vorschläge zu den Darbietungsformen zielen auf eine „räumlich[e], nicht zeitlich[e]“ Anlage in Form von „kontrastive[n] Gegenüberstellungen“, meinen also den Präsentationsraum der Edition, der „synoptisch“ nutzbar gemacht werden soll, wobei der Edition – soweit sie 2002 auch schon elektronisch gedacht war – die „Technik der ‚windows‘ in der digitalen Aufbereitung“ empfohlen wird.25 Was dieses Konzept theoretisch anschlussfähig macht, drückt sich in Turks Formulierung aus: „Im Vordergrund stünden nicht Wort- und Sacherläuterungen, sondern Wort- und Sachverortungen“.26 Denn daraus ableitbar ist die Notwendigkeit, solche Verortungen in einen Bezug zueinander zu setzen und so die Leistungsfähigkeit und die Zielsetzungen der Übersetzungsedition prägnant zu beschreiben. Statt von der ‚generischen‘ sei hier daher vorgeschlagen von der ‚relationalen Edition‘ als besonderem Kennzeichen der Übersetzungsedition zu sprechen. Dass die Edition Bezüge, Relationen aufzeigt, gilt allemal als ein 21 22 23 24 25 26
Turk 2002 (Anm. 11), S. 20. Turk 2002 (Anm. 11), S. 14. Turk 2002 (Anm. 11), S. 18. Turk 2002 (Anm. 11), S. 19. Turk 2002 (Anm. 11), S. 19. Turk 2002 (Anm. 11), S. 19.
270
Rüdiger Nutt-Kofoth
Standardanspruch an sie. In der traditionellen Edition des originalen, authentischen Autortexts handelt es sich dabei um das Verhältnis von Texten und Varianten, von Fassungen zueinander, von Textstufen, also genetischen Elementen im Werktext. Die Übersetzungsedition mit ihrer ‚generischen‘ Grundannahme müsste solche Bezüge dann aber zum Kern ihres objektspezifischen Darstellungsanliegens machen. Die Vermittlung der Relation von Ausgangs- und Zielsprachentext, die ja auch Vonhoff zum Informationskern der Übersetzungsedition erklärt hatte,27 betrifft damit sämtliche Kategorien der Übersetzungsedition: die Textdarstellung ebenso wie diejenige der Entstehungsgeschichte, der Variantendarstellung oder der Erläuterungen. Dies sei im Folgenden erörtert.
3. Zur Editionspraxis von Übersetzungseditionen Wie die Textdarbietung für Übersetzungen, die durch literarische Autoren angefertigt worden sind, aussehen könnte, war in der Geschichte der neugermanistischen Edition nicht von Anfang an geklärt. Die Weimarer Goethe-Ausgabe als jene musterbildende historisch-kritische Ausgabe um die Schwelle zum 20. Jahrhundert demonstriert, wie in der Frühphase der neugermanistischen Edition das starke Autorkonzept die Übersetzungen ohne wesentliche Differenzierungen gegenüber den originalen Autorwerken präsentiert und somit quasi dem Autorgesamtwerk zuschlägt. So bieten etwa die Bände der Weimarer Ausgabe mit Goethes Übersetzung der Autobiografie Benvenuto Cellinis aus dem Italienischen (1890) oder derjenigen von Diderots Le neveu de Rameau als Rameau’s Neffe (1900) allein den Abdruck von Goethes Übersetzungstext und bringen nur im Apparatteil eine kurze Notiz zu Goethes Vorlage, also dem ausgangssprachigen Text des Originalautors.28 Ein halbes Jahrhundert später beschränkt Friedrich Beißners Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe mit ihrem neuartigen genetischen Darstellungsverfahren des Stufenmodells in ihrem Band zu Hölderlins Übersetzungen (1952) die Text- wie die Textgenese-Darstellung weiterhin ganz auf die Hölderlin’schen Handschriften. Hölderlins konkrete Übersetzungsvorlagen, die spezifischen Ausgaben mit dem Autortext der Ausgangssprache, spielen als Werktext weiterhin keine Rolle. Immerhin wird nun aber in den Erläuterungen dargestellt, wo Hölderlin vom ausgangssprachigen Text abweicht, ob bewusst anders formulierend oder Übersetzungsfehler begehend.29 Die Schiller-Nationalausgabe hatte in der gleichen Zeit Schillers Übersetzungen 1949 unter
27 28
29
Vonhoff 2002 (Anm. 18), S. 435. Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 133 Bände in 143. Weimar 1887–1919, Abt. I, Bd. 43. Weimar 1890, und Bd. 44. Weimar 1890, zu Goethes Übersetzungsvorlage zu Benvenuto Cellini ebd., Bd. 43, S. 381; Bd. 45. Weimar 1900, zu Goethes Übersetzungsvorlage zu Rameau’s Neffe. Ein Dialog von Diderot. Aus dem Manuscript übersetzt ebd., S. 325–327. Hölderlin: Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Im Auftrag des Württembergischen Kultministeriums hrsg. von Friedrich Beißner. 8 Bde. in 15. Stuttgart 1943–1985, Bd. 5: Übersetzungen. Hrsg. von Friedrich Beißner. Stuttgart 1952.
Die Edition von Übersetzungen
271
die Bühnenbearbeitungen gereiht, somit ihr primäres editorisches Interesse dahingehend ausgerichtet und konsequenterweise ebenfalls nur im Apparatteil eine Reihe an übersetzungsspezifischen Informationen platziert.30 Zudem lässt sie bei Turandot zwar auch nicht den Ausgangstext, wohl aber die von Schiller genutzte, in Prosa abgefasste deutsche Leitübersetzung am Seitenfuß des edierten Texts mitlaufen, um so Schillers Umsetzung in Verstext nachdrücklich sichtbar zu machen, also hier das Verhältnis zwischen seiner Übersetzung und ihrem Übersetzungsvorgänger in Gänze zu vermitteln31 – ein Verfahren, das sich für die Übersetzungsedition in dieser Art jedoch nicht durchsetzen sollte. Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe wählt dagegen mehr als drei Jahrzehnte später in ihren Übersetzungsbänden (zur Pindar- oder zur Sophokles-Übersetzung Hölderlins 1987/88 bzw. 1999) einen anderen Weg, indem sie auf der Ebene der Textkonstitution eine Mehrfachdarstellung anbietet:32 auf der linken Buchseite Hölderlins Vorlagentext, also den ausgangssprachigen Text, und auf der rechten Buchseite Hölderlins Übersetzung, also den zielsprachigen Text. Durch den Paralleldruck von Ausgangstext und Zieltext wird die Edition damit der Aufgabe gerecht, den interkulturellen Texttransfer zu dokumentieren, während die früheren Ausgaben den Text des Übersetzers auf die Ebene der Autorfunktion gehoben hatten, ohne dies durch eine durchgängige Relation zu dem den originalen Autortext repräsentierenden Ausgangstext einzuschränken. Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe wendet in ihrer Textdarstellung zudem ein weiteres Verfahren an. Sie reichert nämlich die Präsentation des Ausgangstexts auf der linken Buchseite noch durch eine deutschsprachige Interlinearversion an. Insofern bietet die Rubrik der Textpräsentation in der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe dem Benutzer zum einen die Möglichkeit, Ausgangstext und übersetzten Zieltext durch die zeilenparallele Gegenüberstellung zu vergleichen. Zum anderen erhält er aber auch noch eine Hilfe zur Bewertung der Qualität oder Eigentümlichkeit der zielsprachigen Übersetzung des literarischen Autors, indem mit der herausgeberseits hergestellten Interlinearversion eine zusätzliche wort- und syntaxgebundene ‚Rohübersetzung‘33 des Ausgangstexts als eine 30
31
32
33
Schillers Werke. Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs und des Schiller-Nationalmuseums hrsg. von Julius Petersen † und Hermann Schneider. Bd. 13: Bühnenbearbeitungen. Teil 1. Hrsg. von Hans Heinrich Borcherdt. Weimar 1949, S. 362–405 zu Shakespeares Macbeth mit Erörterungen zu Ausgangstext und Vorgängerübersetzungen; dass., Bd. 14: Bühnenbearbeitungen. Teil 2. Hrsg. von Hans Heinrich Borcherdt. Weimar 1949, S. 290–326 und S. 341–377 zu Gozzis Turandot und Shakespeares Othello. Schillers Werke, Bd. 14, 1949 (Anm. 30), S. 1–135: Turandot, Prinzessin von China. Ein tragikomisches Märchen nach Gozzi von Schiller. Unter dem Text die Übersetzung von August Clemens Werthes: Turandot. Ein chinesisches tragikomisches Märchen für die Schaubühne in fünf Akten. Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. ‚Frankfurter Ausgabe‘. Historisch-Kritische Ausgabe hrsg. von D.E. Sattler. Frankfurt a.M. [seit 1985: Basel, Frankfurt a.M.] 1975–2008, Bd. 15: Pindar. Nach Vorarbeiten von Michael Franz und Michael Knaupp hrsg. von D.E. Sattler. Basel, Frankfurt a.M. 1987; Bd. 16: Sophokles. Hrsg. von Michael Franz, Michael Knaupp und D.E. Sattler. 2. Aufl. (photomechanischer Nachdruck). Frankfurt a.M., Basel 1999 [1. Aufl. 1988]. Der Herausgeber von Hölderlin, Frankfurter Ausgabe, Bd. 15, 1987 (Anm. 32), formuliert ebd., S. 12, innerhalb der editorischen Einleitung, dass die „in dieser Form erstmals vorgelegte“ und „als Hilfsmittel gedachte[ ] Interlinearversion“ „nur gutmüthig zu lesen[ ]“ sei.
272
Rüdiger Nutt-Kofoth
weitere Relation und quasi als Brücke zwischen Ausgangs- und Zieltext bereitsteht. Dieses Verfahren der dreifachen Textdarstellung ist in der historisch-kritischen Ausgabe von Übersetzungen allerdings nicht musterbildend geworden, wohl aber hat der Parallelabdruck von Ausgangs- und Zieltext weiten Einzug in die historisch-kritischen Ausgaben gehalten, etwa in die Droste-Hülshoff-Ausgabe bei der Darbietung der Übersetzungsübungen Drostes (im Band mit den nachgelassenen Gedichten 1994).34 Auch das elektronische Medium ist für die parallele Präsentation von Ausgangssprachentext und Zielsprachentext im Falle der Übersetzung durch einen literarischen Autor genutzt worden, nämlich 2011 von der Wolfenbütteler Lessing-Akademie für Lessings Übersetzungen.35 Allerdings beschränkt sich deren gesamte Darbietung auf die bloße Parallelisierung von Ausgangstext und Übersetzung. Die historisch-kritische Übersetzungsedition steht hingegen vor der Herausforderung, die Relation der Übersetzung zum Ausgangstext in breitem Maße detailliert aufzuzeigen.36 Das betrifft schon die Feststellung des Vorlagentextes, also der Ausgabe, die der Übersetzer benutzte, was Winfried Woesler 2002 als „die wichtigste und nicht selten schwierigste Aufgabe“ der Übersetzungsedition beschrieben hat.37 Wie die Frage des korrekten Vorlagentextes und jene der in der Edition ebenfalls zu dokumentierenden, vom Übersetzer hilfsweise herangezogenen, früheren Übersetzungen ineinandergreifen, hat Burghard Dedner 2012 an Beispielen aus der Edition von Georg Büchners Victor-Hugo-Übersetzungen Lucretia Borgia und Maria Tudor in der Marburger Büchner-Ausgabe vorgeführt.38 Ein anschaulicher Fall zeigt, wie problematisch es sein kann, Textfehler (also etwa Setzerfehler im autorisierten Druck der Übersetzung), die die Marburger Büchner-Ausgabe emendiert, von Fehlern des Übersetzers, die die Ausgabe nicht behebt, zu unterscheiden. In Hugos Ausgangstext steht im Kontext der Diffamierung einer Figur die Formulierung: „dans les ruisseaux“, was mit ‚in den Gossen‘ zu übersetzen wäre. Im autorisierten Druck von Büchners Übersetzung heißt es an dieser 34
35
36
37 38
Annette von Droste-Hülshoff: Historisch-kritische Ausgabe. Werke, Briefwechsel. 14 Bde. in 28. Hrsg. von Winfried Woesler. Tübingen 1978–2000, Bd. II,1: Gedichte aus dem Nachlaß. Text. Bearb. von Bernd Kortländer. Tübingen 1994, S. 247–311. Lessings Übersetzungen. Hrsg. von der Lessing-Akademie Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2011 (Editiones Electronicae Guelferbytanae. 8), http://diglib.hab.de/edoc/ed000146/start.htm, und https://www.lessingakademie.de/uebersetzungen (beide gesehen 6.7.2022). Auf die wichtige Differenz von ‚Original‘ und Ausgangstext als der vom Übersetzer konkret genutzten Vorlage weisen hin Frank/Kittel 2004 (Anm. 19), S. 7, mit der resümierenden Feststellung ebd.: „Das heißt, daß kompetente Übersetzungsanalyse kompetente Textkritik voraussetzt.“ Woesler 2002 (Anm. 11), S. 33. Burghard Dedner: Intertextual Layers in Translations. Methods of Research and Editorial Presentation. In: Variants 9, 2012: Texts beyond Borders. Multilingualism and Textual Scholarship. Hrsg. von Wout Dillen, Caroline Macé und Dirk Van Hulle, S. 115–131; das folgende Beispiel ist ebd., S. 125–128, vorgestellt. Zu dem Beispiel s. auch die ganz knappe Darlegung bei Burghard Dedner: Die Ordnung editorischer Darstellungen. Ein Vorschlag. In: editio 22, 2008, S. 60–89, hier S. 83f., sowie ausführlich die Edition selbst: Georg Büchner: Sämtliche Werke und Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit Quellendokumentation und Kommentar (Marburger Ausgabe). Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, hrsg. von Burghard Dedner. Mitbegründet von Thomas Michael Mayer. Bd. 4: Übersetzungen. Hrsg. von Burghard Dedner unter Mitarbeit von Arnd Beise, Gerald Funk, Ingrid Rehme und Eva-Maria Vering. Darmstadt 2007, S. 52,32 und 53,32 sowie S. 319 und 380.
Die Edition von Übersetzungen
273
Stelle aber: „in den Gassen“, was die Rufschädigung der Figur weniger schwer erscheinen lässt. Die Marburger Editoren vermuteten zunächst eine Verlesung des Setzers in der verlorenen, an dieser Stelle eventuell nicht ganz sauber geschriebenen handschriftlichen Satzvorlage von ‚o‘ in ‚Gossen‘ zu ‚a‘ für ‚Gassen‘, sodass zu emendieren wäre. Dann aber fanden sie in einer anderen vor Büchners Übersetzung erschienenen zeitgenössischen Übersetzung an dieser Stelle ebenfalls ‚Gassen‘, ja ermittelten bei genauerer Betrachtung dieser anderen Übersetzung sogar weitere Übereinstimmungen zwischen Büchners und der anderen Übersetzung. Das führte zur Schlussfolgerung, dass Büchner diese andere Übersetzung wahrscheinlich als Hilfsmittel benutzt habe, was wiederum bedeutete, dass Büchner an der in Rede stehenden Stelle bewusst ‚Gassen‘ übersetzte, es sich daher um eine autorisierte Formulierung des Übersetzers Büchner in Anlehnung an eine andere Übersetzung und nicht um einen Setzerfehler handelt. Deshalb haben die Marburger Editoren bei der Textkonstitution des Büchner-Texts an dieser Stelle nicht eingegriffen. Der Übersetzungen-Band der Marburger Büchner-Ausgabe darf als das wohl ambitionierteste editorische Unternehmen jüngeren Datums für Übersetzungen durch literarische Autoren gelten. In methodischer Hinsicht ließe sich daraus ein Muster ableiten, obwohl die Edition zum einen als Buchausgabe angelegt ist, also Darstellungsmöglichkeiten des digitalen Mediums nicht einbezieht, und zum anderen aus der Sachlage der Überlieferung ihres Objekts eine wichtige und darstellungstechnisch aufwändige editorische Kategorie nicht bedienen muss. Da nämlich keine Handschriften Büchners zu seinen Übersetzungen überliefert sind, entfällt für die Marburger Ausgabe die Darbietung von Entstehungsvarianten bzw. die Darstellung des textgenetischen Übersetzungsprozesses. Zu allen anderen Bereichen einer Übersetzungsedition gibt es allerdings ausführliche, hochdetaillierte Einlassungen. In einem sich über mehr als 110 großformatige Seiten erstreckenden Editionsbericht zu Büchners zwei Hugo-Dramen-Übersetzungen werden sämtliche hier notwendigen thematischen Bereiche behandelt. Sie lassen sich folgendermaßen für die historisch-kritische Übersetzungsedition verallgemeinern:39 – Grundzüge der Rezeption des übersetzten Autors in Deutschland bis zur Entstehung der edierten Übersetzungen, – Vorbereitungen und Verlauf der deutschen Werkausgabe des Originalautors, zu der der Übersetzer seine Übersetzungen beisteuerte, – Kenntnisse des Übersetzers von der Sprache des Ausgangstexts sowie der Literatur der Ausgangssprache, – Entstehungsgeschichte der edierten Übersetzung, – Erörterungen zur konkreten fremdsprachigen Vorlage der Übersetzung, zu den vom Übersetzer benutzten Wörterbüchern und anderen möglichen Vorlagen, – Ermittlung von zeitgenössischen Übersetzungen in die Zielsprache als zusätzliche Hilfsmittel des Übersetzers, 39
Siehe vergleichend Büchner, Marburger Ausgabe, Bd. 4, 2007 (Anm. 38), S. 239f.
274
Rüdiger Nutt-Kofoth
– differenzierte Darstellung von sprachlichen Besonderheiten der edierten Übersetzung, – Erörterung von Textauslassungen gegenüber dem Ausgangstext, – Bemerkungen zur Orthografie der Übersetzung, – schließlich ein ausführlicher textkritischer Abschnitt hinsichtlich der Frage von Fehlern und Emendationen unterschiedlichsten Typus, – gefolgt von einem Abschnitt zur zeitgenössischen Rezeption der edierten Übersetzung. An den Editionsbericht im Übersetzungen-Band der Marburger Büchner-Ausgabe schließen sich gute 100 Seiten Erläuterungen zu den beiden edierten Dramenübersetzungen an, die für auffällige Einzelstellen die Relation der fremdsprachigen Vorlage des Übersetzers zu seiner Übersetzung unter genauem Einbezug der vom Übersetzer als Hilfsmittel herangezogenen bzw. vermutlich herangezogenen zeitgenössischen deutschen Übersetzungen des Ausgangssprachentexts aufzeigen. Übersetzungsspezifische Einzelstellenerläuterungen hatten aus den oben vorgestellten Editionen für ihre Übersetzungsbände keineswegs sämtliche, aber durchaus die Stuttgarter HölderlinAusgabe oder die Droste-Hülshoff-Ausgabe – und in Teilen auch die Schiller-Nationalausgabe – zum Kern ihres Erläuterungsverfahrens gemacht.40 Wie eine diesbezügliche Lösung für Lessings Übersetzungen aussehen könnte, hat die Einzelausgabe zu Lessings Diderot-Übersetzungen 2014 vorgeführt, die den Paralleldruck von Ausgangs- und Zieltext ebenfalls durch eine Reihe an übersetzungsspezifischen, aber durchaus auch andere Sachverhalte einbeziehenden Einzelstellenerläuterungen begleitet.41 Im Editionsbericht der Marburger Büchner-Ausgabe ist die spezifizierte Aufgabe der Einzelstellenerläuterungen einer historisch-kritischen Übersetzungsedition gegenüber derjenigen von Einzelstellenerläuterungen zu originalen Werken des literarischen Autors besonders prägnant – und editionsmethodisch exemplarisch – als fokussierter Blick auf die individuelle wie epochenspezifische sprachliche Gestaltung der Übersetzung formuliert. Daher sei folgendes längeres Zitat erlaubt: Anders als bei Büchners selbständigen Werken sollen die Stellenerläuterungen in diesem Band nicht dazu beitragen, den zeitgenössischen Verstehenshorizont der Dramen zu rekonstruieren. Vielmehr werden die hier edierten Texte in ihrer Qualität als Übersetzungen kommentiert, das heißt: die Erläuterungen weisen auf Spezifika der Übertragung hin. Hierzu gehören lexikalische, grammatische oder semantische Schwierigkeiten oder Eigenarten der französischen Vorlage und deren Umsetzung in die deutsche Sprache. Um einen Eindruck 40
41
Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 5, 1952 (Anm. 29). – Droste-Hülshoff (Anm. 34), Bd. II,2: Gedichte aus dem Nachlaß. Dokumentation. Bearb. von Bernd Kortländer. Tübingen 1998, S. 969–980, 985f., 995–999, 1006f. – Zur Schiller-Nationalausgabe s. Anm. 30. Das Theater des Herrn Diderot. Zweisprachige, synoptische Edition von Denis Diderots „Le Fils naturel“ (1757) und „Le Pere de famille“ (1758) sowie den „Entretiens sur Le Fils naturel“ und dem Essay „De la Poésie dramatique“ in der Übersetzung Gotthold Ephraim Lessings (1760). Hrsg. und kommentiert von Nikolas Immer und Olaf Müller. St. Ingbert 2014 (Literatur im historischen Kontext. 6); die Einzelstellenerläuterungen ebd., S. 674–707, ein Überblickskommentar ebd., S. 708–735.
Die Edition von Übersetzungen
275
von Büchners Übersetzungsleistung zu gewinnen, haben wir sie beständig mit anderen zeitgenössischen Übersetzungen verglichen. Nur durch diesen Vergleich konnten außerdem die möglichen Leitübersetzungen ermittelt werden, an denen Büchner sich bei seiner Übersetzung orientierte […]. / Die Dokumentation der vergleichbaren Lösungen anderer Übersetzer nimmt in den Erläuterungen den größten Raum ein. Dabei stehen die von Büchner vermutlich eingesehenen Übersetzungen […] an erster Stelle; nur in Einzelfällen werden auch die als sekundär eingeschätzten Übersetzungen […] berücksichtigt, wenn deren Wiedergabe einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn für die Einschätzung von Büchners Übersetzungsarbeit bot. […] / Büchners Übersetzungen bewahren gelegentlich einen zeitgenössisch schon veralteten Sprachstand, und einzelne Wendungen wirken deshalb heute als möglicherweise fehlerhaft. Derartige Wendungen werden außer durch lexikalische Hinweise durch Vergleiche mit literarischen Werken anderer Autoren erläutert, und zwar unabhängig davon, ob diese von einem prägenden Einfluß auf Büchner waren oder nicht. In diesen Fällen dienen die Vergleichsbeispiele dazu, die Verbreitung bestimmter Sprachformen oder deren speziellen Status in der literarischen Sprache zwischen Aufklärung und Vormärz aufzuzeigen. In manchen Fällen werden Vergleichsstellen aber auch angegeben, um die Prägung von Büchners literarischer Sprache durch bestimmte Vorbilder zu zeigen, wobei hier wie auch sonst vor allem an Goethe, Shakespeare, Jean Paul, Tieck und einzelne Romantiker zu denken ist.42
4. Zu den Rahmen einer historisch-kritischen Edition des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Übersetzungskomplexes Solchermaßen gesetzte Standards für die historisch-kritische Übersetzungsedition bündeln sich im Konzept einer übersetzungsspezifischen relationalen Edition und ließen sich auf Wünsche an eine derartige Edition der Schlegel-Tieck’schen ShakespeareÜbersetzung übertragen. Deren historischer Überlieferungsrahmen bringt allerdings noch weitere Spezifika ins Spiel. So wäre eine solche Edition ganz eigenständig und nicht in eine Gesamtwerkedition des bzw. der Übersetzer eingebunden. Denn erstens ist allein umfangsmäßig eine solche Edition selbst schon vielbändig (pragmatisches Argument), und zweitens sind an ihr mehrere Übersetzer beteiligt, zu denen zum einen (zu August Wilhelm Schlegel sowie Ludwig Tieck) ein je eigenes Gesamtwerk vorliegt, zu denen zum anderen (zu Wolf Heinrich von Baudissin und Dorothea Tieck) eine Gesamtwerkedition sachlich und literaturgeschichtlich nicht realistisch sein dürfte, also auch vor diesem Hintergrund der einzelne Übersetzer als Rahmengeber der Edition nicht greifen kann, stattdessen diese Begrenzungsfunktion vom Ausgangssprachenautor und vor allem vom Ausgangssprachenwerk gesteuert wird, obwohl das primäre Editionsobjekt die Übersetzung ist (literaturtheoretisches Argument). Daher zeigt ein Fall wie der Schlegel-Tieck’sche Shakespeare-Übersetzungskomplex exemplarisch, wie die Übersetzung als Editionsobjekt weniger abhängig von der das Literatursystem vielfach ordnenden Autorfunktion ihren Ort gewinnt.
42
Büchner, Marburger Ausgabe, Bd. 4, 2007 (Anm. 38), S. 350f.
276
Rüdiger Nutt-Kofoth
Für jedes übersetzte Shakespeare-Drama wünschenswert wären detaillierte Einzelstellenerläuterungen, die die Intensität des Bezugs zum fremdsprachigen Vorlagentext wie zu den vorhandenen und von den Übersetzern mitbenutzten deutschsprachigen Shakespeare-Dramen-Übersetzungen nach den Kriterien von Übernahme und Abweichung abwägen würden. Was hier für die Frage der eigentümlichen Übersetzungsleistung im Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Komplex an sprach- und literaturgeschichtlicher Erkenntnis zu gewinnen ist, hat Peter Gebhardt schon 1970 monografisch am Beispiel des Hamlet eingehend vorgeführt.43 Neben der genauen Ermittlung der fremdsprachigen Vorlagen der Übersetzung (etwa die Ausgaben von Malone oder von Johnson und Steevens)44 und ihres Einbezugs auf der Textdarstellungsebene wäre auch zu beschreiben, in welchem Verhältnis die Schlegel-Tieck’schen – in der Regel – Blankvers-Übersetzungen zu ihren großen Vorgängern, den zuallermeist in Prosa vorgenommenen Shakespeare-Übersetzungen von Wieland (1762–1766) und Eschenburg (1775– 1777/1782), stehen.45 Dies könnte auf der Textdarstellungsebene sowie stellenspezifisch auf derjenigen der Erläuterungen geschehen. Die Präsentation von Text und Varianten bzw. der Textgenese müsste genau bedacht werden, denn es liegt eine Reihe an Entstehungshandschriften vor.46 Eine Edition
43
44
45
46
Peter Gebhardt: A. W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257), bes. S. 143–254. Überblicke und bibliografische Verzeichnungen zu den englischsprachigen Shakespeare-Ausgaben finden sich bei Andrew Murphy: Shakespeare in Print. A History and Chronology of Shakespeare Publishing. Second Edition. Cambridge 2021. Verzeichnet bei Blinn/Schmidt 2003 (Anm. 4), S. 25–29. Zu den Anfängen der Shakespeare-Philologie in Deutschland s. Michael Hiltscher: Shakespeares Text in Deutschland. Textkritik und Kanonfrage von den Anfängen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Frankfurt a.M. u.a. 1993 (Münsteraner Monographien zur englischen Literatur. 12), S. 10–56. Zu den Ausgaben von Wieland und Eschenburg siehe auch Norbert Greiner: Shakespeare und seine Übersetzer. In: Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760–1820. Epoche im Überblick. Hrsg. von Horst Albert Glaser und György M. Vajda. Amsterdam, Philadelphia 2001 (A comparative history of literatures in European languages. 14), S. 613–632, hier S. 623–627. Zur Wieland-Übersetzung siehe „Shakespeare, so wie er ist“. Wielands Übersetzung im Kontext ihrer Zeit. Hrsg. von Peter Erwin Kofler. Heidelberg 2021 (Wieland im Kontext. Oßmannstedter Studien. 7). Zur Eschenburg-Übersetzung s. Carolin Roder: Der treue Sammler: Eschenburg und die Tücken der Shakespeare-Übersetzung. In: Johann Joachim Eschenburg und die Künste und Wissenschaften zwischen Aufklärung und Romantik. Netzwerke und Kulturen des Wissens. Hrsg. von Cord-Friedrich Berghahn und Till Kinzel. Heidelberg 2013 (Germanisch-romanische Monatsschrift. Beiheft 50), S. 267–282; siehe auch Claudia Olk: „die angenehmsten, lehrreichsten Geschäfte und Erholungen meines Lebens“. J.J. Eschenburg und der deutsche Shakespeare. In: Kofler 2021 (s.o.), S. 297–318. Die Variantenfrage ist schon früh aufgeworfen worden; s. Michael Bernays: Zur Entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare. Leipzig 1872. – Schon Gebhardt 1970 (Anm. 43), S. 141f., hat ausgehend von Schlegels Hamlet-Übersetzung gefordert: „Der kritische Herausgeber sollte mit dem Text des deutschen Shakespeare umgehen[ ] wie mit einer Originaldichtung der deutschen Sprache. Das Ideal wäre eine Edition, die Schlegels Werk als Übersetzung Shakespeares und zugleich als eigenständigem Kunstwerk gerecht wird. Dies würde bedeuten: eine zweisprachige historisch-kritische Ausgabe zu veranstalten, die Schlegels englische Vorlage und seinen historisch-kritisch durchgesehenen Übersetzungstext abdruckt. Der kritische Apparat dieser Edition hätte zu verzeichnen: alle im Text selbst nicht
Die Edition von Übersetzungen
277
von Schlegels Hamlet-Manuskript im reduzierten Darstellungsverfahren von Faksimile und Transkription hat Kaltërina Latifi 2016 erstellt;47 es müsste überlegt werden, wie eine solche Darbietung des Handschriftentexts für eine historisch-kritische Edition um die textuellen Darstellungsebenen ‚Textgenese‘ und ‚Lesetextfassung‘ erweitert werden kann. In den Blick kommen müssten auch Frühfassungen der Shakespeare-Übersetzung, etwa Schlegels mit Bürger entworfene Fassung des Sommernachtstraums (1789), die er später in Abkehr von Bürgers Übersetzungsvorstellung vollständig revidierte.48 Daneben müssten aber auch die Druckvarianten der verschiedenen Ausgaben innerhalb des Schlegel-Tieck’schen Shakespeare-Komplexes angemessen berücksichtigt werden, also die unvollständig gebliebene Ausgabe von Schlegel (1797–1801/1810, abgebrochen nach Bd. 9,1, Nachdrucke 1818 und 1823), dann die erste Ausgabe des Schlegel-Tieck’schen Shakespeares (1825–1833) mit den Ergänzungen von Übersetzungen weiterer Dramen durch Baudissin und Dorothea Tieck und den Eingriffen Ludwig Tiecks in den Text der Schlegel-Übersetzungen, schließlich deren Neuausgabe (1839/40; in weiteren Ausgaben noch zu Lebzeiten Schlegels und Tiecks, schließlich 6. Ausgabe 1863–1865), die unter anderem wegen der Frage, wie Ludwig Tieck mit Schlegels Kritik an den Eingriffen in den Schlegel’schen Übersetzungstext der ersten Ausgabe umgegangen ist, textgenetisch von Bedeutung ist.49 Die Entstehungsgeschichte sollte dann diese Sachlagen diskursiv beschreiben und z.B. deutlich machen, welche Rolle der Verleger Reimer für die beiden Schlegel-TieckAusgaben spielte, nämlich etwa die des vor dem Hintergrund einer einsetzenden Shakespeare-Übersetzungsflut nachhaltig an den beiden großen Romantikernamen Schlegel und Tieck als Aushängeschild interessierten Motivators. Dabei steuerte Schlegel letztlich – bis auf die Wiederabdruckerlaubnis der von ihm in seiner früheren Ausgabe dargebotenen Übersetzungen – keine Leistung mehr bei und auch Ludwig Tieck brachte keine eigenen Übersetzungen ein, fungierte aber für die Übersetzungen nicht namentlich genannter Übersetzer (Baudissin, Dorothea Tieck) als korrigierende Schlussinstanz
47
48
49
abgedruckten Varianten des Manuskripts und der zu Schlegels Lebzeiten erschienenen Ausgaben seiner Übersetzung.“ August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100). Die Edition enthält zudem eine Entstehungsgeschichte (ebd., S. 377–390) und druckt Dokumente zur Entstehungsgeschichte ab (ebd., S. 391–407). Dazu existiert eine eigene Edition: A. W. Schlegels Sommernachtstraum in der ersten Fassung vom Jahre 1789. Nach den Handschriften hrsg. von Frank Jolles. Göttingen 1967 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 244). Zum Spektrum der Shakespeare-Philologie Ludwig Tiecks siehe Hiltscher 1993 (Anm. 45), S. 57–178.
278
Rüdiger Nutt-Kofoth
der Ausgabe.50 Einer solchen Darstellung dürfte ein kompakter exemplarischer Einblick in das zeitgenössische literarische Feld (sensu Bourdieu)51 bzw. die Bedingungen des zeitgenössischen Literaturbetriebs für Übersetzungen gelingen. Wenn die Darstellung all dieser Sachverhalte noch durch einen Überblickskommentar zur Geschichte der Shakespeare-(Dramen-)Übersetzung in Deutschland und zu den Übersetzungskonzeptionen der Romantiker, an denen sich gerade Schlegel intensiv beteiligte, bereichert würde, ließe sich eine solche Edition als Teil der Grundlagenforschung zu einem der wirkmächtigsten Fälle in der Geschichte der deutschsprachigen literarischen Übersetzung verstehen – einem Fall, den Friedmar Apel schon 1983 als „das dichteste Paradigma“ bezeichnet hat, „von dem aus eine Modellvorstellung für eine umfassende Geschichte der Übersetzung in Deutschland gewonnen werden kann.“52 Zugleich wäre eine solche Edition ein Baustein für die übersetzungstheoretische wie übersetzungsgeschichtliche Perspektive auf die „Instabilität der zielsprachigen Texte“,53 denn allein in dem in Rede stehenden Zeitraum der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht von Wielands über Eschenburgs bis zu Schlegel-Tiecks Shakespeare-Übersetzung, die ja zudem durch eine ganze Reihe weiterer begleitet wurden, eine immense Variationsbreite des deutschen Shakespeare-Dramentexts. Darüber hinaus könnte eine derartige Edition auch eine Antwort der Grundlagenforschung auf die noch allerjüngst geäußerte Klage über „die Vernachlässigung der Übersetzungsliteratur durch die kulturwissenschaftliche Germanistik“ sein, die begleitet ist von der Forderung nach der Behandlung von Übersetzungen als „Texte[n] eigenen Rechts […], die hermeneutische, ästhetische, epistemische und historische Spezifika aufweisen“.54 Und schließlich ließe sich in solchem Zusammenhang das Wirkungspotenzial einer so-
50
51
52 53 54
Siehe dazu die verschiedenen Überblicke: Kenneth E. Larson: The Origins of the „Schlegel-Tieck“ Shakespeare in the 1820s. In: The German Quarterly 60, 1987, Nr. 1, S. 19–37. – Christine Roger: Von „bequemen und wohlfeilen Nebenbuhlern“: die ‚Schlegel-Tiecksche‘ Shakespeare-Übersetzung und die Konkurrenz. In: „lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn! –“. Ludwig Tieck (1773–1853). Hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin unter Mitarbeit von Heidrun Markert. Bern u.a. 2004 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge. 9), S. 277–296. – Stefan Knödler: „Am Shakespeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Jansohn u.a. 2015 (Anm. 8), S. 33–48. – Christa Jansohn, Bodo Plachta: „Blicken wir in die Originalausgabe!“. Michael Bernays als „Anwalt“ von Goethe und Shakespeare. In: editio 35, 2021, S. 120–141, hier S. 128–135. Vgl. auch den Beitrag von Paulin in diesem Band. Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Übersetzt von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt a.M. 1999; französisch 1992 als Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Friedmar Apel: Literarische Übersetzung. Stuttgart 1983, S. 72. Jansohn in Jansohn/Plachta 2021 (Anm. 50), S. 140. Regina Toepfer: Translationsanthropologie. Philologische Übersetzungsforschung als Kulturwissenschaft. Mit einer exemplarischen Analyse der ersten deutschen Odyssee von Simon Schaidenreisser (1537/38). Hannover 2022 (Neue Perspektiven der Frühneuzeitforschung. 7), S. 9 und 12.
Die Edition von Übersetzungen
279
mit intensivierten Übersetzungsforschung auch in Hinblick auf eine literaturgeschichtliche Perspektive bedenken, die schon vor zwei Jahrzehnten in Anschlag gebracht wurde: Literarische Übersetzung und Literatur – oder, wenn man so will, übersetzte und unübersetzte Literatur – sind zwar nicht dasselbe, tragen aber in ihrem Zusammenwirken eine internationale Dynamik solchen Ausmaßes und solcher Stärke in die Nationalliteraturen hinein, daß sich die Frage aufdrängt, ob es von der Sache her überhaupt gerechtfertigt ist, so etwas wie eine nationale Geschichte einer Nationalliteratur zu schreiben, also eine, die die internationalen Verflechtungen programmatisch ausschließt oder praktisch kappt. Schon möglich, daß sich die Literaturhistoriker aller Länder vereint von einer Fiktion haben blenden lassen.55
55
Frank/Kittel 2004 (Anm. 19), S. 61.
Katrin Henzel
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises
Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises1 digital zu edieren, stellt ein voraussetzungsreiches und komplexes Unterfangen dar. Der vorliegende Beitrag soll dazu dienen, mögliche Ansprüche in Form von Mindestanforderungen an ein solches Projekt zu formulieren. Es soll also kein konkretes Editionsmodell vorgestellt werden – dies wäre nur in interdisziplinärer Teamarbeit mit der jeweils notwendigen Spezialisierung realisierbar. Vielmehr geht es in diesem Beitrag darum, sich einem solchen Editionsplan zu ShakespeareÜbersetzungen der deutschsprachigen Frühromantik in ersten Überlegungen konzeptionell anzunähern und Formen möglicher Zugangs- und Präsentationsweisen aufzuzeigen. Meine Grundannahme lautet, dass in einer solchen digitalen Edition von Shakespeare-Übersetzungen nicht ein einzelner festgelegter Text im Mittelpunkt steht, sondern sich die Edition aus mehreren gleichberechtigten Teilen modulartig zusammensetzt. Diese Teile lassen sich wiederum berechtigt als Editionen oder Teileditionen bezeichnen. Man sollte entsprechend nicht von einer oder gar der digitalen2 Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises sprechen. Diese Meta-Edition bzw. unter einem Dach verschiedene Editionen versammelnde Gesamt-Edition3 sollte dynamisch gestaltet sein, die Nutzerinteressen stark in den Mittelpunkt stellen und den Nutzern mehr Gestaltungs- und Auswahlrechte ermöglichen. Grundlegend hierfür sind, wie zu zeigen sein wird, die Schnittstellen (Interfaces): „Gerade bei Digitalen Editionen hat [einerseits, KH] die Benutzerschnittstelle (User Interface) einen wesentlichen Einfluss auf die subjektive 1
2
3
Zur verbreiteten, aber sachlich falschen Kurzbezeichnung einer bzw. „der ‚Schlegel-Tieckschen‘ Übersetzung“ Stefan Knödler: „Am Shakspeare ist weder für meinen Ruhm noch meine Wissenschaft etwas zu gewinnen“. August Wilhelm Schlegels Shakespeare nach 1801. In: Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn unter Mitarb. von Werner Habicht, Dieter Mehl und Philipp Redl. Mainz, Stuttgart 2015 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2015, Nr. 2), S. 33–48, hier S. 45; sowie Claudia Bamberg: Prolegomena zu einer künftigen Edition der Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und dem Tieck-Kreis. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 256, 2019, H. 2, S. 421–435, hier S. 423; und auch schon Michael Bernays: Der Schlegel-Tieck’sche Shakespeare. In: Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 1, 1865, S. 396–405, hier S. 396. Es ist wünschenswert, eine solche Edition vorrangig als historisch-kritische zu modellieren. In meinem Beitrag denke ich daher, wenn ich von der digitalen Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises spreche, diese als historisch-kritische. Claudine Moulin sprach in ihrem Vortrag im Rahmen dieses Sammelbandes von einem Forschungsportal.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-019
282
Katrin Henzel
Wahrnehmung der Qualität einer Anwendung“.4 Andererseits „sind die APIs (Application Programming Interfaces) von großer Bedeutung, da so Daten auch automatisiert abgefragt und ausgetauscht werden können.“5 Das heißt, die Schnittstellen sind sowohl für das Funktionieren von Abläufen innerhalb der Edition, für die Anwendung (durch die Nutzer) als auch für die Kommunikation nach außen zu anderen Portalen, Projekten usw. (man denke insbesondere an die Verknüpfung mit Standardformaten und -daten wie z.B. aus der GND) unverzichtbar.6
1. Konzeptionelle Annäherungen Eine digitale Edition ist im Gegensatz zu einer gedruckten nicht sofort in ihrem Umfang erkennbar, im wörtlichen Sinn nicht greifbar. Umso wichtiger sind für eine digitale Edition Orientierungshilfen und eine geschickte Nutzerlenkung. Ein großer Vorteil ist es im digitalen Medium zwischen verschiedenen Ebenen wechseln zu können. Bewährt hat sich beispielsweise für genetische Ausgaben eine schon visuell leichter fassbare Zweiteilung in Mikro- und Makroebene.7 Auf der Mikroebene lassen sich Textvarianten innerhalb eines festgelegten Ausschnitts (z.B. einer Szene oder einer Figurenrede im Drama) darstellen, wobei man auf im Druck etablierte Visualisierungsformen wie den Stufenapparat zurückgreifen kann, der bekanntlich von Beißner zwar für größere Textzusammenhänge (also die Makrogenese) entwickelt wurde, sich aber gerade für die Mikrogenese (man denke insbesondere an die Heym-Ausgabe)8 als praktikabel erwiesen und durchgesetzt hat.9 Die Makroebene dient hingegen als Übersicht aus einer Vogelperspektive, in der Regel über einen gesamten Text oder das gesamte in einer 4
5 6
7
8
9
Lisa Rieger: Interface. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. von Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“, https://gams.unigraz.at/o:konde.98 (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 13.1.2023 gesehen), Abs. 3. Rieger 2021 (Anm. 4), Abs. 3. Zu Interfaces in Editionen bzw. Editionen als Interfaces s. den Band: Digital Scholarly Editions as Interfaces. Hrsg. von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber und Gerlinde Schneider. Norderstedt 2018, https://kups.ub.uni-koeln.de/9085/. Vgl. diese Unterscheidung in der Faust-Edition, insbesondere für den Teilbereich Genese, http://faustedition.net/genesis. Dirk Van Hulle unterscheidet in der Analyse von Schreibprozessen (allerdings für Digital-Born-Dokumente) sogar diese vier Dimensionen: Megagenesis, Macrogenesis, Microgenesis und Nanogenesis. Dirk Van Hulle: Genetic Criticism. Tracing Creativity in Literature. Oxford 2022, S. 177–192. Hierzu ausführlich Gunter Martens: Textdynamik und Edition. Überlegungen zur Bedeutung und Darstellung variierender Textstufen. In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Hrsg. von Gunter Martens und Hans Zeller. München 1971, S. 165–201. Vgl. hierzu Katrin Henzel: Genetische Edition. In: edlex. Online-Editionslexikon. Unter Redaktionsleitung von Roland S. Kamzelak. 2017ff., Art. Online seit 5.2.2018, Forschungsbericht, Abs. 1, https://edlex.de/index.php?title=Genetische_Edition#Forschungsbericht. Prinzipiell reizvoll und wünschenswert wäre aber eine stärkere Loslösung von traditionellen Darstellungsmethoden wie den etablierten Apparatformen und – in Abhängigkeit des Forschungsgegenstands und der Ziele einer Edition – die Entwicklung neuer Präsentationsweisen, die sich stärker vom Seitenformat zu lösen wissen.
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
283
Edition bereitgestellte Material. Von dieser Ebene lässt sich dann in einzelne Bereiche wie Texte/Textsegmente bis zur Mikroebene hineinzoomen. Darstellungen auf der Makroebene eignen sich insbesondere als heuristisches Instrument für die Einstiegsseite, um Nutzer einer Edition gezielt in interessante Bereiche zu lenken oder aber ihnen überhaupt eine Übersicht (ein ‚Gefühl für das Ganze‘) all dessen zu geben, was eine digitale Edition an Materialien bereitstellt. Eine besondere Hürde liegt darin, den Wechsel zwischen der Mikro- und Makroebene ‚sanft‘ zu gestalten: Die Nutzer sollten zu jeder Zeit die Orientierung innerhalb der Edition behalten und sicher navigieren können. Bezogen auf die Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises stellt sich daher die für mich erste und dringlichste Frage, wie sich das Material in einer digitalen Edition strukturieren und anordnen lässt. Vorgeschlagen werden drei Perspektiven auf den Editionsgegenstand als Form des Zugangs und der Anordnung des Materials: 1. die Sicht auf die Texte und ihre Bezüge zueinander, d.h. eine intertextuelle Sicht, 2. die Sicht auf die am Übersetzungsmarkt Beteiligten, d.h. eine literatursoziologische Perspektive, sowie 3. die Sicht auf die Gattung – das Drama – und ihren Aufführungscharakter und Wirkungskontext. Diese Perspektiven sollen dazu dienen, einen optimalen Einstieg in die Edition zu erhalten. Je nach Forschungsinteresse spielen hier selbstredend unterschiedliche Fragestellungen und Methoden eine Rolle. Unabhängig von diesen Perspektiven (es sind lediglich Vorschläge) lässt sich das Material in der Edition grundsätzlich auch über die ‚konventionellen‘ Wege der Archivsicht und des Lesetexts bereitstellen, doch sollte diese Anordnung eher als zusätzliches denn als alleiniges Zugangsangebot gedacht sein (vorrangig in Form einer von den Nutzern durchführbaren Suche als Datenbankabfrage), da 1. die Suche nach Bestandshaltern i.d.R. nicht primäres Forschungsinteresse, sondern einer thematischen Frage untergeordnet ist, und 2. im Fall der Shakespeare-Übersetzungen noch nicht einmal klar ist, was der Lesetext denn überhaupt sei. Die folgenden drei vorgestellten Perspektiven stellen somit ein inhaltlich geordnetes Gefüge der ausgesprochen komplexen Materiallage der Übersetzungen Shakespeares durch ‚Schlegel-Tieck‘ dar.
1.1 Intertextualität Für literarische Übersetzungen liegt es nahe, die Grundunterscheidung zwischen ‚Original‘ und ‚Übersetzung‘ zu treffen. Diese beiden Begriffe sind jedoch nicht unproblematisch. So kann bei der Überlieferung der Texte Shakespeares schwerlich von Originaltexten gesprochen werden, sind sie uns doch nicht in Handschriften des Autors überliefert. Auch ist die Übersetzung nur ein Teilaspekt der Beziehung zwischen Shakespeares Texten und deren deutschsprachiger Herausgabe. Denn es handelt sich im Fall der sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘-Übersetzung nicht nur um eine Übersetzung, sondern zugleich um eine literarische Adaptation. Daher bevorzuge ich gegenüber den Begriffen ‚Original‘ und ‚Übersetzung‘ die von Genette geprägten Kategorien ‚Hyper-‘ und ‚Hypotext‘. Hypertextualität stellt bekanntlich eine besondere Form von Text-Text-
Hypotext Shakespeares
Hypertext Schlegels und des Tieck-Kreises
Teilausgabe Hamlet
Hypotext Shakespeares
Hypertext Schlegels und des Tieck-Kreises
Teilausgabe Macbeth
(Digitale) ShakespeareGesamtausgabe
Hypotext Shakespeares
Hypertext Schlegels und des Tieck-Kreises
Teilausgabe ‚n‘
284 Katrin Henzel
Abb. 1: Zusammensetzung einer Shakespeare-Ausgabe unter Verwendung der Hypo- und Hypertextkategorien
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
285
Beziehungen dar, die allesamt dem Phänomen der Intertextualität untergeordnet sind, in der Genette’schen Begrifflichkeit als ‚Transtextualität‘10 tituliert. Von den fünf verschiedenen Formen von Textbeziehungen, die Genette hierunter subsumiert, also ‚Inter-‘, ‚Para-‘, ‚Meta-‘, ‚Hyper-‘ und ‚Achitextualität‘, hat sich eigentlich nur die Paratextualität als eigenständige Theorie erfolgreich durchsetzen können. Die Hypertextualitätstheorie ist in ihrer stark spezialisierten Anwendung Genettes auf die französische Gattungs- und Literaturgeschichte nicht merklich weiterentwickelt worden. Jedoch haben sich die beiden Begriffe ‚Hyper-‘ und ‚Hypotext‘ in das allgemeine Theorievokabular eingeschrieben, und so verwende ich sie auch hier, da sie neutraler und offener sind als ‚Original‘ und ‚Übersetzung‘. Hypertextualität definiert Genette als „jede Beziehung zwischen einem Text B (den ich als Hypertext bezeichne) und einem Text A (den ich, wie zu erwarten, als Hypotext bezeichne), wobei Text B Text A auf eine Art und Weise überlagert, die nicht die des Kommentars ist.“11 Text B kann also ohne Text A nicht existieren und wird aus Text A abgeleitet.12 Text A (Hypotext) wäre also ein Drama Shakespeares, Text B (Hypertext) ein Drama Shakespeares in der Übersetzung durch Schlegel und den Tieck-Kreis. Doch sind die Relationen zwischen diesen weitaus komplexer. In der Regel wird sich bei der Nennung der ‚Schlegel-Tieck‘-Übersetzung auf die Gesamtausgabe bezogen. Bei einem intertextuellen (hypertextuellen) Vergleich ist dies jedoch nicht unproblematisch bzw. unmöglich. Den Ausgangspunkt einer solchen Sicht auf die Übersetzung in einer digitalen Edition müsste also stets ein einzelner Text bilden. Wir hätten entsprechend viele einzelne Teileditionen, die sich unter dem Dach der Gesamtausgabe subsumieren ließen (Abb. 1). Am Beispiel von Macbeth wird im Folgenden das Verhältnis zwischen Hyperund Hypotext (Abb. 2)13 noch einmal konkretisiert.
10
11
12
13
Der Begriff hat sich in der Literaturwissenschaft gegenüber der Intertextualität nicht durchsetzen können, ich werde ihn auch nicht weiterverwenden, sondern erwähne ihn lediglich zwecks einer historischen Kontextualisierung. Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Übersetzt von Wolfram Bayer und Dieter Hornig nach der 2., ergänzten Aufl. Frankfurt a.M. 1993, S. 14f. (Hervorhebung im Original). Die Übersetzung ist für Genette eine „ernste Transposition“, die wiederum der Gruppe der Transformation untergeordnet ist. Genette 1993 (Anm. 11), S. 287. a) „Most conspicuous are Act 3, Scene 5 and parts of Act 4, Scene 1: 38.1–60 and 141–8.1.“ Stanley Wells: Macbeth by William Shakespeare (Adapted by Thomas Middleton). In: William Shakespeare: The Complete Works. 2. Ausg. Hrsg. von Stanley Wells, Gary Taylor sowie John Jowett und William Montgomery. Oxford 2005 [11986], S. 969; b) William Shakespeare: Macbeth. In: The Poems and Plays of William Shakespeare. 10 Bde. Bd. 4. London 1790, S. 261–441; c) Shakespeare’s dramatische Werke übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Bd. 9. Berlin: J. F. Unger 1810 (Macbeth war für diesen Band vorgesehen); d) Shakespeare’s dramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Bd. 19. Berlin: G. Reimer 1840; e) „I. 1 – die 32 ersten Verse von I. 2 – der Hexenchor von IV. 1.“ Armin G. Kuckhoff: Das Drama William Shakespeares. Berlin 1964 (Schriften zur Theaterwissenschaft. 3.1), S. 833. Übernommen wird für die genannten Passagen in Bd. 19 die Übersetzung Baudissins. f) William Shakespeare: Schauspiele. Übersetzt von Heinrich Voß und Abraham Voß. Bd. 1. Tübingen: Cotta 1810.
286
Katrin Henzel
Teilausgabe Macbeth
Hypertext Schlegels und des Tieck-Kreises
Hypotext Shakespeares Inexakte Datierung
Verschiedene Übersetzer:innen über längeren Zeitraum, dynamische Übersetzer:innenschaft
Erstdruck 1623 Folio
Umfang der Übersetzungen variiert (nicht immer Übersetzung eines Textes in Gänze, teils nur Passagen)
Unklare Autorschaft mit vermuteter Bearbeitung durch Thomas Middletona) Intertextuelle Bezüge i.e.S. zu Middletons The Witch
Übersetzungen für verschiedene Ausgaben vorgesehen
[DeutschDeutsch[DeutschDeutschsprachiger sprachiger sprachiger sprachige Hypertext der Hypertexte als HypertextHypertextsog. Schlegels Schlegels sog. ‚Schlegel‚Schlegelals als Bruchstück] Bruchstück] Tieck‘ nach Tieck‘-Ausgabe 1840 Englischsprachige HypotextVorlage für Hypertext Schlegels und des TieckKreises Bd. 4 der Malone-Edition, 1790b)
Letzter Teilbd., Letzter Teilbd., 1810*** 1810c)
Deutschsprachige Hypertexte vor Schlegel (auch Vorlagen für →)
Nur Nur Bruchstück Bruchstück des des Macbeth Macbeth
Bd. 19, 1840d) Dorothea Tieck alleinige ÜberSetzerin des Großteils von Macbeth Schlegel vs. Baudissin (identische Passagene) Übersetzt)
Wieland Eschenburg
Schlegel vs. Baudissine)
[Deutschsprachige parallel erschienene Konkurrenz-Hypertexte] z.B. Voß’ Macbeth 1810f) ferner auch Raubdrucke und Mischübersetzungen (i.d.R. nicht autorisiert)
Abb. 2: Auffächerung der Hypo- und Hypertexte von Macbeth
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
287
Shakespeares Macbeth (Hypotext) wird als politisches Stück eingeordnet, das genaue Entstehungsdatum ist nicht bekannt: „Macbeth is obviously a Jacobean play, composed probably in 1606.“14 Weiter heißt es: „But the first printed text, in the 1623 Folio, shows signs of having been adapted at a later date.“15 Wells verweist zudem auf die auffällige Kürze des Stücks im Vergleich zu anderen Tragödien Shakespeares. Es enthalte Episoden, für die es Gründe gebe, sie nicht Shakespeare zuzuschreiben.16 Es wird eine Bearbeitung durch Thomas Middleton als wahrscheinlich angenommen, genaue Zuordnungen sind allerdings nicht möglich, weder personell noch zeitlich.17 Der Autorbegriff wird also bereits hier strapaziert, eine eindeutige Textvorlage bleibt dem Hypertext praktisch verwehrt, Middletons The Witch wäre mindestens in einem Kommentar zu erläutern – handelt es sich um einen Paratext, um einen eigenständigen Hypotext oder um einen Teil des hier angenommenen Hypotexts?18 Auch der Textstatus wäre also grundlegend zu prüfen, die Terminologie zu schärfen. Macbeth in der sogenannten ‚Schlegel-Tieck‘-Übersetzung befindet sich in Band 19 (dem letzten) der Gesamtausgabe von 1840, übersetzt wurde das Drama von Dorothea Tieck (1833).19 Nur wenige ausgewählte Passagen wurden von August Wilhelm Schlegel und Wolf Heinrich von Baudissin übersetzt – man sieht in der Übersicht (Abb. 2), dass man sich zunächst für den Abdruck der Baudissin’schen Übersetzung entschieden hat, während alle nachfolgenden Ausgaben Schlegels kurze Übersetzungspassage nutzen. Neben dem Hypertext i.e.S. (sog. ‚Schlegel-Tieck‘), um den es hier geht, sind auch weitere Hypertexte in Form von Übersetzungen ins Deutsche für das Verhältnis von Hypo- und Hypertext interessant und sollten bei einer Edition gleichermaßen Berücksichtigung finden: Zu nennen sind hier die Vorgängerübersetzungen Wielands und Eschenburgs,20 aber eben 14
15 16
17
18
19 20
Wells 2005 (Anm. 13). Die Shakespeare Company stand unter dem Patronat von James VI von Schottland, der 1603 den englischen Thron bestieg (ebd.). Wells 2005 (Anm. 13). Wells 2005 (Anm. 13). „Most conspicuous are Act 3, Scene 5 and parts of Act 4, Scene 1: 38.1–60 and 141–8.1.“ Wells 2005 (Anm. 13). „Probably Middleton himself adapted Shakespeare’s play some years after its first performance, adding these ad more localized details, and cutting the play elsewhere. We do not attempt to excise passages most clearly written by Middleton, because the adapter’s hand almost certainly affected the text at other, less determinable points. The Folio text of Macbeth cites only the opening words of the songs; drawing on The Witch, we attempt a reconstruction of their staging in Macbeth.“ Zu unterscheiden wäre bei einer Edition des Macbeth und seiner Übersetzung auch hinsichtlich des zeitgenössischen Wissens um Überlieferung und Textzusammensetzung und des heutigen Forschungsstands. Wells 2005 (Anm. 13). Das Trauerspiel von Macbeth. In: Wielands Gesammelte Schriften [= A.A.]. Hrsg. von der Deutschen Kommission der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Zweite Abteilung: Übersetzungen. Bd. 3: Shakespeares theatralische Werke. Sechster, siebenter und achter Teil. Hrsg. von Ernst Stadler. Berlin 1911, S. 71–132; Macbeth, ein Trauerspiel. In: William Shakespear’s Schauspiele. Von Johann Joachim Eschenburg. Neue Ausgabe. Bd. 5. Zürich 1776, S. 287–400; [Ders.:] Macbeth, ein Trauerspiel. In: Willhelm Shakespears Schauspiele. Neue verbesserte Aufl. Bd. 12. Straßburg 1779, S. 3–144. Die letztgenannte der Eschenburg-Ausgaben könnte in vergleichender Perspektive interessant sein, da sie die Vorlage für Schillers Bearbeitung war (vgl. hierzu Katrin Henzel: Veranschaulichung versus Imagination. Tod- und Jenseitsdarstellungen in Schillers Bühnenbearbeitungen Egmont und
288
Katrin Henzel
auch parallel entstandene konkurrierende Übersetzungen, v.a. durch Voß.21 Ein eigenes Forschungsprojekt böte sich sicher mit der Beschäftigung der ‚Mischübersetzungen‘ – gemeint sind damit Editionen, die verschiedene Übersetzungen partiell vermischen, i.d.R. geschieht dies in Form von partiellen Raubdrucken.22 „Die Übersetzung des Macbeth wurde von Schlegel begonnen, aber dann nicht weitergeführt.“23 Ähnlich formuliert es Michael Bernays: „Die frische Lust der Arbeit kehrte nicht wieder: nur noch ein Band folgte den früheren (1810); er enthielt Richard III – und von seiner ferneren Beschäftigung mit Shakespeare zeugt nur das kostbare Bruchstück aus dem Anfange des ‚Macbeth‘“.24 Über Schlegels offensichtlich kaum vorhandenes Interesse an Macbeth lässt sich nur spekulieren: Möglicherweise hängt dies mit der atypischen Form des Stücks zusammen. Oder aber Schlegel störte sich an dem Fakt, dass Macbeth im 18. Jahrhundert insbesondere im aufklärerischen Kontext intensiv rezipiert wurde. Macbeth ist im 18. Jahrhundert „das bei weitem am häufigsten adaptierte Werk Shakespeares, was insofern nicht erstaunt, als die an Shakespeare so hochgelobte Kunst der psychologischen Charakteranalyse in diesem Stück besonders geradlinig in Erscheinung tritt.“25 Als Übersetzungsvorlage diente der vierte Band von Malones Ausgabe von 1790.26 Wie für den Hypotext muss auch für den Hypertext gelten, dass es kein in sich geschlossener Text aus einer Hand ist. Entsprechend wäre das Verhältnis zwischen den verschiedenen Übersetzungsfragmenten der verschiedenen Übersetzungsvorhaben und teilweisen Realisierung in Form von publizierten Drucken zu klären. Auch hier lässt sich daher konsequenterweise nicht mehr von einem (einzigen) Hypertext sprechen. Sinnvoll wäre es hier den Fassungsbegriff auf Übersetzungen zu übertragen, sodass folgende Terminologie vorgeschlagen wird: Hypo-/Hypertext für aus editorischer Sicht eindeutige Phänomene mit Textstatus, Hypo-/Hypertext in Fassungen für die jeweiligen Übersetzungen/Übersetzungsmischformen (gewissermaßen hybride Hypertexte) sowie der Terminus des Hypo-/Hyperwerks für eine Summe verschiedener Hypo-/Hypertexte, die einem Autor zugeschrieben werden. Das von mir gewählte Beispiel Macbeth ist gewissermaßen eine Ausnahmeerscheinung, weil Macbeth aufgrund seiner Kürze und seiner offensichtlich später eingefügten nicht-autorisierten Passagen als nicht-typisches Drama Shakespeares gilt. Für die Modellierung einer Edition müssen aber alle vorkommenden Typen berücksichtigt werden, auch wenn sie nur einmal in
21 22
23 24 25
26
Macbeth. In: „Sei wie du willt namenloses Jenseits“. Neue interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung des Unerklärlichen. Hrsg. von Christa Agnes Tuczay, Ester Saletta und Barbara Hindinger. Wien 2016, S. 39–50, hier Anm. 13, S. 45. Voß/Voß 1810 (Anm. 13). Diese Mischeditionen stellen zugleich einen interessanten Gegenstand für die zweite konzeptionelle Annäherung (1.2.), das literarische Feld, dar. Kuckhoff 1964 (Anm. 13), S. 833. Bernays 1865 (Anm. 1), S. 399. Renata Häublein: Die Entdeckung Shakespeares auf der deutschen Bühne des 18. Jahrhunderts. Adaption und Wirkung der Vermittlung auf dem Theater. Tübingen 2005 [E-Book 2010] (Theatron. 46), https://doi.org/10.1515/9783110943887, S. 166. Shakespeare 1790 (Anm. 13). Vgl. Kuckhoff 1964 (Anm. 13), S. 833; Bernays 1865 (Anm. 1), S. 399.
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
289
Erscheinung treten. Insofern schien mir die Einbeziehung von Macbeth als Ergänzung sinnvoll, da zu Hamlet schon vergleichsweise viele Überlegungen angestellt wurden und die Übersetzung durch ‚Schlegel-Tieck‘ immer wieder gerade und gern aufgrund der relativ guten Überlieferungslage und der zahlreichen Kommentare und Zeugnisse bemüht wird.27 Wie deutlich werden sollte, stellen also bereits die Textauswahl für die einzelnen Shakespeare-Dramen sowie die Zuordnung zwischen Hypo- und Hypertext kein triviales Unterfangen dar. Da mir die Übersicht lediglich zur Veranschaulichung diente, möchte ich hier nicht weiter in die Tiefe der Textauswahl gehen, sondern in einem nächsten Schritt der Frage nachgehen, wie sich die Texte anordnen lassen, welche Aspekte bei der Visualisierung in einer digitalen Edition der Übersetzungen Shakespeares durch Schlegel und den Tieck-Kreis zu bedenken sind und welche weiteren Faktoren in der Materialauswahl, -anordnung und -anreicherung eine Rolle spielen (siehe Abb. 3). Hypo- und Hypertext in ihren verschiedenen Fassungen lassen sich sicherlich ohne Probleme und wie üblich direkt nebeneinanderstellen und vergleichend betrachten – sobald eben die Auswahl der Texte erfolgt und begründet ist. Auch eine Verbindung von Bild (Faksimile) und Text, die eigentlich den festen Bestandteil digitaler Editionen bildet,28 bietet sich hier an, sobald klar ist, welche Texte und Fragmente in direkten Vergleich gehören. Ein Vorteil im Digitalen ist, die Textansichten und Synopsen den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen, etwa hinsichtlich der Anzahl der zu vergleichenden Texte oder hinsichtlich der Auswahl und Anordnung. Von besonderer Wichtigkeit sind bei einer Hypotext-Hypertext-Edition (und nicht nur da) die mitzuliefernden Metadaten. Auch hier besteht nun bei Macbeth eine gewisse Herausforderung hinsichtlich der Granularität – eine derart komplexe Druck- und Übersetzungsgeschichte verlangt aus meiner Sicht eine gleichermaßen komplexe Aufschlüsselung der Metadaten auf der jeweils zum Tragen kommenden Ebene, d.h. dass es Metadaten auf der obersten Ebene gibt, die das gesamte Beziehungsgeflecht betreffen, dass andere Metadaten wiederum auf tieferer Ebene anzusiedeln wären, was eine gewisse Herausforderung für die Verlinkung darstellt. Das betrifft z.B. Datierungen, Personen- und andere Normdaten. Hier halte ich auch die Einbindung von Thesauri zwecks einer relationalen Verschlagwortung für ausgesprochen nützlich. Weitere Schnittstellen nach außen könnten beispielsweise in Form von Verknüpfungen mit anderen Editionen – Shakespeare-Ausgaben, der Schlegel-Briefedition (KAWS) u.a. – erfolgen, die jeweils über die diffizile Überlieferungslage aufklären. Damit erhalten diese verknüpften Texte von ‚außerhalb‘ den Status eines Paratexts, konkret eines Epitexts.29
27
28
29
Siehe die einschlägigen Beiträge im vorliegenden Band, siehe auch die bereitgestellten Materialien in August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100). Dirk Van Hulle: Dynamic Facsimiles. Note on the Transcription of Born-Digital Works for Genetic Criticism. In: Variants [Online] 15–16, 2021, S. 231–241, hier S. 236, https://doi.org/10.4000/variants.1450. Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Übersetzt von Dieter Hornig. Frankfurt a.M. 2003 [Nachdruck der Übersetzung von 1989, frz. Originalausgabe 1987], S. 12f., 328–384.
290
Katrin Henzel
zur Datenanalyse durch Nutzer:innen
ols s to ng ru o l s o s ie ali yset su al Vi An
zur Veranschaulichung als heuristisches Instrument für in der Edition bereitgestellte Datenzusammenhänge
Metada ten Verwendung von Thesauri
Geschickte Zuordnung (Ebene der Antragung)
Granularität (in Abhängigkeit der Ebene, auf der die jeweiligen Metadaten angetragen werden)
Persistente Identifier für Auffindbarkeit, Zitierbarkeit MenschMaschine (UI) vs. MaschineMaschine (API)
Normdaten zwecks Austausch nach 'außen'
tellen Schnitts
auf Te Sichten Anordnung: synoptisch, interlinear, Granularität, Raumnutzung horizontal vs. vertikal vs. Tiefe
xtebene Bild-Bild
Text-Text (Parallelsicht, Synopsen Bild-Text (Faksimile und Transkription)
Auswahlkriterien: Umfang, Sinnhaftigkeit, Dynamik der Anzeige: Darstellbarkeit, Auswahl der Texte, Rekonstruierbarkeit Anzahl der Texte, Umfang der Vergleichspassage
Abb. 3: Bei Auswahl und Anordnung von Hypo- und Hypertexten zu beachtende Faktoren
Welche Forschungsinteressen verbinden sich mit einem Vergleich von Hypo- und Hypertext(en)? Es sind v.a. sprach- und literaturwissenschaftliche Fragestellungen. Neben der längst obligatorischen Volltextsuche braucht es für Editionen von Übersetzungen Werkzeuge, die die vergleichende Analyse erleichtern oder vielleicht sogar neue Fragestellungen ermöglichen. Dies könnte beispielsweise derart gestaltet sein, dass Nutzer Häufigkeitsanalysen vornehmen können und diese sich außerdem visualisieren lassen. Tools für die Analyse von Metrik, Versmaß und Strophenform wären insbesondere für Editionen im didaktischen Kontext wertvoll. Wichtig bleibt stets, den Nutzern die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich in der Edition ergeben können, das kann etwa in Form einer gezielten Lenkung auf bestimmte Textstellen erfolgen. Den Möglichkei-
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
291
ten sind kaum Grenzen gesetzt, und es gilt hier abzuwägen, welche Werkzeuge für notwendig und sinnvoll erachtet werden, ohne die Edition zu überfrachten (siehe hierzu noch einmal die Übersicht all der eben aufgeführten Aspekte in Abb. 3).
1.2 Das literarische Feld Neben dieser typischen Konzentration auf Texte gibt es noch andere Zugänge und Sichtweisen, die vielleicht gerade durch die Nichtbeachtung der Texte einen interessanten Einstieg hin zu diesen bieten können. Die Entstehungs- und Druckgeschichte der sogenannten ‚Schlegel-Tieck’schen‘ Ausgabe gestaltet sich als eine sehr komplexe und unübersichtliche.30 Sieht man dieses kulturelle Unterfangen als ein ökonomisch potentiell ertragreiches Geschäft, gewinnt diese komplexe Gemengelage an Konturen. So bewertet Kenneth E. Larson die Edition der Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises als Gewinner der „initial battle for the German Shakespeare readership […] against the seven or so nearly simultaneous competing translations of the 1820s and 1830s“.31 Zu den deutschsprachigen Übersetzungen Shakespeares im 19. Jahrhundert gibt es zwar grundlegende Forschungsbeiträge, diese fokussieren allerdings verständlicherweise nur ausgewählte Kreise und Ausgaben, sodass die von Werner Habicht 199332 formulierte Forderung einer kritischen Geschichte der Shakespeare-Übersetzungen im deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts noch nicht erfüllt ist. Welchen Beitrag könnte eine digitale Edition des ‚Schlegel-Tieck‘ für die Erforschung dieser Rezeptionsgeschichte konkret leisten und welchen Nutzen hätte vice versa eine solche Ausgabe von der Rekonstruktion des Übersetzermarkts? In seiner 1992 erschienenen Monographie Die Regeln der Kunst33 entwickelt Pierre Bourdieu ausgehend von Gustave Flaubert eine an der materiellen Produktion orientierte französische Literaturgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die quasi den Geniebegriff verabschiedet und die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen – die Regeln der Kunst oder besser des Kunstmarktes – für die Entstehung der Avantgarden auf Basis quantitativer wie qualitativer Analysen aufzeigt. Stark vereinfacht, gibt es im literarischen Feld der genannten Zeit eine Konkurrenzsituation zwischen älteren und nachfolgenden Generationen wie auch zwischen parallel existierenden Gruppen, die sich jeweils in einem Wettbewerb bezüglich der Anhäufung verschiedener Formen des Kapitals (des ökonomischen, des symbolischen und des kulturellen 30 31
32
33
Siehe dazu die zahlreichen einschlägigen Beiträge in vorliegendem Sammelband. Kenneth E. Larson: The Origins of the „Schlegel-Tieck“ Shakespeare in the 1820s. In: The German Quarterly 60, 1987, Nr. 1, S. 19–37, hier S. 32. Werner Habicht: The Romanticism of the Schlegel-Tieck Shakespeare and the History of NineteenthCentury German Shakespeare Translation. In: European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic Age. Hrsg. von Dirk Delabastita und Lieven d’Hulst. Amsterdam/Philadelphia 1993, S. 45–53, hier S. 50. Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Übers. von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt a.M. 72016.
292
Katrin Henzel
Kapitals) befinden. Dieses Feld der kulturellen Produktion befindet sich im Feld der Macht und dieses wiederum in einem (nationalen) sozialen Raum (in Bourdieus Modell Frankreich), der am Verhältnis zwischen ökonomischem und kulturellem Kapital ausgerichtet ist.34 Das Feld der kulturellen Produktion ist in der linken Hälfte des Machtfeldes situiert und lässt sich wiederum in zwei Hälften unterteilen: Links ist die Avantgarde angesiedelt, die über wenig ökonomisches aber viel kulturelles Kapital verfügt, rechts davon befindet sich die Massenproduktion, die über mehr ökonomisches Kapital, aber weniger kulturelles Kapital verfügt. Die Avantgarde lässt sich nun wiederum auf der y-Achse hierarchisch in einzelne Avantgarden untergliedern und bezieht das symbolische Kapital mit ein: Oben stehen die Arrivierten mit einem hohen Konsekrationsgrad, unten die Avantgarde ohne (viel) Anerkennung („arrivierte“ versus „BohèmeAvantgarde“ in Bourdieus Terminologie). Dieses Modell ist deshalb so interessant, weil es die verschiedenen Kapitalgruppen einzelner Akteure im Feld zueinander ins Verhältnis setzt. Das Modell ist zudem dynamisch, Gruppen können Kapitalsorten anhäufen oder abbauen, man denke v.a. an die Bedeutsamkeit des Alterns für die Zunahme von symbolischem Kapital bei Autoren, die sich ihren Ruf erst ‚verdienen‘ mussten (auch wenn die Aufstiegschancen kaum mit heutigen Rahmenbedingungen zu vergleichen sind). Das Modell ist darüber hinaus nicht nur für die französische Kunstgeschichte von Interesse, sondern es lässt sich – freilich mit einigem Bearbeitungsaufwand – auch auf andere Gruppen in anderen nationalen bzw. sozialen Räumen zu anderen Zeiten/Epochen übertragen. Neben den äußeren Einflussfaktoren spielen v.a. die konkurrierenden Gruppen im Verhältnis zueinander die zentrale Rolle für die Anordnung des Feldes. Somit werden Künstlergruppen und deren Poetologien und Kunstwerke nicht autark im ‚luftleeren‘ Raum beschrieben, sondern relativ und immer in Abhängigkeit zum Umfeld. Bezogen auf die Situation der Übersetzungen Shakespeares ins Deutsche im frühen 19. Jahrhundert, bietet sich das Modell Bourdieus zwingend an für die immer wieder auftauchende Frage, warum sich die sogenannte ‚SchlegelTieck‘-Ausgabe gegenüber anderen durchsetzen konnte. Die Erstellung eines solchen Modells stellt allerdings ein aufwendiges Unternehmen dar, das auf zahlreiche Einzelstudien wird aufbauen müssen, um belastbare Daten auswerten und das literarische Feld der Übersetzer nachzeichnen zu können. Auch aus literatursoziologischer Sicht bietet es sich also an, von Einzelprojekten auszugehen und diese in einem Portal zu bündeln (s.o.). Auf Basis einer zu erstellenden Übersicht, die sich beispielsweise in Form einer Landkarte und/oder eines Personennetzwerks visualisieren ließe, könnte man Einstiegspunkte für Nutzer definieren, die zu den jeweils relevanten Einzeleditionen weiterleiten. Durch die literatursoziologische Sicht eröffnen sich neue Perspektiven auf die Übersetzung jenseits ästhetischer Fragestellungen, die sich aber auch problemlos kombinieren ließen. So könnten Übersetzungen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden,
34
Die Grundlage für die Beschreibung dieses Felds der kulturellen Produktion stellt das von Bourdieu selbst bereitgestellte Schaubild in Bourdieu 2016 (Anm. 33), S. 203, dar.
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
293
die entweder unter gleichen oder konträren Bedingungen entstanden sind, die zueinander in nachweislicher Nähe oder Distanz, gar Konkurrenz35 stehen: etwa ‚SchlegelTieck‘ versus Johann Heinrich Voß.36 Lohnenswert scheint mir insbesondere auch ein Einstieg über die Verleger, insbesondere Georg Andreas Reimer.37 Es wäre eine Verknüpfung mit Rezensionen und Kritiken, aber auch mit Verkaufslisten, Messekatalogen u.a.m. denkbar. Gerade für die Rezensionen und Kritiken bietet sich eine Verlinkung auf bestehende Textsammlungen, Datenbanken und Editionen an. Damit würde eine solche Edition als interdisziplinärer Ankerpunkt fungieren und wäre auch für nichtphilologische Projekte, z.B. in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, anschlussfähig.
1.3 Performativität Meine dritte Perspektive betrifft die Aufführbarkeit unter Einschluss der (historischen) Aufführungspraxis.38 Gewissermaßen handelt es sich hierbei um eine doppelte editorische Herausforderung, da neben der Edition von Übersetzungen auch die Dramenedition bisher eher stiefmütterlich in der Editionswissenschaft behandelt wurde und es vergleichsweise wenige theoretische Überlegungen hierzu gibt.39 Besonders schwierig dürfte hier die Eingrenzung des Gegenstands sein: Welche Aufführungen, denen nach-
35
36
37
38 39
Ausführlich: Christine Roger: Von „bequemen und wohlfeilen Nebenbuhlern“: die ‚Schlegel-Tiecksche‘ Shakespeare-Übersetzung und die Konkurrenz. In: „lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn! –“. Ludwig Tieck (1773–1853). Hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin unter Mitarbeit von Heidrun Markert. Bern u.a. 2004 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge. 9), S. 277–296. Christine Roger: Der deutsche und der fremde Shakespeare. Die Voß’sche Shakespeare-Übersetzung im Kontext ihrer Zeit. In: Voß’ Übersetzungssprache. Voraussetzungen, Kontexte, Folgen. Hrsg. von Anne Baillot, Enrica Fantino und Josefine Kitzbichler. Berlin, Boston 2015, S. 113–124. Konkret zum schwierigen Verhältnis zwischen Schlegel und insbesondere den Voß-Söhnen (Johann) Heinrich und Abraham vgl. Knödler 2015 (Anm. 1), S. 39. „Der Berliner Verleger Georg Andreas Reimer, der nach Konkurs des Ungerschen Verlags die Rechte an Schlegels Shakespeare innehatte, wollte offenbar aus verkaufsstrategischen Gründen zwei prominente ‚romantische‘ Namen [Schlegel und Tieck, KH] auf dem Titel haben, zumal die Konkurrenz nicht schlief und inzwischen zahlreiche weitere deutsche Shakespeare-Übersetzungen den Buchmarkt eroberten.“ Bamberg 2015 (Anm. 1), S. 422. Siehe hierzu auch den Beitrag von Stefan Knödler im vorliegenden Band. Aber auch die (verlorene) gerichtliche Auseinandersetzung Schlegels mit seinem ersten Verleger Unger wäre hier einzuordnen, siehe Knödler 2015 (Anm. 1), S. 35f. Siehe hierzu auch den Beitrag Bodo Plachtas im vorliegenden Band. Bodo Plachta: „Krähe mit Pfauenfedern“ oder: Warum spielen Bühnenbearbeitungen kaum eine Rolle in Dramenedition und Dramenkanon? In: Kanonbildung und Editionspraxis. Hrsg. von Jörn Bohr, Gerald Hartung und Rüdiger Nutt-Kofoth. Berlin, Boston 2021 (Beihefte zu editio. 49), S. 123–136, https://doi.org/10.1515/9783110684650-009; Katrin Henzel: Epitextuelle Bühnenanweisungen unter besonderer Berücksichtigung des Regiebuchs. In: editio 32, 2018, S. 63–81, https://doi.org/10.1515/editio2018-0005. Gerhard Seidel: Der ‚edierte‘ Text als Repräsentation und Reduktion des Werkes. Zur Wahl der Textgrundlage bei Brecht. In: Textkonstitution bei mündlicher und bei schriftlicher Überlieferung. Hrsg. von Martin Stern unter Mitarbeit von Beatrice Grob, Wolfram Groddeck und Helmut Puff. Tübingen 1991 (Beihefte zu editio. 1), S. 209–213.
294
Katrin Henzel
weislich die Übersetzung Schlegels und des Tieck-Kreises zugrunde lag, sollten in einer Edition in welcher Form Berücksichtigung finden? Stellen die Aufführungen und Inszenierungen zusätzliches Material in einer solchen Edition bereit? Spannender und dem Gegenstand gerechter wäre doch vielmehr der Verzicht auf Bonus- und Zusatzmaterial und eine Gleichbehandlung, wenn nicht höhere Bewertung der Medien, die zum Aufführungskontext unverzichtbar dazugehören, im Vergleich zum Dramentext und seiner Übersetzung. Denn gerade die sogenannte Schlegel-Tieck’sche Übersetzung wirkte wie wohl kaum eine andere auf dem Theater, sodass man sagen kann, dass der Klang dieser romantischen Shakespeare-Übersetzung den Zuhörern im Ohr blieb und in Deutschland das (wohl noch immer dominierende) Shakespeare-Bild formt(e). Nimmt man wieder das Beispiel Macbeth, lässt sich etwa auf Max Reinhardts berühmte Inszenierung verweisen.40 Man muss an dieser Stelle auch auf das grundsätzlich bestehende Paradox hinweisen, dass Aufführung und Materialität einander konträr gegenüberstehen. Die Aufführung ist singulär, d.h. „nach ihrem Ende unwiederbringlich verloren; sie läßt sich niemals wieder als dieselbe wiederholen.“41 Sie lässt sich aber, mit Fischer-Lichte gesprochen, durch das entstandene Material „dokumentieren“: „Eine solche Dokumentation schafft vielmehr erst die Bedingung der Möglichkeit, um über Aufführungen sprechen zu können“42 – und sie edieren zu können, ließe sich hier ergänzen. Was könnte an einem Vergleich von Bühnenbearbeitungen und Aufführungen innerhalb einer ‚Schlegel-Tieck‘-Ausgabe interessant sein? Denkbar wären Kategorien wie Textnähe und explizite wie implizite Bezugnahmen auf diese Übersetzung und deren Ausgaben. So ließe sich auch die Frage der Traditionsbildung auf dem Theater noch einmal anders stellen, indem nicht nur Autoren und Regisseure,43 sondern auch die Übersetzer in den Blick genommen werden. Eine derartige Perspektive ließe sich auch unter dem in Kapitel 1.2 diskutierten Ansatz Bourdieus analysieren, da es auch und gerade auf dem Theater bei der Dramenauswahl, der nötigen Textgrundlage, der gewählten Musik usw. um Machtverhältnisse geht (Kanonbildung) und Theater- und Verlags- wie Literaturgeschichte zusammengedacht werden müssen. Ein solcher Zugang wäre dann insbesondere durch Akteure und deren Netzwerk visualisierbar, aber auch intertextuelle oder vielmehr intermediale Bezüge (vgl. 1.1.) ließen sich darstellen und als Einstieg zum Material der Edition verwenden. Gleichermaßen bietet sich hier aber durchaus auch ein attraktiver Zugang zu den Übersetzungstexten über das Material selbst, über Texte und Medien aus dem Aufführungskontext: Regieblätter und -bücher (die nicht selten auch durchschossene Textausgaben beinhalten, die eine aufschlussreiche Quelle für die Umsetzung der Übersetzungen auf der Bühne sind), historische Stell40
41 42 43
Siehe dazu das Regiebuch Reinhardts, aus dem deutlich hervorgeht, dass Reinhardt als Vorlage die Übersetzung Dorothea Tiecks nutzte. Max Reinhardt: Regiebuch zu Macbeth. Hrsg. von Manfred Großmann. Basel 1966 (Schweizer Theater Jahrbuch XXXI/XXXII, 1965/66; Sonderausgabe der Schriftenreihe „Theater unserer Zeit“. 8). Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt a.M. 2004, S. 127. Fischer-Lichte 2004 (Anm. 41), S. 127. In der Regel werden noch immer Autorinnen und Regisseurinnen weitgehend ignoriert.
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
295
und Kostümskizzen, Bühnenbilder, Partituren, Theaterzettel und Programmhefte und vieles andere mehr. Auch hier müsste sich eine Edition entscheiden, welcher Zeitraum mit welchen Inszenierungen und Aufführungen Gegenstand sein soll und in welcher Form und Ausführlichkeit man auf weitere Zusammenhänge verweist. In die Betrachtung der Performativität der Shakespeare-Dramen in ihrer Übersetzung gehört auch der Film.44 Für dieses Medium ist gleichermaßen interessant, welche Textausgaben der Verfilmung jeweils zugrunde lagen; das gilt für deutschsprachige wie auch für fremdsprachige Filme, im zweiten Fall ist deren deutsche Synchronisierung, aber auch der Untertitel45 von großem Interesse für eine solche Edition. Auch hier dient wieder als Beispiel Macbeth: In der Verfilmung Tragedy of Macbeth46 (Regie: Joel Coen) aus dem Jahr 2021 bildet die Übersetzung Dorothea Tiecks (in weiten Teilen) die Grundlage für die Synchronisation und den Untertitel, wie anhand der Verse 1ff. (= erste Szene) exemplarisch gezeigt werden soll:47 Synchronisation: Wann kommen wir drei uns wieder entgegen Im Blitz und Donner oder im Regen? Wenn der Wirrwarr stille schweigt, wer der Sieger ist, sich zeigt. An welchem Ort? Auf dem Schlachtfeld. Dort begegnen wir Macbeth. Schön ist hässlich, hässlich ist schön. Schwebt durch Dunst und Nebelhöh‘n.
Untertitel: Wann kommen wir drei uns wieder entgegen, Im Blitz und Donner oder im Regen? Wenn der Wirrwarr stille schweigt, wer der Sieger ist, sich zeigt. Wo der Ort? Die Heide dort. Dort begegnen wir Macbeth. Schön ist hässlich, hässlich schön. Schwebt durch Dunst und Nebelhöhn.
Die deutschsprachige Synchronisation erfolgt auf Grundlage der Übersetzung von Axel Malzacher, dessen Dialogbuch und Dialogregie.48 Das Dialogbuch Malzachers wäre in einer Edition, die auch Filme berücksichtigt, aus meiner Sicht unbedingt miteinzubeziehen. Schlüsselszenen wie die Eingangsszene von Macbeth mit den Hexen etwa böten 44
45
46 47
48
Zu einer historisch-kritischen Filmedition siehe den jüngst hierzu erschienenen Sammelband Kritische Film- und Literaturedition. Perspektiven einer transdisziplinären Editionswissenschaft. Hrsg. von Ursula von Keitz, Wolfgang Lukas und Rüdiger Nutt-Kofoth. Berlin, Boston 2022 (Beihefte zu editio. 51). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass beispielsweise bei Streamingdiensten Untertitel nicht selten automatisch erzeugt werden und daher stärker von der Synchronisation abweichen können. Beide Formen der Übersetzung – Synchronisation (Ton) und Untertitel (Schrift) – sind also getrennt zu betrachten, aber gleichermaßen interessant. The Tragedy of Macbeth. Regie: Joel Coen. USA: Apple TV+, 2021, 105’. Ein Vergleich erfolgte nur stichprobenartig und wäre noch systematisch hinsichtlich der ‚Texttreue‘ und der Grade der Abweichung zu untersuchen. Dass für den Untertitel Dorothea Tiecks Übersetzung genutzt wurde, wird im Abspann explizit angegeben („Untertitel: Thomas Schröter / nach der Übersetzung von Dorothea Tieck“), Coen 2021 (Anm. 46), 1:45:44. Vers 3 („Wenn der Wirrwarr stille schweigt“) ist entscheidend für die Zuordnung zu Dorothea Tiecks Übersetzung, so schon bei Robert Gericke: Zu einer neuen Bühnenbearbeitung des Macbeth. In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 6, 1871, S. 19–82, hier S. 34. Coen 2021 (Anm. 46), 1:46:41.
296
Katrin Henzel
einen guten Einstieg in eine solche Ausgabe. Um eine Übersicht über das gesamte Material zu gewährleisten, wäre zu überlegen, wie solche ‚Szenenschnipsel‘ auf der Einstiegsseite angeordnet werden könnten. Die Ordnung des Materials wäre auch über Übersetzungspartikel (bestimmte Wörter oder Wortgruppen) denkbar; hier kommen Übersetzungsaspekt und mediale Adaptation wieder eng zusammen. Auch für diese Perspektive gilt, dass es keine einzige Lösung der Materialdarbietung gibt und hier editorische als auch Nutzerinteressen vorab in Abhängigkeit vom Ausgabentyp und den damit verbundenen Zielen festzulegen wären. Es sollte deutlich werden, dass es auch und gerade für Dramen und deren Übersetzungen lohnt, sich vom Text selbst stärker zu lösen (auch wenn dies zunächst paradox erscheint) und die Rezeption vor die Produktion zu stellen, denn so kann der Performativität erst gerecht werden.
2. Digitalität und Zielgruppen Es ist längst Konsens, dass eine digitale Edition die Möglichkeiten des digitalen Mediums voll ausschöpfen sollte. Das bedeutet, dass jene nicht einfach die Nachbildung einer gedruckten Edition darstellt, sondern medienadäquate Formate und Features bereithält, die sich aus Modellen der Dynamik und Nicht-Linerarität, wie z.B. Fluidität,49 Inter- und Plurimedialität,50 (medialen) Interaktivität51 und Hypertextualität/Hypermedialität (sowohl im literatur-/ geisteswissenschaftlichen als auch im informationstechnologischen Verständnis)52 speisen. Dies lässt sich nicht ohne die Frage nach der Nutzergruppe diskutieren und soll abschließend Beachtung finden. Für wen erstellen wir Editionen? Es ist allgemein bekannt, dass historisch-kritische Ausgaben in Schule und Studium, selbst in der Wissenschaft,53 eher marginal genutzt 49 50
51
52
53
John Bryant: The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen. Ann Arbor 2002. Werner Wolf: Intermedialitat. Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie, intermediale Formen. In: Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien. Hrsg. von Volker C. Dorr und Tobias Kurwinkel. Würzburg 2014, S. 11–45. Christian Fries: Interaktivität in den Medien. In: Ders.: Grundlagen der Mediengestaltung. Konzeption, Ideenfindung, Bildaufbau, Farbe, Typografie, Interface Design. 6., neu bearbeitete Aufl. München 2021, S. 120–131, https://doi.org/10.3139/9783446469662.007. Sowohl im literatur- als auch informationstechnologischen Verständnis. Im literarischen Kontext noch immer lesenswert (Hypertext als Gegenstand): Simone Winko: Hyper – Text – Literatur. Digitale Literatur als Herausforderung. In: Digitalität und Literalität. Zur Zukunft der Literatur. Hrsg. von Harro Segeberg und Simone Winko. München 2005, S. 137–157. Anregend hinsichtlich des Hypertexts als heuristisches Medium (Hypertext als wissenschaftliches Verfahren): Christian Wachter: Geschichte digital schreiben. Hypertext als non-lineare Wissenspräsentation in der Digital History. Bielefeld 2021, https://doi.org/10.1515/9783839458013. Dazu Rüdiger Nutt-Kofoth: Wie werden neugermanistische (historisch-)kritische Editionen für die literaturwissenschaftliche Interpretation genutzt? In: Vom Nutzen der Editionen. Zur Bedeutung moderner Editorik für die Erforschung von Literatur- und Kulturgeschichte. Hrsg. von Thomas Bein. Berlin, Boston 2015 (Beihefte zu editio. 39), https://doi.org/10.1515/9783110418255, S. 233–245; Patrick Sahle: Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. 3 Bde. Bd. 1. Norderstedt 2013, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-53510, Anm. 4, S. 12.
Anforderungen an eine künftige digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen
297
werden. Es sollte Aufgabe der Editionswissenschaft sein sich (wieder) stärker den Zielgruppen in Studium und Schulen anzunähern und die Frage von Zweck und Funktionalität dieser Ausgaben auch verstärkt auf diese beiden genannten Gruppen zu richten.54 Auch wenn in den Schulen insbesondere die Darstellung von Textvarianz in Apparaten kaum von Interesse sein wird, sollte doch auch und erst recht schon im Sprachund Literaturunterricht ein zuverlässiger Lesetext verfügbar sein, und zwar gleichermaßen für alle Schultypen. Mit Bourdieu argumentiert, würde sonst den Schülern, die nicht von zuverlässigen Ausgaben profitieren, von vornherein die Möglichkeit genommen, kulturelles Kapital zu sammeln. Aufstiegschancen im deutschen Bildungsbereich werden so weiter geschmälert. Manche Schüler werden sich beruflich nicht wieder literarischen Texten widmen, sie knüpfen ihre Leseerfahrung und - erinnerung an die Ausgaben, die im Deutschunterricht genutzt wurden. Umso wertvoller erscheint mir daher ein Meta-Editionsmodell, das dynamisch verfährt, dem man Module oder Bausteine nach Bedarf entnehmen kann und aus dem sich aus der Nutzersicht unnötige Bestandteile ‚wegklicken‘ lassen.55 Auch Verlinkungen zu Theateraufführungen, Ausstellungen, (Computer-)Spielen oder anderen Ereignissen und Materialsammlungen sind prinzipiell ein gangbarer Weg, neue Anreize in Editionen zu schaffen. Auch Virtual Reality könnte hier künftig einen größeren Raum einnehmen, ermöglicht diese gerade synästhetische Zugänge und fördert die kreative Auseinandersetzung mit kanonischen Texten.56 Es ist unbestritten, dass Fragen der literarischen, medialen und popkulturellen Transformation gerade auch für die Shakespeare-Forschung von Interesse sind. Die Fertigkeiten, die heutige Schüler als ‚Digital Natives‘ mitbringen, sollten auch für digitale Editionen berücksichtigt werden. Gelingende Wissenschaftskommunikation, zu der in einem weiteren Verständnis auch die Vermittlung von Forschungsergebnissen im schulischen Kontext zählt, ist eine aktuelle wissenschaftspolitische Maxime.57 Hier gilt es wohl allgemein für den geisteswissenschaftlichen Bereich, die mediale Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren Vermittlung noch stärker und früher in Projektplanungen einzubeziehen, beispielsweise das grafische Design bei der Konzeption einer digitalen Edition schon mitzudenken. 54
55
56
57
So auch die Argumentation von Florian Radvan: Edition, Didaktik und Nutzungsforschung. ‚Lesen‘ und ‚Benutzen‘ als Paradigmen des Umgangs mit Textausgaben im Deutschunterricht. In: editio 28/1, 2014, S. 22–49, hier S. 39, https://doi.org/10.1515/editio-2014-004. Er fordert zudem, dass die Editionswissenschaft sich intensiv mit Schulausgaben als Forschungsgegenstand widmen solle, ebd., S. 40. Damit würden sich historisch-kritische Edition und Schulausgabe prinzipiell annähern. Radvan argumentiert schließlich auch mit der möglichen und tatsächlichen Nutzbarkeit von Editionen und sieht auch die Apparate (zumindest bei der Lektüre) als eher störendes und überforderndes Element im Literaturunterricht, vgl. Radvan 2014 (Anm. 54), S. 30. Siehe etwa Goethes Faust als interaktive Virtual Reality Experience, ein von der Deutschen Nationalbibliothek zusammen mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen initiiertes Projekt, https://www.dnb.de/goethevr. „Es gilt, Wissenschaftskommunikation in Zukunft stärker entlang der gesamten Bildungskette zu denken – von der Kita bis zur Hochschule und darüber hinaus.“ Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Wissenschaftskommunikation. Hrsg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Referat 118: Wissenschaftskommunikation; Wissenschaftsjahre. Berlin 2019, S. 4 (unpag.).
298
Katrin Henzel
In der akademischen wie auch schulischen Lehre und Vermittlung lohnt ein Blick in den angloamerikanischen Raum. Dort haben sich bereits Formate etabliert, die die genannten Punkte der Digitalität aufgreifen und neue Wege für die Arbeit an und mit Shakespeares Werk erproben. Zur Zielgruppe der Studierenden konstatieren Christie Carson und Peter Kirwan etwa: „Students are some of the key ‚users‘ of digital Shakespeare, the term gaining potency in a culture where Shakespeare is the raw material to merely be ‚used‘ in the pursuit of a degree whose value may be perceived more in terms of transferable skills than content specificity.“58 Shakespeare als Mittel zum Zweck, könnte man nun lapidar schlussfolgern, aber ich verstehe Carson und Kirwan hier so, dass es eben durch die Einbindung digitaler Skills der Studierenden doch auch zu einer Aufwertung von Shakespeare selbst wieder kommt, indem dessen Werk aktualisierbar wird. Übertragbare Fähigkeiten und Fertigkeiten könnten also der Schlüssel sein, um scheinbar ‚nicht mehr relevante‘ Inhalte v.a. in Schule und Lehre wieder attraktiver zu machen. Das Attraktivitätskriterium lässt sich gewissermaßen auch auf die Forschung und Allgemeinheit ausweiten: Wie gelingt es die Relevanz und das Potential neuer Methoden und Gegenstände für die Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des TieckKreises deutlich zu machen, das Interesse daran zu wecken oder zu steigern? Es bedarf einer grundlegenden Zugänglichmachung des gesamten Materials in Form von Editionen. Da es sich – wie deutlich werden sollte – um einen ausgesprochen komplexen Gegenstand handelt, der von (Übersetzungs-)Texten selbst über die in den Buch- und Übersetzermarkt involvierten Akteure bis zu Fragen der Rezeption (v.a. auf dem Theater, aber auch im Film usw.) reicht, kann ein solches Editionsunternehmen nur kollaborativ in Form mehrerer kleiner spezialisierter Projekte, die sich unter einem Dach zusammenfinden, vonstattengehen. Damit die Daten und Ergebnisse der einzelnen Projekte sinnvoll und nachhaltig miteinander kombiniert werden und voneinander profitieren können, ohne die Nutzer (wie auch die Projektbeteiligten selbst) zu ermüden oder zu überfordern, müssen Formen der digitalen Verknüpfung gefunden werden, die diesem hohen Anspruch gerecht werden. Hierfür bietet sich eine Meta-Edition an, in die sich Einzeleditionen verschiedener Forschungsprojekte integrieren lassen. Diese MetaEdition nutzt die Vorteile des digitalen Raums, um komplexe Verknüpfungen herzustellen und so das ausgesprochen unübersichtliche Netzwerk rund um die ShakespeareÜbersetzungen in eine begreifbare Darstellungs- und Vermittlungsform zu packen. Dynamisches Modell, Interaktion, Verknüpfung sind hierbei zentrale Kategorien. Nur so lässt sich dem Phänomen Shakespeare gerecht werden. While ‚Shakespeare‘ as cultural concept may be in a state of perpetual change, the specific and temporally contingent effect of the impact of digital technology in recent years has been the foregrounding of multiplicity. More than at any previous point in history, we are studying Shakespeares.59 58
59
Christie Carson und Peter Kirwan: Conclusion. Digital Dreaming. In: Shakespeare and the Digital World. Redefining Scholarship and Practice. Hrsg. von dens. Cambridge 2014, S. 238–257, hier S. 244 (Hervorhebung K.H.). Carson/Kirwan 2014 (Anm. 58), S. 239 (Hervorhebung im Original).
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Hamlet – digital ediert
1. Grundlagen Es wirkt auf den ersten Blick wie eine philologische Kuriosität, dass eine wissenschaftliche Edition der deutschen Shakespeare-Übersetzungen, die August Wilhelm Schlegel und der Kreis um Ludwig Tieck zwischen 1797 – dem Erscheinungsjahr des ersten Bandes von Schlegels neunbändiger Shakespeare-Übersetzung – und 1853 – dem Todesjahr Tiecks – vorgelegt haben, bis heute ausgeblieben ist. Denn gemessen an der breiten Rezeption und Wirkung, die diesen Übertragungen weit über das 19. Jahrhundert hinaus in der deutschen Literatur und auf dem Theater zuteilwurde,1 muss die auch heute noch fehlende philologische Erarbeitung einer nach historisch-kritischen Maßstäben aufbereiteten Edition verwundern. Die Gründe dafür indessen sind vielfältig und vielschichtig; und bei deren genauer Betrachtung wird das Desiderat erklärlich. Als erstes ist hier wohl die Tatsache zu nennen, dass weder für August Wilhelm Schlegel noch für Ludwig Tieck – ganz zu schweigen von Dorothea Tieck und Wolf Heinrich von Baudissin – eine vollständige, historisch-kritische Werkausgabe vorliegt. Nach der Ausgabe der Sämmtlichen Werke von Schlegels Nachlassverwalter Eduard Böcking aus den Jahren 1846/47 wurde keine Werkedition zu August Wilhelm Schlegel mehr unternommen; dabei ist Böckings Ausgabe nicht historisch-kritisch. Ähnliches gilt für Ludwig Tieck: Auch hier sind Versuche einer vollständigen historisch-kritischen Ausgabe seines Gesamtwerks nicht über Anläufe und Teilausgaben hinausgekommen.2 Auch wenn einzelne Werkteile der beiden Autoren inzwischen in Editionen greifbar sind – zu nennen sind für Schlegel etwa 1
2
Vgl. dazu Roger Paulin: The Critical Reception of Shakespeare in Germany: 1682–1914. Native Literature and Foreign Genius. Hildesheim 2003; Christine Roger: Von „bequemen und wohlfeilen Nebenbuhlern“: die ‚Schlegel-Tiecksche‘ Shakespeare-Übersetzung und die Konkurrenz. In: „lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn! –“. Ludwig Tieck (1773–1853). Hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin unter Mitarbeit von Heidrun Markert. Bern u.a. 2004 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge. 9), S. 277–296; dies.: La réception de Shakespeare en Allemagne de 1815 à 1850. Propagation et assimilation de la référence étrangère. Bern 2008; Philipp Ajouri und Christa Jansohn: Shakespeare-Ausgaben der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1867 bis zur Jahrhundertwende. In: IASL (Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur) 45, 2020, Bd. 2, S. 386–396, sowie den Beitrag von Christa Jansohn in diesem Band. Von der von 1985 bis 1995 erschienenen Ausgabe der Schriften Ludwig Tiecks sind nur 5 Bände erschienen: Ludwig Tieck: Schriften in 12 Bänden. Hrsg. von Manfred Frank, Achim Hölter, Uwe Schweikert und Ruprecht Wimmer. Frankfurt a.M. 1985–1995. Vgl. zudem das digitale Briefrepertorium von Jochen Strobel und Walter Schmitz: Repertorium der Briefwechsel Ludwig Tiecks. CD-ROM mit Beiheft. Dresden 2002. Vgl. dazu auch den Beitrag von Jochen Strobel in diesem Band.
https://doi.org/10.1515/9783111017419-020
300
Claudia Bamberg und Thomas Burch
die noch nicht abgeschlossene Kritische Ausgabe der Vorlesungen (KAV) und die digitale Edition seiner Gesamtkorrespondenz (KAWS)3 –, fehlt nach wie vor jeweils eine vollständige Edition ihrer Schriften. Dies hatte offenbar auch für die Edition der Shakespeare-Übersetzungen Konsequenzen. Abgesehen davon aber scheint von Beginn an ein Hindernis gewesen zu sein, dass für eine Übersetzungsedition zunächst neue philologische Konzepte entwickelt werden müssen, die sodann in der Praxis erprobt werden. Jedoch liegen solche Konzepte und Praktiken bisher nicht oder nur vereinzelt vor, ohne dass sie weiterentwickelt worden sind. Warum sind sie notwendig? Die Antwort liegt in der Gattung ‚Übersetzung‘, die sich von anderen Werken eines Autor oder einer Autorin maßgeblich unterscheidet: Eine Edition von Übersetzungen folgt nicht einer der wichtigsten Zielvorgaben konventioneller Editionen, nämlich stets einen von einem Autor oder einer Autorin autorisierten Text als maßgebliche Fassung anzunehmen – unter diesen Voraussetzungen jedoch sind Übersetzungen bislang in Editionen überwiegend angesehen und behandelt worden.4 Bei Übersetzungen sind mehrere Texte im Spiel, die gleichrangig nebeneinander stehen, sowie häufig auch mehrere Autoren: Der Textbegriff ist demnach bei Übersetzungen ein anderer als bei anderen Werken.5 Dies wiederum scheint ein zentraler Grund dafür zu sein, dass bis heute weder im analogen noch im digitalen Medium6 ein in der Praxis erprobtes, vor allem aber kaum ein vorbildgebendes Editionskonzept speziell für Übersetzungen existiert. Rüdiger Nutt-Kofoth weist in seinem Beitrag für diesen Band allerdings in überzeugender Weise auf eine Edition hin, die für ihren Autor ein so differenziertes Konzept für die Edition seiner Übersetzungen vorgelegt hat, dass sie für künftige Editionen (zunächst vor allem mit Blick auf das Buch) mustergültig sein könnte: auf die Marburger Büchner-Ausgabe,7 die als einzige historisch-kritische Ausgabe bislang ein ausführliches
3
4
5
6
7
KAWS, https://www.august-wilhelm-schlegel.de (alle Webseiten in diesem Beitrag wurden am 27.11.2022 gesehen). Rüdiger Nutt-Kofoth gibt in seinem Beitrag für diesen Band einen guten Überblick über den bisherigen Umgang mit Übersetzungen von Autoren in historisch-kritischen Ausgaben (Kapitel 3). Dabei wird deutlich, dass sie jeweils unterschiedlich gehandhabt werden. Vgl. dazu und zu den folgenden Anmerkungen zur Besonderheit von Übersetzungseditionen insbesondere auch die Beiträge von Christa Jansohn und Katrin Henzel, vor allem aber von Rüdiger Nutt-Kofoth in diesem Band. Auch die digitale Edition von Lessings Übersetzungen, bereits 2011 von der Lessing-Akademie Wolfenbüttel publiziert und von der DFG im Rahmen des Projekts Digitale Edition sämtlicher Übersetzungen Lessings und ihrer Vorlagen gefördert, bietet nur einen Paralleldruck von Ausgangstext und Lessings Übersetzung, aber kein eigenes digitales Editionskonzept für Übersetzungen – was freilich 2011, in der Frühphase digitaler Editionen, eine große Herausforderung gewesen wäre. Auch ist positiv hervorzuheben, dass dem Ausgangstext in der Edition so viel Raum gegeben wird (http://diglib.hab.de/edoc/ed000146/start.htm). Der gerade erschienene Band Lessing digital. Studien für eine historisch-kritische Neuedition, hrsg. von Cord-Friedrich Berghahn, Kai Bremer und Peter Burschel, Berlin 2022, widmet den Übersetzungen kein eigenes Kapitel. Georg Büchner: Sämtliche Werke und Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit Quellendokumentation und Kommentar (Marburger Ausgabe). Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Hrsg. von Burghard Dedner und Thomas Michael Mayer, [seit 2005:] hrsg. von Burghard
Hamlet – digital ediert
301
und durchdachtes sowie genuin auf Büchners Übersetzungen abgestimmtes Editionskonzept erarbeitet hat, an das sich auch für eine Edition der Shakespeare-Übersetzungen anschließen ließe.8 Wir kommen später noch einmal kurz darauf zurück. Auch Literatur zur Konzeption von Übersetzungseditionen gibt es kaum. Obwohl die bereits vor über zwanzig Jahren in Lingen von der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition veranstaltete Tagung zum Thema Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Transfers zahlreiche wertvolle Impulse für die Edition von Übersetzungen gegeben und diskutiert hat,9 wurden diese Ideen im Anschluss nicht weiterverfolgt oder gar in die Praxis umgesetzt. Zu sehr hing man in der traditionellen Editionsphilologie offenbar noch an der konventionellen Werkausgabe, d.h. die Autorität des einen Autors oder der einen Autorin blieb ebenso wie die Orientierung an einer Werkfassung maßgeblich. Die konzeptionellen Beschränkungen, die damit einhergehen, wurden im Druckmedium gleichsam hingenommen, lassen sich aber für digitale Editionen nicht mehr rechtfertigen oder aufrechterhalten, da Texte nun in einer ganz anderen Dimension in der Breite und Tiefe erschlossen und ediert werden können. Dass die umfassende Erarbeitung eines Editionskonzeptes für Übersetzungen bis heute ausgeblieben ist, liegt demnach zweifelsohne auch daran, dass die Möglichkeiten, die das Buchmedium für Übersetzungseditionen bietet, begrenzt sind. Zu groß ist die Textmenge, mit der man umgehen muss (Ausgangs- und Zieltexte, Vorgängerübersetzungen, überarbeitete bzw. revidierte Übersetzungen durch verschiedene Hände zu Lebzeiten der Übersetzer, benutzte Wörterbücher, zeitgenössische Dokumente wie Briefe, Rezensionen, weitere Rezeptionsdokumente etc.); und zu komplex für eine Buchfassung ist wohl auch die notwendige Verweisstruktur zwischen den Texten, die in einer Übersetzungsedition umgesetzt werden muss (zwischen Ausgangs- und Zieltexten, zwischen Vorgängerübersetzungen, zwischen Vorgängerübersetzungen und Zieltexten etc.). So gilt es, den interkulturellen und interlingualen Transfer auf verschiedenen Ebenen transparent zu machen: Das bedeutet, dass die Texte in mehrere Richtungen und je nach Interessenlage oder Forschungsfrage der Benutzer miteinander verknüpft sein müssen, um z.B. bestimmte sprachliche Phänomene wie etwa Informationen zum Sprachstand, Hinweise auf benutzte Wörterbücher oder auch Phänomene der
8 9
Dedner, mitbegründet von Thomas Michael Mayer. 10 Bde. Darmstadt 2000–2013. Bd. 4: Übersetzungen. Hrsg. von Burghard Dedner unter Mitarbeit von Arnd Beise, Gerald Funk, Ingrid Rehme und EvaMaria Vering. Darmstadt 2007. Die Marburger Büchner- Ausgabe wird derzeit im Rahmen eines DFGProjekts auch als digitale Ausgabe aufbereitet (MBA digital); das Projekt wird in Kürze abgeschlossen und die Edition dann frei zugänglich im Internet abrufbar sein, vgl. https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/digitale-marburger-buechner-ausgabe sowie http://buechnerportal.de/. Vgl. seinen Beitrag Kapitel 3. Dokumentiert sind die Beiträge in dem Band: Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Transfers. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, 8. bis 11. März 2000. Hrsg. von Bodo Plachta und Winfried Woesler. Tübingen 2002 (Beihefte zu editio. 18). Weitere vereinzelte Beiträge, die in anderen Kontexten entstanden sind, werden von Rüdiger Nutt-Kofoth in seinem Beitrag in diesem Band diskutiert.
302
Claudia Bamberg und Thomas Burch
lexikalischen Kreativität10 verstehen und vergleichen zu können; bei August Wilhelm Schlegel sollten ferner Hinweise und Erläuterungen zu seinem Konzept des ‚poetischen‘ Übersetzens nicht fehlen.11 Das wiederum bedeutet, dass die ausgezeichneten Textstellen über die reine Dokumentation hinaus auch kommentiert und erläutert werden müssen. In einer digitalen Edition ist es sehr gut möglich, diese Phänomene zu strukturieren und auch je nach Interessenlage sich anzeigen, also ein- und ausblenden lassen zu können, d.h. die Leser werden von der Fülle an Informationen nicht sofort erschlagen, sondern können selbst entscheiden, welche Informationen für sie relevant sind und entsprechend auswählen. Dabei ist freilich vorab genau zu klären, wie und zu welchem Zweck der interkulturelle Transfer dargestellt werden soll, zumal zunächst geklärt werden muss, was genau hier in systematisierender Weise zu erfassen ist. Dabei wird die Grenze zwischen Dokumentation und Interpretation manchmal fließend sein – und muss nicht zuletzt mit Blick auf die Zielgruppen der Edition wohlüberlegt sein. Mit Blick auf die Übertragungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises – und dies wird auch auf viele andere Übersetzungen zutreffen – muss darüber hinaus auch das Verhältnis zu den jeweiligen Vorgängerübersetzungen gut dokumentiert und gegebenenfalls auch erläutert werden. Für Schlegel sind hier die Übertragungen von Christoph Martin Wieland12 und Johann Joachim Eschenburg zu nennen,13 zudem die Übersetzungsausschnitte von Johann Gottfried Herder für seine Volkslied-Sammlungen.14 Schlegel zog sie nachweislich zu Rate oder nahm sie zumindest zur Kenntnis, 10 11
12
13 14
Vgl. hierzu den Beitrag von Claudine Moulin in diesem Band. Vgl. dazu Peter Gebhardt: A. W. Schlegels Shakespeare-Übersetzung. Untersuchungen zu seinem Übersetzungsverfahren am Beispiel des Hamlet. Göttingen 1970 (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. 257), bes. S. 75–103, sowie Norbert Greiner: Die großen Übersetzungen (Schlegel, Bodenstedt, Hauptmann, Rothe Fried). In: Hamlet-Handbuch. Stoffe, Aneignungen, Deutungen. Hrsg. von Peter W. Marx. Stuttgart, Weimar 2014, S. 28–35, hier S. 28–30; Claudia Bamberg: August Wilhelm Schlegels Konzept des romantischen Übersetzens, oder: Wie wird aus Nationalliteratur Weltliteratur? In: Tra Weltliteratur e parole bugiarde. Sulle traduzioni della letteratura tedesca nell’Ottocento italiano. Hrsg. von Daria Biagi und Marco Rispoli. Padua 2021, S. 23–40. Wielands Shakespeare-Übersetzung erschien in Zürich bei Orell, Geßner und Comp. in den Jahren 1762–1766. Auch Eschenburgs Shakespeare-Übersetzung erschien in Zürich bei Orell, Geßner und Comp. (1775–1782). Vgl. Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Berlin 1877–1913. Auszüge aus Hamlet III,1, wo auch der berühmte Hamlet-Monolog enthalten ist (um den es hier gehen wird), finden sich in Bd. 5, S. 255f., sowie in Bd. 25, S. 127. Vgl. hierzu auch Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 38, Anm. 1: „Die Sammlung Alte Volkslieder (1774), die Herder nach dem Druck des ersten Bogens zurückgezogen und nicht veröffentlicht hat, enthält unter dem Titel Lieder aus Shakespeare (Suphan [s.o., C.B.] 25, 33–60) ungleich mehr Übersetzungsproben aus Shakespeare. […] Zusätzlich aus den Proben aus As You Like It und aus Hamlet in der Sammlung von 1778 erscheint in den Alten Volksliedern je eine weitere Übersetzung: Aus Hamlet […] der Monolog III,1,56ff. Eine frühere und andere Stelle, die Herder verworfen hat, druckt Suphan [s.o., C.B.] 5, S. 255f. ab“, sowie S. 38f.: „In Herders Volkslieder-Sammlung (1. Teil, 1778) findet Schlegel übersetzte Lieder (z.T. in ihrem Textzusammenhang) aus Shakespeares Measure for Measure, Cymbeline, The Tempest, As You Like It, Othelllo, Twelfth Night, Merchant of Venice und aus Hamlet (IV,5,1–39; 67–73, 154–200: unter dem Titel Opheliens verwirrter Gesang um ihren erschlagenen Vater). Fünf der genannten Dramen hat er selbst übersetzt: Der Sturm, Wie es Euch gefällt, Was ihr wollt, Kaufmann von Venedig und Hamlet. Auf der Titelseite der Volkslieder erscheint
Hamlet – digital ediert
303
um sich – was die Übertragungen Wielands und Eschenburgs betrifft – bewusst davon abzusetzen. Hinzu kommen schließlich auch noch die überlieferten handschriftlichen Übersetzungsmanuskripte – für August Wilhelm Schlegels Hamlet-Übersetzung ist hier das sogenannte Hamlet-Manuskript zu nennen, das in der SLUB Dresden verwahrt wird und an dem auch Caroline Schlegel mitgearbeitet hat.15 Diese Manuskripte müssen in einen textgenetischen Zusammenhang gestellt und mit dem Erstdruck, dem Ausgangstext – also der englischen Vorlage –, mit den Vorgängerübersetzungen und mit weiteren Auflagen abgeglichen werden. Auch hier stößt eine Buchedition schnell an ihre Grenzen, wie auch die dokumentarische Transkription von Kaltërina Latifi gezeigt hat: Diese stellt auf statische Weise lediglich einen bestimmten Stand der Übersetzung dar, einen bestimmten Moment im Übertragungsprozess, und bekommt folglich weder das Prozesshafte noch die ganze Komplexität des Übersetzungsvorgangs, aber auch nicht die Text- und Revisionsgeschichte oder die Abfolge der Sofortkorrekturen (die in Schlegels Hamlet-Manuskript zahlreich sind), soweit sie sich rekonstruieren lassen, in den Blick.16 Aber auch weitaus differenziertere Editionen wie sie z.B. durch die Hinzufügung ausführlicher textkritischer Apparate entstehen könnten, vermögen es wohl kaum, die zahlreichen Textbezüge im Medium des Buchs abzubilden; das Ergebnis wäre gerade aus Nutzerperspektive schwer lesbar, d.h. überaus umständlich und nicht zuletzt auch zu statisch. Digitale genetische Editionen wie die Edition Arthur Schnitzler digital: Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905 bis 1931)17 hingegen haben gezeigt, wie innovativ und wie anschaulich die Dynamik der Textgenese in digitalen Editionen inzwischen dargestellt werden kann. Im jüngst publizierten Modul Mikrogenese18 wird die Entstehung eines Textes von Arthur Schnitzler sichtbar gemacht, indem die einzelnen Fassungen automatisch aligniert nach unterschiedlich wählbaren Vergleichsparametern angezeigt werden können.19 Der Entstehungsprozess einzelner Texteinheiten von der
15
16
17 18 19
als Motto Herders Übersetzung der Hamletstelle I,3,7–9. Die Hamlet-Tragödie ist es auch, die am Anfang der Beschäftigung Herders mit Shakespeare steht: Joh. G. Hamann führt Herder 1764 zu Shakespeare. Er lehrt ihn das Englische und liest mit ihm Hamlet.“ SLUB Dresden, Msc.Dresd. e.90,XXII,1 (http://digital.slub-dresden.de/id329494473). Vgl. die dokumentarische Transkription des Manuskripts bei Kaltërina Latifi: August Wilhelm Schlegel: Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Kaltërina Latifi. Hildesheim, Zürich, New York 2018 (Germanistische Texte und Studien. 100). Vgl. auch Claudia Bamberg: Prolegomena zu einer künftigen Edition der Shakespeare-Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel und dem Tieck-Kreis. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 256, 2019, H. 2, S. 421–435, sowie auch die weiteren Rezensionen zu Latifis Edition, etwa die Rezension von Roger Paulin: August Wilhelm Schlegel Hamlet-Manuskript: Kritische Ausgabe by Kaltërina Latifi. In: Modern Language Review 114, Juli 2019, Stück 3, S. 588–590, und die weiteren aufgeführten Besprechungen in Christa Jansohns Aufsatz in diesem Band, Kapitel 3, Anm. 53. https://www.arthur-schnitzler.de. Vgl. etwa die Mikrogenese zu Fräulein Else: https://www.schnitzler-edition.net/mikrogenese/9257. Die Mikrogenese wurde mit dem im Rahmen der Schnitzler-Edition am Trier Center for Digital Humanities entwickelten Werkzeug Comparo erarbeitet, mit dem eine nahezu beliebige Anzahl von Texten miteinander verglichen werden kann (https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/comparo).
304
Claudia Bamberg und Thomas Burch
ersten Fassung bis hin zum Druck wird dadurch en détail, in allen Varianten und Veränderungen, dynamisch sicht- und nachvollziehbar. Auch für Übersetzungseditionen ist ein solches Modul denkbar, auch wenn hier die Voraussetzungen etwas andere sind. Denn es geht hier nicht (nur) um die Entstehung eines Textes von den handschriftlichen Entwürfen über Typoskriptfassungen bis zum ‚vollendeten‘ Werk, sondern (auch) darum, verschiedene gleichrangige Übersetzungsfassungen, die von unterschiedlichen Autoren stammen können und in nacheinander erschienenen Drucken zu Lebzeiten vorliegen, miteinander zu vergleichen und die Textänderungen von Fassung zu Fassung weiter zu verfolgen. Die Absicht ist also weniger eine mikro-‚genetische‘ als vielmehr eine mikro-‚revisionistische‘. Dies alles impliziert, dass es sich bei Übersetzungen tendenziell um unfeste und wandelbare Texte handelt – mit Blick auf die romantische Poetik durchaus im Sinne einer „progressive[n] Universalpoesie“.20 Es geht also um Texte, die sich fortlaufend verändern können und von denen es nicht eine einzige abgeschlossene, ‚vollendete‘ Fassung gibt, die zugleich aber dennoch als originäre Werke angesehen werden müssen und einem Autor oder einer Autorin – oder gar einem Autorenkreis – zuzuschreiben sind. Auch August Wilhelm Schlegel selbst verstand seine poetischen Übersetzungen auf der Grundlage frühromantischer Poetik ganz in diesem Sinne explizit als Fortschreibungen und schöpferische Steigerungen der Originale und keinesfalls als bloße Nachahmungen (von abgeschlossenen Originalwerken), wie er in den Berliner Vorlesungen über die romantische Poesie erklärt. Auf den Vorwurf, das Übersetzen „rühre von der Geistesträgheit und Knechtschaft her und erzeuge sie auch wieder“, antwortet er hier: Hiegegen läßt sich leicht dartun, daß das objective poetische Übersetzen ein wahres Dichten, eine neue Schöpfung sei. Oder wenn jemand sagt, man solle gar nicht übersetzen, so setzt man ihm entgegen: der menschliche Geist könne eigentlich nichts als übersetzen, alle seine Thätigkeit bestehe darin.21
In der Theorie der Frühromantik gilt das Übersetzen als ein geradezu urpoetischer Akt, denn jede sprachliche Äußerung erscheint hier bereits als ein geistiger und damit schöpferischer Übertragungsvorgang, bei dem etwas Natürliches in Geistiges umgewandelt – ‚übersetzt‘ – wird. Dabei geht Schlegel sogar so weit, in den ersten lallenden Lauten von Kindern einen solchen übersetzerischen Akt zu sehen: Er versteht jene Laute also gerade nicht bloß als physische Naturlaute, sondern sieht in ihnen Anfänge von Poesie,
20
21
So Friedrich Schlegel im berühmten 116. Athenaeumsfragment: „Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie.“ KFSA, Bd. II: Charakteristiken und Kritiken I. 1796–1801. Hrsg. von Hans Eichner. München u.a. 1967, S. 182. Vgl. zu diesem Zusammenhang auch Bamberg 2021 (Anm. 11). August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über die romantische Poesie [1803–1804]. In: KAV, Bd. II/1: Vorlesungen über Ästhetik (1803–1827). Textzusammenstellung von Ernst Behler. Mit einer Nachbemerkung von Georg Braungart. Paderborn u.a. 2007, S. 1–194, hier S. 24.
Hamlet – digital ediert
305
eine schöpferisch-gestaltende, poietische Handlung: „[D]ie Sprache ist in ihrem Ursprunge poetisch“,22 schreibt er in den Berliner Vorlesungen, denn „Poesie [ist] das Unentbehrlichste, Erste, Ursprünglichste in allem menschlichen Tun und Treiben […]“.23 Folglich ist auch jedes sprachliche Kunstwerk, die Poesie, als eine besondere Form jener Übertragung, das Produkt eines solchen Übersetzungsvorgangs: das Ergebnis einer Tätigkeit, bei der der Mensch etwas geistig aktiv hervorbringt, etwas erschafft und gestaltet, schöpferisch tätig wird, seine poietische Gabe einsetzt, Natürliches in Geistiges verwandelt. Und dieser Übertragungsvorgangs wird in der Übersetzung – als einer weiteren Stufe der Übertragung – noch einmal gesteigert.24 Auch Novalis hebt anlässlich des Erscheinens von Schlegels Shakespeare-Übersetzung in einem Brief an Schlegel vom 30. November 1797 den Zusammenhang von Poesie und Übersetzung hervor: „Übersetzen ist so gut dichten, als eigne Wercke zu stande bringen – und schwerer, seltner. Am Ende ist alle Poesie Übersetzung.“25 Dieser poetologische Hintergrund bekräftigt, was Rüdiger Nutt-Kofoth bereits im Jahr 2000 in seinem Beitrag mit dem Titel Autor oder Übersetzer oder Autor als Übersetzer? Überlegungen zur editorischen Präsentation von ‚Übertragungen‘ am Beispiel Stefan George auf der Lingener Tagung zu Edition und Übersetzung für literarische Übersetzungen gesagt hat: […] für diese Art der Übersetzung [ist] konstitutiv, dass der Verfasser der Übersetzung als literarischer Autor diese nicht – oder nicht allein – als Brotarbeit anfertigt, sondern – auch – aufgrund eigener ästhetischer Interessen, bestimmter Bezüge zu seinem eigenen Werk oder seiner Dichtungsvorstellung. In diesem Sinne ist der Übersetzer als der Autor des neuen Textes anzusehen.26
Auch dies ist eine unhintergehbare Prämisse für die Konzeption einer Übersetzungsedition und bedeutet noch einmal zusammengefasst: Vom Konzept der einen letztgültigen Fassung gilt es mit allen editorischen Konsequenzen abzurücken, zugleich aber
22
23 24
25 26
August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über philosophische Kunstlehre [Jena 1798–1799]. In: KAV, Bd. I: Vorlesungen über Ästhetik I [1798–1803]. Mit Kommentar und Nachwort hrsg. von Ernst Behler. Paderborn u.a. 1989, S. 1–177, hier S. 7. Schlegel 1989 (Anm. 22), S. 392. Zu erinnern ist dabei stets, dass ‚Poesie‘ bei den Romantikern nicht gleichzusetzen ist mit ‚Literatur‘: Denn Poesie ist für Schlegel „gemessene[] Bewegung“, ist gebunden an Rhythmus, Silbenmaß und Klang – und dies ist sie nicht im Zwang und auch nicht, um sich mit „äußerliche[m] Zierat“ zu schmücken, sondern, ganz im Gegenteil, dies ist sie aus ihrer innersten Natur aus heraus, als urmenschlicher, poietischer Ausdruck des Menschseins (August Wilhelm Schlegel: Briefe über Poesie, Silbenmaß und Sprache [1795]. In: Ders.: Kritische Schriften und Briefe. Hrsg. von Edgar Lohner. Bd. 1: Sprache und Poetik. Stuttgart 1962, S. 141–180, hier S. 148 und 147). KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/4161. Rüdiger Nutt-Kofoth: Autor oder Übersetzer oder Autor als Übersetzer? Überlegungen zur editorischen Präsentation von ‚Übertragungen‘ am Beispiel Stefan George. In: Plachta/Woesler 2002 (Anm. 9), S. 88–103, hier S. 88f.
306
Claudia Bamberg und Thomas Burch
muss bei der literarischen Übersetzung an der Vorstellung, dass hier ‚Werke‘ von Autoren, also ihren übrigen Texten gleichrangige Schriften, geschaffen werden, festgehalten werden. Das Gesagte sollte deutlich machen, dass es wohl erst mit digitalen Methoden möglich wird, eine Übersetzungsedition adäquat umzusetzen. Jene Methoden sind im Jahr 2000 auf der Lingener Tagung zur Edition von Übersetzungen noch nicht weiter in den Blick geraten27 – genuin digitale bzw. Born-Digital-Editionen gab es zu diesem Zeitpunkt bekanntlich noch nicht. Das macht die Entwicklung eines neuen Konzepts einerseits schwieriger, andererseits liegt in dieser Forschungslücke aber auch eine Chance. Übersetzungseditionen können nun von vornherein für das digitale Medium konzipiert werden und müssen nicht mehr auf gedruckte Editionen und deren etablierte Konzepte Rücksicht nehmen. Es muss also kein medial-philologischer Transformationsprozess von der Konzeption für das Buch in das digitale Medium stattfinden, wie es bei den konventionellen Editionen in der Regel der Fall ist. Schließlich sind auch die Nutzer- und Lesergruppen von Anfang an in den Blick zu nehmen. Wer soll eine digitale Übersetzungsedition nutzen, für wen könnte sie interessant sein? Mit Blick auf die romantischen Shakespeare-Übersetzungen fallen einem gleich mehrere Zielgruppen ein: Neben den Fachwissenschaftlern (Germanistik, Anglistik, Übersetzungswissenschaften, Theaterwissenschaften, Editionsphilologie) etwa auch Studierende und Schüler, Übersetzer und Dramaturgen, nicht zuletzt auch interessierte Laien. Dieser breite Nutzerkreis erfordert einen klaren und nicht allzu komplexen Aufbau sowie verschiedene Zugänge zu den Texten, denen unterschiedliche Erschließungstiefen entsprechen. Im Folgenden soll nun ein erstes mögliches digitales Editionskonzept für den Hamlet in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und der anschließenden Bearbeitung durch den Kreis um Ludwig Tieck vorgestellt werden. Dabei gliedern sich die Überlegungen in zwei Teile: Zunächst wird es um die Überlieferungsgeschichte und die verschiedenen Textfassungen der Hamlet-Übersetzung gehen, und in einem zweiten Schritt soll dann anhand eines Beispiels – der ersten Szene des dritten Aufzugs mit dem berühmten Hamlet-Monolog – ein erstes Konzept einer digitalen Edition der ‚SchlegelTieckschen‘ Shakespeare-Übersetzungen präsentiert werden. Dieses Konzept versteht sich als erster Versuch einer Umsetzung unter Berücksichtigung der von uns und in diesem Band reflektierten Anforderungen an eine solche Edition und ist sicherlich noch diskussions- und revisionsbedürftig.
27
Erste leise Hinweise darauf finden sich im Beitrag von Horst Turk, der zumindest von den Möglichkeiten einer „digitalen Aufbereitung“ spricht – ohne freilich schon an digitale Editionen zu denken. Horst Turk: Edition und Übersetzung. In kulturvergleichender und kontaktgeschichtlicher Sicht. In: Plachta/Woesler 2002 (Anm. 9), S. 5–20, hier S. 19.
Hamlet – digital ediert
307
2. Zur Überlieferung der romantischen Hamlet-Übersetzung (mit dem Schwerpunkt auf August Wilhelm Schlegel) Zu Lebzeiten Schlegels und Tiecks ist die Hamlet-Übersetzung im Rahmen der Schlegelschen Ausgabe und des nachfolgenden sog. ‚Schlegel-Tieck‘ insgesamt neun Mal gedruckt worden: Sie wurde in den Jahren 1798, 1800 (als Einzeldruck), 1818, 1823, 1831, 1841, 1844, 1850 und 1852 publiziert,28 dabei sind die ersten beiden Ausgaben bei Unger erschienen, die weiteren bei Reimer; der Unger-Verlag ist 1811 in Konkurs gegangen. Hinzu kommt das in der SLUB Dresden erhaltene Hamlet-Manuskript,29 das die Transformation der Übersetzung in eine ‚poetische‘ dokumentiert, d.h. es handelt sich bei dieser handschriftlichen Fassung offensichtlich nicht um die erste Übersetzungsskizze,30 aber auch nicht um die Reinschrift bzw. die Druckvorlage, sondern um die Fassung, in welcher der von Schlegel intendierte Poetisierungsprozess – das ‚poetische‘ Übersetzen31 – erstmals umgesetzt wird.32 An einigen Stellen ist die Handschrift Caroline Schlegels zu erkennen,33 die wie auch August Wilhelm Schlegel Korrekturen und Varianten im Manuskript einfügte. Von den neun Drucken der Hamlet-Übersetzung stammen die ersten vier von August Wilhelm Schlegel allein; die Hamlet-Übersetzung im Rahmen der ersten ‚SchlegelTieckschen‘-Ausgabe von 183134 enthält erstmals die Eingriffe Tiecks, die sich mit Blick auf die von uns gewählte Beispielszene – die 1. Szene des 3. Aufzugs – vor allem in einer Szenenumstellung zeigen: Die 1. Szene des 3. Aufzugs wurde von Tieck aus dramaturgischen Gründen ans Ende des 2. Aufzuges verlegt.35 Nach den Beschwerden Schlegels darüber sind die Eingriffe Tiecks vom Verlag für die weiteren Drucke wieder rückgängig gemacht worden,36 zu Schlegels und Tiecks Lebzeiten sind noch einmal vier Auflagen erschienen.
28
29 30
31
32 33 34
35 36
Vgl. die Übersicht über die Druckgeschichte in dem sehr lesenswerten Artikel von Julia Jennifer Beine: Die Re- bzw. Dekonstruktion des „Schlegel-Tieck-Shakespeare“ anhand der kritischen Edition des Hamlet. In: forsch! – Studentisches Online-Journal der Universität Oldenburg, Bd. 1, 2017, S. 75– 86, hier S. 78. Siehe Anm. 15. Dies ist beim Sommernachtstraum und Romeo und Julia anders: Von diesen beiden Dramen sind in der SLUB Dresden auch frühere Entwürfe der Übersetzung überliefert. Vgl. Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 130, Anm. 5. Siehe hierzu v.a. August Wilhelm Schlegels programmatischen Aufsatz Etwas über William Shakespeare bey Gelegneheit Wilhelm Meisters. In: Die Horen 6, 1796, Stück 4, S. 57–112, sowie die Ausführungen in der Forschung bei Andreas Huyssen: Die frühromantische Konzeption von Übersetzung und Aneignung. Studien zur frühromantischen Utopie einer Weltliteratur. Zürich 1969, S. 69–96, Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 84–103, Bamberg 2021 (Anm. 11), S. 31–36 sowie im Beitrag von Claudine Moulin in diesem Band. Vgl. hierzu Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 130, Latifi 2018 (Anm. 15), S. 412. Siehe etwa auf 26v, 37r und 55r im Dresdner Hamlet-Manuskript (Anm. 15). Shakspeare’s dramatische Werke. Uebersetzt von A. W. von Schlegel, ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck. Sechster Theil. Titus Andronicus. Hamlet, Prinz von Dänemark. Der Widerspenstigen Zähmung. Die Comödie der Irrungen. Berlin 1831, S. 77–196. Siehe hierzu Beine 2017 (Anm. 28), S. 81–83. Vgl. dazu auch den Beitrag von Stefan Knödler in diesem Band.
308
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Schlegel hatte natürlich die Vorgänger-Übersetzungen von Christoph Martin Wieland und Johann Joachim Eschenburg sowie auch Johann Gottfried Herders Teilübersetzungen studiert; Wielands Hamlet-Übersetzung stammt aus dem Jahr 1766,37 Eschenburgs von 1777.38 Mit Eschenburgs Vorschlägen haben er und Caroline Schlegel nachweislich gearbeitet, wie nicht nur vereinzelte „E.“ bzw. „Esch.“, an den Rand notiert, im Manuskript anzeigen.39 Aber auch die Übersetzungsauszüge von Johann Gottfried Herder – die bereits metrische waren und auch etwa den Hamlet-Monolog enthalten40 – hat Schlegel gekannt; seine Übersetzungsmaximen sind, wie Peter Gebhardt dargelegt hat, von Herder beeinflusst.41 Tieck und sein Kreis wiederum arbeiteten ab den frühen 1820er Jahren mit ihren eigenen Vorgänger-Übersetzungen; hier ist zu bedenken, dass seit Schlegels Übersetzungen weitere deutsche Übertragungen erschienen sind, die der Tieck-Kreis zur Kenntnis genommen hat.42 Darüber hinaus sind freilich auch die Ausgangstexte in die Edition unbedingt mit einzubeziehen: Für August Wilhelm Schlegel ist hier in erster Linie die Ausgabe von Edmond Malone aus dem Jahr 178643 zu nennen, daneben aber auch jene von Samuel Johnson und George Steevens aus dem Jahr 177344 – beide Ausgaben nennt er selbst im Vorwort des ersten Bandes seiner Shakespeare-Übersetzung, die 1797 bei Unger erschienen ist.45 Tieck und sein Kreis wiederum haben weitere Ausgangstexte herangezogen,46 so dass sich ein sehr komplexes Gefüge an zu edierenden Texten ergibt. Auch die Wörterbücher, die von den einzelnen Übersetzern bei der Arbeit zu Rate gezogen wurden, sind für die Kommentierung des interkulturellen Transfers unabdingbar. Dabei ergibt sich für jeden der Übersetzer der Shakespeare-Übersetzung ein eigenes Bild. August Wilhelm Schlegel etwa benutzte wohl die Wörterbücher von Theodor 37
38
39
40 41 42
43
44
45
46
Shakespear: Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. VIItr Band: Hamlet, Prinz von Dännemark. Ein Trauerspiel. Zürich 1766. William Shakespear’s Schauspiele. Neue Ausgabe. Von Johann Joachim Eschenburg, Professor am Collegio Carolino in Braunschweig. Bd. 12: Drey Trauerspiele. Romeo und Julie. Hamlet. Othello. Zürich 1777. Siehe z.B. auf 43v und 44r des Dresdner Hamlet-Manuskripts (Unterstreichung im Original). – Dass Schlegel auch noch für den letzten Band seiner Übersetzung, der erst 1810 erschien, Eschenburg konsultierte, geht aus einem Brief von Johann Ferdinand Koreff vom Februar 1807 an ihn hervor: „Den Theil von Eschenburgs Shakespeare, den Sie verlangten habe ich nicht bekommen können […]“. KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/142. Vgl. Anm. 16. Vgl. dazu Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 32–57. Zum hochkonkurrenten Markt der deutschen Shakespeare-Übersetzungen ab den 1820er Jahren vgl. Roger 2003 (Anm. 1). The Plays of William Shakespeare. Accurately printed from the text of Mr. Malone’s edition; with selected explanatory notes. Volume the seventh. Containing Cymbeline. King Lear. Romeo and Juliet. Hamlet. Othello. London: 1786. The Plays of William Shakspeare. Volume the tenth. Containing Romeo and Juliet. Hamlet. Othello. London 1773. August Wilhelm Schlegel: Vorerinnerung. In: Shakspeare’s dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Erster Theil. Berlin 1797, S. III–VI, hier S. V. Vgl. zu Tiecks Shakespeare-Bibliothek ausführlich den Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann.
Hamlet – digital ediert
309
Arnold (Englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch. Leipzig 1790) und Samuel Johnson (Samuel Johnson’s Dictionary of the English Language. 8th edition. London 1786), die, unter den Nummern 1090 und 1091, im Katalog seiner nachgelassenen Büchersammlung aufgeführt sind.47 Zu bedenken ist bei dieser nachgelassenen Büchersammlung allerdings, dass sie nicht die Bibliothek des jungen Schlegel – und damit nicht die Bibliothek des Übersetzers – abbildet, die zumindest in den 1790er Jahren ohnehin nicht reich bestückt war. So heißt es in einem Brief Schlegels an Georg Andreas Reimer vom 29. bis 31. Dezember 1838, dass er damals für eine kommentierte Übersetzung „nicht gehörig mit Hülfsmitteln ausgerüstet“ gewesen sei; „ich hatte keine Shakspear-Bibliothek, wie Eschenburg sie besaß; die Anschaffung einer solchen hätte leicht das Doppelte und Dreifache des Honorars für die Übersetzung verschlungen […].“48 Schlegels frühe Bibliothek ist indessen im handschriftlichen Verzeichniß meiner Bücher bis 181149 mit aufgelistet, allerdings nicht vollständig.50 Gleichwohl muss das Verzeichniß für eine Edition der Übersetzungen so genau wie möglich untersucht werden. Wie viel mehr und welche Literatur Ludwig Tieck – der freilich auch anders gelagerte Absichten als der junge Schlegel verfolgte – und seinem Kreis ab den 1820er
47
48
49 50
Katalog der von August Wilhelm von Schlegel, Professor an der Königlichen Universität zu Bonn, Ritter etc., nachgelaßnen Büchersammlung, welche Montag den 1sten December 1845 und an den folgenden Tagen Abends 5 Uhr präcise bei J. M. Heberle in Bonn öffentlich versteigert und dem Letztbietenden gegen gleiche baare Bezahlung verabfolgt wird. Bonn 1845. Siehe dazu Gebhardt 1970 (Anm. 11), S. 82. Zu den vom Tieck-Kreis benutzten Wörterbüchern vgl. den Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann in diesem Band. Böcking, Bd. 1., S. 249. – Zu Schlegels (Nicht-)Nutzung von Eschenburgs Bibliothek für die eigene Übersetzung – die vermutlich auch Skrupeln gegenüber dem Vorgängerübersetzer, der gut mit der Familie Schlegel bekannt war, geschuldet war – vgl. den Beitrag von Nikolas Immer in diesem Band, Kapitel 1, Anm. 30. SLUB Dresden, Mscr. Dresd. 3.90,XV, http://digital.slub-dresden.de/id343238063. Vgl. dazu Roger Paulin: Der kosmopolitische Büchersammler. Zu August Wilhelm Schlegels Verzeichniß meiner Bücher im December 1811. In: Kooperative Informationsstrukturen als Chance und Herausforderung. Thomas Bürger zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Achim Bonte und Juliane Rehnolt. Berlin 2018, S. 317–325, S. 318. Die Vorgeschichte dieses Verzeichnisses von 1811 ist turbulent: Schlegel hatte seine Bücher bei dem einstigen romantischen Mitstreiter August Ferdinand Bernhardi in Berlin deponiert, als er 1804 recht plötzlich nach Coppet aufbrach und in die Dienste Germaine de Staëls trat; Bernhardi wollte sie später aber nicht mehr herausrücken. Schließlich jedoch gelang es der Berliner Verlegerin Friederike Helene Unger, die Schlegel beauftragt hatte, nach Jahren des Streits mit Bernhardi, die Sammlung wiederzuerlangen. Vgl. dazu Schlegels Briefwechsel mit der Verlegerin Friederike Helene Unger (KAWS, https://www.august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=36_absender.LmAdd.personid17:4709+OR+36_adressat.LmAdd.personid17:4709). Hier schreibt Unger etwa am 24. Mai 1806 an Schlegel aus Berlin nach Paris: „Der Katalog Ihrer Bibliothek wird heut fertig; und würde es eher geworden sein, wäre Hh: Bernhardi nicht verreiset gewesen. Fällt er nicht zu stark aus, sende ich ihn […]“. (KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1695). Es sollte noch vier Jahre dauern – in denen Schlegel mehrfach das Gericht beauftragte –, bis die Bücher samt Katalog tatsächlich nach Coppet abgingen (vgl. Ungers Brief an Schlegel vom 17. März 1810, KAWS, https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/1685). Hier fehlt noch eine genaue Aufarbeitung der Zusammenhänge. So ist bis heute auch nicht klar, was mit diesen und mit den bis 1817 (dem Todesjahr de Staëls) erworbenen Büchern geschehen ist; Schlegels in der Schweiz und in Frankreich verbliebene Nachlassteile sind bis heute weitestgehend in (unzugänglichem) Privatbesitz.
310
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Jahren zur Verfügung stand, zeigt der Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann in diesem Band. Diese ganze Komplexität an Texten, Kommentaren und Verknüpfungen nun muss in der Architektur einer digitalen Edition so abgebildet werden, dass zum einen deutlich wird, wie die Texte zueinander in Beziehung stehen (vgl. dazu auch unsere Skizze, Abb. 1). Zum anderen muss es möglich sein, sich variable Synopsen anzeigen zu lassen, um die verschiedenen Textfassungen, Ausgangs- und Zieltexte, Ausgangs- und Ausgangstexte sowie auch Zieltexte und Zieltexte je nach Forschungsfrage miteinander vergleichen zu können.
Abb. 1: Die Hamlet-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und des Tieck-Kreises mit den zu beachtenden Ausgangstexten und Vorgänger-Übersetzungen
Hamlet – digital ediert
311
Das Hamlet-Manuskript selbst sollte, als frühester überlieferter Textträger der HamletÜbersetzung und damit der Ausgangspunkt der darstellbaren Genese, so feingranular wie nur möglich transkribiert und ediert werden, um den Übersetzungsprozess bis in jedes Detail nachvollziehbar zu machen und verstehen zu können. Hierzu bietet sich das vom Trier Center for Digital Humanities im Rahmen der digitalen Schnitzler-Edition entwickelte Transkriptionswerkzeug Transcribo an, das eine zeichengenaue Transkription und Annotation ebenso ermöglicht wie eine detaillierte Erfassung textgenetischer Zusammenhänge (vgl. Abb. 4).51 Zugleich kann damit die Transkription über das Faksimile gelegt und so das überaus komplexe Manuskript mit seinen zahlreichen Durchstreichungen, Einfügungen und Marginalien lesbar gemacht werden. Für den Tieck-Kreis wären die Angaben, die hier mit dem Fokus auf August Wilhelm Schlegel angeführt wurden, zu ergänzen. Hier sei an dieser Stelle nur noch einmal auf den Beitrag von Achim Hölter, Paul Ferstl und Theresa Mallmann sowie auch auf den Aufsatz von Stefan Knödler und Jochen Strobel in diesem Band verwiesen. Bleibt zu erwähnen, dass freilich auch die Dokumente zur Entstehungsgeschichte – wie z.B. Briefe – sowie die die Übersetzungen begleitenden Schriften der Autoren Teil der digitalen Edition sein müssen. Überhaupt muss der Entstehungs- und Rezeptionskontext der einzelnen Übersetzungen sehr genau aufgearbeitet und dargelegt werden. Hier hat Rüdiger Nutt-Kofoth in seinem Beitrag für diesen Band mit Blick auf die Marburger Büchner-Ausgabe konkrete Vorschläge gemacht, an denen man sich gut orientieren kann.52 Für eine genuin digitale Edition ist zu ergänzen, dass alle Informationen eng miteinander zu verknüpfen sind, so dass eine eng vernetzte Edition entsteht, die vielfältige Zugriffe, Anzeigemöglichkeiten und Explorationen ermöglicht – so wie es auch die Digitale Marburger Büchner-Ausgabe (MBA digital)53 umsetzt, die in Kürze freigeschaltet wird, die aber freilich als Ausgangsressource die Druckausgabe zugrunde legt und damit in einem gewissen Maße an das Druckmedium gebunden bleibt. In einer Born-Digital-Edition jedenfalls stehen die Teile nicht mehr starr hintereinander oder bilden keine voneinander getrennten Blöcke mehr, sondern können in variablen und eng verknüpften Tableaus zusammengestellt werden. Schließlich ist indessen auch zu fragen, ob eine solche digitale Übersetzungsedition nun tatsächlich nur als ‚historisch-kritische‘ zu realisieren ist oder ob möglicherweise auch schon eine etwas niedrigschwelligere oder zumindest anders konzipierte Ausgabe – eine ‚kritische‘ Ausgabe etwa oder ein ganz neuer digitaler Typus: hier macht Katrin Henzel in ihrem Beitrag bedenkenswerte innovative Vorschläge – dem Anspruch einer wissenschaftlichen Erschließung und Präsentation der in Frage stehenden Texte in ihrem Zusammenhang gerecht wird. Vor dem Hintergrund der Fülle an Materialien, die in eine Übersetzungsedition wie jene zu August Wilhelm Schlegel und dem Tieck-Kreis einfließen müssen, darf diese Frage erlaubt sein. Nun aber zu unserem Beispiel einer Umsetzung. 51 52 53
Vgl. https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/transcribo. Vgl. Kapitel 3. Vgl. Anm. 7.
312
Claudia Bamberg und Thomas Burch
3. Erste Überlegungen zur Konzeption einer digitalen Ausgabe Gegenüber digitalen Editionen, wie es sie seit mehr als zwanzig Jahren gibt, und die zunächst die Ergebnisse sogenannter Retrodigitalisierungsprojekte waren und damit vorrangig auf die digitale Aufbereitung und Nachbildung gedruckter Ausgaben abzielten, lassen sich heutige digitale Editionen von Beginn an ganz anders denken und umsetzen. An die Stelle der Reproduktion einer Buchausgabe tritt ein Softwaresystem als Internetanwendung mit einer mehr oder weniger komplexen graphischen Benutzerschnittstelle, basierend auf einem Datenbanksystem, in dem der Editionsgegenstand möglichst generisch und fein granular modelliert ist. Digitale Editionen sind damit ein Produkt der Digital Humanities, indem vorwiegend computergestützte Methoden zur Erstellung, Erforschung und Verbreitung von wissenschaftlich fundierten Quellenveröffentlichungen herangezogen werden. Zeichnet sich schon die „klassische“ Editionspraxis durch historisch gewachsene Diversität aus, erhält dieses Forschungsgebiet durch die Erweiterung um den Aspekt der digitalen Arbeitsmethoden eine weitere Dimension an Komplexität: Neben den wissenschaftshistorisch betroffenen Fachwissenschaften (Editionsphilologie, Historische Hilfswissenschaften usw.) diskutieren und beeinflussen nun auch andere Forschungsbereiche (z.B. Datenarchivierung, Layout- und Texterkennung, Datenvisualisierung, Historische Fachinformatik, Computerlinguistik) die Entwicklung und Umsetzung von Digitalen Editionen.54
Die vom Kompetenznetzwerk Digitale Edition herausgegebene Definition zielt im Wesentlichen auf zwei Aspekte einer digitalen Ausgabe ab: einerseits auf ihre Modellierung, Erstellung und Produktion, die computergestützt erfolgt, und andererseits auf ihre Publikationsform, die ebenfalls rechnergestützt von den Funktionalitäten her weit über das hinaus geht, was mit gedruckten Ausgaben möglich ist. Beide Aspekte haben entscheidenden Einfluss auf die Organisation und die Arbeitsabläufe in digital aufgestellten Editionsprojekten. Eine zentrale Voraussetzung für die hier vorgesehene digitale Edition besteht daher zunächst darin, eine formale Beschreibung der Strukturen des zu untersuchenden Gegenstands zu finden und zumindest teilweise automatisierbare Verfahren zur Gewinnung dieser Beschreibung zu definieren. Dieser als Datenmodellierung bezeichnete Prozess zielt darauf ab, die Datensemantik zu organisieren, Daten zu beschreiben und die Konsistenzgrenzen von Daten anzugehen.55 Sie kann mit einer Zeichnung oder einem Gebäudeplan eines Architekten verglichen werden, der die Grundlage für die konzeptionelle Modellierung bildet und die Beziehungen zwischen verschiedenen Datenkomponenten festlegt. Hauptziel ist dabei die eindeutige Definition und Spezifikation der in einem Informationssystem zu verwaltenden Objekte, ihrer zugehörigen Attribute und Eigenschaften sowie der Zusammenhänge zwischen den Informationsobjekten, um 54 55
KONDE – Kompetenznetzwerk Digitale Edition, https://www.digitale-edition.at. Vgl. Ramez Elmasri, Sham Navathe: Fundamentals of database systems. Boston u.a. 2017.
Hamlet – digital ediert
313
so einen schematischen Überblick über die Datensicht des gesamten Systems erhalten zu können. Ergebnisse dieses Prozesses sind Datenmodelle, die, mehrere Modellierungsstufen durchlaufend, letztlich zu einsatzfähigen Datenbanken bzw. Datenbeständen führen. Ein solches Datenmodell besteht aus einer Reihe von Spezifikationen und Diagrammen zur Erläuterung der Datenanforderungen und der zugehörigen Designs. Im Allgemeinen finden drei Arten von Datenmodellierungstypen und -aktivitäten Anwendung in der Praxis: a) ein konzeptionelles Datenmodell definiert im Wesentlichen, was das System inhärent enthält; b) ein logisches Datenmodell dient dazu, festzulegen, wie ein System unabhängig vom verwendeten Datenbankmanagementsystem implementiert werden muss. Das Ziel der Erstellung eines logischen Datenmodells ist die Entwicklung einer hochtechnischen Abbildung der zugrunde liegenden Regeln und Datenstrukturen; c) das physische Datenmodell bezieht sich auf die Art und Weise, wie das System implementiert wird, und berücksichtigt das zur Implementierung der Anwendung eingesetzte Datenbankmanagementsystem. Dieser Modelltyp wird normalerweise von Entwicklern erstellt, und es definiert, wie die tatsächliche Datenbank eingerichtet wird. Im Allgemeinen sind sowohl die konzeptionelle Datenmodellierung als auch die logische Datenmodellierung Aktivitäten der „Anforderungsanalyse“, während die physische Datenmodellierung als Designtätigkeit betrachtet wird. Im Sinne des konzeptionellen Datenmodells lässt sich die Gesamtkonstellation der Hamlet-Fassungen zunächst abstrakt als multidimensionales System fassen, wobei eine Dimension „T“ die sequentielle Textstruktur repräsentiert, d.h. den im Falle eines Dramentextes vergleichsweise stringenten Aufbau des Werkes als Folge von Akten, Szenen, Sprechern mit ihren jeweiligen Redebeiträgen und eingeschobenen Bühnenanweisungen. Eine zweite Dimension „Z“ ergibt sich aus der chronologischen bzw. stemmatischen Abfolge der Ausgaben. Die dritte Dimension „S“ wird durch die beiden Sprachebenen (englisch – deutsch) aufgespannt. Zwischen den Dimensionen bestehen Verbindungen, die insgesamt das Geflecht der Ausgaben in Bezug auf die Basiseinheiten des Textes repräsentieren. So spiegeln die Verbindungen (Ti, Ti+1) innerhalb der Ebene T den linearen Ablauf des Textes einer Ausgabe gemäß der definierten Basiseinheiten wider. Relationen (Zi, Zj) in der Ebene der Ausgaben bilden die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen diesen wort- bzw. zeichenweise ab und dokumentieren vor allem die Modifikationen, während die Beziehungen zwischen den Sprachebenen (Sen, Sde) die Übersetzungsvorgänge festhalten. Jede der modellierten Verbindungen kann in einer weiteren Metaebene kommentiert und annotiert werden, um qualitative Merkmale der Befunde zu beschreiben. Ausgehend vom konzeptionellen Entwurf wird zur Implementierung in einem konkreten Datenbanksystem das logische Datenmodell daraus abgeleitet, indem die abstrakten Bezüge auf Basis der drei Hauptbestandteile „Entitäten“, „Relationen“ und „Attribute“ modelliert werden. Jede Entität stellt dabei eine Reihe von für das Modell relevanten Objekten (z.B. Personen, Orte, Reden, Kommentare etc.) oder Konzepten dar. Relationen beschreiben Zusammenhänge zwischen je zwei der Entitäten (z.B. „Person P ist Sprecher von Rede R“), während Attribute beschreibende Merkmale oder
314
Claudia Bamberg und Thomas Burch
andere Informationen, die der näheren Klassifikation einer Entität dienen, repräsentieren (z.B. „Person P ist weiblich“). Im Falle unseres Vorhabens gilt es also zunächst im Sinne der konzeptionellen und logischen Datenmodellierung, die relevanten Entitäten zu identifizieren. In einem Top-Down-Prozess, d.h. von über- zu untergeordneten Einheiten, lässt sich zunächst die Entität der „Werkfassung“ identifizieren, die durch Attribute wie „Autor“, „Erscheinungsjahr“, „Sprache“, „Typ“ (Manuskript, Druck) etc. präzisiert werden kann. Auf dieser oberen Ebene lassen sich weitere Entitäten wie bspw. „Globalkommentar“ und „Entstehungsgeschichte“ einordnen. Die nächsttiefere Ebene beschreibt den Aufbau einer Werkfassung, d.h. des Dramentextes mittels struktureller Einheiten wie „Akt“ und „Szene“, die weiter untergliedert werden durch „Rede“ und „Bühnenanweisung“ und mit ihren Attributen „Sprecher“, „Redebeitrag“ und „Typ“ (Vers, Prosa) gekennzeichnet werden. Ausgehend von der Bestimmung der Entitäten und ihrer zugehörigen Attribute können die Beziehungen (Relationen) zwischen diesen modelliert und damit die Konnektivität im Sinne eines Entity-Relationship-Modells (ER-Modell) bestimmt werden. Auftritt, Szene und Akt stehen dabei in einer enthalten-in-Relation: mindestens ein Auftritt ist enthalten in einer Szene, mindestens eine Szene bildet einen Akt. Diese formalen Relationen reflektieren die temporalen Beziehungen in der Spielzeit des Dramas: eine Szene umfasst die Zeitspanne des Auftritts einer oder mehrerer Figuren. Ein Akt umfasst in der Regel mehrere zeitlich nahtlos aneinandergereihte Szenen. Aktgrenzen markieren jeweils größere Abschnitte der Spielzeit. Im Datenmodell werden diese Abfolgen formal durch Vorgänger- und Nachfolgerelationen zwischen den Strukturelementen des Dramas abgebildet. In unserem Fall wird durch Attribute wie „Strukturelement ist ein Sprechakt“ oder „Strukturelement ist eine Bühnenanweisung“ die Funktion des Elements im Ablauf des Dramas erfasst und über eine Relation zum Objekt „Sprechakt“, welches wiederum mit den Einheiten „Person“ und „Rede“ die Beziehung „Sprechakt besteht aus Sprecher und Rede“ beschreibt (vgl. Abb. 2). Neben der formalen Beschreibung der Architektur der Dramentexte können wir auf Basis des Modells die intertextuellen Beziehungen zwischen den einzelnen Werkfassungen einbeziehen, indem wir das Modell generisch um eine Entität der „Annotation“ erweitern. Im Sinne unserer Edition kann diese in Relationen zwischen Werkfassungen und Redebeiträgen eingesetzt werden, um einerseits die Bezüge zwischen englischem Text und deutscher Übersetzung und andererseits die Revisionen und Veränderungen zwischen den deutschen Fassungen zu beschreiben. Entsprechende Attribute erfassen den Typ und die Funktion der Kommentierung (z.B. Annotation zu Übersetzung, zu Metrik, zu Korrektur etc.) im Gesamtkontext. Jeder einzelne Bezug selbst kann wieder mit einer (oder mehreren) Annotation(en) verknüpft werden. Bei einer entsprechend feingranularen Modellierung können die Zuordnungen auf Wortebene erfolgen, so dass beispielsweise Übersetzungsvorgänge oder gezielte Wortschöpfungen direkt an den zugehörigen Textpassagen dokumentierbar werden.
Hamlet – digital ediert
315
Abb. 2: Auszug aus dem Entity-Relationship-Modell zur Beschreibung der Werkfassung eines Dramentextes
316
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Zur effektiven Organisation, Verwaltung und Bearbeitung der Menge zu analysierender Quellen und der damit verbundenen multidimensionalen Informationseinheiten bietet sich der Einsatz einer virtuellen Forschungsumgebung (VFU) als zentrales Werkzeug an, das sämtliche Arbeitsschritte von der Erfassung der Dokumente über deren Erschließung auf Metadatenebene bis zur textstellengenauen Annotation und Kommentierung unterstützt.56 Dieses Anforderungsprofil einer VFU bietet das Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD), das gemeinsam vom Servicezentrum eSciences und dem Trier Center for Digital Humanities an der Universität Trier entwickelt wird und sich in zahlreichen digitalen (Editions-)Projekten an Universitäten, Akademien und Forschungseinrichtungen bewährt hat.57 Die Bearbeitung der aus den Erstdrucken übernommenen Texte erfolgt von Anfang an in der Inventarisierungs- und Analyseumgebung von FuD, indem das System und damit der editorische Arbeitsablauf gemäß dem oben beschriebenen formalen Editionsmodell konfiguriert wird, um die Arbeitsschritte wie die Erfassung der Metadaten und Dokumente, die Erstellung von Querverweisen zwischen diesen, die Kommentierung und die Erstellung von Registern jederzeit konsistent in der Datenbank abzubilden (Abb. 3). Während die Erstdrucke direkt in FuD erfasst und bearbeitet werden, erfolgt die Erfassung und digitale Aufbereitung des Hamlet-Manuskripts wie oben beschrieben durch den Einsatz des Werkzeugs Transcribo (Abb. 4), welches aber mit der zentralen Datenbank verbunden ist und damit die Überführung dieses frühesten Textträgers in das Gesamtdatenmodell unterstützt. Mittels Transcribo ist neben einer detaillierten Erfassung des Dramentextes auch die Beschreibung von Textveränderungen und Korrekturstufen möglich. Marginalien, handschriftliche Eigenheiten oder der Einsatz spezifischer Schreibgeräte können systematisch erfasst und aufbereitet werden (vgl. Abb. 4).
56
57
Vgl. die am 28.1.2011 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, S. 7f. (http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10465-11.pdf; 28.12.2022); ferner Claudine Moulin, Julianne Nyhan u.a.: Research Infrastructures in the Digital Humanities, European Science Foundation, Science Policy Briefing 42, Strasbourg 2011 (http://archives.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/strategic-activities/research-infrastructures-in-the-humanities.html). Gisela Minn, Thomas Burch, Marina Lemaire, Alexander Patrut, Yvonne Rommelfanger, Ansgar Schmitz: FuD2015 – Eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geistes- und Sozialwissenschaften auf dem Weg in den Regelbetrieb. Akteure, Arbeitsfelder, Organisations- und Finanzierungsstrukturen. Trier 2016, online: urn:nbn:de:hbz:385-10103.
Hamlet – digital ediert
Abb. 3: Abbildung des Workflows in der virtuellen Forschungsumgebung FuD
317
318
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Abb. 4: Transkription und Annotation einer Manuskriptseite (Msc.Dresd. e.90,XXII,1, http://digital.slub-dresden.de/id329494473) mit dem Werkzeug Transcribo (Transkription: Olivia Varwig)
Hamlet – digital ediert
319
Die graphische Nutzeroberfläche des Werkzeugs ist dabei um das digitale Faksimile zentriert. Beliebig große Einheiten (z.B. Wörter, Zeilen oder Absätze) können markiert, transkribiert und annotiert werden. Dabei wird jede Bilddatei doppelt dargeboten: Links liegt der Ausgangstext zur Ansicht, der Bereich rechts daneben dient als Arbeitsunterlage; hier wird der transkribierte Text topographisch exakt über das leicht ausgegraute Faksimile gelegt. Wo die räumliche Anordnung nicht der textuellen Wortreihenfolge entspricht, können Wörter in der graphischen Oberfläche zu Sequenzen zusammengefasst und so die semantischen Zusammenhänge im Transkript protokolliert werden. Ein zentrales Merkmal des Programms besteht außerdem in der Möglichkeit, in jeder erfassten Einheit textgenetische und editionsphilologisch relevante Phänomene zu kennzeichnen und mit Annotationen zu versehen. Dabei kommt ein projektspezifisches Auswahlmenü zum Einsatz, welches unterschiedliche Varianten von Korrekturen (wie etwa Sofortkorrekturen, Spätkorrekturen mit ein-, zwei- oder mehrfacher Durchstreichung und Überschreibung), die Kennzeichnung von Hervorhebungen sowie von unsicheren Lesungen oder nicht identifizierten Graphen umfasst. Aus den erfassten Informationen über jede einzelne Handschriftenseite lassen sich verschiedene Ansichten oder Fassungen (diplomatisch, genetisch, Lesefassung) des transkribierten Textes automatisch erstellen und synoptisch zum digitalen Ausgangstext anzeigen. Ein „Relationen-Modul“ ermöglicht es den Benutzenden, ausgehend von den Einzeltranskripten die hierarchische Gesamtstruktur des Textes zu konstruieren. So können aus den transkribierten Wortformen topographische und syntaktische Zeilen, Relationen und Änderungsverbände sowie Sätze und Absätze aufgebaut und diese wiederum in hierarchisch übergeordnete Textstrukturen wie z.B. Absätze usw. zusammengefasst werden. Im Anschluss an die Erfassung der Quellen werden die Texte inhaltlich weiter ausgezeichnet, kommentiert und miteinander sowie mit externen Ressourcen verknüpft. Auszeichnen bedeutet hier, dass einzelne Textpassagen (auch einzelne Wörter oder Zeichen) markiert und je nach Vorgabe durch die Editionsprinzipien Notizen, Anmerkungen und Kommentare auf unterschiedlichen Ebenen zugewiesen werden. Auf diese Weise können Merkmale wie Übersetzungsalternativen, Wortschöpfungen, aber auch Revisionen zwischen den Textfassungen oder Erläuterungen zu Wortbedeutungen und Verknüpfungen zu Wörterbüchern direkt im Kontext der Textfassung festgehalten, und es kann ein intertextuelles Informationsnetzwerk aufgebaut werden. Unterstützt werden diese manuell interaktiv erfassten Verknüpfungen durch den Einsatz von Algorithmen, die insbesondere für den automatisierten Vergleich zwischen den chronologisch ‚benachbarten‘ Textfassungen eingesetzt werden. Hier bieten sich vor allem Verfahren aus dem Bereich des approximativen Vergleichs von Zeichenfolgen wie z.B. „Longest Common Subsequence“, „Levenshtein Distance“ oder „N-Gram Matching“ an.58 Mit Hilfe dieser Methoden lassen sich zunächst automatisch die Übereinstimmungen und Differenzen zwischen vergleichbaren Textfassungen vorberechnen und anschließend mit Hilfe der manuell interaktiven Arbeitsumgebung von FuD bewerten, 58
Vgl. hierzu: Graham A. Stephen: String Searching Algorithms. (Lecture Notes Series on Computing. 3). London 1994.
320
Claudia Bamberg und Thomas Burch
korrigieren, anpassen und entsprechend in das Informationsnetzwerk der Edition integrieren. Der digitalen Produktion der Editionsdaten (Backend) steht die Erarbeitung einer adäquaten Präsentationsumgebung (Frontend) gegenüber. Ein zentraler Aspekt besteht hier darin, den Nutzern geeignete Navigations- und Zugriffsfunktionalitäten an die Hand zu geben, mit denen sie aus der Gesamtheit der repräsentierten Daten die relevanten Informationen ausfiltern und auswerten können, um so eine vorgegebene Fragestellung zu bearbeiten. Eine digitale Edition ermöglicht dabei nicht nur das Lesen der edierten Texte und deren Kommentare, sondern erlaubt in der Regel auch die Zusammenstellung von Teilkorpora und den systematischen Vergleich von einzelnen Abschnitten. Sie entwickelt sich damit weiter von einer reinen Textpräsentation hin zu einer Forschungsplattform. Der Weg dahin folgt in der Regel einem nutzerzentrierten Entwurfsprozess, indem besondere Charakteristika geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlicher Anwendungsszenarien berücksichtigt werden. Dieser gesamte Entwurfsprozess erfolgt in iterativen Schritten zwischen Annäherung an eine Lösung über die Erstellung von Entwürfen, Mockups oder Wireframes sowie einer regelmäßigen Bewertung des Designs und der Usability des Konzepts. Dabei gilt es gleichzeitig die Balance zwischen der Bereitstellung eines angemessenen Funktionsspektrums einerseits und einer ergonomischen, intuitiven Bedienoberfläche andererseits zu halten. Die Umsetzung dieses Usability-Konzepts und damit die Implementierung des Systems erfolgt im Sinne eines agilen Entwicklungsprozesses, d.h. in einer zyklischen Abfolge aus Programmierung, Testen, Bugfixing, Optimierung und anschließender Weiterentwicklung. Die dabei zu beachtenden Herausforderungen ergeben sich aus einer korrekten, möglichst effizienten Implementierung der Applikation, verbunden mit dem grundlegenden Ansatz eines generischen Entwicklungskonzepts, der durch den dynamischen Datenbestand und eine zukünftige Erweiterbarkeit der Edition bedingt wird. Daher werden gezielt Standardentwurfsmuster für Softwaresysteme wie beispielsweise das Prinzip des Model-View-Controllers eingesetzt, das insbesondere die Kommunikation zwischen Applikation und Datenbank standardisiert und das zusätzlich eine Integration weiterer Module in die Applikation ermöglicht. Die geplante digitale Edition möchte spezifische Module entwickeln, die den Entstehungs- und den Revisionsprozess übersichtlich und transparent darstellen, und dabei bis ins Detail nachvollziehbar machen, wie sich die Übersetzung des Hamlet vom Manuskript über den Erstdruck und die Nachdrucke, über den sog. ‚Schlegel-Tieck‘ bis hin zu den weiteren Bearbeitungen nach dem Tod Schlegels und der Mitglieder des Tieck-Kreises, d.h. von Revision zu Revision, entwickelt und immer wieder neu konstituiert hat und welche Ausgaben diesen Revisionen jeweils zugrunde lagen. Dabei wird es mittels der oben genannten automatischen und manuell annotierten Vergleichsverfahren möglich sein, die unterschiedlichen Fassungen zeichengenau zu alignieren; zudem können die Nutzer der Edition flexibel auswählen, welche Fassungen sie in einer Synopse direkt miteinander vergleichen möchten. So kann beispielsweise der Erstdruck des Hamlet in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel (1798) mit dem letzten
Hamlet – digital ediert
321
Druck zu Lebzeiten (1852), der erste ‚Schlegel-Tiecksche‘ Hamlet (1831) mit der Leseausgabe des Hamlet von 1891, die auf dem ‚Schlegel-Tieck‘ basiert, oder die Ausgabe von Hermann Ulrici (1869) mit der von Michael Bernays (1872) in einer synchronisierbaren Paralleldarstellung angezeigt und analysiert werden.59 Ferner soll es möglich sein, genau nachzuvollziehen, welche englische(n) Shakespeare-Ausgabe(n) beim Übersetzen jeweils maßgeblich war(en) und damit auch, auf welche Weise – d.h. nach welchen Übersetzungsprinzipien – der Hamlet vom Englischen ins Deutsche übertragen wurde. Das bedeutet, dass auch die englischen Ausgaben im Volltext in die Edition eingebunden werden und bis hin zu einer wortgenauen Synopse mit den deutschen Übertragungen verglichen werden können (vgl. Abb. 5). Über die benutzten englischen Ausgaben geben die Vorworte, die Übersetzung begleitende Publikationen, Korrespondenzen und die Bibliotheken der Übersetzer Aufschluss. Auch diese Dokumente werden in die Edition eingearbeitet und direkt mit den entsprechenden Ausgaben der Übersetzungen verknüpft. Eine auf dem beschriebenen Weg von Beginn an durch Software-Unterstützung entstehende Born-Digital-Edition60 bietet entscheidende Vorteile hinsichtlich der Berücksichtigung von Bezügen zwischen editorischem Inhalt und der angestrebten Publikationsform. Gerade aufgrund der Abstraktion von einem anhand der vorgegebenen Editionsrichtlinien eindeutig festgelegten Text liegt eine wesentliche Stärke von genuin digital erstellten Ausgaben vor allem in der Möglichkeit dynamischer Darstellungsformen. Eine durch die Benutzer konfigurierbare und variable Anzeige von Ausgangstexten, Primärtexten, philologischen Kommentaren sowie von Verknüpfungen mit Sekundärquellen kann die unterschiedlichen Textstufen, Varianten oder intertextuelle Zusammenhänge dynamisch abbilden. Sie wird so die Entstehung eines Werkes (hier des Übersetzungsvorganges), die nachfolgenden Revisionen und Veränderungen sowie die damit verbundenen Interpretationsmöglichkeiten der Editoren offensichtlich machen.
59
60
Die hier gezeigte Beispiel-Synopse (Abb. 5) stellt also eine Möglichkeit von vielen dar; der Leser kann sie sich in der digitalen Edition selbst variabel zusammenstellen. Interessant wäre z.B. auch – für einen genaueren Vergleich der drei deutschen Übersetzungen – der ergänzende Blick auf die von Wieland und Eschenburg verwendeten englischen Shakespeare-Ausgaben; beide konnten ja noch nicht auf die von Schlegel hauptsächlich verwendete Ausgabe von Malone zurückgreifen. Im hier angeführten Beispiel ist der Wortlaut des berühmten englischen Verses auch in den von Wieland und Eschenburg genutzten Ausgaben identisch. Hinsichtlich der elektronischen Publikation einer wissenschaftlichen Ausgabe kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen einer retrospektiv produzierten und einer sogenannten „born digital“ erstellten Digitalen Edition. Im ersten Fall, bei dem man von bestehenden gedruckten Ausgaben ausgeht, entsteht idealerweise kein weiterer editorischer Aufwand. Die traditionell erarbeiteten Inhalte werden lediglich technisch aufbereitet und damit einer digitalen Nachnutzung zugeführt. Als zentrale Aufgabe in diesem Fall steht die digitale Reproduktion von durchsuchbaren Daten – eine reine Bilddigitalisierung der Buchseiten ist nicht ausreichend – aus der analogen Buchvorlage am Anfang des gesamten Arbeitsablaufes.
322
Claudia Bamberg und Thomas Burch
Abb. 5: Synopse der Ausgaben von Malone, Wieland, Eschenburg und Schlegel mit stellengenauem Vergleich und Kommentierung der deutschen Übersetzungen
Hamlet – digital ediert
323
Dieser datenzentrierte Ansatz bedeutet einen Paradigmenwechsel. Er ermöglicht reichhaltigere Editionen, in denen unterschiedlichste Aspekte und Perspektiven gleichberechtigt behandelt und in multiplen Formen für ein differenziertes Publikum nutzbar gemacht werden können. Sicherlich wird das Blättern in digitalen Umgebungen emuliert, genauso wie viele andere Lesegesten. Doch bürgert sich eine eigene Leselogik ein und damit eine andere Lesekompetenz. Das der Edition zugrunde liegende Datenmodell unterstützt zudem auf einfache Weise die Erweiterbarkeit des gesamten Systems. So könnten einerseits moderne Ausgaben integriert und in den Vergleichsprozess eingebunden werden. Andererseits können weitere Verknüpfungen und Annotationen eingerichtet und damit eine neue qualitative Ebene an Kommentierungen angelegt werden. Wenn, wie hier angedacht, generische Lösungen – und das sollte bei der Entwicklung von Modellen eines der wichtigsten Ziele sein – entstehen, dann eröffnen sich auch vielfältige Möglichkeiten zur Nachnutzung der Ergebnisse. So könnten die entstehenden Methoden und Verfahren auch auf vergleichbare Untersuchungen zum Übersetzungsvorgang von Dramentexten weit über das geplante Editionsunternehmen ‚Schlegel-Tieck‘ hinaus angewendet werden. Entscheidend ist also, ein Konzept zu entwickeln, dass es auch anderen digitalen Übersetzungseditionen ermöglicht, sich an diesem Modell zu orientieren, es kritisch zu erproben und zu erweitern. So könnte sich auf dem Feld der digitalen Edition auch für die Textgattung ‚Übersetzung‘ eine best practice etablieren und es könnte sich eine spannende Fachdiskussion entwickeln. Doch dazu müssen nun erst einmal die Grundlagen geschaffen werden.
Anschriften
Prof. Dr. Frieder von Ammon LMU München Institut für Deutsche Philologie Schellingstraße 3 D-80799 München [email protected] Dr. Claudia Bamberg Universität Trier Trier Center for Digital Humanities D-54286 Trier [email protected] Dr. Thomas Burch Universität Trier Trier Center for Digital Humanities D-54286 Trier [email protected] Prof. Dr. Thomas Bürger Hohe Straße 21a D-01445 Radebeul [email protected] Dr. Robert Craig Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Britische Kultur Kapuzinerstr. 16 96047 Bamberg [email protected] Mag. Dr. Paul Ferstl Universität Wien Abt. für Vergleichende Literaturwissenschaft Sensengasse 3A A-1090 Wien [email protected]
https://doi.org/10.1515/9783111017419-021
Carolin Geib, M.A. Universität Trier Trier Center for Digital Humanities D-54286 Trier [email protected] Dr. Thomas Haffner SLUB Dresden Zellescher Weg 18 D-01069 Dresden [email protected] Dr. Katrin Henzel Universität Kiel Universitätsbibliothek Leibnizstraße 9 D-24118 Kiel [email protected] Prof. Dr. Achim Hölter Universität Wien Abt. für Vergleichende Literaturwissenschaft Sensengasse 3A A-1090 Wien [email protected] Dr. Cornelia Ilbrig Göttinger Akademie der Wissenschaften Arbeitsstelle Hamburg Überseering 35 D-22297 Hamburg [email protected] PD Dr. Nikolas Immer DFG-Kolleg „Lyrik in Transition“ Universität Trier Universitätsring 15 54296 Trier [email protected]
326
Anschriften
Prof. Dr. Christa Jansohn Argelanderstraße 140 D-53115 Bonn [email protected]
Prof. Dr. Bodo Plachta Niesertstraße 34 D-48145 Münster [email protected]
PD Dr. Stefan Knödler Universität Tübingen Deutsches Seminar Wilhelmstraße 50 D-72074 Tübingen [email protected]
Dr. Tim Sommer Universität Passau Lehrstuhl für Englische Literatur und Kultur Innstraße 41 D-94032 Passau [email protected]
Theresa Mallmann, M.A. Universität Wien Abt. für Vergleichende Literaturwissenschaft Sensengasse 3A A-1090 Wien [email protected] Prof. Dr. Claudine Moulin Universität Trier FB II – Germanistik Universitätsring 15 D-54296 Trier [email protected] Dr. Rüdiger Nutt-Kofoth Bergische Universität Wuppertal Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften Gaußstraße 20 D-42119 Wuppertal [email protected] Prof. em. Dr. Günter Oesterle Nahrungsberg 49 D-35390 Giessen [email protected] Prof. em. Roger Paulin Trinity College, Cambridge P4 Burrells, Trinity Street Cambridge, CB2 1TQ United Kingdom [email protected]
Dr. Thomas Stern SLUB Dresden Zellescher Weg 18 D-01069 Dresden [email protected] Prof. Dr. Jochen Strobel Universität Marburg Institut für Neuere deutsche Literatur Deutschhausstraße 3 D-35032 Marburg [email protected] Katrin Stump, M.A. SLUB Dresden Zellescher Weg 18 D-01054 Dresden [email protected] Dr. Olivia Varwig Bergische Universität Wuppertal Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften Gaußstraße 20 D-42119 Wuppertal [email protected]



![Feier des Vereins für die Geschichte Berlins zum Gedächtnis der Hochseligen Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. [1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/feier-des-vereins-fr-die-geschichte-berlins-zum-gedchtnis-der-hochseligen-kaiser-wilhelm-i-und-friedrich-iii-1nbsped.jpg)