Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang [1 ed.] 9783428499984, 9783428099986
Der Autor setzt die rechtliche Stellung der Parlamentspräsidenten in den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland zuein
172 59 38MB
German Pages 340 [341] Year 2000
Polecaj historie
Citation preview
Beiträge zum Parlamentsrecht Band 46
Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang
Von
Michael Köhler
Duncker & Humblot · Berlin
Gefördert mit Mitteln des Deutschen Bundestages
MICHAEL KÖHLER
Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang
Beiträge zum Parlamentsrecht Herausgegeben von Ulrich Karpen, Heinrich Oberreuter, Wolfgang Zeh in Verbindung mit Peter Β adura, Wolfgang Heyde, Joachim Linck Georg-Berndt Oschatz, Hans-Peter Schneider Uwe Thaysen
Band 46
Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang
Von
Michael Köhler
Duncker & Humblot · Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Köhler, Michael: Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang / von Michael Köhler. Berlin : Duncker und Humblot, 2000 (Beiträge zum Parlamentsrecht ; Bd. 46) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1998 ISBN 3-428-09998-2
Alle Rechte vorbehalten © 2000 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 0720-6674 ISBN 3-428-09998-2 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 θ
Meinen
Eltern
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Mai 1999 von der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Dissertation angenommen. Meinem verehrten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Hans H. Klein, Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D., bin ich für die Anregung des Themas und seine umsichtige Betreuung während der Erstellung der Arbeit in Dank verbunden. Herr Prof. Dr. Hans H. Klein hat die Entstehung der Arbeit in jeder Hinsicht in beispielhafter Weise gefördert. Gedankt sei auch Herrn Privatdozent Dr. Volker Schiette für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. Dank schulde ich ebenfalls den Mitarbeitern der Verwaltung des Niedersächsischen Landtags und der Hamburgischen Bürgerschaft sowie den vielen Gesprächspartnern in Politik und Wissenschaft, deren Informationen und Erfahrungen für diese Arbeit von großem Wert waren. Ferner danke ich der Konrad-Adenauer-Stiftung für die ideelle und finanzielle Förderung der vorliegenden Arbeit aus Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Ulrich Karpen sowie dem Verlag Duncker & Humblot für die Aufnahme in die Reihe „Beiträge zum Parlamentsrecht". Mein besonderer Dank gilt all denen, ohne deren gewinnbringende und aufmunternde Unterstützung die Anfertigung der Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Der liebevolle Zuspruch meiner Freundin Sabine Neumeister sei an dieser Stelle hervorgehoben. Herzlich danke ich schließlich meinen Eltern. Ich freue mich, ihnen diese Arbeit widmen zu können. Sie haben mehr für mich getan, als diese Widmung zum Ausdruck bringen kann. Hamburg, im Februar 2000
Michael Köhler
Inhaltsverzeichnis Einleitung
15
Erster Abschnitt
Das Amt des Landtagspräsidenten I. Der Amtserwerb
17 17
1. Die Voraussetzungen für den Erwerb
18
2. Das Wahlverfahren
20
3. Der Amtserwerb und dessen Folgen
26
4. Die Erforderlichkeit eines Amtseides
29
5. Die Inkompatibilität mit anderen Tätigkeiten
32
II. Der Amtsverlust
34
1. Die Verlustgründe
34
a) Das Ende der Amtszeit
34
b) Der Verlust des Abgeordnetenmandats
36
c) Der Verlust der Fraktionszugehörigkeit
39
d) Die Abberufung
40
2. Die Amtsniederlegung
48
III. Die protokollarische Einordnung des Amtes
50
IV. Die Organstellung des Landtagspräsidenten
53
Zweiter Abschnitt
Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium I. Die Zusammensetzung des Präsidiums 1. Die Vizepräsidenten a) Anzahl und persönliche Voraussetzungen
57 58 61 61
10
Inhaltsverzeichnis b) Die Aufgaben der Vizepräsidenten
63
aa) Unterstützung der Amtsführung des Präsidenten
63
bb) Vertretung des Präsidenten
63
2. Die Schriftführer
67
a) Anzahl und Stellung der Schriftführer
67
b) Das Aufgabenfeld der Schriftführer
68
II. Das Wahlverfahren
70
III. Der Verlauf der Präsidiumssitzungen
73
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
76
1. Bildung des Sitzungsvorstands
77
2. Entwurf des Haushaltsplans für den Landtag
79
3. Mitwirkung an Personalentscheidungen innerhalb der Landtagsverwaltung ...
81
4. Überwachung des Verhaltens der Abgeordneten
82
5. Sonstige Aufgaben
84
Dritter Abschnitt
Die Stellung des Landtagspräsidenten in sonstigen parlamentarischen Gremien
89
I. Die Stellung im Ältestenrat
89
1. Historische Grundlagen
89
2. Zusammensetzung und Sitzungsverlauf
91
3. Die Arbeit des Ältestenrats
94
a) Die Unterstützung des Präsidenten bei der Amtsführung
95
b) Innere Angelegenheiten
98
c) Lenkungs-, Vermittlungs- und Schlichtungsorgan
99
II. Die Stellung in den Ausschüssen
101
Inhaltsverzeichnis Vierter
11
Abschnitt
Die Leitungsgewalt des Landtagispräsidenten in den Verhandlungen des Landtags I. Begriff und Umfang der Leitungsgewalt II. Die Vorbereitung der Arbeiten des Landtags 1. Die Sichtung und Überprüfung der Beratungsgegenstände 2. Die Aufstellung der Tagesordnung III. Die Einberufung des Landtags
102 102 104 104 106 110
1. Das Selbstversammlungsrecht des Parlaments und das Einberufungsrecht des Landtagspräsidenten 110 2. Besondere Fälle der Einberufung durch den Landtagspräsidenten a) Die Einberufung nach der Wahl
112 112
b) Die Einberufung auf Verlangen einer Abgeordnetenminderheit oder der Landesregierung 113 IV. Der Verlauf der Plenarsitzungen
115
1. Die Eröffnung der Sitzungen
116
2. Der Eintritt in die Tagesordnung
118
3. Die Eröffnung der Beratung und der Aussprache
120
V. Die Leitung während der Reden
126
1. Die Bestimmung der Rednerreihenfolge
126
2. Die Worterteilung
129
3. Besondere Formen der Worterteilung
131
a) Die Worterteilung zur Sache
132
b) Die Worterteilung zur Geschäftsordnung
132
c) Die Worterteilung zu einer persönlichen Bemerkung
134
d) Die Worterteilung zur Abgabe einer Erklärung
136
aa) Persönliche Erklärungen
137
bb) Sachliche Erklärungen
138
e) Die Worterteilung zu einer Zwischenfrage
139
4. Die äußere Form und die Dauer der Reden
140
5. Möglichkeiten zur Verlängerung der Redezeit
144
12
Inhaltsverzeichnis
VI. Die Leitung der Abstimmungen
146
1. Die Feststellung der Beschlußfähigkeit
146
2. Die Fassung der Fragen und die Abstimmungsreihenfolge
150
3. Die Arten der Abstimmung
155
VII. Die Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten bei Fragen der Geschäftsordnung
164
1. Rechtsnatur und Geltungsdauer der Geschäftsordnung
164
2. Die Auslegung der Geschäftsordnung
166
3. Die Abweichung von der Geschäftsordnung
169
4. Die Änderung der Geschäftsordnung
170
VIII. Die Tätigkeit nach dem Schluß der Sitzung
171
Fünfter Abschnitt
Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten I. Der Begriff der Ordnungsgewalt II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt gegenüber den Abgeordneten
175 175 177
1. Die rechtlichen Grundlagen der Disziplinargewalt
180
2. Die Maßnahmen der Disziplinargewalt
182
a) Die Maßnahmen in der Redeordnung
183
aa) Der Ruf zur Sache
183
bb) Die Wortentziehung infolge mehrfacher Sachrufe
186
cc) Die Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit
189
b) Die Maßnahmen in der Sitzungsordnung
191
aa) Die Rüge
191
bb) Der Ruf zur Ordnung
194
cc) Die Wortentziehung infolge mehrfacher Ordnungsrufe
200
dd) Der Ausschluß eines Abgeordneten von der Sitzung
202
(1) Parlamentshistorische Grundlagen
202
(2) Der Ausschluß für den Rest der Sitzung
206
(3) Der Ausschluß für mehrere Sitzungstage
210
c) Sonstige Maßnahmen
215
Inhaltsverzeichnis 3. Die rechtliche Überprüfbarkeit präsidialer Disziplinarmaßnahmen
215
a) Die Einlegung eines Einspruchs
216
b) Gerichtliche Überprüfbarkeit
221
III. Die Ordnungsgewalt gegenüber der Gesamtheit der Abgeordneten
224
IV. Die Ordnungsgewalt gegenüber Mitgliedern der Landesregierung sowie ihren Beauftragten 228 V. Die Ordnungsgewalt gegenüber den Zuhörern
232
Sechster Abschnitt
Das Hausrecht des Landtagspräsidenten I. Der Begriff des Hausrechts und seine rechtliche Charakterisierung II. Der Umfang und Anwendungsbereich des Hausrechts
235 235 238
III. Die Maßnahmen des Landtagspräsidenten aufgrund des Hausrechts und ihre strafrechtliche Beurteilung 240 IV. Die Strafbarkeit der Mißachtung präsidialer Anordnungen
243
V. Die Zustimmungsbefugnis bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen im Landtagsgebäude 245 VI. Die Bannmeile als Erweiterung des präsidialen Hausrechts
248
Siebter Abschnitt
Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten I. Die historische Entwicklung II. Die funktionale Bedeutung und Trägerschaft
252 254 257
III. Der Umfang der Polizeigewalt
259
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
264
1. Handlungsformen polizeilicher Maßnahmen und ihre gesetzlichen Grundlagen 264 2. Die Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen
268
a) Hauseigener Ordnungsdienst
270
b) Amts- und Vollzugshilfe durch die ordentliche Polizei
271
14
Inhaltsverzeichnis
3. Das Eingreifen der ordentlichen Polizeibehörden im Landtag in Ausnahmefallen 273 V. Der Rechtsschutz gegen polizeiliche Maßnahmen des Landtagspräsidenten
276
VI. Das „Zählsorge-Telefon" als besonderer Anwendungsfall der präsidialen Polizeigewalt 277 Achter Abschnitt
Der Landtagspräsident als Leiter der Parlamentsverwaltung und Vertreter des Landtags I. Die Parlamentsverwaltung
279 279
1. Rechtsgrundlage und Stellung im Verwaltungsaufbau der Länder 2. Aufgaben und Organisation a) Der allgemeine Verwaltungsaufbau aa) Der Direktor beim Landtag bb) Die allgemeine Verwaltung cc) Der Parlamentsdienst dd) Die Presse-und Öffentlichkeitsarbeit b) Der wissenschaftliche Hilfsdienst
280 281 282 283 284 287 290 291
3. Die Leitung der Personalverwaltung
296
4. Die Leitung der wirtschaftlichen Verwaltung
301
II. Die Vertretung des Landtags
302
1. Die staatsrechtliche Repräsentation 2. Die Vertretung in Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten
303 304
Neunter Abschnitt
Interparlamentarische Zusammenarbeit
308
Schlußbetrachtung
310
Gesetzestexte
313
Literaturverzeichnis
315
Stichwortverzeichnis
327
Anhang
331
Einleitung Auch in einer Zeit, in der das, was man große Politik nennt, sich in zunehmenden Maße von den Ländern auf den Bund verlagert, behalten die Länderparlamente ihre herausragende Bedeutung als „Herz der Demokratie". Vielfältig sind nach wie vor die Möglichkeiten, das Leben der Bürger im jeweiligen Bundesland zu beeinflussen und auch mit ihren gesetzgeberischen und sonstigen Entscheidungen Akzente zu setzen, die deutlich das Agieren der Bundesorgane und letztlich die Lebensverhältnisse eines jeden Bundesbürgers zumindest mittelbar mit 1 prägen. Von besonderem Interesse muß in diesem Zusammenhang die Rolle des jeweiligen Parlamentspräsidenten sein. Der Parlamentspräsident erscheint aufgrund der Vielzahl seiner Kompetenzen als Zentralfigur der parlamentarischen Organisation und verkörpert auf diese Weise die hervorragende Position des Parlaments. Seit den Anfängen des deutschen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert ist die Stellung des Parlamentspräsidenten im wesentlichen durch eine doppelte Ausrichtung seiner Aufgaben und Befugnisse gekennzeichnet: sie sind einerseits nach innen gerichtet, wo sie insbesondere in der Ordnungs- und Leitungsgewalt des Präsidenten zum Ausdruck kommen, und sie sind andererseits nach außen gerichtet, insbesondere als Aufgabe und Befugnis der Repräsentation des Parlaments. Mit der Repräsentantenfunktion korrespondiert eine umfassende Vertretungsbefugnis, vor allem gegenüber den anderen Staatsorganen, die sich aber nach der Konstruktion des Amtes durch alle Rechtsbereiche zieht und mithin auch die Vertretung des Landtags in allen rechtsgeschäftlichen und gerichtlichen Angelegenheiten des Parlaments erfaßt. Im Zusammenhang mit der Ordnungs- und Leitungsgewalt steht zudem die Befugnis des Präsidenten, die Polizeigewalt und das Hausrecht auszuüben. Obgleich diese Kompetenzen in der parlamentarischen Praxis meist eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig ergänzen, sind sie doch - zumindest in der Theorie - scharf voneinander zu unterscheiden. Verfassungsrechtliche Aufgabe des Landtagspräsidenten ist schließlich auch die Leitung der Parlamentsverwaltung, bei der ihm als oberster Dienstbehörde alle Maßnahmen der Dienstaufsicht und der Disziplinargewalt gegenüber den Angehörigen der Hausverwaltung zur Verfügung stehen. Das genannte Aufgabenfeld des Präsidenten gibt die Gliederung dieser Arbeit vor. Die vorliegende Untersuchung setzt auf dieser Grundlage die rechtliche Stellung der Parlamentspräsidenten in den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland zueinander vergleichend in Beziehung, mit der Maßgabe, Gemeinsamkeiten,
16
Einleitung
Abweichungen und strukturelle Besonderheiten herauszuarbeiten und zu kommentieren. Dabei erfaßt das Thema zwar schwerpunktmäßig die Person des Landtagspräsidenten und dessen Rechte und Pflichten, strahlt aber naturgemäß aus auf rechtliche Strukturen des Parlaments im allgemeinen. Hinsichtlich dieser Strukturen wird das für das deutsche Parlamentsrecht Allgemeingültige herausgestellt, ohne daß für einzelne Parlamente bestehende Besonderheiten darüber zu kurz kommen. Vom Parlamentsrecht der Landtage abweichende Regelungen für den Bundestag werden deutlich hervorgehoben und werfen damit auch mittelbar Licht auf die Rechtsstellung des Bundestagspräsidenten. Wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit sind zudem die führenden politischen Gremien der Parlamente, namentlich Präsidium und Ältestenrat. Auch hier wird aufgezeigt, welche Rolle dem Parlamentspräsidenten in diesen Gremien zukommt. Primäres Anliegen der Bearbeitung ist jedoch, einen Überblick über Zusammensetzung und Arbeitsweise dieser Gremien in den einzelnen Ländern zu geben, zumal nicht alle Länderparlamente die Existenz beider Gremien nebeneinander kennen. Im Mittelpunkt steht demgemäß die Darstellung der Unterschiede von Präsidium und Ältestenrat in den Landtagen im Hinblick auf personelle Struktur, Funktionen der Mitglieder, sowie Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse. Im Rahmen der Stellung des Landtagspräsidenten als Leiter der Parlamentsverwaltung werden schließlich auch Aufbau, Organisation und Aufgaben der einzelnen Landtagsverwaltungen untersucht, die jeweils eine eigene Prägung erfahren haben. Insgesamt betrachtet ist die Arbeit also bemüht, unter Zugrundelegung der Landesverfassungen und parlamentarischen Geschäftsordnungen ein Bild vom Parlamentsrecht der Länder zu zeichnen, in dessen Mittelpunkt das Präsidentenamt und seine unterschiedliche Ausgestaltung in den einzelnen Landtagen steht.
Erster Abschnitt
Das Amt des Landtagspräsidenten I. Der Amtserwerb In allen Verfassungen der Länder der Bundesrepublik besteht die Regelung, daß der Landtagspräsident vom Parlament gewählt wird 1 . Die Wahl des Präsidenten ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine verfassungsrechtliche Verpflichtung 2 und als solche eine der ersten Amtshandlungen des neu gewählten Parlaments. Sie ist Ausfluß des Selbstorganisationsrechts der Legislative3 und stellt ein Verfahren dar, das der Landtag in eigener Verantwortung durchführt. Der Landtag kann somit als erste Gewalt der dreigeteilten Staatsmacht seine Organisation und Geschäftsführung selbst und ohne Beeinträchtigung durch andere Staatsorgane vornehmen4. Eine derart freie Präsidentenwahl war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in den deutschen Parlamenten nicht üblich. Vielmehr wurden dem Monarchen mehrere zuvor gewählte Kandidaten vorgeschlagen. Dieser ernannte dann einen der Kandidaten nach seinem Belieben zum Präsidenten5. In der Regel wurden drei Kandidaten vorgeschlagen. Das gleiche Verfahren wurde entsprechend bei den Vizepräsidenten angewandt. In Staaten mit Zweikammersystem wurden die meisten Präsidenten der ersten Kammer sogar bis zum Ende des Kaiserreichs ganz ohne Vorschlag der Kammer direkt vom Monarchen zum sog. „Landtagsmarschair bestellt6. Eine Wende trat erst 1848 ein, als die zentralen deutschen Volksvertretungen ein Selbstorganisationsrecht beanspruchten, was ihnen vereinzelt auch zugestanden wurde 7, beispielgebend" 8 war in diesem Zusammenhang vor allem die Entwicklung in Preußen. Dort war in den Verfassungen von 1848 und 1850 gegen ι Art. 69 I LV-Bg; Art. 41 LV-Be; Art. 86 LV-Br; Art. 32 I LV-BW; Art. 20 I LV-By; Art. 18 I LV-Ha; Art. 84 LV He; Art. 29 I LV-MV; Art. 18 I LV-Nds; Art. 38 I LV-NRW; Art. 85 II LV-RP; Art. 491 LV-SA; Art. 141 LV-SH; Art. 70 II LV-Sl; Art. 47 I LV-Ss; Art. 57 I LV-Th. 2 Neumann, Art. 86 LV-Br, Rn. 4; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 1. 3 Mahnke, Art. 49 LV-Ss, Rn. 1. 4 Geller/Kleinrahm, Art. 38 LV-NRW, Anm. 1. 5 Schick, in: DVP 1989,153 (160). 6 Vgl. § 18 der VO über die Bildung des Vereinigten Landtags vom 3. 2. 1847, pr. GS, S. 34. ι Gundelach, S. 320. « Arndt, S. 29. 2 Köhler
18
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
den Wunsch Friedrich Wilhelm IV. festgelegt worden, daß jede Kammer ihren Präsidenten, ihre Vizepräsidenten und Schriftführer selbst wählen sollte9. Die bis zum Ende des wilhelminischen Reiches praktizierte Regel, den Kandidaten für dieses Amt den Reihen der Regierungsparteien zu entnehmen, um dadurch die Verbindung der Mehrheit des Hauses zur Krone zu dokumentieren, wurde schließlich mit Einführung des parlamentarischen Systems durch das demokratische Mehrheitsprinzip verdrängt 10.
1· Die Voraussetzungen für den Erwerb Als Bewerber für das Amt des Landtagspräsidenten kommt nur ein Abgeordneter in Betracht. Diese Voraussetzung ergibt sich in Bayern, Berlin, Brandenburg und Thüringen unmittelbar aus der Landesverfassung, in der es heißt, daß der Landtag den Präsidenten „aus seiner Mitte" wählt 11 . In Baden-Württemberg und Sachsen findet sich diese Formulierung zwar nicht in der Verfassung, wohl aber in der Geschäftsordnung des Landtags wieder 12 . Auch Niedersachsen und SachsenAnhalt machen in ihren Geschäftsordnungen deutlich, daß nur ein „Mitglied des Landtags" für das Präsidentenamt vorgeschlagen werden kann 13 . Eine ausdrückliche Klarstellung hinsichtlich der Abgeordneteneigenschaft besteht indessen nicht in den Ländern Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Insbesondere ergibt sich dies nicht aus der Wendung „Der Landtag wählt seinen Präsidenten", wie vereinzelt angenommen wird 1 4 , da diese Formulierung - wie eingangs erwähnt - lediglich Ausdruck des parlamentarischen Selbstorganisationsrechts ist 1 5 . Daß aber auch hier das Abgeordnetenmandat verlangt wird, läßt sich den Länderverfassungen und Geschäftsordnungen gleichwohl mittelbar entnehmen. So enthält etwa die Hessische Verfassung die Bestimmung, „der Präsident soll der stärksten Fraktion angehören" 16, sind doch Fraktionen Vereinigungen von Mitgliedern der jeweiligen Landesparlamente, also Mandatsträger. Ebenso verhält es sich mit der Bestimmung über die Zusammensetzung des Vorstands der Bremer Bürgerschaft, dessen leitendes Mitglied der Präsident ist, wonach die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke zu berücksichtigen sind 17 . Auch hier wird die Fraktionsmitgliedschaft und damit die Abgeordneteneigenschaft vorausgesetzt. 9 Art. 7712 pr. Verf. von 1848 sowie Art. 7812 pr. Verf. von 1850. 10 Gundelach, S. 320. n Art. 691 LV-Bg; Art. 41 LV-Be; Art. 201 LV-By; Art. 57 I LV-Th. 12 § 4 1 1 GOLT-BW; § 2 V GOLT-Ss. 13 § 5 II 1 GOLT-Nds; § 4 II 1 GOLT-SA. 14 Hubrich, Verfassungsrecht, S. 65. 15 Vgl. Fn. 3 auf S. 17. 16 § 2 II GOLT-He. π Vgl. § 8 II 1 GOBü-Br.
I. Der Amtser
19
In Hamburg und Rheinland-Pfalz kommt die Abgeordneteneigenschaft bei der Besetzung des Ältestenrats zum Ausdruck, wenn es dort heißt, er „besteht aus dem Präsidenten ( . . . ) und weiteren Mitgliedern der Bürgerschaft (des Landtags)"18. Die Worte „weitere Mitglieder" ergeben, daß der Präsident ebenfalls Mitglied des Landtags sein muß. Gleiches ergibt sich in Nordrhein-Westfalen aus dem Abstimmungsverfahren durch Hammelsprung. § 52 V GOLT-NRW spricht davon, daß der Präsident seine Stimme durch öffentliche Erklärung abgibt. Stimmberechtigt sind allerdings nur Abgeordnete. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein läßt sich dieses Ergebnis schließlich dem Abgeordnetengesetz entnehmen, das dem Präsidenten eine „zusätzliche Entschädigung" zugesteht, also eine Abfindung, die über die grundlegende Entschädigung für die Tätigkeit als Abgeordneter hinausgeht 19 . Somit bleibt festzuhalten, daß auch in den o. g. Ländern die Abgeordneteneigenschaft als Grundlage für das Präsidentenamt zu verstehen ist, wenngleich sie sich erst auf den „zweiten Blick" erschließt. Bedingung für den Erwerb des Präsidentenamts ist also immer, daß der Kandidat selbst ordnungsgemäß in den Landtag gewählt wurde und über die persönlichen Voraussetzungen zur Wählbarkeit nach den entsprechenden Landeswahlgesetzen verfügt. Die Abgeordneteneigenschaft ist mithin nicht nur eine parlamentstypische Prämisse für dieses hohe Amt, sondern unerläßliche Voraussetzung für dessen Wahrnehmung 20. Zwar würde die Wahl eines Nichtmitglieds möglicherweise dem Neutralitätsanspruch dieses Amtes förderlich sein. Nicht zu unterschätzen wäre aber die Gefahr, daß außerparlamentarische Kräfte auf das Parlament einwirken und auf dessen Arbeit Einfluß nehmen könnten21. Dieser Umstand würde die autonome Stellung des Parlaments in erheblichem Maße beeinträchtigen 22. Daher gilt auch vor diesem Hintergrund die Zugehörigkeit zum Landtag als zwingendes Erfordernis für die Wählbarkeit zum Präsidentenamt. Fehlt es an einem persönlichen Mandat aus der Landtagswahl, so ist die Wahl zum Landtagspräsidenten nichtig 23 . Für den Erwerb des Präsidentenamtes ist jedoch die Abgeordneteneigenschaft allein nicht ausreichend. Vielmehr verlangen die Geschäftsordnungen, daß der Landtagspräsident auch Mitglied einer Fraktion sein muß 24 . Fraktionslose Abgeordnete sind infolgedessen von vornherein aus dem Kreis der Bewerber ausgeschlossen. Nicht notwendig ist hingegen, daß der Landtagspräsident, selbst wenn er beispielsweise nach bayerischem Verfassungsrecht in einem Teilbereich den Ministeris § 11 GOBü-Ha; § 1111 GOLT-RP. 19 § 61, II AbgG-SH; § 6 I, II AbgG-MV. 20 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 1. 21 Gerlach, S. 39. 22 Kleinschnittger, S. 18. 23 Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33. 24 Vgl. stellvertretend den eindeutigen Wortlaut von § 3 14 GOLT-Ss. *
20
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Präsidenten vertritt 25 , auch dessen Amtsvoraussetzungen in eigener Person erfüllen muß, also „Bayer" ist und das 40. Lebensjahr vollendet hat 26 .
2. Das Wahlverfahren Die Wahl des Landtagspräsidenten erfolgt in der ersten Sitzung des Parlaments. Der Umstand, daß der Präsident aus einer freien Wahlentscheidung des Parlaments hervorgeht, trägt wesentlich zur Stärkung seiner Amtsstellung und Autorität bei 27 . Die Geschäftsordnungen sehen übereinstimmend vor, daß das Wahlverfahren von dem sog. Alterspräsidenten geleitet wird. Sofern dies wie in Bremen und Nordrhein-Westfalen nicht ausdrücklich geregelt ist, beruht die Berufung des Alterspräsidenten zum Wahlleiter auf parlamentarischem Gewohnheitsrecht28. Bei dem Alterspräsidenten handelt es sich üblicherweise um den an Lebensjahren ältesten Abgeordneten, der sich zu dieser Aufgabe bereit erklärt und nach erfolgter Wahl ins Glied der Parlamentarier zurücktritt 29 . Lehnt er das Amt ab, folgt das nächstälteste Mitglied des Hauses. Lediglich in Schleswig-Holstein wird deijenige Abgeordnete zum Alterspräsidenten berufen, der dem Landtag die längste Zeit angehört hat. Entscheidend ist hier also nicht das Alter, sondern die Dauer der Mitgliedschaft. Erst bei gleicher Qualifikation fällt die Präsidentschaft auf den Abgeordneten mit dem höchsten Lebensalter 30. Die Hauptaufgabe des Alterspräsidenten besteht darin, die Voraussetzungen für die Wahl des Präsidenten zu schaffen. Demzufolge übernimmt er den Vorsitz, ernennt mindestens zwei Abgeordnete zu Schriftführern 31 und erklärt durch Namensfeststellung die Beschlußfähigkeit des Parlaments. Damit gilt das Parlament als konstituiert 32. Alsdann erfolgt die Wahl des endgültigen Präsidenten. Die Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten werden unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen von diesen mündlich vorgeschla25 Vgl. Art. 44 III 4 LV-By. 26 Köhler, in: BayVBl. 1983, 168 (172f.) m.w.N. 27 Barschel/Gebel, Art. 13 LV-SH, S. 130. 28 Vgl. v. Mangoldt/Klein, Art. 39, Anm. V 1 c. 29 § 10 II GO-Be; § 2 GOLT-Bg; § 3 I GOLT-BW; § 1 II GOLT-By; § 1 II GOBü-Ha; § 1 I GOLT-He; § 1 III, IV GOLT-MV; § 68 II GOLT-Nds; § 1 II GOLT-RP; § 59 I, II GOLT-SA; §111 GOLT-Sl; § 21 GOLT-Ss; § 1 II GOLT-Th. Dem Alterspräsidenten obliegt die Verhandlungsführung mitunter nur in dem seltenen Fall, daß der Präsident und sämtliche Stellvertreter an der Amtsführung verhindert sind, vgl. z. B. § 35 Satz 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 30 Vgl. § 1 II, IV GOLT-SH. 31 In Bayern, Hessen und Berlin sind dies regelmäßig die jüngsten Abgeordneten, vgl. § 1 II 2 GOLT-By; § 1 II GOLT-He; § 10 III 1 GO-Be. Auch in Niedersachsen erfolgt die Auswahl nach diesem Prinzip, vgl. etwa StenBer. 13.WP, 1. Sitzung vom 23. 6. 1994, S. 1. 32 Vgl. den Wortlaut von § 1 II GOLT-He a.E.
I. Der Amtser
21
gen 33 . Mitunter folgt diese Verfahrensweise entsprechenden Vorschriften in den Geschäftsordnungen 34, mitunter aber auch parlamentarischem Gewohnheitsrecht 35. Da nahezu alle Geschäftsordnungen die Präsentation von Kandidaten nicht auf solche der stärksten Fraktion beschränken - wie das mehrstufige Wahlprozedere der meisten Geschäftsordnungen zeigt - sind die einschlägigen Bestimmungen nur als Sollvorschriften anzusehen 3 6 . Das bedeutet also, daß grundsätzlich auch alle anderen Fraktionen eigene Kandidaten zur Abstimmung stellen können. Ein noch weitergehendes Vorschlagsverfahren findet sich in Baden-Württemberg. Nach § 4 Π 2 GOLT-BW bleiben Wahlvorschläge auch hier nicht ausschließlich der stärksten Fraktion vorbehalten, sondern „werden aus der Mitte des Hauses gemacht; ihre Zahl ist nicht beschränkt". Vorschlagsberechtigt ist demnach jedes einzelne Parlamentsmitglied, wobei einzubringende Vorschläge grundsätzlich nicht der Unterstützung einer Fraktion bedürfen. Eine wesentlich eingegrenztere Vorgehensweise sehen hingegen die Geschäftsordnungen der Landtage von Sachsen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vor 37 . Danach steht ausschließlich der stärksten Fraktion des Hauses das Recht zu, ein Mitglied des Landtags für die Wahl zum Präsidenten zu nominieren 38. Während allerdings in Sachsen im Falle der Nichtwahl des von der stärksten Fraktion vorgeschlagenen Kandidaten die Möglichkeit besteht, „für den zweiten Wahlgang neue Bewerber" vorzuschlagen, was Nominierungen anderer Fraktionen einschließt39, bleibt in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt das Vorschlagsrecht für den zweiten Wahlgang ausschließlich bei der stärksten Fraktion 40 . Das geschäftsordnungsmäßig vorgeschriebene Wahlverfahren des Landtagspräsidenten ist in den einzelnen Parlamenten unterschiedlich ausgestaltet. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, herrscht allerdings insoweit Einheitlichkeit, als die Wahl geheim ist, d. h. mit verdeckten Stimmzetteln durchgeführt wird 41 . Diese 33 Der Nominierung geht ein innerparteilicher Entscheidungsprozeß voraus, in dem sich meist nicht nur die Fraktion, sondern vor allem der Landesvorstand als höchstes Parteigremium auf einen Kandidaten festlegt. Dabei wird die Partei bemüht sein, eine allen Fraktionen genehme Persönlichkeit vorzuschlagen, die die Gewähr bietet, daß sie bei der späteren Wahl auch die erforderliche Stimmenzahl erhält. Vgl. bspw. § 2 II 1 GOLT-Th; § 9 I 2 GOLT-By; vgl. auch § 8 II GOBü-Br. 35 Vgl. Achterberg, S. 190 m.w.N. 3
* Achterberg, S. 190 f. ? § 3 III 2 GOLT-Ss; § 5 II 1 GOLT-Nds; § 4 II 1 GOLT-SA. 3 « Jekewitz, in: Recht und Politik 1977, 98 (99), kritisiert an diesem Verfahren zu Recht, daß es den verfassungsrechtlichen Begriff der Wahl im Sinne einer „Auswahl" unterlaufe und sich damit die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Abgeordneten auf einen faktischen Zwang zur Zustimmung zu dem einzigen dem Parlament vorliegenden Wahlvorschlag verkörpere. 3
§ 3 IV 2 GOLT-Ss. 40 § 5 IV 2 GOLT-Nds; § 4 IV 2 GOLT-SA. 41 § 46 I 3 GOLT-By; § 2 I 2 GOBü-Ha; § 8 II 1 GOLT-NRW; § 3 I 2 GOLT-MV; § 3 III GOLT-Ss; § 2 I 2 GOLT-Th; § 1 IV GOLT-SH; § 4 II 1 GOLT-BW. In Niedersachsen, Hessen
22
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Durchbrechung des Grundsatzes der Parlamentsöffentlichkeit läßt sich im Hinblick auf die neutrale Stellung des Präsidenten damit rechtfertigen, daß seine Autorität auf diese Weise gewahrt und sein Verhältnis zu den Abgeordneten nicht von vornherein belastet werden soll 42 . Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt 43 . Vereinzelt wird auch die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder verlangt 44 . In allen Länderparlamenten sehen die Geschäftsordnungen für die Präsidentenwahl ein mehrstufiges Wahlsystem vor. Dieses Verfahren ist notwendig, wenn eine Mehrzahl von Fraktionen vorhanden ist, von denen keine die absolute Mehrheit besitzt, andererseits der Präsident aber von einer breiten Mehrheit des Hauses getragen werden soll. Kommt im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit zustande, so ist der weitere Gang des Verfahrens von Parlament zu Parlament verschieden. Einige Landtage haben sich für das Prinzip der schrittweisen Auswahl entschieden45. Danach findet eine unbeschränkte Zahl von Wahlgängen statt, wobei jeweils der am wenigsten erfolgreiche Kandidat ausscheidet, bis ein Kandidat schließlich die Mehrheit erreicht hat. Mitunter können für die weiteren Wahlgänge auch neue Bewerber vorgeschlagen werden 46. Andere Landtage wiederum haben die Anzahl der Wahlgänge auf drei begrenzt 47 . Indem die Wahl im zweiten Wahlgang nicht auf die Kandidaten des ersten Wahlgangs beschränkt wird, sondern neue Kandidaten benannt werden können 48 , besteht die Möglichkeit, einen neuen und von dem ersten Wahlgang unabhängigen Versuch zu unternehmen. Führt auch der zweite Wahlgang zu keiner Entscheidung, so wird in einem dritten und letzten Wahlgang zwischen den beiden Anwärtern mit den höchsten Stimmzahlen in einer Stichwahl entschieden. Zwar ist es auch bei einer Stichwahl nicht ausgeschlossen, daß sich eine Mehrzahl von Abgeordneten der Stimme enthält oder an der Wahl nicht teilnimmt und deswegen der zu Wählende nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Mitglieder des Hauses hinter sich zu bringen braucht, da Enthaltungen und ungültig abgegebene Stimmen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mitgezählt werden. Jedoch bietet das Verfahren der Stichwahl gegenüber dem zweiten Wahlgang ohne Beschränkung der Zahl und Sachsen-Anhalt ist u.U. auch eine Abstimmung durch Handzeichen möglich, vgl. § 5 III GOLT-Nds; § 21 GOLT-He; § 4 III 1 GOLT-SA. 42 Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 3. 43 § 68 I 2 GOLT-Bg; § 9 I 2 GOBü-Br; § 4 IV 1 GOLT-BW; § 9 I 4 GOLT-By; § 2 III GOBü-Ha; § 1 V GOLT-MV; § 5 IV 1 GOLT-Nds; § 4 IV 1 GOLT-SA; § 2 II 1 GOLT-Th; § 2 II GOLT-RP; § 1 V GOLT-SH. 44 § 11 GO-Be; § 9 I 1 GOLT-He; § 3 IV GOLT-Ss. 45 46 47 48
§ 91 GOBü-Br; § 2 II GOLT-Th. § 2 II 2 GOLT-Th. § 2 II GOLT-RP; § 91 GOLT-He; § 3 IV GOLT-Ss; § 2 III GOBü-Ha. Dies gilt nicht für Hamburg, § 2 III GOBü-Ha.
I. Der Amtser
23
der Kandidaten den Vorzug, daß es einen mittelbaren Zwang zur Stimmenkonzentration enthält und damit größere Aussichten auf eine Verbreiterung der Mehrheitsbasis hat. Sollte es in diesem dritten Wahlgang dennoch zu einer Stimmengleichheit kommen, so gibt das Los durch die Hand des amtierenden Präsidenten den Ausschlag. In der Mehrzahl der Landtage findet die Stichwahl allerdings schon im zweiten Wahlgang statt 49 . Ergibt sich bei dieser Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet ebenfalls das Los. Eine Sonderregelung haben die Landtagsgeschäftsordnungen der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt getroffen 50. Danach findet weder eine schrittweise Auswahl noch eine Stichwahl statt, da nach Anordnung der Geschäftsordnungen nur ein einziger Kandidat zur Wahl stehen kann. Wird das vorgeschlagene Mitglied des Landtags nicht gewählt, kann die vorschlagsberechtigte Fraktion, die zugleich auch die stärkste ist 5 1 , ein anderes Mitglied vorschlagen. Die Anzahl der Wahlgänge ist nicht begrenzt. Findet während einer Wahlperiode eine Neuwahl des Parlamentspräsidenten statt, so erfolgt sie in gleicher Weise. Die Wahl wird dann allerdings üblicherweise nicht durch den Alterspräsidenten, sondern durch einen Vizepräsidenten geleitet 52 . Unabhängig von der geschäftsordnungsmäßigen Ausgestaltung des Vorschlagsund Wahlverfahrens und der Anzahl der danach möglichen Nominierungen wird in der parlamentarischen Praxis der meisten Länder die Benennung des Parlamentspräsidenten letztlich doch der jeweils stärksten Landtagsfraktion überlassen. Damit wird einem seit der Weimarer Republik praktizierten Parlamentsbrauch gefolgt 53 , dessen Wurzeln nach Ansicht von Meyn im Wahlmodus des britischen Unterhauses zu finden sind 54 . Ebenso entspricht es mittlerweile „verfassungsgewohnheitsrechtlicher Übung" 55 , daß der von der stärksten Fraktion des Hauses mündlich vorgeschlagene Kandidat auch antragsgemäß gewählt wird 5 6 , unabhängig davon, ob die stärkste Fraktion Regierungs- oder Oppositionspartei ist und ob sie selbst über die absolute Mehrheit verfügt 57 .
49 § 4 I V GOLT-BW; § 74 IV, V GO-Be; § 1 V GOLT-MV; § 1 V GOLT-SH; § 48 GOLTBy; § 67 II Gesetz Nr. 970 über den Landtag des Saarlandes. » § 5 I V 2 GOLT-Nds; § 4 I V 2 GOLT-SA. § 5 II 1 GOLT-Nds; § 4 II 1 GOLT-SA. 52 Vgl. Achterberg, S. 191. 53 Rummel, S. 38. 54 Meyn, in: JZ 1977,167 (169) m.w.N. Bemerkenswert ist dabei die Regel, daß der Speaker - auch wenn im Parlament die Mehrheit gewechsel hat - wiedergewählt werden muß, sofern er es selbst wünscht, und daß die stärkste Fraktion des Unterhauses erst dann den Anspruch hat, den Posten zu besetzen, wenn der alte Speaker zurücktritt. 55 Stern II, S. 90. 56 Versteyl, in: v. Münch, Art. 40, Rn. 3; Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 1; Barschel/Gebel, Art. 13 LV-SH, Anm. 2; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 3; David, Art. 49, Rn. 1; vgl. auch PIPr. des Niedersächsischen Landtags, 13. WP, 1. Sitzung, S. 8; Schäfer, S. 68.
24
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Praxis ergibt sich aus dem demokratischen Mehrheitsprinzip im Parteienstaat. Dem Parlament wird in der durch Art. 21 GG abgestützten Verfassungswirklichkeit des parlamentarischen Systems seine Legitimation vor allem durch die Wahl und damit aber auch über die politischen Parteien vermittelt. Deshalb soll diejenige Partei, die vom Wähler die meisten Sitze zugesprochen erhalten hat, berechtigt sein, den höchsten Repräsentanten des Parlaments - der dieses wiederum insbesondere auch dem Wähler gegenüber repräsentiert - zu stellen 58 . Einen rechtlichen Anspruch der stärksten Fraktion, das Präsidentenamt zu besetzen, gibt es allerdings nicht 59 . Selbst wenn die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags in § 2 I I bestimmt: „Die Präsidentin oder der Präsident soll der stärksten Fraktion angehören", so ist dies lediglich eine Soll-Vorschrift, aus der sich in dieser Hinsicht keine Rechtsansprüche ableiten lassen. Diese können auch nicht aus dem Rechtssatz hergeleitet werden, daß die Zusammensetzung des Präsidiums bzw. Vorstands im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen sei 60 . Zwar könnte man daran denken, die „ratio legis" dieser Vorschrift darin zu sehen, daß das Hauptgewicht in der Organisation des Parlaments der stärksten Fraktion zukommen soll, insbesondere durch Besetzung des Präsidentenamtes61. Jedoch ist im allgemeinen die Stellung des Landtagspräsidenten gegenüber derjenigen der anderen Mitglieder des Präsidiums weitaus gewichtiger, so daß von einer verhältnismäßigen Besetzung im Sinne einer Verhältnisrechnung eigentlich keine Rede sein kann 62 . In Ansehung der parlamentarischen Praxis, den Präsidenten regelmäßig der stärksten Fraktion zu entnehmen, kann allenfalls von einer »Anwartschaft" gesprochen werden, die aber keine weitergehende Rechtswirkung entfaltet. Im übrigen finden prinzipiell - einer alten parlamentarischen Tradition entsprechend - vor der Wahl des Präsidenten und seiner Stellvertreter „interfraktionelle" Verhandlungen über die zu besetzenden Ämter statt 63 . Die kleinen Fraktionen nehmen auf diese Weise für sich ein indirektes Mitspracherecht bei der Kandidatenwahl in Anspruch, da der Präsident ja schließlich „für das gesamte Parlament" 64 gestellt wird. Derartige Besprechungen sind jedoch sowohl für die Fraktionen als auch für die einzelnen Mitglieder des Hauses nicht verbindlich 65 . 57 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 5. So stellt beispielsweise in Hessen in der 14. WP. die CDU als stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten, ohne jedoch Regierungspartei zu sein. 58 Meyn, in: JZ 1977,167 (168). 59 So bereits v. Brentano, S. 24. Vgl. auch Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 16 ff. 60 Vgl. etwa § 101 1 GOBü-Ha; § 8 II 1 GOBü-Br; § 13 12 GOLT-Bg. 61 So Sperling, S. 10. 62 Vgl. Kleinschnittger, S. 19. 63 Hatschek, S. 202.
64 So der Abg. Walter Menzel in einer Geschäftsordnungsdebatte während der 53. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 16. 11.1954, Sten. Bericht, Bd. 22, S. 2696. 65 Ritzel /Bücker, § 2, Anm. 1 c, S. 1.
I. Der Amtser
25
Keine Besonderheiten ergeben sich schließlich für den Fall, daß die Fraktion, die den Präsidenten stellt, im Laufe einer Wahlperiode ihre Stellung als stärkste Fraktion verliert. Da diese Stellung - wie oben festgestellt - keine rechtliche Voraussetzung, sondern lediglich eine traditionelle für die Wählbarkeit eines ihrer Abgeordneten zum Präsidenten ist, bleibt auch der Verlust dieser Stellung ohne Bedeutung für die weitere Innehabung des Präsidentenamtes66. Zu dem gleichen Ergebnis kam der Staatsgerichthof des Landes Niedersachsen, als er über die Folgen der Veränderung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen im Niedersächsischen Landtag zu entscheiden hatte. Hier hatten sich am 29. März 1962 16 Abgeordnete der DP-Fraktion der CDU angeschlossen, wodurch diese mit nunmehr 69 Mitgliedern zur stärksten Fraktion des Landtags wurde. Die CDU-Fraktion vertrat daraufhin die Ansicht, daß nach dem Wortlaut des § 812 GOLT-Nds („Die Stelle des Präsidenten wird von der stärksten Fraktion besetzt.")67 das Amt des Landtagspräsidenten durch diese Veränderung im Bestände der Landtagsfraktionen vakant geworden und daher nach einem von ihr zu machenden Vorschlag neu zu besetzen sei 68 . Der Staatsgerichtshof entschied jedoch, daß die Wahl zum Parlamentspräsidenten nicht unter der auflösenden Bedingung konstanter Mehrheiten erfolge 69. Da der Landtagspräsident für die gesamte Dauer der Wahlperiode gewählt werde, komme es vielmehr allein auf die Fraktionsstärken zur Zeit der Wahl an 70 . Eine Änderung des Stärkeverhältnisses entziehe also der einmal erfolgten Wahl nicht die Grundlage und führe damit nicht zu einem Freiwerden der betreffenden Stelle und nicht zu einem Neuwahlzwang 71 . Der Antrag der CDU blieb daher ohne Erfolg 72 . Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf eine Besonderheit in der Geschäftsordnung der Bremer Bürgerschaft. Hier enthält § 8 Π 2 für eine Änderung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen die Regelung, daß auf Antrag einer Fraktion Neuwahlen für die von der Änderung betroffenen Stellen des Vorstandes, einschließlich des Präsidentenamtes, vorzunehmen sind. Allerdings ist diese Vorschrift nach Aufhebung der entsprechenden verfassungsrechtlichen Verankerung in Art. 86 I 3 der Bremer Landessatzung73 ohne jede praktische Relevanz. Ändert « Uhlitz, in: AöR 87 (1962), S. 296 (306 ff.); David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 8. 67 Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtags in der Fassung vom 8. 7.1959. 68 Antrag der CDU-Fraktion in der Plenarsitzung am 19. 04. 1962. 69 Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 13. 08. 1962, Drs. IV, Nr. 912, S. 4760. 70 Ebenda. 71 Loewenberg, S. 175. 72 Etwas anders beurteilte hingegen der Landtag von Nordrhein- Westfalen diese Konstellation, als die CDU nach einer Korrektur der Sitzverteilung infolge der Kommunalwahlen vom Oktober und September 1946 zur stärksten Fraktion geworden war und nun die Position des Parlamentspräsidenten beanspruchte. Daraufhin mußte der SPD-Abgeordnete Gnoß, der als erster Präsident des Landtags amtierte, nach nur zehnwöchiger Amtszeit noch während der Sitzungsperiode sein Amt an den CDU-Abgeordneten Lehr abtreten. Gnoß wurde Vizepräsident. Vgl. zu diesem Vorgang auch Dierl, S. 146 f. 73 Geändert durch Gesetz vom 1.11. 1994, BremGBl. S. 289.
26
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
sich also im Laufe der Wahlperiode die Fraktionsstärke wesentlich und wird eine andere Fraktion stärkste Fraktion, so hat sie nach einhelliger Auffassung im
Schrifttum keinen Anspruch auf eine Neuwahl74.
3. Der Amtserwerb und dessen Folgen Der Gewählte erwirbt das Amt des Landtagspräsidenten erst mit der ausdrücklichen Annahmeerklärung 75. Dies entspricht einem feststehenden parlamentarischen Brauch 76 , der sich in dieser Form auch vereinzelt in den Geschäftsordnungen der Landtage wiederfindet 77. Erklärt sich der Gewählte auf Anfrage des amtierenden Präsidenten zur Annahme des Präsidentenamtes bereit, geht die Führung der Geschäfte sofort auf ihn über. Zugleich bedeutet sie das Ende der Tätigkeit des Alterspräsidenten. Die persönliche Abwesenheit des Gewählten in der konstituierenden Sitzung des Landtags steht dem Amtserwerb nicht entgegen, sofern die Erklärung über die Annahme der Wahl auf andere Weise erfolgt 78 . Die einmal abgegebene Annahmeerklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden 79. Eine rechtliche Verpflichtung zur Amtsübernahme besteht indessen nicht und wäre auch nicht realisierbar 80. Der Gewählte hat daher die Möglichkeit, die Annahme abzulehnen81. In diesem Fall gilt die Wahl als nicht erfolgt und muß wiederholt werden 82. Gleichwohl besteht für den Gewählten eine „moralische Pflicht" zur Übernahme des Präsidentenamtes83, die sich auch den parlamentarischen Geschäftsordnungen entnehmen läßt. Danach ist jeder Landtagsabgeordnete verpflichtet, an den Arbeiten des Landtags teilzunehmen84, d. h. entsprechend seiner Kraft und unter Einsatz seiner persönlichen Fähigkeiten an den parlamentarischen Aufgaben mitzuwirken. Diese Verpflichtung zur Beteiligung an der Parlamentsarbeit konkretisiert sich insbesondere in der Übernahme von Ämtern 85 , für die einem Abgeordneten von der Mehrheit der Parlamentsmitglieder das Vertrauen ausge74 Vgl. nur Neumann, Art. 86 LV-Br, Rn. 7. 75 Gerlach, S. 51 f. 76 Gentemann, S. 12; Mühlbauer, S. 8. 77 Siehe z. B. § 4 V GOLT-BW; § 3 V GOLT-Ss. 78 Hatschek, S. 206. 79 Ebenda. 80 Perels, S. 16, Ν 16; Stern, Stellung des Reichstagspräsidenten, S. 33 ; Spengler, S. 13. 81 Rummel, S. 39. 82 Vgl. bspw. § 4 V GOLT-BW. 83 Böttcher, S. 32. 84 § 1 I GO-Be; § 3 11 GOLT-Bg; § 1 I GOBü-Br; § 73 GOLT-BW; § 3 I GOLT-By; § 391 GOLT-He; § 361GOLT-MV; § 1 11 GOLT-Nds; § 31GOLT-NRW; § 141 GOLT-RP; § 1 II 1 GOLT-SA; § 47 IGOLT-SH; § 10 II 1 GOLT-Ss; § 13 I GOLT-Th. 85 So bereits Hatschek, S. 603.
I. Der Amtser
27
sprochen wurde. Um so mehr muß dies für die Übernahme des herausragenden Amtes des Landtagspräsidenten gelten, so daß sich der designierte Parlamentspräsident dieser Verpflichtung nicht ohne weiteres durch Ablehnung entziehen kann. Mit der Übernahme des Präsidentenamtes tritt der Abgeordnete in einen neuen Pflichtenkreis ein und erwirbt damit Rechte, die ihm bisher nicht zustanden. Diese Rechte verpflichten ihn, sich bei der Ausübung seines Amtes vom Grundsatz der parteipolitischen Neutralität leiten zu lassen86. Die Verpflichtung zur Unparteilichkeit bedeutet jedoch nicht, daß der Landtagspräsident zu einem politischen Neutrum wird 8 7 . Zwar ist es unbestritten, daß der Präsident in seiner Funktion als Sitzungspräsident in die sachlichen Auseinandersetzungen des Parlaments nicht derart eingreifen darf, daß er Reden parteipolitischen Inhalts hält 88 . Der Parlamentspräsident kann diesbezüglich nur Erklärungen für das gesamte Parlament abgeben89. Es bleibt ihm jedoch unbenommen, sich in seiner Eigenschaft als Abgeordneter - und eben nicht als Sitzungspräsident - an den Plenardebatten zu beteiligen, ohne daß er dies ausdrücklich erklären müßte90. Von dieser Möglichkeit macht der Landtagspräsident üblicherweise aber nur in besonderen, die Belange des ganzen Hauses betreffenden Angelegenheiten Gebrauch 91. In einem solchen Fall ist er gehalten, den Vorsitz abzugeben92, indem er - nicht nur eine reine Äußerlichkeit - den Präsidentensessel verläßt und an das Rednerpult tritt 93 . Aber auch dann erwartet man von ihm, daß er überzogene Polemik und unnötige Schärfe vermeidet, damit seine Integrationsfunktion keinen Schaden nimmt 94 . Mit der Übernahme des Präsidentenamtes geht keine Einschränkung der Statusrechte als Abgeordneter einher. Naturgemäß behält er auch weiterhin sein Mandat, denn die Verlustgründe sind in den einzelnen Landeswahlgesetzen abschließend geregelt, und die Wahl zum Landtagspräsidenten ist darin nicht enthalten95. Zudem 86
Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 3. 87 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 11. 88 Wohl aus diesem Grunde ist es in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein einem Mitglied des Sitzungspräsidiums nicht gestattet, daß Wort in der Sache zu ergreifen, § 41 IV GOLT-MV, § 52 VI GOLT-SH. Dadurch wird der Gefahr vorgebeugt, daß ein Sachbeitrag in eine parteipolitische Kampfrede abgleitet. 8 * BVerfGE 1, 115(116). 90 In dieser Form trat bspw. der Präsident des Niedersächsischen Landtags in einer kontroversen Debatte über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung sehr energisch für die Aufnahme des Gottesbezuges in die Landessatzung ein, vgl. PlPr. 12. WP, 106. Sitzung vom 19. 05. 1994, S. 10004. So Dierl, S. 153; Lemke, § 46, Anm. 6; Rausch, S. 77. « § 106 GOLT-By; § 58 II GO-Be; § 25 III GOLT-Bg; § 82 V GOLT-BW; § 5 VI GOBü-Ha; § 57 GOLT-He; § 67 IV GOLT-Nds; § 57 II GOLT-NRW; § 85 VI GOLT-Ss; § 26 III GOLT-Th; § 27 III GOLT-RP. 93 Hatschek, S. 216. 94 Schick, S. 156.
95 Vgl. dazu auch Carstens, S. 122; Achterberg, S. 123, Fn. 8; Spengler, S. 10; Schick, S. 156.
28
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
wäre es widersinnig, wenn das Mandat einerseits Voraussetzung für das Präsidentenamt ist, es aber andererseits beim tatsächlichen Erwerb des Amtes wieder entfallen sollte. Vor diesem Hintergrund muß sich der Präsident auch nicht der Teilnahme an Abstimmungen enthalten96. An dem - nach englischen Vorbild 97 in der Paulskirchenversammlung geprägten Grundsatz: „Der Präsident stimmt niemals ab" 9 8 wurde schon alsbald nicht weiter festgehalten. Heute nimmt der Landtagspräsident in allen Landesparlamenten stets an den Abstimmungen als Mitglied des Hauses teil 9 9 , wie auch der Wortlaut einiger Geschäftsordnungsbestimmungen zum Teil sehr deutlich unterstreicht 100. Bis 1918 war es üblich, den Präsidenten darum zu ersuchen, sich von seiner Fraktion zu trennen 101 und unter Umständen sogar die Parteimitgliedschaft niederzulegen 102 . Dadurch sollte eine besonders unabhängige Haltung zum Ausdruck gebracht werden 103 . Seit der stark von Parteigefühlen bestimmten Atmosphäre der Weimarer Republik wird dieser Brauch entschieden abgelehnt104. Wie eingangs erläutert, wird der Präsident nunmehr übungsgemäß der stärksten Fraktion des Landtags entnommen. Es wäre daher geradezu widersinnig, ihn dann nach der erfolgten Wahl von seiner Fraktion abschwören zu lassen 105 . In einigen Ländern, wie Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 106 , enthalten die Landtagsgeschäftsordnungen sogar die Bestimmung, daß der Präsident seines Amtes verlustig geht, wenn er aus der Fraktion, die ihn vorgeschlagen hat, ausscheidet. Der Parlamentspräsident bleibt also auch nach der Amtsübernahme Mitglied seiner Fraktion 107 . Darüber hinaus bekleidet er im allgemeinen auch während seiner Amtszeit wichtige Ämter innerhalb seiner Fraktion, beispielsweise als Vorstandsmitglied 108 . In Anbetracht der Tatsache, daß der Landtagspräsident nach der Amtsübernahme keine Einschränkung seines Abgeordnetenstatus erfährt, stehen ihm infolgedessen auch die elementaren Schutzrechte der Immunität und Indemnität zu. Eine Beson96 Gentemann, S. 13. 97 Hierzu Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 34. 98 § 43 Satz 2 Geschäftsordnung der Nationalversammlung von 1848, beschlossen in der 9. Sitzung am 29. 05. 1848, in: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt a.M., Nr. 10, S. 165. 99 Loewenberg, S. 180; Dierl, S. 153. 100 Vgl. § 70 II 7 GO-Be und die Anmerkung zu § 52 V 2 GOLT-NRW. 101 Kleinschnittger, S. 24. 102 Loewenberg, S. 179; Hatschek, S. 184,212. 103 Spengler, S. 11. 104 Carstens, S. 124; Loewenberg, S. 179. 105 Kleinschnittger, S. 24. 106 § 5 V GOLT-Nds; § 4 V GOLT-SA; § 2 I V GOLT-Th. io? Schick, S. 156. los Dierl, S. 150 f.; Achterberg, S. 285.
I. Der Amtser
29
derheit haben in diesem Zusammenhang die Verfassungen von Bayern, BadenWürttemberg und Hessen zu verzeichnen, die eine zeitliche Erstreckung des Abgeordnetenschutzes für den Parlamentspräsidenten und die weiteren Mitglieder des Präsidiums über die Dauer der Wahlperiode hinaus vorsehen 109. Eine derartige Regelung ist in diesen Ländern zwecks Wahrung der Kontinuität der Geschäfte deshalb erforderlich, weil die Landtagsabgeordneten mit dem Ablauf der Wahlperiode oder mit der Auflösung des Landtages ihren Abgeordnetenstatus verlieren 110 . Hingegen bedarf es in allen anderen Ländern keines besonderen Schutzes durch Ausdehnung der formellen Immunität über die Dauer der Wahlperiode hinaus, da alle Abgeordneten den Immunitätsschutz bis zum Zusammentritt des neuen Landtags genießen111. Allerdings besteht die wohl rein theoretische Möglichkeit, daß das alte Präsidium noch über den Zeitpunkt des ersten Zusammentritts hinaus im Amts bleibt, weil es in der ersten Sitzung noch nicht zur Neuwahl gekommen ist. In dieser Zeit zwischen dem ersten Zusammentritt und der Neuwahl würden in der Tat die Mitglieder des alten Präsidiums, die dem neuen Landtag nicht angehören, ohne Immunitätsschutz ihr Amt ausüben müssen112.
4. Die Erforderlichkeit eines Amtseides Vor dem Hintergrund, daß nahezu alle wichtigen staatlichen Funktionsträger wie Bundespräsident 113, Bundeskanzler und Minister 114 sowie Verfassungsrichter 115 vor dem Antritt ihres Amtes einen Eid auf die Verfassung abzulegen haben, stellt sich auch für den Parlamentspräsidenten die Frage der Eidesleistung. Einen speziell für den Präsidenten geschaffenen Eid hat es weder in der bisherigen Parlamentsgeschichte gegeben, noch ist in der parlamentarischen Gegenwart eine entsprechende Regelung getroffen worden. Gleichwohl war im 19. Jahrhundert eine Vereidigung der Abgeordneten und mithin auch des Präsidenten als Mitglied des Hauses durchaus üblich 116 . Mit dem 109 Art. 32 LV-By; Art. 44 LV-BW; Art. 85 Satz 2 LV-He. no Vgl. Braun, Art. 44 LV-BW, Rn. 1. Früher galt dies auch für Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, vgl. Art. 18 VNV; Art. 40 Satz 6 LV-NRW; Art. 39 V LV-Be; Art. 92 Satz 2 LV-RP; Art. 19 LV-SH. m Vgl. z. B. Art. 48 IV LV-NRW; Art. 13 I 2 LV-SH; Art. 9 I 2 LV-Nds; Art. 10 I 2 LVHa; Art. 441 2 LV-Ss; Art. 62 IV LV-Bg; Art. 50 III 1 LV-Th; Art. 27 I 2 LV-MV; Art. 43 LVSA; Art. 54 V 1 LV-Be; Art. 67 I 2 LV-Sl; Art. 85 II 2 LV-RP. uz So auch Geller/Kleinrahm, Art. 38 LV-NRW, Anm. 4. 113 Art. 56 GG. 114 Art. 69 II GG. 115 § 11 BVerfGG. 116 Vgl. beispielsweise § 25 der Verfassung des Königreichs Bayern vom 26. 5. 1818, § 74 der Verfassung für das Kurfürstentum Hessen vom 5. 1. 1831 sowie § 82 der Verfassung für das Königreich Sachsen vom 4. 9. 1831. Einen guten Überblick zum Abgeordneteneid bietet Friesenhahn, Der politische Eid, S. 64-82.
30
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Beginn der Weimarer Republik wurde auf diesen Brauch jedoch völlig verzichtet 1 1 7 . Möglicherweise schreckten hier die Spuren des konstitutionellen Verfassungsrechtes, unter dem die Abgeordneten formell zwar meist auf die Verfassung, damit aber zugleich auch auf das dieser zugrundeliegende monarchische Prinzip verpflichtet wurden 118 . Gegenwärtig wird die Eidesleistung in keiner geltenden deutschen Verfassung mehr gefordert. Lediglich in den Geschäftsordnungen von vier Landtagen ist eine Verpflichtung der Abgeordneten einschließlich ihres Präsidenten auch heute noch vorgesehen. Dabei handelt es sich von der Rechtsnatur her jeweils um einen sog. promissorischen Eid, also ein Versprechen für künftiges Verhalten 119. So stellt etwa die Geschäftsordnung des Nordrhein-Westfälischen Landtages in § 21 fest: „Die erste Sitzung beginnt mit dem Namensaufruf der Abgeordneten und ihrer Verpflichtung. Die vor dem Landtag abzugebende Verpflichtungserklärung lautet: ,Die Mitglieder des Landtags von Nordrhein-Westfalen bezeugen vor dem Lande, daß sie ihre ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die übernommene Pflicht und Verantwortung nach besten Wissen und Können erfüllen und in der Gerechtigkeit gegenüber jedem Menschen dem Frieden dienen werden/ Die Verpflichtung wird durch Erheben von den Plätzen bekräftigt."
Die Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages hat sich dieser Formulierung in § 2 ΠΙ angeschlossen. Sie ergänzt den Text lediglich mit der Verpflichtung, die Verfassung und Gesetze zu achten. In § 2 Π der Geschäftsordnung der Landtage von Schleswig-Holstein und Mecklenburg· Vorpommern heißt es dagegen unter Verwendung der Begriffe „Eid" und „Schwur": „Die Eidesformel lautet: ,Ich schwöre, meine Pflichten als Abgeordneter gewissenhaft zu erfüllen, Verfassung und Gesetze zu wahren und dem Lande unbestechlich und ohne Eigennutz zu dienen, so wahr mir Gott helfe/ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden."
In allen vier Landtagen leistet der Präsident also den Eid in seiner Eigenschaft als Abgeordneter und nicht in seiner Stellung als Parlamentspräsident. Im Unterschied zu Nordrhein-Westfalen und Sachsen, wo alle Mitglieder des Hauses gemeinsam vom Alterspräsidenten verpflichtet werden, leistet der Landtagspräsident in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern den Eid zeitlich als erster und wird damit aus der Gesamtheit der Parlamentarier hervorgehoben 120. Im übrigen scheint es nach beiden Geschäftsordnungen nicht zwingend zu sein, daß der Präsident lediglich schwört, seine „Pflichten als Abgeordneter" gewissen117 Steffani, in: ZParl 1976,86 (lOOf.). us So Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 56, Rn. 2. 119 Vgl. Friesenhahn, Der politische Eid, S. 21. 120 Vgl. ζ. B. PIPr. SH, 9. WP, 1. Sitzung vom 29. 05. 1979, S. 4.
I. Der Amtser
31
haft zu erfüllen 121 . Diese Formel in § 2 Π ist nämlich nur für die Vereidigung der Abgeordneten vorgeschrieben, die durch den Präsidenten erfolgt. Hingegen wird für die in § 1 IV der Geschäftsordnungen vorgesehene Vereidigung des Landtagspräsidenten durch den Alterspräsidenten keine konkrete Formel angegeben. Hier könnte sich die Möglichkeit eines speziellen „Präsidenteneides" eröffnen, ohne davon jedoch die Berechtigung zur Amtsübernahme abhängig zu machen oder an die Verwerfung der Eidesleistung Sanktionen bezüglich der Gültigkeit von Amtshandlungen zu knüpfen 122 . Einem besonderen Präsidenteneid wird mitunter entgegengehalten, er würde die Gruppe der Parlamentarier spalten. In Anbetracht der Tatsache, daß ζ. B. Teile der Aufgaben des Parlamentspräsidenten auch von seinen Stellvertretern wahrgenommen werden, müßten diese konsequenterweise ebenfalls einen Eid leisten. Damit aber würden in allen Landtagen, mit Ausnahme der oben genannten, zwei Arten von Abgeordneten geschaffen: vereidigte und unvereidigte 123. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, daß das Amt des Parlamentspräsidenten von großer Bedeutung für das Funktionieren des gesamten Staatsmechanismus ist und die Gewichtigkeit des Amtes durch einen vom Präsidenten zu leistenden Verfassungseid noch stärker herausgehoben und gefestigt werden würde 124 . Außerdem ist es inkonsequent, daß der Landtagspräsident Regierungsmitglieder und andere Funktionsträger (ζ. B. in Berlin den Datenschutzbeauftragten, § 18 Π Berliner Datenschutzgesetz) vereidigt, ohne selbst einen Eid geleistet zu haben. Neben der rechtlichen Komponente des Eides, nämlich dem Bekenntnis des Amtsträgers zur Verfassung und den besonderen Pflichten des Amtes, in das er berufen ist 1 2 5 , kommt dem Eid zudem eine außerrechtliche, psychologische Komponente zu 1 2 6 : Im Zuge der Eidesleistung verpflichtet sich der neue Amtsträger vor den Augen der Öffentlichkeit auf diejenigen politischen und ethischen Grundpositionen, die er für sein Wirken in Anspruch nimmt. Dabei kann es vorkommen, daß diese Grundpositionen für den einzelnen u. U. wesentlich höherwertiger und wesentlich verbindlicher sein mögen als anderweitige Rechtsvorschriften oder gar die Verfassung selbst. Hieraus erwachsen für ihn zusätzliche Beweggründe, das Amt des Parlamentspräsidenten so zu führen, wie es der Verfassung und vor allem seinen verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen entspricht. Auf diese Weise bindet der Schwörende seine Amtsführung an sein innerstes Selbstverständnis und an den Kern seiner Persönlichkeit 127. Diese Bindung in der persönlich-inneren Sphäre bewirkt zudem eine Verstärkung der Gewissensbisse vor einem Eidesbruch und errichtet damit 121 So Härth, in: ZParl 1985,497 (503); a.A. Lembke, § 1, Anm. 4. 122 Stern II, S. 208. 123 Vgl. Schick, S. 27 f. 124 Vgl. Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 3; Härth, in: ZParl 1980,497 (503). 125 Stern II, S. 207. 126 Vgl. Friesenhahn zum Beamteneid, S. 91. 127 Vgl. auch Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 56, Rn. 10.
32
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
eine letzte Hemmschwelle. Der Eid stellt damit einen Appell an den inneren Zensor dar 1 2 8 . Die Forderung nach einem Amtseid des Parlamentspräsidenten ist sicherlich nicht frei von Konflikten. Sie ist dennoch legitim und unter Berücksichtigung der besonderen staatsrechtlichen Stellung des Präsidentenamtes im Rahmen der Landesverfassungen geboten. Je stärker herausgehoben und dem gesamten Staatswesen verpflichtet ein Amt ist, desto eher ist eine Verfassungsbindung in Form einer besonderen Eidesleistung begründet 129.
5. Die Inkompatibilität mit anderen Tätigkeiten Eine Inkompatibilität, also eine öffentlich-rechtliche Unvereinbarkeit des Präsidentenamtes mit bestimmten anderen Ämtern, Berufen oder Betätigungen130, bemißt sich in erster Linie nach den Abgeordnetengesetzen der Länder. Dabei wird man ζ. B. ein Verbleiben in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis - wie bei jedem Abgeordneten - als unzulässig erachten müssen131. Diese Reglementierung soll verhindern, „daß Angehörige des Parlaments, die auch Mitglieder der Exekutive sind, gleichsam sich selbst kontrollieren." 132 Die Unvereinbarkeitsbestimmung verfolgt daher das doppelte Ziel einer Sicherung der Gewaltenteilung einerseits und einer parteipolitischen Neutralität des Beamtentums andererseits 133 . Weiterhin kann der Landtagspräsident als Repräsentant des gesamten Parlaments nicht zugleich auch Mitglied der Staatsregierung sein. In dieser Beziehung bestehen ungeschriebene, in langer parlamentarischer Tradition gefestigte und von der Praxis durchweg beachtete Inkompatibilitäten 134 . Eine gleichzeitige Ausübung 128 Stern II, S. 207. 129 Vgl. Steffani, in: ZParl 1976, 86 (108). 130 Siehe hierzu Weber, in: AöR 58 (1930), 164. m Vgl. §§ 27 ff. AbgG-Be; §§ 28 f. AbgG-Bg; §§ 28 f. AbgG-Br; §§ 26ff. AbgG-BW; Art. 29ff. AbgG-Bay; §§ 27 ff. AbgG-He; §§ 34ff. AbgG-MV; § 5 AbgG-Nds; §§ 31 ff. AbgG-NRW; §§ 29ff. AbgG-RP; §§ 34ff. AbgG-SH; §§ 32ff. AbgG-Sl; §§ 33ff. AbgG-Th. Dieser Regelung folgend gab beispielsweise der Präsident des Landtags von MecklenburgVorpommern, Prachtl (CDU), nach der Wahl seine Tätigkeit als Abteilungsleiter und Stellvertreter des Regierungsbevollmächtigten der Regionalverwaltung Neubrandenburg auf. Vgl. außerdem § 25 SoldG sowie § 36 DRiG. Etwas anderes gilt in Teilzeitparlamenten wie der Hamburger Bürgerschaft. Hier schließt das Abgeordnetenmandat ein Verbleiben in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nicht aus, sofern dabei dauerhaft und regelmäßig keine hoheitsrechtlichen Aufgaben mit Zwangs- und Befehlsgewalt wahrgenommen werden, vgl. §§ 13 ff. WahlG-HaBü. Dementsprechend ist die amtierende Bürgerschaftspräsidentin Pape (SPD) nach wie vor als Studienrätin an einer Gesamtschule tätig. 132 BVerfGE 18, 73 (77). 133 Vgl. Klein, in: ZBR 1964, 225 (226). 134 Sturm, S. 95, 99.
I. Der Amtser
33
leitender Funktionen in beiden Organen würde sich nicht mehr als Konsequenz des parlamentarischen Regierungssystems darstellen, das insoweit das Gewaltenteilungsprinzip zu verdrängen vermöchte. Der personellen Identität von Parlament und Regierung sind mithin enge Grenzen gesetzt, denn der Grundsatz subjektiver Gewaltenteilung verhindert jedenfalls eine Funktionsvereinigung auf der Ebene der offiziellen, das Organ oder einen seiner Teile repräsentierenden Parlamentsämter 135 . Des weiteren ist - schon allein aufgrund des Abgeordnetenmandats - eine Verknüpfung des Landtagspräsidentenamtes mit einer Mitgliedschaft bei den Verfassungsgerichten der Länder unzulässig136, da der Repräsentant der gesetzgebenden Gewalt nicht zugleich der sie kontrollierenden Judikative angehören kann. Gleichermaßen ist eine Zugehörigkeit zu den jeweiligen Landesrechnungshöfen mit diesem Amt unvereinbar. Die quasirichterliche Kontrollfunktion der Rechnungshöfe setzt nämlich ebenso deren sachliche und personelle Unabhängigkeit voraus wie der in einem erweiterten Sinn auch hier zutreffende Gedanke der notwendigen Abgrenzung von Parteistellung und Richteramt, der jeder personellen Identität entgegenläuft 137 . Sowohl die richterliche Tätigkeit als auch die Mitwirkung bei einem Landesrechnungshof erfordert strenge Objektivität. Andererseits wird man dem Parlamentspräsidenten die Möglichkeit der Mitgliedschaft in kommunalen Vertretungskörpern, beispielsweise in Gemeinderat, Kreistag oder Bezirkstag, mangels entgegenstehender Regelung nicht absprechen können 138 . Außerdem bleibt dem Landtagspräsidenten eine vergütete oder ehrenamtliche Funktion in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessensverbänden oder ähnlichen Organisationen unbenommen, sowie eine entsprechende Tätigkeit als Mitglied eines Vorstandes, eines Aufsichtsrats, eines Verwaltungsrats oder einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des Öffentlichen Rechts 139 . Schließlich wird man dem Landtagspräsidenten eine zusätzliche berufliche Tätigkeit, ζ. B. als Rechtsanwalt140, vom Grundsatz her nicht versagen können, wenngleich dies nicht uneingeschränkt gelten kann. Die Ausübung beliebiger wei»35 Vgl. Sturm, S. 96. 136 Vgl. Art. 112 V 2 LV-Bg; Art. 139 Satz 5 LV-Bg; Art. 68 III 6 LV-BW; Art. 68 III 2 LV-By; Art. 65 I 3 LV-Ha; Art. 130 I 1 LV-He; Art. 52 IV LV-MV; Art. 55 III LV-Nds; Art. 134 IV 2 LV-RP; Art. 74IV 1 LV-SA; Art. 81 III 3 LV-Ss; Art. 79 III 1 LV-Th. Vgl. auch die entsprechenden Gesetze über die Verfassungsgerichte der Länder. 137 Sturm, S. 85. 138 Der Präsident des Niedersächsischen Landtags Milde (SPD) war bis 1991 zugleich Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg. Vgl. hierzu auch BVerfGE 44, 245 ff. 139
So war ζ. B. der Präsident des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern Mitglied des ZDF-Fernsehrates, des ZK der deutschen Katholiken sowie Vorsitzender des Landesfremdenverkehrsverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Der Präsident des Thüringischen Landtags ist Mitglied des Aufsichtsrats der Klink-Neubau-Gmbh Weimar und der Niedersächsische Landtagspräsident ist Vorsitzender des Landesverbandes der Volkshochschulen in Niedersachsen. 140 Zur Kompatibilität von Anwaltsberuf und Mandat siehe BGH, in: DRiZ 1978,282. 3 Köhler
34
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
terer Tätigkeiten findet verfassungssystematisch da ihre Grenzen, wo sie ihn nach Art und Umfang in der ordnungsgemäßen Führung seines Amtes beeinträchtigt. Eine derartige Einschränkung gilt naturgemäß auch für die Wahrnehmung weiterer politischer Ämter, die für den Parlamentspräsidenten unbeschadet des Neutralitätsgebots kein Tabu darstellt. So kann er etwa den Vorsitz eines Landtagsausschusses übernehmen, sofern er es schafft, diese anspruchsvolle Aufgabe zeitlich zu bewältigen. Ebenso ist die parallele Übernahme von Ämtern innerhalb der eigenen Partei unter dieser Prämisse möglich und durchaus üblich 141 . Problematisch erscheint hingegen die gleichzeitige Übernahme eines Fraktionsvorsitzes im Landtag. Sie dürfte sich schon aus Zeitgründen nicht mit dem Amt des Landtagspräsidenten vertragen. Außerdem begegnet eine solche Tätigkeit aus den verschiedenen Funktionen des Amtes heraus gravierenden Bedenken. Eine gewisse Distanz zu den im Landtag vertretenen Fraktionen ist für die Akzeptanz des Amtsinhabers bei den Parlamentariern, ohne die er sein Amt praktisch kaum wirkungsvoll ausüben kann, nahezu unverzichtbar.
II. Der Amtsverlust 1. Die Verlustgründe a) Das Ende der Amtszeit Das Präsidentenamt erlischt unweigerlich mit dem Ablauf der vorgesehenen Amtszeit. Die Landesverfassungen von Berlin und Rheinland-Pfalz 142 sowie die Geschäftsordnungen der meisten anderen Landtage ordnen diesbezüglich an, daß der Parlamentspräsident „für die Dauer der Wahlperiode" gewählt wird 1 4 3 , also nicht für eine kürzere Zeit - gleichsam auf Probe - und nicht über diese Zeit hinaus. Mit dem Zusammentritt des neugewählten Landtages findet die Amtszeit des Präsidenten folglich ihr Ende 144 . Historisch gesehen ist die Wahl des Parlamentspräsidenten für die Dauer der Wahlperiode keine Selbstverständlichkeit. Noch in der Paulskirche, in der Geschäftsordnung des Reichstages des Norddeutschen Bundes vom 12. 6. 1868, im 141 So ist beispielsweise der Rheinland-Pfälzische Landtagspräsident Grimm stellvertretender SPD-Landesvorsitzender und zudem Mitglied des Parteirats. Ebenso gehörte der Niedersächsische Landtagspräsident Milde (SPD) in der 13. Wahlperiode dem Fraktionsvorstand seiner Partei als stimmberechtigtes Mitglied an. 142 Art. 28 LV-Be; Art. 85 II LV-RP.
ι « § 11 Satz 1 GO-Be; § 8 I 1 GOBü-Br; § 5 GOLT-BW; § 9 I 1 GOLT-By; § 3 Satz 1 GOBü-Ha; § 2 II GOLT-He; § 1 IV GOLT-MV; § 5 I 2 GOLT-Nds; § 2 I GOLT-RP; § 4 I GOLT-SA; § 1 IV GOLT-SH; § 33 Satz 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 2 I 1 GOLT-Th. m Vgl. § 2 III GOLT-BW. Siehe auch Zinn/Stein, Art. 85 LV-He; Anm. 2.
II. Der Amtsverlust
35
Bismarckschen Reichstag und in § 11 der Geschäftsordnung der Nationalversammlung vom 6. 2. 1919 wurde festgelegt, daß der Präsident und seine Stellvertreter zunächst nur für eine Art Probezeit von vier Wochen gewählt werden 145 . Im Falle der Bewährung folgte dann die endgültige Wahl für die Dauer einer Session. Die Einführung eines „Probepräsidenten" geht auf Robert von Mohl zurück, der dieses Verfahren für die Nationalversammlung von 1848 vorgeschlagen hatte. Die kurze Amtszeit von vier Wochen sollte seiner Ansicht nach dazu dienen, einen Irrtum der einander noch unbekannten Abgeordneten über „die geistige, sittliche oder körperliche Befähigung zu dem ebenso hochwichtigen wie schwierigen Amte" bald korrigieren zu können, der Entstehung einer zu großen persönlichen Machtstellung vorzubeugen und „mehr als einem hervorragenden Manne die Ehre des Vorsitzes möglich zu machen" 146 . Im Gegensatz zu den o.g. Gesetzeswerken ließ die Weimarer Verfassung die Frage offen, ob der Präsident des Reichtages nur eine befristete Probezeit oder aber für die ganze Wahlperiode zu wählen sei 1 4 7 . Erst die Geschäftsordnung des Reichstages vom 12. 12. 1922 legte in § 14 fest, daß die Wahl des Präsidenten für die Dauer der ganzen Legislaturperiode zu erfolgen habe. Die Landtage der deutschen Länder folgten dem Beispiel des Reichstages nur zögernd 148 . Insbesondere das Preußische Abgeordnetenhaus hielt in § 9 der Geschäftsordnung an der Wahl eines Probepräsidenten für vier Wochen und der Wahl des definitiven Präsidenten für die Dauer der Tagung fest. Auch in den Hansestädten wurde der Parlamentspräsident zunächst nur für ein Jahr gewählt 149 . In Bayern hingegen konnte sich die Wahl eines Probepräsidenten nicht durchsetzen. So bestimmte die Bayerische Geschäftsordnung von 1923, daß der Landtagspräsident für die Dauer des Landtags im Amt bleiben soll. Diese Anordnung befand sich in Übereinstimmung mit der Bayerischen Verfassung vom 14. 8. 1919, in der der Landtag angewiesen wurde, sich für seine Dauer einen Vorstand zu wählen 150 . Im Laufe der Zeit ist die Dauer der Präsidentschaft im Interesse des Amtes in nahezu allen Parlamenten schrittweise verlängert worden und hat somit zu einer nicht unbeträchtlichen Stärkung des Präsidentenamtes beigetragen 151. Zudem wurde die Figur des „Probepräsidenten" endgültig beseitigt und die Wiederwahl nicht nur für rechtlich zulässig erklärt, sondern auch zu einer weitverbreiteten Übung 152 . 145 Vgl. Gundelach, S. 323; Ritzel / Bücker, § 2, S. 3. 146
Robert von Mohl, Vorschläge zu einer Geschäftsordnung des verfassungsgebenden Reichstages (1848), S. 11 f., zitiert bei Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 9. 147 Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 9. 148 Ebenda. 149 Ebenda. 150 Gerlach, S. 56. 151 Vgl. Loewenberg, S. 174; Gundelach, S. 323. 152 Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 35. 3*
36
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Lediglich in zwei Parlamenten fiel die Amtsdauer des Präsidenten zunächst nicht mit der Dauer der Wahlperiode zusammen: In Hamburg wurde des Präsidium entsprechend § 5 Abs. Π der Geschäftsordnung der Bürgerschaft vom 14. 03. 1924 grundsätzlich nur für ein Geschäftsjahr gewählt. Die parlamentarische Praxis wurde allerdings dahingehend ausgestaltet, daß der Präsident der Bürgerschaft in den entsprechenden Abständen wiedergewählt wurde und damit letztlich doch für die Dauer der gesamten Wahlperiode amtierte 153 . Gleichermaßen wurden in Rheinland-Pfalz der Präsident und seine Stellvertreter zunächst nur für die ersten sechs Sitzungstage gewählt. Am sechsten Tag war dann nochmals über die Wahl zu befinden; erst bei ihrer Bestätigung galt sie alsdann für die gesamte Wahlperiode 154 . Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß zwischen der Amtsdauer des Landtags und der des Präsidenten eine Akzessorietät besteht, d. h. die Beendigung des Präsidentenamtes geht einher mit dem Amtsende des Landtags 155 . Das Amtsende des Landtags durch Ablauf der Wahlperiode ist deshalb zwar der reguläre und häufigste, wenngleich nicht der einzige Gesichtspunkt. Das Amt des Präsidenten endet ebenfalls durch die Selbstauflösung des Parlaments 156, die Auflösung bei gescheiterter Neuwahl des Ministerpräsidenten 157, die Abberufung des Parlaments durch Volksentscheid158 oder auf sonstige Weise 159 .
b) Der Verlust des Abgeordnetenmandats Verliert der Landtagspräsident sein Abgeordnetenmandat, verliert er auch sein Amt als Parlamentspräsident. Das Mandat stellt demzufolge nicht nur eine unabdingbare Voraussetzung für seine Wahl dar, sondern ist auch für die weitere Aus153 Vgl. hierzu die Ausführungen des Abg. Dr. Hofmeister (CDU), Sten. Bericht des Niedersächsischen Landtags, IV. WP, 61. Sitzung, Sp. 3613. 154 Achterberg, S. 191. 155 Sollte zwischen dem Ende der Wahlperiode und dem Zusammentritt des neugewählten Parlaments eine Lücke entstehen, so besteht für verschiedene Landtage die Regel, daß der Parlamentspräsident die Geschäfte bis zum Zusammentritt des nächsten Parlaments fortführt, vgl. Art. 12 IV LV-Ha; Art. 85 Satz 1 LV-He; Art. 32 IV BW, § 5 GOLT-BW; Art. 85 II 2 LVRP. In Bayern obliegt diese Aufgabe dem Präsidium, Art. 20 II LV-By. In allen anderen Parlamenten gilt, daß die Wahlperiode erst mit Zusammentritt den nächsten Landtags endet, vgl. Art. 9 I LV-Nds; Art. 50 III 1 LV-Th; Art. 13 I 2 LV-SH; Art. 27 I 2 LV-MV; Art. 62 IV LV-Bg; Art. 43 Satz 2 LV-SA; Art. 4412 LV-Ss; Art. 67 12 LV-Sl. 156 Vgl. ζ. B. Art. 13 II LV-SH; Art. 50 II Nr. 1 LV-Th; Art. 80 LV-He; Art. 57 LV-Ss; Art. 35 ILV-NRW; Art. 101 LV-Nds. 157 Vgl. Art. 44 V LV-By; Art. 50 II Nr. 2 LV-Th.
158 Vgl. ζ. B. Art. 18 III LV-By; Art. 43 I LV-BW. 159 Vgl. ζ. B. Art. 68 III LV-NRW: Die Landesregierung kann den Landtag auflösen, wenn ein von ihr eingebrachtes Gesetz, das vom Landtag abgelehnt wurde, im Rahmen eines Volksentscheides angenommen wird.
II. Der Amtsverlust
37
Übung des Amtes unerläßlich. Mit dem Ausscheiden aus dem Parlament endet also die Amtsstellung des Präsidenten 160. Die zwingenden Verlustgründe hinsichtlich des Mandats sind in den jeweiligen Landeswahlgesetzen niedergelegt. Trotz unterschiedlicher Ausgestaltung lassen sich doch Gemeinsamkeiten nennen. Stellt sich beispielsweise im Verlauf der Wahlperiode heraus, daß der Erwerb der Mitgliedschaft im Parlament ungültig ist 1 6 1 , etwa weil die Wahl als solche für ungültig erklärt wurde 162 , so entfällt die Mandatseigenschaft vom Zeitpunkt der Feststellung an. Gleichzeitig endet das Amt des Parlamentspräsidenten. Ebenso verhält es sich bei einer Neufeststellung des Wahlergebnisses. Dieser Vorgang kann ζ. B. darauf beruhen, daß in einem Wahlkreis - möglicherweise infolge höherer Gewalt - eine Wahl nicht durchgeführt werden konnte und die spätere Wahl zu einer entsprechenden Veränderung des Listenergebnisses geführt hat. Ferner ist es denkbar, daß ein Wahlkreisvorschlag weniger Sitze zugeteilt erhält als vorher, so daß die aus der Wahlkreisliste zuviel gewählten Abgeordneten wieder ausscheiden müssen. Auch eine Wiederholungswahl 163 in einem Wahlbezirk oder einem Wahlkreis kann das Wahlergebnis entscheidend verändern und beim Landtagspräsidenten zum Verlust des Abgeordnetenmandats führen. Ein weiterer Verlustgrund besteht in dem Wegfall der Wählbarkeit 164 . Wird dem Gewählten also durch rechtskräftigen Richterspruch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt 165, weil er wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist und er aus diesem Grunde für „mandatsunwürdig" erachtet wird, so ist die Voraussetzung für das Mandat und mithin für die weitere Bekleidung des Präsidentenamtes entfallen. Entsprechendes gilt, wenn sich im nachhinein erweist, daß der Gewählte nicht seit mindestens einem Jahr Deutscher im Sinne des Art. 116 I GG ist 1 6 6 . Bei dem einmal eingetretenen Wegfall der Wählbarkeit ist grundsätzlich keine Heilung möglich 167 . Ferner bleibt es dem Landtagspräsidenten unbenommen, nach der Annahme der Wahl in das Parlament bis zum Ablauf der Wahlperiode den Verzicht auf das 160 Vgl. hierzu auch Gerlach, S. 55. So legte beispielsweise der frühere Präsident der Bremer Bürgerschaft Engel am 31. 12. 1970 sein Abgeordnetenmandat nieder, woraufhin die Bürgerschaft in der 51. Plenarsitzung am 20. 01. 1971 den bisherigen Vizepräsidenten Dr. Klink zu ihrem Präsidenten wählte. 161 Vgl. z. B. § 7 I Nr. 4 LWG-Nds; § 45 I Nr. 3 LWG-MV; § 9 I Nr. 2 LWG-SH; § 46 I Nr. 1 LWG-Th; § 58 I Nr. 3 LWG-RP; § 47 II Nr. 4 LWG-BW. 162 Vgl. z. B. § 5 Nr. 4 LWG-BW. 163 Vgl. z. B. § 44 LWG-Th; § 56 LWG-RP. 164 § 8 I Nr. 2 LWG-Nds.; § 45 I Nr. 2 LWG-MV; § 91 Nr. 3 LWG-SH; § 46 I Nr. 3 LWGTh; § 58 I Nr. 2 LWG-RP; § 47 II Nr. 3 LWG-BW; § 5 Nr. 2 LWG-NRW. 165 § 7 I Nr. 3 LWG-Nds; § 461 Nr. 3 iVm. § 17 Nr. 2 LWG-Th; § 58 I Nr. 2 iVm. § 32 II Nr. 2 LWG-RP; § 47 II Nr. 3 iVm. § 9 II LWG-BW; § 5 Nr. 2 iVm. § 4 II LWG-NRW. 166 Vgl. etwa § 32 II Nr. 3 LWG-RP; § 61 Nr. 3 LWG-Nds. 167 Versteyl, in: Schneider/Zeh, § 14, Rn. 32.
38
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Abgeordnetenmandat zu erklären 168 . Die Möglichkeit des Mandatsverzichts gehört als fester Bestandteil des freien Mandats im Sinne des Art. 38 I 2 GG zu den Statusrechten des Abgeordneten 169. Infolge des Verzichts auf das Abgeordnetenmandat erlischt ebenfalls das Präsidentenamt. Der Mandatsverzicht ist unwiderruflich 1 7 0 und im übrigen vom präsidialen Amtsrücktritt zu unterscheiden. Außerdem verliert der Parlamentspräsident seinen Sitz im Landtag und damit sein Amt bei einem Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgerichts gem. Art. 21 Π GG 1 7 1 , wenn er dieser Partei zu irgendeiner Zeit zwischen dem Tag der Antragstellung nach § 43 BVerfGG und der Verkündung der Entscheidung angehört hat. Denn an der Einfügung der Parteien in das Verfassungsgefüge können sinnvollerweise nur Parteien teilhaben, die auf dem Boden der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung stehen. Wenn nach dem Urteil des Gerichts feststeht, daß eine Partei die Voraussetzungen für die Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des Volkes nicht erfüllt, kann es den wichtigsten Exponenten der Partei, den Abgeordneten, nicht weiterhin ermöglicht werden, die Ideen dieser Partei im Parlament, dem Zentrum der politischen Entscheidungen, zu vertreten und bei Abstimmungen zum Ausdruck zu bringen 172 . Dieser Grundsatz muß erst recht für den Landtagspräsidenten gelten, der als Zentralfigur der parlamentarischen Organisation das Parlament repräsentiert. Gleichwohl dürfte dieser Fall in der Parlamentswirklichkeit so gut wie ausgeschlossen sein und ist daher nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. In einigen Ländern besteht zudem die Möglichkeit, dem Landtagspräsidenten sein Abgeordnetenmandat dann abzuerkennen, wenn sich der dringende Verdacht ergibt, daß er seine Stellung als Mitglied des Landtages in gewinnsüchtiger Absicht mißbraucht hat. In diesem Fall kann der Landtag beim Staatsgerichtshof ein entsprechendes Verfahren beantragen 173. Gleichermaßen verliert der Landtagspräsident Mandat und Amt, wenn sich die von ihm abzugebende Erklärung, er habe wissentlich weder als hauptamtlicher noch als inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet, als wahrheitswidrig erweist 174 . Daß das Abgeordnetenmandat und das Präsidentenamt schließlich durch den Tod des Inhabers enden, versteht sich von selbst, findet gleichwohl in § 47 I I Nr. 1 des Landeswahlgesetzes von Baden-Württemberg eine ausdrückliche Erwähnung. i« § 8 I Nr. 1 LWG-Nds; § 45 I Nr. 1 LWG-MV; § 9 I Nr. 1 LWG-SH; § 46 I Nr. 5 LWGTh; § 58 I Nr. 1 LWG-RP; § 47 II Nr. 2 LWG-BW; § 5 Nr. 1 LWG-NRW; Art. 80 LV-Br. 169 Schreiber, Handbuch des Wahlrechts, § 46, Rn. 8. 170 Vgl. Art. 81 LV-RP; Art. 80 Satz 2 LV-Br. πι Siehe auch § 8 I Nr. 4 LWG-Nds; § 45 I Nr. 5 LWG-MV; § 46 I Nr. 4 LWG-Th; § 49 LWG-BW. 172 Feneberg/ Simander, Art. 66 LWG-By, Rn. 1. 173 Vgl. ζ. B. Art. 42 LV-BW iVm. § 47 II Nr. 5 LWG-BW. 174 Vgl. § 461 Nr. 6 iVm. § 17 Nr. 3 LWG-Th.
II. Der Amtsverlust
39
c) Der Verlust der Fraktionszugehörigkeit Nach den Geschäftsordnungen der Landtage in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verliert der Präsident sein Amt, wenn er aus der Fraktion, die ihn für dieses Amt vorgeschlagen hat, ausgeschieden ist 1 7 5 . Der Verlust der Fraktionszugehörigkeit kann zum einen durch freiwilligen Austritt des Abgeordneten aus der Fraktionsgemeinschaft erfolgen. Zum anderen ist aber auch ein zwangsweises Ausscheiden denkbar, da der Fraktion als Gesinnungs- und Konsensgemeinschaft und parlamentarischer „Kampfverband" nicht die Möglichkeit abgesprochen werden kann, ein von ihrer Linie abweichendes Mitglied auszuschließen176. Dieses Recht gebührt den Fraktionen schon allein aus ihrem autonomen Status heraus 177 . Das Interesse der Fraktionen an einer Ausschließung ist allerdings abzuwägen mit dem Interesse des Abgeordneten an seiner Zugehörigkeit zur Fraktion, das gerade deshalb besonders gewichtig ist, weil der fraktionslose Abgeordnete für die parlamentarische Arbeit gleichsam in die Bedeutungslosigkeit verfällt. In Anbetracht der Tatsache, daß der Fraktionsausschluß aufgrund der begrenzten Einzelrechte des Abgeordneten eine erhebliche Minderung seiner Wirkungsmöglichkeiten darstellt, darf deshalb ein Ausschluß nur unter begründeten Bedingungen ergehen und nicht nach freiem Belieben oder aus mißbräuchlichen Erwägungen. Mitunter wird daher verlangt, daß der Abgeordnete „nur aus wichtigem Grund" 1 7 8 ausgeschlossen werden darf. Ein wichtiger Grund liegt jedenfalls dann vor, wenn die weitere Zugehörigkeit des betreffenden Mitglieds für die Fraktion unzumutbar ist oder sich schädigend für sie auswirkt 179 . Für den Parlamentspräsidenten erweisen sich jedoch die genannten Bestimmungen der Landtagsgeschäftsordnungen insoweit als unpraktikabel, als ihm das Recht zukommt, den Ausschluß aus seiner Fraktion anzufechten 180. Denn wenn das Gericht in einem summarischen Verfahren feststellt, daß der Ausschluß noch nicht rechtlich wirksam ist, führt dies zu einem „Landtagspräsidenten auf Abruf* 1 8 1 . ns § 5 V GOLT-Nds; § 3 VII GOLT-Ss; § 4 V GOLT-SA; § 2 I V GOLT-Th. 176 StGH Bremen, in: DÖV 1970, 639; Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 38, Rn. 12. So geschehen im übrigen bei dem Niedersächsischen Landtagsabgeordneten Kurt Vajen, der wegen öffentlicher Sympathiebekundungen für die Partei der Republikaner die CDU-Fraktion verlassen mußte, vgl. PIPr. 11. WR, 90. Sitzung vom 6. 9. 1989, S. 8295 ff. 177 Stern I, § 23 I 2; Kasten, in: ZParl 1985,475 (482). 178 So das OVG NRW, in: DÖV 1993, 209. Eine gefestigte Rechtsprechung über die Zulässigkeit eines Fraktionsausschlusses bzw. deren konkreter Voraussetzungen hat sich angesichts des vielfältigen Meinungsbildes bislang noch nicht ergeben und ist in absehbarer Zeit auch nicht zu erwarten. 179 So Stern I, § 23 I 2. 180 Die Rechtmäßigkeit des Ausschlusses kann im Wege einer Organklage vor dem jeweiligen Verfassungsgericht überprüft werden, wobei die ausschließende Fraktion Antragsgegner ist. Vgl. hierzu Grimm, in: Schneider/Zeh, § 6, Rn. 28; Demmler, S. 251 ff. sowie StGH Bremen, in: DÖV 1970,639. 181 So Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 2.
40
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Dieser Umstand würde nicht gerade eine Stärkung der Position des Präsidenten bedeuten und wäre überdies dem Ansehen des Amtes abträglich. Angesichts der großen Bedeutung des Amtes sollten sich daher die entsprechenden Bestimmungen der Landtagsgeschäftsordnungen besser auf einen reduzierten Tatbestand verständigen und nur an dem Merkmal des freiwilligen Austrittes aus der Fraktion anknüpfen. Dies gilt vor allem aber auch deshalb, weil der mit dem Fraktionsausschluß zwingend verbundene Amtsverlust in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken stößt. Da in diesen Ländern eine Abberufung des Landtagspräsidenten nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags möglich ist 1 8 2 und diese Mehrheit aus verfassungsrechtlichen Gründen auch geboten ist 1 8 3 , kann nicht im Gegenzug eine Fraktion mit einer wesentlich geringeren Mehrheit durch das Instrument des Fraktionsausschlusses den Präsidenten seines Amtes entheben. Hierin wäre gleichsam eine ,Abwahl durch die Hintertür" zu erblicken, die einer verfassungsrechtlichen Grundlage entbehrt. d) Die Abberufung Die Frage der Abberufbarkeit des Parlamentspräsidenten ist im parlamentarischen Raum und in der Öffentlichkeit immer wieder Gegenstand von Erörterungen und zum Teil lebhafter Auseinandersetzungen gewesen und bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Die rechtliche Beurteilung dieser Problematik bietet dort keine Schwierigkeiten, wo die Abberufbarkeit des Landtagspräsidenten in der Verfassung oder parlamentarischen Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehen ist. So war etwa der Bayerische Landtag nach 1945 die erste legislative Versammlung in der Bundesrepublik, die das Prinzip der parlamentarischen Verantwortung des Präsidenten gegenüber dem Parlament eingeführt und auf Verfassungsebene verankert hat 1 8 4 . Danach kann der Landtagspräsident jederzeit auf schriftlichen Antrag einer Fraktion oder von mindestens zehn Abgeordneten ohne Angabe von Gründen abberufen werden, ohne daß bestimmte Voraussetzungen, wie etwa eine Veränderung in der parteipolitischen Gruppierung oder ein Unterliegen des Präsidenten in einer Debatte über die Auslegung der Geschäftsordnung, vorzuliegen braucht 185 . Von dieser Möglichkeit wurde jedoch bislang kein Gebrauch gemacht 186 .
182 Vgl. Art. 18 IV LV-Nds; Art. 49IV LV-SA; § 2 III GOLT-Th. 183 Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 43 ff. 184
Die Abwählbarkeit des Präsidenten ergibt sich aus einem Umkehrschluß aus Art. 44 III 5 LV-By. Beachte in diesem Zusammenhang ebenfalls § 9 II GOLT-By. 185 Partsch, in: AöR 86 (1961), 37; Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (304). 186 Vgl. Carstens, S. 128.
II. Der Amtsverlust
41
In Niedersachsen wurde der Präsident des Landtags bis in die 10. Wahlperiode hinein ohne eine Bedingung und ohne die Möglichkeit der Abberufung gewählt. Erst im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die gegen den Landtagspräsidenten Bruno Brandes (CDU) aufgrund von Verstrickungen in Vorgänge aus dem außerparlamentarischen Bereich in der Öffentlichkeit erhoben wurden und die den Inhaber des Amtes in seiner Integrität schwer belasteten187, beschloß der Landtag am 9. 5. 1985 - nachdem Brandes der allgemeinen Erwartung, er werde von seinem Amt zurücktreten, nicht nachgekommen war - eine Ergänzung der Geschäftsordnung 188 . Auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU hin 1 8 9 , erhielt § 5 der Landtagsgeschäftsordnung einen neuen Absatz VI. Dieser Absatz ermöglicht die Abberufung von Mitgliedern des Präsidiums auf Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags mit einer ebenso großen Beschlußmehrheit. Beide Fraktionen legten besonderen Wert auf die Feststellung, daß die Änderung der Geschäftsordnung nicht als „Lex Brandes" zu verstehen sei 1 9 0 . Zwar wolle man auch aus dem konkreten Anlaß heraus eine Möglichkeit schaffen, den amtierenden Präsidenten abzuwählen, jedoch sei die Änderung in erster Linie als Regelung für ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft bestimmt. Aus diesem Grunde handele es sich nicht um ein unzulässiges Einzelfallgesetz. Diese Auffassung wurde vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Niedersächsischen Landtags (GBD), der im Auftrag des Rechts- und Geschäftsordnungsausschusses die Sachlage begutachtete, bestätigt 191 . Der GBD wies darauf hin, daß die Änderung der Geschäftsordnung - obwohl sie bereits den gegenwärtigen Präsidenten betreffe - auch unter dem Gesichtspunkt der Rückwirkung nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoße. Es handele sich vielmehr um eine sog. „unechte Rückwirkung", die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zulässig sei, wenn sie das Ergebnis einer gerechten Interessensabwägung darstelle. Hierbei gelangte der GBD zu der Auffassung, daß das Interesse des Parlaments an der Wiederherstellung seines Ansehens und seiner Funktionsfähigkeit, die durch die Störung des Vertrauensverhältnisses schwer beeinträchtigt wurden, wesentlich gewichtiger sei als das Interesse des Amtsinhabers, sein Amt beizubehalten192. Auch in sonstiger Hinsicht äußerte der GBD gegen die Abberufungsmöglichkeit des Landtagspräsidenten keine verfassungsrechtlichen Bedenken, zumal die Niedersächsische Verfassung selbst nicht vorschreibe, daß der Präsident für die Dauer einer Wahlperiode gewählt werde und somit sein Amt vor Ablauf der Wahlperiode auch nicht verlieren könnte. 187 Vgl. die Ausführungen des Abg. Meinsen (Grüne) in der 77. Sitzung am 7. 3. 1985, Sten. Ber. 10. WP, S. 7286 und das Rücktrittsersuchen der Fraktion der Grünen vom 4. 2. 1985, LT-Drs. 10/3802. 188 LT-Drs. 10/4293. 189 LT-Drs. 10/4251. 190 Vgl. die entsprechende Anmerkung des Ministerpräsidenten Dr. Albrecht (CDU) in der 81. Sitzung vom 9. 5. 1985, 10. WP., S. 7687. 191 Vgl. die Berichterstattung durch den Abg. Drechsler (SPD) in der 81. Sitzung vom 9. 5. 1985, 10. WP., S. 7680. 192 Ebenda.
42
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Der Niedersächsische Landtag änderte die Geschäftsordnung weiterhin derart, daß zwischen der Einbringung des Antrags auf Abberufung und der Abstimmung eine Frist von drei Wochen verstreichen müsse, um dem Betroffenen die Gelegenheit zu geben, sich entweder vor den Antragstellern zu rechtfertigen oder von sich aus die Konsequenzen zu ziehen 193 . Außerdem ist nach der Neufassung ein Abberufungsantrag lediglich in einer einzigen Plenarsitzung mit anschließender Ausschußüberweisung zu beraten, da es für das Ansehen des Parlamentes nur abträglich wäre, wenn derartige Vorfälle mehrfach im Plenum behandelt werden müßten 1 9 4 . Der so ausgestaltete § 5 V I der parlamentarischen Geschäftsordnung fand schließlich in Art. 18 IV der neuen Niedersächsischen Verfassung vom 13. 5.1993 eine verfassungsrechtliche Grundlage, wobei nunmehr nur noch der Abberufungsbeschluß - nicht mehr der Antrag selbst - der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags bedarf. Die Frage der Abberufbarkeit des Parlamentspräsidenten wird in Schleswig-Holstein durch Art. 14 Π der Landessatzung ebenfalls im Sinne der Zulässigkeit einer Abwahl beantwortet. Da die Abwahl die Kehrseite der Wahl darstellt, hatte die Enquete-Kommission „Verfassungs- und Parlamentsreform" die Schaffung einer verfassungsrechtlich gesicherten Basis empfohlen und eine reine Geschäftsordnungsregelung als unzureichend bewertet 195 . Dem Beispiel der Länder Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind nunmehr auch die Landtage in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gefolgt, indem sie die rechtliche Möglichkeit einer Abberufung des Landtagspräsidenten in ihren Verfassungen verankert haben 196 . Eine Regelung über die Abberufbarkeit des Präsidenten findet sich zudem in den Geschäftsordnungen der Landtage von Nordrhein-Westfalen und Thüringen 197 . Zwar unterliegt eine geschäftsordnungsmäßige Regelung nach überwiegender Ansicht keinen etwa aus höherrangigem Recht herzuleitenden Bedenken 198 , jedoch wäre eine verfassungsrechtliche Absicherung durchaus wünschenswert und würde zur Rechtssicherheit beitragen, da Verfassungsvorschriften mehr Bestandskraft haben als Geschäftsordnungsbestimmungen. Selbst wenn die genannten Landesparlamente die Möglichkeit haben, sich von ihren Repräsentanten zu trennen - vorausgesetzt, das Vertrauensverhältnis 193 Vgl. den Bericht des Abg. Drechsler (SPD), Sten. Ber. 10. WP., S. 7681. 194 Ebenda. 195 Enquete-Kommission „Verfassungs- und Parlamentsreform" des Schleswig-holsteinischen Landtags, Schlußbericht, Drs. 12/180 vom 7. 2. 1989, B., Kap. 2, Abschnitt 3, Ziff. 2.1.1., S. 106. 196 Art. 69 II LV-Bg, § 11 II GOLT-Bg; Art. 29 II LV-MV; Art. 49 IV LV-SA, § 4 VI GOLT-SA. Die Abwahlmöglichkeit gilt im übrigen auch für die Vizepräsidenten. 197 § 8 II 2 GOLT-NRW; § 2 III 1 GOLT-Th. 198 So Stern II, § 26 IV 2 a, S 90f.; Schmidt-Bleibtreu/ Klein, Art. 40 Rn. 3; Versteyl, in; v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 4; Braun, Art. 32 LV-BW Rn. 11; Härth, in: ZParl 1985, 490 (493). A.A. die Enquete-Kommission des Schleswig-Holsteinischen Landtags, s.o. Fn. 195.
II. Der Amtsverlust
43
zwischen Präsident und Gesamtparlament ist so tiefgreifend zerstört, daß sich die Abgeordneten durch ihn nicht mehr vertreten fühlen - , so gilt dennoch für alle angestrengten Abwahlverfahren gleichermaßen, daß die Unabhängigkeit und das Ansehen des Präsidentenamtes nicht leichtsinnig gefährdet werden dürfen. Der Präsident darf daher nicht durch permanente, wenn auch letztlich erfolglose Abwahlanträge „demontiert" werden 199 , so daß ein Abwahlverfahren nicht schon allein bei Alltagsquerelen zulässig sein kann. Da die vorzeitige Beendigung der Amtszeit von ihrer Zielsetzung her die Reaktion auf eine Entwicklung ist, an deren Ende sich das gesamte Parlament über die Fraktionsgrenzen hinweg nicht mehr vom Präsidenten vertreten fühlt, kann die Entscheidung über die Abwahl nicht in die Hände der Fraktion gelegt werden, die über die absolute Mehrheit im Hause verfügt. Eine solche Fraktion hätte die Möglichkeit, das Instrument der Abwahl zu mißbrauchen, etwa indem sie einen ihr angehörigen Präsidenten durch »Amtsenthebung" bestraft, weil dieser sein Amt nicht ihren Vorstellungen gemäß ausübt 200 . In allen Landtagen, in denen eine Abwahlregelung vorgesehen ist, wird daher stets eine Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags verlangt 201 . Bei Abwahl des Landtagspräsidenten ohne direkte Wahl eines Nachfolgers führt nach Maßgabe der vorgegebenen Regelungen ein Vizepräsident den Vorsitz, da die Sitzung naturgemäß nicht von dem Abzuwählenden selbst geleitet werden kann. Der Vizepräsident entstammt der parlamentarischen Tradition entsprechend der zweitgrößten Fraktion 202 . Ein Sonderfall der Abberufung des Präsidenten war schließlich bis 1994 in Art. 86 I 3 der Bremer Landesverfassung niedergelegt 203. Danach fanden bei einer Änderung der Zusammensetzung der Fraktionen Neuwahlen statt, sofern diese beantragt wurden. Verlor also die Fraktion, die den Präsidenten für dieses Amt vorgeschlagen hatte, ihren Charakter als stärkste Fraktion, so verlor auch der Präsident sein Amt, da dieses bei der Zusammensetzung des Vorstandes nach der „Stärke der Fraktionen" 204 übungsgemäß der größten Fraktion zukam. Die Neuwahl mußte allerdings so früh wie möglich nach der eingetretenen Veränderung des Stärkeverhältnisses beantragt werden. Anderenfalls wäre es zu einer verfassungspolitisch unerwünschten Behinderung der präsidialen Amtsführung gekommen, weil der i » So auch Wuttke, in: v. Mutius/Wuttke/Hübner, Art. 14 LV-SH, Rn. 9. Enquete-Kommission, S. 106. 20 1 Hingegen reicht für den Antrag als solchen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein die einfache Mehrheit, in Nordrhein-Westfalen und Thüringen die Mehrheit von einem Drittel sowie in Brandenburg die Mehrheit von einem Fünftel der Mitglieder des Landtags aus. In Bayern kann der Antrag nur von einer Fraktion oder 20 Abgeordneten eingebracht werden. 202 Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 6. 203 Vgl. zur rechtlichen Bedeutung der noch bestehenden Geschäftsordnungsvorschrift des § 8 II 2 GOBü-Br die Ausführungen auf S. 25. 200
204 Vgl. § 8 II 1 GOBü-Br.
44
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
Präsident hätte befürchten müssen, unter dem Vorwand, daß sich das Stärkeverhältnis der Fraktionen geändert habe, abberufen zu werden 205 . Eine Abberufung wurde infolgedessen nicht mehr als zulässig angesehen, wenn keine Fraktion bis zur ersten Sitzung nach der Änderung des Stärkeverhältnisses eine Neuwahl beantragt hatte 206 . Was letztlich die Frage einer Abberufung aus anderen Gründen betraf, so schwieg sowohl die Bremische Verfassung als auch die Geschäftsordnung der Bürgerschaft. In allen übrigen Länderparlamenten - und auch im Bundestag - finden sich hingegen keine ausdrücklichen Bestimmungen über die Abberufbarkeit des Parlamentspräsidenten 207. Ob auch ohne explizite Reglementierung eine Abberufung des Parlamentspräsidenten zulässig ist, hat im Schrifttum zu heftigen Kontroversen geführt 208 . Einigkeit besteht nur in dem Punkt, daß die in den Geschäftsordnungen der Landtage festgelegte Amtszeit für die „Dauer einer Wahlperiode" nicht - wie in der früheren parlamentarischen Praxis häufig angenommen wurde 209 - gegen eine Abberufung des Parlamentspräsidenten spricht. Sie legt vielmehr nur die äußerste zeitliche Grenze der Tätigkeit fest bzw. den zeitlichen Rahmen (Legislaturperiode, nicht Session), hat also lediglich eine rein formelle Bedeutung für den Regelfall der Amtsdauer und kann eine vorzeitige Abberufung rechtlich nicht ausschließen210. Die Befürworter einer Abwahl stützen ihre Argumentation auf einen Vergleich mit dem Regierungschef im parlamentarischen System. Wenn sogar der Regie205 Uhlitz, in: AöR 87 (1962), S. 296 (305). 206 Ebenda. 207 Zwar gibt es in den Ländern mitunter auf der einfachgesetzlichen Ebene Abberufungsregelungen allgemeiner Art. So eröffnet beispielsweise in Hamburg der § 7 II 1 iVm. III 3 des Gesetzes über Verwaltungsbehörden (in der Fassung vom 30. 7. 1952, BL I 2000-a, zuletzt geändert am 2. 7. 1991) die Möglichkeit, daß die von der Bürgerschaft für die Dauer einer Wahlperiode gewählten Deputierten vorzeitig abberufen werden können. Daraus läßt sich im Ergebnis jedoch für den Landtagspräsidenten nichts herleiten, vgl. David, Art. 18 LVHa, Rn. 6. 208 Bejahend Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 4; Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 10; Zivier, S. 96; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 11; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 6f. Verneinend hingegen Troßmann, § 2, Rn. 1.3.; Geller/Kleinrahm, Art. 38 LV-NRW, Anm. 2; Nauber, S. 101, 103; Ley, S. 64; Achterberg, S. 213; Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 4; Schick, in: DVP 1989, 161; Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 37f.; Gundelach, S. 324; Ritzel/Bücker, § 2, S. 3 f.; Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (306); Härth, in: ZParl 1985, 490 (492); v. Brentano, S. 26. 209 Vgl. ζ. B. die auf S. 41 zitierte Begründung des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes im Niedersächsischen Landtag. 210 David, Art. 18, Rn. 6; Gundelach, S. 324; Härth, in: ZParl 1985, 490 (492); Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (305); a.A. Ritzel / Bücker, § 2, S. 3 und Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 4, der die Nichtabberufbarkeit aus der Präsidentenwahl für die Dauer der Wahlperiode herleitet und dies für einen überkommenen Begriffsinhalt hält, der weder durch Geschäftsordnung noch durch einfaches Gesetz geändert werden könne. Ebenso der Niedersächsische Staatsgerichtshof in einem Urteil vom 13. 8. 1962, Drs. IV, Nr. 912, S. 4760.
II. Der Amtsverlust
45
rungschef bei einem zerrütteten Vertrauensverhältnis zum Parlament ausgewechselt werden könne, so müsse dies doch erst recht für den Parlamentspräsidenten gelten 211 . Dem wird zu Recht entgegengehalten, daß die Macht des Inhabers der Exekutive nicht nur unvergleichbar viel größer und gefährlicher als die des Vorsitzenden einer Versammlung sei, sondern die Willensübereinstimmung zwischen Regierung und Parlament auch systematisch eine ganz andere Bedeutung habe als das Vertrauensverhältnis zwischen Parlament und Präsident 212. Vor diesem Hintergrund kann auch der Ansicht von Gerlach nicht gefolgt werden, der aus der parlamentarischen Staatsform und der Stellung des Parlaments als Repräsentant des Volkes die Schlußfolgerung zieht, daß das Parlament befugt sei, seinen Präsidenten zu überwachen und nötigenfalls sogar durch Abwahl zu entfernen 213. Gerlach verkennt, daß sich das parlamentarische System nur auf das Verhältnis des Parlaments zur Regierung bezieht und damit auf das Verhältnis des Parlaments zu seinem Präsidenten keine Anwendung finden kann 214 . Des weiteren wird von den Vertretern einer Abwahlmöglichkeit angeführt, daß sich diese schon allein aus der Autonomie des Parlaments ergebe, die Modalitäten seiner Organbestellung und -abberufung ihm Rahmen der Verfassung zu bestimmen und auszuüben215. Zumindest im Fall der Unfähigkeit oder des Amtsmißbrauchs muß das Parlament kraft seiner Souveränität die Möglichkeit haben, seinen Präsidenten zu ersetzen 216. Alles andere wäre eine unzulässige Einschränkung der Souveränität des Parlaments. Auch dieser Gedanke wird in der Literatur nicht ohne weiteres geteilt. Die Nichtabberufbarkeit des Präsidenten, so führt Uhlitz aus, beschränke keineswegs die Souveränität des Parlaments, da die das Parlament betreffenden Entscheidungen des Präsidenten in dessen eigener verfassungsrechtlicher Verantwortlichkeit ergehen 217. Außerdem sei die Souveränität des Parlaments bereits durch die Wahl des Präsidenten von Anfang an dahingehend beschränkt, daß im Interesse der ordnungsmäßigen parlamentarischen Verfahrensweise gewisse im parlamentarischen Raum notwendig werdende Entscheidungen von dem zur Unparteilichkeit verpflichteten Präsidenten getroffen werden und gerade nicht von einer Augenblicksmehrheit 218. Entscheidend für die Frage der Abberufbarkeit des Landtagspräsidenten ist vor allem die im parlamentarischen Leben historisch gewachsene Symbol- und Integrationsfunktion des Präsidentenamtes, also die Aufgabe, das Parlament nach 211
16. 3. 2 2 > 2 i3 2 4 * ™ 2 i6 2
Vgl. die Ausführungen des Abg. Ritzel (SPD) in der 47. Sitzung des Bundestages vom 1950, Sten. Ber., S. 1591 Α/Β. Ritzel /Bücker, § 2, S. 3 f.; Partsch, in: AöR 86 (1961), 37 f. Gerlach, S. 60. Maunz, Deutsches Staatsrecht, S. 277; Kleinschnittger, S. 26. Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 11; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 6. Zivier, S. 96.
" Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (307). 218 Ebenda.
46
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
außen zu vertreten, seine Würde und seine Rechte zu wahren, seine Arbeit zu fördern, die Verhandlungen gerecht und unparteiisch zu leiten und die Ordnung im Hause aufrechtzuerhalten 219. Die genannten Pflichten, vor allem die Pflicht zur gerechten und unparteiischen Amtsführung, können von einem Parlamentspräsidenten jedoch nur dann sachgerecht erfüllt werden, wenn er in der Lage ist, sich zum Schutze der Minderheit auch gegenüber einer augenblicklichen Parlamentsmehrheit durchzusetzen und zudem gegenüber seiner eigenen Fraktion frei in der Entscheidung ist 2 2 0 . Der Präsident bedarf infolgedessen einer relativ autonomen Position zur Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlichen Aufgaben. Einer derart unabhängigen Stellung gegenüber der Parlamentsmehrheit entspricht es nicht, wenn der Präsident vor jeder Entscheidung die Tatsache in Rechnung stellen müßte, daß er vor dem Ablauf seiner Amtszeit jederzeit von der Mehrheit abberufen werden kann. In solchen Situationen ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß die Furcht vor einer vorzeitigen Abberufung nicht ohne Einfluß auf die von ihm zu treffenden Entscheidungen ist. Ein Präsident, der mit der Möglichkeit rechnen muß, bei für die Parlamentsmehrheit unangenehmen Entscheidungen seines Amtes enthoben zu werden und damit in eine innere Konfliktsituation gedrängt wird, ist nicht mehr fähig, dem verfassungsrechtlichen Leitbild des unabhängigen, zur unparteiischen Amtsführung verpflichteten Parlamentspräsidenten zu entsprechen 221. Diesem Leitbild gemäß muß er als Hüter der Ordnung auch in der Lage sein, mit aller Strenge gegen die Mehrheit, die ihn gewählt hat, oder auch gegen eine anders zusammengesetzte Mehrheit vorzugehen. Daran darf ihn die Furcht vor einer vorzeitigen Abberufung nicht hindern 222 . Nur in dem Bewußtsein, nicht ständig von der „Gnade" der Mehrheit abhängig zu sein, kann der Parlamentspräsident seine Funktion wirkungsvoll erfüllen 223 . Die Nichtabberufbarkeit des Landtagspräsidenten ist vor diesem Hintergrund das Fundament für eine starke, unangreifbare Stellung, die notwendig ist, um den Präsidenten sowohl vor seiner eigenen Fraktion, die ihn nominiert hat, zu schützen, als auch vor der Mehrheit, die ihn gewählt hat; mißliebige Entscheidungen bleiben dann für ihn persönlich ohne Folgen 224 . Dies wiederum schafft für den Konfliktfall ein Gegengewicht zur Parlamentsmehrheit und ermöglicht eine unparteiische Entscheidung im Interesse des gesamten Parlaments 225. Im übrigen zwingt die Nichtabberufbarkeit des Präsidenten den Landtag dazu, sich bei der Wahl die Entscheidung gründlich zu überlegen und nur eine hervorstechende Persönlichkeit für dieses Amt zu wählen, die allgemeine Achtung besitzt 21 9 Vgl. auch Gottschalck, S. 35 sowie Partsch, in: AöR 86 (1961), 37. 220 Härth, in: ZParl. 1985,490 (493).
221 Vgl. Schick, S. 26. 222 Partsch, in: AöR 86 (1961), 37 f. 223 Achterberg, S. 213; Gundelach, S. 324; Partsch, in: AöR 86 (1961), 37 f. 224 Schick,S. 26. 225 Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (307).
II. Der Amtsverlust
47
und von vornherein die Gewähr dafür bietet, daß sie das hohe Amt im Geiste der Verfassung fair und unparteiisch auszuüben vermag 226 . Dies verhindert einen Präsidenten, der lediglich mit einem „Versorgungsposten" bedacht werden soll. Im Ergebnis ist also festzuhalten, daß der Parlamentspräsident nur in den Ländern abberufen werden darf, die hierfür entweder eine entsprechende verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen haben, wie Bayern, Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, oder die Abberufungsmöglichkeit in der Geschäftsordnung verankert haben, wie Nordrhein-Westfalen und Thüringen 227 . Aus den erwähnten verfassungsrechtlichen Gründen bedarf eine Abberufung jedoch regelmäßig der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags. In allen anderen Ländern ist die Abberufung des Landtagspräsidenten aus den genannten Gründen unzulässig. Auch ein „konstruktives Mißtrauensvotum", bei dem das Parlament einen neuen Präsidenten wählt und somit die Funktion des alten für erloschen erklärt, ist aus diesen Gründen unzulässig 228 . Dadurch wird die notwendige Stabilität dieses herausragenden Amtes gewährleistet, denn gerade in dem kunstvollen Gebäude einer rechtsstaatlichen Demokratie bedarf es mitunter einiger „Grundpfeiler, die fest im Boden stehen" 229 .
226 Uhlitz, in: AöR 87 (1962), 296 (308). 227 Vgl. zum Sonderfall Bremen S. 43 f. 228 Harth, in: ZParl. 1985, 490 (493); Ritzel /Bücker, § 2, S. 3 f.; Schick, in: DVP 1989, 161; Kleinschnittger, S. 27; Troßmann, § 2, Rn. 1.3.; Partsch, in: AöR 86 (1961), S. 38. A.A. Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 4; Schmidt-Bleibtreu / Klein, Art. 40, Rn. 3; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 4; Zivier, S. 96; widersprüchlich jedoch v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Anm. III 2 b und Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 10, da sie einerseits der Auffassung sind, daß der Parlamentspräsident nicht durch ein Mißtrauensvotum zum Rücktritt gezwungen werden kann, andererseits aber die Absetzung durch Wahl eines neuen Präsidenten für zulässig halten. Die Einführung eines konstruktiven Mißtrauensvotums war im übrigen in Nordrhein-Westfalen bei den Beratungen im Rahmen der Parlamentsreform von 1969/70 Diskussionsgegenstand. Nachdem der Sonderausschuß für Parlamentsreform zunächst gegen die Einführung des Mißtrauensvotums keine Bedenken hatte, weil damit der Präsident und seine Stellvertreter „stärker unter die Kontrolle des Plenums gestellt" werden könnten (vgl. 6. WP, Drs. 1386, S. 2), hielt er jedoch letztlich das konstruktive Mißtrauensvotum „nicht für zweckmäßig, da hierdurch Elemente Eingang finden in den Vorgang der Besetzung dieser Ämter, welche ihre Neutralität in Frage stellen" (vgl. 6. WP, Drs. 1856, S. 5). 229 So Partsch, in: AöR 86 (1961), 37 f. Wie umstritten die konkrete Amtsführung des Präsidenten jedoch sein kann, zeigt ein Fall, in dem alle Oppositionsfraktionen der Bremer Bürgerschaft einen Mißtrauensantrag gegen den von der Mehrheitsfraktion gestellten Präsidenten einbrachten und unterstützten; weder der Präsident noch die Mehrheitsfraktion wußten oder wagten zu argumentieren, dieses sei unzulässig, vgl. Bremer Bürgerschaft, 10. WP, Drs. 10/ 437, 35. Sitzung am 18. 2. 1981, Plenarprotokoll S. 2509 ff.
48
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
2. Die Amtsniederlegung Dem Landtagspräsidenten steht das Recht zu, das einmal übernommene Präsidialamt freiwillig wieder niederzulegen 230. Zwar enthalten die parlamentarischen Geschäftsordnungen keine ausdrücklichen Bestimmungen über die Rücktrittsmöglichkeit, jedoch wird man annehmen dürfen, daß dieses Recht „selbstverständlich" ist und daher keiner ausdrücklichen Regelung bedarf 231 . Insbesondere kann dem Landtagspräsidenten ein Rücktrittsrecht schon deshalb nicht abgesprochen werden, weil der Rücktritt oftmals die einzige Möglichkeit ist, die Würde der Person und die der Volksvertretung zu wahren, sofern der Präsident vom Parlament bloßgestellt wird 2 3 2 . Der Rücktritt ist als empfangsbedürftige Willenserklärung dem Landtag gegenüber zu erklären. Wird der Verzicht schriftlich mitgeteilt, so wird die Amtsniederlegung erst mit dem Zeitpunkt der Verlesung im Parlament wirksam 233 . Um sich insbesondere in Konfliktfällen der Mehrheit des Parlaments zu versichern, hält es Achterberg für sinnvoll, die Amtsniederlegung des Präsidenten mit einer vorgeschalteten Vertrauensfrage zu verknüpfen 234. Erst wenn diese negativ ausfalle, müsse der Präsident die entsprechenden Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Dieser Verfahrensweise wird allerdings zu Recht entgegengehalten, daß das Institut der Vertrauensfrage ein Instrument des „parlamentarischen Systems" sei, welches ausschließlich zwischen Regierungschef und Parlament Anwendung finde. Eine Übertragung auf den Parlamentspräsidenten wäre systemwidrig, da der Präsident mit seiner Wahl nicht aus dem Parlament heraustrete, sondern organisches Glied des Parlaments selbst bleibe 235 . Außerdem könnte der Präsident durch Ausübung von politischem Druck leicht dazu gedrängt werden, eben jene Vertrauensfrage zu stellen, und wäre dann im Prinzip in der gleichen Situation wie bei einem Abwahlantrag 236 . Hieran schließt sich die Frage, welche Möglichkeiten dem Parlament verbleiben, eine Amtsniederlegung des Präsidenten zu erreichen. Dies ist vor allem für die Landtage von Bedeutung, die nicht über ein gesetzliches Abwahl-Instrumentarium verfügen. Noch der Reichstag konnte im Wege der sog. „Question du fauteuil" Einfluß nehmen und erreichen, daß der Präsident immer dann sein Amt niederlegte, wenn 230 Hatschek, S. 206; Wermser, S. 22; Stern II, S. 90f.; Gerlach, S. 55; Schick, in: DVP 1989,161; Feuchte, Art. 32 LV-BW; Gundelach, S. 324; v. Brentano, S. 26. 231 v. Brentano, S. 26. 232 Böttcher, S. 36. 233 Kleinschnittger, S. 25. 234 Achterberg, S. 213; im Gegensatz dazu billigt Partsch die Vertrauensfrage nur in der Form, daß der Präsident zunächst zurücktritt, dann aber bei der anschließenden Wahl wieder kandidiert, vgl. AöR 86 (1961), S. 37 f. 235 Härth, in: ZParl 1985,490 (493). 236 Ebenda.
II. Der Amtsverlust
49
er mit seiner Auslegung der Geschäftsordnung gegenüber dem Parlament unterlegen war 2 3 7 . Dieses Verfahren ist im heutigen parlamentarischen Geschehen allerdings nicht mehr gebräuchlich, da es sich im Kern ebenfalls um eine Vertrauensfrage handelt, die lediglich anders „eingekleidet" ist. Gleichermaßen wird ein vom Parlament an den Präsidenten gerichtetes Rücktrittsersuchen für unzulässig gehalten 238 , da ein derartiger Antrag ein unzulässiges Mißtrauensvotum enthält, das nur mit anderen Worten ausgesprochen wird 2 3 9 . Zugleich wird auf diese Weise versucht, Druck auf den Landtagspräsidenten auszuüben, der zwar nicht rechtlich, aber dafür um so stärker moralisch wirken soll 2 4 0 . Im Rahmen der rechtlichen Einflußmöglichkeiten des Landtags auf das Präsidentenamt steht es dem Parlament lediglich offen, auf einen Antrag aus dem Hause hin das Verhalten des Präsidenten zu mißbilligen 241 . Die Mißbilligung wird als rechtlich zulässig erachtet, weil einerseits das Parlament seinem Präsidenten übergeordnet i s t 2 4 2 und andererseits im Falle der Unzulässigkeit mit einer verdeckten Kampagne gegen den Präsidenten zu rechnen wäre, die für Präsident, Parlament und Land ein größeres Übel darstellte als eine Mißbilligung 243 . Ein im Plenum gestellter Mißbilligungsantrag findet grundsätzlich ohne Aussprache statt, damit das Ansehen des Amtes nicht demontiert wird 2 4 4 . Aus dem selben Grunde ist den einzelnen Abgeordneten - einem alten Parlamentsbrauch folgend - eine öffentliche Kritik an der Amtsführung des Präsidenten verwehrt 245 . Zudem stellt die Äußerung von Kritik an der Verhandlungsführung des Präsidenten im Plenum eine Ordnungswidrigkeit dar. In der Regel weist der Präsident die Kritik an seiner Verhandlungsführung zurück. Die Form, die er wählt, steht in seinem Ermessen. Sie kann von der schlichten Feststellung der Unzulässigkeit der Kritik bis zur Rüge im förmlichen Sinne reichen 246 . Auch ein Ordnungsruf oder Wortentzug, sowie unter Umständen sogar 237 Vgl. dazu Hatschek, S. 209. 238 Vgl. nur Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Anm. 2; Gundelach, S. 3224; Kleinschnittger, S. 28; Troßmann, § 2, Rn. 1.3.; v. Mangoldt, Art. 40, Anm. 2, S. 239. 239 Kleinschnittger, S. 28. 240 Ein Rücktrittsersuchen der stellvertretenden Parlamentspräsidenten wurde beispielsweise von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus beantragt, hatte aber keine Aussicht auf Erfolg, vgl. Drs. 13/239 sowie PlPr., 13. WP, 5. Sitzung vom 14. März 1996, S. 254f. 241 So ζ. B. geschehen im Abgeordnetenhaus von Berlin gegenüber der Präsidentin Dr. Laurien wegen angeblicher Verletzung der Neutralitätspflicht, vgl. Drs. vom 21. Mai 1991, 12. WP., S. 329. 242 Hatschek, S. 216; Sperling, S. 10; Stern II, S. 141; Böttcher, S. 35; a.A. Troßmann, § 2, Rn. 1.3. 243 So Steiger, in: Schneider/Zeh, § 25, Rn. 8; a.A. Troßmann, § 2, Rn. 1.3. 244 Böttcher, S. 35; Hatschek, S. 215 f. 245 Vgl. Hatschek, S. 215 f.; Kleinschnittger, S. 26; Achterberg, S. 124, 656; Loewenberg, S. 173. 246 Troßmann, § 7, Rn. 31. 4 Köhler
50
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
die Androhung der Verweisung aus dem Saale ist als Sanktion denkbar. Wenn Abgeordnete kritische Bemerkungen und Ausführungen machen wollen, so findet deren Behandlung ausschließlich im Ältestenrat statt 247 . Hier können auch Beschwerden allgemeiner Art über den Präsidenten erhoben werden, ohne jedoch auf dessen unantastbare Stellung einen Einfluß zu gewinnen. Selbst wenn sich der Ältestenrat einer Beschwerde anschließen oder ein Mißbilligungsantrag im Plenum angenommen würde, ergäben sich daraus für den Landtagspräsidenten keine zwingenden Konsequenzen, etwa in Form einer Amtsniederlegung 248. Gleichwohl ist es ein parlamentarisch unhaltbarer Zustand, wenn ein Parlamentspräsident im Amt bleibt, ohne das Vertrauen mindestens der überwiegenden Mehrheit des Hauses zu besitzen. In einer solchen Lage wird man von einem Parlamentspräsidenten erwarten können, daß er aus freien Stücken die Konsequenzen zieht und sein Amt niederlegt. Dieser Entschluß dürfte auch die angemessene Form sein, einen ernsthaften Konflikt zwischen Präsident und Landtag zu beenden249. Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, daß das Parlament insgesamt - von den genannten Maßnahmen abgesehen - keine rechtliche Möglichkeit hat, den Präsidenten abzuwählen oder seinen Rücktritt zu veranlassen. Doch diese formale Unangreifbarkeit bietet dem Präsidenten vor den politischen Möglichkeiten, seine Absetzung zu erreichen, oftmals keinen ausreichenden Schutz. Vielmehr genügt mitunter eine von namhafter politischer Seite erhobene Rücktrittsforderung, die nötigenfalls durch einen Boykott der vom Präsidenten geleiteten Sitzung unterstrichen werden kann, um ihm die Grundlage für seine weitere Amtsführung zu entziehen 250 .
I I I . Die protokollarische Einordnung des Amtes Während der Bundestagspräsident nach allgemeiner Auffassung von Verfassungs· wie Parlamentsrechtlern in der protokollarischen Rangordnung der Bundesrepublik den zweiten Platz nach dem Bundespräsidenten einnimmt 251 , ist die Einordnung des Landtagspräsidenten in das staatliche Gefüge der Länder ungleich schwieriger und umstrittener 252. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen steht 247 Klinke, in: ZParl. 1981, 436 (437); Gundelach, S. 324; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 29. 248 Böttcher, S. 36. 249 Stem II, § 26 IV 2 a, betrachtet den Rücktritt in solchen Situationen als „nobile officium". 250 Die Ereignisse um den Rücktritt des Bundestagspräsidenten Dr. Jenninger (CDU) im November 1988 haben jene formale Stabilität des Präsidentenamtes erheblich relativiert und gezeigt, wie sensibel die Grundlage dieses Amtes doch ist. 251 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 6; Loewenberg, S. 173; Schick, in: DVP 1988, 153. Diese Rangordnung ist ungeschriebene Staatspraxis, ein entsprechendes Gesetz oder eine sonstige Vorschrift existiert nicht.
III. Die protokollarische Einordnung des Amtes
51
die Frage, ob die verfassungsrechtliche Stellung des Landtagspräsidenten noch vor der des Ministerpräsidenten anzusiedeln ist oder erst danach. Zwar haben die Verfassungen der Länder die Befugnisse des Ministerpräsidenten einerseits und des Landtagspräsidenten andererseits so eindeutig festgelegt, daß ein Kompetenzstreit in der Verwaltungspraxis kaum möglich erscheint. Dennoch ist die Frage nach der „Spitze des Staates" in erster Linie bei protokollarischen Angelegenheiten von nicht zu unterschätzender Bedeutung, zumal bei der Beratung der Länderverfassungen nach 1945 auf die Schaffung von sog. Staatspräsidenten ausdrücklich verzichtet wurde. Man befürchtete mit derartigen Einrichtungen eine zusätzliche Komplizierung des ohnehin schon recht komplizierten bundesstaatlichen Verfassungslebens253. Gleichwohl haben es die Länderverfassungen in diesem Zusammenhang versäumt, deutlich zu machen, wer an Stelle des Staatspräsidenten im Lande als Oberhaupt anzusehen ist. Mitunter wird unter Bezugnahme auf die inhaltliche Bedeutung des parlamentarischen Regierungssystems vertreten, daß der Landtagspräsident in die Position des Staatspräsidenten getreten sei. Das Verhältnis vom Parlament zur Regierung - so wird ausgeführt - und damit auch das Verhältnis des Landtagspräsidenten als Oberhaupt des Parlaments zum Ministerpräsidenten bestimme sich gerade aus dem Abhängigkeitsverhältnis der Regierung zum Parlament und aus der Stellung des Parlaments als Repräsentant des Volkes 254 . Daraus folge, daß der Landtagspräsident der „erste Mann" im Staate vor dem Ministerpräsidenten sei. Überdies wohne dem Amt des Parlamentspräsidenten eine viel größere Integrationskraft inne als dem Amt des Ministerpräsidenten, da der Landtagspräsident - im Gegensatz zum Ministerpräsidenten - in der Regel von dem Vertrauen der Mehrheits- und der Oppositionsparteien getragen werde 255 . Ohne jeden Zweifel nimmt der Landtagspräsident im Staatsaufbau der Länder eine besondere und herausragende Stellung ein, die sich im wesentlichen aus der demokratischen Legitimation des Parlaments ergibt. Denn im Gegensatz zum Ministerpräsidenten, der nicht dem Landtag angehören muß, von diesem aber erst in sein Amt gewählt wird, hat der Landtagspräsident eine unmittelbare demokratische Legitimation als Volksvertreter. Mit seiner Wahl durch das Parlament erhält er eine abgeleitete Legitimation zur Repräsentation der Wählerschaft 256. Zudem ist er mit allen Würden ausgestattet, die die symbolische und offizielle Personifizierung der Volksvertretung verlangen 257 . Daraus aber seine Stellung als Staatsober252 Vgl. Grosse-Sender, in: Schneider/Zeh, § 64, Rn. 10. 253 Vgl. Delbrück, in: DÖV 1958, 353. 254 So Böttcher, S. 34. Siehe auch Uhlitz, in: DÖV 1966,293 (298). 255 Vgl. Uhlitz, in: DÖV 1966,293 (298). 256 Schick, in: DVP 1989, 153; Grosse-Sender, in: Schneider/Zeh, § 64, Rn. 10; Bücker, in: Schneider /Zeh, § 27, Rn. 6. 257 Um die Würde vor seinem Amt auszudrücken, sind bestimmte Formen entwickelt worden, etwa, daß sich alle Anwesenden beim Eintritt des Präsidenten erheben. 4*
52
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
haupt herzuleiten, wäre verfehlt. Vielmehr besteht im Schrifttum weitestgehend Übereinstimmung, daß als Spitze eines Landes traditionsgemäß nur dasjenige Staatsorgan anzusehen ist, das kraft Verfassung die „typischen Funktionen" eines republikanischen Staatsoberhauptes auszuüben berechtigt ist 2 5 8 . Hierunter fallen insbesondere die völkerrechtliche Vertretung und die sog. „staatsnotariellen" Funktionen wie Ernennung der Beamten, Ausübung des Begnadigungsrechts und Ausfertigung und Verkündung der Gesetze259. Bei einem direkten Vergleich ist festzustellen, daß die Länderverfassungen jene Funktionen mehrheitlich dem Ministerpräsidenten bzw. der Landesregierung zugedacht haben und gerade nicht dem Landtagspräsidenten. Dies gilt für die Vertretungsbefugnis des Landes 260 , die Beamtenernennung 261, das Begnadigungsrecht 262 sowie für die Ausfertigung und Verkündung der Gesetze263. Wenn einzelne dieser Funktionen nicht dem Ministerpräsidenten selbst, sondern der Landesregierung zustehen264, so ist der Ministerpräsident doch deren Vorsitzender und kann damit den Vorrang vor dem Landtagspräsidenten beanspruchen. Lediglich in Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin steht dem Landtagspräsidenten das Ausfertigungsrecht im Gesetzgebungsverfahren zu 2 6 5 ; in Brandenburg obliegt ihm nach Art. 81 I LV-Bg überdies die Verkündung. Diese Rechte bedeuten zwar eine merkliche qualitative Verschiebung der Stellung von Landtagspräsident und Ministerpräsident. Jedoch geht es dabei offensichtlich nicht so sehr um eine Heraushebung des Landtagspräsidenten als vielmehr um eine Stärkung des Organs, das er nach außen vertritt, nämlich eine Stärkung des Landtags 258 y. Mangoldt, Vorbem. 2 d vor Art. 54ff. GG, S. 297; vgl. auch Stern II, S. 200 und Degenhard, Rn. 448; Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 11; Starck, S. 17. 259 Stern II, S. 200; v. Mangoldt, Vorbem. 2 d vor Art. 54 ff. GG, S. 297. 260 Vgl. z. B. Art. 77 I LV-Th; Art. 101 LV-RP; Art. 103 I 1 LV-He; Art. 47 III LV-By; Art. 65 I LV-Ss; Art. 69 I LV-SA; Art. 47 I 1 LV-MV; Art. 91 I 1 LV-Bg; Art. 35 I LV-Nds; Art. 50 Satz 1 LV-BW; Art. 95 I LV-Sl; Art. 58 I 1 LV-Be. 261 Vgl. z. B. Art. 78 I LV-Th; Art. 102 LV-RP; Art. 66 LV-Ss; Art. 70 LV-SA; Art. 48 LVMV; Art. 51 LV-BW. 262 Vgl. z. B. Art. 78 III LV-Th; Art. 103 I LV-RP; Art. 109 I LV-He; Art. 59 I 1 LV-NRW; Art. 47 IV 1 LV-By; Art. 67 I 1 LV-Ss; Art. 49 I LV-MV; Art. 92 LV-Bg; Art. 36 I 1 LV-Nds; Art. 52 I 1 LV-BW. 263 Vgl. z. B. Art. 85 I LV-Th; Art. 113 I LV-RP; Art. 120 LV-He; Art. 76 I LV-By; Art. 58 I LV-MV; Art. 63 I LV-BW; Art. 102 LV-Sl. 264 So in Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und dem Saarland die Beamtenernennung (Art. 93 LV-Bg; Art. 108 LV-He; Art. 38 II LV-Nds; Art. 92 LV-Sl), in Nordrhein-Westfalen die Beamtenernennung, die Vertretungsbefugnis sowie die Ausfertigung und Verkündung (Art. 58, 57 Satz 1 und 52 LV-NRW). In Bremen obliegt dem Senat die Vertretungsbefugnis und das Begnadigungsrecht (Art. 118 I 2, 121 I 1 LV-Br). 265 Art. 76 I LV-Ss; Art. 45 I LV-Nds; Art. 82 I LV-SA; Art. 60 II LV-Be. Mit der Aufgabe, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze auszufertigen verbindet sich im übrigen das Recht und die Pflicht des Parlamentspräsidenten, sie auch auf ihre materielle Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfen. Vgl. zu dieser Thematik Härth, in: JR 1978, 489-493 sowie Marx, in: DVB1. 1967,716-717.
IV. Die Organstellung des Landtagspräsidenten
53
im Sinne einer Gewaltenteilung266. Die verfassungsrechtliche Zuordnung der Funktionen macht also deutlich, daß die Landessatzungen die Position des Staatsoberhauptes dem Ministerpräsidenten zuweisen, dieser mithin „erster Mann" im Staate ist 2 6 7 . Gleichwohl hat sich hinsichtlich der Begrüßungsreihenfolge bei offiziellen Veranstaltungen vereinzelt der Grundsatz eingebürgert, daß der Landtagspräsident vor dem Ministerpräsidenten genannt wird 2 6 8 . Abweichend von diesem Ergebnis ist die Praxis in Hamburg und Schleswig-Holstein. Obwohl auch hier die verfassungsrechtliche Zuordnung der erwähnten Funktionen beim Senat bzw. Ministerpräsidenten liegt 2 6 9 , ist in der parlamentarischen Wirklichkeit das Amt des Parlamentspräsidenten das „erste Amt" im Staate 270 . Während diese Stellung in Schleswig-Holstein auf einer langjährigen Tradition fußt, scheint sie in Hamburg sehr eng mit der Persönlichkeit und dem Amtsverständnis des jeweiligen Bürgerschaftspräsidenten verknüpft zu sein und war daher nicht immer unumstritten, mitunter auch einem kurzzeitigen Wandel unterworfen.
IV. Die Organstellung des Landtagspräsidenten Die Frage, ob die Parlamentspräsidenten als besondere Staats- oder Verfassungsorgane anzusehen sind oder nur Organ eines obersten Verfassungsorgans sind, wird in den Ländern durch die obersten Gerichte unterschiedlich beantwortet. Während der Bayerische Verfassungsgerichtshof die Stellung des Landtagspräsidenten als selbständiges Verfassungsorgan ausdrücklich mit der Begründung bejaht, daß ihm die Bayerische Verfassung auch „im Bereich der Exekutive ( . . . ) bedeutsame Befugnisse zuerkannt" habe 271 , wird dem Parlamentspräsidenten von Rheinland-Pfalz die Organeigenschaft vom Verfassungsgerichtshof des Landes wegen des Fehlens derartiger Kompetenzen versagt. Als Mitglied des Landtags sei er lediglich primus inter pares und nur aus dieser Position heraus mitbeteiligt an der Willensbildung des Staates. Seine sonstige Tätigkeit hätte dagegen den Charakter reiner Verwaltungstätigkeit, sie sei also nicht Tätigkeit eines Staatsorgans im engeren Sinne, sondern insoweit sei der Landtagspräsident Verwaltungsorgan 272. Dieser Auffassung ist der Hessische Staatsgerichtshof im Ergebnis gefolgt und hat die Parteifähigkeit 266 Vgl. Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 4. Aus der Kompetenz zur Ausfertigung der vom Landtag beschlossenen Gesetze kann nicht geschlossen werden, daß der Landtagspräsident Staatsoberhaupt ist, so Starck, S. 17. 267 So auch Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 1; Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 11. Im Ergebnis auch Starck, S. 17. Gemeinhin ist für den Ministerpräsidenten auch die Bezeichnung „Landesvater" gebräuchlich, die diese Position unterstreicht. 268 Auskunft des GBD beim Niedersächsischen Landtag gegenüber dem Verfasser. 269 Art. 43 - 4 5 , 52 LV-Ha; Art. 301, 31, 321,391 LV-SH. 270 Auskunft der Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Pape gegenüber dem Verfasser.
271 BayVerfGHE 23,62 (69). 272 RhPfVerfGH VRspr. Bd. 2, 284 (286).
54
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
des Hessischen Landtagspräsidenten als Antragsgegner im Rahmen eines Organstreitverfahrens mit der Begründung abgelehnt, „daß nicht der Präsident des Landtags, sondern nur der Landtag selbst ein Verfassungsorgan ist" 2 7 3 . Der Staatsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg bezeichnete den Landtagspräsidenten in einer Entscheidung über die Verwaltung und Auszahlung von Mitteln im Rahmen der Wahlkampfkostenerstattung an die Parteien „als Verfassungsorgan oder Teil eines solchen Organs" 274 und hat damit diese Fragestellung generell zumindest offengelassen. Im konkreten Fall wurde der Präsident jedoch nur als Verwaltungsbehörde eingestuft, weil sich seine Kompetenzen hinsichtlich der Festsetzung und Anweisung von Erstattungsbeträgen weder aus der Landesverfassung noch aus der Geschäftsordnung des Landtages ergeben. Wäre dagegen seine verfassungsrechtliche Funktion als Leiter der wirtschaftlichen Angelegenheiten betroffen, so würde der Landtagspräsident als mit selbständigen Rechten ausgestatteter Teil eines Verfassungsorgans zweifelsohne auch im Organstreitverfahren parteifähig sein 275 . Doch selbst dann, wenn der Landtagspräsident durch die Verfassung mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet ist, können seine Obliegenheiten als Verwaltungstätigkeit bewertet werden. In diesem Sinne bezeichnet ihn das Hamburgische Verfassungsgericht bezüglich der Personalangelegenheiten der Bürgerschaftsbediensteten als „Dienststellenleiter und ernennendes Organ" 276 , obwohl sich das Beamtenernennungsrecht unmittelbar aus Art. 18 I I 3 LV-Ha ergibt. Für die Olganstellung des Landtagspräsidenten kommt es deshalb nicht allein darauf an, ob ihm durch die Verfassung oder Geschäftsordnung eigene Rechte eingeräumt werden, sondern zugleich auf die Rechtsnatur der jeweiligen in Betracht kommenden Sachaufgaben 277. Vor diesem Hintergrund erscheint der Präsident des Bayerischen Landtags in Ansehung seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse als von den anderen völlig unabhängiges Staatsorgan, so etwa hinsichtlich der Auflösung des Landtags gem. Art. 18 Π iVm. Art. 44 III 4, 5 LV-By und insbesondere hinsichtlich der Vertretung Bayerns nach außen gem. Art. 44ΙΠ 4, 5 LV-By 2 7 8 . Zugleich jedoch tritt er als zwar selbständiges, aber der jeweiligen Funktion nach ausführendes Unterorgan des Staatsorgans Landtag in Erscheinung. So ζ. B. bei der Leitungsbefugnis in Vollsitzungen des Landtags nach §§93 ff. GOLT-By, der Ausübung des Hausrechts und der Polizeigewalt nach Art. 211 LV-By, dem Führen der Hausverwaltung nach Art. 21 I I LV-By sowie der Genehmigung von Untersuchungen und Beschlagnahmen in den Landtagsräumen gem. Art. 29 II LV-By. Alle diese Obliegenheiten rühren im wesentlichen aus der Autonomie des Parlaments 273 HessStGH ESVGH 18, 195 (198). 274 BaWüStGH BaWüVBl. 1970,169. 275 Vgl. auch NdsStGHE 1,83 (88 f.). 276 HambVerfG, in: Giese/Schunck/Winkler, Verfassungsrechtsprechung in der Bundesrepublik, Entscheidungssammlung, Bd. 31, Art. 18 LV-Ha Nr. 1. 277 Schneider, in: Landesverfassungsgerichtsbarkeit, Teilbd. III, S. 96; ebenso Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 13. 278 Vgl. BayVerfGHE 23,62 (69).
IV. Die Organstellung des Landtagspräsidenten
55
her, sind dem Grunde nach diesem zugeordnet und bedürfen lediglich zum Zweck ihrer Ausübung und ihrer Wirkung der Konzentration auf ein Organ des Parlaments. Der Landtagspräsident handelt hier als Hilfsorgan oder Unterorgan des Landtags 279 . Er ist „ein durch organisierende Rechtssätze gebildetes, selbständiges Subjekt von transistorischen Zuständigkeiten zur funktionsteiligen Wahrnehmung von Aufgaben einer (teil-)rechtsfahigen Organisation." 280 Sein Verhalten als Organ waiter ist Organ verhalten und damit Organisationsverhalten 281, es wird dem Parlament zugerechnet und zugeordnet 282. Da der Bayerische Landtagspräsident einerseits Hilfsorgan des Landtags ist, andererseits aber Funktionen eines unabhängigen Staatsorgans ausübt, wird seine Organstellung infolge dieser zweifachen Ausrichtung als „doppelt geschichtet" bezeichnet283. Eine vergleichbare Einordnung gilt für den Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Während Befugnisse wie die Ordnungsmacht gegenüber Regierungsmitgliedern in den Sitzungen nach Art. 23 Π 3 LV-Nds oder die Feststellung der Verhinderung des Landtages gem. Art. 44 I LV-Nds neben den in Art. 18 LV-Nds angeführten Rechten wiederum für ein Handeln als Unter- bzw. Hilfsorgan sprechen, handelt es sich beispielsweise bei dem Zustimmungsrecht zu Notverordnungen der Landesregierung gem. Art. 44 ΙΠ LV-Nds um originäre Gesetzgebung, da der Landtagspräsident hier als Ersatzparlament handelt 284 . Der Landtagspräsident hat somit im Notstandsfalle mit dem Landesministerium bzw. der Landesregierung als Kollegialorgan den Status eines obersten Verfassungsorgans. Ebenso verhält es sich mit seiner Kompetenz, gem. Art. 45 I LV-Nds Gesetze auszufertigen, die ein Teil der Gesetzgebung ist und daher im Schrifttum ebenfalls als Verfassungsorgankompetenz anerkannt ist 2 8 5 . Insoweit kann man also auch hier von einer doppelt geschichteten Organstellung des Landtagspräsidenten sprechen 286. Da auch den Parlamentspräsidenten von Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein verfassungsrechtliches Ausfertigungs-, mitunter auch Verkündungsrecht zukommt 287 , alle anderen präsidialen Befugnisse dagegen aus der Autonomie des Parlaments folgen, das Handeln des Präsidenten hier also dem Landtag zugerechnet wird, ist die Organstellung des Präsidenten in diesen Ländern ebenfalls „doppelt geschichtet". Eine „doppelte Schichtung" des Präsidentenamtes 279 Vgl. Geller/ Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 1; Groß, in: DVB1. 1954,422. 280 So Wolff/ Bachof, S. 48, Fn. 13. 281 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 9; Groß, in: DVB1. 1954,422. 282 Vgl. Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 4. 283 Köhler, in: BayVBl. 1988, 33 (34); Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 2 und Art. 20 LV-By, Rn. 2. 284 Vgl. Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 13. 285 Ebenda. 286 So auch Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 13, der den Landtagspräsidenten als „besonderes oberstes Verfassungsorgan" bezeichnet. 287 Art. 60 II LV-Be; Art. 811 LV-Bg; Art. 761 LV-Ss; Art. 821LV-SA.
56
. Abschnitt: D
t des Landtagspräsidenten
findet sich zudem im Saarland, wo der Landtagspräsident kraft eigener Organstellung den Ministerpräsidenten bei dessen Rücktritt oder einer sonstigen Beendigung des Amtes gem. Art. 87 V LV-Sl von der Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes freistellen kann. Hingegen kann - wie vereinzelt im Schriftum geschehen288 - die Befugnis des Präsidenten zur Einberufung des Landtags nicht als Verfassungsorgankompetenz charakterisiert werden 289 . In den meisten Ländern wird dem Präsidenten diese Kompetenz nicht als „eigenes Recht" eingeräumt, sondern nur als Recht des Parlaments, das ihm zur Ausübung übertragen ist 2 9 0 . Der Präsident wird damit lediglich als ausführendes Organ des Parlaments in dessen Selbstversammlungskompetenz tätig 2 9 1 . Doch selbst wenn einige Flächenstaaten, wie etwa Thüringen, dem Landtagspräsidenten ein eigenes, originäres Einberufungsrecht eingeräumt haben, verleiht ihm das nicht die Stellung eines unabhängigen Staatsorgans. Vielmehr genießt auch hier das Selbstversammlungsrecht des Landtags den Vorrang gegenüber der Einberufungskompetenz des Präsidenten. Außerdem darf der Landtagspräsident seine Befugnisse nicht im Widerspruch zum Willen des Landtags ausüben292. Von einer selbständigen Verfassungsorgankompetenz kann daher keine Rede sein. Keine Verfassungsorgankompetenz besitzen schließlich die Parlamentspräsidenten in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein293. Hier nehmen sie jeweils nur Funktionen des Organs Landtag wahr und sind damit lediglich als Hilfsorgan oder Unterorgan des Landtags zu qualifizieren.
288 Vgl. Köhler, in: BayVBl. 1988, 33 (34). 289 Vgl. Art. 30 IV 2 LV-BW; Art. 64 I LV-Bg; Art. 42 I LV-Be; Art. 13 IV 2 LV-SH; Art. 38 III LV-NRW; Art. 57 II LV-Th; Art. 68 Satz 2 LV-Sl; Art. 45 I LV-SA; Art. 44 IV 2 LV-Ss; Art. 83 V 1 LV-He; Art. 22 LV-Ha. 290 Vgl. Groß, in: DVB1. 1954,422. 291 Vgl. die Ausführungen auf S. 110 ff. 292 Vgl. hierzu S. 111. 293 So die Kommentierungen zu den Landesverfassungen. Vgl. Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 1; Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 11; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 9; Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Anm. 4; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 4; Wuttke, in: v. Mutius/Hübner/Wuttke, Art. 14 LV-SH, Rn. 2; Barschel/Gebel, Art. 14 LV-SH, S. 130. Eine Staatsorganstellung des Präsidenten der Hamburger Bürgerschaft wird allerdings ohne nähere Begründung bejaht von Wege/Grönwall, S. 29.
Zweiter Abschnitt
Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium Dem Präsidium 1 kommt unter den parlamentarischen Leitungsgremien eine ganz besondere Stellung zu. Diese ist darauf zurückzuführen, daß es als einziges Gremium dieser Art in den meisten Flächenstaaten eine verfassungsrechtliche Verankerung erfahren hat2. Das Präsidium ist in den einzelnen Landesparlamenten unterschiedlich zusammengesetzt und mit verschiedenen Aufgaben bzw. Mitwirkungsrechten betraut, durch die eine gewisse Kontrollfunktion des Präsidiums gegenüber dem Präsidenten fixiert werden soll 3 . Von Art und Umfang dieser Beteiligungsrechte hängt es ab, inwieweit die Amtsführung des Parlamentspräsidenten durch das Präsidium und andere parlamentarische Gremien begrenzt werden kann. Überdies eröffnen sich für die Fraktionen bei der personellen Besetzung des Präsidiums mittelbare Einflußmöglichkeiten auf die parlamentarische Geschäftsführung, indem sie „linientreu" erscheinende Abgeordnete in dieses Gremium „entsenden", bei denen die Aussicht besteht, daß sie sich trotz aller erstrebten Unparteilichkeit doch unbewußt von Fraktionsinteressen motivieren lassen4. Auf diese Weise gewinnen sie eine mittelbare Kontrolle über die Ausübung der präsidialen Leitungskompetenz, die im Vertretungsfall von „ihren" Vizepräsidenten wahrgenommen wird 5 . » In Bremen (Art. 86 LV, § 8 GOBü); Rheinland-Pfalz (§ 5 GOLT) und Thüringen (§ 5 GOLT): der Vorstand. Art. 84 und 86 der Hessischen Landesverfassung sprechen ebenfalls von „Vorstand", während die Geschäftsordnung des Landtags in § 3 die Bezeichnung ,»Präsidium" verwendet. § 46 I 1 GOLT-He stellt allerdings klar: „Das Präsidium ist der Vorstand des Landtags im Sinne der Art. 84 und 86 HV". Der Ausdruck „Vorstand" hat allem Anschein nach seinen Ursprung in Art. 18 PrVerf und § 14 GORT, vgl. Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Anm. 1. In Hamburg gab es bis zum Ende der 15. Wahlperiode ebenfalls einen Vorstand (Art. 18 LV, § 2 GOBü), dem allerdings keine Funktion zukam. Der Begriff diente lediglich als Bezeichnung der Gesamtheit von Präsident, Vizepräsidenten und Schriftführern. Die Geschäftsordnung des Bundestages kannte bis 1969 mit dem „Vorstand" ein weiteres Leitungsgremium neben Präsidium und Ältestenrat, dem die Präsidiumsmitglieder und Schriftführer sowie je ein parlamentarischer Geschäftsführer pro Fraktion angehörten, vgl. § 14 vorläufige GOBT, § 61GOBT von 1951. Nach Auflösung dieses Gremiums wurden die parlamentarischen Verwaltungsaufgaben dem Ältestenrat übertragen. 2 Vgl. Art. 69 I LV-Bg; Art. 41 II LV-Be; Art. 86 LV-Br; Art. 32 I LV-BW; Art. 20 I LVBy; Art. 84 LV-He; Art. 18 I LV-Nds; Art. 381 LV-NRW; Art. 70 II LV-Sl; Art. 471 LV-Ss. 3 Rummel, S. 68. 4
Vgl. dazu auch die Ausführungen von Wermser, S. 25 f. 5 So auch Rothaug, S. 167.
58
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums Das Präsidium besteht im Bund, in Rheinland-Pfalz und in Thüringen aus dem Präsidenten und seinen als solchen gleichrangigen Stellvertretern, auch Vizepräsidenten genannt6. In fast allen übrigen Ländern gehören zudem noch die Schriftführer zu diesem Gremium 7. Gehören die Schriftführer dem Präsidium nicht an, so setzt es sich neben Präsident und Vizepräsidenten meist aus „weiteren Mitgliedern" zusammen8. Üblicherweise handelt es sich dabei um leitende Mitglieder der Fraktionen und Gruppen 9. Der § 3 I, I I der Sächsischen Landtagsgeschäftsordnung benennt in diesem Zusammenhang etwa die Vorsitzenden der im Landtag vertretenen Fraktionen sowie die parlamentarischen Geschäftsführer. Sie wirken allein an den Entscheidungen mit, die das Präsidium als Kollegialorgan trifft, sind also an der Leitung der Plenarsitzungen nicht beteiligt. Als einziger Flächenstaat weist das Saarland die Besonderheit eines „erweiterten Präsidiums" auf. Dies gilt für den Fall, daß das Präsidium Funktionen des Ältestenrats übernimmt. Unterstützt es also den Präsidenten bei der Führung seiner Geschäfte, insbesondere bei der Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des Landtags und über die Stellen der Ausschußvorsitzenden und ihrer Stellvertreter, so wird das Präsidium durch Hinzuziehung der Fraktionsvorsitzenden erweitert 10 . Andere Flächenstaaten wiederum haben von der Einrichtung eines Präsidiums Abstand genommen, wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern und SachsenAnhalt. In Schleswig-Holstein ist mit Beginn der 13. Wahlperiode auf das Präsidium verzichtet worden. Ursache hierfür ist der Umstand, daß das Präsidium weitestgehend ein Schattendasein geführt hat, da die Beratungs- und Unterstützungsfunktionen bereits im wesentlichen vom Ältestenrat als dem insbesondere für die Gestaltung der parlamentarischen Abläufe wesentlichen Gremium wahrgenommen wurden 11. Die vormals dem Präsidium obliegenden Aufgaben sind damit dem Ältestenrat übertragen worden 12 . 6 § 5 GOBT; § 5 IGOLT-RP; § 5 I GOLT-Th. 7 § 8 I GOBü-Br; § 8 GOLT-By; § 5 I GOLT-Nds; § 8 I GOLT-NRW; § 12 I GO-Be; § 29 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 8 § 11 I GOLT-Bg; § 4 VII GOLT-BW; § 3 I GOLT-He; § 3 II GOLT-Ss. Gleichwohl können die Schriftführer als „weitere Mitglieder" in das Präsidium gewählt werden, wie dies etwa in Hessen üblich ist, vgl. Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Erl. 6. 9 Vgl. Feuchte, Art. 32 LV-BW, Rn. 2. 10
§ 32 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. Vgl. den Schlußbericht der Enquete-Kommission „Verfassungs- und Parlamentsreform" des Schleswig-holsteinischen Landtags, Drs. 12/180 vom 7. 2. 1989, B., Kap. 2, Abschnitt 3, Ziff. 2.3.3., S. 107. 12 Neben dem Ältestenrat gibt es jedoch weiterhin das sog. Sitzungspräsidium, das sich aus dem amtierenden Präsidenten und den beiden amtierenden Schriftführern zusammensetzt. 11
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
59
Mit der Zusammensetzung des Präsidiums ist überdies die Frage verknüpft, ob die einzelnen im Landtag vertretenen Fraktionen einen Anspruch auf Vertretung in diesem Gremium haben, ihnen also ein sog. „Grundmandat" zusteht13. Ein solches Grundmandat würde dem Anspruch der Fraktionen auf Chancengleichheit bei der Mitwirkung an der parlamentarischen Willensbildung Rechnung tragen. Dieser Anspruch ist Ausdruck des verfassungsmäßig verbürgten Minderheitenschutzes im Parlament, dem Recht auf Bildung und Ausübung der Opposition sowie dem Mitwirkungsrecht des einzelnen Abgeordneten, das er faktisch nur als Mitglied einer Fraktion ausüben kann 14 . Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts steuern und erleichtern die Fraktionen als „notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens"15 die parlamentarische Arbeit, „indem sie insbesondere eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organisieren, gemeinsam Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie eine umfassende Information der Fraktionsmitglieder unterstützen" 16. Den genannten Aufgaben können die Fraktionen jedoch nur dann nachkommen, wenn sie in den Gremien des Landtags, in denen der größte Teil der parlamentarischen Arbeit geleistet wird, mit mindestens einem Mitglied vertreten sind 17 . Dies gilt sowohl für die sachlich-inhaltlich arbeitenden Gremien als auch für die, die sich wie das Präsidium mit der Organisation und Leitung des Parlaments befassen 18. Vor diesem Hintergrund wurde in der konstituierenden Sitzung des 13. Bundestages die Geschäftsordnung dahingehend geändert, daß nunmehr gem. § 2 I 2 GOBT jede Fraktion durch mindestens einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten ist. Zwar wurden in der parlamentarischen Praxis bei der Besetzung des Ältestenrats und anderer Gremien bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich alle Fraktionen berücksichtigt 19, jedoch ist die Regelung über einen verbrieften Anspruch jeder Fraktion auf einen Sitz im Präsidium eine Neuheit in der deutschen Parlamentsgeschichte. Die „Grundmandats"-Regelung geht dabei von dem Gedanken aus, daß es bei der Zusammensetzung des Präsidiums nicht um die Widerspiegelung der Kräfteverhältnisse des Parlaments, sondern um die „Repräsentation des ganzen Hauses" gehe20. Jedoch kann die kurzfristig und ohne vorhergehende Beratung im Geschäftsordnungsausschuß eingeführte Änderung des § 21 GOBT die bezweckte Zusammensetzung des Präsidiums nicht in jedem Falle gewährleisten 21. u Vgl. Ritzel / Bücker, § 2, S. 5. 14 Edinger, in: Recht und Politik 2/95,77 (80). »5 BVerfGE 84, 304 (322). 16 BVerfGE 80, 188(231). π Vgl. BVerfGE 70, 324 (362 ff.); BayVerfGH 41, 124 (132 f.). ι» Vgl. Edinger, in: Recht und Politik 2/95,77 (81). 19 Vgl. Edinger, S. 180 ff. (Ältestenrat) und S. 275 ff. (übrige Gremien); Loewenberg, S. 176 f. 20 Vgl. die Begründung des Abg. W. Schulz, 13. WP, Sten. Prot. 1. Sitzung vom 10. 11. 1994, S. 10 D. 21 Vgl. die kritischen Anmerkungen bei Ritzel / Bücker, § 2, S. 5.
60
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Schon mit Rücksicht auf Art. 38 I 2 GG verbietet sich die Annahme einer Verpflichtung der Mitglieder des Deutschen Bundestages, (mindestens) je einem Kandidaten jeder Fraktion die gem. Abs. Π Satz 1 zur Wahl erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen zu geben22. Eine „Grundmandats"-Regelung hat auch vereinzelt in die Verfassungen und Geschäftsordnungen der Länder Eingang gefunden. Obgleich sich die Zusammensetzung des Präsidiums grundsätzlich an dem Stärkeverhältnis der im Landtag vertretenen Fraktionen orientiert 23 , bestimmt etwa Art. 69 I 2 der Brandenburgischen Landesverfassung: , Jede Fraktion ist berechtigt, im Präsidium vertreten zu sein." Auch Art. 41 Π 2 der Berliner Verfassung sieht vor, daß ,jede Fraktion ( . . . ) mindestens einen Vertreter im Präsidium" hat. Nach Art. 70 I I der Saarländischen Landesverfassung erfolgt die Besetzung des Präsidiums „unter Berücksichtigung der verschiedenen Fraktionen." Ähnliche Regelungen bestehen in den Geschäftsordnungen von Baden-Württemberg und Sachsen24. Während jedoch § 2 I 2 der Geschäftsordnung des Bundestages jeder Fraktion einen Anspruch auf das Amt eines Vizepräsidenten verleiht, beziehen sich die Regelungen der Länder nicht auf dieses konkrete Amt, sondern gewährleisten lediglich eine grundsätzliche Vertretung in diesem Gremium. Für die kleineren Fraktionen bedeutet dies regelmäßig das Amt eines Schriftführers oder Beisitzers; einen Anspruch auf das Amt des Vizepräsidenten haben sie nicht 25 . In allen anderen Flächenstaaten ist hingegen ein derartiger Anspruch der Fraktionen auf Vertretung im Präsidium nicht ausdrücklich normiert. Vielmehr werden hier die Präsidiumssitze allein unter Proporzgesichtspunkten vergeben 26, d. h., die Festlegung der Zahl der Präsidiumsmitglieder je Fraktion orientiert sich an einem mathematischen Verfahren zur proportionalen Umrechnung der Fraktionsstärke auf Anteile an den Präsidiumssitzen. Ohne eine Grundmandatsregelung kann dies jedoch zur Folge haben, daß schwächere Fraktionen bei der Präsidiumsbesetzung keine Berücksichtigung finden. Aus diesem Grund enthält beispielsweise die Landtagsgeschäftsordnung von Bayern die Regelung, daß diejenige Fraktion, auf die nach der Besetzung des Präsidiums im Wege des d'Hondtschen Höchstzahlverfahrens kein Sitz entfällt, einen zusätzlichen Schriftführer stellt und damit ebenfalls in diesem Gremium vertreten ist 27 . Im übrigen erschient es in den meisten Parlamenten nicht geboten, die Zahl der Präsidiumsmitglieder aufzustocken, um zu gewährleisten, daß alle Fraktionen entsprechend ihres parlamentarischen Stärkeverhältnisses im Präsidium vertreten 22
Ebenda. 23 Vgl. etwa § 101 1 GOLT-Bg; § 121 2 GO-Be. 24
§ 41 2 GOLT-BW; § 3 I 2 iVm. § 9 II GOLT-Ss. » So auch Neumann, Art. 86 LV-Br, Rn. 9. 26 § 9 I GOLT-By; § 8 II 1 GOBü-Br; § 10 I 1 GOBü-Ha; § 17 I GOLT-NRW; § 4 II GOLT-SA; § 5 II GOLT-Nds; § 2 II 1 GOLT-Th. 27 § 9 I GOLT-By.
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
61
sind. In diesem Fall wäre die Arbeits- und Funktionsfähigkeit dieses Gremiums nicht mehr gesichert 28.
1. Die Vizepräsidenten a) Anzahl und persönliche Voraussetzungen Für den Bundestag enthalten weder das Grundgesetz noch die Geschäftsordnung eine genaue Festlegung der Zahl der Stellvertreter des Präsidenten. Vielmehr entscheidet der Bundestag von Fall zu Fall über die Zahl der Vizepräsidenten 29, die in der Regel jedoch vorab durch interfraktionelle Absprachen festgelegt wird 30 . Während in der 1. Wahlperiode noch zwei Vizepräsidenten gewählt wurden, die der zweit- und drittstärksten Fraktion angehörten, wurde die Anzahl in den weiteren Wahlperioden kontinuierlich gesteigert 31. Zu Beginn der 4. Wahlperiode einigte man sich auf einen zweiten Sitz für die SPD und damit auf vier Vizepräsidenten. An dieser Zahl änderte sich auch nichts, als der Bundestag in seiner konstituierenden Sitzung am 10. 11. 1994 erstmals eine Vertreterin der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zur Vizepräsidentin wählte, da dieser Sitz auf Kosten des zweiten Vizepräsidenten der SPD-Fraktion ging 32 . Im Gegensatz zum Verfahren auf Bundesebene ist in der Mehrzahl der Landtagsgeschäftsordnungen exakt festgelegt, wie viele Vizepräsidenten das Parlament zu wählen hat. Dabei weicht die Anzahl mitunter recht deutlich voneinander ab. So hat etwa das Brandenburgische Präsidium nur ein Vizepräsidentenamt zu vergeben33, während das Präsidium des Berliner Abgeordnetenhauses drei Stellvertreter 34 und das des Niedersächsischen Landtags sogar vier Stellvertreter aufzuweisen hat 35 . Alle anderen Landtage, wie die von Bayern, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, haben sich für zwei Vizepräsidenten entschieden36. Keine festgelegte Zahl findet man hingegen in den Präsidien der Landtage von Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hier entscheidet das Parlament von Fall zu Fall über die zu vergebenden Stellvertretersitze 37. Die Fraktionen 28 Vgl. zu diesem Gesichtspunkt BVerfGE 70, 366 sowie Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 5. 29 Ritzel /Bücker, § 2, Anm. 1 f. 30 So Rausch, S. 78. 31 Nachweise hierzu bei Schindler, S. 222 f. 32 Zur Besetzung des Präsidiums des 13. Bundestages s. Stenographischer Bericht 13/1, S. 8 ff. 33 Vgl. den Wortlaut des § 11 I 1 GOLT-Bg. 34 § 121 1 GO-Be. 35 § 5 I 1 GOLT-Nds. 36 § 8 GOLT-By; § 2 II GO-Ha; § 3 I 1 GOLT-MV; § 2 V GOLT-Ss; § 4 I GOLT-SA; § 3 I GOLT-SH; § 2 I 1 GOLT-Th.
62
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
haben dadurch die Möglichkeit, auf vorhandene politische oder personalpolitische Notwendigkeiten zu reagieren 38. Der Stellenwert eines Vizepräsidenten ist im Prinzip mit dem des Parlamentspräsidenten vergleichbar. Im Vertretungsfall etwa übernehmen die Vizepräsidenten nach einer gesetzlich geregelten oder vereinbarten Reihenfolge die Leitung der Sitzung, die Führung der Amtsgeschäfte und die Repräsentation des Parlaments. Insoweit treten sie also in die vollen Rechte und Kompetenzen des Präsidenten ein und üben die o.g. Funktionen selbst als „amtierende Präsidenten" aus. Vor diesem Hintergrund sind an das Vizepräsidentenamt dieselben Ansprüche zu stellen wie an das Amt des Präsidenten. Dies gilt sowohl hinsichtlich der formalen Voraussetzungen 39 , wie ζ. B. die Eigenschaft als Mandatsträger, aber auch hinsichtlich des charakterlichen Rüstzeugs und der Persönlichkeitsstruktur. Denn der Rang der Vizepräsidenten orientiert sich maßgeblich an deren Fähigkeit, den Präsidenten mit allen Aufgaben und Befugnissen vollgültig vertreten zu können. Für das Amt eines Vizepräsidenten werden demnach von den einzelnen Fraktionen nur Persönlichkeiten vorgeschlagen, die sich in der parlamentarischen Arbeit Verdienste erworben haben und die sich durch ein besonderes politisches Profil ausgezeichnet haben40. Die Bestellung zum Stellvertreter des Landtagspräsidenten wird deshalb von den Abgeordneten ohne Zweifel als eine wichtige Auszeichnung und Anerkennung der geleisteten politischen Arbeit empfunden. Außerdem nehmen die Vizepräsidenten in ihren Parteien kraft Amt und Persönlichkeit eine gewichtige Position ein, zwar weniger als exponierte Parteiagitatoren, wohl aber als geachtete und erfahrene Persönlichkeiten und Repräsentanten, deren Wort und Rat selten unerhört bleibt. Die Amtsdauer der Vizepräsidenten währt wie die des Präsidenten eine volle Legislaturperiode lang. Hinsichtlich ihrer Absetzbarkeit oder sonstiger Mißtrauensanträge gelten die im Zusammenhang mit dem Parlamentspräsidenten erörterten Grundsätze. Danach ist eine Abberufung ohne gesetzliche Regelung prinzipiell unzulässig. Der Einführung einer entsprechenden Normierung steht jedoch kein höherrangiges Recht entgegen41. Sollten dabei die Stellvertreter zusammen mit dem Landtagspräsidenten abgewählt werden, so geht die Sitzungsleitung auf den Alterspräsidenten über. Unabhängig davon sind die Vizepräsidenten wie der Landtagspräsident berechtigt, das Amt jederzeit niederzulegen. Die Amtsniederlegung hat auf das Mandat keine Auswirkungen. 37 Vgl. den Wortlaut des § 11 I GOLT-BW und die Plenarprotokolle der 1. Sitzung des Landtags der 8. WP, S. 6. 38 Vgl. Rummel, S. 65. 39 Vgl. hierzu S. 18 ff. 40 Gundelach, S. 325. 41 Die Abberufung eines Präsidiumsmitglieds erfolgte beispielsweise im Bayerischen Landtag als die Abg. Memmel (Fraktion Die Grünen) wegen Entrollens eines Transparents auf der Pressetribüne während einer Vollversammlung nach kurzzeitiger Unterbrechung der Sitzung aus dem Präsidium ausgeschlossen wurde, vgl. PIPr. des Bayer. LT, 11. WP., 23. Sitzung vom 13.5. 1985, S. 1408 ff.
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
63
b) Die Aufgaben der Vizepräsidenten Zumeist besteht für die Vizepräsidenten in den Geschäftsordnungen eine eigene Norm, die deren Aufgabenkreis als Stellvertreter des Landtagspräsidenten schwerpunktmäßig umreißt. Im wesentlichen handelt es sich dabei um die Unterstützung des Präsidenten in seiner Amtsführung einerseits und zum anderen um die verantwortungsvolle Aufgabe, den Präsidenten im Verhinderungsfälle zu vertreten.
aa) Unterstützung der Amtsführung des Präsidenten Soweit die Unterstützung der Amtsführung des Präsidenten nicht dem Präsidium insgesamt zugewiesen ist 4 2 , obliegt diese Verpflichtung allein den Vizepräsidenten 43 . Der Begriff der Amtsführung ist ein Sammelbegriff für alle anfallenden Dienstgeschäfte im weiteren Sinne. Ihm unterfallen insbesondere die in Verfassung und Geschäftsordnung gesondert aufgeführten Aufgaben, wie ζ. B. die Ausübung der Ordnungsgewalt und des Hausrechts, die Verwaltung der gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags sowie die Vertretung in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten. Der Amtsführung unterfallen aber auch die Geschäfte der laufenden Parlamentsverwaltung, etwa die Einberufung zu Sitzungen, die Festsetzung der vorläufigen Tagesordnung, die Entgegennahme von Erklärungen, Anträgen und Anfragen, die Überweisung von Gegenständen, die Verantwortung für die Ausfertigung der Plenarprotokolle, die Ausfertigung und Weiterleitung der vom Landtag gefaßten Beschlüsse sowie die Führung des gesamten Schriftverkehrs 44 . Auch die Gewährung von Urlaub, die Unterrichtung des Plenums über Eingänge und die Verantwortung für die Herstellung und Verteilung der Landtagsdrucksachen sowie für die Fertigung der Protokolle gehört hierzu 45 . Schließlich umfaßt die Amtsführung des Präsidenten all diejenigen Tätigkeiten, die die Arbeit der Organe des Parlaments ordnen und regeln. Die Vielfalt der Landtagsgeschäfte macht deutlich, daß eine möglichst effektive Abwicklung und Überwachung nicht allein dem Landtagspräsidenten obliegen kann, sondern die Einbindung der Vizepräsidenten erfordert. bb) Vertretung des Präsidenten Im Rahmen der Vertretung des Präsidenten durch die Vizepräsidenten ist zwischen der Organvertretung und der sog. Organwaltervertretung zu unterscheiden. Bei der Organvertretung handelt der Vizepräsident aufgrund einer mit dem Landtagspräsidenten geschlossenen Vereinbarung an seiner Statt als Parlamentsorgan. 42 Vgl. z. B. § 15 I GOLT-Bg. 43 Vgl. etwa § 15 11 GO-Be; § 13 Satz 2 GOLT-By; § 13 Satz 2 GOBü-Br. 44 Vgl. Wuttke, in: v. Mutius / Hübner / Wuttke, Art. 14 LV-SH, Rn. 3. 45 Vgl. z. B. §§ 75 Satz 1, 77 II, 39 II, 101 I, 103 IGOLT-BW.
64
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Das kommt beispielsweise bei repräsentativen Anlässen in Betracht 46. Die Organvertretung darf allerdings nicht dazu führen, daß der gewählte Präsident im Vereinbarungswege durch einen Vizepräsidenten ersetzt wird, so daß diese Form der Vertretung grundsätzlich auf Einzelfälle zu beschränken ist 47 . Im Gegensatz zur Organvertretung ist der Vizepräsident bei der Organwaltervertretung lediglich „amtierender Präsident" ohne die Organstellung des Parlamentspräsidenten 48. Um eine Organwaltervertretung handelt es sich vor allem bei der Vertretung des Landtagspräsidenten in der gesamten Führung der Amtsgeschäfte, sofern dieser selbst an der Amtsführung gehindert ist 4 9 . Ob ein Verhinderungsfall gegeben ist, ist Tatfrage, muß also für den konkreten Fall entschieden werden. Als Verhinderungsgründe wird man in der Regel längere und ernsthafte Erkrankung sowie nicht nur kurzfristige Auslands- und Ferienaufenthalte ansehen können50. Wenn der Präsident allerdings erreichbar ist, müssen diese Umstände nicht zwangsläufig zu einem Verhinderungsfall führen. So wird es ζ. B. auch bei längerer Abwesenheit vom „Dienstsitz" darauf ankommen, ob der Präsident trotz dieser Abwesenheit in der Lage ist, alle Aufgaben wahrzunehmen, oder ob er nur an der Ausübung einiger bestimmter Rechte gehindert ist 51 . Ist der Präsident erkrankt, kann er beispielsweise zwar seine Rechte als oberster Dienstherr ausüben, nicht jedoch andere Aufgaben erfüllen, die seine Anwesenheit im Parlament erfordern. Einvernehmlich mit seinen Vertretern muß es dem Präsidenten gleichwohl vorbehalten bleiben, bestimmte aufschiebbare Aufgaben selbst, gegebenenfalls nach Beendigung des Verhinderungsfalles, wahrzunehmen 52. Ist der Landtagspräsident an der Führung der Amtsgeschäfte gehindert, so wird er - wie man vielleicht infolge der Formulierung einiger Geschäftsordnungen „Die Präsidentin oder der Präsident wird durch die Vizepräsidentm/ien und Vizepräsidenten vertreten" 53 meinen könnte - nicht von seinen Stellvertretern als Kollegium vertreten 54. Vielmehr kann nur jeweils ein Stellvertreter voll in die Rechte des Präsidenten eintreten. Erst dann übt der Vizepräsident ein „konkretes Amt" aus55. Der Stellvertreter übernimmt die Aufgaben des Präsidenten in vollem Umfang 56 . Eine etwaige Einschränkung der Vertretungskompetenz ist Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie von dieser Einschränkung Kenntnis haben. 46 4
? 4 « 4 9 so
Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 278. Nawiasky, Art. 20 LV-By, Rn. 7. Achterberg, S. 128 f.; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 278. Achterberg, S. 129. Barschel/Gebel, Art. 13 LV-SH, Anm. II 8, S. 133.
51 Ritzel/Bücker, § 7, S. 12 b. 52 Ebenda. 53 Vgl. z. B. § 45 I 1 GOLT-He. 54 Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 2. 55 Νauber, S. 113. 56 § 11 13 GOLT-BW.
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
65
Die Reihenfolge der Vertretung im Verhinderungsfall ist in den Parlamenten unterschiedlich geregelt. Im Bund bestimmt - seit einer Änderung der Geschäftsordnung durch Beschluß vom 27. 3. 196957 - § 7 IV der Geschäftsordnung des Bundestages, daß der Präsident im Verhinderungsfall von einem Vizepräsidenten vertreten wird, der der zweitstärksten Fraktion angehört. Vor dieser Änderung übernahm die Stellvertretung regelmäßig derjenige Vizepräsident, der dem Bundestag die längste Zeit angehörte 58. Ob an diesem „parlamentarischen Brauch" 59 subsidiär festgehalten werden soll, läßt § 7 GOBT offen, und zwar sowohl für den Fall, daß zu entscheiden ist, welcher von zwei Stellvertretern der zweitstärksten Fraktion den Vorrang hat, als auch für den Fall, daß die Stellvertreter des Präsidenten, die der zweitstärksten Fraktion angehören, verhindert sind. In den Geschäftsordnungen der Landtage sind verschiedene Arten der Vertretungsreihenfolge festzustellen. In Bayern, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein - in deren Landtagen es laut Geschäftsordnung ohnehin nur zwei Vizepräsidenten gibt - wird der Präsident im Verhinderungsfall durch den „Ersten Vizepräsidenten" vertreten. Sollte auch dieser verhindert sein, so vertritt ihn der „Zweite Vizepräsident" 60. Beide Vizepräsidenten gehören üblicherweise der zweit- bzw. drittstärksten Fraktion an. In Baden-Württemberg vertreten die Vizepräsidenten den Landtagspräsidenten in der Reihenfolge ihrer Wahl nach § 4 der Geschäftsordnung 61, was in der Regel zu dem gleichen Ergebnis führt. In Brandenburg, wo die Geschäftsordnung nur einen einzigen Vizepräsidenten vorsieht, wird der Landtagspräsident im Falle seiner Verhinderung durch eben diesen vertreten. Sind sowohl Präsident als auch Vizepräsident verhindert, so geht das Vertretungsrecht auf die anderen Mitglieder des Präsidiums in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen über 62 . Dagegen ist für die Landtage von Berlin, Niedersachsen und Sachsen festgelegt, daß sich die Reihenfolge der Vertretung aus einer Vereinbarung des Parlamentspräsidenten mit seinen Stellvertretern ergeben soll. In Hessen, im Saarland und in den meisten anderen Ländern vollzieht sich die Vertretung „nach parlamentarischem Brauch" nach dem Dienstalter der Vizepräsidenten63. In Thüringen gibt es indessen weder eine ausdrückliche noch eine ungeschriebene normative Regelung, so daß die Entscheidung insoweit dem Präsidenten obliegt 64 .
57 5. WP./225./12363 D iVm. Drs. 4008. 58 Vgl. Troßmann, § 7, Rn. 44. 59 Achterberg/Schulte, in: v. Mangoldt, Art. 40, Rn. 9. « § 13 Satz 1 iVm. § 8 Satz 1 GOLT-By; § 2 III 1 GOBü-Ha; § 4 IX GOLT-Ss; § 5 IV GOLT-SH. Entsprechendes gilt wohl auch für Mecklenburg-Vorpommern, vgl. § 31 1 GOLTMV. § 1112 GOLT-BW. w § 13 I GOLT-Bg. « Vgl. Achterberg, S. 128. 64 So Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 6. 5 Köhler
66
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Ein anderer Fall der Vertretung des Präsidenten ist seine Vertretung bei der Leitung der Plenarsitzung. Auch hierbei handelt es sich um eine sog. Organwaltervertretung 65. Die Vizepräsidenten leiten die Verhandlungen des Parlaments mit allen dem Präsidenten zustehenden Leitungs- und Ordnungsbefugnissen, die sie im Vertretungsfall kraft eigenen Rechts ausüben66. Die Reihenfolge der Vertretung bei der Sitzungsleitung ist nicht zwingend mit der identisch, die für die Vertretung in der Führung der Amtsgeschäfte vorgesehen ist 67 . In Berlin, Rheinland-Pfalz und Sachsen bestimmt der Landtagspräsident im Einvernehmen mit seinen Stellvertretern die Reihenfolge der Vertretung 68. Entsprechendes gilt für Hamburg und die meisten anderen Länder 69 . In Thüringen bestimmt er die Reihenfolge der Vertretung „im Benehmen" mit den Vizepräsidenten 70 . Der Präsident kann also selbst über die Vertretungsreihenfolge entscheiden und braucht seine Stellvertreter hiervon nur zu unterrichten. Für den Fall, daß der Präsident sowie sämtliche Vizepräsidenten gleichzeitig verhindert sind, geht in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen das Vertretungsrecht auf den Alterspräsidenten über, sofern dieser zur Übernahme der Vertretung bereit ist 71 . Die Zulässigkeit dieser Bestimmung ist zweifelhaft, da die Landesverfassungen einheitlich vorschreiben, daß die Stellvertreter des Präsidenten zum Präsidium gehören und vom Landtag gewählt sein müssen; zumindest wird der Alterspräsident nur solange amtieren dürfen, bis der Landtag in der Lage ist, einen weiteren Stellvertreter zu wählen 72 . In Bremen und Nordrhein-Westfalen hingegen bestehen derartige Bedenken nicht. Hier treten die Schriftführer als gewählte Mitglieder des Präsidiums - im allgemeinen in der Reihenfolge ihres Amtsalters - an die Stelle von Präsident und Vizepräsident 73. Gleichermaßen geht in Brandenburg das Vertretungsrecht auf die „anderen Mitglieder" des Präsidiums in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen über 74 .
65 Achterberg, S. 129. 66 Rausch, S. 78. 67 Vgl. hierzu nur die unterschiedlichen Anordnungen in § 4 IX und § 5 II 1 der Sächsischen Geschäftsordnung. 68 § 15 I 2 GO-Be; § 20 II 1 GOLT-RP; § 5 II 1 GOLT-Ss; § 7 Satz 2 GOLT-Nds sowie § 6 Satz 2 GOLT-SA. 69 Auskunft der Hamburgischen Bürgerschaftspräsidentin Pape gegenüber dem Verfasser. Hiervon abweichend § 11 I 2 iVm. Abs. II 1 GOLT-BW; § 3 I 1 GOLT-MV; § 13 Satz 1 iVm. § 8 Satz 1 GOLT-By. 70 § 18 II 1 GOLT-Th. 71 § 11 II 2 GOLT-BW; § 15 II 1 GO-Be; § 45 Satz 2 GOLT-He; § 20 II 2 GOLT-RP; § 35 Satz 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 58 II 1 GOLT-SA; § 18 II 2 GOLT-Th. 72 Vgl. Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Anm. 5. 73 § 14 GOBü-Br; § 11 Satz 2 GOLT-NRW. 74 § 1312 GOLT-Bg.
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
67
Dem Parlamentspräsidenten ist es im übrigen nach allgemeiner Auffassung verwehrt, direkten oder indirekten Einfluß auf die Geschäftsführung des diensttuenden Vizepräsidenten zu nehmen75. Hat etwa ein amtierender Präsident einen Sitzungsausschluß verhängt, so bleibt die Entscheidung über die Dauer des Ausschlusses nach ständiger Übung seine Aufgabe, auch wenn er inzwischen die Leitung der Sitzung abgegeben hat. Entsprechendes gilt für eine nachträgliche Rüge. Die Unabhängigkeit des dienstführenden Präsidenten bedeutet außerdem, daß der jeweils amtierende Präsident den ihn ablösenden Präsidenten grundsätzlich nicht in der Geschäftsführung binden darf 76 . Hat der diensttuende Präsident sich beispielsweise für eine Verfahrensart entschieden und diese dem Parlament mitgeteilt, so ist der ihn ablösende Präsident nicht zur Übernahme dieser Verfahrensart verpflichtet. Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur für den Fall, daß der Landtag in jener Sache einen Beschluß gefaßt hat. Gleichwohl wird der nachfolgende Präsident nach Möglichkeit das Konzept seines Vorgängers aufgreifen und in dessen Sinne weiterführen. Aus dem Grundsatz der Entscheidungsfreiheit des amtierenden Präsidenten folgt schließlich, daß Zusagen an einzelne Abgeordnete, beispielsweise zur Abgabe einer Erklärung, möglichst nur dann gegeben werden, wenn sie vor dem Wechsel des Amtsinhabers eingelöst werden können. Anderenfalls sähe sich der amtierende Präsident, der die Sitzungsleitung inzwischen übernommen hat, unter Umständen in einer Konfliktsituation bei der Frage, ob er beispielsweise das Wort zu erteilen hat, obwohl er die Erklärung - wäre ihm die Entscheidung auferlegt worden - abgelehnt hätte. Neben ihrer Funktion als Stellvertreter des Landtagspräsidenten sind die Vizepräsidenten schließlich von Amts wegen Mitglieder des Ältestenrats und in Rheinland-Pfalz auch gem. § 85 I GOLT-RP des Zwischenausschusses, dessen Aufgabe darin besteht, in der „parlamentslosen" Zeit vom Ablauf der Wahlperiode oder von der Auflösung an bis zum Zusammentritt des neuen Landtags die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung zu wahren.
2. Die Schriftführer a) Anzahl und Stellung der Schriftführer Die Stellung der Schriftführer im Gefüge des Parlaments ist weder eine eminent politische noch eine repräsentative. Sie haben aus eigenem Recht heraus keine dem Landtag zuzurechnende Entscheidungsgewalt und nehmen damit nur die Position eines Hilfsorgans ein 77 . Ihr Wirken hat zumeist den Charakter schlichten innerparlamentarischen Handelns ohne Regelungsgehalt78. 75 Troßmann, § 8, Rn. 3. 76 Ebenda. 77 Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 1. 78 Achterberg, S. 758. 5*
68
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Die Anzahl der Schriftführer schwankt zwischen jeweils 2 in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein79 und 15 in Baden-Württemberg 80. Dazwischen liegen das Saarland mit 3, Hamburg mit 4, Bayern mit 6, Niedersachsen mit 10, Sachsen-Anhalt mit 12 und schließlich Rheinland-Pfalz und Thüringen mit jeweils 14 Schriftführern 81. In den Ländern, in denen die Zahl nicht durch Gesetz oder Geschäftsordnung festgelegt worden ist, wird die Anzahl der Schriftführer durch Beschluß des Parlaments 82 oder des Präsidiums 83 bestimmt; sie entspricht der Schlüsselstärke der jeweiligen Fraktion 84 . Das gleiche gilt gem. § 3 Satz 1 GOBT für den Bundestag.
b) Das Aufgabenfeld der Schriftführer „Die Schriftführer unterstützen den Präsidenten" 85. Diese in nahezu allen Geschäftsordnungen niedergelegte Generalklausel läßt sich bis zur Geschäftsordnung der Zweiten Kammer des Preußischen Landtags - dort in § 13 I festgehalten zurückverfolgen. Bis zur Geschäftsordnung des Reichstags von 1922 hatten die Schriftführer „den Präsidenten in der Besorgung der äußeren Angelegenheiten (der Kammer, des Hauses, des Reichstages) zu unterstützen". In § 21 der Geschäftsordnung des Reichstages von 1922 wurde den Schriftführern die Aufgabe zugewiesen, die „äußeren Angelegenheiten des Reichstags nach Weisung des Präsidenten zu besorgen" 86. Soweit die Schriftführer nicht dem Präsidium angehören und dem damit einhergehenden Pflichtenkreis unterfallen, beschränkt sich die den Präsidenten unterstützende Tätigkeit vornehmlich auf die Plenarsitzungen, deren ordnungsgemäße Abwicklung ohne Mitarbeit der Schriftführer nur schwerlich vorstellbar wäre. Sie umfaßt dabei üblicherweise die allgemeine Beobachtung des Ablaufs der Sitzung, die Beachtung der Vorschriften der Geschäftsordnung, Entgegennahme von Wortmeldungen, Feststellung der Namen von Fragestellern, Zwischenrufern oder Ruhestörern 87. Daneben sehen die Geschäftsordnungen noch eine Reihe weiterer Auf79 § 3 I 1 GOLT-MV; § 3 I 1 GOLT-SH. so § 4 VIII GOLT-BW. 81 § 33 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 2 II GOBü-Ha; § 8 Satz 1 GOLT-By; § 5 I 1 GOLT-Nds; § 7 I 1 GOLT-SA; § 1 IV GOLT-RP; § 1 IV GOLT-Th. 82 Vgl. z. B. § 4 II GOLT-He; § 3 IX GOLT-Ss. 83 § 16 II GOLT-Bg. Das Präsidium besteht hier aus dem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und „weiteren Mitgliedern", deren Zahl durch Beschluß des Landtags bestimmt wird. 84
Vgl. Grosse-Sender, in: Schneider/Zeh, § 64, Rn. 11.
85 § 14 I GOLT-By; § 16 I GO-Be; § 16 III GOLT-Bg; § 12 I GOLT-BW; § 7 I GOBü-Ha; § 5 I GOLT-MV; § 14 I GOLT-NRW; § 7 Satz 2 GOLT-RP; § 7 II GOLT-SA; § 6 I GOLT-SH; § 36 I Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 7 I GOLT-Ss; § 7 Satz 2 GOLT-Th. 86 Zitiert nach Ritzel/Bücker, § 9, S. 1. 87 Vgl. Ritzel /Bücker, § 9, Anm. 1 b, S. 1.
I. Die Zusammensetzung des Präsidiums
69
gaben der Schriftführer vor, deren Auflistung ebenfalls auf die Geschäftsordnung der Zweiten Kammer des Preußischen Landtags zurückgeht. Demzufolge haben die Schriftführer die Rednerliste zu führen und die Einhaltung der Redezeit zu überwachen. Sie unterzeichnen - zusammen mit dem Präsidenten - das amtliche Protokoll, das über jede Sitzung des Landtags geführt wird und in das die gefaßten Beschlüsse, aber auch beispielsweise die Amtsübernahme durch den Parlamentspräsidenten, die Vereidigung der Regierungsmitglieder sowie Regierungserklärungen aufgenommen werden 88. Dem Protokoll werden die entsprechenden Drucksachen mit den von den Schriftführern darauf vermerkten Beschlüssen als Bestandteile angeheftet. Teilweise sind sie zudem für die Korrektur der Plenarprotokolle zuständig89. Darüber hinaus ist es ihre Aufgabe, bei Wahlen und Abstimmungen die Namen der Abgeordneten aufzurufen, für die Stimmabgabe zu sorgen und im Anschluß daran die Stimmen zu sammeln und zu zählen. Diese Tätigkeit bildet die Grundlage für die Verkündung der Ergebnisse durch den Präsidenten. Zu den Funktionen der Schriftführer gehört auch die Verlesung aller Schriftstücke, soweit dies der Präsident wegen der Bedeutung oder auch der Einfachheit halber nicht selbst macht 90 . Schließlich sind die Schriftführer ganz allgemein zur Unterstützung des Präsidenten bei der Besorgung der Angelegenheiten des Landtags berufen. Wie der Präsident diese Mitarbeit in Anspruch nimmt, bleibt ihm selbst überlassen; er verteilt die Geschäfte und regelt den Dienst der Schriftführer in jeder Hinsicht 91 . In der heutigen parlamentarischen Praxis werden jedoch nicht mehr alle der o. g. Funktionen von den Schriftführern wahrgenommen. De facto obliegt ihnen heute lediglich die Führung der „Rednerliste", der Namensaufruf und das Einsammeln und Auszählen der Stimmzettel, alles andere ist entweder obsolet oder wird inzwischen von der Verwaltung erledigt 92 . Nebenbei sei bemerkt, daß die in den Geschäftsordnungen gebrauchte Formulierung „Führung der Rednerliste" irreführend ist 93 . Die Schriftführer halten lediglich fest, von wann bis wann die einzelnen Redner gesprochen haben. Sie nehmen zwar die Wortmeldungen entgegen, die eigentliche Rednerliste wird jedoch vom Präsidenten aufgrund der Wortmeldungen geführt, wobei er die Reihenfolge der Redner bestimmt94. Wenn in einer Sitzung nicht die erforderliche Zahl von Schriftführern zur Verfügung steht, so ist der Präsident in einem derartigen Bedarfsfall berechtigt, aus der Zahl der anwesenden Mitglieder des Hauses nach eigenem Ermessen Vertreter zu 88 Vgl. z. B. § 87 Satz 1 GO-Be; § 145 I 1 GOLT-By; § 111 I GOLT-He; § 107 I GOLTNRW. 89 Vgl. z. B. § 7 II 1 GOLT-SA. 90 Gerlach, S. 89. 91 92 93 94
Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 226. So Gundelach, S. 327. Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 225. Ritzel /Bücker, § 9, Anm. 2, S. 1.
70
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
ernennen 95. In der Praxis wird als Bedarfsfall, der die Ernennung weiterer stellvertretender Schriftführer durch den Präsidenten erforderlich macht, auch der Fall angesehen, daß zwar noch ein Schriftführer und ein stellvertretender Schriftführer anwesend sind, diese jedoch der gleichen Fraktion angehören96. Der Präsident ernennt auch den weiteren Schriftführer im Bedarfsfalle auf Vorschlag derjenigen Fraktion, die den von ihm zu vertretenden Schriftführer benannt hatte. Ein ernannter stellvertretender Schriftführer hat durch diese Ernennung für die Dauer der Vertretung die gleichen Rechte und Pflichten wie die gewählten Schriftführer. Die Ernennung macht ihn zwar zum vorübergehenden Mitglied im „amtierenden Sitzungsvorstand" des Parlaments, jedoch wird er dadurch nicht zugleich auch zum Präsidiumsmitglied, sofern die Schriftführer diesem Gremium überhaupt angehören.
II. Das Wahlverfahren Nach der eingangs geschilderten Wahl des Parlamentspräsidenten erfolgt die seiner Stellvertreter. Die Trennung dieser beiden Wahlhandlungen ergibt sich zwangsläufig schon daraus, daß der Alterspräsident nur die Wahl des Präsidenten und der neu gewählte Präsident sodann die Wahl der Vizepräsidenten leitet. Hierbei lassen die entsprechenden Geschäftsordnungsvorschriften, nach denen Präsident und Stellvertreter „in getrennten Wahlgängen"97 gewählt werden, allerdings offen, ob auch die Vizepräsidenten in separaten Wahlgängen ermittelt werden müssen. Die in den meisten Wahlverfahren vorgesehene Prozedur der Stichwahl legt die Annahme getrennter Wahlgänge eigentlich nahe98, da sie einen Wahlsieger aus mehreren Kandidaten ermitteln soll. Es ist hingegen auch denkbar, die gemeinsame Wahl mit mehreren Stichwahlen für diejenigen Bewerber zu verbinden, die die absolute Mehrheit nicht erreicht haben, so daß dieses Ergebnis nicht zwingend ist 99 . Ausschließlich in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stellt der Wortlaut der Geschäftsordnungen klar, daß die Vizepräsidenten grundsätzlich einzeln, d. h. in besonderen Wahlgängen, ermittelt werden. Nur wenn kein anwesendes Mitglied des Landtags widerspricht, können sämtliche Stellvertreter „in einem Wahlgang" gewählt werden 100 . 95 § 14 II GOLT-By; § 16 II GO-Be; § 12 II GOLT-BW; § 7 II GOBü-Ha; § 5 II GOLTMV; § 6 II GOLT-RP; § 6 II GOLT-SH; § 36 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 7 II GOLT-Ss; § 6 II GOLT-Th; 67 I 2 GOLT-Nds. Lediglich in Nordrhein-Westfalen ist gem. § 14 III GOLT für die Übertragung der Aufgaben der Schriftführer auf andere Abgeordnete die „Zustimmung des Hauses" erforderlich. 96 Lemke, § 6, S. 17. 97 § 4 VI GOLT-BW; § 3 II GOLT-He; § 4 III 1 GOLT-SA; § 2 I GOLT-RP; § 5 III 1 GOLT-Nds; § 3 I 1 GOLT-SH; § 11 I 1 GOLT-Bg; § 2 III 1 GOBü-Ha; § 3 I 2 GOLT-MV. 98 § 74 IV GO-Be; § 4 IV 3 GOLT-BW; § 9 I 3 GOLT-He; § 3 IV 3 GOLT-Ss; § 2 II 3 GOLT-RP; § 1 V 2 GOLT-SH; § 2 III 3 GOBü-Ha; § 1 V 2 GOLT-MV; § 48 Satz 2 GOLT-By. 99 Edinger, S. 168 f.
II. Das Wahlverfahren
71
Das Vorschlagsrecht für das Amt des Vizepräsidenten orientiert sich - wie bei der Präsidentenwahl - an dem Stärkeverhältnis der im Landtag vertretenen Fraktionen, wobei die Zahl der auf eine Fraktion entfallenden Wahlvorschläge zum Teil nach dem Höchstzahlverfahren ermittelt wird, so in Niedersachsen gem. § 5 ΙΠ 2 GOLT-Nds und Sachsen-Anhalt gem. § 4 Π 2 GOLT-SA. Dementsprechend schlagen in Niedersachsen die Fraktionen, auf die nach jenem Verfahren die zweite bis fünfte Höchstzahl entfällt, je Höchstzahl ein Mitglied des Landtags für die Wahl zum Vizepräsidenten vor. Überdies hat jede Fraktion, die nach dem Höchstzahlverfahren nur das Vorschlagsrecht für Schriftführer hat, die Möglichkeit, einen Abgeordneten statt für die Wahl zum Schriftführer für die Wahl zu einem zusätzlichen Vizepräsidenten vorzuschlagen 101. In der Praxis wird es in diesem Zusammenhang als zulässig angesehen, daß eine Fraktion zugunsten einer anderen auf ihr Vorschlagsrecht verzichtet 102 . Die Wahlvorschläge werden in ständiger Übung mündlich in das Plenum eingebracht 103 . Dabei ist es grundsätzlich nicht erforderlich, daß das Einverständnis des Vorgeschlagenen zu dem Wahlvorschlag vor der Wahl vorliegt; die Erklärung, ob ein Gewählter die Wahl annimmt oder ablehnt, ist prinzipiell erst nach der Wahl abzugeben104. Gleichwohl darf niemand gegen seinen Willen zur Kandidatur gezwungen werden. Weder die parlamentarische Übung, wonach die Wahl durch die Fraktionen beeinflußt wird, noch der Umstand, daß es bei der Wahl um einen Akt der Selbstorganisation eines Verfassungsorgans handelt, rechtfertigt einen Wahlvorschlag, bei dem das Einverständnis eines Kandidaten verweigert worden ist 1 0 5 . Die Wahl der Vizepräsidenten erfolgt ohne Aussprache und in geheimer Abstimmung, also mit Stimmzetteln 106 . Soweit kein Widerspruch durch ein anwesendes Mitglied des Landtags erfolgt, kann mitunter auch durch Handzeichen gewählt werden 107 . Im übrigen wird die Wahl der Vizepräsidenten vom Grundsatz her in der gleichen Art und Weise durchgeführt wie die vorhergehende Wahl des ioo Vgl. § 5 III 2 GOLT-Nds; § 4 III 2 GOLT-SA. Die in Niedersachsen sonst gängige Verfahrensweise, alle Vizepräsidenten in einem Wahlgang zu wählen, wurde in der 13. Wahlperiode durch einen Widerspruch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterbrochen, vgl. Sten. Ber., 13. WP, 1. Sitzung vom 23. 6. 1994, S. 15. ιοί § 5 II 3 GOLT-Nds. io: Vgl. Zinn/Stein, Art. 84 LV-He, Anm. 1. 103 Vgl. Troßmann, § 2, Rn. 2.1. 104 Troßmann, § 2, Rn. 2.2. 105 Ritzel /Bücker, § 2, Anm. I 1 c, S. 2. 106 § 2 I GOLT-RP; § 2 I 2 GOBü-Ha; § 3 I 2 GOLT-MV; § 3 I GOLT-SH; § 2 I GOLT-Th; § 5 III 1 GOLT-Nds; § 4 II 1 GOLT-BW; § 3 II GOLT-He; § 8 II 1 GOLT-NRW; § 3 III 1 GOLT-Ss; § 4 III 1 GOLT-SA. 107 Vgl. ζ. B. § 3 II GOLT-He; § 5 III 2 GOLT-Nds; § 4 III 2 GOLT-SA. In Niedersachsen ist die Wahl der Vizepräsidenten durch Handzeichen die übliche Verfahrensweise, vgl. Sten. Ber., 12. WP, 1. Sitzung vom 21. 6. 1990, S. 12; 13. WP, 1. Sitzung vom 23. 6.1994, S. 15.
72
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Präsidenten 108. Das Wahlverfahren ist also ebenfalls in mehrere Wahlgänge aufgebaut, einschließlich der Stichwahl und dem abschließenden Losentscheid109. Gewählt ist, wer die „Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen" 110 auf sich vereint hat. Die Bestimmungen des Wahlverfahrens mit den entsprechenden Mehrheitserfordernissen sind nicht nur ein Rettungsanker für „Schlechtwetterzeiten", sondern dienen darüber hinaus allgemein dazu, dem Präsidenten und seinen Stellvertretern als Repräsentanten der Volksvertretung einen breiten Rückhalt im Hause zu verschaffen, indem sie alle Seiten zur Kompromißbereitschaft und Mäßigung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte - sei es Vorschlag oder Ablehnung eines Kandidaten zwingen 111 . In der parlamentarischen Praxis gibt es selten Unstimmigkeiten bei der Aufstellung der Kandidaten für das Amt der Vizepräsidenten, da der Wahl in aller Regel interfraktionelle Absprachen und Vereinbarungen vorausgehen 112. Dementsprechend ist es parlamentarischer Brauch, den Präsidenten und seine Stellvertreter einstimmig zu wählen 113 . In diesem Verhalten ist der Ausdruck prinzipieller Bereitschaft der Abgeordneten zu sehen, den jeweils amtierenden Präsidenten als Sprecher des ganzen Hauses anzuerkennen. In diesem Sinne ist auch die in Nordrhein-Westfalen bis zur 7. Wahlperiode feststellbare Übung zu interpretieren, daß im Plenum der Wahlvorschlag für das Amt des Präsidenten vom Führer der zweitstärksten Fraktion, der Wahlvorschlag für die Vizepräsidenten vom Führer der stärksten Fraktion eingebracht wurde 114 . Selbstverständlich ist auch die Nichtwahl eines Kandidaten für ein Präsidiumsamt möglich und gleichfalls Rechtens, parlamentsgeschichtlich ist sie aber eine Rarität. So ist beispielsweise im Berliner Abgeordnetenhaus nur ein einziger Fall dieser Art bekannt: 1983 und 1984 ist ein Personalvorschlag der AL-Fraktion für einen Beisitzer in drei Wahlgängen durchgefallen, weil die Person des Kandidaten den anderen Fraktionen als nicht wählbar erschien 115. Sollte entgegen jeder Regel in der konstituierenden Sitzung die Situation eintreten, daß weder der Präsident noch einer seiner Stellvertreter gewählt werden, so obliegt die Wahrnehmung der Funktionen weiterhin dem Alterspräsidenten 116. io» Vgl. dazu den Wortlaut des § 3 VI GOLT-Ss: „Die Vizepräsidenten werden nach demselben Verfahren wie der Präsident gewählt". 109 Vgl. die Darstellung des Wahlverfahrens auf S. 5 ff. no § 4 IV GOLT-BW; § 9 II GOLT-He; § 4 IV GOLT-SA; § 2 II 1 GOLT-RP; § 1 V 1 GOLT-SH; § 2 II GOLT-Th; § 5 IV GOLT-Nds; § 915 GOLT-By; § 1 V GOLT-MV. in Gundelach, S. 322. 112 Vgl. Troßmann, § 2, Rn. 1.2. 113 Dierl, S. 150. 114 Ebenda. 115 Nauber, S. 114. Vgl. hierzu auch die Wahl der Vizepräsidenten des Bundestags am 26. 10. 1998, bei der die Abgeordnete Geiger (CSU) ihrer direkten Gegenkandidatin von der PDS unterlegen war, Sten. Ber., 14. WP, 1. Sitzung, S. 18. 116 Vgl. Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 1.
III. Der Verlauf der Präsidiumssitzungen
73
Die Schriftführer bzw. die weiteren Mitglieder des Präsidiums werden nach der Wahl des Parlamentspräsidenten und seiner Stellvertreter im allgemeinen in einem einzigen Wahlgang aufgrund eines auf interfraktioneller Vereinbarung beruhenden gemeinsamen Vorschlags der Fraktionen gewählt 117 . Kommt ein derartiger Vorschlag nicht zustande, bestimmt sich die Wahl hilfsweise nach dem Stärkeverhältnis der einzelnen Fraktionen 118 . Teilweise wird auch von Beginn an nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt 119 , mitunter auf Zuruf 120 . Das Präsidium ist zugleich mit der Annahme der Wahl durch den Präsidenten und seine Stellvertreter gebildet, sofern es nur aus diesen besteht, im übrigen erst, wenn auch die Schriftführer bzw. die weiteren Mitglieder gewählt sind 121 . Die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten, der Schriftführer und gegebenenfalls der weiteren Mitglieder erfolgt jeweils für die Amtszeit bzw. für den Rest der Amtszeit des Parlaments.
I I I . Der Verlauf der Präsidiumssitzungen Nicht allein im Interesse des parlamentarischen Grundkonsenses hat sich in den meisten Landesparlamenten der Brauch entwickelt, in jeder Sitzungswoche des Landtags eine Sitzung des Präsidiums durchzuführen. In aller Regel finden diese am Tag vor der regelmäßigen Sitzung des Ältestenrats statt 122 . Die Sitzungen des Präsidiums werden von dem Präsidenten unter Berücksichtigung einer angemessenen Frist 123 einberufen 124. Der Landtagspräsident ist zur Einberufung des Präsidiums verpflichtet, wenn dies von einer bestimmten Anzahl der Mitglieder verlangt wird, mitunter in Form eines schriftlichen Antrags 125 unter Angabe des Zwecks 126 oder des Beratungsgegenstandes, sofern die Beratung des Gegenstandes zulässig ist 1 2 7 . in § 2 IV GOBü-Ha; § 4 II GOLT-He; § 8 III 1 GOLT-NRW; § 3 Satz 1 GOLT-RP; § 3 Satz 1 GOLT-Th; § 7 I 1 GOLT-SA. us § 8 III 2 GOLT-NRW; § 3 Satz 2 GOLT-RP; § 7 I 2 GOLT-SA; § 3 Satz 2 GOLT-Th. 119 § 11 iVm. § 12 I 2 GO-Be; § 101 1 GOLT-Bg; § 8 II 1 GOBü-Br; § 4 VIIIGOLT-BW; § 91 2 GOLT-By; § 5 II 2 GOLT-Nds; § 3 I 2 iVm. § 9 II 1 GOLT-Ss. 120 § 741 1 GO-Be. 121 Vgl. Achterberg, S. 191. ι 2 2 So die Auskunft der Verwaltung des Niedersächsischen Landtags gegenüber dem Verfasser. 123 § 11 I 1 GOLT-By. 124 § 11 I 1 GOBü-Br; § 14 I GOLT-Bg; § 8 Satz 1 GOBü-Ha; § 4 II 1 GOLT-Th; § 92 I iVm. § 97 GOLT-Nds; § 301 GOLT-Sl; § 13 Satz 1 GOLT-NRW; § 47 I 1 GOLT-He; § 14 I 1 GOLT-BW; § 13 IV 1 GO-Be. 125 § 14 II GOLT-Bg. 126 § 11 12 GOLT-By. 127 § 92 II iVm. § 97 GOLT-Nds. Die Zulässigkeit des Beratungsgegenstandesrichtetsich nach § 12 GOLT-Nds.
74
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Das Verlangen zur Einberufung muß in einigen Ländern von einem Fünftel 128 bzw. einem Drittel 1 2 9 der Mitglieder getragen sein, in anderen Ländern spricht die Geschäftsordnung von zwei 1 3 0 bzw. drei 1 3 1 Mitgliedern, in Baden-Württemberg wird auch das Begehren von zwei Fraktionen des Landtags als ausreichend angesehen 1 3 2 . Im Hinblick auf die Präsidiumssitzung legt der Landtagspräsident die Tagesordnung fest 133 und fügt sie der schriftlichen Einberufung bei 1 3 4 . Inhaltlich geht es in den Sitzungen nicht nur um Fragen, die sich auf das parlamentarische Geschehen - ob zurückliegend oder bevorstehend - bzw. auf die Verwaltung beziehen, sondern insbesondere auch um Fragen organisatorischer Natur. Demzufolge wird etwa über Urlaubsvertretungen, Auslands- und Dienstreisen von Mitgliedern des Präsidiums, Teilnahme an besonderen Veranstaltungen des Landtags und verschiedener Organisationen diskutiert, ebenso wie über die Einteilung der Leitung der Plenarsitzungen 135. Für einen würdigen und ordnungsgemäßen Ablauf der Plenarsitzungen ist zudem die einheitliche Handhabung des Ordnungsrechts von besonderer Bedeutung. Hierüber kann in den Sitzungen des Präsidiums mit dem Ziel einer gleichmäßigen Handhabung gesprochen werden. Dies trifft gleichfalls auf Maßnahmen des Hausrechts und der Polizeigewalt zu. Im Rahmen des Präsidiums hat der Landtagspräsident die Möglichkeit, diesbezügliche Entscheidungen mit den Stellvertretern weitgehend abzustimmen und damit auch die Meinungen der Fraktionen zu berücksichtigen. Obwohl die Mitglieder des Präsidiums keine Beauftragten der Fraktionen sind, können sie aufgrund ihrer Stellung bis zu einem gewissen Grade als Vermittler der Meinungsbildung in ihren Fraktionen angesehen werden 136 . Dadurch erhalten Vorschläge und Entscheidungen des Präsidiums eine breitere Absicherung und eine stärkere Geltungskraft, insbesondere dann, wenn sie noch vom Ältestenrat behandelt werden können oder 137
müssen . Schließlich sind in den Präsidiumssitzungen auch kritische Anmerkungen über Entscheidungen und Maßnahmen eines sitzungsleitenden Präsidenten in einem Einzelfall nicht ausgeschlossen. Auch in dieser Hinsicht kann es zweckmäßig sein, im Vorfeld einer Sitzung des Ältestenrats, ebensogut auch im nachhinein zwecks Folgerungen aus einer dort geführten Diskussion, derartige Fragen im Präsidium zu besprechen. 128 § 14 II GOLT-Bg; § 6 V 1 GOLT-Ss. 129 § 92 II iVm. § 97 GOLT-Nds; § 30 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 130 § 8 Satz 2 GOBü-Ha. 131 § 13 IV 2 GO-Be; § 111 2 GOLT-By; § 14 II 1 GOLT-BW. 132 § 14 II 1 GOLT-BW. 133 § 4 II 1 GOLT-Th; § 141 1 GOLT-BW. 134 § 11 I 1 GOLT-By. 135 Vgl. Edinger, S. 165. 136 So Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 30. 137 Edinger, S. 165.
III. Der Verlauf der Präsidiumssitzungen
75
Der Landtagspräsident sitzt den Besprechungen des Präsidiums vor; ihm obliegt damit die Funktion, die Beratungen dieses Gremiums zu leiten 138 . Er bekleidet die Rolle des Moderators, ist also bemüht, parteipolitsch neutral und ausgleichend zu wirken und nicht zu polarisieren. Zur Wahrung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzungen stehen ihm die Vorschriften, die auch für die Vollversammlungen des Landtags gelten, entsprechend zur Seite 139 . Er erteilt das Wort, entzieht es nötigenfalls und kann von allen ihm nach der Geschäftsordnung zur Verfügung stehenden Ordnungsmaßnahmen Gebrauch machen. Die Präsidiumssitzungen finden unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt 140 und sind grundsätzlich vertraulich, sofern nicht mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder etwas anderes beschlossen wurde 141 . Über die regulären Präsidiumsmitglieder hinaus können auch weitere Mitglieder des Landtags hinzugezogen werden, die an den Besprechungen mit beratender Stimme teilnehmen 142 . Zum Teil ist für die Hinzuziehung ein besonderer Präsidiumsbeschluß erforderlich 143, zum Teil haben bestimmte Funktionsträger - wie beispielsweise in Hessen gem. § 47 ΠΙ GOLT die Fraktionsvorsitzenden und parlamentarischen Geschäftsführer - allein kraft ihres Amtes beratende Stimme. In aller Regel nimmt zudem der Direktor beim Landtag an den Sitzungen des Präsidiums teil 1 4 4 . Für die regulären Präsidiumsmitglieder besteht keine Vertretungsmöglichkeit 145. Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder 146 bzw. deren Mehrheit 147 anwesend ist. Mitunter wird auch nur die Präsenz von mindestens drei 1 4 8 bzw. vier 1 4 9 Präsidiumsmitgliedern verlangt. Hingegen werden die Beschlüsse des Präsidiums selbst regelmäßig mit einfacher Mehrheit gefaßt 150 . Sofern das Präsidium als Kollegialorgan handelt, kommt dem Landtagspräsidenten nur die Stellung eines primus inter pares zu, insbesondere hat er bei Kollegiales § 11 I 1 GOBü-Br; § 141 GOLT-Bg; § 4 II 1 GOLT-Th; § 301 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 13 Satz 1 GOLT-NRW; § 47 I 1 GOLT-He; § 11 I 1 GOLT-By; § 14 I 1 GOLT-BW; § 14 III 1 GO-Be. 139 § 96 iVm. § 97 GOLT-Nds. 140 § 93 I iVm. § 97 GOLT-Nds; § 6 VII 1 GOLT-Ss. 141 § 47 V GOLT-He. Nach § 93 IV iVm. § 97 GOLT-Nds dürfen Beratungsgegenstand und -ergebnis nichtöffentlicher Sitzungen der Presse mitgeteilt werden. Das gilt jedoch nicht für die Äußerungen einzelner Teilnehmer oder das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder. 142 § 93 II iVm. § 97 GOLT-Nds. 143 § 6 VII 2 GOLT-Ss. 144 § 14 III 1 GOLT-BW; § 6 VI 1 GOLT-Ss. 145 § 11 13 GOLT-By. 146 § 6 V 2 GOLT-Ss; § 11 II 1 GOLT-By; § 14 II 2 GOLT-BW. 147 § 14 III GOLT-Bg; § 4 II 2 GOLT-Th; § 30 III Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 13 Satz 2 GOLT-NRW; § 47 I 2 GOLT-He. 148 § 11 12 GOBü-Br. 149 § 8 Satz 3 GOBü-Ha. 150 § 11 I 2 GOBü-Br; § 47 I 3 GOLT-He; § 11 II 2 GOLT-By.
76
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
entscheidungen nur eine Stimme 151 . Bei Stimmengleichheit allerdings gibt die Stimme des Präsidenten in der Regel den Ausschlag 152 . Im übrigen kann der Präsident einen Beschluß des Präsidiums in dringenden Angelegenheiten auch über eine schriftlich übermittelte Vorlage herbeiführen 153. Der Beschluß kommt zustande, sobald die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Präsidiums vorliegt, falls nicht mindestens ein Drittel der Mitglieder der schriftlichen Beschlußfassung innerhalb der von dem Präsidium angegebenen Frist, die mindestens fünf Tage betragen soll, widerspricht. Über die Verhandlungen des Präsidiums werden Protokolle angefertigt. Diese Niederschriften müssen die Namen der Anwesenden, den wesentlichen Inhalt des Verhandlungsverlaufs und die gefaßten Beschlüsse wiedergeben 154, unter Umständen müssen sie überdies die Gründe für jene Beschlüsse enthalten155. Die Protokolle werden in der Regel von dem Direktor beim Landtag erstellt 156 . Im Anschluß an die Fertigstellung sind sie von dem Landtagspräsidenten zu unterzeichnen 157. In einigen Parlamenten wird darüber hinaus noch eine weitere Unterschrift verlangt, die entweder von einem Vizepräsidenten 158, einem Schriftführer 159 oder aber von dem Protokollführer selbst 160 geleistet wird.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums Das Präsidium des Bundestages war in seiner Anfangszeit nahezu funktionslos. Die Geschäftsordnung von 1952 wies diesem Gremium in § 117 ΙΠ nur die sehr bescheidene Aufgabe zu, über die Verwahrung der Tonbandaufnahmen von Plenarsitzungsberichten im Archiv zu entscheiden. Erst im Zuge der Parlamentsreform wurden dem Präsidium weitergehende Aufgaben übertragen 161. Einen ähnlichen Kompetenzzuwachs haben auch die Präsidien der Länderparlamente erfahren. Das Aufgabenspektrum nach heutigem Geschäftsordnungsrecht ist weitaus breiter gefächert. Es reicht von der traditionellen Bildung des Sitzungsvorstands und der 151 Köhler, in: BayVBl. 1988, 33 (34). 152 § 11 I 3 GOBü-Br; § 47 14 GOLT-He. 153 § 47 II GOLT-He. 154 § 11 II GOBü-Br; § 4 II 3 GOLT-Th; § 95 I 1, 2 iVm. § 97 GOLT-Nds; § 13 Satz 3 GOLT-NRW; § 6 I V 2 GOLT-Ss; § 47 IV 1 GOLT-He; § 14 III 2 GOLT-BW. 155 § 13 Satz 3 GOLT-NRW. 156 § 6 VI 2 GOLT-Ss; § 14 III 2 GOLT-BW. 157 § 6 VI 2 GOLT-Ss; § 14 III 2 GOLT-BW. 158 § 4 II 4 GOLT-Th. 159 § 13 Satz 4 GOLT-Th. 160 § 47 IV 2 GOLT-He. 161 Beschluß des Bundestages vom 5. 11. 1969 in der Fassung der Bekanntmachung über Änderungen der Geschäftsordnungen des Deutschen Bundestages vom 10. 11. 1969.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
77
damit verbundenen Unterstützung des Präsidenten bei der Sitzungsleitung über rein verwaltungsbezogene Aufgaben, insbesondere der Feststellung des Haushaltsplanentwurfs für das Parlament, der Mitwirkung bei der Ernennung oder Entlassung der Landtagsbediensteten und einer Vielzahl von Funktionen, die eher im organisatorischen Bereich angesiedelt sind, bis teilweise hin zur Überwachung des Verhaltens der Abgeordneten nach bestimmten Verhaltensregeln.
1. Bildung des Sitzungsvorstands Die wesentliche und nach außen sichtbare Aufgabe der Mitglieder des Präsidiums besteht darin, in den Vollversammlungen des Parlaments den Sitzungsvorstand zu bilden, der im Bund und in den meisten Ländern aus dem amtierenden Präsidenten 162 und den diensthabenden Schriftführern besteht 163 . Die Schriftführer können selbst keine Leitungsfunktionen ausüben, sondern den Präsidenten lediglich bei der Leitung der Sitzungen unterstützen 164. Der Sitzungsvorstand trägt in Berlin die Bezeichnung: das „amtierende Präsidium", in Nordrhein-Westfalen und Bayern: das „geschäftsführende Präsidium" und in Brandenburg, MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein: das „Sitzungspräsidium" 165. Der Begriff „Sitzungsvorstand" wurde erstmals in § 15 der Geschäftsordnung des Reichstags von 1922 verwendet. Dem in § 14 normierten Vorstand des Reichstags wurde damit begrifflich der Sitzungsvorstand entgegengesetzt. Zuvor fand die Bezeichnung „Bureau" als Name für die Vereinigung des Präsidenten und aller Schriftführer - auch auf den während der Sitzung amtierenden Präsidenten und die diensttuenden Schriftführer - Anwendung 166 . Damals wie heute ist die Aufgabe des SitzungsVorstands doppelt ausgerichtet. Zum einen obliegt ihm bei Abstimmungen im Plenum die Feststellung des Ergebnisses167. Zum anderen hat er über die Beschlußfähigkeit des Hauses zu entscheiden, soweit diese angezweifelt wird 1 6 8 und soweit diese Funktion nicht dem Präsidenten allein vorbehalten ist 1 6 9 . Bejaht der Sitzungsvorstand einmütig die Be162 Präsident im Sinne der Geschäftsordnung sind bei der Leitung der Sitzungen auch die diensttuenden Stellvertreter des Präsidenten. ι « § 12 I 1 GOLT-BW; § 4 I GOLT-He; § 5 I GOLT-Ss; § 67 I 1 GOLT-Nds; § 6 I GOLTTh; § 6 I GOLT-RP; § 58 I 1 GOLT-SA. im Vgl. zu den Aufgaben der Schriftführer S. 56 ff. 165 § 12 II GO-Be; § 9 GOLT-NRW; § 129 II 1 GOLT-By; § 16 I GOLT-Bg; § 3 II GOLTMV; § 4 GOLT-SH. 166 Vgl. Perei s, S. 15, Fn. 65. 167 Vgl. z. B. § 40 II GOLT-Th. In Bremen wird das Abstimmungsergebnis nicht vom Sitzungsvorstand festgestellt, sondern vom Bürgerschaftspräsidenten und seinen Stellvertretern, § 57 II GOBü-Br.
16« Vgl. z. B. § 41 V GOLT-Th. 169 So etwa in Baden-Württemberg
gem. § 80 I 1 GOLT-BW.
78
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
schlußfähigkeit des Parlaments, so hat dies zur Folge, daß eine exakte Stimmenzählung unterbleibt und die Anzweifelung gegenstandslos wird. Der Sitzungsvorstand kann somit ungerechtfertigten Anzweifelungen die Wirkung nehmen und zeitraubende Auszählungen vermeiden. Ein genaues Auszählungsverfahren wird also nur für den Fall in Gang gesetzt, daß der Sitzungsvorstand nicht einmütig ist oder daß er die Beschlußfähigkeit einmütig bejaht. Ob im Sitzungsvorstand Einmütigkeit über die Beschlußfähigkeit bzw. das Ergebnis der Abstimmung vorherrscht oder nicht, wird nicht durch Beschluß ermittelt, sondern ist eine reine Tatsachenfeststellung, aus der die in der Geschäftsordnung niedergelegten Folgen zu ziehen sind 1 7 0 . Im Rahmen derartiger Entscheidungen sind die Stimmen der Schriftführer und die des Präsidenten von gleichem Rang 171 . Abweichend von den beiden oben genannten traditionellen Funktionen des Sitzungsvorstandes besteht in Schleswig-Holstein die Aufgabe des Sitzungspräsidiums darin, die in den Einzelberatungen gefaßten Beschlüsse für die Schlußabstimmung zusammenzustellen172. Ist in den Landtagsgeschäftsordnungen kein Sitzungsvorstand vorgesehen, so werden die entsprechenden Tätigkeiten durch den Präsidenten selbst wahrgenommen, mitunter in Zusammenarbeit mit den Vizepräsidenten 173. Der Sitzungsvorstand ist kein Organ des Parlaments. Diese Einordnung ist darauf zurückzuführen, daß ihm die Geschäftsordnungen keine eigenen besonderen Aufgaben übertragen haben, deren Durchführung dem Landtag zugerechnet werden könnten 174 . Insbesondere kann weder aus der Vorschrift über die Feststellung der Abstimmungsergebnisse noch aus der Entscheidungsbefugnis über die Beschlußfähigkeit des Plenums eine Kollegialbefugnis des Sitzungsvorstandes als Organ hergeleitet werden 175 . Soweit die Geschäftsordnungen also von „Sitzungsvorstand" sprechen, ist dies lediglich eine Kollektivbezeichnung für den diensttuenden Präsidenten und die beiden diensttuenden Schriftführer 176. Die jeweilige Einteilung zur Leitung der Plenarsitzungen sowie die personelle Besetzung des Sitzungsvorstandes wird in den Sitzungen des Präsidiums festgelegt. In der Geschäftsordnung der Zweiten Kammer des Preußischen Landtags und in der Geschäftsordnung des Reichstags des Norddeutschen Bundes war die Vertretung durch die Reihenfolge der Erwählung geregelt. Durch Beschluß des Reichstags vom 7. 6. 1918 wurde dann erstmals die einvernehmliche Vertretung eingeführt 177 . Auch heute noch bestimmt der Präsident in den meisten Länder170 Ritzel/Bücker, § 8, Anm. I c, S. 2. ni Gundelach, S. 327. 172 § 30 GOLT-SH. 173 Vgl. § 57 II GOBü-Br. 174 Vgl. Hatschek, Parlamentsrecht des Deutschen Reiches, S. 217; Ritzel/Βücker, § 8, Anm. I c, S. 1; a.A. Pereis, S. 15 sowie Rothaug, S. 165. 175 Vgl. Ritzel /Bücker, § 8 , Anm. I c. 176 Hatschek, Parlamentsrecht des Deutschen Reiches, S. 217. 177 Vgl. Bd. 312, 169. Sitzung, S. 5295; Ani. Bd. 324, Drs. 1624.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
79
Parlamenten die Reihenfolge seiner Vertretung im Einvernehmen mit den Vizepräsidenten 178 . Die einvernehmliche Bestimmung verlangt jedoch keinen formellen Beschluß des Präsidiums, sondern lediglich das jeweilige Einverständnis des Stellvertreters, für eine bestimmte Zeit den Sitzungsdienst wahrzunehmen 179. Vereinzelt hat es sich eingebürgert, daß der Parlamentspräsident bei der Reihenfolge der Vertretung den Dienstältesten zuerst berücksichtigt 180. Über die Einteilung der Schriftführer für den Sitzungsdienst enthalten die Geschäftsordnungen keine besondere Bestimmung. Auch aus der in den Geschäftsordnungen häufig gebrauchten Formulierung „Der Präsident verteilt die Geschäfte unter sie" 1 8 1 bzw. „Der Präsident bestimmt den Einsatz der Schriftführer" 182 läßt sich unmittelbar keine Einteilungsregelung herleiten. Vielmehr wird hierdurch die Befugnis des Präsidenten begründet, die im Zusammenhang mit den Schriftführern genannten Aufgaben auf eben diese zu verteilen. Aus diesem Grunde hat sich zumindest auf Bundesebene - die parlamentarische Übung herausgebildet, daß die Schriftführer einen Obmann wählen, der die konkrete Einteilung zum Sitzungsdienst vornimmt 183 . Gleichwohl übt er diese Aufgabe nicht im eigenen, sondern im Namen des Präsidenten aus. Der Obmann ist in der Regel Mitglied der stärksten Fraktion des Hauses. Können die jeweiligen Schriftführer für die eingeteilte Zeit ihren Dienst nicht wahrnehmen, so sind sie verpflichtet, unter den weiteren Schriftführern ihrer eigenen Fraktion selbst einen Vertreter zu suchen. Es entspricht parlamentarischem Brauch, daß die diensttuenden Schriftführer nicht derselben Fraktion angehören 184. Auch sollen sie nicht beide Mitglieder der Regierungs- oder Oppositionsfraktionen sein. Üblicherweise wird deshalb bei der Einteilung der Schriftführer je einer aus den Reihen der Mehrheit und einer aus den Reihen der Minderheit zum Dienst entnommen 185 .
2. Entwurf des Haushaltsplans für den Landtag Eine weitere wichtige Aufgabe des Präsidiums ist in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Bayern und Bremen die Aufstellung des Voranschlags für den Haushaltseinzelplan des Landtags 186 . In einigen Parlamenten wird diese Tätigkeit mitunter 178 Vgl. zur Reihenfolge der Vertretung des Präsidenten in der Sitzungsleitung die Ausführungen auf S. 52 ff. 179 Ritzel /Bücker, § 8, Anm. II 1 a.
180 Troßmann, in: Deuerlein, Der Reichstag, S. 127. 181 § 14 I 3 GOLT-NRW; § 36 I 3 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 7 Satz 3 GOLT-RP; § 7 II 3 GOLT-SA; § 7 Satz 3 GOLT-SH; § 5 I 3 GOLT-MV. 182 § 16 III 3 GOLT-Bg. 183 Ritzel /Bücker, § 8 , Anm. III b. 184 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 232. 185 Gundelach, S. 327; Troßmann, § 8, Rn. 5.
80
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
vom Präsidenten selbst 187 , mitunter auch vom Ältestenrat 188 wahrgenommen 189. Grundlage ist dabei ein von der Landtagsverwaltung erarbeiteter und vom Präsidenten gebilligter Entwurf. Dieser Entwurf ist das Ergebnis eines sich dem Verwaltungsaufbau entsprechend vollziehenden Bestimmungsverfahrens, bei dem die voraussichtlich anfallenden oder geplanten Einnahmen und Ausgaben sowie die voraussichtlich benötigten Ermächtigungen zum Eingehen von überjährigen Verpflichtungen ermittelt und zusammengestellt werden 190 . In Ansehung des Entwurfs stellt das Präsidium schließlich nach eingehenden Beratungen den Voranschlag des Haushaltsplans für den Landtag fest, der im Anschluß daran an den Finanzminister des Landes weitergeleitet wird. Dieser prüft den Voranschlag und hat dabei, da der Landtag seinen Haushalt nicht autonom bestimmt, sondern haushaltsrechtlich wie ein Ressort behandelt wird, die Befugnis, mit Zustimmung der Beteiligten, also Landtagspräsident und Präsidium, Änderungen vorzunehmen. Bleibt die Zustimmung allerdings aus, so kann der Finanzminister zwar ändern, muß diese Änderung aber der Landesregierung mitteilen 191 . Die Entscheidung in solchen Situationen obliegt alsdann dem Kabinett, das gegebenenfalls auch gegen die Stimme des Finanzministers votiert. Ist jedoch auch die Landesregierung, die das Initiativrecht für den gesamten Haushalt, also auch für den Einzelplan des Landtags hat 1 9 2 , nicht bereit, diese strittigen Teile, wie vom Parlament gewünscht, in den Regierungsentwurf zu übernehmen, so werden die Änderungen, die die Voranschläge des Landtagspräsidenten noch nach dem Haushaltsbeschluß der Landesregierung gegenüber den entsprechenden Teilen des Entwurfs aufweisen, dem Landtag in der Weise zur Kenntnis gebracht, daß der gesamte Voranschlag, über den im Kabinett kein Einvernehmen erzielt worden ist, unverändert dem Planentwurf beigefügt wird 1 9 3 . Das Parlament kann sich also für den einen oder den anderen Entwurf entscheiden. So stimmte beispielsweise das Niedersächsische Parlament 1975 und auch 1993 für den Entwurf des Landtagspräsidenten und damit gegen den Regierungsent186 § 13 II GO-Be; § 13 II GOLT-BW; § 46 II GOLT-He; § 8 Satz 2 GOLT-Nds; § 12 II 1 GOLT-NRW; § 5 II GOLT-RP; § 13 Satz 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 6 III GOLT-Ss; § 10 I 1 GOLT-By; § 101 Nr. b GOBü-Br. 187 § 4 IV 1 GOLT-MV. Nach § 5 II 3 GOLT-Th hat sich der Landtagspräsident mit dem Vorstand diesbezüglich ins Benehmen zu setzen bzw. nach § 5 II GOLT-SH mit dem Ältestenrat. 188 § 10 II 2 GOLT-SA. 189 Vgl. zur Aufstellung des Voranschlags für den Haushaltseinzelplan durch den Parlamentspräsidenten die Darstellung auf S. 299 ff. 190 Vgl. Giesen/Fricke, Das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, § 27, Rn. 2. 191 Vgl. z. B. § 28 III LHO-NRW; § 28 III LHO-Nds; § 28 III LHO-BW; § 28 III LHOHe. 192 Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 43. 193 Vgl. z. B. § 29 III LHO-NRW; § 29 III LHO-Nds; § 29 III LHO-BW; § 29 III LHOHe. Die Vorschriften entsprechen der „Empfehlung der Konferenz der Präsidenten der deutschen Länderparlamente zur Neuordnung des Landeshaushaltsrechts und zur Neuordnung des Verhältnisses von Parlament und Landesrechnungshof4. Vgl. zur LandtagspräsidentenKonferenz allgemein die Ausführungen auf S. 306.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
81
wurf 1 9 4 . Der Grund für die Sonderstellung des Landtagspräsidenten in diesem Verfahren ist darin zu sehen, daß weder der Präsident selbst noch ein anderes Mitglied des Präsidiums im Kabinett vertreten ist, das aber - wie oben dargestellt- über den Einzelplan des Landtags im Entwurf entscheidet. Die Regelung des § 29 ΠΙ der Landeshaushaltsordnungen stellt demzufolge einen gewissen Ausgleich für diesen Umstand dar 1 9 5 . Um spektakuläre Sondervorlagen zu vermeiden, wird der Einzelplan mitunter vorab im Hauptausschuß und im Haushalts- und Finanzausschuß behandelt. Bei den Beratungen in diesen Gremien erstattet ein Mitglied des Präsidiums Bericht; im übrigen können auch die anderen Mitglieder des Präsidiums mit beratender Stimme teilnehmen 196 . Im Ergebnis kann also festgehalten werden, daß die Hauptverantwortung für den Haushaltseinzelplan des Landtags über weite Verfahrensstrecken hinweg beim Präsidium liegt.
3. Mitwirkung an Personalentscheidungen innerhalb der Landtagsverwaltung In Bayern und Bremen ist das Präsidium oberste Dienstbehörde für die Bediensteten der Parlamentsverwaltung 197. In dieser Funktion ist es zuständig für alle beamten-, personal- und disziplinarrechtlichen Angelegenheiten des Hauses. Geht es beispielsweise um die Ernennung und Entlassung von Beamten oder die Einstellung, Entlassung und Eingruppierung der Angestellten und Arbeiter der Parlamentsverwaltung, so ist in beiden Flächenstaaten allein das Präsidium als Kollegialorgan entscheidungsbefugt 198. Auch in Baden-Württemberg kann der Präsident hinsichtlich der Beamten nur „im Einvernehmen" mit dem Präsidium handeln 199 . In allen anderen Flächenstaaten ist das Präsidium - soweit nicht der Parlamentspräsident die Beschäftigten des Landtags in eigener Verantwortung ernennt und entläßt 200 oder der Ältestenrat an die Stelle des Präsidiums tritt 2 0 1 - ebenfalls an Personalfragen beteiligt, wenngleich auch nicht in der rechtlich starken Form der 194
Auskunft der Niedersächsischen Landtagsverwaltung gegenüber dem Verfasser. 195 Giesen /Fricke, § 29 LHO-NRW, Rn. 4. 196 Vgl. § 12 II 2 GOLT-NRW. 197 Vgl. ζ. B. Art. 93 LV-Br iVm. § 165 Satz 2 LBG-Br; § 10 III GOLT-By iVm. § 125 II 1 BayBG. 198 § 10 III 2 GOLT-By; Art. 92IV LV-Br. 199 Art. 32 III 3 LV-BW. 200 § 121 2 GOLT-Bg; § 51 3 GOLT-SH; Art. 18 II 3 LV-Ha iVm. § 5 IV GOBü-Ha; § 4 V 2 GOLT-Ss (betrifft nur Angestellte und Arbeiter); § 34 II 2, 3 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; Art. 29 VI 2 LV-MV; Art. 49 III 2 LV-SA. Eine eingehende Beratung des Präsidiums über die anstehende Personalfrage ist deshalb jedoch nicht ausgeschlossen. 201 Art. 14IV 1 LV-SH, § 187 LBG-SH, § 5 II GOLT-SH; § 110 LBG-SA, § 5 III 2 GOLTSA. 6 Köhler
82
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Zustimmung. Vielmehr hat sich hier der Landtagspräsident bei Personalentscheidungen lediglich mit dem Präsidium ins ,3enehmen" zu setzen 202 . Das bedeutet, daß der Präsident das Präsidium rechtzeitig vor der Entscheidungsbildung ausreichend zu informieren hat, um diesem Gremium die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben 203 . Auf diesem Wege kann das Präsidium im Rahmen der Beratungen über die zu entscheidende Personalfrage auf den Präsidenten Einfluß nehmen. Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist es, dem Präsidium und damit mittelbar den Fraktionen ein gewisses Maß an Kontrolle über die Personalpolitik des Präsidenten zu ermöglichen. Ein Mitentscheidungsrecht des Präsidiums im eigentlichen Sinne existiert hier allerdings nicht, d. h., der Landtagspräsident ist an die entsprechenden Beschlüsse des Präsidiums nicht gebunden204. Gleichwohl kann ein Unterlassen der vorherigen Anhörung die beamtenrechtliche Entscheidung fehlerhaft machen 205 . In der parlamentarischen Praxis wird jedoch das Benehmen mit dem Präsidium in diesen und allen anderen bedeutenden Personalund Verwaltungsangelegenheiten in aller Regel hergestellt 206. Über das geschilderte Tätigkeitsfeld hinaus nimmt das Präsidium ζ. B. in Hessen für die Landtagsbeamten zudem Aufgaben wahr, die im Grunde genommen dem Direktor des Landespersonalamts und der Landespersonalkommission obliegen 207 . Dabei handelt es sich u. a. um die Mitwirkung bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse, die Erarbeitung von Vorschlägen zur Beseitigung von Mängeln in der Handhabung beamtenrechtlicher Vorschriften und die Unterbreitung von Anregungen zur Verbesserung des Personalwesens allgemein 208 . 4. Überwachung des Verhaltens der Abgeordneten Mit der Verabschiedung der „Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages" am 21. 9. 1972 wurde dem Präsidium im Bundestag die Aufgabe übertragen, den beruflichen und finanziellen Hintergrund der Abgeordneten auf seine Zulässigkeit hin zu überprüfen. Diese Tätigkeit wurde alsbald auch von den Länderparlamenten aufgegriffen und in einem Anhang zu den Geschäftsordnungen rechtlich verankert. Bei diesen Anlagen handelt es sich nicht um echtes Geschäftsordnungsrecht, dessen Geltung auf die Dauer der Wahlperiode begrenzt ist und von 202 § 5 II 1 GLT-Th; Art. 18 III § LV-Nds, § 8 Satz 2 GOLT-Nds; Art. 86 LV-He, § 44 III 2 GOLT-He; Art. 39 II 1 LV-NRW; § 4 V 2 GOLT-Ss (gilt nur für Beamte); Art. 85 III 2 LV-RP, § 5 II GOLT-RP; Art. 71 I LV-Sl. 203 Vgl. Kunzmann, Art. 47 LV-SA, Rn. 8; Neumann, Art. 9 VNV, Rn. 20. 204 Linck, Art. 58 LV-Th, Rn. 26; Korte/Rebe, S. 219; Neumann, Art. 9 VNV, Rn. 20; Kunzmann, Art. 47 LV-SA, Rn. 8. 205 Neumann, Art. 9 VNV, Rn. 20. 206 So Korte/Rebe, S. 219. 207 Vgl. z. B. § 185 Satz 4 LBG-He. 208 Vgl. § 115 LBG-He.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
83
dem bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen abgewichen werden kann. Die Verhaltensregeln sind vielmehr eine besondere Form des parlamentarischen Innenrechts, das im allgemeinen aufgrund einer besonderen Anordnung in der Geschäftsordnung ergangen ist 2 0 9 . Die Parlamente zogen mit den Verhaltensregeln die längst überfällige Konsequenz aus einigen Vorkommnissen, bei denen verschiedene Abgeordnete ihr politisches und privatwirtschaftliches Handeln nicht immer konsequent getrennt hatten. Zwar stellt der einzelne käufliche Abgeordnete noch nicht das parlamentarische System als solches in Frage, jedoch geht bereits von ihm eine ernst zu nehmende Gefährdung für das Ansehen der Volksvertretung in der Öffentlichkeit aus, welches für das Verhältnis von Loyalität und Anerkennung konstitutiv ist, das das politische System der parlamentarischen Demokratie trägt 210 . Die Verhaltensvorschriften tragen vor diesem Hintergrund überdies dem Anliegen Rechnung, die Offenheit und Durchschaubarkeit des politischen Prozesses zu verbessern und damit die Integrität der parlamentarischen Entscheidungsbildung zu sichern 211 , ohne dabei jedoch einen Katalog über die allgemeine Berufsethik für die Abgeordneten aufstellen zu wollen. Entsprechend der Verhaltensregeln hat jedes Parlamentsmitglied seinen gegenwärtig ausgeübten Beruf anzugeben, einschließlich der Personen, Firmen, Institutionen oder Vereinigungen, für die es beruflich tätig ist. Auch früher ausgeübte Berufe sind anzugeben. Dasselbe gilt für eine entgeltliche oder ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied eines Organs einer Gesellschaft sowie für vergütete und ehrenamtliche Funktionen und Mitgliedschaften in Interessenverbänden. Diese Angaben werden in einem sog. Amtlichen Handbuch des jeweiligen Parlaments veröffentlicht. Daneben besteht für die Abgeordneten eine Anzeigepflicht für bestimmte vergütete Tätigkeiten. Dieser unterfallen entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Einnahmen aus Gutachten und aus Veröffentlichungs- und Vortragstätigkeit. Ebenso werden Zuwendungen erfaßt, die im Zusammenhang mit der Abgeordnetentätigkeit stehen. Jeder Abgeordnete, der beruflich oder entgeltlich mit einem Gegenstand beschäftigt ist, der in einem Ausschuß des Parlaments zur Beratung ansteht, hat als Mitglied dieses Ausschusses seine Interessensverknüpfung offenzulegen. Zudem darf ein Abgeordneter kein Rechtsverhältnis eingehen, das ihm deshalb Bezüge verschafft, weil von ihm im Hinblick auf sein Mandat erwartet wird, daß er im Parlament bestimmte Interessen vertreten und möglichst durchsetzen wird. Während es früher mehrheitlich dem Präsidium als Kollegialorgan oblag, die Angaben der Abgeordneten über deren beruflichen und finanziellen Hintergrund zu registrieren, zu überprüfen und das weitere Verhalten zu überwachen, ist diese Funktion mittlerweile mehr und mehr dem Parlamentspräsidenten allein zuge209 Vgl. § 14 GOLT-Th. Siehe hierzu auch Roll, in: Schneider/Zeh, § 19, Rn. 21. 210 Krause, in: DÖV 1974, 325. 211 Ebenda. 6*
84
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
wachsen. Demzufolge obliegt ihm auch der Gang des Verfahrens für den Fall, daß bei einem Abgeordneten bestimmte Anhaltspunkte dafür bestehen, gegen die Verhaltensregeln verstoßen zu haben. Der Präsident hört daraufhin den Abgeordneten an und entscheidet anschließend nach pflichtgemäßen Ermessen, ob die Untersuchungen fortgeführt werden. Staatsanwaltliche Befugnisse stehen im dabei nicht zur Verfügung 212 . Nach Abschluß der Sachverhaltsaufklärung stellt der Präsident fest, ob eine Verletzung der Verhaltensregeln vorliegt und unterrichtet darüber das Präsidium und die Vorsitzenden aller Fraktionen in einer gemeinsamen vertraulichen Sitzung. Lediglich in Berlin wird dieses Verfahren noch vom Präsidium gemeinschaftlich und nicht vom Parlamentspräsidenten allein durchgeführt. Hier hat das Präsidium als Kollegialorgan den Sachverhalt aufzuklären und den betreffenden Abgeordneten anzuhören. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so hat das Präsidium der Fraktion, der der betreffende Abgeordnete angehört, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Anschließend teilt der Präsident das Ergebnis der Überprüfung den Fraktionen mit, es sei denn, daß das Präsidium mit den Stimmen von zwei Dritteln seiner Mitglieder widerspricht, weil das öffentliche Interesse eine solche Mitteilung nicht erfordert. Das Präsidium des Deutschen Bundestages hat dabei im übrigen die Befugnis, zur Wahrung der Transparenz und Würde des Parlaments sowie als letztes Mittel gegen ein „schwarzes Schaf 4 einstimmig für berechtigt erachtete Vorwürfe zu veröffentlichen 213. Abschließend sei angemerkt, daß das freie Mandat durch jene Verhaltensregeln nicht eingeschränkt wird, da der Abgeordnete selbst bei einer öffentlichen Bekanntmachung seiner privaten Interessen in seinen Entscheidungen frei bleibt. Gleichwohl ist es aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erforderlich, die Verhaltensregeln nicht extensiv, sondern stets restriktiv auszulegen214.
5. Sonstige Aufgaben Neben den oben aufgeführten klassischen Aufgaben des Präsidiums findet sich in den Landtagsgeschäftsordnungen eine Vielzahl weiterer Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte, denen aber - abgesehen von der Befugnis zur Auslegung der Geschäftsordnung 215 und der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Ordnungsmaßnahmen des Präsidenten 216 - eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung zukommt. Sie ziehen sich durch alle Bereiche der parlamentarischen Organisation. Dabei sind Art, Umfang und Ausgestaltung dieser Partizipations212 Vgl. Roll, in: Schneider/Zeh, § 19, Rn. 19. 213 Vgl. § 8 III Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages in der Fassung vom 18. 12. 1986. 214 So Roll, in: Schneider/Zeh, § 19, Rn. 22. 215 Vgl. hierzu die besondere Behandlung auf S. 166 ff. 216 Siehe die Ausführungen auf S. 219 ff.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
85
rechte von Parlament zu Parlament verschieden. In einigen Ländern ist das Präsidium wesentlich stärker in die parlamentarische Arbeit eingebunden als in anderen. Im folgenden soll nun durch eine Zusammenstellung der Funktionen aller Präsidien ein Überblick über die Vielfalt der Aufgaben gegeben werden. Der weitaus größte Teil derartiger Befugnisse ist im Bereich der allgemeinen Verwaltung des Parlaments angesiedelt. Die Geschäftsordnungen von Berlin, Brandenburg, Hessen, Saarland und Nordrhein-Westfalen formulieren diesbezüglich, daß das Präsidium das für alle inneren Angelegenheiten des Parlaments zuständige Gremium ist 2 1 7 . So wirkt das Präsidium beispielsweise mit beim Erlaß von Archiv-, Bibliotheks- 218 und allgemeinen Hausordnungen 219 sowie bei Dienstordnungen für die Landtagsverwaltung 220. Zudem erläßt es in eigener Verantwortung Ausführungsbestimmungen über die Ausstattung der Abgeordneten mit Informations- und Kommunikationseinrichtungen 221. Das Präsidium ist ferner eingebunden bei der Verfügung über die Akten des Landtags 222 und bei der Aufbewahrung der Aufzeichnungen über die Verhandlungen des Landtags 223 . Archivalien, die nur in einem Stück vorhanden sind, dürfen lediglich mit Genehmigung dieses Gremiums vernichtet werden 224 . Weiterhin verfügt das Präsidium über die dem Landtag vorbehaltenen Räume 225 und bestimmt im Benehmen mit den Fraktionen die Plätze der Abgeordneten im Plenarsaal 226. Es ist für die Erteilung längerwährenden Urlaubs der Abgeordneten zuständig 227 und trifft die Entscheidung, wenn es um die Festlegung des Wahltags 228 oder der sitzungsfreien Zeit geht 229 . In NordrheinWestfalen gehören schließlich auch die Belange der Wirtschaftsbetriebe des Landtags zum Aufgabenkreis des Präsidiums 230. 217 § 13 I GO-Be; § 15 II GOLT-Bg; § 461 2 GOLT-He; § 31 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 121 1 GOLT-NRW. 218 § 6 III GOLT-Bg; § 10 I 2 GOLT-By; § 46 II GOLT-He; § 8 Satz 2 GOLT-Nds; § 121 2 GOLT-NRW. 219 §8 Satz 2 GOLT-Nds. 220 § 148 GOLT-By. 221 § 121 3 GOLT-NRW. 222 § 8 Satz 2 GOLT-Nds. 223 § 142 III GOLT-By. 224 § 21 II Archivordnung des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 225 § 13 m GO-Be; § 10 I 2 GOLT-By; § 31 Gesetz über den Landtag des Saarlandes, § 6 I V GOLT-Ss; § 8 Satz 2 GOLT-Nds. 226 § 5 GOLT-Bg. 227 § 2 GOLT-Sl. 228 Art. 62 I 2 LV-Bg. 229 § 6 II GOLT-Ss. 230 § 12 I 2 GOLT-NRW. Zu den Wirtschaftsbetrieben des Landtags gehören das Betriebsrestaurant, das Appartementhaus der Abgeordneten sowie das Gästehaus. Das Präsidium hat hierfür eigens die Kommission „Wirtschaftsbetriebe" eingerichtet, die die Entscheidungen des Präsidiums über Fragen der Wirtschaftsform, Notwendigkeit von Preiserhöhungen u. a. vorbereitet.
86
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Neben den Aufgaben mit Verwaltungscharakter ist das Präsidium auch im Bereich der Plenarsitzungen und deren Vorbereitung mit entsprechenden Funktionen ausgestattet worden. So beruft es etwa in Bremen und Hamburg nicht nur die Vollversammlungen des Parlaments ein 2 3 1 , sondern beschließt außerdem in einer Reihe von Landtagen über den Arbeits- und Zeitplan sowie über die Beratungsgegenstände der Landtagssitzungen und deren Reihenfolge 232. Obliegt hingegen die Auswahl der Beratungsgegenstände dem Landtagspräsidenten und ergeht diesbezüglich eine Abgeordnetenbeschwerde, weil ein Beratungsgegenstand vom Präsidenten zurückgewiesen wurde, so entscheidet hierüber in Brandenburg und in Nordrhein» Westfalen wiederum das Präsidium als Kollegialorgan 233 . Die Zeitdauer für die Aussprache über einen Beratungsgegenstand kann außerdem wie in Bremen und Hamburg auf Beschluß des Präsidiums begrenzt werden 234 . Das Präsidium in Baden-Württemberg und Sachsen trifft zudem Entscheidungen über die Zulässigkeit von selbständigen Anträgen aus der Mitte des Parlaments 235 und von Anträgen auf Aktuelle Debatte 236 , wobei grundsätzlich jeder Antrag durch einmütigen Beschluß des Präsidiums für dringlich erklärt werden kann 237 . Darüber hinaus entscheidet dieses Gremium über die Zulässigkeit von Großen Anfragen 238 . Das Präsidium kann hier außerdem durch einstimmigen Beschluß festlegen, daß derartige Anfragen anstelle des Plenums in einem von ihm zu bestimmenden Ausschuß besprochen werden 239 . In solchen Fällen beschließt das Präsidium über die Öffentlichkeit der Besprechungen und regelt zudem die Einzelheiten des Verfahrens 240. Das Präsidium ist im übrigen nicht nur Kontrollinstanz für einen geordneten parlamentarischen Sitzungsverlauf, sondern kann auch selbst gestaltend in das parlamentarische Geschehen eingreifen, indem es ζ. B. in Brandenburg berechtigt ist, Gesetzentwürfe, Anträge oder Entschließungsanträge in das Plenum einzubringen 241 . Zum Aufgabenfeld des Präsidiums gehört in Brandenburg ebenfalls die Bildung von Ausschüssen. Das Präsidium schlägt dem Landtag in diesem Zusammenhang nicht nur die Mitgliederzahl eines Ausschusses vor 2 4 2 , sondern führt zudem eine 231 § 101 Nr. a GOBü-Br; Art. 22 Nr. 1 LV-Ha. 232 § 15 I 2 GOLT-Bg; § 10 I Nr. a GOBü-Br; § 13 I 2 GOLT-BW; § 78 I 2, II GOLT-BW; § 32 I Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 28 I GOLT-Sl; §§612, 81 I, II GOLT-Ss; §211 GOLT-Th. 233 § 41 II 2 GOLT-Bg; § 75 II GOLT-NRW. 234 235 236 237 238
§ 101 Nr. a GOBü-Br; Art. 22 Nr. 1 LV-Ha. § 54 II 2 GOLT-BW; § 53 II 2 GOLT-Ss. § 59 II 2 GOLT-BW; § 5914 GOLT-Ss. § 57 III 1 GOLT-BW; § 54 III 1 GOLT-Ss. § 62 III 2 GOLT-BW.
239 240 241 242
§ 63 a I GOLT-BW. § 63 a V 3, VI GOLT-BW. § 52 I 1 GOLT-Bg. So in Brandenburg gem. § 75 I GOLT-Bg.
IV. Der Aufgabenbereich des Präsidiums
87
Einigung über die Ausschußvorsitzenden und deren Stellvertreter herbei 243 . Die Ausschüsse wählen dann ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter aus den vom Präsidium vorgeschlagenen Fraktionen 244 . Fraktionslosen Abgeordneten wird vom Präsidium unter Wahrung der Mehrheitsverhältnisse ein Ausschuß zugewiesen245. Besonders bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Befugnis des Vorstands der Hamburger Bürgerschaft, der den Senat zur Entsendung von Vertretern in die Ausschußsitzungen verpflichten kann 246 . Entsprechendes gilt für die Sitzungen der Bürgerschaft. Über die regulären Sitzungen hinaus kann ein Ausschuß in dringenden Fällen und mit Zustimmung des Präsidiums ausnahmsweise auch während der sitzungsfreien Zeit einberufen werden 247 . Die Zustimmung des Präsidiums ist ebenfalls erforderlich, wenn Ausschüsse aus ihrer Mitte heraus Unterausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einsetzen wollen 248 . Das Präsidium entscheidet in vielen Landtagen ferner bei Meinungsverschiedenheiten über die mit Kosten verbundene Hinzuziehung von Sachverständigen249 und trifft in Berlin schließlich auch die Entscheidung hinsichtlich der Beteiligung einer Parlamentarischen Gruppe bei den Sonderausschüssen250. Auf Bundesebene ist das Präsidium mit weniger breiten Befugnissen ausgestattet als auf Länderebene. Allerdings fungiert hier das Präsidium beispielsweise als Beirat des Pressezentrums des Bundestages251, in dem die Beziehungen zu den Medien, ihre Versorgung mit Informationen aus den Ausschüssen und sonstige Auskünfte und Erklärungen aller Art wahrgenommen werden. Auch die fachliche Öffentlichkeitsarbeit erfolgt unter Beteiligung des Präsidiums. Eine vom Gesetzgeber dem Präsidenten übertragene Aufgabe, die über den Bundestag hinauswirkt, ist die Mitwirkung im Bereich der Parteienfinanzierung. Das Parteiengesetz bestimmt in § 23 a Π, ΠΙ, daß das Präsidium rechtswidrig erlangte Spenden, die die Parteien zurückerstatten müssen, entgegenzunehmen und an mildtätige, kirchliche, religiöse oder wissenschaftliche Einrichtungen weiterzuleiten hat. Besonders bemerkenswert ist dabei, daß durch die gesetzliche Verankerung des Präsidiums im Parteiengesetz dieses Parlamentsorgan in seiner Existenz auf Dauer gestellt wird, ungeachtet der Tatsache, daß die Geschäftsordnung des Bundestages von diesem für jede Wahlperiode neu beschlossen werden muß. Damit ist dem Bundestag ein institutioneller Teil seiner inneren Gliederung vorgegeben 252. 243 § 75 III 1 GOLT-Bg; § 321 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 244 § 75 III 3 GOLT-Bg. 245 § 75 V 2 GOLT-Bg. 246 Art. 23 I 2 LV-Ha. 247 § 78 V GOLT-Bg. 248 § 74 III GOLT-Bg. 249 § 82 IV 2 GOLT-Bg; § 30 II 2 GOLT-BW; § 34 III 2 GOLT-Ss; § 31 II 2 GOLT-NRW. 250 § 20 V GO-Be. 251 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 31. 252 So Bücker, in: Schneider /Zeh, § 27, Rn. 34.
88
2. Abschnitt: Die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium
Im Hinblick auf die Stellung des Landtagspräsidenten im Präsidium ist in Ansehung der oben genannten Mitwirkungsrechte folgendes festzustellen: Je umfangreicher und einschneidender die Befugnisse des Präsidiums sind, desto stärker ist der Wirkungskreis des Landtagspräsidenten eingegrenzt. Dem Präsidenten als dem Vorsitzenden des Präsidiums fällt dann meist nur die Rolle des Vorbereiters, Anregers, Vermittlers, Moderators zu, selten die des Letztentscheidenden253. Dies mag vor allem für die Parlamente gelten, in denen das Präsidium nach der Aufhebung des Ältestenrats die Aufgabe eines einheitlichen Lenkungsorgans des Parlaments übernommen hat, wie etwa in Baden-Württemberg, Brandenburg und dem Saarland, und dadurch einen erheblichen Bedeutungs- und Entscheidungszuwachs erfahren hat. Für alle Belange des Landtags, soweit sie nicht ausdrücklich der Landtagspräsident allein entscheiden kann, ist hier das Präsidium als Kollegialorgan zuständig 254 . Die Mitwirkungsgrenzen finden sich allerdings in den klassischen Hoheitsrechten des Parlamentspräsidenten, die ihm durch die jeweilige Landesverfassung zur alleinigen Ausübung übertragen wurden. In den meisten Landtagen trifft der Präsident jedoch die wesentlichen Entscheidungen überwiegend selbst. Dennoch entspricht es der parlamentarischen Gewohnheit, daß der Landtagspräsident das Präsidium vor Entscheidungen von größerer Tragweite konsultiert. Das Präsidium hat aber auch dann immer nur beratende Funktion; die endgültige Entscheidung liegt beim Landtagspräsidenten allein 255 . Vor diesem Hintergrund kann das Präsidium nur beschränkt als ein Kollegium gleichberechtigter Mitglieder betrachtet werden 256 . Überdies hängt die Rolle des Präsidiums und der Einfluß auf die Amtsführung des Präsidenten entscheidend von dessen Persönlichkeit ab 2 5 7 . Je nach Selbstverständnis und Unabhängigkeit stimmt der Präsident alle wesentlichen Entscheidungen zuvor im Präsidium politisch ab oder beschränkt sich auf dessen gelegentliche Unterrichtung 258.
253 254 255 256 257 258
Ähnliche Einschätzung auch bei Schick, in: DVP 1989, 153. Vgl. Grosse-Sender, in: Schneider/Zeh, § 64, Rn. 12. Vgl. Reifenberg, S. 135 f.; Bartels, S. 14; Rothaug, S. 166. So auch Nauber, S. 112. So Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 28. Vgl. Linck, Art. 58 LV-Th, Rn. 26.
Dritter Abschnitt
Die Stellung des Landtagspräsidenten in sonstigen parlamentarischen Gremien I . Die Stellung im Ältestenrat Während die Länder Brandenburg, Bremen, Saarland und Sachsen ganz auf die Institution des Ältestenrats verzichtet haben1, hat dieses Gremium in anderen Ländern die Stellung eines zentralen parlamentarischen Lenkungsorgans2. Es ist das Bindeglied zwischen dem Landtagspräsidenten und dem Plenum. Ähnlich wie bei dem vorab behandelten Präsidium hat auch hier der Parlamentspräsident den Vorsitz. Gleichwohl sind Aufgaben und Struktur des Ältestenrats anders gelagert als beim Präsidium, so daß auch die Rolle des Parlamentspräsidenten in diesem Gremium anders zu bewerten ist. Dabei ist zunächst auf die geschichtliche Entwicklung des Ältestenrats und dessen Zusammensetzung nach geltendem Geschäftsordnungsrecht einzugehen sowie auf den Βeratungsverlauf unter der „ordnenden Hand" des Präsidenten. Die anschließende Darstellung der Aufgaben des Ältestenrats vermitteln einen Eindruck von der Bedeutung dieses Gremiums und läßt zudem Rückschlüsse auf den Wirkungskreis des Präsidenten zu.
1. Historische Grundlagen Der historische Ursprung des Ältestenrats läßt sich bis in die Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückverfolgen und steht damit im engen Zusammenhang mit dem Preußischen Abgeordnetenhaus und dem Reichstag des Kaiserreichs. Ob die Frankfurter Nationalversammlung von 1848/49 ebenfalls ein derartiges Gremium kannte bzw. institutionalisiert hatte, läßt sich nicht belegen. Gleichwohl ist zu vermuten, daß es auch hier Bestrebungen gab, bestimmte Verfahrensfragen einverständlich zu regeln 3. Zumindest sind diesbezüglich Ansätze 1 Auch in Baden-Württemberg ist der Ältestenrat 1984 mit der Änderung der Geschäftsordnung weggefallen. Seine Funktionen sind auf das Präsidium übergegangen. 2 In den meisten Fällen ist der Ältestenrat hier an die Stelle des Präsidiums getreten, ζ. B. in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. 3 Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 1.
90
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
einer interfraktionellen Zusammenarbeit über die Koalitionen gleichgesinnter Fraktionen hinaus nicht zu verkennen4. Der „Seniorenkonvent" bzw. die „Delegiertenkonferenz" tagte anfangs nur kraft parlamentarischen Brauchs, eine satzungsmäßige Grundlage war nicht vorhanden5. Die Ursache für das Fehlen einer entsprechenden Regelung in der Geschäftsordnung liegt in dem Umstand, daß es sich nicht um ein Organ des Parlaments handelte, sondern allein um eine Versammlung der Parteiführer unter einem eigenen Vorsitzenden6. Während im Reichstag zunächst alle Fraktionen jeweils einen Vertreter stellten, orientierte sich ab 1893 die Anzahl der entsandten Vertreter an der Stärke der Fraktionen 7. Noch bis 1884 tagte der Seniorenkonvent regelmäßig ohne eine Beteiligung des Präsidiums8. Dann wurde es Brauch, den Ersten Vizepräsidenten des Reichstags zum Vorsitzenden zu wählen9. Ab 1899 übernahm schließlich der Reichstagspräsident den Vorsitz im Seniorenkonvent, ohne allerdings dessen Mitglied zu sein 10 . Der Seniorenkonvent arbeitete schon damals bei Verfahrensfragen nach dem Konsensprinzip; Mehrheitsbeschlüsse wurden nicht gefaßt 11. Die wichtigsten Aufgaben des Seniorenkonvents, die vorrangig dem Schutz parlamentarischer Minderheiten dienen sollten 12 , bestanden in der Festlegung der Größe der Kommissionen13 und des Verteilungsmaßstabs für Kommissionsmandate, Verteilung der Stellen der Kommissionsvorsitzenden und ihrer Stellvertreter sowie die Besetzung weiterer parlamentarischer Ämter (ζ. B. die der Schriftführer), Vereinbarungen über den Arbeitsplan des Parlaments, insbesondere über die Dauer der Budgetberatungen, Verständigung über die Rednerlisten und in Einzelfällen auch Verwaltungsfragen, etwa die Vergabe von Tribüneplätzen 14. In den Ländern verlief die Entwicklung des Seniorenkonvents im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ähnlich wie bei den o.g. Volksvertretungen. Zwar kannten die Geschäftsordnungen weder Fraktionen noch Seniorenkonvente, gleichwohl führte parlamentarischer Brauch zur Entstehung derselben 15. Vorreiter 4 Vgl. H. Franke, S. 39. 5 Arndt, S. 35; Hatschek, S. 192. 6 Achterberg, S. 130. 7 Troßmann, in: Deuerlein, S. 129; Hatschek, S. 180; Schindler, in: Parlament, Nr. 44 vom 2. 11. 1966, S. 12. 8
Hatschek, S. 177. Jedoch weist H. Franke darauf hin, daß es schon vor November 1884 zu Fühlungsnahmen zwischen Präsident und Seniorenkonvent gekommen sei und der Präsident auch verschiedentlich die Einberufung des Seniorenkonvents vorgenommen habe, H. Franke, S. 54. 9 Hatschek, S. 178. 10 Troßmann, in: Deuerlein, S. 130; Achterberg, S. 130; H. Franke, S. 54. " Roll, in: Schneider/Zeh, § 28; Rn. 2; H. Franke, S. 55. 12 Arndt, S. 36; Achterberg, S. 130. 13 Unter Kommissionen sind nach heutigem Sprachgebrauch „Ausschüsse" zu verstehen. 14 Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 2; ausführliche Darstellung bei H. Franke, S. 56-63. 15 H. Franke, S. 68.
I. Die Stellung im Ältestenrat
91
der nun zu Anfang dieses Jahrhunderts einsetzenden Kodifikationsbewegung war das Königreich Württemberg, das dem Seniorenkonvent in § 15 WürttGO erstmals eine rechtssatzmäßige Grundlage gab 16 . Dem württembergischen Beispiel folgte eine Reihe von Ländern, die ihre Geschäftsordnungen novellierten und den Seniorenkonvent kodifizierten. Aufzuführen sind in diesem Zusammenhang insbesondere Elsaß-Lothringen 17, Baden 18 , Hessen19 und Anhalt 20 . Trotz teilweise unterschiedlicher Benennungen waren die Funktionen dieses Gremiums überall im wesentlichen dieselben. Rechtlich bindende Wirkung hatten die Vereinbarungen des Seniorenkonvents allerdings nicht, gleichwohl wurden sie in der Praxis regelmäßig eingehalten21.
2. Zusammensetzung und Sitzungsverlauf Der Ältestenrat wird in der ersten Sitzung vom Parlament eingesetzt22 und besteht aus dem Parlamentspräsidenten, seinen Stellvertretern und weiteren von den Fraktionen benannten Mitgliedern, deren Anzahl häufig durch die Geschäftsordnung genau festgelegt ist. Den Fraktionen obliegt die Ernennung ihrer Mitglieder - einschließlich einer bestimmten Anzahl von Stellvertretern - und deren Abberufung 23. Entsprechend der Geschäftsordnung gehören dem Ältestenrat von Rheinland-Pfalz elf weitere Mitglieder an, während Sachsen-Anhalt dreizehn und Niedersachsen schließlich fünfzehn weitere Abgeordnete aufzuweisen haben24. Die Verteilung auf die einzelnen Fraktionen berechnet sich dabei nach dem Höchstzahlverfahren 25 bzw. dem Rangmaßzahlverfahren 26. In Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird die Zahl der weiteren Mitglieder des Ältestenrats wiederum durch einen zu Beginn der Wahlperiode ergehenden Parlamentsbeschluß 16 H. Franke, S. 70. 17 § 16 der Geschäftsordnung für die Zweite Kammer des Landtags für Elsaß-Lothringen vom 22. 12. 1911 (Rauchhaupt, S. 750). 18 § 15 der Geschäftsordnung für die Zweite Kammer der Landstände des Großherzogtums Baden vom 16. 7. 1912 (Rauchhaupt, S. 92 f.). 19 Art. 36 des Gesetzes, die landständische Geschäftsordnung betreffend, vom 23. 3. 1914 (Rauchhaupt). 20 §§ 27, 28 der Geschäftsordnung für den Landtag vom 14. 11. 1914 (Rauchhaupt, S. 52 f.). 2
1 Hatschek, S. 192 ff., insbesondere S. 195; H. Franke, S. 66. § 17 I 1 GO-Be; § 15 IV GOLT-By. 23 § 15 I 3 GOLT-By; § 11 II GOLT-RP; § 3 II 1 GOLT-Nds; § 10 II 1 GOLT-TH; § 5 II GOLT-He; § 9 II GOLT-SA. * § 11 I 1 GOLT-RP; § 9 I 1 GOLT-SA; § 3 I GOLT-Nds. 2 5 § 11 I 2 GOLT-RP; § 3 II 2 GOLT-Nds. Für die Berechnung können sich mitunter Fraktionen zusammenschließen und fraktionslose Abgeordnete einer Fraktion anschließen (vgl. § 3 II 4 GOLT-Nds). * § 9 I 1 GOLT-SA. Ebenso § 10 I GOLT-Th, wobei die Geschäftsordnung keine zahlenmäßige Begrenzung der weiteren Mitglieder vorsieht. 22
92
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
festgelegt 27. Auch hier orientiert sich die konkrete Verteilung an dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 28. Dieses Kriterium ist ebenfalls in Bayern maßgeblich, wo jede Fraktion für die angefangene Zahl von je zwanzig Mitgliedern einen Sitz im Ältestenrat erhält 29 . Etwas anderes gilt hingegen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein: hier entsendet jede im Landtag vertretene Fraktion lediglich einen einzigen Abgeordneten in dieses Gremium 30 . Wurden früher noch die Fraktionsvorsitzenden als Ältestenratsmitglieder benannt, so ist es heute zumindest auf Bundesebene üblich geworden, die parlamentarischen Geschäftsführer zu entsenden, weil sich deren Verantwortungsbereich in aller Regel mit den Aufgaben des Ältestenrats deckt 31 . Ansonsten spielen bei der Benennung weiterer Mitglieder unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Jedoch wird im allgemeinen darauf geachtet, daß möglichst verschiedene politische Richtungen Berücksichtigung finden, um ein annähernd repräsentatives Bild der gesamten Fraktion zu erhalten. Auffällig ist in diesem Zusammenhang außerdem, daß die Mitglieder des Ältestenrats in den meisten Fällen auch zugleich Mitglieder des Geschäftsordnungsausschusses sind. Die Sitzungen des Ältestenrats sind gemeinhin nicht öffentlich 32 , so daß grundsätzlich nur die Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwesend sein dürfen 33. Ferner ist es jeweils einem Mitglied einer Parlamentarischen Gruppe gestattet, an den Sitzungen teilzunehmen34. Da sie jedoch keine Vollmitgliedschaft besitzen, steht ihnen nur das Rederecht und nicht das Stimmrecht zu. Mitunter werden auch die Fraktionsgeschäftsführer zugelassen, die dem Parlament nicht angehören (sog. nichtparlamentarische Geschäftsführer), allerdings nur als Zuhörer 35. Sofern sich der Ältestenrat mit der Vorbereitung von Plenarsitzungen beschäftigt, wird in einigen Geschäftsordnungen zudem die Hinzuziehung eines Regierungsvertreters angeraten 36. Andere Personen, die diesem genannten Kreis nicht angehören, können nur auf Einladung des Präsidenten oder auf Beschluß des Ältestenrats zugelassen werden 37. Um schließlich über auftretende Fragen der Geschäftsordnung und der Verwaltung Auskunft zu geben und um den Präsidenten zu beraten, ist der Landtagsdirektor bei den Sitzungen anwesend. Hinzugezogen werden außerdem Mitarbeiter der Landtagsverwaltung. 27 § 17 I 2 GO-Be; § 5 I GOLT-He; § 18 S. 2 GOLT-NRW. 28 § 17 II GOLT-NRW; § 171 2 GO-Be. 29 30 31 32 33
§ 15 I 2 GOLT-By. § 61 GOLT-MV; § 71 GOLT-SH. Vgl. Achterberg, S. 130. Vgl. § 90 iVm. § 85 I GOLT-SA. § 16 III 1 GOLT-By.
34 § 17 II 1 GO-Be; § 15 II GOLT-By. 35 § 25 VI 1 GO-Be. 36 Vgl. z. B. § 6 I V GOLT-MV. 37 § 11 III GOLT-RP; § 10 III GOLT-Th.
I. Die Stellung im Ältestenrat
93
Die Sitzungen des Ältestenrats werden durch die Vertreter der Fraktionen entsprechend vorbereitet 38. Dem Landtagspräsidenten obliegt es dann, dieses Gremium einzuberufen 39 - der Ältestenrat tritt in aller Regel vor jeder Vollversammlung des Parlaments zusammen40 - und dessen Verhandlungen zu leiten 41 . Bei Verhinderung des Präsidenten vertritt ihn einer seiner Stellvertreter. Sollten auch alle Stellvertreter verhindert sein, so kommt die Verhandlungsleitung dem ältesten anwesenden Mitglied zu 42 . Eine Verpflichtung des Präsidenten zur Einberufung besteht, wenn dies von einer Fraktion verlangt wird 43 . Mitunter wird auch ein entsprechendes Begehren von mindestens zwei 44 , drei 45 oder vier Mitgliedern unter schriftlicher Angabe des Zwecks als ausreichend angesehen46. In Sachsen-Anhalt ist ein Votum von einem Drittel der Mitglieder erforderlich 47. Der Ältestenrat muß dann binnen zehn Tagen nach Eingang des Verlangens einberufen werden 48. Darüber hinaus tritt der Ältestenrat - ohne besondere Aufforderung - immer in den Fällen der Unterbrechung einer Plenarsitzung zusammen und beschließt darüber, ob und wann die Sitzung fortgesetzt werden soll 49 . Die Verhandlungsfähigkeit dieses Gremiums ist zu bejahen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 50 bzw. der dem Ältestenrat angehörenden Fraktionen 51 anwesend ist. Was den Gang der Beratungen betrifft, so gelten in aller Regel die Bestimmungen über die Sitzungen des Präsidiums sinngemäß52, sofern dieses existiert. Ansonsten sind Praktikabilitätserwägungen entscheidend. Das Wort wird nach der Reihenfolge der Meldung erteilt; der Präsident kann jedoch jederzeit mit Sach38 § 19 II GO-Be. 39 § 18 I 1 GO-Be; § 17 I 1 GOLT-By; § 19 I GOLT-NRW; § 90 iVm. § 84 I GOLT-SA; § 131 1 GOLT-RP; § 8 I 1 GOLT-SH; § 13 I 1 GOBü-Ha; § 12 I 1 GOLT-Th. 40 § 18 II 1 GO-Be. § 18 I 2 GO-Be; § 17 I 1 GOLT-SA; § 13 I 1 GOLT-RP; § 3 IV GOLT-Nds; § 8 I 1 GOLT-SH; § 13 I 1 GOBü-Ha; § 12 I 1 GOLT-Th. « § 13 I 2 GOLT-RP; § 12 I 1 GOLT-Th; § 13 I 1 GOBü-Ha. Auf Bundesebene leitet im Vertretungsfall statt des ältesten Abgeordneten der erste Parlamentarische Geschäftsführer der stärksten Fraktion die Sitzung. Diese nicht ausdrücklich geregelte Vertretung, die bisher erst einmal praktiziert wurde, trägt dem Umstand Rechnung, daß der Ältestenrat primär eine Versammlung der Fraktionen ist, vgl. Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 13. 43 § 18 II 2 GO-Be; § 19 II GOLT-NRW; § 6 III GOLT-MV; § 13 II GOBü-Ha. 44 § 19 II GOLT-NRW. 45 § 13 II GOLT-RP; § 8 I 2 GOLT-SH; § 12 II 1 GOLT-Th. 46 § 17 12 GOLT-By. 47 § 90 iVm. § 84 II GOLT-SA. 4« § 17 12 GOLT-By. 49 § 67 II GOLT-He; vgl. auch § 18 II 3 GO-Be, wonach der Ältestenrat bei Feststellung der Beschlußunfähigkeit des Parlaments zusammentritt. so § 19 III GOLT-NRW; § 13 II GOLT-RP; § 18 III GO-Be; § 8 II GOLT-SH; § 12 II 2 GOLT-Th. 51 § 13 II GOBü-Ha. 52 § 48 IV GOLT-He.
94
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
beitragen intervenieren. In den Beratungen über die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzungen und bei den damit zusammenhängenden Fragen ist für jede Fraktion ein von ihr ausgewähltes Mitglied der Wortführer. Nach Abschluß der Beratungen über einen Gegenstand der Tagesordnung faßt der Präsident das Ergebnis zusammen. Soweit ausnahmsweise eine Beschlußfassung erforderlich ist, wird ohne große Formalität verfahren. Dies gilt allerdings nicht für den Ältestenrat der Hamburger Bürgerschaft. Die Geschäftsordnung bestimmt hier ausdrücklich in § 6 ΠΙ 4 GOBü, daß der Ältestenrat kein Beschlußorgan ist. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß der Landtagspräsident in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt dem Ältestenrat nur mit beratender Stimme angehört, also trotz seiner Funktion als Vorsitzender dieses Gremiums kein eigenes Stimmrecht besitzt 53 . Nach Ansicht der Literatur können die Vereinbarungen des Ältestenrats für den Präsidenten in diesen Landtagen also auch keine rechtliche Bindungswirkung ausüben54. Über die Sitzungen des Ältestenrats wird schließlich eine Niederschrift gefertigt, die den wesentlichen Ablauf der Verhandlungen in indirekter Rede wiedergibt und von der die Mitglieder eine Abschrift erhalten 55. Die Fraktionen selbst werden über den Inhalt der Beratungen durch ihre Vertreter informiert; bei fraktionslosen Abgeordneten übernimmt diese Aufgabe der Landtagspräsident56.
3. Die Arbeit des Ältestenrats Ein enumerativer Zuständigkeitskatalog des Ältestenrats ist in keiner der Landtagsgeschäftsordnungen zu finden. Dies hat seinen Grund darin, daß der Ältestenrat prinzipiell offen sein muß für alle Aufgaben, die sich in der Parlamentspraxis stellen. Denn nur so kann er die ihm zugedachte Grundfunktion wirksam wahrnehmen, die in der Vermittlung zwischen den divergierenden Interessen besteht. Dennoch lassen sich die in der Geschäftsordnung normierten Aufgaben in zwei grundsätzliche Bereiche einteilen: einerseits die traditionelle Funktion des Ältestenrats als interfraktionelles Verständigungsgremium (ζ. B. bei der Unterstützung des Präsidenten) und andererseits die Funktion als Beschlußorgan (ζ. B. bei den inneren Angelegenheiten). Daneben gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht von der eben getroffenen Unterscheidung erfaßt sind. Sie können davon unabhängig als Nebenaufgaben bezeichnet werden.
» § 3 I V GOLT-Nds; § 9 1 2 GOLT-SA. Entsprechendes gilt auch für die Vizepräsidenten. 54 Vgl. Achterberg, S. 131, Fn. 44, allerdings ohne Angabe einer Begründung. 55 § 13 III GOLT-RP; § 12 III GOLT-Th, nach einem entsprechenden Beschluß. 56 § 16 III 2 GOLT-By.
I. Die Stellung im Ältestenrat
95
a) Die Unterstützung des Präsidenten bei der Amtsführung Wichtigste Aufgabe des Ältestenrats ist es, den Parlamentspräsidenten bei der Führung seiner Geschäfte 57 bzw. in parlamentarischen Angelegenheiten58 zu unterstützen. Dies bedeutet insbesondere, eine Verständigung der Fraktionen über den Arbeitsplan des Landtags herbeizuführen 59. Zum Arbeitsplan gehört die Festlegung, welche Wochen im Jahr mit Sitzungen belegt werden und welche Tage der Sitzungswochen für solche des Plenums, der Ausschüsse und der Fraktionen zur Verfügung stehen60. In der Praxis wird der Zeitplan jeweils in der Mitte eines Jahres für das nächste Jahr vereinbart. In Thüringen ist vorgeschrieben, daß der Arbeitsplan mindestens für die Dauer eines halben Jahres zu gelten hat 61 . Zugleich stellt der Ältestenrat die Tagesordnung für die einzelnen Sitzungen auf 62 oder wirkt zumindest daran mit 6 3 . Sie enthält die Beratungsgegenstände in der Reihenfolge, in der sie im Plenum aufgerufen und behandelt werden sollen. Allerdings kann der Landtagspräsident im Einvernehmen mit dem Ältestenrat auch Gegenstände der Tagesordnung außerhalb der Reihe behandeln lassen64. Auch wenn die Tagesordnung im allgemeinen jeweils für die gesamte nächste Sitzungswoche vereinbart wird, so bleibt sie trotzdem für jeden einzelnen Sitzungstag geschäftsordnungsrechtlich selbständig65. Nachträge bedürfen der Genehmigung des Ältestenrats 66. Der Ältestenrat ist aber nicht allein für die Aufstellung der Tagesordnung zuständig, sondern berät zudem über die Gestaltung und Dauer der Debatten insgesamt67. Er vereinbart in diesem Zusammenhang u. a., ob Gesetzentwürfe und sonstige Anträge mündlich begründet werden sollen und ob zu den einzelnen Tagesordnungspunkten überhaupt eine Debatte stattfinden soll oder nicht 68 . Teil57 § 19 I 1 GO-Be; § 48 I GOLT-He; § 16 I 1 GOLT-By; § 20 GOLT-NRW; § 121 GOLTRP; § 6 II 1 GOLT-MV; § 7 II 2 GOLT-SH; § 121 GOBü-Ha; § 11 GOLT-Th. 58 § 101 1 GOLT-SA; § 4 GOLT-Nds. 59 § 48 I GOLT-He; § 20 GOLT-NRW; § 12 I GOLT-RP; § 6 II 1 GOLT-MV; § 7 II 2 GOLT-SH; § 121 GOBü-Ha; § 11 GOLT-Th. 60 Vgl. Ritzel/Bücker, § 6, S. 4. § 19IV GOLT-Th. 62 § 100 I GOLT-By; § 10 I 2 GOLT-SA; § 23 I Nr. 1 GOBü-Ha; § 21 I 2 GOLT-Th; § 4 GOLT-Nds; § 6 II 1 GOLT-MV; § 59 II 2 GO-Be; § 20 GOLT-NRW. Bis zur Feststellung im Plenum bleibt die im Ältestenrat vereinbarte Tagesordnung lediglich ein Vorschlag, vgl. Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 27. 63 § 58 I GOLT-He. 64 § 59 V GO-Be. 65 Vgl. Troßmann, § 24, Rn. 11. 66 § 15 II 1 GOBü-Ha. 67 § 44 II GOLT-MV; § 23 I Nr. 3 GOBü-Ha; § 56 IV 3 GOLT-SH; § 108 I 1 GOLT-By; § 63 I GOLT-NRW. 68 § 44 II GOLT-MV. Mitunter wird dabei auch festgelegt, welche Hilfsmittel durch die Redner in der Vollversammlung benutzt werden dürfen (§ 107 II 1 GOLT-By).
96
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
weise verständigen sich die Fraktionen in diesem Rahmen ebenfalls über die Reihenfolge der Redebeiträge 69 und über die Frage, welche Vorlagen an welche Ausschüsse überwiesen werden sollen 70 . Eine weitere wichtige Aufgabe des Ältestenrats besteht darin, dem Parlament Vorschläge bezüglich der Einsetzung von Ausschüssen für bestimmte Sachgebiete zu unterbreiten 71 und zudem zwischen den Fraktionen eine Verständigung über die Besetzung der Stellen der Ausschußvorsitzenden und ihrer Stellvertreter herbeizuführen 72. Maßgebliches Kriterium ist hierbei in der Regel die Stärke der Fraktion 73 . Die Auswahl der Ausschußmitglieder ist jedoch nicht Sache des Ältestenrats, sondern allein der entsendungsberechtigten Fraktionen 74. In ihrem Ermessen steht es, die Mitglieder zu benennen, abzuberufen oder jederzeit auszuwechseln75. Des weiteren gehört es zum Aufgabenkreis des Ältestenrats, über Einsprüche von Abgeordneten zu beraten, die sich gegen Ordnungsmaßnahmen des Landtagspräsidenten richten. Als Abschluß derartiger Beratungen gibt der Ältestenrat dem Parlament eine entsprechende Entscheidungsempfehlung 76. Ähnlich verhält es sich auch mit Beratungen über weitergehende Ordnungsmaßnahmen, die über die bereits erfolgten Sanktionen des Präsidenten hinausgehen77. Auch hier spricht der Ältestenrat dem Landtag eine Empfehlung aus, ggf. den Ausschluß von der Teilnahme an mehreren Sitzungstagen78. Hat das Parlament eine Entscheidung in Immunitätsangelegenheiten zu treffen, so berät darüber wiederum zunächst der Ältestenrat, der dem Landtag anschließend eine Beschlußempfehlung vorschlägt 79. Auch kann sich der Ältestenrat ohne besonderen Auftrag mit Fragen der Geschäftsordnung auseinandersetzen und dem Abgeordnetenhaus in einer Beschlußempfehlung Vorschläge zu ihrer Änderung machen80. In Sachsen-Anhalt obliegt dem Ältestenrat sogar die Auslegung der Geschäftsordnung 81. Mitunter werden auch 69 § 6 II 1 GOLT-MV. 70 § 57 V GOLT-Th. 71 § 611 GOBü-Ha. 72 § 6 II 1 GOLT-MV; § 7 II 2 GOLT-SH; § 12 I GOBü-Ha; § 11 GOLT-Th; § 20 GOLTNRW; § 12 I GOLT-RP. 73 Vgl. z. B. § 191 2 GO-Be; § 161 2 GOLT-By. 74 Loewenberg, S. 191; Dexheimer, in: Festgabe für Blischke, S. 260. 75 Vgl. H. Franke, S. 95. 76 § 80 V 2 GOLT-SA; § 38 VI 2 GOLT-RP; § 88 V 2 GOLT-Nds; § 37 VII GOLT-Th. In Hessen und Bayern trifft der Ältestenrat selbst die Entscheidung über die Gewährung bzw. Nichtgewährung des Einspruchs, vgl. §§ 78 Satz 2 GOLT-He, 121 I GOLT-By. 77 Vgl. z. B. §§ 118 III, 119 II, 120 GOLT-By. 78 § 118 IV GOLT-By; § 78 II GOLT-He; § 37 III 3 GOLT-Th; § 38 III 3 GOLT-RP. 79 § 53 I GOLT-SA. Dem Ältestenrat obliegt es hier außerdem, Grundsätze über die Behandlung von Ersuchen auf Aufhebung der Immunität aufzustellen, § 53 II 1 GOLT-SA. 80 § 93 II 1 GOLT-SA; § 116 GOLT-NRW. 81 § 91 I GOLT-SA.
I. Die Stellung im Ältestenrat
97
Wahlvorschläge in diesem Kreise vorberaten; sie sind dann dem Parlament entweder als Vorschläge des Ältestenrats selbst oder als Vorschläge der Fraktionen schriftlich mitzuteilen 82 . Dem Präsidenten bleibt es schließlich unbenommen, in den Sitzungen des Ältestenrats auch andere wichtige Angelegenheiten zu erörtern. Dabei kann es etwa um die Behandlung aktueller Geschäftsordnungskontroversen der Fraktionen über den weiteren Verfahrensablauf im Plenum gehen oder um Fragen, die sich auf die Würde und die Rechte des Parlaments, das Verhalten einzelner Abgeordneter oder das Verhältnis des Parlaments zur Öffentlichkeit beziehen83. Selbst Fragen, die ganz oder teilweise in den Zuständigkeitsbereich des Landtagspräsidenten fallen, können in diesem Rahmen behandelt werden. Die Diskussion solcher Fragen verfolgt auch immer den Zweck, einen Ausgleich zwischen den Fraktionen herbeizuführen. Der Ältestenrat kann also unter diesem Gesichtspunkt als Schiedsstelle der Fraktionen charakterisiert werden 84. Anders als im Plenum ist im Ältestenrat auch eine Kritik an der Verhandlungsführung des Präsidenten zulässig85. Diese Möglichkeit bezieht sich nicht nur auf Entscheidungen über Verfahrensfragen und auf die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen, sondern umfaßt auch Entscheidungen, die im Vorfeld der Plenarsitzungen getroffen worden sind, aber direkte Auswirkungen auf die Gestaltung und den Ablauf der Vollversammlung haben86. In all diesen Fällen handelt der Ältestenrat nicht als Revisionsinstanz, sondern als Beratungsorgan 87. Der Präsident kann die geäußerten Ansichten zur Kenntnis nehmen und ggf. sein künftiges Verhalten daran ausrichten. Rechtliche Konsequenzen hat die Kritik jedoch nicht. Insbesondere sind Mißtrauensanträge gegenüber dem Präsidenten in diesem Gremium unzulässig, gerade weil der Ältestenrat in solchen Angelegenheiten reines Beratungs- und kein Beschlußorgan ist 8 8 . Entsprechendes gilt für die Wahrnehmung der meisten genannten Unterstützungsaufgaben: Auch hier wird der Ältestenrat nicht als Beschlußorgan tätig, wie § 6 ΠΙ 4 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft ausdrücklich unterstreicht, sondern vielmehr als Beratungs- und Koordinierungsorgan. In seiner Eigenschaft als Beratungsgremium kann der Ältestenrat somit nur versuchen, ein „Einvernehmen" zu erzielen 89. Demzufolge gibt es in ihm lediglich (interfraktionelle) Vereinbarungen zwischen den einzelnen Beteiligten, die einen Konsens 82 § 28 IV GOBü-Ha. 83 Vgl. Achterberg, S. 131. 84 Vgl. Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 37. 85 Siehe dazu S. 50. Im Ältestenrat fand im übrigen auch die Überprüfung der sog. ,Dienstreisen-Affaire" der Bundestagspräsidentin Süssmuth statt. 86 Vgl. Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 38. 87 Rasner, S. 102. 88 Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 38. 89 Ritzel/Bücker, § 6, S. 4. 7 Köhler
98
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
aller anwesenden Mitglieder erfordern. Eine Vereinbarung kommt nicht zustande, wenn nur ein Mitglied widerspricht 90. Die Bindung des Parlaments oder des Präsidenten an derartige Vereinbarungen des Ältestenrats ist geschäftsordnungsmäßig nicht vorgesehen, so daß ihnen keine Rechtsqualität zukommt 91 . Insbesondere handelt es sich nicht um Verträge. Die Bindungswirkung ist vielmehr rein politischer bzw. faktischer Natur 92 . Unter diesem Blickwinkel ist es zu sehen, daß die Beteiligten ihre Abmachungen gerade nicht als beliebig austauschbar betrachten, sondern sie üblicherweise einhalten und ausnahmsweise beabsichtigte Abweichungen rechtzeitig bekanntgeben. Die Vereinbarungen des Ältestenrats sind vor diesem Hintergrund als Regeln zu charakterisieren, die zwischen Recht und Politik angesiedelt sind 93 .
b) Innere Angelegenheiten Der Begriff „innere Angelegenheiten" umfaßt alle für die Funktionsfähigkeit des Parlaments erforderlichen Arbeitsbedingungen. Sie können sowohl den parlamentarischen als auch den administrativen Bereich betreffen 94. Im Rahmen der inneren Angelegenheiten stellt der Ältestenrat in SachsenAnhalt und Schleswig-Holstein den Entwurf des Haushaltsplans für den Landtag auf 95 und verfügt über die ihm vorbehaltenen Räume im Landtagsgebäude sowie über die Akten des Landtags96. Ebenso ist er zuständig für den Erlaß einer Hausordnung und für alle Angelegenheiten der Bibliothek, des Archivs und anderer Dokumentationen97. Der Ältestenrat in Bayern wirkt ferner mit bei Entscheidungen über die Ernennung und Beförderung des Landtagsdirektors 98, in SachsenAnhalt und Schleswig-Holstein über die Einstellung und Entlassung der Arbeiter und Angestellten sowie bei der Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand der Beamten des Landtags99. In Hessen entscheidet er auch darüber, ob der Landtag in verfassungsrechtlichen Verfahren das Recht zum Beitritt oder zur Äußerung wahrnehmen soll 1 0 0 . Außerdem beschließt der Ältestenrat in einigen 90 Vgl. Troßmann, Der Bundestag, S. 161. Rothaug, S. 164 m.w.N.; Achterberg, S. 131,618; Rasner, S. 103. 92 Loewenberg, S. 248, 251; Ritzel /Bücker, § 6, S. 3; H. Franke, S. 118 f.; Rothaug, S. 164; Achterberg, S. 131; Roll, in: Schneider/Zeh, § 28, Rn. 49; Rausch, S. 78. 93 Vgl. Roll, in: Schneider /Zeh, § 28, Rn. 49. 94 Ritzel/Bücker, § 6, S. 5. 95 § 10 II 2 GOLT-SA; § 5 II GOLT-SH. 96 § 10 II 2 GOLT-SA. 97 § 10 II 2 GOLT-SA. 98 § 10IV GOLT-By. 99 § 7 II iVm. § 5 II GOLT-SH; § 5 III 2 GOLT-SA, § 110 LBG-SA. Vgl. auch S. 298. 100 § 48 II GOLT-He.
I. Die Stellung im Ältestenrat
99
anderen Landtagen im Bereich der inneren Angelegenheiten über die Sitzordnung im Plenarsaal 1 0 1 und über Ausschußsitzungen in sitzungsfreien Zeiten 102 . Überdies genehmigt er Ausschußreisen 103 sowie Bild- und Tonaufnahmen während der Vollversammlung des Parlaments 104 und trifft schließlich die Entscheidung über die Festlegung der Parlamentsferien 105. Aus den Formulierungen dieser und anderer Aufgaben ergibt sich, daß der Ältestenrat bei der Erledigung dieser Obliegenheiten als Beschlußorgan tätig wird, d. h. es muß abgestimmt und mit Mehrheit entschieden werden 106 . Das bei den o. g. Unterstützungsaufgaben praktizierte Konsensprinzip findet hier keine Anwendung. Die Beschlüsse des Ältestenrats sind bindende Entscheidungen, die vom Adressaten befolgt werden müssen, sie bedürfen keiner Bestätigung durch das Plenum 107 . Der Landtagsverwaltung allerdings kann der Ältestenrat keine unmittelbaren Weisungen erteilen und somit seine Beschlüsse in inneren Angelegenheiten auch nicht selbst vollziehen. Die Durchführung der Beschlüsse obliegt deshalb dem Landtagspräsidenten persönlich 108 . Eine ausgeprägte Stellung hat der Ältestenrat überwiegend in den Landesparlamenten erfahren, die wie Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein auf das Präsidium als parlamentarisches Leitungsgremium verzichtet haben. Infolge des damit einhergehenden Aufgabenzuwachses ist der Ältestenrat zum zentralen Lenkungsund Koordinationsorgan im innerparlamentarischen Bereich avanciert 109.
c) Lenkungs-, Vermittlungs-
und Schlichtungsorgan
Neben der Funktion als Lenkungs- und Koordinationsorgan liegt die parlamentspolitische Bedeutung des Ältestenrats aber vor allem in seinem Verständnis als Organ der Integration und der Kommunikation 110 . Dies gilt sowohl für das Verhältnis zwischen Parlamentspräsident und Fraktionen als auch für die Fraktionen untereinander. Der Ältestenrat ist mithin auch der Ort, an dem Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen über Fragen der Geschäftsordnung und Organisation beigelegt werden können. Selbst wenn keine Einigung zustande kommt, so besteht doch immerhin die Möglichkeit, die Probleme in angemessenem Rahmen und in 101 § 4 Satz 3 GOLT-Nds; § 101 3 GOLT-SA. 102 § 27 III 3 GOLT-NRW. 103 104 105 106
§ 40 II GOLT-By. § 17 IV 1 GOLT-Th; § 941 GOLT-By. § 11 GOLT-Th. Vgl. Achterberg, S. 131.
107 Vgl. Ritzel /Bücker, § 6, S. 7. los Roll, in: Schneider /Zeh, § 28, Rn. 52. 109 Bspw. in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. no Vgl. Loewenberg, S. 250. 7*
100
3. Abschnitt: Der Landtagspräsident in parlamentarischen Gremien
vertraulicher Atmosphäre zu erörtern 111. Dementsprechend ist der Arbeitsstil des Ältestenrats auch durch Kollegialität und Kompromißbereitschaft gekennzeichnet. Allein die Tatsache, daß Meinungsverschiedenheiten mit dem Ziel der Beilegung in ihm besprochen werden, daß sogar Vollversammlungen des Parlaments gelegentlich unterbrochen werden, um den Rat und mitunter die Entscheidung dieses Gremiums einzuholen und daß schließlich auch die Auslegung der Geschäftsordnung im Ältestenrat erörtert wird, unterstreicht seine überragende Bedeutung als parlamentarisches Lenkungs-, Vermittlungs- und Schlichtungsorgan 112. Die Stellung des Landtagspräsidenten im Ältestenrat ist formal-geschäftsordnungsmäßig zunächst dadurch gekennzeichnet, daß er den Vorsitz führt. Damit hat der Präsident die Kompetenz, die Sitzungen des Ältestenrats zu eröffnen, zu schließen und jederzeit das Wort zu ergreifen. Allein darin offenbart sich augenscheinlich eine größere Selbständigkeit des Präsidenten gegenüber den anderen Ältestenratsmitgliedern, die teilweise in der Literatur zu der Schlußfolgerung Anlaß gegeben hat, er sei „mehr als ein Erster unter Gleichen" 113 . In der parlamentarischen Praxis hingegen agiert der Landtagspräsident im allgemeinen sehr zurückhaltend und nimmt daher eine eher passive Rolle ein. Sein Part beschränkt sich im wesentlichen auf die Kontrolle des Sitzungsablaufs und auf die Anregung und Förderung von Vermittlungs Vorschlägen114. Die apodiktische Feststellung von Gerstenmaier, der Präsident habe im Ältestenrat immer das letzte Wort gehabt 115 , kann deshalb nicht uneingeschränkt gelten. Das gilt vor allem für die Kompetenzen, die den Ältestenrat als dem Präsidenten übergeordnete innerparlamentarische Instanz erscheinen lassen, beispielsweise bei der Kontrolle von Zurückweisungen von Anträgen oder Interpellationen durch den Landtagspräsidenten sowie vor allem bei der alleinigen Entscheidung über Einsprüche eines Abgeordneten gegen präsidiale Ordnungsmaßnahmen116. Eine allgemeine und abschließende Beurteilung der Stellung des Parlamentspräsidenten im Ältestenrat zu geben, ist dennoch nahezu unmöglich, weil das Verhältnis zwischen beiden im wesentlichen nicht durch die Rechtslage, sondern auch durch die jeweiligen politischen Gegebenheiten bestimmt wird 1 1 7 . Außerdem darf nicht verkannt werden, daß der Präsident durch seinen Verhandlungsstil und seine persönliche Autorität entscheidenden Einfluß auf „Klima und Arbeitsweise im Ältestenrat" nehmen kann 118 . Je eher es dem Präsidenten gelingt, sich persönlich Achtung zu verschaffen, desto größer wird sein Einfluß in diesem Gremium sein m Vgl. Rothaug, S. 163. Π2 Vgl. Achterberg, S. 133. H3 Mommer, in: Das Parlament, Nr. 35/36 vom 30. 8. 1969, S. 6. "4 Vgl. Roll, in: Schneider /Zeh, § 28, Rn. 40. 115 Gerstenmaier, S. 380. 116 Vgl. etwa §§ 62IV, 68 II, 121 I GOLT-By. in Roll, in: Schneider /Zeh, § 28, Rn. 36. ne Loewenberg, S. 175.
II. Die Stellung in den Ausschüssen
101
und um so mehr wird er imstande sein, seine formell starke Stellung mit materiellem Gehalt zu versehen 119. Die Stellung, die der Parlamentspräsident im Ältestenrat innehat, hängt infolgedessen auch ganz entscheidend von seiner Persönlichkeit ab 1 2 0
II. Die Stellung in den Ausschüssen In allen Landesparlamenten bestellt der Landtag zur Vorbereitung seiner Beratungen Ausschüsse. Diese sind interne Hilfsorgane des Landtags, die - Untersuchungsausschüsse ausgenommen - keine eigenen, nach außen wirkenden Entscheidungen treffen 121 . Die Rolle des Parlamentspräsidenten in den Ausschüssen ist im Vergleich zu der im Präsidium oder im Ältestenrat formal-rechtlich wenig herausragend; weder die Verfassung noch die Geschäftsordnung hat ihm in diesem Bereich entsprechende Leitungs- oder Ordnungsbefugnisse übertragen. Auch das Stimmrecht ist ihm versagt worden. Der Landtagspräsident kann daher an allen Ausschußsitzungen stets nur mit beratender Stimme teilnehmen 122 . In Hamburg ist der Parlamentspräsident allerdings traditionell stimmberechtigtes Mitglied in zwei Ausschüssen der Bürgerschaft, wovon regelmäßig einer der Verfassungsausschuß ist. Eine weitere Ausnahme findet sich in diesem Zusammenhang in der Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft. Nach § 63 I 2 wird dem Präsidenten die Funktion zugestanden, in dem Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuß den Vorsitz zu führen. Die gleiche Aufgabe kommt dem Parlamentspräsidenten auf Bundesebene in dem Gemeinsamen Ausschuß nach Art. 53a GG zu 1 2 3 . Für alle anderen Ausschüsse gelten jedoch die oben benannten Grundsätze 124 . Entscheidend für das Ansehen und den Einfluß des Parlamentspräsidenten in den verschiedenen Ausschüssen ist auch hier wiederum weniger der Umfang der Rechte nach der Verfassung oder Geschäftsordnung, sondern vor allem die Kraft und Ausstrahlung seiner Persönlichkeit. Je mehr es der Präsident versteht, seiner Person Ausdruck zu verleihen, desto gewichtiger ist sein Wort und desto stärker seine Autorität und seine Stellung in diesen Gremien.
119 H. Franke, S. 116. 120 So auch Rothaug, S. 164 m.w.N.. 121 Nawiasky, Art. 20 LV-By, Rn. 11. 122 § 14 III 2 GO-Be; § 94 III GOLT-Nds; § 12 III GOLT-By; § 16 III GOLT-SH; § 12 II 2 GOLT-Bg; § 4 I 4 GOLT-Th; § 4 Satz 3 GOLT-RP; § 4 IV GOLT-Ss; § 10 II GOLT-NRW; § 441 3 GOLT-He; § 9 ΠΙ GOLT-BW; § 66 II GOBü-Br. 123 Vgl. § 7 I GOGemAussch. Der Gemeinsame Ausschuß ist allerdings kein Ausschuß des Bundestages. 124 An den Sitzungen des Vermittlungsausschusses darf der Bundestagspräsident allerdings nur gem. § 6 GO VA mit dessen Genehmigung teilnehmen.
Vierter Abschnitt
Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten in den Verhandlungen des Landtags I. Der Begriff und Umfang der Leitungsgewalt Nach den Bestimmungen der Landtagsgeschäftsordnungen leitet der Parlamentspräsident die Verhandlungen des Parlaments gerecht und unparteiisch1. Wenngleich diese Befugnis in den meisten Länderverfassungen begrifflich nicht erwähnt wird - eine ausdrückliche Regelung der Leitungskompetenz auf Verfassungsebene besteht lediglich in Art. 92 I der Bremischen Landesverfassung - , so findet sie dennoch dort ihre eigentliche Grundlage2. Einer ausdrücklichen Erwähnung bedarf es im übrigen auch nicht zwingend, weil die Steuerung des geschäftsordnungsmäßigen Verhandlungsabiaufs selbstverständlicher Ausfluß der parlamentarischen Stellung des Präsidenten ist 3 , die sich aus seiner Eigenschaft als Vorsitzender eines mehrköpfigen Gremiums ergibt 4. Die Leitungsgewalt umfaßt alle Maßnahmen, die unter verfahrenstechnischen Gesichtspunkten zur Gewährleistung des geschäftsordnungsmäßigen und sachgerechten Verhandlungsablaufs erforderlich sind5. Da die Geschäftsordnungen dem Landtagspräsidenten die Aufgabe übertragen haben, die Sitzungen und Beratungen des Parlaments zu eröffnen, zu leiten und zu schließen6, trägt er auch dafür Sorge, die Beratungen in Gang zu bringen und auf ihren produktiven Verlauf hinzuwirken 7. Der Landtagspräsident hat ferner über die Einhaltung der parlamentarischen Verfahrensvorschriften zu wachen und die durch sie geforderten Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen 8. Er schreitet zudem kraft seiner Leitungs1 § 14 II 2 GO-Be; § 9 II 1 GOLT-BW; § 44 I 2 GOLT-He; § 12 II GOLT-By; § 10 I 2 GOLT-NRW; § 4 III GOLT-Ss; § 5 I 2 GOLT-SA; § 341 2 Gesetz über den Landtag des Saarlands; § 4 Satz 2 GOLT-RP; § 5 V 1 GOBü-Ha; § 4 I 2 GOLT-MV; § 4 I 2 GOLT-Th; § 12 II 1 GOLT-Bg. 2 Dammholz, S. 73. 3 Ritzel /Bücker, § 7, Anm. 2 d, S. 5. « Rothaug, S. 64. 5 Vgl. Stern, S. 92; Engels, S. 52; Mühlbauer, S. 39. 6 § 58 I 1 GO-Be; § 60 I 1 GOLT-He; § 99 Satz 2 GOLT-By; § 42 I GOLT-NRW; § 58 I 2 GOLT-SA; § 27 I GOLT-Sl; § 20 I 1 GOLT-RP; § 501 GOLT-SH; § 39 I GOLT-MV; § 18 I 1 GOLT-Th; § 67 II 1 GOLT-Nds; § 201 GOLT-Bg; § 121 GOBü-Br. 7 von Pechmann, S. 58. 8 Vgl. Klinke, S. 94.
I. Der Begriff und Umfang der Leitungsgewalt
103
kompetenz ein, wenn die Verhandlungen zwar ruhig und sachlich verlaufen, jedoch eine effektivere und zielorientiertere Vorgehensweise möglich ist, indem etwa näher am Beratungsgegenstand gesprochen, die Redezeit eingehalten oder nicht abgelesen wird 9 . Die Leitungsbefugnis erfaßt in räumlicher und zeitlicher Hinsicht die gesamte Sitzung einschließlich ihrer Eröffnung und Schließung, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in die Tagesordnung10. Alle Maßnahmen, die außerhalb der Plenarsitzung ergehen, insbesondere vor- und nachbereitende Tätigkeiten, unterfallen demzufolge nicht mehr der Leitungskompetenz. In personeller Hinsicht erfaßt die Leitungskompetenz unstreitig die Gruppe der Abgeordneten, während die Zuhörer infolge ihres passiven Verhaltens bei den Beratungen nicht der Leitungsgewalt des Präsidenten unterliegen. Jedoch hat der Parlamentspräsident bei Störungen die Möglichkeit, kraft seiner Ordnungsgewalt gegen sie vorzugehen 11. Trotz fehlender gesetzlicher Anordnung muß die Leitungskompetenz sinnvollerweise auch gegenüber den Vertretern der Landesregierung gelten 12 . Die Aufrechterhaltung der parlamentarischen Ordnung und die verfahrenstechnisch einwandfreie und sachgemäße Abwicklung der Beratungen ist nur möglich, wenn ausnahmslos alle Beteiligten der Leitungsbefugnis des Landtagspräsidenten unterfallen. Ansonsten wären Störungen im Verfahrensablauf durch unkontrollierte Wortbeiträge, Nichtbeachtung der Rednerreihenfolge u. a. vorbestimmt. Das Parlament wäre unter diesen Umständen in der Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben erheblich beeinträchtigt 13. Vor diesem Hintergrund befolgen die Regierungsvertreter seit jeher die Leitungsmaßnahmen des Parlamentspräsidenten, so daß eine von allgemeiner Rechtsüberzeugung getragene dauernde Übung besteht14. Der Begriff der Leitungskompetenz bedarf schließlich einer inhaltlichen Abgrenzung gegenüber der Ordnungsgewalt. Die Ordnungsgewalt dient der Beseitigung von Störungen und soll die Beratungen auf eine sachliche Ebene zurückführen 15. Solange sich hingegen die Verhandlungen in einem sachlichen Rahmen bewegen, kommen ausschließlich Leitungsmaßnahmen zur Anwendung, um eine zielstrebigere Behandlung der Beratungsgegenstände zu ermöglichen. Fallen Verfahrenswidrigkeit und Störung in einem Akt zusammen, so sind beide Komponenten angesichts der unterschiedlichen Intentionen grundsätzlich nebeneinander anwendbar 16. 9 Rothaug, S. 64. 10 Kleinschnittger, S. 125. 11
Siehe dazu die Ausführungen auf S. 232 ff. 12 So auch Klinke, S. 168; Reinecke, S. 17; Kraul, S. 98, Böttcher, S. 121; von Brentano, S. 68; Engels, S. 66; Woldt, S. 12; Mühlbauer, S. 19, 70; Seligmann, S. 94; a.A. Maunz, MD, Art. 40, Rn. 13; Kleinschnittger, S. 81. 13 Vgl. Rummel, S. 52. 14 Böttcher, S. 21. 15 Vgl. Mühlbauer, S. 39; Stern, S. 92; Spengler, S. 39.
104
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
II. Die Vorbereitung der Arbeiten des Landtags 1. Die Sichtung und Überprüfung der Beratungsgegenstände Alle Beratungsgegenstände gelangen zunächst an den Landtagspräsidenten. Dabei handelt es sich seitens der Abgeordneten um Gesetzesanträge, Änderungsanträge sowie große und kleine Anfragen. Von der Landesregierung können u. a. Gesetzesvorlagen und Denkschriften eingebracht werden. Bevor jedoch der Parlamentspräsident die Verhandlungsgegenstände dem weiteren Geschäftsgang zuführt, unterwirft er sie einer eingehenden Prüfung. Das Augenmerk dieser Überprüfung liegt insbesondere auf der Einhaltung der formellen Vorschriften. Dementsprechend stellt der Präsident fest, ob dem Erfordernis der Schriftlichkeit genügt ist, ob die Anträge und Anfragen unterzeichnet sind, vor allem ob sie die erforderliche Anzahl der Unterschriften aufweisen 17. Fehlt eine Form Voraussetzung, so weist der Landtagspräsident die Anträge, Anfragen und sonstigen Schriftstücke zurück 18 . Zweifelhaft ist in diesem Zusammenhang, ob das Prüfungsrecht des Landtagspräsidenten auch eine materielle Prüfungsbefugnis umfaßt. Soweit ein materielles Prüfungsrecht des Präsidenten nicht ausdrücklich im Gesetz verankert ist, wird es in der Literatur grundsätzlich abgelehnt19. Eine derartige Befugnis widerspreche der Ausgestaltung seiner Stellung, die ihm jeden direkten Einfluß auf die vom Parlament zu behandelnden Gegenstände verwehre 20. Ausschlaggebend ist bei dieser Frage jedoch, daß durch ein materielles Prüfungsrecht des Präsidenten die Entscheidungsmöglichkeit des Parlaments beschnitten würde, das im Rahmen einer Beschlußfassung auch über die Verfassungsmäßigkeit der Angelegenheit zu befinden hat. Durch ein vorgeschaltetes präsidiales Prüfungsrecht würde diese Befugnis dem Parlament faktisch entzogen21. Außerdem besteht bei Gesetzen die Möglichkeit, die Verfassungsmäßigkeit im Wege eines Normenkontrollverfahrens beim Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Ein wirkliches Bedürfnis nach einem materiellen Prüfungsrecht des Landtagspräsidenten kann daher nicht festgestellt werden. Da somit im Gegenzug ebenfalls keine Prüfungspflicht besteht, braucht der Präsident einen Verhandlungsgegenstand mit verfassungswidrigem Inhalt auch nicht zurückzuweisen, sondern kann ihn der Beratung und Abstimmung durch das Parlament unterstellen 22. 16 So auch Rothaug, S. 66; a.A. Kleinschnittger, S. 105; von Pechmann, S. 101; Böttcher, S. 102. 17 Vgl. dazu ζ. B. die formellen Voraussetzungen einer großen Anfrage (§ 85 II GOLT-Th) oder eines Gesetzesentwurfs (§ 22 II GOLT-Nds). 18 So muß der Präsident ζ. B. regelmäßig kleine Anfragen zurückweisen, die Meinungen enthalten, also nicht wertneutral formuliert sind. 19 Rothaug, S. 98; Achterberg, S. 627; Kleinschnittger, S. 41; a.A. Sperling, S. 19, der eine Prüfungsbefugnis des Präsidenten dahingehend bejaht, daß dieser überprüfen könne, ob das Parlament im Rahmen seiner Kompetenzen tätig geworden ist. 20 Kleinschnittger, S. 40.
21 Vgl. Rothaug, S. 98.
II. Die Vorbereitung der Arbeiten des Landtags
105
Ein materielles Prüfungsrecht des Landtagspräsidenten besteht hingegen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. So soll der Landtagspräsident gem. § 41 I GOLT-Bg und § 75 GOLT-NRW Beratungsgegenstände zurückweisen, wenn sie gegen die parlamentarische Ordnung verstoßen, wenn durch ihren Inhalt offenkundig der Tatbestand einer strafbaren Handlung erfüllt wird, wenn sie Gegenstände behandeln, die nicht in die Zuständigkeit des Landtags fallen und schließlich, wenn deren Behandlung einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit bedeuten könnte. Gleichermaßen hat der Landtagspräsident nach § 20 Satz 1 GOLT-Nds und § 20 Satz 1 GOLT-SA Vorlagen zurückzuweisen, die gegen die Geschäftsordnung oder gegen Formvorschriften der Verfassung oder andere Gesetze verstoßen. Aber auch in den Länderparlamenten, in denen der Landtagspräsident kein gesetzliches Prüfungsrecht besitzt, wird man ihm wohl nicht zumuten können, an der Drucklegung und Verteilung von Verhandlungsgegenständen mitzuwirken, die einen strafbaren Inhalt haben bzw. Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen müßten oder offenkundig nur scherzhaft gemeint sind. Gleichwohl hat der Präsident immer für den Einzelfall zu entscheiden, wobei er zwischen dem verfassungsrechtlich garantierten Initiativrecht des Abgeordneten einerseits und der Grenze des Mißbrauchsverbots andererseits abzuwägen hat 23 . Nach Abschluß der Überprüfung werden alle nicht zurückgewiesenen Gegenstände - mit Ausnahme der Petitionen - gedruckt und an die Mitglieder des Landtags verteilt 24 . Ist der Druck vor der Beratung nicht möglich, so können sie vorab in anderer Weise vervielfältigt werden 25. Denkschriften und sonstige Eingänge kann der Präsident unmittelbar einem Ausschuß zuleiten 26 . Die Verteilung an die Abgeordneten gilt an Sitzungstagen als vollzogen, wenn die Drucksachen auf die Abgeordnetenplätze gelegt wurden 27 . Ansonsten gelten Drucksachen als verteilt, wenn sie den Abgeordneten in ihren Postfächern bei den Fraktionsgeschäftsstellen zugestellt sind 28 oder bei Fraktionssitzungen den Fraktionen zur Verteilung über22 Achterberg, S. 627. 23 Achterberg, S. 627. 24 § 18 I GOLT-MV; § 23 I GOLT-SH; § 72 GOBü-Br; § 661 GOLT-RP; § 191 GOLT-SA; § 108 I GOLT-Ss; § 51 GOLT-By; § 108 I GOLT-He; § 291 GO-Be. 25 § 521 2 GOLT-Th; § 72 GOBü-Br; § 66 II GOLT-RP; § 29IV GO-Be. 26 § 18 II GOLT-MV; § 23 III GOLT-SH. 27 § 98 II GOLT-Bg; § 19 II GOLT-Nds; § 116 I GOLT-Th; § 123 I GOLT-RP; § 19 II GOLT-SA; § 111 II GOLT-NRW; § 108 III Nr. 1 GOLT-He; § 31 II GOLT-Sl. 28 § 98 I 1 GOLT-Bg; § 19 II GOLT-Nds; § 116 i GOLT-Th; § 123 I GOLT-RP; § 19 II GOLT-SA; § 31 II GOLT-Sl. In Schleswig-Holstein gelten Drucksachen als verteilt, wenn sie am zwölften bzw. achten Tag vor Beginn der Tagung zur Post gegeben worden sind, § 23 II GOLT-SH. In Nordrhein-Westfalen gelten sie als verteilt, wenn sie den Abgeordneten in ihre Wohnung oder an einen von den Abgeordneten oder dem Ältestenrat bestimmten anderen Ort zugestellt sind, § 111 I GOLT-NRW. In Hessen ist die Verteilung zudem vollzogen, wenn die Drucksachen an einen durch Absprache zwischen dem Präsidenten und den Fraktionsvorsitzenden bestimmten Ort im Landtagsgebäude für die Abgeordneten zur Abholung bis
106
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
geben worden sind 29 . Soweit Abgeordnete keiner Fraktion angehören, gilt die Verteilung mit Zustellung in das Postfach bei der Geschäftsstelle des Landtags als vorgenommen30. Landtagsdrucksachen gelten auch dann als verteilt, wenn einzelne Mitglieder des Landtags infolge höherer Gewalt, technischer Schwierigkeiten oder aus zufälligen Gründen oder wegen vorübergehender Abwesenheit erst nach der allgemeinen Verteilung Kenntnis erlangen 31. Der weitere Geschäftsgang ist je nach der Sache verschieden. Die Gesetzesvorlagen werden auf die Tagesordnung gesetzt32, die Anfragen an die Landesregierung weitergereicht 33, die Petitionen, ohne gedruckt und verteilt zu werden, an den Petitionsausschuß überwiesen 34. Regierungsvorlagen, die keiner Beschlußfassung bedürfen, wie ζ. B. Denkschriften, Nachweisungen u.ä., kann der Landtagspräsident mit Zustimmung des Landtags an einen Ausschuß verweisen, ohne sie auf die Tagesordnung zu setzen35. Zu den vorbereitenden Arbeiten des Landtagspräsidenten gehört schließlich die Zusammenstellung und Vervielfältigung der bei der zweiten Beratung eines Gesetzentwurfs beschlossenen Änderungen, bevor der Landtag in die dritte Lesung eintritt 36 . 2. Die Aufstellung der Tagesordnung Als ein wichtiger Punkt der vorbereitenden Arbeiten des Landtagspräsidenten verdient die Aufstellung der Tagesordnung, nach der sich die Arbeit des Plenums vollzieht, besondere Beachtung. Obwohl sie im Vorfeld der Vollversammlung erfolgt, wird sie zu den Arbeiten gezählt, die dem Landtagspräsidenten kraft seiner Leitungsgewalt obliegen 37 . Bei der Tagesordnung handelt es sich um einen imperativen Plan, in dem die in einer bestimmten Sitzung zu erledigenden Beratungsgegenstände verzeichnet sind 38 . Sie legt aber nicht nur die Beratungsgegenstände fest, sondern bestimmt zugleich die Reihenfolge ihrer Behandlung. Üblicherweise 24 Uhr bereitgelegt worden sind, § 108 III Nr. 3 GOLT-He, bzw. bei Versand durch die Post am ersten allgemeinen Zustellungstag nach der Aufgabe, bei Eilzustellung am Tag nach der Aufgabe zur Post, § 108 Nr. 4 GOLT-He. 29 § 19 II GOLT-Nds; § 19 II GOLT-SA; § 108 III Nr. 2 GOLT-He; § 29 III GO-Be. 30 § 98 I 2 GOLT-Bg. 31 § 19 III GOLT-SA; § 108 III GOLT-He. 32 § 50 GOLT-Th; § 591 GO-Be; § 541 GOLT-RP; § 78 I GOLT-BW. 33 § 85 IV GOLT-Th; § 34 III GOLT-He; § 89 IV GOLT-RP; § 30 II GOLT-MV; § 59 I GOLT-Bg. 34 35 36 37 38
§ 99 II GOLT-RP; § 311 GOLT-MV; § 85 GOLT-Bg; §§ 94 ff. GOLT-Th. § 441 GOLT-BW; § 52 III 1 GOLT-Th; § 53 II GOLT-RP; § 33 I GOLT-He. § 461 GOLT-BW, § 45 I GOLT-Ss. Seligmann, S. 22; Kleinschnittger; S. 47; Sperling, S. 17 f. Klinke, S. 97; Gerlach, S. 69; Kleinschnittger, S. 42; Rothaug, S. 97.
II. Die Vorbereitung der Arbeiten des Landtags
107
wird sie als „durchlaufende Tagesordnung" für die Sitzungstage einer gesamten Sitzungswoche aufgestellt 39. Bei der Entstehung der Tagesordnung sind zwei Verfahrensstadien strikt voneinander zu trennen: die Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung im „präplenaren Raum" 40 und die daran anschließende Feststellung der endgültigen Tagesordnung in der Vollversammlung des Parlaments. Beide Schritte sind innerparlamentarische Rechtsakte, unterscheiden sich jedoch darin, daß die Aufstellung zumeist unter Leitung des Landtagspräsidenten interfraktionell vereinbart wird, die Feststellung indessen vom Plenum selbst beschlossen wird 4 1 . Bis zur Feststellung ist die aufgestellte Tagesordnung lediglich ein Vorschlag oder Entwurf 42 . Auch wenn das Recht der Tagesordnung durch seine Handhabung in der parlamentarischen Praxis von Landtag zu Landtag eine jeweils andere Prägung erfahren hat, so stimmt es doch in seinen Grundzügen überein. Die Aufstellung der Tagesordnung fällt zumeist in den Zuständigkeitsbereich der Lenkungsorgane des Parlaments. Dementsprechend obliegt in Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen, Brandenburg und im Saarland dem Präsidium diese Tätigkeit 43 , während sie in Bayern und Thüringen dem Ältestenrat zukommt 44 . Sofern im Ältestenrat kein Beschluß gefaßt werden kann, fällt in Thüringen die Aufstellung dem Präsidium zu 45 . Üblicherweise erarbeitet die Landtagsverwaltung - in Abstimmung mit den Fraktionen - einen Vorschlag für die Tagesordnung, der den Mitgliedern des entsprechenden Gremiums vor dessen Sitzung zugeleitet wird 46 . In Brandenburg ist das Präsidium sogar an eine Entscheidungsfrist gebunden, nach der es spätestens am 7. Tage vor der Plenarsitzung über die Beratungsgegenstände für die Landtagssitzung beschlossen haben soll 47 . Häufig ist aber auch der Landtagspräsident zentrales Organ der Aufstellung. Entweder er stellt die Tagesordnung wie in Hessen und Rheinland-Pfalz aufgrund der Beratungen im Ältestenrat auf 48 oder er allein „setzt die Tagesordnung fest", wie es die Geschäftsordnungen von NordrheinWestfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen vorschreiben 49. Das kann indes nichts anderes 39 Vgl. Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 238. Szmula, in: Röhring/Sontheimer, S. 462. Achterberg, S. 604. 42 Vgl. Ritzel /Bücker, § 20, Anm. II 1 a, S. 2; Kleinschnittger, S. 43; Gerlach, S. 70; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 240; Mühlbauer, S. 13; Spengler, S. 24; Engels, S. 19. 43 § 78 II GOLT-BW; § 18 I GOBü-Br; § 81 II GOLT-Ss; § 18 I GOLT-Bg; § 28 I GOLTSl. 44 § 1001 GOLT-By; § 21 I 2 GOLT-Th. 45 § 21 I 3 GOLT-Th. 46 Vgl. z. B. § 81 II 2 GOLT-Ss. 47 § 18 I 1 GOLT-Bg. 48 § 58 I GOLT-He; § 22 I 1 GOLT-RP. 49 § 38 Satz 1 GOLT-NRW; § 55 II 1 GOLT-SA; § 14 I GOBü-Ha; § 51 I 1 GOLT-SH; § 401 1 GOLT-MV; § 63 II 2 GOLT-Nds.
108
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
bedeuten, als daß der Landtagspräsident die Tagesordnung ohne Beteiligung des Ältestenrats aufstellt. Die eigentliche Feststellung obliegt dem Parlament 50. Der Präsident hat die Möglichkeit, für die Tagesordnung solche Punkte zusammenzufassen, die miteinander in einem sachlichen Zusammenhang stehen51. Eine Trennung dieser Punkte kann durch Einvernehmen im Ältestenrat oder durch Geschäftsordnungsbeschluß des Parlaments erfolgen 52. Mitunter kann der Landtagspräsident sogar in den Parlamenten, in denen grundsätzlich das Präsidium die Aufstellung vornimmt, diese in Ausnahmefällen ebenfalls in eigener Verantwortung durchführen. Voraussetzung ist allerdings, daß der Landtag seinen Präsidenten dazu ermächtigt hat oder aber wegen Beschlußunfähigkeit oder aus anderen Gründen nicht entscheiden kann 53 , also wenn das Parlament sich vertagt hat, ohne einen neuen Sitzungstermin zu bestimmen oder wenn die Sitzung wegen störender Unruhe aufgehoben wird und eine Vereinbarung im Präsidium bzw. Ältestenrat über Termin und Tagesordnung der nächsten Sitzung nicht zu erzielen ist. Anträge auf Aufnahme von Beratungsgegenständen auf die Tagesordnung kann die Regierung, ein Ausschuß, eine Fraktion oder eine sonstige Abgeordnetengruppe, aber auch jeder Abgeordnete stellen. Mitunter besteht jedoch eine Frist für die Aufnahme auf die Tagesordnung. So müssen ζ. B. in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Verhandlungsgegenstände spätestens zwei Wochen bzw. am 12. Tag vor der Tagung bis 12.00 Uhr eingereicht werden 54. Die Anträge werden - wie oben dargestellt - gesichtet und unter thematischen Gesichtspunkten geordnet. In welcher Reihenfolge der Landtagspräsident die Beratungsgegenstände auf die Tagesordnung setzt, orientiert sich an verschiedenen Kriterien. Im Gegensatz zu Berlin und Bremen beispielsweise, die die Reihenfolge nach dem Zeitpunkt des Eingangs bestimmen55, ordnen Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen die Beratungsgegenstände nach der Bedeutung, der Aktualität und unter Berücksichtigung des Sachzusammenhangs56. Kommt in Baden-Württemberg und Sachsen ein Einvernehmen im Präsidium nicht zustande, so gilt für die Aufstellung der Tagesordnung durch das Präsidium die nachstehende Reihenfolge: Erste Aktuelle Debatte, Dringliche Anträge, Gesetzentwürfe, Fraktionsanträge, Große Anfragen, 50 Vgl. S. 107 ff.
51 § 15 V 1 GOBü-Ha; § 51 I 2 GOLT-SH. 52 § 15 V 2 GOBü-Ha. 53 § 77 IV GOLT-BW; § 79 II GOLT-Ss; § 28 II GOLT-Sl. 54 § 40 I 2 GOLT-MV; § 51 I 2 GOLT-SH. Vgl. dazu auch § 58 II GOLT-He, der nach den einzelnen Beratungsgegenständen differenziert. 55 § 59 II 1 GO-Be; § 18 II GOBü-Br. In Berlin ist außerdem vorgesehen, daß bis zum Redaktionsschluß eingegangene Gesetzesanträge und Gesetzesvorlagen auf die Tagesordnung der übernächsten Sitzung gesetzt, aber bereits zur nächsten Sitzung zugestellt werden. Auf einstimmige Empfehlung des Ältestenrats kann das Abgeordnetenhaus jedoch beschließen, daß diese bereits in der gleichen Sitzung behandelt werden, § 59 III 1,3 GO-Be. 56 § 78 I 1 GOLT-BW; § 81 I 1 GOLT-Ss; § 21 I 1 GOLT-Th.
II. Die Vorbereitung der Arbeiten des Landtags
109
Zweite Aktuelle Debatte, sonstige Anträge und Vorlagen, Kleine Anfragen 57. Zudem findet sich in Baden-Württemberg die Besonderheit, daß - abweichend von der genannten Reihenfolge - bei Plenarsitzungen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden, jede Fraktion verlangen kann, daß eine bestimmte eigene Initiative oder Vorlage an einem der Tage als Punkt 2 oder 3 der Tagesordnung behandelt wird. Die Ausübung des Wahlrechts erfolgt im wechselnden Turnus unter den Fraktionen 58. In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hingegen richtet sich die Reihenfolge der Beratungsgegenstände bei mehreren Gesetzentwürfen, Anträgen oder anderen Vorlagen gleicher Art ebenfalls nach dem Eingangsdatum der Vorlagen. Überdies haben dritte Beratungen in der Regel vor zweiten und ersten Beratungen Vorrang, zweite Beratungen vor ersten Beratungen. Gesetzentwürfe haben in der Regel Vorrang vor selbständigen Anträgen und vor Großen Anfragen 59. In Mecklenburg-Vorpommern schließlich empfiehlt der Ältestenrat die Reihenfolge der Beratungsgegenstände, ohne sich dabei an vorgegebenen Kriterien orientieren zu müssen60. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ferner, daß es sowohl in Berlin und Brandenburg als auch in Thüringen ein konkretes Schema für die Unterteilung der Tagesordnung gibt, in das sich die einzelnen Beratungsgegenstände nach den ζ. T. oben genannten Kriterien einreihen 61. Der Landtagspräsident trägt dafür Sorge, daß die Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung den Abgeordneten, den Fraktionen und den Regierungsmitgliedern schriftlich mitgeteilt wird 6 2 . Mitunter wird sie außerdem an den Präsidenten des Landesrechnungshofes und den Landesbeauftragten für Datenschutz übersandt 63. Wird für denselben Tag eine weitere Sitzung anberaumt, so reicht es aus, wenn der Landtagspräsident die Tagesordnung mündlich bekanntgibt64. Dies entspricht der Praktikabilität, da es kaum möglich sein wird, in der Kürze der Zeit noch eine Tagesordnung als Drucksache erstellen und verteilen zu lassen. 57 § 78 I 2 GOLT-BW. Die Sächsische Geschäftsordnung weicht hiervon in § 81 I 2 wie folgt ab: Aktuelle Stunde, Gesetzentwürfe (dritte, zweite, erste Lesung), Große Anfragen, Fraktionsanträge, sonstige Anträge und Vorlagen, Kleine Anfragen. 58 § 78 I 2 2.HS GOLT-BW. 59 § 56 GOLT-SA; § 65 GOLT-Nds. 60 § 40 II GOLT-MV. 61 Entsprechend § 18 II GOLT-Bg und einer Protokollnotiz zu § 59 II GO-Be ergibt sich für die Unterteilung der Tagesordnung im Verhältnis der nachstehenden Punkte untereinander folgende Reihenfolge: a) Fragestunde; b) Aktuelle Stunde; c) Lesung von Gesetzen; d) Große Anfragen; e) Anträge. Für Thüringen gilt gem. § 21 I 3 GOLT folgende Reihenfolge: a) Gesetzentwürfe (dritte Beratung, zweite Beratung, erste Beratung); b) Fraktionsanträge; c) sonstige Vorlagen. 62 § 78 III GOLT-BW; § 81 III GOLT-Ss; § 29 I GOLT-Sl; § 22 I 3 GOLT-RP; § 15 I GOBü-Ha; § 63 IV GOLT-Nds. In Thüringen muß die Tagesordnung gem. § 20 GOLT spätestens am 7. Tag vor der Plenarsitzung übermittelt worden sein. 63 § 38 Satz 2 GOLT-NRW; § 18 I 2 GOLT-Bg. 64 § 57 II GO-Be; § 78 V GOLT-BW; § 81 V GOLT-Ss; § 21 V GOLT-Th. Nach § 40 Satz 2 GOLT-NRW kann der Landtagspräsident in diesem Fall einen Beratungsgegenstand selbständig an eine andere Stelle der Tagesordnung setzen oder von ihr absetzen.
110
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
In Anknüpfung an das eingangs erwähnte Prüfungsrecht des Präsidenten bei der Sichtung der Beratungsgegenstände haben Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eine zweite Prüfungsstufe eingeschoben. Stellt sich nämlich nach Aufstellung der Tagesordnung heraus, daß ein Gegenstand nach den Vorschriften der Verfassung oder der Geschäftsordnung nicht beraten werden darf, so hat ihn der Landtagspräsident von der Tagesordnung abzusetzen65. An die hier geschilderte Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung schließt sich die Feststellung der endgültigen Tagesordnung durch das Parlament. Diese vollzieht sich nach der Einberufung des Landtags und der Sitzungseröffhung. Auf die Besonderheiten der Feststellung im Hinblick auf eine Änderung der Tagesordnung wird deshalb später noch einzugehen sein 66 .
I I I . Die Einberufung des Landtags 1. Das Selbstversammlungsrecht des Parlaments und das Einberufungsrecht des Landtagspräsidenten Als Selbstversammlungsrecht bezeichnet man die Befugnis des Parlaments zur eigenständigen Einberufung der Vollversammlung, indem es selbst den Wiederbeginn seiner Sitzungen bestimmt 67 . Während in der Monarchie noch der Kaiser das Parlament berief, eröffnete, vertagte und Schloß68, berief sich der Reichstag in der Weimarer Republik erstmals selbst ein. Heute gilt das Selbstversammlungsrecht für alle deutschen Parlamente und kann als fester Bestandteil der Parlamentsautonomie aufgefaßt werden. Im Gegensatz zur grundgesetzlichen Regelung in Art. 39 ΙΠ 1 GG hat das Selbstversammlungsrecht nicht in allen Ländern eine verfassungsrechtliche Verankerung gefunden. Das ist aber auch nicht zwingend erforderlich, da sich diese Befugnis aufgrund der allgemeinen Parlamentsautonomie von selbst versteht. Dem Landtag obliegt somit primär die Entscheidung, zu welchem Termin er eine Sitzung durchführen will. In der parlamentarischen Praxis gibt der Landtagspräsident in der Regel vor dem Ende jeder Sitzung den durch Vereinbarung im Ältestenrat oder Beschluß der Vollversammlung festgelegten Termin der nächsten Sitzung bekannt69. Das Parlament kann den Präsidenten im Rahmen des Selbstversammlungsrechts allerdings auch dazu ermächtigen, den Zeitpunkt der Sitzungen eigenverantwortlich festzulegen; entsprechendes gilt in unaufschiebbaren 65 § 66 II GOLT-Nds; § 57 II GOLT-SA. 66 Siehe S. 188 ff. 67 Maunz/ Klein, MD, Art. 39, Rn. 65. 68 Vgl. z. B. § 104 RVerfE 1849, Art. 77 I PrVerfUrk. 1850, Art. 12 RV 71. 69 Vgl. z. B. § 191 GOLT-Th; § 211 GOLT-RP; § 57 I GOLT-He; § 34 II, III GOLT-MV.
III. Die Einberufung des Landtags
111
Fällen 70 oder wenn das Abgeordnetenhaus beschlußunfähig ist bzw. aus einem anderen Grunde nicht entscheiden kann 71 . Die auf einer Ermächtigung fußende oder aus einem anderen Grund erfolgende Einberufung kommt beispielsweise in Betracht, wenn am Sitzungsende der Vollversammlung noch nicht erkennbar ist, zu wann die erneute Einberufung des Parlaments sinnvollerweise möglich ist - etwa, weil eine Regierungsvorlage oder ein Ausschußbericht noch aussteht72. In all den Fällen, in denen der Landtag einen Einberufungsbeschluß gefaßt hat, hat der Landtagspräsident diesen durch eine entsprechende Einladung nur zu vollziehen. Er wird damit lediglich als ausführendes Organ des Parlaments in dessen Selbstversammlungskompetenz tätig 73 . Eine ganze Reihe von Ländern hat dem Landtagspräsidenten allerdings auch ein eigenes, originäres Einberufungsrecht eingeräumt 74. Darin ist jedoch keine Kompetenzverlagerung zugunsten des Parlamentspräsidenten und zulasten des Landtags zu erblicken, sondern beide Kompetenzen bestehen selbständig nebeneinander, wobei das Selbstversammlungsrecht des Landtags den Vorrang genießt75. Dies bedeutet konsequenterweise für die parlamentarische Praxis, daß der Parlamentspräsident bis zum Sitzungsende nicht befugt ist, die Einberufung vorzunehmen, da die Einberufungskompetenz bis zu diesem Zeitpunkt noch vorrangig dem Parlament obliegt 76 . Ebensowenig darf der Landtagspräsident seine Befugnis im Widerspruch zum Willen des Landtags ausüben. Die dem Präsidenten bei der Einberufung des Landtags zugestandene unabhängige Stellung, die keinen weiteren Einschränkungen unterliegt 77, wird in einigen Geschäftsordnungen dadurch unterstrichen, daß er befugt ist, den Landtag Jederzeit" einzuberufen 78. Beruft der Landtagspräsident im Rahmen seiner eigenen Kompetenz das Parlament ein, so obliegt ihm im allgemeinen zugleich auch die Festlegung des Termins. Doch selbst die Verwendung des Wortes »jederzeit" ge70 Vgl. etwa § 57 II GOLT-He. 71 § 21 II GOLT-RP; § 19 II GOLT-Th; § 77 IV GOLT-BW; § 79 II GOLT-Ss; § 28 II GOLT-Sl. 72 Achterberg, S. 599. 73 Demzufolge wird das Selbstversammlungsrecht auch nicht durch die Einberufungsbefugnis des Parlamentspräsidenten durchbrochen. Ebenso Maunz/Klein, MD, Art. 39, Rn 67; Groß, Betrachtungen, DVB1. 1954,422; Achterberg, S. 598; a.A. Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 84, 229. 74 Anders die Rechtslage im Bund. Vgl. dazu Achterberg/Schulte, Art. 39, Rn. 24ff. In Rheinland-Pfalz bedarf der Präsident der ausdrücklichen Genehmigung des Landtags, § 21IV GOLT-RP. 75 Linck, Art. 57, Rn. 9, 10; Achterberg, S. 599. 76 Vgl. Kleinschnittger, S. 37 f.; Achterberg, S. 599. 77 Einschränkungen finden sich in einigen Flächenstaaten dergestalt, daß die Einberufungskompetenz des Landtagspräsidenten auf „besondere" bzw. „unaufschiebbare Fälle" begrenzt ist, vgl. § 461 GOLT-SH; § 77 II 1 GOLT-BW; § 79 III 1 GOLT-Ss; § 35 I GOLT-MV. 78 Art. 57 II 1 LV-Th; Art. 6411 LV-Bg; Art. 83 V 2 LV-He.
112
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
währt ihm nicht die Befugnis, die Terminierung tatsächlich nach freiem Belieben vorzunehmen. Vielmehr unterliegt auch der Präsident als Amtsträger bei Ermessensentscheidungen der pflichtgemäßen Wahrnehmung mit der Folge, daß er einen Termin auszuwählen hat, der eine geordnete Teilnahme und Vorbereitung der Abgeordneten auf diese Sitzung ermöglicht und der im übrigen auch nicht willkürlich sein darf 79 . Nur in wenigen Fällen umfaßt die Einberufung nach eigenem Ermessen außerdem das Recht der selbständigen Festsetzung der Tagesordnung80. Diese Befugnis stößt deshalb auf Bedenken, weil dem Landtagspräsidenten damit die Auswahl der Beratungsgegenstände in die Hände gelegt wird, die in streitigen Fällen unter Umständen mit seiner Funktion als unparteiischer Versammlungsleiter in Konflikt geraten könnte.
2. Besondere Fälle der Einberufung durch den Landtagspräsidenten Bei der Einberufung des Parlaments durch den Landtagspräsidenten sind in einigen Fällen Besonderheiten zu verzeichnen. Dies betrifft zum einen den Zusammentritt des Abgeordnetenhauses nach der Wahl und zum anderen den Zusammentritt infolge des Einberufungsverlangens einer Abgeordnetenminderheit. Entsprechendes gilt, wenn der Landtagspräsident auf Verlangen von Organwaltern der Exekutive ebenfalls ohne eigenen Ermessensspielraum gehalten ist, die Einberufung vorzunehmen. a) Die Einberufung nach der Wahl Weder die Landesverfassungen noch die Landtagsgeschäftsordnungen bestimmen den Zeitpunkt der ersten Einberufung bei Beginn der Wahlperiode auf den Tag genau. Während der Landtagspräsident den Landtag in Bayern spätestens am 15. Tag nach der Wahl einberufen muß, tritt das Parlament in Baden-Württemberg am 16. Tag nach Beginn der Wahlperiode zusammen, in Rheinland-Pfalz am 17. Tag nach der Wahl, in Hessen am 18. Tag nach der Wahl, in NordrheinWestfalen am 20. Tag nach der Wahl, in Hamburg drei Wochen nach der Wahl und in Bremen schließlich spätestens einen Monat nach Ablauf der Wahlperiode 81. Eine ganze Reihe von Ländern hat dagegen spätestens den 30. Tag nach der Wahl als Zeitpunkt des ersten Zusammentritts festgelegt 82. Teilweise ist dabei ausdrücklich geregelt, daß der Landtagspräsident die erste Einberufung jedoch nicht vor 79 Linck, Art. 57, Rn. 10; Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33. so Diese Befugnis findet sich ausschließlich in Art. 21 II 1 LV-Nds; Art 38 III LV-NRW. In Hamburg obliegt der Präsidentin die Festsetzung der Tagesordnung und der Zeit nur, sofern die Bürgerschaft nicht selber darüber beschlossen hat, Art. 22 LV-Ha, § 141 GOBü-Ha. si § 1 I GOBü-Ha; § 2 I GOLT-BW; § 1 I 3 GOLT-By; § 1 GOLT-NRW; § 1 I 1 GOLT-RP. 82 § 1 I GOLT-Ss; § 55 I 2 GOLT-SA; § 1 I GOLT-SH; § 1 I 1 GOLT-Th; § 1 I GOLT-MV; Art. 9 III LV-Nds; Art. 62IV 1 LV-Bg.
III. Die Einberufung des Landtags
113
dem Ende der alten Wahlperiode vornehmen darf, sondern frühestens am Tag danach83. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der sog. formellen Diskontinuität ist es ferner dem vorhergehenden Parlament verwehrt, den Zeitpunkt des Zusammentritts des nachfolgenden Parlaments zu beschließen, da prinzipiell kein Parlament das spätere durch innerparlamentarische Regelungen verfassungsrechtlich binden kann. Dies folgt allein schon aus der Tatsache, daß zwischen dem früheren und dem späteren Parlament kein Rechtsverhältnis bestehen kann, weil beide nicht zu derselben Zeit als Rechtssubjekt existieren 84. Gleichwohl haben die meisten Verfassungen und Geschäftsordnungen die Bestimmung aufgenommen, nach der der Präsident des vorhergehenden Parlaments das nachfolgende Parlament einberuft 85. Lediglich in Baden-Württemberg und Sachsen ist vorgesehen, daß die Einberufung durch den Alterspräsidenten erfolgt 86 . Diese offensichtliche Durchbrechung der „Gewaltenteilung in der Zeit" 8 7 läßt sich allenfalls damit begründen, daß die formelle Diskontinuität bezüglich des Landtagspräsidenten insoweit (punktuell) suspendiert wird, bis der Einberufungsvorgang abgeschlossen ist 8 8 . Der Parlamentspräsident der alten Legislaturperiode wird also in Ansehung dieser Maßnahme noch als Organwalter des sich neu konstituierenden Parlaments tätig, unabhängig davon, wann die Einberufung vorgenommen wird. Auch wenn der Präsident legitimiert ist, die Einberufung des nachfolgenden Abgeordnetenhauses vorzunehmen, so erstreckt sich diese Legitimation nicht mehr auf die Leitung der ersten Vollversammlung, die traditionell dem Alterspräsidenten obliegt 89 .
b) Die Einberufung auf Verlangen einer Abgeordnetenminderheit oder der Landesregierung Aufgrund des entsprechenden Verlangens eines bestimmten Quorums der Mitglieder des Landtags ist der Präsident verpflichtet, unverzüglich das Parlament einzuberufen. Die dafür erforderliche Anzahl der Abgeordneten ist von Parlament zu Parlament verschieden. Während in Rheinland-Pfalz und Bayern ein entsprechen83 Art. 37 LV-RP; Art. 83 II 2 LV-He; Art. 83 IV 1 LV-RP; § 1 I GOLT-By. Vgl. dazu auch Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 m.w.N. 84 Achterberg, S. 597. 85 § 63 I GOLT-Nds; § 1 GOLT-Bg; § 10 I GO-Be; § 1 I 1 GOLT-By; § 1 GOLT-NRW; § 55 I 2 GOLT-SA; § 1 I GOBü-Ha; § 1 I GOLT-SH; § 1 I 2 GOLT-Th; § 1 I GOLT-MV. In Bremen wird diese Aufgabe gem. Art. 81 II LV-Br durch den Vorstand der Bürgerschaft wahrgenommen. 86 Art. 30 III 2 LV-BW; Art. 44 III LV-Ss. 87 Kägi, in: Festschrift für Hans Huber, 1961, S. 151 (167 f.). 88 Achterberg, S. 597. 89 Vgl. dazu oben S. 20. 8 Köhler
114
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
des Begehren von jeweils 1 / 3 der Mitglieder vorliegen muß 90 , wird in den Parlamenten von Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern ein Einberufungsverlangen von 1 / 4 der Abgeordneten gefordert 91 und in den Landtagen von Thüringen, Brandenburg, Berlin und Hessen sogar nur ein Quorum von 1/5 der Mitglieder der Landtags92. In Hamburg ist der Präsident auf Verlangen von 1/10 der Abgeordneten zur Einberufung der Bürgerschaft verpflichtet, wenn seit der letzten Sitzung mehr als ein Monat verflossen ist 9 3 . Und in Schleswig-Holstein schließlich muß der Parlamentspräsident den Landtag einberufen, wenn achtzehn Abgeordnete es verlangen 94. Als einziges Land hat Thüringen eine Bestimmung in die Verfassung aufgenommen, wonach auch bei einem entsprechenden Begehren einer Fraktion eine Einberufungsverpflichtung des Landtagspräsidenten besteht95. Entsprechend § 8 I GOLT-Th. genügen somit also bereits fünf Parlamentarier. In Anbetracht der Tatsache, daß das Quorum für ein Einberufungsverlangen im allgemeinen relativ niedrig angesetzt ist und die Einberufung und Durchführung einer Sondersitzung des Landtags zeit- und kostenträchtig ist, unterliegt dieses Minderheitenrecht in ganz besonderer Weise dem Mißbrauchsverbot. Häufig verlangen die Geschäftsordnungen, daß ein derartiger Antrag nur unter Angabe des Beratungsgegenstandes erfolgen kann 96 , teilweise muß er von den Abgeordneten persönlich unterzeichnet werden 97. Der Landtagspräsident hat daraufhin das Parlament „unverzüglich" einzuberufen. Die Sitzung muß binnen einer angemessenen Zeit, spätestens jedoch zwei Wochen nach Eingang des Antrags stattfinden 98. Dabei ist es zulässig, mit dem Einberufungsverlangen einen bestimmten Terminwunsch zu verbinden, an den der Präsident jedoch nicht gebunden ist. Vielmehr obliegt die Terminbestimmung seinem pflichtgemäßen Ermessen, wobei er - wie auch bei seiner originären Einberufungsbefugnis - den Termin so zu wählen hat, daß das politische Anliegen der Antragsteller nicht etwa durch Zeitablauf ganz oder teilweise obsolet wird. Damit der Präsident sein Ermessen insoweit sachgerecht auszuüben vermag und damit die Sitzung auch in qualifizierter Weise von den Fraktionen vorbereitet werden kann, ist es erforderlich, daß mit dem Einberufungsverlangen zugleich die Tagesordnungspunkte angegeben werden müssen, über die der Landtag zu Beginn der Sitzung mit Mehrheit entscheidet99.
90 Art. 83 V LV-RP; Art. 17 II LV-By. 91 Art. 21 II 2 LV-Nds; Art. 30IV 3 LV-BW; Art. 88 II LV-Br; Art. 38 IV LV-NRW; Art. 44 IV 3 LV-Ss; Art. 45 II LV-SA; Art. 68 Satz 3 LV-Sl; § 35 II GOLT-MV. 92 Art. 57 II 2 LV-Th; Art. 6412 LV-Bg; Art. 42 II LV-Be; Art. 83 V 2 LV-He. 93 Art. 22 Nr. 4 LV-Ha. 94 § 46 II GOLT-SH. 95 Art. 57 II 2 LV-Th. 96 § 17 II GOLT-Bg; Art. 21 II 2 LV-Nds; § 36 II GOLT-NRW; § 55 III 1 GOLT-SA. 97 § 19 III GOLT-Th; § 21 III GOLT-RP. 98 § 63 III GOLT-Nds; § 55 III 3 GOLT-SA; § 37 Satz 1 GOLT-NRW; § 57 IV GOLT-He.
IV. Der Verlauf der Plenarsitzungen
115
Der Landtagspräsident ist außerdem zur Einberufung des Landtags verpflichtet, wenn dies von der jeweiligen Landesregierung verlangt wird 1 0 0 . Hier kann im wesentlichen auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen werden. Allerdings gilt sowohl für das Einberufungsverlangen der Landesregierung als auch für das einer Abgeordnetenminderheit, daß beide eine subsidiäre Stellung gegenüber der Einberufungsbefugnis des Parlaments einnehmen, diese mithin vorrangig ist. Solange also die Vollversammlung noch andauert, befindet die parlamentarische Mehrheit im Rahmen des Selbstversammlungsrechts über die Einberufung. Es ist daher ausgeschlossen, daß an ihrer Stelle der Parlamentspräsident auf Minderheitsverlangen oder Exekutivorganwalter-Verlangen die Einberufung vornimmt 101 . Die der Einberufung folgende Versammlung des Landtags findet in der Regel am Sitze der Landesregierung 102 statt, wobei das Parlamentsgebäude den konkreten Sitzungsort markiert. Diese Grundsätze gelten insbesondere auch für die Länder, die den Sitzungsort weder verfassungsrechtlich noch geschäftsordnungsmäßig erfaßt haben. Die Bestimmung des Sitzungsortes folgt im allgemeinen derjenigen der Zeit der neuen Sitzung 103 .
IV. Der Verlauf der Plenarsitzungen Die ordentlichen Sitzungen des Parlaments sind grundsätzlich sog. Arbeitssitzungen 104 , wobei in Berlin mit Rücksicht auf einen effektiven Gang der Beratungen die Sitzungsdauer sieben Stunden nicht überschreiten soll 1 0 5 . Da die Abgeordneten verpflichtet sind, an den Sitzungen des Landtags teilzunehmen106, haben sie 99 Maunz/ Klein, MD, Art. 39 Rn. 25; Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 39, Rn. 38; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 11; a.A. Ritzel /Bücker, § 21, Anm. II c. 100 Art. 57 II 2 LV-Th, § 19 III GOLT-Th; Art. 64 I 2 LV-Bg, § 17 II GOLT-Bg; Art. 21 II LV-Nds, § 63 III GOLT-Nds; § 46 II GOLT-SH; Art. 22 Nr. 5 LV-Ha; Art. 83 V LV-RP, § 21 III GOLT-RP; Art. 30IV 3 LV-BW; Art. 88 II LV-Br, § 16 II Nr. 3 GOBü-Br; Art. 83 V 2 LV-He, § 57 IV GOLT-He; Art. 17 II 2 LV-By; Art. 38 IV LV-NRW, § 36 II GOLT-NRW; Art. 44 IV 3 LV-Ss, § 79 IV GOLT-Ss; Art. 45 II LV-SA, § 55 III 1 GOLT-SA; Art. 68 Satz 3 LV-Sl; § 35 II GOLT-MV. ιοί Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 84; Achterberg, S. 599; a.A. Ritzel /Bücker, §21, Anm. IIaaa,S.2. 102 Art. 83 I LV-He; Art. 83 III LV-RP. 103 v. Mangoldt/Klein, Art. 39, Anm. V 3; Maunz, MD, Art. 39, Rn. 80. 104 Vgl. § 56 II 1 GO-Be. Aus besonderen Anlässen kann der Präsident mit Zustimmung des Parlaments oder des Ältestenrats aber auch besondere Sitzungen (außerordentliche Sitzungen) einberufen, § 56 II 2 GO-Be; § 461 GOLT-SH; § 35 I GOLT-MV. 105 § 56 III GO-Be. Die Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft vom 6. Oktober 1993 begrenzte in § 35 die Sitzungsdauer auf 22 Uhr. Nach Auskunft der Bürgerschaftsverwaltung hat der Präsident allerdings keine Handhabe, eine Ausdehnung über den genannten Zeitpunkt hinaus zu unterbinden. 106 § 72 GOLT-BW; § 1 II 1 GOLT-SA; § 14 II 1 GOLT-RP; § 47 I GOLT-SH; § 36 I GOLT-MV; § 1 I 2 GOLT-Nds; § 1 I GOBü-Br; § 3 I 1 GOLT-Bg. 8*
116
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
im Falle ihrer Verhinderung den Landtagspräsidenten hiervon rechtzeitig, d. h. spätestens bis zum Beginn der Sitzung, zu unterrichten 107. Ebenso müssen die Abgeordneten, die eine Sitzung vorzeitig verlassen, dem Präsidenten diesbezüglich Mitteilung machen 108 . Zur Überprüfung der tatsächlichen Teilnahme liegt in jeder Sitzung eine Anwesenheitsliste aus, in die sich die Abgeordneten einzutragen haben. Übersieht dennoch ein Abgeordneter die Eintragung, so gilt seine Anwesenheit als nachgewiesen, wenn sie aus dem Sitzungsbericht festgestellt werden kann 109 . Die Verhandlungen des Landtags sind im allgemeinen öffentlich 110 und damit für jedermann zugänglich. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Öffentlichkeit für bestimmte Angelegenheiten - meist mit streng vertraulichem Charakter - auszuschließen111. Beschließt der Landtag den Ausschluß der Öffentlichkeit, so dürfen nur Abgeordnete, Mitglieder der Landesregierung sowie die von dem Präsidenten zugelassenen Personen im Sitzungssaal verbleiben 112 . Zum Sitzungssaal haben indessen während der Sitzungen des Landtags nur Abgeordnete und Mitglieder der Regierung Zutritt. Über Ausnahmen von dieser Regelung entscheidet der Landtagspräsident, wenn es um die Zulassung von Landtagsbediensteten geht, während über die Zulassung von Beamten der zuständige Minister entscheidet113.
1. Die Eröffnung der Sitzungen In früheren Jahren ist die Eröffnung der parlamentarischen Vollversammlung von besonderen Zeremonien begleitet worden. Der Parlamentspräsident betrat als erster den Sitzungssaal und rief anschließend die Abgeordneten über die Hausglocke in den Plenarsaal 114. Auf dieses Prozedere, durch das dem Präsidenten als 107 § 74 I 1 GOLT-BW; § 1 III GOLT-Sl; § 14 IV GOLT-RP; § 47 II GOLT-SH; § 36 II GOLT-MV; § 1 IV GOLT-Nds; § 3 I 2 GOLT-Bg. 108 § 74 II GOLT-BW; § 1 II GOLT-Sl; § 47 IV GOLT-SH; § 36 IV GOLT-MV; § 1 III GOLT-Nds. 109 § 76 I, II GOLT-BW; § 1 I GOLT-Sl; § 14 III GOLT-RP; § 47 III GOLT-SH; § 36 III GOLT-MV; § 1 II GOLT-Nds; § 3 III GOLT-Bg. Die Namen der mit und ohne Entschuldigung in der Sitzung des Landtags abwesenden Abgeordneten werden in das Protokoll aufgenommen, § 3 III GOLT-Bg. no § 60 I GO-Be; § 56 I GOLT-He; § 93 GOLT-By; § 41 Satz 1 GOLT-NRW; § 77 I GOLT-Ss; § 19 I GOLT- RP; § 491 1 GOLT-SH; § 16 I GOBü-Ha; § 38 I 1 GOLT-MV; § 17 I GOLT-Th; § 19 Satz 1 GOLT-Bg. m § 60 II 1 GO-Be; § 56 II 1 GOLT-He; § 41 Satz 2 GOLT-NRW; § 77 II GOLT-Ss; § 19 II GOLT-RP; § 49 I 2 GOLT-SH; § 16 II GOBü-Ha; § 38 I 2 GOLT-MV; § 17 II GOLT-Th; § 19 Satz 2 GOLT-Bg. 112 § 56 III GOLT-He; § 49 II GOLT-SH; § 17 III GOLT-Th; § 19 III GOLT-RP; § 38 II GOLT-MV. 113 § 72 GOLT-BW; § 78 GOLT-Ss; § 17 VI GOLT-Th. 114 Klinke, S. 95, Fn. 1.
I . Der Verlauf der Prsitzungen
117
exponierte Persönlichkeit auch zu Beginn der Sitzung eine besondere Ehre zuteil werden sollte 115 , ist später weitgehend verzichtet worden. Heute erscheint der Parlamentspräsident - meist in Begleitung des Direktors beim Landtag - erst nachdem sich das Parlament versammelt hat. Bei seinem Eintritt erheben sich die Abgeordneten von ihren Sitzen. Der Landtagspräsident nimmt Platz und eröffnet sodann die Sitzung, indem er ausdrücklich erklärt: „Ich eröffne die (erste) Sitzung des (Niedersächsischen) Landtags" oder auch „Die Sitzung ist eröffnet" 116 . Mit diesen Sätzen soll jeweils unzweifelhaft festgestellt werden, daß das geschäftsordnungsmäßige Verfahren begonnen hat 117 . Gibt der Präsident indessen keine ausdrückliche Eröffnungserklärung ab, so gilt die Sitzung als eröffnet, wenn er mit der Bekanntgabe der geschäftlichen Mitteilungen beginnt bzw. den ersten Punkt der Tagesordnung aufruft 118 . Unmittelbar nach der Eröffnung, aber noch vor Eintritt in die Tagesordnung, macht der Landtagspräsident zunächst regelmäßig die erforderlichen geschäftlichen Mitteilungen 119 . Er unterrichtet den Landtag über Eingänge und Vorlagen, von denen dieser in Kenntnis gesetzt werden muß 1 2 0 . Ferner gibt er das Ausscheiden und Neueintreten von Abgeordneten bekannt sowie Fraktionsaustritte und -Wechsel121. Der Landtagspräsident informiert weiterhin über die Ernennung und Entlassung von Ministern und über geänderte Ausschußbezeichnungen122. Des weiteren teilt er dem Landtag die Genehmigung von Aufnahmen in Bild und Ton mit, die nicht für Zwecke des Landtags angefertigt werden 123 . Überdies ist er in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gehalten, zu Beginn der ersten Sitzung einer Tagung die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlußfähigkeit des Landtags festzustellen 124. Ebenso werden vor Eintritt in die Tagesordnung die Urlaubsgesuche erledigt 125 . Urlaub bis zu vier Wochen erteilt im allgemeinen der Präsident, längere Urlaubszeiten der Landtag. Urlaub auf unbestimmte Zeit wird nicht erteilt 126 . Häufig nutzt der Landtagspräsident auch die Gelegenheit, um Gedenkworte aus Anlaß des Todes eines derzeitigen oder früheren Abgeordneten, eines angesehenen Π5 Rummel, S. 43. 116 Ritzel /Bücker, § 26, S. 338; Sperling, S. 22; Bartels, S. 48. 117 Kleinschnittger, S. 47. us Rothaug, S. 97, Fn. 8; Ritzel / Bücker, § 26, S. 338. 119 Vgl. § 191 GOBü-Ha. 120 Vgl. § 77 II GOLT-BW; § 42 II GOLT-NRW; § 24 Satz 2 GOBü-Br. 121 Vgl. § 20 II GOLT-Bg. 122 Vgl. hierzu Rothaug, S. 97. 123 § 17 IV, V GOLT-Th; § 94 III GOLT-By. 124 § 50 II GOLT-SH; § 39 II GOLT-MV; § 701 2 GOLT-SA; § 60 II GOLT-He. 125 Vgl. § 77 I GOLT-BW. 126 § 75 GOLT-BW. Vgl. dazu auch § 14 V GOLT-RP; § 47 V GOLT-SH; § 36 V GOLTMV; § 2 GOLT-Sl; § 1 V GOLT-Nds; § 3 I GOLT-Bg.
118
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
Staatsmannes oder zum Jahrestag eines bedeutenden Ereignisses zu sprechen 127. Schließlich gratuliert er Abgeordneten über 60 Jahren zum Geburtstag und begrüßt neu eintretende Abgeordnete 128. Gelegentlich gibt er auch eine repräsentative Erklärung über Vorfälle ab, die alle Staatsbürger ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Bindung in gleicher Weise betreffen 129.
2. Der Eintritt in die Tagesordnung Nach Eröffnung der Sitzung und Bekanntgabe der geschäftlichen Mitteilungen hat der Landtagspräsident den Eintritt in die Tagesordnung zu veranlassen 130. Zuvor jedoch bedarf es der Feststellung der Tagesordnung. Die Feststellung erfolgt durch das Plenum selbst und zwar entweder durch ausdrücklichen, mehrheitlich gefaßten Beschluß oder aber durch Stillschweigen. Der Landtagspräsident fragt also das Parlament, ob der vorläufigen Tagesordnung widersprochen wird. Erfolgt kein Widerspruch, so gilt die Tagesordnung als festgestellt 131. Wird für mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Sitzungstage eine vorläufige gemeinsame Tagesordnung festgestellt, so gilt die Tagesordnung für den jeweils nachfolgenden Sitzungstag mit Aufruf des ersten Beratungspunktes in der Reihenfolge der nicht erledigten Tagesordnungspunkte als festgestellt, sofern kein Widerspruch erfolgt 132 . Gleichwohl ist es möglich, von der festgestellten Tagesordnung abzuweichen, etwa durch Aufsetzung, Umstellung oder Absetzung von Beratungsgegenständen. Eine Änderung kann natürlich auch schon in der Aufstellungsphase erfolgen und dann die interfraktionelle Vereinbarung über die Tagesordnung modifizieren 133 . Unter Aufsetzung versteht man die Erweiterung der Tagesordnung durch Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes. Der Landtag kann somit auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag einer Fraktion oder einer bestimmten Abgeordnetenzahl beschließen, daß Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, beraten werden 134 . !27 So ζ. B. der Niedersächsische Landtagspräsident Milde zum 10. Jahrestag des Reaktorunglücks in Tschernobyl in der Landtagssitzung am 17. April 1996, Stenographischer Bericht, 13. WP., 52. Sitzung, S. 5435. 128 Kleinschnittger, S. 48. 129 Rothaug, S. 97. 130 Gerlach, S. 69 f. 131 § 22 II 2 GOLT-RP; § 21 II 2 GOLT-Th. Vgl. auch § 58 III 1 GOLT-He. 132 § 22 III GOLT-RP; § 21 II 3 GOLT-Th. 133 Achterberg, S. 607. In dringenden Fällen kann der Landtagspräsident selbst nachträglich die Tagesordnung erweitem. Allerdings ist er verpflichtet, bei Eröffnung der Sitzung die Genehmigung des Landtags einzuholen, vgl. § 28 IV GOLT-Sl. 134 § 59 IV 1 GO-Be; § 78 IV 1 GOLT-BW (zu Sitzungsbeginn); § 100 II 1 GOLT-By; § 391 1 GOLT-NRW; § 81IV 1 GOLT-Ss (zu Sitzungsbeginn); § 571 Nr. 1 GOLT-SA; § 29 II GOLT-Sl (vor Eintritt in die Tagesordnung); § 23 I Nr. 1 GOLT-RP; § 22 I Nr. 1 GOLT-Th; § 661 Nr. 1 GOLT-Nds; § 20ΙΠ GOLT-Bg (vor Eintritt in die Tagesordnung).
I . Der Verlauf der Prsitzungen
119
In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist die Aufsetzung eines Tagesordnungspunktes nur möglich, wenn der Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten dessen Dringlichkeit bejaht 135 . Auch in Hessen können nach Feststellung der Tagesordnung nur noch dringliche Initiativen aufgenommen werden, sofern sich die Tagesordnung noch nicht erledigt ist. Welche Angelegenheiten als dringlich zu betrachten sind, ist in der Geschäftsordnung abschließend aufgezählt. Eines besonderen Parlamentsbeschlusses bedarf es insoweit nicht. Dringlich sind danach Anträge, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen auszusprechen oder zu versagen, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, aus der Mitte des Landtags eingebrachte Gesetzentwürfe, sofern sie von den Initiatoren als dringlich bezeichnet sind und der Landtag die Dringlichkeit bejaht, gleichermaßen Anträge mit dem Verlangen, sie zunächst im Landtag und nicht in einem Ausschuß zu erörtern, sowie Anträge, die die Auflösung des Parlaments begehren 136. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der Landtagspräsident selbst ermächtigt, eine vom Landtag beschlossene Tagesordnung zu erweitern 137 . Nach der Hamburgischen Geschäftsordnung indessen sollen Nachträge nur im Einvernehmen mit dem Ältestenrat auf die Tagesordnung gesetzt werden. Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung oder einem Nachtrag stehen, können nicht verhandelt werden 138 . In einigen Ländern ist die Beratung des aufgesetzten Verhandlungsgegenstandes allerdings ausgeschlossen, wenn eine Fraktion oder mehrere Abgeordnete widersprechen. Die Größe der Sperrminorität ist unterschiedlich. Während in Bayern zwanzig Abgeordnete erforderlich sind, reichen in Niedersachsen und Thüringen zehn Abgeordnete aus, in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt acht und in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sogar nur fünf 1 3 9 . Die Geschäftsordnung des Landtags von Sachsen verlangt einen Widerspruch, der von zehn vom Hundert der Abgeordneten getragen wird 1 4 0 . In den meisten Flächenstaaten kann das Parlament ferner auf Vorschlag des Präsidenten, auf Antrag einer Fraktion oder einer Mindestzahl von Abgeordneten mit der Mehrheit seiner Stimmen beschließen, die Reihenfolge der Beratungsgegenstände zu ändern 141 . Umstellungen dieser Art können sich im Ablauf der Tagesordnung als zweckmäßig erweisen, wenn etwa bei der Behandlung eines 135 § 51 III 1 GOLT-SH; § 40 III 1 GOLT-MV. Vgl. zur Dringlichkeit auch § 63 III GOLTBy und § 21 Satz 2 GOBü-Br. 136 § 59 GOLT-He. 137 § 63 II 3 GOLT-Nds; § 55 II 2 GOLT-SA. 138 § 15 II GOBü-Ha. 139 § 100 II 1 2.HS GOLT-By; § 66 I Nr. 1 2.HS GOLT-Nds; § 22 I Nr. 1 2.HS GOLT-Th; § 23 I Nr. 1 2.HS GOLT-RP; § 57 I Nr. 1 2.HS GOLT-SA; § 78 IV 2 GOLT-BW; § 39 II GOLT-NRW. 140 § 81 IV 2 GOLT-Ss. 141 § 59 VI GO-Be; § 58 III 2 GOLT-He; § 78IV 1 GOLT-BW; § 100 II 2 GOLT-By; § 18 III GOBü-Br; § 81 IV 1 GOLT-Ss; § 57 I Nr. 2 GOLT-SA; § 29 III GOLT-Sl; § 23 I Nr. 2 GOLTRP; § 51 II 2 GOLT-SH; § 221 Nr. 2 GOLT-Th; § 20 ΠΙ GOLT-Bg; § 661 Nr. 2 GOLT-Nds.
120
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
Tagesordnungspunktes Fragen berührt werden, die erst Gegenstand eines späteren sind. Darüber hinaus ermöglichen es einige Geschäftsordnungen, daß verschiedene Punkte der Tagesordnung zusammen beraten werden können 142 . Mitunter wird diesbezüglich ein Sachzusammenhang143 bzw. eine Gleichartigkeit oder Verwandtschaft 144 zwischen den Gegenständen verlangt. Eine gemeinsame Beratung verschiedener Tagesordnungspunkte ist in Bremen ausgeschlossen, wenn der Abgeordnete, der den Antrag eingebracht hat, der Verbindung widerspricht 145 . Im Gegenzug zur Aufsetzung neuer Tagesordnungspunkte kann die Vollversammlung schließlich durch einen entsprechenden Beschluß auch die Absetzung bereits aufgenommener Tagesordnungspunkte bewirken 146 . Neben dem Landtagspräsidenten, der dem Plenum einen gleichlautenden Vorschlag unterbreiten kann, sind wiederum die Fraktionen und eine Mindestzahl von Mitgliedern des Landtags antragsberechtigt. Die Bremische Geschäftsordnung schreibt allerdings vor, daß Tagesordnungspunkte, die von Abgeordneten eingebracht werden, nur mit Zustimmung der Antragsteller wieder abgesetzt werden können 147 . Im Saarland darf die Absetzung zwar gegen den Widerspruch des Einbringers des betreffenden Beratungsgegenstandes erfolgen, aber nur, wenn dieser das Wort zur Begründung seiner Vorlage erhalten hat 1 4 8 . Die Schleswig-Holsteinische Geschäftsordnung ordnet in diesem Zusammenhang an, daß abgesetzte Anträge in der nächsten oder der darauffolgenden Landtagssitzung zu behandeln sind 149 . Doch nicht alle Tagesordnungspunkte unterliegen der Absetzung. Geschäftsordnungsmäßig ausgeschlossen sind in einigen Landtagen etwa Einsprüche gegen Ordnungsrufe oder Ausschlüsse von der Sitzung 150 , mitunter auch Gesetzesvorlagen und Interpellationen 151.
3. Die Eröffnung der Beratung und der Aussprache Steht die Tagesordnung fest, so hat der Präsident jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung steht, zur Beratung aufzurufen und darüber die Aussprache zu 142 § 78 IV 1 GOLT-BW; § 100 III GOLT-By; § 20 GOBü-Br; § 57 I Nr. 3 GOLT-SA; § 29 III GOLT-Sl; § 23 I Nr. 3 GOLT-RP; § 15 VI GOBü-Ha; § 221 Nr. 3 GOLT-Th; § 20 III GOLT-Bg; § 661 Nr. 3 GOLT-Nds. 143 §59 VII GO-Be. 144 § 64 II GOLT-He; § 391 2 GOLT-NRW; § 81IV 1 GOLT-Ss. 145 § 20 Satz 2 GOBü-Br. 146 § 58 III 2 GOLT-He; § 78 IV 1 GOLT-BW; § 100 II 1 GOLT-By; § 39 I 1 GOLT-NRW; § 81IV 1 GOLT-Ss; § 571 Nr. 4 GOLT-SA; § 23 I Nr. 4 GOLT-RP; § 40IV GOLT-MV; § 221 Nr. 4 GOLT-Th; § 20 III GOLT-Bg; § 661 Nr. 4 GOLT-Nds; § 19 I GOBü-Br. 147 § 19 II GOBü-Br. 148 § 29IV 2 GOLT-Sl. 149 § 5 1 I V 2 GOLT-SH. 150 Vgl. z. B. § 80 Satz 2 GO-Be; § 37 VII 2 GOLT-Th; § 53 III 1 GOLT-MV. 151 Vgl. z. B. §§ 541 1,691 GOLT-By.
I . Der Verlauf der Prsitzungen
121
eröffnen, soweit nicht die Geschäftsordnungen besondere Voraussetzungen dafür festlegen 152. Die Beratung erfolgt in der durch die Tagesordnung festgelegten Reihenfolge 1 5 3 . Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat kann der Präsident mitunter auch Gegenstände der Tagesordnung außer der Reihe behandeln lassen154. Der Landtagspräsident kann die Beratung durch ausdrückliche Erklärung einleiten oder durch Aufruf des entsprechenden Tagesordnungspunktes, wobei er in der Regel Titel und Nummer der korrespondierenden Drucksachen nennt. Die Beratung umfaßt inhaltlich das gesamte parlamentarische Verfahren zur Erledigung eines Tagesordnungspunktes in der Vollversammlung des Landtags, also Begründung und Berichterstattung, Aussprache einschließlich Schlußwort und abschließende Abstimmung oder Wahl 1 5 5 . Hingegen unterfallen sowohl die Ausschußarbeit als auch die Abgabe persönlicher oder tatsächlicher Erklärungen außerhalb der Tagesordnung nicht der Beratung. Die Eröffnung der Beratung kann unter Umständen unzulässig sein. Dies ist etwa beim Fehlen der Beratungsgrundlage infolge Rücknahme des Antrags oder NichtVorliegens des Ausschußberichts der Fall 1 5 6 oder aber auch, wenn die Beratungsfähigkeit des Parlaments verneint werden muß, weil es nicht beschlußfähig ist. Mit Feststellung der Beschlußunfähigkeit entfällt die Beratungsfähigkeit, weil der Landtagspräsident die Sitzung dann sofort aufheben muß 1 5 7 . Nach erfolgter Antragsbegründung 1 5 8 oder Berichterstattung eröffnet der Präsident im Rahmen der Beratung zumeist in ausdrücklicher Form die Aussprache. Aber auch eine konkludente Eröffnung der Aussprache ist denkbar, indem er nämlich dem ersten Redner das Wort erteilt 159 . Bei der Aussprache im Plenum handelt es sich um eine mündliche Erörterung des Beratungsgegenstandes, wenngleich die eigentliche Entscheidungsdiskussion weitgehend in fraktionsinternen Gremien und in den Ausschüssen stattfindet, so daß es bei der Aussprache in der Regel nur um einen rhetorischen Kampf um politische Machtpositionen und eine überzeugende 152 § 64 I GOLT-He; § 43 GOLT-NRW; § 81 I GOLT-BW; § 24 I GOLT-RP; § 50 III GOLT-SH; § 23 I 1 GOLT-Th; § 69 I 1 GOLT-Nds; § 21 I GOLT-Bg; § 62 I GO-Be; § 84 I GOLT-Ss; § 601 GOLT-SA. 153 Vgl. § 51 II 1 GOLT-SH. 154 § 59 V GO-Be. 155 Vgl. Ritzel /Bücker, § 23, Anm. a, S. 1; Troßmann, § 27, Rn. 1; ders., Parlamentsrecht und Praxis, S. 57 f. 156 Vgl. Ritzel/Bücker, § 20; Anm. III 2 b, S. 8. 157 § 73 III 1 GO-Be; § 80 II GOLT-BW; § 62 Satz 1 GOLT-He; § 129 III 1, 2 GOLT-By; § 49 I GOLT-NRW; § 83 III 1 GOLT-Ss; § 47 Satz 3 GOLT-Sl; § 70IV 1 GOLT-SA; § 41 IV 1 GOLT-RP; § 40 IV 2 GOLT-Th; § 79 IV 1 GOLT-Nds; § 65 Satz 1 GOLT-Bg. Vgl. zur Beschlußfähigkeit unten S. 140 ff. 158 Vgl. z. B. § 24 III 1, 2 GOLT-RP. Danach erhält bei der Behandlung von Gesetzentwürfen und Anträgen aus der Mitte des Landtags vorab einer der Antragsteller das Wort zur Begründung. 159 Gerlach, S. 71; Böttcher, S. 60; Sperling, S. 24.
122
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
Darstellung der politischen Anschauungen gegenüber der Öffentlichkeit gehen kann 160 . Der Landtagspräsident ist zur Eröffnung der Aussprache verpflichtet, die geschäftsordnungsmäßig ein fester Bestandteil der Beratung ist 1 6 1 . Zudem begründet sie die Voraussetzung dafür, daß jeder Abgeordnete die Gelegenheit hat, von seinem verfassungsrechtlich garantierten Rederecht Gebrauch zu machen 162 . Ausnahmsweise darf der Präsident von der förmlichen Eröffnung der Aussprache absehen, wenn etwa infolge einer interfraktionellen Vereinbarung auf eine Debatte verzichtet wurde und in der Vollversammlung kein Abgeordneter widerspricht 163 . In einer solchen Situation kann der Landtagspräsident gleich zur Abstimmung übergehen. Ein Sonderfall der Verpflichtung des Präsidenten zur Eröffnung der Aussprache tritt ein, wenn ein Mitglied oder Beauftragter der Landesregierung Ausführungen zu einem bereits erledigten Tagesordnungspunkt macht oder außerhalb der Tagesordnung das Wort ergreift, also zu einem Gegenstand spricht, der noch nicht aufgerufen ist bzw. überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Unter diesen Gegebenheiten kann auf Antrag einer Fraktion oder einer Abgeordnetengruppe die Aussprache durch Beschluß eröffnet werden 164 . Anträge zur Sache dürfen dabei nicht gestellt werden. Ebenso wie der Parlamentspräsident kraft seiner Leitungsgewalt die Eröffnung der Aussprache erklärt, so erklärt er auch deren Schluß. Dies geschieht regelmäßig dann, wenn die Rednerliste erschöpft ist und der Präsident durch ausdrückliches Befragen festgestellt hat, daß kein Abgeordneter das Wort zu nehmen wünscht 165 . Die Bayerische Geschäftsordnung sieht in diesem Zusammenhang vor, daß Anträge auf Schluß der Aussprache nach Schluß der Rednerliste mit Unterstützung von fünfzig Abgeordneten gestellt werden können 166 . Teilweise ist vorgesehen, daß der Schluß der Aussprache erst zulässig ist, wenn mindestens ein Abgeordneter oder sogar ein Abgeordneter jeder Fraktion die Möglichkeit hatte, das Wort zu nehmen 167 . In einigen Parlamenten darf der Landtagspräsident über 160 Vgl. Rothaug, S. 103. 161 Vgl. Kleinschnittger, S. 48. 162 Troßmann, § 27, Rn. 2. Vgl. zum Rederecht als Bestandteil des verfassungsrechtlichen Abgeordnetenstatus BVerfGE 2, 143 (171). 163 Vgl. den ausdrücklichen Wortlaut von § 69 I 2 GOLT-Nds und § 23 I 2 GOLT-Th: Die Aussprache unterbleibt, „wenn niemand das Wort wünscht". 164 § 81 II GOLT-BW; § 70 II GOLT-He; § 127 Satz 1 GOLT-By; § 72 II 1 GOLT-NRW; § 86 III 1 GOLT-Ss; § 45 II 1 GOLT-Sl; § 69 III GOLT-SA; § 36 II GOLT-RP; § 58 III 1 GOLT-SH; § 46 III 1 GOLT-MV; § 35 II GOLT-Th; § 78 III 1 GOLT-Nds; § 31 III 1 GOLTBg. 165 § 62 II GO-Be; § 65 I GOLT-He; § 104 I GOLT-By; § 45 I GOLT-NRW; § 84 III GOLT-Ss; § 65 I GOLT-SA; § 24 IV GOLT-RP; § 57 I GOLT-SH; § 20 IV GOBü-Ha; § 45 I GOLT-MV; § 241 GOLT-Th; § 741 GOLT-Nds; § 22 I GOLT-Bg. 166 § 104 III GOLT-By. 167 Vgl. z. B. § 62 III 2 GO-Be; § 22 II 2 GOLT-Bg.
I . Der Verlauf der Prsitzungen
123
einen Antrag auf Schluß der Aussprache erst abstimmen lassen, nachdem einer der Abgeordneten, die den Beratungsgegenstand eingebracht haben, der Berichterstatter und je ein Redner für und wider den Beratungsgegenstand sprechen konnten. Wird einem Antrag auf Schluß der Aussprache widersprochen, so ist vor der Abstimmung über diesen Antrag auch je ein Redner für und wider diesen Antrag zu hören 168 . Ein Antrag auf Schluß der Aussprache ist im übrigen auch in einer Aussprache zur Geschäftsordnung oder über die Feststellung der Tagesordnung zulässig 169 . Nach dem Schluß der Aussprache ist grundsätzlich keine Worterteilung mehr möglich und der Landtagspräsident ist gehalten, alsbald die Abstimmung vorzunehmen oder, falls eine Abstimmung nicht in Betracht kommt, den Tagesordnungspunkt für erledigt zu erklären 170 . Der Schluß der Aussprache bedeutet in diesem Fall also zugleich auch Schluß der Beratung. Eine bereits geschlossene Aussprache darf prinzipiell aus Gründen der Rechtssicherheit nicht wiedereröffnet werden 171 . In der parlamentarischen Praxis ist es allerdings üblich, in bestimmten Konstellationen Ausnahmen zuzulassen, etwa wenn der Landtagspräsident eine schriftliche Wortmeldung übersehen hat oder sie irrtümlich für zurückgenommen hielt. Rechtliche Bedenken gegen diese Handhabung bestehen nicht, da nur auf diesem Wege das Rederecht der betroffenen Abgeordneten aktualisiert werden kann 172 . Eine geschäftsordnungsmäßig angeordnete Wiedereröffnung greift indessen ein, wenn nach Schluß der Aussprache - mitunter auch nach Ablauf der beschlossenen Redezeit - aber vor dem Ende der Beratung ein Mitglied oder Beauftragter der Landesregierung zu dem Verhandlungsgegenstand das Wort ergreift 173 . Diese Regelung entspricht dem Grundsatz, daß Regierungsmitglieder von Verfassungs wegen im Parlament jederzeit gehört werden müssen174. Die Wiedereröffnung erfolgt ipso iure, ohne daß es dazu eines besonderen Beschlusses oder einer in der Praxis allerdings üblichen Erklärung des Präsidenten bedarf 175 . Eine Wiedereröffnung ist in Bayern jedoch ausgeschlossen, wenn die Landesregierung bei der Beratung der Haushalte der einzelnen Ressorts und des Gesamthaushalts zusammenfassend Stellung nimmt, bei der Besprechung einer Interpellation sich zu dem Sach-
»68 Vgl. § 65 II GOLT-SA; § 74 II GOLT-Nds. 169 Vgl. § 46 III GOLT-Sl. no Vgl. § 65 IV GOLT-He. 171 Kleinschnittger, S. 48; Sperling, S. 27; Ritzel/Bücker, § 44, Anm. I a, S. 1. 172 Vgl. Rothaug, S. 104 m.w.N. 173 § 36 I GOLT-RP; § 86 GOLT-BW; § 65 III GOLT-He; § 108 IV 1 GOLT-By; § 72 I GOLT-NRW; § 86 I GOLT-Ss; § 69 II GOLT-SA; § 36 I GOLT-RP; § 58 I 1 GOLT-SH; § 461 GOLT-MV; § 35 I GOLT-Th; § 78 II GOLT-Nds; § 31 II GOLT-Bg. Das gleiche gilt in Schleswig-Holstein, wenn ein Abgeordneter nach Ablauf der festgesetzten Redezeit zu dem Gegenstand das Wort erhält, vgl. § 58 I 2 GOLT-SH. 174 Siehe dazu insbesondere BVerfGE 10,4 (17 f.). 175 Achterberg, S. 612; Rothaug, S. 105; Sperling, S. 24; Kleinschnittger, S. 49.
124
. Abschnitt: Die eung
des Landtagspräsidenten
antrag, ihre Ausführungen entsprächen nicht der Meinung des Hauses, geäußert hat oder aber bei der Beratung einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zusammenfassend Stellung nimmt 1 7 6 . Häufig bestimmen die Geschäftsordnungen, daß ein Antrag auf Schluß der Beratung - ähnlich wie bei der Aussprache - erst dann gestellt werden kann, wenn mindestens ein Vertreter jeder Fraktion die Gelegenheit gehabt hat, zur Sache zu sprechen und seinen Standpunkt darzulegen 177. Über den Antrag, die Beratung zu schließen, wird ohne Aussprache abgestimmt. In einigen Parlamenten ist ausdrücklich geregelt, daß ein vor Beendigung der Aussprache gestellter Antrag auf Schluß der Beratung die Unterstützung einer Fraktion oder einer Abgeordnetengruppe, bestehend aus zehn bzw. acht Abgeordneten, bedarf 178 . Wird der Antrag auf Schluß der Beratung abgelehnt, so kann er, wenn mindestens ein weiteres Mitglied des Landtags gesprochen hat, erneut gestellt werden 179 . Das ermöglicht ein konzentriertes Verfahren. Um einen Tagesordnungspunkt - zumindest vorläufig - zu beenden, besteht meist auch die Möglichkeit, die Vertagung der Beratung zu beschließen180. Liegt dem Landtag allerdings neben dem Antrag auf Vertagung ein Antrag auf Schluß der Beratung vor, so muß der Landtagspräsident zunächst über den Antrag auf Schluß der Beratung abstimmen lassen 181 . Diese Rangfolge gilt dagegen nicht bei einem unzulässigen Antrag auf Schluß der Beratung, da die Geschäftsordnungen nicht gebieten, mit der Abstimmung über einen Vertagungsantrag solange zu warten, bis ein zulässiger Antrag auf Schluß der Beratung vorliegt 182 . Der Vertagungsantrag, der mitunter von einer bestimmten Abgeordnetenzahl getragen sein muß 1 8 3 , hat zur Folge, daß der Beratungsgegenstand in der aktuellen Sitzung nicht weiter behandelt wird, sondern in einer späteren wieder auflebt. Die Geschäftsordnungen schweigen im allgemeinen zu der Frage, innerhalb welchen Zeitraums dies zu geschehen hat. Doch wird es als zulässig angesehen, den Vertagungsantrag mit 176 § 108 IV GOLT-By. 177 § 85 I 1 GOLT-BW; § 65 II 2 GOLT-He; § 45 III 2 GOLT-NRW; § 84 IV 5 GOLT-Ss; § 26 II GOLT-RP; § 57 IV GOLT-SH; § 45 IV GOLT-MV; § 24 II 3 GOLT-Th. 178 § 24 II 1 GOLT-Th; § 74 II 2 GOLT-Nds; § 20 V 2 GOBü-Ha; § 45 III 1 GOLT-MV; § 65 II 2 GOLT-SA; § 26 I 2 GOLT-RP. In Sachsen kann der Landtag einen entsprechenden Beschluß auf Antrag einer Fraktion oder fünf von Hundert der Mitglieder des Landtags fassen, § 84IV 1 GOLT-Ss. 179 § 85 II GOLT-BW. 180 § 62 III 1 GO-Be; § 24 II 1 GOLT-Th; § 21 II 1 GOLT-Bg; § 132 II GOLT-By; § 45 II 1 GOLT-NRW; § 46 I 1 GOLT-Sl; § 2611 GOLT-RP; § 57 II GOLT-SH; § 45 II GOLT-MV. 181 § 62 III 6 GO-Be; § 24 II 2 GOLT-Th; § 132 II 2 GOLT-By; § 26 II 1 GOLT-RP; § 45 III 3 GOLT-MV. 182 Ritzel /Bücker, § 25, Anm. II 2 a, S. 2; Troßmann, § 30, Rn. 17.3. 183 In Berlin und Thüringen sind es jeweils zehn Abgeordnete, §§62 III 2 GO-Be, 24 II 1 GOLT-Th, im Saarland reichen fünf Abgeordnete, § 461 2 GOLT-Sl, in Rheinland-Pfalz acht, § 261 2 GOLT-RP, und in Mecklenburg-Vorpommern vier Abgeordnete, § 45 III 1 GOLT-MV.
I . Der Verlauf der Prsitzungen
125
einem Antrag auf Weiterbehandlung in einer konkret genannten Sitzung zu verbinden 184 . Auf Beschluß des Landtags kann dann über beide Anträge getrennt oder auch gemeinsam abgestimmt werden. Für die Zulässigkeit des Vertagungsantrags kommt es entscheidend auf den Zeitpunkt der Antragstellung an. Anerkanntermaßen kann der Vertagungsantrag nämlich erst nach Eintritt in die Beratung gestellt werden. Anderenfalls, d. h. nach Aufruf des Tagesordnungspunktes und vor Eröffnung der Beratung, handelt es sich um einen Absetzungsantrag. Maßgeblich für den Vertagungsantrag ist also der Moment, in dem nach der Eröffnungserklärung des Landtagspräsidenten dem Antragsteller, Berichterstatter oder sonstigem Redner das Wort zur Sache erteilt worden ist 1 8 5 . Nicht darunter fallen hingegen amtliche Mitteilungen des Landtagspräsidenten oder Anträge und Bemerkungen zur Geschäftsordnung 186. Der Antrag auf Vertagung kann im übrigen auch unzulässig sein, etwa wenn ein Minderheitenrecht auf Aussprache besteht 187 . Wird ein Antrag auf Vertagung gestellt, so kann in der Regel nach Verlesung der Rednerliste neben dem Antragsteller je einem weiteren Abgeordneten für und wider den Antrag das Wort erteilt werden 188 . Von dem Antrag auf Schluß der Aussprache bzw. Beratung ist schließlich noch der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung zu unterscheiden 189. Wird diesem Antrag durch Beschluß des Parlaments entsprochen, so gilt der Beratungsgegenstand als erledigt und der Landtagspräsident muß zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen 190. Im Gegensatz zur Vertagung findet eine spätere Behandlung nicht statt. Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann im allgemeinen nur nach Eröffnung der Beratung bis zur Abstimmung gestellt werden 191 . Wird ihm widersprochen, so erfolgt die Abstimmung erst, wenn sich je ein Abgeordneter für und gegen den Antrag aussprechen konnte 192 . Die Abstimmung hat grundsätzlich Vorrang gegenüber allen anderen Anträgen 193 . Findet der Antrag nicht die erforderliche Mehrheit, so darf er im Laufe derselben Beratung des gleichen Gegenstands nicht wiederholt werden 194 . Für einzelne Beratungsgegenstände ist der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung mitunter ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insiw Troßmann, § 30, Rn. 14. 185 Achterberg, S. 613. 186 Vgl. Troßmann, § 30, Rn. 7. 187 Achterberg, S. 613. 188 Vgl. z. B. § 57 III GOLT-SH; § 45 III 2 GOLT-MV. 189 § 66 I 1 GOLT-He; § 61 I 1 GO-Be; § 87 I GOLT-BW; § 25 I 1 GOLT-RP; § 33 Satz 1 GOLT-SH; § 25 I 1 GOBü-Ha; § 26 Satz 1 GOLT-MV. 190 Vgl. § 66 V GOLT-He. 191 § 66 I 2 GOLT-He; § 87 I 1 GOLT-BW; § 441 1 GOLT-NRW. 192 § 66 II GOLT-He; § 61 I 2 GO-Be; § 44 I 2 GOLT-NRW; § 25 II GOLT-RP; § 33 Satz 2 GOLT-SH; § 26 Satz 2 GOLT-MV. 193 § 66 III 1 GOLT-He; § 61 14 GO-Be; § 44 II GOLT-NRW; § 26 Satz 3 GOLT-MV. 194 § 66 III 2 GOLT-He; § 61 I 3 GO-Be; § 44 I 3 GOLT-NRW; § 33 Satz 3 GOLT-SH; § 25 I 4 GOBü-Ha; § 26 Satz 4 GOLT-MV.
126
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
besondere für Gesetzentwürfe, Vorlagen der Landesregierung, Aktuelle Stunden und Große Anfragen 195 .
V. Die Leitung während der Reden Das Rederecht ist unverzichtbarer Bestandteil des verfassungsrechtlichen Status eines jeden Abgeordneten. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnete es sogar als »Angelpunkt einer demokratisch-parlamentarischen Verfassung" 196. Vor diesem Hintergrund bilden die Reden nicht nur in zeitlicher Hinsicht den Schwerpunkt der parlamentarischen Vollversammlung, sondern auch hinsichtlich ihrer Bedeutung und Tragweite. Die Handhabung der die Redeordnung betreffenden Bestimmungen gehört mithin zu den wichtigsten Aufgaben des Landtagspräsidenten bei der Leitung der Plenarsitzungen. Die folgende Darstellung ist deshalb auch bemüht, der konkreten Ausgestaltung der „parlamentarischen Rede" im Gefüge der Geschäftsordnungsbestimmungen hinreichend Rechnung zu tragen und dabei die in den Ländern bestehenden Unterschiede im Gang der parlamentarischen Verhandlung besonders zu akzentuieren. Selbst wenn der Landtagspräsident nicht immer im direkten Zusammenhang mit den einschlägigen Vorschriften der Redeordnung genannt wird, so hat er gleichwohl darauf zu achten, daß die jeweiligen Vorgaben der Geschäftsordnung zu Form, Dauer und Inhalt der Rede eingehalten werden. In materieller Hinsicht hat er etwa dafür Sorge zu tragen, daß der Redner zum Gegenstand der Verhandlung spricht und nicht auf bereits abgeschlossene Gegenstände zurückgreift, daß sich seine Ausführungen innerhalb des Geschäftsordnungsmäßigen bewegen und daß die Grenzen der jeweiligen Redeform gewahrt sind. In formeller Hinsicht hat der Landtagspräsident u. a. die Vortragsweise und die Innehaltung der durch die Geschäftsordnung vorgegebenen Redezeit zu überwachen. Insoweit bedarf es keiner Erklärung, daß auch die Vorschriften der Redeordnung - zumindest mittelbar - für die Rechtsstellung des Landtagspräsidenten von Bedeutung sind.
1. Die Bestimmung der Rednerreihenfolge Die Reihenfolge der Redner bestimmt in nahezu allen Landtagen der Parlamentspräsident 197, und zwar mangels anderslautender Vorschriften grundsätzlich 195 § 66 IV GOLT-He; § 61 II GO-Be; § 87 II GOLT-BW; § 44 III GOLT-NRW; § 25 III GOLT-RP; § 33 Satz 4 GOLT-SH; § 25 II GOBü-Ha. 196 BVerfGE 2, 143(171). 197 § 63 III 1 GO-Be; § 82 II 1 GOLT-BW; § 69 GOLT-He; § 58 I 1 GOLT-NRW; § 39 I 1 GOLT-Sl; § 61 I 1 GOLT-SA; § 28 I 1 GOLT-RP; § 52 III 1 GOLT-SH; § 21 II 1 GOBü-Ha; § 41 III 1 GOLT-MV; § 27 I 1 GOLT-Th; § 701 1 GOLT-Nds; § 261 1 GOLT-Bg.
V. Die Leitung während der Reden
127
nach seinem Ermessen 198. Demzufolge ist er auch nicht an die Rednerliste gebunden. Obgleich er jede auf dieser Liste vermerkte Wortmeldung zu berücksichtigen hat, ist die Einhaltung der dort festgehaltenen Reihenfolge für ihn in den meisten Landtagen nicht zwingend. Die Reihenfolge der Worterteilung kann vielmehr von der Reihenfolge der Wortmeldung abweichen. Gleichwohl haben sich seine Entscheidungen an dem Grundsatz der gerechten und unparteiischen Verhandlungsleitung zu orientieren. Als Ausfluß dieser Maxime bestimmen die Geschäftsordnungen daher im allgemeinen, daß den Präsidenten bei der Bestimmung der Rednerreihenfolge die Sorge für eine sachgemäße Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Beratung, die Rücksicht auf die verschiedenen Parteirichtungen, auf Rede und Gegenrede und auf die Stärke der Fraktionen leiten sollen 199 . Diese Kriterien fördern eine lebendige Debatte, legen kontroverse Ansichten offen und vermeiden schließlich Disproportionalitäten unter den politischen Gewichten der Aussagen 200 . In Berlin bestimmt der Landtagspräsident, die Rednerreihenfolge unter Berücksichtigung des zeitlichen Eingangs der Wortmeldungen und des Sachzusammenhangs der Aussprache 201. Lediglich in Bayern, Bremen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ist der Präsident verpflichtet, die Reihenfolge der Wortmeldungen einzuhalten und in dieser Abfolge das Wort zu erteilen 202 . Sofern es sachdienlich ist bzw. eine sachgemäße Erledigung und eine zweckmäßige Gestaltung der Beratung fördert, kann der Präsident aber auch ausnahmsweise hiervon abweichen und eine andere Reihenfolge festlegen. Mitunter ist er dabei jedoch an die Zustimmung des Parlaments gebunden bzw. hat sich diesbezüglich mit den Fraktionen ins Benehmen zu setzen 203 . In einigen Landtagen ist vorgesehen, daß nach der Rede eines Mitglieds oder Beauftragten der Landesregierung eine abweichende Meinung zu Wort kommen soll 2 0 4 . Gleichermaßen muß der Landtagspräsident den Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen - auf ihr Verlangen - das Wort erteilen, wenn der Ministerpräsident im Verlauf der Aussprache vorab das Wort ergriffen hat 2 0 5 . Außerdem ist teilweise geregelt, daß bei der Besprechung von Anfragen und der Beratung von selbständigen Anträgen der erste Redner nach dem Begründer des Antrags oder der An»98 y. Brentano, S. 35; Kleinschnittger, S. 52; Mühlbauer, S. 19f.; Sperling, S. 31. 199 § 41 III 2 GOLT-MV; § 26 I 2 GOLT-Bg; § 82 II 2 GOLT-BW; § 39 I 2 GOLT-Sl; § 61 I 2 GOLT-SA; § 28 I 2 GOLT-RP; § 21 II 2 GOBü-Ha; § 27 I 2 GOLT-Th; § 70 I 2 GOLT-Nds. 200 Vgl. Achterberg, S. 617 f. 201 § 63 III 1 GO-Be. 202 § 102 I 2 GOLT-By; § 401 2 GOBü-Br; § 52 III 2 GOLT-SH (Umkehrschluß); § 58 I 2 GOLT-NRW. Nach § 102 III 2 GOLT-By entscheidet der Landtagspräsident beim gleichzeitigen Eingang mehrerer Wortmeldungen nach eigenem Ermessen. 203 § 401 3 GOBü-Br; § 58 I 3 GOLT-NRW; § 52 III 2 GOLT-SH; § 1021 3 GOLT-By. 204 § 41 III 2 2. HS GOLT-MV; § 3912 2. HS GOLT-Sl. 205 § 82 IV GOLT-BW; § 58 III GOLT-NRW; § 52 IV GOLT-SH; § 41 IV GOLT-MV; § 26 III GOLT-Bg.
128
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
frage nicht derselben Fraktion angehören soll wie der Antragsteller 206 bzw. daß die Aussprache in der Regel durch einen Vertreter einer entgegengesetzten Auffassung eröffnet werden soll 2 0 7 . All diese Bestimmungen dienen bei sinnvoller Anwendung durch den Landtagspräsidenten ebenfalls der Lebendigkeit der Debatte, in der nicht über längere Zeitspannen hinweg dieselbe politische Ausrichtung verfestigt werden soll, sondern alternative und kontroverse Standpunkte offengelegt werden sollen. Die Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhauses ermöglicht ferner, daß der Präsident zu Beginn der Aussprache je einem Sprecher jeder Fraktion auf dessen Wunsch hin das Wort erteilen kann 208 . Bei der Beratung von Anträgen hat der Landtagspräsident im übrigen die Sonderstellung der Antragsteller und Berichterstatter zu berücksichtigen. Sie können zumeist sowohl zu Beginn als auch am Schluß der Beratung das Wort verlangen 209 . Im Saarland ist diese Möglichkeit auf das Schlußwort begrenzt 210. Der Präsident muß dabei darauf achten, daß es sich bei dem Schlußwort um keinen kontroversen Diskussionsbeitrag mehr handelt, der die Aussprache der Sache nach wieder eröffnet, sondern daß sich der Redner auf eine abschließende Stellungnahme beschränkt. In Berlin und Nordrhein-Westfalen können Antragsteller und Berichterstatter lediglich vor Beginn der Aussprache vom Landtagspräsidenten das Wort verlangen 211 . In Bremen gilt entsprechendes nur für die Berichterstatter 212. Mitunter sehen die Geschäftsordnungen vor, daß sowohl Berichterstatter 213 als auch die FraktionsVorsitzenden 214 und naturgemäß die Mitglieder der Landesregierung 2 1 5 jederzeit gehört werden müssen. Den Fraktionsvorsitzenden steht dieses Recht nur persönlich zu 2 1 6 . Im übrigen gilt für im Ältestenrat getroffene Vereinbarungen über die Reihenfolge der Redner, daß diese für deren Bestimmung durch den Parlamentspräsidenten durchaus hilfreich sein können, für ihn aber nicht bindend sind 217 .
206 § 82 II 3 GOLT-BW; § 28 II 1 GOLT-RP; § 27 II 1 GOLT-Th. 207 § 58 II 2 GOLT-NRW; § 26 II 2 GOLT-Bg. 208 § 63 II 2 GO-Be. 209 Antragsteller: § 61 II GOLT-SA; § 28 II 2 GOLT-RP; § 70 II GOLT-Nds; § 26 II 1 GOLT-Bg; § 27 II 2 GOLT-Th. Berichterstatter: § 82 II 4 GOLT-BW; § 28 II 2 GOLT-RP; § 27 II 2 GOLT-Th. 210 § 39 II GOLT-Sl. 211 212 213 214
§ 63 II 3 GO-Be; § 58 II 1 GOLT-NRW. § 40 II 1 GOBü-Br. § 61 III GOLT-SA; § 28 II 2 GOLT-RP; § 27 II 2 GOLT-Th; § 70 III GOLT-Nds. § 61 I 3 GOLT-SA; § 701 3 GOLT-Nds.
215 § 63 V 1 GO-Be; § 82 III GOLT-BW; § 70 I GOLT-He; § 27 II GOLT-RP; § 31 I 1 GOLT-Bg; § 40IV GOBü-Br. 216 § 61 I 3 2. HS GOLT-SA; § 701 3 2. HS GOLT-Nds. 217 Vgl. zur Rechtswirkung von Vereinbarungen des Ältestenrats S. 98.
V. Die Leitung während der Reden
129
2. Die Worterteilung In allen Redeordnungen der Länderparlamente besteht der Grundsatz, daß niemand das Wort ergreifen darf, bevor es ihm nicht der Landtagspräsident in Ausübung seiner Leitungsbefugnis erteilt hat 2 1 8 . Dies gilt dem Wortlaut der Bestimmungen folgend allein für Abgeordnete und nicht für Mitglieder oder Beauftragte der Landesregierung, weil die Geschäftsordnung eines Landtags das Inter-OrganVerhältnis zwischen Parlament und Regierung nicht zu regeln vermag 219 . Jedoch unterliegt dieser Personenkreis kraft Verfassungsgewohnheitsrechts der Leitungskompetenz des Landtagspräsidenten und darf daher nach allgemeiner Ansicht ebenfalls erst nach der Worterteilung sprechen 220. Wenn also § 82 I 1 der Geschäftsordnung des Baden-Württembergischen Landtags auch Regierungsvertreter der Worterteilung durch den Präsidenten unterstellt, so hat dies lediglich deklaratorischen Charakter. Ein Recht des Präsidenten zur Worterteilung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Entsprechendes gilt für die Regelung der Brandenburgischen Geschäftsordnung, wonach die Staatssekretäre, der Präsident des Landesrechnungshofes sowie der Landesbeauftragte für Datenschutz erst nach Erhalt des Wortes sprechen dürfen 221 . Da es sich hier ebenfalls nicht um Abgeordnete handelt, kann die Geschäftsordnung keine rechtliche Verpflichtung für sie begründen. Die Bindung an die Worterteilung durch den Präsidenten beruht also auch hier auf Verfassungsgewohnheitsrecht. Allerdings bedürfen nicht alle Äußerungen im parlamentarischen Raum der Worterteilung, sondern nur Reden und Bemerkungen von gewissem Umfang 222 . Nicht dazu gehören Zwischenrufe der Abgeordneten sowie Beifalls- und Mißfallensbezeugungen, die nach parlamentarischem Satzungsgewohnheitsrecht ohne weiteres zulässig sind 2 2 3 . Auf sie kann der Landtagspräsident gegebenenfalls nur aufgrund seiner Ordnungsgewalt Einfluß nehmen 224 . Die Worterteilung erfolgt entweder durch eindeutiges Zeichen oder durch ausdrückliche Erklärung des Parlamentspräsidenten mit den Worten: „Das Wort hat der Abgeordnete N N . " 2 2 5 218 § 63 I 3 GO-Be; § 821 3 GOLT-BW; § 10211 GOLT-By; § 5711 GOLT-NRW; § 85 III GOLT-Ss; § 60 III GOLT-SA; § 38 I GOLT-Sl; § 27 I 1 GOLT-RP; § 52 I GOLT-SH; § 41 I GOLT-MV; § 261 1 GOLT-Th; § 69 III GOLT-Nds; § 25 II GOLT-Bg; § 43 I GOBü-Br. 219 So Achterberg, S. 615. Vgl. hierzu auch S. 228. 220 Ritzel /Bücker, § 27, Anm. I 1 a, S. 1; Troßmann, § 47, Rn. 7; Rummel, S. 52; Kleinschnittger, S. 60; Klinke, S. 104; Mühlbauer, S. 19; Engels, S. 66; Seligmann, S. 93. 221 § 32 II GOLT-Bg. 222 Vgl. Troßmann, § 32, Rn. 1; Seligmann, S. 34. 223 Böttcher, S. 79; Mühlbauer, S. 18; Kleinschnittger, S. 51; Rothaug, S. 105. Vgl. dazu insbesondere § 89 GOLT-Ss: Der amtierende Präsident hat dafür zu sorgen, daß der Redner seine Gedanken ungehindert aussprechen kann; jedoch sind Zwischenrufe von Mitgliedern des Landtags, die eine solche Verhinderung nicht darstellen und nicht zu einem Zwiegespräch mit dem Redner ausarten, gestattet. 224 Seligmann, S. 34; Kleinschnittger, S. 85. 225 Vgl. Kleinschnittger, S. 51; Rothaug, S. 105. 9 Köhler
130
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Der Landtagspräsident kann im übrigen nicht zu jedem Zeitpunkt das Wort erteilen. Die Worterteilung ist beispielsweise während des Redebeitrags eines anderen Abgeordneten ausgeschlossen, sofern sich dieser nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt, wie etwa bei der Zulassung von Zwischenfragen 226. Ebensowenig kann der Landtagspräsident während einer Abstimmung das Wort erteilen, d. h. von Beginn der Aufforderung zur Abstimmung bis zur Verkündigung des Ergebnisses 227 . Hat ein Redner jedoch noch nicht mit seinen Ausführungen begonnen, so kann der Landtagspräsident von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Worterteilung zugunsten eines anderen bevorrechtigten Redners abzuändern, der zunächst übersehen worden war 2 2 8 . Der Worterteilung geht die Wortmeldung voraus. Abgeordnete, die zur Sache sprechen wollen, melden sich also nach Eröffnung der Aussprache schriftlich oder durch Zuruf zu Wort 2 2 9 . In der Regel erfolgt die Wortmeldung bei dem Schriftführer, der die Rednerliste führt, mitunter auch bei einem sonstigen Mitglied des Sitzungspräsidiums, vor allem dem Präsidenten 230. Sie können in zeitlicher Hinsicht ab Eröffnung der Sitzung bis zum Schluß der Aussprache über den Tagesordnungspunkt, zu dem sich der Redner meldet, vorgenommen werden 2 3 1 . Gleichwohl sind sie rechtzeitig vor Aufruf des Tagesordnungspunktes einzureichen, damit der Landtagspräsident die Reihenfolge der Redner sinnvoll koordinieren kann. Mitunter ist vorgesehen, daß die Wortmeldung den Tagesordnungspunkt und die Redezeit enthalten muß 2 3 2 . Obgleich die meisten Geschäftsordnungen die Schriftlichkeit der Wortmeldung als Regelfall vorgeben, der Parlamentspräsident diese teilweise sogar ausdrücklich verlangen kann 233 , werden in der parlamentarischen Praxis aber auch auf andere Weise erfolgende Wortmeldungen berücksichtigt, etwa durch den bereits genannten Zuruf oder durch Zeichen 234 . Der Formmangel der Wortmeldung ist dann geheilt. Anders als bei der schriftlichen Wortmeldung besteht in diesem Fall - sofern Zuruf und Zeichengebung geschäftsordnungsmäßig nicht erwähnt werden - kein Anspruch auf die Worterteilung 235 . 226 Klinke, S. 105; Ritzel/Koch, § 32, Anm. 2, S. 63; Mühlbauer, S. 19; Sperling, S. 28; Seligmann, S. 34. 227 Vgl. § 132 V GOLT-By; § 41 III GOLT-Th. 228 Vgl. Rothaug, S. 106; Troßmann, § 47, Rn. 7. 229 § 63 I 1 GO-Be; § 82 I 1 GOLT-BW; § 102 I 1 GOLT-By; § 85 II GOLT-Ss; § 38 II GOLT-Sl; § 211 GOBü-Ha; § 261 3 GOLT-Th. 230 § 60 II 2 GOLT-SA; § 27 I 2 GOLT-RP; § 102 III 1 GOLT-By; § 52 II GOLT-SH; § 41 II GOLT-MV; § 26 I 2 GOLT-Th; § 69 II 1 GOLT-Nds; § 82 I 2 GOLT-BW; § 85 II a. E. GOLT-Ss. 231 § 102 II 1 GOLT-By. 232 § 85 II GOLT-Ss. 233 § 63 12 GO-Be; § 60 II 2 GOLT-SA; § 69 II 2 GOLT-Nds. 234 § 60 II 3 GOLT-SA; § 69 II 3 GOLT-Nds. 235 Vgl. Achterberg, S. 615.
V. Die Leitung während der Reden
131
Vereinzelt ist in den Parlamenten auch die Möglichkeit der Abtretung der Wortmeldung an andere Abgeordnete geregelt 236 . Befindet sich der Abgeordnete nicht im Plenarsaal, wenn ihm das Wort erteilt wird, so braucht der Präsident die Wortmeldung nicht weiter zu berücksichtigen, die Wortmeldung verfällt 237 . Der Präsident muß dem Abgeordneten jedoch gestatten, sich erneut zum Wort zu melden, solange die Aussprache über den betreffenden Verhandlungsgegenstand noch nicht geschlossen ist 2 3 8 . Lediglich die Bayerische Geschäftsordnung verbietet es in § 102 IV 2 ausdrücklich, daß der Landtagspräsident die Wortmeldung zum selben Gegenstand erneuert. Zieht ein Abgeordneter seine Wortmeldung innerhalb einer Aussprache zurück, so hat er in Bayern ebenfalls nicht mehr das Recht, sich zur Aussprache zur gleichen Sache nochmals zu melden, es sei denn, die Aussprache wird durch die Wortergreifung eines Mitglieds der Staatsregierung oder aus anderen Gründen von neuem eröffnet. Die Zurückziehung der Wortmeldung kann auch mündlich dem Schriftführer gegenüber erfolgen 239 . Will sich der Landtagspräsident selbst an der Debatte beteiligen, so muß er den Vorsitz abgeben und auf die Worterteilung durch den dann amtierenden Präsidenten warten 240 . Im Gegensatz zu den Ministern steht ihm das Recht auf sofortige Worterteilung nicht zu. Der Landtagspräsident ist dadurch den anderen Landtagsmitgliedern als Abgeordneter gleichgestellt; seine präsidiale Vorrangstellung ruht während dieser Zeit. Zum Zwecke der Geschäftsleitung hingegen kann der Präsident jederzeit sprechen 241. Im übrigen kann der Parlamentspräsident als Verhandlungsleiter andere Redner unterbrechen, zumal Sachrufe und ähnliche Maßnahmen sonst nicht angebracht werden könnten 242 . Der Redner muß deshalb sofort schweigen, wenn der Präsident das Wort ergreift oder eine derartige Absicht durch das Läuten der Glocke anzeigt 243 . 3. Besondere Formen der Worterteilung In allen Geschäftsordnungen werden mehrere parlamentarische Äußerungsformen aufgeführt, die sich vom Inhalt des Redebeitrags grundsätzlich unterscheiden und an verschiedene Voraussetzungen geknüpft sind. Dementsprechend muß auch der Landtagspräsident deutlich machen, ob er das Wort zur Sache, zur Geschäfts236 § 21 III GOBü-Ha; § 103 I 1 GOLT-By; § 63 III 2 GO-Be. 237 § 102IV 1 GOLT-By. 238 Troßmann, § 32, Rn. 4. 239 § 102 V GOLT-By. 240 Vgl. dazu oben S. 27. 241 Vgl. Rothaug, S. 105. 242 Kleinschnittger, S. 58; Seligmann, S. 96; Spengler, S. 29. 243 § 29 II GOLT-RP; § 28 III GOLT-Th; § 43 IV GOBü-Br; § 71 II GOLT-He. 9*
132
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Ordnung, zu einer persönlichen Bemerkung, zur Abgabe einer Erklärung oder zur Zwischenfrage erteilt.
a) Die Worterteilung
zur Sache
Erteilt der Landtagspräsident das Wort zur Sache, so ist der Redner berechtigt, inhaltlich zum Beratungsgegenstand Stellung zu nehmen. Die Worterteilung kann daher nur zur Antragsbegründung und in der Aussprache erfolgen 244 . Die Verpflichtung des Landtagspräsidenten, das Wort zur Sachäußerung zu erteilen, besteht jedoch nicht, wenn die Beschlußunfähigkeit des Parlaments festgestellt worden ist oder wenn die Gesamtredezeit abgelaufen ist, die für die Beratung des betreffenden Gegenstandes festgelegt wurde 245 . Ebenso wenig kann das Wort zur Sache erteilt werden, wenn die Zeit, die die Fraktion des Redners zugeteilt bekommen hat, ausgeschöpft ist 2 4 6 . Die Worterteilung zur Sache findet in allen Geschäftsordnungen keine ausdrückliche Erwähnung. Gleichwohl handelt es sich bei dieser Kategorie der Worterteilung um die typische und grundlegende Form einer Worterteilung, so daß insoweit auf die oben gemachten allgemeinen Ausführungen zur Worterteilung zu verweisen ist.
b) Die Worterteilung
zur Geschäftsordnung
Gegenstand der Worterteilung zur Geschäftsordnung ist die verfahrenstechnische Behandlung des gerade anstehenden oder unmittelbar vorhergehenden Beratungsgegenstands oder des Geschäftsplans des Hauses, der die Tagesordnung umfaßt 247 , mitunter auch des Sitzungsplans der Ausschüsse248. Der Landtagspräsident hat also darauf zu achten, daß sich die Redebeiträge auf die Art und Weise der Beratung und die insoweit einschlägigen Geschäftsordnungsbestimmungen beschränken 249. Der Redner kann unter diesen Voraussetzungen etwa Stellung nehmen zur Geschäftsordnungsmäßigkeit eines Berichts oder auf Fragen des Abstimmungsverfahrens eingehen 250 . In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht verkannt werden, daß Bemerkungen zur Geschäftsordnung oftmals nur dann verständlich werden, wenn auf die Sache selbst eingegangen wird. Der Landtagspräsident läßt dies grundsätzlich dann zu, wenn sich der sachliche Gehalt des Redebeitrags 244 Vgl. Rothaug, S. 106. 245 Kleinschnittger, S. 51. 246 Sperling, S. 28; Kleinschnittger, S. 51. 247 § 84 Satz 2 GOLT-BW; § 80 Satz 1 GOLT-He; § 105 III GOLT-By; § 88 I 2 GOLT-Ss; § 66 II 1 GOLT-SA; § 40 II GOLT-Sl; § 32 Satz 2 GOLT-RP; § 29 Satz 2 GOBü-Ha; § 54 II GOLT-SH; § 42 II GOLT-MV; § 75 II 1 GOLT-Nds; § 27 II GOLT-Bg; § 41 Satz 2 GOBü-Br. 248 Vgl. § 59 II GOLT-NRW. 249 Böttcher, S. 85; Klinke, S. 119; Gerlach, S. 78; Mühlbauer, S. 21 f.; Seligmann, S. 39. 250 Vgl. dazu die Nachweise bei Rothaug, S. 107, Fn. 217, 218.
V. Die Leitung während der Reden
133
auf die Erläuterung des die Geschäftsordnung betreffenden Themas bezieht, also keinen Selbstzweck darstellt 251 . Die Wortmeldung eines Abgeordneten ist jederzeit, also auch nach dem Schluß der Besprechung aber nur bis zur Eröffnung der Abstimmung möglich 252 und erfolgt im allgemeinen mit dem Zuruf „Zur Geschäftsordnung" 253. Der Landtagspräsident hat daraufhin dem Abgeordneten unverzüglich das Wort zu erteilen 254 , wobei jedoch die Ausführungen des gegenwärtigen Redners nicht unterbrochen werden dürfen 255 . Geschäftsordnungsmeldungen, die während einer Rede erfolgen, ruft der Landtagspräsident daher unmittelbar im Anschluß an die Rede auf 2 5 6 . Eine unverzügliche Worterteilung bedeutet vor diesem Hintergrund, daß der betreffende Abgeordnete außerhalb der Rednerreihenfolge sprechen kann 257 . In Nordrhein-Westfalen ist vorgesehen, daß der Landtagspräsident einem Redner zum selben Beratungsgegenstand in der Regel nicht öfter als zweimal das Wort erteilen soll 2 5 8 . Während in den meisten Länderparlamenten der einzelne Abgeordnete einen Anspruch gegenüber dem Präsidenten auf die Worterteilung hat, erfolgt sie in Hamburg, Thüringen und im Saarland lediglich nach pflichtgemäßem Ermessen des Landtagspräsidenten, dessen Ausübung jedoch unter dem Vorbehalt einer gerechten und unparteiischen Amtsführung steht 259 . Ein Anspruch auf Bemerkungen zur Geschäftsordnung steht in Thüringen allein dem Fraktionsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter im Amt zu, dem der Landtagspräsident unverzüglich das Wort zu erteilen hat 2 6 0 . Das zum verfassungsrechtlichen Status eines Abgeordneten zählende Rederecht wird im übrigen durch derartige Ermessensentscheidungen deshalb nicht beeinträchtigt, weil sich dieses nur auf Ausführungen zur Sache, nicht aber zur Geschäftsordnung erstreckt 261. Der Landtagspräsident darf das Wort zur Geschäftsordnung indessen nicht erteilen, wenn die Worterteilung geschäftsordnungsmäßig unzulässig ist. Das ist etwa nach Eröffnung der Abstimmung der Fall oder wenn die Plenarsitzung unterbro251 Vgl. Achterberg, S. 620. 252 § 63 IV GO-Be. 253 § 75 I 1 GOLT-Nds; § 80 Satz 1 GOLT-He; § 66 I 1 GOLT-SA; § 105 I 2 GOLT-By. 254 § 105 I 1 GOLT-By; § 75 I 2 GOLT-Nds; § 591 1 GOLT-NRW; § 661 2 GOLT-SA; § 32 Satz 1 GOLT-RP; § 541 1 GOLT-SH; § 421 1 GOLT-MV. Bei gleichzeitig eingehenden Wortmeldungen entscheidet der Präsident, § 105 V GOLT-By. 255 § 66 I 3 GOLT-SA; § 75 I 3 GOLT-Nds; § 54 I 2 GOLT-SH; § 42 I 2 GOLT-MV. 256 § 31 II 2 GOLT-Th; § 105 II 2 GOLT-By. 257 § 59 I 1 GOLT-NRW; § 41 Satz 1 GOBü-Br; § 84 Satz 1 GOLT-BW; § 88 I 1 GOLTSs; § 27 I GOLT-Bg. 258 § 59 I 2 GOLT-NRW. 259 § 29 Satz 1 GOBü-Ha; § 31 I GOLT-Th; § 401 GOLT-Sl. 260 § 31 II 1 GOLT-Th. 261 Achterberg, S. 621.
134
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
chen, aufgehoben oder geschlossen wurde 262 . Die Redezeit bei Bemerkungen zur Geschäftsordnung ist in den meisten Parlamenten genau festgelegt. Üblicherweise dürfen die Redebeiträge danach eine Dauer von fünf Minuten 263 bzw. drei Minuten 2 6 4 nicht überschreiten. In Hamburg stehen dem Redner sogar nur zwei Minuten zur Verfügung 265 . Dabei hat der Parlamentspräsident weder die Möglichkeit der Verlängerung noch der Verkürzung der Redezeit. Häufig, aber nicht unbedingt erforderlich, nutzen die Redner die Worterteilung zur Geschäftsordnung, um daran einen Geschäftsordnungsantrag zu knüpfen 266 . Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere Übergang zur Tagesordnung, Vertagung, Überweisung an einen Ausschuß, Unterbrechung der Tagung, Behandlung unter einem späteren Tagesordnungspunkt, Schluß der Aussprache sowie Schluß der Rednerliste 267 . Nach Stellung eines solchen Antrags erteilt der Landtagspräsident - sofern der Landtag nicht mehr Redner zuläßt und der Antragsteller nicht selbst den Antrag begründet - das Wort nur noch einem Redner für sowie einem Redner gegen den Antrag; insoweit ist die Redezeit auf höchstens fünfzehn Minuten beschränkt 268. Regierungsmitgliedern kann der Landtagspräsident schließlich das Wort zur Geschäftsordnung nicht erteilen 269 . Sie haben allerdings das Recht, Bemerkungen zur Geschäftsordnung im Rahmen ihres Rechts auf jederzeitiges Gehör vorzubringen, jedoch nicht vor der Begründung eines Antrags oder einer Großen Anfrage durch den Antragsteller oder Fragesteller, nicht vor der Berichterstattung und ohne daß ein Redner in seinem begonnenen Vortrag unterbrochen werden darf 270 .
c) Die Worterteilung
zu einer persönlichen Bemerkung
Persönliche Bemerkungen dürfen nur die Zurückweisung eines Angriffs gegen die Person des Redners oder die Berichtigung einer unrichtigen Wiedergabe von Ausführungen zum Gegenstand haben 271 . Anlaß persönlicher Bemerkungen kön262
Vgl. dazu ferner Kleinschnittger, S. 54. 263 § 84 Satz 3 GOLT-BW; § 105 III GOLT-By; § 40 II GOLT-Sl; § 32 Satz 3 GOLT-RP; § 42 II GOLT-MV; § 31 IV GOLT-Th; § 75 II 2 GOLT-SA; § 41 Satz 3 GOBü-Br. 264 § 80 Satz 2 GOLT-He; § 59 II GOLT-NRW; § 88 V GOLT-Ss; § 66 II 2 GOLT-SA; § 54 II GOLT-SH; § 27 II GOLT-Bg. 265 § 22 II Nr. 3 GOBü-Ha. 266 Vgl. Ritzel /Bücker, § 29, Anm. III b, S. 8. 267 Vgl. dazu die Auflistung in § 88 II GOLT-Ss. 268 § 105 IV GOLT-By. 269 Troßmann, § 34, Rn. 12. 270 § 63 V GO-Be; § 82 III GOLT-BW; § 70 I GOLT-He; § 126 I 2 GOLT-By; § 85 V 1 GOLT-Ss; § 27 II 1 GOLT-RP; § 26 II 1 GOLT-Th; § 311 1 GOLT-Bg; § 40IV 1 GOBü-Br. 271 § 65 Satz 2 GO-Be; § 88 II GOLT-BW; § 81 II GOLT-He; § 110 Satz 2 GOLT-By; § 60 Satz 2 GOLT-NRW; § 67 Satz 2 GOLT-SA; § 41 I 2 GOLT-Sl; § 33 II GOLT-RP; § 30 Satz 3
V. Die Leitung während der Reden
135
nen also sowohl die Rede eines anderen als auch diejenige des betreffenden Abgeordneten selbst sein. Unzulässig sind daher Erklärungen, bei denen es sich um die Entgegnung auf Angriffe handelt, die sich gegen dritte Personen oder Personengruppen, etwa Parteien, richten272. Die Angriffe auf die Person des Abgeordneten müssen zudem nicht ausschließlich Inhalt des Redebeitrags eines anderen Abgeordneten sein, sondern können auch durch Zwischenrufe, mitunter auch als Bestandteil von Zwischenfragen erfolgen 273 . In diesem Fall ist der Landtagspräsident gehalten, dem betroffenen Abgeordneten auf Verlangen das Wort zu einer persönlichen Bemerkung zu erteilen. In den meisten Ländern besteht dabei dem Wortlaut nach ein geschäftsordnungsmäßiger Anspruch der Abgeordneten auf Worterteilung. Lediglich in Zweifelsfällen hat der Parlamentspräsident die Möglichkeit, sich durch Rückfragen zu vergewissern, ob es sich bei dem Inhalt der Wortmeldung tatsächlich um eine persönliche Bemerkung handelt. In Sachsen-Anhalt kann der Präsident außerdem verlangen, daß ihm der wesentliche Inhalt der Erklärung schriftlich vorgelegt wird 2 7 4 . Der Landtagspräsident darf das Wort zu einer persönlichen Bemerkung nur nach Schluß der Beratung eines Gegenstandes, jedoch vor Eröffnung der Abstimmung erteilen 275 . Findet keine Abstimmung statt, so erhält der Abgeordnete das Wort vor dem Aufruf des nächsten Tagesordnungspunktes. In Rheinland-Pfalz und in Thüringen kann der Präsident in besonderen Fällen eine persönliche Bemerkung bis zum Schluß der Sitzung sowie zu Beginn der nächsten oder zu Beginn der auf die Verteilung des Plenarprotokolls folgenden Sitzung zulassen276. Ein solcher Fall kann etwa vorliegen, wenn der betreffende Abgeordnete zu dem regulären Zeitpunkt nicht zu einer Reaktion in der Lage war, weil er wegen des genauen Wortlauts die autorisierte Formulierung des Sitzungsberichts abwarten mußte oder aus diesem überhaupt erst von dem Angriff erfuhr, so daß das Bedürfnis nach persönlicher Klarstellung jeweils erst später entsteht277. Auch nach der Bremer Geschäftsordnung hat der Parlamentspräsident verspätete Wortmeldungen zu beGOBü-Ha; § 55 I 2 GOLT-SH; § 43 I 2 GOLT-MV; § 32 II 1 GOLT-Th; § 76 Satz 2 GOLTNds. In Bremen und Sachsen wird der Begriff „persönliche Erklärung" gebraucht, § 42 II GOBü-Br; § 90 II GOLT-Ss. 272 Kleinschnittger, S. 56; Mühlbauer, S. 23; Seligmann, S. 40; Sperling, S. 30. 273 So Ritzel/Bücker, § 31, Anm. 4 e, S. 6; Troßmann, § 35, Rn. 6.1.; Gerlach, S. 78; Achterberg, S. 621. Rothaug weist zutreffend darauf hin, daß eine mögliche Ordnungsmaßnahme des Präsidenten gegen den Zwischenrufer die persönliche Verteidigung qualitativ nicht gleichwertig ersetzen könne, S. 107. Anders hingegen Kleinschnittger, S. 56; Böttcher, S. 86; Mühlbauer, S. 23; Sperling, S. 29 f. 274 § 67 Satz 3 GOLT-SA. 275 § 65 Satz 1 GO-Be; § 88 I GOLT-BW; § 8111 GOLT-He; § 110 Satz 1 GOLT-By; § 60 Satz 1 GOLT-NRW; § 901 GOLT-Ss; § 67 Satz 1 GOLT-SA; § 411 GOLT-Sl; § 3311 GOLTRP; § 30 Satz 1 GOBü-Ha; § 55 I 1 GOLT-SH; § 43 I 1 GOLT-MV; § 321 1 GOLT-Th; § 76 Satz 1 GOLT-Nds; § 42 II GOBü-Br. 276 § 33 I 2 GOLT-RP; § 321 2 GOLT-Th. 277 Vgl. Ritzel/Bücker, § 31 Anm. 4 e, S. 6; Rothaug, S. 107.
136
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
rücksichtigen, wenn etwa die Wortmeldung nach Schluß der Beratung desjenigen Tagesordnungspunktes erfolgt, zu dem die Erklärung abgegeben werden soll. Allerdings darf der Präsident das Wort erst unmittelbar vor Schluß der Sitzung erteilen 278 . Hat der Landtagspräsident einem Abgeordneten das Wort erteilt, so darf dieser im Rahmen der persönlichen Bemerkung nicht zur Sache selbst sprechen, sondern ausschließlich zu den eingangs genannten Themen 279 . Spricht er dennoch zur Sache, so ist ihm durch den Landtagspräsidenten unmittelbar das Wort zu entziehen 2 8 0 . Wird die Beratung durch eine Vertagung unterbrochen, so erteilt der Präsident das Wort zu einer persönlichen Erklärung direkt nach dem Vertagungsbeschluß281. Im übrigen ist etwa der Präsident der Bremer Bürgerschaft gehalten, das Wort zu einer persönlichen Bemerkung grundsätzlich nur einmal zu erteilen 282 . Die Redezeit ist bei persönlichen Bemerkungen geschäftsordnungsmäßig begrenzt. So beträgt sie in Sachsen-Anhalt drei Minuten 283 , in Hessen, NordrheinWestfalen, Niedersachsen und Bremen hingegen fünf Minuten 284 . In RheinlandPfalz, Thüringen und im Saarland darf eine persönliche Bemerkung nur mit Zustimmung des Landtagspräsidenten länger als fünf Minuten dauern 285 . Erfüllt der Abgeordnete diese Voraussetzungen nicht, so kann der Parlamentspräsident von seinem Recht, Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen, Gebrauch machen. Möglichkeiten zur direkten Erwiderung auf eine persönliche Erklärung sind in keiner Landtagsgeschäftsordnung vorgesehen und mithin grundsätzlich als unzulässig zu betrachten 286. Regierungsmitgliedern kann der Präsident das Wort zu einer persönlichen Bemerkung nicht erteilen. Jedoch können sie auch hier im Rahmen ihres Rechts auf jederzeitiges Gehör das Wort ergreifen.
d) Die Worterteilung
zur Abgabe einer Erklärung
Die Worterteilung zur Abgabe einer Erklärung ist inhaltlich weiter gefaßt als die auf zwei Fälle begrenzte persönliche Bemerkung und unterteilt sich in persönliche und sachliche (tatsächliche) Erklärungen. Beide Formen finden sich nicht in allen 278 § 42 III GOBü-Br. 279 Vgl. § n o Satz 3 GOLT-By; § 60 Satz 2 GOLT-NRW; § 41 I 2 GOLT-Sl; § 32 II 1 GOLT-Th. 280 § 32 II 2 GOLT-Th. 281 § 88 III GOLT-BW; § 81 I 1 GOLT-He; § 90 III GOLT-Ss; § 41 I GOLT-Sl; § 3 1 1 1 GOLT-RP; § 55 I 1 GOLT-SH; § 43 11 GOLT-MV; § 3211 GOLT-Th; § 42 II GOBü-Br. 282 § 42 IV 1 GOBü-Br. 283 § 67 Satz 4 GOLT-SA. 284 § 81 I 2 GOLT-He; § 60 Satz 3 GOLT-NRW; § 76 Satz 3 GOLT-Nds; § 42 IV 2 GOBü-Br. 285 § 33 III GOLT-RP; § 32 ΠΙ GOLT-Th; § 41 II GOLT-Sl. 286 Vgl. Achterberg, S. 623; Troßmann, § 35, Rn. 8.
V. Die Leitung während der Reden
137
deutschen Parlamenten wieder, die Mehrzahl hat jedoch entsprechende Vorschriften in die Geschäftsordnung aufgenommen.
aa) Persönliche Erklärungen Der konkrete Inhalt einer persönlichen Erklärung ist geschäftsordnungsmäßig nicht näher bestimmt. Die Geschäftsordnungen umreißen ihn allerdings insoweit, als daß die Erklärung nicht im Zusammenhang mit der Aussprache in der laufenden Sitzung stehen darf, aber einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit des Landtags oder eines seiner Ausschüsse aufweisen muß 2 8 7 . Demnach muß der Landtagspräsident auch Vorkommnisse außerhalb des Landtags als Gegenstand der Erklärung zulassen, sowie Angelegenheiten, die den Abgeordneten sonst betreffen. Voraussetzung ist jedoch immer, daß der Gegenstand das Interesse des Parlaments im engeren Sinne berührt 288 . Ebenso können politische Angriffe gegen einen Abgeordneten oder die Behandlung von Veröffentlichungen in der Presse in diesem Rahmen erfolgen, ohne daß sich der Landtagspräsident zum Einschreiten veranlaßt sehen muß. Der gegenwärtige Beratungsgegenstand kann dagegen schon allein deshalb nicht Erklärungsinhalt sein, weil der Landtagspräsident das Wort grundsätzlich nur außerhalb der Tagesordnung erteilen darf. Die Worterteilung ist also jederzeit mit Ausnahme der Beratung des eventuell in Bezug genommenen Tagesordnungspunktes zulässig 289 . Sie ist somit auch im Anschluß an eine Fragestunde möglich 290 . Ausgeschlossen ist sie dagegen, wenn die Aussprache noch im Gange ist, weil sich die parlamentarische Verhandlung dann noch innerhalb der Tagesordnung bewegt 291 . In aller Regel erteilt der Landtagspräsident das Wort vor Eintritt in die Tagesordnung oder nach ihrer Erledigung, mitunter auch zwischen zwei Beratungen 292. Die Redezeit ist im allgemeinen auf drei Minuten 293 bzw. fünf Minuten 294 beschränkt. Ähnlich wie bei persönlichen Bemerkungen darf der Redner dabei auch grundsätzlich nicht für einen anderen Abgeordneten sprechen 295. Aufgrund des engeren Inhalts der persönlichen Bemerkung in Gestalt von Zurückweisung von Angriffen oder Richtigstellung mißverständlicher Ausführun287 § 66 Satz 1 GO-Be; § 111 I 1 GOLT-By; § 61 Satz 1 GOLT-NRW; § 68 Satz 1 GOLTSA; § 34 Satz 1 GOLT-RP; § 55 II GOLT-SH; § 43 II GOLT-MV; § 33 Satz 1 GOLT-Th; § 77 Satz 1 GOLT-Nds. 288 Vgl. Achterberg, S. 623. 289 Troßmann, § 36, Rn. 12.1.; Blischke, S. 7. 290 Troßmann, § 36; Rn. 3, 7. 291 Achterberg, S. 624; Troßmann, § 36; Rn. 8.1.; a.A. Rothaug, S. 108 mit Bezug auf die parlamentarische Handhabung. 292 Vgl. die Nachweise bei Rothaug, S. 108, Fn. 244, 245. 293 § 68 Satz 2 2.HS GOLT-SA. 294 § 61 Satz 3 GOLT-NRW; § 34 Satz 3 GOLT-RP. 295 Kleinschnittger, S. 57; Sperling, S. 30; Ritzel /Βücker, § 30, Anm. 4 b, S. 5.
138
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
gen, kann man der persönlichen Erklärung in diesem Verhältnis lediglich subsidiären Charakter zugestehen296, den der Landtagspräsident bei der Worterteilung zu beachten hat. Soweit also andere Äußerungsmöglichkeiten bestehen, ist eine persönliche Erklärung ausgeschlossen. Ebenso sind hinsichtlich der Rechtsfolge Unterschiede festzumachen. Während die persönliche Bemerkung den Landtagspräsidenten zur Worterteilung verpflichtet, besteht kein Rechtsanspruch auf eine persönliche Erklärung. Vielmehr steht die Worterteilung im pflichtgemäßen Ermessen des Parlamentspräsidenten. Um diesem eine gerechte Entscheidung zu ermöglichen, ist ihm die Erklärung vorher in schriftlicher Form vorzulegen 297. Dabei dürfte die alleinige Angabe des Zwecks der persönlichen Erklärung im allgemeinen als ausreichend zu bewerten sein 298 .
bb) Sachliche Erklärungen Erteilt der Landtagspräsident das Wort zu einer sachlichen Erklärung, so hat der Redner Gelegenheit, den Landtag auf bestimmte Sachverhalte aufmerksam zu machen 299 . Ein Zusammenhang mit einem konkreten Verhandlungsgegenstand wird meist nicht verlangt. Insoweit kann der Erklärungsinhalt eine Materie nach dem Belieben des Redners behandeln. Erforderlich ist jedoch wiederum, daß der Inhalt der Erklärung für das Parlament von Interesse ist 3 0 0 . Da die sachliche Erklärung im Gegensatz zur persönlichen Erklärung in keinem Subsidiaritätsverhältnis zu anderen Äußerungsformen steht, ist sie in jedem Fall zulässig, unabhängig davon, ob auch eine andere Art der Bemerkung oder Erklärung möglich ist. Ein Sonderfall der sachlichen Erklärung findet sich in Baden-Württemberg und Sachsen mit dem Institut der „sachlichen Richtigstellung", zu der der Landtagspräsident vor der Abstimmung oder vor Schluß der Sitzung außerhalb der Tagesordnung das Wort erteilt 301 . In Bremen kann der Präsident schließlich jederzeit bis zum Schluß der Beratung Abgeordneten das Wort erteilen, die erklären, tatsächliche Aufklärung über den Verhandlungsgegenstand geben zu können. Dabei darf jedoch kein anderer Redner unterbrochen werden 302 . Im übrigen kann auf die Ausführungen zur persönlichen Erklärung verwiesen werden. Insbesondere steht auch hier die Worterteilung im pflichtgemäßen Ermessen des Landtagspräsidenten.
296 Rothaug, S. 108; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 93; Achterberg, S. 623. 297 § 66 Satz 2 GO-Be; § 111 I 2 GOLT-By; § 61 Satz 2 GOLT-NRW; § 34 Satz 2 GOLTRP; § 43 II GOLT-MV; § 55 II GOLT-SH; § 33 Satz 2 GOLT-Th; § 77 Satz 2 GOLT-Nds. 298 Achterberg, S. 624; Troßmann, § 36, Rn. 13.3. 299 § 66 Satz 1 GO-Be; § 111 I 1 GOLT-By. Vgl. zudem zur inhaltlichen Bestimmung, Achterberg, S. 624. 300 Troßmann, § 36, Rn. 9. 301 § 89 GOLT-BW; § 91 GOLT-Ss. 302 § 42 I GOBü-Br.
V. Die Leitung während der Reden
e) Die Worterteilung
139
zu einer Zwischenfrage
Während der Rede eines Abgeordneten können die anderen Mitglieder des Landtags Zwischenfragen an den Redner stellen 303 . Zu diesem Zweck begibt sich der jeweilige Abgeordnete zu einem der Saalmikrofone und wartet ab, bis der Landtagspräsident den Redner gefragt hat, ob er eine Zwischenfrage zuläßt. Wenn der Redner bejaht, erteilt der Präsident das Wort zur Zwischenfrage 304. In Hamburg können Abgeordnete, die eine Zwischenfrage zu stellen wünschen, dies gegenüber dem Präsidenten dadurch kenntlich machen, daß sie sich von ihren Plätzen erheben 305. Mitunter können Abgeordnete die Zwischenfrage auch von ihrem Platz aus stellen 306 . Zwischenfragen müssen kurz und präzise formuliert sein und dürfen weder Wertungen noch eigene Stellungnahmen des Fragenden enthalten307. Dabei hat der Landtagspräsident darauf zu achten, daß sie in sachlicher Hinsicht den Verhandlungsgegenstand betreffen und Fragecharakter haben, d. h. streng die grammatische Frageform einhalten 308 . Bemerkungen lediglich feststellenden oder wertenden Charakters erfüllen die Voraussetzung nicht und stellen daher schon begrifflich keine Zwischenfrage dar. Demzufolge ist auch der Mißbrauch von Zwischenfragen zu selbständigen Redebeiträgen vom amtierenden Präsidenten sofort zu unterbinden 3 0 9 . Im Vordergrund steht bei diesem Institut der Dialogzweck, indem Rede und Gegenrede einander gedrängt gegenübertreten und so ein rascher Gedankenaustausch stattfindet, der den Entscheidungsprozeß transparenter gestaltet310. Zwischenfragen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich erst dann gestattet, wenn der Landtagspräsident die Aussprache zu einem Gegenstand eröffnet hat. Nach Beendigung der Aussprache werden sie vom Präsidenten zurückgewiesen 311. Voraussetzung ist weiterhin, daß der Redner einen gewissen gedanklichen Abschnitt seiner Ausführungen abgeschlossen hat 3 1 2 . Hat der Redner noch gar nicht mit seinen Ausführungen begonnen, so kommen Zwischenfragen schon rein begrifflich nicht in Betracht. 303 § 63 VIII 1 GO-Be; § 82 VII GOLT-BW; § 74 I GOLT-He; § 116 I GOLT-By; § 64 I GOLT-NRW; § 85 VIII GOLT-Ss; § 60 IV GOLT-SA; § 31 I GOLT-RP; § 24 I GOBü-Ha; § 53 Satz 1 GOLT-SH; § 30 I GOLT-Th; § 69 IV GOLT-Nds; § 29 I GOLT-Bg; § 44 Satz 1 GOBü-Br. 304 § 82 VII 3 GOLT-BW; § 116 II 1 GOLT-By; § 85 VIII 2 GOLT-Ss; § 29 II 2 GOLT-Bg. 305 § 24 I 2 GOBü-Ha. 306 Vgl. z. B. § 63 VIII 1 GO-Be. 307 § 74 II GOLT-He; § 116 II 2 GOLT-By; § 64 II 2 GOLT-NRW; § 85 VIII 2 GOLT-Ss; § 31 II 1 GOLT-RP; § 53 Satz 2 GOLT-SH; § 30 II 1,2 GOLT-Th; § 291 3 GOLT-Bg. 308 Troßmann, § 32 GOBT, Anh., Rn. A 8; Achterberg, S. 616. 309 Vgl. § 85 VIII 3 GOLT-Ss. 310 Scheuner, Festschrift für Eschenburg, S. 143 ( 150); Achterberg, S. 616. 311 §11611,2 GOLT-By; § 64 I 1, 2 GOLT-NRW; § 29 I 1, IV GOLT-Bg. 312 Vgl. Troßmann, § 32, Anh., Rn. A 5.1.
140
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Zwischenfragen sind geschäftsordnungsmäßig unzulässig bei Regierungserklärungen, Kundgebungen der Landesregierung und Erklärungen des Präsidenten sowie förmlichen Erklärungen der Fraktionen 313 . Entsprechendes gilt für Aussprachen im Anschluß an Mündliche Anfragen und Aktuelle Stunden 314 , was auf die für letztere geltenden strengen Redezeitbegrenzungen zurückzuführen ist. Außerdem sind Zwischenfragen vom Präsidenten zurückzuweisen, wenn das Wort zu einer persönlichen Bemerkung, einer persönlichen Erklärung oder einer sachlichen Erklärung erteilt ist. Ebensowenig läßt der Präsident Zwischenfragen in Fragestunden z u 3 1 5 . Sofern der Landtagspräsident Zwischenfragen als unzulässig bewertet hat, kann sich der Redner nicht bereit erklären, sie dennoch zu beantworten, da es sich dabei nicht um ein disponibles Recht handelt, über das der Redner beliebig verfügen kann 3 1 6 . Nur bei erlaubten Zwischenfragen steht es im Ermessen des Redners, sie zuzulassen oder abzulehnen. Im übrigen darf der Landtagspräsident keine Zwischenfragen zulassen, die nicht an den Redner, sondern an Abgeordnete im Plenum gerichtet sind. Entsprechendes gilt für Gegenfragen des Redners an den Zwischenfrager 317 . Zwischenfragen sind während einer Rede grundsätzlich in beliebiger Anzahl zulässig 318 . An sie können im allgemeinen Zusatzfragen geknüpft werden. Dabei handelt es sich um Fragen, deren Gegenstand im Sachzusammenhang mit der gestellten Hauptfrage steht 3 1 9 . Diese sind jedoch nur in begrenzter Zahl möglich. Im allgemeinen können im gleichen Zusammenhang nur zwei Zusatzfragen gestellt werden 3 2 0 . Ist die Redezeit des Redners durch Zwischenfragen in erheblichem Umfang in Anspruch genommen worden, so hat der Landtagspräsident die Möglichkeit, diese entsprechend zu verlängern 321 . In Brandenburg darf die Beantwortung einer Zwischenfrage nicht auf die Rededauer des jeweiligen Redners angerechnet werden 3 2 2 .
4. Die äußere Form und die Dauer der Reden Der Landtagspräsident hat darauf zu achten, daß die Redner grundsätzlich in freiem Vortrag sprechen 323 . Allerdings ist es ihnen gestattet, „zur Stützung des 313 314 315 316 317 318 319 320
§ 24 II GOBü-Ha. Vgl. § 31 I 1 GOLT-RP; § 301 1 GOLT-Th. Achterberg, S. 616. Achterberg, S. 616m.w.N. Rothaug, S. 108 m.w.N. § 116 III GOLT-By. Achterberg, S. 616. § 63 VIII 2 GO-Be; § 116 III 2 GOLT-By; § 64 III GOLT-NRW; § 31 II 2 GOLT-RP.
321 § 82 VII 4 GOLT-BW; § 85 VIII GOLT-Ss. 322 § 29 III 1 GOLT-Bg.
V. Die Leitung während der Reden
141
Gedächnisses" stichwortartige Aufzeichnungen zu benutzen 324 . Mitunter ist angeordnet, daß derartige Redemanuskripte nach Beendigung der Rede dem Landtagspräsidenten für den Stenographischen Dienst vorübergehend zur Verfügung gestellt werden 325 . Ausnahmsweise ist es aber auch möglich, eine im Wortlaut vorbereitete Rede zu verlesen, wenn vorab die Erlaubnis des Landtagspräsidenten eingeholt wurde 3 2 6 . Die Redner haben in diesem Fall ebenfalls den verlesenen Text dem Stenographen zur Verfügung zu stellen 327 . Dem Präsidenten steht es jedoch frei, unter Umständen eine einmal erteilte Erlaubnis zur Verlesung einer Rede wieder zurückzunehmen 328 . Verliest der Redner dennoch ohne dessen Einwilligung eine im Wortlaut vorbereitete Rede, so hat der Landtagspräsident den Abgeordneten zu ermahnen. Nach einer weiteren Mahnung ist er berechtigt, ihm das Wort zu entziehen 329 . Unbedenklich ist hingegen die Verlesung von Zitaten, sofern die Redner diese als solche kenntlich machen 330 . Mitunter gilt dies auch für Anfragen und Anträge 3 3 1 . Im übrigen dürfen schriftlich formulierte Ausführungen nur von Berichterstattern sowie von Mitgliedern oder Beauftragten der Landesregierung vorgetragen werden 3 3 2 . In Hessen sind schriftlich formulierte Ausführungen ferner zulässig bei Stellungnahmen der Vertreter der Fraktionen zur Regierungserklärung und zum Haushaltsgesetz333. Andere als die genannten Hilfsmittel dürfen in der Vollversammlung grundsätzlich nicht benutzt werden. Auf Antrag kann jedoch in Bayern der Ältestenrat über Ausnahmen beschließen. Der Antrag muß so rechtzeitig gestellt werden, daß dadurch die Ablauf der Sitzung und die Ansetzung der Tagesordnung nicht gestört wird. Dem Ältestenrat bleibt es unbenommen, seine Zustimmung an zeitliche und sachliche Bedingungen zu knüpfen; seine Entscheidung ist endgültig. Die Kosten trägt ferner derjenige, der sich des weiteren Hilfsmittels bedient 334 . 323 § 63 VI 1 GO-Be; § 83 GOLT-BW; § 71 I 1 GOLT-He; § 107 I 1 GOLT-By; § 62 Satz 1 GOLT-NRW; § 87 I 1 GOLT-Ss; § 63 I 1 GOLT-SA; § 43 I 1 GOLT-Sl; § 29 I 1 GOLT-RP; § 21 V 1 GOBü-Ha; § 56 I 1 GOLT-SH; § 44 I GOLT-MV; § 28 I 1 GOLT-Th; § 72 I 1 GOLT-Nds; § 43 II 1 GOBü-Br. 324 § 63 VI 2 GO-Be; § 71 I 2 GOLT-He; § 107 I 3 GOLT-By; § 62 Satz 2 GOLT-NRW; § 87 I 2 GOLT-Ss; § 63 I 2 GOLT-SA; § 43 I 2 GOLT-Sl; § 29 I 2 GOLT-RP; § 56 I 2 GOLTSH; § 44 I 2. HS GOLT-MV; § 28 I 2 GOLT-Th; § 72 I 2 GOLT-Nds. 325 § 62 Satz 3 GOLT-NRW. 326 § 63 II 1 GOLT-SA; § 43 I 4 GOLT-Sl; § 72 II 1 GOLT-Nds; § 43 III 1 GOBü-Br. 327 § 43 III 2 GOBü-Br. 328 § 72 II 2 GOLT-Nds. 329 § 28 II GOLT-Th; § 43 III GOLT-Sl; § 72 II 3 iVm. 71 III GOLT-Nds; § 63 II 3 iVm. § 62 III GOLT-SA. 330 § 63 I 3 GOLT-SA; § 43 I 3 GOLT-Sl; § 72 I 3 GOLT-Nds. 331 §21 V 2 GOBü-Ha. 332 § 71 I 3 GOLT-He; § 107 III GOLT-By; § 87 II GOLT-Ss; § 63 III GOLT-SA. 333 §71 14 GOLT-He. 334 § 107 II GOLT-By.
142
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Die Redner richten ihre Ausführungen ausschließlich an den Landtag 335 , wobei die Redebeiträge grundsätzlich von Rednerpult aus gesprochen werden 336 . Der Präsident hat die Möglichkeit, hiervon Ausnahmen zuzulassen. Dies gilt insbesondere für kurze Bemerkungen zur Geschäftsordnung 337. Gleichermaßen hat der Ältestenrat des Baden-Württembergischen Landtags beschlossen, daß kurze Erklärungen von Platz des Redners aus über das Tischmikrofon abgegeben werden. Diese Absicht kann bereits bei der Wortmeldung angekündigt werden, die üblicherweise bei einem Schriftführer erfolgt. Auch Reden vom Platz aus werden auf die festgelegten Redezeiten angerechnet 338. Ebenso können die Abgeordneten in aller Regel auch bei Fragestunden und mitunter bei Zwischenfragen von ihrem Platz aus sprechen 339. Das Rederecht ist - wie bereits mehrfach erwähnt - wesentlicher Bestandteil des verfassungsrechtlichen Status eines jeden Abgeordneten. Um einen geordneten Geschäftsgang der Vollversammlung zu ermöglichen, ist es erforderlich, die Redezeit zu begrenzen. Dies kann durch Parlamentsbeschluß geschehen oder durch interfraktionelle Vereinbarungen. Häufig ist die Redezeit bereits durch Geschäftsordnungsbestimmungen beschränkt. Aber selbst für den Fall, daß eine entsprechende Begrenzungsmöglichkeit geschäftsordnungsmäßig nicht vorgesehen ist, wird man eine solche für zulässig erachten müssen, weil es sich dann um eine Ergänzung der Geschäftsordnung durch autonomes Parlamentsrecht für den Einzelfall handelt 340 . Die Redezeitbeschränkungen können sich dabei sowohl auf die dem einzelnen Redner zustehende als auch auf die jeder Fraktion zukommende Gesamtredezeit beziehen 341 . Auf diese Weise sollen Phänomene verhindert werden, die der im US-Parlamentarismus anzutreffenden Möglichkeit des „filibuster" entsprechen. Redezeitbegrenzungen sind im übrigen mit dem oben genannten Rederecht insoweit zu vereinbaren, als sie dem Erfordernis des ungestörten Verhandlungsablaufs dienen und müssen mithin unter diesem Aspekt dem Gebot der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen 342. Die Einhaltung der Redezeit obliegt dem Parlamentspräsidenten. Zur Bestimmung der Redezeit kann der Parlamentspräsident in den Volksvertretungen der Länder überwiegend auf spezielle Vorgaben der parlamentarischen Geschäftsordnung zurückgreifen 343. Diese verfolgen einerseits das Ziel, die Ver335 § 82 VI GOLT-BW; § 85 VII GOLT-Ss. 336 § 63 VI 1 GO-Be; § 71 III 1 GOLT-He; § 107 I 1 GOLT-By; § 29 III 1 GOLT-RP; § 21IV 1 GOBü-Ha; § 43 II 1 GOBü-Br. 33? § 71 III 2 GOLT-He; § 29 III 2 GOLT-RP; § 28 IV 2 GOLT-Th; § 43 II 2 GOBü-Br; § 21IV 2 GOBü-Ha; § 107 I 2 GOLT-By. 338 Beschluß des Ältestenrats des Baden-Württembergischen Landtags vom 22. 10. 1981. 339 § 71 III 2 2. HS GOLT-He; § 29 III 2 2. HS GOLT-RP; § 28 IV 2 2. HS GOLT-Th. 340 So Achterberg, S. 619, Fn. 88. 341 Vgl. den Wortlaut von § 83a 11 GOLT-BW. 342 Vgl. BVerfGE 10, 12, 14.
V. Die Leitung während der Reden
143
handlungen zu einem Gegenstand zeitlich zu konzentrieren und die Redner zu sachlicher und knapper Vortragsweise zu zwingen, andererseits allen Parteien gleiche zeitliche Möglichkeiten zur Stellungnahme zu gewähren. Ein besonders detailliertes Regelwerk steht dabei dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses zur Verfügung 344 . Mitunter ist für den Landtagspräsidenten aber auch ein entsprechender Beschluß des Parlaments maßgeblich, gegebenenfalls mit von der Geschäftsordnung abweichenden Regelungen345. Dem Landtagsbeschluß geht in Brandenburg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen regelmäßig ein Vorschlag des Ältestenrats oder des Präsidiums voraus. In den Landtagen von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ist auch der Landtagspräsident vorschlagsberechtigt, in Schleswig-Holstein nur im Benehmen mit dem Ältestenrat. Dem Nordrhein-Westfälischen Landtagspräsidenten steht überdies in Ausnahmefällen das Recht zu, einzelnen Rednern das Wort zu dem Beratungsgegenstand für einen Redebeitrag bis zu fünf Minuten zu erteilen 346 . In Baden-Württemberg hat sich der Präsident hingegen zunächst nach den Redezeitbeschlüssen des Präsidiums zu richten347. Der Landtag kann die Beschlüsse jedoch auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag einer Fraktion ändern 348 . In Hessen kann neben dem Parlament auch der Ältestenrat Beschlüsse treffen, die für den Präsidenten verbindlich sind 3 4 9 . In Thüringen bedürfen Abweichungen von den Vorgaben der Geschäftsordnung grundsätzlich des Einvernehmens im Ältestenrat 350 . Aufgabe des Landtagspräsidenten ist es, die Einhaltung der Redezeit zu überwachen und den Redner auf den Ablauf der Redezeit hinzuweisen. Spricht ein Abgeordneter über die festgesetzte Redezeit hinaus, so kann ihm der Präsident nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen351. Lediglich im Saarland ist der Präsident verpflichtet, den Redner zweimal zu ermahnen 352. Ist dem Redner das Wort entzogen, so darf es ihm der Landtagspräsident zu demselben Beratungsgegen343 § 83a GOLT-BW; § 28 GOLT-Bg; § 45 GOBü-Br; § 108 GOLT-By; § 44 GOLT-MV; § 22 f. GOBü-Ha; § 72 GOLT-He; § 71 GOLT-Nds; § 62 GOLT-SA; § 63 GOLT-NRW; § 30 GOLT-RP; § 56 GOLT-SH; § 44 GOLT-Sl; § 85 GOLT-Ss; § 29 GOLT-Th. 344 Vgl. § 64 GO-Be. 345 § 64 III GO-Be; § 28 I 1 GOLT-Bg; § 45 I, Π GOBü-Br; § 108 I GOLT-By; § 72 I GOLT-He; § 44 II GOLT-MV; § 23 I Nr. 3 GOBü-Ha; § 71 I GOLT-Nds; § 62 I GOLT-SA; § 63 I GOLT-NRW; § 56IV GOLT-SH. 346 § 63 III GOLT-NRW. 347 § 83a I 1 GOLT-BW. 348 § 83a 12 GOLT-BW. 349 § 72 I GOLT-He. 350 § 29 I GOLT-Th. 351 § 64 IV GO-Be; § 28 II GOLT-Bg; § 47 I GOBü-Br; § 44 III GOLT-MV; § 108 II GOLT-By; § 72 II GOLT-He; § 71 III GOLT-Nds; § 62 III GOLT-SA; § 63 IV GOLT-NRW; § 30 III GOLT-RP; § 56 III GOLT-SH; § 29 IV GOLT-Th. 352 § 44 II GOLT-Sl.
144
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
stand in derselben Sitzung nicht mehr erteilen 353 . Der Präsident trägt zudem dafür Sorge, daß Ausführungen des Redners, die nach Entziehung des Wortes gemacht wurden, nicht in das Plenarprotokoll aufgenommen werden.
5. Möglichkeiten zur Verlängerung der Redezeit In einer Reihe von Landtagen kann der Präsident die Redezeit eines Redners auf Antrag verlängern, wenn der Gegenstand oder der Verlauf der Aussprache dies erforderlich macht 354 . Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Redezeit durch Zwischenfragen in erheblichem Umfang in Anspruch genommen worden ist 3 5 5 . In Nordrhein-Westfalen hat der Landtagspräsident die Möglichkeit, die Rededauer um bis zu dreißig Minuten zu verlängern, wenn sich dies nach Ausschöpfung der vereinbarten Redezeit als notwendig erweist. Die Mitglieder des Landtags haben unter diesen Umständen eine Redezeit bis zu fünf Minuten. Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner 356 . Diese Form der Redezeitverlängerung steht allein im pflichtgemäßen Ermessen des Landtagspräsidenten; ein geschäftsordnungsmäßig begründeter Anspruch besteht nicht. Die Geschäftsordnungen der Parlamente sehen jedoch bestimmte Konstellationen vor, in denen der Landtagspräsident zur Verlängerung der Redezeit verpflichtet ist. Nimmt etwa in Bayern ein Mitglied der Staatsregierung nach Ablauf der Rednerliste das Wort, so muß der Präsident für jeweils einen Redner einer Fraktion, die dies wünscht, die Redezeit verlängern; die Verlängerung beträgt für jede Fraktion höchstens fünfzehn Minuten 357 . In Baden-Württemberg hat der Landtagspräsident auf Verlangen einer Fraktion eine Zusatzredezeit einzuräumen, die dem Stärkeverhältnis der Fraktionen entspricht. Die Zusatzredezeit einer Fraktion darf fünfzig vom Hundert ihrer Grundredezeit nicht überschreiten 358. Zudem kann der Präsident die Redezeiten verlängern, wenn die Regierungsvertreter die für die Fraktionen festgelegte Redezeit erheblich überschreiten 359. Sprechen Mitglieder des Berliner Senats in einer Aussprache insgesamt länger als an Redezeit jeder Fraktion zusteht, so erhält jede Fraktion danach vom Präsidenten eine Redezeit zugeteilt, die der Dauer der Überschreitung durch die Mitglieder des Senats entspricht 360 . Ähnliche Regelungen sind in Brandenburg, Bremen und Schleswig353 § 28 III GOLT-Bg; § 44 III GOLT-MV; § 108 II GOLT-By; § 72 II GOLT-He; § 63 V GOLT-NRW; § 56 III GOLT-SH; § 44 II GOLT-Sl. 354 § 56 II 3 GOLT-SH; § 44 II 4 GOLT-MV; § 301 2, 3 GOLT-RP; § 108 I 3 2. HS GOLTBy (bis zu fünfzehn Minuten); § 441 2, 3 GOLT-Sl. 355 Vgl. § 82 VII 4 GOLT-BW; § 85 V I I I 4 GOLT-Ss. 356 § 63 II GOLT-NRW. 357 § 108 III GOLT-By. 358 § 83a II 3,4 GOLT-BW. 359 § 83a I 3 GOLT-BW. 360 § 64 VII 2 GO-Be.
V. Die Leitung während der Reden
145
Holstein anzutreffen 361. In Hamburg entscheidet die Bürgerschaft auf Anfrage des Präsidenten, ob die Redezeit verlängert werden soll. Bei einem bejahenden Beschluß hat er entsprechend zu verfahren 362. In Hessen sieht die Geschäftsordnung für den Fall der Redezeitüberschreitung durch Mitglieder der Landesregierung und ihrer Beauftragten unter Hinweis auf ihr jederzeitiges Rederecht vor, daß der über die vereinbarte Redezeit hinausgehende Zeitraum den Fraktionen, die nicht an der Regierung beteiligt sind (Oppositionsfraktionen), erneut zur Verfügung steht 363 . Ergreift zudem ein Mitglied oder Beauftragter der Landesregierung das Wort, nachdem die einer Fraktion zustehende Redezeit ausgeschöpft ist, so erteilt der Landtagspräsident auf Verlangen noch einem weiteren Redner aus dieser Fraktion das Wort für eine Redezeit von fünf Minuten 364 . Erhält in Mecklenburg-Vorpommern während der Beratung ein Mitglied der Landesregierung zu dem Gegenstand das Wort, so haben alle Fraktionen, denen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ein volles Viertel ihrer ursprünglichen Redezeit zu diesem Tagesordnungspunkt zur Verfügung steht, Anspruch auf ein zusätzliches Viertel ihrer ursprünglichen Redezeit 365 . Spricht in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ein Mitglied oder Beauftragter der Landesregierung, wenn einer Fraktion nicht mehr ausreichende Redezeit für eine Erwiderung zur Verfügung steht, so muß der Landtagspräsident der Fraktion auf Verlangen eine angemessene zusätzliche Redezeit für die Erwiderung gewähren 366. Die Geschäftsordnung von Rheinland-Pfalz bestimmt für den Fall, daß in einer Aussprache ein Mitglied oder Beauftragter der Landesregierung länger als zwanzig Minuten das Wort ergreift, daß jede Fraktion danach für einen ihrer Redner eine entsprechende Redezeit beanspruchen kann 367 . Überschreitet in Sachsen die Redezeit der Staatsregierung das Zweifache der Redezeit der kleinsten Fraktion, so erhält jede Fraktion, die eine abweichende Meinung vortragen will, vom Landtagspräsidenten eine Ergänzungsredezeit in Höhe der Überschreitung 368. Ergreift ferner während der Beratung ein Mitglied der Staatsregierung zu dem Beratungsgegenstand das Wort, so wird die verbleibende Redezeit der Fraktionen, die ihre ursprüngliche Redezeit zu diesem Tagesordnungspunkt bereits zu mehr als drei Vierteln ausgeschöpft haben, auf ein Viertel der ursprünglichen Redezeit ergänzt 369 . Die Geschäftsordnung von Thüringen sieht schließlich vor, daß die Grundredezeit jeder Fraktion in dem Fall entsprechend verlängert wird, daß ein Mitglied der Landesregierung in einer Aussprache über die Grundredezeit hinaus das Wort ergreift 370 . 361 § 28 I 3 GOLT-Bg; § 45 III 1 GOBü-Br; § 56 VI GOLT-SH. 362 § 22 III GOBü-Ha. 363 § 73 I 2 GOLT-He. 364 § 73 II 1 GOLT-He. 365 § 46 II GOLT-MV. 366 367 368 369 370
§ 71 II GOLT-Nds; § 62 II GOLT-SA. § 30 II GOLT-RP. § 85 V GOLT-Ss. § 86 II GOLT-Ss. § 29 III GOLT-Th.
10 Köhler
146
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Insgesamt läßt sich festhalten, daß den Landtagspräsidenten im Rahmen ihrer Redeleitung ein mitunter recht vielfältiges Instrumentarium in die Hände gelegt worden ist, mit dem sie durchaus wirkungsvoll auf Form, Dauer und Reihenfolge der Reden Einfluß nehmen und damit sowohl den zügigen Beratungsverlauf als auch gegebenenfalls die Lebendigkeit der Debatten fördern können 371 . Unerläßliche Voraussetzung ist diesbezüglich allerdings, daß sie selbst den geringsten Anschein von Parteilichkeit konsequent vermeiden und mithin politische Freunde und Gegner grundsätzlich gleich behandeln.
VI. Die Leitung der Abstimmungen An die Beendigung der Aussprache schließt sich regelmäßig die Sachabstimmung über den Verhandlungsgegenstand oder eine Wahl, deren Leitung in Form von Eröffnung, Durchführung und Schließung ebenfalls dem Landtagspräsidenten zukommt. Sie ist eine weitere Einzelfunktion im Bereich der präsidialen Leitungskompetenz während der Plenarsitzungen 372.
1. Die Feststellung der Beschlußfähigkeit Für die Abstimmung ist die Beschlußfähigkeit des Landtags unerläßliche Voraussetzung. Durch dieses Erfordernis sollen künstlich herbeigeführte oder umstandsbedingte (späte Nacht, Freitag nachmittag) Zufallsentscheidungen verhindert werden, die dem Willen der wirklichen Parlamentsmehrheit nicht entsprechen 373. Die Beschlußfähigkeit des Landtags ergibt sich entweder aus Rechtsnormen oder folgt aus einer Rechtsvermutung. Geschäftsordnungsmäßig, also kraft Rechtsnorm ist das Parlament beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten Abgeordneten im Plenarsaal anwesend ist 3 7 4 . Dabei entscheidet nicht die Teilnahme an der Abstimmung, sondern allein die Anwesenheit der Abgeordneten. Maßgeblich für die Berechnung der Beschlußfähigkeit ist die Anzahl der gesetzlichen Mitglieder und nicht die tatsächliche Mitgliederzahl, so daß infolge Verzicht, Ausschluß, Krankheit oder Tod vorübergehend unbesetzte Mandate mitgezählt werden 375 . In Bremen kann ausnahmsweise auch bei Anwesenheit einer geringeren Zahl von Mitgliedern ein Beschluß 371 So auch Wermser, S. 53. 372 Vgl. Breiholdt, in: AöR 49,289 (363). 373 Kleinschnittger, S. 63; Schäfer, S. 80. 374 § 73 11 GO-Be; § 128 I GOLT-By; § 47 GOLT-NRW; § 83 I GOLT-Ss; § 7011 GOLTSA; § 41 I GOLT-RP; § 59 I 1 GOLT-SH; § 47 I 1 GOLT-MV; § 40 I 1 GOLT-Th; § 79 I 1 GOLT-Nds; § 63 GOLT-Bg. 375 Stern, S. 79; Troßmann, § 49, Rn. 2.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
147
gültig gefaßt werden, wenn die Dringlichkeit des Gegenstandes keinen Aufschub gestattet und dies bei der Ladung zu der Versammlung ausdrücklich angezeigt worden ist. Ebenso ist zu verfahren, wenn der Senat beantragt, daß wegen Dringlichkeit des Gegenstandes diese Ausnahme eintritt 376 . In Hamburg bestimmt die Geschäftsordnung, daß für die Regelung von Fragen, welche die Geschäftshandlung betreffen, wie Anberaumung von Sitzungen und Feststellung der Tagesordnung, die Bürgerschaft in jedem Falle beschlußfähig ist 3 7 7 . Soweit die Geschäftsordnungen keine Aussagen über die für die Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl anwesender Mitglieder treffen, wird stillschweigend von der Anwesenheit der Mehrheit ausgegangen378. Hingegen ist der Landtag kraft Rechtsvermutung beschlußfähig, wenn seine Beschlußfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Abgeordneten nicht bezweifelt wird 3 7 9 . Die daraufhin gefaßten Beschlüsse sind grundsätzlich gültig, selbst wenn tatsächlich weniger als die Hälfte der gewählten Abgeordneten anwesend ist. Während die Anzweifelung der Beschlußfähigkeit im Bundestag nur einer Fraktion oder einer Abgeordnetengruppe in Fraktionsstärke möglich ist, kann sie in den Landtagen schon durch einen einzelnen Abgeordneten bezweifelt werden 3 8 0 . Die Zweifel sind dem Sitzungspräsidium gegenüber zu erklären. In zeitlicher Hinsicht kann die Anzweifelung nur unmittelbar nach Beendigung der Aussprache bis zur Eröffnung der Abstimmung zu einem Tagesordnungspunkt erfolgen 381 . Demnach ist sowohl die verspätete Anzweifelung rechtlich bedeutungslos 3 8 2 als auch eine während der Aussprache vorgebrachte „verfrühte" Zweifelsäußerung, wie der Wortlaut des § 129 Π 2 der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags explizit unterstreicht 383. Nach der Bezweifelung der Beschlußfähigkeit ist bis zu deren Feststellung eine Geschäftsordnungsdebatte über die Berechtigung der Anzweifelung geschäftsordnungsmäßig ausgeschlossen384. Die Bezweifelung der Beschlußfähigkeit führt allerdings nicht zu einer sofortigen Auszählung der anwesenden Abgeordneten. Vielmehr ist zunächst der Landtagspräsident, mitunter auch der Sitzungsvorstand in „einmütiger" Weise zur Stellungnahme berufen 385 . 376 § 55 II GOBü-Br. 377 § 17 II GOBü-Ha. 378 Vgl. Achterberg, S. 631. 379 Vgl. den Wortlaut von § 1291 GOLT-By; § 4012 GOLT-Th; § 5912 GOLT-SH; § 471 2 GOLT-MV; § 17 I 2 GOBü-Ha. 380 Vgl. § 83 I GOLT-Ss. 381 § 61 I 1 GOLT-He; § 129 II 1 GOLT-By; § 6411 GOLT-Bg. Zum Begriff der Unmittelbarkeit vgl. Achterberg, S. 632 f. 382 Roßmann, S. 46; Rothaug, S. 136. 383 So auch Ritzel/Bücker, § 45, Anm. II 1 e, S. 3; Troßmann, § 49, Rn. 3; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S 57 f.; Sperling, S. 37; a.A. Rothaug, S. 136. 384 § 129 II 3 GOLT-By; § 4812 GOLT-NRW; § 68 12 GOLT-Bg.
385 in Bayern (§ 129 II 1 GOLT), Nordrhein-Westfalen
(§ 48 II GOLT), Rheinland-Pfalz
(§ 41 II GOLT), Hamburg (§18 11 GOBü) und Thüringen ( § 40 II 1 GOLT) trifft der Sit-
10*
148
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Dadurch sollen von Anfang an offensichtlich unbegründete obstruktionelle Anzweifelungen herausgefiltert werden, um zeitraubende Auszählungen zu vermeiden 3 8 6 . Je nachdem, welche Entscheidung der Landtagspräsident trifft, greifen unterschiedliche Rechtsfolgen. Bejaht er die Beschlußfähigkeit, so wird die Anzweifelung obsolet 387 und eine Auszählung unterbleibt 388 . Die Entscheidung des Präsidenten ist ohne Diskussion zu akzeptieren und wirkt für das weitere Verfahren bindend, sie kann nicht angefochten werden 389 . Eine erneute Bezweifelung ist erst wieder bei der nächsten Abstimmung möglich 390 . Verneint hingegen der Landtagspräsident die Beschlußfähigkeit, so steht nach parlamentarischem Gewohnheitsrecht die Beschlußunfähigkeit der Versammlung fest, ohne daß es einer Auszählung bedarf 391 . Dies entspricht auch dem Sinn der selektiven Vorschaltung des Landtagspräsidenten bzw. des Sitzungsvorstands, überflüssige Auszählungen zu vermeiden 392 . Anders als die bejahende Entscheidung über die Beschlußfähigkeit ist die verneinende nicht von bindender Wirkung. Der Parlamentspräsident bzw. Sitzungsvorstand kann diese vielmehr feststellen, sobald der Sitzungssaal sich dermaßen gefüllt hat, daß die Beschlußfähigkeit des Landtags wieder hergestellt ist 3 9 3 . Wird jedoch die Beschlußfähigkeit bezweifelt und vom Präsidenten bzw. Sitzungsvorstand weder bejaht noch verneint, so ist sie durch Namensaufruf oder Zählung der anwesenden Abgeordneten festzustellen 394. In Hamburg und Thüringen kann die Feststellung der Beschlußfähigkeit mit der betreffenden Sachabstimmung verbunden werden, wobei auch hier das Ergebnis der Auszählung einer besonderen Konstatierung bedarf 395 . Sofern in diesem Fall nicht eine namentliche Abstimmung beantragt wird oder sogar geschäftsordnungsmäßig vorgeschrieben ist, erfolgt die Feststellung in aller Regel in der Form des „Hammelsprungs" 396. zungsvorstand die Entscheidung, in allen anderen Ländern obliegt sie allein dem Landtagspräsidenten. 386 Troßmann, Der Deutsche Bundestag, S. 83. 387 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 58; Kleinschnittger, S. 64; Seligmann, S. 58. 388 § 73 I 3 GO-Be. 389 Achterberg, S. 633. 390 v g i . Reifenberg, S. 194. 391 Gerlach, S. 83; Kleinschnittger, S. 66; Hartwig, S. 59; Engels, S. 35; Achterberg. S. 633. 392 Vgl. Kleinschnittger, S. 65. 393 Vgl. Troßmann, § 49, Rn. 9. 394 § 80 I 1 GOLT-BW; § 129 II 1 GOLT-By; § 48 II GOLT-NRW; § 83 II 1 GOLT-Ss; § 70 III 1 GOLT-SA; § 41 II 1 GOLT-RP; § 18 I 2 GOBü-Ha; § 47 II GOLT-MV; § 40 II 1 GOLT-Th; § 79 III 1 GOLT-Nds; § 64 II 1 GOLT-Bg. 395 § 18 II 2 GOBü-Ha; § 40 II 1 GOLT-Th. 396 Vgl. z. B. § 32 III GOBü-Ha; § 134 II GOLT-By. Siehe zum Verfahren des „Hammelsprungs" S. 156.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
149
Häufige Anwendung - zumindest im Bundestag - findet diese Möglichkeit der Koppelung von Feststellung der Beschlußfähigkeit und namentlicher Abstimmung bei der Wahl des Parlamentspräsidenten in der konstituierenden Sitzung, indem zur Stimmabgabe Namensaufruf erfolgt und sich mithin bei der Auszählung der Stimmkarten gleichzeitig die Beschlußfähigkeit ergibt 397 . Zur Feststellung der Beschlußfähigkeit des Parlaments werden auch Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen mitgezählt 398 . Hat ein Mitglied des Landtags dagegen versehentlich an der Abstimmung nicht teilgenommen oder seine Stimmabgabe bewußt unterlassen, so findet es hinsichtlich der Beschlußfähigkeit keine weitere Berücksichtigung 399. Vor Eintritt in die Auszählungs- bzw. Abstimmungshandlung hat der Landtagspräsident das Recht, diese „auf kurze Zeit auszusetzen"400. Dies geschieht zumeist vor dem Hintergrund, säumigen Abgeordneten die Gelegenheit zu bieten, noch herbeizueilen und auf diese Weise gegebenenfalls zeitraubende Auszählungen zu vermeiden 401 . Ist allerdings absehbar, daß sich die Zahl der anwesenden Abgeordneten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kurzfristig erhöhen läßt, so wird der Landtagspräsident in Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens von der Aussetzung der Abstimmung Abstand nehmen 402 . Die Aussetzung erfolgt entweder dadurch, daß er die Sitzung unterbricht oder dadurch, daß er die Abstimmung zurückstellt und die Beratung des nächsten Tagesordnungspunktes eröffnet 403 . Ergibt sich am Ende der Auszählung, daß die zur Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl der Abgeordneten nicht anwesend ist, so stellt der Präsident fest, daß das Haus beschlußunfähig ist 4 0 4 . Nach Feststellung der Beschlußunfähigkeit hat der Landtagspräsident die Sitzung sofort zu schließen und nur noch Zeit und Tagesordnung der nächsten Sitzung zu verkünden 405 . Da das Parlament nicht mehr beratungsfähig ist, darf auch das Wort nicht mehr erteilt werden 406 . In Bayern und Thüringen sehen die Geschäftsordnungen für den Fall der Feststellung der 397 Vgl. Ritzel/Bücker, § 1, Anm. IV a, S. 5; Troßmann, § 1, Rn. 5; Kleinschnittger, S. 20 f.; Klinke, S. 50; Hartwig, S. 16. 398 Vgl. etwa § 69 II GO-Be; § 97 III GOLT-BW. 399 Vgl. Ritzel/Bücker, § 45, Anm. II 1 i, S. 4; Kleinschnittger, S. 67; Rothaug, S. 137. 400 § 8012 GOLT-BW; § 61 II GOLT-He; § 48 III GOLT-NRW; § 83 II 2 GOLT-Ss; § 70 III 2 GOLT-SA; § 41 II 2 GOLT-RP; § 18 I 2 GOBü-Ha; § 40 II 2 GOLT-Th; § 79 III 2 GOLTNds; § 64 III GOLT-Bg. 401 Troßmann, § 49, Rn. 9; Steiger, S. 102; Straßberger, S. 63. 402 Rothaug, S. 137. 403 Kleinschnittger, S. 64 f. 404 § 47 Satz 2 GOLT-Sl; § 73 I I GO-Be; § 41 I I I GOLT-RP; § 40 I I I GOLT-Th.
405 § 73 III 1 GO-Be; § 80 II GOLT-BW; § 62 Satz 1 GOLT-He; § 49 I GOLT-NRW; § 70IV 1 GOLT-SA; § 47 Satz 3 GOLT-Sl; § 41 IV 1 GOLT-RP; § 79IV 1 GOLT-Nds; § 65 Satz 1 GOLT-Bg. 406 Achterberg, S. 634. Der Volksvertretung fehlt mithin die Willensbildung, das Hauptwesensmerkmal der parlamentarischen Verhandlung, Breiholdt, in: AöR, 49,289 (362).
150
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Beschlußunfähigkeit des Parlaments vor, daß der Landtagspräsident zunächst die Sitzung auf bestimmte Zeit (fünfzehn Minuten) unterbricht. Ist nach dieser Zeit die Beschlußfähigkeit noch nicht eingetreten, so vertagt er die Sitzung und bestimmt den Zeitpunkt der Fortsetzung 407. Im allgemeinen wird die Abstimmung oder die Wahl in der nächsten Sitzung ohne Beratung vorgenommen 408, wobei die Abstimmungsfrage in der gleichen Fassung erneut gestellt wird 4 0 9 . Überhaupt bleibt das Abstimmungsstadium erhalten, insbesondere bleibt ein Verlangen auf namentliche Abstimmung in Kraft und braucht also bei Wiederholung der Abstimmung nicht erneut gestellt zu werden 410 . In Sachsen kann der Präsident, wenn eine Sitzung wegen Beschlußunfähigkeit aufgehoben worden ist, für denselben Tag einmal eine weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Innerhalb dieser Tagesordnung kann er den Zeitpunkt für die Wiederholung einer erfolglosen Abstimmung oder Wahl festlegen. Auch kann er eine Abstimmung oder Wahl von der Tagesordnung absetzen, es sei denn, daß von zehn vom Hundert der anwesenden Mitglieder des Landtags widersprochen wird 4 1 1 . In Hessen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird die Beschlußfähigkeit nicht erst unmittelbar vor einer Abstimmung, sondern bereits zu Beginn der Sitzung des Landtags festgestellt 412. Eine spätere Anzweifelung ist dadurch jedoch nicht ausgeschlossen413.
2. Die Fassung der Fragen und die Abstimmungsreihenfolge Sofern die Beschlußfähigkeit während oder unmittelbar nach Beendigung der Aussprache nicht angezweifelt oder nach Bezweifelung festgestellt worden ist, eröffnet der Landtagspräsident im Anschluß an die Beratung und etwaigen persönlichen Bemerkungen ausdrücklich die Abstimmung und teilt dabei in der Regel den Wortlaut des Abstimmungsgegenstandes mit 4 1 4 . Die ausdrückliche Eröff407 § 129 III 1, 2 GOLT-By; § 40IV 1, 2 GOLT-Th. 408 § 73 III 2 GO-Be; § 80 III 1 GOLT-BW; § 62 Satz 2 GOLT-He; § 49 II 1 GOLT-NRW; § 70IV 2 GOLT-SA; § 41IV 2 GOLT-RP; § 59 III 1 GOLT-SH; § 47 III 1 GOLT-MV; § 40IV 3 GOLT-Th; § 79IV 2 GOLT-Nds; § 65 Satz 2 GOLT-Bg. 409 Steiger, S. 102. 410 § 73 III 3 GO-Be; § 80 III 2 GOLT-BW; § 62 Satz 3 GOLT-He; § 129 III 3 GOLT-By; § 49 II 2 GOLT-NRW; § 41 IV 3 GOLT-RP; § 59 III 2 GOLT-SH; § 47 III 2 GOLT-MV; § 40IV 4 GOLT-Th; § 65 Satz 3 GOLT-Bg. 411 § 83 III GOLT-Ss; vgl. auch § 70IV 3 GOLT-SA. 412 § 60 II GOLT-He; § 701 2 GOLT-SA; § 7912 GOLT-Nds. 413 Vgl. § 61 11 GOLT-He; § 70 II GOLT-SA; § 79 II 1 GOLT-Nds. 414 § 67 I 1 GO-Be; § 96 I 1 GOLT-BW; § 50 I GOLT-NRW; § 98 I 1 GOLT-Ss; § 48 I 1 GOLT-Sl; § 31 11 GOBü-Ha; § 6111 GOLT-SH; § 4911 GOLT-MV; § 80 GOLT-Nds; § 661 1 GOLT-Bg; § 50 Satz 1 GOBü-Br.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
151
nungserklärung vollzieht sich häufig mit den Worten: „Wir kommen zur Abstimmung", „Wir treten in die Abstimmung ein" oder „Ich lasse nun abstimmen" 415 . Da der Zeitpunkt der Eröffnung maßgeblich für die Bezweifelung der Beschlußfähigkeit ist, verhindert eine eindeutige Eröffnungserklärung später auftretende Kontroversen 416. Gleichwohl kann die Eröffnung der Abstimmung auch konkludent erfolgen, indem etwa der Präsident die Abstimmungsfrage stellt 417 . Vorab hat der Parlamentspräsident allerdings zu prüfen, ob über den gestellten Antrag überhaupt abgestimmt werden darf. Unzulässig ist beispielsweise die Abstimmung über einen Antrag auf Überweisung einer Regierungserklärung oder eines Interpellationsgegenstands418. Nach Eröffnung der Abstimmung hat der Landtagspräsident die Frage zur Abstimmung zu formulieren. Diese muß so gestellt werden, daß sie sich mit, Ja" oder „Nein" beantworten läßt 4 1 9 . Sie bedarf also nach dem Grundsatz simplexer Fragestellung einer klaren Fassung, die eine eindeutige Entscheidung des Abstimmenden ermöglicht 420 . Da es sich um eine Entscheidungsfrage handelt, darf kein Zusatz dabei sein, etwa daß die Annahme unter Bedingungen, Voraussetzungen oder Erwartungen erfolge 421 . Ziel der Fragestellung muß es immer sein, den Willen des Landtags in den Beschlüssen klar zum Ausdruck kommen zu lassen422. Die regelmäßige Fassung der Fragen geht dahin, daß gefragt wird, ob der Landtag die Zustimmung erteilt oder nicht 4 2 3 . Auch wenn der Präsident demnach nicht gehindert ist, die Abstimmungsfrage negativ zu formulieren, also zu fragen, ob ein gestellter Antrag abgelehnt wird, so ist die Frage in der Regel doch möglichst positiv („affirmativ") zu stellen 424 . Um Irritationen zu vermeiden, wird zudem nach parlamentarischem Gewohnheitsrecht grundsätzlich über die Vorlage selbst abgestimmt und nicht etwa über einen Ablehnung oder Erledigung empfehlenden Ausschußantrag 425. 415 Vgl. Rothaug, S. 138.
416 Kleinschnittger, S. 62; Sperling, S. 38, Fn. 33. 417 Vgl. Bartels, S. 64. 418 Rothaug, S. 138 mit weiteren Beispielen. Zur Prüfungskompetenz des Parlamentspräsidenten bei geschäftsordnungswidrigen Anträgen und solchen, die gegen sonstige (verfassungs-)gesetzliche Bestimmungen verstoßen, vgl. Achterberg, S. 639. Siehe hierzu auch S. 104 f. 419 § 67 I 2 GO-Be; § 96 I 2 GOLT-BW; § 82 I 1 GOLT-He; § 98 I 2 GOLT-Ss; § 48 I 2 GOLT-Sl; § 43 I 1 GOLT-RP; § 61 II 1 GOLT-SH; § 49 II 1 GOLT-MV; § 42 I 1 GOLT-Th; § 6 6 I V GOLT-Bg. 420 Vgl. Achterberg, S. 636. 421 Sperling, S. 35; Kleinschnittger, S. 68. 422 So der ausdrückliche Wortlaut der §§ 72 II GOLT-SA; 81 II GOLT-Nds. 423 § 67 I 3 GO-Be; § 82 I 2 GOLT-He; § 72 I GOLT-SA; § 43 I 2 GOLT-RP; Ergebnis durch Namensaufruf festgestellt, § 97 I 3 GOLT-BW. In Sachsen § 42 I 2 GOLT-Th; § 8 1 1 GOLT-Nds. 424 Dementsprechend heißt es in § 130 Satz 2 GOLT-By: „Die Fragen sind, wenn tunlich, positiv zu fassen." 425 Rothaug, S. 139. Vgl. dazu aber § 132 III 4,5 GOLT-By.
152
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Über die Fassung der Fragen kann das Wort zur Geschäftsordnung verlangt werden 4 2 6 . Hierbei handelt es sich nicht um einen Antrag, sondern um eine Bemerkung zur Geschäftsordnung. Im allgemeinen besteht diesbezüglich ein Rechtsanspruch des Abgeordneten auf Worterteilung, nur vereinzelt steht die Worterteilung im Ermessen des Parlamentspräsidenten 427. Ebenso kann gegen die vorgeschlagene Fassung einer Frage Widerspruch erhoben werden, über den das Parlament mit einfacher Mehrheit der anwesenden Abgeordneten entscheidet428. Eine Teilung der zur Abstimmung gestellten Frage kann von jedem Abgeordneten beantragt werden 429 . Sofern die Teilung zulässig ist, muß der Parlamentspräsident dem Antrag entsprechen. In Hessen hingegen entscheidet der Landtag über die beantragte Teilung 430 . Falls über die Zulässigkeit der Frageteilung Zweifel bestehen, so trifft hierüber grundsätzlich das Parlament die Entscheidung431. Ausnahmsweise in Rheinland-Pfalz und Thüringen obliegt diese bei Anträgen dem Antragsteller 432 . Das bedeutet allerdings, daß mit der Antragstellung die Entscheidung bereits getroffen ist, weil jene die Zustimmung impliziert 433 . Eine Teilung der Frage kann bis zum Beginn der Abstimmung begehrt werden, nicht mehr dagegen, wenn diese bereits begonnen hat. Vereinzelt sehen die Geschäftsordnungen vor, daß auf Verlangen unmittelbar vor der Abstimmung der Abstimmungstext vorzulesen ist 4 3 4 . Die Verlesung verfolgt im wesentlichen zwei Ziele: einerseits soll sie vor der Teilung der Frage den Abgeordneten darüber Klarheit verschaffen, ob sie eine solche begehren wollen, andererseits hat sie nach vollzogener Teilung den Zweck, den Inhalt der nunmehr geteilten Frage nochmals zu verdeutlichen, um den Abgeordneten eine sichere Grundlage für ihr Abstimmungsverhalten zu bieten 435 . 426 § 67 II 1 GO-Be; § 9613 GOLT-BW, § 821 3 GOLT-He; § 130 Satz 3 GOLT-By; § 50 II 1 GOLT-NRW; § 98 I 3 GOLT-Ss; § 48 II 1 GOLT-Sl; § 43 I 3 GOLT-RP; § 31 II 1 GOBüHa; § 61 III 1 GOLT-SH; § 49 III 1 GOLT-MV; § 421 3 GOLT-Th. 427 So ζ. B. in Hessen. 428 § 67 II 2 GO-Be; § 96 I 4 GOLT-BW; § 82 I 4 GOLT-He; § 130 Satz 4 GOLT-By; § 50 II 2 GOLT-NRW; § 98 I 4 GOLT-Ss; § 48 II 2 GOLT-Sl; § 43 I 4 GOLT-RP; § 31 II 2 GOBü-Ha; § 61 III 2 GOLT-SH; § 49 III 2 GOLT-MV; § 4214 GOLT-Th; § 661 2 GOLT-Bg; § 521 2 GOBü-Br. 429 § 67 III 1 GO-Be; § 51 I GOLT-NRW; § 66 III 1 GOLT-Bg; § 52 I 1 GOBü-Br; § 82 II 1 GOLT-He; § 43 III 1 GOLT-RP; § 42 IUI GOLT-Th. 430 § 82 II 2 GOLT-He. 431 Vgl. § 67 III 2 GO-Be; § 511 GOLT-NRW; § 66 II 2 GOLT-Bg. 432 § 43 III 1 GOLT-RP; § 42 III 1 GOLT-Th. Hierunter sind sowohl selbständige Anträge ohne Gesetzentwurf als auch Entschließungsanträge unter Einschluß solcher zu Großen Anfragen als auch Änderungsanträge zu fassen, vgl. Achterberg, S. 637. 433 Vgl. Pereis, S. 59. 434 § 98 V GOLT-Ss; § 48 III GOLT-Sl; § 43 II GOLT-RP; § 61 I 2 GOLT-SH; § 49 I 2 GOLT-MV; § 42 II GOLT-Th; § 66 II 3 GOLT-Bg; § 131 Satz 3 GOLT-By: § 51 III 1 GOLTNRW. 435 Achterberg, S. 638.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
153
Die Reihenfolge der zur Abstimmung gestellten Fragen ist teilweise ausdrücklich in den Geschäftsordnungen verankert 436 . Von vereinzelten Abweichungen abgesehen, ergibt sich im Grundsatz folgende Reihenfolge: Oberste Priorität genießen Anträge auf Übergang zur Tagesordnung, über sie muß der Landtagspräsident vor allen anderen Anträgen abstimmen lassen. Ihnen folgen Anträge auf Vertagung der Beratung und Anträge auf Aussetzung der Abstimmung. Anträge, die, ohne die Sache selbst zu berühren, lediglich Vorfragen betreffen, insbesondere Verweisung an einen Ausschuß 437 , Einholung einer Auskunft und dergleichen, haben ihrerseits Vorrang vor Anträgen auf Entscheidung in der Sache selbst. Diese und die nachstehenden Regeln werden im übrigen auch in den Parlamenten angewandt, die keine normative Abstimmungsreihenfolge aufzuweisen haben. Rechtsgrundlage ist hier parlamentarisches Gewohnheitsrecht. Des weiteren läßt der Landtagspräsident grundsätzlich über den weitergehenden Antrag zuerst abstimmen 438 . Gehen die Anträge gleich weit, so ist zunächst über den älteren abzustimmen439. Handelt es sich um Unterschiede in den Zahlen, so wird zunächst über die höhere Zahl abgestimmt440. Bei verschiedenen in Frage stehenden Geldsummen ist die kleinere im Antrag gebrachte Einnahme- und die größere Ausgabesumme vorrangig zur Abstimmung zu bringen und in dieser Folge weiter 441 . Bei Zeitbestimmungen ist über die längere Zeit zuerst zu entscheiden442. Ferner sind Änderungsanträge vor dem Hauptantrag zur Abstimmung zu bringen 4 4 3 . Liegen mehrere Änderungsanträge vor, so stellt der Landtagspräsident zunächst den Antrag zur Abstimmung, der von der Vorlage am weitesten abweicht 444 . Ein Änderungsantrag zu einem Änderungsantrag ist im übrigen zulässig, soweit er im einzelnen eine Veränderung von dessen Wortlaut anstrebt und nicht lediglich das Begehren eines im gleichen Zusammenhang bereits gestellten Antrages wiederholt 445 . Alle Anträge, die eine Erweiterung des Verhandlungsgegen436
Ausdrückliche Vorschriften über die Abstimmungsreihenfolge finden sich insbesondere in § 68 GO-Be; § 85 GOLT-He; § 44 GOLT-RP; § 62 GOLT-SH; § 43 GOLT-Th; § 67 GOLT-Bg und § 51 GOBü-Br. 437
In Nordrhein-Westfalen wird über den Antrag auf Überweisung an einen Ausschuß vor allen anderen Anträgen abgestimmt, § 52 II 2 GOLT-NRW. 43 » § 68 Satz 2 GO-Be; § 85 II 1 GOLT-He; § 52 II 1 GOLT-NRW; § 72 III 1 GOLT-SA; § 44 II 1 GOLT-RP; § 62 Satz 2 GOLT-SH; § 43 II 1 GOLT-Th; § 81 III 1 GOLT-Nds. 43 9 § 68 Satz 3 GO-Be; § 85 II 2 GOLT-He; § 44 II 2 GOLT-RP; § 62 Satz 3 GOLT-SH; § 43 II 2 GOLT-Th. 440
§ 97 VI GOLT-BW; § 85 II 3 GOLT-He; § 99 VII GOLT-Ss. 441 § 68 Satz 4 GO-Be; § 44 III 1 GOLT-RP; § 62 Satz 4 GOLT-SH; § 43 III 1 GOLT-Th; § 67 III 1 GOLT-Bg. "2 § 68 Satz 5 GO-Be; § 44 III GOLT-RP; § 62 Satz 5 GOLT-SH; § 43 III 2 GOLT-Th; § 67 III 2 GOLT-Bg. 443
§ 67 VI GOLT-Bg; § 44 IV GOLT-RP; § 43 IV GOLT-Th; § 85 III 1 GOLT-He; § 51 VII GOBü-Br. 444
§ 85 III 2 GOLT-He. § 99 IX GOLT-Ss; § 97 VII GOLT-BW.
154
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
standes bezwecken (Zusatzanträge), werden den Abänderungsanträgen in der Behandlung gleichgestellt 446 . Schließlich wird über einen Hilfsantrag (Eventualantrag) erst abgestimmt, wenn der Hauptantrag abgelehnt worden ist 4 4 7 . In einigen Geschäftsordnungen finden sich darüber hinaus spezielle Regeln für Anträge, die den Bereich des Haushalts betreffen. Sind beispielsweise einzelne Anträge zu einer Haushaltsstelle in der Gesamtsumme von Anschlag und Verpflichtungsermächtigung gleich, so bestimmen die Geschäftsordnungen von Bremen und Brandenburg, daß der Landtagspräsident über den Antrag abstimmen läßt, bei dem der Anschlag höher ist 4 4 8 . Liegen ferner zur gleichen Haushaltsstelle Anträge vor, von denen einer eine Erhöhung und einer eine Kürzung des Anschlags bezwecken, so wird zuerst über die höhere Haushaltsbelastung abgestimmt449. Bei Anträgen, die den gleichen Betrag entweder kürzen oder dem Eventualhaushalt zuweisen, wird der Kürzungsantrag vorrangig zur Abstimmung gestellt 450 . Die Bayerische Geschäftsordnung schreibt für Abstimmungen über die Einzelpläne des Staatshaushalts vor, daß über die Entwürfe in der Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen abgestimmt wird. Mit dieser Abstimmung finden zugleich die vom Ausschuß für Staatshaushalt und Finanzfragen abgelehnten Änderungsanträge ihre Erledigung, sofern nicht die Antragsteller bis zum Beginn der Sitzungsfolge schriftlich Einzelabstimmung verlangt haben 451 . Abweichungen von der eingangs aufgeführten Reihenfolge der zur Abstimmung gestellten Fragen finden sich vor allem in Hamburg und Brandenburg. Während in Hamburg der Präsident der Bürgerschaft eigenverantwortlich die Reihenfolge der Abstimmungen bestimmt 452 , wird in Brandenburg - bis auf wenige Ausnahmen über die Anträge grundsätzlich in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs abgestimmt 453 . Abweichungen, wenn auch nur geringfügiger Art, sind zudem in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen anzutreffen. Zwar haben hier Anträge zur Geschäftsordnung ebenfalls Priorität gegenüber Anträgen zur Sache 454 , insbesondere wird über Anträge auf Schluß der Aussprache vor Vertagungsanträgen abgestimmt 455 . Liegen jedoch mehrere konkurrierende Anträge zur Geschäftsordnung vor, so hat der Landtagspräsident zuerst über den Antrag abstimmen zu 446
§ 132 III 1 GOLT-By. 447 § 72 III 2 GOLT-SA; § 81 III 2 GOLT-Nds. 448 § 51 IV 2 GOBü-Br; § 67 IV 2 GOLT-Bg. 449 § 51 V GOBü-Br; § 67 V GOLT-Bg. 450 § 51 VI 2 GOBü-Br. 451 § 132 IV GOLT-By. 452 § 31 ι 2 GOBü-Ha. Der Präsident ist nur insoweit gebunden, als daß Anträge über die geschäftliche Behandlung einer Vorlage voranzustellen sind. Ebenso gehen Änderungsanträge der ursprünglichen Vorlage vor, § 311 3,4 GOBü-Ha. 453 § 67 II GOLT-Bg. 454 § 1321 GOLT-By; § 97 V GOLT-BW; § 99 V GOLT-Ss. 455 § 132 II 2 GOLT-By; § 97 V GOLT-BW.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
155
lassen, der der Weiterbehandlung des Gegenstandes am meisten widerspricht 456 . Bei mehreren Anträgen zur Sache soll der Landtagspräsident indessen vorrangig den Antrag zur Abstimmung stellen, der am weitesten von der Vorlage, dem Antrag oder der Eingabe abweicht 457 . Im Zweifelsfall entscheidet der Landtag oder der Ausschuß 458 . Liegt ferner ein Vorschlag eines Ausschusses vor, so tritt dieser Vorschlag an die Stelle der Vorlage oder des Antrages. Liegen hingegen unterschiedliche Empfehlungen der Ausschüsse vor, so ist in der Vollversammlung zuerst über den Vorschlag des Ausschusses abzustimmen, der sich als letzter mit dem Gegenstand befaßt und kein ablehnendes Votum abgegeben hat 4 5 9 .
3. Die Arten der Abstimmung Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handzeichen* 60, mitunter auch durch Aufstehen oder Sitzenbleiben 461. Die letztere Abstimmungsart ist in Niedersachsen, Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz sogar ausdrücklich für die Schlußabstimmung bei Gesetzentwürfen vorgeschrieben 462. Wird die Abstimmung jedoch irrtümlich durch Handzeichen vorgenommen, so ist sie dadurch nicht zwangsläufig als ungültig zu bewerten. Vielmehr gilt der Formfehler mit Verkündung des Abstimmungsergebnisses als geheilt 463 . Soweit das Ergebnis der Abstimmung zu Zweifeln Anlaß gibt, also diesbezüglich innerhalb des Sitzungsvorstands keine Einigkeit besteht, veranlaßt der Landtagspräsident die Wiederholung der Abstimmung in derselben Form 4 6 4 oder macht die Gegenprobe, indem er fragt, wer den Beschlußvorschlag ablehnt 465 . In Berlin und Bremen kann der Landtagspräsident bei jeder Abstimmung grundsätzlich von sich aus die Gegenprobe vornehmen. Eine Verpflichtung dazu besteht lediglich bei ausdrücklichem Verlangen 466. Hingegen ist in Bayern eine Gegenprobe in allen Fällen der Abstimmung vorzuneh456 § 97 y GOLT-BW; § 132 II 1 GOLT-By; § 99 V I GOLT-Ss. 457 § 99 v u GOLT-SS; § 132 I I I 2 GOLT-By; § 97 V GOLT-BW.
458 § 132 III 3 GOLT-By. 459 § 132 III 4,5 GOLT-By. 460 § 70 I 1 GO-Be; § 97 I 1 GOLT-BW; § 83 I GOLT-He; § 133 I 1 GOLT-By; § 52 I GOLT-NRW; § 99 I 1 GOLT-Ss; § 74 I GOLT-SA; § 42 I 1 GOLT-By; § 32 I 1 GOBü-Ha; § 63 I 2 GOLT-SH; § 41 I GOLT-Th; § 501 2 GOLT-MV; § 83 I GOLT-Nds; § 68 I 1 GOLTBg; § 5711 GOBü-Br; § 68 I Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 461 § 97 I 1 GOLT-BW; § 83 I GOLT-He (nur in besonderen Fällen); § 133 I 1 GOLT-By; § 521 GOLT-NRW; § 991 1 GOLT-Ss; § 741 GOLT-SA. 462 § 83 I GOLT-Nds; § 133 I 2 GOLT-By; § 41 I GOLT-Th; § 421 1 GOLT-RP. 463 Troßmann, § 54, Rn. 1. 464 § 97 I 2 GOLT-BW; § 52 V 1 GOLT-NRW; § 102 II 1 GOLT-Ss; § 74 II 1 GOLT-SA; § 41 V 1 GOLT-Th; § 83 II 1 GOLT-Nds. 465 § 74 II 1 GOLT-SA; § 42 V 1 GOLT-RP; § 32 II GOBü-Ha; § 49 II 2 GOLT-MV; § 83 II 1 GOLT-Nds; § 57 II 1 GOBü-Br. 466 § 70 I 2, 3 GO-Be; § 57 I 2, 3 GOBü-Br.
156
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
men 4 6 7 . Werden die Zweifel auch hierdurch nicht beseitigt, so sind die Stimmen zu zählen 468 . Das Auszählverfahren wird im allgemeinen in Form des sog. „Hammelsprungs" vorgenommen 469. Die Mitglieder des Landtags verlassen nach Aufforderung des Präsidenten den Sitzungssaal. Die Türen werden geschlossen bis auf die zur Abstimmung erforderlichen Türen. Dann bestimmt der Präsident für jede Abstimmungstür einen Zähler, meist einen Schriftführer. Auf das Glockenzeichen des Präsidenten treten die Abgeordneten, die dem Beschlußvorschlag zustimmen wollen, durch die Ja-Tür, die ihn ablehnen wollen, durch die Nein-Tür, und die keine Stimmen abgeben wollen, durch die Enthaltungstür in den Plenarsaal ein. Die eintretenden Abgeordneten werden an den Eingängen laut gezählt. Kein Mitglied des Landtags darf vor Schluß der Abstimmung den Saal wieder verlassen. Mit einem Glokkenzeichen schließt der Präsident die Zählung. Hierauf stimmen nur noch der Landtagspräsident und die bestellten Zähler selbst ab. In Bayern geben die diensttuenden Mitglieder des Präsidiums ihre Stimme bereits vor dem Auszählungsverfahren in einem amtlichen Briefumschlag ab, während in Nordrhein-Westfalen die Stimmabgabe am Abstimmungsende durch öffentliche Erklärung erfolgt 470 . Später eintretende Abgeordnete werden nicht mehr mitgezählt. Das Hammelsprungverfahren leitet seinen Namen von einem Bild her, das im alten Reichstagsgebäude über einer der Türen angebracht war. Diese Sopraporte stellte den zuvor von Odysseus geblendeten Polyphem dar, der am Eingang seiner Höhle die hinausströmenden Schafe abtastete und zählte, ohne jedoch auf diese Weise die Flucht des Odysseus und seiner Gefährten verhindern zu können 471 . Ist selbst nach der Stimmenzählung das Abstimmungsergebnis weiterhin zweifelhaft, so erfolgt in der Bremer Bürgerschaft eine namentliche Abstimmung 472 . Die Bayerische Geschäftsordnung sieht vor, daß unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses ein Abgeordneter geschäftsordnungsmäßig das Ergebnis der Abstimmung bezweifeln und den Antrag stellen kann, die Abstimmung in der nächst strengeren Form zu wiederholen. Wird dieser Antrag zudem von einer Fraktion oder zwanzig Abgeordneten unterstützt, so entscheidet die Voll467 § 133 I 3 GOLT-By. 468 § 83 IV GOLT-He; § 134 I GOLT-By; § 52 V 2 GOLT-NRW; § 102 II 1 GOLT-Ss; § 74 II 2 GOLT-SA; § 42 V 2 GOLT-RP; § 32 III 1 GOBü-Ha; § 83 II 2 GOLT-Nds; § 68 II GOLT-Bg; § 57 II 1 GOBü-Br. In Baden-Württemberg wird das Ergebnis durch Namensaufruf festgestellt, § 97 I 3 GOLT-BW. In Sachsen-Anhalt ist diese Form alternativ möglich, § 74 II 2 GOLT-SA. 469 Ausführliche Beschreibungen zum Verfahren finden sich in §§ 83 III GOLT-Nds; 102 III GOLT-Ss; 70 II GO-Be; 134 II GOLT-By; 74 III GOLT-SA. In Berlin besteht für den Präsidenten zudem die Möglichkeit, mit der elektronischen Abstimmungsanlage abstimmen zu lassen, § 7 0 I V a) GO-Be. 470 § 134 II 1 GOLT-By; § 52 V 2 GOLT-NRW. 471 Dach, in: BK, Art. 40, Rn. 99. 472 § 57 II 2 GOBü-Br.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
157
Versammlung, ob dem Antrag entsprochen wird, anderenfalls erfolgt die Gegenprobe in der Ausgangsform der Abstimmung. Ergeht ein derartiger Beschluß, so tritt an die Stelle der Abstimmung durch Zeichen die Auszählung und - ähnlich wie in Bremen - an deren Stelle die namentliche Abstimmung 473 . Nach der Berliner Geschäftsordnung kann zum zweiten Mal abgestimmt werden, wenn über das Ergebnis der Abstimmung eine Entscheidung des amtierenden Präsidiums herbeigeführt wurde und wenn nach einstimmiger Meinung des Hauses ein offensichtlicher Irrtum vorliegt 474 . Eine namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung der Abstimmung beantragt werden 475 . Der Landtagspräsident muß sie vornehmen, wenn der Antrag von einer Fraktion 476 oder von einer bestimmten Abgeordnetengruppe unterstützt wird, deren Größe unterschiedlich ist. So sind in Baden-Württemberg und im Saarland fünf, in Hamburg sechs, in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt jeweils acht und in Niedersachsen sowie Thüringen jeweils zehn anwesende Abgeordnete erforderlich 4 7 7 . In Mecklenburg-Vorpommern spricht die Geschäftsordnung von fünfzehn anwesenden Abgeordneten, in Schleswig-Holstein von achtzehn anwesenden Abgeordneten und in Bayern sogar von zwanzig anwesenden Abgeordneten 478. In Bremen ist eine Abgeordnetengruppe in Fraktionsstärke vorgeschrieben 479. Hingegen wird in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ein Verlangen von 1 / 4 bzw. 1 /5 der Mitglieder des Landtags vorausgesetzt 480. In Sachsen schließlich muß eine namentliche Abstimmung stattfinden, wenn ein entsprechender Antrag durch anwesende fünf vom Hundert der Mitglieder des Landtags unterstützt wird 4 8 1 . In einigen Ländern wird eine namentliche Abstimmung für bestimmte Verhandlungsgegenstände sogar geschäftsordnungsmäßig angeordnet. Dies gilt für die Landtage von Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen, in denen über Verfassungsänderungen ausschließlich namentlich abgestimmt werden darf 482 . Ebenso hat in Bayern die Schlußabstimmung über Gesetzesvorlagen in dieser Weise stattzufinden 483 . 473 § 1381 GOLT-By. 474 § 70 III GO-Be. 475 § 53 I 1 GOLT-Nds; § 45 I 1 GOLT-RP; § 33 I 2 GOBü-Ha; § 441 1 GOLT-Th; § 691 1 GOLT-Bg; § 71 I GO-Be; § 86 I 1 GOLT-He; § 53 I 1 GOLT-NRW; § 63 II 1 GOLT-SH; § 50 II 1 GOLT-MV; § 69 I 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 476 § 71 I GO-Be; § 86 I 1 GOLT-He; § 135 III 2 GOLT-By; § 53 I 2 GOLT-NRW; § 75 III 1 GOLT-SA; § 45 I 2 GOLT-RP; § 441 2 GOLT-Th; § 50 II 1 GOLT-MV; § 691 2 GOLT-Bg. 477 § 991 GOLT-BW; § 69 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 33 I 1 GOBü-Ha; § 45 I 2 GOLT-RP; § 75 III 1 GOLT-SA; § 84 III 1 GOLT-Nds; §4412 GOLT-Th. 478 § 50 III GOLT-MV; § 63 II 1 GOLT-SH; § 135 III 2 GOLT-By. 479 § 57 III 1 GOBü-Br. 480 § 53 I 2 GOLT-NRW; § 69 I 2 GOLT-Bg. 481 § 101 I GOLT-Ss. 482 § 99 II GOLT-BW; § 691 1 Gesetz über den Landtag des Saarlands; § 101 II GOLT-Ss. 483 § 1351 GOLT-By.
158
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Die namentliche Abstimmung vollzieht sich derart, daß die Mitglieder des Landtags einzeln zur Stimmabgabe aufgerufen werden, entweder in alphabetischer Reihenfolge 484 oder in einer wechselnden Buchstabenfolge 485. Beim Aufruf ihres Namens antworten sie m i t , ja" oder „nein" oder „Stimmenthaltung". Vorbehalte, Bedingungen oder eine Begründung sind nicht statthaft 486. Vor Schließung der Abstimmung erkundigt sich der amtierende Präsident, ob möglicherweise ein anwesendes Mitglied des Landtags nicht aufgerufen worden ist 4 8 7 . Ist dies der Fall, wird der Betreffende unter Namensnennung nach seiner Stimmabgabe gefragt 488 . Erhält der Landtagspräsident keine Antwort, so stellt er fest, daß sich der entsprechende Abgeordnete an der Abstimmung nicht beteiligt hat 4 8 9 . Irrtümlich abgegebene Stimmen können bis zum Schluß der Abstimmung berichtigt werden 490 . In einigen Landesparlamenten, wie in Berlin, Rheinland-Pfalz und Thüringen 4 9 1 , erhält für die namentliche Abstimmung jeder Abgeordnete drei Abstimmungskarten, die seinen Namen tragen, in drei verschiedenen Farben gehalten und mit, Ja",,,Nein" oder „Enthält sich" gekennzeichnet sind. Bei Namensaufruf wirft jeder Abgeordneter seine Stimmkarte in die von einem Schriftführer beaufsichtigte Wahlurne. Die Verwendung anderer als der amtlich hergestellten Stimmkarten sowie auf diesen angebrachte Zusätze oder Abänderungen machen die Abstimmung ungültig 492 . Dies gilt auch für den Fall, daß ein Abgeordneter zwei sich widersprechende Stimmkarten abgegeben hat; bei zwei gleichlautenden Stimmkarten wird nur eine gewertet 493 . Nachdem alle Stimmkarten eingesammelt wurden, erklärt der Landtagspräsident die Abstimmung für geschlossen. Nunmehr beginnt die Auszählung, während der keine Korrektur der abgegebenen Stimmen mehr möglich ist. Das Abstimmungsergebnis wird anfangs nur als vorläufiges bekanntgegeben und steht bis zur Verkündung des endgültigen unter dem Vorbehalt der Korrektur, die sich aus der kontrollierenden Zählung ergeben kann. Wird die Richtigkeit des Ergebnisses von einem Abgeordneten bezweifelt, so erfolgt sofort eine Nachprüfung durch die Schriftführer und den Präsidenten, mitunter wird die Abstimmung auch sofort wiederholt 494 . Nach dem Schluß der Sitzung, in der die 484 485 486 487
§ 137 I 1 GOLT-By; § 57 IV GOBü-Br; § 75 II 1 GOLT-SA; § 84 II 1 GOLT-Nds. § 99 IV 2 GOLT-BW; 101IV 2 GOLT-Ss. § 57 V 2 GOBü-Br. § 51 Satz 3 Gesetz über den Landtag des Saarlandes;
488 § 86 III 2 GOLT-He; § 69 II 3 GOLT-Bg. 489 § 53 II 4 GOLT-NRW; § 69 II 4 GOLT-Bg. 490 § 99 γ 4 GOLT-BW. 491 § 71 II GO-Be; § 45 II GOLT-RP; § 44 II GOLT-Th. In allen anderen Ländern gilt das oben dargestellte Verfahren. In Nordrhein-Westfalen kann die Abstimmung stattdessen durch Zuhilfenahme einer elektronischen Abstimmungsanlage erfolgen, § 53 II 1 GOLT-NRW. 492 § 137 III GOLT-By. 493 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 196; Ritzel / Bücker, § 52, Anm. 2e, S. 2. 494 § 57 IV 3 GOBü-Br.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
159
Abstimmung vorgenommen wurde, ist schließlich eine Anfechtung des Ergebnisses nicht mehr möglich 495 . Bei der namentlichen Abstimmung wird außerdem im Stenographischen Bericht vermerkt, wie jedes Mitglied des Landtags abgestimmt hat 4 9 6 . In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist im übrigen eine Abstimmung durch Namensaufruf angeordnet, wenn ein Beschluß einer Mehrheit bedarf, die nach der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags zu berechnen ist 4 9 7 . Während in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen eine namentliche Abstimmung nur über den Beratungsgegenstand selbst und über Änderungs- und Entschließungsanträge zulässig ist 4 9 8 , wird in allen anderen Geschäftsordnungen negativ abgegrenzt. Dementsprechend ist die namentliche Abstimmung unzulässig bei der Festsetzung von Zeit und Tagesordnung der Sitzung, bei Anträgen auf Vertagung der Sitzung oder der Beratung eines Gegenstandes oder auf Abkürzung der Fristen oder auf getrennte Abstimmung, bei Anträgen auf Festsetzung der Mitgliederzahl eines Ausschusses, bei Anträgen auf Überweisung an einen Ausschuß sowie bei der Entscheidung über Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen499. In Bayern ist eine namentliche Abstimmung ferner unzulässig bei Widersprüchen hinsichtlich der Fragestellung und bei Anträgen auf Erscheinen eines Mitglieds der Staatsregierung 5 0 0 . Mitunter ist auch die Unzulässigkeit namentlicher Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung ausdrücklich vorgeschrieben 501. Die enumerati ve Auflistung dieser Gründe ergibt ihre abschließende Natur, was ihrer ausdehnenden Auslegung oder analogen Anwendung unter den entsprechenden Voraussetzungen allerdings nicht entgegensteht502. Eine geheime Abstimmung muß der Landtagspräsident zumeist bei Wahlen vornehmen 503 . Über die Wahl der üblichen exponierten staatlich-parlamentarischen 495 § 99 v i n GOLT-BW; § 101 VIII GOLT-Ss. 496 § 75 IV 2 GOLT-SA; § 84IV 2 GOLT-Nds; siehe auch § 87 Satz 2 GOLT-He. 497 § 841 GOLT-Nds; § 75 I GOLT-SA. 498 § 75 III 2 GOLT-SA; § 84 III 2 GOLT-Nds. 499 § 99 ΙΠ GOLT-BW; § 71 V GO-Be; § 54 GOLT-NRW; § 101 III GOLT-Ss; § 45 IV GOLT-RP; § 33 I 3 GOBü-Ha; § 63 II 3 GOLT-SH; § 44 IV GOLT-Th; § 50 II 3 GOLT-MV; § 70 GOLT-Bg; § 69 III Gesetz über den Landtag des Saarlandes. In Hessen findet sich keine ausdrückliche Bestimmung über die Unzulässigkeit der namentlichen Abstimmung. Diese ist jedoch auch hier wie in allen anderen Landtagen anzunehmen, wenn eine nicht namentlich durchgeführte Abstimmung wiederholt wird, weil sie wegen Beschlußunfähigkeit, eines Irrtums oder Ungültigkeit ergebnislos geblieben ist. Eine derartige ungeschriebene Regelung ist notwendig, um zu vermeiden, daß durch die Wahl einer anderen Abstimmungsart möglicherweise das Abstimmungsergebnis verändert wird, Achterberg, S. 645. 500 § 136 Nr. 7, 10 GOLT-By. 501 § 57 VI GOBü-Br; § 136 Nr. 9 GOLT-By; § 33 I 3 GOBü-Ha; § 63 II 3 GOLT-SH; §50 II 3 GOLT-MV. 502 Vgl. Troßmann, § 58, Rn. 1 ; Achterberg, S. 645. 503 § 50 V 1 GOLT-MV; § 97a I 1 GOLT-BW; § 10011 GOLT-Ss; § 4611 GOLT-Th.
160
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Funktionsträger wie ζ. B. Ministerpräsident und Landtagspräsident hinaus werden in den Landtagen von Baden-Württemberg und Sachsen auch der Präsident des Staatsgerichtshofs, dessen ständiger Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des Staatsgerichtshofs ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Entsprechendes gilt zudem für die Wahl bzw. für die Erteilung der Zustimmung zur Ernennung des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs sowie des Landesbeauftragten für den Datenschutz504. Eine geheime Abstimmung ist geschäftsordnungsmäßig ferner in Bayern vorgesehen bei der Entscheidung über einen Antrag auf Abberufung eines Mitglieds des Präsidiums, eines Ausschußvorsitzenden oder dessen Stellvertreters 505. In Mecklenburg-Vorpommern kann außerdem auf Antrag von mindestens fünfzehn Abgeordneten oder einer Fraktion eine geheime Abstimmung beschlossen werden 506 . Die geheime Abstimmung findet in der Weise statt, daß die Abgeordneten auf weißen unbeschriebenen Karten die vom Landtagspräsidenten formulierte Abstimmungsfrage mit „ja", „nein" oder „Enthaltung" beantworten 507. Zur Abgabe der amtlichen Stimmzettel werden die Mitglieder des Landtags mit Namen aufgerufen 508 , wobei die Abstimmungskarten von den Schriftführern in Urnen gesammelt werden 509 . Häufig erfolgt die geheime Abstimmung auch durch die Verwendung verdeckter Stimmzettel 510 . In diesem Fall dürfen die Stimmzettel erst nach Namensaufruf, unmittelbar vor Betreten der Wahlkabine ausgehändigt werden 511 . Bei der Stimmabgabe sind die zur Gewährleistung einer geheimen Wahl aufgestellten Wahlkabinen zu benutzen. Jeder Stimmzettel enthält die Namen aller Bewerber nach der Reihenfolge des Vorschlags. Dabei muß dem Wähler die Möglichkeit gegeben werden, mit „Ja", „Nein" oder „Enthaltung" stimmen zu können. Fehlt eine Kennzeichnung, gilt die Stimme als nicht abgegeben. In Schleswig-Holstein und Hamburg hingegen bedeutet die Abgabe eines weißen Zettels Wahlenthaltung512. Hat hingegen der Wähler bei mehr Namen mit „Ja" gestimmt als Personen zu wählen sind, so ist der Stimmzettel ungültig 513 . Die gekennzeichneten Stimmzettel sind anschließend in einem Umschlag in die dafür vorgesehenen Wahlurnen zu legen. Die Schriftführer haben mithin Stimmzettel zurückzuweisen, die außerhalb 504 § 97a III GOLT-BW; § 100 III GOLT-Ss. Vgl. auch § 71 II GOLT-Bg. 505 §§ 9 II, 2b GOLT-By. 506 § 50 III 1 GOLT-MV. 507 § 50 III 2 GOLT-MV. 508 § 46 I 2 GOLT-Th; § 97a I 2 GOLT-BW; § 46 I 2 GOLT-Th; § 1001 2 GOLT-Ss; § 67 I 3 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 509 § 58 III GOBü-Br; § 50 III 3 GOLT-MV. 510 Dies ist etwa in Bremen der Fall, wenn es von Mitgliedern der Bürgerschaft in Fraktionsstärke verlangt wird, § 58 IV 1 GOBü-Br, ansonsten wenn es die Verfassung, ein Gesetz oder die Geschäftsordnung vorsieht. su § 74 II 2 GO-Be; § 58 IV 2 GOBü-Br; § 461 5, 6 GOLT-By. 512 § 28 I GOLT-SH; § 28 I 2 GOBü-Ha. 513 § 74 VI GO-Be; § 58 VI GOBü-Br.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
161
der Wahlkabine gekennzeichnet oder in den Wahlumschlag gelegt wurden, sowie diejenigen, die überhaupt nicht in einen Wahlumschlag gelegt wurden. Zurückzuweisen sind ferner Stimmzettel, die sich in einem Wahlumschlag befinden, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält 514 . Überdies sind Stimmzettel, die Zusätze oder Kennzeichnungen enthalten, ungültig, wenn sie den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lassen oder aber die Person des Wählers erkennbar wird 5 1 5 . Vereinzelt ist in den Geschäftsordnungen vorgesehen, daß auf Vorschlag des Landtagspräsidenten oder auf Antrag 516 an Stelle einer geheimen Abstimmung auch offen durch Handzeichen oder sogar durch Zuruf 5 1 7 gewählt werden kann, es sei denn, daß ein Abgeordneter, in Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein fünfzehn bzw. achtzehn Abgeordnete 518, in Bayern 1/3 der Mitglieder des Landtags 519 , oder eine Fraktion widersprechen 520. Dies gilt jedoch nicht bei Wahlen, für welche in der Verfassung, durch Gesetz oder durch die Geschäftsordnung geheime Abstimmung vorgeschrieben ist. Eine namentliche Abstimmung ist ebenso wenig zulässig 521 . Der Sinn einer geheimen Abstimmung besteht vor allem darin, daß persönliche Beziehungen nicht durch ein bei der Wahl zu Tage tretendes Abstimmungsverhalten belastet werden sollen. Eine geheime Wahl verhindert indessen nicht, die Namen deijenigen Abgeordneten offenzulegen, die an ihr teilgenommen haben. Verboten ist vielmehr nur, das „Wie", nicht aber, das „Ob" der Abstimmung bekanntzugeben522. Das Ergebnis jeder Abstimmung wird durch das Sitzungspräsidium festgestellt und vom Landtagspräsidenten verkündet 523 . Dabei erklärt er, ob die Abstimmungsfrage bejaht oder verneint worden ist, ob Gegenstimmen abgegeben wurden oder ob Stimmenthaltungen zu verzeichnen sind. Das Parlament faßt seine Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit nicht die Verfassung eine andere Mehrheit vorschreibt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung 524 . Soweit 514 §§ 58 IV 3 GOBü-Br; § 74 II 5 GO-Be. 515 § 58 V GOBü-Br. 516 § 63 III 3 GOLT-SH. 517 § 741 1 GO-Be; § 47 GOLT-RP. 518 § 50 V 3 GOLT-MV; § 63 III 3 GOLT-SH. 519 § 46 III GOLT-By. 520 § 97a II 1 GOLT-BW; § 58 II 1 GOBü-Br; § 46 II 1 GOLT-Th; § 77 I 2 GOLT-SA; § 67 I 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 8612 GOLT-Nds. 521 § 97a II 2, 3 GOLT-BW; § 46 II 2, 3 GOLT-Th; § 100 II 2, 3 GOLT-Ss. 522 Troßmann, § 54a, Rn. 8; Achterberg, S. 643. 523 § 72 I GOLT-Bg; § 71 III GO-Be; § 99 VI GOLT-BW; § 87 Satz 1 GOLT-He; § 137 III GOLT-By; § 55 I GOLT-NRW; § 102 I GOLT-Ss; § 79 GOLT-SA; § 64 I GOLT-SH; § 5 1 1 GOLT-MV. 11 Köhler
162
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
für einen Beschluß oder eine Wahl eine bestimmte Mehrheit vorgeschrieben ist, hat der Landtagspräsident klarzustellen, ob diese Mehrheit erreicht wurde 525 . Nach Schluß der abschließenden Abstimmung über einen Beratungsgegenstand muß der Landtagspräsident jedem Abgeordneten, mitunter auch jeder Fraktion 526 die Möglichkeit gewähren, eine mündliche Erklärung zu dem Stimmverhalten abzugeben 527 . Diese Erklärung hat sich auf eine sachliche Begründung für das Votum zu beschränken 528 und darf einen Zeitraum von drei 5 2 9 oder fünf 5 3 0 Minuten nicht überschreiten. Wird dieser Rahmen vom Redner nicht eingehalten, so kann der Landtagspräsident ihm das Wort entziehen 531 . Mitunter besteht auch alternativ die Möglichkeit, eine kurze schriftliche Erklärung abzugeben, die in das Plenarprotokoll aufzunehmen ist 5 3 2 . Eine Verlesung im Landtag kann hingegen nicht verlangt werden 533 . Ausgenommen hiervon sind Wahlen, die nach Verfassung oder Gesetz ohne Aussprache vorzunehmen sind 534 , sowie Abstimmungen zu Geschäftsordnungsanträgen 535. Über die Erklärung zur Abstimmung findet grundsätzlich keine Aussprache statt 536 . In Hessen und Niedersachsen kann die Begründung der Abstimmung nur in schriftlicher Form erfolgen 537 . Im Saarland ist eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung allein zulässig, wenn der Abgeordnete seine von dem Beschluß der Mehrheit abweichende Stimmabgabe begründen w i l l 5 3 8 . Diese Begründung ist spätestens am ersten Werktag nach der Sitzung dem Präsidenten zu übermitteln. Auch hier kann der Abgeordnete die Aufnahme der Begründung in den Sitzungsbericht verlangen, nicht jedoch ihre Verlesung vor dem Landtag. In Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen kann jedes Mitglied des 524 § 691 GO-Be; § 97 II GOLT-BW; § 83 II GOLT-He; § 133 II GOLT-By; § 99 II GOLTSs; § 73 I, II GOLT-SA; § 42 II GOLT-RP; § 60 I GOLT-SH; § 48 I GOLT-MV; § 82 I, II GOLT-Nds. 525 § 83 III GOLT-He; § 55 II GOLT-NRW; § 66 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 41IV GOLT-Th. 526 § 88 I 1 GOLT-He; § 100 II GOLT-BW; § 1391 GOLT-By; § 76 II GOLT-SA; § 103 II GOLT-Ss; § 64 II 2 GOLT-SH. 527 § 73 II 1 GOLT-Bg; § 100 I 1 GOLT-BW; § 139 II 1 GOLT-By; § 76 I 1 GOLT-SA; § 103 I 1 GOLT-Ss; § 5611 GOLT-NRW; § 88 II 1 GOLT-He; § 46 Satz 1 GOLT-RP; § 64 II 1 GOLT-SH; § 45 Satz 1 GOLT-Th. 528 § 139 II 2 GOLT-By. 529 § 73 II 1 GOLT-Bg; § 76 III GOLT-SH; § 103 III GOLT-Ss; § 64 II 3 GOLT-SH; § 45 Satz 1 GOLT-Th. 530 § 139 III GOLT-By; § 5611 GOLT-NRW; § 88 12 GOLT-He; § 100 III GOLT-BW. 531 532 533 534 535 536 537
§ 73 III GOLT-Bg. § 73 II 1 GOLT-Bg; § 56 II GOLT-NRW; § 46 Satz 2, 3 GOLT-RP; § 45 GOLT-Th. § 56 II GOLT-NRW. § 73 II 2 GOLT-Bg; § 76 12 GOLT-SA; § 10012 GOLT-BW; § 103 I 2 GOLT-Ss. § 73 II 2 GOLT-Bg. § 139IV GOLT-By; § 103 IV GOLT-Ss. § 88 II 1 GOLT-He; § 85 Satz 2 GOLT-Nds.
538 §52 GOLT-Sl.
VI. Die Leitung der Abstimmungen
163
Landtags außerdem nach der Abstimmung erklären, warum es nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich enthalten hat 5 3 9 . In Sachsen-Anhalt ist diese Erklärung nur vor der Abstimmung zulässig 540 . Im übrigen kann der Landtagspräsident vor wichtigen abschließenden Sachentscheidungen oder vor einer Wahl eine Überlegungspause einschalten541. Er ist dazu mitunter verpflichtet, wenn es eine Fraktion oder eine bestimmte Abgeordnetengruppe verlangt. Die Überlegungspause soll im allgemeinen nicht länger als dreißig Minuten oder eine Stunde dauern. Ist eine längere Zeit erforderlich, so soll der Präsident den Tagesordnungspunkt vertagen lassen. In Hessen besteht für den Fall, daß zu einer Vorlage mündlich Änderungen beantragt werden, zudem die Möglichkeit, auf Verlangen einer Fraktion die Abstimmung so lange auszusetzen, bis der Änderungsantrag schriftlich vorliegt 542 . Vom Beginn der Aufforderung zur Abstimmung bis zur Verkündung des Ergebnisses erteilt der Landtagspräsident im allgemeinen weder das Wort noch läßt er Anträge zu 5 4 3 . Die Geschäftsordnung des Saarländischen Landtags sieht allerdings vor, daß die Abstimmung über einen Beratungsgegenstand durch eine Abstimmung über einen Geschäftsordnungsantrag, der jedoch das Abstimmungsverfahren selbst betreffen muß, unterbrochen werden darf 544 . Ebenso muß der Nordrhein-Westfälische Landtagspräsident während der Abstimmung das Wort erteilen, wenn es sich dabei um einen Beitrag zur Abstimmung handelt 545 . Die Geschäftsordnungen von Rheinland-Pfalz und Thüringen bestimmen sogar, daß zwischen der Abstimmung und der Verkündung des Ergebnisses verhandelt werden darf; Beschlüsse hingegen dürfen nicht gefaßt werden 546 . In Bayern besteht schließlich die Regelung, daß der Landtagspräsident einen Abgeordneten von der Abstimmung auszuschließen hat, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die allein und unmittelbar ihn selbst betreffen. Gegen die Verweigerung der Zulassung zur Abstimmung ist der sofortige Einspruch an den Ältestenrat möglich. Dem Einspruch ist Rechnung zu tragen, wenn nicht mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des Ältestenrats widersprechen. Der Ältestenrat entscheidet innerhalb des Landtags endgültig 547 .
539 § 51 II GOLT-MV; § 56 III 1 GOLT-NRW. 540 § 76 IV GOLT-SA. 541 § 140 GOLT-By; § 86 I 2 GOLT-He; § 51 Satz 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 41 VI GOLT-Th; § 104 GOLT-Ss. 542 § 84 GOLT-He. 543 544 545 546
§ 132 V GOLT-By; § 99IV GOLT-Ss; § 66 III GOLT-Bg. §49 GOLT-Sl. § 50 III GOLT-NRW. § 45 III GOLT-RP; § 44 III GOLT-Th.
547 § 141 GOLT-By. 1
164
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
V I I . Die Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten bei Fragen der Geschäftsordnung Die parlamentarische Geschäftsordnung dient dem Landtagspräsidenten als Grundlage für die Ausübung seiner Leitungskompetenz, auf deren Anordnungen er während der gesamten Sitzung zurückzugreifen hat. Bei der Anwendung dieser Bestimmungen können aus vielerlei Gründen Zweifel auftreten. Sofern die Geschäftsordnung das konkrete Problem zwar regelt, aber keine eindeutige Lösung anbietet, ist eine Auslegung unerläßlich. Die Entscheidung über die Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall obliegt in mehreren Länderparlamenten dem Präsidenten und ist Ausfluß seiner Leitungsgewalt548.
1. Rechtsnatur und Geltungsdauer der Geschäftsordnung Aufgabe der parlamentarischen Geschäftsordnung ist es, einerseits eine der Bewältigung der Aufgaben des Parlaments förderliche Verfahrensweise und Organisation festzulegen, insbesondere ein ordnungsgemäßes Verfahren bei den Beratungen und Abstimmungen zu gewährleisten, und andererseits den Schutz der Minderheiten durch Festlegung von Minderheitenrechten zu sichern 549 . Während der Zweck der Geschäftsordnung damit klar umrissen ist, hat deren Rechtscharakter offenbar noch keine abschließende Einordnung erfahren. Sofern die Verfassung nicht ausnahmsweise eine bestimmte Form für den Erlaß der Geschäftsordnung vorsieht, wie dies etwa in Art. 70 I der Saarländischen Verfassung mit dem Hinweis auf die fakultative Gesetzesform geschehen ist, ist der Platz der parlamentarischen kodifizierten Geschäftsordnungen im System der Rechtsquellen seit jeher umstritten. Die Theorien zur Rechtsnatur der parlamentarischen Geschäftsordnungen knüpfen dabei sowohl am Konzept der Regelungsformen als auch an der Rechtsstellung des Parlaments an. So wurden sie beispielsweise maßgeblich von Hatschek als interne Rechtsvorschriften ohne Rechtssatzcharakter, als Konventionalregeln eingestuft 550 . Eine andere Auffassung hingegen betrachtete sie als Rechtsverordnungen 551, während das Parlamentsbild von der Versammlung freigewählter Abgeordneter zu der Charakterisierung parlamentarischer Geschäftsordnungen als öffentlich-rechtliche Vereinbarung führte 552 . Teilweise wurden sie 548 Vgl. Ritzel/Bücker, § 7, Anm. 2d, S. 5. 549 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 123; Böttcher, S. 126; Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 22. 550 Hatschek qualifiziert sie wörtlich als „eine Summe von Resolutionen des Hauses, die an und für sich nicht rechtsverbindlich sind und welche nur Konventionalregeln ( . . . ) darstellen, d. h., in hundert Fällen werden sie befolgt und im hundertersten Fall wieder außer acht gelassen, je nachdem es das Haus zweckmäßig und angemessen findet", Hatschek, S. 42. 551 Jellinek, System, S. 169; G. Meyer/G. Anschütz, S. 235. 552 v. Brentano, S. 11.
VII. Die Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten
165
auch als „Verfassungssatzung" 553 oder „Organsatzung" 554 bewertet und mitunter sogar neben den VerwaltungsVorschriften als zweite Form des Innenrechts 555. Vereinzelt sah man schließlich in der parlamentarischen Geschäftsordnung ein Gebilde sui generis 556 . Die derzeit herrschende Lehre vom Rechtscharakter der parlamentarischen Geschäftsordnung betont indessen stärker die parlamentarische Selbständigkeit. Danach ist die Geschäftsordnung eines Parlaments eine autonome Satzung mit der Konsequenz, daß sie ungeachtet ihrer großen Bedeutung für das materielle Verfassungsrecht und das Verfassungsleben der Verfassung und den Gesetzen im Range nachsteht557. Das Bundesverfassungsgericht und einige Landes Verfassungsgerichte haben diese Ansicht in ihren Entscheidungen bestätigt558. Entsprechend ihrer Rechtsnatur binden die Bestimmungen der Geschäftsordnung nur die Mitglieder des Parlaments und besitzen damit für Dritte keine Rechtsverbindlichkeit 559. Kein Landtag ist an die Geschäftsordnung eines vorangegangenen gebunden. Dieser Grundsatz der Diskontinuität der parlamentarischen Arbeit 5 6 0 führt dazu, daß sich jedes neu gewählte Parlament für die anstehende Legislaturperiode eine eigene Geschäftsordnung geben muß 5 6 1 . Gleichwohl ist es möglich und sogar in der Praxis die Regel, daß der nächste Landtag die in Kraft befindliche Geschäftsordnung des früheren Parlaments übernimmt 562 . Dies kann durch einen ausdrücklichen Akt, aber auch konkludent durch Stillschweigen geschehen563. 553 Böckenförde, S. 122f.; Steiger, S. 41 ff.; Magiera, S. 123. 554 Stern II, § 26 III 6 d. 555 Arndt, S. 159ff.; ähnlich auch die Lösung von Achterberg, S. 59 und Weides, in: Staatslexikon, Bd. 2, S. 922. 556 Haagen, S. 32 ff.; Rösch, S. 83; Seifert in: Seifert/Hömig, Art. 40, Rn. 3. 557 Maunz, MD, Art. 40, Rn. 21 f.; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 123; Ritzel/ Bücker, § 7, Anm. IV 4b bb, S. 11; Leibholz/Rinck, Art. 40, Rn. 2; Klein, Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 40, Rn. 6; v. Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, 2. Aufl., S. 914f. Sachs-Magiera, Art. 40, Rn. 25 und Haug, S. 194 f. sprechen indessen in Abgrenzung zur autonomen Satzung von „Verfassungssatzung". Kritisch dazu Kretschmer, der diese Auffassungen schon deshalb als nicht vollends befriedigend empfindet, weil der Begriff der Satzung Analogien zu Fällen des Kommunalrechts und des Vereinsrechts zieht, bei denen zwar eine Selbständigkeit bei der Satzungsgebung vorliegt, das Inkrafttreten der Satzung aber von der staatlichen Genehmigung einer Aufsichtsbehörde oder eines kontrollbefugten Gerichts abhängig ist, Kretschmer in: Schneider/Zeh, § 9, Rn. 48. 558 BVerfGE 1, 144 (148 f.); BayVerfGH E 8 II, 91 ( 95 ff.); HambVerfG, DVB1. 1976, 444. Das Bundesverfassungsgericht hat dabei im übrigen deutlich gemacht, daß die Geschäftsordnung nicht nur die geschriebene Satzung, sondern zudem die gewachsene parlamentarische Tradition und Praxis sei, vgl. S. 161. 559 BVerfGE 1, 144 (148); Pieroth in: Jarass/Pieroth, Art. 40, Rn. 5; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 124. 560 Dazu Jekewitz, Diskontinuität, S. 242 ff. 561 Vgl. Ziekow, in: JuS 1991, 28 (29). 562 Vgl. BVerfGE 1, 144 ( 148); Arndt, S. 126ff. Vgl. dazu auch §§ 152 GOLT-By, 112 GOLT-Ss. 563 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 123.
166
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
2. Die Auslegung der Geschäftsordnung Treten während einer Plenarsitzung ad hoc Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall auf, so entscheidet hierüber in aller Regel der amtierende Landtagspräsident 564. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Zweifel handelt, die der Parlamentspräsident selbst hegt, oder aber um Zweifel, die von Mitgliedern des Hauses geäußert werden 565 . Zunächst jedoch muß der Landtagspräsident unterscheiden, ob es sich um eine Auslegung nur für den Einzelfall oder eine darüber hinausgehende handelt, für die er im allgemeinen nicht zuständig ist. Die Entscheidung über die Auslegungsart obliegt ihm allein, wodurch er naturgemäß den Landtag, der im Regelfall über die grundsätzliche Auslegung entscheidet, weitgehend von der Auslegung ausschalten kann 566 . Vertritt er die Auffassung, es handele sich bei der gegebenen Konstellation um einen Einzelfall, so trifft er seine Entscheidung ohne Befragung des Landtags. Diese Auslegung kann dann lediglich für den konkreten Einzelfall Geltung beanspruchen, für künftige Fälle hingegen ist sie ohne Bedeutung. Da die Auslegungsentscheidung somit keine rechtsfortbildende Wirkung entfalten kann, handelt es sich also auch nicht um einen Präzedenzfall, dem eine Regel entnommen werden kann, die auch in kommenden Fällen Anwendung findet. Dies erscheint um so verständlicher, wenn man berücksichtigt, daß die Auslegung der Geschäftsordnung häufig ad hoc und mit einer gewissen Spontanität erfolgen muß. Gleichwohl bleibt es unbenommen, ausgesuchte Entscheidungen bei der Geschäftsordnungsinterpretation als Argument zu verwenden 567. Eine gewisse fortdauernde Geltung erlangt die Auslegung des Landtagspräsidenten allerdings, wenn sie in immer wiederkehrender Weise in der gleichen Art erfolgt. Mit dieser Handhabung kann der Präsident durch eine stets gleichmäßige und einheitliche Anwendung der Geschäftsordnung und ihrer Auslegungsregeln eine über den Einzelfall hinausgehende grundsätzliche Auslegung mit präjudizieller Wirkung erreichen 568 . In diesem Sinne kann der Landtagspräsident zudem auch eine Auslegungsentscheidung bei einem Einzelfall von „grundsätzlicher" Bedeutung selbständig treffen und auf diesem Wege der Entscheidungsbefugnis des Parlaments in Angelegenheiten grundsätzlicher Art vorgreifen 569 . Die Auslegung selbst nimmt der Landtagspräsident nicht nach pflichtgemäßen Ermessen vor 5 7 0 . Vielmehr hat er dabei die methodologisch anerkannten Aus564 § 89 I GO-Be; § 1041 GOLT-BW; § 113 I 1 GOLT-He; § 150 Satz 1 GOLT-By; § 109 I GOLT-Ss; § 91 I GOLT-SA; § 128 I GOLT-RP; § 91 II GOBü-Ha; § 74 I GOLT-SH; § 61 I GOLT-MV; § 98 GOLT-Nds; § 121 I GOLT-Th; § 71 GOBü-Br. 565 Vgl. Kleinschnittger, S. 77. 566 Böttcher, S. 127. 567 Hans-Achim Roll, in: Festgabe für Werner Blischke, S. 93 (99). 568 Vgl. Mühlbauer, S. 37; Sperling, S. 13; Böttcher, S. 127; Kleinschnittger, S. 78. 569 Böttcher, S. 127. 570 Rothaug, S. 148.
ΥΠ. Die Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten
167
legungsregeln zu beachten und anzuwenden571. Vor allem ist er gehalten, bereits authentische Interpretationen bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen 572. Bei der Auslegung parlamentarischer Geschäftsordnungen ist außerdem die parlamentarische Tradition und Praxis mit heranzuziehen, wie sie durch die historische und politische Entwicklung geformt worden ist 5 7 3 . Denn gerade die Praxis ist im Parlamentsrecht, dessen Normen fast alle unmittelbar der Wirklichkeit entspringen, eine Interpretationshilfe von wesentlicher Bedeutung 574 . Sie zeigt die gegenwärtigen Bewußtseinswandlungen und Entwicklungstendenzen am deutlichsten auf und hat gleichsam einen „Vorsprung" vor dem geschriebenen Recht 575 . Die Entscheidung des Parlamentspräsidenten, die er in aller Regel kurz vor dem Plenum begründet, kann von der Vollversammlung nicht angefochten werden 576 . Ebensowenig ist es zulässig, sie gegen den Willen des Präsidenten in einer Geschäftsordnungsdebatte zur Diskussion zu stellen 577 . Dem Landtagspräsidenten ist es im übrigen nicht verwehrt, von seiner Entscheidungsbefugnis im Einzelfall keinen Gebrauch zu machen und einen Beschluß des Parlaments herbeizuführen, ohne daß es um eine grundsätzliche Auslegungsfrage geht 578 . Eine derartige Einschaltung des Plenums ist schon allein deshalb rechtlich unbedenklich, weil die Auslegungsbefugnis des Präsidenten ihren Ursprung in der Geschäftsordnungsautonomie des Hauses hat und deshalb an das Haus zurückgegeben werden kann 5 7 9 . In einigen Ländern sind hinsichtlich der Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten im Einzelfall Besonderheiten vorzufinden. So liegt etwa in Bayern diese Kompetenz grundsätzlich ebenfalls beim Präsidenten. Widersprechen jedoch eine Fraktion oder zwanzig Abgeordnete, so entscheidet die Vollversammlung. Der Präsident hat durch ausdrückliche Frage Gelegenheit zu geben, einen solchen Widerspruch zu erheben 580 . Gleichermaßen kann in Hamburg die Auslegungsentscheidung auf eine entsprechende Frage des Präsidenten von der Bürgerschaft getroffen werden 581 . Auch in Rheinland-Pfalz und Thüringen kann der Landtag nach Prüfung durch den Rechts- bzw. Justizausschuß über die Auslegung der Geschäfts571 Vgl. Achterberg, S. 333 mit weiteren Ausführungen zu den Auslegungskriterien bei der Interpretation der Geschäftsordnung. 572 Vgl. Sperling, S. 12. 573 BVerfGE 1, 144 ( 148 f.); Klein in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, 8. Aufl., Art. 40, Rn. 7. 574 Vgl. dazu Häberle, in: JZ 1969,613 (615). 575 Rothaug, S. 148. 576 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 124; Klinke, S. 86; Reifenberg, S. 90; Schäfer, S. 66. 577 γ. Brentano, S. 28. 578 Kleinschnittger, S. 78; Troßmann, § 128, Rn. 3; Böttcher, S. 128; a.A. Rothaug, S. 149. 579 Roll, in: Festgabe für Blischke, S. 99. 580 § 150 Satz 2, 3 GOLT-By. 581 § 91 II GOBü-Ha.
168
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Ordnung entscheiden, sofern von einer Fraktion oder von mindestens acht bzw. zehn Abgeordneten Einspruch gegen die vorherige Entscheidung des Landtagspräsidenten erhoben wird 5 8 2 . In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland hingegen entscheidet während der laufenden Debatte im Plenum das geschäftsführende Präsidium über die Auslegung im Einzelfall 583 . Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der Geschäftsordnung geschieht in der Regel nach einer vorausgehenden Beratung bzw. Prüfung in dem für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschuß durch das Parlament 584 . In Baden-Württemberg und Sachsen wird zudem ein entsprechender Antrag verlangt, der von mindestens fünf Abgeordneten bzw. von mindestens zehn vom Hundert der Mitglieder des Landtags eingebracht wird 5 8 5 . Nach der Geschäftsordnung von Nordrhein-Westfalen ist dies nur auf Vorschlag des Ältestenrats und nach Stellungnahme durch das Präsidium möglich 586 . An Stelle des Geschäftsordnungsausschusses erfolgt die vorherige Prüfung in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Innen- und Rechtsausschuß587, in Thüringen im Justizausschuß588 und schließlich in Brandenburg im Hauptausschuß, der gem. § 76 I I GOLT-Bg in erster Linie politisch grundsätzliche Angelegenheiten behandelt589. In Hessen und Sachsen-Anhalt ist statt des Parlaments der Ältestenrat für die grundsätzliche Auslegung zuständig. Jedoch kann eine Fraktion, in Sachsen-Anhalt auch der Präsident, ein Ausschuß oder acht Mitglieder des Landtags verlangen, daß die Auslegung dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt wird 5 9 0 . Eine Unterscheidung zwischen Einzelfallauslegung und grundsätzlicher Auslegung ist dagegen im Gesetz über den Landtag des Saarlandes und in der Bremischen Geschäftsordnung nicht anzutreffen. Während in Bremen der Parlamentspräsident bei weitreichender Bedeutung der Auslegung die Stellungnahme des Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschusses einholt 591 , entscheidet im Saarland das Präsidium bei der Auslegung von Fall zu Fall 5 9 2 . Ebensowenig kennt die Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtags eine derartige Unterscheidung zwischen einfacher und grundsätzlicher Auslegung 593 . 582 583 584 585 586 587 588 589
§ 128 II GOLT-RP; § 121 II GOLT-Th. § 101 Satz 1 GOLT-Bg; § 114 Satz 1 NRW; § 83 II GOLT-Sl. § 89 II GO-Be; § 151 GOLT-By; § 91 III GOBü-Ha. § 104 II GOLT-BW; § 109 II GOLT-Ss. § 114 Satz 2 GOLT-NRW. § 129 GOLT-RP; § 74 II GOLT-SH; § 61 II GOLT-MV. § 122 GOLT-Th. § 101 Satz 2 GOLT-Bg.
590 § 113 II GOLT-He; § 91 II GOLT-SA. 591 § 71 GOBü-Br. 592 § 83 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 593 Vgl. § 98 GOLT-Nds.
VII. Die Auslegungsbefugnis des Landtagspräsidenten
169
3. Die Abweichung von der Geschäftsordnung Neben der Auslegungsmöglichkeit der Geschäftsordnung haben die Länderparlamente - mit Ausnahme von Bremen - die Möglichkeit der Abweichung von der Geschäftsordnung ausdrücklich für zulässig erklärt. Diese Vorschriften tragen der Erkenntnis Rechnung, daß die starre Einhaltung festgelegter Normen zwangsläufig zu einer Einschränkung der Beweglichkeit und Elastizität der Geschäftsordnung führt und damit auch die Flexibilität parlamentarischer Arbeit gefährdet 594. Denn in der Parlamentspraxis ergeben sich häufig Situationen, in den es zweckmäßig oder gar unumgänglich ist, von den bestehenden Bestimmungen abzuweichen. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und im Saarland kann der Landtag einzelne Abweichungen von der Geschäftsordnung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschließen, mindestens jedoch ist die Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich 595. Im Landtag von Baden-Württemberg und Sachsen geht der Beschlußfassung auf Verlangen von fünf Abgeordneten bzw. von zehn vom Hundert der Mitglieder des Landtags eine Prüfung durch den für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschuß voraus 596 . In Hessen hingegen bedarf die Abweichung von der Geschäftsordnung der einfachen Mitgliedermehrheit 597 . In den anderen Landtagen kann die Abweichung durch Erhebung eines Widerspruchs verhindert werden. In Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein reicht dazu bereits der Widerspruch von mindestens fünf Abgeordneten aus 598 . Auch die Geschäftsordnungen von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sehen einen Widerspruch von mindestens fünf Abgeordneten vor 5 9 9 . In Bayern ist ein hindernder Widerspruch durch eine Fraktion oder mindestens zwanzig Abgeordnete festgeschrieben. Der Landtagspräsident hat dabei durch ausdrückliche Frage den Abgeordneten Gelegenheit zu geben, einen solchen Widerspruch zu erheben 600. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist schließlich eine durch Landtagsbeschluß gefaßte Abweichung zulässig, wenn nicht zehn bzw. acht, in Mecklenburg-Vorpommern ein Viertel der anwesenden Mitglieder des Landtags widersprechen 601. Überdies enthalten die Landtagsgeschäftsordnungen von Hessen, SchleswigHolstein sowie das Gesetz über den Landtag des Saarlandes die Bestimmung, daß die Abweichung nicht gegen eine Vorschrift der jeweiligen Landesverfassung ver594 Vgl. Versteyl in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 21; Böttcher, S. 131. 595 § 105 I GOLT-BW; § 127 GOLT-RP; § 110 I GOLT-Ss; § 120 GOLT-Th; § 83 I Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 596 § 105 II GOLT-BW; § 110 II GOLT-Ss. 597 § 115 GOLT-He. 598 § 91 GO-Be; § 911 GOBü-Ha; § 75 GOLT-SH. 599 § 100 GOLT-Bg; § 115 GOLT-NRW. 600 § 149 GOLT-By. 601 § 99 GOLT-Nds; § 92 GOLT-SA; § 62 GOLT-MV.
170
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
stoßen darf, was vor allem hinsichtlich jener Vorschriften der Geschäftsordnungen bedeutsam wird, die solche der Verfassung wiederholen. Außerdem spiegelt sich in diesen Bestimmungen der zuvor dargelegte Vorrang der Verfassung gegenüber der Geschäftsordnung wider 6 0 2 .
4. Die Änderung der Geschäftsordnung In einem engen Zusammenhang mit der Auslegung der Geschäftsordnung und der Abweichung von dieser steht schließlich die Änderung der parlamentarischen Geschäftsordnung, die daher nicht unerwähnt bleiben soll. Sie ist nicht in allen Landtagsgeschäftsordnungen verankert, sondern nur in denen von Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. In Baden-Württemberg und Sachsen kann der Landtag eine Änderung der Geschäftsordnung nur aufgrund einer von fünf bzw. zwanzig Abgeordneten eingebrachten und von dem für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschuß geprüften Vorlage mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschließen603. Eine Vorprüfung durch den für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschuß ist ebenfalls in Berlin vorgesehen 604. In Hamburg bedarf ein Parlamentsbeschluß, durch den die Geschäftsordnung geändert werden soll, grundsätzlich einer zweiten Lesung, es sei denn, daß er mit einer Zweidrittelmehrheit gefaßt ist. Zwischen den beiden Lesungen muß eine Frist von mindestens sechs Tagen liegen 605 . Die Niedersächsische Geschäftsordnung bestimmt indessen, daß für Geschäftsordnungsänderungen die Vorschriften über das Gesetzgebungsverfahren entsprechend anzuwenden sind. Jedoch kann sich hier der Geschäftsordnungsausschuß auch ohne besondere Überweisung mit Fragen der Geschäftsordnung befassen und in Beschlußempfehlungen Vorschläge zu ihrer Änderung machen, die vom Parlament sogleich in einer zweiten Beratung zu behandeln sind 606 . An Stelle des Geschäftsordnungsausschusses obliegt diese Funktion in Sachsen-Anhalt dem Ältestenrat 607 . Hinter diesen Vorschriften steht der Sinn, offensichtlich übereilte Änderungen der Geschäftsordnung zu vermeiden. Gleichwohl wird durch die Möglichkeit der Änderung der Geschäftsordnung sowie der Abweichung und mitunter auch der Auslegung, das eigentliche Erscheinungsbild der Verfahrensweise der Parlamente 602
Im Gesetz über den Landtag des Saarlandes ist im übrigen niedergelegt, daß Abweichungen von der Geschäftsordnung nicht gegen dieses Gesetz verstoßen dürfen, was hinsichtlich der parlamentarischen Geschäftsordnungsautonomie auf Bedenken stößt, vgl. Achterberg, S. 331. 603 § 107 GOLT-BW; § 111 GOLT-Ss. «m 605 606 607
§90 GO-Be. §92 GOBü-Ha. § 100 GOLT-Nds. § 93 GOLT-SA.
Vili. Die Tätigkeit nach dem Schluß der Sitzung
171
nicht wirklich getroffen. Vielmehr kommt in der parlamentarischen Praxis den interfraktionellen Absprachen zwischen den Fraktionsgeschäftsführern und den Vereinbarungen im Ältestenrat die entscheidende Bedeutung zu, die in weiten Teilen die kodifizierte Geschäftsordnung überlagern 608.
V I I I . Die Tätigkeit nach dem Schluß der Sitzung Im Rahmen seiner Leitungsgewalt erklärt der Landtagspräsident den Schluß der Plenarsitzung. Soweit dies nicht ausdrücklich mit den Worten „Ich schließe die Sitzung" oder „Die Sitzung ist geschlossen" erfolgt, endet die Sitzung, wenn er den Präsidentenstuhl endgültig verläßt. Der Landtagspräsident darf die Sitzung der Vollversammlung im allgemeinen nur dann schließen, wenn die Tagesordnung erledigt ist oder wenn es das Parlament auf Vorschlag des Präsidenten sowie auf Antrag einer Fraktion oder einer bestimmten Abgeordnetengruppe, die in BadenWürttemberg und im Saarland aus mindestens fünf, in Sachsen und Thüringen aus mindestens zehn und in Bayern aus mindestens zwanzig Abgeordneten bestehen muß, beschließt 609 . Darüber hinaus kann der Parlamentspräsident die Sitzung schließen, wenn störende Unruhe im Sitzungssaal entsteht 610 oder wenn ein Abgeordneter nach einem Sitzungsausschluß der Aufforderung des Präsidenten, den Saal zu verlassen, nicht nachkommt 611 . Die Schließungserklärung des Präsidenten ist von konstitutiver Wirkung, so daß die Sitzung des Parlaments auch dann beendet ist, wenn die erwähnten Voraussetzungen für eine Schließung nicht vorliegen 6 1 2 . Da der Landtagspräsident auch in diesem Fall kraft der ihm verfassungsrechtlich eingeräumten Befugnis als Organ des Parlaments mit Wirkung für dieses tätig wird, wird dessen Stellung als Herr des Verfahrens insoweit nicht tangiert 613 . Über jede Sitzung des Landtags wird ein wortgetreuer Bericht angefertigt 614. Nach dem Schluß der Sitzung hat der Landtagspräsident aufgrund seiner Leitungs608 pietzcker in: Schneider/Zeh, § 10, Rn. 37; Arndt, S. 107f.; Loewenberg, S. 255ff.; Roll in: Festgabe für Blischke, S. 102. 609 § 79 GOLT-BW; § 27 III GOLT-Sl; § 82 GOLT-Ss; § 22 I Nr. 5 GOLT-Th; § 100 IV GOLT-By; § 59 VIII GO-Be; § 23 II GOLT-Bg. In Bremen bestimmt der Präsident den Schluß der Sitzung im Einvernehmen mit der Bürgerschaft, § 26 Satz 2 GOBü-Br. 610 § 82 Satz 1 GO-Be; § 94 Satz 1 GOLT-BW; § 69 I 1 GOLT-NRW; § 96 Satz 1 GOLTSs; § 81 IV 1 GOLT-SA; § 75 I 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 39 Satz 1 GOLT-RP; § 69 GOLT-SH; § 56 GOLT-MV; § 89IV 1 GOLT-Nds. 611 § 37 III 1 GOLT-Th. 612 Maunz/Klein, MD, Art. 39, Rn. 26; v. Mangoldt/Klein, Art. 39, Anm. V 2b, S. 904; Sperling, S. 23. 613 Vgl. Achterberg, S. 614. 614 § 104 Satz 1 GOLT-NRW; § 85 GO-Be; § 101 GOLT-BW; !09 I 1 GOLT-He; § 142 I GOLT-By; § 105 I 1 GOLT-Ss; § 82 I 1 GOLT-SA; § 54 Satz 1 GOLT-Sl; § 113 I GOLT-RP; § 60 I GOBü-Ha; § 71 I GOLT-SH; § 58 I GOLT-MV; § 90 I 1 GOLT-Nds; § 94 Satz 1
172
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
gewalt dafür Sorge zu tragen, daß dieser stenographische Bericht gedruckt und an die Mitglieder des Landtags, die Fraktionen, die Mitglieder der Landesregierung und den Präsidenten des Landesrechnungshofs verteilt wird 6 1 5 . Für den stenographischen Bericht gilt das Prinzip der Vollständigkeit, d. h. es müssen alle in der Vollversammlung gefallenen Äußerungen in die Niederschrift aufgenommen werden, der Ausschluß von Wortbeiträgen ist unzulässig616. Die Erstellung des Berichts erfolgt nach Anweisung und unter der Verantwortung des Präsidenten durch den der Parlamentsverwaltung angehörenden Stenographischen Dienst. Bei Unregelmäßigkeiten und Unrichtigkeiten ist die Klärung durch den Parlamentspräsidenten als Behördenleiter der Parlamentsverwaltung erforderlich, der dabei gegebenenfalls auch disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen kann 617 . Die Landtagsgeschäftsordnungen enthalten zum Teil ausdrückliche Angaben über den Mindestinhalt der stenographischen Berichte 618 . Grundsätzlich werden sowohl die mündlichen amtlichen Mitteilungen und geschäftsleitenden Erklärungen und sonstige Ausführungen des Präsidenten dem Hause gegenüber aufgenommen als auch alle Äußerungen der Abgeordneten und anderen Sitzungsteilnehmer, sei es in Form von Reden, Bemerkungen, Erklärungen, Anträgen, Fragen, Zwischenfragen oder Zwischenrufen 619. Letztere dürfen nur mit Zustimmung des Landtagspräsidenten und der Beteiligten wieder aus dem Bericht gestrichen werden 6 2 0 . Ausführungen eines Abgeordneten, dem das Wort nicht erteilt wurde, werden indessen in den Sitzungsbericht nicht aufgenommen. Ein Abgeordneter kann allerdings eine Rede, für welche ihm das Wort hätte erteilt werden können, mit Zustimmung des Landtagspräsidenten zur Aufnahme in den Sitzungsbericht übergeben, wenn der Verzicht auf Worterteilung der sachgemäßen Erledigung der Tagesordnung dient. Die Erklärung muß dem Präsidenten vor Schluß der Sitzung schriftlich übergeben werden. Sie wird im Sitzungsbericht am Ende der Niederschrift über den Tagesordnungspunkt abgedruckt und als Erklärung zum Protokoll kenntlich gemacht 621 . Nach der Anfertigung des stenographischen Berichts, jedoch bevor dieser in den Druck gegeben wird, erhält jeder Redner die Niederschrift seiner Rede zur DurchGOLT-Bg; § 107 I GOLT-Th; § 611 GOBü-Br. In den Geschäftsordnungen wird die wörtliche Niederschrift neben „Stenographischer Bericht" auch häufig „Plenarprotokoll" oder „Sitzungsbericht" genannt. 615 Vgl. § 104 Satz 2 GOLT-NRW; § 85 GO-Be; § 10211 GOLT-BW; § 109 III GOLT-He; § 82 I 1 GOLT-SA; § 113 II GOLT-RP; § 71 III GOLT-SH; § 58 III GOLT-MV; § 90 I 1 GOLT-Nds; § 94 Satz 2 GOLT-Bg; § 107 II GOLT-Th. 616 Vgl. Achterberg, S. 664. 617 Troßmann, § 117,Rn.3. 618 Vgl. § 94 Satz 3 GOLT-Bg; § 58 II GOLT-MV; § 71 II GOLT-SH; § 54 Satz 2 GOLTSl; § 1091, II GOLT-He; § 104 Satz 3 GOLT-NRW. 619 Troßmann, § 117, Rn. 1. 620 § 115 GOLT-RP; § 109 GOLT-Th. 621 § 102 III GOLT-BW; § 106 III GOLT-Ss.
Vili. Die Tätigkeit nach dem Schluß der Sitzung
173
sieht und zu einer etwa erforderlichen Berichtigung 622 . Die Berichtigung muß sich auf sprachliche Fehler und Unebenheiten beschränken und darf den Sinn der Ausführungen nicht verändern 623. Berichtigungen dürfen ferner nicht vorgenommen werden, wenn dadurch Zurufe oder Ausführungen anderer Redner unverständlich werden, es sei denn, daß der Zurufer oder der andere Redner mit der Berichtigung einverstanden ist 6 2 4 . Verändern die vom Redner vorgenommenen Korrekturen dennoch den Sinn der Rede, so wird der Parlamentspräsident von der Landtagsverwaltung unterrichtet. Er bespricht sich daraufhin mit dem Redner und entscheidet, wenn die Besprechung zu keiner Verständigung führt, darüber, in welcher Fassung die Niederschrift in den Sitzungsbericht aufzunehmen ist 6 2 5 . Sofern eine Berichtigung nicht erforderlich erscheint, ist die geprüfte Niederschrift im allgemeinen von dem Redner zu unterzeichnen und unverzüglich an den Stenographischen Dienst zurückzugeben. Geschieht dies nicht innerhalb einer bestimmten Frist, so wird die Niederschrift mit dem Vermerk „vom Redner nicht autorisiert" gekennzeichnet und anschließend in Druck gegeben und veröffentlicht 626 . In einer Reihe von Landtagen gilt dagegen die verspätete Rückgabe der Niederschrift als Genehmigung des Berichts in der vorliegenden Form 6 2 7 . Vor Berichtigung der Niederschrift einer Rede darf diese einem anderem als dem Landtagspräsidenten nur mit Zustimmung des Redners zur Einsicht überlassen werden 628 . Die Zustimmung des Redners kann mitunter durch die des Landtagspräsidenten ersetzt werden, wenn ein Minister oder ein Abgeordneter aus berechtigtem Interesse die alsbaldige Einsicht verlangt 629 . Die Aufgabe, die vom Landtag gefaßten Beschlüsse aufzuzeichnen, überträgt der Parlamentspräsident laut Geschäftsordnungen jeweils einem der amtierenden Schriftführer 630. In der tatsächlichen Parlamentspraxis hingegen übernimmt diese 622 § 143 I 1 GOLT-By; § 105 I 1 GOLT-NRW; § 86 I 1 GO-Be; § 102 I 1 GOLT-BW; § 110 I 1 GOLT-He; § 106 I 1 GOLT-Ss; § 83 I 1 GOLT-SA; § 55 I GOLT-Sl; § 114 I 1 GOLT-RP; § 72 I 1 GOLT-SH; § 59 II 1 GOLT-MV; § 91 I 1 GOLT-Nds; § 95 I GOLT-Bg; § 108 I 1 GOLT-Th; § 62 I GOBü-Br. 623 § 86 I 3 GO-Be; § 102 II 1 GOLT-BW; § 110 II 2 GOLT-He; § 106 II 1 GOLT-Ss; § 83 II 1 GOLT-SA; § 55 II 1 GOLT-Sl; § 114 II 1 GOLT-RP; § 72 II 1 GOLT-SH; § 91 II 1 GOLT-Nds; § 95 II 2 GOLT-Bg; § 108 I 1 GOLT-Th; § 62 II 4 GOBü-Br. Soweit allerdings Hörfehler oder Übertragungsfehler vorgekommen sind, dürfen diese mitunter berichtigt werden, auch wenn dadurch der Sinn der Niederschrift geändert wird, § 143 II 2 GOLT-By. 624 § 55 III GOLT-Sl. 625 § 106 II GOLT-Ss; § 80 I 4 GO-Be; § 102 II GOLT-BW; § 110 II GOLT-He; § 83 II 2 GOLT-SA; § 55 II 2 GOLT-Sl; § 114 II 2 GOLT-RP; § 72 II 2 GOLT-SH; § 59 II 2 GOLTMV; § 91 II 2 GOLT-Nds; § 95 IV GOLT-Bg; § 62 V GOBü-Br. 626 § 105 I GOLT-NRW; § 86 I 2 GO-Be; § 110 I 2, III GOLT-He; § 55 IV GOLT-Sl; § 95 III GOLT-Bg; § 62 IV GOBü-Br. 627 § 1021 2 GOLT-BW; § 1061 2 GOLT-Ss; § 83 I 3 GOLT-SA; § 1141 3 GOLT-RP; § 721 2 GOLT-SH; § 59 I 2 GOLT-MV; § 91 I 3 GOLT-Nds; § 108 I 3 GOLT-Th. 62« § 105 II GOLT-NRW; § 143 V GOLT-By; § 106 V GOLT-Ss; § 102IV GOLT-BW; § 55 V GOLT-Sl; § 59 III GOLT-MV; § 108 II 1 GOLT-Th; § 62 III GOBü-Br. 629 § 108 II 2 GOLT-Th. 630 § 111 I GOLT-He; § 96 I GOLT-Bg.
174
4. Abschnitt: Die Leitungsgewalt des Landtagspräsidenten
Tätigkeit im allgemeinen die Landtagsverwaltung. Im Gegensatz zu dem stenographischen Bericht handelt es sich bei dem amtlichen Beschlußprotokoll um eine Beurkundung 631 . Außer den Beschlüssen sind in dem Protokoll aber auch beispielsweise die Arbeitsübernahme durch den Landtagspräsidenten, die Vereidigung der Regierungsmitglieder sowie Regierungserklärungen enthalten632. Dem Protokoll werden in der Regel die entsprechenden Drucksachen mit den von den Schriftführern darauf vermerkten Beschlüssen als Bestandteil angeheftet. Am Schluß der Sitzung ist das Beschlußprotokoll von dem sitzungsleitenden Präsidenten und einem amtierenden Schriftführer zu unterzeichnen 633. Mitunter ist vorgeschrieben, daß der Direktor beim Landtag gegenzuzeichnen hat 6 3 4 . Daran anschließend wird das Beschlußprotokoll unverzüglich an alle Abgeordneten und Mitglieder der Landesregierung verteilt 635 . Dies geschieht gewöhnlich dadurch, daß diesem Personenkreis Kopien der Urkunde zugeleitet werden. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Verteilung kein Einspruch von einem Mitglied des Landtags oder einem Mitglied der Landesregierung erhoben wird 6 3 6 . Wird jedoch das Protokoll durch Einspruch beanstandet und dieser nicht durch die Erklärung des Präsidiums bzw. eines Schriftführers behoben, so hat der Landtagspräsident die Vollversammlung darüber entscheiden zu lassen, ob ihm stattgegeben werden soll 6 3 7 . Wird der Einspruch für begründet erachtet, ist die neue Fassung der beanstandeten Stelle noch während der Sitzung vorzulegen 638 . In Hessen trifft der Präsident die Entscheidung über den Einspruch auch selbst. Er kann dazu alle erforderlichen Beweismittel heranziehen. Insbesondere kann er den zur Zeit des fraglichen Beschlusses sitzungsleitenden Präsidenten befragen, sofern er die Sitzung nicht selbst geleitet hat. Gegen die Entscheidung des Präsidenten kann der Ältestenrat angerufen werden 639 .
« ι Kleinschnittger, S. 76; Mühlbauer, S. 36; Perels, S. 104; Spengler, S. 33; Achterberg, S. 667. Das genehmigte Protokoll ist beweiskräftige Urkunde über die Beschlüsse des Parlaments, während der stenographische Bericht lediglich informatorischen Charakter hat. Weichen Protokoll und stenographischer Bericht voneinander ab, so bleibt bis zum Beweis des Gegenteils das Protokoll, nicht aber der stenographische Bericht maßgebend, Troßmann, § 121, Rn. 2. 632 Achterberg, S. 667. «3 § 111 I 2 GOLT-He; § 87 Satz 1 GO-Be; § 145 I 1 GOLT-By; § 107 I GOLT-NRW; § 96 II 1 GOLT-Bg. 634 So beispielsweise in Hessen, § 11112 GOLT-He. 635 § 107 IV GOLT-Th; § 71 III GOLT-SH; § 113 V GOLT-RP; § 871 3 GOLT-SA; § 107 II 1 GOLT-NRW; § 145 I 2 GOLT-By; § 87 Satz 2 GO-Be; § 111 II GOLT-He. 636 § 96 II 2 GOLT-Bg; § 107 II 1 GOLT-NRW; § 87 Satz 2 GO-Be; § 111 III GOLT-He. 637 § 108 Satz 1 GOLT-NRW; § 96 III 1 GOLT-Bg. 638 § 96 III 2 GOLT-Bg. 639 § 111 IV GOLT-He.
Fünfter Abschnitt
Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten Dem in den Verfassungen und parlamentarischen Geschäftsordnungen der Länder niedergelegten Postulat einer gerechten und unparteiischen Leitung der parlamentarischen Vollversammlung zu entsprechen, wäre dem Landtagspräsidenten kraft der ihm übertragenen Leitungsgewalt allein nur schwer möglich. Die Leitungsgewalt findet demzufolge ihre logische Ergänzung in der Ordnungsgewalt. Worum es sich hierbei handelt und welchen Inhalt sie hat, soll im folgenden behandelt werden.
I. Der Begriff der Ordnungsgewalt Weder die Länderverfassungen noch die Geschäftsordnungen der Länderparlamente enthalten eine nähere Umschreibung oder Legaldefinition der parlamentarischen Ordnungsgewalt. Ausgangspunkt einer Definition muß daher der unbestimmte Rechtsbegriff 1 der parlamentarischen Ordnung sein, zu deren Schutz und Wahrung die Ordnungsgewalt bestimmt ist. Der Begriff der parlamentarischen Ordnung wird verstanden als „die Gesamtheit der Normen, deren Befolgung nach den im Parlament herrschenden - nur selten und ungern wechselnden - Anschauungen als Vorbedingung einer gedeihlichen, das Staatsleben fördernden Beratung der Abgeordneten und als Grundlage des innerparlamentarischen Lebens gilt" 2 . Dem Begriff unterfallen mithin nicht nur geschriebene und ungeschriebene Regeln des Parlamentsrechts, sondern auch außerrechtliche Normierungen wie etwa der Parlamentsbrauch, so daß er damit praktisch sämtliche Bereiche des innerparlamentarischen Geschäftsgangs erfaßt. In der Literatur wird dabei vielfach zwischen parlamentarischer Redeordnung und parlamentarischer Ordnung im engeren Sinne, auch als Sitzungsordnung bezeichnet, unterschieden3. Die Redeordnung umfaßt den ordnungsgemäßen Verhandlungsablauf in verfahrenstechnischer Hinsicht, vor allem die sachgemäße Behandlung des Verfahrensgegenstands 4. Hingegen bedeutet die parlamentarische ι Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2b, S. 3. 2 Schmid, in: AöR 32 (1914), S. 439 (498). 3 Böttcher, S. 76; Klinke, S. 123; Kleinschnittger, S. 80; Vogler, S. 7; Sperling, S. 42; Schmid, in: AöR 32, S. 439 (544); Bücker, in: Schneider/Zeh, Rn. 13. * von Pechmann, S. 100; Kleinschnittger, S. 80; Klinke, S. 123 f.; Vogler, S. 7; Sperling, S. 42.
176
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
Ordnung im engeren Sinne die Freiheit von Störungen im Interesse der parlamentarischen Würde und Ethik und ist damit auf eine ruhige Abwicklung der Plenarsitzung gerichtet 5. Sobald also der weitere Verhandlungsgang unsachlich oder persönlich wird oder die reibungslose Durchführung der Vollversammlung durch störende Einwirkungen gefährdet ist, hat der Landtagspräsident einzugreifen. Das parlamentarische Ordnungsrecht ist demzufolge das rechtliche Instrumentarium zur Wahrung der parlamentarischen Ordnung in den Sitzungen des Parlaments. Vor diesem Hintergrund kann schließlich auch der Begriff der Ordnungsgewalt als die Befugnis des Präsidenten verstanden werden, mittels der in der jeweiligen Geschäftsordnung vorgesehenen Maßnahmen den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzungen sicherzustellen6. Originärer Träger bzw. Inhaber der parlamentarischen Ordnungsgewalt sind die Parlamente, also jeweils die Abgeordneten in ihrer Gesamtheit7. Dies ergibt sich aus der Parlamentsautonomie8. Da das Parlament indessen zur Ausübung der Ordnungsgewalt den jeweils amtierenden Präsidenten berufen hat, fallen tatsächliche Anwendung und originäre Inhaberschaft der parlamentarischen Ordnungsgewalt auseinander. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig nur bemerkt, daß das Parlament „aus Zweckmäßigkeitsgründen die Ausübung der Gewalt dem Parlamentspräsidenten übertragen" habe9. Eine entsprechende Umschreibung benutzte das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluß vom 8. 6. 198210. Auf die dogmatische Einordnung der dargelegten Kompetenzverlagerung wurde dagegen nur vereinzelt eingegangen. Dabei wurde die Rechtsnatur dieses Vorgangs insbesondere von Achterberg als Delegation qualifiziert 11. Unter Delegation wird die Übertragung von Kompetenzen eines Hoheitsträgers auf einen anderen verstanden 12 . Wesentliches Kennzeichen einer Delegation ist die Begründung einer neuen, eigenständigen Zuständigkeit für den Delegatar 13. Für eine eigenständige Zustän5 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 200; Engels, S. 51 f.; von Pechmann, S. 46; Klinke, S. 124; Mühlbauer, S. 39. 6 Vgl. Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1578); Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 1; Gundelach, S. 334; Kleinschnittger, S. 79; Vogler, S. 1; Böttcher, S. 74f.; Leinius, in: NJW 1973; 448 (449). 7 Ritzel/Bücker, Vorbem. zu §§ 36-41, Anm. lb, S. 1; Arndt, S. 68; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 17; Böttcher, S. 75; Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 15; Kleinschnittger, S. 83.
β Vgl. Leinius, in: NJW 1973, 448 (449); Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 3; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 6. Siehe auch BVerfGE 60, 374 (379) und Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840. 9 Böttcher, S. 75. Vgl. auch Klinke, S. 127; Nelamischkies, S. 33; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 15. 10 BVerfGE 60, 374 (379). h Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841). Vgl. dazu auch die Abgrenzung von Delegation und Mandat bei Franke, S. 19 f. 12 Triepel, S. 23. Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 20.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
177
digkeit des Parlamentspräsidenten kraft Delegation spricht zum einen der weitreichende Umfang der präsidialen Befugnisse 14, zum anderen aber vor allem die Möglichkeit jedes einzelnen Abgeordneten, gegen eine gegen ihn verhängte Ordnungsmaßnahme das Plenum anzurufen; die Überprüfung der Ausübung einer übertragenen Zuständigkeit durch den Zuständigkeitsgeber ist wesentliches Merkmal einer Delegation und setzt zudem eine eigenständige Kompetenz des Präsidenten voraus 15. Rechtsgrundlage für die wirksame Begründung dieser Kompetenz ist die parlamentarische Geschäftsordnung, die ausschließlich für den innerparlamentarischen Bereich gilt und keine unmittelbaren Rechtswirkungen für den Bürger entfaltet. Infolge der Delegation der Ordnungsgewalt auf den Landtagspräsidenten wird diese Bestandteil der präsidialen Rechte und Pflichten, deren Umfang Gegenstand eines Organstreitverfahrens vor einem Landesverfassungsgericht sein kann. In dem Streitverfahren ist der Parlamentspräsident dann selbst partei- und prozeßfähig 16. Der Adressatenkreis der präsidialen Ordnungsgewalt läßt sich untergliedern in Mitglieder des Parlaments, sonstige Sitzungsteilnehmer, die nicht Mitglieder des Parlaments sind, und Zuhörer. Zumindest die Gruppe der Abgeordneten unterfällt unstreitig der uneingeschränkten Ordnungsgewalt des Präsidenten17. Da jedoch sowohl die Vertreter der Landesregierung als auch die Zuhörer in einem anderen rechtlichen Verhältnis zum Parlament stehen, wird auch die rechtliche Grundlage der gegen sie ergehenden Maßnahmen in der Literatur sehr unterschiedlich beurteilt. Auf diesen Umstand wird daher später noch gesondert einzugehen sein.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt gegenüber den Abgeordneten Die dem Landtagspräsidenten zur Ausübung übertragenen Ordnungsmaßnahmen verfolgen den Zweck, die Mitglieder des Parlaments zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch ihrer Statusrechte, d. h. des Rederechts und sonstiger Mitwirkungsrechte anzuhalten. Die Ordnungsgewalt hat damit den Abgeordneten gegenüber den Charakter einer Disziplinargewalt 18. 14
Ebenda. 15 Vgl. dazu Troßmann, § 7, Rn. 34; Triepel, S. 14. Siehe auch BVerfGE 60,374 (379). 16
Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841); ders., Das rahmengebundene Mandat, S. 20ff.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 21. 17 Vgl. Gundelach, S. 334; Rothaug, S. 63; Böttcher, S. 19 f.; Achterberg, S. 651; ders., Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841). is Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 3; Gundelach, S. 334; Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. la, S. 1; Versteyl, Parlamentarische Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379; Kleinschnittger, S. 81 ; Gentemann, S. 16; Hatschek, S. 210,603; Mühlbauer, S. 41; Sperling, S. 42; Vogler, S. 11; Woldt, S. 10f.; Rode, S. 12ff; Reinicke, S. 6ff.; Böttcher, S. 91; Nelamischkies, S. 14; Klinke, S. 125. Ebenso Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 15 sowie Stern II, § 24 II 2 a, S. 1061. Andere Autoren sprechen indessen in Anlehnung an §§ 176 ff. GVG von „Sitzungspolizei", so Knemeyer, Hausrecht und Ordnungsgewalt, in: 12 Köhler
178
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
Wahrend die Bismarcksche Reichsverfassung von 1871 in Art. 27 den Reichstag noch ausdrücklich ermächtigte, „seinen Geschäftsgang und seine Disziplin" durch eine Geschäftsordnung zu regeln, wurde in allen späteren Verfassungen die ausdrückliche Erwähnung der parlamentarischen Disziplinargewalt fallengelassen, weil sie fortan als ein notwendiger und selbstverständlicher Bestandteil der Geschäftsordnungsautonomie angesehen wurde 19 . Nach einer überwiegenden Ansicht in der Literatur beruht die Disziplinargewalt auf einer besonderen Beziehung des einzelnen Abgeordneten zum Parlament, in die jeder mit der Annahme der Wahl eintritt 20 . Diese Beziehung ist - im Gegensatz zu dem allgemeinen Staat-UntertanVerhältnis - als Sonderstatusverhältnis ausgestaltet, mit der Konsequenz, daß jedes Mitglied dem Parlament als der Gesamtheit der Mitglieder untergeordnet ist 2 1 . Die Abgeordneten bilden somit einen Sonderkreis, dessen Mitglieder dem Staat gegenüber in spezifischer Weise verantwortlich sind und amtsbedingte ethische Pflichten haben, zu denen insbesondere die Unterordnung unter die parlamentarische Disziplinargewalt gehört 22 . Die Maßnahmen der parlamentarischen Disziplinargewalt berühren regelmäßig den verfassungsrechtlichen Status des Abgeordneten, wobei die verfassungsrechtlich gewährleistete und geschützte Redefreiheit der Abgeordneten in der Vollversammlung des Parlaments besonders betroffen ist. Die Ausübung des Rederechts und der anderen Statusrechte unterliegt jedoch den vom Parlament kraft seiner Geschäftsordnungsautonomie gesetzten Schranken. Sofern also die Voraussetzungen der in den parlamentarischen Geschäftsordnungen vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen erfüllt sind und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinreichend Rechnung getragen wurde, stoßen diese Maßnahmen in verfassungsrechtlicher Hinsicht auf keine Bedenken23. Auf den besonderen Fall des zeitweisen Ausschlusses eines Abgeordneten von der Teilnahme an Sitzungen des Parlaments wird später noch gesondert einzugehen sein. Die parlamentarische Disziplinargewalt stellt im übrigen ein notwendiges innerparlamentarisches Korrektiv zu dem besonderen Schutz der parlamentarischen DÖV 1970, 596 (601); Leinius, in: NJW 1973, 448 (449); vgl. auch § 55 GOLT-Sl. Franke dagegen verneint den Charakter der Ordnungsbefugnis als Disziplinargewalt, Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 52; ebenso Rothaug, S. 66. 19 Vgl. Nelamischkies, S. 82f. 20 Jellinek, S. 214; Böttcher, S. 91; Klinke, S. 125; Nelamischkies, S. 159; Kleinschnittger, S. 81 f.; Gerlach, S. 90; Sperling, S. 42; von Brentano, S. 41; Gentemann, S. 16; Mühlbauer, S. 41; Roßmann S. 48; Vogler, S. 11; von Pechmann, S. 58 f. Auch die Rechtsprechung der Verfassungsgerichte ist von der Theorie eines Sonderrechtsverhältnisses des Abgeordneten im Verhältnis zum Parlament nicht unbeeinflußt geblieben, vgl. nur BVerfGE 1, 144 (148); 10, 4 (13); StGH Bremen, in: DÖV 1971, 164; BayVGHE N.F. 8 II, 91, 102; 29 II, 62, 86. Andere Ansicht offenbar Rothaug, S. 66 und Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 47. 21 Kleinschnittger, S. 82. 22 Nelamischkies, S. 27. 23 BVerfGE 10,4 (13); Schneider, in AK-GG, Art. 38, Rn. 23; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 10.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
179
Redefreiheit durch die verfassungsrechtliche Gewährleistung der Indemnität dar 24 . Erst die parlamentarische Disziplinargewalt läßt das im Interesse der Arbeitsfähigkeit des Parlaments ausgesprochene Verbot gerechtfertigt erscheinen, einen Abgeordneten wegen einer Äußerung im Plenum außerhalb dessen zur Verantwortung zu ziehen25. Die dem Landtagspräsidenten zur Verfügung stehenden Disziplinarmaßnahmen lassen sich grundsätzlich nach Art und Charakter unterscheiden. So setzen etwa Maßnahmen wie der Ordnungsruf, Wortentzug und Sitzungsausschluß ein Verschulden, also mindestens Fahrlässigkeit voraus und besitzen damit pönalen Charakter 26. Andere Maßnahmen wiederum, wie beispielsweise der Sachruf, sind als präventive Disziplinarmaßnahmen einzuordnen 27. Diesen Maßnahmen „vorgeschaltet" sind Ordnungsmittel, die in den parlamentarischen Geschäftsordnungen nicht fixiert sind und keine beeinträchtigenden Rechtsfolgen nach sich ziehen, wie Beanstandungen, Ermahnungen, aber auch Rügen im engeren Sinne 28 . Die Maßnahmen der Disziplinargewalt können zudem nach dem Schutzobjekt unterschieden werden in Maßnahmen bei Verstößen gegen die Redeordnung, vor allem Sachruf und Wortentziehung, und Maßnahmen bei Verstößen gegen die Sitzungsordnung, die den Ordnungsruf, die Rüge, die Wortentziehung und den Sitzungsausschluß umfassen 29. Das Ordnungsmittel der Wortentziehung findet also in beiden Bereichen Anwendung. Schließlich gibt es Maßnahmen, die nicht als eigentliche Disziplinarmittel charakterisiert werden können, wie ζ. B. die Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung. Bei ihnen handelt es sich um präventive Maßnahmen eigener Art 3 0 , die sowohl Störer als auch Nichtstörer erfassen und dann in Betracht kommen, wenn der einzelne Störer nicht festgestellt werden kann. Trotz ihres teilweise pönalen Charakters handelt es sich bei der Disziplinargewalt nicht um eine Abart der staatlichen Strafgewalt. Da sie nicht auf dem allgemeinen Staat-Untertan-Verhältnis fußt, sondern dem Sonderstatus der Abgeordneten entspringt, verfolgt sie einen völlig anderen Zweck. Während das allgemeine Strafrecht u. a. auch auf den Sühnegedanken abstellt, soll mittels der Disziplinarmaßnahmen allein der Zweck verwirklicht werden, der dem besonderen Gewaltverhältnis innewohnt 31 . Ebensowenig gibt es bei der Disziplinargewalt ein System der besonderen Tatbestände, besondere Strafarten oder das Legalitätsprinzip 32.
24 Bücker, in: Schneider /Zeh, § 34, Rn. 11. 25 Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. la, S. 1. 26 Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§36-41, Anm. le, S. 2. 27 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 12; Kleinschnittger, S. 86; Mühlbauer, S. 43. 28 Vgl. BVerfGE 60, 374 (382); Vogler, S. 13 f. 29 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 13. 30 Vogler, S. 42; Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 3. 31 Thieme, in: DVB1. 1957, 769 (772); Kleinschnittger, S. 84. 32 Schmid, in: AöR 32, 476; Sperling, S. 42.
12*
180
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
1· Die rechtlichen Grundlagen der Disziplinargewalt Die rechtlichen Grundlagen der parlamentarischen Ordnungsgewalt sind in den Bestimmungen der Landesverfassungen und der parlamentarischen Geschäftsordnungen angesiedelt, wobei der Begriff der Ordnungsgewalt auf Verfassungsebene nicht immer explizit erwähnt wird 3 3 . Diese Regelungen werden im allgemeinen ergänzt durch Sätze des parlamentarischen Gewohnheitsrechts und Parlamentsbräuche, die sich noch nicht zu Gewohnheitsrecht verdichtet haben34. Gegenüber den Mitgliedern des Parlaments hat die Ordnungsgewalt in der Form der „Disziplinargewalt" ihre Rechtsgrundlage in der Geschäftsordnungsautonomie 35 . Die Geschäftsordnungsautonomie berechtigt das Parlament zur Aufstellung von Regeln, die ein ordnungsgemäßes und der Würde des Hauses entsprechendes Arbeiten gewährleisten. Die Kompetenz zum Erlaß einer solchen Geschäftsordnung schließt damit notwendig die Befugnis ein, auch die zur Beseitigung von Störungen im Plenarsaal erforderlichen Normen aufzustellen 36. Mit Ausnahme des Saarlands findet sich also die unmittelbare Rechtsgrundlage der einzelnen Ordnungsmaßnahmen im parlamentarischen Geschäftsordnungsrecht. Im Saarland dagegen beruht sie auf formellem Gesetz37. Dies ist vor dem Hintergrund, daß die Gesetzgebung grundsätzlich das Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer, gleichrangiger und voneinander unabhängiger Verfassungsorgane ist, nicht unproblematisch. Nach Art. 102 Satz 1 der Saarländischen Landesverfassung hat der Ministerpräsident die im verfassungsmäßigen Verfahren beschlossenen Gesetze mit den zuständigen Ministern auszufertigen und zu verkünden. Die Literatur entnimmt dem Wortlaut dieser Bestimmung ein formelles und materielles Prüfungsrecht des Ministerpräsidenten im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Gesetzes mit formellen Verfassungsrecht 38. Gelangt er dabei zu der Überzeugung, daß das Landtagsgesetz 33 § 441 2 GOLT-He; § 10 I 2 GOLT-NRW; § 4 II 2 GOLT-Ss; § 9 II 2 GOLT-BW; § 5 I 2 GOLT-SA; § 14 II 2 GO-Be; § 34 I 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 4 Satz 2 GOLT-RP; § 5 I 1 GOLT-SH; § 5 V 2 GOBü-Ha; § 4 II 1 GOLT-MV; § 12 II 1 GOLT-Bg; § 41 2 GOLT-Th. Im Bereich des Landesverfassungsrechts wird die Ordnungsgewalt nur in Art. 49 II 2 LV-SA, Art. 18 II 1 LV-Nds, Art. 29 III 2 LV-MV, Art. 57 III 2 LV-Th sowie in Art. 14 III 2 LV-SH erwähnt. In der Bremischen Landesverfassung heißt es in Art. 92 II, daß dem Präsidenten " die Aufrechterhaltung der ( . . . ) Ordnung" obliege. 34 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 2. 35 Art. 99 LV-He; Art. 38 I 2 LV-NRW; Art. 20 III LV-By; Art. 46 I LV-Ss; Art. 32 I 2 LVBW; Art. 46 I LV-SA; Art. 41 I LV-Be; Art. 70 I LV-Sl; Art. 106 LV-Br; Art. 85 I LV-RP; Art. 14 I 2 LV-SH; Art. 18 I 2 LV-Ha; Art. 21 I LV-Nds; Art. 29 I 2 LV-MV; Art. 68 LV-Bg; Art. 57 V LV-Th. 36 BayVerfGH DÖV 1956,533 (535); Richter, S. 88; Reinecke, S. 7; Nelamischkies, S. 30; von Brentano, S. 41; Rothaug, S. 61. 37 Gesetz über den Landtag des Saarlandes, das seine Grundlage in Art. 701 LV-Sl findet. 38 Aufgrund fehlender Kommentierungen zur Saarländischen Landesverfassung wird auf die Erläuterung gleichlautender Verfassungsbestimmungen anderer Länder zurückgegriffen. Vgl. insoweit insbesondere Meder, Art. 76 LV-By, Rn. 1 sowie Spreng /Birn/Feuchte, Art. 63 LV-BW, Anm. 1.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
181
verfassungswidrig ist, kann er im äußersten Fall sogar eine Überprüfung des Gesetzes durch den Saarländischen Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle herbeiführen 39. Allein dieser Umstand unterstreicht, daß die erforderliche Unabhängigkeit der Regelung innerparlamentarischer Angelegenheiten nicht gewährleistet ist, soweit diese im Wege der Gesetzgebung erfolgt. Gleichermaßen stellte das Bundesverfassungsgericht fest, daß die Regelung der Angelegenheiten des Parlaments durch Gesetz zahlreiche Einwirkungsmöglichkeiten anderer Verfassungsorgane eröffne und aus diesem Grunde unzulässig sei. Dem Sinn und Zweck der Parlamentsautonomie könne nur in der Form Rechnung getragen werden, daß die einschlägigen Bestimmungen in Gestalt einer Geschäftsordnung erlassen werden. Dies sei auch deshalb erforderlich, damit das Parlament „Herr im Hause seiner Angelegenheiten" bleibe 40 . Die Entscheidung des Saarlands, die dem Präsidenten gegenüber den Abgeordneten zustehenden Disziplinarmaßnahmen nicht in einer Geschäftsordnung, sondern in einem Gesetz über den Landtag zu verankern, stößt demzufolge auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken41. Greift der Landtagspräsident zu Ordnungsmitteln, so gelten die konkreten Bestimmungen der Geschäftsordnungen als Ermächtigungsvorschriften. Soweit jedoch keine geschäftsordnungsmäßige Regelung einzelner Ordnungsmaßnahmen erfolgt ist, läßt sich ihre Anwendung im allgemeinen auf parlamentarisches Gewohnheitsrecht zurückführen 42. Dies ist vor allem deshalb unproblematisch, weil das Prinzip des Gesetzesvorbehalts für belastendes Verwaltungshandeln, das im Verhältnis Organisation / Organisationsmitglied zwischen dem Staat und seinen Organen einerseits sowie dem Staatsbürger andererseits gilt, im Intra-OrganVerhältnis zwischen dem Parlament und dessen Präsidenten einerseits sowie dem Abgeordneten andererseits nicht eingreift 43 . Der Fall, daß ein Parlamentspräsident eine geschäftsordnungsmäßig nicht vorgesehene Ordnungsmaßnahme trifft, löst daher grundsätzlich keine auf den Gesetzesvorbehalt begründeten Bedenken aus 44 .
39 Vgl. Art. 97 Ziff. 2 LV-SL iVm. § 7 Ziff. 6; §§ 41ff. VerfGHG-Sl; ebenso Braun, Art. 63 LV-BW, Rn. 14. 40 BVerfGE 60, 374 (379); ebenso Arndt, S. 123 f. 41
Franke spricht in diesem Zusammenhang von einem Verstoß gegen den Grundsatz des repräsentativen Mandats in Art. 68 II LV-Sl und gegen die in Art. 70 I LV-Sl geregelte Geschäftsordnungsautonomie, sowie von einem Verstoß gegen das grundgesetzlich vorgegebene repräsentative Mandat aus Art. 38 I 2 GG, das über Art. 28 I 1,2 GG auf die Verfassungsordnung der Länder einwirke, Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 66. 42 Vgl. dazu die obigen Ausführungen. Ebenso Härth, Rede- und Abstimmungsfreiheit, S. 135; Achterberg, S. 651; Kleinschnittger, S. 90f.; Versteyl, in: NJW 1983, 379. Dies gilt insbesondere für die Rüge (vgl. hierzu BVerfGE 60, 378) und die Unterbrechung eines Redners (vgl. hierzu BremStGH, DÖV 71,164). 4 3 Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, -840 (841); Rupp, S. 60ff., 70. 44 BremStGH, DÖV 1971, 164; Achterberg, S. 651.
182
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
2. Die Maßnahmen der Disziplinargewalt Zur Durchsetzung der parlamentarischen Ordnung steht dem amtierenden Präsidenten ein abgestufter Katalog von Maßnahmen zur Verfügung, der vom Sachbzw. Ordnungsruf über die Entziehung des Wortes bis zum Ausschluß von der weiteren Teilnahme an der laufenden Plenarsitzung, schlimmstenfalls von der weiteren Teilnahme an den nachfolgenden Sitzungstagen, reicht. Der Landtagspräsident hat damit Zugriff auf ein höchst eindrucksvolles Instrumentarium zur Sicherung eines würdigen und reibungslosen Ablaufs der Parlamentssitzungen. Ob eine Verletzung der parlamentarischen Ordnung gegeben ist und die Voraussetzungen für ein Ordnungsmittel vorliegen, entscheidet allein der Landtagspräsident nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen 45. Regelmäßig schreitet er allerdings bei persönlichen Angriffen beleidigender oder ehrverletzender Art 4 6 , bei der Verwendung unparlamentarischer Ausdrücke 47, bei besonders lautstarken Zwischenrufen 48 sowie bei kritischen Äußerungen über die präsidiale Verhandlungsführung ein 49 . Ebenso können Zeichen oder Tätlichkeiten Anlaß für ein Einschreiten des Parlamentspräsidenten sein 50 . Welches der geschäftsordnungsmäßig vorgesehenen Ordnungsmittel der Landtagspräsident anwendet, steht ebenfalls in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Dabei hängt die Art des Ordnungsmittels nicht nur von der Schwere des Verstoßes, sondern auch von der Person des Störers ab, weil die im Plenarsaal anwesenden Personengruppen zum Parlament in unterschiedlichen Rechtsverhältnissen stehen51. So dürfen beispielsweise Vertreter der Landesregierung aufgrund ihres verfassungsmäßig garantierten jederzeitigen Rederechts nur in sehr eingeschränkter Form mit Ordnungsmaßnahmen belegt werden. Auch Zuhörern gegenüber ist der dem Landtagspräsidenten zur Verfügung stehende Maßnahmenkatalog ein anderer als gegenüber Parlamentsmitgliedern. Im übrigen würde an sich auch der Parlamentspräsident der Disziplinargewalt unterliegen, da er neben dieser Eigenschaft auch immer noch Abgeordneter ist. Ein disziplinelles Vorgehen gegen sich selbst ist aber naturgemäß ausgeschlossen. Nur für den Fall, daß er den Vorsitz abgibt, untersteht er dem amtierenden Vizepräsidenten in der Art und Weise wie die übrigen Abgeordneten 52.
45 Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. lb, S. 1; Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 200; Vogler, S. 8; Spengler, S. 41; von Pechmann, S. 79 f. Rummel, S. 60; Kleinschnittger, S. 85; Nelamischkies, S. 29. 47
Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 6; Vogler, S. 8. Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 313. Troßmann, § 7, Rn. 31; Nelamischkies, S. 78. » Klinke, S. 127; Spengler, S. 42.
48
Kleinschnittger, S. 80. 52 Vgl. Vogler, S. 11 f.; Kleinschnittger, S. 84.
. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
183
a) Die Maßnahmen in der Redeordnung Die Disziplinarmaßnahmen im Rahmen der Redeordnung sollen den Abgeordneten in seiner Funktion als Redner treffen. Diesem Zweck dienen der Sachruf und nach wiederholtem Sachruf die Wortentziehung. Als „Vorstufe" zum Sachruf versucht der Landtagspräsident jedoch für gewöhnlich, den Redner durch Ermahnungen zu einer Rückkehr zum Verhandlungsgegenstand zu bewegen. Diese Maßnahme wird trotz fehlender geschäftsordnungsmäßiger Regelung allgemein anerkannt und ist mittlerweile zum Gewohnheitsrecht erstarkt 53. Gleichwohl handelt es sich sowohl beim Sachruf als auch bei der Mahnung sowie der Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit nicht um Maßnahmen, die als Sanktionen auf ein im eigentlichen Sinne ordnungswidriges Verhalten eines Parlamentsmitglieds anzusehen sind. Ihr Zweck ist es vielmehr, den äußeren Rahmen der parlamentarischen Verhandlung, der durch die jeweilige Tagesordnung und die Aufteilung der nicht unbeschränkt zur Verfügung stehenden Redezeit gebildet wird, vor Störungen zu bewahren 54. Dennoch sind sie in den Kreis der Ordnungs- und Disziplinarmaßnahmen einzubeziehen, da sie wesentlich zur Verhinderung parlamentarischer Obstruktion, also einer planvollen Störung des Ablaufs der Plenarsitzung durch Abgeordnete, die häufig einer Minderheitsfraktion angehören, beitragen. Die parlamentarische Obstruktion erfolgt u. a. durch die mißbräuchliche Ausnutzung einzelner parlamentarischer Befugnisse, vor allem des Rederechts 55. Redezeitüberschreitungen und endloses Abschweifen vom eigentlichen Beratungsgegenstand haben sich insoweit als besonders geeignet erwiesen 56 . Störungen dieser Art sind hinsichtlich ihrer Wirkung durchaus mit Ordnungsverstößen im eigentlichen Sinne gleichzusetzen, so daß die Befugnis des Landtagspräsidenten, dagegen vorzugehen, im Ergebnis als Ausübung parlamentarischer Disziplinargewalt zu bewerten ist. aa) Der Ruf zur Sache Der Sachruf dient der Rückführung des Redners zum Beratungsthema. Der Parlamentspräsident kann demnach Abgeordnete, die in ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen 57. Dadurch soll verhindert werden, daß der Redner, dem stets zum Verhandlungsgegenstand das Wort erteilt wird, zu einem anderen Thema spricht und somit die Arbeiten des Parlaments 53 Vgl. Mühlbauer, S. 43; Sperling, S. 43; Vogler, S. 16; Gentemann, S. 19. 54
Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 54. 55 Vgl. Keller, in: ZParl 1986,423 f.; Achterberg, S. 296. 56 Nelamischkies, S. 61 f.; Keller, in: ZParl 1986,423 (425 ff.). 57 § 76 I GO-Be; § 90 GOLT-BW; § 75 I GOLT-He; § 117 I 1 GOLT-By; § 65 GOLTNRW; § 92 GOLT-Ss; § 64 I GOLT-SA; § 71 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 37 I GOLT-RP; § 65 GOLT-SH; § 47 I 1 GOBü-Ha; § 73 I GOLT-Nds; § 52 GOLT-MV; § 33 GOLT-Bg; § 361 GOLT-Th; § 461 GOBü-Br.
184
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
nachhaltig beeinträchtigt. Der Sachruf ist also in erster Linie ein präventives Ordnungsmittel zur Wahrung der Redeordnung 58 und hat nur einen indirekten disziplinarischen Charakter 59. Obwohl die Geschäftsordnungen allgemein vom „Redner" als Adressaten sprechen, kann ein förmlicher Sachruf nur gegenüber Abgeordneten erfolgen und nicht gegenüber Vertretern der Landesregierung, soweit diese gestützt auf ihr jederzeitiges Rederecht sprechen. Jenes verfassungsrechtlich garantierte Rederecht kann nämlich nicht auf der Grundlage geschäftsordnungsrechtlicher Regelungen eingeschränkt werden 60. Ob der Landtagspräsident auch einen Sachruf erteilen darf, wenn der Redner Ausführungen zum Thema ständig wiederholt, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet. Teilweise wird dabei die Ansicht vertreten, daß der Ruf zur Sache auch in einem solchen Fall angewendet werden müsse61. Dauernde Wiederholungen seien zwar an sich kein »Abschweifen" vom Verhandlungsgegenstand; wenn aber der Sachruf als Mittel zur Aufrechterhaltung der Redeordnung einen Sinn haben solle - zur Redeordnung gehöre auch die zügige und gründliche Behandlung eines Gegenstands - , so müsse man davon ausgehen, daß dauernde Wiederholungen, das sog. Filibustern, einen Sachruf in sinngemäßer Anwendung rechtfertigen. Dem wird richtigerweise der Gedanke entgegengehalten, daß die Erteilung eines Sachrufs - also die Aufforderung, zum Verhandlungsgegenstand zurückzukehren bei einem Redner, der zwar bestimmte Ausführungen ständig wiederhole, aber dennoch zum Verhandlungsgegenstand spreche, ein Widerspruch in sich sei 62 . Die Geschäftsordnungen enthalten für den Fall, daß die parlamentarische Verhandlung durch endloses Reden gestört wird, die präsidiale Befugnis der Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit. Der Sachruf dient schließlich nicht der Konzentration der parlamentarischen Verhandlung, sondern allein dem Verbleiben bei dem Beratungsgegenstand. Wann ein Abschweifen vom Verhandlungsgegenstand gegeben ist, ist Tatfrage. Zwar wird es allgemein als Abschweifen betrachtet, wenn beispielsweise eine Erklärung zur Abstimmung über die Darlegung der Motive zur Abstimmung hinausgeht oder wenn sich eine Bemerkung zur Geschäftsordnung nicht auf die geschäftsordnungsmäßige Behandlung des zur Beratung anstehenden Gegenstandes oder die Tagesordnung bezieht63. Eine abstrakte Konkretisierung ist dagegen nicht möglich. Die Feststellung des Abschweifens kann nur aufgrund des kon58 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 17; Kleinschnittger, S. 86; Mühlbauer, S. 43; Vogler, S. 16; Seligmann, S. 74; Schmid, in: AöR Bd. 32, 546; von Pechmann, S. 102. 59 Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380). 60 Ritzel/Bücker, § 36, Anm. lc. 61 Ritzel/Bücker, § 36; Anm. lg, S. 3; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34; Rn. 17; Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380); Nelamischkies, S. 60. 62 Troßmann, § 40; Rn. 1; Achterberg, S. 652; Böttcher, S. 98, der jedoch dem Landtagspräsidenten im Interesse einer geordneten Parlamentsarbeit gestattet, den Redner auf die Wiederholung hinzuweisen. 63 Vgl. Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 1 f., S. 3 mit weiteren Beispielen.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
185
kreten Einzelfalls getroffen werden. Der Landtagspräsident hat es dabei in der Hand, den Erfordernissen der konkreten Situation durch eine großzügige oder enge Auslegung gerecht zu werden, zumal ihm bei der Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ein Beurteilungsspielraum zukommt 64 . Die Feststellung, ob ein Abgeordneter vom Gegenstand der Verhandlung abschweift, gebührt allein dem Landtagspräsidenten. Aus der Mitte des Hauses darf niemand den Präsidenten durch einen entsprechenden Wortbeitrag auf Abweichungen vom Thema aufmerksam machen oder gar einen Antrag stellen, einen Ruf zur Sache zu erteilen 65. Als unmittelbare Reaktion auf ein Abschweifen des Redners vom Verhandlungsgegenstand kann der Landtagspräsident den Sachruf nur sofort erteilen. Die nachträgliche Ahndung der Abweichung vom Thema, etwa nach Beendigung der Rede oder sogar erst am Ende einer Sitzung, würde nicht seinem Zweck entsprechen und wäre deshalb als unzulässig anzusehen66. Die Erteilung des Sachrufs ist an keine bestimmte Form gebunden67. Insbesondere ist - mit Ausnahme des Saarländischen Landtags68 - eine Namensnennung nicht erforderlich 69. Im Einzelfall kann es daher ohne Benennung der konkreten Maßnahme zweifelhaft sein, ob der Präsident einem Redner lediglich formlos den Verhandlungsgegenstand in Erinnerung rufen oder einen Sachruf erteilen will. Ebensogut könnte in der Äußerung des Landtagspräsidenten auch eine Ermahnung des Redners, sich enger an das Thema zu halten, zu sehen sein. Eine Unterscheidung ist allerdings von Bedeutung im Hinblick auf eine möglicherweise nachfolgende Wortentziehung, die nur nach mehrfachem Sachruf zulässig ist. Trotz mangelnder Formvorschrift ist dem Präsidenten daher aus Gründen der Rechtsklarheit eine unmißverständliche Formulierung des Sachrufs geboten. Die Verwendung des Ausdrucks „zur Sache rufen" würde beispielsweise diesem Erfordernis genügen70. Der Sachruf steht nach den Geschäftsordnungen der meisten Parlamente im pflichtgemäßen Ermessen des Landtagspräsidenten. Der Präsident ist also nicht verpflichtet, bei Abweichungen des Redners vom Diskussionsthema einen Sachruf zu erteilen, sondern kann sie auch durch Schweigen billigen. Letzteres kommt insbesondere dann in Betracht, wenn es sich um eine kurze oder unwesentliche 64
Ritzel / Bücker, § 36, Anm. 1 f., S. 3; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 60. 65 Böttcher, S. 98. 66 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 20; Böttcher, S. 98; Kleinschnittger, S. 87; Nelamischkies, S. 62; Ritzel/Bücker, § 36, Anm. Ih, S. 3; von Brentano, S. 43; Mühlbauer, S. 43; Vogler, S. 15 f.; Sperling, S. 43. 67 Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380); Böttcher, S. 98; Achterberg, S. 652; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 20; Kleinschnittger, S. 86. 68 § 71 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 69 Böttcher, S. 98; Kleinschnittger, S. 86. 70 Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 62; Achterberg, S. 653; Klinke, S. 132; Kleinschnittger, S. 86; Rothaug, S. 128; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 20.
186
. Abschnitt: Die
ngsgewalt des Landtagspräsidenten
Abweichung handelt, die den Fortgang der Debatte nicht über Gebühr stört 71 . Im Gegensatz hierzu ist der Präsident in den Parlamenten von Bayern, BadenWürttemberg, Bremen und Sachsen bei einer Abschweifung des Redners verpflichtet, ihm einen Sachruf zu erteilen 72. Der Wortlaut der entsprechenden Vorschriften in den parlamentarischen Geschäftsordnungen macht deutlich, daß dem amtierenden Präsidenten ausdrücklich kein Ermessen eingeräumt wird. Gleichwohl steht dem Landtagspräsidenten bei der Beurteilung, ob ein Abschweifen vom Verhandlungsgegenstand vorliegt, ein weiter Entscheidungsspielraum zu, so daß diese Unterschiede im Vergleich zu einer Ermessensvorschrift praktisch keine Auswirkung haben dürften 73 . Eine Einschränkung des dem Landtagspräsidenten geschäftsordnungsmäßig eingeräumten Ermessens ist im übrigen möglich, wenn mit dem Abschweifen vom Verhandlungsgegenstand eine weitere Ordnungsverletzung konkurriert, die den Präsidenten zum Einschreiten zwingt 74 . Dies kommt beispielsweise bei Bemerkungen zur Geschäftsordnung in Betracht, wenn der Redner über das erforderliche Maß der möglicherweise notwendigen Berührung der Sache hinausgeht. Der Sachruf verpflichtet den Abgeordneten, unverzüglich zum Verhandlungsgegenstand zurückzukehren 75, ein Einspruch gegen den Ruf zur Sache ist nur in Hessen und im Saarland statthaft 76.
bb) Die Wortentziehung infolge mehrfacher Sachrufe Die Befugnis des Landtagspräsidenten, ein Parlamentsmitglied zur Sache zu rufen, bliebe ohne große Wirkung, wenn ihm nicht gleichzeitig ein Mittel zur Verfügung stünde, um bei wiederholter Mißachtung dieser Ordnungsmaßnahme die Wiederherstellung der disziplinarischen Ordnung zu erzwingen und damit die Rückkehr zum ordnungsgemäßen Beratungsgegenstand zu ermöglichen. Die parlamentarischen Geschäftsordnungen sehen deshalb vor, daß der Landtagspräsident einem Redner, der in derselben Rede (in Hessen: in derselben Sitzung) dreimal zur Sache gerufen und beim zweitenmal auf die Folgen eines dritten Sachrufs hingewiesen wurde, das Wort zu entziehen hat 77 . Nach § 47 I I der Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft genügt für die Wortentziehung ein zweimaliger Sachruf. Lediglich in Nordrhein-Westfalen sind an den mehrfachen Sachruf des Landtagspräsidenten geschäftsordnungsmäßig keine weiteren Konsequenzen geknüpft.
72 73 74 75 76
Achterberg, S. 652. § 11711 GOLT-By; § 90 GOLT-BW; § 461 GOBü-Br; § 92 GOLT-Ss. So Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 67. Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 19; Achterberg, S. 652. Mühlbauer, S. 43; Richter, S. 91. § 78 Satz 1 GOLT-He; § 74 Satz 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes.
77 § 77 I 1 GO-Be; § 91 III GOLT-BW; § 76 GOLT-He; § 117 I 2 GOLT-By; § 93 III GOLT-Ss; § 64 II GOLT-SA; § 71 III Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 67 I GOLTSH; § 47 I GOBü-Ha; § 73 II GOLT-Nds; § 36 II GOLT-Th; § 54 I GOLT-MV; § 34 III GOLT-Bg.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
187
Die Wortentziehung setzt jedoch zunächst voraus, daß der Abgeordnete zuvor drei Sachrufe erhalten hat, die den formellen Erfordernissen entsprechen. Bloße Sachmahnungen reichen dagegen nicht aus 78 . Der klare Wortlaut der Vorschriften macht dabei deutlich, daß die drei Sachrufe ausschließlich während ein und derselben Rede des Abgeordneten erfolgt sein müssen. Das bedeutet, daß eine kumulative Berücksichtigung mehrerer Sachrufe im Verlauf mehrerer Reden ausgeschlossen ist 7 9 . Adressat der Wortentziehung kann nur der Redner sein, und zwar nur derjenige, dem das Wort vom Landtagspräsidenten erteilt wurde. Abgeordnete, die in unzulässiger Weise das Wort ergriffen haben, können somit nicht Adressat dieser Ordnungsmaßnahme sein 80 . Wie der Wortlaut der Vorschrift nahelegt, ist die Wortentziehung allein auf Reden im Rahmen einer Aussprache bzw. Sachdebatte beschränkt 81. Unzulässig ist die Wortentziehung demnach, wenn eine Aussprache nicht stattfindet, etwa bei der Begründung eines Gesetzentwurfs, die der Aussprache zeitlich vorangeht oder bei persönlichen Bemerkungen sowie persönlichen oder tatsächlichen Erklärungen, die ihr nachfolgen. Zusätzliche Voraussetzung der Wortentziehung ist ein vorheriger Hinweis auf die drohende Folge. Nach dem Wortlaut der Vorschriften ist der Redner beim zweiten Sachruf darauf aufmerksam zu machen, daß ein dritter Sachruf den Wortentzug zur Konsequenz hat. Zwar bleibt es dem Landtagspräsidenten unbenommen, den Hinweis bereits im Zusammenhang mit dem ersten Sachruf auszusprechen. Dies allein ist aber nicht ausreichend. Vielmehr ist es erforderlich, daß der Hinweis beim zweiten Sachruf wiederholt wird, damit die Voraussetzungen für eine Wortentziehung vorliegen 82 . Dieses Formerfordernis hat den Sinn, den Redner ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß er sich bereits zweier Ordnungsverletzungen schuldig gemacht hat und ein weiterer Sachruf mit dem Wortentzug verbunden ist 83 . Der Hinweis ist an keine weiteren Formalien gebunden, muß allerdings wegen der davon abhängigen Wortentziehung eindeutig formuliert sein 84 . Versäumt der Landtagspräsident den rechtzeitigen Hinweis, so kann die Rechtsfolge 78 Rothaug, S. 131; Achterberg, S. 657; Nelamischkies, S. 73. 79 Ritzel/Bücker, § 37, Anm. c, S. 1; Böttcher, S. 103; Kleinschnittger, S. 87; Klinke, S. 143; Nelamischkies, S. 70; Sperling, S. 43; Vogler, S. 23. 80 Nelamischkies, S. 70; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 85; Ritzel / Bücker, § 37, Anm. e, S. 1. 81 Troßmann, § 41, Rn. 1, 2; Achterberg, S. 656; a.A. Ritzel / Bücker, § 37; Anm. e, S. 1, der unter „Rede" alle Ausführungen eines Abgeordneten versteht, unabhängig davon, ob der Redner im Rahmen einer Sach- oder Geschäftsordnungsdebatte spricht, eine Erklärung zur Aussprache, eine tatsächliche oder persönliche Erklärung oder eine Erklärung zur Abstimmung abgibt. Für eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs ebenso Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 85 f. 82 Troßmann, § 41, Rn. 4.2; Ritzel /Bücker, § 37; Anm. f, S. lf.; Nelamischkies, S. 71; Sperling, S. 44; a.A. Gerlach, S. 98 und Rothaug, S. 132, der auch einen Hinweis in der Zeit zwischen den drei Sachrufen als ausreichend ansieht. 83 So Ritzel/Bücker, § 37, Anm. f, S. 1 f. 84 Mühlbauer, S. 51; Nelamischkies, S. 71.
188
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
erst eintreten, wenn bei einem erneuten Sachruf der Hinweis erfolgt und der Redner danach abermals vom Beratungsgegenstand abschweift 85. Sind die zuvor dargestellten Voraussetzungen erfüllt, so muß der amtierende Präsident die Wortentziehung aussprechen. Ein Ermessensspielraum ist ihm in den meisten Landtagen nicht eingeräumt. Literatur und Praxis gehen davon aus, daß der dritte Sachruf, der allerdings noch formell zu erteilen ist, und die Wortentziehung zugleich zur Anwendung kommen, ohne daß es einer weiteren Abschweifung bedarf. Die Wortentziehung wird somit als unmittelbare geschäftsordnungsmäßige Folge des dritten Sachrufs verstanden 86. Doch auch wenn die einschlägigen Bestimmungen einer unmittelbaren Ermessensentscheidung des Landtagspräsidenten keinen Raum lassen, so kann er dennoch mittelbar nach seinem Ermessen befinden, weil er in der Erteilung des letzten Sachrufs frei ist 8 7 . Möglicherweise „vergißt" der Präsident auch den Hinweis auf die Folgen und hält sich dadurch einen Ermessensspielraum offen 88 . Ein Ermessensspielraum des Landtagspräsidenten befindet sich dagegen in den parlamentarischen Geschäftsordnungen von Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern 89. Sofern er also eine Wortentziehung nicht als notwendig ansieht, kann er davon absehen, ohne dabei seine präsidialen Pflichten zu verletzten. In Bayern indessen fällt die Wortentziehung nicht in den Verantwortungsbereich des Präsidenten 90. Ihm ist lediglich ein Antragsrecht, dessen Ausübung allerdings in seinem freien Ermessen steht, zugestanden worden. Die eigentliche Entscheidung trifft dagegen das Parlament auf die entsprechende Frage des Präsidenten mit einfacher Mehrheit. Der Beschluß wird ohne Beratung gefaßt. Diese Regelung erscheint wenig glücklich, da durch sie die Mehrheit im Parlament in die Lage versetzt wird, gegen Parteifreunde gerichtete Wortentziehungen trotz wiederholter Ordnungsverletzung zu verhindern. Sie kann daher die dem Parlamentspräsidenten übertragene Ordnungsgewalt kraft ihrer Mehrheit im Plenum völlig untergraben 91. Ist dem Redner das Wort entzogen worden, so muß er seine Rede unverzüglich abbrechen; selbst eine Fortführung des angefangenen Gedankens ist ihm nicht mehr gestattet92. Ausführungen nach Entziehung des Wortes werden nicht in das Plenar85 Ritzel/Bücker, § 37; Anm. f, S. 2; Rothaug, S. 132; Nelamischkies, S. 71; Kleinschnittger, S. 90; Sperling, S. 44. 86 Klinke, S. 142; Nelamischkies, S. 70; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 87; Rothaug, S. 132 m.w.N. 87 Rothaug, S. 132. 88 Nelamischkies, S. 71. 89 § 64 II GOLT-SA; § 37 II GOLT-RP; § 73 II GOLT-Nds; § 36 II GOLT-Th; § 54 I GOLT-MV. 90 § 11712 GOLT-By. 91 Böttcher, S. 105. 92 Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 87.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
189
Protokoll aufgenommen 93. Außerdem darf (in Hessen: soll) der Landtagspräsident diesem Redner das Wort vor Erledigung des zur Beratung stehenden Gegenstandes - der nicht mit demselben Tagesordnungspunkt identisch ist - nicht mehr erteilen 94. Die Bayerische Geschäftsordnung sieht als Ausnahme hiervon den Fall vor, daß die Aussprache durch die Wortergreifung eines Mitglieds der Staatsregierung oder aus anderen Gründen von neuem eröffnet wird 95 . Das Recht auf Antragstellung und Antragsbegründung bleibt indessen durch die Wortentziehung unberührt 96.
cc) Die Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit Bei der Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit handelt es sich ebenfalls um eine Ordnungsmaßnahme mit disziplinärem Charakter 97. Maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob ein Redner, dem das Wort erteilt wurde, die ihm zustehende Redezeit überschritten hat, ist die vorgegebene Redezeitverteilung 98. Bevor jedoch der Landtagspräsident dem Redner das Wort entziehen kann, muß er ihm vorab eine Mahnung erteilt haben99. Eines vorherigen Hinweises auf die Möglichkeit einer Wortentziehung bedarf es nicht 1 0 0 . Die Mahnung selbst ist an keine bestimmte Form gebunden. Allerdings muß der Präsident gegenüber dem Redner deutlich machen, daß es sich nicht nur um einen unverbindlichen Hinweis handelt, sondern um eine Mahnung im Sinne der Geschäftsordnung 101. Während es in den Landtagen von Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und NordrheinWestfalen im pflichtgemäßen Ermessen des Landtagspräsidenten steht, ob er dem Redner nach der Mahnung sogleich das Wort entzieht, falls dieser mit seinen Ausführungen fortfährt, ist er hierzu in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Nieder93 Vgl. z. B. § 77 II GO-Be. 94 § 77 I 2 GO-Be; § 91 IV GOLT-BW; § 76 2. HS. GOLT-He; § 93 IV GOLT-Ss; § 64 II 2 GOLT-SA; § 71 III 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 37 II 2 GOLT-RP; § 67 II GOLT-SH; § 47 I 2 GOBü-Ha; § 73 II 2 GOLT-Nds; § 36 II 2 GOLT-Th; § 54 II GOLT-MV; § 28 III GOLT-Bg; § 47 IV GOBü-Br. 95 § 117 II GOLT-By. 96 Troßmann, § 41, Rn. 5. 97 Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 2; Nelamischkies, S. 68; a.A. Vogler, S. 22 Fn. 1 und Kleinschnittger, S. 90, die diese Form der Wortentziehung lediglich als „geschäftsleitende Maßnahme" des Präsidenten einstufen. 98 Vgl. dazu die Ausführungen auf S. 132 ff. 99 § 64 VI GO-Be; § 28 II GOLT-Bg; § 44 III 1 GOLT-MV; § 72 II GOLT-He; § 71 III GOLT-Nds; § 62 III GOLT-SA; § 63 IV, V GOLT-NRW; § 30 III GOLT-RP; § 56 III 1 GOLTSH; § 44 II 1 GOLT-Sl; § 29 IV GOLT-Th; § 47 I GOBü-Br; § 108 II GOLT-By. Die Geschäftsordnungen der Landtage von Baden-Württemberg und Sachsen knüpfen keine ausdrücklichen Sanktionen an die Redezeitüberschreitung, die der Hamburger Bürgerschaft sieht gem. § 22 III GOBü-Ha lediglich einen Hinweis des Präsidenten auf die Redezeitüberschreitung an den Redner vor. 100 Vgl. Nelamischkies, S. 65; Rothaug, S. 131. ιοί Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 57.
190
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
sachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und dem Saarland verpflichtet. Die parlamentarische Geschäftsordnung von Sachsen-Anhalt enthält hingegen eine Sollvorschrift. Nach allgemeiner Auffassung bindet eine derartige Regelung den Anwender, so daß nur ausnahmsweise und aus zwingenden Gründen eine Abweichung gestattet ist 1 0 2 . Demzufolge besteht auch hier für den Parlamentspräsidenten eine Verpflichtung, in der angegebenen Weise zu verfahren, es sei denn, er hat besondere Gründe, die eine abweichende Entscheidung rechtfertigen 103 . Sofern die Bestimmungen dem Präsidenten jedoch einen Ermessensspielraum zugestehen, kann er seine Mahnung auch einmal oder mehrfach wiederholen oder von einem Einschreiten sogar ganz Abstand nehmen. Allerdings sollte der Präsident darauf bedacht sein, in der Handhabung eine gewisse Regelmäßigkeit walten zu lassen. Insbesondere nach einem vorher angedrohten Wortentzug liegt es im Interesse der Glaubwürdigkeit des Landtagspräsidenten, diese Konsequenz auch zu ziehen 104 . Im Gegensatz zur Mahnung handelt es sich bei der Wortentziehung um eine Vollstreckungsmaßnahme mit eigenständigem Regelungsgehalt105. Hat der Landtagspräsident einem Redner gegenüber die Wortentziehung ausgesprochen, so muß dieser seine Ausführungen sofort abbrechen, das Rednerpult verlassen und seinen Platz aufsuchen 106. Die Geschäftsordnungen von Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und dem Saarland schreiben in diesem Zusammenhang vor, daß der Präsident dem Redner zu demselben Beratungsgegenstand in derselben Sitzung (in Hessen: in derselben Aussprache) das Wort nicht mehr erteilen darf, sofern er es ihm wegen Überschreitung der Redezeit entzogen hat 1 0 7 . Neben der Wortentziehung wegen Überschreitung der Redezeit sei schließlich im Rahmen der Redeordnung noch auf die Wortentziehung wegen Verlesung der Rede hingewiesen. Verliest also ein Redner ohne Einwilligung des Landtagspräsidenten eine im Wortlaut vorbereitete Rede, so soll der Präsident ihm nach zweimaliger Mahnung das Wort entziehen, sofern der Redner seine Ausführungen weiterhin abliest 108 . Da es sich bei den Vorschriften um Sollbestimmungen handelt, muß der Landtagspräsident besondere Gründe geltend machen, wenn er trotz vorliegender Voraussetzungen keine Wortentziehung anordnet 109. 102 Zur rechtlichen Wirkung von Sollvorschriften vgl. Wolff/Bachof, § 31 II b, S. 196 und Mayer/ Kopp, § 9 II 3, S. 156 m.w.N. 103 Vgl. Troßmann, § 39, Rn. 7. 104 Mühlbauer, S. 29; Rothaug, S. 131. 105
Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 57 106 Vgl. Nelamischkies, S. 66. 107 § 28 III GOLT-Bg; § 47 IV GOBü-Br; § 72 II 2.HS GOLT-He; § 44 III 2 GOLT-MV; § 63 V GOLT-NRW; § 56 III 2 GOLT-SH; § 44 II 2 GOLT-Sl. io« § 28 II GOLT-Th; § 43 III GOLT-Sl; § 73 II 3 iVm. § 71 III GOLT-Nds; § 63 II 3 iVm. § 62 III GOLT-SA. 109 in der parlamentarischen Praxis ist dies jedoch überwiegend nicht üblich.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
191
b) Die Maßnahmen in der Sitzungsordnung Die Maßnahmen in der Sitzungsordnung bezwecken den ruhigen, störungsfreien Verlauf der Vollversammlung des Landtags im Interesse der parlamentarischen Würde und Ethik 1 1 0 . Als Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Plenarsitzungen stellen die parlamentarischen Geschäftsordnungen dem Landtagspräsidenten den Ordnungsruf, die Wortentziehung infolge mehrfacher Ordnungsrufe und die Ausschließung von den Verhandlungen des Parlaments zur Verfügung. Als Ordnungsmaßnahme außerhalb des geschriebenen Geschäftsordnungsrechts der meisten Landtage kann der Präsident zudem auf die parlamentarische Rüge zurückgreifen. aa) Die Rüge Die Rüge ist in den meisten Geschäftsordnungen der Länderparlamente nicht normiert. Lediglich die parlamentarischen Geschäftsordnungen der Länder Bayern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen kennen die Rüge als kodifizierte Ordnungsmaßnahme111. Soweit keine geschäftsordnungsmäßige Regelung erfolgt ist, läßt sich ihre Anwendung auf parlamentarisches Gewohnheitsrecht zurückführen 1 1 2 . Dies ergibt sich aus der lang andauernden gleichförmigen Übung durch die jeweiligen Parlamentspräsidenten einerseits und andererseits aus der Überzeugung der Parlamentsmitglieder, daß die Anwendung dieses Ordnungsmittels dem geltenden Recht entspricht. Bei der parlamentarischen Rüge handelt es sich um eine Disziplinarmaßnahme 1 1 3 , die eigenständig neben den anderen Ordnungsmaßnahmen angesiedelt ist 1 1 4 . Sie übernimmt damit begrifflich auch keine Sammelfünktion für alle unter110 Troßmann, Parlamentsrecht, S. 200; Klinke, S. 124, 173; Engels, S. 51 f.; von Pechmann, S. 46. m § 1191 GOLT-By; § 3412 GOLT-Bg; § 38 11 l.Alt. GOLT-RP; § 37 I 1 1. Alt. GOLTTh. Diese Ordnungsmaßnahme der Rüge im engeren Sinne ist zu unterscheiden von der in § 66 I 2 GOLT-SH und § 53 I 2 GOLT-MV normierten „Rüge", die diesen Begriff untechnisch als Oberbegriff für die Maßnahmen der Zurückweisung einer Äußerung als unparlamentarisch, der Rüge im engeren Sinne und des formellen Ordnungsrufs verwendet, vgl. Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841). 112 Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379; Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841); Härth, Die Rede- und Abstimmungsfreiheit des Parlamentsabgeordneten in der Bundesrepublik Deutschland, 1983, S. 135; Kleinschnittger, S. 90 f.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 120; wohl auch Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34; Rn. 16. Mitunter wird die Rüge auch dem Parlamentsbrauch zugerechnet, vgl. zur Abgrenzung Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 118 f. 113 Kleinschnittger, S. 91; Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 2; Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (843); von Brentano, S. 44; Mühlbauer, S. 43; von Pechmann, S. 83; Vogler, S. 17, der darauf hinweist, daß die Rüge anfangs als schärferes Disziplinarmittel eingestuft wurde als etwa der Sach- oder Ordnungsruf.
192
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
halb von Ordnungs- und Sachruf anzuwendenden Ordnungsmittel in Form von Mahnung, Erinnerung, Ermahnung, Mißbilligung, einer Aufforderung zu ordnungsgemäßem Verhalten oder eines Hinweises auf die Unzulässigkeit eines Ausdrucks bzw. das Unparlamentarische des Verhaltens 115. Abgesehen von der entgegenstehenden parlamentarischen Praxis 116 ist diese Einstufung schon allein deshalb nicht zu teilen, weil sie die Möglichkeit der Entstehung und Anwendung neuer, möglicherweise milderer Ordnungsmittel unterbinden würde 117 . Dies gilt etwa für die Zurückweisung einer Äußerung als unparlamentarisch, die Unterbrechung des Redners oder für die sogenannte Sachmahnung118. Vielmehr treten derartige Maßnahmen als eigenständige Ordnungsmittel neben die Rüge und werden von dieser nicht „aufgesogen". Voraussetzung für die Erteilung einer Rüge ist die Verletzung der parlamentarischen Ordnung durch ein Parlamentsmitglied, unabhängig davon, ob es als Redner oder Zuhörer in Erscheinung tritt. Dabei wird die Rüge als Minus im Verhältnis zum Sach- und Ordnungsruf, zum Wortentzug und zum Ausschluß verstanden und ist somit als das mildeste Mittel zur Aufrechterhaltung der parlamentarischen Ordnung zu bewerten 119 . Dementsprechend greift der amtierende Präsident nur bei leichten Ordnungsverstößen zu dieser Maßnahme, für die einschneidendere Ordnungsmittel als noch nicht notwendig erscheinen 120. Die Rüge kann nur sofort auf die Ordnungsverletzung erfolgen 121 . Diese zeitliche Einordnung folgt aus dem Verständnis der Rüge als Ordnungsmaßnahme mit Präventivcharakter 122. Denn eine 114
Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 16; Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (842); Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. lc, S. 2; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 121. Die Eigenständigkeit der Rüge wird auch durch die Fassung des § 34 I GOLT-Bg unterstrichen, der diese Maßnahme als selbständiges Ordnungsmittel gegenüber der milderen Mahnung und gegenüber dem einschneidenderen Ordnungsruf hervorhebt. 115 So aber das Bundesverfassungsgericht, vgl. BVerfGE 60, 374 (381); gleichermaßen Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379. Vgl. Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 3. Vgl. Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (842); Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 121. 118 So Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 121. Siehe zur Sachmahnung Rothaug, S. 119 ff. 119 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 16; Ritzel / Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 2; Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (841); Kleinschnittger, S. 91; Richter, S. 93; Klinke, S. 130; ebenso BVerfGE 60, 374 (378) und Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380). 120 Vgl. Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. le, S. 2f.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 121. 121 Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (843); so auch Troßmann für den Ordnungsruf, § 40, Rn. 13. Bei der Entscheidung, ob eine Ordnungsverletzung gegeben ist, steht dem Landtagspräsidenten ein Beurteilungsspielraum zu, Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 121. 122 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 16; Ritzel / Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. 1 c, S. 2; ebenso BVerfGE 60, 374 (382).
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
193
Vorbeugung gegen weiteres ordnungswidriges Verhalten ist nur bei unverzüglicher Ahndung des Verstoßes durch entsprechende Disziplinarmittel möglich 123 . In Ausnahmefällen - vor allem bei Unklarheiten über den Wortlaut - kann sich jedoch der Landtagspräsident die Erteilung der Rüge bis zu dem Zeitpunkt ausdrücklich vorbehalten, an dem die stenographische Aufnahme vorliegt 124 . Bei der Erteilung der Rüge ist der Präsident an keine bestimmte Form gebunden125. Allerdings muß für den Adressaten klar erkennbar sein, um welches konkrete Ordnungsmittel (Rüge, Mahnung, Zurückweisung einer Äußerung als unparlamentarisch ... ) es sich handelt, so daß die Verwendung des Begriffs „Rüge" durchaus angezeigt ist und auch die parlamentarische Praxis in diesem Sinne verfährt 126 . Während das Bundesverfassungsgericht in der Rüge nur die „formelle Konstatierung" einer Ordnungsverletzung sieht und ihr damit ausdrücklich die Sanktionseigenschaft abspricht 127 , enthält die Rüge nach Ansicht eines Teils der Literatur nicht nur eine präventive, hinweisende Komponente, sondern auch eine repressive 128 . Dieser repressive Charakter bestehe darin, daß die Rüge das geschehene konkrete Verhalten eines bestimmten Abgeordneten mißbillige und dadurch stärker auf ihn einwirke, als dies bei den Mitteln der Zurückweisung einer Äußerung als unparlamentarisch und der Unterbrechung des Redners der Fall sei 1 2 9 . Doch selbst wenn man dieser Auffassung insoweit folgt, als die Rüge des Präsidenten zugleich auch eine Mißbilligung der Äußerung oder des Verhaltens des betroffenen Abgeordneten zum Ausdruck bringt, so ist mit der Mißbilligung weder unmittelbar noch mittelbar ein Rechtsnachteil verbunden 130. Zwar wird die Rüge vor allem in der Öffentlichkeit und von betroffenen Abgeordneten vielfach als „Ahndung" eines Fehl Verhaltens verstanden 131, gleichwohl entfaltet sie keine konkrete Rechtsfolge, die eine Sanktionseigenschaft begründen könnte. Eine Sanktionseigenschaft der Rüge läßt sich auch nicht im Blick auf deren präventive Komponente mit der Erwägung rechtfertigen, daß sie bestimmten Verhaltens· und Ausdrucksweisen für die Zukunft die Eignung zur Verwendung im Parlament abspreche und allein diese „Verbannung" aus dem Parlament eine Rechtsfolge enthalte 132 . Vielmehr handelt es sich hier weniger um eine rechtliche als um 123
Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983,840 (843). ι*» Troßmann, § 40, Rn. 16. ™ Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379; Kleinschnittger, S. 91; Franke, S. 122; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 16. i * Franke, S. 122. m BVerfGE 60, 374 (381 f.); wohl auch Härth, Rede- und Abstimmungsfreiheit, S. 135 f. im So Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (842) und Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 122 f. 129 Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983, 840 (842). 130 So auch BVerfGE 60, 374 (381 f.). 131 Vgl. Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 16. 132 Achterberg, Rechtsnatur parlamentarischer Rügen, in: JuS 1983,840 (842). 13 Köhler
194
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
eine psychologische Folge, die sich aus dem Verständnis der Rüge als moralische Mißfallensäußerung ergibt, jedoch keine tatsächliche rechtserhebliche Wirkung entfaltet 133 . bb) Der Ruf zur Ordnung Das Disziplinarmittel des Ordnungsrufs 134 findet in den Fällen Anwendung, in denen ein Abgeordneter während der Plenarsitzung im Sitzungssaal oder in dessen unmittelbarer Nähe die parlamentarische Ordnung verletzt 135 . Eine Verletzung der parlamentarischen Ordnung liegt vor, wenn gegen sie durch Äußerungen oder Handlungen, die den parlamentarischen Regeln widersprechen und das Ansehen des Parlaments zu schädigen geeignet sind, verstoßen wird 1 3 6 . In den parlamentarischen Geschäftsordnungen von Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen wird deshalb auch ausdrücklich auf eine Verletzung der „Würde ( . . . ) des Hauses" als Tatbestandsmerkmal hingewiesen. Da es sich bei dem Begriff der parlamentarischen Ordnung um einen unbestimmten, ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriff handelt 137 , steht dem Landtagspräsidenten bei der Entscheidung über die Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ein gewisser Beurteilungsspielräum zu . Als Verletzungshandlungen kommen sowohl verbale Äußerungen als auch tatsächliche Verhaltensweisen in Betracht, die nicht nur vom jeweiligen Redner, sondern von jedem anderen anwesenden Parlamentsmitglied ausgehen können 139 . Dementsprechend kann ein Ordnungsruf auch gegen Abgeordnete ergehen, denen der Landtagspräsident das Wort nicht erteilt hat, die aber in anderer Weise - etwa durch lautstarke und permanente Zwischenrufe - die parlamentarische Ordnung verletzen 140 . Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten einer OrdnungsVerletzung ist eine erschöpfende Aufzählung der Verletzungstatbestände nahezu ausgeschlossen. Zwar hat sich in der parlamentarischen Praxis ein ganzer Katalog von Ausdrücken und Redewendungen herausgebildet, die den Tatbestand einer Ordnungs133 Versteyl, in: NJW 1983, 379 (380 f.). 134 Kleinschnittger, S. 92; Vogler, S. 21; Mühlbauer, S. 45; Gentemann, S. 21; Böttcher, S. 100. 135 Vgl. § 76 Π GO-Be; § 91 I GOLT-BW; § 75 II GOLT-He; § 66 II GOLT-NRW; § 93 I GOLT-Ss; § 80 I GOLT-SA; § 71 I 2. Alt. Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 38 I 1 GOLT-RP; § 47 I 1 2. Alt. GOBü-Ha; § 66 I 1 GOLT-SH; § 88 I GOLT-Nds; § 37 I 1 GOLTTh; § 53 11 GOLT-MV; § 34 II 1 GOLT-Bg; § 46 II GOBü-Br. 136 Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 b, S. 3; vgl. zum Begriff der parlamentarischen Ordnung oben S. 170 ff. 137 Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 b, S. 3. 138 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 21; Achterberg, S. 653; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 69; Ritzel/Bücker; § 36, Anm. 2 b, S. 3.
139 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 22. 140 Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380).
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
195
Verletzung erfüllen 141 . Da jedoch sprachliche Gepflogenheiten einer raschen Wandlung unterliegen und der parlamentarische Sprachgebrauch von der Alltagssprache nicht unbeeinflußt bleibt, lassen sich generelle Regelungen nur schwer festmachen. Außerdem sind die Vorstellungen von parlamentarischer Würde und Ordnung Ausdruck entsprechender gesellschaftlicher Wertmaßstäbe, die ihrerseits einem raschen Wandel unterworfen sind 1 4 2 . Unstreitig werden allerdings Verbalinjurien in Form von grob kränkenden Bemerkungen mit einem Ordnungsruf belegt sowie Beschimpfungen einzelner politischer Gruppierungen des Hauses, des Staatswesens, des Staatsoberhauptes oder bestimmter Volksgruppen. Ebenso werden Beleidigungen im Sinne der §§ 185 ff. StGB und andere strafbare Handlungen (ζ. B. Nötigung, Drohung, Hausfriedensbruch, Verteilung verfassungswidrigen Propagandamaterials u.ä.) regelmäßig vom Landtagspräsidenten geahndet. Ein besonderer Grund für einen Ordnungsruf ist nach ständigem Parlamentsbrauch eine Kritik an der Amtsführung des Parlamentspräsidenten 143. Bejaht der Landtagspräsident die Voraussetzungen für einen Ordnungsruf, so ist er verpflichtet, diesen auch zu erteilen; ein Ermessensspielraum wird ihm in den meisten Geschäftsordnungen der Länderparlamente nicht eingeräumt. Lediglich die Geschäftsordnung der Hamburger Bürgerschaft und des Landtags von Nordrhein-Westfalen sowie das Gesetz über den Landtag des Saarlandes sehen vor, daß der Präsident den Ordnungsruf nach seinem Ermessen verhängt 144 . Die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags enthält insoweit eine Sollvorschrift 145 . Sofern dem Parlamentspräsidenten ein Ermessensspielraum zugestanden wird, hat er sich dabei sowohl von den Interessen eines geordneten Geschäftsgangs leiten zu lassen als auch von der Wahrung des Ansehens und der Würde des Parlaments in der Öffentlichkeit 146 . Hinweise anderer Abgeordneter auf eine Ordnungsverletzung braucht der Landtagspräsident nicht zu befolgen. Ebensowenig ist ein förmlicher Antrag aus der Mitte des Hauses auf Erteilung eines Ordnungsrufs wegen seines unberechtigten Eingreifens in die präsidiale Entscheidungsbefugnis zulässig 147 . Das Ermessen des Präsidenten findet allerdings eine Begrenzung durch das Prinzip der Erforderlichkeit des Mittels als Ausfluß der Rechtsstaatlichkeit148. In allen anderen Landtagen, in denen ein Ermessensspielraum des Präsidenten nicht vorgesehen ist, müssen dessen Erwägungen, 141 Vgl. die Beispiele bei Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 3, S. 6 f. 142 vgl. Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 69 und S. 78 f. ι 4 3 Troßmann, § 40, Rn. 5 ff.; Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 c, S. 4; Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380). 144 § 47 I 1 2. Alt. GOBü-Ha; § 66 II GOLT-NRW; § 711 2. Alt. Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 145 § 75 II GOLT-He. 146 Troßmann, § 40, Rn. 13. 147 Vgl. Böttcher, S. 101; Nelamischkies, S. 34 f.; Perels, S. 100; Vogler, S. 16; Sperling, S. 43; siehe auch Richter, S. 101 f. 148 Achterberg, S. 655. 1*
196
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
ob im Hinblick auf die Schwere der Ordnungsverletzung ein Ordnungsruf angemessen ist, bereits bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Verletzung der Ordnung" berücksichtigt werden 149 . Eine von den anderen Landtagen abweichende Regelung hinsichtlich der Erteilung eines Ordnungsrufs ist in der Geschäftsordnung des Landtags von Bayern anzutreffen. Gem. § 119 I GOLT-By kann ein Ordnungsruf nur dann erfolgen, wenn ein Abgeordneter eine gröbliche Störung der Ordnung verursacht hat. Dies gilt gleichermaßen für persönlich verletzende Ausführungen oder persönlich verletzende Zwischenrufe eines Abgeordneten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß der Ordnungsruf nach der bayerischen Regelung nur im Falle einer wiederholten Ordnungsverletzung Anwendung findet, während der Landtagspräsident bei erstmaliger Verletzung der parlamentarischen Ordnung lediglich eine Rüge erteilen darf. Indessen schweigt die Geschäftsordnung über die vom Präsidenten zu ergreifenden Maßnahmen für den Fall, daß ein Ordnungsverstoß unterhalb des Schweregrads einer gröblichen Störung der Ordnung liegt. Im Interesse eines ruhigen und störungsfreien Beratungsverlaufs wird dem Präsidenten für diese Konstellation zumindest ein entsprechender Hinweis an den Abgeordneten oder gar eine Mahnung gestattet sein 150 . Eine abweichende Regelung enthält ebenfalls die parlamentarische Geschäftsordnung von Nordrhein-Westfalen. Nach § 661 GOLT-NRW muß der Landtagspräsident einen Redner, dessen Redebeitrag die parlamentarische Ordnung verletzt, ermähnen, wieder zu derselben zurückzufinden oder seine Ausführungen zu berichtigen. Darüber hinaus hat der Präsident gem. § 66 I I GOLT-NRW die Möglichkeit, dem Redner - gewissermaßen als weiterführende Maßnahme - einen Ordnungsruf zu erteilen, dessen Verhängung in sein Ermessen gestellt ist. Insofern ergibt sich auch hier ein ähnliches Stufenverhältnis der Ordnungsmittel wie in Bayern. Eine abgestufte Vorgehensweise des Präsidenten enthält zudem § 34 I GOLT-Bg. Diese Vorschrift verpflichtet den Präsidenten, dem Redner schon dann eine Mahnung auszusprechen, wenn dessen Redewendungen geeignet sind, die parlamentarische Ordnung zu verletzen, sich also eine Störung derselben in den Ausführungen des Abgeordneten erst abzeichnet. Nach seinem freien Ermessen kann er dem Redner auch eine Rüge erteilen. Ergänzend hat der Präsident bei Ordnungsverletzungen die Befugnis, einen Ordnungsruf zu verhängen. Die Geschäftsordnungen der Landtage von Rheinland-Pfalz und Thüringen hingegen stellen den Landtagspräsidenten bei einem Ordnungsverstoß vor die Alternative, entweder eine Rüge oder einen Ordnungsruf zu verhängen 151; eine Rangfolge zwischen beiden Maßnahmen läßt sich dem Wortlaut der Vorschriften zumindest nicht unmittelbar entnehmen. Gleichwohl ist in Ansehung des Grundsatzes, stets das mildeste Mittel zu wählen, von der Verpflichtung des Präsidenten aus149
Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 82. Schmid, Geschäftsordnung, S. 111 m.w.N. 151 § 38 11 GOLT-RP; § 37 I 1 GOLT-Th. 150
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
197
zugehen, zunächst die Rüge auszusprechen und erst bei einer weiteren Ordnungsverletzung den Ordnungsruf folgen zu lassen152. Für die Erteilung eines Ordnungsrufs als disziplinäre Maßnahme gelten bestimmte Formerfordernisse. So schreiben die meisten parlamentarischen Geschäftsordnungen vor, daß der Landtagspräsident den Abgeordneten mit Nennung des Namens zur Ordnung rufen muß 153 . Dem Wortsinn nach ist hierunter die Nennung des Familiennamens zu verstehen 154. Diese Formvorschrift soll einerseits verhindern, daß der Ordnungsruf an eine unbestimmte Zahl von Adressaten gerichtet wird, ein sogenannter Blankettordnungsruf ist unzulässig155. Andererseits dient die Namensnennung dem Zweck, den entsprechenden Abgeordneten öffentlich als Verletzer der Ordnung „anzuprangern" 156. Neben der Namensnennung ist aber auch jede andere konkret-individuelle Anrede zulässig, etwa die Bezeichnung des Abgeordneten mit seinem Wahlkreis 157 . Dem Erfordernis der Namensnennung ist zudem auch dann genügt, wenn sich der Adressat der Ordnungsmaßnahme eindeutig aus den Umständen ergibt und für die im Plenarsaal Anwesenden kein Zweifel an der Identität des Störers besteht. Die Anrede mit „Sie" ohne ausdrückliche Namensnennung ist dann ausreichend 158. Im Rahmen der Formvorschriften ist der Landtagspräsident bei der Verhängung des Ordnungsrufs außerdem gehalten, eine so eindeutige Formulierung zu verwenden, daß der Rechtscharakter der Maßnahme in Abgrenzung zur Rüge, Mahnung oder Beanstandung hinreichend zum Ausdruck kommt 159 . Dies erfordert in aller Regel die Benutzung des Begriffs „zur Ordnung" 160 . In einigen parlamentarischen Geschäftsordnungen ist der Gebrauch dieser Formulierung sogar ausdrücklich vorgesehen 161. Im übrigen bleibt dem Präsidenten die weitere Wortwahl überlassen. Ferner steht es in seinem Ermessen, ob er den Grund für den Ordnungsruf angibt 162 . Grundsätzlich muß der Landtagspräsident den Ordnungsruf unmittelbar im Anschluß an die Verletzung der Ordnung erteilen, weil dieser nur dann seine repressive und präventive Wirkung voll entfalten kann 163 . Insbesondere die Vorbeugung 152
So auch Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 82. Lediglich in Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern Bremen ist geschäftsordnungsmäßig keine Namensnennung angeordnet. 154 Kleinschnittger, S. 92 f. 155 Kleinschnittger, S. 93. 156 Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 f., S. 5. 157 Vgl. Schmid, in: AöR Bd. 32, S. 499. 158 Vgl. Nelamischkies, S. 81; Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 f., S. 5. 159 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 24 m.w.N.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 71. 160 Achterberg, S. 655; Troßmann, § 40, Rn. 17; Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 g, S. 5; Kleinschnittger, S. 92; Franke, Ordnunsmaßnahmen, S. 71. 161 So in § 76 II GO-Be; § 801 GOLT-SA;§ 66 I 1 GOLT-SH; § 88 I GOLT-Nds und § 53 I 1 GOLT-MV. 162 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 24 m.w.N.; Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 g, S. 5. 153
und
198
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
gegen weiteres ordnungswidriges Verhalten in derselben Aussprache ist nur dann zu erreichen, wenn der Ordnungsruf der Ordnungsverletzung auf dem Fuß folgt 1 6 4 . Die Geschäftsordnung des Landtags von Nordrhein-Westfalen eröffnet dem Parlamentspräsidenten jedoch in § 66 Π 2 GOLT-NRW ausdrücklich die Möglichkeit, einen Abgeordneten auch noch nachträglich, d. h. in der nächstfolgenden Sitzung zur Ordnung zu rufen. Ähnliche Regelungen sind zudem in den parlamentarischen Geschäftsordnungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen, nach denen der Landtagspräsident Ordnungsverletzungen, die ihm entgangen sind, in der nächsten Sitzung erwähnen und gegebenenfalls rügen kann 165 . Zwar wird hier die Maßnahme des Ordnungsrufs nicht explizit aufgeführt, jedoch wird diese von dem Begriff der ,,Rüge", der hier im weiten Sinne gebraucht wird, mitumfaßt 166 . In Thüringen beschränkt § 3713 GOLT-Th diese Befugnis lediglich auf Zwischenrufe, die der Präsident nicht wahrgenommen hat. Selbst wenn die Geschäftsordnungen der Landtage die Möglichkeit eines nachträglichen Ordnungsrufes nicht ausdrücklich erwähnen, so wird dieser aufgrund ständiger Übung in der parlamentarischen Praxis als Gewohnheitsrecht angesehen und damit grundsätzlich als zulässig bewertet 167 . Die Befugnis des Landtagspräsidenten zur Erteilung eines nachträglichen Ordnungsrufs entspricht im übrigen dem Strafcharakter dieser Maßnahme und ermöglicht außerdem eine genaue Nachprüfung, um einen unberechtigten Ordnungsruf zu verhindern 168 . Der Ordnungsruf darf nur von dem Präsidenten verhängt werden, dem zum Zeitpunkt der Ordnungsverletzung die Sitzungsleitung oblag 169 . Daraus folgt aber nicht, daß die Bekanntgabe des Ordnungsrufs ebenfalls durch ihn persönlich zu erfolgen hat. Vielmehr kann diese in seinem Namen von jedem anderen amtierenden Präsidenten vorgenommen werden 170 . Trotz grundsätzlicher Zulässigkeit des nachträglichen Ordnungsrufs ist zu bedenken, daß sich die oben erwähnte präventive und repressive Wirkung eines Ordnungsrufs mit zunehmendem zeitlichen Abstand immer mehr abschwächt, der Erfolg nachträglicher Erteilung mithin wesentlich schwächer ist als der sofortiger Verhängung 171. Vor diesem Hintergrund sollte sich der Landtagspräsident aus ι « Achterberg, S. 655; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 71; Troßmann, § 40, Rn. 16; Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 i, S. 5; Böttcher, S. 101; Kleinschnittger, S. 93; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 25. ι « Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 i, S. 5. 165 § 66 12 GOLT-SH; § 53 12 GOLT-MV. 166 Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 i, S. 5 unten; vgl. dazu auch die Ausführungen auf S. 187. 167 Troßmann, § 40, Rn. 16; Achterberg, S. 655; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 25; Kleinschnittger, S. 93; Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 i, S. 5; Böttcher, S. 101; kritisch Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 72 ff. 168 Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 i, S. 5. κ* Troßmann, § 40, Rn. 15, 20; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 72f.; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 25. 170 So Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 j, S. 6. 171 Böttcher, S. 101; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 72.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
199
Gründen der Effektivität verpflichtet fühlen, Ordnungsrufe prinzipiell im unmittelbaren Anschluß an die Ordnungsverletzung zu erteilen und von der Befugnis nachträglicher Ahndung nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen. Hat sich der Landtagspräsident für die Verhängung eines Ordnungsrufs entschieden, so greifen dessen Rechtsfolgen in zweierlei Hinsicht: einerseits verfolgen sie den Zweck, den betroffenen Abgeordneten von weiteren Störungen abzuhalten, andererseits enthalten sie die strikte Mißbilligung des ordnungswidrigen Verhaltens 172 und die damit einhergehende Bloßstellung des Parlamentsmitglieds vor allen Anwesenden als „Rechts- bzw. Ordnungsbrecher". In einigen Landtagen ist mitunter vorgeschrieben, daß der ergangene Ordnungsruf und der Anlaß hierzu von den nachfolgenden Rednern nicht behandelt werden dürfen 173 , und zwar auch nicht im Wege einer persönlichen Bemerkung oder einer persönlichen oder tatsächlichen Erklärung 174 . Diese Bestimmungen rechtfertigen sich aus dem Umstand, daß das Parlament die Ausübung der Disziplinargewalt ausschließlich dem amtierenden Präsidenten übertragen hat und steht damit im Einklang mit dem Verbot der Kritik an dessen Amtsführung 175 . Vielmehr stellen kritische Äußerungen über die Amtsführung des Landtagspräsidenten ihrerseits eine Ordnungswidrigkeit dar, die entsprechend zu ahnden ist 1 7 6 . Beruht der Ordnungsruf auf einem Irrtum, der in der Person oder der Sache begründet liegt, so bleibt dem Landtagspräsidenten die Rücknahme dieses Ordnungsmittels unbenommen177. Die Rücknahme ist allerdings nicht zeitlich unbefristet möglich, sondern ist nur bis zur Entscheidung über einen Einspruch des Abgeordneten bzw. bis zum Ablauf der Einspruchsfrist gestattet178. Sofern der Landtagspräsident die Rücknahme des Ordnungsrufs bekanntgegeben hat, gilt dieser als nicht erteilt 179 . Ein Anspruch des betroffenen Abgeordneten gegenüber dem amtierenden Präsidenten auf Rücknahme eines Ordnungsrufs, selbst wenn dieser zu Unrecht erteilt wurde, besteht indessen nicht 1 8 0 . Der Abgeordnete ist in diesem 172 Vgl. Achterberg, S. 653; Ritzel /Bücker, § 36, Anm. 2 f., S. 5; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 70. Zur Frage, ob der Ordnungsruf das Recht des Abgeordneten auf freie Meinungsäußerung im Sinne des Art. 5 11 GG und das zum Abgeordnetenstatus zählende Rederecht berührt, vgl. Troßmann, § 40, Rn. 6 ff.; Achterberg, S. 653 f. (beide bejahend) sowie Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 75 ff. (verneinend). 173 § 76 III GO-Be; § 75 II 2 GOLT-He; § 66 III GOLT-NRW; § 38 I 2 GOLT-RP; § 47 II GOBü-Ha; § 371 2 GOLT-Th; § 34 II 2 GOLT-Bg; § 46 III GOBü-Br. 174 Troßmann, § 40, Rn. 19. 175 Kleinschnittger, S. 94; Achterberg, S. 656. 176 Siehe zum Verbot der Kritik an der Amtsführung des Landtagspräsidenten auch die Ausführungen auf S. 36. 177 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 26; Nelamischkies, S. 84 f.; Vogler, S. 21; Mühlbauer, S. 12. 178 Ritzel/Bücker, § 36, Anm. 2 k, S. 6; Nelamischkies, S. 84 f. 179 So Richter, S. 99. 180 Vgl. dazu die Ausführungen von Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 74 f.
200
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
Fall auf die in den parlamentarischen Geschäftsordnungen abschließend festgelegten Möglichkeiten der Überprüfung von Ordnungsmaßnahmen zu verweisen. Im Gegensatz zur Rücknahme des Ordnungsrufs durch den Präsidenten hat die Rücknahme einer ordnungswidrigen Äußerung durch den Abgeordneten keinerlei Einfluß auf die Disziplinarstrafe, da die Wiedergutmachung den Ordnungsverstoß nicht ungeschehen machen kann 181 . Verstößt ein Parlamentsmitglied zugleich gegen die Redeordnung, so verwirkt es das schwerere Disziplinarmittel, also den Ordnungsruf. Der Sachruf hingegen entfällt 182 . Im übrigen steht es dem Landtagspräsidenten frei, mildere Maßnahmen nachträglich in schärfere umzuwandeln. Da keine doppelte Bestrafung (ne bis in idem) und keine Rechtskraft der ausgesprochenen Strafe vorliegt, wird durch eine mildere Strafe nicht das Recht erschöpft, wegen des gleichen Sachverhalts eine andere (schärfere) Maßnahme zu ergreifen, ζ. B. zuerst einen Ordnungsruf, später den Ausschluß von der Teilnahme an der Verhandlung 183.
cc) Die Wortentziehung infolge mehrfacher Ordnungsrufe Die Disziplinarmaßnahme der Wortentziehung ist neben der Redeordnung ebenfalls im Bereich der Sitzungsordnung anzutreffen 184. Auch hier stellt sie sich als Konsequenz von drei Ordnungsrufen dar, die vom Landtagspräsidenten während derselben Rede, in Hessen während derselben Sitzung, verhängt wurden, wobei der Präsident wiederum beim zweiten Mal auf die Folgen der Wiederholung hinzuweisen hat. Ist dem Redner das Wort entzogen worden, so kann er es vor Erledigung des zur Beratung stehenden Gegenstandes nicht mehr erhalten. Insofern kann auf die Ausführungen zur Wortentziehung infolge dreimaliger Sachrufe verwiesen werden, da die Voraussetzungen nahezu identisch sind 185 . Eine Abweichung findet sich lediglich in Bremen. Gem. § 47 ΠΙ der Geschäftsordnung der dortigen Bürgerschaft kann der Parlamentspräsident einem Redner das Wort entziehen, den er bereits zur Ordnung gerufen hat, der aber dennoch bei seinem Verhalten beharrt. Voraussetzung für die Wortentziehung ist mithin nur ein einziger Ordnungsruf; ein Hinweis auf die drohende Folge ist nicht vorgeschrieben. Die Erteilung des Wortentzugs steht im pflichtgemäßen Ermessen des Landtagspräsidenten. Ist die Ordnung des Hauses auf diese Weise trotzdem nicht wiederherzustellen, so ist der Präsident gehalten, die Sitzung vorläufig aufzuheben, d. h. zu unterbrechen oder sie zu schließen. Im übrigen sehen die parlamenta181 Mühlbauer, S. 49; Kleinschnittger, S. 94. 182 Vgl. Vogler, S. 22; Sperling, S. 45; Böttcher, S. 102. 183 Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 12. iw § 77 I GO-Be; § 91 III GOLT-BW; § 76 GOLT-He; § 66 IV GOLT-NRW; § 93 III GOLT-Ss; § 71 ΙΠ Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 67 I GOLT-SH; § 47 I GOBüHa; § 541 GOLT-MV; § 34 ΠΙ GOLT-Bg. 185 Siehe dazu die Erläuterungen auf S. 186 f.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
201
rischen Geschäftsordnungen der Länder Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern die präsidiale Möglichkeit einer sofortigen Wortentziehung für den Fall vor, daß ein Parlamentsmitglied „in gröblicher Weise" die Ordnung verletzt 186 bzw. sich eines „ganz besonders schweren Verstoßes" gegen die parlamentarische Ordnung schuldig macht 187 . Gelegentlich ist in der parlamentsrechtlichen Literatur die Frage aufgeworfen worden, ob Rufe unterschiedlicher Art - also etwa zwei Ordnungsrufe und ein Sachruf - addiert werden dürfen, um dadurch die rechtliche Grundlage für eine sich anschließende Wortentziehung zu schaffen. Als Argument für eine derartige Vorgehensweise des Landtagspräsidenten wird mitunter angeführt, daß es nur auf das dreimalige ordnungswidrige Verhalten des Redners insgesamt ankomme. Indem er nämlich drei Rufe gleich welcher Art auf sich gezogen habe, unterstreiche er seine mangelnde Bereitschaft, sich während der Aussprache ordnungsgemäß zu verhalten. Allein dieser Umstand rechtfertige einen Wortentzug 188. Dieser Ansicht ist der eindeutige Wortlaut der meisten Geschäftsordnungsbestimmungen entgegenzuhalten189. Hiernach darf das Wort nach dem zweiten Ordnungs- oder Sachruf mit anschließendem Folgenhinweis nicht ohne vorherigen dritten S ach- oder Ordnungsruf entzogen werden 190 . Dem dritten Ruf müssen folglich zwei gleichgeartete Rufe vorausgegangen sein 191 . Die Unzulässigkeit der Zusammenfassung von S ach- und Ordnungsruf ergibt sich ferner aus der völlig verschiedenen Zweckrichtung der beiden Ordnungsmaßnahmen192. Während sich der Sachruf gegen die Verletzung der Redeordnung richtet und schwerpunktmäßig als präventive Maßnahme zu charakterisieren ist, liegt der Schutzzweck des Ordnungsrufs bei der Aufrechterhaltung der parlamentarischen Sitzungsordnung und besitzt vornehmlich repressiven Charakter. Außerdem ist die einschneidende Folge der Wortentziehung vor allem darin begründet, daß der Abgeordnete sein ordnungswidriges Verhalten, auf das er bereits hingewiesen wurde, fortgesetzt hat 1 9 3 . Die Kumulation von Rufen unterschiedlicher Art kann demzufolge keine rechtliche Grundlage für eine Wortentziehung schaffen.
186 § 91 II GOLT-BW; § 93 II GOLT-Ss. 187 § 120 Satz 1 GOLT-By. 188 So Achterberg, S. 657. 189 Vgl. dazu stellvertretend § 77 I 1 GO-Be: Ist ein Redner dreimal in derselben Rede „zur Ordnung" oder dreimal „zur Sache" gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen des dritten Rufes „zur Sache" oder „zur Ordnung" hingewiesen worden, so entzieht ihm der Präsident das Wort. 190 Nelamischkies, S. 70; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 85. 191 Troßmann, Parlamentsrecht und Praxis, S. 299; Ritzel / Bücker, § 37, Anm. d, S. 1 mit dem Verweis auf den schriftlichen Bericht des 1. Ausschusses, BT-Dr. V/521. 192 Kleinschnittger, S. 87; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 29; Rothaug, S. 131; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 85; Böttcher, S. 103; Spengler, S. 52; Klinke, S. 142; Nelamischkies, S. 70; Richter, S. 92; Vogler, S. 23; Gentemann, S. 24. 193 So Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 29.
202
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
Im übrigen folgt nicht in allen Landtagen nach drei Ordnungsrufen eine Wortentziehung. Vielmehr räumen die parlamentarischen Geschäftsordnungen von Bayern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Thüringen dem Landtagspräsidenten stattdessen (in Bayern: alternativ) die Befugnis ein, ein Parlamentsmitglied nach dreimaligem (in Bayern: zweimaligem) Ruf zur Ordnung von dem weiteren Verlauf der Sitzung auszuschließen194. Der ausgeschlossene Abgeordnete hat den Sitzungssaal unverzüglich zu verlassen. Leistet er der Aufforderung keine Folge, so muß der Präsident die Sitzung unterbrechen oder schließen.
dd) Der Ausschluß eines Abgeordneten von der Sitzung Der Ausschluß eines Abgeordneten von der Teilnahme an der Plenarsitzung ist das schärfste Disziplinarmittel 195 , das die parlamentarischen Geschäftsordnungen der Länder dem Landtagspräsidenten zur Aufrechterhaltung der Ordnung zur Verfügung stellen. Gerade wegen der einschneidenden Rechtsfolgen, die elementare Abgeordnetenrechte berühren, ist diese Maßnahme nach wie vor die umstrittenste. (I) Parlamentshistorische
Grundlagen
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten haben in Deutschland die Ordnungsmaßnahmen gegen Abgeordnete nur sehr schleppend Eingang gefunden. Maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklung in den deutschen Ländern hatte das französische Disziplinarrecht, nachdem es die ursprüngliche Strenge der Revolutionszeit abgelegt hatte 196 . Dementsprechend war dem parlamentarischen Ordnungsrecht einiger deutscher Landtage zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch die Ausschließung eines Parlamentsmitglieds als Disziplinarmaßnahme nicht unbekannt 197 . In Hannover beispielsweise konnte ein Mitglied der Ständeversammlung im äußersten Fall durch Beschluß beider Kammern und unter Zustimmung der Regierung von der weiteren Teilnahme an den Verhandlungen ausgeschlossen werden, in Bayern und Sachsen durch Mehrheitsentscheid allein der jeweiligen Kammer. Auch der kurhessische Landtag konnte Maßnahmen zur „künftigen Verhütung" schwerer und fortgesetzter Ordnungswidrigkeiten eines Abgeordneten beschließen198. In Hannover, Bayern und Sachsen kam ein vorübergehender oder dauerhafter Ausschluß insbesondere bei Ausfällen gegen das Herrscherhaus, die Regierung, die Ständeversammlung oder einzelne ihrer Mitglieder sowie bei Belei194 § 119 II GOLT-By; § 80 II GOLT-SA; § 38 II GOLT-RP; § 88 II GOLT-Nds; § 37 II GOLT-Th. 195 Ritzel/Bücker, § 38 Anm. 1 a, S. 1; Kleinschnittger, S. 95; Böttcher, S. 106; Seligmann, S. 82; Mühlbauer, S. 52; Sperling, S. 47. 196 Ritzel/Bücker, Vorbemerkung zu den §§ 36-41, Anm. 4 a, S. 9. 197 Vgl. Hubrich, Redefreiheit, S. 456. 198 Botzenhart, S. 473 mit entsprechenden Nachweisen.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
203
digungen fremder Regierungen und des Deutschen Bundes in Betracht. Aber auch ein Verstoß gegen das Vertraulichkeitsgebot bei Geheimsitzungen konnte den Ausschluß aus Ständeversammlung zur Folge haben 199 . Die Frankfurter Nationalversammlung von 1848 sah in ihrem Entwurf einer Disziplinarordnung ebenfalls den Sitzungsausschluß vor, der jedoch infolge der politischen Ereignisse nicht mehr zur Beratung vorgelegt werden konnte 200 . Hingegen gab es weder in Preußen noch im Reich die Möglichkeit, einen Abgeordneten auszuschließen. Ein von Bismarck vorgelegter Entwurf, nach dem gegen Abgeordnete wegen „Ungebühr" die Ausschließung aus dem Reichstag für eine bestimmte Zeitdauer verhängt werden konnte, unter Umständen sogar verbunden mit dem Verlust der Wählbarkeit, wurde am 7. März 1879 von der Mehrheit der Parlamentarier als „Maulkorbgesetzentwurf 4 abgelehnt 201 . Anlaß zur Verschärfung der parlamentarischen Ordnungsmaßnahmen gab schließlich das Verhalten des Abgeordneten Liebknecht. Dieser war in der Sitzung zur Eröffnung des neuen Reichstagsgebäudes während der Ausbringung des traditionellen Kaiserhochs demonstrativ auf seinem Platz sitzengeblieben202. Die daraufhin vom Reichstag am 16. Februar 1895 beschlossene Änderung der Geschäftsordnung enthielt nunmehr die Befugnis des amtierenden Parlamentspräsidenten, im Falle einer „gröblichen Verletzung der Ordnung" den betreffenden Abgeordneten für den Rest der Sitzung ausschließen zu können. Zugleich sah die neue Fassung vor, daß während des Ausschlusses vorgenommene Abstimmungen über andere als Geschäftsordnungsfragen in der ersten Sitzung nach Ablauf der Ausschließung wiederholt werden müssen, sofern die Stimme des abwesenden Abgeordneten bei der Abstimmung den Ausschlag hätte geben können. In Preußen wurde die Möglichkeit des Abgeordnetenausschlusses für den Rest des Sitzungstages erstmalig durch die Einführung des § 64 in die Geschäftsordnung des Preußischen Abgeordnetenhauses am 6. Mai 1910 geschaffen. Erstmals angewendet wurde diese Bestimmung in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 9. Mai 1912 als der Abgeordnete Borchardt die Rede des Abgeordneten Schifferer durch mehrere Zwischenrufe erheblich störte 203 . Nach mehreren Unterlassungsaufforderungen des amtierenden Präsidenten, die keine weitere Beachtung fanden, wurde dem Abgeordneten Borchardt schließlich der Ausschluß von der Sitzung ausgesprochen. Aufgrund seiner endgültigen Weigerung, den Sitzungssaal zu verlassen, ließ ihn der amtierende Präsident nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung 199 Ebenda. zoo Vgl. Randorf, S. 15. 201 Gesetz, betreffend die Strafgewalt des Reichstages über seine Mitglieder, vom 12. Februar 1879, abgedruckt in den Sten. Ber. über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 55,4. Legislaturperiode, II. Session 1879, Anlagen, Aktenstück Nr. 15, S. 326 ff. 202 Sitzung des Reichstages vom 6.Dezember 1895, Sten. Ber. über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 138,9. Legislaturperiode, III. Session, Erster Band, S. 7 und 10. 203 Vgl. Sten. Ber. über die Verhandlungen des Preußischen Abgeordnetenhauses, 21. Legislaturperiode, V. Session 1912/13,5. Band, Sp. 5647 ff.
204
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
durch die Polizei aus dem Plenarsaal bringen 204 . Gleiches widerfuhr dem Abgeordneten Leinert, der in das Geschehen eingriff 205 . Beide Abgeordnete wurden später wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt vor dem Landgericht Berlin angeklagt und verurteilt. Die politisch instabilen Verhältnisse während der Weimarer Zeit spiegelten sich auch in den Debatten des Reichstags und der Länderparlamente wider, in denen es immer häufiger zu tumultartigen Szenen und organisierter Obstruktion kam 2 0 6 . Dieser Entwicklung versuchte man durch eine ständige Verschärfung der parlamentarischen Ordnungsgewalt Herr zu werden. Bereits zu Beginn der Weimarer Zeit wurden deshalb verschiedentlich Versuche unternommen, auch die Ausschließungsvorschriften zu verschärfen, vor allem bei einer Weigerung des betroffenen Abgeordneten, den Plenarsaal zu verlassen. Doch erst die Geschäftsordnung des Reichstages vom 12. Dezember 1922 führte zu einer tatsächlichen Verschärfung des Reglements. Sie enthielt die Befugnis des Präsidenten, ein Parlamentsmitglied wegen „gröblicher Verletzung der Ordnung" bis zu dreißig Sitzungstagen auszuschließen. Verließ der ausgeschlossene Abgeordnete trotz Aufforderung des Präsidenten nicht sofort den Sitzungssaal, so war der automatische Ausschluß von weiteren acht Sitzungstagen die Folge. Bei wiederholter Weigerung sah die Geschäftsordnung zudem einen automatischen Ausschluß von zwanzig Sitzungstagen vor 2 0 7 . Eine zusätzliche Verschärfung der Bestimmungen erfolgte mit der Änderung der Geschäftsordnung vom 11. 12. 1929, die eine Erhöhung des automatischen Ausschlusses von acht auf dreißig Sitzungstage festlegte und damit das zulässige Höchstmaß für einen Ausschluß auf sechzig Sitzungstage anhob. Eine vergleichbare Entwicklung - allerdings milderer Art - war in den Länderparlamenten zu verzeichnen, wo für den Fall der Widersetzlichkeit des Abgeordneten ebenfalls eine automatisch eintretende Verlängerung der Ausschließung angeordnet war. Diese betrug etwa in Hessen vier Sitzungstage, in Preußen, Bayern, Thüringen, Braunschweig und Anhalt acht Sitzungstage, in Sachsen drei Sitzungen, aber höchstens eine Woche, in Baden vierzehn Kalendertage und in Hamburg einem Monat 2 0 8 . Bei wiederholter Weigerung, den Saal zu verlassen, kam im allgemeinen eine nochmalige wesentliche Verschärfung der Strafe hinzu. Der Ausschluß verlängerte sich dabei nach den parlamentarischen Geschäftsordnungen von Bayern und Anhalt um weitere zwölf Sitzungstage auf insgesamt zwanzig Sitzungstage, in Hessen um weitere zehn auf vierzehn Sitzungstage und in Baden 204 Sten. Ber., Sp. 5650. 205 Sten. Ber., Sp. 5651. 206 Bracher, S. 336, 342 f. m.w.N. 207 § 91 GORT vom 12. 12. 1922. 208 Vgl. § 57 GO von Hessen vom 16. Juni 1926; § 58 GO von Preußen vom 24. November 1921; § 31 GO von Bayern aus dem Jahr 1926 (vom Landtagsamt ohne Datum herausgegeben); § 84 GO von Thüringen vom 13. Mai 1924; § 64 GO von Braunschweig vom 25. Januar 1927; § 51 GO von Anhalt vom 11. Mai 1920; § 50 IV GO von Sachsen vom 3. März 1921; § 76 a GO von Baden vom 19. November 1919; § 41 GO von Hamburg von 14. März 1924.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
205
konnte das Höchstmaß der Ausschließung sogar zweiundvierzig Kalendertage betragen, wurde also um weitere achtundzwanzig Kalendertage erhöht. In Braunschweig konnte der Ausschluß des Abgeordneten durch den Präsidenten im Einvernehmen mit dem Ältestenrat um bis zu zwölf weitere, mithin auf insgesamt zwanzig Sitzungstage verlängert werden. Die Geschäftsordnungen von Preußen und Thüringen ermöglichten die Ausschließung eines Mitglieds allein durch einen mit 3/4 Mehrheit gefaßten Beschluß des Ältestenrats auf maximal zwanzig Sitzungstage. Im Sächsischen Landtag schließlich konnte der Ausschluß auf die folgenden sechs Sitzungstage, höchstens jedoch auf zwei Wochen, erstreckt werden, sofern der Abgeordnete bei der wiederholten Aufforderung, den Saal zu verlassen, auf die geschäftsordnungsmäßige Folge hingewiesen wurde. Eine endgültige und nicht nur vorübergehende Ausschließung war von allen deutschen Ländern allein in Bremen vorgesehen. Nach § 46 der Geschäftsordnung des Bremer Parlaments konnte ein Mitglied, das sich beharrlich weigerte, die ihm obliegenden Pflichten zu erfüllen, mit einer Mehrheit von 3 / 4 der gesetzlichen Mitgliederzahl bzw. mit Einstimmigkeit bei Anwesenheit von weniger aber mindestens sechzig Abgeordneten für dauernd ausgeschlossen werden 209 . Im Schrifttum ist die Zulässigkeit des Ausschlusses eines Abgeordneten von der weiteren Teilnahme an der Plenarsitzung seit jeher umstritten gewesen, insbesondere dann, wenn sie auf der Grundlage von Geschäftsordnungsbestimmungen erfolgte. Dabei kreiste der Meinungsstreit von Beginn an im wesentlichen um die Frage, ob die Ausschließung einen Verstoß gegen die Verfassung, die Statusrechte eines Abgeordneten oder gegen § 106 RStGB darstellt 210 . Im Zusammenhang mit dem erwähnten Zwischenfall im preußischen Abgeordnetenhaus hatte allerdings das Reichsgericht den zeitweisen Ausschluß von der Teilnahme an der Plenarsitzung unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erklärt, ihn sogar im Interesse der Aufrechterhaltung der parlamentarischen Ordnung als unentbehrlich und kraft Verfassung als geradezu geboten bewertet 211 . Damit verneinte es einen Verstoß gegen die Verfassung und stellte zudem fest, daß die Ausschließung das Abgeordnetenmandat in keiner Weise verletze. Der überwiegende Teil der Rechtslehre Schloß sich dieser Beurteilung des Reichsgerichts an. Außerdem sahen sie in der Ausschließung und Entfernung des Abgeordneten aus dem Haus eine Notwehrhandlung zur Wahrung der ordnungsgemäßen Beratung eines Gegenstands imPlenum. Die Maßnahme der Ausschließung könne deshalb infolge dieser Rechtfertigung auch keinen Verstoß gegen die §§ 105 und 106 RStGB darstellen 212. 209
Geschäftsordnung der Bremer Bürgerschaft aus dem Jahre 1922. Vgl. hierzu die Darstellung bei von Brentano, S. 54 ff. ™ RGSt 47, 270 (274). 2 2 i Vgl. von Bar, in: DR 1912, Sp. 301, 303 f.; Goldschmidt, in: JW 1912, 562 (564); Palen, S. 52ff.; Heyden, S. 42ff.; Hamm, in: DJZ 1912, Sp. 649ff.; a.A. Werthauer, in: JW 1912, 834 ff. und Bendix, in: JW 1912, 665 (666), die wegen der fehlenden Rechtsgrundlage der Ausschließung in der Verfassung einen Verstoß gegen die genannten Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuchs bejahten. 210
206
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
Trotz dieser breiten Rechtsansicht in Literatur und höchstrichterlicher Rechtsprechung wurde die Ausschließung von einem anderen, wenngleich geringeren Teil des Schrifttums mit erheblicher Kritik bedacht. Erst in der Weimarer Republik nahmen die Stimmen, die einen Abgeordnetenausschluß für unzulässig hielten, ab. Herrschend war indessen die Ansicht, daß das Recht des Abgeordneten auf Teilnahme an den Sitzungen des Parlaments dort seine Schranke finde, wo die Funktionsfähigkeit des Plenums in Frage gestellt werde. Demzufolge müsse die Rechtsstellung des Abgeordneten grundsätzlich hinter dem Gesamtinteresse des Parlaments zurücktreten, so daß er seine Rechte gleichsam nur unter der auflösenden Bedingung eigenen ordnungsgemäßen Verhaltens ausüben könne 213 . Widersetze er sich zudem der Saalverweisung des Parlamentspräsidenten, so begehe er Hausfriedensbruch und dürfe gegebenenfalls auch gewaltsam entfernt werden 214 . Die breite Akzeptanz der wenigstens zeitweiligen Ausschließung eines Mitglieds von der Verhandlung zeigte sich während der Weimarer Republik nicht nur im Schrifttum, sondern auch in vielen parlamentarischen Geschäftsordnungen, die entsprechende Bestimmungen enthielten 215 .
(2) Der Ausschluß für den Rest der Sitzung Die Maßnahme der Abgeordnetenausschließung ist in den meisten Ländern in den parlamentarischen Geschäftsordnungen geregelt, im Saarland hat sie dagegen eine gesetzliche Grundlage gefunden. Von der Möglichkeit, den Ausschluß des Abgeordneten auf Verfassungsebene zu regeln, haben lediglich Bremen und Hamburg Gebrauch gemacht 216 . Die Mehrzahl der Parlamente verlangt für den Ausschluß eines Abgeordneten durch den amtierenden Präsidenten eine „gröbliche Verletzung der Ordnung" 217 . Teilweise ist an diese Voraussetzung der ausdrückliche Hinweis geknüpft, daß hierfür kein vorhergehender Ordnungsruf erforderlich ist. Eine etwas abweichende Formulierung enthält die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags, wenn sie von einer „gröblichen Verletzung der Würde oder der Ordnung des Hauses" spricht 218 . Das Gesetz über den Landtag des Saarlandes verlangt indessen
213 Vgl. Vogler, S. 30f.; Sperling, S. 46ff.; Mühlbauer, S. 57 ff.; von Brentano, S. 54ff.; Gentemann, S. 24 ff. 214 Mühlbauer, S. 62. 215 Siehe oben S. 204 f., vgl. zudem Zschuke, Die Geschäftsordnungen der deutschen Parlamente, 1928. 216 Art. 85 II LV-Br und Art. 13 ΙΠ LV-Ha. Die Berliner Landesverfassung enthält in Art. 45 Satz 2 nur den generellen Hinweis, daß „die Rechte der einzelnen Abgeordneten ( . . . ) nur insoweit beschränkt werden (können), wie es für die gemeinschaftliche Ausübung der Mitgliedschaft im Parlament notwendig ist". 217 § 78 I GO-Be; § 6711 GOLT-NRW; § 80 II GOLT-SA; § 38 II GOLT-RP; § 49 GOBüHa; § 68 I 1 GOLT-SH; § 88 II GOLT-Nds; § 37 II 1 GOLT-Th; § 55 I 1 GOLT-MV; § 35 I 1 GOLT-Bg. 218 § 77 11 GOLT-He.
. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
207
für einen Ausschluß, daß ein Abgeordneter gegen die Ordnungsbestimmungen verstößt und sich zudem nicht den Anordnungen des Präsidenten fügt 2 1 9 . In BadenWürttemberg und Sachsen kommt hingegen ein Ausschluß nur in Betracht, wenn die anderen Ordnungsmaßnahmen „wegen der Schwere der Ordnungsverletzung" nicht mehr ausreichen 220. Eine Abstufung vergleichbarer Art findet sich in Bayern. Hier ist der Ausschluß nur zulässig, wenn sich der Abgeordnete eines „ganz besonders schweren Verstoßes" schuldig gemacht hat und der Präsident eine Wortentziehung als nicht ausreichend betrachtet 221. Einen Sonderfall bildet schließlich der Stadtstaat Bremen. Nach § 48 Satz 1 der Geschäftsordnung der Bremer Bürgerschaft darf ein Mitglied nur bei grober Ungebühr oder wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung gegebenen Vorschriften von der Sitzung ausgeschlossen werden. Bemerkenswert und bundesweit einzigartig an dieser Regelung ist der Umstand, daß der Ausschluß nur durch Beschluß der Bürgerschaft und nicht durch Anordnung des Parlamentspräsidenten erfolgen kann. Infolge der Entziehung der Abgeordnetenausschließung aus dem Kompetenzbereich des Präsidenten, der zu einer gerechten und unparteiischen Amtsführung verpflichtet ist, und der Übertragung auf das Parlament steht zu befürchten, daß parteitaktische Erwägungen der Mehrheitsfraktionen in die Entscheidung einfließen. Auf diese Weise wird der Mehrheit im Parlament beispielsweise die Möglichkeit eröffnet, den Ausschluß eines Parteifreundes vor wichtigen Abstimmungen zu verhindern. Einige Geschäftsordnungen kennen im übrigen neben der Ausschließung wegen gröblicher Störung der parlamentarischen Ordnung auch die Möglichkeit des Ausschlusses nach wiederholtem Ordnungsruf, auf die bereits oben schon eingegangen wurde 222 . Bei dem in den meisten Landtagen anzutreffenden Tatbestand der „gröblichen Verletzung der Ordnung" handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff 223. Im Hinblick auf den Begriff der parlamentarischen Ordnung kann dabei auf die Ausführungen an früherer Stelle verwiesen werden 224 . Die Formulierung „gröbliche Verletzung" macht deutlich, daß der Tatbestand nur bei Ordnungsverletzungen erfüllt ist, die nach ihrem Schweregrad erheblich über dem Durchschnitt lie21
9 § 7211 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 220 § 9211 GOLT-BW; § 9411 GOLT-Ss.
221 § 120 Satz 1 GOLT-By. 222 Siehe dazu S. 202. 223 Vgl. Achterberg, S. 658. Mitunter ist die Kritik geäußert worden, der Begriff „gröbliche Ordnungsverletzung" sei zu ungenau. Außerdem berge der weite Rahmen, der dem amtierenden Präsidenten bei seiner Entscheidung gezogen sei, die Gefahr der Mißachtung von Rechten der Abgeordneten, vgl. Abmeier, S. 238. Dem wird zu Recht entgegengehalten, daß sich der unbestimmte Rechtsbegriff der gröblichen Ordnungsverletzung allein schon durch die parlamentarische Praxis mit Inhalt gefüllt habe. Im übrigen sei der Entscheidungsfreiheit des amtierenden Präsidenten durch die Einspruchsmöglichkeit des betroffenen Abgeordneten eine Grenze gesetzt, vgl. Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 110. 224 Vgl.S. 175 ff.
208
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
gen. Der Abgeordnete Roeren nannte in diesem Zusammenhang bei der Begründung seines Antrags zur Einführung des § 60 GORT solche Verhaltensweisen, „welche den ersten Anforderungen des Anstands widerstreiten und beispielsweise in offenen Beschimpfungen oder Verleumdungen anderer Mitglieder des Reichstages oder anderer dritter Personen" bestehen225. In Anlehnung an die Erklärung des Reichstagspräsidenten Lobe anläßlich des Ausschlusses eines Abgeordneten in der Sitzung des Reichstags vom 22. 11. 1923 226 wird eine „gröbliche Verletzung der Ordnung" regelmäßig anzunehmen sein bei Behinderung eines Redners durch fortgesetzte Unterbrechungen seiner Rede, bei Weigerung des Redners, die Rednertribüne nach der Wortentziehung zu verlassen, bei Tätlichkeiten, bei groben Beschimpfungen des Präsidenten oder der Abgeordneten oder aber bei groben Beleidigungen gegenüber Bundesorganen 227. Hierbei kann es sich jedoch angesichts der Vielfalt denkbarer grober Ordnungsverstöße keineswegs um eine abschließende Aufzählung handeln 228 . Adressat der Ausschließungsmaßnahme ist nicht nur der Redner, sondern jedes sich ordnungswidrig verhaltende Parlamentsmitglied, soweit es als Störer identifizierbar ist 2 2 9 . Kann der amtierende Präsident den störenden Abgeordneten nicht ausfindig machen, so muß er von der Ausschließung Abstand nehmen 230 . Insbesondere ist es nicht zulässig, eine Gruppe von Parlamentariern, in der der Präsident auch den Störer vermutet, in ihrer Gesamtheit von der weiteren Teilnahme an der Vollversammlung auszuschließen231. Die Ordnungs Verletzung muß sich ferner während der Vollversammlung des Parlaments im Plenarsaal oder in unmittelbarer Nähe des Sitzungssaals zugetragen haben 232 . Zum Plenarsaal gehört dabei nicht nur der für die Abgeordneten bestimmte Bereich. Vielmehr werden auch die Tribünen für Zuschauer und Presse sowie vorhandene Gäste-Logen mit erfaßt 233 .
225 Sitzung des Reichstags vom 16.2. 1895, Sten. Ber. Bd. 139, S. 935 D. 226 Sten. Ber. Bd. 361, S. 12179 C und D. 227 Vgl. auch Ritzel/Bücker, § 38, Anm. 11 a, S. 1. 228 Kleinschnittger, S. 95; Böttcher, S. 106; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 102; Troßmann, § 42, Rn. 3. 229 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 34. 230 Ritzel/Bücker, § 38, Anm. 11 c, S. 2. 231 Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 102. 232 Troßmann, § 42, Rn. 7f.; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 33. Kritisch zu dieser Ausdehnung Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 103, der es für unwahrscheinlich hält, daß der Präsident Ordnungsverletzungen außerhalb des Plenarsaales durch eigene Wahrnehmung feststellen kann. 233 Vgl. § 35 I 3 GOLT-Bg: „Ein solcher Ausschluß schließt das Verbot des Aufenthaltes im gesamten Sitzungssaal, einschließlich des Zuschauerraumes und der Pressetribüne, ein." Vgl. hierzu auch den Vorfall während der Sitzung des Bayerischen Landtags am 13. 5. 1987, bei dem zwei Mitglieder der Fraktion der Grünen auf der Pressetribüne ein Transparent entrollten und somit nach Ansicht des Präsidenten Dr. Heubl gegen die Ordnung des Parlaments verstießen, PlPr., 11. WP., 23. Sitzung, S. 1408 f.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
209
Die Ausschließung steht - sofern eine gröbliche Verletzung der parlamentarischen Ordnung vorliegt - in nahezu allen Landtagen im pflichtgemäßen Ermessen des Präsidenten, die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags enthält eine „SollVorschrift" 234 . Bei der Entscheidung, ob auf die Ordnungsstörung mit einer Ausschließung reagiert werden soll, kommt der Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine wesentliche Bedeutung zu 2 3 5 . Die sorgfältige Berücksichtigung dieses Grundsatzes durch den Landtagspräsidenten ist vor allem dann unerläßlich, wenn der Ausschluß wie in Baden-Württemberg und Sachsen an die Voraussetzung geknüpft ist, daß eine andere Ordnungsmaßnahme wegen der Schwere der Ordnungsverletzung nicht ausreicht. Die Ausschließung darf in diesen wie auch in anderen Fällen nur als ultima ratio zur Anwendung kommen 236 . Ähnlich wie bei den anderen Ordnungsmitteln macht der Ausschluß nur dann Sinn, wenn er im unmittelbaren Anschluß an die gröbliche Verletzung der Ordnung durch den Landtagspräsidenten verhängt wird. Allein eine „Sofortmaßnahme" kann die verletzte Ordnung am ehesten wiederherstellen und eine Wiederholung der Verletzung vermeiden 237 . Im Hinblick auf die mit dieser Ordnungsmaßnahme für den betroffenen Abgeordneten verbundenen Folgen hat der Landtagspräsident allerdings die Möglichkeit, sich die abschließende Prüfung eines möglicherweise ordnungswidrigen Verhaltens bis zur Verfügbarkeit der stenographischen Aufzeichnungen vorzubehalten 238. Eine nachträgliche Erteilung dieser Disziplinarmaßnahme nach dem Schluß der Plenarsitzung, etwa weil dem Präsidenten die Verfehlung entgangen ist oder er die von ihm getroffene Ordnungsmaßnahme nunmehr für zu mild erachtet, ist dagegen unzulässig239. Auch hier wird man kein Bedürfnis für eine derartige Befugnis des Landtagspräsidenten feststellen können. Hat nämlich der Präsident das Fehlverhalten eines Abgeordneten nicht einmal bemerkt oder hielt er ein milderes Mittel, ζ. B. einen Ordnungsruf für ausreichend, so wird eine gröbliche Ordnungsverletzung als Voraussetzung für den Sitzungsausschluß regelmäßig fehlen 240 . Auch wenn die Ausschließungsmaßnahme nur als „Sofortmaßnahme" Wirkung entfalten kann, ist es gleichwohl zulässig, wenn der Landtagspräsident diese Maßnahme nach Wiedereröffnung einer unterbrochenen Sitzung verhängt 241 . Der Ausschluß wird mit der Verkündung wirksam 242 und bezieht sich grundsätzlich auf den Rest der Sitzung. Der betroffene Abgeordnete hat daraufhin unverzüg234 § 77 I 1 GOLT-He. 235 Lemke, Parlamentspraxis, § 59, Anm. 5; Harth, Ausschluß, in: ZRP 1984, 313 (316). 236 Vgl. Achterberg, S. 658. 237 Lemke, Parlamentspraxis, § 59, Anm. 4. 238 Ebenda. 239 Ritzel/Bücker, § 38, Anm. I 2 e, S. 3; ebenso Kleinschnittger, S. 98; Lemke, Parlamentspraxis, § 59, Anm. 5; Troßmann, § 9 Rn. 5 ; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 105; a.A. Nelamischkies, S. 100. 240 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 36. 241 Troßmann, § 47, Rn. 7. 242 Böttcher, S. 106; Achterberg, S. 659. 14 Köhler
210
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
lieh, d. h. ohne schuldhaftes Zögern den Sitzungssaal zu verlassen 243, anderenfalls erfüllt er den Tatbestand des Hausfriedensbruchs 244. Gleichzeitig verursacht der Abgeordnete damit eine Störung der öffentlichen Sicherheit, so daß der amtierende Präsident aufgrund seiner Polizeigewalt mit polizeilichen Mitteln gegen ihn einschreiten kann 2 4 5 . Eine schuldhafte Verzögerung kann beispielsweise dann angenommen werden, wenn sich aus dem Verhalten des ausgewiesenen Abgeordneten unmißverständlich ergibt, daß er der Entscheidung des Präsidenten nicht Folge leisten w i l l 2 4 6 . In diesem Fall wird die Sitzung vom Präsidenten unterbrochen oder aufgehoben 247. In Bayern beruft der Landtagspräsident nach § 120 Satz 2 iVm. § 118 ΠΙ GOLT-By sofort den Ältestenrat ein, der über etwaige weitere Maßnahmen berät. Die parlamentarischen Geschäftsordnungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hingegen ermächtigen den amtierenden Präsidenten ausdrücklich, das sich widersetzende Parlamentsmitglied aus dem Sitzungssaal entfernen zu lassen 248 . Hat sich der Präsident über das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Ausschließung oder über die Person des Störers geirrt, so kann er den Sitzungsausschluß zurücknehmen. Die Rücknahme ist allerdings nur bis zur Entscheidung über einen Einspruch des Abgeordneten bzw. bis zum Ablauf der Einspruchsfrist möglich 249 . (3) Der Ausschluß für mehrere Sitzungstage Während die Hamburger Bürgerschaft nur den Ausschluß von der Sitzung kennt, in der sich die gröbliche Ordnungsverletzung ereignet hat 2 5 0 , finden sich in allen 243 § 78 I 2 GO-Be; § 92 I 2 GOLT-BW; § 77 I 2 GOLT-He; § 120 Satz 2 iVm. § 118 II 2 GOLT-By; § 67 12 GOLT-NRW; § 9412 GOLT-Ss; § 80 II 2 GOLT-SA; § 721 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 38 II 2 GOLT-RP; § 68 I 2 GOLT-SH; § 88 II 2 GOLT-Nds; § 37 II 2 GOLT-Th; § 5512 GOLT-MV; § 35 12 GOLT-Bg. 244 RGSt 47,277; Troßmann, § 42, Rn. 16 f.; Achterberg, S. 659. 245 Vgl. Ritzel/Bücker, § 38, Anm. II 2 b, S. 4. 246 Ritzel /Bücker, § 38, Anm. II 1, S. 3. 247 § 92 I 3 GOLT-BW; § 77 I 3 GOLT-He; § 67 I 3 GOLT-NRW; § 94 I 3 GOLT-Ss; § 80 III 1 GOLT-SA; § 72 I 3 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 38 III 1 GOLT-RP; § 68 I 3 GOLT-SH; § 88 II 1 GOLT-Nds; § 37 III 1 GOLT-Th; § 55 I 3 GOLT-MV; § 35 I 4 GOLT-Bg. Nach § 48 Satz 3 GOBü-Br ist der Landtagspräsident ermächtigt, die „erforderlichen Maßnahmen" zu treffen. 248 § 88 III 2 GOLT-Nds; § 80 III 2 GOLT-SA. 249 Vgl. Franke, Ordnungsmaßnahme, S. 105 f.; Ritzel/Bücker, § 38, Anm. 12 c, S. 2. Danach fällt die Angelegenheit in den Kompetenzbereich des Plenums als übergeordnete Instanz, vgl. S. 216. 250 Ein mehrtägiger Sitzungsausschluß ist ebenfalls in den parlamentarischen Geschäftsordnungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nicht explizit vorgesehen. Verursacht jedoch ein Abgeordneter durch ordnungswidriges Verhalten eine erhebliche Störung der Arbeiten des Landtags, so kann ihm der Präsident die Teilnahme an Sitzungen des Plenums verbieten, soweit dies erforderlich ist, um weitere Störungen zu verhüten, vgl. § 88 IV 1 GOLT-
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
211
anderen Geschäftsordnungen Vorschriften, die auch einen Ausschluß für mehrere Sitzungstage ermöglichen. Dies bedeutet gleichsam eine Verschärfung gegenüber der Ausschließung für den Rest der Sitzung. Voraussetzung für eine solche weitergehende Ordnungsmaßnahme ist, daß der von der Ausschließung für den Rest der laufenden Sitzung betroffene Abgeordnete der Aufforderung des Präsidenten, den Sitzungssaal zu verlassen, nicht nachkommt. Lediglich in Bremen ist schon beim Grundtatbestand der Ausschließung infolge gröblicher Ordnungsverletzung ein Ausschluß von mehreren, höchstens jedoch drei Sitzungen durch entsprechenden Beschluß der Bürgerschaft zulässig 251 . Aufgrund dieser Weigerung ergeht eine automatische, kraft positiver Vorschrift in den parlamentarischen Geschäftsordnungen angeordnete Ausschließung für mehrere Tage gegen den sich widersetzenden Abgeordneten, auf deren Erteilung der Landtagspräsident in der Regel keinen Einfluß nehmen kann 252 . Nur in Brandenburg steht die Ausschließung für weitere Sitzungstage ausnahmsweise im pflichtgemäßen Ermessen des Präsidenten 253. Die Dauer des Ausschlusses ist in den Länderparlamenten unterschiedlich ausgestaltet. Die kürzeste Frist findet sich im Saarland, wo dem betroffenen Abgeordneten lediglich die Teilnahme an der nächstfolgenden Sitzung untersagt ist 2 5 4 . In Berlin umfaßt der Ausschluß zwei weitere Sitzungstage, während in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg jeweils drei vorgesehen sind 255 . In Hessen beträgt die Ausschlußdauer vier Plenarsitzungen und in Thüringen sowie Rheinland-Pfalz sind schließlich sechs Sitzungstage geschäftsordnungsmäßig angeordnet 256. Eine zusätzliche Verschärfung ist in Hessen und Brandenburg für den Fall der wiederholten Weigerung, den Saal zu verlassen, möglich. Der Landtagspräsident kann dann einen Ausschluß für bis zu zehn Sitzungstage in Folge festlegen 257. Die Entscheidung steht in seinem freien Ermessen und wird von ihm bei Wiedereröffnung oder bei Beginn der nächsten Sitzung festgestellt, je nachdem, ob der Präsident die Plenarsitzung nach der erstmaligen Weigerung des ausgewiesenen Abgeordneten unterbrochen oder aufgehoben hat 2 5 8 . Ein Sonderfall der Ausschließung aufgrund vorheriger Weigerung ist in Bayern vorzufinden 259. Hier erfolgt die AusNds; § 80 IV 1 GOLT-SA. Die Formulierung dieser Vorschrift legt die Vermutung nahe, daß hierunter auch ein Ausschluß für mehrere Sitzungstage zu fassen sein dürfte. 251 § 48 Satz 1 GOBü-Br. 252 Der Automatismus der Ausschließung ist in den Vorschriften mit der Wortwahl „ohne weiteres" gekennzeichnet. 253 § 35 15 GOLT-Bg. 254 § 7214 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 255 § 78 I 3 GO-Be; § 92 14 GOLT-BW; § 67 14 GOLT-NRW; § 9414 GOLT-Ss; § 68 I 5 GOLT-SH; § 55 I 3 GOLT-MV; § 35 15 GOLT-Bg. 256 257 258 259 14*
§ 77 14 GOLT-He; § 37 III 2 GOLT-Th; § 38 III 2 GOLT-RP. § 77 II GOLT-He; § 35 II GOLT-Bg. Vgl. z. B. § 68 I 5 GOLT-SH; § 55 I 3 GOLT-MV; § 9214 GOLT-BW. § 120 Satz 2 iVm. § 118 IV 1,2 GOLT-By.
212
5. Abschnitt: Die Ordnungsgewalt des Landtagspräsidenten
Schließung weder automatisch noch durch Entscheidung des Präsidenten. Zuständiges Organ ist vielmehr das Parlament, das den betroffenen Abgeordneten auf Empfehlung des Ältestenrats ohne Beratung von der Teilnahme an höchstens zehn weiteren Sitzungen der Vollversammlung ausschließen kann. Der Beschluß bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Der sich in den meisten Landtagen automatisch vollziehende Ausschluß für mehrere Sitzungstage ist insoweit verfassungsrechtlich zweifelhaft, als dem Landtagspräsidenten die Möglichkeit genommen wird, seine Entscheidung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls und unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, dem - wie festgestellt - beim Abgeordnetenausschluß eine besondere Bedeutung zukommt, zu treffen 260 . Eine Ausschlußregelung nach dem Beispiel der Geschäftsordnung des Brandenburgischen Landtags, die dem Präsidenten für die mehrtägige Ausschließung einen Ermessenund Entscheidungsspielraum eröffnet, begegnet indessen keinen verfassungsrechtlichen Bedenken; ihr kommt insoweit eine Vorbildfunktion zu. Eine weitere Verschärfung ist in einigen Geschäftsordnungen ferner für den Fall des erneuten Ausschlusses eines Abgeordneten vorgesehen, sofern sich dieser innerhalb derselben Wahlperiode des Landtags bereits einmal den Ausschluß von der Sitzung zugezogen hat 2 6 1 . Häufig überlassen dabei die parlamentarischen Geschäftsordnungen die Entscheidung über einen mehrtägigen Ausschluß auf dieser Grundlage nicht allein dem Landtagspräsidenten, sondern verlangen die beratende Mitwirkung oder eine entsprechende Empfehlung anderer parlamentarischer Gremien. So kann etwa der Präsident in Baden-Württemberg und Sachsen den Ausschluß für höchstens zehn Sitzungstage nur im Einvernehmen mit dem Präsidium vornehmen 262 . In Berlin indessen kann das Abgeordnetenhaus selbst auf Empfehlung des Ältestenrats den betroffenen Abgeordneten von der Teilnahme an höchstens zehn Sitzungstagen ausschließen263. Der Beschluß wird ohne vorherige Beratung gefaßt und bedarf der einfachen Mehrheit. In Rheinland-Pfalz und Thüringen ist dagegen der Ältestenrat das entscheidende Organ. Dieses kann das betroffene Parlamentsmitglied bei wiederholtem Ausschluß durch einen mit Dreiviertelmehrheit gefaßten Beschluß bis zu zwanzig Sitzungstagen ausschließen264. Die Landtagsgeschäftsordnungen von Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz sehen überdies vor, daß eine derartige Verschärfung des Ausschlusses neben dem Tatbestand der Wiederholung auch für den Tatbestand der Ordnungsverletzung ,4m besonders schweren Fall" in Betracht kommt. Lediglich die letzt260 Bedenken gleicher Art finden sich auch bei Härth, Ausschluß, in: ZRP 1984, 313 (316) und bei Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 113. 261 Vgl. den Wortlaut von § 92 II 2 GOLT-BW; § 94 II 2 GOLT-Ss. 262 § 92 II 1 GOLT-BW; § 94 II 1 GOLT-Ss. 263 § 78 II GO-Be. 264 § 38 III 3 GOLT-RP; § 37 III 3 GOLT-Th.
II. Die Ordnungsgewalt als Disziplinargewalt
213
genannte Konstellation bietet im Saarland Anlaß für einen mehrtägigen Ausschluß. In besonders schweren Fällen kann hier also das Präsidium durch einen entsprechenden Mehrheitsbeschluß den betroffenen Abgeordneten von der Teilnahme an höchstens 10 aufeinanderfolgenden Landtagssitzungen ausschließen265. Für den mehrtägigen Ausschluß gilt im übrigen grundsätzlich, daß der Sitzungstag, an dem die Ausschließung erfolgt ist, in die Zahl der Sitzungstage eingerechnet wird 2 6 6 . Der Präsident gibt vor dem Ende der Plenarsitzung bekannt, für wie viele Sitzungstage der Abgeordnete ausgeschlossen ist 2 6 7 . Der Ausschluß eines Abgeordneten von der Teilnahme an den weiteren Vollversammlungen des Landtags wird von mehreren Nebenfolgen begleitet. So ruht beispielsweise für den Ausgeschlossenen während der Ausschlußfrist die Berechtigung, an Ausschußsitzungen sowie mitunter auch an sonstigen Gremien teilzunehmen 268 . Dieses Verbot ist dahingehend zu verstehen, daß die ihm aufgrund seines Abgeordnetenstatus zustehenden Mitwirkungsrechte in den Ausschüssen und Gremien, denen er als Mitglied angehört, für die Dauer des Ausschlusses ruhen. Gleichwohl ist es dem betroffenen Parlamentarier gestattet, nicht in seiner Eigenschaft als Mitglied eines Ausschusses, sondern lediglich als Zuhörer an den jeweiligen Sitzungen teilzunehmen, sofern es sich dabei um öffentliche Informationssitzungen handelt 269 . Ebensowenig erstreckt sich das Verbot auf den Fall, daß der ausgeschlossene Abgeordnete als Sachverständiger hinzugezogen wird 2 7 0 . Ausgeschlossenen Abgeordneten ist es weiterhin verwehrt, während der Ausschlußfrist Anträge zu stellen oder diese zu unterstützen 271. Dies ist selbst dann nicht möglich, wenn der Antrag nur von einer Fraktion gestellt werden kann und diese durch den Ausschluß von Abgeordneten unter die Fraktionsmindeststärke abgesunken ist 2 7 2 . Überdies ist es im allgemeinen nicht zulässig, einem ausgeschlossenen Parlamentsmitglied Urlaub zu gewähren 273. Auch in finanzieller Hinsicht macht sich der Ausschluß bemerkbar. Da sich ausgeschlossene Abgeordnete nicht wirksam in die Anwesenheitslisten eintragen können 274 , haben sie in der Regel für den Zeitraum des 265
§ 72 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 3 Vgl. etwa VG Karlsruhe, DVB1. 1972, 351; OVG Berlin, DVB1. 1952, 763; OVG Hamburg, MDR 1957, 188; HessVGH, DVB1. 1979, 925; OVG Münster, DVB1. 1968, 157. 14 BVerwGE 35, 103(106). •5 BGHZ 33, 230 (231 f.); BGH, DVB1. 1968, 145 f. 16 Kortmann, in: DVB1. 1972, 772. 17 Bethge, Die Verwaltung, 1977, 315 (319). ι» So Ronellenfitsch, in: VwArchiv, Bd. 73 (1982), S. 465 (473). 19 Siehe auch Ronellenfitsch, in: VwArchiv Bd. 73 (1982), S. 465 (472). 20 Vgl. Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 3, S. 2; Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (36); Knemeyer, in: DÖV 1970, 596 (599); ders. in: DÖV 1971, 303 (304). 21 So im Ergebnis auch Achterberg, S. 652; Franke, S. 6; Stern II, § 26 III 7, S. 85; Leinius, in: NJW 1973, 448 (449); Knemeyer, in: VB1BW. 1982, 249 (252); Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (36); David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Braun, Art. 32 LVBW, Rn. 7; Feuchte, Art. 32 LV-BW, Rn. 11; Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 3, S. 2; Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 3; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 sowie Rothaug, S. 60, der den öffentlich-rechtlichen Charakter des präsidialen Hausrechts allerdings - unter Zugrundelegung der Subjektstheorie - dem Art. 40 II 1 GG als Satz des öffentlichen Rechts entnimmt.
238
. Abschnitt: D
u s e t des Landtagspräsidenten
Ziehungen in Betracht sowie bei anderen Vorfällen, die in keinem Zusammenhang mit der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten stehen (etwa der schlafende Obdachlose). Solange allerdings die Funktionsfähigkeit des Parlaments betroffen ist, wird der bürgerlichrechtliche Besitz-(Eigentums-)Schutz öffentlichrechtlich überlagert 22.
IL Der Umfang und Anwendungsbereich des Hausrechts Das Hausrecht steht dem Landtagspräsidenten höchstpersönlich zu. Demzufolge können hausrechtliche Maßnahmen des Präsidenten nicht Gegenstand einer parlamentarischen Auseinandersetzung sein oder gar vom Plenum aufgehoben werden 23 . Der geringe Einfluß des Landtags auf die Anwendung des Hausrechts bedeutet im Umkehrschluß aber zugleich eine Stärkung der Autorität des Parlamentspräsidenten und der Unabhängigkeit der präsidialen Amtsführung in diesem Bereich. Der räumliche Geltungsbereich des Hausrechts ist in den Länderverfassungen mit dem Begriff „Landtagsgebäude" umrissen. Im Interesse der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Landtags wird dessen Verständnis weit gefaßt. Er umschließt nicht nur jeden Raum, in dem das Parlament tagt, sondern auch alle Gebäude, Gebäudeteile und letztlich Grundstücke, in oder auf denen sich die Arbeit des Landtags, seiner Ausschüsse und sonstigen Unterorgane sowie der Landtagsverwaltung gewöhnlich abspielt24. Ausgenommen hiervon sind lediglich solche Gebäude oder Räume, die von Abgeordneten oder Fraktionen eigenmächtig - und sei es auch für ihre parlamentarische Tätigkeit - angemietet werden 25. Fraglich ist, ob sich das Hausrecht des Präsidenten auch auf die von den Fraktionen des Landtags genutzten Räumlichkeiten erstreckt, oder ob diesen ein eigenes Hausrecht an ihren Geschäftsräumen zusteht. Unabhängig von dem Streit über die Rechtsnatur von parlamentarischen Fraktionen 26 spricht vor allem deren unbestritten eigenstän22 Vgl. dazu Ipsen/Koch, in: JuS 1992, 809 ff. und Schwerdtfeger, Rn. 388 ff. sowie BayObLG, DÖV 1980, 728 ff. Einen tendenziell ähnlichen Weg geht in diesem Zusammenhang Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 10 und 12, der auf den „Ort" der Maßnahme abstellt: Erfolgt die Maßnahme außerhalb des Sitzungssaales, so soll sie privatrechtlicher Natur sein; ergeht sie indessen im Sitzungssaal, so soll sie dem öffentlichen Recht zuzuordnen sein. 23 Schick, S. 69; ders., in: DVP 1989,153 (158). 24 Vgl. Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 27; Kleinschnittger, S. 123; Klinke, S. 177; Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (36); Achterberg, S. 125; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 13; Schick, S. 69; Ritzel /Bücker, § 7, Anm. II c, S. 6; Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 25; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 15; Korte/Rebe, S. 218; Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 14; Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 1; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 19; a.A. Dach, in: BK, Art. 40, Rn. 101, der ein Hausrecht des Parlamentspräsidenten bei der auswärtigen Tagung von Ausschüssen verneint, weil dieses vom Hausrecht des jeweiligen Kongreß-Zentrum-Betreibers verdrängt werde. 25 Dach, in: BK, Art. 40, Rn. 100. 26 Siehe dazu etwa Achterberg, S. 274ff. und Hauenschild, S. 167 f.
II. Der Umfang und Anwendungsbereich des Hausrechts
239
diger Stellenwert von Verfassungsrang 27 für ein Selbstentscheidungsrecht über das Betreten und Verweilen von Personen in ihren Räumen28. Mit der Zuweisung der Fraktionsräume durch den Parlamentspräsidenten erhalten die Fraktionen den rechtmäßigen unmittelbaren Besitz im Rahmen eines Besitzmittlungsverhältnisses im Sinne des § 868 BGB 2 9 . Zugleich wird mit diesem Akt das eigenständige Hausrecht begründet. Der Gedanke an ein übergeordnetes Hausrecht des Parlamentspräsidenten für diesen Fall ist schon deshalb abwegig, weil lediglich ein gleichrangiges Hausrecht mehrerer Personen oder Institutionen anerkannt und juristisch zweckmäßig ist 3 0 . Ein eigenständiges Hausrecht der Fraktionen an den von ihnen genutzten Räumen schließt dabei allerdings nicht aus, daß der Parlamentspräsident aufgrund seiner Polizeigewalt, die sich auf sämtliche Räume im Parlamentsgebäude erstreckt, zumindest bei Gefahr im Verzuge berechtigt ist, bei von den Fraktionsräumen ausgehenden Störungen einzuschreiten 31. In personeller Hinsicht bezieht sich das Hausrecht auf alle Personen, die sich im dargestellten räumlichen Geltungsbereich aufhalten 32. Hierunter fallen insbesondere die Mitglieder der Landesregierung sowie deren Beauftragte und Zuhörer, da ihnen gegenüber Ordnungsmaßnahmen des Präsidenten auf der Grundlage parlamentarischer Geschäftsordnungsbestimmungen ins Leere laufen 33. Aber auch gegenüber Abgeordneten kommt das präsidiale Hausrecht zum Zuge, etwa dann, wenn ein Parlamentsmitglied nach Ausschluß von einer Sitzung den Sitzungssaal nicht freiwillig verläßt 34 . Kommt er der Aufforderung nicht nach, so begeht er Hausfriedensbruch 35. Mitunter begegnet man der Ansicht, das Hausrecht diene dem Schutz vor Beeinträchtigungen von außen, also vor Störungen von sog. „hausfremden" Personen, die nicht berechtigt sind, in den räumlichen Bereich einzutreten 27 Vgl. vor allem BVerfGE 1, 351 (359); 2, 143 (159f.); 2, 347 (365); 10, 4 (14f.); 20, 56 (104); 27,44 (51); 38,258 (273); 43,142 (147). 28 So auch Gottschalck, S. 39 f.; a.A. Lembke, Parlamentsrecht, § 5, Anm. 3, S. 14. 29 Vgl. Schmidt, in: DÖV 1990,102 (106). 30
Ebenda. Ein „übergeordnetes Hausrecht" ist allerdings vom Berliner Verfassungsgerichtshof angenommen worden, vgl. BerlVerfGH, in: NJW 1996, 2567 (2568). 31 Gottschalck, S. 40; Schmidt, in: DÖV 1990, 102 (107). Der Berliner Verfassungsgerichtshof (s. Fn. 30) hat demgegenüber auch die Ausübung des präsidiellen Hausrechts sowie die zwangsweise Durchsetzung eines Hausverbots in den einer Fraktion zugewiesenen Räumlichkeiten für rechtmäßig erklärt, sofern ein offensichtlicher Mißbrauch dieser Fraktionsräume (ζ. B. bei Überlassung der Räumlichkeiten an Dritte zur Durchführung eines Hungerstreiks) vorliege. 32 Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 15; Gundelach, S. 336f.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 7; Böttcher, S. 123; Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 28. 33 Achterberg, S. 652 und 659; Troßmann, § 45, Rn. 2.2.; Kleinschnittger, S. 121; Vogler, S. 48 f.; Versteyl, Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379 (380); Bücker, in: Schneider/Zeh, § 34, Rn. 5; David, Art. 18, Rn. 16. 34 Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 15; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Rothaug, S. 61; OVG Bremen, in: NJW 1990,931. 35 Siehe dazu unten S. 241.
240
. Abschnitt: D
u s e t des Landtagspräsidenten
oder darin zu bleiben 36 . Diese Auffassung führt zu dem Ergebnis, daß weder Abgeordnete - selbst nach einem Ausschluß - noch Regierungsvertreter als hausfremd einzuordnen sind; entsprechendes gilt für Besucher, die den Landtag widmungsgemäß betreten 37. Soll mithin das Hausrecht des Landtagspräsidenten nicht völlig inhaltsleer sein, indem es sich nur auf einen ganz geringen Personenkreis bezieht, so muß es richtigerweise auf alle Anwesenden gleichermaßen angewendet werden 38. Das Hausrecht umfaßt außerdem die Hausordnungsgewalt39. Im Rahmen seiner Hausordnungsgewalt regelt der Parlamentspräsident die Modalitäten des Zutritts zu den Gebäuden und Räumen des Landtags, insbesondere zum Plenarsaal und anderen Sitzungszimmern, legt die Besuchszeiten fest und entscheidet über die Benutzung von Bibliothek, Archiv und anderen Sondereinrichtungen sowie über die Bereitstellung von Räumen zu besonderen Veranstaltungen oder ihre Überlassung an Mieter oder Pächter, sofern letzteres nicht dem Präsidium oder Ältestenrat vorbehalten ist. Ebenso trifft der Präsident Anordnungen, die das äußere Verhalten in den genannten Räumlichkeiten betreffen. Eine Verpflichtung zum Erlaß einer Hausordnung besteht allerdings nicht 40 . So stellen etwa die parlamentarischen Geschäftsordnungen von Hessen und Sachsen-Anhalt die Hausordnung ausdrücklich in das Ermessen des Präsidenten 41. Entscheidet er sich jedoch für die Aufstellung hausrechtlicher Anordnungen, so ist er teilweise an die Mitwirkung anderer parlamentarischer Gremien gebunden: in Sachsen-Anhalt beispielsweise an die Mitwirkung des Ältestenrats - in Thüringen hat er sich mit demselben ins Benehmen zu setzen - und in Niedersachsen an die Unterstützung des Präsidiums 42.
I I I . Die Maßnahmen des Landtagspräsidenten aufgrund des Hausrechts und ihre strafrechtliche Beurteilung Das Hausrecht des Landtagspräsidenten dient der Wahrung und Erhaltung des Hausfriedens als Voraussetzung eines geordneten Betriebs, hat also primär präventiven Charakter 43. Wird der Hausfrieden in besonders nachhaltiger Weise beeinträchtigt, kann der Präsident auf der Grundlage seines Hausrechts ein Hausverbot aussprechen44. Hat der Präsident ein Hausverbot erlassen und wird es von dem 36 Vgl. ζ. B. Feuchte, Art. 32 LV-BW, Rn. 11. 37 Vgl. die Angaben bei Rothaug, S. 61 m.w.N. 38 Troßmann, § 7, Rn. 36; Böttcher, S. 123; Mühlbauer, S. 74; Rothaug, S. 61; Götz, § 6, Rn. 86. 39 Ritzel /Bücker, § 7, Anm. II b, S. 6. 40 Die Hamburger Bürgerschaft hat beispielsweise auf den Erlaß einer Hausordnung verzichtet, vgl. Gottschalck, S. 39; Schmidt, in: DÖV 1990, 102 (103). 41 § 44IV 2 GOLT-He; § 5 II 2 GOLT-SA. 42 § 10 II 2 GOLT-SA; § 41 4 GOLT-Th; § 8 Satz 2 GOLT-Nds. 43 VGH Mannheim, ES-VGH 25, 144.
III. Die Maßnahmen des Landtagspräsidenten
241
Betroffenen mißachtet, so erfüllt dieses Verhalten den Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäß § 1231 StGB 45 . Entsprechendes gilt für den Fall, daß ein Abgeordneter von der weiteren Teilnahme an der Plenarsitzung ausgeschlossen wird. Die Ausschlußerklärung des Präsidenten hat für den Abgeordneten zur Folge, daß er unverzüglich den Sitzungssaal zu verlassen hat 46 ; seine grundsätzliche Berechtigung zum Aufenthalt im Sitzungssaal hat er durch sein Verhalten verwirkt 47 . Kommt er der Aufforderung des Präsidenten nicht nach, so begeht er Hausfriedensbruch, da er „ohne Befugnis" in den dem Hausrecht des Präsidenten unterliegenden Räumlichkeiten verweilt. Der Landtagspräsident ist dabei „Berechtigter" im Sinne des § 123 StGB 48 . Gleichermaßen liegt ein Hausfriedensbruch vor, wenn ein auf Zeit ausgeschlossener Abgeordneter vor Ablauf der Ausschlußfrist den Sitzungssaal betritt. Da dem Ausgeschlossenen das Recht entzogen wurde, an den Verhandlungen des Parlaments teilzunehmen, besteht die unter Strafe gestellte Handlung in dieser Konstellation darin, daß er „widerrechtlich eindringt" 49 . Die Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhauses gestattet es dem Präsidenten im übrigen, einem Abgeordneten, der trotz des Ausschlusses versucht, in die Sitzungen des Hauses oder seiner Ausschüsse einzudringen, für die Dauer des Ausschlusses ein umfassendes Hausverbot aufzuerlegen, das sich auf alle Räumlichkeiten des Abgeordnetenhauses erstreckt 50. Von dem Hausverbot ausgenommen bleiben lediglich die Räume der Fraktion, der der Abgeordnete angehört. Die Frage, ob das Hausrecht dem Landtagspräsidenten auch eine Durchsetzungsbefugnis verleiht, wird unterschiedlich beantwortet. Mitunter wird vertreten, daß sich das Hausrecht in der Erteilung eines Hausverbots erschöpfe, da keinem Recht ohne weiteres seine zwangsweise Durchsetzung seitens des Berechtigten immanent sei 51 . Richtigerweise deckt jedoch das dem Präsidenten kraft Verfassung zur Ausübung überlassene Hausrecht auch Vollstreckungsanordnungen 52. Aller44 Korte/Rebe, S. 218; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 7; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LVNRW, Anm. 6.; Knemeyer, Hausrecht, in: DÖV 1970,596 (599). 45 BGH, NJW 1982,189; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 13; Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 3; Ritzel /Bücker, § 7, Anm. II c, S. 6; Schick, S. 69 f.; Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 23; Rothaug, S. 60; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 7; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Kleinschnittger, S. 127 f.; von Brentano, S. 60; Sperling, S. 49; Vogler, S. 33; Mühlbauer, S. 61. 46 Vgl. dazu die Ausführungen auf S. 209 f. 47 Vgl. Klinke, S. 179; Richter, S. 131. 48 Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6. 49 Vgl. Kleinschnittger, S. 128; Gentemann, S. 28; Klinke, S. 180 50 Vgl. § 79 GO-Be. 51 So Knemeyer, Hausrecht, in: DÖV 1970,596 (599) und Rothaug, S. 60. 52 Troßmann, § 7,Rn. 36; Kleinschnittger, S. 128; Klinke, S. 180f.; Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 7; Ritzel/Bücker, Vorbem. zu §§ 36-41, Anm. 3, S. 8; Achterberg, S. 652; Richter, S. 129f.; Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 23; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 3; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 13; Achterberg /Schulte, in: von Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 63; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 7. 16 Köhler
242
. Abschnitt: D
u s e t des Landtagspräsidenten
dings bestehen in einem solchen Fall naturgemäß Übergänge zwischen dem Hausrecht und der Polizeigewalt53. Zur Entfernung des betroffenen Abgeordneten kann sich der Landtagspräsident deshalb nicht nur der Ordnungskräfte des Hauses bedienen, sondern darüber hinaus auch die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen54, unbeschadet der Tatsache, daß der Präsident in den Räumlichkeiten des Landtags die Polizeigewalt ausübt. Auf wessen Hilfe er in der konkreten Situation zurückgreift, liegt in seinem freien Ermessen. Der allgemeinen Praxis entspricht es jedoch, Ausschließungsanordnungen mit Hilfe der Polizei zu vollziehen, da anderenfalls die zwangsweise Entfernung eines Abgeordneten aus dem Plenarsaal durch den Einsatz von Hausbediensteten das Ansehen und die Autorität des Parlamentsmitglieds beschädigen könnte 55 . In der zwangsweisen Entfernung einer Person aus dem Sitzungssaal könnte unter strafrechtlichen Aspekten eine Nötigung gemäß § 240 StGB erblickt werden, begangen durch den Landtagspräsidenten als mittelbaren Täter im Sinne des § 25 I 2. Alt. StGB und die Ordnungsbediensteten als Gehilfen, § 27 StGB. Der Tatbestand des § 2401 1 1. Alt. StGB ist erfüllt, da der Betroffene durch die bewußte und gewollte Ausübung physischer Gewalt zur Duldung der Entfernung aus den entsprechenden Räumlichkeiten gezwungen wird. Eine Strafbarkeit scheitert jedoch auf der Ebene der Rechtswidrigkeit. Zum einen ist die Anwendung der Gewalt zu dem Zweck, das Hausrecht durchzusetzen und den Hausfrieden wiederherzustellen, nicht als „verwerflich" im Sinne des § 240 Π StGB zu bewerten 56. Zum anderen steht dem Landtagspräsidenten der Rechtfertigungsgrund der Notwehr nach § 32 StGB zur Seite, weil die durch Verweilen oder Wiedererscheinen dokumentierte Mißachtung der Anordnung des Präsidenten einen „gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff' auf das geschützte Rechtsgut des Hausfriedens und des präsidialen Hausrechts darstellt 57. Da auch Abgeordnete grundsätzlich einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterliegen, findet das Notwehrrecht neben dem parlamentarischen Geschäftsordnungsrecht in vollem Umfang Anwendung58. Es entfällt auch nicht infolge der verfassungsrechtlich garantierten Immunität eines Abgeordneten. Diese Regelung hindert zwar die Strafverfolgung, beseitigt aber nicht die Rechtswidrigkeit des Angriffs 59 . Die gewaltsame Entfernung eines ausgeschlossenen Abgeordneten könnte für den Landtagspräsidenten im Hinblick auf § 106 I Nr. 2a StGB von strafrechtlicher » So auch David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Kleinschnittger, S. 128. « Gundelach, S. 337; Klinke, S. 181; Kleinschnittger, S. 128; Schick, S. 69f.; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 18; Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 63; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 a. 55 Klinke, S. 181; Kleinschnittger, S. 128. 56 Vgl. Kleinschnittger, S. 128. 57 Rothaug, S. 60; Gentemann, S. 28; Nelamischkies, S. 121; Kleinschnittger, S. 128; Sperling, S. 49; Klinke, S. 181; Vogler, S. 34; von Brentano, S. 61. 58 Gentemann, S. 28; Rothaug, S. 60. 59 Roßmann, S. 63; Rothaug, S. 60; Kleinschnittger, S. 129.
IV. Die Strafbarkeit der Mißachtung präsidialer Anordnungen
243
Relevanz sein. Diese Vorschrift schützt die Funktionsfähigkeit und Funktionsfreiheit des Abgeordneten, d. h. die Ausübung seiner verfassungsmäßigen Befugnisse in der Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung60. Strafbar macht sich demnach jeder, der ein Parlamentsmitglied rechtswidrig mit Gewalt nötigt, seine Befugnisse nicht auszuüben, indem er ihn beispielsweise gewaltsam an der weiteren Teilnahme einer Plenarsitzung hindert. Da die Tathandlung von jedermann begehbar ist 6 1 , fällt prinzipiell auch der Parlamentspräsident in den möglichen Täterkreis. Doch auch hier kommt eine Strafbarkeit des Präsidenten im Ergebnis nicht in Betracht, da § 106 I Nr. 2a StGB nur den Abgeordneten schützt, der sich in rechtmäßiger Ausübung seines Mandats im Sitzungssaal aufhält; der ausgeschlossene Abgeordnete hingegen hat das Recht auf Verweilen im Sitzungssaal verloren 62. Der Rechtsweg gegen Einzelmaßnahmen des Landtagspräsidenten im Zusammenhang mit seinem Hausrecht, insbesondere gegen Hausverbote, wird einhellig als öffentlich-rechtlich eingeordnet 63.
IV. Die Strafbarkeit der Mißachtung präsidialer Anordnungen Verstößt ein Besucher des Landtags gegen hausrechtliche Anordnungen des Parlamentspräsidenten, so kann sein Verhalten strafrechtlich von § 123 StGB sowie unter Umständen von §§ 113 ff. StGB erfaßt werden. Handelt es sich jedoch um Verletzungen, die weder einen Hausfriedensbruch noch eine Widerstandshandlung darstellen, dann ist die Hausordnungsgewalt des Landtagspräsidenten durch die §§ 106 b I StGB, 1121 OWiG strafrechtlich abgesichert. Seinen Ursprung hat der Schutz des Parlamentsfriedens durch straf- und bußgeldrechtliche Bestimmungen in § 4 des Gesetzes über die Befriedung der Gebäude des Reichstags und der Landtage vom 8. 5. 192064. Nach zwischenzeitlichen Änderungen 65 kam es schließlich zur Bildung eines unechten Mischtatbestandes66, dessen strafrechtlicher Teil im heutigen § 106 StGB geregelt ist, während der bußgeldrechtliche Teil von § 112 OWiG ausgefüllt wird. Geschütztes Rechtsgut ist nicht nur das Hausrecht und die Polizeigewalt im Parlamentsge60 Tröndle, § 106 StGB, Rn. 1; LK-Willms, § 106 StGB, Anm. I. 61 LK-Willms, § 106 StGB, Anm. III. 62 Richter, S. 131; Rothaug, S. 60 m.w.N. 63 Vgl. BayVGH, in: BayVBl. 1980, 723 (724); Knemeyer, in: BayVBl. 1981, 152; Berg, in: JuS 1982, 277; Zeiler, in: DVB1.1981,1000 (1001 f.); BayVGH, in: BayVBl. 1982, 277. 64 Die Vorschrift hatte folgenden Wortlaut: „Wer vorsätzlich Anordnungen übertritt, die der Präsident des Reichstags oder eines Landtags über das Betreten des Gebäudes oder über das Verhalten in den Gebäuden erläßt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1.500,- RM bestraft." Vgl. RGBl. S. 909. 65 Vgl. die Darstellung der Entstehungsgeschichte bei KK OWiG-Rogall, § 112 OWiG, Rn. 3. 66 So KK OWiG-Rogall, § 112 OWiG, Rn. 1. \6*
244
. Abschnitt: D
u s e t des Landtagspräsidenten
bäude, sondern vor allem die Funktionsfähigkeit des Gesetzgebungsorgans, dessen Tätigkeit vor Behinderungen oder Störungen Externer bewahrt werden soll 67 . Der Tatbestand beider Vorschriften erfaßt sowohl Verstöße gegen präsidiale Anordnungen allgemeiner Art („Hausordnungen") als auch Einzelanordnungen, die sich gegen eine bestimmte Person oder Personengruppe richten und gleichermaßen schriftlich wie mündlich erlassen werden können68. Insoweit handelt es sich um eine Blankettvorschrift, die der Ergänzung durch die entsprechende Anordnung bedarf 69. Für die Verwirklichung des Tatbestands des § 106 b StGB ist es erforderlich, daß die Zuwiderhandlung des Täters eine Hinderung oder Störung der Tätigkeit des Gesetzgebungsorgans verursacht, die Tätigkeit also verzögert oder unmittelbar beeinträchtigt 70. Ist dies nicht der Fall, so kommt lediglich eine Ordnungswidrigkeit gem. § 112 OWiG in Betracht 71. Dieses Stufen Verhältnis unterstreicht im übrigen die generelle Funktion des § 112 OWiG, die darin besteht, Störungen und Behinderungen der Tätigkeit des Gesetzgebungsorgans bereits im Vorfeld tatsächlicher Beeinträchtigungen entgegenzuwirken 72. Mit Blick auf ihren Charakter ist diese Norm als abstraktes Gefährdungsdelikt einzuordnen 73. Zuständige Verwaltungsbehörde in Sinne des § 36 I Nr. 1 OWiG ist für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen Anordnungen des Präsidenten im allgemeinen der Parlamentspräsident selbst74. Im Gegensatz zu den Parlamentsexternen kann § 106 b StGB gegenüber Abgeordneten sowie gegenüber Mitgliedern der Landesregierung und ihren Beauftragten keine Geltung beanspruchen75. Dieser Personenkreis kann damit immer nur wegen Hausfriedensbruch gemäß § 123 StGB bestraft werden. Hinsichtlich der Externen bedarf es im übrigen keiner Verfolgungsermächtigung durch den Parlamentspräsidenten mehr, wie sie etwa noch in § 106 b 12 a.F. StGB vorgesehen war 76 . 67 SK-Rudolphi, § 106 b StGB, Rn. 1; LK-Willms, § 106 b, Rn. 1; Schönke/SchröderEser, § 106 b StGB, Rn. 1. 68 Schönke/Schröder-Eser, § 106 b StGB, Rn. 2. 69 SK-Rudolphi, § 106 b StGB, Rn. 3; LK-Willms, § 106 b StGB, Rn. 3. 70 LK-Willms, § 106 b StGB, Rn. 3. 71 Schönke/Schröder-Eser, § 106 b StGB, Rn. 3; SK-Rudolphi, § 106 b StGB, Rn. 4. 72 KK OWiG-Rogall, § 112 OWiG, Rn. 1. 73 KK OWiG-Rogall, § 112 OWiG, Rn. 2. 74 Da § 36 I Nr. 2 a OWiG keine Anwendung finden kann, weil das Gesetzgebungsorgan eines Landes keiner fachlich zuständigen obersten Landesbehörde untersteht, ist die sachlich zuständige Verwaltungsbehörde entsprechend § 36 I Nr. 1 OWiG durch Landesgesetz zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund ist in jedem Land ein „Gesetz über die Zuständigkeit des Präsidenten des Landtags für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 112 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten" geschaffen worden, vgl. stellvertretend Hamburger GVB1. 1975, S. 55, vgl. aber auch § 34 IV Gesetz über den Landtag des Saarlandes. Abweichend Bayern, hier ist gem. Art. 59 Nr. 1, 2 LStVG idF. der Bek. v. 13. 2. 1982, GVB1. S. 1098 der Direktor des Landtagsamts bzw. des Senatsamts zuständige Verwaltungsbehörde. 75 Vgl. § 106 b II StGB. 76 Schönke/Schröder-Eser, § 106 b StGB, Rn. 7.
V. Die Zustimmungsbefugnis
245
V. Die Zustimmungsbefugnis bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen im Landtagsgebäude Alle Länderverfassungen enthalten die Regelung, daß eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den Räumen des Landtags nur mit der Zustimmung des Präsidenten vorgenommen werden darf 77 . Damit obliegt dem Landtagspräsidenten der räumliche Schutz des Parlaments gegenüber der Exekutive, d. h. die Sicherung der Integrität der Gebäude und Grundstücke. Ein entsprechendes Privileg war bereits in Art. 38 Π WRV niedergelegt. Der Genehmigungsvorbehalt sichert die Institution Parlament und dessen Funktionsfähigkeit ab und ist seiner historischen Entwicklung nach bestrebt, die Exemtion des Parlaments von der Amtsgewalt anderer Staatsorgane zu erweitern 78. Eine nicht vom Landtagspräsidenten abhängige staatliche oder sonstige öffentliche Gewalt soll demnach die Arbeit des Landtags in keiner Weise beeinträchtigen können79 . Zugleich soll durch diese Befugnis aber auch das Hausrecht und die Autorität des Präsidenten geschützt werden 80. Hieraus folgt, daß es sich bei dem Zustimmungsvorbehalt nicht - wie vereinzelt vertreten um einen Ausfluß der Polizeigewalt handelt81. Die Zustimmungsbefugnis ist angesichts ihres Schutzzweckes vielmehr dem Bereich des präsidialen Hausrechts zuzuordnen 82. Die Erteilung der Zustimmung ist an keine bestimmte Form gebunden und steht im pflichtgemäßen Ermessen des Parlamentspräsidenten 83. Nur er allein hat zu prüfen, ob er seine Zustimmung erteilt. Neben den allgemeinen politischen Auswirkungen, die eine solche Maßnahme haben kann, sind bei der Zustimmung insbesondere die Immunität, mitunter die Indemnität sowie insbesondere das Zeugnisverweigerungsrecht der Abgeordneten zu berücksichtigen 84. Bei der Ausübung seines Ermessens hat sich der Landtagspräsident an der ratio legis zu orientieren. Dabei ist vor allem zu beachten, daß diese im Gegensatz zum englischen Parla77 Art. 95 II LV-RP; Art. 49 II LV-NRW; Art. 97 II LV-He; Art. 29 II LV-By; Art. 47 ΙΠ 2 LV-Ss; Art. 18 III LV-Ha; Art. 25 LV-SH; Art. 18 II 2 LV-Nds; Art. 57 ΠΙ2 LV-Th; Art. 29IV LV-MV; Art. 69 IV 2 LV-Bg; Art. 32 II 2 LV-BW; Art. 71 II 2 LV-Sl; Art. 41 III 2 LV-Be; Art. 59 II LV-SA; Art. 96 II LV-Br. 78 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581). 79 Vgl. Brandl, in: BayVBl. 1964,280 (284 f.); Dach, in: BK, Art. 40, Rn. 108. so Stern II, § 26 III 7c, S. 86; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 26; Versteyl, in: von Münch/ Kunig, Art. 40, Rn. 29. 81 So auch Reinecke, S. 263 f. Gleichwohl steht der Zustimmungsvorbehalt in einer engen Beziehung zur präsidialen Polizeigewalt. 82 Rode spricht in diesem Zusammenhang etwa von einer Erweiterung des Hausrechts, vgl S. 48. Hingegen räumen Gentemann, S. 47, und Woldt, S. 40, der Zustimmungsbefugnis eine Sonderstellung ein und verneinen damit jedwede Beziehung zum Hausrecht und zur Polizeigewalt. 83 Sperling, S. 54f.; von Brentano, S. 63; Rode, S. 48 f.; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 19; a.A. Gentemann, S. 48. 84 Vgl. Dach, in: BK, Art. 40, Rn. 108.
246
. Abschnitt: D
u s e t des Landtagspräsidenten
mentsrecht keine Asylfunktion für Straftäter, säumige Schuldner oder anderweitig von gerichtlichen oder behördlichen Zwangsmaßnahmen bedrohte Personen enthält, die sich in den Räumlichkeiten des Landtags aufhalten 85. Dementsprechend ist etwa die Verweigerung der Zustimmung zur Verhaftung eines Straftäters im Parlamentsgebäude immer dann unzulässig, wenn diese Entscheidung eine Vereitelung der Strafverfolgung überhaupt bedeuten würde. Unbedenklich ist es hingegen, wenn der Präsident darauf besteht, daß die Verhaftung erst erfolgt, nachdem er die betreffende Person kraft seines Hausrechts aus dem Landtag gewiesen hat. Soweit jedoch die Verweigerung der Zustimmung zu einer Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen einzelner oder der Allgemeinheit führt, ist sie rechtsmißbräuchlich 86. Als „Zustimmung" gilt grundsätzlich nur die ausdrückliche, vorherige Zustimmung im Sinne des § 183 BGB 8 7 . Die Beschlagnahme oder Durchsuchung ist mithin prinzipiell unzulässig, wenn der Parlamentspräsident erst nachträglich zustimmt oder gar ein stillschweigendes Einverständnis erteilt. Soweit also die Landesverfassungen von Bayern und Nordrhein-Westfalen in diesem Zusammenhang von „Genehmigung" sprechen, ist auch hierunter entsprechend dem Sinn der Vorschrift und entgegen dem sonstigen juristischen Sprachgebrauch - § 184 I BGB findet keine Anwendung - nur die vorherige Zustimmung zu verstehen88. Die Zustimmung des Präsidenten kann zudem nicht durch die Zustimmung des von einer Durchsuchung betroffenen Abgeordneten ersetzt werden, selbst wenn sich diese allein auf die dem Abgeordneten als Büro dienenden Räumlichkeiten beschränkt 89. Eine derartige Handhabung würde den Sinn der Vorschrift unterlaufen, da neben persönlichen Unterlagen auch Parlamentsdokumente beschlagnahmt werden könnten 90 . Ebensowenig kann der einzelne Abgeordnete auf die Zustimmung des Landtagspräsidenten wirksam verzichten 91. Auch dem Präsidenten selbst ist dies nicht möglich 92 . Eine Ausnahme von dem Erfordernis der ausdrücklichen, vorherigen Zustimmung des Landtagspräsidenten ist gleichwohl in Fällen dringender Gefahr denkbar, in denen es um den Schutz des Parlaments und seiner Mitglieder oder um
85 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1581); Linck, Art. 57 LV-Th., Rn. 19. 86 So Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581). 87 Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 31; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 16; Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 27; Kunzmann, Art. 47 LV-Ss, Rn. 6; Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 16; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 19; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 25; Stern II, § 26 III 7c, S. 86; Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1581); Kleinschnittger, S. 133. 88 Vgl. stellvertretend für die Begrifflichkeit auf Bundesebene Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 31. 89 Die Substituierung der Zustimmung des Präsidenten durch die eines Abgeordneten wurde anläßlich einer Durchsuchung bei dem Mitglied des Bundestags Wienand erörtert, vgl. dazu auch die Ausführungen bei Rosen, in: ZRP 1974,80 m.w.N. » So Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 27. 91 Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Art. 40, Rn. 11. 92 Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 16.
V. Die Zustimmungsbefugnis
247
die Abwehr eines Angriffs auf Leib oder Leben anderer Personen geht 93 . So wird man etwa die Festnahme eines Geiselnehmers in den Räumen des Landtags im Anschluß an seine Verfolgung durch die örtliche Polizei nicht von einer vorherigen Zustimmung des Präsidenten abhängig machen müssen, sondern kann dessen Einverständnis - sofern keine gegensätzlichen Anhaltspunkte vorliegen - ausnahmsweise als stillschweigend gegeben voraussetzen94. Im übrigen ersetzt auch eine ausdrückliche Zustimmung des Parlamentspräsidenten nicht die für Durchsuchungen im allgemeinen erforderliche richterliche Anordnung 95. Obgleich die Landesverfassungen im Zusammenhang mit der Zustimmungsbefugnis des Landtagspräsidenten lediglich die Durchsuchung und Beschlagnahme nennen96, darf die präsidiale Einwilligung nicht nur auf diese beiden Maßnahmen beschränkt bleiben. Denn wenn schon Durchsuchungen und Beschlagnahmen zustimmungspflichtig sind, so muß dies erst recht für schwerwiegendere Eingriffe gelten. Umfaßt sind damit auch sonstige gegen die Abgeordneten gerichtete Maßnahmen wie Festnahme und Verhaftung gem. §§ 112 ff. StPO97. Aber auch Maßnahmen von geringerer Intensität werden von einem überwiegenden Teil der Literatur miteinbezogen, etwa alle denkbaren auf zivil- oder öffentlichrechtlicher Grundlage ergehenden Zwangsmaßnahmen98. Der räumliche Geltungsbereich, innerhalb dessen die genannten Maßnahmen der Zustimmung des Parlamentspräsidenten unterliegen, ist mit demjenigen gleichzusetzen, der für das Hausrecht und die Polizeigewalt des Präsidenten gilt 9 9 . Er umfaßt demnach die ständigen Gebäude, Gebäudeteile, Grundstücke, Räume usw. des Landtags und darüber hinaus auch die dem konkreten Zusammentritt dienenden Räumlichkeiten 100 . Nicht geschützt sind hingegen Wohnungen oder Büroräume, die die Abgeordneten außerhalb der Parlamentsgebäude unterhalten 101. 93 Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 27; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5; Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 72; a.A. Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 26. 94 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581); Geller/Kleinrahm, Art. 39 LVNRW, Anm. 6 b; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5. 95 Vgl. Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 16. 96 Gemeint sind hierbei in erster Linie Durchsuchungen nach §§ 94 ff. StPO sowie Beschlagnahmen nach §§ 102ff. StPO. 97 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 40, Rn. 10; Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 29; Gottschalck, S. 40; Nauber, S. 101; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 26; Kunzmann, Art. 47 LV-Ss, Rn. 6; Stern, Π, § 26 ΙΠ 7c, S. 86; Kleinschnittger, S. 133; Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581); a.A. Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Art. 40, Rn. 11; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 19.
98 Versteyl, in: von Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 29; Klein, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, Art. 40, Rn. 10; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 26; Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 16; a.A. Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581). 99 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 27; vgl. dazu auch die Ausführungen auf S. 235. 100 Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 30. ιοί Versteyl, in: v. Münch / Kunig, Art. 40, Rn. 28.
. Abschnitt: D
e t des Landtagspräsidenten
Parlamentarische Unterlagen, die sich außerhalb der Räume, Gebäude oder Grundstücke des Landtags befinden, sind, auch wenn sie vertraulichen Charakter haben, ebenfalls nicht geschützt 102 .
VI. Die Bannmeile als Erweiterung des präsidialen Hausrechts Das Hausrecht des Parlamentspräsidenten gilt - wie oben festgestellt - in allen Gebäuden, die der Erfüllung der Aufgaben des Landtags dienen 103 . Es gilt aber auch innerhalb der den Landtag umschließenden Bannmeile 104 . Man kann also sagen, daß die entsprechenden Bannmeilengesetze der Länder das Hausrecht des Präsidenten nach außen hin ergänzen 105. Mit Ausnahme von Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben alle Flächenstaaten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 106 . Der Schleswig-Holsteinische Gesetzgeber hat demgegenüber im Jahre 1990 sein Bannkreisgesetz aufgehoben 107 . Der von der SPD-Fraktion eingebrachte Gesetzentwurf wurde damit begründet, daß der Bannkreis nicht mehr dem heutigen Parlamentsverständnis entspreche, den Dialog mit dem Bürger erschwere und eine faktische Distanz zwischen Parlament und Bevölkerung schaffe 108. Ihren historischen Ursprung haben die Bannmeilengesetze in der Zeit der Weimarer Republik. Zwar kannte das Landesrecht im Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts gleichfalls Bannmeilenverbote; diese galten aber nur für die Zeit der Sitzungsperiode, und für diese Zeit waren staatlich autorisierte Versammlungen 102 Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 16. 103 Vgl. oben S. 235, vgl. auch den Wortlaut von § 10 III GOLT-NRW. 104 Dietel/Gintzel/Kniesel, § 16, Rn. 20; so auch schon Woldt, S. 18 f. los So auch Gottschalck, S. 40. 106 Bannmeilengesetz des Landes Baden-Württemberg vom 12. 11. 1963 (GBl. S. 1975), geändert durch Gesetz von 28. 7. 1970 (GBl. S. 421); Gesetz über die Befriedung des Landtagsgebäudes des Freistaates Bayern vom 7. 3. 1952 (BGVB1. S. 99) iVm. der VO zur Durchführung des Gesetzes über die Befriedung des Landtagsgebäudes vom 30. 4. 1969 (GVB1. S. 136); Gesetz über die Befriedung des Tagungsortes des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 13. 3. 1983 (GVB1. S. 482), geändert durch Gesetz vom 8. 10. 1986 (GVB1. S. 141); Bannkreisgesetz der Hansestadt Hamburg vom 5. 2. 1985 (GVB1. S. 61), geändert durch Gesetz vom 8. 10. 1986 (GVB1. S. 326); Gesetz über die Bannmeile des Hessischen Landtags vom 25. 5. 1990 (GVB1. S. 173); Niedersächsisches Bannmeilengesetz vom 12. 6. 1962 (GVB1. S. 55), geändert durch Gesetz vom 22. 3. 1990 (GVB1. S. 101); Bannmeilengesetz des Landtags von Nordrhein-Westfalen vom 25. 2. 1969 (GVB1. S. 142), geändert durch Gesetz vom 14. 6. 1988 (GVB1. S. 246); Landesgesetz über die Befriedung des Landtagsgebäudes von Rheinland-Pfalz vom 23. 2. 1966 (GVB1. S. 60); Gesetz Nr. 970 über den Landtag des Saarlandes vom 20. 6. 1973 - §§ 81 ff. - Amtsbl. S. 528; Gesetz über die Bannmeile des Thüringer Landtags vom 14. 5. 1991 (GVB1. S. 82). 107 Gesetz zur Aufhebung des Bannkreisgesetzes vom 17. 9. 1990 (GVOB1. S. 500). io» Vgl. Schleswig-Holst. LT-Drs. 12/860.
VI. Die Bannmeile als Erweiterung des präsidialen Hausrechts
249
ausgenommen109. Die landesrechtlichen Bannmeilenregelungen waren also keine Tabuzonen für politische Versammlungen generell 110 . Anlaß für die Einrichtung von Bannmeilen in der Weimarer Republik waren rechtswidrige, gewaltsame Angriffe auf den Reichstag am 13. Januar 1920, als eine gegen die Beratungen der Nationalversammlungen über das Betriebsrätegesetz demonstrierende Ansammlung von Radikalen das Reichstagsgebäude zu stürmen versuchte 111. Das daraufhin am 8. Mai 1920 in Kraft getretene „Gesetz über die Befriedung der Gebäude des Reichstags und der Landtage" verbot sodann dauerhaft Versammlungen im näheren Umkreis um den Reichstag und die Landtage, und zwar auch dann, wenn das Parlament nicht versammelt war 1 1 2 . Die Regelung entstammt insofern dem Geist eines Notstandsdenkens113. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in Berlin 1948 ebenfalls aufgrund einer gewaltsamen Besetzung des Sitzungssaales des Berliner Abgeordnetenhauses im Zusammenhang mit Maßnahmen, die der Auswirkung der Währungsreform galten, die erste (landes-)gesetzliche Bannmeilenregelung geschaffen 114. Auch in den anderen Ländern waren die Parlamente mitunter Objekt heftiger Unruhen, wie etwa bei dem Einmarsch der VVN in den Wiesbadener Landtag 115 , so daß hier ebenfalls entsprechende Gesetze folgten. Zweck dieser Bannmeilenregelungen ist die Abwehr von Gefahren für die Arbeits- und Funktionsfähigkeit der Landesparlamente 116. Zwar stand und steht zur Abwehr unbefugten Eindringens in die Gebäude bzw. in die darin befindlichen Sitzungsräume grundsätzlich das Hausrecht des Parlamentspräsidenten zur Verfügung. Dieses war und ist allerdings im Hinblick auf die Gefahr von Einmärschen nicht ausreichend, weil der Bereich vor den Parlamentsgebäuden - ohne Bannmeilenregelung - nicht dem präsidialen Hausrecht unterfällt 117 . Während der ursprüngliche gesetzgeberische Beweggrund in der Abwehr derartiger physischer Angriffe auf das Parlament bestand, sieht man heute die Rechtfertigung des Bannkreises vor allem in der Abwehr einer psychischen Bedrohung der Abgeordneten 118. Durch 109 Vgl. bspw. § 11 des preußischen Versammlungs- und Vereinigungsgesetzes vom 11.3. 1850, zitiert bei Breitbach, Versammlungsverbot, in: NVwZ 1988,584 (586). »ο So Breitbach, Versammlungsverbot, in: NVwZ 1988,584 (587). m Huber, S. 364. 112 Vgl. die Nachweise bei Schwarze, in: DÖV 1985,213 (216). 113 Ridder/Breitbach/Rühl/Steinmeier, § 16, Rn. 1, S. 564. Breitbach, Bannmeile, S. 103. us Vgl. die Ausführungen des Abg. von Thadden, BT-Prot. 83. Sitzung vom 12. 9. 1950, S. 3124; Witte, Hess. LT-Drs. Abt. III, 2. WP, 55. Sitzung vom 16. 12. 1953, S. 2330. 116 Dietel/Gintzel/Kniesel, § 16, Rn. 9; Breitbach, Versammlungsverbot, in: NVwZ 1988,584(588) m.w.N. 117
Vgl. Breitbach, Bannmeile, S. 105 m.w.N. Etwas anderes gilt bei einer bestehenden gesetzlichen Bannmeile, innerhalb derer der Landtagspräsident kraft seines Hausrechts wirksame Anordnungen treffen kann. us Dietel/Gintzel/Kniesel, § 16, Rn. 11; Breitbach, Bannmeile, S. 105; ders., Versammlungsverbot, in: NVwZ 1988, 584 (588) m.w.N.; kritisch Zeitler, Rn. 250.
250
. Abschnitt: D
a
t
des Landtagspräsidenten
massive verbale Attacken oder bedrohliche Inszenierungen mit emotionalisierten Großansammlungen unmittelbar vor den Sitzungsräumen können sich Einschüchterungseffekte ergeben, die zu einer psychischen Zwangswirkung führen und die Entscheidungsfreiheit der Parlamentsmitglieder beeinträchtigen 119. Die Bannmeilenregelungen sollen damit der Gefahr vorbeugen, daß unter Druck Versprechungen gemacht oder Entscheidungen gefällt werden, die nicht am Gemeinwohl orientiert und deshalb sachlich nicht vertretbar sind 120 . Die Entscheidung über die konkrete Festlegung der Bannmeile und damit auch über den erweiterten Geltungsbereich des präsidialen Hausrechts liegt in bewußter Abkehr zur Weimarer Rechtslage allein beim Landesgesetzgeber. Eine Ausnahme macht Bayern, wo aufgrund des Bannmeilengesetzes die Grenzen der Bannmeile vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Landtagspräsidenten durch Rechtsverordnung bestimmt werden 121 . Das Erfordernis des Einvernehmens mit dem Landtagspräsidenten ersetzt aber nicht die strengen Prozeduren eines Gesetzgebungsverfahrens 122. Mit dem Begriff der Meile, soweit er von den Landesgesetzgebern verwendet wird, ist keine Vorgabe für eine bestimmte Größe verbunden 123. Der Bannkreis muß einerseits so groß wie nötig sein, um den Schutz der Unabhängigkeit des Parlaments sicherzustellen, andererseits aber auch so klein wie möglich, um das Versammlungsrecht nicht übermäßig zu beeinträchtigen 124. Dies rechtfertigt im allgemeinen nur eine Befriedung des näheren Umfeldes des Landtagsgebäudes125. Neben den Bestimmungen zur Festlegung der genauen räumlichen Grenzen der Bannmeile enthalten alle bestehenden Bannmeilenregelungen der Länder auch Vorschriften über die Erteilung von Ausnahmen vom Versammlungsverbot im Bannbereich 126. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Ausnahmebewilligung liegt in der Regel bei der Exekutive und hier beim Innenminister, der seineru* Vgl. Breitbach, Bannmeile, S. 105. 120 Dietel/Gintzel/Kniesel (10. Aufl.), § 16, Rn. 3. 121 Art. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Befriedung des Landtagsgebäudes des Freistaates Bayern. 122 Ridder / Breitbach/Rühl/Steinmeier, § 16,Rn.21. 123 Der Begriff des Bannkreises wird in Bayern, Berlin und Hamburg verwendet. Die Landesgesetzgeber in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen haben sich dagegen in den Überschriften der Gesetze für die Bezeichnung „Bannmeile" entschieden, obgleich sich in den einzelnen Normierungen die Bezeichnung ,3annkreis" findet. Mit der Bezeichnung Bannkreis wird so von Anfang an eine Assoziation zum Längenmaß der Meile vermieden. Der saarländische Gesetzgeber hat im übrigen von der Verwendung beider Begriffe Abstand genommen und stattdessen nur die Bezeichnung „befriedeter Bezirk" gewählt. 124 Dietel/Gintzel/Kniesel, § 16, Rn. 25. 125 Vgl. Breitbach, Bannmeile, S. 101 m.w.N.
126 Rechtlich handelt es sich hierbei um ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, vgl. Krüger, S. 141 f.
VI. Die Bannmeile als Erweiterung des präsidialen Hausrechts
251
seits wiederum „im Einvernehmen" des Landtagspräsidenten entscheidet127. Aus der verfassungsrechtlichen Stellung des Parlamentspräsidenten ergibt sich, daß es sich bei dem Einvernehmen nicht bloß um eine lediglich intern bindende Entscheidung handeln kann, die gegebenenfalls durch ein Gericht ersetzt wird 1 2 8 . Das Einvernehmen besitzt vielmehr eine selbständige Bedeutung und muß, wenn es nicht vorliegt, gegen den Präsidenten in einem eigenen Verfahren geltend gemacht werden 1 2 9 . Im Rahmen der Ausnahmebewilligung wird dem Landtagspräsidenten demzufolge eine echte materielle Mitentscheidung darüber zugesprochen, ob Beeinträchtigungen der Parlamentsarbeit zu befürchten sind 130 . Eine besonders starke Stellung ist in diesem Zusammenhang dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Landtags zugewiesen worden, der seine Entscheidung über eine Ausnahmebewilligung lediglich „im Benehmen" mit dem Innenminister trifft 1 3 1 . Die eigentliche Entscheidungsbefugnis obliegt damit dem Präsidenten selbst, der seinerseits die Exekutive nur zu unterrichten hat 1 3 2 . Im Saarland hingegen entscheidet über Ausnahmen das Präsidium des Landtags.
127 So in Baden-Württemberg (§ 2 I), Bayern (§ 1 II), Hessen (§ 3 I), Rheinland-Pfalz (§ 3 I) und Thüringen (§ 3). In der Berliner Bannmeilenregelung ist die umgekehrte Reihenfolge festgelegt. Hier entscheidet der Präsident des Abgeordnetenhauses im Einvernehmen mit dem Senator für Inneres (§ 2 II). 128 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 29. 129 Vgl. Busch, in: NVwZ 1985, 634 (635); vgl. auch den Beschluß des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 18. 10. 1983, - 7 VG 2697/83 - unveröffentlicht, Umdruck, S. 3, aufgehoben durch Beschluß vom OVG Hamburg vom 20. 10. 1983 - OVG Bs. VII 909/83 - unveröffentlicht. 130 Korte/Rebe, S. 215. 13
1 § 1 II Bannmeilengesetz des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 132 ,3enehmen" bedeutet gegenseitige Fühlungnahme bzw. Anhören, nicht aber die Herstellung des Einvernehmens, so Ritzel / Bücker, § 7, Anm. III 1 b, S. 7 mit Hinweisen auf Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 519 und Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 89, Rn. 62.
Siebter Abschnitt
Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten Eng mit dem im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Hausrecht verbunden, aber rechtlich von ihm scharf zu unterscheiden, ist die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten1. Mit der Polizeigewalt ist dem Präsidenten eine besondere öffentlichrechtliche Zuständigkeit übertragen worden, durch die die Unabhängigkeit des Parlaments gesichert werden soll 2 . Die Übertragung der Polizeigewalt enthält eine echte Kompetenzzuweisung3. Als Ermächtigung zu präventivem Handeln umfaßt sie alle Aufgaben, die sonst den Polizeibehörden obliegen, also vor allem die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Landtagsgebäude4. Damit wird der Einflußbereich des Präsidenten gegenüber dem Hausrecht zwar nicht räumlich erweitert. Doch werden die Befugnisse des Landtagspräsidenten im Verhältnis zur allgemeinen Polizeibehörde in besonderer Weise zu seinen Gunsten geregelt, da der Bereich des Landtags aus der Kompetenz der Polizeibehörden herausgenommen wird 5 . Als Polizeiherr eines zwar kleinen, aber verfassungsrechtlich besonders wichtigen örtlichen Bereichs ist er somit das vornehmste Polizeiorgan des Landes6, er ist gewissermaßen „Polizeipräsident im Polizeibereich Landtag"7. Die Übertragung der Polizeigewalt auf den Landtagspräsidenten findet sich in fast allen Landesverfassungen und parlamentarischen Geschäftsordnungen 8. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird der Begriff „Polizeigewalt" nur auf Verfassungsebene benutzt, erscheint also nicht explizit in den Geschäftsordnungen; diese weisen nur ganz allgemein darauf hin, daß der Landtagspräsident die „Ordnung im Hause" wahre 9. Die Länder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schles1
Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 24; Ritzel /Bücker, § 7, Anm. II b, S. 6. 2 Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 71 mit weiteren Angaben. 3 Stern II, § 26 III 7, S. 85. * Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14. 5 Leinius, in: NJW 1973,448 (449). 6
Vgl. Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 72. In Anlehnung an die Formulierung „Polizeipräsident im Sprengel Reichstagsgebäude" von W. Jellinek, S. 72. 8 Art. 41 III 1 LV-Be, § 141 2 GO-Be; Art. 69 IV 3 LV-Bg, § 121 3 GOLT-Bg; Art. 32 II 1 LV-BW, § 9 II 3 GOLT-BW; Art. 21 I LV-By, § 12 I 3 GOLT-By; Art. 18 II 1 LV-Ha, § 5 I GOBü-Ha; Art. 86 Satz 4 LV-He, § 44IV 1 GOLT-He; Art. 39 II 3 LV-NRW, § 10 III GOLTNRW; Art. 47 III 1 LV-Ss, § 41 3 GOLT-Ss; Art. 57 III 2 LV-Th, § 41 3 GOLT-Th. 7
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
253
wig-Holstein und Sachsen-Anhalt haben indessen in ihren Verfassungen und zum Teil auch in den Geschäftsordnungen den Begriff „Polizeigewalt" durch den Ausdruck „Ordnungsgewalt" ersetzt 10. Daraus ist jedoch nicht die Schlußfolgerung zu ziehen, daß dem Präsidenten die Kompetenz der Polizeigewalt entzogen wurde. Vielmehr ist die „Ordnungsgewalt" in diesem Zusammenhang als umfassender Oberbegriff der präsidialen Befugnisse zu verstehen, der damit auch die präsidiale Polizeigewalt einschließt11. Nur so ist es im übrigen zu erklären, daß die Geschäftsordnung des Landtags von Sachsen-Anhalt die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten namentlich nennt, während die Verfassung nur allgemein von Ordnungsgewalt spricht 12 . Etwas anderes gilt im Stadtstaat Bremen. Hier gewährt die Landesverfassung dem Parlamentspräsidenten weder namentlich die „Polizeigewalt" noch wird der allgemeine Ausdruck „Ordnungsgewalt" verwendet. Es gibt daher berechtigte Zweifel, ob dem Bürgerschaftspräsidenten die Polizeigewalt verfassungsrechtlich überhaupt zusteht13. Ein Blick in die Bremer Verfassungsgeschichte ergibt, daß der bremische Verfassungsgeber von der Aufnahme der Polizeigewalt in Art. 28 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 und in Art. 20 der Preußischen Verfassung von 1920 ebenso unberührt blieb wie 1947 und demzufolge keine inhaltlich gleiche Kompetenz des Präsidenten von Verfassungsrang schuf. Auch die nach der Verkündung der Landesverfassung in Kraft getretenen deutschen Verfassungen, die alle die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten regeln, veranlaßten den bremischen Verfassungsgeber nicht, Art. 92 der Landesverfassung entsprechend zu ergänzen, so daß hier von einer bewußten Ausklammerung dieser präsidialen Befugnis auszugehen ist 1 4 . Dieses Ergebnis wird außerdem nicht dadurch korrigiert, daß die Polizeigewalt des Bürgerschaftspräsidenten nunmehr ausdrücklich in § 12 V 1 GOBü-Br genannt wird. In Anbetracht der Tatsache, daß Geschäftsordnungsregelungen grundsätzlich keine Außenwirkung entfalten, kann somit die Polizeigewalt auch nicht durch parlamentarisches Geschäftsordnungsrecht verliehen werden 15.
9 Art. 85 III 4 LV-RP, § 4 Satz 2 GOLT-RP; Art. 71 II 1 LV-Sl, § 34 I 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 10 Art. 18 II 1 LV-Nds; Art. 29 III 2 LV-MV, § 4 II 1 GOLT-MV; Art. 14 III 2 LV-SH, § 5 I 2 GOLT-SH; Art. 49 II 2 LV-SA. 11 So auch Wuttke, in: v. Mutius/Wuttke/Hübner, Art. 14, Rn. 4; Barschel/Gebel, S. 131. Ebenso Kleinschnittger, S. 123. 12 Vgl. § 5 II 1 GOLT-SA und Art. 49 II 2 LV-SA. 13 Zweifel in dieser Hinsicht äußerte bereits Spitta in einer Anmerkung zu Art. 92 sowie Härth, in: ZParl. 1980,497 (500). 14 Ebenso Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 5. Vgl. auch Klinke, S. 189. 15 Preuß, in: Handbuch der Bremischen Verfassung, S. 301 (311).
254
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
I. Die historische Entwicklung Die historischen Wurzeln der parlamentarischen Polizeigewalt reichen bis in das Mittelalter zurück. Anknüpfungspunkt ist der sog. Friedensbann des europäischen Königshofes 16. Dieser gewährte sowohl den Richtern des Königsgerichts als auch den Parteien, die das Königsgericht anriefen, Schutz vor jeder staatlichen und sonstigen Gewalt 17 . Der älteste im Zusammenhang mit dem Friedensbann überlieferte Rechtsfall ereignete sich im Jahre 1289 in England. Hier oblag dem Parlament die Funktion des Königsgerichts. Die Verletzung des Friedensbannes erfolgte dergestalt, daß ein Mitglied des Parlaments in dessen Räumlichkeiten von einem Gläubiger mit der Zustellung einer zivilrechtlichen Klage behelligt wurde 18 . Im Laufe der Zeit verlagerte sich die Trägerschaft des Friedensbanns vom Herrscher auf das Parlament, das spätestens seit dem 17. Jahrhundert in seinen Räumen jede Amtshandlung einer anderen Behörde oder eines anderen Gerichts ausschließen konnte 19 . Dem englischen Parlament wurde auf diese Weise die Entscheidung über hoheitliche Eingriffsakte gegen Personen zugesprochen, die sich in den Räumlichkeiten des Parlaments aufhielten 20. Grundlegend für die Entstehung der parlamentarischen Polizeigewalt war jedoch vor allem die Entwicklung des Parlamentarismus in der Französischen Revolution 21 . Als herausragendes Ereignis dieser Zeit wird überliefert, daß die Nationalversammlung im Juni 1789 beim König die Entfernung von Gardetruppen erwirkte, die den Tagungssaal umstellt hatten, angeblich zur Sicherheit der Versammlung, ebenso aber wohl, um die Mitglieder der Constituante einzuschüchtern 22 . Die Zurückziehung der Truppen erfolgte entsprechend der Auffassung der Versammlung, daß die Zuständigkeit der ordentlichen Polizeiorgane für den Sitzungsort der Constituante ausgeschlossen sei, weil dieser selbst dort die Polizeigewalt zustehe23. Durch das Nachgeben des Königs erhielt diese Auffassung Bestandskraft, so daß auch die in den nächsten Jahren folgenden gesetzgebenden Versammlungen in Frankreich an einer eigenen Polizeigewalt festhielten 24. In Deutschland hat die parlamentarische Polizeigewalt mit den Anfängen des Konstitutionalismus, der Beschränkung der monarchischen Herrschaft durch die Verfassung und die Mitwirkung des Parlaments Eingang gefunden. Die Zuerken16 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1578). 17 Vgl. Hatschek, Asylrecht, S. 801 (804). is Eingehende Behandlung bei Hatschek, Asylrecht, S. 801 sowie bei Rode, S. 23 und Reinecke, S. 37 f. 19 Dokumentiert bei Hatschek, Asylrecht, S. 801. 20 Reinecke, S. 33ff.; vgl. auch Gerlach, S. 111 und Woldt, S. 2. 21 So Kleinschnittger, S. 131. 22 Reinecke, S. 45. 23 Vgl. Rode, S. 27. 24 Hubrich, Polizeirecht, in: Der Gerichtssaal 1908, S. 127 (132 f.).
I. Die historische Entwicklung
255
nung der Polizeigewalt an die Kammern der Parlamente in Deutschland erfolgte vielfach ausdrücklich durch die Verfassung selbst, zum Teil durch die gewöhnliche Gesetzgebung und bisweilen auch durch die parlamentarische Geschäftsordnung, wobei hinsichtlich der letzten Variante die entsprechenden Regelungen in Frankreich und Belgien Vorbildfunktion übernahmen 25. Allen voran ging Bayern im Wege der ordentlichen Gesetzgebung mit dem Edikt über die Ständeversammlungen vom 26. 5. 1818 26 . Der dortige § 6 wies den Kammern für die Dauer der Sitzung die Polizeigewalt zu, die durch den Kammerpräsidenten ausgeübt wurde. Die Zuständigkeit der ordentlichen Polizeiorgane wurde insoweit ausgeschlossen. Im Rahmen der Polizeigewalt konnte der Präsident Polizeiverordnungen und Polizeiverfügungen erlassen. Außerdem stand ihm gem. § 9 für die polizeiliche Exekutive als Polizeitruppe eine Militärwache zur Verfügung. Andere deutsche Länder folgten und trafen ebenfalls Regelungen, nach denen dem Präsidenten während der Sitzungsdauer in den Räumlichkeiten des Parlaments die Polizeigewalt anvertraut wurde. Hierzu gehörten Württemberg 1821, Hohenzollern-Sigmaringen 1833, Preußen 1848, Kurhessen 1852, Hessen-Darmstadt 1856, Meiningen 1868, Hessen und Sachsen 1874 sowie Bremen 1875 27 . Allerdings enthielt sowohl die sächsische Landtagsordnung als auch die Bremer Verfassung die Besonderheit, daß ein Einschreiten der Polizeibehörden unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich für zulässig gehalten wurde 28 . Nachdem weder in der Paulskirchenversammlung von 1848/49 noch in der preußischen Verfassung von 1850 oder der Reichsverfassung von 1871 eine Bestimmung über die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten enthalten war 29 , übertrug die Weimarer Reichsverfassung in Art. 28 Satz 1 als erste deutsche Verfassung dem Reichstagspräsidenten eine entsprechende Kompetenz30. Zwar stand dem Präsidenten bereits gem. § 62 der Reichstagsgeschäftsordnung von 1876 „die Handhabung der Polizei im Sitzungsgebäude und in den Zuhörer-Räumen zu" 3 1 , jedoch konnte darin nach richtiger Ansicht keine wirksame Übertragung der Polizeigewalt im eigentlichen Sinne gesehen werden, da dies nur durch ein Gesetz möglich ist 3 2 . 25 Reinecke, S. 79. 26 Vgl. die Angaben bei Reinecke. 27 Siehe die Nachweise bei Vogler, S. 35 ff. und Reinecke, S. 93. 28 Die sächsische Landtagsordnung vom 12. 10. 1874 bestimmte in § 27 Jeder Kammer ist die Polizei in den vor ihr benützten Räumlichkeiten überlassen, doch wird hierdurch das Einschreiten der Behörden, wenn dasselbe in Bezug auf ein Verbrechen oder Vergehen erforderlich werden sollte, nicht ausgeschlossen. " Die Bremer Verfassung vom 17.11.1875 sah in § 52 vor, daß „erforderlichen Falles die bewaffnete Macht in Anspruch" genommen werden könnte. Vgl. zu beiden Angaben Hubrich, Redefreiheit, S. 429 ff., zitiert nach Reinecke, S. 94. 29 Härth, Amtseid, in: ZParl 1980,497 (498). 30 Siehe dazu Rode, S. 36 f.; Kleinschnittger, S. 131 m.w.N. 31 Zitiert nach Härth, Amtseid, in: ZParl 1980,497 (498). 32 Vgl. Anschütz, Art. 28, Anm. 3, S. 205. Dementsprechend stellte auch der Präsident des Reichstags in der Sitzung vom 24. 3.1884 fest, daß das Parlament „von der Vorsorge der Polizei für die öffentliche Sicherheit nicht ausgenommen" sei, zitiert nach Pereis, S. 102.
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
Während der Weimarer Zeit war die Rechtslage in den Ländern sehr unterschiedlich33. Entsprechende Verfassungsbestimmungen gab es nur in fünf Ländern, nämlich in Braunschweig (Art. 22 ΠΙ), Hamburg (Art. 17 II), MecklenburgSchwerin (§ 34), Preußen (Art. 20) und Sachsen (Art. 12). In Württemberg wurde indessen von einem speziellen Gewohnheitsrecht ausgegangen34. Während in Baden und Hessen noch einschlägige Geschäftsordnungsbestimmungen vorzufinden waren 35 , hatten die übrigen Länder wie Anhalt, Bremen, Bayern, Lippe, Lübeck, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Schaumburg-Lippe sowie Waldeck keine Regelung der Polizeigewalt getroffen. Soweit also keine Vorschriften existierten oder nur im Geschäftsordnungsrecht der Länder verankert waren, hatte die staatliche Polizei auch in den Räumlichkeiten des Parlaments - im Rahmen der Gesetze einschließlich der Verfassung - freie Hand und konnte damit ohne Zustimmung oder Ersuchen des Präsidenten im Sitzungsgebäude zur Gefahrenabwehr tätig werden 36. Im Dritten Reich bestand die Regelung des Art. 28 Satz 1 WRV zwar formal weiter, wurde allerdings im Schrifttum für obsolet erklärt, da das Zugeständnis einer Art staatsfreien Raumes an die Volksvertretung als „undenkbar und widersinnig" galt 37 . Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus wurde die Polizeigewalt des Bundestagspräsidenten unter Verwendung des Wortlauts von Art. 28 Satz 1 WRV in das neue Grundgesetz aufgenommen. Inhaltsgleiche Bestimmungen fanden ebenso Eingang in die Verfassungen nahezu aller Flächenstaaten38. Lediglich in Hamburg und Bremen erhielt der Bürgerschaftspräsident die Ausübung der Polizeigewalt nur durch die parlamentarische Geschäftsordnung zugesprochen39. In Schleswig-Holstein hingegen fand die präsidiale Polizeigewalt zunächst keine Verankerung.
33
Vgl. für die nachstehenden Angaben Reinecke, S. 158 f. m.w.N. Kritisch dazu Reinecke, S. 160 f. Die Württembergische Geschäftsordnung von 1909 enthielt im übrigen noch eine Regelung der Polizeigewalt. Erst in der neuen Geschäftsordnung vom 1. 7. 1926 findet sich keine einschlägige Bestimmung mehr. 34
35
Vgl. § 771 der Badischen Geschäftsordnung vom 19. 11.1919 sowie Art. 9 II der Hessischen Geschäftsordnung vom 16.6. 1926. 3 6 Reinecke, S. 159. 37 So ausdrücklich Woldt, S. 49. 3 8 Art. 8 II LV-Nds vom 13. 4. 1951; Art. 39 II 3 LV-NRW vom 28. 6. 1950; Art. 85 III a.E. LV-RP vom 18. 5. 1947; Art. 86 a.E. LV-He vom 11. 12. 1946; Art. 21 I LV-By vom 2. 12.1946; Art. 66 I 2 LV-Baden vom 22. 5. 1947 (Baden ging wenig später in Baden-Württemberg auf); Art. 32 II LV-BW vom 11. 11. 1953; Art. 37 LV-Be vom 1. 9. 1950; Art. 73 LV-Sl in der Fassung der Änderungsgesetze vom 20. 12. 1956 und vom 1. 7. 1958. 39 § 3 GOBü-Ha vom 1. 7. 1953 in der Fassung vom 16. 10. 1957; § 12 V GOBü-Br vom 17. 10. 1956.
II. Die funktionale Bedeutung und Trägerschaft
257
I I . Die funktionale Bedeutung und Trägerschaft Sinn und Zweck der präsidialen Polizeigewalt ergeben sich aus der geschichtlichen Entwicklung. Historisch begründet in der Furcht der Parlamente vor der Polizeimacht des Königs 40 , ist die Ausstattung der Legislative mit eigenen polizeilichen Befugnissen „eine Errungenschaft der konstitutionellen Emanzipation des bürgerlichen Parlamentes gegenüber der Krone" 41 . Als wesentlicher Bestandteil der Autonomie des Landtags42 gehört die Übertragung der Polizeigewalt auf den Präsidenten nunmehr zu den wichtigsten und traditionellen Rechten des Parlaments43. Im Gegensatz zur konstitutionellen Monarchie ist es heute in der parlamentarischen Demokratie Aufgabe des Parlaments, das Selbstverständnis der Volksvertretung gegenüber der von ihr kontrollierten Exekutive zu wahren 44. Dazu gehört insbesondere, daß der Präsident das Parlament auf der Grundlage der Verfassung von der übrigen Staatsgewalt freistellen können muß. Der also mit der Übertragung der Polizeigewalt auf den Parlamentspräsidenten verfolgte Zweck, das Parlament als Legislativorgan vor Einflüssen der Exekutive zu bewahren, vor allem zu verhindern, daß diese mit Hilfe polizeilicher Maßnahmen auf die parlamentarischen Verhandlungen und Beschlüsse einwirkt 45 , trägt somit auch der Trennung der Gewalten zwischen Legislative und Exekutive weitgehend Rechnung46. Hierin liegt die verfassungsrechtliche Bedeutung der Polizeigewalt. Im Verhältnis zur allgemeinen Polizei hat die präsidiale Polizeigewalt eine doppelte Schutzfunktion 47. Einerseits sind Polizeibeamte in ihrer üblichen Zuordnung grundsätzlich nicht befugt, das Parlamentsgebäude von sich aus und ohne förmliches Amtshilfeersuchen des Präsidenten zu betreten. Insoweit schließt die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten prinzipiell jede andere Polizeigewalt aus. Andererseits ist die örtliche Polizeibehörde verpflichtet, dem Präsidenten auf dessen Ersuchen hin Amtshilfe zu leisten, etwa weil das Ordnungspersonal zur Gefahrenabwehr nicht ausreicht oder Maßnahmen auf dem Gebiet der Strafverfolgung zu treffen sind. Die im Rahmen der Amtshilfe tätig werdenden Polizeikräfte bleiben allerdings der Weisung des Präsidenten unterstellt. Im Ergebnis kann man also festhalten, daß der Sinn und Zweck der Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten generell darin besteht, das Parlament von der übrigen Staatsgewalt freizustellen, 40 Gundelach, S. 337 f. 41
Pietzner, in: Evangelisches Staatslexikon, Bd. I, Sp. 328. 42 Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5. 43 Vgl. Stern II, §26 III 6, S. 81. 44 Vgl. Bethge, in: Staatslexikon I, Sp. 999 (1003 f.). 45 Kleinschnittger, S. 131 m.w.N. 46 Leinius, in: NJW 1973,448 (449); David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 21. 47 Siehe dazu Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 24; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14. 17 Köhler
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
um einer Beeinträchtigung seiner Funktion im Gesamtgefüge der staatlichen Ordnung zu begegnen48. Hinsichtlich der Trägerschaft der Polizeigewalt ist in der parlamentsrechtlichen Literatur vielfach erörtert worden, ob der Parlamentspräsident selbst oder aber das Parlament als ganzes als ihr Träger zu betrachten ist. In Ansehung der historischen Entwicklung der Polizeigewalt liegt zunächst die Vermutung nahe, daß sie in erster Linie dem Parlament zustehe und lediglich die Ausübung dem Präsidenten übertragen worden sei 49 . Geht man hingegen vom Wortlaut und Zweck der einschlägigen Verfassungsvorschriften aus, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß der Parlamentspräsident die Polizeigewalt nicht nur ausübt, sondern auch innehat50. Dies folgt schon allein daraus, daß eine effiziente Gefahrenabwehr häufig nur durch schnelle Entscheidungen möglich ist. Eine Entscheidung im Wege eines Parlamentsbeschlusses herbeizuführen, wäre dabei das zeitlich aufwendigere Verfahren und der Situationsbewältigung zeitlich nicht angemessen51. Zudem kann es mitunter erforderlich sein, Maßnahmen im Rahmen der Polizeigewalt auch gegen Mitglieder des Parlaments selbst oder gegen die Mehrheit des Hauses zu richten52. Stünde die Trägerschaft der Polizeigewalt indessen dem Parlament zu, könnten derartige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Parlamentsmitgliedern der Minderheitsparteien von der Parlamentsmehrheit unterlaufen werden. Schon allein aus Zweckmäßigkeitserwägungen scheint es daher mehr Sinn zu machen, nicht das Parlament, sondern den Landtagspräsidenten als Träger der Polizeigewalt anzusehen. Das Parlament ist somit rechtlich auch nicht in der Lage, polizeiliche Entscheidungen des Präsidenten zu revidieren. Die Eigenschaft des Präsidenten als Träger der Polizeigewalt ermächtigt ihn jedoch nicht, die damit verbundenen Befugnisse auf andere Hoheitsträger zu delegieren. Damit soll verhindert werden, daß er sich in ein Abhängigkeitsverhältnis begibt und der Gnade und dem Wohlwollen anderer staatlicher Stellen ausgeliefert ist 5 3 . Entsprechendes gilt selbstverständlich für eine Übertragung an beliehene Unternehmer oder sonstige Private 54.
4
« So zusammenfassend Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1579). 49 Ritzel/Bücker, § 7, Anm. II a, S. 6; Kleinschnittger, S. 130; Maunz/Zippelius, S. 258. 50 So auch Troßmann, § 7, Rn. 40; v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Anm. V 1 b, Bd. II, 2. Aufl., 1964; Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (285); Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1584); David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 21; Klinke, S. 182; Gerlach, S. 116; im Ergebnis auch Franke, Ordnungsmaßnahmen, S. 8. 51 52 53 54
Vgl. Brandl, in: BayVBl. 1964,280 (285). Vgl. Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1584). Vgl. Hatschek, Reichsstaatsrecht, S. 130. Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (282).
III. Der Umfang der Polizeigewalt
259
I I I . Der Umfang der Polizeigewalt Der Umfang der Polizeigewalt des Landtagspräsidenten deckt sich im Grundsatz mit dem als Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstandenen „materiellen Polizeibegriff" 55. Danach übt der Landtagspräsident sämtliche allgemeinen Polizeibefugnisse aus, kann also insbesondere Identitätsfeststellungen vornehmen, erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen, ja sogar Durchsuchungen oder Verhaftungen auf polizeirechtlicher Grundlage anordnen 56. Obwohl sich der materielle Polizeibegriff anfangs nur landesrechtlich entwikkelte - was auf den Umstand zurückzuführen ist, daß die „formelle Polizeigewalt" grundsätzlich den Ländern zustand - fand sich doch bald eine einheitliche inhaltsgleiche deutsche Begrifflichkeit 57 . Erstmals kodifiziert wurde der materielle Polizeibegriff im Allgemeinem Landrecht für die Preußischen Staaten vom 1.6.1794 58 . Dort bestimmte § 10 Teil I I Titel 17: „Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey" 59 . Dieser Polizeibegriff galt forthin nicht nur im Bereich des ALR und in den zum alten landrechtlichen Gebiet gehörenden Teilen des preußischen Staates, sondern erlangte auch in allen nord- und mitteldeutschen Staaten gewohnheitsrechtliche Anerkennung 60. Die Begriffsbestimmung verfestigte sich mit § 14 I des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1.6. 1931, und außerhalb Preußens bereits mit der Landesverwaltungsordnung für Thüringen (§ 32) vom 9. 6. 1926 61 . Im Sinne des materiellen Polizeibegriffs wurden zur Zeit der Weimarer Republik auch die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten verstanden 62. Die im Dritten Reich erfolgte Pervertierung des materiellen Polizeibegriffs im Zuge der Durchdringung der gesamten Rechtsordnung durch die nationalsozialistische Ideologie blieb Episode63, und auch die Eingriffe der Besatzungsmächte haben ihn letztlich unberührt gelassen 64 . Zwar fand im Bestreben einer Entpolizeilichung vor allem auf Initiative der britischen, aber auch der amerikanischen Militärregierung eine äußerlich-organisatorische Trennung von uniformierter Vollzugspolizei im institutionellen Sinne und 55 56 57 58
Achterberg, S. 125; ders., in: v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 64. Vgl. Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14. Vgl. Reinecke, S. 165. Klinke, S. 183.
59
Zitiert nach Boldt, in: Lisken/Denninger, Abschnitt A, Rn. 20. 60 Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 7. 61 Reinecke, S. 167; Klinke, S. 183. 62 Für die in Art. 28 WRV normierte Polizeigewalt des Reichstagspräsidenten Anschütz, Art. 28, Anm. 3. 63 Vgl. Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 12 f. 64 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1579). 17*
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
Verwaltungspolizei (ζ. B. Gewerbe-, Bau-, Fremden-, Gesundheits-, Veterinärpolizei) statt 65 , jedoch war von diesen Maßnahmen lediglich die formelle, organisatorische Seite der Polizei betroffen; der materielle Polizeibegriff ist indessen der gleiche geblieben66. Dies bedeutet somit auch für die Begriffsbestimmung der Polizeigewalt des Landtagspräsidenten in den nach dem Krieg ergangenen Verfassungsnormierungen, daß das Wort „Polizeigewalt44 auf diesen herkömmlichen Polizeibegriff des deutschen Rechts verweist 67 . Der materielle Polizeibegriff umfaßt nicht nur die präventiven Aufgaben der Vollzugsdienstkräfte der Polizei, sondern ebenfalls die der Verwaltungspolizei. Während dem Landtagspräsidenten unstreitig die Befugnisse der Vollzugspolizei zuerkannt werden 68 , herrscht jedoch hinsichtlich der verwaltungspolizeilichen Funktionen Uneinigkeit. Ein Teil der Literatur vertritt die Ansicht, daß für die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten grundsätzlich alle verwaltungspolizeilichen Aufgaben ausgeschlossen seien69. Gentemann und Rode folgern dies aus der Beschränkung der Polizeigewalt des Präsidenten auf den räumlich abgegrenzten Bereich des Parlamentsgebäudes und der Art des in ihm weilenden Personenkreises70. Demgegenüber entnimmt Reinecke diesen Standpunkt der geschichtlichen Entwicklung, welche aufzeige, daß der Verfassungsgeber zu allen Zeiten bei der Verleihung der Polizeigewalt überhaupt nicht an verwaltungspolizeiliche Befugnisse gedacht habe 71 . Außerdem hätten die Parlamentspräsidenten in der bisherigen Praxis bestimmte verwaltungsrechtliche Befugnisse nie beansprucht, sondern insoweit die örtlich zuständigen Behörden für allein befugt gehalten72. Reinecke ist bemüht, diese Auffassung mit einer Fülle von Beispielen zu belegen, etwa daß für die Erteilung einer Baugenehmigung bei Baumaßnahmen für das Bundeshaus traditionell die örtliche Baubehörde in Anspruch genommen wurde 73 , übersieht 65
Habermehl, S. 18 f. In den Ländern Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein werden die mit den Aufgaben der Verwaltungspolizei betrauten Behörden vornehmlich als „Ordnungsbehörden" und nicht mehr als „Polizeibehörden" bezeichnet, so daß die von den Besatzungsmächten eingeführte Terminologie noch heute Verwendung findet. « So Reinecke, S. 169 m.w.N. 67 Drews / Wacke / Vogel / Martens, S. 71. 68 Vgl. für alle Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1580). 69 Gentemann, S. 39; Rode, S. 39; Reinecke, S. 187; Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 15; Zivier, S. 98. Nach Rothaug, S. 58, erschöpft sich die präsidiale Polizeigewalt im Aufgabenbereich der „gewöhnlichen Sicherheitspolizei". 70 Gentemann, S. 39; Rode, S. 39. Kritisch dazu allerdings Reinecke, S. 183. 71 Reinecke, S. 184. Ebenso Woldt, S. 16. 72 Reinecke, S. 185. 73 Vgl. Reinecke, S. 186. Als weiteres Beispiel nennt Reinecke das Restaurant im Bundeshaus, dessen privater Betreiber die Schankerlaubnis nicht vom Bundestagspräsidenten, sondern von dem nach dem Gaststättengesetz zuständigen Ordnungsamt erhalten habe. Schließlich weist er auf eine Äußerung des Abgeordneten Böhme in der 4. Sitzung des Verfassungsausschusses des Niedersächsischen Landtags vom 22. 9. 1950 hin, die erkennen lasse, daß
. Der Umfang der Polizeigewalt
261
jedoch, daß damit nicht zugleich die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit dieser Praxis begründet wird 7 4 . Eine andere im parlamentsrechtlichen Schrifttum vertretene Meinung schränkt den materiellen Polizeibegriff weniger stark ein, indem dem Parlamentspräsidenten grundsätzlich nicht alle verwaltungspolizeilichen Befugnisse abgesprochen werden. So sei es beispielsweise durchaus sinnvoll, eine Zuständigkeit des Präsidenten für die Bereiche Baupolizei und Feuerpolizei anzuerkennen75. Ausgeschlossen seien dagegen Aufgaben, die wegen der räumlichen Beschränkung der Polizeigewalt des Landtagspräsidenten ihrer Natur nach generell nicht in Frage kämen, etwa Aufgaben der Jagd-Fischerei- oder Wasserschutzpolizei76. Ausgenommen seien ferner Aufgaben, deren Wahrnehmung eines besonderen technischen Apparates bedürfe, über den der Parlamentspräsident nicht verfüge 77. Kleinschnittger nennt in diesem Zusammenhang etwa die Überwachung von Bettlern, Landstreichern und Vorbestraften sowie die Fremden-, Presse-, Vereins- und Versammlungspolizei78. Nicht umfaßt von der Polizeigewalt des Präsidenten seien schließlich die Zweige der Verwaltungspolizei, bei denen der Parlamentspräsident aufgrund fehlender sachlicher und technischer Spezialkenntnisse nicht in der Lage sei, die jeweilige polizeiliche Befugnis auszuüben79. Zu Recht kritisiert Köhler an dieser Argumentationsführung, daß sie - methodologisch verquer - von der Ausübungsmöglichkeit eines Rechts auf dessen Bestehen schließe80. Der weitaus größte Teil des Schrifttums legt der präsidialen Polizeigewalt demgegenüber einen weiten materiellen Polizeibegriff zugrunde, der die gesamte Gefahrenabwehr umschließt81. Dieser materielle Polizeibegriff erfaßt damit auch sämtliche verwaltungspolizeilichen Aufgaben. Als Argument wird der Sinn und Zweck der Polizeigewalt des Landtagspräsidenten selbst ins Feld geführt. In Anverwaltungspolizeiliche Maßnahmen der dafür zuständigen ordentlichen Behörden im Gebäude des Landtags nicht ausgeschlossen sein sollen, vgl.dazu „Vorläufige Niedersächsische Verfassung vom 13. 4. 1951", Bd. I, Beratungen im Verfassungsausschuß des Niedersächsischen Landtags der 1. WP, zusammengestellt vom Büro des Landtags, S. 48. 74 Ebenso Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1580). 75 So Kleinschnittger, S. 132; Woldt, S. 15; grundsätzlich nicht abgeneigt wohl auch Reinecke, S. 183. 76 Ebenda. 77 Woldt, S. 16; Kleinschnittger, S. 133. 78 Kleinschnittger, S. 133. 79 Woldt, S. 48. 80 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1580). si v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Erl. V 1 b, Bd. II, 2. Aufl., Berlin/Frankfurt a.M. 1964; Achterberg/Schulte, in: v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 64; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14; Klein, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, Art. 40, Rn. 10; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 16; Kunzmann, Art. 47 LV-Ss, Rn. 6; Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 a; Ritzel/Bücker, § 7, Anm. II d, S. 6; Drews /Wacke /Vogel /Martens, S. 72; Stern II, § 26 III 7; Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (282); Klinke, S. 184f. Ebenso bereits Anschütz, Art. 28 WRV, Bern. 3.
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
betracht der Tatsache, daß der räumliche Bezirk der Legislative gegenüber sicherheitsrechtlich begründeten Eingriffen der Exekutive generell Immunität genießen soll, wäre dieses Ziel nur unvollkommen erreicht, wollte man diese Immunität auf Eingriffe der Vollzugspolizei beschränken82. Eine Ausdehnung der Polizeigewalt auf den Aufgabenbereich aller Sicherheitsbehörden sei daher angebracht83. Dem ist vom Grundsatz her zuzustimmen, da jedes Abweichen von dem weiten materiellen Polizeibegriff in kaum zu lösende Schwierigkeiten führt und die o.g. Ansätze keinerlei griffige Abgrenzung anbieten können. Allerdings darf die präsidiale Polizeigewalt nicht gänzlich außerhalb ihres Zwecks bestimmt werden. Im Ergebnis richtig ist deshalb die Auffassung von Köhlen stets den materiellen Polizeibegriff im weiten Sinne zugrundezulegen, dann jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die sicherheitsrechtliche Befugnis, würde sie von einer anderen Stelle wahrgenommen, objektiv in irgendeiner Weise die verfassungsmäßige Aufgabenwahrnehmung des Parlaments berühren kann. Ist dies der Fall, so ist regelmäßig der Parlamentspräsident allein zu ihrer Ausübung im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben berufen 84. Sollte er sich hierzu aufgrund mangelnder Sachkenntnis außerstande sehen, kann er wie auch sonst im Wege der Amtshilfe die Dienste anderer, kundiger Behörden in Anspruch nehmen85. Dem Umfang des materiellen Polizeibegriffs und damit der präsidialen Polizeigewalt sind im übrigen die Grenzen zu setzen, die sich aus dem Zweck der dem Parlamentspräsidenten eingeräumten Kompetenz ergeben, nämlich die Belange des Landtags vor Eingriffen seitens der Exekutive zu wahren 86. Demzufolge verleiht die Polizeigewalt dem Präsidenten kein Initiativrecht zur Verfolgung strafbarer Handlungen gem. § 163 StPO mit dem Ziel, den Täter seiner Strafe zuzuführen und auf diese Weise den staatlichen Strafanspruch zu verwirklichen 87. Eine derartige Befugnis würde eindeutig über die Zweckbestimmung der präsidialen Polizeigewalt hinausgehen. Der Landtagspräsident hat auch keine größere Anzeigepflicht hinsichtlich strafbarer Handlungen, als sie das Strafgesetzbuch jedem Staatsbürger 82 Vgl. Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (36). Auch Reinecke räumt ein, daß eine verwaltungspolizeiliche Maßnahme der Exekutive das Parlament in der Wahrnehmung seiner Aufgaben empfindlich stören kann, bspw. durch die Sperrung des Plenarsaals aufgrund Bauordnungsrechts. 83 Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 8; Feuchte, Art. 32 LV-BW, Rn. 13. 84 So Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1580). 85 Ebenda. 86 Vgl. Klinke, S. 186; Kleinschnittger, S. 133. 87 Vgl. Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 132. Ebenso Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 15; Geller/ Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 b; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5; Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Kleinschnittger, S. 133; Klinke, S. 186; Böttcher, S. 124; Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (284); Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1579); ders., Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (37). Ein Initiativrecht des Parlamentspräsidenten zur Strafverfolgung von Delikten, die im Parlamentsgebäude begangen worden sind, wird hingegen bejaht von Woldt, S. 40 und Reinecke, S. 243.
III. Der Umfang der Polizeigewalt
263
auferlegt 88. Die Polizeigewalt beschränkt sich also auf rein präventiv-polizeiliche Aufgaben und umfaßt nicht repressiv-polizeiliche Tätigkeiten89, obgleich es zwischen beiden Bereichen mitunter zu Überschneidungen kommen kann 90 . Im räumlichen Bereich des Landtags wird die polizeiliche Aufgabe der Strafverfolgung somit allein durch die Strafverfolgungsorgane der Exekutive wahrgenommen 91. Der Landtagspräsident kann folglich aus der StPO - mit Ausnahme des sogenannten „Jedermann-Paragraphen" (§ 127 StPO) - grundsätzlich keine weitergehenden polizeilichen oder sonstigen Befugnisse ableiten92; eine Festnahme von Störern im Landtagsgebäude läßt sich beispielsweise nicht auf § 164 StPO stützen93. Auch steht ihm nicht das Recht der Zeugnisverweigerung bei der Verfolgung von Delikten zu, die im Haus begangen worden sind 94 . Zu trennen ist hiervon auf Bundesebene die Stellung der Polizeivollzugsbeamten im Polizei- und Sicherheitsdienst des Deutschen Bundestages, welche vollen Polizeivollzugsstatus im Sinne von StPO und OWiG genießen95. In personeller Hinsicht richtet sich die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten ihrem Wesen nach grundsätzlich gegen jedermann 96. „Polizeipflichtig" sind demnach nicht nur Zuhörer, Besucher und Parlamentsbedienstete, sondern auch Abgeordnete, Regierungsmitglieder, Regierungsvertreter sowie alle anderen Personen, die sich im Parlament aufhalten 97. Die Ansicht des Baden-Württembergischen Staatsgerichtshofs, nach der Abgeordnete und Fraktionen der präsidialen Polizeigewalt nur dann unterliegen, wenn die Ausübung der Polizeigewalt zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unumgänglich sei 98 , führt in der Konsequenz zu keiner weiteren Einschränkung des Anwendungsbereichs, da die Erforderlichkeit polizeilichen Einschreitens ohnehin ein von der Verfassung gebotener allgemeiner Grundsatz des Polizeirechts ist 9 9 . 88 Gerlach, S. 117. 89 Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (284). 90 Siehe dazu die Ausführungen von Dreier, in: JZ 1987,1009 ff. 91 Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 3. Entsprechendes ergebe sich schon allein aus einem Umkehrschluß derjenigen Verfassungsbestimmungen, die die Genehmigungspflicht des Landtagspräsidenten bei Maßnahmen der Beschlagnahme und Durchsuchung von Polizeikräften im Parlamentsgebäude regeln, vgl. Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988,33 (37). 92 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1579). Dies gilt unabhängig davon, ob deren Ausübung an die Eigenschaft eines Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft geknüpft ist oder nicht. Andere Auffassung offenbar Tilch, in: Münchener Rechtslexikon, Bd. 2, S. 1287. 93 Vgl. Geller / Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 b. 94 Gerlach, S. 117. 95 Näheres dazu unten auf S. 270 f.
96 Woldt, S. 13; Reinecke, S. 28. 97 Böttcher, S. 125; Rothaug, S. 59. 98 StGH Baden-Württemberg, Urteil vom 28. 1. 1988 - GR 1/87, in: NJW 1988, 31993200. 99 So auch Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1583 f.).
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
Der räumliche Umfang der Polizeigewalt des Präsidenten erstreckt sich auf alle Räume, Gebäude, Gebäudeteile und Grundstücke des Parlaments, in bzw. auf denen sich die parlamentarische Arbeit gewöhnlich vollzieht 100 . Dies gilt grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob das Parlament dort gerade tagt oder nicht, ob es aufgelöst oder die Wahlperiode abgelaufen ist 1 0 1 . Im Gegensatz zum präsidialen Hausrecht erstreckt sich die Polizeigewalt auch auf die den Fraktionen zur Nutzung zugewiesenen Geschäftsräume 102. Nicht umfaßt ist allerdings die Dienstwohnung des Präsidenten selbst 103 . Zum räumlichen Geltungsbereich der Polizeigewalt gehören ferner alle auswärtigen Tagungsräume, in denen das Parlament oder Teile desselben konkret zusammentreten 104. Dies gilt bei zweckorientierter Betrachtungsweise nicht nur für Plenarsitzungen, sondern ebenso für Fraktions- und Ausschußsitzungen sowie für die Zusammenkünfte der anderen geschäftsordnungsmäßig anerkannten parlamentarischen Gremien 105 . In den Geltungsbereich der Polizeigewalt des Landtagspräsidenten ist schließlich auch der befriedete Bannkreis des Landtagsgebäudes einzubeziehen106.
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten ist dazu bestimmt, die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch entsprechende polizeiliche Maßnahmen zu gewährleisten. Mit Blick auf die konkrete Ausübung stellt sich dabei einerseits die Frage nach einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für polizeiliche Anordnungen des Präsidenten und andererseits die Frage nach den Möglichkeiten, die getroffenen Maßnahmen auch durchzusetzen.
1. Handlungsformen polizeilicher Maßnahmen und ihre gesetzlichen Grundlagen Die Ausübung der Polizeigewalt erfolgt durch den Erlaß von Polizeibefehlen, die sich in Polizeiverordnungen und Polizeiverfügungen unterteilen 107 . Während sich Polizeiverfügungen zur Regelung eines konkreten Einzelfalls an bestimmte loo Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14; Rothaug, S. 58. ιοί Gentemann, S. 49; Reinecke, S. 255. 102 Schmidt, in: DÖV 1990,102 (107); Gottschalck, S. 40. i° 3 Vgl. dazu die Anmerkungen von Reinecke, S. 255 f. sowie Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1583); a.A. Woldt, S. 47 f. 104
Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 30. 105 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1.1992,1577 (1582); Rothaug, S. 58. 106 Dietel/Gintzel/Kniesel, § 16, Rn. 20; a.A. wohl Reinecke, S. 198. 107 Drews/ Wacke / Vogel / Martens, S. 342.
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
265
Personen oder einen bestimmten Personenkreis richten, also konkret-individueller Art sind, wenden sich Polizeiverordnungen zur Regelung einer unbestimmten Anzahl von Fällen an eine unbestimmte Anzahl von Personen und sind damit abstrakt-genereller Natur 1 0 8 . Die Gemeinsamkeit beider Handlungsformen besteht allerdings darin, daß es sich sowohl bei polizeilichen Verfügungen, die als belastende Verwaltungsakte zu verstehen sind 1 0 9 , als auch bei Polizei Verordnungen um Maßnahmen mit Eingriffscharakter handelt 110 . Aus diesem Grunde ist für ihren Erlaß nach dem Prinzip des Gesetzesvorbehalts eine formalgesetzliche Grundlage erforderlich. Die Präsidenten der Länderparlamente können dabei auf die in ihren jeweiligen Flächenstaaten ergangenen Polizeigesetze zurückgreifen, die als einfachgesetzliche Normen die Ausübung der Polizeigewalt im einzelnen regeln. Außerdem stehen ihnen mitunter bundesgesetzliche Ermächtigungsvorschriften zur Verfügung, die beispielsweise im Bundesimmissionsschutzgesetz oder im Waffengesetz niedergelegt sind. Ausgehend von der in der Landesverfassung festgeschriebenen präsidialen Polizeigewalt können die Landtagspräsidenten demzufolge im Rahmen der im jeweiligen Land geltenden Gesetze rechtswirksame Polizeiverfügungen und Polizei Verordnungen erlassen 111 . Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, daß in den Ländern Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen die Ermächtigungsvorschriften für den Erlaß von Polizeiverordnungen nicht mehr in den Polizeigesetzen enthalten sind. Grundlage für den Erlaß von Verordnungen sind hier ordnungsbehördliche Gesetze 112 . Doch auch in den Ländern mit polizeigesetzlicher Regelung wird nicht die Vollzugspolizei, sondern werden die allgemeinen Gefahrenabwehrbehörden bzw. Polizeiverwaltungsbehörden zum Erlaß von Rechts Verordnungen ermächtigt 113 . Für die Landtagspräsidenten ist dies jedoch unschädlich, da die präsidiale Polizeigewalt nicht nur die präventiven Aufgaben der Vollzugspolizei, sondern eben grundsätzlich auch jene der Verwaltungspolizei umfaßt 1 1 4 . Im übrigen spielt die Befugnis des Präsidenten zum Erlaß von Polizei Verordnungen in der parlamentarischen Praxis nur eine untergeordnete Rolle. Abstrakt-generelle Anordnungen des Parlamentspräsidenten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Landtagsgebäude beruhen meist auf dessen Hausrecht 115 . Etwas komplizierter stellt sich die Situation dagegen auf Bundesebene dar. Abgesehen von einigen spezialgesetzlichen Regelungen 116 gibt es kein den Polizei108
Rachor, in: Lisken / Denninger, Abschnitt F, Rn. 49. 109 Kleinschnittger, S. 135. no Vgl. Reinecke, S. 193. m So auch Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581). 112 Vgl. z. B. BayLStVG, OBG-NRW. 113 Vgl. etwa § 1 HSOG oder § 1 SPolG. H 4 Siehe dazu S. 260 ff. us Vgl. Kleinschnittger, S. 140; Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1582).
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
gesetzen der Länder entsprechendes allgemeines Polizeigesetz des Bundes und damit auch keine allgemeinen polizeilichen Ermächtigungsgrundlagen, auf die der Bundestagspräsident sein Handeln unmittelbar stützen könnte. Zur Zeit der Weimarer Republik erblickte ein Teil des Schrifttums in § 4 des Reichsgesetzes über die Befriedung der Gebäude des Reichstages und der Landtage vom 8. 5. 1920 die ausdrückliche Ermächtigung des Präsidenten zum Erlaß von Polizeibefehlen 117. Während diese Ansicht schon damals auf Kritik stieß 118 , kann dem heutigen Äquivalent dieser Bestimmung, dem § 106 b StGB, eine derartige Ermächtigungsgrundlage erst recht nicht entnommen werden. Zwar bezieht sich diese Vorschrift auch auf Anordnungen des Präsidenten „über die Sicherheit und Ordnung" im Bundestag, jedoch wird gerade durch die Aufnahme der Befriedungsvorschrift in das StGB unterstrichen, daß ihr Zweck auf den rein strafrechtlichen Schutz beschränkt bleiben soll 1 1 9 . Ebensowenig kann die „Dienstanweisung für die Hausinspektion des Deutschen Bundestages" vom 6. 4. 1976 eine Rechtsgrundlage für Polizeibefehle bilden, da ihr der erforderliche Gesetzescharakter fehlt 120 . Da aber eine Polizeigewalt des Bundestagspräsidenten ohne das Recht, polizeiliche Verfügungen zu erlassen, sinnentleert wäre, wird man den Art. 40 Π 1 GG selbst subsidiär - soweit die o. g. Spezialgesetze nicht ausreichen - als unmittelbare Rechtsgrundlage heranziehen müssen. Eine ähnliche Lösung wurde bereits zur Zeit der Weimarer Republik im Hinblick auf Art. 28 WRV vertreten 121. Zweifelhaft ist bei diesem Ansatz allerdings, ob die in Art. 40 I I 1 GG anzutreffende Formulierung „Der Präsident übt die Polizeigewalt aus" als unmittelbare Befugnisnorm inhaltlich so hinreichend konkret ist, daß sie im Einklang mit dem rechtsstaatlichen Gebot der Bestimmtheit steht. Als Ausfluß der Rechtssicherheit verfolgt der verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz das Ziel, dem Normunterworfenen die Voraussehbarkeit, Meßbarkeit und Berechenbarkeit staatlichen Handelns zu ermöglichen 122 . Auch wenn die zur Rede stehende Verfassungsvorschrift weder die genauen Voraussetzungen polizeilicher Befehle noch deren Grenzen explizit erwähnt, ist sie doch so begrenzt und bestimmt, daß voraussehbar ist, in welchen Fällen und mit welchem Sinn und Zweck der Präsident davon Ge116 Zu erwähnen sind hier in erster Linie das Bundespolizeibeamtengesetz (BPolBG), das Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG) sowie das Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges (UZwG), wobei für die Ausübung der präsidialen Polizeigewalt lediglich das BPolBG und das UZwG einschlägig sind. Diese Gesetze enthalten Vorschriften, nach denen Parlamentsbeamte und auch die Beamten des Hausordnungsdienstes des Deutschen Bundestages Polizeivollzugsbeamte sein können. 117
So etwa Rode, S. 42; nicht ganz eindeutig Gentemann, S. 44. us Vgl. nur Woldt, S. 19. 119 Kleinschnittger, S. 137 m.w.N.; siehe auch Reinecke, S. 197. 120 Vgl. Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 71; Kleinschnittger, S. 136. 121 Vgl. Sperling, S. 54; v. Brentano, S. 61; Mühlbauer, S. 71; Vogler, S. 39. Der Art. 28 WRV wurde dabei im Sinne des § 10 II. 17. pr. ALR interpretiert. 122 Vgl. Stem I, § 20IV 4 f., S. 829 f.
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
267
brauch machen wird und was von den Adressaten gefordert werden kann 123 . Solange sich also der Bundestagspräsident bei seinen Maßnahmen an den herkömmlichen Grundsätzen des allgemeinen Polizeirechts orientiert, ist die Meßbarkeit und die Berechenbarkeit seines Handelns gewährleistet und dem Bestimmtheitsgrundsatz weitestgehend genügt 124 . Gesetzliche Grundlage zumindest für Polizeiverfügungen des Bundestagspräsidenten ist also Art. 40 Π 1 GG 1 2 5 . Fraglich ist indessen, ob diese Rechtsauffassung ebenfalls für den Erlaß von Polizeiverordnungen tragfähig ist. Das Grundgesetz selbst stellt hier in Art. 801 2 sehr hohe Anforderungen an die Ermächtigungsgrundlage, nämlich dergestalt, daß Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung in dem ermächtigenden Gesetz bestimmt sein müssen. Diese drei Aspekte lassen sich jedoch dem Art. 40 I I 1 GG nicht ohne weiteres entnehmen, insbesondere gibt der Wortlaut keine genauen Aufschlüsse, so daß auf den ersten Blick an der Bestimmtheit der Norm berechtigte Zweifel bestünden. Die Frage, wann eine Ermächtigungsgrundlage den genannten Voraussetzungen entspricht, ist mehrfach Verhandlungsgegenstand des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Nach einer anfangs außerordentlichen strengen Rechtsprechung hat das BVerfG später das Ausmaß der Begrenzung merklich gelockert: Wenn auch Art. 80 I 2 GG für Rechtsverordnungen festlege, daß ihre gesetzliche Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmt sein muß, ein Gesetz also nicht bloß allgemein zur Ausführung durch Rechtsverordnung ermächtigen darf, sondern spezielle Angaben dessen enthalten muß, was in der Rechtsverordnung geregelt werden soll, wenn die gesetzgeberische Tendenz ersichtlich sein muß und wenn die Grenzen der dem Verordnungsgeber übertragenen Rechtsetzungsbefugnis umschrieben sein sollen, so verlange Art. 80 I 2 GG doch nicht, daß die Ermächtigung in ihrem Wortlaut so genau wie nur irgend möglich formuliert und gefaßt sein muß. Vielmehr habe sie von Verfassungs wegen nur hinreichend bestimmt zu sein 126 . Eine Ermächtigungsnorm hält demzufolge auch dann der verfassungsrechtlichen Prüfung am Maßstab der zu Art. 80 I 2 GG entwickelten Rechtsgrundsätze stand, wenn sich die dort geforderte Bestimmtheit durch Auslegung im Rahmen der allgemeingültigen Auslegungsmethoden ermitteln und feststellen läßt 127 . Zur Klärung von Zweck, Inhalt und Ausmaß der Ermächtigung könne also, wie auch sonst 123 Reinecke, S. 201. In diesem Zusammenhang empfahl Walter Jellinek, man müsse bei dem Parlamentspräsidenten „ein Auge zudrücken, wenn sich ( . . . ) das Polizeiverfügungsrecht nicht auf förmliche Texte gründen läßt", sondern aus der in der Verfassung übertragenen Polizeigewalt selbst herzuleiten ist, Jellinek, S. 89 und S. 428, zitiert nach Kleinschnittger, S. 139. 124 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1581).
125 Im Ergebnis ebenso Kleinschnittger, S. 138 f.; Reinecke, S. 201; Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1581), Woldt, S. 20f.; Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 71; a.A. wohl BayVerfGH, Urteil vom 9. 7. 1985, in: DVB1. 1986, 35. 126 Vgl. BVerfGE 8, 274 (312); 26,228 (241). 127 BVerfGE, 55, 207 (226 f.).
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
bei der Auslegung einer Vorschrift, der Sinnzusammenhang der Norm mit anderen Bestimmungen und das Ziel, das die gesetzliche Regelung insgesamt verfolgt, berücksichtigt werden 128 . Auch die Entstehungsgeschichte der Norm kann insoweit herangezogen werden 129 . Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wird deutlich, in welcher Art von Fällen und mit welcher Zielrichtung von der Ermächtigung Gebrauch gemacht werden darf. Insbesondere die historische Entwicklung des materiellen Polizeibegriffs unterstreicht, daß die Polizeigewalt allein auf die Abwehr aller Gefahren zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gerichtet ist 1 3 0 . Dabei stellen die Worte „öffentliche Sicherheit", „öffentliche Ordnung", „Gefahr" nur Abkürzungen und zusammenfassende Bezeichnungen für all das dar, was Rechtsprechung und Gesetzgeber im Laufe von fast einem Jahrhundert an Grundsätzen des Polizeirechts entwickelt haben. Jeder dieser Begriffe ist dementsprechend durch eine Fülle gerichtlicher Erkenntnisse in seiner rechtlichen Bedeutung konkretisiert und begrenzt 131. Da Inhalt, Zweck und Ausmaß insofern hinreichend bestimmt sind, mithin den Anforderungen des Art. 80 I 2 GG entsprochen wird, ist Art. 40 I I 1 GG als rechtmäßige Ermächtigungsgrundlage des Bundestagspräsidenten für den Erlaß von Polizei Verordnungen anzusehen132.
2. Die Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten wäre unvollkommen und wirkungslos, würde sie dem Präsidenten nicht zugleich die Möglichkeit bieten, die polizeilichen Anordnungen zwangsweise durchzusetzen 133. Die Frage der Durchsetzbarkeit von Polizeimaßnahmen ist demnach unweigerlich verknüpft mit der Frage, ob der Parlamentspräsident generell mit Zwangsmitteln vorgehen kann. Das Polizeirecht kennt drei Arten von Zwangsmitteln, nämlich die Ersatzvornahme, also die Ausführung einer gebotenen Handlung auf Kosten des Pflichtigen, die Festsetzung von Zwangsgeld und den unmittelbaren Zwang. Der unmittelbare Zwang ist das schärfste polizeiliche Machtmittel. Unter ihm wird die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen verstanden 134 . Im Schrifttum ist es allgemein anerkannt, daß der Präsident zur Vollstrek128 Vgl. BVerfGE 7, 267 (272 f.); 7, 282 (291); 8, 274 (307); 10, 20 (51). 129 Vgl. BVerfGE 1, 117 (127, 134 ff.). 130 So auch Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (282) für die Polizeigewalt des Bayerischen Landtagspräsidenten. 131 Drews / Wacke / Vogel / Martens, S. 493 f. 132 So auch Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1582); ebenso bereits Drews/ Wacke/Vogel/Martens, S. 492ff.; a.A. Kleinschnittger, S. 139f. Reinecke bejaht im Ergebnis gleichfalls die präsidiale Befugnis zum Erlaß von Polizeiverordnungen auf der Grundlage des Art. 40 II 1 GG, mißt diese jedoch nicht am Maßstab des Art. 801 2 GG, vgl. S. 200 f. 133 Kleinschnittger, S. 141; Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1582). !34 Rachor, in: Lisken / Denninger, Abschnitt F, Rn. 495.
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
269
kung seiner getroffenen Anordnungen von allen Zwangsmitteln - einschließlich des unmittelbaren Zwangs - Gebrauch machen darf 135 . Die Präsidenten der Länderparlamente können sich dabei im allgemeinen auf die jeweiligen Bestimmungen ihrer Polizeigesetze stützen 136 . Sofern die Polizeigesetze das Verfahren der Zwangsanwendung nur ausschnittsweise, begrenzt auf den unmittelbaren Zwang, regeln 137 oder diesen Bereich gänzlich ungeregelt lassen138, sind - § 49 I PolGBW; § 40 I BremPolG und § 30 I SächsPolG bestimmen dies sogar ausdrücklich die allgemeinen Vollstreckungsgesetze anzuwenden139. Im Vergleich zu den Landtagspräsidenten war die Anwendung von Zwangsmitteln durch den Bundestagspräsidenten anfänglich mit Problemen verbunden, weil entweder eine Ermächtigungsgrundlage gefunden werden mußte oder aber diese nicht hinreichend bestimmt war 1 4 0 . Inzwischen hat die Gesetzgebung jedoch in diesem Bereich für Rechtsklarheit gesorgt, so daß entsprechende Maßnahmen des Bundestagspräsidenten nach heutiger Rechtslage in den §§ 6 ff. VwVG ihre gesetzliche Grundlage finden. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zudem im UZwG spezialgesetzlich geregelt 141 . Die Frage nach der zwangsweisen Durchsetzbarkeit polizeilicher Maßnahmen ist aber nicht nur eine rechtliche, sondern in der Praxis vor allem eine personelle. Ein persönliches Einschreiten des Landtagspräsidenten erscheint gerade bei der Anwendung von unmittelbarem Zwang wenig erfolgversprechend. Außerdem entspricht es nicht dem herkömmlichen Bild eines Parlamentspräsidenten, daß sich dieser selbst in das Gemenge stürzt, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, oder von der Schußwaffe Gebrauch macht 142 . Eine derartiges Verhalten hätte vielmehr eine Beeinträchtigung der Würde des Präsidentenamtes zur Folge 143 . Aus diesem Grunde ist es unerläßlich, daß dem Landtagspräsidenten zur Durchsetzung seiner Anordnungen andere Hilfskräfte zur Verfügung stehen.
135 Vgl. nur Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (284); Achterberg, S. 125. 136 Für die Ersatzvornahme gelten die Vorschriften: Art. 55 Bay PAG; § 55 VGPolG-Bg; § 49 HSOG; § 89 SOG-MV; § 66 NGefAG; § 52 PolG-NRW; § 52 POG-RP; § 46 SPolG; § 55 SOG-SA; § 238 LVwG-SH; § 53 ThürPAG. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist geregelt in: § 50 I PolG-BW; Art. 61 I Bay PAG; § 60 I VGPolG-Bg; § 41 I BremPolG; § 18 I HmbSOG; § 55 I HSOG; § 102 I SOG-MV; § 69 I NGefAG; § 58 I PolG-NRW; § 58 I POGRP; § 49 II SPolG; § 31 I SächsPolG; § 58 I SOG-SA; § 251 I LVwG-SH; § 59 I ThürPAG. 137
Dies ist vor allem in den Polizeigesetzen der Länder Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen der Fall. 138 So etwa das ASOG für Berlin. 139 Vgl. Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 523. 140
Siehe hierzu die Ausführungen von Reinecke, S. 212 ff. ι 4 · Vgl. § 1 II BPolBG iVm. §§ 1, 6 Nr. 1 UZwG. ι 4 2 Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (282); derselben Auffassung Reinecke, S. 218. i43 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1584).
Bremen,
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
a) Hauseigener Ordnungsdienst Obgleich lange Zeit umstritten 144 , hat sich inzwischen in der parlamentsrechtlichen Literatur die Meinung durchgesetzt, daß der Parlamentspräsident seine Polizeiaufgaben auch mit Hilfe des eigenen Personals durchführen könne 145 . Im Gegensatz zum Deutschen Bundestag haben die Volksvertretungen der Länder ihren Ordnungskräften jedoch bislang nicht den Status von Polizeivollzugsbeamten verliehen 146 . Sie können daher nur zur Durchsetzung des Hausrechts eingesetzt werden 1 4 7 , nicht aber zur zwangsweisen Durchsetzung polizeilicher Anordnungen des Präsidenten 148. Ist also zur Vollstreckung getroffener Anordnungen die Anwendung von Zwangsmitteln erforderlich, so werden hierzu die Polizeivollzugsbeamten der allgemeinen Landespolizei angefordert, die daraufhin im Wege der Amtshilfe oder der Vollzugshilfe tätig werden 149 . Anders stellt sich die Situation im Deutschen Bundestag dar. Dort bedient sich der Präsident zur Ausübung seiner polizeilichen Aufgaben der Verwaltung des Deutschen Bundestages, insbesondere des Polizei- und Sicherheitsdienstes, früher „Hausinspektion" genannt 150 . Dabei handelt es sich um eine polizeilich voll ausgebildete Schutzeinheit von über hundert Personen, die materiell als „polizeiliche Vollzugsdienststelle des Bundes" 151 rund um die Uhr im Einsatz ist 1 5 2 . Bereits im Jahre 1960 hatte das Bundespolizeibeamtengesetz in § 1 Π „die Beamten des Ordnungsdienstes der Verwaltung des Deutschen Bundestages" ausdrücklich zu Polizeivollzugsbeamten des Bundes erklärt. Darüber hinaus bezeichnete auch das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes vom 10. 3. 1961 die Beamten des Hausordnungsdienstes als Vollzugsbeamte im Sinne dieses Gesetzes und ermächtigte diese außerdem zum Gebrauch von Schußwaffen 153. Auch der heutige Polizei- und Sicherheits144 Vgl. di e Nachweise bei Kleinschnittger S. 141; siehe auch Reinecke, S. 218 f. 145 Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 b; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5; Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 3. So auch schon Hatschek, Reichsstaatsrecht, S. 230. 146 Vgl. Nauber, S. 102; Gottschalck, S. 39; Nawiasky, Art. 21 Lv-By, Rn. 3; Gerlach, S. 116; Wuttke, in: v. Mutius/Wuttke/Hübner, Art. 14, Rn. 4. 147 So David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 23. 148 Soweit also in den Landtagen Vorschriften bestehen, die den parlamentarischen Ordnungsdienst zur Anwendung unmittelbaren Zwangs ermächtigen, so gilt dies nicht für die zwangsweise Durchsetzung polizeilicher Anordnungen des Landtagspräsidenten, sondern ausschließlich für hausrechtliche Anordnungen, vgl. etwa § 6 II 2 Allgemeine Anordnung über die Ordnung und Sicherheit in den Gebäuden des Landtags von Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 13. 12. 1990 (MB1. NRW 1991, S. 116). 149 Nauber, S. 102. Dies gilt insbesondere für die Anwendung unmittelbaren Zwangs, weniger für die Ersatzvornahme, weil der Präsident hierbei nicht auf Exekutivpersonal mit polizeilichen Funktionen angewiesen ist, sondern sich Dritter bedienen kann. 150 Der ursprüngliche Name lautete " Ordnungsdienst des Deutschen Bundestages". 151 So Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 71. 152 Schick, in: DVP 1989, 153 ( 158).
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
271
dienst des Deutschen Bundestages ist durch das UZwG zum Schußwaffengebrauch berechtigt 154 . Der Polizei- und Sicherheitsdienst ist im übrigen nicht nur für die Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig, sondern ist im Kompetenzbereich des Bundestagspräsidenten auch Polizei im Sinne des § 163 StPO und hat somit das Recht des ersten Zugriffs. Hierfür stehen ihm die polizeilichen Befugnisse nach der StPO zu. Zudem verfügen sie über eine Online-Abfrageberechtigung zu den Fahndungsdateien des polizeilichen Informationssystems 155. Bei der Aufgabenbewältigung steht ihm der Bundesgrenzschutz unterstützend zur Seite. Da es sich bei den Vollzugsbeamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes um solche im Sinne von StPO und OWiG handelt, sind sie insoweit der jeweils örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft als auch den Strafgerichten untergeordnet 156.
b) Amts- und Vollzugshilfe
durch die ordentliche Polizei
Gemäß Art. 35 I GG leisten die Behörden des Bundes und der Länder sich gegenseitig Amtshilfe. Hierunter versteht man die in den §§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der meisten Länder geregelte ergänzende Hilfe, die eine Behörde einer anderen auf deren Ersuchen hin leistet 157 . Da der Präsident bei der Ausübung seiner Polizeigewalt Polizeibehörde für den Bereich des Parlamentsgebäudes ist und dort für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu sorgen hat, ist die örtliche Polizeibehörde aufgrund der Bestimmung des Art. 35 I GG verpflichtet, einem Hilfegesuch des Präsidenten zu entsprechen und zur Durchsetzung seiner polizeilichen Anordnungen Polizeivollzugsbeamte in das Parlament zu entsenden. Für den Bundestagspräsidenten ist das Amtshilfeersuchen an die ordentliche Polizei eine Alternative zum Einsatz seines hauseigenen Polizei- und Sicherheitsdienstes oder für den Fall, daß dieser zur Gefahrenabwehr allein nicht in der Lage ist. Für die Landtagspräsidenten hingegen ist das Amtshilfeverfahren mangels eigener Exekutivkräfte oftmals die einzige Möglichkeit, polizeiliche Anordnungen zwangsweise durchzusetzen 158. Das Amtshilfeersuchen ist seiner Art nach nicht nur ein bloßer Hinweis an die örtliche Polizei, daß im Hause ein die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedrohender Zustand herrsche und sie Maßnahmen in eigener Zuständigkeit ergreifen möge 159 . Mit der Anforderung von Polizeivollzugsbeamten geht damit kein Verzicht des Präsidenten auf die Ausübung seiner Polizeigewalt einher, der die Befug153 Vgl. die Nachweise bei Wacke, Polizeirecht als Bundesrecht, S. 169. 154 §§6 Nr. 1,9 Nr. 1 UZwG. 155 Tilch, in: Münchener Rechtslexikon, Bd. II, S. 1287. 156 Vgl. Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1584). 157 Vgl. die Legaldefinitionen in den genannten Normen. 158 Siehe dazu die Ausführungen oben. 159 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1.1992,1577 (1584).
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
nisse der örtlichen Polizei wieder aufleben lassen würde 160 . Die ersuchte Polizeibehörde ist grundsätzlich verpflichtet, dem Amtshilfeersuchen des Parlamentspräsidenten Folge zu leisten, da ein Verweigern der Hilfe zu einer Beeinträchtigung der Aufgabenwahrnehmung des Parlaments führen könnte 161 . Einzig und allein in den Fällen des § 5 I Nr. 1 - 5 VwVfG, der sich wortgleich in den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder wiederfindet, darf das Ersuchen abgelehnt werden. Ansonsten muß Amtshilfe geleistet werden. Überstellt die ersuchte Polizeibehörde gemäß ihrer Verpflichtung aus Art. 35 I GG Polizeivollzugsbeamte, so unterstehen diese dann dem Parlamentspräsidenten. Sie haben während der Zeit ihrer Überstellung ausnahmslos den Weisungen des Parlamentspräsidenten als besonderer Polizeibehörde zu folgen 162 . Die Weisungsbefugnis des Präsidenten gegenüber den abgestellten Polizeibeamten kann jedoch nicht unbeschränkt sein. Vielmehr müssen sich seine Anweisungen im Rahmen des allgemeinen Polizeirechts halten, so daß auch hier der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel gilt 1 6 3 . Die Amtshilfe erschöpft sich also darin, daß die Polizeibehörde Personal und Ausrüstung zur Verfügung stellt, aber keine weitergehenden polizeilichen Maßnahmen treffen kann. Auf diese Weise bleibt das Parlament getreu dem Gewaltenteilungsprinzip weitestgehend von Einflußmöglichkeiten der Exekutive frei 1 6 4 . Die Verantwortung für die Durchführung der Maßnahmen trägt nach § 7 I I der Verwaltungsverfahrensgesetze die um Amtshilfe ersuchte Behörde, während die ersuchende Behörde gegenüber der ersuchten die Verantwortung für deren Rechtmäßigkeit trägt. Ein an die Bundeswehr gerichtetes Amtshilfeersuchen hat im übrigen wegen § 5 Π Nr. 1 der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder keine Aussicht auf Erfolg. Der Einsatz von Bundeswehrtruppen zur Unterstützung der Polizei im Sinne der Artikel 87 a IV, 91 I I GG untersteht allein dem Einsatz- und Entscheidungsmonopol der Bundesregierung und ist für den Spannungs- und Verteidigungsfall speziell in Art. 87 a ΙΠ und 115 f. I Nr. 1 GG geregelt 165 . Neben der Amtshilfe ist auch eine Vollzugshilfe denkbar 166 , die in den neueren Polizeigesetzen als eigenständige Aufgabe in der allgemeinen Aufgaben-Norm ausgewiesen wird 1 6 7 . Zwar weist die Vollzugshilfe gewisse Ähnlichkeiten mit der 160 So Kleinschnittger, S. 143; a.A. offenbar Klinke, S. 189. 161 Vgl. Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 24; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 5; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 b; Rode, S. 43; Reinecke, S. 221 f.; Kleinschnittger, S. 142. ι « Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 16; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 8; Versteyl, in: v. Münch/ Kunig, Art. 40, Rn. 24; Ritzel / Bücker, § 7, Anm. II d, S. 7; Rothaug, S. 59; Gottschalck, S. 39. 163 Nauber, S. 102. 164 Vgl. Leinius, in: NJW 1973,448 (449). 165 So zu Recht Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 ( 1585). 166 Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Leinius, in: NJW 1973,448 (449); ebenso Böttcher, S. 124. 167 § 60 IV PolG-BW; Art. 2 III Bay PAG; § 4 V ASOG-Be; § 1 III VGPolG-Bg; § 1 III BremPolG; § 1 V HSOG; § 7 II 1 SOG-MV; § 1 IV NGefAG; § 1 III PolG-NRW; § 1 IV POG-RP; § 1 IV SPolG; § 2 III SOG-SA; § 168 II 1 Nr. 1 LVwG-SH; § 2 III ThürPOG.
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
273
Amtshilfe auf, ist jedoch nicht einfach als deren Unterfall zu qualifizieren 168 . Vollzugshilfe kommt immer dann in Betracht, wenn Polizeibehörden anderen Behörden Hilfe leisten, soweit diese nicht über eigene Vollzugsorgane verfügen oder Maßnahmen nicht selbst durchsetzen können 169 . Exakt diese Sachlage ist wie oben geschildert bei den Landtagspräsidenten gegeben. Die Vollzugshilfe leistenden Polizeibehörden sind dann lediglich dafür verantwortlich, wie die Vollzugshilfe durchgeführt wird, während der Erlaß der ihr zugrundeliegenden polizeilichen Anordnung und die Entscheidung über ihre Vollstreckung dem Parlamentspräsidenten obliegt 170 .
3. Das Eingreifen der ordentlichen Polizeibehörden im Landtag in Ausnahmefallen Ohne ein Ersuchen des Präsidenten ist weder die Orts- noch eine sonstige Polizeibehörde berechtigt, Amtshandlungen im Landtagsgebäude vorzunehmen. Die Zuständigkeit aller anderen Bundes- und Landespolizeibehörden ist also insoweit ausgeschlossen171. Sicherheitspolizeiliche Anordnungen, die eine Polizeibehörde für das Parlamentsgebäude ohne Ersuchen des Präsidenten trifft, sind wegen der fehlenden örtlichen Zuständigkeit nichtig oder unwirksam 172 . Ob jener Grundsatz der Exemtion von aller anderen Polizeigewalt jedoch ausnahmslose Geltung beansprucht, wird im Schrifttum unterschiedlich bewertet. Umstritten ist dabei vor allen die Frage, ob andere Polizeiorgane bei dringender Gefahr im Verzuge sowie bei hinzutretender Handlungsunfähigkeit des Präsidenten ohne dessen Einverständnis im Parlamentsgebäude tätig werden dürfen. Während ein Teil des Schrifttums ein polizeiliches Eingreifen mangels verfassungsrechtlicher Grundlage ablehnt 173 , wird von einem anderen Teil der Literatur ein polizeiliches Tätigwerden bei Gefahr im Verzug für zulässig gehalten 174 . Die Befürworter weisen insbesondere darauf hin, daß die verfassungsrechtlichen Normierungen der präsidialen Polizeigewalt nur die grundsätzliche sachliche Zuständigkeitsverteilung vor Augen haben, eine Einengung der davon unabhängigen Kompetenzen der Polizeibehörden bei polizei168 So Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 146, streitig. 169
Vgl. Denninger, in: Lisken/Denninger, Abschnitt E, Rn. 170 ff. no Tilch, in: Münchner Rechtslexikon, Bd. III, S. 1036. 171 Siehe dazu oben S. 257 f. 172 Reinecke, S. 259. 173 So Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 40, Rn. 26; Schneider, in: AK, Art. 40, Rn. 14; Jarass/Pieroth, Art. 40, Rn. 9; Magiera, in: Sachs, Art. 40, Rn. 29; Troßmann, § 7, Rn. 38; Ritzel/Bücker, § 7, Anm. II 2 d; Kleinschnittger, S. 134 f. 174 Achterberg/Schulte, in: v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 64; Versteyl, in: v. Münch/ Kunig, Art. 40, Rn. 24; Geller /Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 6 b; Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Rn. 5; Stern II, S. 85; Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 72; Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (37); Vogel, S. 72; Gerlach, S. 117; Klinke, S. 186. Differenzierend, aber mit gleichem Ergebnis Reinecke, S. 259 ff. 18 Köhler
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
lichem Notstand sei hingegen nicht intendiert 175 . Sollte daher beispielsweise bei einer Auseinandersetzung mit Waffen im Parlamentsgebäude akute Lebensgefahr bestehen, dann können dieser Ansicht entsprechend auf der Straße patrouillierende Schutzpolizisten aufgrund allgemeinpolizeilicher Zuständigkeit einschreiten 176. Zwar ist die Zulässigkeit von Einbrüchen in die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten nur schwer mit der historisch gewachsenen funktionalen Bedeutung dieser Kompetenz in Einklang zu bringen. Jedoch muß der Sinn und Zweck der Polizeigewalt auch immer im Zusammenhang mit der Werteordnung des Grundgesetzes gesehen werden, die den Grundrechten einen ausdrücklichen Vorrang gegenüber allen anderen Gütern und Prinzipien einräumt. Soweit also eine Gefährdung von Grundrechten oder ranggleichen anderen Rechtsgütern besteht, ist deshalb aus übergeordneten Verfassungsentscheidungen von einer subsidiären Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Parlamentspräsidenten auszugehen177. Gleichwohl sollte vor, während oder nach dem Eingreifen der ordentlichen Polizeibehörden versucht werden, das Einverständnis oder die Genehmigung des Präsidenten einzuholen 178 . Da es sich zudem nur um ein hilfsweises Tätigwerden handelt, geht die Garantenstellung für die Gefahrenabwehr in dem Augenblick wieder auf den Parlamentspräsidenten über, in dem er selbst zur Ausübung seiner Polizeigewalt in der Lage ist. Im Gegenzug erlischt die Befugnis der Sicherheitsbehörden zur präventiven Nothilfe oder Nacheile 179 . Im übrigen ist diese Problematik von nur geringer politischer Bedeutung. Legt ein Landtagspräsident indessen Wert auf ein Eingreifen der ordentlichen Polizeibehörden in Notfällen, so ist zur Rechtsklarheit angeraten, daß er mit dem Innenminister ein entsprechendes Verwaltungsabkommen abschließt180. Ein weiterer Einbruch in die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten besteht, wenn das Bundeskriminalamt gem. § 5 BKAG polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung selbst wahrnimmt oder auf Anordnung des Bundesministers des Innern oder auf Ersuchen des Generalbundesanwalts eigene kriminalpolizeiliche Ermittlungen durchführt, § 5 ΙΠ Nr. 2, 3 BKAG. Hier erweist sich aufgrund des Prinzips ,3undesrecht bricht Landesrecht" nach Art. 31 GG und des im Grundgesetz selbst enthaltenen verfassungsrechtlichen Vorbehalts der Art. 73 Nr. 10 und 871, unter dem die Polizeihoheit der Länder nun einmal steht, die Kraft der Länderverfassungen als zu schwach, um entsprechende Einbrüche abzuwehren 1 8 1 . Gerade in Ansehung der Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten sollte 175 Vgl. für Nordrhein-Westfalen Geller /Kleinrahm, Art. 39, Anm. 6 b. 176 Versteyl, in: v. Münch/Kunig, Art. 40, Rn. 24. 177 So Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1.1992,1577 (1583). 178 Vgl. Achterberg/Schulte, in: v. Mangoldt/Klein, Art. 40, Rn. 64. 179 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1.1992,1577 (1583). 180 Neumann, Art. 8 VNV, Rn. 15. lei Vgl. Nawiasky, Art. 21 LV-By, Rn. 3; Brandl, in: BayVBl. 1964, 280 (282); Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (37).
IV. Die Ausübung der Polizeigewalt
275
deshalb auch hier stets angestrebt werden, das Einverständnis des Landtagspräsidenten zu dem bevorstehenden bzw. laufenden bundespolizeilichen Eingreifen im Landtagsbereich einzuholen oder zumindest dessen Genehmigung zu erhalten. Für den Bundestagspräsidenten macht Köhler auf einen weiteren Einbruch in dessen Polizeigewalt aufmerksam, der im sogenannten Inneren Notstandsfall auftreten kann. Die für diesen Fall in Art. 91 Π GG niedergelegte Befugnis der Bundesregierung zur Übernahme der vollzugspolizeilichen Gewalt hat - auf den räumlichen Bereich des Bundestages bezogen - im Ergebnis zur Folge, daß die Bundesregierung den Bundestagspräsidenten als Polizeiorgan und damit auch seine Polizeivollzugsbeamten ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes oder von Länderpolizeien im räumlichen Bereich des Bundestages einzusetzen berechtigt ist 1 8 2 . Darüber hinaus kann die Bundesregierung nach Maßgabe des Art. 87 a IV GG dort Streitkräfte einsetzen. Selbst wenn die verfassungsrechtliche Verankerung der präsidialen Polizeigewalt das Parlament ja gerade vor jedweder Unterordnung unter die Exekutive freistellen will, so lassen Gestaltung und Entstehungsgeschichte der Notstandsartikel erkennen, daß im Interesse der Erhaltung des Bestandes des Staates Gesichtspunkte der Gewaltenteilung zurücktreten müssen und das Parlament um der Effizienz der Gefahrenabwehr für das Ganze willen einen weniger herausragenden Stellenwert einnimmt, als es für gewöhnlich der Fall ist. Die Bundesregierung ist allerdings zur sofortigen Rückgabe der Polizeigewalt an den Bundestagspräsidenten verpflichtet, sobald dieser wieder zur wirksamen Gefahrenabwehr in der Lage ist, und sei es unter Inanspruchnahme von Amtshilfe. Für die Landtagspräsidenten hat die geschilderte Situation im übrigen keine derartigen Auswirkungen. Ein letzter Einbruch in die präsidiale Polizeigewalt, der sowohl die Landtagspräsidenten als auch den Bundestagspräsidenten betrifft, besteht schließlich im Spannungs- und Verteidigungsfall. Entsprechend den Art. 87 a ΙΠ, 115 f. I Nr. 1 GG obliegt den Streitkräften - mitunter zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen der „Schutz ziviler Objekte", worunter u. a. Parlamentsgebäude zu verstehen sind 183 . Auch hier wird also die ansonsten lückenlose Exemtion der Landtage und des Bundestages durchbrochen und der Parlamentspräsident in seiner Polizeigewalt beschränkt.
182 Vgl. hierzu wie im folgenden Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992, 1577 (1583); s.a. Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 16. 183 Köhler, Polizeigewalt, in: DVB1. 1992,1577 (1583). 18*
276
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
V. Der Rechtsschutz gegen polizeiliche Maßnahmen des Landtagspräsidenten Gemäß Art. 19 IV GG wird Rechtsschutz gewährt, wenn jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird. Dies gilt auch für die polizeilichen Maßnahmen des Landtagspräsidenten. Da es sich bei seinen polizeilichen Verfügungen um Verwaltungsakte im Sinne des § 35 VwVfG handelt 184 , fallen sie aufgrund der Generalklausel des § 40 I VwGO in die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit 185 . Dem Betroffenen stehen damit für ein Verwaltungsstreitverfahren alle Rechtsschutzmöglichkeiten des Verwaltungsprozeßrechts zur Verfügung, wobei sich die Klageart nach der Art der polizeilichen Maßnahme richtet. Von größter Bedeutung sind dabei die Rechtsbehelfe des Widerspruchs (§ 68 VwGO) und der Anfechtungsklage (§ 74 VwGO), zum Teil unter Berücksichtigung der Modalitäten der Landespolizeigesetze. So gilt etwa für Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Anordnungen des bayerischen Landtagspräsidenten Art. 12 POG analog mit der Maßgabe, daß Widerspruchsbehörde wie auch Aufsichtsbehörde im Sinn dieser Vorschrift allein der Präsident ist 1 8 6 . Für Entschädigungsansprüche nach Polizeirecht 187 sind hingegen die ordentlichen Gerichte zuständig188. Die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Polizeiverwaltungsakte des Präsidenten war jedoch nicht von Anfang an gegeben. Zwar hatten die meisten Länder in der Zeit von 1863 bis zur Weimarer Verfassung Verwaltungsgerichte geschaffen. Ein wirkungsvoller und umfassender Verwaltungsrechtsschutz war damit allerdings noch nicht erreicht, da die Unabhängigkeit dieser Verwaltungsgerichte nicht überall in hinreichender Weise sichergestellt und die Zulässigkeit der Anfechtungsklage meist nach dem Enumerationsprinzip auf die gesetzlich besonders festgelegten Fälle beschränkt war 1 8 9 . Lediglich in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen, mit gewissen Einschränkungen auch in Württemberg, Sachsen, Lübeck, Thüringen, war gegen sämtliche polizeiliche Maßnahmen der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Entsprechendes galt auch in Preußen, dem größten deutschen Staat, was insoweit für die weitere Entwicklung des Polizeirechts von wesentlicher Bedeutung war 1 9 0 .
iw Vgl. Reinecke, S. 232 ff. 185 Vgl. vertiefend hierzu Götz, Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Polizei, in: JuS 1985, 869-873. 186 So Köhler, Staatsrechtliche Stellung, in: BayVBl. 1988, 33 (37). 187 Vgl. etwa §§ 41 und 43 PolG-BW. 188 § 44 PolG-BW. 189 Reinecke, S. 232. 190 Drews / Wacke / Vogel / Martens, S. 571.
VI. Das,Zählsorge-Telefon"
277
VI. Das „Zählsorge-Telefon" als besonderer Anwendungsfall der präsidialen Polizeigewalt In einer besonders schwierigen Situation befand sich der Präsident des Landtags von Baden-Württemberg, als der Landesverband „Die Grünen Baden-Württemberg" im Februar 1987 zum Boykott der gesetzlich beschlossenen und vom Bundesverfassungsgericht für rechtmäßig erklärten Volkszählung aufrief und die Landtagsfraktion der Grünen zum Zwecke der Boykottberatung ein „ZählsorgeTelefon" einrichtete. Bei diesem Telefon handelte es sich um das Telefon eines Abgeordneten der Grünen, das diesem von der Landtagsverwaltung als Abgeordnetenfernsprechanschluß zugeteilt worden war. Nach einem Schriftwechsel und einem Gespräch zwischen der Fraktion und dem Landtagspräsidenten teilte dieser schließlich der Fraktion schriftlich mit, daß er veranlaßt habe, den Telefonanschluß mit sofortiger Wirkung zu sperren. Gleichzeitig mit der Sperrung des Fernsprechanschlusses wurde dem betroffenen Abgeordneten ein neuer Anschluß zugeteilt. Gegen diese Maßnahme strengten die Landtagsfraktion sowie neun ihrer Mitglieder ein Organstreitverfahren beim Staatsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg an und beantragten die Feststellung, daß die Sperrung des „Zählsorge-Telefons" durch den Landtagspräsidenten gegen Art. 32 II und Art. 27 ΠΙ LV-BW verstoßen habe. Der Staatsgerichtshof hat den Antrag jedoch zu Recht als unbegründet abgewiesen 191 . Er stellte fest, daß der Landtagspräsident gemäß der ihm nach Art. 32 Π LV-BW zustehenden Polizeigewalt befugt war, den Anschluß zu sperren, um eine drohende Gefahr für die öffentliche Sicherheit im polizeilichen Sinne abzuwehren. Der Staatsgerichtshof erblickte die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit im wesentlichen in einer Verletzung des Rechtsstaatsprinzips und des Demokratieprinzips durch die Fraktion der „Grünen", die die zur Rede stehende Aktion im Bewußtsein der Rechtswidrigkeit geplant hatte. Dabei sind Abgeordnete und Fraktionen in ganz besonderer Weise verpflichtet, die ihnen anvertraute gesetzgebende Gewalt sowie die Überwachung der Ausübung der vollziehenden Gewalt ordnungsgemäß wahrzunehmen und sich hierbei an wichtige Verfassungsprinzipien wie eben das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip zu halten. Wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips ist die selbstverständliche Gebundenheit eines jeden Bürgers an die verfassungsgemäß beschlossenen Gesetze. Um so mehr, so der StGH folgerichtig, müßten sich gewählte Abgeordnete, denen selbst gesetzgebende Gewalt anvertraut sei, an ordnungsgemäß ergangene Normen wie das Volkszählungsgesetz und die weiteren mit ihm in Zusammenhang stehenden Vorschriften halten. Außerdem sah der Staatsgerichtshof in diesem Verhalten eine Verletzung des Demokratieprinzips, dessen zentraler Gedanke die Anerkennung demokratischer Entscheidungsfindung mit Hilfe der Mehrheit ist sowie ihre 191 StGH Baden-Württemberg, Urteil vom 28. 1. 1988 - GR 1/87, in: NJW 1988, 31993200 sowie in: DVB1. 1988,632 ff. mit Anmerkung von Thilo Weichert.
7. Abschnitt: Die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten
Respektierung durch die Minderheit. Indem die Abgeordneten der Fraktion der Grünen einem Gesetz unter Ausnutzung ihres parlamentarischen Status den Gehorsam verweigern wollten, verstießen sie nach der zutreffenden Ansicht der Richter gegen die verfassungsmäßige Ordnung, an die sie als Parlamentarier besonders gebunden sind. Gegen die hierin liegende Bedrohung der öffentlichen Sicherheit konnte der Landtagspräsident kraft seiner Polizeigewalt vorgehen. Darüber hinaus erklärte das Gericht in ebenso zutreffender Weise auch die sonstigen Voraussetzungen polizeilichen Handelns für erfüllt. Angesichts des verfassungswidrigen Verhaltens der Fraktionsmitglieder sei das Vorgehen des Landtagspräsidenten im öffentlichen Interesse geboten und die Sperrung des Telefonanschlusses die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderliche Maßnahme gegen die Abgeordneten als Verhaltensstörer gewesen. Indem der Präsident dem betroffenen Abgeordneten gleichzeitig als Ersatz für seinen gesperrten Anschluß einen neuen zur Verfügung stellte, gestaltete er den Eingriff so, daß er die unter den gegebenen Umständen am wenigsten beeinträchtigende Maßnahme anordnete. Auch im übrigen ist das Urteil unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu beanstanden, zumal der Staatsgerichtshof betonte, daß der Einsatz der präsidialen Polizeigewalt gegen Landtagsabgeordnete und gegen eine Fraktion nur dann erfolgen dürfe, wenn es keine andere Möglichkeit gebe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren. Hiervon war vorliegend jedoch auszugehen, da die Fraktion und ihre Mitglieder in eindeutiger Weise im Begriff gewesen sind, grundlegende Pflichten ihres parlamentarischen Status zu verletzen.
ter Abschnitt
Der Landtagspräsident als Leiter der Parlamentsverwaltung und Vertreter des Landtags Neben der ordnungsgemäßen Leitung der Vollversammlungen des Parlaments und der Ausübung des Hausrechts sowie der Polizeigewalt ist es Aufgabe des Landtagspräsidenten, die Geschäfte des Landtags zu führen 1. Zur Unterstützung seiner Geschäftsführungstätigkeit kann sich der Präsident einer eigenen Landtagsverwaltung bedienen, an deren Spitze er steht2. Organisationsrechtlich ist er selbst Verwaltungsbehörde 3. Mit der Stellung des Präsidenten als Leiter der Parlamentsverwaltung korrespondiert eine umfassende Vertretungsbefugnis, insbesondere gegenüber den anderen Staatsorganen. Als konsequente Folge seiner Behördeneigenschaft vertritt er zudem das Land in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten des Landtags4.
L Die Parlamentsverwaltung Die Erfüllung der vielfältigen parlamentarischen und administrativen Aufgaben des Landtagspräsidenten wird im wesentlichen durch die Parlamentsverwaltung sichergestellt. Ein reibungsloses Funktionieren dieser Verwaltung ist unerläßliche Voraussetzung für die volle politische Wirksamkeit der Volksvertretung 5. Hierfür hat der Präsident gegenüber dem Parlament Sorge zu tragen6. ι Art. 57 III 1 LV-Th, § 4 I 1 GOLT-Th; Art. 71 I 1 LV-Sl; Art. 29 III 1 LV-MV, § 4 I 1 GOLT-MV; Art. 14 III 1 LV-SH, § 5 11 GOLT-SH; § 1411 GO-Be; § 91 GOLT-BW; § 441 1 GOLT-He; § 1211 GOLT-By; § 1011 GOLT-NRW; § 411 GOLT-Ss; § 511 GOLT-SA; § 6 II GOLT-Nds („verwaltet seine Angelegenheiten"); § 4 Satz 1 GOLT-RP; § 12IV 1 GOBü-Br. 2 Art. 21 II 1 LV-By; Art. 18 II 1 LV-Ha, § 5 I GOBü-Ha; Art. 18 III 1 LV-Nds; Art. 57IV 1 LV-Th; Art. 49 III 1 LV-SA, § 5 III 1 GOLT-SA; Art. 711 2 LV-Sl; § 9 I V 2 GOLT-BW; § 4 V 1 GOLT-Ss; § 5 III GOLT-SH; § 4 V GOLT-MV. 3 Achterberg, S. 306f.; David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 30; Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 9; Meder, Art. 21 LV-By,Rn. 2. 4 Art. 86 Satz 3 LV-He, § 44 I 1 GOLT-He; Art. 39 I 1 LV-NRW, § 10 I 1 GOLT-NRW; Art. 21 II LV-By, § 12 I 2 GOLT-By; Art. 47 IV 2 LV-Ss, § 4 I 1 GOLT-Ss; Art. 18 II 2 LVHa, § 5 II GOBü-Ha; Art. 18 III 1 LV-Nds, § 6 II GOLT-Nds; Art. 57 IV 1 LV-Th, § 4 I 1 GOLT-Th; Art. 85 III 3 LV-RP, § 4 Satz 1 GOLT-RP; Art. 32 III 2 LV-BW, § 9 I GOLT-BW; Art. 49 III 1 LV-SA, § 5 I 1 GOLT-SA; Art. 71 I 4 LV-Sl; Art. 41 IV 2 LV-Be, § 141 1 GOBe; Art. 92 III LV-Br, § 12 IV 2 GOBü-Br; Art. 69 IV 1 LV-Bg; Art. 29 V LV-MV, § 4 I 1 GOLT-MV; Art. 14 III 2 LV-SH, § 5 12 GOLT-SH. 5 Gerlach, S. 118.
280
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
Die Wurzeln parlamentarischer Dienste reichen zurück bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon damals gab es Saaldiener, Protokollanten sowie andere Hilfestellungen und Dienstleistungen. Bereits um 1820 läßt sich beispielsweise für das Königreich Württemberg ein sog. „ständischer Dienst" der Kammern - bestehend aus Registratoren (Archivaren), Canzellisten und Bürodienern - nachweisen7. Zwar waren diese frühen Erscheinungsformen parlamentarischer Verwaltungsstrukturen in Deutschland vor allem in personeller Hinsicht nicht sehr umfangreich. Gleichwohl handelte es sich meist um organisatorisch verfestige Formen parlamentarischer Verwaltung, welche mit dem allmählichen Bedeutungszuwachs der Parlamente stetig ausgebaut wurden 8. Diese Entwicklung zeigt sich auch darin, daß schon im frühkonstitutionellen Württemberg ein eigener Haushaltstitel für die mit der Parlamentsverwaltung einhergehenden finanziellen Aufwendungen vorgesehen war 9 . Vor allem aber im Kaiserreich stellten sich aufgrund der vermehrten Gesetzgebungstätigkeit höhere Anforderungen an die vorbereitende Zuarbeit und die Durchführung parlamentarischer Tätigkeiten, so daß sich hier eine feste institutionelle Form von Parlamentsverwaltung und parlamentarischen Diensten herausbildete 10 .
1. Rechtsgrundlage und Stellung im Verwaltungsaufbau der Länder Ihre Rechtsgrundlage findet die Parlamentsverwaltung in dem verfassungsrechtlich kodifizierten autonomen Selbstorganisationsrecht der Parlamente11. Hiervon werden alle im Geschäftsbereich liegenden Maßnahmen umfaßt, die zur Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Ordnung und ihrer Verfahren erforderlich sind, also auch das Recht, einen eigenen technischen und wissenschaftlichen Apparat zur eigenen Unterstützung zu schaffen und zu unterhalten 12. Die mitunter in den Landessatzungen und parlamentarischen Geschäftsordnungen anzutreffenden Bestimmungen über die Verwaltung des Landtags sind demnach lediglich Ausdruck dieser Parlamentsautonomie13. Die Funktion der Landtagsverwaltung kann als eine umfassende Hilfstätigkeit für das Parlament bezeichnet werden 14. Aus dieser Tätigkeit heraus ergibt sich, daß sie keiner anderen Staatsgewalt als der Legislative selbst unterworfen sein 6 Wermser, S. 91; Rummel, S. 31. 7 Siehe dazu H. Brandt, S. 196 f. 8 So v. Westphalen, S. 107. 9 H. Brandt, S. 196 f. m Vgl. die detaillierten Ausführungen von Hatschek, S. 248 ff. h So bereits Hatschek, S. 248; ebenso Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl-1; Schick, in: DVP 1989,153 (159); Kleinschnittger, S. 147. 12 Jekewitz, in: DVB1. 1969,513; v. Westphalen, S. 108. 13 Vgl. Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 1. 14 Voigtländer, in: Röhring/Sontheimer, S. 496.
I. Die Parlamentserwaltung
281
kann. Im Gegensatz zur allgemeinen Staatsverwaltung, die der Organisationsgewalt der Exekutive entspringt und vom Parlament lediglich kontrolliert wird, ist sie ministerialfrei, d. h. selbständig und von allen Regierungsstellen völlig unabhängig 15 . Da sie aber die Verwaltungsgeschäfte des Landtags führt, soweit sie zur Erfüllung der parlamentarischen Aufgaben notwendig sind, bleibt sie Verwaltung im eigentlichen Sinne des Wortes. Zudem handelt es sich bei ihr um eine selbständige oberste Landesbehörde, denn sie übt als eine organische Einheit Verwaltungstätigkeit nach außen aus 16 . Gleichwohl ist die Landtagsverwaltung ein Sonderfall, schon allein deshalb, weil ein Parlament kein Verwaltungsorgan und auch sonst mit keinem anderen Staatsorgan vergleichbar ist 1 7 . Aus diesem Grunde kann die Parlamentsverwaltung keinem der bekannten Verwaltungstypen zugeordnet werden 18 . Parlamentsverwaltungen sind mithin als Verwaltungen sui generis einzustufen, in der alle administrativen, wissenschaftlichen und organisatorisch-technischen Dienste zusammengefaßt sind, damit das Parlament und dessen Organe die vielfältigen verfassungsrechtlichen Aufgaben erfüllen können19.
2. Aufgaben und Organisation Die Organisation der Parlamentsverwaltung hängt ausschließlich von den Aufgaben ab, die das Parlament zu erfüllen hat. Dazu gehört sowohl die Unterstützung des Landtagspräsidenten bei der Ausübung seiner Leitungs- und Koordinierungsfunktionen wie die Unterstützung der verschiedenen parlamentarischen Gremien und der Abgeordneten bei der Wahrnehmung ihres Mandats. Die parlamentarischen Geschäftsordnungen der Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Thüringen umschreiben den Aufgabenbereich ihrer Landtagsverwaltungen etwas konkreter: „Die Unterstützung des Präsidenten bei der Durchführung seiner Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Vorbereitung der Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse, die Entgegennahme von Gesetzentwürfen, Anträgen, sonstigen Vorlagen, Eingaben und anderen an den Landtag gerichteten Schriftstücken und deren vorbereitende Bearbeitung ist Aufgabe der Landtagsverwaltung" 20. Hiervon ausgehend lassen sich zwei Bereiche von Verwaltungsfunktionen unterscheiden, nämlich die Wahrnehmung parlamentsbezogener Dienste einerseits sowie die Ausübung allgemeiner Verwaltungstätig15 Schindler, in: Schneider /Zeh, § 29, Rn. 1. 16 Jekewitz, in: DVB1. 1969, 513. 17 So Schindler, in: Schneider/Zeh, § 29, Rn. 1 f. 18 Vgl. v. Westphalen, S. 108. 19 Ebenda m.w.N. 20 § 9 I GOLT-Nds.; § 1101 GOLT-NRW; § 78 I Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 8 I GOLT-SA; § 132 I GOLT-RP; § 124 I GOLT-Th. Die Geschäftsordnungen der Bremischen Bürgerschaft und des Bayerischen Landtags treffen dagegen nur sehr generelle Anordnungen, vgl. § 73 Satz 1 GOBü-Br, § 147 GOLT-By; die restlichen Geschäftsordnungen machen gar keine Angaben.
282
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
keit andererseits. Letztere wiederum gliedert sich in Organisations- und Ressourcenverwaltung, Vorbereitung und Vollzug parlamentsspezifischer Gesetze (etwa Abgeordnetengesetz, Parteiengesetz) und Öffentlichkeitsarbeit. Angesichts der Aufgabenvielfalt kann die Parlamentsverwaltung durchaus als Dienstleistungsunternehmen charakterisiert werden. Die Organisationsgewalt der Verwaltung obliegt dem Landtagspräsidenten21. Er hat die organisatorischen Voraussetzungen für den Ablauf der parlamentarischen Arbeit sicherzustellen und bestimmt demzufolge auch das Organisationsschema der Verwaltung 22. Dabei hängen Umfang und Größe der Landtagsverwaltung von vielen verschiedenen Faktoren und Bedingungen ab 23 . Hierzu zählen vor allem die Größe des Landes, Art und Umfang der Wahrnehmung der Parlamentsfunktionen, Zahl und Status der Abgeordneten sowie Zahl und Größe der Fraktionen. Ein ebenfalls wichtiges Kriterium ist das Ausmaß der Arbeitsteilung zwischen Parlamentsverwaltung und Fraktionen, die ihrerseits Mitarbeiterstäbe beschäftigen und auf diese Weise - je nach Aufgabenzuweisung - zur Entlastung der Parlamentsverwaltung beitragen können. Der Umfang der Verwaltung ergibt sich aber auch entscheidend aus den Anforderungen, die das Parlament im Rahmen seiner Funktionswahrnehmung an sich selbst und damit ebenso an die unterstützende Parlamentsverwaltung stellt. So hat beispielsweise die Verwaltung des Landtags von NordrheinWestfalen in der letzten Legislaturperiode auf die Einsetzung eines Unterausschusses „Europapolitik" mit der Einrichtung eines eigenen Europareferats reagiert 24. Auch hierfür muß entsprechendes Personal bereitgestellt werden. Entsprechendes gilt im übrigen auch für eventuell einzurichtende Untersuchungsausschüsse. Dies alles zeigt, daß die Verwaltungsorganisation eines Parlaments alles andere als ein statisches Gebilde ist. Vielmehr ist sie geprägt von einer Fülle an Neuerungen und Erweiterungen. Insbesondere die rasante Entwicklung in der elektronischen Informations- und Kommunikationstechnik wird auf die Verwaltungsstruktur einen nicht zu unterschätzenden Einfluß nehmen und Organisation und Arbeitsweisen der Parlamentsverwaltungen nachhaltig verändern.
a) Der allgemeine Verwaltungsaufbau Aufbau und Organisation der Parlamentsverwaltungen in den Ländern sind sehr verschieden. Dies betrifft insbesondere die einzelnen Sachgebiete, die zwar im Kern weitestgehend übereinstimmen, jedoch meist unterschiedlichen Abteilungen innerhalb der Landtagsverwaltung zugeordnet sind. Allgemeingültige Aussagen sind daher nur bedingt möglich. Gleichwohl soll im folgenden versucht werden, in 21 Lincke, Art. 57 LV-Th, Rn. 22. 22 Rummel, S. 27. 23 Vgl. dazu auch Schindler, in: Schneider/Zeh, § 29, Rn. 6 f. 24 Ockermann/Glende, S. 77.
I. Die Parlamentserwaltung
283
groben und mehr funktionsorientierten Zügen ein Bild der Parlamentsverwaltung zu zeichnen. Im übrigen wird auf die Organigramme der Landtagsverwaltungen im Anhang verwiesen. aa) Der Direktor beim Landtag Die Doppelstellung des Landtagspräsidenten als Vertreter des Parlaments in seiner Gesamtheit einerseits und als Chef der Landtagsverwaltung andererseits bringt es mit sich, daß er die Ausführung eines Teils seiner Aufgaben delegiert hat. Während er im parlamentarischen Bereich von den Vizepräsidenten vertreten wird, ist sein ständiger Vertreter in seiner Eigenschaft als Chef einer obersten Landesbehörde der Direktor beim Landtag 25 . Der Direktor ist damit sowohl an generelle Richtlinien des Präsidenten als auch an dessen Weisungen im Einzelfall gebunden26. Die Direktoren bei den Landesparlamenten stehen überwiegend in der Besoldungsgruppe Β 9, darunter besoldet nur in Bremen, Hamburg, Berlin und im Saarland (B 4, Β 6). Die Landtagsdirektoren werden damit wie die Staatssekretäre in den Landesregierungen besoldet. Diese Stellung stößt vor allem deswegen auf Bedenken, weil die besonderen Voraussetzungen des Staatssekretärs auf den Parlamentsdirektor nur bedingt zutreffen. Der Staatssekretär übt in einem sehr viel größeren Maße als der Direktor politische Funktionen aus, da er auf die effektive Durchführung der politischen Ziele der Regierung hinarbeitet und somit wesentlich zur Einhaltung der politischen Linie in der Verwaltungspraxis beiträgt 27. Die Arbeit der Landtagsverwaltung hingegen ist von ihrer Ausrichtung her grundsätzlich nicht geeignet, politisch beeinflußt zu werden 28. Ebensowenig begründet sie einen Nahtstellenbereich zwischen Politik und Verwaltung, der eine Mittlerrolle durch den Parlamentsdirektor erforderlich machen würde. Insofern sind Funktion und Wirkungsweise beider Ämter grundverschieden. Da aber selbst die rein administrativen Aufgaben des Direktors vielfach einen politischen Bezug aufweisen, ist der Parlamentsdirektor nach überwiegender Ansicht politischer Beamter im weitesten Sinne des Wortes 29. Jedoch nimmt er stets nur Verwaltungsaufgaben wahr, politische Befugnisse stehen ihm nach der Konstruktion des Amtes prinzipiell nicht zu. Als Leiter der Hausverwaltung ist der Parlamentsdirektor Vorgesetzter aller Bediensteten des Landtags, leitet die gesamte Parlamentsverwaltung und ist für die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Aufgaben dem Präsidenten gegenüber verantwortlich. Soweit er dazu vom Landtagspräsidenten ermächtigt ist, kann er aus25 § 13 II 1 GOLT-Bg; § 73 Satz 2 GOBü-Br; § 107 IV GOLT-He; § 9 II GOLT-Nds; § 110 II GOLT-NRW; § 132 II GOLT-RP; § 78 II Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 8 II GOLT-SA; § 124 II GOLT-Th. In Bremen und Hamburg lautet die Amtsbezeichnung: „Direktor bei der Bürgerschaft", in Berlin „Direktor beim Abgeordnetenhaus". 26 Korte/Rebe, S. 218; Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 16. 27 Vgl. Zimmerling, in: ZBR 1976, 368. 28 Kugele, S. 131. 29 Achterberg, S. 310; Jekewitz, in: DVB1. 1969, 513 (514); Feuchte, Art. 32 LV-BW, Rn. 16. Ablehnend Zimmerling, in: ZBR 1976, 368.
284
8. Abschnitt: Leiter der Parlaments Verwaltung und Vertreter des Landtags
nahmsweise Beförderungen aussprechen und Höhergruppierungen vornehmen. Mitunter wird ihm sogar zugestanden, den Präsidenten in Disziplinarangelegenheiten zu vertreten 30. Teilweise ist der Parlamentsdirektor für einzelne Verwaltungsbereiche bzw. Referate selbst zuständig. So nimmt etwa der Direktor beim Saarländischen Landtag das Amt des Beauftragten für den Haushalt gem. § 9 LHO wahr und ist damit für den Vollzug des Haushalts verantwortlich. Dazu gehört u. a. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans des Landtags sowie die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Neben der Durchführung administrativer Aufgaben wird der Direktor beim Landtag auch im parlamentarischen Bereich tätig. Hier steht er dem Präsidenten als Sekretär und Berater in Fragen der Geschäftsordnung zur Seite31. Zum Zweck der Beantwortung aufkommender Parlaments- und geschäftsordnungsrechtlicher Fragen nimmt er im allgemeinen sowohl an den Plenarsitzungen32 als auch an den Sitzungen von Präsidium 33 und Ältestenrat teil, so daß der Präsident jederzeit seinen Rat einholen kann. Im übrigen ist dem Parlamentsdirektor zumeist ebenfalls der Zutritt zu allen Ausschußsitzungen gestattet34. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang noch, daß der Direktor beim Landtag von Rheinland-Pfalz für interregionale Zusammenarbeit und Partnerschaften des Landtags zuständig ist. Zu diesem Zweck ist ihm ein sog. „Direktorbüro" zur Verfügung gestellt worden, das neben dem Sekretariat des Direktors besteht. Der Aufgabenbereich ist sehr vielschichtig und umfaßt etwa Kontakte zu ausländischen Parlamenten und Parlamentsorganisationen, Angelegenheiten des Internationalen Parlamentarier-Rates (IPR) sowie die Pflege der Partnerschaften des Landtags, etwa zu Burgund, South Carolina oder der Provinz Valencia. Aber auch die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Konferenzen der Präsidenten und Direktoren der deutschen Landesparlamente gehört zu den Tätigkeiten des Direktorbüros. Der Direktor kann im übrigen jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Antragsberechtigt hierfür ist jeder Vizepräsident des Landtags35.
bb) Die allgemeine Verwaltung Fester Bestandteil jeder Parlamentsverwaltung ist die Abteilung »Allgemeine Verwaltung" 36 , die die Hausverwaltung im eigentlichen Sinne wahrnimmt. Sie 30 Bücker, in: Schneider/Zeh, § 27, Rn. 16. 31 Rummel, S. 31; Gundelach, S. 339. 32 Vgl. z. B. § 78 II 2 Gesetz über den Landtag des Saarlandes. 33 Vgl. z. B. § 14 III GOLT-BW; § 6 VI GOLT-Ss; § 13 II 2 GOLT-Bg. 34 Vgl. etwa § 132 II 2 GOLT-RP; § 110 II 2.HS GOLT-NRW; § 107 IV 2.HS. GOLT-He; § 13 II 2 GOLT-Bg. 35 Vgl. z. B. § 118 II ThürBeamtenG. 36 In Thüringen: „Innere Verwaltung", in Sachsen: „Zentrale Dienste".
I. Die Parlamentserwaltung
285
trägt für die Bereitstellung des Personals, die Organisation des inneren Dienstbetriebs und die notwendige Infrastruktur für den Landtag Sorge. Das Aufgabenfeld ist weitgefächert. Neben Haushaltsangelegenheiten umschließt es die Mitwirkung bei Baumaßnahmen und die Beschaffung technischer Geräte ebenso wie die Ausstattung der Referate mit modernen Kommunikationseinrichtungen. In einigen Landtagsverwaltungen wie etwa in Bayern und Rheinland-Pfalz wurde daher ein eigenes EDV-Referat eingerichtet. Dieses Referat hat nicht nur die Aufgabe, technische Hilfestellungen bei der EDV-Nutzung zu geben, ζ. B. durch Mitarbeiterschulungen, sondern ist darüber hinaus zuständig für Bedarfsanalysen und Systemplanungen, Beschaffung und Installation von Hard- und Software, Weiterentwicklung und Betreuung der installierten Systeme und Netzwerke sowie die Planung, Erstellung, Betreuung und Weiterentwicklung der Software, um firmenunabhängig eigene Strategien zu entwerfen. Der Abteilung „Allgemeine Verwaltung" obliegt darüber hinaus die Festsetzung der Fraktionszuschüsse sowie der Erstattungsbeträge und Abschlagszahlungen nach dem Wahlkampfkostengesetz, ferner bewirkt sie sämtliche Leistungen an die Abgeordneten nach dem Abgeordneten- bzw. Aufwandsentschädigungsgesetz. Im wesentlichen sind folgende Leistungen zu nennen37: Monatliche Berechnung und Zahlbarmachung von steuerpflichtiger Entschädigung und von steuerfreier Aufwandsentschädigung sowie der Funktionszulagen der Präsidenten und Ausschußvorsitzenden. Bei der Entschädigung sind andere Einkünfte aus öffentlichen Kassen in dem im Abgeordnetengesetz geregelten Umfang anzurechnen. Der Zahlbetrag der Entschädigung ist daher unterschiedlich. Da die Aufwandsentschädigung bei der Nichtteilnahme an Pflichtsitzungen zu kürzen ist, muß auch diese jeden Monat für alle Abgeordneten neu festgestellt werden 38. Außerdem erfolgt die Berechnung und Zahlbarmachung der Übergangsgelder an ausgeschiedene Abgeordnete, wobei jeweils beim Wechsel der Legislaturperiode der Arbeitsaufwand erheblich ist 3 9 , die Berechnung und Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge an ehemalige Abgeordnete und ihre Hinterbliebenen 40, die Festsetzung und Anweisung der Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene 41 sowie die Festsetzung und Auszahlung von Versorgungsabfindungen bzw. Durchführung der Nachversicherung bei ausgeschiedenen Abgeordneten, die aufgrund ihrer Mandatsdauer noch keine Versor37
Die nachstehende Auflistung orientiert sich an den Aufgaben des Personalreferats des Bayerischen Landtagsamtes. Vgl. dazu auch Kremer, in: Die Verwaltung 1994,495 (515 ff.). 38 Vgl. z. B. Art. 5 - 8 BayAbgG. Bayern hat als erstes Land bereits 1979 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung einer Diätenkommission geschaffen (Änderungsgesetz vom 10. 8. 1979, GVB1., S. 222), die noch im selben Jahr erstmals vom Parlament gewählt wurde. Die anderen Länder sind diesem Beispiel überwiegend erst in den letzten Jahren gefolgt. 39 Vgl. z. B.Art. 11 BayAbgG. 40 Vgl. z. B. Art. 12-15, 17-19 BayAbgG. 41 Vgl. z. B. Art. 201, II BayAbgG.
286
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
gungsanwartschaft erworben haben42. Aufgabe der »Allgemeinen Verwaltung" ist schließlich auch die Berechnung und Auszahlung der Mitarbeiterentschädigung, ferner die jährliche Überprüfung der Verwendung der ausgezahlten Mitarbeiterentschädigung und Zurückforderung eventuell zuviel bezogener Beträge, sowie die Berechnung und Anweisung der Erstattungsbeträge für die Anschaffung von mandatsbedingten Informations- und Kommunikationseinrichtungen. Zu erwähnen ist noch die Berechnung der Reisekosten bei Dienstreisen von Abgeordneten und bei Ausschußreisen sowie die Bereitstellung der Abgeordnetenausweise und der Fahrscheine für die Deutsche Bahn AG 4 3 . Schließlich müssen auch die Auslagen bei Ausschußanhörungen und bei Untersuchungsausschüssen (Zeugen- und Sachverständigenentschädigung) abgerechnet werden. Mitunter gehört zu den Aufgaben der Abteilung »Allgemeine Verwaltung" auch die Wahrnehmung der rechtlichen Angelegenheiten des Parlaments. Zu diesem Zweck haben die Landtagsverwaltungen von Bayern, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen eigens das Referat „Justitiariat" geschaffen. Das Justitiariat bearbeitet die aufkommenden Rechtsfragen, die vornehmlich das Verfassungs- und Parlamentsrecht betreffen, erstattet aber auch Rechtsgutachten auf sonstigen Gebieten des öffentlichen Rechts sowie des Zivil- und Strafrechts. Überdies wird der Justitiar im allgemeinen bei Gerichtsstreitigkeiten des Landtags tätig und führt die Prozesse für und gegen das Land. Die Landtagsverwaltung tritt durch einen eigenen Vertreter vor Gericht vorwiegend in Verwaltungsprozessen auf, und dort insbesondere bei Klagen im Petitionswesen44. Teilweise können die Justitiariate den Wissenschaftlichen Hilfsdiensten zugerechnet werden, sofern sie nicht nur Rechtsangelegenheiten des Landtagspräsidenten und der Hausverwaltung begutachten, sondern auch solche der Abgeordneten und Fraktionen. Eine wichtige und zentrale Informationsquelle für das Parlament, die Abgeordneten, die Fraktionen und die Wissenschaftlichen Dienste stellt die landtagseigene Bibliothek dar, die in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen in die Abteilung „Allgemeine Verwaltung" integriert wurde, zu der ebenfalls das Landtagsarchiv sowie der Dokumentationsdienst gehört 45 . In der Bibliothek werden Nachschlagewerke, Loseblattsammlungen, Lexika aus den wichtigsten Wissenschaftsgebieten, juristische Grundwerke, Gesetzessammlungen, Amtsblätter sowie Buch- und Zeitschriftenliteratur zu Themen der politischen Diskussion und der parlamentarischen Arbeit geführt, bearbeitet und bereitgestellt. Ihre Sammelschwerpunkte liegen zu« Vgl. z. B. Art. 16 BayAbgG. « Vgl. z. B. Art. 10 und Art. 61 BayAbgG. 44 Vgl. die Angaben bei Kremer, in: Die Verwaltung 1994,495 (499). 45 In den anderen Ländern bildet dieser Bereich überwiegend eine selbständige Abteilung, wie etwa in Hamburg, Bremen und dem Saarland, oder aber ist der Abteilung „Wissenschaftlicher Dienst" zugeordnet worden, so in Berlin und Schleswig-Holstein.
I. Die Parlamentserwaltung
287
meist auf den Gebieten Staats- und Verwaltungsrecht, Parlamentsrecht und Geschichte. Sie sind im wesentlichen Präsenzbibliotheken und führen in ihrem Bestand in aller Regel auch die Drucksachen der anderen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments sowie die entsprechenden Gesetz- und Verordnungsblätter. Eng verbunden mit der Bibliothek ist das Landtagsarchiv sowie die parlamentsspezifische Dokumentation, die die Datenund Nachrichtenflut für die Abgeordneten und Fraktionen kanalisieren und in verwertbare Informationen umsetzen soll. Im Parlamentsarchiv werden alle Drucksachen, Plenar- und Ausschußprotokolle des Landtags inhaltlich erschlossen und archiviert. Im Zuge der Ausstattung der Parlamentsverwaltung mit moderner Bürotechnik sind die meisten Landtagsverwaltungen dazu übergegangen, die Auswertungsergebnisse in einer Datenbank zu speichern, die den parlamentarischen Ablauf der Vorgänge dokumentiert, umfangreiche Suchmöglichkeiten nach inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten bietet und die Fundstellen nachweist. Die in den Archiven der Landesparlamente gesammelten Materialien werden von der Zentraldokumentation „Palamentsspiegel" beim Landtag Nordrhein-Westfalen erschlossen. In der Presse- und Literaturdokumentation werden schließlich Meldungen, Kommentare und Meinungen aus der Presse und Aufsätze aus Fachzeitschriften nach Sachgesichtspunkten und Personen zentral gesammelt, erschlossen und archiviert sowie themen- und personenbezogene Recherchen im Bestand durchgeführt. Zudem wird für gewöhnlich ein täglicher Pressespiegel für die Abgeordneten, Fraktionen und ihre Mitarbeiter erstellt, schwerpunktmäßig aus der regionalen Tages- und Wochenpresse. Regelmäßiger Bestandteil der Abteilung „Allgemeine Verwaltung" ist schließlich die Drucksachen- und Vervielfältigungsstelle, die häufig auch für die Verteilung der eingehenden Post zuständig ist. Ebenso ist regelmäßig die Fahrbereitschaft der »Allgemeinen Verwaltung" zugeordnet. In Rheinland-Pfalz obliegt dieser Abteilung zudem die Verwaltung des hauseigenen Restaurantbetriebes.
cc) Der Parlamentsdienst Der Parlamentsdienst faßt die verschiedenen für den Gesamtablauf der Arbeit des Landtags notwendigen, mehr technischen Dienste in einer separaten Abteilung der Parlamentsverwaltung zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei naturgemäß die Vor- und Nachbereitung der Plenar- und Ausschußsitzungen, so daß zumindest theoretisch auch zwischen einem Plenardienst und einem Ausschußdienst zu unterscheiden ist, obgleich beide in den meisten Landtagsverwaltungen eng miteinander verwoben sind. Dem eigentlichen Parlamentsdienst ist in einigen Landtagsverwaltungen wie etwa in Baden-Württemberg nach dem Vorbild des Deutschen Bundestages eine Antragsannahmestelle vorgeschaltet. Als zentrale Eingangsstelle für Gesetzentwürfe, Anträge auf Aktuelle Debatten, Dringliche Anträge sowie Vorlagen und Berichte der Regierung gewährleistet sie den reibungslosen, geordneten und fristgerechten Ablauf des Gesetzgebungs- und Beschlußverfahrens. Zudem
288
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
werden die eingebrachten Vorlagen und Anträge auf ihre Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Geschäftsordnung geprüft. Die Zuständigkeit des Plenardienstes umfaßt im allgemeinen die Kleinen und Großen Anfragen der Abgeordneten sowie die Anträge der Fraktionen. In Hamburg kommt, neben der Zuständigkeit für den Ältestenrat, die weitere Aufgabe hinzu, auch den Bürgerausschuß, eine Art ständiges Notparlament, zu betreuen. Der Plenardienst stellt die Tagesordnungen der Sitzungen zusammen, nimmt die Vorlagen der Landesregierung an das Parlament entgegen und fertigt die Beschlüsse des Landtags und die Mitteilungen an die Regierung. Mitunter gehört auch die Auslieferung und Versendung sämtlicher Drucksachen des Landtags zur Aufgabe des Plenardienstes. Der Ausschußdienst hingegen übernimmt nicht nur die technische und büromäßige Vorbereitung und Abwicklung der Ausschußsitzungen, sondern entwickelt auch eine eigene sachliche Assistenz durch Mithilfe bei der gesetzgeberischen Arbeit und Erledigung der umfangreichen Korrespondenz 46. In der Regel ist jedem Landtagsausschuß ein wissenschaftlich vorgebildeter Assistent zugewiesen47. Zur Unterstützung der Ausschußvorsitzenden bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausschußsitzungen haben die Assistenten den Vorsitzenden über die im Ausschuß anstehenden Arbeiten zu unterrichten und ihm Vorschläge für die Aufstellung der Tagesordnung, die Benennung von Berichterstattern und Mitberichterstattern, die Ladung von Sachverständigen sowie die Formulierung von Ausschußbeschlüssen und -Stellungnahmen, die in einer Sitzung keine endgültige Form erhielten, zu machen. Darüber hinaus stellen sie das notwendige Material zusammen, unterrichten den Ausschuß über das Beratungsergebnis anderer beteiligter Ausschüsse und treffen die geschäftsordnungsmäßigen und technischredaktionellen Vorbereitungen für die von ihrem Ausschuß zu erstellenden amtlichen Drucksachen, meist Anträge sowie mündliche und schriftliche Berichte an das Plenum. Sofern nicht wegen Umfang oder Bedeutung der Ausführungen wörtliche Niederschriften notwendig sind, fertigen die Ausschußassistenten Kurzprotokolle an, die den wesentlichen Inhalt und Ablauf der Beratungen wiedergeben. Ebenso achten sie auf das geschäftsordnungsmäßige Zustandekommen der Beschlüsse und deren Aufnahme ins Protokoll. Neben dieser eher technischen Mitarbeit leisten sie in den meisten Landtagen vor allem auch eine wissenschaftliche Ausschußbetreuung, indem sie ihr fachliches Wissen den Ausschußmitgliedern zur Erleichterung politischer Entscheidungen zur Verfügung stellen sowie Inhalt und sachliche Problematik anstehender Entwürfe und Anträge auf wissenschaftlicher Grundlage erörtern und Lösungsvorschläge erarbeiten. Ferner obliegt ihnen die Beschaffung von Unterlagen bei Regierungsstellen, Interessenverbänden und Sachverständigen, die Anfertigung von Auszügen aus wissenschaftlichen Hilfsquellen 46
Vgl. auch zu den Aufgaben des Ausschußdienstes des Deutschen Bundestages, Jekewitz, in: DVB1. 1969, 513, (516 ff.). 47 Vgl. etwa den Aufbau des Parlamentsdienstes von Thüringen und Rheinland-Pfalz. Hier sind im übrigen Parlamentsdienst und Wissenschaftlicher Dienst gleichbedeutend bzw. personenidentisch.
I. Die Parlamentserwaltung
289
und Fachliteratur sowie die Bereitstellung von sachlich geordneten vergleichenden Darstellungen bei mehreren Vorlagen zum selben Beratungsgegenstand. Schließlich sind sie häufig ständige Kontaktstelle zu den anderen am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organen, indem sie etwa mit den Referenten der dem Sachgebiet ihres Ausschusses entsprechenden Ressortministerien sachliche Verbindung halten. Doch nicht alle Parlamentsverwaltungen besitzen eine wissenschaftliche Ausschußassistenz. So wird etwa in Hamburg keine spezielle fachwissenschaftliche Assistenz für die einzelnen Ausschüsse geboten. Eine Hamburger Originalität ist jedoch die Betreuung des Haushaltsausschusses. Diesem ist ein Sekretariat zugeordnet, das Teil der Behörde des Finanzsenators ist. Vorsitzender und Schriftführer des bürgerschaftlichen Haushaltsausschusses haben außerdem je einen Assistenten. Die Gehälter für diese Assistenten werden den beiden Abgeordneten gesondert erstattet, deren Angestellte sie sind. Für Parlamentarische Untersuchungsausschüsse muß die Exekutive aufgrund der Hamburger Verfassung zur Unterstützung die erforderlichen Beamten oder Angestellten zur Verfügung stellen. Um auch für spezielle Fachgebiete Sachverständige zu erhalten, werden solche mitunter vorübergehend im öffentlichen Dienst beschäftigt, eigens zur Unterstützung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Bei einer Enquete-Kommission wurde erstmalig sogar ein privatwirtschaftliches Unternehmen beauftragt, einen Arbeitsstab zur Unterstützung zu bilden 48 . Zum Parlamentsdienst gehört ebenfalls ein zentraler Geschäftsbereich für die an das Parlament gerichteten Petitionen und Eingaben. Teilweise ist dieser Bereich in den allgemeinen Ausschußdienst integriert, teilweise nimmt er als selbständiges Referat eine Sonderstellung in der Abteilung „Parlamentsdienst" ein, wie etwa in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, ist jedoch gleichwohl dem Petitionsausschuß zugeordnet. Hier werden alle Beschwerden von Bürgern über die öffentliche Verwaltung behandelt, soweit das Parlament für die Bearbeitung örtlich und sachlich zuständig ist. Alle Petitionen werden zunächst dahingehend überprüft, ob die Einholung einer Stellungnahme durch das zuständige Fachministerium erforderlich ist oder nicht, ober ob die Eingabe auf andere Weise, ζ. B. durch eine Raterteilung oder durch eine qualifizierte Auskunft erledigt werden kann. Soweit Stellungnahmen der Fachministerien vorgelegt werden, werden diese von den Mitarbeitern einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen, bevor sie dem Berichterstatter zur Beratung im Ausschuß zugeleitet werden. Wesentlicher Bestandteil des Parlamentsdienstes ist schließlich der Stenographische Dienst, vielfach wie in Bayern ein eigenes Referat innerhalb der Abteilung „Öffentlichkeits- und Informationsdienst". Der Stenographische Dienst trägt traditionell dafür Sorge, daß die Beratungen des Landtags schriftlich festgehalten werden. Demzufolge fertigt er wörtliche Berichte über die Sitzungen des Landtags, sog. Plenarprotokolle, und erstellt Niederschriften über die Sitzungen der Ausschüsse, Unterausschüsse und anderen Gremien des Landesparlaments. Während 48 Vgl. die Angaben bei Lange, S. 179. 19 Köhler
290
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
über die Sitzungen des Landtagsplenums ausschließlich Wortprotokolle erstellt werden 49, fertigt der Stenographische Dienst von den Sitzungen der Landtagsausschüsse, -Unterausschüsse und -gremien grundsätzlich nur zusammenfassende Niederschriften in indirekter Rede. Eine wörtliche Abfassung erfolgt ausnahmsweise bei Anhörungen und bei Sitzungen der Untersuchungsausschüsse. In Anbetracht der Tatsache, daß der Parlamentsstenograph zum Mangelberuf geworden ist, sind einige Parlamentsverwaltungen - allen voran die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg - dazu übergegangen, auf die Protokollierung durch Tonbandredakteure umzustellen50. Diese Änderung hat nach eigenen Angaben zu keinem Substanzverlust der Niederschriften geführt. Da das gesprochene Wort mit weniger kosmetischer Meisterschaft niedergeschrieben werde, sei der Eindruck des Lesers von den Debatten der Redner lebensnaher, stilechter und unmittelbarer geworden 51.
dd) Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zum Mindestbestand einer Parlamentsverwaltung zählt schließlich der Geschäftsbereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit". Sofern dieser nicht direkt der Leitungsebene des Präsidenten oder des Direktors zugeordnet ist 5 2 oder aber ein Referat in der Abteilung „Parlamentsdienste" bildet 53 , haben die Landtagsverwaltungen für diesen Bereich vielfach eine eigene Abteilung eingerichtet 54. Die mit der Öffentlichkeitsarbeit betraute Stelle bemüht sich mit einer Fülle von Aktivitäten darum, das parlamentarische Geschehen transparent und für möglichst viele Bürger verständlich zu machen. Dazu gehört auch, daß ein wirklichkeitsgerechtes Bild von der Parlamentsarbeit vermittelt wird, durch das die Eigenart und gewachsene Gesetzmäßigkeit seiner inneren Willensbildung und die Zwänge der Komplexität von Entscheidungsprozessen deutlich werden. Diesem Ziel dienen die zahlreichen Kontakte des Geschäftsbereichs zu den Abgeordneten einerseits und zu Verbänden, Organisationen und interessierten Bürgern andererseits, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Journalisten von Presse, Hörfunk und Fernsehen, die Veranstaltung von Pressegesprächen und die Herausgabe von Publikationen. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört üblicherweise neben einer Pressestelle auch ein Besucherdienst. Dieser führt die Besucher durch das Parlamentsgebäude und unterrichtet sie mit Vorträgen und unter Zuhilfenahme audiovisueller Mittel über die 49 50
Eine detaillierte Beschreibung findet sich bei Achterberg, S. 310. Der Stenographische Dienst ist hier durch den sog. Protokollführungsdienst ersetzt wor-
den. So Lange, S. 179. 52 Vgl. ζ. B. Thüringen und Sachsen. 53 So in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland und Baden-Württemberg. In BadenWürttemberg ist die in dem Referat befindliche Pressestelle unmittelbar dem Landtagspräsidenten bzw. dem Landtagsdirektor unterstellt. In Brandenburg ist das Referat ,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" in die Abteilung »Allgemeine Verwaltung" eingegliedert. 54
So geschehen in Bayern, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein
und Bremen.
I. Die Parlamentsverwaltung
291
Arbeit des Landtags und seiner Abgeordneten. Für die Betreuung von Besuchern, die sich in offizieller Eigenschaft über die Arbeit des Parlaments informieren wollen, haben die Landtage vielfach eine Stelle für protokollarische Angelegenheiten und parlamentarische Repräsentation eingerichtet. Die Protokollstelle ist mithin zuständig für Repräsentationsveranstaltungen des Landtags wie für Auslandsreisen des Präsidenten und des Präsidiums, für die Betreuung in- und ausländischer Delegationen, vor allem auch für die Pflege interparlamentarischer Kontakte sowie für das Ordenswesen55. Die Hamburger Bürgerschaft hat dagegen weder eine Protokoll- noch eine Pressestelle. Während die Angelegenheiten des Protokolls von jeweiligen Persönlichen Referenten des Präsidenten wahrgenommen werden, erfolgt die Information der Presse im wesentlichen über die Pressesprecher der einzelnen Fraktionen 56. Die Fraktionen betreiben auch ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit. b) Der wissenschaftliche
Hilfsdienst
Die wissenschaftliche Begleitung und Betreuung der parlamentarischen Arbeit ist bei den Ausführungen über den Ausschußdienst bereits angeklungen; tatsächlich ist dieser Bereich noch wesentlich komplexer. Wissenschaftlicher Hilfsdienst bedeutet allgemein formuliert, daß den Abgeordneten von wissenschaftlich ausgebildeten Kräften eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe geleistet werden soll 57 . Ein solcher Dienst wurde zunächst im Bundestag eingerichtet. Die Länder nahmen ihn zum Vorbild, als ihre Parlamente die Arbeitsmöglichkeit der Abgeordneten verbessern wollten. Angesichts der anders gelagerten Bedürfnisse und Möglichkeiten der Länder konnten die Einrichtungen des Bundesparlamentes meist nur in abgewandelter Form übertragen werden. Langjährige Regierungsfraktionen hielten anfänglich nicht allzuviel von der Einrichtung der wissenschaftlichen Hilfsdienste. Dementsprechend befand sich beispielsweise in den Landtagen von Bayern und Hessen noch zu Ende der 60er Jahre der Aufbau eines eigentlichen, vom Parlament bezahlten Hilfsdienstes auf der Warteliste der Opposition. Diese wurde bis dahin von der Regierungsfraktion auf die Möglichkeit verwiesen, sich des Sachverstandes der Bürokratien zu bedienen, deren Angehörige zu Ausschuß- oder Fraktionssitzungen eingeladen werden könnten. Dabei wurde allerdings übersehen, daß der Opposition dieser bürokratische Sachverstand - bei aller Überparteilichkeit - nicht gleichermaßen wie ihnen selbst zur Verfügung steht. Die Einsicht in die Notwendigkeit von wissenschaftlichen Hilfsdiensten hat sich daher inzwischen allenthalben durchgesetzt. Bei der Einrichtung der wissenschaftlichen Hilfsdienste standen die Landtage vor der Frage, ob sie diese beim Leiter der Parlamentsverwaltung oder bei den Fraktionen lokalisieren sollten. Die Mehrzahl der Länderparlamente entschied sich 55 Vgl. für den Bayerischen Landtag Kremer, in: Die Verwaltung 1994,495 (512). 56 Lange, S. 177. 57 Schneider, Länderparlamentarismus, S. 91. 19*
292
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
zugunsten der Fraktionen, wie Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und das Saarland; einige Länder wählten als Alternative die Zuweisung zur Landtagsverwaltung, etwa Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, während sich Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zu einem Mittelweg entschlossen, indem sie sowohl einen Fraktions- als auch einen Parlamentshilfsdienst schufen. Mittlerweile sind nahezu alle Landtage dazu übergegangen, wissenschaftliche Dienste als Teil der Parlamentsverwaltung einzurichten. Daneben bestehen die inzwischen überall vorhandenen und in den letzten Jahren recht umfassend ausgebauten Stäbe der Fraktionen, die aus deren eigenem Personal oder aus Kräften der betreffenden Partei bestehen58. Ihr Aufgabenfeld ist allerdings in erheblichem Maße mit demjenigen der wissenschaftlichen Dienste identisch. Dies gilt besonders dann, wenn die Angehörigen der wissenschaftlichen Dienste den einzelnen Parlamentsfraktionen zugewiesen sind. Anderenfalls überschneidet sich der beiderseitige Tätigkeitsbereich nur teilweise, und beide Institutionen haben daneben noch spezifische eigene Aufgaben, die es auf der jeweils anderen Seite nicht gibt. Das Vorhandensein fraktionseigener Stäbe von recht unterschiedlicher Größe und Arbeitskraft erklärt weitgehend das recht nuancenreiche Bild der wissenschaftlichen Dienste, die in den einzelnen Landtagen außerordentlich verschieden ausgestaltet sind. In Baden-Württemberg besteht der »Juristische Dienst" als Referat der Abteilung ,Parlamentsdienst". Hier sind insgesamt fünf Mitarbeiter beschäftigt, zwei Schreibkräfte, zwei juristisch ausgebildete Referenten sowie der Referatsleiter, der ebenfalls Jurist ist. Die innere Gliederung des Referats ist somit keine kollegiale, sondern ein hierarchische, so daß die Referenten auch in sachlicher Hinsicht weisungsabhängig sind. Der „Juristische Dienst" wirkt mit an der Beratung von Gesetzen durch die Ausschüsse, wobei der Umfang der Mitwirkung vom Ausschußvorsitzenden festgelegt wird, er beteiligt sich an der Ausarbeitung von parlamentarischen Initiativen, die häufig als interfraktionelle Initiativen - insbesondere zu parlamentsrechtlichen Regelungen - erarbeitet werden und fertigt schließlich auf Anforderung der Ausschüsse Rechtsgutachten sowie fachliche Stellungnahmen. Teilweise wird auch dem Landtagspräsidenten oder den Ausschußvorsitzenden insoweit zugearbeitet, als Reden und Vorträge vorbereitet werden. Neben diesem »Juristischen Dienst" gibt es in Baden-Württemberg einen »Parlamentarischen Beratungsdienst", der aus Bediensteten des Landes besteht und deren Mitglieder den einzelnen Fraktionen zugewiesen sind 59 . In diesem Dienst sind außer der vorherrschenden Rechtswissenschaft auch andere Disziplinen, ζ. B. Pädagogen, vertreten. Zu der Tätigkeit, die der „Parlamentarische Beratungsdienst" ausschließlich im Bereich der Fraktionen leistet, gehört die Unterstützung und Beratung der fraktionsinternen Arbeitskreise sowie die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, anderen Initiativen und Reden. Über die Angehörigen dieses 58
Vgl. zu Stellung und Aufgaben der Fraktionsmitarbeiter Walter, S. 174 ff. sowie Jekewitz, in: ZParl 1995, 395. Vgl. als allgemeine Richtlinie des „Parlamentarischen Beratungsdienstes" die entsprechende Verwaltungsanordnung vom 5. 11. 1964.
I. Die Parlamentserwaltung
293
Dienstes übt ebenfalls der Landtagspräsident die Dienstaufsicht aus, soweit es um Ernennungen und Beförderungen geht, ansonsten steht die Dienstaufsicht dem FraktionsVorsitzenden zu. In Bayern wie Sachsen besteht der „Juristische Ausschußdienst" bzw. Juristische Dienst" als Referat der Abteilung „Parlamentarischer Dienst". Sein Schwerpunkt liegt im Gegensatz zum „Justitiariat" der Abteilung „Verwaltung" beim Verfassungsrecht und in Fragen der Anwendung und Auslegung der Geschäftsordnung. Er ist zuständig zur juristischen Beratung der Ausschüsse sowie zur Erstellung von Rechtsgutachten60. Dem Referat ist es allerdings verwehrt, bereits gefaßte Beschlüsse von Ältestenrat, Ausschüssen und Plenum ohne ausdrücklichen Auftrag dieser Organe zu überprüfen oder deren Entscheidung gutachtlich zu würdigen. Der „Juristische Ausschußdienst" bereitet Stellungnahmen des Landtags gegenüber dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht bei Verfassungsstreitigkeiten und bei Verfassungsbeschwerden und Popularklagen vor. Eine wesentliche Aufgabe besteht ferner in der Funktion als Sekretariat der Untersuchungsausschüsse, insbesondere in der organisatorischen Vorbereitung der Sitzungen wie auch in der Erstellung des Entwurfs des formellen Teils des Schlußberichtes. Außerdem unterstützt der Juristische Ausschußdienst" den Vorsitzenden der Parlamentarischen Kontrollkommission. In Berlin gibt es den „Wissenschaftlichen Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses" als Teil der Abteilung „Wissenschaftlicher Dienst" 61 , der insgesamt sieben Mitarbeiter umfaßt, welche ebenfalls der Dienstaufsicht des Parlamentspräsidenten unterstehen. Er nimmt auf Wunsch eines Ausschusses an der Beratung von Gesetzen teil, arbeitet auf Antrag eines Fachausschusses oder einer Fraktion gutachtliche Stellungnahmen wie auch parlamentarische Initiativen aus und wirkt darüber hinaus an der Gesetzesausfertigung durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses mit. Außer der juristischen Beratung des Präsidenten fertigt er für diesen in Ausnahmefällen auch Reden und Vorträge. Neben dem „Wissenschaftlichen Parlamentsdienst" besteht ein „Wissenschaftlicher Fraktionsberatungsdienst" als Bestandteil der Abteilung „Wissenschaftlicher Dienst", dessen Mitarbeiter als Landesbedienstete den Fraktionen zugeordnet sind. Gleichwohl obliegt dem Parlamentspräsidenten auch hier die Dienstaufsicht. Die Angehörigen dieses Dienstes nehmen ausschließlich Aufgaben der Fraktionsberatung wahr. In Bremen ist für den „Wissenschaftlichen Dienst" eine eigene Abteilung eingerichtet worden, die aus sechs Mitarbeitern besteht. Die Dienstaufsicht steht nicht dem Präsidenten der Bürgerschaft, sondern dem Direktor bei der Bürgerschaft zu. Die Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes sind regelmäßig zugleich Ausschußassistenten und besitzen in dieser Funktion Teilnahme- und Äußerungsrecht „von Amts wegen". Während sie für die juristische Beratung von Gesetzesvorlagen 60 Vgl. hierzu die Beispiele bei Kremer, in: Die Verwaltung 1994,495 (502). 61 Siehe hierzu die Anweisung des Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über den wissenschaftlichen Parlamentsdienst vom 10.4. 1969.
294
8. Abschnitt: Leiter der Parlaments Verwaltung und Vertreter des Landtags
zuständig sind, ist die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, Entschließungsanträgen und Anfragen nicht ihre Aufgabe. Ebenso werden fachliche Stellungnahmen und Rechtsgutachten nur für diejenigen Ausschüsse erstellt, die zum Teil in gewissem Umfange ein Initiativrecht in Anspruch nehmen. In Hamburg wurde der am 15. 4. 1986 eingerichtete Wissenschaftliche Dienst bereits zum Ende des Jahres 1989 wieder aufgelöst 62. Stattdessen erhalten die Fraktionen zusätzliche Zuschüsse zur Einstellung wissenschaftlicher Mitarbeiter. So wurde ζ. B. in der 14. Wahlperiode der CDU- und der SPD-Fraktion je eine Stelle, der FDP- und der Grüne/GAL-Fraktion je eine halbe Stelle zugewiesen. Da die wissenschaftlichen Hilfsdienste ausschließlich bei den Fraktionen der Bürgerschaft angesiedelt sind, steht die Bürgerschaftsverwaltung nur in Ausnahmesituationen beratend zur Verfügung. In diesen Fällen wird der Direktor oder der Justitiar der Bürgerschaft tätig. In Hessen besteht ebenfalls kein Wissenschaftlicher Dienst. Die wissenschaftliche Beratung wird von Bediensteten des Landes übernommen, die den Fraktionen zugewiesen sind. Dabei kommt den Fraktionen das Vorschlagsrecht für die Besetzung dieser Stellen zu. Für die wissenschaftliche Begleitung der Fraktionen stehen insgesamt 23 Stellen zur Verfügung, die mit Fachkräften der verschiedensten Disziplinen besetzt werden. Der Landtagspräsident hat über sie die Dienstaufsicht. Verfassungs- und parlamentsrechtliche Angelegenheiten sowie die Erstellung von Rechtsgutachten aus diesen Bereichen werden ebenso wie die Ausarbeitung von parlamentarischen Initiativen - soweit es sich um fraktionsübergreifende Initiativen handelt - von der Leiterin des Referats „Parlamentarischer Dienst" und vom Justitiar wahrgenommen. Auch in Nordrhein-Westfalen besteht kein eigentlicher wissenschaftlicher Dienst. Lediglich dem Referat »Abgeordnete, Fraktionen, Parteien und Parlamentsrecht" in der Abteilung »Parlament" obliegt in begrenztem Umfange eine juristische Beratungstätigkeit. Außerdem besteht zur Vorbereitung von personalrelevanten Entscheidungen des Haushalts- und Finanzausschusses sowie seines Unterausschusses „Personal" ein Gutachterdienst von Mitarbeitern der Landtagsverwaltung, die diese Aufgabe neben ihrer eigentlichen Tätigkeit ausführen. Im übrigen sind die einzelnen im Landtag vertretenen Fraktionen sehr umfangreich mit wissenschaftlichen Mitarbeiter-Stäben ausgestattet. Dagegen gibt es in Rheinland-Pfalz und Thüringen einen „Wissenschaftlichen Dienst" als Sachgebiet der Abteilung ,Parlamentsdienst" 63. In beiden Landtagen sind die Mitarbeiter des „Wissenschaftlichen Dienstes" wie in der Bremer Bürgerschaft regelmäßig zugleich Ausschußassistenten. Eine Zuweisung zu den Fraktio62 Grund der schnellen Auflösung waren nach Auskunft der Bürgerschaftsverwaltung gegenüber dem Verfasser Bedenken der Fraktionen an der parteipolitischen Neutralität des Wissenschaftlichen Dienstes. 63 Vgl. zudem die Richtlinien über die Organisation und die Aufgaben des beim Landtag Rheinland-Pfalz eingerichteten Wissenschaftlichen Dienstes von 1964.
I. Die Parlamentsealtung
295
nen besteht damit vom Grundsatz her nicht. Allerdings stellen die Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP im rheinland-pfälzischen Landtag seit Einrichtung des Wissenschaftlichen Dienstes einen sog. „Vertrauensmann", an den sie sich bei besonders vertraulichen Angelegenheiten unmittelbar wenden können; der „Vertrauensmann" hat umgekehrt auch Zugang zu den betreffenden Fraktionen. Die Fraktion der Grünen hat die Möglichkeit, sich im Einzelfall an den Dienst zu wenden. Die Vertrauensleute sind im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern des Dienstes in sachlicher Hinsicht weisungsunabhängig. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Thüringen besitzen die Angehörigen des Wissenschaftlichen Dienstes in den Ausschußsitzungen ein Teilnahme- und Äußerungsrecht „von Amts wegen". An der Beratung von Gesetzen in den Ausschüssen sind sie regelmäßig in Form von Stellungnahmen zu Rechts- und Verfahrensfragen beteiligt. Gleichermaßen beteiligt sind sie bei der Ausarbeitung parlamentarischer Initiativen, fachlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten. Für die Anfertigung von Reden und Vorträgen sind sie jedoch nur in Ausnahmefällen zuständig und dann auch nur für den Präsidenten des Landtags. Ebensowenig wie Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen kann auch die saarländische Parlamentsverwaltung einen Wissenschaftlichen Dienst aufweisen. Gleichwohl wird die Vorbereitung interfraktioneller Initiativen zum Abgeordnetenrecht und zur Geschäftsordnung des Landtags durch die Ausschußassistenten und den Justitiar geleistet, sofern dies auf Wunsch der Ausschußvorsitzenden und -berichterstatter geschieht. In Schleswig-Holstein schließlich gibt es die Abteilung „Wissenschaftlicher Dienst, Gesetzgebungsdienst und Justitiariat" 64 , die aus insgesamt vier Mitgliedern besteht. Sie ist hierarchisch gegliedert, doch sind die Angehörigen laut Auskunft der Landtagsverwaltung „unter Leitung des Abteilungsleiters selbständig und eigenverantwortlich tätig." Die Dienstaufsicht steht dem Landtagspräsidenten zu. Die Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes haben bezüglich der Sitzungen der Fachausschüsse nicht nur von Amts wegen das Recht zur Teilnahme, sondern auch zu Äußerungen, ggf. nach Abstimmung mit dem Ausschußvorsitzenden. Ihre Aufgabe ist es, Stellungnahmen zu Rechtsfragen abzugeben und Formulierungshilfen zu leisten. Darüber hinaus fertigen sie rechtliche Gutachten und Stellungnahmen für Ausschüsse oder deren Vorsitzende, für Fraktionen sowie auch für einzelne Abgeordnete, soweit die betreffende Fraktion zustimmt. Zum Tätigkeitsbereich des Wissenschaftlichen Dienstes gehört letztlich auch die Mitwirkung an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, Entschließungsanträgen, Anfragen oder sonstigen parlamentarischen Initiativen. Ein besonderes Augenmerk gilt zum Schluß dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst (GBD) in Niedersachsen 65 und Sachsen-Anhalt, der nach Vorbildern in 64 Vgl. die Dienstordnung der Abteilung Wissenschaftlicher Dienst und Justitiariat vom 23.4.1971. 65 Vgl. die Richtlinien und den Geschäftsverteilungsplan für den GBD beim Niedersächsischen Landtag vom 4. 12. 1957, LT-Drs. 3/328.
296
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
mehreren Einzelstaaten der USA aufgebaut wurde und eine selbständige Organisation neben den Abteilungen der Landtagsverwaltung bildet. Der GBD besteht aus einem Kollegium von wenigen hochqualifizierten Juristen, die von zeitweilig abgeordneten Referenten aus der Justiz oder der inneren Verwaltung Unterstützung erhalten. Die Mitglieder des Kollegiums sind nicht Bedienstete der Landesregierung, sondern des Parlaments. Sie unterstehen aber nur in dienstrechtlicher und organisatorischer Hinsicht der Aufsicht des Landtagspräsidenten, ansonsten sind sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben weisungsunabhängig. § 1 Π der Richtlinie sieht vor, daß sich die Angehörigen des Dienstes keiner parteipolitischen Richtung verpflichtet fühlen dürfen und in besonderem Maße von den Abgeordneten als ihre Vertrauenspersonen anerkannt und angesehen werden müssen. Aus diesem Grunde sind die Mitglieder auch nicht bestimmten Fraktionen zugeordnet. Vielmehr wird jeder Angehörige des GBD entsprechend seiner fachlichen Kompetenz für Aufgaben mit unterschiedlichster politischer Zielsetzung tätig. Der GBD nimmt von Amts wegen an allen Beratungen der Fachausschüsse über Gesetzentwürfe teil. Seine Aufgabe ist es, die Vorlagen in verfassungsrechtlicher, gesetzestechnischer und sprachlicher Hinsicht zu prüfen und die von den Ausschüssen beabsichtigten sachlichen Änderungen der Gesetzentwürfe zu formulieren. Überdies unterstützt er den Ausschußvorsitzenden bei der Verhandlungsführung und bereitet den Bericht des Ausschusses an das Plenum vor. Während der Ausschußsitzungen können die Angehörigen des Dienstes jederzeit das Wort ergreifen. Aber auch außerhalb der Ausschußsitzungen besteht für den GBD ein weites Aufgabengebiet. So steht er etwa den Fraktionen des Landtags wie allen Abgeordneten für fachliche Urteile und Hilfen in rechtlichen Problemfällen und Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung, erstattet juristische Gutachten und erteilt Auskünfte, bereitet Gesetzentwürfe, Entschließungsanträge sowie parlamentarische Anfragen vor und beschafft Material für die politische Arbeit der Parlamentarier. Obgleich § 5 Π 1 der Richtlinie anordnet, daß die Mitarbeiter des GBD die Vorstellungen und Wünsche ihrer Auftraggeber bei den genannten Tätigkeiten zu berücksichtigen haben, kann dies nur für eventuelle „politische Vorgaben" gelten, nicht jedoch für das Ergebnis und die Argumente der rechtlichen Würdigung. Letztere ergeben sich aus der unbeeinflußten Überzeugung des jeweiligen Bearbeiters. Daß der GBD alle Aufgaben und individuellen Hilfeleistungen stets vertraulich und uneigennützig, vor allem ohne eigene politische Ambitionen wahrnimmt, versteht sich von selbst.
3. Die Leitung der Personalverwaltung Entsprechend der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Landtagsverwaltungen ist auch der Personalbedarf sehr unterschiedlich. Während etwa die Verwaltung des Landtags von Nordrhein-Westfalen rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, umfaßt die Verwaltung der Hamburgischen Bürgerschaft lediglich rund 60 Mitarbeiter und ist damit im Vergleich zu allen anderen Parlamentsverwaltungen im-
I. Die Parlamentserwaltung
297
mer noch diejenige mit dem geringsten Personal. Selbst die Bremer Bürgerschaft ist umfangreicher ausgestattet. Dazwischen liegen ζ. B. die Landtags Verwaltungen von Bayern mit 209 Mitarbeitern, von Hessen mit 200 Mitarbeitern und von Mecklenburg·^Vorpommern mit rund 130 Beschäftigten. In der Verwaltung dieses Personals sind die Parlamente von den Behörden der allgemeinen Staatsverwaltung unabhängig66. Das rechtliche Fundament für diese Unabhängigkeit bilden die Landesverfassungen, konkretisiert durch die Landesbeamtengesetze, die sich zwar im Kern an § 176 BBG als dem bundesrechtlichen Vorbild orientieren, aber hinsichtlich des Umfanges und der detaillierten Ausgestaltung zum Teil deutlich Unterschiede aufweisen 67. Die Landesbeamtengesetze schreiben vor, daß die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Landtagsverwaltung Bedienstete des Landes und nicht des Parlaments sind 68 . Gleichwohl ordnen sie in Übereinstimmung mit den entsprechenden Verfassungsbestimmungen an, daß die Ernennung, Einstellung, Entlassung und Zurruhesetzung der Landtagsbeamten, Angestellten und Arbeiter durch den Parlamentspräsidenten vorgenommen wird 6 9 . Diese Anordnung für den parlamentarischen Verwaltungsbereich ist eine Durchbrechung des verfassungsrechtlichen Ernennungsmonopols der Landesregierung, wonach grundsätzlich der Ministerpräsident dafür zuständig ist. In Hamburg trifft der Präsident der Bürgerschaft auch die durch die Neuregelung des Beamtenrechtsrahmengesetzes hinsichtlich der EU-Staaten teilweise obsolet gewordene Ausnahmeentscheidung bezüglich der Zulassung von Nichtdeutschen als Beamte sowie das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand70 und erteilt die Genehmigung für das Tragen von Titeln und Ehrenzeichen 71 . In anderen Ländern ist der Präsident bei der Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten des Landtags an die Mitwirkung bestimmter parlamentarischer Gremien gebunden. So trifft er beispielsweise in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz diese Entscheidungen im Benehmen mit dem Präsidium des Landtags72. In Rheinland-Pfalz gilt dies auch für son66 In Hamburg besteht allerdings die Besonderheit, daß ein Teil der Personalverwaltung im Wege der Amtshilfe durch die Senatskanzlei erfolgt, so ζ. B. die Verwaltung der Personalakten. 67 Das Land Baden-Württemberg und der Freistaat Sachsen haben ausnahmsweise keine Regelung getroffen, welche den Grundgedanken des § 176 widerspiegelt. Die Beamten den Sächsischen Landtags werden weder unter den besonderen Beamtengruppen (§ 138ff. SächsBG) noch unter dem Abschnitt „andere Beamtengruppen" (§ 152ff. SächsBG) aufgeführt. 68 Art. 125 I 1 BayBG; § 129 LBG-Bg; § 165 LBG-Br; § 15 HmbBG; § 130 LBG-MV; § 200 I NBG; § 182 LBG-NRW; § 189 I LBG-RP; § 128 SBG; § 110 LBG-SA; § 187 LBGSH; § 118 ThürBG. 69 § 129 LBG-Bg; § 15 HmbBG; § 130 LBG-MV; § 128 SGB; § 11 II ThürBG. 7
§ 45 III HmbBG.
7
1 §75 HmbBG. 2 § 185 HBG; § 200 NBG; § 182 LBG-NRW; § 189 LBG-RP („Vorstand"); vgl. auch Art. 86 Satz 2 LV-He, § 44 III 2 GOLT-He; Art. 18 III 3 LV-Nds, § 8 Satz 2 GOLT-Nds; Art. 39 II 1 LV-NRW; Art. 85 III 2 LV-RP, § 5 II GOLT-RP. 7
298
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
stige beamtenrechtliche Entscheidungen, für die bei anderen Landesbeamten die Landesregierung oder das fachlich zuständige Ministerium zuständig ist. An die Stelle des Einvernehmens der Landesregierung oder des fachlich zuständigen Ministeriums bei entsprechenden beamtenrechtlichen Entscheidungen tritt für die Beamten des Landtags das Benehmen. Bei den Beamten der Landtage von Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt muß der Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat handeln73. Die Begrifflichkeit „im Benehmen" verpflichtet den Parlamentspräsidenten regelmäßig, vor der Ernennung oder Entlassung dem jeweiligen parlamentarischen Gremium Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. An diese Stellungnahme ist der Präsident allerdings nicht gebunden74. Die „Ernennung und Entlassung" umfaßt nach überwiegender Ansicht die gesamte Personalhoheit, also alle statusändernden, alle wesentlichen Personalentscheidungen. Dazu gehören Maßnahmen wie Beförderung, Höhergruppierung, Versetzung in den Ruhestand, Umwandlung eines Dienstverhältnisses oder Einverständnis zur Versetzung eines Beamten in den Landesdienst aus einem anderen Dienstverhältnis 75. Bei den Angestellten und Arbeitern der Landtagsverwaltung stehen dem Landtagspräsidenten die Arbeitgeberbefugnisse im übrigen ohne Mitwirkung von Ältestenrat und Präsidium zu 7 6 , da die Beteiligung dieser Gremien nur bei den beamtenrechtlichen Befugnissen vorgeschrieben ist 7 7 . Einen Sonderfall bildet schließlich der Freistaat Bayern, der für die Einstellung, Entlassung und Eingruppierung der Angestellten und Arbeiter sowie der Beamten des Landtagsamtes das Präsidium des Landtags für zuständig erklärt hat 78 . Außerdem ist zur Ernennung der höheren Beamten und des Direktors des Landtags die Zustimmung des Ältestenrats erforderlich 79. In Bremen werden die Beamten der Bürgerschaft durch den Vorstand der Bremischen Bürgerschaft ernannt, entlassen und zurruhegesetzt 80. Die Einstellung und Entlassung aller anderen im Dienst der Bremischen Bürgerschaft stehenden Personen obliegt ebenfalls dem Vorstand 81. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang noch, daß die Anstellung und Entlassung von Personal nicht immer zu den uneingeschränkten Rechten des Parlamentspräsidenten gehörte. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden etwa in Bayern die leitenden Beamten zwar gewählt, aber von der Krone ernannt 82. In der 73 § 187 LBG-SH, Art. 14 IV 1 LV-SH, § 5 II GOLT-SH; § 110 LBG-SA, § 5 III 2 GOLTSA. 74 Zinn /Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 3; Art. 8 VNV, Rn. 20; Geller/Kleinrahm, Art. 39 LVNRW, Anm. 5 d. 75 Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 9. 76 Vgl. ζ. B. den Wortlaut von § 14 II 2 GO-Be. 77 Vgl. den Wortlaut von Art. 39 II 1 LV-NRW. 78 § 10 III 2 GOLT-By. 79 Art. 125 I 2 BayBG, vgl. auch § 10 III, IV GOLT-By. so § 165 LBG-Br. 81 Art. 92 III 1 LV-Br. 82 Schumacher, S. 11 und 107.
I. Die Parlamentserwaltung
299
Weimarer Zeit sahen die in den Verfassungen und Geschäftsordnungen enthaltenen Bestimmungen teilweise eine Wahl der Beamten durch das Plenum oder eine Auswahl durch den Vorstand des Parlaments vor. Soweit der Präsident selbst Beamte ernennen konnte, war er in einigen Fällen an die Zustimmung des Hauses gebunden 83 . Als am 30. 3. 1926 der Direktor des Landtags von Mecklenburg-Schwerin in den Ruhestand trat, ernannte der Ministerpräsident (!) den Nachfolger, was zunächst vom Parlament widerspruchslos hingenommen wurde 84 . Die Landesbeamtengesetze stellen ferner den Landtagspräsidenten als oberste Dienstbehörde der Landtagsbeamten heraus 85. In Bayern ist das Präsidium des Landtags, in Bremen der Vorstand der Bürgerschaft oberste Dienstbehörde86. Die Befugnisse, die nach den Landesbeamtengesetzen die jeweilige Landesregierung hat, stehen für die Beamten beim Landtag dem Präsidenten des Landtags zu 87 . Mitunter darf er wie etwa in Sachsen-Anhalt diese Befugnisse nur im Benehmen mit dem Ältestenrat wahrnehmen. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist dem Präsidenten allerdings der Erlaß von Verordnungen ausdrücklich untersagt. Diese Ausnahme bedeutet jedoch nicht, daß die von der Landesregierung oder den Ministerien erlassenen Verordnungen auch insoweit gelten. Nach der Zuständigkeitsregelung beider Landesverfassungen können jedenfalls Zuständigkeitsverordnungen für die Beamten des Landtags keine Gültigkeit haben88. In den meisten Landtagen nimmt der Präsident gegenüber den Beamten ebenfalls die Stellung eines Dienstvorgesetzten ein und trifft so Entscheidungen über persönliche Angelegenheiten der Verwaltungsmitarbeiter 89. Ein etwaiges Mitentscheidungsrecht der Personalvertretung muß er aber beachten. Der Präsident des Hessischen Landtags nimmt außerdem die Aufgaben des Direktors des Landespersonalamts und der Landespersonalkommission wahr. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erläßt er Bestimmungen über die Dienstkleidung der Landesbeamten. Als Folge der Bestimmung des Landtagspräsidenten zur obersten Dienstbehörde gelten alle Rechtsnormen des öffentlichen Dienstrechts auch in diesem parlamentarischen Verwaltungsbereich, insbesondere die verfassungsrechtlichen Vor83 Siehe v. Brentano, S. 78 f. 84 Ebenda. 85 § 3 I Nr. 2 LBG-Be; § 129 LBG-Bg; § 15 HmbBG; § 185 HBG; § 130 LBG-MV; § 2001 NBG; § 182 LBG-NRW; § 189 II LBG-RP; § 1101LBG-SA; § 187 LBG-SH; § 118 ThürBG. Mitunter ist dies auch hinsichtlich der Angestellten und Arbeiter normiert, vgl. etwa Art. 47 IV 4 LV-Ss; Art. 14 III 4 LV-SH. 86 § 10 III GOLT-By; Art. 91 LV-Br. 87 Vgl. z. B. § 200 II NBG. 88 Reich, Art. 49 LV-SA, Rn. 5. 89 So beispielsweise in Hamburg gem. § 3 II HmbBG. In Hamburg wird im übrigen die Bürgerschaft gem. § 61 Nr. 2 des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes zur Dienststelle erklärt, deren Dienststellenleiter nach § 8 der Präsident der Bürgerschaft ist. Damit sollen Zweifel beseitigt werden, die sich aus § 6 II deswegen ergeben könnten, weil die Bürgerschaft über keine eigene Personalverwaltung verfugt.
300
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
Schriften über die Pflichten öffentlicher Bediensteter und den Amtseid der Beamten, ferner das allgemeine Landesbeamtenrecht und Personalvertretungsrecht 90. Darüber hinaus steht dem Präsidenten in seiner Eigenschaft als oberste Dienstbehörde auch die Dienstaufsicht zu 9 1 . Die Dienstaufsicht erstreckt sich sowohl auf die fachliche Seite wie auf die Art und Weise der Erledigung der Dienstgeschäfte. Sie umfaßt die Befugnis, das dienstliche Verhalten zu beobachten, den Beamten in seiner dienstlichen Tätigkeit durch allgemeine oder für den Einzelfall erteilte Weisungen anzuleiten, die ordnungswidrige oder unsachgemäße Erledigung eines Dienstgeschäfts zu beanstanden oder zu seiner anderweitigen Erledigung anzuweisen 92 . Der Landtagspräsident nimmt zudem - wenn in der Regel auch ohne ausdrückliche Vorschrift - die Dienststrafgewalt 93 über die Landtagsbeamten wahr. Da die Dienstaufsicht als Überwachung und Regulierung des Dienstes in der Landtagsverwaltung eng mit der Dienststrafgewalt zusammenhängt, ist es nur zweckmäßig, beide Aufgabenbereiche in der Hand des Präsidenten zusammenzufassen, während noch unter der Geltung der preußischen Verfassungen die Dienstaufsicht dem Präsidenten, die Dienststrafgewalt aber dem Innenminister zustand94. Die dem Präsidenten übertragene Dienststrafgewalt soll zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Parlamentsverwaltung beitragen und die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben gewährleisten 95. Als Maßnahmen stehen dem Präsidenten der Verweis, die Geldbuße, die Gehaltskürzung, die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt, die Entfernung aus dem Dienst, die Kürzung des Ruhegehalts sowie die Aberkennung des Ruhegehalts zur Verfügung 96. Die Dienstaufsicht des Präsidenten erstreckt sich auf das gesamte Personal beim Landtag 97 . In einer Reihe von Landtagen, vor allem in Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen erfaßt die präsidiale Dienstaufsicht auch den Datenschutzbeauftragten 98. Teilweise übt der Landtagspräsident die Dienstaufsicht ebenfalls über den Präsidenten des Landesrechnungshofes aus. So bedarf etwa in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen der Präsident des Rechnungshofes für die Ausübung einer Nebentätigkeit der Genehmigung des Landtagspräsidenten99. In Baden-Württemberg, Hessen, Nieder90 Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 5 d. 91 Vgl. z. B. § 12IV GOLT-By; Art. 39 II 2 LV-NRW. 92 Vgl. Scheerbarth, Höffken, Bauschke, Schmidt, S. 204 f. 93 Vgl. die Wortwahl des Art. 39 II 2 LV-NRW. 94 Geller / Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 5 d m.w.N. 95 Vgl. Scheerbarth, Höffken, Bauschke, Schmidt, S. 477 f. 96 Vgl. z. B. § 6 I BayDO; § 5 I HDO; § 5 I NDO; § 4 I SächsDO; § 5 I DO für das Land Schleswig-Holstein. 97 Barschel/Gebel, Art. 13 LV-SH, Anm. 7. 98 Siehe etwa § 21 DSG-SA; § 23 SächsDSG; § 19 II 2 BerlDSG. 99 § 11 III RechnungshofG-BW; § 7 III 2 RechnungshofG-He; § 3 V 2 RechnungshofGNRW.
I. Die Parlaments Verwaltung
301
sachsen und Nordrhein-Westfalen ist bei Disziplinarsachen für den Präsidenten des Rechnungshofes der Landtagspräsident Einleitungsbehörde, in Bremen der Präsident der Bürgerschaft im Einvernehmen mit dem Senat 100 .
4. Die Leitung der wirtschaftlichen Verwaltung Im Gegensatz zu Art. 28 WRV, der dem Präsidenten nur die „Hausverwaltung" übertrug, weisen nahezu alle gegenwärtigen Landesverfassungen dem Landtagspräsidenten ebenfalls die Verwaltung der gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Parlaments zu 1 0 1 . Dazu gehören die Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, die Einrichtung des gesamten technischen Apparates sowie vor allem die Verfügung über die Einnahmen und Ausgaben 102. Der Präsident ist hierbei an das jeweilige Landeshaushaltsgesetz und an das allgemeine Haushaltsrecht gebunden. Beide können jedoch die Position des Präsidenten nicht mindern, sondern lediglich konkretisieren 103. Der Haushalt der Landtagsverwaltung ist Teil des gesamten Landeshaushalts und wird in einem besonderen Einzelplan ausgewiesen. Der Voranschlag für den Haushalt des Landtags wird in der Regel vom Präsidenten entworfen 1 0 4 . Seine Aufgabe ist es, sich mit allen wesentlichen Haushaltsforderungen persönlich vertraut zu machen, sie auf ihre Berechtigung hin zu prüfen und über ihre Aufnahme in den Haushaltsvoranschlag zu entscheiden105. Die Feststellung des Voranschlags ist hingegen von den parlamentarischen Geschäftsordnungen der Länder mehrheitlich dem Präsidium übertragen worden 106 , in Schleswig-Holstein erfolgt die Feststellung durch den Präsidenten im Benehmen mit dem Ältestenrat 1 0 7 . Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern stellt der Landtagspräsident gem. § 3 I V 1 GOLT den Voranschlag des Haushaltsplanes des Landtags selbständig und loo § 12 I 2 RechnungshofG-BW; § 5 II 4 RechnungshofG-Br; § 5 II 4 RechnungshofGHe; § 3 V 5 RechnungshofG-Nds. ιοί Art. 32 III 1 LV-BW; Art. 43 IV 1 LV-Be; Art. 86 Satz 1 LV-He; Art. 29 VI 1 LV-MV; Art. 85 III 1 LV-RP; Art. 47 IV 1 LV-Ss; Art. 14 III 1 LV-SH; Art. 57 IV 1 LV-Th. 102 Vgl. § 9 IV 4 GOLT-BW; Art. 21 II LV-By; § 14 V GO-Be; § 12 III GOLT-Bg; Art. 69 IV 4 LV-Bg; Art. 92 III 1 LV-Br; Art. 18 II 2 LV-Ha; § 3 IV 1 GOLT-MV; Art. 39 I 2 LVNRW; Art. 71 I 3 LV-Sl. 103 Vgl. Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 6. 104 Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 2. In Bayern und Berlin obliegt dem Präsidium diese Aufgabe, § 10 I 1 GOLT-By, § 13 II GO-Be. In Niedersachsen entsteht der Voranschlag unter Mitwirkung des Präsidiums, in Rheinland-Pfalz unter Mitwirkung des Vorstandes und in Sachsen-Anhalt unter Mitwirkung des Ältestenrats, vgl. § 8 Satz 2 GOLT-Nds, § 5 II GOLTRP, § 10 II 2 GOLT-SA. In Thüringen wird der Haushaltsvoranschlag gem. § 5 II 2 GOLT-Th vom Landtagspräsidenten im Benehmen mit den Vorstandsmitgliedern aufgestellt. los Schick, S. 74. 106 § 13 II GOLT-BW; § 15 II GOLT-Bg; § 46 II GOLT-He; § 12 GOLT-NRW; § 31 Satz 1 Gesetz über den Landtag des Saarlandes; § 8 II 1 GOLT-Ss. Vgl. hierzu auch die Darstellung aufS. 67 ff. 107 § 5 II GOLT-SH.
302
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
ohne Mitwirkung anderer parlamentarischer Gremien fest. Weicht allerdings der so festgestellte Voranschlag des Landtags von dem Entwurf des Haushaltsplanes des Finanzministers ab, so ist die Abweichung vom Finanzminister der Landesregierung mitzuteilen, soweit der Änderung nicht zugestimmt worden ist 1 0 8 . Stimmt das Landesministerium dem Voranschlag des Parlaments nicht zu, so sind die Teile, über die kein Einvernehmen erzielt worden ist, mitunter auch der gesamte Voranschlag des Landtags, unverändert dem Entwurf des Haushaltsplanes beizufügen 109. Diese Regelung ist eine Verbeugung vor der Unabhängigkeit des Verfassungsorgans Parlament gegenüber der Regierung. Ansonsten gelten für den Einzelplan des Parlaments die üblichen Verfahrensstationen, d. h. der Haushaltsentwurf des Landtages ist genauso der Beschlußfassung des Haushaltsausschusses und des Plenums unterworfen wie jeder andere Einzelplan. Der Präsident ist also im Haushaltsbewilligungsverfahren nicht viel besser gestellt als jeder andere Bedarfsträger auch, insbesondere erwartet der Haushaltsausschuß bei seinen Beratungen, daß der Präsident seinen Einzelplan dort persönlich vertritt und Rede und Antwort steht. Das Verfahren zeigt im übrigen, daß sich das Parlament hinsichtlich seines Haushaltes in einer Zwitterrolle befindet, da es Bedarfträger und bewilligende Stelle zugleich ist. Während der Präsident, unterstützt von Präsidium, Vorstand oder Ältestenrat den Bedarf vertritt, obliegt dem Haushaltsausschuß und letztlich dem Plenum die Bewilligung 110 . Der Präsident führt den beschlossenen Haushaltsplan aus. Dabei hat er - wie die Landesregierung - die Befugnis zu Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßigen Ausgaben, bedarf aber gegebenenfalls der Zustimmung des Finanzministers und der nachträglichen Genehmigung des Landtags111. Die Haushaltsführung des Präsidenten unterliegt außerdem der Überwachung durch den Landesrechnungshof 1 1 2 . Jedoch wird der Einzelplan des Landtags nicht in die Entlastung der Landesregierung einbezogen, weil die Landesregierung nicht für die Haushaltsführung des Landtagspräsidenten verantwortlich gemacht werden kann 113 .
I L Die Vertretung des Landtags Der Präsident vertritt das Land in allen Angelegenheiten des Landtags. Diese allgemeine Vertretung des Landtags bezieht sich nach dem expliziten Wortlaut der meisten Landessatzungen sowohl auf den rechtsgeschäftlichen Bereich als auch auf die Rechtsstreitigkeiten 114, wozu auch die verfassungsrechtlichen Streitigkei108
Siehe dazu § 28 III der Landeshaushaltsordnungen.
109
Vgl. § 29 III der Landeshaushaltsordnungen, no Vgl. Schick, S. 73. m Vgl. z. B. Art. 143 LV-He. 112 Vgl. z. B. Art. 144 LV-He iVm. § 108 RHO-He. 113 Geller/Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 5 c.
II. Die Vertretung des Landtags
303
ten gehören, und stellt somit die konsequente Folge der präsidialen Behördeneigenschaft dar 1 1 5 . Ebenso obliegt dem Präsidenten die Vertretung des Landes nach außen, soweit Angelegenheiten des Landtags betroffen sind. Die staatsrechtliche Vertretung umfaßt vor allem die Aufgabe des Präsidenten, das Parlament staatsrechtlich zu repräsentieren.
1. Die staatsrechtliche Repräsentation In seiner Funktion als staatsrechtlicher Repräsentant des Landtags ist der Präsident die symbolische und offizielle Personifizierung des Parlaments 116 und hat in dieser Eigenschaft ein großes Pensum hochpolitischer und gesellschaftlich-formaler Repräsentationsverpflichtungen zu erfüllen. Dazu gehören Staats- und Festakte, offizielle Veranstaltungen im Namen des Landtags, Würdigungen der für das Staatswesen bedeutenden Persönlichkeiten und Begebenheiten aus der Geschichte und Gegenwart, auch Staatsbegräbnisse und Trauerakte verlangen zumindest die Anwesenheit, wenn nicht gar die persönliche Aktivität des Landtagspräsidenten. Aus seiner Repräsentationsfunktion erwachsen auch seine Pflichten als Gastgeber ausländischer Parlamentarier, die er zu Besuchen einlädt, oder als Leiter von Delegationen des Landtags bei offiziellen Besuchen im Ausland. In all diesen Fällen agiert der Landtagspräsident nicht als schlichter Abgeordneter, sondern stets als Vertreter des Landtags im gesamten117, immer bemüht, dessen politische Bedeutung zu dokumentieren und dessen Ansehen zu wahren. Doch damit ist die Aufgabe des Präsidenten, den Landtag zu repräsentieren, keineswegs erschöpft. Vielmehr ist der Präsident auch Empfänger und Absender des gesamten Schriftverkehrs des Landtags mit anderen staatlichen oder öffentlichen Stellen sowie mit Privaten. Er ist Ansprechpartner der Bürger, soweit diese Eingaben und Anfragen an das Parlament und nicht an einzelne Abgeordnete richten. Ihm obliegt der dienstliche Verkehr mit der Regierung, Rechnungshof und dem Landesbeauftragten für Datenschutz 118 , er nimmt die an den Landtag gerichteten Erklärungen entgegen119 und teilt der Regierung die an sie gerichteten Landtagsbeschlüsse mit 1 2 0 . Die dem Präsidenten obliegende staatsrechtliche Repräsentation umfaßt also kurzum jedes Handeln nach außen für die nicht rechtsfähige Körperschaft des Landtags 121 . 114 Vgl. z. B. Art. 21 II LV-By; Art. 86 Satz 3 LV-He; Art. 39 I LV-NRW; Art. 29 V LVMV; Art. 7114 LV-Sl; Art. 14 III 2 LV-SH; Art. 18 II 2 LV-Ha; Art. 92 III LV-Br. 115 So David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 34. 116 Siehe Loewenberg, S. 371. 117 Der Begriff „Vertretung" ist in diesem Zusammenhang nicht im Rechtssinn zu verstehen, vgl. auch Kleinschnittger, S. 151. ne Vgl. z. B. §§ 101, 36 GOLT-BW. 119
Ζ. B. die Rücktrittserklärung eines Ministerpräsidenten, soweit sie nicht vor dem Plenum erfolgt. 120 Vgl. z. B. §§ 10 II GOLT-BW. 121 So Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 4.
304
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
Die Repräsentantenstellung des Präsidenten hat allerdings auch eine nach innen gerichtete Seite, ζ. B. in Form der ständigen Kooperation mit den politischen Gremien des Parlaments 122. Ebenso bestimmen die Landesverfassungen, daß etwa der Verzicht auf das Abgeordnetenmandat gegenüber dem Präsidenten schriftlich zu erklären ist 1 2 3 . Gleichermaßen sind ihm gegenüber auch sonstige Erklärungen abzugeben, soweit sie nicht vor dem Parlament abzugeben sind (beispielsweise Angaben nach den Verhaltensregeln). In diesen Zusammenhang gehört schließlich auch die Pflicht des Präsidenten, die Würde und Rechte des Landtags zu wahren 1 2 4 , insbesondere durch Strafanzeigen, Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit oder der Presse sowie die Überwachung von Fristen, die von der Regierung zu beachten sind 1 2 5 . Zur Innenvertretung ermächtigt im übrigen auch das Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft 126. Danach kann der Präsident gem. § 411 Einspruch über die Gültigkeit der Wahl einlegen. Unterschiedlich beurteilt wurde in diesem Zusammenhang allerdings wiederholt die Frage, wer einen Untersuchungsausschuß nach außen vertritt. Mangels besonderer Regelung ist jedenfalls für Nordrhein-Westfalen festzustellen, daß es bei der allgemeinen Außenvertretungsbefugnis des Präsidenten bleibt, während etwa in Bayern, im Saarland und in Schleswig-Holstein die Außenvertretung des Untersuchungsausschusses von dessen Vorsitzenden wahrgenommen wird. Regelmäßig vollzieht dann im Auftrag des Vorsitzenden die Landtagsverwaltung die Beweisbeschlüsse, indem sie Zeugen und Sachverständige lädt und Beweismittel anfordert 127 .
2. Die Vertretung in Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten Nach dem Wortlaut der meisten Landesverfassungen vertritt der Landtagspräsident das Land in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten des Landtags 128 . Diese Vertretung ist zugriffsfest und kann weder durch Landesgesetz noch durch die Geschäftsordnung eingeschränkt werden 129 . Der Formulierung jener Verfassungsbestimmungen liegt der Umstand zugrunde, daß der Landtag zwar oberstes Verfassungsorgan ist, aber gleichwohl keine Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit auch nicht rechtsfähig im Sinne des Bürgerlichen Gesetz122 Schick, S. 31. 123 Siehe z. B. Art. 41 II 2 LV-BW. 124 Vgl. z. B. § 9 II 2 GOLT-BW. 125 Vgl. Troßmann, § 7, Rn. 19 ff. 126 In der Fassung vom 22. 7. 1986, GVB1. S. 223, zuletzt geändert am 1. 7. 1993, GVB1. S. 149. 127 So Grosse-Sender, in: Schneider/Zeh, § 64, Rn. 10. 128 Art. 18 III 1 LV-Nds; Art. 29 V LV-MV; Art. 49 III 1 LV-SA; Art. 7114 LV-Sl; Art. 57 IV 1 LV-Th; Art. 14 III 2 LV-SH; Art. 18 II 2 LV-Ha; Art. 92 III LV-Br. 129 So Neumann, Art. 92 LV-Br, Rn. 7.
II. Die Vertretung des Landtags
305
buches 130 . Vertragspartner bei allen Rechtsgeschäften ist deshalb die Gebietskörperschaft, also das jeweilige Land, das insoweit vom Landtagspräsidenten vertreten wird, als es sich um Angelegenheiten des Parlaments handelt. Entsprechendes gilt für alle Rechtsstreitigkeiten des Landtags, vor allem solchen der Landtagsverwaltung, die zivilrechtlicher, Vertrags-, Schadensersatz-, arbeits- oder auch verwaltungsrechtlicher Natur sein können 131 . Auch hier ist grundsätzlich das Land aktiv oder passiv legitimiert, wird jedoch für diesen Bereich durch den Landtagspräsidenten gesetzlich vertreten. Das Rubrum in Prozessen der Landtagsverwaltung lautet daher: „Das Land . . . , gesetzlich vertreten durch den Präsidenten des Landtags" 132 . Nach einer Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes gilt das Vertretungsrecht des Präsidenten ebenfalls bei Rechtsstreitigkeiten aus der Tätigkeit von Untersuchungsausschüssen und um die ordnungsgemäße Erledigung von Petitionen 133 . Die Vertretungsbefugnis des Präsidenten ergibt sich hier - basierend auf den entsprechenden Verfassungs- und Geschäftsordnungsbestimmungen - aus dem allgemeinen Gedanken, „daß der Umfang der Vertretungszuständigkeit eines Organs sich grundsätzlich nach seinem Aufgabenbereich bestimmt" 134 . In einigen Ländern, wie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen, beschränkt der Verfassungswortlaut die präsidiale Vertretungsmacht scheinbar insoweit, als sich diese nur auf Rechtsstreitigkeiten der Landtagsverwa/iwrtg bezieht 135 , verfassungsrechtliche Streitigkeiten des Parlaments demnach - zumindest vom Wortlaut her - nicht erfaßt werden. Die Vertretungsbefugnis des Präsidenten in Streitigkeiten vor dem Staatsgerichtshof oder Verfassungsgerichtshof ergibt sich in diesen Ländern jedoch aus der „allgemeinen Stellung" 136 des Präsidenten als Repräsentanten des höchsten Verfassungsoigans und aus der Geschäftsordnung 137. Diese enthält in allen genannten Ländern die Regelung: „Der Landtagspräsident vertritt den Landtag" 138 . Da hier Einschränkun130 Barschel/Gebel, Art. 13 LV-SH, Anm. 5, Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 4; Meder, Art. 21 LV-By, Rn. 5. 131 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 35. 132 Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 4. 133 So der BayVGH in einem Beschluß vom 10. 10. 1979 Nr. 849 XII 78, in: BayVBl. 1981,211. 134 Ebenda. Siehe dazu auch Freudling, in: BayVBl. 1969, S. 11 ff. sowie BVerwGE 14, 330 (333 ff.). 135 Art. 32 III 2 LV-BW; Art. 21 II LV-By; Art. 86 Satz 3 LV-He; Art. 39 I LV-NRW; Art. 85 III 2 LV-RP; Art. 47 IV 2 LV-Ss. 136 So Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 4. 137 So der Hessische Staatsgerichtshof in einem Urteil vom 25. 10. 1967, in: DÖV 1968, 50 (51); Zinn/Stein, Art. 86 LV-He, Erl- 4; Geller /Kleinrahm, Art. 39 LV-NRW, Anm. 4; vgl. auch StGH Baden-Württemberg, in: BWVB1. 1970,1969. 138 § 91 GOLT-BW; § 1212 GOLT-By; § 441 1 GOLT-He; § 1011 GOLT-NRW; § 4 Satz 1 GOLT-RP; § 4 1 1 GOLT-Ss. 20 Köhler
306
8. Abschnitt: Leiter der Parlamentserwaltung und Vertreter des Landtags
gen nicht ersichtlich sind, gilt dieses Vertretungsrecht folglich auch für Verfassungsstreitigkeiten 139. Das Rubrum lautet demgemäß: „Der Landtag von . . . , vertreten durch seinen Präsidenten" 140. Verfassungsrechtlicher Art sind ζ. B. Streitigkeiten zwischen dem Präsidenten und einzelnen Abgeordneten über die Entschädigung für die Abgeordnetentätigkeit 141, ebenso wie Streitigkeiten über Fraktionszuschüsse142. Dagegen haben Streitigkeiten über die Rückforderung von Abschlagszahlungen auf Wahlkampfkosten öffentlich-rechtlichen Charakter nichtverfassungsrechtlicher A r t 1 4 3 . Als gesetzlicher Vertreter des Parlaments nimmt der Präsident vor Gericht die Anliegen des Landtags als Gesamtheit, „nicht die Anliegen der Mehrheit" wahr 144 . Dies ist in der Regel unproblematisch, sofern es um rein fiskalische 145 oder verwaltungsrechtliche 146 Prozeßgegenstände geht. Schwierigkeiten kann es indessen geben, wenn sich innerhalb des Landtags zu einer Frage divergierende Mehrheitsund Minderheitsmeinungen herausgebildet haben und eine Minderheitsfraktion ihre Auffassung vor dem Verfassungsgericht im Wege des Organstreits gegen den Landtag, d. h. seine Mehrheit durchsetzen w i l l 1 4 7 . Hier kann die Aufgabe des Präsidenten, den Landtag zu vertreten, leicht mit dem Neutralitätsgebot kollidieren, weil sich seine Prozeßführung der Sache nach als Förderung der Mehrheitsmeinung erweist. In der Praxis wird bei solchen Konstellationen inzwischen derart verfahren, daß sich der Landtag, jeweils unbeschadet der Rechte des Präsidenten, besondere Vertretungen für die Mehrheits- und die Minderheitsauffassung wählt 1 4 8 . Da der Landtagspräsident nicht verpflichtet ist, persönlich vor Gericht aufzutreten 149, kann er sich in solchen Fällen durch Prozeßbevollmächtigte ver139 Diese Auffassung ist nicht unumstritten, vgl. Reich, Art. 49 LV-SA, Anm. 1, der der Meinung ist, daß der Umfang des Vertretungsrechts nicht durch die parlamentarische Geschäftsordnung bestimmt werden könne. Gleichwohl könne die Geschäftsordnung die Berechtigung intern an die Beteiligung eines parlamentarischen Gremiums, etwa des Ältestenrats, knüpfen. Im Rahmen dieser Zuständigkeit habe der Präsident nach pflichtgemäßen Ermessen auch über die Einlegung von Rechtsmitteln zu entscheiden. 140 Zinn /Stein, Art. 86 LV-He, Erl. 4. 141 David, Art. 18 LV-Ha, Rn. 35 und Art. 13 LV-Ha, Rn. 20. 142 BVerwG, Urteil vom 11. 7. 1985, in: DÖV 1986, 246 f. 143 BVerwG, Beschlüsse vom 16. 1. 1980, in: NJW 1980, 2092 und in: JZ 1980, 477; BVerfG, Urteil vom 14. 7.1986, in: BVerfGE 73,1 (30 f.). 144 So das BVerfG in einem Beschluß vom 15.2. 1952, BVerfGE 1,115 (116). 145 Ζ. B. vermögensrechtliche Ansprüche gegen das Parlament aus Verkehrsunfällen. 146 Ζ. B. Streitigkeiten aus dem Beamten Verhältnis zwischen dem Landtag und einem Angehörigen seiner Verwaltung. 147 Vgl. zu weiteren Fallkonstellationen Gusy, in: Schneider /Zeh, § 60, Rn. 32. 148 Vgl. zur gesamten Thematik Troßmann, § 7, Rn. 3 ff.; s.a. Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 20. 149 Auf Bundesebene berichtet Troßmann nur von einem einzigen Fall, in dem der Bundestagspräsident persönlich als Vertreter des Bundestages vor dem Bundesverfassungsgericht aufgetreten ist, vgl. Troßmann, § 7, Rn. 6.
Π. Die Vertretung des Landtags
307
treten lassen 150 . Üblich ist dabei die Vertretung durch Abgeordnete des Landtags, aber auch Rechtsanwälten und Hochschullehrern kann diese Aufgabe übertragen werden 151 . Die Prozeßbevollmächtigten treten zwar auch im Namen des gesamten Hauses auf; sie nehmen aber keine besondere Stellung ein, welche sie zu einer politischen Neutralität verpflichtet, auf die sie schon bei der Leitung der nächsten Plenarsitzung ihre Autorität stützen müßten. Das so beschriebene Verfahren berücksichtigt demzufolge die Neutralitätspflicht des Präsidenten und mindert den Anschein der Parteilichkeit 152 .
150 Ritzel/Bücker, § 7, S. 3. 151 Vgl. Braun, Art. 32 LV-BW, Rn. 4 mit Hinweis auf § 141 StGHG-BW. 152 Gusy, in: Schneider/Zeh, § 60, Rn. 32. 20*
eter Abschnitt
Interparlamentarische Zusammenarbeit Um ein vollständiges Bild vom Aufgabenfeld der Landtagspräsidenten zu geben, darf deren Tätigkeit im Rahmen der „Konferenz der Präsidenten der deutschen Länderparlamente" nicht unterschlagen werden 1. Die Landtagspräsidenten-Konferenz wurde in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts ins Leben gerufen, ohne dabei an eine historische Vorgänger-Institution anknüpfen zu können. Lediglich die Direktoren der deutschen Parlamente hatten sich in der Weimarer Zeit zur Erörterung parlamentarischer Organisations- und Verwaltungsfragen zusammengeschlossen; die Arbeit wurde jedoch nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges nicht weiter fortgeführt. Hingegen trafen sich erstmals im November 1947 die Präsidenten der unter der Besatzungsherrschaft gewählten und konstituierten Regionalparlamente. Inhalt der Zusammenkunft war die Beratung von Problemen, die sich bei der Organisation und Durchführung der Plenarsitzungen ergeben hatten. Nach einer weiteren Sitzung im Jahre 1950 wurde zwei Jahre später die Institutionalisierung der Landtagspräsidenten-Konferenz beschlossen. Seither treffen sich alle Amtsinhaber sowie alle Landtagsdirektoren mindestens einmal jährlich zu einer Vollversammlung. Bei aktuellen Problemen können außer der Reihe Sondersitzungen anberaumt werden. Als Gast hat in den letzten Jahren regelmäßig auch der Bundestagspräsident oder ein Mitglied des Präsidiums des Bundestages an den Vollsitzungen teilgenommen. Entsprechend ihrem Ziel, die Stellung der Parlamente im Prozeß der Willensbildung und politischen Entscheidung zu wahren, befaßt sich die Präsidenten-Konferenz mit allen die Landtage betreffenden verfassungsrechtlichen Fragen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen daher regelmäßig Fragen des Verhältnisses von Parlament und Regierung, der internen Organisation und Arbeitsweise der Landtage, vor allem aus dem Parlaments- und Geschäftsordnungsrecht, der Rechtsstellung der Abgeordneten und der Parlamentsverwaltungen. Gleichwohl ist in der Zeit des Bestehens dieser Konferenz ein Wechsel der Themenschwerpunkte feststellbar. Während die Anfangszeit vom Wiederaufbau des parlamentarischen Systems beherrscht war, von Fragen der Organisation und Verwaltung der Parlamente, der Praxis der parlamentarischen Verhandlungen, der Stellung der Abgeordneten sowie der Einführung parlamentarischer Hilfsdienste, befaßten sich die Beratungsthemen ι Die Darstellung orientiert sich im wesentlichen an Huth, Die Konferenz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente, und Klatt, in: Schneider/Zeh, § 67, Rn. 63 ff.
9. Abschnitt: Interparlamentarische Zusammenarbeit
309
später mit der Regierungs- und Verwaltungskontrolle der Parlamente, mit Untersuchungsausschüssen und mit dem Petitionswesen. In den letzten Jahren rückte die bundesstaatliche Ordnung in den Vordergrund des Interesses, und in jüngster Zeit vor allem das Verhältnis der Regionalparlamente zur Europäischen Union sowie die europäische Integrationspolitik überhaupt. Bei der Konferenz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente handelt es sich um eine zwischenstaatliche Institution, die verfassungsrechtlich nicht vorgesehen ist. Sie wirkt nach außen hin durch Beschlüsse, Erklärungen oder Empfehlungen; letztere werden in Kommissionen, bestehend aus vier bis fünf Landesvertretern, in intensiven Beratungen vorbereitet. Die von der Konferenz verabschiedeten Beschlüsse können für die Landtage keine Rechtsbindung entfalten, unterliegen also der Kompetenz der gesetzgebenden Körperschaften, ehe sie rechtsverbindlich werden. Da ein Zwang, die Beschlüsse ihrer Präsidenten auszuführen oder den Empfehlungen zu entsprechen, für die Landesparlamente nicht besteht, variieren die parlamentsrechtlichen Regelungen in den Ländern immer noch beträchtlich. Als Beispiel hierfür seien die Organisations- und Verfahrensregelungen der Untersuchungsausschüsse genannt. Gleichwohl können gemeinsame Beratungen und Entschließungen der Amtsinhaber mitunter wesentlich zur Durchsetzung und Beschleunigung von Initiativen in den Landtagen beitragen. Die Weiterleitung der erarbeiteten Vorschläge erfolgt im allgemeinen über das Präsidium oder den Ältestenrat, dem der jeweilige Präsident vorsitzt, zum Teil auch über die einzelnen im Landtag vertretenen Fraktionen. Selbst wenn die Umsetzung der Konferenzbeschlüsse und der anderen Initiativen nicht immer Aussicht auf Erfolg hat, so liegt die eigentliche Bedeutung der Landtagspräsidentenkonferenz in ihrer Eigenschaft als Forum des Meinungs- und Erfahrungsaustausches. Die zwischenparlamentarische Verständigung ist auch für die Verwaltung der Parlamente gewinnbringend, ζ. B. beim Austausch von Materialien und bei Installation und Betrieb von Informationssystemen. Die Präsidentenkonferenz avanciert auf diese Weise zum herausragenden Kommunikationsund Kooperationszentrum der deutschen Landtage.
Schlußbetrachtung Zusammenfassend läßt sich zunächst festhalten, daß die Stellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern im Staats- und Verfassungsleben, im Verfahrensgang der parlamentarischen Verhandlung und im Wechselspiel mit den verschiedenen parlamentarischen Gremien in den Grundzügen weitestgehend übereinstimmt. So steht etwa allen Präsidenten der Vorsitz und damit die Verhandlungsleitung im Präsidium und im Ältestenrat zu, wenngleich ihnen in einigen Landtagen das Stimmrecht in dem letztgenannten Gremium verwehrt ist. Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse dieser Gremien sind zum Teil sehr unterschiedlich und grenzen daher den Wirkungskreis des Präsidenten in einigen Parlamenten mehr, in anderen weniger ein. Dies gilt vor allem für Personalentscheidungen innerhalb der Landtagsverwaltung, bei denen der Landtagspräsident mitunter an die Zustimmung von Präsidium und Ältestenrat gebunden ist oder diese Gremien zumindest vorher anzuhören hat. Ebenso ist den Landtagspräsidenten durch die Landesverfassungen gleichermaßen die Ausübung der Leitungsgewalt, der Ordnungsgewalt, des Hausrechts sowie der Polizeigewalt übertragen worden. Ausnahmsweise in Bremen findet die Ausübung der Polizeigewalt durch den Präsidenten der Bürgerschaft keine Stütze in der Landessatzung. Die innerhalb dieser vier Funktionen auszumachenden Unterschiede sind zwar recht vielfältig, betreffen aber in der Regel lediglich Detailfragen. Dementsprechend sind für den Bereich der Leitungsgewalt nur einige wenige Punkte erwähnenswert. Hierzu gehört etwa das dem Präsidenten in einigen Landtagen eingeräumte materielle Prüfungsrecht bezüglich der eingebrachten Beratungsgegenstände, die vereinzelt anzutreffende Befugnis, selbständig das Parlament einzuberufen sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Präsidenten, die Redezeit der Abgeordneten zu verlängern. Im Bereich der Ordnungsgewalt steht jedem Parlamentspräsidenten im wesentlichen der gleiche Maßnahmenkatalog zur Aufrechterhaltung der parlamentarischen Ordnung zur Verfügung. In einigen wenigen Landtagen ist er punktuell erweitert worden, so daß der Präsident ζ. B. einen Ordnungsruf auch noch nachträglich erteilen darf oder auch zur Verhängung eines sofortigen Wortentzugs ermächtigt ist. Ansonsten ergeben sich hier Unterschiede vor allem bei den geschäftsordnungsmäßig geforderten Voraussetzungen für die einzelnen Ordnungsmaßnahmen sowie bei den verschiedenen Ermessensspielräumen des Präsidenten. Auch die Einspruchsmöglichkeiten gegen präsidielle Ordnungsmaßnahmen sind in den Parlamenten sehr unterschiedlich geregelt. Mitunter wird dabei dem Landtagspräsidenten ein sog. Vorprüfungsrecht eingeräumt, d. h. er kann dem Einspruch
Schlußbetrachtung
311
abhelfen, bevor sich der Ältestenrat oder das Präsidium letztinstanzlich damit beschäftigt. Gravierende Unterschiede gibt es bei der staatsrechtlichen Stellung des Präsidentenamtes. Während ihn einige Länderverfassungen als selbständiges Staatsorgan betrachten, ist er in anderen - zum Teil nach höchstrichterlichen Entscheidungen - lediglich Unterorgan des Landtags. Unterschiedlich bewertet wird zudem die protokollarische Einordnung des Landtagspräsidenten im Verhältnis zum Ministerpräsidenten und die damit verbundene Frage nach dem „ersten Mann im Staate", die hier zugunsten des Regierungschefs entschieden wird, der kraft Verfassung die typischen Funktionen eines republikanischen Staatsoberhauptes wahrzunehmen berechtigt ist. Obgleich die Praxis der meisten Länder diesem Ergebnis entspricht, hat sich in einigen Flächenstaaten eine andere Rangfolge herausgebildet, die sich mittlerweile aufgrund ständiger Übung verfestigt hat. Unterschiede sind ferner bei den Gründen, die zur Beendigung des Präsidentenamtes führen, festzustellen. Beispielsweise verliert der Landtagspräsident in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sein Amt, wenn er nicht mehr Mitglied einer Fraktion ist. Außerdem haben die Parlamente in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Thüringen die rechtliche Möglichkeit geschaffen, den Präsidenten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen vorzeitig abzuberufen. In allen anderen Ländern ist die Abwahl des Landtagspräsidenten verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Hervorzuheben sind schließlich noch Befugnisse, die der herausgehobenen Stellung des Landtagspräsidenten besonderen Ausdruck verleihen. So hat der Bayerische Landtagspräsident in bestimmten Konstellationen das Recht, den Landtag aufzulösen und den Flächenstaat Bayern nach außen hin zu vertreten. In Niedersachsen indessen räumt die Landessatzung dem Präsidenten ein Zustimmungsrecht zu den Notverordnungen der Landesregierung ein, so daß der Präsident gewissermaßen als Ersatzparlament tätig wird. Ferner ist der Landtagspräsident nach der Saarländischen Verfassung berechtigt, den Ministerpräsidenten bei dessen Rücktritt oder einer sonstigen Beendigung des Amtes von der Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes freizustellen. Schließlich steht dem Präsidenten in Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt das Ausfertigungsrecht im Gesetzgebungsverfahren zu, in Brandenburg überdies die Verkündung. Vor allem durch diese beiden Funktionen im Gesetzgebungsverfahren nimmt der Landtagspräsident eine Stellung ein, die üblicherweise nur einem Staatsoberhaupt zukommt. Die genannten Aspekte können nur auszugsweise die Verschiedenartigkeit der rechtlichen Position des Präsidentenamtes, wie sie sich in manchen Bereichen ergibt, aufzeigen. Obgleich die Offenlegung dieser Unterschiede im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht, sollte die Untersuchung auch deutlich machen, daß das Amt des Parlamentspräsidenten mit einer eigentümlichen inneren Widersprüchlichkeit belastet ist: Er ist als Vertreter einer bestimmten politischen Rieh-
312
Schlußbetrachtung
tung in ein Parlament gewählt worden, soll aber unparteiisch und gerecht die Würde des Hauses wahren; er gehört einer Versammlung an, die kollegial und nicht hierarchisch organisiert ist, soll aber im Interesse der Würde und Ordnung des Hauses Maßnahmen gegen seine Kollegen treffen; er verdankt sein Amt einer Mehrheit und ist doch zum Schutze der Minderheit berufen. Ungeachtet aller Verschiedenheiten in der rechtlichen Ausgestaltung dieser Position fordert das Präsidentenamt im parlamentarischen Alltag eines jeden Landesparlaments von seinem Inhaber die gleichen besonderen Eigenschaften. Robert von Mohl hat sie bereits 1860 treffend benannt: " unerschütterliche Ruhe und Selbstbeherrschung, Festigkeit und Unparteilichkeit gegen Freund und Feind, gewinnendes Benehmen, schnelle Auffassung und scharfsinnige Beurteilung plötzlich eintretender Fragen oder Tatsachen, sichere logische Beherrschung der Verhandlungen, beständige Kenntnis der Geschäftsordnung und des Geschäftsstandes, endlich eine Eindruck machende Persönlichkeit und eine leichte Handhabung des Wortes, womöglich selbst ernste Beredsamkeit" 1. An der Gültigkeit dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert.
1
Robert von Mohl, Die Geschäftsordnungen der Ständeversammlungen, in: Staatsrecht, Völkerrecht und Politik (1860), S. 285, zitiert nach Partsch, in: AöR 86 (1961), 1 (6).
Gesetzestexte 1. Landesverfassungen Verfassung des Landes Baden-Württemberg (GBl. S. 81).
vom 11.11.1953, zuletzt geändert am 12.2.1991
Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 1946, zuletzt geändert am 20. 6. 1984 (GVB1. S. 223). Verfassung von Berlin vom 22. 10. 1995. Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. 8. 1992 (GVB1.1S. 298). Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21. 10. 1947, zuletzt geändert am 1. 11. 1994 (BremGBl. S.289). Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. 6. 1952, zuletzt geändert am 20.06. 1996 Verfassung des Landes Hessen vom 1. 12. 1946, zuletzt geändert am 20. 3. 1991 (GVB1.1 S. 101,102). Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vom 23. 5.1993 (GV0B1. S. 372).
Niedersächsische Verfassung vom 13.5.1993, zuletzt geändert am 6.6.1994 (GVB1. S. 229). Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 24. 11. 1992. Verfassung für Rheinland-Pfalz S. 405).
vom 28. 6. 1950, zuletzt geändert am
vom 18. 5. 1947, zuletzt geändert am 12. 10. 1995 (GVB1.
Verfassung des Saarlandes vom 15. 12. 1947, zuletzt geändert am 9. 6. 1993 (Amtsbl. S. 626). Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. 5. 1992 (GVB1. S. 243). Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. 7. 1992 (GVB1. S. 564). Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (GV0B1. S. 391).
vom 13. 12. 1949, zuletzt geändert am 13.6.1990
Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. 10. 1993 (GVB1. S. 625).
2. Parlamentarische Geschäftsordnungen Geschäftsordnung des Landtags von Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Juni 1989, geändert durch Beschluß vom 9. Dezember 1992 (GBl. 1993 S. 43). Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag in der Fassung vom 1. August 1985, zuletzt geändert am 22. 7. 1992.
314
Gesetzestexte
Geschäftsordnung des Landtages von Brandenburg vom 11. Oktober 1994 (GVB1.1S. 414). Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 1984 (GVB1. S. 401), zuletzt geändert durch Beschluß des Abgeordnetenhauses vom 8. Juni 1995 (GVB1. S. 377). Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft in der Fassung des Übernahmebeschlusses vom 6. November 1991, zuletzt geändert am 23. Februar 1995. Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft vom 11. Dezember 1997. Geschäftsordnung des Hessischen Landtags vom 16. Dezember 1993 (GVB1. I S. 628), zuletzt geändert durch Beschluß des Landtags vom 30. Mai 1995 (GVB1.1S. 412). Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern in der ab 1. März 1991 geltenden Fassung vom 27. Februar 1991 (GVOB1. M-V S. 50), geändert durch Beschluß des Landtages vom 9. Dezember 1994. Geschäftsordnung für den Niedersächsischen Landtag vom 7. Dezember 1994. Geschäftsordnung des Landtags von Nordrhein-Westfalen 29. November 1995 und 25. Januar 1996. Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz
vom 1. Juni 1995, geändert am
vom 14. Oktober 1996 (GVB1. S. 387).
Geschäftsordnung des Saarländischen Landtages vom 20. Juni 1973 (Amtsbl. S. 529), zuletzt geändert am 14. Dezember 1994. Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages der 2. Wahlperiode. Vorläufige Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt vom 21. Juli 1994, zuletzt geändert durch Beschluß des Landtages vom 4. Mai 1995. Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen 1993
Landtages in der Fassung vom 26. März
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags vom 7. Juli 1994
3. Sonstige Gesetze Gesetz Nr. 970 über den Landtag des Saarlandes vom 20. Juni 1973 (Amtsbl. S. 517), zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 1261 vom 14. März 1990 (Amtsbl. S. 422).
Literaturverzeichnis Abmeier, Klaus: Die parlamentarischen Befugnisse der Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach dem Grundgesetz, Diss. Mainz 1983. Achterberg, Norbert: Das rahmengebundene Mandat, Berlin /New York 1975. - Parlamentsrecht, Tübingen 1984. - Zur Rechtsnatur parlamentarischer Rügen - BVerfGE 60,374, in: JuS 1983,840-843. Alternativkommentar, Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von Rudolf Wassermann, Band II (Art. 38-146), 2. Auflage, Neuwied 1989. Anschütz, Gerhard: Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, Nachdruck der 14. Auflage von 1933, Darmstadt 1965. Arndt, Klaus Friedrich: Parlamentarische Geschäftsordnungsautonomie und autonomes Parlamentsrecht, Berlin 1966. Bar, Ludwig von: Der § 64 der Geschäftsordnung des preußischen Abgeordnetenhauses, in: DR 1912, Sp. 302 ff. Barschel, Uwe/ Gebet, Volkram: Landessatzung für Schleswig-Holstein, Kommentar, Neumünster 1976. Bartels, Werner: Die Stellung des Reichstagspräsidenten, Diss. Halle 1923. Bayer, Helmut: Der niedersächsische Landtag, Hannover 1980. Bendix, Ludwig: Zum Fall Borchardt, in: JW 1912,665 ff. Berg, Wilfried: Das Hausrecht des Landtagspräsidenten - VGH München, BayVBl. 1980, 723, in JuS 1982, 260-264. Bethge, Herbert: Das Hausrecht der öffentlichen Hand im Dilemma zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, in: Die Verwaltung (10) 1977, 315-332. - Stichwort „Bundestag", in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, Band I, 7. Auflage, Freiburg 1985, Sp. 999-1006. Blischke, Werner: Geschäftsordnung. Kurz skizziert und kommentiert, in: Bundestag von A-Z, Bonn 1976. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung. Eine Untersuchung zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1964. Böttcher, Stefan: Die Rechtsstellung des Landtagspräsidenten, Diss. Kiel 1956. Bonner Kommentar: Kommentar zum Bonner Grundgesetz, hrsg. von Rudolf Dolzer und Klaus Vogel, Bd. 5 (Art. 38-49), Loseblattsammlung, Heidelberg, Stand: 87. Lieferung, Dezember 1998.
316
Literaturverzeichnis
Botzenhart, Manfred: Deutscher Parlamentarismus 1848-1850. Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus, Düsseldorf 1977. Bracher, Karl Dietrich: Die Auflösung der Weimarer Republik, unveränderter 2. Nachdruck der 5. Auflage, Villingen 1971, Düsseldorf 1984. Brandl, Alfons: Die Polizeigewalt des Präsidenten des Bayerischen Landtags, in: BayVBl. 1964, 280-285. Brandt, Hartwig: Parlamentarismus in Württemberg 1819-1870, Düsseldorf 1987. Braun, Klaus: Kommentar zur Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart, München / Hannover 1984. Breihold, Hermann: Die Abstimmung im Reichstag, in: AöR 49 (1926), 289-371. Breitbach, Michael: Die Bannmeile als Ort von Versammlungen, Baden-Baden 1994. - Das Versammlungsverbot innerhalb von Bannmeilen um Parlamente und seine Ausnahmeregelungen, in: NVwZ 1988,584-591 Brentano Di Tremezzo, Heinrich von: Die Rechtsstellung des Parlamentspräsidenten nach Deutschem Verfassungs- und Geschäftsordnungsrecht, Diss. Gießen 1930. Busch, Jost Dietrich: Bannkreise zugunsten der Parlamente im vorläufigen Rechtschutz bei Demonstrationen, in: NVwZ 1985,634-635. Carstens, Karl: Die Stellung des Parlamentspräsidenten nach deutschem Parlamentsrecht, in: Festschrift für Rudolf Hanau, München 1978, S. 121 -129. Dammholz, A. R. Stefan: Die interfraktionelle Vereinbarung, Diss. Marburg 1972. David, Klaus: Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Kommentar, Stuttgart/München / Hannover / Berlin / Weimar / Dresden 1994. Degenhart, Christoph: Staatsrecht 1,14. Auflage, Heidelberg 1998. Delbrück, Ernst: Ministerpräsident - Landtagspräsident, in: DÖV 1958, 353. Demmler, Wolfgang: Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, Diss. Freiburg (Breisgau) 1993. Dexheimer, Wolfgang: Die Mitwirkung der Bundestagsfraktionen bei der Besetzung der Ausschüsse, in: Festschrift für Werner Blischke, Berlin 1982, S. 259-278. Dierl, Brigitte / Dierl, Reinhard / Höffken, falen, Bochum 1982.
Heinz-Werner: Der Landtag von Nordrhein-West-
Dietel, Alfred /Gintzel, Knut ! Kniesel, Michael: Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, 11. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1994. Dreier, Horst: Erkennungsdienstliche Maßnahmen im Spannungsfeld von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, in: JZ 1987,1009-1017. - Grundgesetz, Kommentar, Band II (Art. 20-82), Tübingen 1998 Drexelius, Wilhelm / Weber, Renatus: Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952, Kommentar, 2. Auflage, Berlin 1972. Drews, Bill/ Wacke, Gerhard/ Vogel, KlausIMartens, Wolfgang: Gefahrenabwehr, 9. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1986.
Literaturverzeichnis Edinger, Florian: Fraktionen und Präsidium. Zum Anspruch jeder Fraktion auf Vertretung im Präsidium des Deutschen Bundestages, in: Recht und Politik 2/95,77-83. - Wahl und Besetzung parlamentarischer Gremien: Präsidium, Ältestenrat, Ausschüsse, Diss. Frankfurt a.M. 1991. Ehlers, Dirk: Gesetzesvorbehalt und Hausrecht der Verwaltungen, in: DÖV 1977,737-743. Engels, Felix: Die Funktionen des Reichtagspräsidenten, Diss. Greifswald 1917. Erdmann, Günter: Organstreitigkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht, Diss. Heidelberg 1963. Faber, Heiko /Schneider, Frankfurt a.M. 1985.
Hans-Peter: Niedersächsisches Staats- und Verwaltungsrecht,
Feneberg, Hermann / Simander, August: Landeswahlgesetz, Bezirkswahlgesetz, Landeswahlordnung, 8. Auflage, München 1973. Feuchte, Paul: Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Kommentar, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1987. Franke, Harald: Vom Seniorenkonvent des Reichstages zum Ältestenrat des Bundestages, Berlin 1987. Franke, Ulrich: Ordnungsmaßnahmen der Parlamente, Diss. Münster 1990. Freudling, Fritz: Zur Vertretung des Bundes und der Länder bei Rechtsgeschäften, in: BayVBl. 1969,11-15. Friesenhahn, Ernst: Der politische Eid, Bonn 1928. - Zur Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Bundesverfassungsgerichtsbarkeit und Landesverfassungsgerichtsbarkeit, in: Christian Starck (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Band I, Tübingen 1976, S. 748-799. Geiger, Willi: Die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit in ihrem Verhältnis zur Landesverfassungsgerichtsbarkeit und ihre Einwirkung auf die Verfassungsordnung der Länder, in: Festschrift für Wilhelm Laforet, Band III, München 1952, S. 251 ff. Geller, Gregor / Kleinrahm, Kurt: Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 3. Auflage, Loseblattsammlung, Göttingen, Stand: 1. Lieferung, Oktober 1982. Gentemann, Fritz: Die staatsrechtliche Stellung des Reichstagspräsidenten in Bezug auf die Disziplinargewalt, das Hausrecht und die Polizeigewalt, Diss. Göttingen 1927. Gerlach, Joachim: Die rechtliche Stellung des Parlamentspräsidenten, Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Diss. München 1948. Gerstenmaier, Eugen: Streit und Frieden hat seine Zeit, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1981. Giese, Friedrich: Die Verfassung des Deutschen Reiches, 8. Auflage, Berlin 1931. Giesen, Hans Adolf/ Fricke, München 1972.
Eberhard: Das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen,
Götz, Volkmar: Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Polizei, in: JuS 1985, 869-873. - Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage, Göttingen 1995.
318
Literaturverzeichnis
Goldschmidt, James: Der Vorgang im Preußischen Abgeordnetenhaus vom 9. Mai und die Bedeutung unserer Reichsstrafgesetze, in: JW 1912,562 ff. Gottschalck, Detlef: Die Hamburgische Bürgerschaft, Diss. Hamburg 1993. Gross, W.: Betrachtungen, in: DVB1. 1954,422 - 423. Gundelach, Ulrich: Der Bundestagspräsident, in: Die „vergessenen" Institutionen, hrsg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin bei Bonn 1979. Haagen, Kurt, Die Rechtsnatur der parlamentarischen Geschäftsordnung, Diss. Breslau 1929. Habermehl, Kai: Polizei- und Ordnungsrecht, 2. Auflage, Baden-Baden 1993. Häberle, Peter: „Landesbrauch" oder parlamentarisches Regierungssystem, in: JZ 1969, 613-617. Härth, Wolfgang: Die Befugnis des Präsidenten des Abgeordnetenhauses zur Prüfung verabschiedeter Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit, in: JR 1978,489. - Die Rede- und Abstimmungsfreiheit des Parlamentsabgeordneten in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1983. - Der Aussschluß eines Abgeordneten von der Teilnahme an der Plenarsitzung, in: ZRP 1984,313ff. - Abwählbar oder nicht? Der Parlamentspräsident und sein Amt, in: ZParl. 1985,490-495. - Parlamentspräsidenten und Amtseid, in: ZParl. 1980,497-503. Hamm, O.: Die Ausschließung und Entfernung eines Mitglieds des Preußischen Abgeordnetenhauses in juristischer Beleuchtung, in: DJZ 1912, Sp. 649 ff. Hartwig,
Hans: Die Stellung des Reichstagspräsidenten, Diss. Halle-Wittenberg 1922.
Hatschek, Julius: Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches, Erster Teil, Berlin und Leipzig 1915. - Das Asylrecht des englischen Parlaments, in: Annalen des Deutschen Reichs 1906,801 ff. - Institutionen des Deutschen Staatsrechts, Band I, Das Reichsstaatsrecht, Berlin 1923. Hauenschild, 1968.
Wolf-Dieter: Wesen und Rechtsnatur der parlamentarischen Fraktion, Berlin
Haug, Volker: Bindungsprobleme und Rechtsnatur parlamentarischer Geschäftsordnungen, Diss. Tübingen 1994 Heyden, Jürgen Graf von Cartlow: Die parlamentarische Polizeigewalt im Preußischen Landtag und im Reichstag, Diss. Greifswald 1913. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band VI, Die Weimarer Reichsverfassung, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981. Hubrich, Eduard: Das demokratische Verfassungsrecht des deutschen Reiches, Greifswald 1921. - Die parlamentarische Redefreiheit und Disciplin, Berlin 1899 - Das Polizeirecht des Reichstags und die Reichsstrafprozeßordnung, in: Der Gerichtssaal, Band 71 (1908), S. 127 ff.
Literaturverzeichnis Huth, Ronald, Die Konferenz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente, Diss. Frankfurt a.M. 1988. Ipsen, Jörn / Koch, Thorsten: Öffentliches und privates Recht - Abgrenzungsprobleme bei der Benutzung öffentlicher Einrichtungen, in: JuS 1992, 809-816. Jarass, Hans D.IPieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, München 1995. Jekewitz, Jürgen: Das Personal der Parlamentsfraktionen: Funktion und Status zwischen Politik und Verwaltung, in: ZParl. 1995, 395-423. - Der Grundsatz der Diskontinuität der Parlamentsarbeit im Staatsrecht der Neuzeit und seine Bedeutung unter der parlamentarischen Demokratie des Grundgesetzes. Eine rechtshistorische und rechtsdogmatische Untersuchung, Berlin 1977. - Die Wahl des Parlamentspräsidenten, in: Recht und Politik 1977,98-102. - Organisation und Funktion der Verwaltung des Deutschen Bundestages, in: DVB1. 1969, 513-524. Jellinek, Georg: System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Auflage, Tübingen 1905. Jellinek, Walter: Verfassung und Verwaltung des Reichs und der Länder, 3. Auflage, Leipzig/Berlin 1927. Kägi, Werner: Von der klassischen Dreiteilung zur umfassenden Gewaltenteilung, in: Festschrift für Hans Huber, Bern 1961, S. 151 -173. Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, hrsg. von Karlheinz Boujong, München 1989. Kasten, Hans Hermann: Möglichkeiten und Grenzen der Disziplinierung des Abgeordneten durch seine Fraktion, in: ZParl. 1985,475-484. Keller, Dagmar Jeanette: Parlamentarische Obstruktion, in: ZParl 1986,423 ff. Klein, Hans H.: Vereinbarkeit von Amt und Landtagsmandat der Bürgermeister, in: ZBR 1964,225-227. Kleinschnittger, ster 1962.
Karl-Heinz: Die rechtliche Stellung des Bundestagspräsidenten, Diss. Mün-
Klink, Dieter: Bemerkungen zur Rolle von Parlamentspräsidenten in Politik und Gesellschaft, in: ZParl 1981,436-437. Klinke, Gert: Die Geschäftsordnung des Bundestages, insbesondere die Rechtsstellung des Bundestagspräsidenten unter Heranziehung der Geschäftsordnungen der Länderparlamente, Diss. Köln 1959. Knemeyer, Franz-Ludwig: Öffentlich-rechtliches Hausrecht und Ordnungsgewalt, in: DÖV 1970,596-601. - Das Hausrecht der öffentlichen Verwaltung, in: VB1BW 1982,249 - 252. - Janusköpfiges Hausrecht?, in: DÖV 1971,303-304. Knoke, Thomas: Betriebliche Ordnungsgewalt in Räumlichkeiten des Verwaltungsvermögens, in: AöR 94 (1969), 398-418.
320
Literaturverzeichnis
Köhler, Gerd Michael: Die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten im deutschen Staatsrecht, in: DVB1. 1992,1577-1585 - Die staatsrechtliche Stellung des Präsidenten des Bayerischen Landtags, in: BayVBl. 1988, 33-40. - Die Stellvertretung des Bayerischen Ministerpräsidenten, in: BayVBl. 1983,168-174. Kopp, Ferdinand O.: Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Auflage München 1996. Kortmann, Klaus-Peter: Muß das Hausverbot einer Verwaltungsbehörde befristet sein?, in: DVB1. 1972,772-774. Körte, Heinrich / Rebe, Bernd: Verfassung und Verwaltung des Landes Niedersachsen, 2. Auflage, Göttingen 1986. Kraul, Heinz: Zur Ausfüllung von Lücken in parlamentarischen Geschäftsordnungen, Diss. München 1972. Krause, Peter: Freies Mandat und Kontrolle der Abgeordnetentätigkeit, in: DÖV 1974, 325337. Kremer, Harry Andreas: Das Landtagsamt als verwaltende Behörde, in: Die Verwaltung 1994,495 - 524. Krüger, 1994.
Ralf: Versammlungsrecht, Stuttgart/München/Hannover/Berlin/Weimar/Dresden
Kugele, Dieter: Der politische Beamte, München 1978. Kunzmann, Bernd /Haas, Michael /Baumann-Hasske, Harald/Bartlitz, Ulrike: Die Verfassung des Freistaates Sachsen. Kommentierte Textausgabe, Berlin 1993. Lange, Werner Α.: Aufgaben der Bürgerschaftskanzlei, in: Geschichte der Hamburgischen Bürgerschaft, Berlin 1984, S. 177-181. Laubinger, Hans Werner: Organstreitigkeiten, in: JA 1973,117-122. Leibholz, Gerhard /Rinck, Hans-Justus I Hesselberger, Dieter: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Loseblattsammlung, Band II, 7. Auflage, Köln, Stand: 32. Lieferung, Dezember 1997. Leibholz, Gerhard /Rupprecht, Gerhard: Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Rechtsprechungskommentar, Köln, Marienburg 1968. Nachtrag ebd. 1971. Leipziger Kommentar: Großkommentar zum StGB, hrsg. von Hans-Heinrich Jeschek, Wolfgang Ruß, Günter Willms, Band IV, 10. Auflage, Berlin/New York 1988. Leierseder, Ernst: Der bayerische Landtagspräsident im Vergleich mit dem Speaker des House of Commons und des House of Representatives, Diss. München 1949. Leinius, Robert: Zum Verhältnis von Sitzungspolizei, Hausrecht, Polizeigewalt, Amts- und Vollzugshilfe, in: NJW 1973,448-449. Lemke, Helmut: Parlamentspraxis des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Kiel 1982. Ley, Richard: Staats- und Verwaltungsrecht für Rheinland-Pfalz, 3. Auflage, Baden-Baden 1992.
Literaturverzeichnis Linck, Joachim: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Kommentar, Stuttgart/München/ Hannover/Berlin/Weimar/Dresden 1994. Lisken, Hans / Denninger, Erhard: Handbuch des Polizeirechts, 2. Auflage, München 1996. Loewenberg, Gerhard: Parlamentarismus im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1969. Magiera, Siegfried: Parlament und Staatsleitung in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes, Berlin 1979. Mahnke, Hans Heinrich: Die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Textausgabe mit Erläuterungen, Berlin 1993. Mangoldt, Hermann von: Das Bonner Grundgesetz, Berlin und Frankfurt a..M. 1953. Mangoldt, Hermann von! Klein, Friedrich ! Achterberg, Norbert /Schulte, Martin: Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Band VI (Art. 38-49), 3. Auflage, München 1991. Marx, Hugo: Kann der Bundestag seinen Präsidenten ermächtigen, redaktionelle Änderungen an einem von ihm angenommenen Gesetz vorzunehmen?, in: DVB1. 1967,716-717. Maunz, Theodor /Dürig, Günter /Herzog, Roman / Scholz, Rupert: Grundgesetz, Kommentar, Loseblattsammlung, Band III (Art. 20-69), München, Stand: 34. Lieferung, Juni 1998. Maunz, Theodor /Zippelius,
Reinhold: Deutsches Staatsrecht, 30. Auflage, München 1998.
Maurer, Hartmut: Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Auflage., München 1997. Mayer, Franz/Kopp, Ferdinand O.: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Stuttgart/ München / Hannover 1985. Mayer, Franz / Ole, Hermann: Staats- und Verwaltungsrecht in Rheinland-Pfalz, Stuttgart 1969. Meder, Theodor: Die Verfassung des Freistaates Bayern, Handkommentar, 4. Auflage, Stuttgart/München/Hannover/Berlin 1992. Meyer, Geor%/Anschütz, Gerhard: Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 7. Auflage, München/Leipzig 1919. Meyn, Karl-Ulrich: Parlamentsbrauch und Fraktionsgemeinschaft, in: JZ 1977,167-169. Milinski, 2808 f.
Jürgen: Unbegrenztes „Rügerecht" des Bundestagspräsidenten?, in: NJW 1983,
Model, Otto /Müller, Klaus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 11. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1996. Mommer, Karl: Der Ältestenrat - das Lenkungsorgan des Bundestags, in: Das Parlament Nr. 35/36 vom 30. 8. 1969, S. 6. Mühlbauer, Karl: Die rechtliche Stellung des Reichstagspräsidenten, Diss. Erlangen 1931. Münch, Ingo von /Kunig, Philip: Grundgesetz-Kommentar. Band II (Art. 21 -69), 3. Auflage, München 1995. Mutius, Albert von / Wuttke, wig-Holstein, Kiel 1995. 21 Köhler
Horst / Hübner, Peter: Kommentar zur Landesverfassung Schles-
322
Literaturverzeichnis
Nauber, Horst: Das Berliner Parlament. Struktur und Arbeitsweise des Abgeordnetenhauses von Berlin, 5. Auflage, Berlin 1986. Nawiasky, Uans / Leusser, Claus/Schweiger, Karl /Zacher, Hans: Die Verfassung des Freistaates Bayern, Kommentar, Loseblattsammlung, München, Stand: 8. Lieferung, Mai 1995. Nelamischkies, Karl-Heinz: Die Disziplin im Deutschen Bundestag, Diss. Kiel 1962. Neumann, Heinzgeorg: Die vorläufige niedersächsiche Verfassung, Handkommentar, 2. Auflage, Stuttgart/Hannover 1987. - Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, Stuttgart 1996. Ockermann, Jürgen / Glende, Andrea: So arbeitet der Landtag Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage, Rheinbreitbach 1997. Palen, Franz: Das Recht der Sitzungspolizei im preußischen Abgeordnetenhaus und im Reichstag, Diss. Greifwald 1912. Partsch, Karl-Josef: Die Wahl des Parlamentspräsidenten, in: AöR 86 (1961), 1 -38. Pechmann, Karl Albrecht Frhr. von: Die Ordnungsgewalt von Parlamentspräsidenten, Diss. Würzburg 1956. Pereis, Kurt: Das autonome Reichstagsrecht. Die Geschäftsordnung und die Observanz des Reichstages in systematischer Darstellung, Berlin 1903. Pestalozzi, Christian: Verfassungsprozeßrecht. Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder, 3. Auflage, München 1991. Pieroth, Bodo: Störung, Streik und Aussperrung an der Hochschule, Berlin 1976. Pietzner, Rainer: Stichwort „Bundestag", in: Evangelisches Staatslexikon, hrsg. von Roman Herzog/Hermann Kunst/ Klaus Schiaich /Wilhelm Schneemelcher, Band I., 3. Auflage, Stuttgart 1987, Sp. 328-360. Preuss, Ulrich K.: Landtag (Bürgerschaft), in: Handbuch der Bremischen Verfassung, hrsg. von Volker Kröning, 1. Auflage, Baden-Baden 1991. Randorf, Ulrich: Die parlamentarische Ausweisung und ihre Folgen im Reichstag und im Preußischen Abgeordnetenhaus, Diss. Greifwald 1913. Rasner, Will: Herrschaft im Dunkeln? Aufgabe und Bedeutung des Ältestenrats, in: E. Hübner/R. Oberreuter/H. Rausch, Der Bundestag von innen gesehen, München 1969, S. 99113. Rauchhaupt, Friedrich Wilhelm von: Handbuch der Deutschen Wahlgesetze und Geschäftsordnungen, München, Leipzig 1916. Rausch, Heinz: Bundestag und Bundesregierung, 4. Auflage, München 1976. Redeker, Konrad / Oertzen, Hans-Joachim von: Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 12. Auflage, Stuttgart/Berlin/Köln 1997. Reich, Andreas: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kommentar, Bad Honnef 1994. Reifenberg, Gerhard Alois: Die Bundesverfassungsorgane und ihre Geschäftsordnung, Diss. Göttingen 1958. Reinecke, Hans: Die Polizeigewalt des Bundestagspräsidenten, Diss. Hamburg 1960.
Literaturverzeichnis
323
Richter, Wilhelm: Die Stellung des Bundestagspräsidenten, insbesondere seine Ordnungsgewalt, sein Hausrecht und seine Polizeigewalt, Diss. Bonn 1954. Ridder, Helmut ! Breitbach, Michael / Rühl, Uli/ Steinmeier, Kommentar, Baden-Baden 1992.
Frank: Versammlungsrecht,
Ritzel, Heinrich ! Bücker, Joseph: Handbuch für die parlamentarische Praxis mit Kommentar zur Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Loseblattsammlung, Frankfurt a.M., Stand: November 1995. Ritzel, Heinrich /Koch, Helmut: Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Text und Kommentar, Frankfurt a.M. 1952. Rode, Ernst: Die Polizeigewalt des Reichstagspräsidenten, Diss. Göttingen 1929. Röper, Erich: Parlamentarische Ordnungsmaßnahmen gegenüber Regierungsmitgliedern, in: ZParl. 1991,189-196. Rösch, Hans: Wesen und Rechtsnatur der parlamentarischen Geschäftsordnung, Diss. Tübingen 1934. Roll, Hans-Achim: Auslegung und Fortbildung der Geschäftsordnung, in: Festgabe für Werner Blischke, Berlin 1982, S. 93-110. Ronellenfitsch, 478.
Michael: Das Hausrecht der Behörden, in: VerwArchiv Bd. 73 (1982), 465-
Rosen, Klaus-Henning: Immunität und Durchsuchung. Anmerkung zum Fall des Abgeordneten Wienand, in: ZRP 1974, 80-81. Rossmann, Gerhard: Die Leitung der Parlamentsverhandlungen durch das Präsidium des Reichstags, Diss. Jena 1926. Rothaug, Karl-Hans: Die Leitungskompetenz des Bundestagspräsidenten, Kassel 1979. Rummel, Alois: Der Bundestagspräsident: Amt, Funktionen, Personen, 7. Auflage, Stuttgart 1984. Rupp, Hans Heinrich: Grundfragen der heutigen deutschen Verwaltungsrechtslehre. Verwaltungsnorm und Rechtsverhältnis, Tübingen 1965. Sachs, Michael, Grundgesetz: Kommentar, 2. Auflage, München 1999. Schäfer, Friedrich, Der Bundestag, 4. Auflage, Opladen 1982. Scheerbarth, Hans Walter ! Höffken, tenrecht, 6. Auflage, Siegburg 1992.
Heinz /Bauschke, Hans-Joachim / Schmidt, Lutz: Beam-
Scheuner, Ulrich: Zur Entwicklung des parlamentarischen Verfahrens im Deutschen Bundestag, in: Festgabe für Theodor Eschenburg, München 1971, S. 143-160. Schick, Rupert: Der Bundestagspräsident: Amt Funktionen, Personen, 9. Auflage, Stuttgart 1987. - Der Bundestagspräsident, in: DVP 1989,153-161. Schindler, Peter: Ältestenrat - Ein Wort und was dahintersteht, in: Das Parlament Nr. 44 vom 2. 11. 1966, S. 12. 21*
324
Literaturverzeichnis
- Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 bis 1982. Eine Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Bonn 1983. Schmid, Emanuel: Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag, Diss. München 1950. Schmid, Hermann: Parlamentarische Disziplin. Eine rechtsvergleichende Studie, in: AöR 32 (1914), 439-579. Schmidt, Corinna: Zum Hausrecht der Fraktionen an ihren Geschäftsräumen, in: DÖV 1990, 102-107. Schmidt, Walter: Chancengleichheit der Fraktionen unter dem Grundgesetz, in: Der Staat 9 (1970), 481-500. Schmidt-Bleibtreu, Bruno /Klein, Franz: Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 8. Auflage, Neuwied/Kriftel/Berlin 1995. Schneider, Hans-Peter / Zeh, Wolfgang: Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, Berlin/New York 1989. Schneider, Hans-Peter: Parlamente, Wahlen und Parteien in der Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte, in: Landesverfassungsgerichtsbarkeit, hrsg. von Christian Starck und Klaus Stern, Teilband III, Baden-Baden 1983, S. 91 -142. Schneider, Herbert: Länderparlamentarismus in der Bundesrepublik, Opladen 1979. Schänke, Adolf/Schröder, Horst: Strafgesetzbuch, Kommentar, 25. Auflage, München 1997. Scholtissek, Herbert: Zur Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts aus Art. 93 I Nr. 4 GG, in: Festschrift für Gebhard Müller, Tübingen 1970, S. 461 -475. Scholz, Rupert: Zur Polizeipflicht von Hoheitsträgern, in: DVB1.1968,732-740. Schreiber, Wolfgang: Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 5. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1994. Schumacher, Martin: Parlamentspraxis in der Weimarer Republik. Die Tagungsberichte der Vereinigung der deutschen Parlamentsdirektoren 1925-1933, Düsseldorf 1974. Schwarze, Jürgen: Demonstrationen vor den Parlamenten, in: DÖV 1985,213-222. Schwerdtfeger, 1997.
Gunther: Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung, 10. Auflage, München
Seifert, Karl-Heinz / Hömig, Dieter: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 5. Auflage, Baden-Baden 1995. Seligmann, Richard: Die staatsrechtliche Stellung des deutschen Reichstagspräsidenten, Diss. Heidelberg 1912. Sperling, Friedrich: Die Befugnisse des Reichstagspräsidenten, Diss. Kiel 1929. Spitta, Theodor: Kommentar zur Bremischen Verfassung von 1947, Bremen 1960. Spreng, Rudolf/Birn, Willi / Feuchte, Paul: Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Kommentar, Stuttgart und Köln 1954. Spengler, Karl: Die rechtliche Stellung und die Befugnisse des Reichstagspräsidenten, Diss. Würzburg 1913.
Literaturverzeichnis Starck, Christian: Über Niedersächsische Verfassungsdinge, Vortragsabend mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen im Niedersächsischen Landtag am 14. 11. 1996, Hannover 1996. Steffani, Winfried: Ein Verfassungseid für Abgeordnete in Bund und Ländern?, in: ZParl. 1976, 86-112. Steiger, Heinhard: Organisatorische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems. Eine Untersuchung zur rechtlichen Stellung des deutschen Bundestages, Berlin 1973. Stern, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik, Band I, 2. Auflage, München 1984, Band II, München 1980. Stern, Max: Die rechtliche Stellung des deutschen Reichstagspräsidenten, Diss. Gießen 1928. Strassberger, Gudrun: Abstimmungspraxis und Abstimmungsgrundsätze in der Bundesrepublik Deutschland, Diss. Würzburg 1969. Sturm, Gerd: Die Inkompatibilität, München 1967. Stürner, Rolf: Privatrechtliche Gestaltungsformen bei der Verwaltung öffentlicher Sachen, Diss. Tübingen 1968. Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, von Hans-Joachim Rudolphi, Eckhard Horn, Erich Samson, Band II, Besonderer Teil (§§ 80-358), 5. Auflage, Neuwied/Kriftel/Berlin, Stand: 40. Lieferung, April 1997. Szmula, Volker: Stichwort „Tagesordnung", in: Hans-Helmut Röhring/Kurt Sontheimer, Handbuch des deutschen Parlamentarismus, München 1970, S. 462-464. Thaysen, Uwe: Änderung der Befugnisse des Bundestagspräsidenten, in: ZParl. 1970,41 -43. Thieme, Werner: Vom Wesen des Disziplinarrechts, in: DVB1.1957,769-773. Tilch, Horst (Hrsg.): Stichwort „Polizeigewalt des Landtagspräsidenten", in: Münchener Rechts-Lexikon, Band II, 2. Auflage, München 1987, S. 1287. - Stich wort »Polizeigewalt des Bundestagspräsidenten", in: Münchener Rechts-Lexikon, Band II, 2. Auflage, München 1987, S. 1286 f. - Stichwort „Vollzugshilfe", in: Münchener Rechts-Lexikon, Band III, München 1987, S. 1035. Triepel, Heinrich: Delegation und Mandat im öffentlichen Recht. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Stuttgart/Berlin 1942, Darmstadt 1974. Tröndle,
Herbert: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 48. Auflage, München 1997.
Trossmann, Hans: Der deutsche Bundestag. Vorgeschichte und Leistungen. Organisation und Arbeitsweise, 5. Auflage, Darmstadt und Bad Homburg v.d.H. 1971. - Parlamentsrecht des Deutschen Bundestages, Kommentar zur Geschäftsordnung, München 1977. - Parlamentsrecht und Praxis des Deutschen Bundestages, Bonn 1967. - Reichstag und Bundestag - Organisation und Arbeitsweise, in: Ernst Deuerlein, Der Reichstag, Bonn 1963, S. 125-143.
326
Literaturverzeichnis
Uhlitz, Otto: Zur Frage des Staatsoberhauptes in den Ländern, in: DÖV 1966, 293-298. - Zur Frage der Abberufbarkeit der Parlamentspräsidenten, in: AöR 87 (1962), 296-310. Versteyl, Ludger-Anselm: Der Bundestagspräsident und die parlamentarische Disziplinargewalt, in: NJW 1983, 379-381. Voigtländer, Hubert: Stichwort „Verwaltung des Deutschen Bundestages", in: Hans-Helmut Röhring/Kurt Sontheimer, Handbuch des deutschen Parlamentarismus, München 1970. Vogler, Reinhart: Die Ordnungsgewalt der deutschen Parlamente, Hamburg 1926. Wacke, Gerhard: Polizeirecht als Bundesrecht, in: Helmut Külz/Richard Naumann (Hrsg.), Staatsbürger und Staatsgewalt, Jubiläumsschrift, Band II, Karlsruhe 1963, S. 161-202. Walter, Thomas: Die Fraktionsmitarbeiter - Zur Beziehung zwischen Abgeordneten und wissenschaftlichem Fraktionspersonal, in: Geschichte der Hamburgischen Bürgerschaft, Berlin 1984, S. 174-176. Weber, Werner: Parlamentarische Unvereinbarkeiten, in: AöR 58 (1930), 164-254. Wege, Joachim / Grönwall, Angelika: Die Bürgerschaft. Arbeitshefte zur Politik in Hamburg Nr. 8, 3. Auflage, Hamburg 1989. Weides, Peter: Stichwort „Geschäftsordnung", in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, Band II, 7. Auflage, Freiburg 1986, Sp. 922-923. Wermser, Jürgen: Der Bundestagspräsident: Funktion und reale Ausformung eines Amtes im Deutschen Bundestag, Opladen 1984. Werthauer, Johannes: Die Verhinderung eines Abgeordneten an der Ausübung des Mandats durch Bestimmung der Geschäftsordnung eines Abgeordnetenhauses, in: JW 1912, 834 ff. Westphalen, Raban Graf von: Parlamentslehre, München/Wien 1993. Woldt,
Heinz: Die Polizeigewalt des Reichstagspräsidenten, Diss. Heidelberg 1934.
Wolff,
Hans-Julius /Bachof, Otto. Verwaltungsrecht 1,9. Auflage, München 1974.
- Verwaltungsrecht II, 4. Auflage, München 1976. Zeiler, Horst: Das Hausrecht an Verwaltungsgebäuden, in: DVB1. 1981,1000-1004. Zeitler,
Stefan: Versammlungsrecht, Stuttgart, Berlin, Köln 1994.
Ziekow, Jan: Der Status desfraktionslosen Abgeordneten, in: JuS 1991,28-34. Zimmerling, 368-370.
Wolfgang: Der Parlamentsdirektor - ein politischer Beamter?, in: ZBR 1976,
Zinn, Georg August /Stein, Erwin: Verfassung des Landes Hessen. Kommentar. Band I (Art. 1-99), Loseblattsammlung, Bad Homburg v.d.H. 1963 ff., Stand: 15. Lieferung, April 1991. Zivier, Ernst R.: Verfassung und Verwaltung von Berlin, Berlin 1990. Zschucke, O. Th. L.: Die Geschäftsordnungen der deutschen Parlamente, Berlin 1928.
trtverzeichnis Abgeordneter - Eid 29 ff. - Verhaltensregeln 82 ff. Abstimmungen 146 ff. - Arten 155 ff. - geheime Abstimmung 159 ff. - „Hammelsprung" 156 f. - Reihenfolge 150 ff. Alterspräsident 20, 23, 30, 31, 70, 72 Ältestenrat 50,58, 73, 89 ff. - als Lenkungs-, Vermittlungsund Schlichtungsorgan 99 ff. - Aufgaben 94 ff. - historische Grundlagen 89 ff. - Seniorenkonvent 90 f. - Sitzungsverlauf 91 ff. - Zusammensetzung 91 ff. Amtserwerb s. Landtagspräsident Ausschluß von der Sitzung s. Sitzungsausschluß Ausschuß 101 f. Bannmeile s. Hausrecht Beschlagnahmung - im Landtagsgebäude 245 ff. Beschlußfähigkeit 75, 146 ff. - Bezweifelung 146 ff. Beschlußprotokoll 173 f. Direktor beim Landtag s. Landtagsverwaltung Disziplinargewalt 177 ff. - Maßnahmen 182 ff. - rechtliche Grundlagen 180 ff. - rechtliche Überprüfbarkeit 215 ff. Durchsuchung - im Landtagsgebäude 245 ff. Eid s. Landtagspräsident Einberufung des Landtags 56 f., 110 ff. - auf Verlangen 113 ff.
- nach der Wahl 112 Einspruch gegen Disziplinarmaßnahmen 216 ff. Fraktion 18,20 f., 23 ff. - Änderung der Fraktionsstärke 25 f. - Ausschluß s. Landtagspräsident - Austritt s. Landtagspräsident - Benennung des Präsidenten durch stärkste Fraktion 23 f. - Vorschlag des Kandidaten für Präsidentenamt 21 f. Geschäftsordnung 164 ff. - Abweichung 169 f. - Änderung 170 f. - Auslegung 166 ff. - Rechtsnatur 164 ff. Grundmandat, Vertretung 59 ff.
im Präsidium
Hammelsprung s. Abstimmungen Haushaltsplan 79 ff. Hausrecht 235 ff. - Bannmeile als Erweiterung des Hausrechts 248 ff. - Hausordnungsgewalt 240,243 - Hausverbot 240 f. - räumlicher und personeller Geltungsbereich 238 ff. - Rechtsnatur 235 ff. Immunität 28 f. Indemnität 28 f. Konferenz der Landtagspräsidenten 308 f. Landtagspräsident - Abberufung 40 ff. - Abgeordnetenmandat 18 ff. 36 ff. - als Leiter der Parlamentsverwaltung 279 ff., 296 ff., 301 f.
328
trtverzeichnis
- Amtserwerb 17 ff., 26 ff. - Amtsverlust 34 ff. - Amtszeit 34 - Beteiligung an Plenardebatte 27,131 - Disziplinargewalt 177 ff. - Eid 29 ff. - Einberufung des Landtags 110 ff. - Fraktionsausschluß 39 f. - Fraktionsaustritt 39 f. -Fraktionsmitgliedschaft 19, 28, 39 f. - Hausordnungsgewalt 240,243 - Hausrecht 235 ff. - Inkompatibilität 32 ff. - interparlamentarische Zusammenarbeit 308 f. - Leitungsgewalt 102 ff. - Ordnungsgewalt 175 ff. - Organstellung 53 ff. - Polizeigewalt 252 ff. - Probepräsident 34 ff. - protokollarische Stellung 50 ff. - Prüfung der Beratungsgegenstände 104 f. - Recht zur Abstimmung 28 - Repräsentant des Landtags 303 ff. - Rücktritt 48 ff. - Unparteilichkeit 27 f. - Vertretung des Landtags 302 ff. - Voraussetzungen für Amtserwerb 18 ff. - Wahl 17 f., 20 ff. - Worterteilung 129 ff. - Zustimmung bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen 245 ff. Landtagsverwaltung 80, 279 ff. - Aufgabe 281 ff. - Direktor beim Landtag 283 f. - Organisation 28Iff. - Personalverwaltung 296 ff. - wirtschaftliche Verwaltung 80,296 ff. - wissenschaftlicher Hilfsdienst 291 ff. „Lex Brandes" 41 Ministerpräsident, Verhältnis zum Landtagspräsidenten 50 ff. Mißbilligung der Amtsführung 49 f. Mißtrauenvotum 47,49 Ordnungsdienst s. Polizeigewalt Ordnungsgeld 215
Ordnungsgewalt - gegenüber Abgeordneten 177 ff. - gegenüber der Gesamtheit der Abgeordneten 224 ff. - gegenüber Regierungsmitgliedern 228 ff. - gegenüber Zuhörern 232 ff. Ordnungsruf 194 ff. Plenarsitzung 115 ff. - Aufhebung 224 ff. - Aussprache 121 f. - Beratung 121 f. - Eröffnung 116 ff. - Tagesordnung 106 f. - Unterbrechung 224 ff. Polizeigewalt 252 ff. - Adressat 263 f. - Amts-und Vollzugshilfe 271 f. - Funktion 257 ff. - historische Entwicklung 254 ff. - Inhaber 258 - Ordnungsdienst 270 f. - polizeiliche Maßnahmen 264 ff. - räumlicher Geltungsbereich 258 f. - Rechtsschutz 276 ff. - Umfang 259 ff. - „Zählsorge-Telefon" 277 f. Präsidentenwahl s. Landtagspräsident Präsidium 57 ff. - Anspruch auf Vertretung im Präsidium 59 ff. - Aufgaben 76 ff. - Sitzungsverlauf 73 ff. - Zusammensetzung 5 8 ff. Rede - Form und Dauer 140 ff. - Überschreitung der Redezeit s. Wortentziehung - Verlängerung der Redezeit 144 ff. Rednerreihenfolge 126 ff. Rüge 191 ff. Sachruf 183 ff. Schriftführer 20,58, 67, 79 - Anzahl 67 - Aufgaben 68 ff. - Wahl 70 ff.
Stichwortverzeichnis Selbstorganisationsrecht 17,18 Selbstversammlungsrecht des Landtags llOff. Seniorenkonvent s. Ältestenrat Sitzungsausschluß 202 ff. - für den Rest der Sitzung 206 ff. - für mehrere Sitzungstage 210 ff. - historische Grundlagen 202 ff. Sitzungsvorstand 77 ff. Stenographischer Bericht 171 f.
329
-
Anzahl 61 ff. persönliche Voraussetzungen 62 Unabhängigkeit 67 Unterstützung der Amtsführung des Präsidenten 63 f. - Vertretung des Präsidenten 63 ff. - Wahl 70 ff.
- Aufsetzung von Beratungsgegenständen 118 f. - Aufstellung 106 ff. - Feststellung 107,108 - Eintritt in die Tagesordnung 118 ff. - Umstellung 119 f.
Wissenschaftlicher Hilfsdienst s. Landtagsverwaltung Wortentziehung - infolge mehrfacher Ordnungsrufe 200 ff. - infolge mehrfacher Sachrufe 186 ff. - wegen Überschreitung der Redezeit 189 ff. Worterteilung 13 Iff. - zu einer persönlichen Bemerkung 134 ff. - zu einer Zwischenfrage 139 ff. - zur Geschäftsordnung 132 ff. - zur Sache 132
Verhaltensregeln s. Abgeordneter Vizepräsident 23,42,59,60,61 ff.
Zählsorge-Telefon s. Polizeigewalt Zwischenfrage s. Worterteilung
Tagesordnung, - Absetzung von Beratungsgegenständen
120
Anhang
ι Abteilung B
Α,,π-Η»«: a ta BU. Po. ΙΛ lu
F*Mcnme .
Aik^merier AusschuBderstlX |ReferarAI V
1
1
ι ι
1
Vctoug des A&geordneterv—A^V gesetees, Persona ^
Referat ein Haushdt
1
,
I Referat CV
Pressestelle
_ Referat CV« Jusmicrtat
Referate VI EDV
iReferatBIV I Referat CH agcxlsatk^ Innerer Dienst "" Blö.ofhek
Retorte ιν —Protokoll
_ Stenogcphischer Dienst ΚΘΟΘΓΓΟίβίΙ Glien
Ι
Personal, Ve.v/attung, Dokumentation
Abteilung C und Information
Referai Al Referai ABI Referat BI Referat BUI Referat Cl Plenum Altestenrat —Allgemeiner AusschuQdenst OftentllchKeltsafoelt, lAuwchüwKawivff.Hcx^so I Besucherdienst
Abteiluna A Parlamentsdienst
Direktor
I II. Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags
des Bayerischen Landtags
I. Vizepräsident ^ des Bayerischen Landtags |
Präsident des I , Bayerischen Landtags Π
(Stand: 1.3.1997)
Verwaltung des Landtages von Bayern
Anhang 1
1
Frauenbeaunrogte
1
|
Abteilung I Abteilung II Verwaltungsabteilung Parlament. Abteilung
I
Der Direktor beim niedersächsischen Landtag
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst
!
I
'
,
1 I „ I ,, , 1 ~~i , ,I ,, 1 REFERAT1 REFERAT 2 REFERAT 3 REFERAT 4 REFERAT 5 REFERAT 6 REFERAT 7 Haushalt, Hausverwaltung, Organisation, Bibliothek, Presse,' Stenographischer Plenum, AbgeordnetenInnere Dienste Personal, M LAS, ÖffentlichkeitsDienst Ausschüsse, entschädlgungen, luK-Techniken, Archiv, arbeit Eingaben, FrakMonstosterv Protokoll Registratur Drucksachen Zuschüsse, Staatlche Finanzierung der Partelen 1) Die Mitglieder and bel der Ausübung Ihrer Tätigkeit iTKabhängfg und Insbesondere bei der Erstattung von Gutachten und bei der Abgabe von Steik/ignchmen keinen Weisungen unterwerfen. 9e unterstehen der Aufachi des Präsidenten nu m denstttcher und organisatorischer Hinsicht (§§ 1 Absatz 1 und 2 Richtlinien und Geschäftsvertelhxigsptan tü den Gesetzgebungs- und Beratungsdenst vom 04.12.1957). 2) Der Referatsletter 5 Ist hmstehWch der Pressecngelegenheiten dem Direktor unrtttelbar uiterstellt.
ι
ι
Der Präsident des niedersächsischen Landtages
Verwaltung des Landtages von Niedersachsen (Stand: 1.2.1996)
Anhang 3
Sicherheitsbeauftragter
Beauftragter für den Haushalt (gem. §9 LHQ)
. Al|
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Gleichstellungsbeauftragte
lne
Abteilung I Wartung _
, ΟΘΙΓΤί Landtag
Direktor
Pressesprecher des Landtagspräsidenten
tersönltehe(r)Referent(ln)
Abteilung II - Wissenschaftlicher Dienst und Rarlamentsdienst -
Direktorbüro Interregionale Zusammenarbeit und Partnerschaften des Landtags
des Landtages
n

![Die Gegenzeichnung im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland [1 ed.]
9783428424658, 9783428024650](https://dokumen.pub/img/200x200/die-gegenzeichnung-im-parlamentarischen-regierungssystem-der-bundesrepublik-deutschland-1nbsped-9783428424658-9783428024650.jpg)

![Die Professionalisierung der Politik: am Beispiel des Berufspolitikers im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland [1 ed.]
9783428475667, 9783428075669](https://dokumen.pub/img/200x200/die-professionalisierung-der-politik-am-beispiel-des-berufspolitikers-im-parlamentarischen-system-der-bundesrepublik-deutschland-1nbsped-9783428475667-9783428075669.jpg)
![Die Kapitalflußrechnung im Rechnungslegungsrecht der USA und der Bundesrepublik Deutschland [1 ed.]
9783428468706, 9783428068708](https://dokumen.pub/img/200x200/die-kapitalflurechnung-im-rechnungslegungsrecht-der-usa-und-der-bundesrepublik-deutschland-1nbsped-9783428468706-9783428068708.jpg)
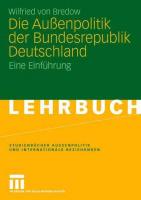
![Die Einkommenslage der Familien in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1973 und 1981 [1 ed.]
9783428462285, 9783428062287](https://dokumen.pub/img/200x200/die-einkommenslage-der-familien-in-der-bundesrepublik-deutschland-in-den-jahren-1973-und-1981-1nbsped-9783428462285-9783428062287.jpg)

![Grundlagen der marktwirtschaftlichen Orientierung in der Bundesrepublik Deutschland und ihre Bedeutung für Sozialpartnerschaft und Gemeinwohlbindung [1 ed.]
9783428468676, 9783428068678](https://dokumen.pub/img/200x200/grundlagen-der-marktwirtschaftlichen-orientierung-in-der-bundesrepublik-deutschland-und-ihre-bedeutung-fr-sozialpartnerschaft-und-gemeinwohlbindung-1nbsped-9783428468676-9783428068678.jpg)
![Gerichtskontrolle der parlamentarischen Geschäftsordnungen in Griechenland, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland: Kontrollverfahren und Verfassungsrechtsprechung. Zugleich eine Untersuchung über die parlamentarische Geschäftsordnung [1 ed.]
9783428488469, 9783428088461](https://dokumen.pub/img/200x200/gerichtskontrolle-der-parlamentarischen-geschftsordnungen-in-griechenland-frankreich-und-der-bundesrepublik-deutschland-kontrollverfahren-und-verfassungsrechtsprechung-zugleich-eine-untersuchung-ber-die-parlamentarische-geschftsordnung-1nbsped-9783428488469-9783428088461.jpg)
![Die Rechtsstellung der Parlamentspräsidenten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgaben im parlamentarischen Geschäftsgang [1 ed.]
9783428499984, 9783428099986](https://dokumen.pub/img/200x200/die-rechtsstellung-der-parlamentsprsidenten-in-den-lndern-der-bundesrepublik-deutschland-und-ihre-aufgaben-im-parlamentarischen-geschftsgang-1nbsped-9783428499984-9783428099986.jpg)