Die Lehre von den Lagerstätten der Erze: Ein Zweig der Geologie [Reprint 2021 ed.] 9783112604540, 9783112604533
163 52 96MB
German Pages 344 [368] Year 1880
Polecaj historie
Citation preview
DIE L E H R E V O N
D E N
LAGERSTÄTTEN DER ERZE. EIN Z W E I G DER
GEOLOGIE.
VON
DR. ALBRECHT VON GrRODDECK, B E R G R A T H UND DIRECTOR DER KÖNIGL. PREUSS. BERGACADEMIE B E R G S C H U L E IN C L A U S T H A L .
MIT 119 ABBILDUNGEN IN HOLZSCHNITT.
LEIPZIG, VERLAG
V O N V E I T & COMP. 1879.
UND
Das Recht der Herausgabe von Uebersetzungen vorbehalten.
SEINEM
HOCHVEREHRTEN
LEHRER
DEM
GEHEIMEN BERGRATH PROFESSOR
Dk. F E R D I N A N D R O E M E R TN
BRESLAU
WIDMET
DIESES BUCH ALS ZEICHEN SEINER DANKBARKEIT
DER VERFASSER.
Vorwort. Häufig hört man von Bergbeamten die Klage aussprechen, dass es ihnen unmöglich sei den raschen Fortschritten der Geologie zu folgen. Diese Klage wird auch sehr leicht begreiflich, wenn man einen Blick auf die Thätigkeit der Specialisten in der Palaeontologie, Petrographie und Stratigraphie wirft. Es ist gewiss nicht zu erwarten, dass Männer, deren Arbeitsfeld auf einem ganz anderen Gebiete hegt, sich in die Feinheiten palaeontologischer Forschungen, mikroskopischer Gesteinsstudien, localer Gliederungen einzelner Formationen etc. vertiefen werden. Sehr wünschenswerth, ja nothwendig ist es aber, dass die Bergleute vom Leder und von der Feder, die auf eine fachwissenschaftliche Bildung Anspruch erheben, stets über die Methoden der Wissenschaft, sowie über die herrschenden geologischen Auffassungen im Allgemeinen orieutirt sind, und den für die Praxis wichtigsten Zweig der Geologie, das ist die Geologie der nutzbaren Fossilien, nie aus den Augen verlieren. Gleich bei dem ersten geologischen Unterricht für angehende Bergleute sind diese Eichtungen einzuschlagen. — Nichts fördert dabei mehr, als kurz gefasste Lehrbücher. Das vorliegende Buch verfolgt den Zweck, eine gedrängte und übersichtliche Darstellung des Wissenswürdigsten aus dem Gebiete der Lehre von den Erzlagerstätten zu geben, die Bergleuten, Geologen und Allen, die Beziehungen zu dem Erzbergbau haben, willkommen sein dürfte, da seit dem Erscheinen der „Lehre von den Erzlagerstätten von B. v. C O T T A " bereits zwanzig Jahre verflossen sind. Seit meiner Studienzeit habe ich dem Gegenstande das lebhafteste Interesse zugewandt, mich mit der Literatur bekannt zu machen gesucht und jede Gelegenheit, die sich darbot, ausgenutzt, um Lagerstätten durch Augenschein kennen zu lernen, und so glaubte ich für dieses Unternehmen hinreichend vorbereitet zu sein. Wer nun einige Erfährungen gesammelt hat, weiss sehr wohl, dass neben den vielen zutreffenden Urtheilen und vortrefflichen Schilderungen auch manche, auf unvollständigen, oder falschen Beobachtungen basirte Anschauungen über Erzlagerstätten, durch Wort und Schrift, verbreitet
VI
Vorwort.
sind, so dass man bei Benutzung der Literatur sehr vorsichtig sein muss, und es selbst bei der grössten Vorsicht doch nicht immer möglich ist, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden; — eine Controlle der Beobachtungen ist, — das liegt in der Natur der Sache — gewöhnlich nicht ausführbar. Diese Erwägungen konnten mich nicht abhalten, den dritten Abschnitt dieses Buches, der eine, in der Hauptsache auf dem Literaturstudium beruhende, systematische Schilderung der Erzlagerstätten enthält, zu verfassen; im Gegentheile verspreche ich mir von dieser, hier zum ersten Male ausgeführten Arbeit einen sehr grossen Nutzen. — Es würde mir zu grosser Genugthuung gereichen, wenn durch dieselbe den practischen Bergleuten neue Anregung zu controllirenden und vergleichenden Beobachtungen über die Erzlagerstätten und Veröffentlichung derselben gegeben würde, damit das Beobachtungsmaterial sich rasch vermehre, das Wahre in dem allgemeinen Bewusstsein sich immer mehr und mehr befestige, und Irrthümer, die sich in die Literatur einzuschleichen drohen, rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. Eine übersichtliche Darstellung war im Anschluss an ältere Eintheilungen nicht möglich. Die Unterscheidung von geschichteten Lagerstätten, massigen Lagerstätten, Hohlraumsfüllungen und metamorphischen Lagerstätten, welche meiner Darstellung zu Grunde liegt, ist aus der Beschäftigung mit dem Gegenstande wie von selbst herausgewachsen, ebenso die Unterscheidungen von Hohlraum, Spalte (Gang) und Höhle — Mineraleinschluss, Mineralausscheidung und Mineraleinsprengung — Lage, Schicht und Kruste — derb und verwachsen — Netzgängen, Parallelgängen und Strahlengängen — Contractionsspalten und Dislocationsspalten etc. etc. Die Lehre von den Lagerstätten der Erze bekam im Laufe der Arbeit durch diese Unterscheidungen eine von den bisherigen Darstellungen und Autfassungen recht abweichende Gestalt, und wurden einige neue Gesichtspunkte gewonnen. — Möge dieser Versuch, auf den Arbeiten so vieler ausgezeichneter Forscher, denen wir die Kenntniss der Erzlagerstätten verdanken, weiter zu bauen, zur Förderung und Verbreitung der Wissenschaft beitragen, und das Buch, das ich dem geognostischen und bergmännischen Publikum übergebe, eine wohlwollende und nachsichtige Beurtheilung erfahren. C l a u s t h a l , im September 1879.
Der Verfasser.
I n h a l t .
Einleitung. § 1. Erze § 2. Erzlagerstätten § 3. Die Lehre von den Erzlagerstätten § 4. Eintheilung § 5. Hülfswissenschaf'ten § 6. Literatur
Seite
1 2 2 3 4 4
Erster Abschnitt. Die räumlichen Verhältnisse der Erzlagerstätten und ihre Beziehungen zum Nebengestein. § 7. § 8. § 9. § 10.
Regelmässig und unregelmässig gestaltete Lagerstätten Bestimmung der Lage der Lagerstätten im Räume Bildliche Darstellung der Lagerstätten Wissenschaftliche Eintheilung der Lagerstätten
5 5 8 8
Die geschichteten Lagerstätten. § 11. Unterschied von Flötzen und Lagern
11
Flötze.
§ § § § §
12. 13. 14. 15. 16.
Ursprüngliche Flötzablagerung Störungen der ursprünglichen Ablagerungsformen Sättel und Mulden Gewirre, Doppelungen und Durchsetzungen Plötzverwerfungen
13 15 16 18 18
Lager.
§ 17. Die Formen der Lager und Lagerzüge
27
Inhalt.
VIII
Die massigen Lagerstätten, Hohlx'anmsfQlInngen und metamorphischen Lagerstätten. Gänge. § 18. §19. § 20. § 21. § 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29.
Die Gangspalten Trümmer Einfache und zusammengesetzte Gänge Verwerfung des Nebengesteins der Gänge Contactgänge Das Streichen und Fallen der Gänge Die Mächtigkeit der Gänge Zertrümmerung der Gänge Das Schaaren der Gänge Das Kreuzen der Gänge Gangablenkungen Gangverwerfungen
Seite
31 32 34 35 38 39 44 45 48 48 50 52
1
Stficke, Butzen und Nester. § 30. Stöcke, Butzen und Nester sind Formen verschiedener Erzlagerstätten
.
53
.
57 59
Zweiter Abschnitt. Der stoffliche Inhalt der Erzlagerstätten. Mineralien nnd Gesteine. § 31. Erze und sonstige Mineralien § 32. Gesteine
,
.
Die T e x t u r der Erzlagerstätten. § 33. § 34. § 35. § 36. §37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42. § 43. § 44. § 45. § 46. § 47.
Uebersicht Ursprüngliche Textur Derbe Massen Verwachsene Massen Massige Verwachsung . . Lagenförmige Verwachsung Schichten Krusten Mineraleinschlüsse Krystalle und Krystallaggregate, oder porphyrartige Einschlüsse Krystallinische Körner und sonstige Aggregate Concretionen Oolithe Primärtrümmer Trümmertextur
. . .
59 60 60 61 61 62 62 63 67 67 69 70 73 74 74
IX
Inhalt.
Erzmittel. § 48.
Seite
Formen der Erzmittel
75
§ 49. Nesterförmige Erzmittel
76
§ 50.
7G
Eizfälle oder Adelsvorschübe
§ 51. Erzsäulen
77 Wechsel der Mineralfiihrung.
§ 52. Mineralsuccessionen
78
§ 53.
Hl
Ursprünglicher und secundärer Teufenunterschied
Dritter Abschnitt. System der Erzlagerstätten. § 54. Eintheilung
84
A. Ursprüngliche Lagerstätten. I.
Geschichtete Lagerstätten.
§ 55.
1. D e r b e E r z f l ö t z e
85
§ 56.
Typus Späth- und Thoneisensteinfiötze
85
§ 57.
Typus Braun- und Kotheisensteinfiötze
90
§ 58. 2. A u s s c h e i d u n g s f l ö t z e § 59.
94
Typus Mansfeld
95
§ 60. Typus P e r m
97
§ 61. Typus Gommern
101
§ 62. Typus Austin
103
§ 63. Typus Arnsberg
104
§ 64.
105
Typus Almaden
§ 65. Typus Fahlband
107
§ 66.
3. E r z l a g e r
§ 67.
Typus Ammeberg
111
§ 68.
Typus Kieslager
112
§ 69. Fortsetzung
,
.
. . .
110
115
§ 70. Portsetzung
119
§ 71.
Typus Goldquarzlager
:
§ 72.
Typus Sala-Tunaberg
128
125
§ 73.
Typus Spatheisensteinlager
129
§ 74.
Typus Eisenglimmerschiefer
132
§ 75. Typus Magneteisenstein- und Eisenglanzlager
133
§ 76. Portsetzung
135
§ 77.
Fortsetzung
138
§ 78.
Typus Taberg
142
§ 79.
Typus lron Mountain
145
II.
Massige Lagerstätten.
Inhalt.
X
Seite
§ § §
80. Typus Wooded Peak 81. Typus Mednorudjansk 82. Typus Monte Cal vi
145 147 151 III. HohlraumsfUilungen.
1. Spaltenfüllungen oder Gänge. § 83. § 84. § 85. § 86. § 87. § 88. § 89. § 90. § 91. § 92. § 93. § 94. § 95. § 96. § 97. § 98. § 99. § 100. § 101. § 102. § 103. § 104. § 105. § 106. § 107. § 108. § 109. § 110. §111. §112. § 113.
a. G ä n g e in m a s s i g e n G e s t e i n e n Typus Zorge Typus Ilfeld Typus Tamaya Typus Dobschau-Nanzenbach Typus Nagyag Fortsetzung Typus Schemnitz . Portsetzung Typus Pontgibaud Typus Magurka Typus Altenberg b. G ä n g e in g e s c h i c h t e t e n G e s t e i n e n Typus Schlaggenwald Typus Rio Albano Typus Bergzabern Typus Stahlberg Typus Mitterberg Typus Kleinkogl Typus Tellemarken-Cornwall Typus Australien-Californien Typus Eewdinsk Typus Kobaltrücken Typus Schneeberg Typus Bräunsdorf Typus Brand Portsetzung Typus Halsbrück Typus Clausthal Typus Aveyron Typus Moscheilandsberg 2.
•
152 153 155 157 162 163 168 171 174 177 179 180 183 183 186 187 190 193 197 198 205 211 211 214 216 217 221 224 '226 231 233
Höhlenfüllungen und der grösste Theil der
IV. Metamorphischen Lagerstätten.
§ 114. §115. § 116. §117.
Typus Rio Cares Typus Raibl Portsetzung Portsetzung
235 236 237 246
Inhalt.
XI Seite
§ 118. §119. § 120. § 121. § 122. § 123.
Portsetzung Typus Hüggel Typus Bohnerz Typus Nassau Typus Huelva Typus Christiania
253 254 256 257 259 2G0 B.
§ § § §
124. 125. 126. 127.
Triiinmerlagerstiitten.
Typus Peine Typus Tapanhoaeanga Metallseifen Uebersicht über die Typen der Erzlagerstätten
265 267 268 273
Vierter Abschnitt. Die Theorie der Genesis der Erzlagerstätten. § 128. Ursprung der Erze § 129.
276
Bildung der Mineralien
279
I. Bildung der Mineralien durch Sublimation oder Einwirkung von Gasen auf feste KSrper.
§ 130. A u. B. Jugendliche Mineralbildungen und charakteristische Fundorte § 131. C. Bildung der Mineralien in Hüttenwerken und Fabriken . . . . § 132. D. Künstliche Mineralien
280 281 281
II. Bildung der Mineralien durch Erstarren aus dem Schmelzfiuss.
§ 133. A u. B. Jugendliche Mineralbildungen und charakteristische Fundorte § 134. C u. 1). Bildungen der Mineralien in Hüttenwerken und Fabriken, sowie künstliche Mineralien
284 284
III. Bildung der Mineralien durch Ausscheidung aus Flüssigkeiten.
§ 135. A. Jugendliche Mineralbildungen § 136. B. Charakteristische Fundorte § 137. C. u. I). Bildung von Mineralien in Hüttenwerken und Fabriken, sowie künstliche Mineralien § 138. H a u p t r e s u l t a t
284 289 291 295
§ 139. Die geschichteten Lagerstätten
296
§ § § § § § §
Typus Spath- und Thoneisensteintlötze Typus Braun- und RotheisensteinfiOtze Typus Mansfeld Typus Perm, (Jommern, Austin, Arnsberg und Almaden Typus Fahlband Erzlager Die massigen Lagerstätten
296 298 301 302 308 309 311
HohlraumsfUllungen
312
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
§ 147.
Inhalt.
XII
Seite
§ § § § § § § §
148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
Spaltenfüllungen oder Gänge Die Bildung der Spalten Die Ausfüllung der Spalten Die Ganggesteine Die Gangarten und Erze Einfluss des Nebengesteins • Verschiedene Theorieen über die Ausfüllung der Gangspalten Höhlenfüllungen
.
.
.
312 313 317 318 321 329 331 332
§ 156.
Metamorphische Lagerstätten
334
§ 157.
Das Alter der HohlraumsfUllungen und der metamorphischen Lagerstätten
336
§ 158.
Trümmerlagerstätten
338
ScllluSS
339
E i n l e i t u n g .
§ 1. E r z e hat man in der Mineralogie metallhaltige Mineralien genannt, z. B. Spatheisenstein, Rothkupfererz, Bleiglanz, Rothgiltigerz etc. Man kann den Begriff, seiner ursprünglichen Bedeutung entsprechend, aber auch technisch auffassen und definiren: Erze sind Mineralien oder Mineralgemenge, aus denen man' im Grossen und auf ökonomisch vortheilhafte Weise Metalle oder Metallverbindungen darstellen kann. Beide Auffassungen stehen gleichberechtigt neben einander. Im Folgenden wird das Wort Erz in doppelter Bedeutung gebraucht werden, ohne dass für gewöhnlich angegeben ist, ob der mineralogische oder technische Begriff gemeint ist, denn es erhellt das meist aus dem Zusammenhang. Erze im technischen Sinne sind also nicht homogene Körper wie die Mineralien, sondern alle diejenigen metallhaltigen Massen, die der Bergmann zu Tage fördert, um sie in den Aufbereitungswerkstätten und in den Hütten weiter zu verarbeiten. — Es gehören dazu z. B. Gesteine, welche metallische Fossilien eingeschlossen enthalten (Kupferschiefer), ferner allerhand Mineralien, die so mit einander, oder mit Gestein verwachsen vorkommen, dass sie gemeinschaftlich gewonnen werden müssen. (Quarz mit gediegenem Gold. — Kalkspath mit Kupferkies und Zinkblende. — Bleiglanz mit Quarz und Thonschiefer.) In der bergmännischen Praxis werden gewisse metallhaltige Mineralgemenge auch besonders benannt, so heissen alle oxydischen Zinkerze Galmei, rundliche, durch concentrische Minerallagen (Bleiglanz und Quarz) verkittete Gesteinsbruchstücke Ringelerze — schwefelfreie, meist pulverige oder erdige, unreine, aber silberhaltige Gemenge von Metalloxyden Pacos etc. Erz im technischen Sinne muss in grösserer Menge vorkommen. — Ein Kupferkieskörnchen oder Kryställchen, das sich vereinzelt in einem Gestein eingewachsen findet, kann der Mineraloge als Erz bezeichnen, der Techniker nicht. Die Verarbeitung im Grossen und auf ökonomisch vortheilhafte Weise erfordert, je nach dem Werth des Metalls, einen bestimmten, ein Minimum nicht unterschreitenden Gehalt des Erzes. — So wird z. B. ein 1 v. G r o d d e c k , Erzlagerstätten.
2
Einleitung.
eisenhaltiges Mineral oder Mineralgemenge, das weniger als 20 f)/0 Eisen enthält, kaum als ein Eisenerz angesprochen werden können, während v 2 °/0 Silber einer mineralischen Masse schon den Charakter eines sehr werthvollen Silbererzes verleiht. Selbstverständlich wird sich das Urtheil über den Werth eines Erzes mit dem Werth der Metalle und dem jeweiligen Standpunkt der hüttenmännischen Technik ändern. Sehr beachtenswerth ist es, dass durch die Erweiterung chemischer Kenntnisse und die Vervollkommnung metallurgischer Processe metallhaltige Minerahen zu Erzen werden, die vorher die Aufmerksamkeit des Bergmanns nicht verdienten. Kobalt und Nickel sind Schimpfnamen, welche die alten Bergleute den Verbindungen des Kobalts und Nickels mit Schwefel, Arsenik und Antimon beilegten (z. B. Kupfernickel),» weil sie dieselben trotz ihres verlockenden metallischen Aussehens als werthlos auf die Halde werfen mussten, bis es am Ende des 16. Jahrhunderts gelang, die Kobalterze zur Smaltefakrikation zu verwenden. — Die Kunst, aus der Zinkblende metallisches Zink zu gewinnen, hat man erst am Ende des vorigen Jahrhunderts gelernt und von dieser Zeit an ist die Zinkblende in die Kategorie der Erze eingetreten. Seitdem man das von WÖHLER entdeckte Aluminium im Grossen darzustellen gelernt hatte, war man berechtigt, nach unserer Auffassung des Begriffs Erz, die dazu benutzten Aluminium enthaltenden Substanzen, wie Thou, Beauxit, Kryolith, als Aluminiumerze zu bezeichnen. Mit dem Begriff Erz ist ursprünglich die Idee der Verwerthbarkeit zur Metallgewinnung eng verbunden. — Es ist daher eine dieser berechtigten Auffassung nicht entsprechende, wenngleich in der Praxis eingebürgerte Erweiterung des Begriffs, Schwefel enthaltende Mineralien, die zur Darstellung von gediegenem Schwefel uder Schwefelsäure benutzt werden können, wie Schwefelkies und Markasit, Schwefelerze zu nennen. § 2. Als E r z l a g e r s t ä t t e n bezeichnet man das Vorkommen der Erze auf ihren natürlichen Ablagerungen, welche, als Theile des Erdkörpers, entweder direct zu den Gesteinen gerechnet werden müssen, oder in letzteren als untergeordnete Einlagerungen auftreten. § 3. D i e L e h r e von d e n E r z l a g e r s t ä t t e n ist ein Theil der Geologie und muss nach der Methode dieser Wissenschaft behandelt werden. — J e vielseitiger die geognostischen Kenntnisse sind, je tiefer die geognostische Auffassung ist, mit um so grösserem Erfolge wird das Studium der Erzlagerstätten betrieben werden können. Exacte Beobachtungen der beim Erzbergbau sich zeigenden Erscheinungen und treue Darstellung derselben in Bild und Wort schaffen die
Einleitung.
3
hauptsächlichste (Grundlage dieses wichtigen Theils der Geologie. — Niemand ist daher mehr berufen, die Kenntnisse der Erzlagerstätten zu fördern, als der practis'-he Bergmann." der durch täglich sich wiederholende Beobachtungen allein im Stande ist. die vielfach wechselnde Natur derselben zu erkennen. Ein einmaliger Besuch einer Grube ist meist nicht genügend, um die bebaute Lagerstätte verstehen zu lernen. Die Beobachtungen müssen so vielseitig angestellt werden wie -irgend möglich, und sich vorzüglich erstrecken auf das räumliche Verhalten der Lagerstätten, ihre Beziehungen zu dem Nebengestein, die Eigenschaften des letzteren, die mineralogische Natur der Lagerstätte, die Art und Weise wie die Mineralien neben und über einander vorkommen etc. etc. J e mehr die Lagerstätten durch Bergbau aufgeschlossen sind, desto günstiger ist natürlich die Gelegenheit zu derartigen Beobachtungen. — Leider hat man diese Gelegenheit, besonders in früheren Zeiten, vielfach ungenutzt vorübergehen lassen. — Die Baue sind zugestürzt und viele der wichtigsten Aufschlüsse sind für ewig zugedeckt; eine Mahnung dem lebenden Geschlechte, dafür .Sorge zu tragen, dass solche Bausteine der Wissenschaft ferner nicht verloren gehen. Das letzte Ziel des Studiums der Erzlagerstätten ist, einen klaren Einblick in die Entstehungsgeschichte derselben zu erlangen. — Wir sind diesem Ziele um so ferner, je lückenhafter unsere positiven Kenntnisse der Lagerstätten sind, um so näher, je vollständiger das Beobachtungsmaterial vorliegt. - Die Einsicht in die Genesis der Lagerstätten muss, wie jedes wissenschaftliche Erkennen, Selbstzweck sein; es ist aber nicht unbeachtet zu lassen, dass dieselbe allein den B e r g m a n n befähigt, in vollkommen rationeller Weise bei der Aufsuchung und Untersuchung der Lagerstätten zu verfahren. Die Erfolge einer oft mit grossem Glück angewandten Empirie einerseits, und die U"eberzeuguug andererseits, dass wir dem erhofften Ziele noch sehr ferne stehen, dürfen an der W a h r h e i t des Satzes nicht irre machen, dass die geognostische Wissenschaft dem Bergmann, bei der Aufsuchung und Untersuchung der Lagerstätten, allein als F ü h r e r dienen kann. § 4. Eintheilung. 1. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, d i e r ä u m l i c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r E r z l a g e r s t ä t t e n u n d i h r e B e z i e h u n g e n zu d e n a n g r e n z e n d e n G e s t e i n e n kennen zu lernen. — Damit beschäftigt sich der erste Abschnitt der Erzlagerstättenlehre. 2. Der zweite Abschnitt handelt v o n d e m s t o f f l i c h e n I n h a l t d e r E r z l a g e r s t ä t t e n oder von den Mineralien und Gesteinen derselben und ihrer Anordnung. l*
4
Einleitung.
3. Der dritte Abschnitt giebt eine s y s t e m a t i s c h geordnete S c h i l d e r u n g a l l e r A r t e n v o n E r z l a g e r s t ä t t e n und gewährt so eine Uebersicht über das ganze Gebiet. 4. In dem vierten Abschnitt wird d i e T h e o r i e d e r G e n e s i s d e r E r z l a g e r s t ä t t e n im Z u s a m m e n h a n g b e h a n d e l t . Es lässt sich nicht vermeiden, in die Darstellung der drei ersten Abschnitte schon genetische Betrachtungen zu verflechten. — Die Gesammtheit der erworbenen Kenntnisse befähigt aber allein — natürlich mit voller Berücksichtigung der Physik und der Chemie — ein Urtheil über die Genesis der Erzlagerstätten zu haben. § 5. H ü l f s w i s s e n s c h a f t e n . Als ein Tlieil der Geologie wird die Erzlagerstättenlehre nur im Zusammenhang mit den übrigen Theilen dieser Wissenschaft verstanden werden können, und ist deshalb die Kenntniss derselben, in möglichst grossem Umfange, vorauszusetzen. Die Hülfswissenschaften der Geologie, vorzüglich Mineralogie, Chemie und Physik, bilden daher auch für uns die nothwendige Grundlage eines tieferen Verständnisses. § 6. L i t e r a t u r . An Lehrbüchern der Erzlagerstättenlehre ist die Literatur sehr arm. Das vorzüglichste ist: Zweite BERNHARD VON COTTA, Die Lehre von den Erzlagerstätten. Auflage. 2 Theile. Freiberg 1859—1861. Ausserdem sind noch zu nennen: JOSEPH W A L D AUF VON WALDENSTEIN,
Die
besonderen
Lagerstätten
der nutzbaren Mineralien. Wien 1824, und JOHANN GRIMM, Die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien. P r a g 1869. Fast alle Lehrbücher der Geologie und Bergbaukunde behandeln in besonderen Abschnitten die Erzlagerstätten. Auf eine vollständige Aufzählung verzichtend, mögen hier nur erwähnt werden: CARL FRIEDRICH NAUMANN, Lehrbuch der Geognosie. Zweite Auflage. 3. Band. 16. Abschnitt. (Leider unvollendet geblieben.) Leipzig 1872. MORITZ FERDIN. GAETSCHMANN,
Die
Auf
und
Untersuchung
vo?i
Lagerstätten nutzbarer Mineralien als 1. Tlieil der Vollständigen Anleitung zur Bergbaukunst. Freiberg 1856. Zweite Auflage. Leipzig 1866, und ALBERT SERLO, Leitfaden zur Bergbaukunde. Dritte Auflage. 1. Abschnitt. Berlin 1878. Ein grosser Schatz an werthvollen Monographien und Arbeiten, die sich auf Erzlagerstätten beziehen, ist in den geologischen und bergmännischen Zeitschriften und sonstigen mineralogischen und geognostischen Werken niedergelegt, auf den im Folgenden durch Citate specieller hingewiesen werden soll.
Erster Abschnitt. Die räumlichen Verhältnisse der Erzlagerstätten und ihre Beziehungen zum Nebengestein. § 7. R e g e l m ä s s i g u n d u n r e g e l m ä s s i g g e s t a l t e t e L a g e r stätten. Man hat die Erzlagerstätten nach ihrer äussern Form in regelmässig und unregelmässig gestaltete eingetheilt, und zu den ersteren F l ö t z e . L a g e r und G ä n g e , zu den letzteren S t ö c k e . B l i t z e n und X e s t er gerechnet. l)ie ideale Form der regelmässig gestalteten Lagerstätten ist die einer mehr oder weniger dicken (mächtigen') ebenen Platte. — Dieser Form kommen Flötze und Gänge in Wirklichkeit manchmal sehr nahe; meist finden sich aber erhebliche Abweichungen, indem sich Undulationen der Platte einstellen. — die die Platte begrenzenden Flächen also nicht mehr Ebenen sind, — ferner keilförmige Gestalten herausbilden, und die scharfen Grenzen der Lagerstätten dadurch verschwinden, dass letztere mit dem Nebengestein in unregelmässigster Weise verwachsen. — Bei den Lagern kommen linsenförmige Gestalten besonders häufig vor, die aber recht oft in ganz regellose Formen übergehen. Lager und Gänge, welche sehr stark von der Plattenform abweichen, werden, wenn sie gleichzeitig grosse Dimensionen besitzen, als stockartig ausgebildet bezeichnet. (Lagerstücke und Gangstöcke.) § 8. B e s t i m m u n g d e r L a g e d e r L a g e r s t ä t t e n i m R a u m . Soll die Lage einer regelmässigen Lagerstätte im R a u m mathematisch bestimmt werden, so muss m a n sich ihre Gestalt, indem m a n von den zufalligen Unregelmässigkeiten absieht, auf die ideale Form und diese schliesslich auf eine Ebene zurückgeführt denken. Die Lage einer Ebene im Räume ist durch drei Punkte, oder durch zwei sich schneidende gerade Linien bestimmt.
6
Erster Abschnitt.
In der Praxis wählt man zwei gerade, in der Ebene der Lagerstätte liegende, sich rechtwinklig schneidende Linien, von denen eine horizontal liegt. Diese horizontale Linie ab in Fig. 1 wird die S t r e i c h l i n i e genannt, und die darauf senkrecht stehende cd die F a l l l i n i e . Die Himmelsrichtung der Streichlinie, gemessen durch den Winkel, welchen letztere mit dem Meridian bildet, nennt man das S t r e i c h e n Fif. 1. der Lagerstätte. Mit Hülfe des Compass kann man das Streichen, bezogen auf den magnetischen Meridian, das sogenannte o b s e r v i r t e S t r e i c h e n leicht bestimmen. Ist das auf den astronomischen Meridian bezogene, sogenannte r e d u c i r t e S t r e i c h e n zu ermitteln, su hat man von dem observirten Streichen die durch die Declination angegebene Anzahl Grade abzuziehen; — für Deutschland gegenwärtig rund 15" westlich. Das Streichen wird entweder in Stunden ihorae), oder in Graden ausgedrückt. — Bei der ersten Methode denkt man sich den Horizont in 2 mal 12 Stunden eingetheilt, und zwar dem Gange der Sonne entsprechend von Ost nach West-, — Jeder Stunde entsprechen 15°. Die Richtung NS ist Stunde 12 (h. 12) — Mitternacht und Mittag —, die Richtung OW ist Stunde C (h. 6) — Morgen und Abend. In beistehender Figur 2 wird der Horizont durch einen Kreis vorgestellt. — Die Linie a b ist die Streichlinie einer in h 3 streiFig. 3. chenden Lagerstätte. In Zukunft wird, wie bereits in Fig. 1 geschehen, der Horizont durch einen horizontal liniirten Rhombus N O S \Y (Fig. 8) dargestellt werden, in welchem NS = h l 2 und WO = h 6 bedeuten soll.
Die räumlichen Verhältnisse d. Erzlagerstätten u. ihre Beziehungen zum Nebengestein. 7
Bei der Bestimmung' nach (¿raden wird der Horizont sehr verschieden eingetheilt, entweder in 800" oder in 2 mal 180", auch sogar in 4 mal 90". — Die Theilung beginnt in den beiden ersten Fällen an der Nordsüdlinie, im letzteren Fall — bei Lintheilung in 4 mal 90" — auch an der Ostwestlinie. Die Pachtung der Zählung wird ausgedrückt, indem man die Zeichen X, S, 0 . \Y vor und hinter die Zaihl, welche die Grade angiebt, sehreibt; so ist z. B. h 8 = X 45" 0. — U m an dem Compass das Streichen direct ablesen zu können, müssen auf dem Theilkreis desselben Ost und West vertauscht sein. Den Winkel, welchen die Falllinie mit d e m Horizont bildet — u in Fig. 1 — nennt man das Fallen; dasselbe wird durch den Gradbogen bestimmt, W e n n eine plattenfnrmige Lagerstätte von 'der regelmässigen idealen Form abweicht, so zeigt dieselbe nicht an allen Stellen dasselbe Streichen und Fallen. Aus den einzelnen Observationen, S p e c i a l s t r e i c h e n und S p e c i a l f a l l e n , wird man aber immer im Stande sein, eine durchschnittliche Streich- und Fallrichtung — das G e n e r a l s t r e i c h e n und G e n e r a l f a l l e n — zu construiren. In Fig. 4 bedeutet a b das Generalstreichen und a b ' ein Specialstreichen, in Fig. 5 c d das Generalfallen und c
![Die Verwirkung: Ein Beitrag zur Lehre von den zeitlichen Schranken der Ausübung der subjektiven Rechte [Reprint 2021 ed.]
9783112453742, 9783112453735](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verwirkung-ein-beitrag-zur-lehre-von-den-zeitlichen-schranken-der-ausbung-der-subjektiven-rechte-reprint-2021nbsped-9783112453742-9783112453735.jpg)
![Die Lehre von der Sittenwidrigkeit der Rechtsgeschäfte in historischer Sicht [Reprint 2020 ed.]
9783112320433, 9783112309261](https://dokumen.pub/img/200x200/die-lehre-von-der-sittenwidrigkeit-der-rechtsgeschfte-in-historischer-sicht-reprint-2020nbsped-9783112320433-9783112309261.jpg)

![Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte: Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den gemeingefährlichen Delikten [1 ed.]
9783428494316, 9783428094318](https://dokumen.pub/img/200x200/die-dogmatik-der-brandstiftungsdelikte-zugleich-ein-beitrag-zur-lehre-von-den-gemeingefhrlichen-delikten-1nbsped-9783428494316-9783428094318.jpg)

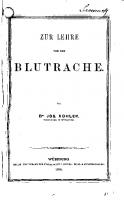

![Compendium der Lehre von den Fracturen: Für Studierende und Ärzte [3. Aufl. Reprint 2020]
9783112377864, 9783112377857](https://dokumen.pub/img/200x200/compendium-der-lehre-von-den-fracturen-fr-studierende-und-rzte-3-aufl-reprint-2020-9783112377864-9783112377857.jpg)
![Zur Lehre von den Götterbildern in der epikureischen Philosophie [Reprint 2021 ed.]
9783112579947, 9783112579930](https://dokumen.pub/img/200x200/zur-lehre-von-den-gtterbildern-in-der-epikureischen-philosophie-reprint-2021nbsped-9783112579947-9783112579930.jpg)

![Die Lehre von den Lagerstätten der Erze: Ein Zweig der Geologie [Reprint 2021 ed.]
9783112604540, 9783112604533](https://dokumen.pub/img/200x200/die-lehre-von-den-lagersttten-der-erze-ein-zweig-der-geologie-reprint-2021nbsped-9783112604540-9783112604533.jpg)