Die Ehre in den Zeiten der Demokratie: Das Verhältnis von athenischer Polis und Ehre in klassischer Zeit 9783666367083, 3525367082, 9783525367087
163 114 3MB
German Pages [356] Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
Historische Semantik
Herausgegeben von Gadi Algazi, Bernhard Jussen, Christian Kiening, Klaus Krüger und Ludolf Kuchenbuch
Band 8
Vandenhoeck & Ruprecht
Christel Brüggenbrock
Die Ehre in den Zeiten der Demokratie Das Verhältnis von athenischer Polis und Ehre in klassischer Zeit
Vandenhoeck & Ruprecht
Umschlagabbildung: Hahnenkampf, Randschale © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN 10: 3-525-36708-2 ISBN 13: 978-3-525-36708-7
Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein sowie der FAZIT-Stiftung, Frankfurt am Main.
© 2006, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen. Internet: www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Druck und Bindung: a Hubert & Co, Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt Vorwort ..................................................................................................
7
I.
Einleitung: Ehre und Polis .............................................................. 1. Methodische Überlegungen ....................................................... 2. Der Begriff der Ehre .................................................................. 3. Die Vorstellung der Ehre und die Ordnung der Polis ................ 4. Die Athener als Ehrenmänner ....................................................
9 11 16 20 27
II.
Die Ehre der Homerischen Helden .................................................
40
III. Der Agon als Wettkampf um Ehre ................................................. 61 1. Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen ........... 64 2. Im Wettlauf zur Ehre: Die athenischen Olympioniken .................................................. 82 3. Das Stadion der Ehre: Athenische Ehrenmänner in Olympia ........................................ 100 4. Der Agon als Schau-Spiel um Ehre: Hahnenkämpfe im Dionysostheater ........................................... 127 Resümee: Das agonale Verhalten der Athener ............................... 140 IV. Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre ...................... 143 V. Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger ....................... 1. Ehre als Bedrohung der Polis: Das Phänomen der Hybris ......................................................... 2. Die Polis als Bedrohung der Ehre: Atimie als Schande .................................................................... Resümee: Gleichheit und Ungleichheit in der Polis ......................
161 163 181 192
6
Inhalt
VI. Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht? ........ 193 1. Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes ............................................. 205 2. Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos ............................................... 236 3. Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide ......................... 265 Resümee: Die Verbindung von Recht und Rache .......................... 306 VII. Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis ....... 309 Anhang .................................................................................................... Abkürzungen .................................................................................. Quellen- und Literaturverzeichnis .................................................. Register ...........................................................................................
321 321 322 346
Vorwort
Ehre, wem Ehre gebührt: An dieser Stelle möchte ich jenen danken, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben. Sie wurde im Juli 2003 als Dissertation von der Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philosophie der Universität Bielefeld angenommen und für die Druckfassung an einigen Stellen überarbeitet und aktualisiert. Winfried Schmitz danke ich für seine stete Förderung und Diskussionsbereitschaft und für den großen Freiraum, den er mir bei der Wahl thematischer Schwerpunkte und Akzente ließ. Er bewahrte mich vor allzu phantasiereichen Exkursen in quellenarme Gebiete und gab mir zahlreiche Anregungen, von denen das Kapitel zu den Hahnenkämpfen nur eine ist. Tassilo Schmitt danke ich besonders herzlich: Er hat meine Studien seit meinem ersten Semester mit fachkundigem Interesse und inspirierenden Gesprächen begleitet. Ohne seine Leidenschaft für die Alte Geschichte und sein Vertrauen in mich und meine Arbeit wäre dieses Buch nicht entstanden. Für viele gute Ratschläge und eine allzeit kritische Haltung meiner Arbeit gegenüber danke ich Oliver Müller; er hat das Werk häufiger gelesen als jeder andere. Wertvolle Kritik und wichtige Hinweise verdanke ich auch Mischa Meier, der mich vor einigen dummen Fehlern bewahrte. Für die teilnehmende Begleitung des Schaffensprozesses gerade in kritischen Phasen möchte ich Wolfgang Will und meinen ehemaligen Bielefelder Kollegen danken. Die Aufnahme der Arbeit in die Reihe »Historische Semantik« verdanke ich insbesondere Bernhard Jussen, der sich bei meiner Disputatio spontan für das Thema begeistern konnte. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag gestaltete sich dank Dörte Rohwedder stets angenehm und professionell. Die Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften und die Fazit-Stiftung haben die Drucklegung der Arbeit dankenswerterweise großzügig unterstützt. Der Dissertationspreis der WestfälischLippischen Universitätsgesellschaft ehrte mich und trug ebenfalls zur Finanzierung bei. Für Beistand in Rat und Tat – insbesondere in schwierigen Zeiten – danke ich meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen Freunden. Und Giovanni Maccioni danke ich für alles. St. Gallen, im Januar 2006
Christel Brüggenbrock
I. Einleitung: Ehre und Polis
Während der Belagerung Troias durch die Griechen wird Achilleus von Agamemnon in seiner Ehre gekränkt. Achill verschanzt sich daraufhin mit seinen Männern bei den griechischen Schiffen und verweigert die weitere Teilnahme am Kampf. Nach einigen Tagen sendet Agamemnon Aias, Odysseus und Phoinix zu ihm, um ihn zur Rückkehr zu bewegen. Da die Gesandten wissen, dass es für Achill um seine Ehre geht, appelliert Odysseus an sein Ehrgefühl und erinnert ihn an die Worte, die ihm sein Vater Peleus mit auf den Weg gegeben hat: SÝ DÒ μEGAL»TORA QUμÕN ‡SCEIN ™N ST»QESSI: FILOFROSÚNH G¦R ¢μE…NWN: LHGšμENAI D' œRIDOJ KAKOμHC£NOU, ÔFRA SE μ©LLON T…WS' '!RGE…WN ºμÒN NšOI ºDÒ GšRONTEJ.1 Mit dem Hinweis auf die verbindlicheren Tugenden, die einen Mann von Ehre auszeichnen sollten, setzt Odysseus einen alternativen Ehrbegriff an die Stelle der Ehre des Achill, die sehr agonal und konfliktorientiert ist. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Ehre bei den Athenern in der klassischen Zeit. Sie untersucht die Beziehung zwischen den normativen Erwartungen der Ehre und den Ansprüchen der demokratischen Polis an das Verhalten eines Atheners. Wie spannungsreich dieses Verhältnis zwischen der Ehre und dem Gemeinwesen sein kann, deutet sich in obiger Szene bereits an. Das beschriebene Verhalten der homerischen Helden ist geeignet, einige wichtige Aspekte von Ehre zu verdeutlichen, deren Wirkung sich nicht auf die homerische Gesellschaft beschränkt. Vor einigen aus der Vorstellung von Ehre resultierenden Problemen stehen die Athener auch in klassischer Zeit. Der Verlauf des Streits zwischen Achill und Agamemnon zeigt zunächst die Bedeutung der Ehre eines Mannes. Das Verhalten eines Ehrenmannes orientierte sich maßgeblich an seiner Vorstellung von Ehre. Der Ehrbegriff umfasste dabei verschiedene ehrenhafte Verhaltensmuster, so etwa die stetige Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit anderen Ehrenmännern und eine schnelle Erregung von Konflikten, wenn das Ehrgefühl betroffen war, aber auch die Anerkennung der Ehre von Statusgleichen und den reziproken Austausch von Gaben. Als ehrenhaft galten verschiedene, untereinander auch widersprüchliche Verhaltensweisen, die in einer gegebenen Situation 1 Hom. Il. 9, 255-259: »Du aber halte den großherzigen Mut fest in der Brust, denn Freundlichkeit ist besser! Laß ab von dem unheilstiftenden Streit, so werden mehr dich ehren die Argeier, die Jungen wie auch die Alten!« Übersetzung W. Schadewaldt.
10
Einleitung
eine Mehrzahl von ehrenhaften Handlungen ermöglichten. Das Urteil darüber, was eine ehrenhafte Handlung ausmachte, sprachen signifikante Andere, wie die Freunde des Achill oder sein Vater und die öffentliche Meinung, hier in Gestalt der Achaier. Als handlungsleitender Wert war die Ehre für die Griechen so entscheidend, dass Achill um seiner Ehre willen die Gemeinschaft im Stich ließ, deren höchster Wert die Ehre darstellte. Die heterogenen Verhaltensmuster der Ehre sind das Problem jeder Gesellschaft, in der Ehre eine große Rolle spielt. Größere Spannungen treten gewöhnlich zwischen dem Wert der Ehre und anderen sozialen und rechtlichen Regeln sozialer Einheiten auf. Die Konzentration der Untersuchung auf die demokratische Polis Athen in klassischer Zeit bietet sich aus mehreren Gründen an. Zum einen waren es die ehrenhaften Athener selbst, die eine politische Ordnung schufen, die sich mit einigen Verhaltensmaximen des nach wie vor äußerst wichtigen Wertes der Ehre schwer vereinbaren ließ. Zum anderen erforderte und förderte die athenische Demokratie ein hohes Maß an aktiver Beteiligung und latenter Loyalität ihrer Bürger sowie an stetiger Reflexion der entstandenen politischen Möglichkeiten. Die Konstellation der Ehre als dem überragenden gesellschaftlichen Wert und der demokratischen Polis als einer populären Ordnung, deren Regeln und Gesetze von vielen getragen wurden, erzeugte große Reibungsflächen. Auf der anderen Seite enthielt die Vorstellung von Ehre durchaus Elemente, die der Demokratisierung der athenischen Bürger Vorschub leisteten. Das Spannungsfeld zwischen den normativen Ansprüchen der Ehre und der Polis lässt sich in Athen besonders gut abstecken. Die Analyse des Verhältnisses, in dem die Ehre und die Polis in klassischer Zeit zueinander standen, verspricht einen ergiebigen Beitrag zum Verständnis der athenischen Demokratie, die in einem von Ehre geprägten sozialen Umfeld geschaffen und aufrechterhalten wurde. Denn die Ehre und die Polis bildeten die zwei Pole, nach denen die athenischen Bürger ihr Verhalten ausrichteten. Zu analytischen Zwecken werden die Ordnungssysteme der Ehre und der Polis, deren Verbindung in der Praxis untersucht werden soll, hier strikt getrennt. Unter diesem methodischen Vorzeichen lassen sich die unvereinbaren und widersprüchlichen Elemente beider normativer Ordnungen besser identifizieren. Im Blickpunkt steht das Verhalten der athenischen Bürger innerhalb des normativen Spannungsfeldes der Ehre einerseits und der demokratischen Polis andererseits, wobei besonders das Miteinander beider auf der Ebene der konkreten Handlungen interessiert. Da es sich bei der Ehre um das ältere Gut mit den länger validen normativen Ansprüchen handelt, ist davon auszugehen, dass sich die entwickelnde Demokratie in ihr Wertesystem eingepasst hat, so gut beide eben kompatibel waren. Die Offenheit und Wandlungsfähigkeit der demokratischen Ordnung äußert sich praktisch in der Pluralität der Meinungen und Reden
Methodische Überlegungen
11
und der regen Diskussion öffentlicher Angelegenheiten, die das politische Tagesgeschäft prägten. Zwar basieren auch ehrenhafte Handlungen in einem nicht zu unterschätzenden Maße auf ihrer Interpretation, aber generell handelt es sich bei der Ehre um das behäbigere Ordnungsprinzip. Der Erklärungsbedarf in dem Prozess der Verknüpfung beider Regelwerke bezieht sich deshalb primär auf die Ehre, deren Rolle in dem viel besser erforschten Kontext der athenischen Demokratie untersucht werden soll.2 Die Einleitung gliedert sich wie folgt: Zunächst werden einige methodische Überlegungen angestellt und die zentralen Prämissen der Arbeit erörtert (1). Darauf folgt die Klärung des komplexen Begriffes der Ehre (2). Anschließend werden die Ehre und die Polis als normative Ordnungen gefasst und einander gegenüber gestellt (3). Hier hat auch die Forschung zur Ehre in Athen und zur athenischen Demokratie ihren Platz. Die Anwendung des theoretischen Konzeptes auf den Untersuchungsgegenstand erfolgt anhand der habituellen Formen: Es gilt, die konkreten Bezugsfelder innerhalb der athenischen Gesellschaft abzustecken, in denen das Verhalten der Athener analysiert werden soll, und die wichtigsten Fragen aufzuwerfen, die im Laufe der Untersuchung zu beantworten sind (4). Eine Diskussion der Quellen schließt sich den jeweiligen Bezugsgebieten an.
1. Methodische Überlegungen Ehre ist ein soziales Konstrukt und gestaltet die gedachte Ordnung3 einer Gesellschaft. Die Vorstellung von Ehre ergibt sich nicht aus einer bestimmten vorgefundenen Ordnung der Lebenswelt, sondern Ehre wird geschaffen, um zu einer sinnhaften Ordnung zu gelangen. Infolgedessen kann Ehre nicht allgemeingültig definiert werden. Sie ist geprägt von der spezifischen Lebenswelt einer Gesellschaft, die sie dem Einzelnen sinnhaft verfügbar machen soll. Der negative Befund bei dem Versuch der inhaltlichen Bestimmung des Begriffs Ehre bedeutet nicht, dass sie keinen Inhalt hat, sondern dass er abhängig ist von der Interpretation derer, die sich dem Wert der Ehre verpflichtet fühlen.4 Offensichtlich muss ihr nicht ein bestimmter 2 Ehre taucht in der Forschung regelmäßig als wichtiger Einflussfaktor neben anderen auf, wenn es um die Werte der Athener oder um die Bedingungen für soziale Ungleichheit geht und wenn jene Wirkungskreise analysiert werden, auf die die Ehre einen prägenden Einfluss ausübt. Eine speziell der Ehre gewidmete Monographie, die über die Auflistung und Exegese der einschlägigen Quellenstellen hinausginge, fehlt. 3 Vgl. zum Begriff der »gedachten Ordnung« M.R. Lepsius, Nation und Nationalismus in Deutschland, in: ders., Interessen, 232-246, 233, der sich hier (terminologisch E. Francis folgend) auf die Nation bezieht. 4 P. Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1976, 44; J. Pitt-Rivers, Honour and Social Status, in: J.G.
12
Einleitung
Wertekanon zugrunde liegen, der sich aus der Bedeutung oder inneren Logik des Begriffs ergibt bzw. für ihre Funktion unerlässlich ist. Im Gegenteil: Gerade durch die inhaltliche Unbestimmtheit kann Ehre die Einhaltung der Normen und Werte einer Gesellschaft herbeiführen, ohne selbst in Konflikt mit ihnen zu geraten. Die normative Kraft der Ehre zeigt sich auf formaler Ebene: Ehre erzeugt bestimmte Muster der Kommunikation und der sozialen Beziehungen, die typisch sind für alle ehrenhaften Gesellschaften. Eine Konzeption von Ehre, die sich auf die athenische Gesellschaft anwenden lässt, muss deshalb auf formaler Ebene klare Kriterien entwickeln dafür, was ehrenhaftes Verhalten ist, und inhaltlich einen gewissen Raum für die spezifisch athenische Variante der Vorstellung von Ehre offenlassen. Die Vielschichtigkeit des Phänomens »Ehre« schlägt sich auch auf sprachlicher Ebene in einer entsprechenden Menge von Ausdrucksmöglichkeiten nieder. Um der Komplexität des Phänomens sprachlich gerecht zu werden, müsste konsequent vom »Komplex der Ehre« gesprochen werden, der die begrifflichen, konzeptuellen, normativen, handlungsleitenden und ideellen Aspekte (sowie jene Faktoren, die davon in den Bann gezogen werden) erfasst. Um stilistische oder syntaktische Verrenkungen zu vermeiden, wird im Folgenden dort verkürzt von »Ehre« gesprochen werden, wo dieses Konglomerat an Eigenschaften mitgedacht ist. Allein der Begriff der »Ehrungen« hat eine besser fassbare Bedeutung: Er bezeichnet die konkreten Auszeichnungen, mit denen die Athener ihre Mitbürger in einem öffentlichen Akt versehen.5 Auch bei den Griechen ist die Wirkung der Ehre begrifflich fassbar. Die Untersuchung der verschiedenen Benennungs- und Bedeutungsmöglichkeiten von Ehre bietet einen quellennahen Ansatz zur Klärung von Ehre bei den Athenern. Dieser methodische Zugang wird hier vernachlässigt werden. Denn eine vornehmlich philologische Analyse hätte den gravierenden Nachteil einer zu ausschließlichen Fokussierung auf die terminologische Ebene.6 Gerade der Begriff der Ehre widersetzt sich jedoch einer allzu leichten Verbalisierung, sodass auf die Äußerungen der Athener in dieser Hinsicht wenig Verlass ist.7 Weil Ehre in einem kommunikativen, handPeristiany (Hg.), Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, London 1966, 19-77, 27f. 5 Vgl. dazu die ausführlichere Definition Kap. VI. 3., S. 254-257. 6 Eine ausführliche, philologisch orientierte Analyse der Begrifflichkeit von Ehre bietet G. Steinkopf, Untersuchungen zur Geschichte des Ruhmes bei den Griechen, Diss. phil., Halle a.d.S. 1937. 7 Vgl. F. Guttandin, Das paradoxe Schicksal der Ehre. Zum Wandel der adeligen Ehre und zur Bedeutung von Duell und Ehre für den monarchischen Zentralstaat, Berlin 1993, 27: »Das Wissen der Ehre ist wesentlich begriffslos« und Bourdieu, Entwurf, 43: »Das Wertsystem der Ehre wird
Methodische Überlegungen
13
lungsorientierten Prozess von den Akteuren beständig aktualisiert werden muss, erfasst eine sozial- bzw. kulturgeschichtliche Analyse einen größeren Wirkungsradius dieses Phänomens. Sie macht die semantische Bandbreite und Flexibilität der Begriffe deutlich, mit denen die Athener ihre Verhaltensweisen als ehrenhaft bezeichnen. Besser als jede Übersetzung der verschiedenen, heute allesamt recht blutleeren Begriffe der Ehre führt eine Untersuchung des Verhaltens der Athener und seiner Interpretation durch sie vor, was ihnen Ehre bedeutet und was sie meinen, wenn sie von ihr sprechen. Als verbales Deutungsmuster ist Ehre nur dort relevant, wo es um die Begründung von Handlungen geht, wo also der Interpretationsspielraum ehrenhaften Verhaltens von den Athenern genutzt wird oder wo eine Debatte über die Ehre als ein Indikator gewertet werden kann dafür, dass der Wert der Ehre grundsätzlich reflektiert bzw. in Zweifel gezogen wird. Eine theoretische Behandlung der Ehre in klassischer Zeit unternimmt Aristoteles. In seiner Rhetorik legt er dar, wie die Ehre des Einzelnen in Wechselwirkung mit den Affekten tritt.8 Dabei beschränkt er sich jedoch auf die emotionale Dynamik und daraus resultierende Manipulierbarkeit der Hörer seiner rhetorischen Finessen.9 Darüber hinausgehende Aspekte nimmt er selten in den Blick, sie sind nicht Thema seiner Abhandlung. Auch der Philosoph ist ein Mitglied der ehrenhaften athenischen Gesellschaft und kommt als solches über einen bestimmten Abstand zu den zeitgenössischen sozialen Verhältnissen nicht hinaus. Eine Aufschlüsselung der aristotelischen Darlegungen zum Ehrgefühl und verwandten Phänomenen bietet ebenfalls eine originär griechische Vorstellung von Ehre, beschränkt den Blickwinkel aber zugleich auf sie. Um die Bestimmung der Perspektive, aus der die Ehre bei den Athenern betrachtet werden soll, nicht zeitgenössischen Auffassungen zu überlassen, erfolgt die Klärung des Begriffs zunächst unabhängig von der griechischen Gesellschaft. Als analytischer Bezugsrahmen bieten sich mit dem Phänomen der Ehre befasste Untersuchungen aus dem Bereich der Anthropologie und Ethnologie an. Sie konzentrieren sich in der Regel auf überschaubare dörfliche Gesellschaften, in denen die Vorstellung von Ehre die Kommunikation und das soziale Leben der Bewohner prägt. Diese Studien können eine Vorstellung davon vermitteln, worum es sich bei der Ehre überhaupt handelt. Gefragt ist dabei nicht nach einer möglichst zutreffenden Definition, sondern nach der Veranschaulichung der sozialen Dynamik, die Ehre entfaltet. Ihre Funktion ist die eines Erklärungsmodells, das einen begrifflieher ›praktiziert‹ als gedacht, und die Grammatik der Ehre kann den Handlungen Form geben, ohne selbst formuliert werden zu müssen.« 8 Aristot. Rhet. II, 1-18. 9 Die psychische Dimension des Ehrgefühls ist sicherlich nicht die unwesentlichste, naturgemäß aber eine in den Quellen kaum fassbare.
14
Einleitung
chen und theoretischen Rahmen stellt, innerhalb dessen anhand der Quellen ein Bild der spezifisch griechischen Ehre ausgestaltet werden kann. Es gibt eine Vielzahl von anthropologischen Studien, die an sehr unterschiedlichen sozialen Einheiten illustrieren, was Ehre ist und wie eine durch Ehre geprägte Gesellschaft »funktioniert«. Die anthropologischen Untersuchungen bieten nicht nur ein geographisch weit gefasstes, sondern auch ein über verschiedene Jahrzehnte und Jahrhunderte sich spannendes Panorama der Lebenswelten von Gesellschaften, die durch Ehre strukturiert sind.10 Die Fülle und Verschiedenartigkeit der Beschreibungen spiegeln den Facettenreichtum des Ehrbegriffs, der die Basis ganz unterschiedlich sich gestaltender sozialer Welten sein kann.11 Gerade die Divergenz der untersuchten Gesellschaften im Hinblick auf andere Faktoren macht die durch Ehre geprägten Denk- und Handlungsmuster als solche evident. Denn ungeachtet aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Gesellschaften und der Heterogenität ihrer sozialen Normen lassen sich doch einige gemeinsame Züge beobachten, die sich aus der inneren Logik und als Konsequenz der Ehre ergeben.
10 Genannt seien hier nur einige der Wichtigsten, um einen Eindruck der Spannweite ihres Untersuchungsraumes zu geben: Bourdieu, Entwurf, untersucht den Zusammenhang von Ehre und Ehrgefühl in der kabylischen Gesellschaft; J. du Boulay, Portrait of a Greek Mountain Village, Oxford 1974 und J. Campbell, Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Oxford 1964 beschreiben die Beziehungs- und Handlungsmuster in kleinen griechischen Dörfern; während J. Schneider und P. Schneider, Culture and Political Economy in Western Sicily, New York 1976, dasselbe für Sizilien bzw. Kreta tun: M. Herzfeld, The Poetics of Manhood. Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton 1985. J.G. Peristiany, Honour and Shame in a Cypriot Highland Village, in: ders. (Hg.), Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, London 1966, 171-190 geht von einer zunächst begrenzt phänomenologischen Studie aus, um dann zu einer übergreiferenden Einschätzung zu gelangen, vgl. ders., Introduction, in: ders., Values, 9-17. Ebenso ist es Pitt-Rivers, Status, um eine Konzeptualisierung des Ehrbegriffs auf der Grundlage anthropologischer Studien zu tun. Berücksichtigt wurden ebenso einige soziologische und sozialhistorische Arbeiten, die sich mit der Ehre oder ihr verwandten Themen, wie etwa dem Duell, beschäftigen. 11 Die Tatsache, dass sich das Studienobjekt der meisten dieser Arbeiten im Mittelmeerraum – so groß dieser auch ist – lokalisieren lässt, hat in der Forschung zur umstrittenen These der Einheitlichkeit des Mittelmeerraumes aufgrund eben dieser tradierten gesellschaftliche Kraft der Ehre geführt. Vgl. zur Diskussion um die Universalität des Konzepts der Ehre im Mittelmeerraum den Sammelband Peristiany, Honour, dem diese These zugrunde liegt, sowie kritisch dazu E. Saurer, Auf der Suche nach Ehre und Scham. Europa, sein mediterraner Raum und die Mittelmeeranthropologie, in: Historische Anthropologie 10,2 (2002), 206-224; M. Herzfeld, The Horns of the Mediterraneanist Dilemma, in: American Ethnologist 11 (1984), 439-454; J. Davis, People of the Mediterranean. An essay in comparative social anthropology, London 1977. Studien wie jene von M. Asano-Tamanoi, Shame, Family, and State in Catalonia and Japan, in: D.D. Gilmore (Hg.), Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean, Washington 1987, 104-120 oder U. Frevert, »Mann und Weib, und Weib und Mann«. Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München 1995 belegen, dass die typischen Interaktionsmuster ehrenhafter Gesellschaften nicht Teil eines bestimmten Kulturraumes sein müssen.
Methodische Überlegungen
15
Die einzelnen Arbeiten konzentrieren sich auf die Beschreibung und Interpretation von bestimmten Verhaltensweisen und Kommunikationsarten, die das Miteinander in den jeweiligen Gesellschaften ausmachen. Denn die Ehre einer Person lässt sich nur in Gegenwart anderer aktualisieren und der Anspruch eines Mannes auf Ehre zeigt sich durch ein entsprechend ehrenhaftes Verhalten. Eine Untersuchung der athenischen Gesellschaft innerhalb des analytischen Bezugsrahmens anthropologischer Forschungen fragt danach, inwieweit sich in Athen Verhaltensweisen und Interaktionsmuster nachweisen lassen, wie sie typisch sind für ehrenhafte Gesellschaften. Zu einem Nachteil dieses methodischen Vorgehens können die häufigen Analogieschlüsse geraten. Zusammen mit dem anthropologischen Fundament, das die allgemeinmenschliche Dimension sozialen Handelns unter bestimmten normativen Bedingungen betont, entsteht leicht die Gefahr der Reduzierung aller Vergleichsobjekte auf die auserkorenen Schlüsselkriterien. Um eine derartige Nivellierung zu vermeiden, sollen die Besonderheiten Athens inmitten vieler ähnlicher Charakteristika aller ehrenhaften Gesellschaften immer wieder hervorgehoben werden. Die Vorteile dieses Ansatzes zeigen sich vor allem in der veränderten Perspektive auf die athenische Polis der klassischen Zeit: Einerseits entsteht mit der Behandlung der Athener als einer vormodernen ehrenhaften Gesellschaft ein Verfremdungseffekt, der zu neuen Einsichten führen kann und andererseits wird das Verhalten der Athener durch die Einbindung in übergreifende Sinnzusammenhänge anschaulicher. Letzteres leisten die anthropologischen Darstellungen der Wirkungsweise von Ehre. Sie liefern eine grundlegende Vorstellung davon, was Ehre für die Art der Vergesellschaftung und den Lebensstil des Einzelnen in einer sozialen Einheit bedeuten kann. Dies umso mehr, als es sich bei der Ehre um ein dem modernen Forschenden relativ erlebnisfernes Konzept einer fremden Gesellschaft handelt.12 Das phänomenologische Fundament der anthropologischen Arbeiten verweist auf die Lebensbereiche, in denen die Erscheinungsformen und die Wirkung von Ehre am besten zu identifizieren sind. Ohne einen solchen Verweis würde sich das Aufzeigen eines derart abstrakten Begriffs wie der Ehre als allzu schwierig erweisen. Durch die anthropologischen Studien soll deshalb geklärt werden, wo sich Ehre manifestiert und was dabei eigentlich zu suchen ist.
12 Vgl. P.L. Berger, Über den Begriff der Ehre und seinen Niedergang, in: ders., B. Berger und H. Kellner (Hg), Das Unbehagen in der Modernität, Frankfurt a.M. 1987, 75-85: »Die heutige Leugnung der Realität von Ehre und Ehrverletzungen ist so sehr Teil einer als selbstverständlich empfundenen Welt, dass es einer bewussten Anstrengung bedarf, dies überhaupt als ein Problem zu sehen«, 76.
16
Einleitung
2. Der Begriff der Ehre Trotz der Verschiedenartigkeit der einzelnen durch Ehre verfassten Gesellschaften lassen sich einige Züge ausmachen, die ihnen allen zu Eigen sind. Bei der Betrachtung der Studien zu diesen sozialen Einheiten fällt zunächst auf, dass die Forschungsobjekte durchweg – aus der Sicht des modernen westlichen Menschen – der gleichen evolutionären Kategorie angehören: Es handelt sich stets um so genannte vormoderne Gesellschaften. Ihre Ökonomie ist vorwiegend agrarisch orientiert und infrastrukturell schwach. Ihre politische Einbindung ist unzuverlässig, d. h. die Staats- oder Verfassungsform ist relativ unwichtig, da sie in nur geringem Maße auf die Organisation der kleinen Gemeinschaften rückwirkt. Kulturell und sozial schließt sich der Horizont an den Grenzen des Dorfes. Kennzeichnend für diese Gesellschaften ist damit in erster Linie ein eklatanter Mangel dessen, was als die Errungenschaften der Moderne gelten. Dazu werden ebenso schlagkräftig wie vage die umfassende Bürokratisierung und Institutionalisierung aller Lebensbereiche, die Individualisierung und Anonymität als Erfahrungen des Individuums und die Mobilität und Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung als soziale Merkmale gezählt.13 Vormoderne Strukturen und der Einfluss von Ehre scheinen hier Hand in Hand zu gehen. Tatsächlich erweisen sich einige Charakteristika, die typisch für diese Art der Vergesellschaftung sind, als notwendige Bedingungen für das Vorhandensein von Ehre. Sie stecken quasi das Terrain ab, auf dem Ehre als soziale Norm gedeihen kann. Eine der Bedingungen ist die buchstäblich überschaubare Größe der sozialen Einheiten. Ihre Mitglieder finden ihre signifikanten Anderen ausschließlich hier und kennen sich untereinander in einem Maße, das es jedem erlaubt, jeden beliebigen anderen persönlich zu kennen und über zumindest einen Teil seiner Biographie informiert zu sein.14 Die Klassifikation als Face-to-face-Gesellschaft veranschaulicht diesen Sachverhalt. Die Folge davon ist eine umfassende soziale Kontrolle, die über die Einhaltung der 13 Berger, Begriff, analysiert den Niedergang der Ehre in der modernen Welt, an deren Genese er folgende Faktoren beteiligt sieht: »Technologie und Industrialisierung, Bürokratie, Verstädterung und Bevölkerungswachstum, die enorme Zunahme an Kommunikation zwischen allen nur denkbaren Menschengruppen, soziale Mobilität, die Pluralisierung der sozialen Welten«, 82. Zum Problem des Begriffs »Moderne« vgl. M.R. Lepsius, Soziologische Theoreme über die Sozialstruktur der ›Moderne‹ und die ›Modernisierung‹, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990, 211-231. Er betrachtet die Dimensionen der Differenzierung, der Mobilisierung, der Partizipation und der Institutionalisierung von Konflikten als Gradmesser für die Modernisierungskapazität einer Gesellschaft, 230. 14 Vgl. J. Peristiany, Introduction, in: ders., Honour, 9-17, 11; Bourdieu, Entwurf, 28.
Der Begriff der Ehre
17
sozialen Normen wacht, und eine nicht zu überschätzende Bedeutung des öffentlichen Raumes.15 Die Öffentlichkeit als sozialer Raum aber ermöglicht erst die Existenz von Ehre. Denn es erfordert immer andere, um ehrenhaft zu sein.16 Zwar kann der Einzelne seine Ehre als naturgemäß gegeben empfinden, doch dieses individuelle Ehrgefühl besteht im Wesentlichen in dem Anspruch an die Mitmenschen, ihm seine Ehrenhaftigkeit zu bestätigen.17 Nur im öffentlichen Raum und im Abschätzen der eigenen Ehre im Vergleich zu anderen, die denselben Anspruch erheben, kann die Ehre des Einzelnen in Kraft treten. Dass jemand überhaupt Ehre innehat, ist also weitgehend, wenn nicht gänzlich abhängig von der Zuschreibung durch andere. Die hohe Bedeutung der Öffentlichkeit gründet in der Bereitstellung eines Raumes, in dem die öffentliche Meinung gebildet und artikuliert werden kann. Grundsätzlich ist der öffentliche Raum den Männern vorbehalten. Als weiterer vormoderner, die Ehre begünstigender Umstand ist deshalb die streng patriarchale Gesellschaft zu nennen. Die Lebenswelt der Frauen ist auf den häuslichen Bereich begrenzt und überschneidet sich kaum mit den Wirkungskreisen der Männer, die sich im öffentlichen Raum behaupten müssen. Beide Geschlechter agieren entsprechend ihrer geschlechtsspezifisch gefassten Ehre. Ihre Rollen und sozialen Räume ergänzen sich komplementär.18 Schon diese beiden Bedingungen ehrenhafter Gesellschaften verdeutlichen, dass Ehre nicht nur bestimmte gesellschaftliche Strukturen erfordert, sondern dass diese Strukturen auch ihr Fortdauern gewährleisten können. Das Wechselverhältnis zwischen bestimmten gesellschaftlichen Grundgegebenheiten wie einer Face-to-face-Gesellschaft und patriarchalen Strukturen auf der einen Seite und der Ehre als dem sozial wichtigsten Wert auf der anderen Seite wirkt auch in umgekehrter Richtung: Ehre trägt zur Erhaltung 15 Der Terminus »Öffentlichkeit« wird hier in seiner alltäglichsten Bedeutung verwandt. Er bezieht sich auf jene Orte, zu denen kein kontrollierter Zugang besteht, wo also potentiell jeder sich aufhalten und angetroffen werden kann. Zu denken ist hier vor allem an Straßen und Plätze, die als Versammlungsorte der Männer in mediterranen Gesellschaften eine große Rolle spielen. Bezogen auf die athenische Gesellschaft steht der Begriff der »Öffentlichkeit« als männlicher Domäne auch im Gegensatz zum »Oikos«, dem sozialen Raum der Frauen. 16 Vgl. Bourdieu, Entwurf, 26: »Das Gefühl der Ehre wird vor den anderen gelebt.« Ähnlich Campbell, Honour, 304-306; Davis, People, 94; M. Dinges, Die Ehre als Thema der historischen Anthropologie, in: K. Schreiner und G. Schwerhoff (Hg.), Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Köln 1995, 29-62, 50; C. Giordano: Mediterrane Ehrvorstellungen: archaisch, anachronistisch und doch immer aktuell, in: Soziologisches Jahrbuch 7,2 (1991), 113-138, 123ff.; Herzfeld, Poetics, 56-67; Schneider und Schneider, Culture, 88ff.; L. Vogt, Ehre in traditionalen und modernen Gesellschaften, in: dies. und A. Zingerle, Ehre. Archaische Momente in der Moderne, Frankfurt a.M. 1994, 291-314, 296. 17 Boulay, Portrait, 108. 18 Vgl. Bourdieu, Entwurf, 35-43; Campbell, Honour, 274-280; Peristiany, Village, 182.
18
Einleitung
bestimmter gesellschaftlicher Umstände bei. Dem nimmt auch die Tatsache nichts, dass der Begriff der Ehre, versuchte man ihn inhaltlich zu füllen, sich nicht als Garant einer bestimmten Ordnung der mit ihm verbundenen Werte erweist. Im Gegenteil ist der Inbegriff dessen, was unter Ehre verstanden wird bzw. was Ehre ausmacht, sehr variabel und von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Ehre kann nicht einheitlich mit bestimmten Werten oder Idealen verknüpft werden, deren Befolgung automatisch zu Ehre führen würde.19 Weder charakterliche Tugenden, noch die Geschlechtsidentität, die Herkunft oder der soziale Status einer Person gewährleisten sui generis das Innehaben von Ehre. Diese Faktoren können die Ehre einer Person fördern oder beeinträchtigen, aber nicht wirklich inszenieren.20 Ehre konstituiert sich auf der Bühne des öffentlichen Raumes über den sozialen Konsens. Deshalb werden persönliche Eigenschaften erst durch ehrenhafte Handlungen, an denen sie ursächlich oder resultativ beteiligt sein mögen, wirksam. Der Erfolg der Ehre als einem sozialen Ordnungsfaktor resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass Ehre als persönliches Attribut erst in der Zuschreibung durch andere real wird. Funktional verbindet Ehre die Werte einer Gesellschaft mit ihrer sozialen Struktur und bewirkt dadurch idealiter bei ihren Mitgliedern die Akzeptanz der sozialen Ungleichheiten.21 Das Wechselverhältnis zwischen dem Anspruch einer Person auf Ehre und der 19 So beziehen sich Definitionen von Ehre eher auf ihre formalen als ihre inhaltlichen Aspekte. Nach Campbell, Honour, drückt der Begriff die Idee des Wertes aus: »social worth evaluated in a complex of competing groups and individuals«, 268; H. Reiner, Ehre, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Darmstadt/Basel 1972, 319-326: »Die Grundbedeutung ... des Begriffs war...: im Zusammenleben gegenüber einem anderen durch Wort und Tat bekundetes Ansehen oder Achtung.«, 319; Schneider und Schneider, Culture, 86: »Generally speaking, honor refers to a person’s worth as judged by others. One’s virtue, dignity, morality, and status constitute one’s honor.«; Vogt und Zingerle, Aktualität, 9 sprechen von einer »Chiffre für Universalien des gesellschaftlichen Lebens«; J. Pitt-Rivers, Honor, in: International Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 5, New York 1968, 503-510 verzichtet gänzlich auf eine Definition. 20 Über den Einfluss des materiellen Status auf die Ehrenhaftigkeit einer Person etwa bestehen in verschiedenen Gesellschaften divergente Auffassungen. Sie hängen ab von der Quelle des Reichtums einer Person und von der ihr zugesprochenen Möglichkeit, trotz materieller Zwänge ein ehrenhaftes Verhalten an den Tag zu legen. Die Kabylen etwa sind der Auffassung, dass »Armut ganz und gar nicht im Widerspruch zur Achtbarkeit steht oder diese ausschließt, sondern im Gegenteil das Verdienst dessen, der besonders stark der Gefahr der Beleidigung ausgesetzt ist und sich trotz allem Respekt zu verschaffen weiß, nur noch vergrößert«, so Bourdieu, Entwurf, 34. Die Sarakatsani betrachten das Verhältnis zwischen Reichtum und Ehre ebenso logisch vom entgegen gesetzten Standpunkt aus: »A poor man is dependent on others for employment, or favours, if his family is to survive. He is not in a position to insist upon an equality in honour which, in any case, the community will not allow him«, Campbell, Honour, 273, vgl. ebd., 298-300. Die Ehre eines reichen Mannes allerdings, dies sei angemerkt, wird nicht auf dieser grundsätzlichen Ebene diskutiert. Er hat indes andere Möglichkeiten, sich durch sein Verhalten zu diskreditieren. 21 Pitt-Rivers, Status, 36-38; ders., Honor, 503; Zingerle, Vorüberlegungen, 32; vgl. Frevert, Mann, 169-176.
Der Begriff der Ehre
19
Bestätigung der Berechtigung dieses Anspruchs durch andere Personen spielt dabei eine zentrale Rolle.22 Zwischen ihnen vermittelt das ehrenhafte Verhalten, das von beiden Seiten als solches interpretiert werden muss. Jene Verhaltensweisen, die mit dem Prädikat der Ehrenhaftigkeit versehen sind, werden zu bevorzugten Handlungsalternativen, weil sie mit der Sicherung oder Erhöhung des sozialen Status belohnt werden. Auf diese Weise legitimiert sich soziale Ungleichheit durch Ehre: Einerseits ist das Innehaben von Ehre Indikator für gesellschaftlich gutgeheißenes Verhalten, andererseits bewirkt Ehre als soziales Konstrukt die Anerkennung einer nicht mehr in Zweifel zu ziehenden Überlegenheit bestimmter Personen.23 Um einen legitimen Anspruch auf Ehre stellen zu können, müssen sich die Mitglieder solcher Gesellschaften ein ehrenhaftes Verhalten an den Tag zu legen. Entscheidend ist das Wie, d. h. in welcher Form sich jemand verhält, weniger, was er aus welchem Grund tut. Die Vorstellung von Ehre geht einher mit einem sozialen Wissen darum, wie ehrenhafte Interaktion sich abspielt. Die Kriterien dafür sind formaler Natur und auf verschiedene Situationen übertragbar. Es gibt einige charakteristische habituelle Formen, welche die ehrenhafte Kommunikation und Interaktion strukturieren und als solche kenntlich und interpretierbar machen.
22 Pitt-Rivers, Status, 22, bringt das Wechselverhältnis auf die Formel: »Honour felt becomes honour claimed and honour claimed becomes honour paid.«, vgl. Campbell, Honour, 291 und Bourdieu, Entwurf, 27f., der den Zusammenhang eher auf philosophisch-psychologischer Ebene beschreibt: »Das Ehrgefühl ist das Fundament einer Moral, in der der Einzelne sich immer unter dem Blick der anderen begreift, wo der Einzelne die anderen braucht, um zu existieren, weil das Bild, das er sich von sich selbst macht, ununterscheidbar ist von dem Bild von sich, das ihm von den anderen zurückgeworfen wird.« 23 Bourdieu, Sinn, 236f.; Pitt-Rivers, Honor, 507f.; Vogt und Zingerle, Aktualität, 18. Tatsächlich beruht die Akzeptanz der sozialen Überlegenheit ehrenhafter Personen nicht unwesentlich auf der Faktizität der Macht. Hier kommen jene sekundär statusbildenden Faktoren ins Spiel, die Ehre befördern können. Sie mögen realiter für eine soziale Vorrangstellung verantwortlich sein, legitimiert wird diese jedoch durch die Ehre. Denn wenn ehrenhaftes Verhalten das Kriterium für einen hohen sozialen Status ist, so gilt umgekehrt, dass sich Personen, die einen hohen sozialen Status haben, ehrenhaft verhalten, vgl. Pitt-Rivers, Status, 23: »If honour establishes status, the converse is also true, and where status is ascribed by birth, honour derives not only from individual reputation but from antecedence.« Unter dieser Prämisse wird Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – offensichtlich privilegiert sind, ein ehrenhaftes Verhalten unterstellt, womit wiederum das einzige Kriterium erfüllt ist, nach dem jemand Ehre innehat. Solange die mit der Idee von Ehre verbundene Vorstellung der natürlichen Überlegenheit ehrenhafter Personen besteht, wird ihr Führungsanspruch als selbstverständlich, weil durch ihre besonderen Fähigkeiten legitimiert, akzeptiert. Aus diesem Grunde erweist sich eine durch Ehre strukturierte Gesellschaft als sehr stabil. In diesem Konstruktcharakter von Ehre gründet andererseits auch die Möglichkeit der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse: Da die Vorstellung und Zuschreibung von Ehre auf dem Konsens aller Mitglieder einer Gesellschaft beruht, ist genau dies der einzige Weg sie umzudefinieren.
20
Einleitung
3. Die Vorstellung der Ehre und die Ordnung der Polis Diese habituellen Formen lassen sich regelmäßig in nahezu allen durch Ehre strukturierten Gesellschaften ausmachen. Es sind jene Besonderheiten, die Anthropologen bevorzugt beschreiben, wenn sie die typische Dynamik des sozialen Miteinanders aufzeigen wollen. Einerseits, weil sie sich phänomenologisch gut beobachten und wiedergeben lassen, andererseits, weil sie die auffälligsten Andersartigkeiten zu modernen Gesellschaften bilden. Sie ergeben sich logisch aus der Vorstellung von Ehre und aus der Funktionsweise ihres Konzeptes. Deshalb können sie als Kriterien für ehrenhaftes Verhalten identifiziert und als in jeder ehrenhaften Gesellschaft präsent angenommen werden. So auch in der ehrenhaften Gesellschaft der Athener im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Um die Bedeutung der Ehre für die Athener festzustellen, sind die habituellen Formen ehrenhaften Verhaltens aufzudecken. Das oben entwickelte Konzept der Ehre als sozialer Norm, die bestimmte Handlungen favorisiert hat den Zweck, jene Verhaltensmuster identifizieren zu können, die durch Ehre geprägt sind. Es setzt einige klar umrissene gesellschaftliche Bedingungen voraus, die relativ problemlos auf die Antike übertragen werden können. So handelt es sich bei der athenischen Polis zweifellos um eine relativ autonome soziale Einheit, die als Face-to-face-Gesellschaft klassifiziert werden kann,24 in der die Öffentlichkeit damit eine große Rolle spielt und die streng patriarchal organisiert ist. Diese gesellschaftlichen Grundbedingungen stellen die athenische Gesellschaft in eine Reihe mit anderen ehrenhaften Gemeinwesen. Die Prämisse, dass die Athener sich ehrenhaft verhielten, rechtfertigt sich zunächst hieraus. Das ehrenhafte Verhalten und die spezifische Ausprägung von Ehre bei den Athenern gilt es im Folgenden zu belegen. Im Gegensatz zu anderen ehrenhaften Gesellschaften steht in der athenischen die politische Ordnung in hohem Ansehen und prägt das alltägliche, soziale Leben der Athener. Die demokratische Polis wird von einer großen Mehrheit der Bürger mitgestaltet und ihre Gesetze und normativen Anfor24 Gegen den Einwand, dass die Einwohner Athens für eine Face-to-face-Gesellschaft zu zahlreich waren, lassen sich zwei Argumente anführen: Erstens erfolgte die Sozialisation der einzelnen Athener in den Demen, so dass die Erfahrung, in einer überschaubaren sozialen Einheit zu leben, fest verankert gewesen sein muss. Und zweitens sind es auf Polisebene die immergleichen Bürger, die in den Quellen genannt werden und notorisch von sich reden machen, so dass sie jedermann bekannt sein müßten. Ähnlich argumentiert D. Cohen, Introduction, in: ders. (Hg., unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner), Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen, München 2002, V-IX.
Die Vorstellung der Ehre und die Ordnung der Polis
21
derungen sind das Produkt gemeinschaftlicher Überlegungen und Entscheidungen.25 Dementsprechend groß ist die normative Kraft der Polis in ihrer demokratischen Verfasstheit. Den Athener galten gleichermaßen der Wert der Ehre wie auch die demokratische Polis als normative Bezugspunkte. Die Ehre und die Polis bildeten für einen einzelnen Athener und für den Oikos, den er repräsentierte, die übergeordneten sinnstiftenden Einheiten, in deren Kontext er sich durch ein entsprechend normgerechtes Verhalten zu stellen suchte. In diesem Sinne werden die demokratische Polis und der Wert der Ehre als konkurrierende Loyalitäten aufgefasst: beide stellen normative Ansprüche an das Verhalten eines athenischen Bürgers. Verkürzt wird deshalb im Folgenden von der ›Norm der Ehre‹ und der ›Norm der Polis‹ die Rede sein, denn als Regelwerke, aus denen soziale Normen entstehen, werden Ehre und Polis hier gegenüber gestellt.26 In einigen Fällen favorisieren Ehre und Polis so unterschiedliche Handlungen, dass sie unmöglich beide befolgt werden können, und in anderen Fällen trägt ein bestimmtes Verhalten den normativen Ansprüchen beider Rechnung. Letztere sind die unkomplizierteren Situationen, sowohl was den theoretischen Erklärungsbedarf, als auch was die Entscheidung des einzelnen athenischen Bürgers angeht. Von größerem Interesse sind erwartungsgemäß jene Handlungen, die einen Konflikt beider Normen verdeutlichen. Speziell in solchen Fällen soll geklärt werden, ob die Athener sich eher zur Ehre oder zur Polis loyal verhielten oder ob und wie sie beides zu verbinden suchten. Um die beiden normativen Ordnungen voneinander abzugrenzen, werden im Folgenden die habituellen Formen oder Verhaltensmuster, deren Beachtung einen Ehrenmann ausmacht, in Beziehung zur Polis gesetzt. Einige kooperative, verbindliche Verhaltensmuster kennzeichnen nicht nur einen Mann von Ehre, sondern auch einen guten Polisbürger. Allgemein gehören auf die Seite der Ehre jene Verhaltensnormen, die eine Person als kampftüchtig und überlegen erweisen, auf die Seite der Polis jene, die die Gemeinschaft stärken und ein friedliches Zusammenleben befördern. In Anlehnung an A.H.W. Adkins kann man bei dieser Kategorisierung auch von kooperativen und kompetitiven Werten sprechen.27 Ähnlich unterscheidet 25 Vgl. K. Ferla, Von Homers Achill bis zur Hekabe des Euripides. Das Phänomen der Transgression in der griechischen Kultur, phil. Diss. phil., München 1996, 301: »Der Raum und der Garant für eie [sic] Realisierung der Rechtswege und das Agieren der Gruppen nach bestimmten Regeln ist die Polis; sie setzt Regeln und achtet auf deren Einhaltung.« 26 Der Begriff »Normen« soll nach Luhmann die generalisierten und verfestigten Erwartungen bezeichnen, an denen auch in vereinzelten Enttäuschungsfällen kontrafaktisch festgehalten wird, vgl. N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M. 1984, 436-452. 27 A.H.W. Adkins, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values, Oxford 1970, 6-7.
22
Einleitung
G. Herman zwischen einem »tribal code« und einem »civic code« des Verhaltens in der athenischen Gesellschaft.28 Die Orientierung an den Normen der Polis resultiert in einer Demonstration der eher kooperativen habituellen Formen, während die Norm der Ehre eher kompetitive Verhaltensmuster favorisiert. Der Begriff der Ehre umfasst sowohl gemeinschaftsstiftende als auch gemeinschaftsschädliche Normen und wird ergänzt durch die Ordnung der Polis mit ihren Gesetzen und Normen. Während der Ausbildung der demokratischen Polis, so die Hypothese, wurden die eher kooperativen Verhaltensmuster der Ehre durch die neue Ordnung vereinnahmt. Die Polarisierung zwischen der Ehre und der Polis resultierte aus der Notwendigkeit der neuen politischen Ordnung, die Norm der Ehre dort zu begrenzen, wo sie asoziale Handlungen empfahl, und Normen zu inthronisieren, die ein friedliches Miteinander der Bürger gewährleisten sollten. In Athen stehen die beiden normativen Bezugssysteme in einem größeren Gegensatz als anderswo, weil die demokratische Ordnung nicht per se von Gruppierungen getragen wird, die über ein hohes Maß an Ehre verfügen, wie dies etwa in aristokratisch oder monarchisch verfassten Poleis der Fall ist. Die Unterscheidung zwischen einem Verhalten, das sich an den Normen der Ehre orientiert, und einem, das sich nach den Normen der Polis richtet, hat einen sozialhistorischen Impetus. Die Norm der Ehre prägt in der athenischen Gesellschaft ein Verhaltensmuster, das traditionsgemäß den Mitgliedern der Oberschicht zu Eigen ist. Die durch die Polis gesetzten Normen hingegen werden eher von der Mehrheit der einfachen Bürger getragen und richten sich unter anderem gegen den überkommenen Anspruch der Adeligen auf eine besonders hohe Ehre. Die Dichotomie zwischen Ehre und Polis ist auch immer eine soziale. Obwohl dieser soziale Aspekt in vielen Fällen von Bedeutung ist, steht er nicht im Vordergrund. Grundsätzlich sind es alle männlichen Bürger Athens, die sich im Spannungsfeld der konkurrierenden Loyalitäten von Ehre und Polis befinden. Denn alle Bürger der Polis Athen verfügen über ein bestimmtes Maß an Ehre und über das athenische Bürgerrecht.29 Sie alle sind sowohl Ehrenmänner als auch Polisbürger, wobei der jeweilige Anteil an beiden Identitäten bei verschiedenen Personen und in unterschiedlichen Situationen stark differieren kann. Für die Ehefrauen dieser athenischen Bürger gilt das in eingeschränktem Sinn: auch sie besitzen eine grundlegende Ehre, die es vor 28 G. Herman, Tribal and Civic Codes of Behaviour in Lysias, in: CQ 43 (1993), 406-419, 408. Die beiden Codes ermöglichen Herman die Verteilung der widersprüchlichen Aussagen des Eratosthenes in Lysias’ erster Rede auf eine primitive und eine zivilisierte Position. 29 Vgl. Campbell, Honour, 295: »The quality of being honourable has this in common with honour, that most men are assumed to have it. It is not something which must be competed for, but something which must not be lost.«
Die Vorstellung der Ehre und die Ordnung der Polis
23
allem nicht zu verlieren gilt, und haben das Bürgerrecht in passiver Form inne. Die übrigen Bevölkerungsgruppen Athens sind nicht mit diesen Privilegien ausgestattet. Um das Verhältnis zwischen Ehre und Polis auf der Ebene des Verhaltens derer zu beleuchten, die in beide normativen Ordnungen eingebunden sind, wird sich diese Arbeit auf die Bürger und Bürgerinnen Athens konzentrieren. Der größte Teil der Forschung zur Ehre in klassischer Zeit bezieht sich auf die Rolle der traditionell sehr ehrenhaften Oberschicht Athens im Prozess der Demokratisierung. Auf die Frage, welche sozialen Schichten die Entstehung der athenischen Demokratie maßgeblich vorangetrieben haben, werden im Wesentlichen zwei Antworten gegeben: Die eine betont die Hartnäckigkeit der einfachen Bürger, die der bisherigen Führungselite Stück für Stück das Recht auf Mitbestimmung abgerungen haben.30 Die andere unterstreicht den dominanten Einfluss einer Oberschicht, die weiterhin konstant die führenden Positionen besetzte.31 Beide Versionen ergänzen einander, kehren jedoch die jeweils andere Seite derselben Medaille nach vorne, indem sie die Dynamik der politischen Entwicklung als entweder von oben oder von unten angetrieben sehen. Allein die Kontroverse darum, wer welchen Einfluss auf den Gang der Entwicklung nahm und nehmen konnte, verweist auf die inkonsistenten Elemente innerhalb der athenischen Polis, die aus einer Vermischung der an sich inkompatiblen Normen der demokratischen Polis und der Ehre entstanden sind.32 Forschungsgeschichtlich resultiert daraus die Verteilung der Widersprüche auf eine politische und eine gesellschaftliche Ebene, wobei die politische alle formalen, juristisch und verfassungsmäßig geregelten Rechte umfasst und die gesellschaftliche alle übrigen Rechte, Ansprüche und Normen.33 30 So vor allem M.H. Hansen, Die Athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes. Struktur, Prinzipien und Selbstverständnis, Berlin 1995; ferner P.J. Rhodes, Who Ran Democratic Athens, in: P. Flensted-Jensen, T.H. Nielsen und L. Rubinstein (Hg.), Polis & Politics. Festschrift Mogens Herman Hansen, Kopenhagen 2000, 465-477; J. Bleicken, Wann begann die athenische Demokratie?, in: HZ 260 (1995), 337-364; C. Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt a.M. 19953; J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton 1989. 31 Repräsentativ für das andere Lager: C. Starr, The Aristocratic Temper of Greek Civilization, New York 1992; J. Roberts, Aristocratic Democracy. The Perseverance of Timocratic Principles in Athenian Government, in: Athenaeum 64 (1986), 355-369; H.-J. Gehrke, Zwischen Freundschaft und Programm. Politische Parteiung im Athen des 5. Jahrhunderts, in: HZ 239 (1984); J. Martin, Von Kleisthenes zu Ephialtes. Zur Entstehung der athenischen Demokratie, in: Chiron 4 (1974), 5-42; 529-564. Eine vermittelnde Position nimmt E. Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Polisgesellschaft, Stuttgart 1989 ein. 32 K.A. Raaflaub, Equalities and Inequalities in Athenian Democracy, in: J. Ober und C. Hedrick (Hg.), Dêmokratia. A Conversation on Democracies, Ancient and Modern, Princeton, N.J. 1996, 139-174, wägt die Gleichheiten und Ungleichheiten der Bürger in der Polis gegeneinander ab und kommt zu einem »picture full of contradictions«, 159. 33 Vgl. ebd., 154-159; C. Harvey, Two Kinds of Equality, in: C&M 26 (1965),101-146.
24
Einleitung
Die Forschung, die sich direkt mit dem Phänomen der Ehre in der griechischen Gesellschaft befasst, untersucht diese zum einen kultur- bzw. geistesgeschichtlich und zum anderen als gesellschaftlichen Ordnungsfaktor. Auf kulturhistorischem Gebiet waren es vor allem Arthur Adkins34 und Eric Dodds,35 die den Anstoß für eine Debatte um die Kontinuität der homerischen Werte in klassischer Zeit gaben. Ihnen folgten intensive Auseinandersetzungen mit den Normen und Werten der athenischen Gesellschaft sowohl in homerischer als auch in klassischer Zeit. Der homerische Held lässt sich in seinem Verhalten vom Ideal des Ehrenmannes leiten. Bezweifelt wird allerdings, ob ein ehrenhaftes Verhalten wirklich in jeder Situation in seinem Interesse liegen kann und welche Auswirkungen das für die Stabilität der gesamten Gesellschaft hat.36 Denn die Verhaltensnorm der Ehre, das betonen sozialgeschichtlich orientierte Arbeiten, birgt ein enormes Konfliktpotential. Sie verleitet stets zur Überschreitung ihrer eigenen und damit der sozial akzeptierten Regeln. Treten solche Transgressionen auf, dann verfällt der Wert der Ehre als verlässliche Norm rapide, weil die Sicherheit in das erwartbare Verhalten anderer schwindet. Es kann zu einer Dynamik kommen, die sich, von niemandem wirklich intendiert, allein aus der Konfusion der nicht mehr regelgerechten Situation ergibt.37 Ob den Griechen das Ideal der Ehre auch in klassischer Zeit noch erstrebenswert erscheint, ist umstritten. Während sich kulturhistorische Studien mit dem Phänomen der Ehre im Kontext und in Abhängigkeit von anderen Wertsetzungen beschäftigen,38 wird sie in sozialhistorischen Arbeiten vor 34 Adkins, Merit. 35 E.R. Dodds, Die Griechen und das Irrationale, Darmstadt 1970. 36 Vgl. zur Diskussion Campbell, The Greek hero, in: J.G. Peristiany und J. Pitt-Rivers (Hg.), Honor and Grace in Anthropology, Cambridge 1992, 129-149; T. Fatheuer, Ehre und Gerechtigkeit. Studien zur Entwicklung der gesellschaftlichen Ordnung im frühen Griechenland, Münster 1988; J.T. Hooker, Homeric Society. A Shame-Culture?, in: G&R 34 (1987), 121-125; H. LloydJones, Ehre und Schande in der griechischen Kultur, in: A&A 33 (1987), 1-28; ders., The Justice of Zeus, London 1973; M. Gagarin, Morality in Homer, in: CPh 82 (1987), 285-306; C.J. Rowe, The Nature of Homeric Morality, in: C. Rubino und C.W. Shelmerdine (Hg.), Approaches to Homer, Texas 1983, 248-275; A.H.W. Adkins, Values, Goals, and Emotions in the Iliad, in: CPh 77 (1982), 292-326; J.-C. Riedinger, Remarques sur la TIμ» chez Homère, in: REG 89 (1976), 244-264; D.M. MacDowell, '!RET» and Generosity, in: Mnemosyne, Ser. 4, 16 (1963), 127-134. 37 Ferla, Achill, 34, bringt das grundsätzliche Dilemma auf den Punkt: »Schwierig wird die Umsetzung dieses Ideals [der Beste zu sein und über den anderen zu stehen, C.B.] erst, wenn dessen Träger nebeneinander auf engstem Raum aufeinander treffen und ein gemeinsames Ziel Zusammenarbeit verlangt.« Vgl. E. Flaig, Tödliches Freien. Penelopes Ruhm, Telemachs Status und die sozialen Normen, in: Historische Anthropologie 3 (1995), 364-388; R. Friedrich, The Hybris of Odysseus, in: JHS 111 (1991), 16-28. 38 Vgl. die entsprechenden Abschnitte, die etwa K.J. Dover, Greek Popular Morality. In the time of Plato and Aristotle, Berkeley/Los Angeles 1974, 226ff. oder L. Pearson, Popular Ethics in Ancient Greece, Stanford 19662, 161ff. neben der Untersuchung der verbreiteten Einstellung zu Gerechtigkeit, Freundschaft oder moralischer Verantwortung der Ehre widmen. Evangelos Alexi-
Die Vorstellung der Ehre und die Ordnung der Polis
25
allem als ein sozialer Ordnungsfaktor behandelt, auf dem die Überlegenheit der Oberschicht basiert.39 Die Beurteilung der Ehre als weiterhin wirkungsmächtigem Faktor ist dabei Konsens. Offen bleibt, in welchem Ausmaß dies der Fall ist, und wie und warum sie sich mit den neuen Ordnungskriterien der Demokratie verträgt. Besonders eingehend haben sich David Cohen40 und Gabriel Herman41 mit dem Verhältnis von Polis und Ehre befasst. Beide fragen nach der Rolle ehrenhaften Verhaltens in der athenischen Gesellschaft in klassischer Zeit. Auf der Basis anthropologischer, empirischer Studien zu verschiedenen Gesellschaften entwickeln beide sehr ähnliche erkenntnisleitende Interessen. Es geht ihnen um die in der athenischen Gesellschaft vorherrschenden Verhaltensmuster im Konfliktfall und um die damit zusammenhängende Frage der Gewalt in der athenischen Gesellschaft. Trotz identischen analytischen Bezugsrahmens und derselben Quellen gelangen sie zu diametral entgegen gesetzten Thesen, deren Unvereinbarkeit miteinander beide vehement vertreten.42 Cohen kategorisiert die athenische Gesellschaft, nicht zuletzt mit Rekurs auf die Definitionen und Theorien des Aristoteles zur Ehre und zur Hybris, als eine ehrenhafte.43 Entsprechend gestalte sich das Konfliktverhalten in Athen, das vergeltende, rächende Züge hat, wie sie typisch sind für eine ou, Ruhm und Ehre. Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates, Diss. phil., Heidelberg 1995 hat die Forschungslücke erkannt, kommt aber lediglich zu dem Ergebnis, dass die FILOTIμ…A (die Ruhm und Ehre umfaßt) für Isokrates ein ethisches Ideal darstellt, das er auch den Athenern zu vermitteln sucht. 39 So generell in Studien, die die Kontinuität der aristokratischen Einflussnahme thematisieren, s. Anm. 31 und jene, die die inneren Strukturen der adeligen Oberschicht analysieren, vgl. W. Donlan, The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Attitudes of superiority from Homer to the end of the fifth century B.C., Lawrence, Kan. 1980; M.T.W. Arnheim, Aristocracy in Greek Society, London 1977. 40 Cohen, Introduction, V-IX; ders., Democracy and Individual Rights in Athens, in: ZRG. Rom.Abt. 114 (1997), 27-44; ders., Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge 1995; ders., Honor, Feud, and Litigation in Classical Athens, in: ZRG.RomAbt. 109 (1992), 100-115; ders., Law, Sexuality, and Society, Cambridge 1991; ders., Demosthenes’ Against Meidias and Athenian Litigation, in: M. Gagarin (Hg.), Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln 1991, 155-164. 41 G. Herman, Reciprocity, Altruism, and the Prisoner’s Dilemma: The Special Case of Classical Athens, in: C. Gill, N. Postlethwaite und R. Seaford (Hg.), Reciprocity in Ancient Greece, Oxford 1998, 199-225; ders., Ancient Athens and the Values of Mediterranean Society, in: Mediterranean Historical Review 11 (1996), 5-36; ders., Honour, Revenge and the State in FourthCentury Athens, in: W. Eder (Hg.), Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Vollendung oder Verfall einer Verfassungsform?, Stuttgart 1995, 43-66; ders., How Violent was Athenian Society?, in: R Osborne und S. Hornblower (Hg.), Ritual, Finance, Politics, Oxford 1994, 99117; ders., Codes. 42 Vgl. G. Herman, Rez. David Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens, in: Gnomon 70 (1998), 605-615. 43 Cohen, Law, 61-70.
26
Einleitung
ehrenhafte Gesellschaft. Cohen zufolge verlagern sich die nach den sozialen Mechanismen der Ehre verlaufenden Konflikte in Athen auf die juristische Ebene. Das Gerichtswesen ersetzt und erweitert das Repertoire der ehrenhaft sich streitenden Männer.44 Das ehrenhafte Konfliktverhalten der Athener ändert sich nicht wesentlich, es integriert mit den Geschworenengerichten lediglich neue Mittel der Auseinandersetzung in den Streit unter Ehrenmännern: »Each party in these battles used the legal system as one means of harassing, attacking, or intimidating his opponent in a series of challenges and responses whose dynamic is driven by an agonistic ethos which aims at the enhancement of honor, status, and power.«45 Herman hingegen rückt die Merkmale der athenischen Polis in den Vordergrund, die unvereinbar sind mit dem individuellen, agonalen, zur Rache neigenden Ehrstreben der Athener, und verlegt letzteres in die Vergangenheit. Mit Blick auf andere Gesellschaften der gleichen oder früherer Epochen gelangt Herman zu der These, dass es sich bei den Athenern um eine bemerkenswert friedliche Gesellschaft gehandelt habe, die in ihrem Konfliktverhalten auffallend wenig aggressiv gewesen sei: »democratic Athens turns out to be a most atypical Mediterranean society. The threshold for taking offence was here expected to be high, and responses to insult or injury were expected to be mild. The victim of aggression was expected rationally to subordinate his behaviour to considerations of communal utility: rather than reacting impulsively and violently, he was expected to forbear, to exercise self-restraint, to reconsider or re-negotiate the case, and to compromise.«46 Beide Forscher kämpfen mit den Prämissen ihrer Arbeiten: Weil Cohen eine wirkungsmächtige Vorstellung von Ehre zugrunde legt, dominiert diese die gesamte klassische Zeit in einer Weise, dass weder die festere Einbindung der Konfliktführung in die Polis noch einzelne Akteure an den
44 Cohen, Law, 183: »The legal relations embodied in a lawsuit or prosecution, it is argued, are seen as being to a significant degree merely an extension of long-term competitive and feuding relations between the parties. The court ... merely provides another resource for enmity to draw upon, another arena where conflict may be pursued, where violence and revenge may be legally sanctioned.« 45 Cohen, Honor, 115. 46 Herman, Athens, 30-31; vgl. ders., Reciprocity, 221f.: »Foreshadowing the Christian ideal of self-renunciation in the name of God, the Athenian moral climate fostered self-abnegation in the name of the state.«
Die Athener als Ehrenmänner
27
strukturellen Mustern des Verhaltens etwas ändern können.47 Herman auf der anderen Seite geht von einer raschen Lernfähigkeit und Entwicklung der athenischen Gesellschaft aus und klassifiziert aus diesem Grunde alle Spuren ehrenhaften Verhaltens als überlebt. Die Standpunkte von Cohen und Herman verdeutlichen die beiden Pole, zwischen denen das Verhalten der Athener sich abspielt. Offenbar orientieren sich athenische Männer, insbesondere in Konfliktsituationen und vor Gericht, sowohl an der Norm der Ehre als auch an der Norm der Polis. Es existieren darüber hinaus weitere Lebensbereiche, in denen ehrenhafte Handlungen das Mit- und Gegeneinander in der athenischen Gesellschaft strukturieren.
4. Die Athener als Ehrenmänner Habituelle Formen konstituieren das eigentliche Ehrverhalten und machen seine Dynamik aus. Ungeachtet der übrigen Interessen und Ziele einer Person binden sie ihr Verhalten in das Konzept der Ehre ein. Der Vorzug der habituellen Formen besteht in ihrer Anwendbarkeit auf die verschiedensten sozialen Situationen, weil sie nicht einzelne Verhaltensweisen vorgeben, sondern nur den generellen Habitus.48 In diesem Sinne besteht für jede potentiell ehrenhafte Handlung ein weiter Möglichkeitsraum der Aktualisierung,49 sowohl für den Akteur in der Wahl seiner Handlungen als auch für den Rezipienten in der Interpretation dieser Handlungen und in der Wahl seiner Reaktion darauf. Das Ausmaß des Spielraumes ist abhängig vom Ehrenstatus der beteiligten Personen und von der beiderseitigen Einschätzung der gegebenen Situation. Das macht die soziale Interaktion in ihrer Grundstruktur erwartbar und zugleich in ihrer spezifischen Ausprägung unberechenbar für den Einzelnen. In dieser Spannung zwischen der Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten von Ehre und einem fest gefügten normativen Rahmen steht jegliche öffentliche Handlung. 47 Die Wortwahl, mit der Herman die These Cohens auf den Punkt bringt, lässt das anklingen: »What C. seems to be saying is this: scratch court rhetoric, and you’ll find patterns of feuding behaviour underneath«, Herman, Rez. Cohen, 610. 48 Bourdieu, Entwurf, 31: »Was man das Ehrgefühl nennt, ist nichts anderes als die kultivierte Disposition, der Habitus...« 49 Ebd. im Anschluss: »...der Habitus, der jedes Individuum in die Lage versetzt, von einer kleinen Anzahl implizit vorhandener Prinzipien aus alle die Verhaltensformen (meine Hervorhebung, C.B.), und nur diese, zu erzeugen, die den Regeln der Logik von Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung entsprechen, und zwar dank eines solchen Erfindungsreichtums, wie ihn der stereotype Ablauf eines Rituals keineswegs erfordern würde. Mit anderen Worten: Wenn man auch für jede Wahl zumindest retrospektiv eine Erklärung geben kann, so bedeutet das jedoch nicht, dass jede Verhaltensform voll und ganz voraussehbar wäre, so wie bei einem Ritus die einzelnen Handlungen sich in die völlig stereotypen Sequenzen einfügen müssen.«
28
Einleitung
Für das Verhalten eines Ehrenmannes, der zugleich Bürger der athenischen Polis ist, bedeutet das einen doppelten Anspruch an seine Loyalität, die sowohl von der Norm der Ehre als auch von der Norm der Polis gefordert wird. Das Verhalten eines Atheners, der über Ehre verfügt, sollte sich durch ehrenhafte Verhaltensmuster, d.h. durch die Beachtung der habituellen Formen auszeichnen, ohne die Normen der Polis zu vernachlässigen. Die Art und Weise, wie die Athener die beiden normativen Anforderungen austarierten, hing auch von den Möglichkeiten des sozialen Kontextes ab und soll deshalb in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen beobachtet werden. Ausschlaggebend für die Wahl der einzelnen Bezugsfelder in dieser Arbeit war die Wahrscheinlichkeit, mit der dort ein ehrenhaftes Verhalten am ehesten zu finden und nachzuweisen sein würde. Einzig ein chronologisch abweichendes Kapitel zu Homer soll einen Eindruck davon vermitteln, wie die homerischen Ehrenmänner, die als Vorbild und Ideal der Athener in klassischer Zeit fungierten, sich mit ihren Handlungen an den habituellen Formen der Ehre orientieren. Die anderen, sachsystematisch angelegten Kapitel der Arbeit konzentrieren sich jeweils auf einen Lebensbereich, in dem bestimmte habituelle Formen der Ehre besonders wichtig sind und in dem ihre Ausprägung folglich gut beobachtet werden kann. Es geht um soziale Kontexte, die typischerweise ein besonders ehrenhaftes Verhalten erfordern oder aber ein dezidiert demokratisches, das der Norm der Polis gerecht wird. Das Bild der athenischen Polisbürger als einer ehrenwerten Gesellschaft setzt sich aus mehreren Wirkungsbereichen der Ehre zusammen. Die wichtigste habituelle Form für einen Ehrenmann ist das agonale Verhalten. Da sich die Ehre einer Person beständig gegen die der anderen potentiell ehrenhaften bewähren muss, wird der öffentliche Raum zur Arena unausgesetzter Rivalitäten zwischen den Männern. Der Kern ehrenhaft agonalen Verhaltens liegt daher in der Herausforderung anderer Ehrenhafter, was sowohl die eigene als auch die Ehre des Herausgeforderten auf die Probe stellt. Weil das Spiel von Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung nur unter an Ehre Gleichen stattfinden kann, stellt die Herausforderung an sich schon eine Anerkennung der Ehre des Gegners dar.50 Die Bewährung des ehrenhaften Status beider Kontrahenten ergibt sich aus ihrer Demonstration des sozialen Wissens um die Regelhaftigkeit des Ablaufs und ihrer Bereitschaft, ihm zu folgen.51 50 Bourdieu, Entwurf, 15-18; Dinges, Ehre, 50f.; Frevert, Mann, 215; D.D. Gilmore, Anthropology of the Mediterranean Area, in: Annual Review of Anthropology 11 (1982), 175-205, 189f.; Giordano, Ehrvorstellungen, 129; Pitt-Rivers, Status, 31: »A man is answerable for his honour only to his social equals, that is to say, to those with whom he can conceptually compete.« 51 Bourdieu, Entwurf, 16; Guttandin, Schicksal, 271.
Die Athener als Ehrenmänner
29
Der Wettbewerb vollzieht sich nach den Regeln der Reziprozität. Sie stellt eine weitere habituelle Form dar. Im Gegensatz zum Agon, der immer ein konfliktreiches Element beinhaltet, hat die Reziprozität als Verhaltensnorm eine kooperative und eine kompetitive Seite. Jede Handlung wird mit einer gleich akzentuierten vergolten. In diesem Sinne ist Freunden freundlich zu begegnen und Feinden feindlich. Funktional bewirkt die Norm der Reziprozität die Solidarität unter an Ehre Gleichen,52 und grenzt andererseits an Ehre Ungleiche voneinander ab. Ein Athener, der sich positiv reziprok verhält, orientiert sich vorbildlich sowohl an der Norm der Ehre als auch an der Norm der Polis. Dagegen verstößt die reziproke Erwiderung einer Ehrverletzung möglicherweise gegen die Norm der Polis, ist aber auf der anderen Seite sehr ehrenhaft. Der Reziprozität als Verhaltensnorm liegt die Vorstellung zugrunde, dass es sich bei der Auseinandersetzung um Ehre um ein Nullsummenspiel handelt: Ein Mehr an Ehre kann immer nur durch das Weniger einer anderen Person gewonnen werden.53 Das Junktim zwischen Ehre und sozialem Status impliziert, dass Ehre demjenigen zukommt, der einem weniger Ehrenhaften überlegen ist.54 Der Reiz der Herausforderung liegt also nicht nur darin, sich als überlegen zu erweisen, sondern zugleich den Kontrahenten in seiner Ehre zu beschneiden.55 Gemäß der Logik des Nullsummenspiels um die Ehre werden Konflikte bewusst provoziert. Eine weitere habituelle Form, die einen Ehrenmann auszeichnet, ist seine Bereitschaft zur Rache. Sie fungiert als ein Mittel der Wiederherstellung von Ehre, wenn die vorausgegangene Ehrverletzung entsprechend gravierend war und das reziproke Ungleichgewicht zwischen zwei Männern nur durch eine drastische Vergeltungsmaßnahme aufgehoben werden kann.56 Wegen ihrer offensichtlich hohen Kosten für beide Seiten und für das Gemeinwesen kommt es selten zu derart radikalen Vergeltungsmaßnahmen wie der Blutrache, verbreiteter sind Akte der rächenden Vergeltung. In diesen Fällen ist ebenfalls von Rache zu sprechen, wenn der Aspekt der Selbstjustiz eine tragende Rolle spielt. Denn Rache hat immer persönlich, unmittelbar und aufsehenerregend zu erfolgen. Etwaige legale, juristische oder institutionalisierte Verfahren zur Erreichung desselben Zwecks, der 52 J. Pitt-Rivers, Postscript: The Place of Grace in Anthropology, in: Peristiany und ders., Grace, 215-246, 218: »Reciprocity is the essence of sociation ... once you have exchanged something, you are related.« 53 D. Gilmore, Honor, Honesty, Shame: Male Status in Contemporary Andalusia, in: ders., Honor, 90-103, 90. 54 Pitt-Rivers, Status, 23: »The claim to excellence is relative. It is always implicitly the claim to excel over others. Hence honour is the basis of precedence.« 55 Detel, Macht, 187. 56 Bourdieu, Entwurf, 33f.; Schneider und Schneider, Culture, 88; S.N. Khalaf, Settlement of Violence in Bedouin Society in: Ethnology 29 (1990), 225-242, 227f.
30
Einleitung
Schädigung des Gegners etwa, verfehlen ihn. Auch der Rächende hat sich an die Norm der Ehre zu halten, obwohl die Rache in ihrer drastischen Form das Potential der Transgression aller Normen hat. Dabei ist es abhängig von den juristischen und sozialen Regeln einer Gesellschaft, ob Rache als ein transgressorischer Akt beurteilt wird. Je deutlicher sie allein aus den Geboten der Ehre resultiert und eklatant alle anderen Normen verletzt, desto eindrücklicher wird ihr destruktiver Charakter, und desto leichter kann sie die Vorstellung von Ehre ad absurdum führen. Da die Erregung von Konflikten ein festes Element der agonalen Verhaltensnorm bildet, existieren in ehrenhaften Gesellschaften auch immer verschiedene Möglichkeiten der Bewältigung von Konflikten. Sobald die Rivalitäten gemäß der Norm der Ehre ablaufen, greift das Prinzip der Reziprozität, so dass jedem Beteiligten aufgrund der Handlungen seines Gegners klar ist, in welchem Stadium der Konfrontation er sich befindet.57 Die allseits bekannten Regeln für den Ablauf des Konfliktes, die relative Berechenbarkeit der Schritte des Gegners und nicht zuletzt die Interpretationsmacht der öffentlichen Meinung eröffnen die Chance auf eine friedliche Lösung.58 Denn sobald von Seiten der Öffentlichkeit in Aussicht gestellt wird, den Kampf ohne Ehrverlust zu beenden, verliert sich das Motiv für ihn. Allein eine einvernehmlich anerkannte Vermittlungsstrategie kann dies leisten. Die athenische Polis trägt der Tatsache Rechnung, dass das Management von Konflikten für jede Gesellschaft von existentieller Bedeutung ist, indem sie auf juristischer Ebene Mittel zur Beendigung von Konflikten bereitstellt. Die Ansprüche der Polis und der Gesetze an die Streitenden gestalten sich gänzlich anders als die Norm der Ehre. Eine Verhandlung vor Gericht erfordert ein Maß an Versachlichung des Anliegens, an berechnender Abgleichung des eigenen Standpunktes mit der Erwartungshaltung der Zuhörer und an einer Zurückhaltung in den gewalttätigen Aktionen, an derer statt die Gerichtsprozesse treten, das nicht dem Habitus eines Mannes von Ehre entspricht. Wegen einiger strukturell sehr ähnlicher Merkmale sowohl der ehrenhaften als auch der juristischen Art der Konfliktführung speziell in Athen erfreuen sich die Gerichte bei den Bürgern dennoch großer Akzeptanz. Entsprechend gut fassbar ist die Erfüllung der agonalen Verhaltensmuster im Bereich der gerichtlichen Konfliktführung. Obwohl sich die streitenden Parteien in diesen Fällen offensichtlich bereits zu einer juristischen Schlichtung bereit gefunden haben, vermögen die athenischen Gerichtsre57 Dinges, Ehre, 52: »Die Ritualisierung der Herausforderung hat auch gewaltbegrenzende Wirkung, da jeder Kenner der Spielregeln aus Worten und Gesten weiß, wie weit er gehen kann und wann er spätestens aus einem Ehrenhandel aussteigen muss.« 58 Herzfeld, Poetics, 82; M.W. Young, Fighting with Food. Leadership, Values and Social Control in a Massim Society, Cambridge 1971, 222.
Die Athener als Ehrenmänner
31
den doch den sozial akzeptierten Ablauf von Konflikten zu zeigen. Anhand der Verfolgung der einzelnen Stadien einer Auseinandersetzung können die Mechanismen der Konfliktaustragung nachgezeichnet werden. Sie geben Aufschluss über die einzelnen Stationen, die die konkreten Herausforderungen an den Gegner markieren, über die Art der Begründung der Verhaltensweise beider Kontrahenten (zuweilen sogar aus beider Perspektive) und über die Reaktionen beider auf die schon erfolgten und eventuell antizipierten weiteren Schritte des Gegners. Die vor den Geschworenengerichten geschilderten Auseinandersetzungen zeigen, ob die Athener sich in ihrem Verhalten an den Normen der Ehre orientieren, d. h., ob sie ein agonales und reziprokes Verhalten an den Tag legen, das konfliktorientiert ist und auch die Rache nicht scheut. Um das einschätzen zu können, müssen Antworten auf Fragen wie die folgenden gefunden werden: Was wird als eindeutige Konfrontation und Kampfansage interpretiert? Welche Art des Verhaltens stellt die Aufforderung zur unmittelbaren Reaktion des Gegners dar und welche zeitigt zunächst keine Konsequenzen, sondern wird erst im Prozess zitiert, um den aggressiven Charakter des Gegners zu beleuchten? In welchem Maße glaubt ein Angegriffener sich verteidigen zu müssen: Schlägt er auf gleicher Ebene zurück, ist die Erwiderung abhängig vom bisherigen Verlauf des Konflikts oder eilt er gar gleich zum Gericht? Gibt es bestimmte Stadien, in denen eine Schlichtung noch möglich oder wünschenswert erscheint und existiert dementsprechend eine Schwelle, deren Überschreitung die nicht mehr umkehrbare Eskalation eines Konfliktes nach sich zieht? Und schließlich, abgesehen von der Handlungsebene: Mit welchen Werten wird das Verhalten beider begründet: Rekurrieren sie offen auf den Wert der Ehre und ihre handlungsleitende Kompetenz oder ziehen sie zu Felde mit dem Appell an das allgemeine Interesse der athenischen Bürgerschaft als konkurrierender Loyalität? Die athenischen Gerichtsreden sind ideale Quellen zur Beantwortung dieser Fragen. Denn sie geben jeweils den Versuch eines Atheners wider, seine Verhaltensweise durch den öffentlichen Konsens zu legitimieren. Der Kontext der athenischen Gerichtshöfe gewährleistet die dafür erforderliche Öffentlichkeit. Die Anwesenheit idealiter aller athenischen Bürger und die Notwendigkeit, das eigene Verhalten als normgerecht darzustellen, bilden eine direkte Analogie zum Mechanismus der Zuschreibung von Ehre. Dabei richtet sich die Darstellung der eigenen Person und der erfolgten Handlungen in den Reden nach den vermuteten Erwartungen der Rezipienten. Die Redner konstruieren sowohl das Ideal an Normerfüllung durch die eigene Person als auch – bezogen auf den Gegner – den Antityp dazu. Der soziale Raum der athenischen Gerichtshöfe ist dazu angetan, eine Dramatisierung des Geschehens und der Darstellung zu fördern, mit Übertreibungen muss
32
Einleitung
deshalb gerechnet werden.59 Doch auch einige möglicherweise fiktive Elemente beeinträchtigen den Wert der Reden als Quellen nicht: Die Worte der Sprecher vor Gericht spiegeln in einfacher Brechung die konsensfähigen Normen der athenischen Gesellschaft. Zudem bietet diese Quellengruppe den Vorzug der Übereinstimmung von historischer Fragestellung und inhaltlicher Thematik. Die Reden des Demosthenes, Isokrates oder Lysias beschäftigen sich mitunter explizit mit Auseinandersetzungen um die Ehre. Einerseits wird hier deutlich, dass um Ehre sowohl tätlich als auch verbal noch gestritten wird. Andererseits weisen die teilweise sehr langen und detaillierten Beschreibungen der Streitigkeiten auf die Dauer der Konflikte um Ehre hin, die sich nicht in einem einmaligen Schlagabtausch erschöpfen, sondern jene verschiedene Stadien der Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung durchlaufen, die für Ehrkonflikte so typisch sind. Anhand der Schilderungen kann nicht nur der Ablauf der Auseinandersetzungen auf der Handlungsebene verfolgt werden, sondern gerade auch die Begründung für die einzelnen Taten ist von Interesse. Da in manchen Fällen die Evidenz der physischen Attacken schlechterdings nicht geleugnet werden kann, kommt es auf die plausible Interpretation des Geschehens an. Der relativ große Interpretationsspielraum für ehrenvolles Handeln erleichtert die Rechtfertigung. Methodisch garantiert er, dass ein Rekurs auf die Werte der athenischen Demokratie – und nicht auf die Ehre – nicht aus einem Erklärungsnotstand heraus erfolgt, sondern den sozialen Konsens der Mehrheit bei der konkurrierenden Loyalität vermutet. Die agonalen habituellen Formen zeigen sich bei den Athenern auch auf weniger konfliktgeladene, feindselige Weise. Die prestigeträchtigen olympischen Wettkämpfe gehören zu den berühmtesten Agonen, die Ehre der Olympioniken ist legendär. In diesem Umfeld wird Ehre nicht nur als persönliches Attribut behauptet, es geht vielmehr um den Gewinn außergewöhnlicher Ehrungen und Ehre. Ein Mann, der für sich und seine Polis die Ehre durch einen Sieg in diesen Wettkämpfen mehrt, sollte erwartungsgemäß im öffentlichen Leben einer Gesellschaft, die hohe Ehre mit einem hohen sozialen Status versieht, eine bedeutende Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob sportliche Erfolge mit einer hohen politischen 59 Vgl. zu den athenischen Gerichtshöfen als Bühne M.R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore, Maryl. 1998, 167-192, und E. Hall, Lawcourt Dramas: The Power of Performance in Greek Forensic Oratory, in: BICS 40 (1995), 39-58, 57: »But the courts were an arena for competitive social performances. One reason for prosecuting a rival was to provide an opportunity for competing verbally against him in public: successful performance at a trial required identical skills to those required by the dramatic actor – stamina, exciting delivery, vocal virtuosity, memorisation, extemporisation, and the abilities to control the audience, hold its attention, and arouse its emotions.«
Die Athener als Ehrenmänner
33
und sozialen Position einhergehen, und ob sich das Wechselverhältnis kausal oder konsekutiv gestaltet. Gerade auf struktureller Ebene kann das Ereignis der Agone in Olympia zeigen, wie sehr die Vorstellung von Ehre in der athenischen Gesellschaft gepflegt wird. Die athenischen Ehrenmänner, die sich dort produzieren, tun das in Erwartung einer Mehrung ihrer Ehre vor Ort und in der athenischen Polis. Während des olympischen Festes mit seinen für die Ehre eines Mannes so wichtigen Agonen erhält das Verhalten athenischer und überhaupt griechischer Männer besondere Aufmerksamkeit von Seiten der dort anwesenden panhellenischen Öffentlichkeit. In Olympia kann sich deshalb zeigen, wie die habituellen Formen der Ehre gefüllt werden, wenn die athenischen Ehrenmänner nicht eingebunden sind in den politischen Kontext ihrer Polis. Legen sie hier besonders ehrenhafte Handlungen an den Tag? Spiegelt die Organisation der olympischen Agone den sozialen Mechanismus des Erwerbs von Ehre durch agonales Verhalten? Die Quellen, die über das Geschehen in Olympia und die Olympioniken Auskunft geben, fließen reichlich. Dank der Ausstrahlung des Ortes fühlten sich bereits antike Autoren berufen, Siegerlisten aufzustellen oder den Ort selbst zu besuchen.60 Olympische Siege fanden in den Biographien angesehener Männer zuverlässig Erwähnung, so dass auch die griechischen Historiographen von den Ereignissen in Olympia zu berichten wussten.61 Allein die Menge der Quellen kann als Beleg für die Faszination der Athener für ihre Agone, besonders für die Olympischen, gewertet werden. Um einen Agon auf spielerischer Ebene handelt es sich bei Hahnenkämpfen. Da die Spiele einer Gesellschaft gängige Handlungsmuster des sozialen Lebens spiegeln, vermag die Untersuchung der Praxis des Hahnenkampfes in der athenischen Gesellschaft ein Schlaglicht auf die Rivalität unter Männern zu werfen. Die Umsetzung der spielerischen auf die soziale Ebene liegt nahe. Die kämpfenden Hähne fechten stellvertretend für die Zuschauer ihre Agone aus. Das den Vögeln zugeschriebene Verhalten kann deshalb die Vorstellungen der athenischen Männer von einem ehrenhaft geführten Kampf, die für einen Sieg erforderlichen Eigenschaften und das von einem Sieger erwartete ehrenhafte Verhalten verbildlichen. Die Beachtung der Regeln des Spiels und die formalen Kriterien ehrenhaften Verhaltens stehen in Analogie zueinander: Beide bilden die Rahmenbedingungen für Teilnahme und Gewinn.
60 Unschätzbar ist Pausanias’ Reisebericht im fünften und sechsten Buch seiner Periegese, von den Siegerlisten ist vor allem jene des Africanus zu nennen, die in großen Teilen erhalten ist. 61 Herodot berichtet z. B. von den Siegen des Alkmaion, Hdt. 6, 125, und Miltiades, 6, 36; während Thukydides und Plutarch vom Auftreten des Alkibiades in Olympia sprechen, Thuk. 6, 16, 3-4; Plut. Alkibiades 11.
34
Einleitung
Die unspektakuläre Alltäglichkeit des Phänomens von Hahnenkämpfen in Athen spiegelt sich in der Quellenlage. Sporadisch finden sich einige Randbemerkungen oder Einzelaspekte zu diesem Phänomen bei verschiedenen griechischen Autoren.62 Schon den Römern erscheint die Faszination der Griechen für ihre Hähne ein Rätsel; es handelt sich also um einen in Athen verbreiteten, dennoch aber ungewöhnlichen Zeitvertreib. Um zu einigermaßen aussagekräftigen Ergebnissen über die Hahnenkämpfe in Athen zu kommen, ist eine Beschränkung der Quellen auf die klassische Zeit kaum möglich. Einige weitere habituelle Formen hängen eng mit dem öffentlichen Charakter der Ehre zusammen. Da die Ehre einer Person erst vor anderen inszeniert werden muss, um realiter Geltung zu erlangen, hat ehrenhaftes Verhalten stets einen öffentlichkeitswirksamen Impetus. Zugleich prägt das soziale Wissen um die Verhaltensnorm der Ehre bei den Akteuren die Wahrnehmung dieses Phänomens überhaupt. Auch das führt zu einem exhibitionistischen Zug, der allen ehrenvollen Handlungen anhaftet. Daher handelt es sich bei dem öffentlichkeitswirksamen Agieren um eine weitere habituelle Form. Nur ein Verhalten, das von anderen gesehen wird, kann auf dem Konto der Ehre verbucht werden.63 Zusammen mit der nicht wertgebundenen Vorstellung von Ehre legt dieser Umstand den Gedanken einer möglichen Kluft zwischen Norm und Realität nahe. Die eigene Ehre bleibt gewahrt, solange ihre Verhaltensgrundsätze befolgt werden, unabhängig davon, ob dies nur oberflächlich und formal geschieht oder dem Akteur eine Herzensangelegenheit ist.64 Die Trennung zwischen Norm und Realität spiegelt sich in der strikten Aufteilung in öffentliche und nicht-öffentliche Räume, die zugleich die Separation der Geschlechter voneinander markiert. Frauen spielen in der Öffentlichkeit insofern eine große Rolle, als ihre Nichtexistenz dort für die Ehre des Mannes von entscheidender Bedeutung ist. Solange sie auf den Wirkungskreis des Hauses beschränkt bleiben, erfüllen Frauen die ihnen 62 So bezeugt Platon etwa die intensive Beschäftigung seiner Mitbürger mit ihren Hähnen, Plat. leg. 789b-c; Aristophanes zieht eindeutige Parallelen zwischen Hähnen und Männern, Aristoph. Av. 486f., 1368; und Plutarch berichtet, dass auch Alkibiades mit einem Vogel auf der Agora gesehen wurde, Plut. Alkibiades 10. 63 Campbell, Honor, 284: »A family head must strut about as if his affairs are of the greatest consequence. His expression is expected to be severe and proud. Modesty in these circumstances is no virtue but a sign of weakness. Ideally, the claims and assertions of other men must be at least equalled, and preferably surpassed. ... Conversation has a sharp, monosyllabic, contrapuntal quality. It is concerned with self-assertion, not with communication or the exchange of information.« Vgl. Giordano, Ehrvorstellungen, 116; Peristiany, Introduction, 11. 64 Gilmore, Anthropology, 189; Giordano, Ehrvorstellungen, 124-129, 125: »Die herausragende Bedeutung der ›politics of reputation‹ als rationales Kalkül für das geschickte Management von Status, Position und Ehre wirft die Problematik der Rolle von ›Fassade‹ bzw. ›Maske‹ bei Individuen und Gruppen in mediterranen Gesellschaften auf.«
Die Athener als Ehrenmänner
35
zugedachte Rollenerwartung und können der Ehre des Mannes am wenigsten gefährlich werden. Gerade die Rigidität der Frauenrolle macht aber eine Diskrepanz zwischen Norm und Realität wahrscheinlich, da die Erfüllung der Norm für den öffentlichen Bereich enorm wichtig ist, die lebensweltliche Realität der Frauen aber auf das Haus bezogen bleibt.65 Die öffentlichkeitswirksame Ehre von Frauen bestimmt zwar ihr Erscheinungsbild, aber eben nur dies: abseits der Öffentlichkeit kann die Gestaltung ihres sozialen Raumes davon relativ unberührt stattfinden.66 In Athen stellt die Polis den öffentlichen Raum für alle männlichen Bürger her, während der Oikos als der soziale Raum der Frauen gilt. Die Abgrenzung der Polisbürger von allen anderen Gruppierungen der Bevölkerung verstärkte in klassischer Zeit auch die Beschränkung der Frauen auf den Oikos, die zuvor nicht in dem Maße gegeben war. Das ehrenhafte Verhaltensmuster des öffentlichkeitswirksamen Agierens bleibt weitgehend den Männern vorbehalten und zieht sich durch alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Im Zweikampf auf der Straße ist die lautstarke Demonstration männlicher Ehre ebenso präsent wie in Olympia. Der dazu komplementäre nicht-öffentliche Bereich ist die Domäne der Frauen. Ihr Wirkungskreis ist häuslicher Natur, nichtsdestotrotz aber ebenso von der Norm der Ehre geprägt wie das Leben der Männer. Die Norm der Ehre und die Norm der Polis gleichermaßen erwarten ein zurückgezogenes Dasein von den Bürgerinnen. Einige der wenigen Gelegenheiten für die Bürgerfrauen, am öffentlichen sozialen Leben teilzunehmen, bieten kultische Feste, die ausschließlich von Frauen begangen werden. Um einen Kontrast zur agonalen Atmosphäre der männlich dominierten Öffentlichkeit zu bieten, wie sie sich etwa in Olympia ausgeprägt zeigt, sollen die kultischen Feste in den Blick genommen werden, deren Feier ausschließlich den Frauen vorbehalten ist. Charakteristischerweise ist nicht nur in Olympia ein weibliches Pendant zu den männlichen Agonen überliefert; sondern in Athen, wie in vielen anderen Poleis, veranstalteten Frauen bestimmte kultische Feiern, in denen sich ihre Rolle nicht in der komplementären Ergänzung ihrer Männer erschöpfen konnte. Bei den Thesmophoria etwa mit ihrer exklusiv weiblichen Teilnehmerschaft handelt es sich um eine mehrere Tage dauernde Vergesellschaftung von Frauen, die abseits der männlich gesetzten Normen veranstaltet wird. In 65 Vgl. G. Fiume, Introduzione, in: dies. (Hg.), Onore e storia nelle società mediterranee. Atti del seminario internazionale (Palermo 3-5 dicembre 1987), Palermo 1989, 11; U. Wilkan, Shame and Honour: A Contestable Pair, in: Man 19 (1984), 635-652, 642ff. 66 Campbell, Honour, 270: »Her honour depends upon the reputation which the community is willing to concede, not upon the evidence of facts in any case difficult to determine. Therefore she protects her honour most effectively by conforming in every outward aspect of her deportment to a code of sexual shame.«
36
Einleitung
dieser reinen Frauengesellschaft können sich die sozialen Rollen der beiden Geschlechter nicht mehr ergänzen, die Orientierung der Frauen an der Ehre ihrer Männer entfällt. Es wird zu fragen sein, welche Rolle hier die habituellen Formen spielten, und wie sich diese Frauengesellschaften im Verhältnis zu jener der Männer gestaltete. Folgten die Frauen weiterhin ihrem angestammten Rollenmodell, entwickelten sie alternative Mechanismen des sozialen Miteinanders oder orientierten sie sich in ihrem Verhalten an den üblicherweise durch die Männer gezeigten habituellen Formen der Ehre? Dass es auch für Frauen denkbar war, durch siegreiche Agone Ehre für sich zu erringen, belegen die wenigen Teilnehmerinnen in Olympia, denen es gelang, einen Kranz zu gewinnen oder auch nur als Zuschauerin anwesend zu sein. Die Quellen äußern sich selten zu den Frauen überhaupt, und wenn sie es tun, haben die durchweg männlichen Aussagen stark normativen Charakter.67 In der Untersuchung thematischer Komplexe, die den Vorstellungen der männlichen Athener zuwiderlaufen, bleibt man deshalb auf zufällige Informationen angewiesen, wie sie etwa Aristophanes in seinen Thesmophoriazusen anklingen lässt. Die reichlichen Zeugnisse zu den olympischen Agonen hingegen widmen sich auch den weiblichen Wettbewerben bzw. sie berichten anekdotenhaft das Erscheinen von Frauen bei den männlichen Agonen, so dass in dieser Hinsicht genügend Material vorhanden ist. Eine gesellschaftlich in ihrer Wirkung kaum zu überschätzende Eigenschaft der Ehre ist ihr beständiges Oszillieren zwischen Gleichheit und Ungleichheit. Obwohl ehrenhafte Gesellschaften in der Regel hierarchisch strukturiert sind, vermag Ehre doch immer den Anschein von Gleichheit zu wahren, da ehrenhafte Interaktion gewöhnlich die Ehre aller Beteiligten voraussetzt.68 Das Versagen dieses Prinzips bei an Ehre höher oder niedriger Gestellten beruht auf der paradoxen Tatsache, dass diese eben mehr oder minder gleich sind – was der virtuell umfassenden Gleichheit aller Ehrenhaften nichts von ihrer Glaubwürdigkeit benimmt.69 In Athen korrelierte diese Gleichheit bei gleichzeitiger Ungleichheit an Ehre mit der Machtverteilung innerhalb der politischen Ordnung. Auch in der Polis gal-
67 Die normativen Erwartungen an die athenischen Bürgerfrauen zeigt exemplarisch der Oikonomikos des Xenophon; das Verfehlen der Normen und die Konsequenzen die 59. demosthenische Rede Gegen Neaira. Darüber hinaus wird das Nichterscheinen von Frauen in der Öffentlichkeit gerühmt, vgl. Thuk. 2, 45, 2, und entsprechend wenig erwähnt. 68 Pitt-Rivers, Postscript, 242: »in the logic of agon, rivalry is wedded to equality, for one must feel oneself to be the equal of one’s antagonist in order to compete, yet the test of strength aims always to destroy this equality and establish hierarchy: a victor and a vanquished.«; vgl. Giordano, Ehrvorstellungen, 120f. 69 Das Paradoxon kann kaum einprägsamer formuliert werden, als es G. Orwell tut: »All animals are equal but some animals are more equal than others.«, Animal Farm, London 1993, 88.
Die Athener als Ehrenmänner
37
ten alle Bürger als gleich, verfügten aber mitnichten über den gleichen sozialen Status oder dieselben Chancen auf eine politische Karriere. Für die Mitglieder einer ehrenhaften Gesellschaft gilt es, durch die Art ihres Verhaltens das Maß an Ehre zu demonstrieren, das sie glauben beanspruchen zu können. Hier hat der Habitus seinen Platz, der für die Ehre und die ehrenhafte Gesellschaft so wichtig ist. Gegenüber faktisch Ungleichen die eigene Stellung anders als durch feine Unterschiede des Verhaltens deutlich zu machen, ist verpönt.70 Denn die Vorstellung von Ehre enthält immer die Akzeptanz der bestehenden sozialen Strukturen, die in einem fragilen Gleichgewicht zwischen Gleichheit und Ungleichheit schwanken.71 Die Gleichheit bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass sich alle an die Verhaltensnorm der Ehre halten, die Ungleichheit kann auf verschiedenen Faktoren beruhen, wird aber durch den Vorrang an Ehre legitimiert. Die vermeintlich zu Recht ungleich verteilte Ehre sollte sich deshalb allein auf dem Sektor spiegeln, mit dem die Statusungleichheit begründet wird: der Art des ehrenhaften Verhaltens. Um dieses richtigen Verhaltens willen sollte jeder seinen Platz in der Gesellschaft kennen. Glaubt nun jemand, trotz dieser einvernehmlich anerkannten Statusdifferenzen seiner Über- oder Unterlegenheit noch zusätzlich Ausdruck verleihen zu müssen, so fällt er unangenehm auf. Denn offensichtlich – so die Interpretation seiner Mitmenschen – verfügt er nicht über das soziale Wissen um die Norm der Ehre, das sich im rechten Habitus ausdrückt. Die Sozialisation in den durch Ehre geprägten sozialen Strukturen besteht aber gerade in dem Erlernen des Wissens um die eigene Position und um die Art, wie man sich zu verhalten hat.72 Die der Ehre eigene fragile Balance zwischen Gleichheit und Ungleichheit zeigt sich in der athenischen Gesellschaft am ehesten in Situationen, wo sie zu kippen droht. Gefährdet werden kann sie einerseits durch Personen, die ihre Ehre auf Kosten anderer demonstrativer deutlich machen, als dies nötig wäre, und andererseits durch Personen, deren Ehre beschädigt ist und die nicht in der Lage sind, diese wiederherzustellen. Ersterer Fall bezieht sich auf das Phänomen der Hybris als Transgression der durch Ehre gesetzten Normen, letzterer auf eine Beeinträchtigung der Ehre, die sich in Schande und in Atimie ausdrücken kann. Die Schande als perhorreszierter 70 Bourdieu, Entwurf, 16; Campbell, Honour, 304: »In displaying pride a man must behave in such a way as to show that he believes himself to be superior to other persons. It requires a suggestion of presumptuousness, a subtle air of arrogance, that suggests a man is dominating the gathering, and yet does not proceed as far as an insult or open challenge to others.« 71 Campbell, Honour, 267; Gilmore, Anthropology, 189f.; Pitt-Rivers, Postscript, 242. 72 Giordano, Ehrvorstellungen, 122f. spricht von einem »extrem feinen Sensorium der Mitglieder mediterraner Gesellschaften für soziale Stratifikation und im Endeffekt für hierarchische Gliederung.«
38
Einleitung
Zustand des Verlustes an Ehre ist besonders mit der spezifisch weiblichen Ehre verbunden. Hybris spielt in vielen Konflikten um die Ehre eine Rolle und ist vor Gericht ein beliebter Vorwurf an den jeweiligen Gegner. Als Hauptquellen fungieren daher wiederum die Gerichtsreden. In ihnen wird Hybris stets verdammt, der hybride Akt aber selten genau benannt. Offensichtlich bezeichnet er ein interpersonales Geschehen, bei dem die Ehre der Beteiligten eine entscheidende Rolle spielt. Doch selbst das gegen die Hybris erlassene Gesetz klärt nicht, welche Worte oder Handlungen das Vergehen der Hybris konstituieren. Es bleibt zu prüfen, wie die Hybris mit der Norm der Ehre zusammenhängt und ob sie Bestandteil des sozialen Wissens um die Norm der Ehre ist, das keine definitorische Aussage, die sich in den Quellen niederschlagen könnte, erlaubt. Diese Hypothese geht einher mit der Auffassung der Hybris als einer Transgression der internalisierten Normen der Gesellschaft, die durch denselben Konsens, mit dem die Athener ihr Normensystem aufrechterhalten, geahndet werden kann. Wenn dem so ist, welche Funktion hat dann das Gesetz? Aus der entgegen gesetzten Perspektive der nicht eingehaltenen Balance von Gleichheit und Ungleichheit ist das Phänomen der Verletzung von Ehre zu untersuchen. In den Gerichtsreden erscheinen die Beeinträchtigungen der Ehre auf zwei Ebenen, die wiederum auf die beiden polaren Normen der Ehre und der Polis verteilt werden können. Einerseits wird als das Gegenteil von Ehre in den Quellen die Schande genannt, in die eine Person verfällt, wenn sie sich nicht normgerecht verhält, und andererseits kann die Unehre als von der Polis verhängte Sanktion gesetzlich ausgesprochen werden. Die Atimie schließt einen Bürger von der Teilnahme am öffentlichen politischen Leben aus. Sie scheint die politische Transformation der zum Vorstellungshorizont einer ehrenhaften Gesellschaft gehörenden Schande zu sein. Das durch Ehre geregelte soziale Leben und die politische Ordnung in Athen funktionieren nur, wenn die athenischen Bürger beide handlungsleitenden Normen einhalten. Sowohl die Ehre als auch die Polis fordern eine beständige Aktivität in ihrem Sinne. Dabei kann die Handlungsebene ergänzt und zum Teil ersetzt werden durch eine geschickte verbale Einordnung des Geschehens in den normativen Kontext. So ist es z. B. möglich, wenig ehrenhaft erscheinende Handlungen mit der Notwendigkeit oder dem Hinweis auf die eigene Ehre zu erklären und zu rechtfertigen und so das soziale Wissen um die Norm der Ehre zu kommunizieren. In dieser Hinsicht besteht ein Interpretationsspielraum.73 Wer deutlich macht, dass er über das soziale Wissen verfügt, wie man sich ehrenhaft zu verhalten habe, 73 Herzfeld, Poetics, 84; Schneider und Schneider, Culture, 88.
Die Athener als Ehrenmänner
39
kann sich die inhaltliche Flexibilität der Ehre zunutze machen. Wie Handlungen interpretiert werden, ficht den ehrenhaften Status einer Person nicht an, solange sie sich an den habituellen Formen orientiert. Einige dieser habituellen Formen – wie jene der Reziprozität oder der öffentlichkeitswirksamen Aktionen – sind in beiden Kontexten die gegebene Wahl, müssen aber unter Umständen die inhaltliche Flexibilität der Ehre nutzen, um sich unter geänderten Verhältnissen weiterhin Geltung zu verschaffen. Andere – wie die Art der Konfliktbewältigung – beziehen sich auf widersprüchliche Handlungsstrategien und konkurrieren daher miteinander. Sofern sie einander ausschließende Handlungsmuster vorgeben, zeigt das Verhalten der Athener, welchem Bezugsfeld sie sich eher verpflichtet fühlen. Sofern sie in Konkurrenz, nicht aber im Widerspruch zueinander stehen, können hier die Mechanismen der Vermischung, Verschränkung oder Umdeutung von Normen beobachtet werden, wie sie sich ereignen, wenn eine politische Ordnung mit eigener Dynamik in einer tradiert ehrenhaften Gesellschaft entwickelt wird.
II. Die Ehre der Homerischen Helden
Ginge der trojanische Krieg nicht schon in sein zehntes Jahr, man könnte meinen, der Beginn der erzählten Geschichte setze ein mit dem Zorn eines Mannes über die Verletzung seiner Ehre: -ÁNIN ¥EIDE, QE£, 0HLHI£DEW '!CILÁOJ OÙLOμšNHN.1 Dieser Zorn ist es, der einen der grundlegenden Konflikte des Epos – jenen zwischen Achill und Agamemnon – in Gang hält und nicht nur dem Streit zwischen diesen beiden Männern, sondern auch der weiteren kriegerischen Entwicklung die innere Dynamik verleiht. Das eigene Ehrgefühl und der Anspruch auf Ehrungen durch andere sind die entscheidenden Motive, die die Handlungen der Helden in der Ilias bestimmen. Worin die Ehre eines Mannes besteht und was ihren Wert ausmacht, ist sowohl Homer als auch seinen Protagonisten so klar und selbstverständlich, dass es für sie keiner näheren Erläuterung bedarf. Umso grundlegender erweist sich für die Forschung die Frage, worum es sich bei dieser Ehre, die das Leben der homerischen Helden so entscheidend prägt, denn eigentlich handele. Dass Ehre in der homerischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielt, ist Konsens.2 Uneinigkeit herrscht über den Inhalt des homerischen Ehrbegriffs und darüber, in welchem Verhältnis die einzelnen Werte und Verhaltensimperative, die er impliziert, zueinander stehen. Eine Schlüsselrolle bei der Untersuchung dieser Fragen spielen die Begriffe TIμ» und ¢RET», die beide die höchste positive Wertschätzung im Wertekanon der homerischen Helden genießen. Während TIμ» als die Zuschreibung oder relative Einschätzung der Ehre eines Mannes charakterisiert werden kann,3 umfasst der Begriff der ¢RET» 1 Hom. Il. 1, 1f.: »Den Zorn singe, Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus, den verderblichen«. 2 Vgl. zum Begriff der »homerischen Gesellschaft« F. Gschnitzer, Zur homerischen Staatsund Gesellschaftsordnung: Grundcharakter und geschichtliche Stellung, in: J. Latacz (Hg.), zweihundert Jahre Homer-Forschung, Stuttgart/Leipzig 1991, 182-204: »Die ›homerische Welt‹, das sind also im Wesentlichen die allgemeinen Verhältnisse in der Entstehungszeit der Epen, die wir uns über einen längeren Zeitraum ausgedehnt denken müssen (mit dem 8. Jahrhundert in der Mitte)«. 3 Vgl. die Definition der TIμ» durch Riedinger, Remarques, 251: »Il ne faut pas se la représenter comme un fait d’ordre psychologique, un sentiment d’honneur, mais pas davantage comme un objet, une sorte de capital qui comprendrait les possessions d’un individu, le rang qu’elles lui assurent et le courage qui les défend. 4Iμ» est en fait conféré par les autres, elle désigne une relation. Elle reconnait à celui qui la reçoit une valeur, et, pour l’obtenir, une qualification est nécessaire.«
Die Ehre der Homerischen Helden
41
inhaltlich die Eigenschaften, die den ehrenhaften Mann auszeichnen sollten.4 Zu diesen gehören neben den so genannten kompetitiven Werten wie Tapferkeit, physische Stärke oder Waffenkundigkeit auch kooperativere Tugenden wie rhetorische Geschicklichkeit, Klugheit oder Großzügigkeit.5 Wie sich ein ¢GAQÒJ idealiter verhält, kommt in den Epen in programmatischen Sätzen zum Ausdruck. Als Leitbild des Handelns gilt, A„ÒN ¢RISTEÚEIN KAˆ ØPE…ROCON œμμENAI ¥LLWN6 oder auch μÚQWN TE HTÁR' œμENAI PRHKTÁR£ TE œRGWN.7 Die Ehre eines Mannes in einer ehrenhaften Gesellschaft manifestiert sich nicht nur durch seinen Status, seinen Habitus oder sein Ehrgefühl, sondern es kommt auf seine Taten an und wesentlich auf den Erfolg seiner Handlungen.8 Wie in jeder ehrenhaften Gesellschaft haben die habituellen Formen der Ehre eine handlungsleitende Funktion. So spielen Akte der Reziprozität, des Agons oder der Rache in der homerischen Gesellschaft wie in jeder anderen ehrenhaften eine wichtige Rolle. Die Wahl und Ausgestaltung der einzelnen Handlungen allerdings und die Werte, die damit ausgetauscht, erkämpft oder missachtet werden, prägen die spezifisch homerische Vorstellung von Ehre. Erst die Interpretation des Verhaltens einer Person durch sie selbst und durch ihre Umgebung macht die Ehrenhaftigkeit aus. Methodisch ermöglicht die postulierte Stetigkeit der Form des Verhaltens, d. h. die durchgehende soziale Akzeptanz der habituellen Formen der Ehre, verschiedene Gesellschaften übereinstimmend als ehrenhaft zu klassifizieren, ohne ein allzu ritualisiertes oder auch nur gleiches Verhalten ihrer 4 G. Zanker, The Heart of Achilles. Characterization and Personal Ethics in the Iliad, Ann Arbor, Mich. 1994, 11, definiert TIμ» als »the preserve of warriors high on the social scale, who maintain their standing in society through the exercise of their prowess, or arete, in battle, sport, or the council.« Ähnlich M. Finkelberg, Timê and Aretê in Homer, in: CQ 48 (1998), 14-28, 16 und A.W. Adkins, Homeric Ethics, in: I. Morris und B. Powell (Hg.), A New Companion to Homer, Leiden 1996, 694-713, 705. 5 Die Unterscheidung zwischen kompetitiven und kooperativen Werten geht zurück auf Adkins, Merit, passim, der die kompetitiven für ausschlaggebender und funktionaler für die homerische Gesellschaft hält als die kooperativen. Seine These zusammengefasst noch einmal in: ders., Ethics, 697-699. Vgl. zur Debatte darum: ders., Values, 321; Donlan, Ideal, 7-13; Gagarin, Morality, 303; Lloyd-Jones, Justice, 22. 6 Hom. Il. 6, 208; 11, 784: »immer Bester zu sein und überlegen zu sein den anderen«. W. Jaeger: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Bd. 1, Berlin/Leipzig 1934, 29, und K.A. Raaflaub, Homeric Society, in: Morris und Powell, Companion, 624-648, 634 halten dies für den Inbegriff der ¢RET». 7 Hom. Il. 9, 443: »ein Redner von Worten zu sein und ein Täter von Taten«. 8 Vgl. D. L. Cairns, Aidôs. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature, Oxford 1993, 74; E. Cantarella, Spunti di riflessione critica su ÛBRIJ e TIμ» in Omero, in: Symposion 1979, Köln/Wien 1983, 85-96, 90: »L’etica omerica, si può ben dire, era un’ etica del successo, che riconosceva all’ eroe una TIμ» proporzionale ai risultati delle sue azioni.« Vgl. Campbell, Hero, 132.
42
Die Ehre der Homerischen Helden
Mitglieder zu erwarten. Einzelne, ganz unterschiedliche Handlungen können in ihrem spezifischen sozialen Kontext als ehrenhaft begriffen werden. Die inhaltliche Ausprägung der habituellen Formen ist gänzlich unbestimmt und erhält ihre normative Füllung durch die Erfordernisse und Verhältnisse einer bestimmten Gesellschaft. So können die mit der Vorstellung von Ehre einhergehenden habituellen Formen in homerischer Zeit dieselben sein wie in klassischer Zeit. Der gesellschaftliche Kontext, die Interpretation der Handlungen und die Motive der Akteure erweisen sich aber als ganz unterschiedlich, weil sich die gesellschaftlichen Bedingungen in klassischer Zeit verändert haben. Obwohl die ehrenvollen Taten der homerischen Helden den Griechen als vorbildlich gelten, ist es speziell den Athenern im 5. und 4. Jahrhundert kaum möglich, sich ähnlich zu verhalten. Dafür erfordert die Polis als politische und normative Einheit zuviel Raum, der entsprechend den einzelnen Akteuren in ihren individuellen Handlungen fehlt. Generell ist der Handlungsspielraum eines Mannes in der homerischen Gesellschaft des 8. Jahrhunderts größer und sein Anspruch auf Ehre rigoroser durchsetzbar als jener eines Atheners in klassischer Zeit. Um einen Kontrast zu zeichnen, demgegenüber sich die Eigentümlichkeiten der klassischen Zeit schärfer konturieren lassen, soll der homerische Ehrbegriff untersucht werden. Vor dem Hintergrund der homerischen Gesellschaft mit ihren nur ansatzweise institutionalisierten Gremien und wenig festgelegten öffentlichen politischen Verfahren lässt sich gut zeigen, welchen Stellenwert die Polis in klassischer Zeit einnimmt und welche Bedeutung ihre Entwicklung für die Vorstellung von Ehre hat. Gerade weil die Gestalten Homers für die athenischen Nachfahren als heldenhafte Identifikationsfiguren begriffen wurden, kann man eine zumindest ideell ähnliche Vorstellung von Ehre auch noch für die Athener in den folgenden Jahrhunderten voraussetzen. Die Durchsetzung eines Anspruchs auf Ehre, wie es Achill versucht, stieße hier sofort an die Grenzen der gemeinschaftlich orientierten Polis. Es sind die ehrenhaften Handlungen der homerischen Helden, die im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Der für den Sozialhistoriker äußerst nachteilige Fokus der Epen auf die Taten eines guten Dutzends namhafter Männer erweist sich hier als Vorzug: Er bedeutet, dass eben jene sicher ehrenhaft handeln. Denn wenn der Begriff der Ehre in der homerischen Gesellschaft auch nur irgendeine Rolle spielen sollte, so sind es jene Helden, die über Ehre verfügen und es ist die Situation des Krieges, die geeignet ist, die Stärke und Tapferkeit der Krieger am besten auf die Probe zu stellen. Wenn jemandes, so sollte ihr Handeln Auskunft geben über normgerechtes ehrenhaftes Verhalten. Die in der Ilias geschilderte Situation des Lagers der Griechen vor Troja ist dabei am besten geeignet, das Verhalten
Die Ehre der Homerischen Helden
43
homerischer Ehrenmänner zu zeigen, die in einem zumindest losen Verbund von Kriegern mit einem gemeinsamen Interesse agieren. Dies gilt besonders für den Konflikt zwischen den Ehrenmännern Achill und Agamemnon. Beide sehen ihren Anspruch auf Ehre in Frage gestellt und sich gezwungen, angesichts der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung ein Verhalten an den Tag zu legen, das die übrigen Krieger von ihrer hohen Ehre überzeugt. Der Streit beider um die Wägung und Wertigkeit ihrer Ehrungen ist in der Ilias keine situativ bedingte Episode, wie es etwa die verschiedenen Abenteuer des Odysseus sind, sondern er hat die Qualität einer handlungstragenden Verstrickung der Protagonisten. Das setzt nicht nur die mögliche Identifizierung der Rezipienten des Epos mit den ehrenhaften Helden voraus, sondern verweist bereits darauf, dass es sich bei der Ehre um einen vielversprechenden und konfliktreichen Stoff handelt. Die Bedeutung, die die homerischen Helden den habituellen Formen der Ehre beimessen und die Art, wie sie ihre Handlungen danach ausrichten, sind geeignet, die normgerechte Auffassung von Ehre im 8. Jahrhundert zu verdeutlichen. So spiegelt das Verhalten der homerischen Protagonisten die Wichtigkeit der Öffentlichkeit als sozialem Raum. Denn die Grundvoraussetzung für ehrenhaftes Handeln ist immer das Vorhandensein von Öffentlichkeit. Da die Zuschreibung von Ehre nur über die jeweils anderen erfolgen kann, muss sich ehrenhaftes Verhalten vor den Augen anderer abspielen. Dieser Grundsatz gilt auch für die Ehre in der homerischen Gesellschaft.9 Er kann aber in seiner Bedeutung für die Akteure schwerlich verifiziert werden, da sie sich in einer Ausnahmesituation befinden: Das Lager der griechischen Männer vor Troja stellt eine konzentrierte Form der permanenten Öffentlichkeit dar, aus der es in der Situation des Krieges keine Rückzugsmöglichkeit gibt, so dass jede Handlung grundsätzlich als öffentlich gelten kann. Es gibt allerdings einige Hinweise in den Epen, die auf die Bedeutung des öffentlichen Raumes in seiner wesentlichen Funktion der sozialen Kontrolle schließen lassen. Das Bewusstsein der homerischen Krieger für normgerechtes ehrenhaftes Verhalten äußert sich in ihrer Angst vor Verfehlungen desselben. D. h. die Vermeidung von Scham als Gegenbegriff zur Ehre ist ein starkes handlungsleitendes Motiv. Die Vorstellung von Ehre auf der einen Seite ist nicht zu trennen von der Angst vor Schande auf der anderen.10 In ehrenhaften Gesellschaften erweist sich nicht nur das Streben nach 9 Vgl. Riedinger, Remarques, 257: »la TIμ» du héros, la TIμ» en général, n’est pas celle qui est réclamée par l’individu. Elle est l’objet d’une réponse de la société, mesurée par elle. Plus exactement encore: l’aspect subjectif e l’aspect objectif de TIμ» ne sont pas séparables.« 10 B. Williams, Shame und Necessity, Berkeley/Los Angeles 1993, 80: »People have at once a sense of their own honour and a respect for other people’s honour; they can feel indignation or
44
Die Ehre der Homerischen Helden
Ehre als charakteristisch für die meisten Handlungen, sondern eine ebenso starke Motivation kann die Vermeidung von Scham oder Schande sein. Während Scham eher mit dem Ehrgefühl einer Person korrespondiert, handelt es sich bei dem Begriff der Schande um das negative Äquivalent der Ehre als sozialem Faktor.11 Wenn die Kampfhandlungen in der Ilias das Leben der Helden oder den sicheren Sieg im Kriege zu gefährden drohen, erweist sich die Furcht vor der Schande als der ausschlaggebende Grund für das Weiterkämpfen. Das gilt für die Griechen, als sich die Lage ungünstig entwickelt: '!RGE‹OI DÒ NEîN μÒN ™CèRHSAN KAˆ ¢N£GKV TîN PRWTšWN, AÙTOà DÒ PAR¦ KLIS…VSIN œμEINAN ¡QRÒOI, OÙD' ™KšDASQEN ¢N¦ STRATÒN: ‡SCE G¦R A„DëJ KAˆ DšOJ: ¢ZHCÒJ G¦R ÐμÒKLEON ¢LL»LOISIN.12 Ähnlich ist die Vermeidung von Scham der Beweggrund Hektors, erneut in die Schlacht zu ziehen, auch angesichts seines drohenden Todes: à KAˆ ™μOˆ T£DE P£NTA μšLEI, GÚNAI: ¢LL¦ μ£L' A„NîJ A„DšOμAI 4RîAJ KAˆ 4RW£DAJ ˜LKESIPšPLOUJ.13 In beiden Fällen verhindert die Scham oder drohende öffentliche Schande ein Verhalten, das mit dem Anspruch der Personen auf Ehre nicht zu vereinbaren ist. Es sind die jeweils anderen, die für das Verhalten des Einzelnen verantwortlich zeichnen: Das Ehrgefühl des Einzelnen besteht hier in dem Bewusstsein, unter sozialer Kontrolle zu stehen und negative soziale Sanktionen zu erleiden, falls das Verhalten nicht den Erwartungen der anderen entspricht. Die Erwartungen, die die anderen an sein Verhalten stellen, folgen aber dem Anspruch des Einzelnen auf ein bestimmtes Maß an Ehre. Verhält er sich nicht erwartungsgemäß, so äußert sich in seiner Scham die Einsicht, dass er seinem eigenen Anspruch auf Ehre nicht gerecht geworden ist.14
other forms of anger when honour is violated, in their own case or someone else’s. These are shared sentiments with similar objects, and they serve to bind people together in a community of feeling.« 11 U. Wikan, Shame and Honour: A Contestable Pair, in: Man 19 (1984), 635-652: »I suggest that, for most people, honour will always be ›experience-distant‹ as compared with shame, and that many who use ›shame‹ ›naturally and effortlessly‹ may never come to feel about ›honour‹ that there is no concept involved«, 637. Vgl. Gilmore, Anthropology, 197f. Vgl. zu dieser Unterscheidung auch Kap. V. 2. 12 Hom. Il. 15, 655-658: »Doch die Argeier wichen zurück von den Schiffen, wenn auch gezwungen, von den ersten, hielten dort aber stand bei den Hütten, dicht versammelt, und zerstreuten sich nicht über das Lager: Scham hielt sie und Furcht, denn unablässig riefen sie einander zu.« 13 Ebd., 6, 441-443: »Aber zu furchtbar schäme ich mich vor den Troern und schleppgewandeten Troerfrauen, wollte ich mich wie ein schlechter Mann vom Kampfe fernhalten.« 14 Vgl. Campbell, Honour, 310: »If self-regard is the need to achieve an identity with the image of an ideal self, shame is the emotion experienced by an individual when he clearly fails to do so.«
Die Ehre der Homerischen Helden
45
Generell ist Scham stets eng mit dem Gefühl des Einzelnen für die ihm zukommende Ehre verbunden und sie macht gleichzeitig die Bedeutung der Beobachter des Verhaltens für die beanspruchte Ehre deutlich. Denn Scham tritt dann auf, wenn der eigenen oder der Ehre eines anderen nicht Genüge getan worden ist, wenn die internalisierte Norm der Ehre nicht so beachtet worden ist, wie sie es verlangt.15 Die in den Epen auffällig präsente Angst vor Scham hat in der Forschung zu einer Klassifizierung der homerischen Gesellschaft als Schamkultur geführt.16 Unabhängig von den weiteren Implikationen dieser These macht sie deutlich, wie konstitutiv die Öffentlichkeit und damit die Meinung der anderen für das Verhalten der homerischen Helden sind.17 Das zeigt z. B. auch die Rolle des Gesehenwerdens bzw. der Augen oder Blicke der anderen in den Epen.18 Komplementär zu den negativen Konsequenzen, die ein nicht normgerechtes Verhalten zeitigen kann, bietet der soziale Raum der Öffentlichkeit die ideale Arena für das intendiert ehrenhafte Verhalten der homerischen Helden. Dazu gehört an erster Stelle der Agon. Agamemnon und die übrigen basileis stehen im Wettstreit um Ehre und sie kämpfen konkret um einzelne Ehrungen. Die Verteilung und der Besitz kostbarer Güter bilden in der homerischen Welt den wichtigen materiellen Teil der Ehre eines Mannes. Die Vorstellung von Ehre ist eng mit dem Verfügen über eine bestimmte Menge an wertvollen Besitztümern verbunden, geht aber auch 15 Cairns, Aidôs, 144 spricht von einem »internal state of conscience which is based on internal standards and an awareness of the values of society; these standards will have become internal to the individual precisely because of their uniformity and of the power of popular opinion to enforce them, and will have been imparted early in the process of socialization.« Vgl. Lloyd-Jones, Ehre, 4, der von einem Gefühl spricht, »das jemand dazu führt, einen Verstoß gegen die eigene TIμ» als Affront zu empfinden oder selbst eine Handlung zu vermeiden, die ihr Schaden zufügen könnte.« 16 A.W. Adkins, Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece. From Homer to the end of the Fifth Century, New York 1972, 12, Anm. 1, definiert den Terminus wie folgt: »A shame-culture is one whose sanction is overtly ›what people will say‹.« Vor allen anderen favorisierte Dodds, Griechen, 17-37, diese These, der sie von R. Benedict, The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture, Tokyo 1954, 222-227, übernahm. Vgl. zur Diskussion darum Lloyd-Jones, Justice, 26f.; Hooker, Society, passim; M. Scott, Aidos and Nemesis in the works of Homer, and their relevance to Social or Co-operative Values, in: AClass 23 (1980), 13-35, 14f. Auch H. Strasburger, Der Einzelne und die Gemeinschaft im Denken der Griechen, in: HZ 177 (1954), 227-248 bezeichnet A„DèJ als höchsten der »sittlichen Bindebegriffe negativer Natur«, 242. 17 »Shame differs from guilt in that it requires an audience; shame is visual.«, Gilmore, Anthropology, 198; Vgl. Donlan, Ideal, 5; Adkins, Merit, 49: »The Homeric hero cannot fall back upon his own opinion of himself, for his self only has the value which other people put upon it.« Vgl. Jaeger, Paideia, 31. 18 Zur Auffassung des Sehens vgl. B. Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg 19482, 16-22; T. Rakoczy, Böser Blick, Macht des Auges und Neid der Götter. Eine Untersuchung zur Kraft des Blickes in der griechischen Literatur, Tübingen 1996, 42-55.
46
Die Ehre der Homerischen Helden
darüber hinaus.19 Diese Kopplung basiert auf der für primitive Gesellschaften charakteristischen Vorstellung, dass bestimmte Güter in nur begrenzten Mengen vorhanden sind. Das Erstreiten von Ehre kann also immer nur eine Umverteilung dieses Gutes unter den anwesenden Männern bedeuten. Ein Paradoxon, da es sich gerade bei der Ehre um ein rein imaginäres Gut handelt, das als soziales Konstrukt in den Köpfen der Menschen geschaffen wird. Der Konflikt zwischen Achill und Agamemnon zeigt, dass diese Vorstellung des Nullsummenspiels um die Ehre auch den homerischen Helden vertraut ist. Umso mehr, als in homerischer Zeit die Ehre noch eng mit materiellen Gütern verbunden ist und über diese erlangt und ausgetauscht werden kann. Der Streit zwischen Achill und Agamemnon ist ein Streit um die Ehre, er entsteht in der Situation eines klassischen Nullsummenspiels, wobei die Verteilung der Ehrgeschenke Anlass und Ursache des Konflikts bildet. Achill und Agamemnon geht es nicht nur abstrakt um ihre Ehre, sondern ganz konkret um den Wert der Ehrgeschenke, die die ihnen zukommende Ehre symbolisieren. Die Rückbindung der Vorstellung von Ehre an ihre materielle Basis ist hier total: Das begrenzte materielle Gut, über das Ehre zugewiesen wird, besteht in den erbeuteten Frauen, die in ihrer Anzahl endlich und zudem schon unter die Männer verteilt sind. Als der Apollonpriester Chryses die Rückgabe einer der zur Beute gehörenden Frauen, seiner Tochter Chryseis, fordert, geraten der Verteilungsmodus der Ehrungen in ein Ungleichgewicht und die Männer in Streit. Denn nachdem Agamemnon Chryseis dem Apoll zurückgegeben hat, fehlt es ihm an gleichwertiger Ehre mit allen anderen, die ihre Ehrgeschenke noch haben. Begreiflicherweise möchte er für dieses Opfer, das er dem Gemeinwesen bringt, entschädigt werden, zumal ihm als Führer mehr Ehre zukommt als den anderen Männern: ¢LL¦ KAˆ ïJ ™QšLW DÒμENAI P£LIN, E„ TÒ G' ¥μEINON: BOÚLOμ' ™Gë LAÕN SîN œμμENAI À ¢POLšSQAI. AÙT¦R ™μOˆ GšRAJ AÙT…C' ˜TOIμ£SAT', ÔFRA μ¾ OÍOJ '!RGE…WN ¢GšRASTOJ œW, ™PEˆ OÙDÒ œOIKEN.20 Achill erfasst die Situation. Er weist Agamemnon auf die fixe Zahl der bereits verteilten Geschenke hin und versucht, ihn auf spätere größere Ehrungen zu vertrösten: PîJ G£R TOI DèSOUSI GšRAJ μEG£QUμOI '!CAIO…; OÙDš T… POU ‡DμEN XUN»IA KE…μENA POLL£, ¢LL¦ T¦ μÒN POL…WN ™XEPR£QOμEN, T¦ DšDASTAI, LAOÝJ D' OÙK ™PšOIKE PAL…LLOGA TAàT' 19 Vgl. Riedinger, Remarques, 263f.; M.I. Finley, Die Welt des Odysseus, Darmstadt 1974, 125-128. 20 Hom. Il. 1, 116-119: »Doch auch so will ich sie [Chryseis] zurückgeben, wenn dies das Bessere ist. Will ich doch, dass das Volk heil sei, statt dass es zugrunde gehe. Aber mir bereitet sofort ein Ehrgeschenk, dass ich nicht einzig von den Argeiern ohne Geschenk bin, da sich dies auch nicht geziemt. Seht ihr das doch alle, wie mir mein Ehrgeschenk dahingeht.«
Die Ehre der Homerischen Helden
47
™PAGE…REIN. ¢LL¦ SÝ μÒN NàN T»NDE QEù PRÒEJ: AÙT¦R '!CAIOˆ TRIPLÍ TETRAPLÍ T' ¢POT…SOμEN, A‡ Kš POQI :EÝJ DùSI PÒLIN 4RO…HN EÙTE…CEON ™XALAP£XAI.21 Auch Achill sieht die Griechen in der Pflicht, Agamemnon für seinen Verzicht zu entschädigen bzw. ihm hohe Ehre zuzuteilen, und man kann annehmen, dass er hier für alle Anwesenden spricht. Doch bekanntermaßen gelten wohlmeinende Absichtserklärungen einem Mann von Ehre wenig, für Agamemnon zählt der Erfolg einer Aktion und er muss sichtbar sein. Als Achill außer diesen vagen Aussichten auf künftige Beute auch noch Kritik an seinem Führungsstil äußert, nimmt Agamemnon ihm kurzerhand eine seiner Frauen, Briseis, und schlägt sie seinem Beuteanteil zu.22 Die Szene ist charakteristisch für durch Ehre entstehende Konflikte: Agamemnon und Achill versuchen beide, ihren Anspruch auf Ehre aufrechtzuerhalten, während die situative Logik des Nullsummenspiels dies unmöglich macht. Bezeichnenderweise ist es das Interesse des Gemeinwesens, das die ehemals einvernehmliche Verteilung der Ehrungen aus dem Gleichgewicht bringt. Agamemnon ist derjenige, der diesem quasi höheren Prinzip der allgemeinen Sicherheit Tribut zollen muss. Natürlich trifft es nicht rein zufällig ihn: Ihm gebührt die meiste Ehre und deshalb auch die wertvollsten Ehrgeschenke, aus diesem Grunde ist er derjenige, der die Tochter des Apollon-Priesters bekommt.23 Wenn nun gerade diese wegen ihres Wertes zurückgefordert wird, so mag Agamemnon das als ein Opfer für die Gemeinschaft betrachten, das im Zusammenhang mit seinem Status als Führer steht.24 Dennoch gelingt es ihm nicht, diese Handlung als Zeichen seiner Verantwortung für das Gemeinwesen zu interpretieren, das ihm höhere Ehre einbringt, als es sein Beuteanteil getan hat. Agamemnon geriert sich hier ganz als Ehrenmann, der seine Verpflichtung zuallererst in der Erhaltung seiner individuellen Ehre sieht. Seine Rolle als Führer der übrigen Männer jedoch verpflichtet ihn einerseits, sein Ehrgeschenk zurückzugeben, und andererseits, Achill als einen seiner besten Krieger bei der Truppe zu halten, um den Krieg erfolgreich führen zu können. Daneben berechtigt ihn seine hervorragende Position auch zur Bestallung mit den wertvollsten Ehrgeschenken. Die Vielfalt der Ansprüche an 21 Ebd., 123-129: »Wie sollen dir denn ein Ehrgeschenk geben die hochgemuten Achaier? Wissen wir doch nicht, dass irgendwo viel Gemeingut liegt, sondern was wir von den Städten erbeuteten: aufgeteilt ist es, und nicht gehört sichs, dass die Männer dies wieder herbringen und zusammenwerfen. Darum gib du jetzt diese dem Gott hin, und wir Achaier werden es dreifach und vierfach zurückerstatten, wenn Zeus denn einmal gibt, die Stadt Troja, die gutummauerte, zu zerstören.« 22 Ebd., 181-187. 23 Ebd., 166f. 24 Ebd., 117: BOÚLOμ' ™Gë LAÕN SîN œμμENAI À ¢POLšSQAI, »Will ich doch, dass das Volk heil sei, statt dass es zugrunde gehe.«
48
Die Ehre der Homerischen Helden
seinen Status als Führer der Griechen scheint Agamemnon hier zu überfordern, offensichtlich sieht er sich nicht imstande, die verschiedenen Werte und Interessen gegeneinander abzuwägen, und zieht sich deshalb zurück auf die Position, die ihm habituell am nächsten liegt: Die des Ehrenmannes, der bereit ist, für den Erhalt seiner Ehre zu streiten. Die Ansprüche der Gemeinschaft an ihn erscheinen ihm lediglich als irritierender Faktor und so diffus, dass er sein Verhalten nicht einmal im Nachhinein rational erklären kann. Er rechtfertigt seine Entscheidung vielmehr durch gottgegebene Verwirrung: ™Gë D' OÙK A‡TIÒJ E„μI, ¢LL¦ :EÝJ KAˆ μO‹RA KAˆ ºEROFO‹TIJ ™RINÚJ, O† Tš μOI E„N ¢GORÍ FRESˆN œμBALON ¥GRION ¥THN, ½μATI Tù ÓT' '!CILLÁOJ GšRAJ AÙTÕJ ¢PHÚRWN. ¢LLA T… KEN šXAIμI; QEÕJ DI¦ P£NTA TELEUT´. PRšSBA $IÕJ QUG£THR ¥TH, ¿ P£NTAJ ¢©TAI, OÙLOμšNH:25 Bezeichnenderweise beruft er sich hier nicht auf sein Ehrgefühl, obwohl dies in der homerischen Gesellschaft einen anerkannten Wert darstellt, zudem auch sein Widersacher Achill den eigenen Ehranspruch ohne Rücksicht auf Verluste verfolgt. Seine Verwirrung mag deshalb durchaus echt sein: Unvermittelt beansprucht das Gemeinwesen eine Position, die ungeklärt ist, offensichtlich aber inkompatibel mit dem individuellen Ehrbedürfnis eines Helden, wie Agamemnon es bisher begriffen hatte.26 So erklärt er die unwillkommenen Ansprüche des Gemeinwesens mit dem Einfluss höherer Mächte; in seiner ehrenhaften Welt haben sie keinen Platz. Sein Gegner Achill scheint die Situation ganz ähnlich einzuschätzen, denn er verhält sich genauso wie Agamemnon: Seine eigene Ehre hat in der Wahl seiner Handlungsmöglichkeiten absolute Priorität. Entsprechend interpretiert er das Verhalten des Agamemnon als Hybris: GšRAJ Dš μOI, ÓJ PER œDWKEN, AâTIJ ™FUBR…ZWN ›LETO KRE…WN '!GAμšμNWN '!TREÏDHJ. – Tù P£NT' ¢GOREUšμEN, æJ ™PITšLLW, ¢μFADÒN, ÔFRA KAˆ ¥LLOI ™PISKÚZWNTAI '!CAIO…, E‡ TIN£ POU $ANAîN œTI œLPETAI 25 Ebd., 19, 86-92: »Ich aber bin nicht schuldig, sondern Zeus und die Moira und die im Dunkeln wandelnde Erinys, die mir in der Versammlung in den Sinn warfen die wilde Beirrung an dem Tag, als ich selbst das Ehrgeschenk des Achilleus fortnahm. Aber was sollte ich tun? Der Gott führt alles zu seinem Ende. Die ehrwürdige Tochter des Zeus ist Ate, die alle beirrt, die verderbliche!« Vgl. Dodds, Griechen, 15, der die Stelle mit den Worten: »Nicht ich war der Grund für die Tat...« übersetzt und erklärt: »Die nicht einzuordnenden, nichtrationalen Impulse sowohl wie die aus ihnen resultierenden Handlungen werden vom Ich häufig ausgesondert und einem fremden Ursprung zugeschrieben.« 26 Vgl. Adkins, Merit, 51f.; Lloyd-Jones, Justice, 26f.; F. Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte. Von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, Wiesbaden 1981, 46: »Das Spannungsverhältnis zwischen dem mächtigen und eigenwilligen Einzelnen und der Gemeinschaft, der er sich auf die Dauer doch nicht entziehen kann und auf die er seinerseits mächtig und vielfach gewaltsam einwirkt, bietet reichlich Stoff für dramatische Konflikte und gehört dementsprechend zu den Grundthemen epischer Dichtung.«
Die Ehre der Homerischen Helden
49
™XAPAT»SEIN A„ÒN ¢NAIDE…HN ™PIEIμšNOJ:27 Mit dieser Deutung steht er nicht allein.28 Die vorsätzliche, öffentliche Beschädigung der Ehre Achills durch Agamemnon kann innerhalb des Normensystems der Ehre als Hybris interpretiert werden.29 Den Impuls der sofortigen, gewalttätigen Rache unterdrückt Achill zugunsten einer längerfristigen Strategie der Vergeltung.30 Achills Rückzug aus der Kampfgemeinschaft der Griechen ist die verzögerte, überlegte Reaktion auf den Akt der Hybris, den Agamemnon begeht. Die Ähnlichkeit des Verhaltens beider Protagonisten ist kein Zufall. Beide vertreten konsequent die Erfordernisse ihrer Ehre und schöpfen so das Konfliktpotential, das dieses agonale Verhalten und die situativen Bedingungen des Nullsummenspiels mit sich bringen, voll aus. Ihr Verhalten beeinflusst nicht nur die in die Streitigkeiten um Ehre involvierten, weil von ihnen abhängigen Männer, sondern gefährdet den Erfolg der gesamten militärischen Operation. Denn zum einen missachten die homerischen Protagonisten die Notwendigkeiten der gemeinsamen Sache, sobald sie ihrem Ehrgefühl zuwiderlaufen, und zum anderen entfaltet sich eine eigene Dynamik der wechselseitigen Handlungen, die aus der Ehre resultieren. Die Vorstellungen namentlich des Achill und des Agamemnon von ihrer Ehre tragen zu einer Zuspitzung des Konfliktes beider bei, der am Ende nur mit Mühe noch gelöst werden kann. Positiv gewendet erfüllt der Ehrbegriff der homerischen Helden eine wichtige gesellschaftliche Funktion. In den diversen Kampf- und Kriegsszenen der Epen zeigt sich der rein praktische Wert der Ehre für den Erhalt der Gesellschaft. Hier »immer Bester zu sein und überlegen zu sein den anderen« ist sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft überlebensnotwendig. Damit resultiert der höchste Wert der Gesellschaft, die Ehre, rein funktional aus jenen Verhaltensmustern, die der Gemeinschaft am meisten nützen.31 Die Absolutheit der kriegerischen Situation, die einerseits über Sieg oder Niederlage und andererseits über Leben oder Tod
27 Hom. Il. 9, 367-372: »Nur das Ehrgeschenk, das er gegeben, nahm er mir wieder, gewalttätig, der gebietende Agamemnon, der Atreus-Sohn! Dem sage alles, wie ich es auftrage, öffentlich, dass auch die anderen Achaier darüber erbittert sind, wenn er noch irgendeinen der Danaer hofft zu betrügen, immer in Unverschämtheit gehüllt«. 28 Ebd., 1, 202-214. 29 Vgl. N.R.E..Fisher, Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, Wiltsh. 1992, 151-156. 30 Athene interveniert, um ihn von der Erschlagung Agamemnons abzuhalten, Hom. Il. 1, 193-201. Ungleich Agamemnon geht Achill hier auf das Versprechen der dreifachen künftigen Entlohnung ein, ebd., 212-214. 31 Vgl. Adkins, Merit, 34f.; Campbell, Hero, 130: »In Homer heroism is a social role. It’s task is the defence of the community’s limits.«
50
Die Ehre der Homerischen Helden
der Krieger entscheidet, zeigt den agonalen Zug der Ehre in seiner schärfsten Form.32 Das aus der Vorstellung des Nullsummenspiels konsequent sich ergebende agonale Verhalten findet sich in den Epen allerdings auch auf weniger spannungsgeladenem oder gar spielerischem Gebiet. Denn auch im zivilen Leben abseits des Schlachtfeldes messen sich die Helden gerne im Agon miteinander. Die berühmtesten Agone in der Ilias sind die Leichenspiele zu Ehren des Patroklos, die von Homer detailliert beschrieben werden. Auch hier streiten die Wettkämpfer um die Ehre, d. h. die Ehrungen, die als Siegespreise ausgesetzt sind. Doch diese Veranstaltung scheint im ganzen eher spielerischen Charakter zu haben, denn nicht nur die Ersten und Besten in den einzelnen Disziplinen tragen wertvolle Preise davon, sondern sogar die Besiegten.33 Nach dem Wagenrennen, mit dem die Leichenspiele beginnen, kommt es dennoch zu Streitigkeiten um die Ehrungen, wobei es den Kontrahenten sowohl um den materiellen Wert als auch um die Anerkennung der agonalen Leistungen der Krieger geht. Während des Rennens ereignen sich zwei Zwischenfälle, die die simple Entscheidung, wer von den Helden am schnellsten die Strecke bewältigt, verkompliziert. Bei der Verteilung der Siegesprämien kommen deshalb plötzlich andere Werte ins Spiel, die wenig mit der Feststellung der Reihenfolge des Zieleinlaufs zu tun haben. Neben dem Streit zwischen Menelaos und Antilochos, von denen ersterer über die besseren Pferde, letzterer aber über die größere Fahrgeschicklichkeit verfügt,34 ist vor allem die Auseinandersetzung um die Platzierung des Eumelos von Interesse. Eumelos bricht während der Fahrt das Joch und er muss den Rest der Strecke zu Fuß zurücklegen, seinen Wagen eigenhändig hinter sich herziehend.35 Trotzdem er als bester der Wagenlenker gilt, erreicht er als letzter das Ziel. Achill versucht, bei der Verteilung der Siegespreise seine Fähigkeiten und sein Unglück zu würdigen, indem er ihm den zweiten Preis zuspricht: TÕN DÒ „DëN øKTEIRE POD£RKHJ D‹OJ '!CILLEÚJ, ST¦J D' ¥R' ™N '!RGE…OIJ œPEA PTERÒENT' ¢GÒREUEN: ›LO‹SQOJ 32 Finley, Welt, 123: »Die Ilias im besonderen ist von Blut gesättigt, eine Tatsache, die nicht verborgen oder hinwegdisputiert werden kann, auch wenn man beim vergeblichen Versuch, die archaischen griechischen Werte einem sanfteren Sittenkodex anzupassen, die Zeugnisse noch so sehr zu drehen sucht.« 33 Hom. Il. 23, 262-270; 653-656; sowie ebd., 702-705, wo Achill für den Ringkampf die Preise aussetzt: Tù μÒN NIK»SANTI μšGAN TR…POD' ™μPURIB»THN, TÕN DÒ DUWDEK£BOION ™Nˆ SF…SI T‹ON '!CAIO…: ¢NDRˆ DÒ NIKHQšNTI GUNA‹K' ™J μšSSON œQHKEN, POLL¦ D' ™P…STATO œRGA, T…ON Dš ˜ TESSAR£BOION. »Für den Sieger einen großen Dreifuß, ins Feuer zu stellen; den schätzten unter sich die Achaier auf zwölf Rinder. Doch für den Mann, den Besiegten, stellte er eine Frau in die Mitte, und sie verstand viele Werke: die schätzten sie auf vier Rinder.« 34 Ebd., 293-300 bzw. ebd., 310-313. 35 Ebd., 391f. 532f.
Die Ehre der Homerischen Helden
51
¢N¾R êRISTOJ ™LAÚNEI μèNUCAJ †PPOUJ‹.36 Mit diesem Vorschlag sind alle einverstanden, außer Antilochos, der als zweiter ins Ziel gekommen ist und Anspruch erhebt auf die dem Zweiten versprochene Stute, die er bereits als die seine betrachtet. Die Situation stellt sich ähnlich dar wie der Konflikt zwischen Agamemnon und Achill um die Verteilung der gefangenen Frauen. Auch hier droht der Streit zu eskalieren, weil einem der Helden ein Ehrgeschenk, das er quasi schon besitzt, weggenommen und jemand anderem zugesprochen werden soll. In beiden Fällen geschieht dies aus Gründen, die der menschlichen Kontrolle nicht zugänglich sind: War es in der Eingangsszene Apoll, der die Tochter seines Priesters zurückforderte, so ist es nun Athene, die für das Unglück des Eumelos verantwortlich zeichnet.37 Antilochos macht nun, ebenso wie Achill, den Vorschlag, den um seine Ehrung Gebrachten mit anderen Gütern zu entschädigen: ›E„ Dš μIN O„KTE…REIJ KA… TOI F…LOJ œPLETO QUμù, œSTI TOI ™N KLIS…V KRUSÕJ POLÚJ, œSTI DÒ CALKÕJ KAˆ PRÒBAT', E„Sˆ Dš TOI DμWAˆ KAˆ μèNUCEJ †PPOI: TîN Oƒ œPEIT' ¢NELëN DÒμENAI KAˆ μE‹ZON ¥EQLON‹.38 Anders als beim Initialstreit zwischen Achill und Agamemnon erweist sich dies als rettender Ausweg aus dem Konflikt, denn die Menge der Güter kann erweitert werden. Zwar hat Eumelos keinen legitimen Anspruch auf die Ehrung, aber der Wertekanon der Ehre impliziert in homerischer Zeit offensichtlich auch kooperativere Verhaltensmuster als die rein agonalen: Achill will Eumelos den zweiten Preis aus Mitleid geben. Der Konflikt, der hier um die Rechtmäßigkeit des Anspruchs auf bestimmte Ehrungen kreist, resultiert aus widersprüchlichen habituellen Formen innerhalb desselben Ehrenkodex’. Achills Einstellung zeigt beide Verhaltensmuster: Obwohl er Eumelos den Siegespreis aus Mitleid geben will, anerkennt er auch den Eifer des Antilochos, der erklärt, um seinen Preis kämpfen zu wollen: ›T¾N D' ™Gë OÙ DèSW: PERˆ D' AÙTÁJ PEIRHQ»TW ¢NDRîN ÓJ K' ™QšLVSIN ™μOˆ CE…RESSI μ£CESQAI.‹ ìJ F£TO, μE…DHSEN DÒ POD£RKHJ D‹OJ '!CILLEÝJ CA…RWN '!NTILÒCJ, ÓTI Oƒ F…LOJ ÃEN ˜TA‹ROJ.39 Achill anerkennt den Anspruch sowohl des Eumelos als auch des Antilochos auf die Ehre als legitim. 36 Ebd., 534-538: »Wie er ihn sah, jammerte es den fußstarken göttlichen Achilleus und aufgestanden sprach er unter den Argeiern die geflügelten Worte: ›Da treibt als letzter der beste Mann die einhufigen Pferde! Doch auf! geben wir ihm als Preis, wie es sich gebührt, den zweiten‹«. 37 Ebd., 391f. 38 Ebd., 548-551:»Jammert er dich aber und ist es dir lieb im Mute – da ist dir in der Hütte viel Gold, und da ist Erz und Schafe, und da sind dir Mägde und einhufige Pferde: Nimm davon später und gib ihm sogar einen größeren Kampfpreis!« 39 Ebd., 553-556: »›Die Stute aber gebe ich nicht her! Um diese mag es versuchen, wer da will von den Männern, mit mir mit Händen zu kämpfen!‹ So sprach er. Da lächelte der fußstarke göttliche Achilleus und freute sich über Antilochos, denn er war ihm ein lieber Gefährte.«
52
Die Ehre der Homerischen Helden
Das Konfliktpotential der Ehre resultiert nicht nur aus ihrem agonalen Charakter, der die Ehrenmänner in beständige Konkurrenz zueinander treten lässt, sondern die Handlungsnorm der Ehre favorisiert widersprüchliche habituelle Formen, deren Befolgung für einen Einzelnen unmöglich und für mehrere konfliktträchtig ist. Eumelos und Antilochos personifizieren für Achill diese widersprüchlichen ehrenhaften Verhaltensmuster, deren beider Legitimität er anerkennt, zwischen denen er sich aber zu entscheiden weigert, indem er geschickt eine Ausflucht wählt. Der Streit spiegelt nicht nur das Verhältnis zwischen den kompetitiven und den kooperativen Verhaltensmustern der Ehre, sondern der Ausgang des Wagenrennens wirft grundsätzlich die Frage nach dem sozialen Status der Beteiligten auf. Weil Eumelos der beste Wagenlenker ist, beansprucht er grundsätzlich diese Ehre, unabhängig vom Ausgang des Rennens. Er lässt sich durch einen momentanen Vergleich, wie es der Wettkampf darstellt, nicht in seinem Status beeinträchtigen. Die Zufälligkeit und Einmaligkeit des Unglücks, das seinen Sieg verhindert, begünstigen diese Einstellung. In einer ehrenhaften Gesellschaft konstituiert sich der Status eines Mannes durch seine Überlegenheit im Wettkampf. Eumelos verweigert die Anerkennung der Kriterien für seinen Status als bester Wagenlenker, wenn er sich auf die Ausnahmesituation seines Unglücks beruft. Er spricht dem Wettkampf damit eine lediglich affirmative Qualität zu, die seinen Status bestätigen, aber nicht grundsätzlich in Frage stellen kann. Die Starrheit dieser Auffassung der homerischen Gesellschaft, die Eumelos damit repräsentiert, wird von Achill sanktioniert, indem auch er ihm die Berechtigung eines Preises zuspricht. Die aktuelle Wettkampfsituation wird durch Achill erweitert zu einem generellen Bild der Gesellschaft, in der die Ehrungen entsprechend des allgemein anerkannten Status eines Mannes vergeben werden, nicht entsprechend einer bestimmten Leistung in einem gegebenen Moment.40 Ebenso materialistisch und zuweilen kooperativ geprägt wie der agonale Zug der Ehre ist die Norm der Reziprozität. Das zeigt sich besonders deutlich im Brauch des Gabentausches. Wie aus dem Anlass der Konflikte sowohl zwischen Agamemnon und Achill als auch zwischen Eumelos und Antilochos ersichtlich, ist der materielle Wert der Ehrungen immer auch
40 Vgl. Adkins, Merit, 55: »Systems of values, however, persist while societies develop; and the Homeric system conflicts violently with any form of society which attempts to allot reward or punishment to an action simply on the basis of the characteristics of that action, irrespective of any other claims to consideration the agent may possess. The persistence of the one system is certain to confuse any attempt to introduce the other.«
Die Ehre der Homerischen Helden
53
Indikator für die Einschätzung der Ehre einer Person.41 Die Möglichkeit, Ehrgeschenke unterschiedlichen materiellen Wertes zu vergeben, erleichtert die Abstufung in der Ehrung der einzelnen Personen.42 Zugleich wird so die Ehrerweisung allen gegenständlich sichtbar, ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlichkeit und den ausgeprägt visuellen Aspekt der Ehre in den Epen. Die Anerkennung der Ehre des anderen durch den Austausch von Gaben findet sich in vielen Situationen. Während des Zweikampfs zwischen Hektor und Aias etwa tauschen beide Geschenke aus, trotzdem sie feindlichen Lagern angehören.43 Die Einschätzung der Ehre des jeweils anderen, die sie damit zum Ausdruck bringen, bezieht sich auch auf die Ehre ihrer eigenen Person: Beide achten sich als hervorragende Krieger, die dem ehrenhaften Agon verpflichtet sind. Dem Grundsatz gemäß, dass der mächtigste Gegner auch der ehrenvollste ist, beanspruchen sie innerhalb ihrer jeweils eigenen Kampfgemeinschaft hohe Ehre. Ähnlich motiviert sehen sich Diomedes und Glaukos zum Gabentausch veranlasst, als sie auf dem Schlachtfeld feststellen, dass ihre Väter und damit auch sie Gastfreunde sind. Um ihre Verbundenheit zu besiegeln, tauschen sie die nicht gleichwertigen Waffen miteinander. Der Dichter begründet die wenig berechnende Handlung des Glaukos mit dem sinneverwirrenden Einfluss des Zeus: œNQ' AâTE 'LAÚKJ +RON…DHJ FRšNAJ ™XšLETO :EÚJ, ÖJ PRÕJ 4UDEÏDHN $IOμ»DEA TEÚCE' ¥μEIBEN KRÚSEA CALKE…WN, ˜KATÒμBOI' ™NNEABO…WN.44 Für die beiden Männer auf dem Schlachtfeld scheint hingegen die symbolische Freundschaftsbekundung den materiellen Wert der Gabe zu überwiegen.45 41 Finley, Welt, 124f. 128: »Weil die konkreten Bekundungen der Ehre und Freundschaft immer Gegenstände von wirklichem Wert ... waren, lag das Element des Prestiges in dem Kleinod verborgen. Es zählte beides sehr stark, sowohl Besitz als Besitz wie Besitz als Symbol.« 42 W. Donlan, The Homeric Economy, in: Morris und Powell, Companion, 649-667, spricht von »a sort of fair inequality«, 661, bei der der Wettbewerb und die Zurschaustellung der Gaben stets im Vordergrund stehen, 663. 43 Hom. Il. 7, 299-302: DîRA D' ¥G' ¢LL»LOISI PERIKLUT¦ DèOμEN ¥μFW, ÔFRA TIJ ïD' E‡PVSIN '!CAIîN TE 4RèWN TE „ºμÒN ™μARN£SQHN œRIDOJ PšRI QUμOBÒROIO, ºD' AâT' ™N FILÒTHTI DIšTμAGEN ¢RQμ»SANTE. »Doch auf! wir wollen einander ringsberühmte Gaben geben beide, dass manch einer so spricht der Achaier und der Troer: ›Sie haben gekämpft in dem Streit, dem mutverzehrenden, sie haben sich wieder getrennt, in Freundschaft vereinigt!‹« 44 Ebd., 6, 234-236: »Da wieder benahm dem Glaukos der Kronide Zeus die Sinne, der mit dem Tydeus-Sohn Diomedes die Waffen tauschte: Goldene gegen eherne, hundert Rinder gegen neun Rinder.« 45 Bourdieu, Sinn, 209, spricht von einer notwendigen »Verschleierung der ökonomischen Handlungen« im Zusammenhang mit dem Gabentausch. Vgl. O. Behrends, Der ungleiche Tausch zwischen Glaukos und Diomedes und die Kauf-Tausch-Kontroverse der römischen Rechtsschulen, in: Historische Anthropologie 10 (2002), 245-266, 264: »Der Tausch, der nicht auf das Wertverhältnis sieht, sondern primär auf das, was dem anderen gefällt, seinen Erwartungen entspricht, ihn beeindruckt, erfreut und dankbar macht, ist in dieser naturrechtlichen Perspektive entschieden ›vornehmer‹... Von diesem Standpunkt aus gewürdigt trägt der Rüstungstausch zwischen Glaukos
54
Die Ehre der Homerischen Helden
Häufig wird der Brauch des Austauschs von Gaben oder Gastgeschenken verbunden mit geselligen Ereignissen. Besonders deutlich wird dies bei den vielen gemeinsamen Mählern: Die Epen triefen nicht nur von Blut, sondern auch von dampfendem Fett, das die Menschen ebenso wie die Götter lieben. Unzählige Male wird beschrieben, wie die Helden gemeinsam opfern und essen, wobei beide Tätigkeiten ähnlich zeremoniell ablaufen.46 Der hohe Kurs, in dem die Gastfreundschaft steht, zeigt sich auch darin, dass jeder Fremde erst einmal zum Mahle geladen wird, bevor nach seiner Person oder dem Grund seines Besuches gefragt wird. Während ihrer Odyssee ergeht es Odysseus und Telemach häufig so. Sie werden auf ihren weiten Reisen gastfreundlich empfangen und verköstigt.47 Ebenso deutlich wird dabei aber, dass diese Gastfreundschaft auf erwarteter Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität beruht und dass die Erscheinung der Gäste ihren habituellen Anspruch auf ein solch ehrenhaftes Verhalten rechtfertigt: ›S…TOU Q' ¤PTESQON KAˆ CA…RETON. AÙT¦R œPEITA DE…PNOU PASSAμšNW E„RHSÒμEQ', O† TINšJ ™STON [¢NDRîN: OÙ G¦R SFùN GE GšNOJ ¢PÒLWLE TOK»WN, ¢LL' ¢NDRîN GšNOJ ™STÒ DIOTREFšWN BASIL»WN SKHPTOÚCWN, ™PEˆ OÜ KE KAKOˆ TOIOÚSDE TšKOIEN]‹.48 Die Gleichheit der Ehrenhaften untereinander ist bedingend für einen ebensolchen Umgang miteinander. Auch in der homerischen Gesellschaft macht das habituelle Verhalten der verschiedenen Männer deutlich, wessen Ebenbürtigkeit sie beanspruchen und anerkennen. Neben der ausgeprägten Vorstellung der Gleichheit an Ehre steht die selbstverständliche Ungleichheit derer, die über weniger Landbesitz, Abhängige und Waffen verfügen. Die weniger Ehrenhaften der Gesellschaft erscheinen in den Epen selten, fungieren aber, wenn sich die Protagonisten auf sie beziehen, eindeutig als Kontrapart ihrer Lebensweise und ihrer Ehre, gegen den sie sich absetzen müssen.49 Die relative Gleichheit, die alle Männer einer bestimmten Schicht und Diomedes alle Züge eines edlen Tausches. Er wird angeboten und vollzogen zur Stärkung eines Verhältnisses, dessen Pflichten nach der Wertung der vorklassischen, von Sabinus fortgeführten Jurisprudenz zu den vorrangigsten der menschlichen Gesellschaft gehört.« 46 Vgl. zur eingehenden Beschreibung des Opferrituals Hom. Il. 1, 457-468; 2, 421-431; Hom. Od. 3, 454-463; 12, 359-365. 47 Hom. Od. 3, 29-74; 4, 37-67; 7, 167-183. 48 Ebd., 4, 60-64: »Langt nun zu und esst mit Wohlgefallen, ihr Freunde! Habt ihr euch dann mit Speise gestärkt, dann wollen wir fragen, wer ihr seid. Denn wahrlich, aus keinem versunknen Geschlechte stammt ihr, sondern ihr stammt von edlen zeptergeschmückten Königen her; denn gewiss, Unedle zeugen nicht solche!« (Übersetzung J.H. Voss). 49 Vgl. Hom. Il. 9, 646-648 und ebd., 16, 56-59, wo Achill die Wegnahme seines Ehrgeschenks als seinem eigenen Status unangemessen bezeichnet. Mit einem ehrlosen Zugewanderten (¢T…μHTON μETAN£STHN), mit dem ihn Agamemnon damit auf eine Stufe stelle, könne man so verfahren. H. Strasburger, Der soziologische Aspekt der homerischen Epen, in: Gymnasium 60 (1953), 97-114, 98, spricht von zwei Klassen, die »in der gängigen Auffassung der Zeit durch eine tiefe Kluft getrennt scheinen«.
Die Ehre der Homerischen Helden
55
umfasst und sogar Feindeslinien ignorieren kann, bedeutet in ihrer Ausschließung eine strikte Ungleichheit gegenüber an Ehre niedriger Gestellten. Die hierarchische Struktur der ehrenhaften homerischen Gesellschaft zeigt sich darin, dass es wenige Aristokraten sind, von deren Heldentaten berichtet wird und die als handelnde Personen identifiziert werden. Ein Grund dafür ist sicherlich die literarische Gattung des Epos, das sich auf die aristokratische Lebenswelt konzentriert. Der Demos als alle übrigen Männer spielt in den Epen eine Nebenrolle, er erscheint nur in seiner Gesamtheit und nimmt auf das Geschehen weniger Einfluss, als dies in der homerischen Gesellschaft tatsächlich wohl der Fall war.50 Aussagen über nichtaristokratische Mitglieder der homerischen Gesellschaft erweisen sich als schwierig. Die Elite bilden die Stammesoberhäupter, die sich auf die Macht eines großen Oikos und einer Menge an Gefolgsleuten stützen.51 Innerhalb dieser Elite spielen sich die erzählten Auseinandersetzungen um Ehre ab. Wie langwierig und schwierig diese Streitigkeiten sein können, in denen es materiell lediglich um einen Teil der Beute, tatsächlich aber um einen Anteil an der Ehre geht, zeigt der Konflikt zwischen Achill und Agamemnon. Nachdem Achill sich tagelang bei den Schiffen verschanzt hat und die Abwesenheit seiner Person und seiner Männer das Kriegsglück der Griechen entscheidend beeinträchtigt haben, erscheint Agamemnon mit einem Versöhnungsangebot bei ihm. Er bietet ihm an, ihm Briseis zurückzugeben und darüber hinaus noch massenhaft andere Gaben, wenn er nur von seinem Zorn ablasse. Achill formuliert die Ablehnung der Versöhnung in den Worten seiner eigenen verletzten Ehre: OÙD' E‡ μOI TÒSA DO…H ÓSA Y£μAQÒJ TE KÒNIJ TE, OÙDš KEN ïJ œTI QUμÕN ™μÕN PE…SEI' '!GAμšμNWN. [PRˆN G' ¢PÕ P©SAN ™μOˆ DÒμENAI QUμALGšA LèBHN.]52 Achill hat sich in seinen Zorn verrannt, der aus einem überspannten Ehrbegriff resultiert. Nachdem er schon in der Ursprungssituation des Streits seinen akuten Impuls zu gewalttätiger Rache überwunden hatte, wählt er eine alternative Vergeltung, die sich schließlich als ausweglos für ihn selbst erweisen wird. Die von Agamemnon vorgeschlagene und sozial akzeptable Lösung, die das Normensystem der Ehre bereitstellt, lehnt er über die Zurückweisung der materiellen Entschädigung ab. Mit dieser Transgression der gesellschaftlichen Normen verweigert er zugleich seine Rückkehr in die
50 Vgl. zur Rolle von Rat und Volksversammlung in der homerischen Gesellschaft Gschnitzer, Staatsordnung, 195-199, und Raaflaub, Society, 642f., der vor einer Unterschätzung des Demos bei der Meinungsbildung in der Volksversammlung warnt. 51 Gschnitzer, Sozialgeschichte, 38-41; Raaflaub, Society, 633f. 52 Hom. Il. 9, 385-387: »›Und wollte er mir soviel geben, wie da Sand und Staub ist: Auch so würde er nicht mehr meinen Mut bereden, Agamemnon, bis er mir nicht die ganze hat abgebüßt, die herzkränkende Beschimpfung!‹«
56
Die Ehre der Homerischen Helden
Gemeinschaft.53 Agamemnons Gesandte wissen um den Wert der Ehre für Achill und weisen ihn auf die verbindlicheren Verhaltensmuster hin, die dieser auch favorisieren sollte. Odysseus erinnert ihn an die Weisung seines Vaters: ð PšPON, Ã μÒN SO… GE PAT¾R ™PETšLLETO 0HLEÝJ ½μATI Tù, ÓTE S' ™K &Q…HJ '!GAμšμNONI PšμPEN, ›TšKNON ™μÒN, K£RTOJ μÒN '!QHNA…H TE KAˆ “(RH DèSOUS', A‡ K' ™QšLWSI, SÝ DÒ μEGAL»TORA QUμÕN ‡SCEIN ™N ST»QESSI: FILOFROSÚNH G¦R ¢μE…NWN: LHGšμENAI D' œRIDOJ KAKOμHC£NOU, ÔFRA SE μ©LLON T…WS' '!RGE…WN ºμÒN NšOI ºDÒ GšRONTEJ.‹ ìJ ™PšTELL' Ð GšRWN, SÝ DÒ L»QEAI.54 Da es sich bei der Ehre um einen allgemein akzeptierten Wert handelt, ohne den die Gemeinschaft nicht denkbar ist, müssen Odysseus und die übrigen Griechen Achills ehrenhafte Entscheidung hinnehmen. Etwaige alternative Werte und Ziele des Gemeinwesens spielen keine Rolle in der Diskussion mit Achill. Offenbar sind deren Gesetze und Verfahren noch zu ungefestigt, um bei der Lösung von Konflikten eine überzeugende Option zu bieten. Der appelliert deshalb an den Ehrbegriff des Achill und versucht, ihm eine erweiterte Interpretation und damit eine alternative Handlungsoption schmackhaft zu machen.55 Achill schätzt die gemeinschaftsstiftenden Verhaltensmuster, wie sie sich etwa im Gaben- und Friedensangebot des Agamemnon zeigen, gering. Sein Ehrbegriff ist ein sehr rigider, einseitiger, der sich vor allem auf die rein agonalen Prinzipien stützt und die Norm der kooperativen Reziprozität vernachlässigt. Die Konsequenzen dieser Einstellung zeigen sich im Epos deutlich: Seine Handlungen wirken sich sowohl für ihn als auch für die übrigen Griechen eher destruktiv aus.56 Für die Kampfgemeinschaft der Griechen und die Verfolgung einer gemeinsamen Sache überhaupt bedarf es eines Ehrbegriffs, der mehr Handlungsoptionen zur Verfügung stellt als die ausschließliche agonale Durchsetzung des individuellen Anspruchs auf Ehre. Nicht zuletzt zeigt die Lösung des Ehrkonflikts, in dem Achill gefangen ist, die Bedeutung solcher alternativer Werte. Nachdem Patroklos durch Hektor getötet worden ist, entschließt sich Achill zur Versöhnung mit 53 Vgl. die Einschätzungen von S. von Reden, Exchange in Ancient Greece, London 1995, 18-23, und Ferla, Achill, 25-31, zu Achills Außenseiterstellung. 54 Hom. Il. 9, 252-259: »Lieber! hat, wirklich! dir der Vater doch aufgetragen, Peleus, an dem Tag, als er dich aus Phthia dem Agamemon schickte: ›Mein Kind! Kraft werden Athenaia und Here geben, wenn sie es wollen. Du aber halte den großherzigen Mut fest in der Brust, denn Freundlichkeit ist besser! Laß ab von dem unheilstiftenden Streit, so werden mehr dich ehren die Argeier, die Jungen wie auch die Alten!‹ So trug der Alte dir auf, doch du vergißt es.« 55 Vgl. Rowe, Nature, 265: »We must, I think, allow for the possibility that the content of arete might itself be a matter of dispute in a given context.« 56 Campbell, Hero, 131, beschreibt Achill als »fated through his sense of honor to spread disturbance and disorder.«
Die Ehre der Homerischen Helden
57
Agamemnon. Sein Zorn ist nicht etwa verraucht, er hat ihn nur auf Hektor verlagert. Nun endlich begreift Achill die Kampfgemeinschaft der Griechen als eine ernstzunehmende Sache, für die er bereit ist, seine eigene verletzte Ehre zu vergessen.57 Von den beiden Handlungsalternativen, die aus seinem Ehrbegriff resultieren, nämlich entweder Agamemnon weiterhin zu zürnen oder aber seinen toten Freund zu rächen, erscheint ihm letztere als die wichtigere. Es gelingt ihm denn auch, Hektor zu erstechen, nachdem er ihm angedroht hat, ihn nicht dem Brauch gemäß bestatten zu lassen, sondern seinen Leichnam den Hunden und Vögeln zum Fraß vorzuwerfen.58 Das Angebot Hektors, ihn durch Gold und reiche Gaben von seiner Rache abzubringen, schlägt er ebenso aus wie zuvor die Gaben Agamemnons.59 Wiederum gewichtet er seine Ehre und sein Verlangen nach Rache so hoch, dass es materiell nicht aufgewogen werden kann. Erst als Priamos ihn aufsucht, willigt er in die Lösung des Leichnams ein, den er zuvor tagtäglich um das Grab des Patroklos geschleift hatte. Seinen Sinneswandel begründet der Dichter mit dem Eingreifen der Götter. Thetis erscheint Achill und mahnt ihn, über seine Rachegelüste nicht sein eigenes Leben, das nur noch kurz währen wird, zu vernachlässigen: TšKNON ™μÒN, TšO μšCRIJ ÑDURÒμENOJ KAˆ ¢CEÚWN S¾N œDEAI KRAD…HN, μEμNHμšNOJ OÜTE TI S…TOU OÜT' EÙNÁJ; ¢GAQÕN DÒ GUNAIK… PER ™N FILÒTHTI μ…SGESQ': OÙ G£R μOI DHRÕN BšV, ¢LL£ TOI ½DH ¥GCI PARšSTHKEN Q£NATOJ KAˆ μO‹RA KRATAI». ¢LL' ™μšQEN XÚNEJ ðKA, $IÕJ Dš TOI ¥GGELÒJ E„μI. SKÚZESQAI SO… FHSI QEOÚJ, ˜Ò D' œXOCA P£NTWN ¢QAN£TWN KECOLîSQAI, ÓTI FRESˆ μAINOμšNVSIN “%KTOR' œCEIJ PAR¦ NHUSˆ KORWN…SIN OÙD' ¢PšLUSAJ.60 Nach diesen Worten ist Achill bereit, von Hektor zu lassen. Als Priamos ihn aufsucht, versöhnt er sich mit ihm. Die Gründe für Achills Entscheidung, seine Rache zu beenden, sind schwierig zu gewichten. Ob es die Fürsorge seiner liebenden Mutter, die ernste Mahnung der Götter, die Einsicht in die Reduktion seiner eigenen Lebendigkeit oder die Großherzigkeit 57 Hom. Il. 19, 65-68: ›¢LL¦ T¦ μÒN PROTETÚCQAI ™£SOμEN ¢CNÚμENO… PER, QUμÕN ™Nˆ ST»QESSI F…LON DAμ£SANTEJ ¢N£GKV: NàN D' ½ TOI μÒN ™Gë PAÚW CÒLON, OÙDš T… μE CR¾ ¢SKELšWJ A„Eˆ μENEAINšμEN‹. »Doch diese Dinge wollen wir abgetan sein lassen, wenn auch bekümmert, und den eigenen Mut in der Brust bezwingen, notgedrungen. Jetzt aber, wahrhaftig! mache ich ein Ende dem Zorn. Musste ich doch nicht unbeugsam immer grollen!« 58 Ebd., 22, 330-336. 59 Ebd., 337-354. 60 Ebd., 24, 128-136: »Mein Kind! Wie lange willst du mit Wehklagen und Betrübnis dein Herz verzehren und gedenkst weder der Speise noch des Lagers? Und ist es doch gut, sich mit einer Frau in Liebe zu vereinigen! Denn nicht lange wirst du mir leben, sondern schon nahe steht bei dir der Tod und das übermächtige Schicksal. Aber vernimm mich schnell: von Zeus bin ich dir ein Bote. Erbittert sind über dich, sagt er, die Götter und er selbst ist von allen den Unsterblichen zornig, dass du mit rasenden Sinnen den Hektor behältst bei den geschweiften Schiffen und nicht gelöst hast.«
58
Die Ehre der Homerischen Helden
Priamos gegenüber angesichts des gemeinsamen Schicksals der Sterblichen ist, die Achill motivieren, wird in der Forschung unterschiedlich beurteilt.61 Ebenso die Überlegung, ob Achill sich damit vollends außerhalb der griechischen oder gar menschlichen Gemeinschaft stellt oder aber in sie zurückkehrt.62 In jedem Falle aber gelangt er zur Einsicht in die Ausweglosigkeit seiner Rache. Um seiner Ehre willen hat er sich anlässlich seines Streits mit Agamemnon nicht nur außerhalb der Kampfgemeinschaft gestellt, sondern ihr damit auch massiv geschadet. Diese Situation mündet in den Konflikt mit Hektor bzw. Priamos, und Achill würde seinem Weg konsequent folgen, wenn er auch von seiner Rache an Hektor nicht abließe. Während er im Konflikt mit Agamemnon erst nach dem Verlust seines Freundes Patroklos seine Handlungsstrategie ändert, so wird ihm im Konflikt mit Priamos die drohende Destruktivität seines Verhaltens vor der Katastrophe klar. Mit dieser Einsicht des Achill und der daraus resultierenden Handlung – der Versöhnung mit Priamos – lösen sich die Verwicklungen, in die der Held der Ilias sich verstrickt hatte. Achill eröffnet sich eine neue Handlungsoption, die nicht auf der bisher verfolgten Linie seines Ehrbegriffs liegt, sondern auch von ihm bisher geringgeschätzte Verhaltensmuster umfasst und ihm damit einen weiteren Spielraum an Handlungsmöglichkeiten bietet. Ohne ihm ein höheres Maß an Menschlichkeit oder eine Erkenntnisfähigkeit unterstellen zu müssen, die aus seiner existentiellen Krise erwachsen, hält sich Achill einfach an jene Gebote der Ehre, deren Geltung er bisher ignoriert hatte. Über die Ehre, genauer gesagt, die Praxis der positiven Reziprozität, kehrt er schließlich auf demselben Weg in die Gemeinschaft zurück, auf dem er sie verlassen hatte. Achills Geschichte macht deutlich, dass die Ehre eines Mannes in der homerischen Gesellschaft sowohl für sein Selbstverständnis als auch für den Zusammenhalt der Gemeinschaft konstitutiv ist, was bedeutet, dass Ehre auch das geeignete Mittel darstellt, beides zu unterminieren. Dass man seinem Ehrgefühl nicht ad infinitum folgen kann, liegt in der Natur der Sache. Es ist lediglich dies, was Achill erkennt. Zugleich wird diese Erkenntnis dem Leser vermittelt, womit schon in homerischer Zeit die Norm
61 Vgl. S. von Reden, Exchange in Ancient Greece, London 1995, 23; Ferla, Achill, 31. 62 Vgl. Ferla, Achill, 32: »Am Schluss scheidet Achill aus der menschlichen Gemeinschaft aus.« Zanker, Heart, 125 dagegen beobachtet einen gereiften Achill mit einem transformierten Ehrbegriff: »The place of honor in human relations is reinstated in a refined form: Social institutions are once again accepted. Due respect is shown for their sanctions, not only shame and honor, but the gods and the fair play that they and especially Zeus seek to preserve; despite internal friction. The affective drives are foregrounded, especially pity, respect, and affection, the significance of which is fully appreciated only in the experience of death.«
Die Ehre der Homerischen Helden
59
der Ehre über die künstlerische Reflexion eine pragmatische Einschränkung erhält. Aus den zentralen Handlungssträngen der Ilias kann man einige wichtige Schlussfolgerungen für die Rolle der Ehre in der homerischen Gesellschaft ziehen. Ehre prägt sowohl die Vorstellungen und das Verhalten des Einzelnen als auch die Struktur der gesamten Gesellschaft. Allerdings äußert sich die Ehre nicht nur als normenstabilisierender Habitus der homerischen Helden, sondern sie zeitigt auch dysfunktionale Effekte, die sich wiederum sowohl auf den Einzelnen als auch auf die gesamte Gesellschaft auswirken können. Tatsächlich scheint das Ehrgefühl der einzelnen Männer, sofern es einigermaßen rigoros in Taten umgesetzt wird, den Zusammenhalt und die Ziele der Gemeinschaft eher zu stören.63 Dieser wenig sozialisierende Zug ist dem Prinzip der Ehre inhärent und manifestiert sich schon in dieser provisorischen Kampfgemeinschaft der Griechen. Die Missverständnisse und Konflikte in den homerischen Epen resultieren deshalb konsequent aus den rivalisierenden Ansprüchen an das Handeln des Einzelnen. Einerseits birgt die Ehre einen Komplex von zum Teil widersprüchlichen Verhaltensimperativen, und andererseits stehen dem grundsätzlich unvereinbar die Anforderungen des Gemeinwesens gegenüber, das wiederum durch die Vorstellung von Ehre zusammengehalten wird.64 Alternative integrative Möglichkeiten oder Konfliktlösungstrategien des Gemeinwesens erscheinen in den Epen kaum, obwohl es sie durchaus gegeben hätte. Die homerische Vorstellung von Ehre bewegt sich innerhalb des Rahmens, den die habituellen Formen stecken, erhält aber ihre zeitspezifische Ausprägung. Wie der Handlungsverlauf besonders der Ilias zeigt, bestimmen die Reziprozität, d. h. vor allem der Gabentausch, das agonale Verhalten und das stetige Gewahrsein der öffentlichen Aufmerksamkeit das Verhalten der Akteure. Im Mittelpunkt des Interesses und kennzeichnend für die Ehrvorstellung der homerischen basileis scheinen dabei der materielle Aspekt der Ehrungen und die selbstverständliche Abgrenzung von anderen Bevölkerungsgruppen zu sein. Trotz der Bedeutung der Öffentlichkeit für die Ehrerweisung ist ihre Akklamation nicht hinreichend konstitutiv für die Ehre des Einzelnen, sie wird in ihrer Funktion der Zuweisung von Ehre nicht instrumentell genutzt. Der Ehrbegriff des Achill oder Agamemnon etwa gewährt dem ehrenhaften Verhalten zwar einen gewissen Spielraum, dieser allerdings ist beschränkt durch die Kopplung der Ehre an gegen63 Vgl. Adkins, Values, 314f.; Campbell, Hero, 130. 64 Campbell, Hero, 132: »The exclusive commitments which honor demands, and the extreme difficulty of retreating from a claim advanced, or a threat made in the heat of battle or dispute, constantly threaten Homeric society with moral disaster, the cause of which lies in the very heroic qualities on which it is based.«
60
Die Ehre der Homerischen Helden
ständliche Ehrerweisungen und durch ihre Abkopplung von den Notwendigkeiten einer möglichst konfliktarmen Gesellschaft. Letzteres wird in den Epen problematisiert: Sollte es der ehrenhaften Gesellschaft nicht gelingen, Möglichkeiten der Konfliktbewältigung zu schaffen, so wird sich das ehrenhafte Verhalten – exemplarisch verdeutlicht am Beispiel des Achill – als nicht gesellschaftsfähig erweisen.
III. Der Agon als Wettkampf um Ehre
Eine der wichtigsten habituellen Formen der Ehre ist das agonale Verhalten. Im Agon kann ein Mann im direkten Wettstreit mit seinen Konkurrenten seine Kräfte messen und seine Position in Relation zu den übrigen Ehrenmännern erkämpfen. Der Agon wurde von den Athenern hoch geschätzt. Er existiert deshalb nicht nur als ein ehrenhaftes Verhaltensmuster, das zum Habitus eines Ehrenmannes gehört, sondern hat mit der Veranstaltung der Panathenäen, der panhellenischen Agone und der unzähligen kleineren, lokalen Wettkämpfe einen festen Platz im Leben jedes Atheners. Als ein Feld, auf dem außerordentliche Ehre gewonnen werden konnte, stellten die Agone eine feste Einrichtung dar, die in begrenztem, wohl definiertem Rahmen die Demonstration ehrenhaften Verhaltens ermöglichte und die Ehre eines Mannes mehren konnte. Viele Quellen sprechen beredt von der Begeisterung der Athener für die einzelnen Agone.1 Das bedeutet zum einen, dass die Quellenlage relativ gut ist, zum anderen, dass der Agon sowohl soziologisch als auch subjektiv für die Athener ein so wichtiger Faktor ist, dass er die Zuschreibung von Ehre nachhaltig beeinflussen kann. Übereinstimmend wird auch das Verhältnis zwischen dem Agon und der Ehre als ein nahes beschrieben: Die Ehre geht dem Agon voraus und folgt ihm nach. Die Teilnahme am Agon erfordert bereits ein gewisses Maß an Ehre, außergewöhnliche Ehrungen aber erwarten den im Agon Siegreichen.2 Die Erforschung der Ehre in der athenischen 1 Dem Enthusiasmus der Griechen und Athener für ihre Agone verdanken sich sogar eigene künstlerische Ausdrucksformen, wie die Epinikia Pindars oder die prächtigen Panathenäischen Preisamphoren. Theokr. 12, 30-34 kann sich gar folgenden Agon vorstellen: !„E… Oƒ PERˆ TÚμBON ¢OLLšEJ E‡ARI PRèTJ KOàROI ™RIDμA…NOUSI FIL»μATOJ ¥KRA FšRESQAI. ÖJ Dš KE PROSμ£XV GLUKERèTERA CE…LESI CE…LH, BRIQÒμENOJ STEF£NOISIN ˜¾N ™J μHTšR' ¢PÁLQEN. ”/LBIOJ, ÓSTIJ PAISˆ FIL»μATA KE‹NA DIAIT´. Übersetzt von E. Steiger: »Immer gedrängt um sein Grab in den ersten Tagen des Frühlings, führen die Knaben den Streit, des Kusses Preis zu gewinnen. Jener, der seine Lippen noch süßer auf Lippen gedrückt hat, kehrt mit Kränzen beschwert zu seiner Mutter nach Hause. Glücklich, wer über die Küsse den Knaben amtet als Richter.« 2 Die Personifikation des Mannes, der über alle erstrebenswerten gesellschaftlichen Güter verfügt, ist zu seiner Zeit Alkibiades. Selbstverständlich gehört zu seinen Selbst- und Fremdbeschreibungen der Hinweis auf seine Siege in Olympia, die entscheidend zu seiner überreichlichen Ehre beitragen, vgl. Thuk. 6, 16, 3-4; Plut. Alkibiades 11. Vor einem athenischen Gericht bezieht der Sohn des Alkibiades die überreiche Ehre seines Vaters noch einmal auf dessen Erfolge in Olympia, Isokr. 16, 34: :EÚGH G¦R KAQÁKEN TOSAàTA μÒN TÕN ¢RIQμÕN ÓSOIJ OÙD' Aƒ μšGISTAI TîN PÒLEWN ºGWN…SANTO, TOIAàTA DÒ T¾N ¢RHT¾N éSTE KAˆ PRîTOJ KAˆ DEÚTE-
62
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Gesellschaft findet deshalb mit den Agonen ein Bezugsfeld, auf dem sich die ehrenhaften Verhaltensmuster sehr deutlich zeigen und von den Zeitgenossen in öffentlichen Prozeduren honoriert werden. Um die Bedeutung der Ehre für die Athener innerhalb des Bezugsfeldes der Agone zu klären, werden im Folgenden einige der ruhmreichsten Agone genauer untersucht und ihre Verwobenheit mit der Vorstellung von Ehre analysiert. Zunächst jedoch soll der Begriff »das Agonale« betrachtet werden. Die Popularität der griechischen Agone bei den Zeitgenossen hat in der Forschung zu einer beispiellosen Karriere »des Agonalen« als lang gesuchtem Schlüsselbegriff für das Begreifen der griechischen Kultur geführt. Die Forschungsdiskussion um »den griechischen Agon« wirft ein erhellendes Licht nicht nur auf diesen Begriff, sondern auch auf jenen der Ehre. Denn der Agon und die Ehre scheinen eng miteinander verbunden zu sein. Tatsächlich weisen sie einige wichtige strukturelle Gemeinsamkeiten auf und vermögen beide aufgrund ihrer abstrakten Universalität einen Anspruch auf die totale Erklärung aller übrigen Phänomene der athenischen Gesellschaft zu stellen. Um dieser heuristisch ungünstigen Situation zu entgehen, muss deshalb zuvorderst konstatiert werden, was der Begriff des »Agon« nicht leisten kann und in welchem Verhältnis er zur Ehre steht. Erst danach geht es um das ehrenhafte Verhalten der Athener in den ehrenvollsten aller Agone: den olympischen. Wegen der sprichwörtlich göttergleichen Ehre, die durch einen Sieg in einem der olympischen Agone errungen werden kann, sind die Wettkämpfe in Olympia hervorragend geeignet, die Einstellung der Athener zu den ehrenhaften Verhaltensmustern, wie sie in den Agonen an den Tag gelegt werden, zu verdeutlichen. Obwohl diese Agone fernab der athenischen Polis stattfanden, übten sie einen großen Einfluss auf die Ehre athenischer Männer aus, die an den Wettkämpfen teilnahmen und siegten. Die athenischen Olympioniken errangen auf dem Felde des Agons die höchste denkbare Ehre und kehrten damit in die demokratische Polis Athen zurück. ROJ GENšSQAI KAˆ TR…TOJ. #WRˆJ DÒ TOÚTWN ™N TA‹J QUS…AIJ KAˆ TA‹J ¥LLAIJ TA‹J PERˆ T¾N ˜ORT¾N DAP£NAIJ OÛTWJ ¢FEIDîJ DIšKEITO KAˆ μEGALOPREPîJ éSTE FA…NESQAI T¦ KOIN¦ T¦ TîN ¥LLWN ™L£TTW TîN „D…WN TîN ™KE…NOU. +ATšLUSEN DÒ T¾N QEWR…AN, T¦J μÒN TîN PROTšRWN EÙTUC…AJ μIKR¦J PRÕJ T¦J AØTOà DÒXAI POI»SAJ, TOÝJ D' ™F' AÛTOà NIK»SANTAJ PAÚSAJ ZHLOUμšNOUJ, TO‹J DÒ μšLLOUSIN ƒPPOTROFE‹N OÙDEμ…AN ØPERBOL¾N KATALIPèN. Übersetzt von C. Ley-Hutton: »Er trat mit so vielen Gespannen zum Wettkampf an, wie es nicht einmal die größten Poleis je getan hatten, außerdem mit so leistungsstarken, dass er erster, zweiter und dritter zugleich wurde. Abgesehen davon war er bei den Opfern und allen anderen Aufwendungen für das Fest so freigebig und großzügig, dass die öffentlichen Ausgaben der anderen geringer erschienen als die privaten Aufwendungen meines Vaters. Er aber schloß seine Reise als Festgesandter ab, nachdem er die Erfolge aller früheren Teilnehmer im Vergleich zu seinen hatte nichtig erscheinen lassen, der Bewunderung der Sieger zu seiner Zeit ein Ende gemacht und denen, die in Zukunft Pferde züchten wollten, keine Möglichkeit gelassen hatte, ihn zu übertreffen.«
Der Agon als Wettkampf um Ehre
63
Eine chronologische Untersuchung der athenischen Olympiasieger und ihres Status’ in der athenischen Polis zielt auf die Bedeutung der agonalen Ehre, die sie mitbrachten: Steigerte die agonale Ehre eines Olympioniken seinen Status in der athenischen Polis bzw. ließ sie sich in andere Statusmerkmale oder Privilegien konvertieren? War es überhaupt möglich, allein durch agonale Siege Ehre zu erlangen, oder musste ein gewisses Maß an Ehre schon die Voraussetzung für die Teilnahme an den Agonen bilden? Geschärftes Augenmerk wird dem potentiell dynamischen Charakter der agonalen Ehre zukommen, die wie ein Preisgeld gewonnen wird, nichtsdestotrotz aber ein Merkmal der sozialen Distinktion bleibt und sich als solches langfristig auf das soziale Leben des Siegers auswirken müsste. Begreift man die Ehre nach Pierre Bourdieu als ein symbolisches Kapital, das in andere Kapitalformen konvertierbar ist, so bietet gerade der Sieg in Olympia für einen heimkehrenden Athener die Gelegenheit zu einer solchen Transformation.3 An der Stellung der Olympioniken in der Polis zeigen sich die Einstellung und ein möglicher Wandel in der Wertschätzung agonaler Ehre und Ehrungen durch die Athener. Das Verhalten der Athener in Olympia ist das Thema des dritten Kapitels. Es konzentriert sich auf die habituellen Formen, wie sie athenische Ehrenmänner in Olympia demonstrieren. Wiederum gilt es, ehrenhafte habituelle Formen wie das reziproke Verhalten oder das zielgerichtet öffentlichkeitswirksame Agieren zu identifizieren. Die panhellenische Öffentlichkeit Olympias an den Tagen der Agone wird von den athenischen Ehrenmännern weidlich genutzt, um ihren ehrenhaften Habitus zu pflegen. Das ambivalente Verhältnis der Gleichheit der Ehrenmänner untereinander und bei den Wettbewerben bei gleichzeitiger Ungleichheit des Status und der Ehre der Anwesenden ist typisch für eine ehrenhafte Gesellschaft und lässt sich im Stadion Olympias gut beobachten. Weniger gut lässt sich bei den Agonen das der Ehre inhärente Konfliktpotential ausmachen, das im Rahmen der reglementierten Wettbewerbe selten zum Tragen kommt. Kämpfe auf Leben und Tod ereignen sich bei den Hahnenkämpfen, die in Athen auf Straßen und offenen Plätzen veranstaltet werden. Die athenischen Männer übertragen auf ihre Hähne ein ähnliches soziales Verhalten und gleiche Eigenschaften, wie sie sie aus der ehrenhaften Gesellschaft Athens kennen. Die Hahnenkämpfe symbolisieren einen wichtigen Aspekt der gesellschaftlichen Realität der Athener und geben ihnen zugleich Gelegenheit, die sozialen Mechanismen der Ehre auf einer spielerischen und 3 P. Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: R. Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheit, Göttingen 1983, 183-198, 195: »Die anderen Kapitalarten können mit Hilfe von ökonomischem Kapital erworben werden, aber nur um den Preis eines mehr oder weniger großen Aufwandes an Transformationsarbeit, die notwendig ist, um die in dem jeweiligen Bereich wirksame Form der Macht zu produzieren.«
64
Der Agon als Wettkampf um Ehre
verbalen Ebene zu reflektieren, wie sie es nicht vermögen, solange sie selbst involviert sind. Wegen der Projektion ihres eigenen Verhaltens auf die kämpfenden Hähne können die Beschreibungen dieser Schauspiele in den Quellen einen kleinen Einblick in die Vorstellung der Athener von ihrem eigenen Verhalten in der ehrenhaften athenischen Gesellschaft geben.
1. Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen Neben einem hohen Sinn für Kunst und Schönheit schrieb das 19. Jahrhundert den antiken Griechen einen besonderen Geist des Agonalen zu. Und weil die ehrgeizig geführten Wettkämpfe der Griechen ebenso greifbar sein sollten wie die sichtlich kunstvollendeten panathenäischen Preisamphoren und Diskobolen, verbreitete sich die Idee der Abhaltung olympischer Spiele, wie die Griechen sie gekannt haben sollen. In den vielen Anläufen zur Einführung dieser Spiele in der Moderne und ihrer schließlichen Erfolgsgeschichte spiegelt sich die hartnäckig behauptete Vorstellung, die Griechen seien ein ganz besonders agonales Volk gewesen. Die Entwicklung dieser Vorstellung kann als eine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Denn einmal entdeckt, etablierte sich der Begriff des Agonalen schnell in der Wissenschaftslandschaft des 19. Jahrhunderts; er wurde zu einer tragenden Säule des Pantheons, in das man die griechische Kultur hob. Dabei verband sich alles Reden, das »den Agon der Griechen« oder auch »den agonalen Geist« in den Mittelpunkt stellte, mit einem bestimmten Bild der antiken Menschen: Der »agonale Geist« sollte das Wesen der alten Griechen beherrschen und sie befähigen, sich zu der Hochkultur zu entwickeln, auf der die abendländische Zivilisation basierte. Der Agon spielte demnach im Leben der Griechen eine ähnlich zentrale Rolle wie die Ehre: Auch sie lässt sich als ein universell einsetzbares Erklärungsmodell für die verschiedensten Erscheinungsformen im Leben der Athener verwenden, und auch sie benennt einen Grundzug der Griechen, der weder soziologisch noch psychologisch oder phänomenologisch richtig zu fassen wäre, die alten Griechen aber ganz entschieden von den modernen Betrachtern entfernt. Um der Gefahr zu entgehen, allgemeine Beobachtungen der offensichtlichen Andersartigkeit der antiken Griechen zusammenzutragen und sie mit dem Prädikat »ehrenhaft« zu versehen, wurde das Konzept der Ehre, wie es hier verwandt wird, so klar wie möglich eingegrenzt. Die Grundzüge ehrenhaften Verhaltens bilden einige wenige habituelle Formen, die in ihren Erscheinungsformen sehr variabel und facettenreich sein können, eine uferlose Interpretation aber nichtsdestoweniger eindämmen sollten. Zu diesen Merkmalen ehrenhaften Verhaltens zählt
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
65
auch der Agon, der die Ehre eines Atheners begründet, bestätigt und zur Schau stellt. Bei diesem Ansatz ist der Agon ein der Ehre untergeordnetes Prinzip. Der agonale Sieg ist so wichtig, weil er eine der wichtigsten und interessantesten Möglichkeiten darstellt, sich als ein Mann von Ehre zu erweisen. Gleichzeitig weist der Agon eine Reihe von strukturellen Ähnlichkeiten zum Konzept der Ehre auf. Beide Begriffe stehen in einem engen Verhältnis zueinander, dessen vorherige Klärung für die Analyse beider unerlässlich ist. Da die Erscheinungsformen und Funktionen des Agons und der Ehre in der griechischen Gesellschaft ineinander übergingen, können sie auch als historiographische Konzepte in ähnlicher Weise funktionieren.4 Die Popularität des Agons im 19. Jahrhundert hängt vielleicht sogar damit zusammen, dass den damaligen Forschern der Ehrgedanke durchaus noch vertraut war und deshalb nicht zu etwas spezifisch Griechischem erklärt werden konnte. Eine Rekapitulation der Entwicklung des Mythos vom Agon ist nicht nur für eine sinnvolle Abgrenzung vom Begriff der Ehre geboten. Sie kann auch demonstrieren, welche Aussagen über die Griechen möglich werden, wenn eine der Ehre vergleichbare Kategorie nicht analytisch, sondern prädikativ verwandt wird. Jakob Burckhardt ist der Vater des Gedankens vom großen Geist des Agon. Er klassifiziert in seiner einflussreichen »Griechischen Kulturgeschichte« die Jahrhunderte entsprechend der Mentalität, die er bei den Menschen in jenem Zeitraum beobachtet. Das sechste Jahrhundert erhält den Namen des »kolonialen und agonalen Menschen«, der der vorherrschende Typus jener Spanne Zeit zwischen dem heroischen Jahrhundert des Homer und dem fünften war. Eine bestimmte Definition des Agon gibt Burckhardt nicht. Was er darunter versteht, klingt relativ schlicht und allgemein: »der Agon ist das allgemeine Gärungselement, welches jegliches Wollen und Können, sobald die nötige Freiheit da ist, in Fermentation bringt. In dieser Beziehung stehen die Griechen einzig da. ... Nur in freien und kleinen Aristokratien konnte dieser Wille der Auszeichnung unter seinesgleichen vor gewählten oder sonst objektiv gegebenen Richtern zur Blüte kommen, und auch hier bedurfte es einer Nation wie der Griechen; die Römer, die sich
4 Vgl. die Parallelen, die H.D. Evjen, Competitive Athletics in Ancient Greece: The Search for Origins and Influences, in: Oath 16 (1986), 51-56, 51, zieht: »This competitive drive can then be blended with an analytic tool borrowed from cultural anthropology, i. e. the concept of a shame culture which demands both success and communal knowledge and approval of success. This combination of an innate competitive drive with the performance demands of a shame culture can be invoked to explain the intensity, even ferocity, not only of competitive athletics but also of other aspects of Greek antiquity.«
66
Der Agon als Wettkampf um Ehre
von ihnen hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass sie nichts ›Zweckloses‹ mögen, würden es zu dieser Entwicklung nicht gebracht haben.«5 Die homerische Maxime, stets erster und bester sein zu wollen, ist lediglich, so Burckhardt, »ein unschuldiger Anfang der späteren Entwicklung« des Agonalen; im heroischen Zeitalter handelt es sich noch um einen »heiteren Zeitvertreib«, und »erst das agonale Zeitalter sollte das ganze Leben auf diese Sache orientieren.«6 Der Begriff des Agon umfasst dabei Wettkämpfe aller Art, die die Gelegenheit verschafften, »dass man sich unaufhörlich untereinander maß und verglich und zwar durch Übungen, bei denen es auf einen direkten praktischen Nutzen nicht abgesehen war.«7 Agone in diesem Sinne stellten die panhellenischen Spiele, besonders Olympia, dar, aber auch Rechtshändel, die philosophischen Gespräche und Wetten bei Symposien, gymnastische Übungen in den Gymnasien und sogar wettkämpfende Hähne und Wachteln.8 Das Verhältnis zwischen Ehre und dem Agon, wie Burckhardt ihn versteht, ist evident und wird von ihm explizit ausgeführt: »Das wahre Ziel des Kampfes aber ist der Sieg an sich, und dieser, namentlich in Olympia, gilt als das Höchste auf Erden, indem er dem Sieger verbürgt, was im Grunde das Ziel jedes Griechen ist, dass er im Leben angestaunt und im Tode hochgepriesen werden muss.«9 Die Interdependenz beider Ziele klingt schon in dem Begriff FILOTIμ…A an, mit dem Burckhardt diese Form des Wetteiferns um den Sieg, der die Ehre bringt, bezeichnet.10 Ein gewisses Maß an Ehre gilt auch als Voraussetzung für die agonale Betätigung. Burckhardt schätzt die Exklusivität der sportlichen Form des Ehrstrebens hoch ein. Seine aristokratischen Pferdebesitzer und Wagenlenker pflegen bei den panhellenischen Spielen nicht zuletzt ihre Geselligkeit und leisten sich den Luxus symbolischer Preise, bis ihnen die Demokratie »den Agon verleidet oder unmöglich gemacht hat«.11 Der Einfluss dieser Gedanken Burckhardts auf seine Fachkollegen kann kaum überschätzt werden. Die angeführten Stellen markieren den Beginn zweier wesentlicher Thesen, die lange die Forschungsdebatten um die Ent5 J. Burckhardt, Der koloniale und der agonale Mensch, in: ders., Griechische Kulturgeschichte, Bd. IV, München 1977 (ND Basel 1956-57), 82-117, 84f. 6 Ebd., 88. Burckhardt scheint von einem linearen Wachstum auszugehen, obwohl ihm I. Weiler, !„ÒN ¢RISTEÚEIN. Ideologiekritische Bemerkungen zu einem vielzitierten Homerwort, in: Stadion 1 (1975), 199-227, »Reserven gegenüber einer inneren Verflechtung des Inhalts der homerischen Worte mit dem Agonalen« unterstellt, 201. 7 Burckhardt, Mensch, 90. 8 Ebd., 89-94. 9 Ebd., 88, vgl. ebd. 116f. 10 Ebd., 89f. Die Ernsthaftigkeit dieses Ehrgeizes erweist sich auch in der Bekränzung der Sieger, die keine materiellen Preise erwarten, wie es noch bei Homer üblich ist. 11 Ebd., 95.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
67
wicklung der olympischen Spiele und um den griechischen Agon an sich dominierten. Zum einen war das die These des fortschreitenden Niedergangs der olympischen Spiele durch die entstandene athenische Demokratie. Letztere wirkt sich auf die sportlichen Wettkämpfe in Gestalt von zunehmend sich beteiligenden nichtadeligen Athleten aus, die sich als professionelle Wettkämpfer gebärden und von den Einkünften ihrer nicht nur ehrenvollen, sondern auch finanziell einträglichen Siege leben. Diese Männer trainieren und siegen nicht entsprechend dem eigentlichen Gedanken der Spiele, sie kommerzialisieren und instrumentalisieren sie, so das Diktum der Forscher.12 Als noch langlebiger, weil noch enger mit den wissenschaftspolitischen Bedingungen verbunden, erwies sich aber die Idee des »agonalen Menschen«. Nicht nur der Grundgedanke, diesen Wesenszug der Griechen zu einem Hauptmerkmal ihrer kulturellen Leistungen zu machen, stammt von Burckhardt, sondern schon bei dem Wort »agonal« handelt es sich um seine Schöpfung. Das griechische Wort ¢GèN bezeichnete ursprünglich die Versammlung und den Versammlungsplatz, schon in der Ilias aber auch die Versammlung zu festlichen Spielen bzw. den Ort für solche Spiele.13 Wettkampf, Wettstreit und Wettspiel sind im Deutschen die Wörter, die der Bedeutung des griechischen Wortes ¢GèN am nächsten kommen. Ungeachtet der linguistisch möglichen und einiger bestehender griechischer Adjektivbildungen zum Terminus des ¢GèN, hat Burckhardt auf den Sprachschatz der Römer zurückgegriffen und mittels eines lateinischen Suffixes sein Kunstwort »agonal« bzw. in der substantivierten Form »das Agonale« gebildet.14 Der Begriff des griechischen ¢GèN erlangt seine Bedeutung damit von vornherein über den Umweg der Fremdwahrnehmung der Römer, die das Wort von den Griechen übernehmen, und es erweitert sich um die Sinngebung der späteren Rezipienten. Der Wettstreit, der dem Terminus ursprünglich seinen Namen gegeben hatte, wird durch die Neuschöpfung eines ganzen Begriffsfeldes zu einer beispielhaften Tätigkeit, die Zeugnis ablegt für eine vollkommene geistige Haltung. 12 Vgl. zu der Forschungsdebatte im Folgenden; zuletzt gegen die Dekadenzthese: I. Weiler, Gymnastik und Agonistik im hellenistischen Gymnasion, in: D. Kah und P. Scholz (Hg.), Das hellenistische Gymnasion, Berlin 2004, 25-46. 13 W. Gemoll, Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch, erw. v. K. Vretska, eingel. v. H. Kronasser, München 19919, 9; W. Pape, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, Bd. 1 A-K, bearb. v. M. Sengebusch, Braunschweig 19143, 30f.; vgl. T.F. Scanlon, the Vocabulary of Competition, Agôn and Aethlos, Greek Terms for Contest, in: Arete 1, 1 (1983), 147-162, 151. 14 Vgl. zu diesem Schöpfungsprozess J. Huizinga, Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 1956, 75; V. Ehrenberg, Das Agonale, in: ders., Ost und West. Studien zur geschichtlichen Problematik der Antike, Brünn 1935, 63-96, 64; W. Decker, Sport in der griechischen Antike. Vom minoischen Wettkampf bis zu den Olympischen Spielen, München 1995, 1011.
68
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Obwohl es sich beim »Agonalen« gerade nicht um einen eigentlich griechischen Begriff handelte, wurde der »agonale Geist« von der Forschung als originär hellenischer Grundzug anerkannt. Betrachtet man die schöngeistigen Hymnen auf den ›freien‹ und ›kulturschaffenden‹ griechischen Menschen, so entsteht der Eindruck, Burckhardt habe mit seinem Konzept des Agonalen endlich den lang erhofften Begriff bereitgestellt, mit dem sich die Besonderheit der Griechen und ihr Anspruch auf die Vorrangstellung unter allen Kulturen zum Ausdruck bringen ließen. Kaum ein kulturgeschichtlich orientiertes Forschungsprojekt kam in der Folgezeit ohne die Beteuerung aus, bei den Griechen handele es sich um ein wahrhaft agonales Volk und der Agon durchdringe bei den Griechen alle Lebensbereiche.15 Dabei wurde die ursprüngliche Konzeption des »agonalen Menschen« zur Beschreibung einer Phase in der Entwicklung der Hellenen als überflüssige Beschränkung empfunden: Die Griechen, besonders die Athener, waren immer und überall agonal gesinnt. »Es war aber nicht nur in Delphi und Olympia, es war überhaupt nicht nur in den Schranken der Rennbahn, dass die Hellenen ihre Wettkämpfe hielten; ihr ganzes Leben, wie es uns in der Geschichte des Volks vorliegt, war ein großer Wettkampf.«16 Tatsächlich konnte »das Agonale« durch die gesamte griechische Geschichte verfolgt werden. Es zeigte sich allen idealistischen Abstraktionsversuchen zum Trotz denn doch am deutlichsten auf der Rennbahn, d. h. dort, wo die Griechen Wettkämpfe veranstalteten und sich im Wettstreit miteinander maßen. Diese wissenschaftlich belegbaren Manifestationen des »agonalen Geistes« zeigten zwar nicht die Allgegenwart, doch aber die Wichtigkeit der Agone für die antiken Griechen. Von Homer bis Alexander gab es immer wieder Veranstaltungen gymnischer oder musischer Natur, 15 Burckhardts Konzept wirkte so überzeugend, dass sich I. Weiler noch 1974 verpflichtet fühlte, die postulierte Besonderheit des griechischen Agon als unhaltbare These zu entlarven: »Die Vielfalt aller dieser verschiedenen Vorstellungen, welche die Griechen mit dem Wort ¢GèN verbinden, legt bei einem Seitenblick auf andere Völker den Gedanken nahe, dass es sich bei diesen Formen des Rivalisierens im Alltagsleben genauso wie im Wettkampf oder im Krieg um ein allgemein menschliches, um ein anthropologisches Phänomen handelt.«, I. Weiler, Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf, Darmstadt 1974, 35. Den aktuellen Stand der Forschung problematisiert M. Golden, Sport and Society in Ancient Greece, Cambridge 1998, 29, folgendermaßen: »The Greeks were a competitive people. ... In the last while, however, the ascription of a uniquely agonistic spirit to the Greeks has lost much of its appeal, appearing Hellenocentric at best, at times even racist.« 16 E. Curtius, Der Wettkampf, in: ders., Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden und Vorträge, Bd. 1, Stuttgart/Berlin 19035, 132-147, 134. Auch Curtius wiederholt das bekannte Diktum, um zu orakeln, dass »jener Grundzug des arischen Volkscharakters – wetteifernde Thatenlust – bei den Hellenen in größter Reinheit und vorbildlicher Bedeutung sich uns offenbart.«, 133f. In jüngerer Zeit noch beherrscht der agonale Geist sowohl den Bereich der Tragödie J. Duchemin, L’ !'7. dans la tragédie grecque, Paris 19682, 235: »La forme de l’¢GèN est inhérente à l’esprit grec.«; wie auch jenen der Literatur, so die These von W.J. Froleyks, Der !'7. ,/'7. in der antiken Literatur, Diss. phil., Bonn 1973.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
69
die vor einem Publikum oder Gremium ausgetragen wurden, das sowohl das Schauspiel der Wettkämpfe genoss als auch die Entscheidung über die Platzierung der Sieger fällte. Die Chronologie der sich im Wettstreit miteinander messenden Männer beginnt in vielen Forschungsbeiträgen mit den von Homer erzählten Leichenspielen des Patroklos und wird über die Stationen der für die jeweilige Zeit ergiebigsten Quellen, so über die von Herodot berichtete Werbung um Agariste, über die von Pausanias geschilderten Eindrücke des olympischen Geländes verfolgt bis zum Gipfel allen hellenischen Ehrgeizes: dem Sieg im größten der panhellenischen Spiele, in Olympia.17 Die Bekränzung der Olympioniken steht für die immaterielle, rein geistige Dimension des erstrebten Preises. Sie lässt den Agon als einen Wert für sich erscheinen und verleiht gerade den panhellenischen Spielen die Aura des in den Quellen so eifrig gesuchten »agonalen Geistes«. Der Unterschied zu den Wettkämpfen in anderen Kulturkreisen liegt vornehmlich in der griechischen Verachtung des Materiellen.18 Das Zweckfreie gilt als Beweis für den hohen Wert des Wetteifers für die Griechen: »Das Agonale ist Trieb und Wille zum Wettkampfe, zum Sich-Messen um des Sieges willen, nicht für ein noch so wertvolles und allgemeingültiges praktisches Ziel, erst recht nicht für materiellen Gewinn, aber auch nicht zu kultischem oder magischem Zweck. Es ist der Wille zum ›Wettkampf an sich‹«.19 Diese schöngeistige Verherrlichung der alten Griechen wird offensichtlich befördert durch Begriffe, deren Abstraktionsniveau ideal ist für die Projektionen derer, die sich ihrer bedienen. Eine solche Auffassung des Agons hat große Gemeinsamkeiten mit einem sehr weiten Begriff von Ehre. Auch sie kann beschrieben werden als ein Lebensprinzip, das zu jeder Zeit an jedem Ort die Handlungen der Menschen prägt. Aber auch ohne diesen Fluchtpunkt im Unendlichen werden auf der strukturellen Ebene entscheidende Parallelen zwischen dem Agon und der Ehre sichtbar, die in For-
17 Ehrenberg, Agonale,65-73, verfolgt diese Stationen bis zur Demokratie, die auch im Agonalen den griechischen Adel beerbte; vgl. H. Berve, Vom agonalen Geist der Griechen, in: ders., Gestaltende Kräfte der Antike, München 1966, 1-20. Für A.E. Raubitschek, Zum Ursprung und Wesen der Agonistik, in: W. Eck [u.a.] (Hg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff, Köln 1980, 1-5, geht »der agonale Geist der griechischen Kultur« bereits auf die minoische Zeit, »auf die geheimnisvollen Kreter« zurück, 3f. 18 Vgl. Curtius, Wettkampf, 146, der die Begriffe Ehre und Agon auf die dualistischen Pole der Gegenwart und der Griechen aufteilt: »An Eifer und Wetteifer fehlt es freilich nirgends unter den Menschen ... Aber da handelt es sich um Gewinn und Besitz, um Ehre und Einfluss oder eitlen Sinnengenuß; unser gemeinsamer Beruf fordert einen Wetteifer, wie ihn die Hellenen geübt haben, den Wetteifer, welcher in der freien Entfaltung aller Kräfte, im selbstverläugnenden Streben nach dem höchsten Ziele seine volle Befriedigung findet.« 19 Ehrenberg, Agonale, 65.
70
Der Agon als Wettkampf um Ehre
schung wenig beachtet worden sind.20 Als konstituierend für den Agon gelten das Vorhandensein von Öffentlichkeit, die Gleichheit aller um die Ehre sich streitender Männer und das Wissen um die Regeln bzw. deren Einhaltung.21 Das Streben nach einem Sieg im Wettkampf erfüllt einige der formalen Bedingungen ehrenhafter Auseinandersetzungen. Die Ehre ist dabei sowohl Bedingung für die Teilnahme am Agon als auch Folge eines agonalen Sieges. Da beide Begriffe eng miteinander verbandelt sind, werden sie häufig gemeinsam analysiert, wenn es darum geht, grundsätzliche Züge des einen oder der anderen zu klären. Deshalb kann die wissenschaftliche Debatte um den Agon, der ein im Vergleich zur Ehre relativ überschaubares und eindeutig konstruiertes Konzept darstellt, elementare Aspekte auch des Konzeptes der Ehre beleuchten. Einerseits, weil beide Begriffe von den meisten Theoretikern ohnehin in ein enges Abhängigkeitsverhältnis gestellt werden, und andererseits, weil die Schnittmenge des Agons und der Ehre derart groß ist, dass die grundlegenden Problematiken des einen auch immer jene der anderen tangieren. So unterhalten der Agon und die Ehre ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zum Begriffspaar des Spiels und des Kriegs. Eingebettet sind die Fragen, ob es sich beim Agon eher um einen spielerischen oder um einen kriegerischen Wettkampf handelt, in ein umfassenderes Bild der Griechen: Während das Spiel zu jenen Kulturleistungen gehört, mit denen die Hellenen sich einen Namen gemacht haben, steht der kriegerische Agon im Geruch des primitiven, »barbarischen« Verhaltens, das nach den Perserkriegen die Gelegenheit zur Bewährung im Kampf sichern sollte. In letzterem Falle wäre die sich durch die Jahrhunderte ziehende Begeisterung der alten Griechen für den Agon ein ärgerlicher Befund, der sich schlecht einordnen ließe in die Vorstellung der Griechen als eine große 20 Nur einige verbindenden Elemente haben eingehendere Aufmerksamkeit beansprucht. Das beiden gemeinsame Strukturelement der Reziprozität der Handlungen wird sowohl von den Theoretikern der Ehre als auch von jenen des Agon regelmäßig hervorgehoben. Bourdieu, Entwurf, 15-25, überschreibt sein dem Wetteifer gewidmetes Kapitel mit dem bezeichnenden Titel »Die Dialektik von Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung«. Dabei schwankt auch er zwischen den Vorstellungen von Spiel und Krieg: »Die Natur der Erwiderung also ist es, die der Herausforderung (oder Beleidigung) ihren Sinn und sogar ihre Eigenschaft als Herausforderung oder Beleidigung, im Gegensatz zur bloßen Aggression, gibt.«, 18. Die sportliche Reziprozität beschreiben K. Blanchard und A. Cheska, The Anthropology of Sport, South Hadley, Mass. 1985, 218: »The third factor integral to sport participation is the mutual interest in cooperative give-andtake through orderly procedures. ... A controlled yet variable tension exists between members of one’s own and opposing teams, individual and group goals, offense and defense, affectionate identification and hostile rivalry, competition and cooperation.« Die Autoren nennen die Reziprozität hier als dritten Faktor, der sportliches Verhalten qualifiziert als »a planned ritualization of conflict.«, 217. 21 Vgl. Burckhardt, Mensch, 90-95; A.E. Raubitschek, Sport und Zivilisation, in: Nikephoros 4 (1991), 9-11.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
71
Kulturnation einerseits und in die noch allgemeinere Prämisse der fortschreitenden kulturellen Verfeinerung andererseits. Das Verhältnis des Agons zur Ehre ist entscheidend für seine evolutionstheoretische Einordnung. Dient der Agon dem Erwerb von Ehre, die einst auf dem Schlachtfeld erobert werden musste, das nun nach Olympia verlagert worden ist, so erhält er eine kriegerische Qualität. Streben die Griechen aber im »agonalen Geist« danach, sich miteinander zu messen, so wird die Ehre des Siegers zur Nebensache, der Agon als Hauptsache bekommt eine spielerische Qualität. Johan Huizinga hat sich in seiner umfassend angelegten Kultursoziologie wie kein anderer mit dem Thema des Spiels und des Spielens beschäftigt. Er subsumiert den Agon der Griechen unter seinen Begriff des Spiels. Auch er schreibt den Griechen einen ausgeprägten agonalen Geist zu: »Es mag wahr sein, dass erst mit den großen, ganz Hellas vereinigenden Spielen zu Olympia, auf dem Isthmus, zu Delphi und bei Nemea der Wettkampf für ein paar Jahrhunderte das Lebensprinzip der griechischen Gemeinschaft wird, der Geist fortwährenden Wettkampfs beherrschte die hellenische Kultur auch schon vorher und auch danach.«22 Ganz entschieden wendet er sich aber gegen die These, das Agonale sei etwas spezifisch Griechisches. Huizinga zufolge findet sich der Agon, ebenso wie das Spiel überhaupt, bei allen Völkern der Erde zu allen Zeiten. Ebenso entschieden weist Huizinga Einwände von Seiten der altgriechischen Philologie zurück, der Begriff des ¢GèN habe nichts Spielerisches, Unzweckmäßiges, Tändelndes an sich; es sei ein verbreiteter Irrtum, den Terminus der olympischen »Spiele« gedankenlos von den Römern zu übernehmen, die in diesen griechischen Veranstaltungen eben nur »Spiele« sahen.23 Die Richtigkeit der philologischen Auffassung des Wortes bestreitet Huizinga nicht, er erwähnt vielmehr Parallelen einer mangelnden sprachlichen Unterscheidung zwischen »Spiel« und »Wettkampf« in anderen Kulturen. An der Zuordnung des Agon zum Spiel hält er fest, weil dieser alle formalen, definitorischen Kennzeichen des Spiels aufweist. Die Ernsthaftigkeit, den Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit, den die Griechen in ihren Wettkämpfen an den Tag legten, erklärt Huizinga wieder ganz auf einer Linie mit der These des Agons als Lebensprinzip: »Der Wettstreit in allem und bei allen Gelegenheiten wurde bei den Griechen eine so intensive Kulturfunktion, dass man ihn als ›gewöhnlich‹ und vollwertig gelten ließ und nicht mehr als Spiel empfand.«24
22 Huizinga, Homo, 76. 23 Ebd., 35-37. 24 Ebd., 37.
72
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Im Agon kann zwar das kämpferische Element, das bei den wetteifernden Griechen immer mitschwingt, zeitweise die Oberhand über das Spielerische gewinnen, aber das ist eine temporäre Erscheinung, die das Eigentliche des Agons nicht berührt: »Es war nicht ein Übergang ›aus Kampf zu Spiel‹, auch nicht ›aus Spiel zu Kampf‹, sondern ›in spielendem Wetteifer zu Kultur‹, und dabei überwuchert zuweilen der Wettkampf das Kulturleben und verliert gleichzeitig sozusagen seinen spielhaften, geweihten und kulturellen Wert, um zu purer Rivalitätsleidenschaft auszuarten.«25 Huizinga weist die These Burckhardts, die Agone hätten in nichtkriegerischen Zeiten einen Ersatz für ehrenvolles Kämpfen und das Ausleben von Aggressionen geboten, als durch die moderne Anthropologie und Ethnologie falsifiziert zurück.26 Im Sinne dieses Spielebegriffs handelt es sich beim Agon um ein zweckfreies Tun. Entsprechend ist die Ehre, die durch einen Sieg gewonnen wird, vielleicht Anreiz und Belohnung, nicht aber Sinn und Zweck des Spiels, denn das muss das Spiel nach Huizingas Definiton selbst sein. Der Wettkampf als eine Abart des Spiels hat verglichen mit anderen spielerischen Tätigkeiten allerdings weniger den Charakter der Selbstgenügsamkeit. Sobald man gegen andere spielt, kann man auch gegen sie gewinnen, d. h. sich als überlegen erweisen und diese Überlegenheit möglicherweise auch auf andere Bereiche übertragen. »Und hiermit ist etwas mehr gewonnen als das Spiel selbst. Man hat Ansehen gewonnen, Ehre davongetragen, und diese Ehre und dieses Ansehen kommen stets unmittelbar der ganzen Gruppe zugute, der der Gewinnende angehört. ... Primär ist das Verlangen, den anderen zu übertreffen, der Erste zu sein und als solcher geehrt zu werden. ... Die Hauptsache ist, ›gewonnen zu haben‹.«27 Huizinga möchte die griechischen Agone als Spiele begreifen, die eng mit der kulturschaffenden Fähigkeit der Hellenen verbunden sind. Trotz seiner Bedenken gerade im Hinblick auf die alten Griechen, die ihre Agone mit einem ganz ungewöhnlichen Ernst betrieben, bezieht er doch die Wettkämpfe in seinen Begriff des Spiels mit ein.28 Sobald er die griechischen Agone als Spiel kategorisiert hat, sind sie nicht mehr exklusiv griechisch und können wie die Spiele bei allen Völkern kulturschaffend wirken. Die Ehre des Siegers tritt hinter dem Bewusstsein des Erfolgs im Spiel zurück,
25 Ebd., 78. 26 Ebd., 76. Die Anthropologen Blanchard und Cheska, Anthropology, 57f., hingegen stellen mit Bezug auf Huizinga fest: »In other words, in those societies with a high frequency of warfare activities there is a great likelihood that there will also be extensive combative sport behavior. Conversely, those people who do not fight generally do not participate in such sport activities.« 27 Huizinga, Homo, 55. 28 Ebd., 53-55.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
73
sie ist »ein Triumph, der sich in nichts Sichtbares oder Genießbares umsetzt und nur im Gewinnen selbst besteht«.29 Dezidiert gegen diesen kultursoziologischen Entwurf wenden sich Teile der Forschung, die den griechischen Agon fest in der Sphäre des Krieges verankert sehen – auch um den Preis des Zusammenbruchs eines sorgfältig konstruierten kulturevolutionären Modells.30 Sie rücken die Verbindung von antiken Agonen und außeralltäglichem Spiel in den Bereich der »invented tradition«:31 »So entdeckten moderne Kulturanthropologen und Sportwissenschaftler eine dem griechischen Agon innewohnende Idee des Spiels als wesentliches Element, die es in Wahrheit nie gegeben hat und nach dem Selbstverständnis der im Altertum an den Wettkämpfen Beteiligten auch gar nicht geben konnte!«32 Während die Ehre in einem als Spiel deklarierten Agon quasi der Mehrwert ist, der dem Sieger unbeabsichtigt zufällt, ist das Trachten des Wettkämpfers in einem Agon, der als Krieg begriffen wird, allein auf den Ausgang des Kampfes, auf seinen Gewinn gerichtet. Die dem Sieger zukommende Ehre ist hier der eigentliche Zweck des Agons, der nur von seinem Ausgang her für den Teilnehmer sinnvoll oder aber zwecklos war, je nachdem, ob er gewonnen oder verloren hat. Die Konsequenz dieser Perspektive ist ein völlig anderes Bild der olympischen »Spiele«: »In Olympia und bei den anderen Panhellenischen Festen wurde nicht gespielt, sondern mit kompromissloser Härte gekämpft. ... Der klassische Wettkämpfer strebte durch persönliche Selbstdarstellung nach Ruhm und Ehre bei den Zeitgenossen und der Nachwelt. Dabei nahm er Risiken ästhetischer, gesundheitlicher oder psychischer Art, ja selbst die Gefahr für Leib und Leben, auf sich.«33 Diese Gefahren, entstanden durch ein hohes Maß an physischer Gewalt in den Agonen der Antike, sind auch für Norbert Elias Beleg genug für das 29 Ebd., 55. 30 Vgl. T.F. Scanlon, Combat and Contest: Athletic Metaphors for Warfare in Greek Literature, in: S.F. Bandy (Hg.), Coroebus Triumphs. The Alliance of Sports and the Arts, San Diego 1988, 230-244, 235: »Thus in the realm of training the assimilation of athletics and military affairs is total for the Greeks by the Hellenistic age although it has roots in Homeric or pre-Homeric times.« Zu diesen Überlegungen gehören generell die Erwägungen der Entwicklung von Sportgeräten aus Waffen, der Gründe für das Fehlen von Mannschaftssportarten bei den panhellenischen Spielen u.ä., vgl. M. Lämmer, Hier irrte Huizinga. Zum Begriff des Spiels in der griechischen Antike, in: G. Pfister, T. Niewerth und G. Steins (Hg.), Spiele der Welt im Spannungsfeld von Tradition und Moderne, Berlin 1996, 34-39, und Golden, Sport, XI. 31 Mit dem auf E. Hobsbawm zurückgehenden begrifflichen Konzept kann auch die durch Pierre de Coubertin popularisierte Vorstellung von der Identität antiken Sports und Spielen bezeichnet werden, vgl. M. Biddiss, The invention of modern Olympic tradition, in: ders. und M. Wyke (Hg.), The Uses and Abuses of Antiquity, Bern 1999, 125-143. 32 Lämmer, Huizinga, 37. 33 Ebd., 36f.
74
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Kriegerische der griechischen Wettkämpfe und für die gravierenden Unterschiede zu modernen Sportveranstaltungen.34 Elias betont die »Unzivilisiertheit« des antiken Sports und vergleicht ihn mit den zivilisatorischen Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen. Er verweist dabei auf andere nahe Verwandte des Begriffspaares Ehre und Agon: Ihre jeweilige Stellung zur Moderne ist ebenso ambivalent wie jene zum Spiel oder zum Krieg. Denn gerade die olympischen Spiele und der Gedanke der körperlichen Fitness werden als antike Errungenschaften, die es in der Moderne wieder aufzunehmen bzw. zu pflegen gilt, immer wieder gern zitiert. Die scheinbar separierte Welt des Sports innerhalb völlig fremder gesellschaftspolitischer Bedingungen erleichtert den Anspruch, an die sportlichen Vorstellungen der alten Griechen anzuknüpfen. Dieser Anspruch ist nach Meinung von Elias verfehlt. Er betrachtet den Rekurs moderner Sportfans auf den Agon der vorbildlichen griechischen Antike als eine »invented tradition«: »Das Ethos der Wettkämpfer, die Standards, nach denen sie bewertet wurden, die Wettkampfregeln und der individuelle Einsatz im Wettkampf unterschieden sich in vielerlei Hinsicht von den entsprechenden Merkmalen des Sports. Viele der bedeutenden Abhandlungen zu diesem Thema zeigen eine unverkennbare Tendenz, die Unterschiede abzuschwächen und die Ähnlichkeiten zu betonen.«35 Als ein Beispiel für den Unterschied zwischen antikem und zeitgenössischem Wettkampf wählt Elias das höhere Maß an erlaubter und ausgeübter physischer Gewalt in den griechischen Kampfagonen, besonders beim Pankration. Obwohl es sich bei dieser Kampfart um die brutalste handelte, bildeten die Regeln, die ernsthafte Verletzungen des Gegners zuließen, keine Ausnahmeerscheinung in der allseitigen Akzeptanz von Gewalt im Sport und in der griechischen Gesellschaft überhaupt. Der gewalttätige Impetus der antiken Wettkampfbedingungen lässt nicht nur die mit etwas Phantasie gezogenen Traditionslinien zu modernen Sportveranstaltungen obsolet erscheinen, sondern wirft ein bezeichnendes Licht auf die Problematik des allzu gewollten Vergleichs: Er impliziert eine Zivilisationstheorie, die den Blick für bestimmte dokumentierte Phänomene der Antike eher verstellt denn enthüllt. Denn die fortschreitende Zivilisierung und Kultivierung einer Gesellschaft lässt sich messen an der Erhöhung der Schwelle zur Gewaltausübung und der Bereitschaft, Gewalt nicht zu tolerieren. Die unbestreitbar hoch entwickelte Kunst und Kultur der antiken Griechen steht aus dieser Perspektive in eklatantem Widerspuch zur Durchfüh34 N. Elias, Die Genese des Sports als soziologisches Problem, in: ders. und E. Dunning, Sport im Zivilisationsprozess, Münster 1983, 9-46. Der Unterschied zwischen dem Ringen als Sport und dem Ringen als Agon etwa besteht in der Gewalttätigkeit des Kampfes. 35 Ebd., 15.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
75
rung primitiver gewaltträchtiger Agone. »So begegnet man der Vorstellung, dass man der Antike und ihren Leistungen Unrecht tut, wenn man zugibt, dass das Maß der in ihr zulässigen physischen Gewalt, auch in den Wettkampfspielen, höher war und dass die Scham- und Peinlichkeitsschwellen der Menschen, die sich in einem solchen Wettkampf gegenseitig zum Ergötzen der Zuschauer verwundeten oder gar umbrachten, entsprechend niedriger lagen als in unserer eigenen Gesellschaft.«36 Ursache für diese voreingenommene Perspektive, die laut Elias sowohl das Bild der griechischen als auch der eigenen Gesellschaft, vor allem aber der Beziehung zwischen beiden verfälscht, ist ein moralisch polarisierendes Verständnis des Zivilisationsprozesses. »Die vorherrschende Neigung, Begriffe wie ›zivilisiert‹ und ›unzivilisiert‹ im Sinne von ethnozentrischen Werturteilen zu gebrauchen, als absolute und verbindliche moralische Urteile ..., verwickelt unsere Überlegungen offensichtlich in unlösbare Widersprüche.«37 Auf solche moralischen Urteile folgen inkonsistente Kategorisierungsversuche der griechischen Gesellschaft, die auf einigen Gebieten vollendete Schönheit und Harmonie schafft, sich auf anderen aber wie selbstverständlich gewaltsam äußert. Die Berücksichtigung beider Phänomene verhindert eine Einordnung der Griechen auf einer gegebenen Skala der fortschreitenden Zivilisation. Das Problem liegt natürlich nicht bei den Griechen, sondern in der Vorstellung einer linearen kulturellen Evolution, die bestimmte Phänomene mit einer Etikettierung versieht, die eine fruchtbare Analyse von vornherein blockiert. Die Gewaltbereitschaft der Teilnehmer an antiken Agonen ist ein gutes Beispiel für die geringe Ähnlichkeit der alten mit den neuen olympischen »Spielen«, deren oft betonte Tradition auf einer bestimmten Vorstellung von der Entwicklung der Kulturen beruht. Wie weit man diese antike Tradition der Agone von modernen Anknüpfungspunkten entfernen kann, wenn man die Griechen von der Last der Zivilisiertheit befreit, zeigt niemand besser als Friedrich Nietzsche. Einer teleologischen Evolutionstheorie des Menschen erteilt Nietzsche von vornherein eine Absage; wohl aber hält er die Griechen für ein »agonales Volk«.38 Damit meint er ebenso ihre Begeisterung für die Veranstaltung von Agonen, wie auch eine generelle Lebenseinstellung, die das gesamte Leben und die politische Gemeinschaft trägt: »Das ist der Kern der hellenischen Wettkampf-Vorstellung: sie verabscheut die Alleinherrschaft und fürchtet ihre Gefahren, sie begehrt, als Schutzmittel gegen das Genie – ein zweites Genie.«39 In diesem Sinne wirkt der Agon kulturschaffend: er stachelt den 36 37 38 39
Ebd., 16. Ebd., 17. F. Nietzsche, Homers Wettkampf, in: ders., Der griechische Staat, Stuttgart 1942, 236-246. Ebd., 242f.
76
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Ehrgeiz soweit an, dass er für Athen den meisten Nutzen bringt. Bei den vielen veranstalteten Agonen kam die Ehre des erfolgreichen Wettkämpfers seiner Heimatpolis zugute und auf politischem Gebiet hielt der Wettstreit der ehrgeizigsten Männer die Polis im Gleichgewicht der Kräfte.40 Erst dieser Wettkampfgedanke ermöglichte überhaupt ein gemeinschaftliches Handeln, da er die natürliche Rivalität und Aggressivität der einzelnen Individuen in bestimmte Bahnen lenkte. Darin besteht die kulturelle Leistung der Griechen im Gegensatz zu den vorhomerischen Menschen: Sie haben begriffen, »dass ohne Neid, Eifersucht und wettkämpfenden Ehrgeiz der hellenische Staat wie der hellenische Mensch entartet. Er wird böse und grausam, er wird rachsüchtig und gottlos, kurz, er wird ›vorhomerisch‹«.41 Damit charakterisiert auch Nietzsche die Griechen über ihre kulturellen Leistungen, er wertet diese jedoch in Relation zu den übrigen Kulturen und zur menschlichen Natur überhaupt. Zugleich warnt er vor einer unangebrachten Verherrlichung des »antiken Menschen«: »So haben die Griechen, die humansten Menschen der alten Zeit, einen Zug von Grausamkeit, von tigerartiger Vernichtungslust an sich.« Die Bandbreite der Erklärungen des griechischen Agons reicht damit von »Übungen, bei denen es auf einen direkten praktischen Nutzen nicht abgesehen war« (Burckhardt) bis zu der überlebensnotwendigen Einhegung »tigerartiger Vernichtungslust« (Nietzsche). Diese sehr unterschiedlichen Auffassungen eines anerkanntermaßen zentralen Phänomens der griechischen Geschichte demonstrieren die Interpretationsmöglichkeiten, die eine so offene Begriffskonstruktion wie der Agon mit sich bringt. Zwar hat der Agon – im Gegensatz zur Ehre – den großen Vorteil, von den Griechen als solcher veranstaltet worden zu sein, aber jene Agone der Griechen stehen nicht im Mittelpunkt des Interesses dieser Forscher. Eher geht es ihnen um das Lebensgefühl der Griechen, das sich im Begriff des Agon sehr gut fokussieren, weniger gut aber in den Quellen belegen lässt. Das hat sehr unterschiedliche Beurteilungen des Agons und der griechischen Gesellschaft insgesamt zur Folge. Die Dominanz eines »agonalen Geistes« kann die Athener als sehr zivilisiert und kulturell weit entwickelt erweisen und gleichzeitig – bei einem weniger spielerischen, friedlichen Begriff des Agons – als nicht in jeder Hinsicht zivilisatorisch gefestigt. Die Definition und Funktion der Ehre bleiben abhängig von der jeweiligen Vorstellung des Agons. Dementsprechend wandert auch sie die Skala der Zivilisierung hinauf oder hinab. Sie 40 Ebd., 242: Das »Wettspiel der Kräfte« erhält Athen aufrecht, weil »in einer natürlichen Ordnung der Dinge, es immer mehrere Genies gibt, die sich gegenseitig zur Tat reizen, wie sie sich auch gegenseitig in der Grenze des Maßes halten.« 41 Ebd., 246.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
77
gilt als notwendiger Ansporn zum Wettstreit um die beste Leistung oder als Trieb, der die Gemeinschaft zu zerstören droht und deshalb im Zaum gehalten werden muss. Die Aussagen, die ein solcher Begriff »des Agonalen« ermöglicht, reichen weit über die panathenäischen Agone oder die Heraia hinaus; sie dienen der Kategorisierung der athenischen Gesellschaft und einer typologischen Einordnung ihrer Zivilisation in ein bestimmtes Modell. Die so gewonnene Theorie wiederum kann die meisten Phänomene der athenischen Gesellschaft gut erklären, indem sie sie in Beziehung zum »agonalen Verhalten« setzt. »Das Agonale« dient so einerseits als monokausaler Erklärungsansatz, erscheint aber andererseits als ein theoretisch aufgeladener Komplex von verschiedenen Deutungsmustern, die kaum noch zu identifizieren sind. Weder der Agon noch die Ehre sollen in dieser Arbeit auf eine solche Weise behandelt werden. Beide Begriffe sind sehr wichtig, stehen hier aber in umgekehrtem Verhältnis zueinander: Der Ehre gilt das Hauptaugenmerk, der Agon wird im Hinblick auf sie untersucht. Für die Frage nach dem ehrenhaften Verhalten und dem Ehrbegriff der Athener ist der Agon so ungemein wichtig, weil er entscheidende strukturelle Gemeinsamkeiten mit der Ehre aufweist; er kann als eine detaillierte Ansicht der Funktionsweise von Ehre in der athenischen Gesellschaft gelten. Um den Begriff des Agons im Hinblick auf seine Ergiebigkeit für das Thema der Ehre handhaben zu könne, empfiehlt sich die Aufstellung einer funktionalen Definition. Aus einer Perspektive, die die Ehre ins Zentrum der Überlegungen stellt und nach der Relation des Agon zu ihr fragt, könnte man den Agon als einen in der Ereignisfolge festgelegten Kampf um die Ehre definieren, der in komprimierter Form viele Charakteristika ehrenhaften Handelns zeigt, wobei der Schwerpunkt zur kompetitiven Seite neigt. Die zeitlich und räumlich begrenzte Situation des Agons im Sinne einer Veranstaltung von Wettkämpfen zeigt eine Reihe von ehrenhaften Verhaltensmustern, diese bleiben aber zunächst situativ gebunden. Sie bieten einen Ausschnitt aus den vielfältigen Verhaltensweisen, die als besonders ehrenhaft gelten. Erst durch die einzelnen athenischen Athleten, die mit der agonal errungenen Ehre in ihre Heimatpolis zurückkehren, werden die ehrenhaften Verhaltensmuster, die in den Agonen favorisiert werden, auch für die athenische Gesellschaft relevant. Die Wichtigkeit, die die Griechen einem Sieg in Olympia oder in den athletischen Übungen zuschrieben, macht den Wettstreit um den Kranz bedeutender als einen Wettbewerb um die bestausgerüstete Triere oder den klangvollsten Chor. Als Agon funktionieren alle diese Wettbewerbe nach dem gleichen Prinzip, angefangen von den Leichenspielen des Patroklos bis hin zu den Hahnenkämpfen auf offener Straße.
78
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Alle diese Agone bieten die Gelegenheit und stecken das Terrain ab, auf dem um Ehre gerungen wird. Zwar ist jeder Athener mit der Ehre ausgestattet, die er aufgrund seines Geschlechts und seines Bürgerstatus hat. Durch einen Sieg in einem Agon aber, besonders in einem der sehr prestigeträchtigen olympischen Agone, kann ein Maß an Ehre gewonnen werden, das die gewöhnliche Bürgerehre eines Mannes deutlich übersteigt. Damit bekommt die Ehre eine sehr viel dynamischere Bedeutung, als sie sie in einer durch Ehre verfassten Gesellschaft wie der athenischen normalerweise hat. Gerade der Agon eignet sich dafür, quer zur gesellschaftlichen Ordnung stehende Ehre zu begründen. Das Urteil darüber, ob der Bereich der Agone ein relativ eigenständiges oder ein vielfach mit den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen verbundenes Segment der antiken Gesellschaft bildet, hat entscheidende Konsequenzen für die Ehre. Geht man davon aus, dass die Agone Teil einer vormodernen Gesellschaft sind, in der Muße und Mobilität nur einigen Privilegierten der Bevölkerung zukamen, so wird die Ehre betrachtet als die Voraussetzung für die Teilnahme an den Wettkämpfen. Wer zur Oberschicht gehört und über Ehre als gesellschaftlichem Ordnungsfaktor verfügt, kann sich den agonalen Kampf mit Seinesgleichen leisten, an dessen Ende ihm seine Ehre von jenen bestätigt wird, unter denen er als ehrenhaft gelten will, weil er sie als Gleiche betrachtet. Geht man auf der anderen Seite davon aus, dass der Bereich der Agone ähnlich wie der moderne Sport ein relativ autonomes Segment der griechischen Gesellschaft bildet, so gewinnt die agonale Ehre den Aspekt eines relativ bedingungsfrei erworbenen Gutes. Der soziale Bereich des Sports wird in einigen soziologischen Theorien als eigenständiges Einzelsegment der Gesamtgesellschaft begriffen.42 Natürlich handelt es sich bei den griechischen Agonen nicht um Sport im modernen Sinne des Wortes, weshalb der Begriff hier vermieden werden soll.43 Aber der Gedanke, die panhellenischen Agone als ein in jeder Hinsicht außerhalb der Stadtmauern Athens angesiedeltes Feld der Ehre zu behandeln, hat den Vorteil, die von den Athenern so hoch geschätzte agonale Ehre44 als Besonderheit zu betrachten.
42 P. Bourdieu, Sport and social class, in: Social Science Information 17 (1978), 819-840, 824: »The autonomization of the field of sport is also accompanied by a process of rationalization intended ... to ensure predictability and calculability, beyond local differences and particularisms: the constitution of a corpus of specific rules and of specialized governing bodies recruited ... come hand in hand.« 43 Vgl. Elias, Sport, 15; Bourdieu, Sport, 821f. 44 Der so befrachtete Begriff »agonal« soll im Folgenden lediglich als Adjektiv zum »Agon« verwendet werden, insgesondere kombiniert als »agonale Ehre«, um jene Ehre zu bezeichnen, die dem Sieger eines Agons zugesprochen wird.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
79
Ehre ist dann nicht mehr so sehr Voraussetzung, als vielmehr Erfolg eines Sieges in Olympia. Die Ehrung des Siegers ist nicht ein reiner Akklamationsakt seiner ohnehin schon bestehenden Auszeichnung, sondern kann in seiner Heimatpolis in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens Früchte tragen in Form von Ämtern, Ansehen, Reichtum, usw. Gelingt es einem Athleten, der zuvor nicht zur Oberschicht gehört hat, über den sportlichen Bereich Ehre zu erlangen, so trägt er damit quasi ein Element in die vormoderne griechische Gesellschaft hinein, das er abseits der konventionellen politischen und ererbten Wege gewonnen hat. Für letztere Auffassung der Agone sprechen seine modernen Elemente, die eher problematische Beziehungen zu der vormodernen athenischen Gesellschaft unterhalten. Zu diesen gehören die Einhaltung der Regeln durch alle Teilnehmer, der gleiche Status aller Athleten während der Wettkämpfe und die Anerkennung überlegener Leistungen ohne Ansehen der Person.45 Obwohl es sich bei den genannten Merkmalen um genuine Elemente ehrenhaften Verhaltens handelt, kommen diese doch außerhalb der Polis Athen in ganz anderer Weise zum Tragen. Die Agone bilden quasi eine Ausschnittsvergrößerung der Auseinandersetzungen um Ehre, die sich in Olympia im Vergleich zu Athen intensiver gestalten und den Ehrgeiz der Athener in Reinkultur zeigen. Die in den Agonen gewonnene Ehre kann auch deshalb eher entgegen den sozialen Strukturen der Polis wirken, weil sie auf einem Feld erworben wurde, dessen Ehrenhaftigkeit über alle Zweifel erhaben ist, das aber nichtsdestoweniger einige irritierende Momente der Moderne in die athenische Polis trägt. Es ist dieser potentiell dynamische Charakter der Ehre, die durch einen agonalen Sieg errungen wurde, der das Phänomen des Agons sozialgeschichtlich so interessant macht.46 Denn entsprechend der Definiton von Ehre und Agon und der Einschätzung ihrer Beziehung zueinander lassen sich Schlüsse hinsichtlich der sozialen Struktur und Mobilität in der griechischen Gesellschaft ziehen, die über die sportlichen Veranstaltungen weit hinausgehen. Die langjährige Forschungsdebatte, die um die Professionalisierung und soziale Ausweitung der athletischen Fähigkeiten auf größere Teile der griechischen Bevölkerung kreist, operiert zwar mit einer kulturgeschichtlichen Fragestellung, wie sie schon Burckhardt hatte, zielt aber direkt auf die sozialhistorisch relevante Thematik der sozialen Einbettung und Bedeutung der Agone. 45 Vgl. S. Miller, Naked Democracy, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 277296, 279: »This equality before absolute standards of distance and speed and strength – as measured by those of the other competitiors present – that are subject to the interpretation of no man is a basic isonomia«; vgl. ebd., 283-285. 46 Bourdieu, Sport, 832, beobachtet eine ähnliche, durch sportliche Leistungen ermöglichte soziale Mobilität für »sportsmen of working-class origin«.
80
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Vor dem Hintergrund eines biologistischen Modells von Blüte, Reife und Verfall einer kulturellen Erscheinung erklärten einige Forscher den fortschreitenden Niedergang der olympischen Spiele und anderer Agone lebenszyklisch mit dem Fortschreiten der Zeit und ursächlich mit dem Aufstieg der Demokratie.47 Die Freiheit und Gleichheit, die sie gewährte, veranlasste nichtaristokratische Männer, sich in einer bestimmten Sportart zu spezialisieren, an den Agonen teilzunehmen und von den Siegesprämien zu leben. Zwar konnte sich die ursprünglich die Agone dominierende Oberschicht noch die Bastion der kostspieligen Wagenrennen bewahren, aber der hehre Geist des Agon verkümmerte unter diesen Umständen. Als charakteristische Merkmale dieses Wandels zum Schlechteren gelten die zunehmenden Regelverstöße, die Instrumentalisierung der agonalen Ehre und eine ausufernde Vermehrung der olympischen Disziplinen. Wie die Variablen hoch dotierter Siegesprämien, Spezialisierung der Athleten und teilweiser Rückzug der Aristokraten sich auf das agonale Klima auswirkten, beschreibt E. Norman Gardiner, der bekannteste Verfechter der Dekadenzthese: »Indeed, from the middle of the fifth century the athletic interest begins to decline in Greece. A change was taking place in the character of athletics. Over-competition and the multiplication of prizes had made the conditions for success too strenuous and too exacting for the private citizen. So there arose a class of professional athletes, and though athletics formed part of the training of the Epheboi the people generally lost the athletic habit and grew content with the role of spectators.«48 Diese veränderte soziale Rekrutierung der Athleten und die zunehmende Spezialisierung des Trainings haben für Gardiner nicht etwa eine Erhöhung des athletischen Könnens zur Folge, sondern ganz im Gegenteil: »Thus within a century the whole character of athletics was completely changed. From this time there is little to record save that all the evils which we have described grew more and more pronounced. The festivals became more purely spectacular, the competitions became more the monopoly of professionals and their training more artificial and unpractical, and the result is visible in the deteroration of their physical type.«49 Die Demokratisierung der Agone im Zuge der allgemeinen Demokratisierung Athens und die Eroberung neuer Lebensbereiche durch die Bürger der Polis sind in der Forschung als vielfach belegte soziale Fakten einhellig 47 Zur Übersicht über die Forschungsdebatte und ihre Quellenbasis vgl. D.G. Kyle, Athletics in Ancient Athens, Leiden 1987, 124-141; ders., The First Hundred Olympiads: A Process of Decline or Democratization?, in: Nikephoros 10 (1997), 53-75; D.C. Young, The Olympic Myth of Amateur Athletics, Chicago 1984. 48 E.N. Gardiner, Athletics of the Ancient World, Chicago 1980 (ND Oxford 1930), 44. 49 Ebd., 104. Unterstützende Argumente liefert H.A. Harris: Greek Athletes and Athletics, Bloomington 19662.
Die Geburt der Griechen aus dem Geiste des Agonalen
81
akzeptiert. Die Bewertung dieses Befundes als ein Verfall der Agone, wie sie der griechische Geist einmalig konzipiert hatte, hat allerdings von vielen Seiten eine Korrektur erfahren. In die Kritik geraten ist dabei die ungenügend belegte Verbindung eines so genannten Profiathleten bzw. eines Amateurs mit einer bestimmten sozialen Klasse,50 die Gleichsetzung der Kranzverleihung mit einem rein symbolischen, immateriellen Preis51 und die allgemein schwierig zu erstellende Prosopographie der Athleten, namentlich der Sieger in den olympischen Spielen und ihrer sozialen und politischen Biographien.52 Die Rolle der Ehre ist in diesem kulturgeschichtlichen Ansatz die gehabte: Ehre umgibt den Agon wie eine Klammer: Sie steht am Anfang und am Ende jedes agonalen Ereignisses. Sie ist Statusmerkmal jener, die es sich leisten können, im agonalen Wettkampf nach noch höheren Ehren zu streben, und bildet damit die soziale Voraussetzung für den Agon, und sie stellt den bedeutenderen Teil der Siegesprämie für den erfolgreichsten Kämpfer dar, sie ist der Lohn des Sieges und Ziel des Agon. Die Entscheidung über den Sieg im Agon bzw. das erfolgreiche Erringen von Ehre fällt nicht willkürlich. Die agonalen Kämpfe sind aber vergleichsweise strikter an ein bestimmtes, zuvor allen Teilnehmern bekannt gemachtes Regelwerk gebunden. Das Reglement des ehrenvollen sozialen Gegeneinanders hat einen größeren Interpretationsspielraum und setzt darum auch ein sehr komplexes soziales Wissen voraus. Gleich, ob ein Athener sich im Agon messen will oder in die Konkurrenz um Ehre eintritt, dem Kampfspiel zugrunde liegt immer ein Geflecht von Verhaltensweisen, an die er sich zu halten hat. Beim Agon sind die Regeln expliziter gemacht und die Quellen sprechen ausführlich von ihnen, deshalb kann das agonale Ringen um Ehre die allgemeinen ehrenhaften Verhaltensweisen besonders gut verdeutlichen.
50 H.W. Pleket, Zur Soziologie des antiken Sports, in: MededRom 36 (1974), 57-87, 66, kommt zu dem Schluss, dass auch »die adligen Athleten nicht die rein-amateurischen FreizeitAthleten waren, die sie laut klassizistischer Verehrer der griechischen Adelswelt vorzugsweise sein sollten.« 51 H.W. Pleket, Games, Prizes, Athletes and Ideology. Some Aspects of the History of Sport in the Greco-Roman World, in: Stadion 1 (1975), 49-89, 69f: »the crucial point remains that the continuation of the prize is not a late, decadent phenomenon, caused by the emergence of greedy, lower-class professionals but rather an elaboration and articulation of what in nuce already existed in earlier times.« 52 Vgl. Kyle, Athletics, 102-123; M. Lavrencic: Krieger und Athlet? Der militärische Aspekt in der Beurteilung des Wettkampfes der Antike, in: Nikephoros 4 (1991), 167-175; Golden, Sport, 5-10.
82
Der Agon als Wettkampf um Ehre
2. Im Wettlauf zur Ehre: Die athenischen Olympioniken Alkibiades ist sich sicher, zu den ehrenwertesten Bürgern Athens zu gehören. Er verfügt über alle Ressourcen und Attribute, die ihm Ehre einbringen könnten, und er stellt sie gern zur Schau. Wenn es um die Durchsetzung seiner Interessen geht, wirft er nicht nur seine Schönheit, seinen Reichtum und seine Ehre in die Waagschale der öffentlichen Meinung, sondern er spricht auch Beifall heischend von seinen Siegen in Olympia. Welchen Stellenwert sie für ihn und für Athen, die Polis, für die er angetreten ist, haben und warum sie ihn für das Amt des Strategen empfehlen, sagt er – zumindest nach thukydideischer Darstellung – unumwunden: +Aˆ PROS»KEI μOI μ©LLON ˜TšRWN, ð '!QHNA‹OI, ¥RCEIN ..., KAˆ ¥XIOJ ¤μA NOμ…ZW EÍNAI. ïN G¦R PšRI ™PIBÒHTÒJ E„μI, TO‹J μÒN PROGÒNOIJ μOU KAˆ ™μOˆ DÒXAN FšREI TAàTA, TÍ DÒ PATR…DI KAˆ çFEL…AN. Oƒ G¦R “%LLHNEJ KAˆ ØPÒR DÚNAμIN μE…ZW ¹μîN T¾N PÒLIN ™NÒμISAN Tù ™μù DIAPREPE‹ TÁJ '/LUμP…AZE QEWR…AJ, PRÒTERON ™LP…ZONTEJ AÙT¾N KATAPEPOLEμÁSQAI, DIÒTI ¤RμATA μÒN ˜PT¦ KAQÁKA, ÓSA OÙDE…J PW „DIèTHJ PRÒTERON, ™N…KHSA DÒ KAˆ DEÚTEROJ KAˆ TšTARTOJ ™GENÒμHN KAˆ T«LLA ¢X…WJ TÁJ N…KHJ PARESKEUAS£μHN. NÒμJ μÒN G¦R TIμ¾ T¦ TOIAàTA, ™K DÒ TOà DRWμšNOU KAˆ DÚNAμIJ ¤μA ØPONOE‹TAI.53 Die Argumentation des Alkibiades könnte klarer nicht sein und klingt fast zu banal, um einen authentischen Eindruck zu machen. Wahrscheinlich handelt es sich bei den Worten, die der Historiograph ihm in den Mund legt, eher um thukydideische Erklärungen für die Ansprüche des Alkibiades auf das Strategenamt bei der sizilischen Expedition, die an die Rezipienten des Geschichtswerkes gerichtet sind, als um die wirklich gesprochenen Sätze des Olympioniken.54 Denn angesichts der öffentlichen Präsenz des Alkibiades fällt es schwer zu glauben, die Athener hätten nicht schon zur Genüge von den olympischen Siegen ihres berühmten Mitbürgers gehört. Ob sich 53 Thuk. 6, 16, 1-2: »Nicht nur gebührt mir mein Amt, Athener, mehr als andern ..., ich glaube auch dessen würdig zu sein. Worob nämlich mein Name in aller Munde ist, das trägt meinen Vorfahren und mir Ruhm ein, und der Vaterstadt sogar auch Nutzen. Denn die Hellenen hielten Athen, über all seine Macht hinaus, für noch größer wegen meines glanzvollen Auftretens als Festbote in Olympia, nachdem sie eine armgekämpfte Stadt erwartet hatten, weil ich sieben Wagen ins Rennen schickte, so viele wie kein einfacher Bürger je zuvor, und Sieger wurde und Zweiter und Vierter und auch sonst alles dem Sieg entsprechend hergerichtet hatte. Nach herkömmlicher Ansicht gilt solches als Ehre, aus dem Geleisteten aber wird auch noch Macht dahinter vermutet.« Übersetzung G.P. Landmann. 54 Zum Problem der Authentizität und des Zwecks der Reden im Werk des Thukydides vgl. H. Strasburger, Einleitung zu Thukydides, in: ders., Studien zur Alten Geschichte, hg. von R. Zoepffel und W. Schmitthenner, Bd. 2, Hildesheim 1987, 709-776, 759-767.
Die athenischen Olympioniken
83
Alkibiades in dieser speziellen Situation seines Auftretens in Olympia brüstet oder nicht – Thukydides macht deutlich, dass die anwesenden Männer um die überragende agonale Ehre des Alkibiades wissen, gleich ob sie nun verbal oder nur durch seine unverwechselbare Erscheinung beschworen wird. Der Zusammenhang zwischen der agonalen Ehre des Alkibiades und dem zu besetzenden Strategenamt liegt nach Alkibiades bzw. Thukydides auf der Hand: Alkibiades hat Athen zu größerer Ehre verholfen, er kann darum eine Gegenleistung erwarten. Die Betrauung mit dem Amt des Strategen bedeutet eine Ehrung seiner Person durch die Athener. Außerdem hat Alkibiades sich durch seine agonale Großtat als befähigt erwiesen, besondere Herausforderungen ruhmreich zu meistern, gleiches wird er in einem Strategenamt tun. Alkibiades zufolge sind die olympischen Spiele wichtig für die Ehre eines Mannes und können ihn entscheidend aufwerten. Wenn selbst Alkibiades das meint, so gilt es umso mehr für seine weniger von Glück und Ehrgeiz gesegneten Zeitgenossen. Seine Aussage fügt sich nahtlos in die allgemeine Überlegung ein, dass eine Gesellschaft wie die athenische, in der die Ehre statusbildend wirkt und häufig die Verfügung über weitere soziale Güter nach sich zieht, ihre olympischen Sieger besonders hoch schätzen sollte. Wie kein anderer Agon verlagern die olympischen Wettkämpfe die Konkurrenz um die Ehre und den konfliktträchtigen Ehrgeiz athenischer Ehrenmänner auf die panhellenische Ebene. Es tritt kein dysfunktionaler Effekt für die Polis auf, sie kann umgekehrt einen Anteil an der Ehre des siegreichen Athleten verbuchen, der nicht als Individuum in den Wettstreit zieht, sondern immer auch als Vertreter seiner Polis. Alkibiades betrachtet die Konvertierbarkeit von olympischen Ehren als eine Selbstverständlichkeit. Seiner Person sind allerdings so viele andere ehrenhafte Verhaltensweisen attribuiert, dass es zu seiner herausragenden Stellung der agonalen Ehre nicht einmal bedarf. Umso bemerkenswerter, dass er sie dennoch erwähnt; offensichtlich sind seine olympischen Siege wichtig für ihn und werden von vielen Bürgern als prächtiges Spektakel erinnert. Als Mitglied der Oberschicht und eine der berüchtigtsten Erscheinungen der damaligen Zeit stammte Alkibiades aus einer alteingesessenen namhaften Familie und verfügte über viel Geld und Besitz, einflussreiche Freunde und persönliche Qualitäten, die ihm ein übergroßes Maß an Ehre einbrachten. Die sieben Vierspänner, die er bei den olympischen Spielen 416 ins Rennen schickte, und die Prachtentfaltung bei seinem Auftreten dort wurden auch ermöglicht durch die Ehre, die er – neben anderen Distinktionsmerkmalen – bereits besaß.55 55 Vgl. zur sozialen Lage des Alkibiades Davies, APF 600, bes. S. 20f.; zu seinen Siegen in Olympia Plut. Alkibiades 11; Diod. 13, 74. Dass die olympische Ehre des Alkibiades und vor
84
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Die Wechselwirkung, die auf agonale Siege politische Ämter folgen lässt, weil der Erweis von Ehre die Zuschreibung von Ehre nach sich zieht, ist für Alkibiades nicht neu. Anders dagegen für olympische Sieger, die zuvor nicht der Oberschicht angehörten: Im einerseits durch die Ehre, andererseits durch die Demokratie geprägten Athen erfüllen Personen, die über im Agon erworbene Ehre verfügen, die Bedingungen für das Erreichen höherer Ehren, die auch politischer Natur sein können. Natürlich konnten die athenischen Athleten, die aus wenig namhaften Geschlechtern stammten, nicht ihre Pferde ins Rennen schicken und am spektakulärsten Wettkampf der olympischen Spiele teilnehmen, aber der Enthusiasmus der Griechen für jeden der einzelnen Agone und die liberalen Zugangsbedingungen zu den Wettkämpfen in Elis garantierten die Teilnahme von Männern, die unbekannt kamen und als Helden des griechischen Erdkreises gingen.56 Die in den olympischen Agonen errungene Ehre eines Mannes galt den Athenern als die höchste Erfüllung. Olympioniken wurden in der Antike so glücklich gepriesen, wie es sonst nur die unsterblichen Götter waren. Platon bezieht sich offenbar auf diesen sprichwörtlichen Ruhm, wenn er sie zum Maßstab vom Glück begünstigter Menschen macht: 0£NTWN TE D¾ TOÚTWN ¢PALL£XONTAI, Z»SOUS… TE TOà μAKARISTOà B…OU ÖN Oƒ ÑLUμPION‹KAI ZîSI μAKARIèTERON.57 Ein mit dieser Ehre versehener Bürger kehrte nach Beendigung der Agone in seine Heimatpolis zurück, deren Ehre er gemehrt hatte, und er musste sich wieder in die athenische Bürgerschaft eingliedern, die ihrerseits nach dem Kriterium der Ehre geordnet war. Im Falle des Alkibiades oder anderer Aristokraten, die von jeher einen besonderen Status innehatten, bestätigte ihr Auftreten in Olympia ihre panhellenische Ausrichtung und ihre überlegene Ehre. Im Falle einfacher athenischer Bürger allerdings, die durch einen olympischen Sieg mit überreicher Ehre und Ehrungen durch die Polis ausgestattet wurden, konnte es zu Statusinkongruenzen kommen. Um den Wert der agonalen Ehre und ihre mögliche Konvertierbarkeit bzw. statusbildende Kraft zu klären, sollen deshalb gerade die Olympioniken untersucht werden, die außerhalb ihrer olympischen Siege wenig Aufsehen erregten.
allem seine Prahlerei damit auch kontraproduktive Effekte auslösen konnte, zeigen die Argumente seiner Gegner, die Hybris argwöhnen, Thuk. 6, 15, 3-4. Vgl. C. Mann, Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland, Göttingen 2001, 108-113. 56 N.B. Crowther, Athlete and State: Qualifying for the Olympic Games in Ancient Greece, in: Journal of Sport History 23 (1996), 34-35, kommt zu dem Schluss, die talentierten Athleten wären zwar auf ihr eigenes Vermögen angewiesen, auf der anderen Seite aber wenig Zugangsregelungen unterworfen gewesen. 57 Plat. rep. 465d: »Dessen allen also werden sie ledig sein in einem Leben, glückseliger als selbst jenes glückseligste, welches die Olympischen Sieger führen.« (Übersetzung: F. Schleiermacher).
Die athenischen Olympioniken
85
Eine chronologisch angelegte Übersicht der nicht aus der athenischen Oberschicht stammenden Olympioniken und ihres jeweiligen Status in Athen zeigt, inwiefern ein ehrenhafter Status in der athenischen Polis die Voraussetzung für die Erlangung hoher olympischer Ehre war und welche Wirkung die agonale Ehre in Athen haben konnte. Schon die geographische Distanz zwischen Olympia und Athen wirft die Frage nach einer möglichen Erlangung von Ehre auf, die sich nicht aus den bestehenden sozialen Strukturen ergab, durch ihre Transformierbarkeit aber den athenischen Olympioniken die Gelegenheit gab, ihre in Sekunden gewonnene Ehre fernab Athens in einen lebenslangen ehrenhaften Status in der Polis umzumünzen. Diese Konvertierung der Ehre des Olympioniken in einen höheren sozialen Status als athenischer Polisbürger bildet eines der Scharniere zwischen Ehre und Polis. Erwartungsgemäß berichten die Quellen wenig über das Vor- und Nachleben dieser gewöhnlichen Männer, die erst mit einem Sieg in Olympia einen Namen erhielten, der tradiert werden konnte. Auf der anderen Seite existiert eine Fülle von antiken Behandlungen des Themenkomplexes der Olympioniken und der unterschiedlichsten Aspekte der Agone, wie etwa Einzelheiten der athletischen Betätigung, Auflistungen der bisherigen Sieger und Disziplinen in den panhellenischen Spielen und eine ausführliche archäologische Begutachtung der Überreste des agonalen Treibens vor Ort.58 So ermöglicht die reine Masse an Aussagen ein relativ dichtes und wechselseitig abgesichertes Informationsnetz zu den näheren ehrenhaften Umständen derjenigen, die es in Olympia zu Ehre und Ehrungen brachten.59
58 Philostratos erörtert im 2. Jahrhundert n. Chr. Details der verschiedenen sportlichen Disziplinen, die notwendigen körperlichen Voraussetzungen und die optimale Diät während des Trainings, Philostratos: Über Gymnastik, hg. u. übers. v. J. Jüthner, Leipzig/Berlin 1909 (ND Amsterdam 1969). Andere antike Autoren, wie die Historiographen Herodot und Thukydides, überliefern die agonalen Siege namhafter Männer, die sich in ihren Heimatpoleis durch Leistungen in der Politik oder im Krieg hervortaten. Ein Interesse für die siegreichen Kämpfer besonders der olympischen Agone verrät die Anlage von Olympionikenlisten, von denen die jüngste und vollständigste von S. Iulius Africanus stammt. Er greift wohl auf die Ende des 5. Jahrhunderts zu datierenden Aufzeichnungen des Hippias von Elis zurück und wird seinerseits über die Schriften des Eusebius überliefert. Sexti Iulii Africani: '/LUμPI£DWN ¢NAGRAF», hg. und komm. v. J. Rutgers, Diss. phil., Leiden 1862. Eine der wertvollsten Quellen zur Geschichte Olympias stellt die Periegese des Pausanias dar. Der reisende Römer liefert in seinem 5. und 6. Buch einen ausführlichen Augenzeugenbericht der näheren Umgebung Olympias. Besonders seine Beschreibungen der im 2. Jahrhundert n. Chr. noch vorhandenen baulichen Überreste und in situ stehenden epigraphischen Zeugnisse sind für die Rekonstruktion der Altis und die Vorstellung von den olympischen Agonen essentiell. 59 Unschätzbar dafür ist die Olympionikensammlung von L. Moretti, Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici, Rom 1957; ders., Supplemento al catalogo degli Olympionikai, in: Klio 52 (1970), 295-303; ders., Nuovo supplemento al catalogo degli olympionikai, in: MGR 12 (1987), 67-91. Ebenso fundamental und reich an Quellen: J.H. Krause, Olympia oder Darstellung
86
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Damit sind nicht nur Ämter innerhalb der Polis gemeint, die Alkibiades ins Auge gefasst hat, sondern ebenso andere Ehrerweisungen, die von den Bürgern der Polis gewährt werden. Bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts handelt es sich bei den athenischen Olympioniken quasi ausschließlich um Männer, die zur alteingesessenen Oberschicht gehören und mit den Pferdegespannen, die sie ins olympische Rennen schicken, ihre statusgemäße Pracht auf panhellenischer Ebene entfalten.60 So lassen sich die Sieger der Wagenrennen zugleich als die Vertreter der einflussreichsten Familien Athens identifizieren. Namentlich finden sich in den gängigen Aufstellungen der Olympioniken Alkmaion, der im Jahre 592 als erster Athener mit seiner Quadriga siegt;61 der Feldherr Miltiades, Sohn des Kypselos, der mit seinen Gespannen 560 als erster ins Ziel einläuft;62 ferner Kimon, Stesagoras’ Sohn und Vater des Marathonsiegers Miltiades, dessen Pferde nach seinem Tode neben ihm beigesetzt worden sein sollen, weil die Tiere ihm in drei aufeinander folgenden Olympiaden den Sieg erliefen;63 und schließlich Kallias, Sohn des Hipponikos, dreifacher Olympionike mit seinen eigens gezüchteten Pferden und wie alle genannten einer der reichsten Männer seiner Zeit.64 Während des 6. Jahrhunderts verläuft die politische und olympionikische Tradition parallel: Dieselben Männer, die siegreich aus Olympia heimkehren, gehören zu den politisch führenden Familien der Stadt, und sie tun sich in jenen Disziplinen hervor, die von den enormen Ressourcen ihres gesellder großen olympischen Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten, Wien 1938 (Hildesheim 1972). 60 Kyle, Athletics, 156, urteilt über diese vorsolonische Zeit entsprechend: »The earliest Athenian athletes reflect the directness and unity of old aristocratic life.« 61 Belegt durch Isokr. 16, 25: †PPWN G¦R ZEÚGEI PRîTOJ '!LKμšWN TîN POLITîN '/LUμP…ASIN ™N…KHSEN. »Als erster nämlich unter den Bürgern trug bei den Olympischen Spielen Alkmeon mit einem Pferdegespann einen Sieg davon«. Nicht zuletzt deshalb, so Isokrates, sei sein Reichtum noch heute in Erinnerung. Auch Hdt. 6, 125, verbindet Alkmaions Auftreten in Olympia eng mit seinem sagenhaften Vermögen: OÛTW μÒN ™PLOÚTHSE ¹ O„K…H AÛTH μEG£LWJ: KAˆ Ð '!LKμA…WN OáTOJ OÛTW TEQRIPPOTROF»SAJ '/LUμPI£DA ¢NAIRšETAI. In der Übersetzung von W. Marg: »So kam dieses Haus zu großem Reichtum und der genannte Alkmeon war so imstande, ein Viergespann zu halten, und war damit Sieger in Olympia.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 81: »Alkmaion di Atene, quadriga, primo dei suoi concittadini in questa specialità.« 62 Hdt. 6, 36 erwähnt es nebenher: OÛTW D¾ -ILTI£DHJ Ð +UYšLOU, '/LÚμPIA ¢NVRHKëJ PRÒTERON TOÚTWN TEQR…PPJ. »... Miltiades, Kypselos’ Sohn, der vorher einen olympischen Sieg mit dem Viergespann errungen hatte«. Paus. VI, 19, 6, entdeckt die Miltiades ehrende Inschrift in Olympia; vgl. auch Moretti, Olympionikai, no. 106. 63 Hdt. 6, 103; Ail. var. 9, 32, bestätigt das besondere Verhältnis zu seinen Pferden: +Aˆ Aƒ +…μWNOJ DÒ †PPOI CALKA‹ KAˆ AáTAI '!Q»NHSIN E„KASμšNAI ÓTI μ£LISTA TA‹J +…μWNOJ †PPOIJ EƒST»KESAN. Übersetzt von H. Helms: »Auch ein ehernes Standbild der Pferde des Kimon, das Kimons Pferden so ähnlich wie möglich nachgebildet war, stand in Athen.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 120. 64 Schol. Aristoph. Nub. 64; Raubitschek, DAA 111; Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 164, 169 und 176; Davies, APF, no. 7826; Krause, Olympia, 303.
Die athenischen Olympioniken
87
schaftlichen Status gespeist werden. Die Konzentration auf die kostspielige Pferdezucht und ihren Einsatz in den panhellenischen Spielen wird auch während der nächsten Jahrzehnte nicht aufgegeben. Gleichzeitig aber listen die Quellen nun auch Olympioniken auf, die sich – aller prosopographischen Kenntnis nach – nur durch ihre agonalen Siege einen Namen gemacht haben, darüber hinaus aber unbekannt sind. Sie lassen zumeist auch nicht ihre Pferde zu ihrer höheren Ehre laufen, sondern erstreiten den olympischen Kranz in persona. Zum einen, weil sie sich zum Teil die aufwändige Pferdehaltung nicht leisten konnten, auf der anderen Seite aber konnten sie auf diese Weise den schon von Homer geadelten Einsatz ihrer körperlichen Kraft und Geschicklichkeit als Wettkämpfer für sich verbuchen.65 Einer der ersten, der zur Kategorie der Körpereinsatz zeigenden und weniger mächtigen Athleten gehört, ist Kallias, Sohn des Didymias. Seinen olympischen Sieg im Pankration erringt er in der 77. Olympiade im Jahre 472 v. Chr.66 Es scheint der krönende Abschluss einer erfolgreichen Athletenkarriere zu sein, die früh begann und Erfolge in den wichtigsten Agonen feierte. Eine in Olympia gefundene überlebensgroße Bronzestatue ehrt Kallias als Sieger im Pankration.67 Eine zweite Inschrift, entdeckt auf der Akropolis in Athen, listet auch seine anderen agonalen Triumphe auf: er siegte zweimal bei den pythischen, fünfmal bei den isthmischen und viermal bei den nemeischen Spielen, außerdem bei den Panathenäen.68 Neben seinem athletischen Eifer ist Kallias offenbar auch politisch tätig gewesen. Sein Engagement innerhalb der Polis ist nur indirekt dokumentiert: einzig eine beiläufige Bemerkung des Pseudo-Andokides und einige auf der athenischen Agora ausgegrabene Ostraka weisen auf seine Ostraki-
65 Laodamas versucht Odysseus, der bei den Wettkämpfen der Phaiaken durch seine trainierte Erscheinung einerseits und sein Desinteresse an den Agonen andererseits auffällt, zum Kampf zu reizen: ›DEàR' ¥GE KAˆ SÚ, XE‹NE P£TER, PE…RHSAI ¢šQLWN, E‡ TIN£ POU DED£HKAJ: œOIKE Dš S' ‡DμEN ¢šQLOUJ: OÙ μÒN G¦R μE‹ZON KLšOJ ¢NšROJ, ÔFRA K' œVSIN, À Ó TI POSS…N TE šXV KAˆ CERSˆN ˜ÍSIN.‹ Hom. Od. 8, 145-148: »Fremder Vater, auch du musst dich in den Kämpfen versuchen, hast du deren gelernt; und sicher verstehst du den Wettkampf. Denn kein größerer Ruhm verschönt ja das Leben der Menschen, als den ihnen die Stärke der Händ’ und Schenkel erstrebet.« 66 Die pankratischen Erfolge des Kallias Didymiou sind durch die antiken Siegerlisten zweifelsfrei überliefert, s. Afric. 41 (Rutgers): +ALL…AJ $IDUμ…OU '!QHNA‹OJ PAGKR£TION; und Oxyrh. Pap. II 222. Auch Paus. 5, 9, 3, sichert Person und Datum ab. 67 Schon Paus. 6, 6, 1, bewundert Statue und Inschrift: +ALL…AI DÒ '!QHNA…WI PAGKRATIASTÁI TÕN ¢NDRI£NTA ¢N¾R '!QHNA‹OJ -…KWN ™PO…HSEN Ð ZWGR£FOJ. »...und für Kallias aus Athen, der im Pankration siegte, machte der Athener Mikon, der Maler, die Statue.« (Übersetzung E. Meyer) Vgl. IvOl 146. 68 Raubitschek, DAA 164; Syll.3 69. Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 228; R. Knab, Die Periodoniken. Ein Beitrag zur Geschichte der gymnischen Agone an den 4 griechischen Hauptfesten, Diss. phil., Chicago 1966 (ND Gießen 1934), 23. Ein Sieg des Kallias im Knabenalter ist durch eine fragmentarisch erhaltene Inschrift überliefert, Raubitschek, DAA 21.
88
Der Agon als Wettkampf um Ehre
sierung als Gegner des Perikles hin.69 Ob diese Ostrakisierung wirklich erfolgt ist, bleibt umstritten.70 Dessen ungeachtet erlauben die Quellen aber die Schlussfolgerung, dass Kallias politisch so bekannt und einflussreich war, dass er durchaus Gefahr lief, ostrakisiert zu werden. Die auf der Akropolis gefundene Inschrift könnte in Zusammenhang mit seinem politischen Wirken stehen, da sie erheblich jünger ist als jene in Olympia und in den gleichen Zeitraum wie die Scherben mit der Ritzung seines Namens datiert wird. Um 450 hat Kallias die Summe seiner agonalen Erfolge in Stein meißeln lassen, um sie den athenischen Bürgern frisch ins Gedächtnis zu rufen.71 Auch Kallias versucht damit, seine agonale Ehre umzumünzen in dauerhafte Ehre und Ehrung innerhalb der Polis und in handfestes politisches Kapital. Sein relativ hoher politischer Status, der sich an seiner Gegnerschaft zu keinem geringeren als Perikles ermessen lässt, weist auf die Erfüllung der materiellen Voraussetzungen für eine politische Betätigung hin. Obwohl Kallias weder zur alten Oberschicht noch zu den Reichen in Athen gehört,72 setzt er sich doch durch die Mobilisierung seines Vermögens, seiner Zeit und seines Geldes für die Athletenlaufbahn von den meisten anderen Bürgern ab. Offen bleibt dabei, ob seine schon jugendliche Beteiligung an städtischen Agonen so ertragreich war, dass die Wahl seiner folgenden Betätigungsfelder nicht mehr primär von finanziellen Erwägungen geleitet wurde. Seine spätere agonale Ehre erlaubte ihm sicherlich auch materiell, seiner athletischen Laufbahn und später seinen politischen Ambitionen zu folgen. Es ist durchaus möglich, dass Kallias zur Vorhut jener Athleten gehört, die ihre Wettkämpfe nicht nur als adeligen Zeitvertreib, sondern quasi als Profession betrieben; die Konzentration der Quellen allein auf die agonalen Erfolge des Kallias legen eine solche Schlussfolgerung nahe. Sehr viel spärlicher fließen die Quellen zu anderen athenischen Athleten, die im 5. Jahrhundert in Olympia siegten. Von den sicher bekannten Olym69 [And.] 4, 32: +ALL…AN DÒ TÕN $IDUμ…OU, Tù SèμATI NIK»SANTA P£NTAJ TOÝJ STEFANHFÒROUJ ¢GîNAJ, ™XWSTRAK…SATE PRÕJ TOàTO OÙDÒN ¢POBLšYANTEJ, ÓJ ¢PÕ TîN ˜AUTOà PÒNWN ™T…μHSE T¾N PÒLIN. Übersetzt von A.G. Becker, da ihr einen Kallias, Sohn des Didymos, welcher durch seine körperliche Gewandtheit in allen Wettkämpfen die eine Krone erwerben gesiegt hatte, durch Ostrakismos verbanntet, ohne irgend zu berücksichtigen, dass er durch seine Anstrengungen dem Staate Ruhm erworben.« Vgl. zu Ostraka E. Vanderpool, Ostraka from the Athenian Agora, in: Hesperia Suppl. 8 (1949), 409; sowie ergänzend H.A. Thompson, The Excavation of the Athenian Agora, Twelfth Season: 1947, in: Hesperia 17 (1948), 149-196, 194. 70 Vgl. zur Diskussion um den Wahrheitsgehalt der Aussage des Pseudo-Andokides Moretti, IAG 15. Raubitschek, DAA 164. 71 Ebd. 72 Davies, APF, zählt Kallias nicht unter die vermögenden athenischen Personen oder Familien; vgl. Kyle, Athletics, 202.
Die athenischen Olympioniken
89
pioniken verweigert sich zumindest einer der zuverlässigen Zuordnung zur Oberschicht der Polis. Es ist Timodemos, der Sohn des Timonoos, der im Pankration den olympischen Kranz erringt. Timodemos verdankt die Überlieferung seines Namens einer nemeischen Ode des Pindar, der andeutet, Timodemos stamme aus einer Familie, die sich schon zuvor in verschiedenen panhellenischen Agonen siegreich hervorgetan habe: Timodemos solle es ihnen gleichtun, und neben dem nemeischen Sieg auch die pythischen und isthmischen Agone erfolgreich meistern.73 Pindar erwähnt Olympia als Stätte eines Sieges nicht; Timodemos gewinnt das Pankration in Olympia später, wie ein Scholiast weiß.74 Diesen Zeitpunkt genauer zu bestimmen, ist schwierig, vermutet wird das Jahr 460.75 Neben den vereinzelten Informationen über seine Siege können über das Leben des Timodemos nur vage Vermutungen angestellt werden. Die Andeutung seines familiären Hintergrundes lässt eine agonal traditionsreiche Familie erahnen, die es sich leisten konnte, Pindar eine Siegeshymne verfassen zu lassen. Sowohl Kallias als auch Timodemos tragen im Pankration den Sieg davon, sie belegen für das 5. Jahrhundert die Existenz von Olympioniken, die nicht der athenischen Oberschicht angehören. Ihr Erfolg in den Agonen ist vielfach und beschränkt sich nicht nur auf Olympia, sondern ist ebenso für andere panhellenische Agone und im Falle des Kallias Didymiou auch für die Panathenäen belegt. Die Basis ihrer Siege bildet ihre athletische Leistung, sie ermöglicht ihnen die Teilnahme an den Agonen und eine Laufbahn als Athlet, der mit Statuen und Oden geehrt wird. Während Kallias seine Ehre in Athen offenbar für eine politisch einflussreiche Position nutzen konnte, scheint sich Timodemos auf das Betätigungsfeld der Athletik beschränkt zu haben. Die in Olympia siegreichen Aristokraten Athens setzen im 5. Jahrhundert zur Demonstration ihrer Ehre in Olympia weiterhin auf die Kampfkraft ihrer Pferde.76 Für das 4. Jahrhundert fließen die Quellen reichlicher. Die Namen der Olympioniken in dieser Zeit tauchen nicht unbedingt in anderen ehrenhaf73 Pind. N. 2. 74 Schol. Pind. N. S. 29 Dr.: μET¦ G¦R T¾N .EμEAK¾N N…KHN ™STEFANOàTO T¦ '/LÚμPIA. »Nach seinem Sieg in Nemea nämlich wurde er in Olympia bekränzt«. 75 Moretti, Olympionikai, no. 262, findet »la data del 460 potrebbe accordarsi assai bene con le notizie di cui disponiamo per ricostruire la lista degli olimpionici nel V secolo.« Zweifel bei Krause, Olympia, 392f., und C. Robert, Die Ordnung der olympischen Spiele und die Sieger der 75.-83. Olympiade, in: Hermes 35 (1900), 141-195, 183f. H. Förster, Die Sieger in den olympischen Spielen, Zwickau 1891-92, no. 214, datiert ihn in das Jahr 468 v. Chr. 76 Den Sieg des Megakles, Sohn des Megakles, berichtet lediglich Schol Pind. P. S. 201 Dr. Von dem Abkömmling der Alkmeoniden sind aber seine Lebensumstände in Athen bekannt, vgl. Davies, APF, no. 9697, 381: »-EGAKLÁJ (V) -EGAKLšOUJ (IV) '!LWP., son of the ostracisé, gained a victory TEQR…PPJ at Olympia in 436 ..., and held minor public office in 428/7 as secretary to the tamiai of Athene.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 320. Des Alkibiades Triumphe sind sattsam bekannt, sie fallen in das Jahr 416.
90
Der Agon als Wettkampf um Ehre
ten Zusammenhängen auf, ihre olympischen Siege und ihre erfolgreiche athletische Betätigung dafür umso häufiger. Nicht zufällig hebt die These, mit der sich radikalisierenden Demokratie komme es zu einem Niedergang des wahren agonalen Geistes, auf diesen Zeitraum ab: Mit Beginn des 4. Jahrhunderts lassen sich Männer ausmachen, die sicher nicht in der familiären Tradition der athenischen Oberschicht stehen. Die einschlägigen Listen führen vornehmlich athenische Athleten auf, die in den Lauf- oder Kampfsportarten siegreich waren. Tatsächlich scheint es eine gewisse Verschiebung in den sozialen Verhältnissen der Athleten gegeben zu haben. Es machen weniger aristokratische Hipponiken auf sich aufmerksam, die sicherlich auch in anderen Quellen erwähnt worden wären, als nur in den expliziten Auflistungen der Sieger. Auf der anderen Seite bleibt es weiterhin schwierig, neben den sportlichen Erfolgen aussagekräftige Daten über die Olympioniken des 4. Jahrhunderts zu gewinnen, die nicht ohnehin ausführlich dokumentiert sind. Es zeichnet sich eine Rekrutierung der erfolgreichen Athleten nicht mehr unbedingt aus der alteingesessenen, sondern eher aus der reichen Oberschicht der Polis ab. Natürlich überschneiden sich die Gruppen der Nurund Auch-Reichen, die These des vermehrten Auftretens von Athleten finanziell Vermögender wird aber unterstützt durch die Neigung der traditionell Ehrenhaften, sich bevorzugt mit ihren Pferden in Olympia zu zeigen, weil in den hippischen Disziplinen die Exklusivität ihrer Kreise nicht gestört wird. Die aktive Teilnahme an allen Disziplinen und Agonen bleibt im Wesentlichen den privilegierten Männern der Polis vorbehalten. Damit ist keineswegs auszuschließen, dass es einige Athleten gab, die zu keiner der genannten Gruppen gehörten. Ihnen könnte es gelungen sein, ihr athletisches Talent zum Grundstein ihrer Karriere zu machen und die von ihnen gewonnene Ehre als Distinktionsmerkmal einzusetzen, das sie künftig als Mitglied der privilegierten Bürger auswies. Athenische Athleten, über die außer ihrem olympischen Sieg buchstäblich nichts überliefert ist, gibt es auch im 4. Jahrhundert; sie sind in relativ größerer Zahl bekannt als im 5. Jahrhundert. Sie alle erstreiten in der Disziplin des Stadionlaufes den olympischen Kranz, eine Auffälligkeit, die wohl nur zum Teil quellenbedingt ist.77 So siegt im Jahre 400 Minos aus Athen,78 in der 98. Olympiade, 388 v. Chr., sein Mitbürger Sosippos,79 368 77 S. Iulius Africanus, zusammen mit Diodorus Siculus die Hauptquelle zu diesen Athleten, setzt seine Olympionikenliste zu großen Teilen aus den jeweiligen Siegern des Stadionlaufes zusammen, vgl. Jüthner, Philostratos, 61f. 78 Afric. 57 (Rutgers); Diod. 14, 35: ™GEN»QH DÒ KAˆ '/LUμPI¦J PšμPTH PRÕJ TA‹J ™NEN»KONTA, KAQ' ¿N ™N…KA ST£DION -…NWJ '!QHNA‹OJ. In der Übersetzung von J.F. Wurm: »es wurde die fünf und neunzigste Olympiade gefeiert, wo Minos von Athen Sieger auf der Rennbahn war.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 357.
Die athenischen Olympioniken
91
ist der Läufer Pythostratos schnellster,80 bei den nächsten olympischen Agonen Phokides,81 344 erringt Aristolochos die begehrte Trophäe des olympischen Kranzes,82 und in der darauf folgenden Olympiade schließlich gelingt das Antikles.83 Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man diese Männer nicht den führenden Familien Athens zurechnen, denn als deren Nachfahren hätten sie mehr Aufmerksamkeit der Chronisten auf sich gezogen. Der einzig vertretbare Schluss aus dem dürftigen Datenmaterial zu den einzelnen Personen geht in die Richtung, dass weder Pferdebesitz noch Nobilität Voraussetzung für olympische Ehren sind, sondern dass letztere durch Schnelligkeit errungen werden – sofern die unter anderen ökonomischen Bedingungen der Teilnahme an den olympischen Agonen erfüllt werden. Weitergehende Erkenntnisse über die Art der Ehre, die agonal gewonnen ist, versprechen jene Olympioniken des 4. Jahrhunderts, deren Schicksal in den Quellen eingehendere Betrachtung erfahren hat. Epichares aus Athen etwa hat Vor- und Nachfahren, die von sich Reden gemacht haben und infolgedessen in verschiedenen Quellen auftauchen. Über Epichares selbst ist lediglich bekannt, dass er 396 den Lauf der Knaben gewinnt.84 Durch die Einbindung seiner Person zwischen die Generationen seiner Familie ist sein sozialer Hintergrund jedoch relativ leicht auszuleuchten. Sein Onkel Aristokrates zählt zum engsten Kreis der 400, dementsprechend kommt auch Epichares ein sehr hoher sozialer Status zu.85 Später erscheint ein Enkel des 79 Afric. 58 (Rutgers) hegt Zweifel an der Heimatpolis des Sosippos, Diod. 14, 107 nicht: '/LUμPI¦J D' ½CQH ÑGDÒH PRÕJ TA‹J ™NEN»KONTA, KAQ' ¿N ™N…KA 3èSIPPOJ '!QHNA‹OJ. »Es wurde die acht und neunzigste Olympiade gefeiert, wo Sosippus von Athen Sieger war.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 382; Krause, Olympia, 372. 80 Afric. 61 (Rutgers). Auch hier ist dem Africanus die Heimatpolis des Stadioniken zweifelhaft; Diod. 15, 71, kennt Pythostratos als Athener: PAR¦ DÒ '(LE…OIJ ÑLUμPI¦J ½CQH TR…TH PRÕJ TA‹J ˜KATÒN, KAQ' ¿N ™N…KA ST£DION 0UQÒSTRATOJ '!QHNA‹OJ. »bei den Eliern wurde die hundertunddritte Olympiade gefeiert, wo Pythostratus von Athen Sieger auf der Rennbahn war.« Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 414; Krause, Olympia, 367, und K. Ziegler, Pythostratos, in: RE 24 (1963), 618, schließen sich Diodor an. 81 Afric. 61 (Rutgers); Diod. 15, 78; vgl. Moretti, Olympionikai, no. 419; Krause, Olympia, 356f.; A. Raubitschek, Phokides, in: RE 20 (1950), 457. 82 Oxyrh. Pap. 12; Diod. 16, 69; vgl. Moretti, Olympionikai, no. 446. 83 Afric. 64 (Rutgers); Diod. 16, 77; Aischin. 1, 157, spricht von ihm als '!NTIKLÁJ Ð STADIODRÒμOJ. 84 Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 368. 85 Vgl. zu Aristokrates Thuk. 8, 89, 2: KAˆ XUN…STANTÒ TE ½DH KAˆ T¦ PR£GμATA DIEμšμFONTO, œCONTEJ ¹GEμÒNAJ TîN P£NU [STRATHGîN] TîN ™N TÍ ÑLIGARC…v KAˆ ™N ¢RCA‹J ÔNTWN, OŒON 1HRAμšNH TE TÕN “!GNWNOJ KAˆ '!RISTOKR£TH TÕN 3KEL…OU KAˆ ¥LLOUJ, O‰ μETšSCON μÒN ™N TO‹J PRîTOI TîN PRAGμ£TWN. »Schon bildeten sich Gruppen, die auf die Verfassung schimpften, geführt von solchen, die zum engsten Kreis gehörten und in Ämtern waren, wie Theramenes Hagnons Sohn, Aristokrates Skelios’ Sohn und andern, die in den höchsten Stellen saßen«, und Xen. hell. I 7, 2. 34. Nach Davies, APF, 1904, ist Aristokrates »the
92
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Epichares, der seinen Namen trägt, als Sprecher einer pseudodemosthenischen Gerichtsrede auf der politischen Bühne Athens.86 Den Sieg seines Großvaters führt er in eigenem Interesse an: Die vor vor gut fünfzig Jahren errungene Ehre vermehrt auch noch die seine und belegt die Bereicherung Athens an Ehre durch die Großtaten seiner Vorfahren: '!NAμNHSQšNTEJ OâN, ð ¥NDREJ DIKASTA…, KAˆ TÁJ TOÚTWN PONHR…AJ KAˆ TîN PROGÒNWN TîN ¹μETšRWN, ïN '%PIC£RHJ μÒN Ð P£PPOJ Ð ™μÕJ '/LUμP…ASI NIK»SAJ PA‹DAJ ST£DION ™STEF£NWSE T¾N PÒLIN, KAˆ PAR¦ TO‹J ØμETšROIJ PROGÒNOIJ ™PIEIKÁ DÒXAN œCWN ™TELEÚTHSEN:87 Bei der Person des Epichares handelt es sich also zweifellos um einen jener reichen Athener der Oberschicht, denen ein in Olympia errungener Sieg die ohnehin hohe Ehre mehrt. Ähnlich verhält es sich wohl bei Timokrates, Sohn des Antiphon, der 352 in der 107. Olympiade mit seinen Pferden siegreich ist.88 Sowohl seine hippische Disziplin als auch die übrigen Notizen über ihn vermitteln das Bild eines reichen, politisch aktiven Mannes, dessen Vorfahren in Athen einen ebenso hohen Status innehatten wie er selbst.89 Das einmalige ehrenhafte Auftreten des Timokrates bei den olympischen Agonen könnte nicht zufälliger überliefert sein. Seine anderen Betätigungsfelder nehmen mehr Raum ein, für ihn selbst und für seine Zeitgenossen, von denen keine Äußerung zu seinen agonalen Ehren überliefert ist. Timokrates ist bei seinen athenischen Mitbürgern vor allem als Politiker und Redner bekannt, seine Ehre resultiert nicht primär aus seinen agonalen Erfolgen. Ganz anders verhält es sich bei Philammon. Dieser gewinnt 360 den olympischen Faustkampf und bleibt wegen seiner herausragenden athletischen Leistungen lange unvergessen.90 Sein erkämpfter Sieg ist offensichtlich einem größeren Publikum bekannt, denn sowohl Demosthenes als auch Aischines erwähnen ihn in ihren antagonistischen Reden zur Bekränzung Ktesiphons als Beispiel für jemanden, der sich durch Kampfkraft und Sie-
best-known member of a liturgical family that can be traced both forwards and backwards for several generations.« 86 Davies, APF, 5001 datiert die Rede in das Jahr 341. 87 [Demosth.] 58, 66: »Erinnert euch nun, ihr Richter, an die Schlechtigkeit jener und an eure Vorfahren: es war mein Großvater Epichares, der die Polis mit seiner Bekränzung ehrte, nachdem er im Stadionlauf der Knaben gesiegt hatte, und der von euren Vorfahren gebührend in Ehren gehalten starb.« 88 Seinen hippischen Sieg überliefert eine Inschrift, die in Athen stand, IG II/III, 3, 3127; vgl. Moretti, Olympionikai, no. 440. 89 Davies, APF, 13772; und H. Schäfer, Timokrates, in: RE 30 (1937), 1263f. Timokrates taucht immer wieder an der Peripherie des politischen Zentrums Athens auf, so ist die 24. Rede des Demosthenes gegen ihn verfasst und in der Rede ›Gegen Meidias‹ tritt er als Zeuge für Meidias auf, Demosth. 21, 139. 90 Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 424; Krause, Olympia, 352f.
Die athenischen Olympioniken
93
geswillen seinen direkten Rivalen überlegen zeigt.91 Der rhetorische Kunstgriff der Redner, Philammon namentlich zu erwähnen, um den Vergleich mit einem anderen Lebensbereich – der Athletik – lebendiger zu gestalten, lässt auf die Bekanntheit des Faustkämpfers unter den Athenern schließen. Denn der Erörterung einer grundsätzlichen Streitfrage kann die Abstraktheit nur genommen werden, wenn sich die am Prozesstag als Richter fungierenden Bürger tatsächlich an den Jahrzehnte zurückliegenden Sieg des Philammon erinnern und der illustrierende Vergleich des Demosthenes so ein Gesicht bekommt. Philammon wird auch in anderen Quellen immer im Zusammenhang mit seinem olympischen Sieg erwähnt.92 So ist denn außerdem nichts über ihn bekannt bzw. der Rest bleibt schon bei den antiken Autoren Spekulation.93 Bei der relativen Vielzahl der vorhandenen Belege über Philammon könnte man tatsächlich mit einer, wenn auch beiläufigen, Bemerkung zum Leben oder zur Person des Philammon rechnen. Das Fehlen einer solchen Information selbst bei Demosthenes, der die Person des Philammon mit dem Hinweis auf seine sozialen Verhältnisse und aristokratischen Werte sicher überzeugender hätte präsentieren können, verstärkt die Annahme, dass es sich bei dem Faustkämpfer um einen der wenigen Männer handelt, die tatsächlich aufgrund ihrer athletischen Leistungen und aus sonst keinem Grund bei ihren Mitbürgern berühmt waren und geehrt wurden.94
91 Demosth. 18, 319: Ð &IL£μμWN OÙC ÓTI 'LAÚKOU TOà +ARUST…OU KA… TINWN ˜TšRWN PRÒTERON GEGENHμšNWN ¢QLHTîN ¢SQENšSTEROJ ÃN, ¢STEF£NWTOJ ™K TÁJ '/LUμP…AJ ¢PÇEI, ¢LL' ÓTI TîN E„SELQÒNTWN PRÕJ AÙTÕN ¥RIST' ™μ£CETO, ™STEFANOàTO KAˆ NIKîN ¢NHGOREÚETO. In der Übersetzung von W. Zürcher: »Philammon z. B. ging deshalb, weil er schwächer war als Glaukos von Karystos und noch andere frühere Faustkämpfer, nicht etwa unbekränzt aus Olympia weg, sondern erhielt, da er unter denen, die gegen ihn antraten, der beste Kämpfer war, den Kranz und wurde als Sieger ausgerufen.« Vgl. Aischin. 3, 189, der die Aussage des Demosthenes über den Boxer referiert. 92 Eust. IV 818, 6: LšGETAI DÒ KAˆ &IL£μμWN, PÚKTHJ '!QHNA‹OJ, NIK©N TOÝJ ¢NTIP£LOUJ P£NTA TÕN CRÒNON. »Es wird gesagt, dass Philammon, der athenische Faustkämpfer seine Gegner für alle Zeit besiegte.« Vgl. Suda s.v. &IL£μμWN; Anecd. Bekk. 314. Auch Aristoteles nutzt die Bekanntheit Philammons, um anhand eines Beispiels eine rhetorische Übertreibungen im formalen Gewand eines metaphorischen Vergleichs zu verdeutlichen, Aristot. rhet. 1413a 21-27: E„SˆN DÒ KAˆ [Aƒ] EÙDOKIμOàSAI ØPERBOLAˆ μETAFORA…, ... TÕ DÒ ›éSPER TÕ KAˆ TÕ‹ ØPERBOL¾ TÍ LšXEI DIAFšROUSA. ›éSPER &IL£μμWN XUGOμACîN Tù KWRÚKJ‹, ›ò»QHJ D' ¨N AÙTÕN &IL£μμWNA EÍNAI μACÒμENON Tù KWRÚKJ‹. In der Übersetzung von F.G. Sieveke: »Auch bekannte Übertreibungen sind bildhaft, ... Die Form ›wie das und das‹ bedeutet nur einen sprachlichen Unterschied. Und wie Philammon fuchtelt er mit dem Ledersack ›Man hätte glauben könne, er sei Philammon, der mit dem Ledersack um sich schlägt‹«. 93 Schol. Aischin. 3, 189, macht Philammon zum erfolgreichen Strategen, was wohl ein Irrtum ist, vgl. W. Kroll, Philammon, in: RE 19 (1938), 2123. 94 Moretti, Olympionikai, no. 424, kommt zu dem gleichen Schluss: »Ph. è soltanto un famoso pugilatore ateniese, coetaneo all’ incirca di Demostene ed Eschine, e ben noto agli uditori e ai lettori delle orazioni dei due grandi avversari.«
94
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Mit dem Pankratisten Dioxippos siegt 336 ein ähnlich viel beredeter Mann, dessen Kampfeseifer im Mittelpunkt der Geschichten steht, die von ihm erzählt werden. Neben seinem agonalen Ruhm, der sich auf die meisterhafte Beherrschung verschiedener athletischer Disziplinen und als Höhepunkt auf einen Sieg in Olympia gründet, ist von der biographischen Person des Dioxippos, auch von den Einzelheiten seiner athletischen Laufbahn, wenig bekannt.95 Umso mehr Interesse ziehen anekdotische Episoden auf sich, die verschiedene Autoren aus seinem Leben zu berichten wissen und die zweifelsfrei von einer immensen Populärität des Dioxippos zeugen. Ebenso wie fast drei Jahrzehnte zuvor Philammon kommt Dioxippos durch seine Leistungen im Kampfsport nicht nur zu olympischen Ehrungen, sondern wird auch von den Athenern in Ehren gehalten. Er ist ein berühmter Mann und wird von seinen Mitbürgern wegen seiner Stärke und sportlichen Erfolge hoch geachtet.96 Der Redner Hypereides würdigt ihn als einen der beiden Männer, deren körperliche Kraft legendär ist, nicht nur in Athen, sondern unter allen Griechen: KAˆ $IWX…PPOU KAˆ %ÙFRA…OU, TOà PROSGUμNASTOà AÙTOà, O‰ TîN '%LL»NWN ÐμOLOGOUμšNWJ „SCURÒTATO… E„SIN.97 Einen besonderen Beitrag zu den Heldengeschichten, die sich um Dioxippos ranken, leistet Diodor mit seiner Erzählung eines Zweikampfes zwischen dem Makedonen Korrhagos und Dioxippos während des Alexanderfeldzuges.98 Offenbar war der Ruhm des stärksten Mannes dem Dioxip-
95 Als Pankratist erringt Dioxippos laut Aristob. apud Athen. VI 251a den olympischen Kranz; das geschieht ¢KONIT…, ohne Kampf, d. h. seine Gegner, die ihn sicherlich zuvor hatten kämpfen sehen, haben das Feld geräumt, ohne ihn herauszufordern, vgl. Moretti, Olympionikai, no. 458; Krause, Olympia, 274f.; Förster, Sieger, no. 381. Davis, APF, erwähnt ihn nicht. 96 Ail. var. 12, 58 beschreibt den festlichen Einzug des Dioxippos in seine Heimatpolis auf seine anschauliche Art: $IèXIPPOJ '/LUμPION…KHJ ¢QLHT¾J Ð '!QHNA‹OJ E„S»LAUNEN E„J T¦J '!Q»NAJ KAT¦ TÕN NÒμON TîN ¢QLHTîN. SUNšRREI TO…NUN T¦ PL»QH KAˆ ¥LLOJ ¢LLACÒQEN ™KKREμANNÚμENOJ ™QEîNTO AÙTÒN: »Der athenische Sportler Dioxippos, der bei den Olympischen Spielen gesiegt hatte, zog nach Art der Wettkämpfer im Triumphzug in Athen ein. So liefen also die Leute von allen Seiten zusammen, um ihn zu sehen, und hingen mit ihren Blicken an ihm.« Vgl. Diog. Laert. VI, 61. Von einem Gemälde, das Dioxippos darstellte, weiß Plin. nat. 35, 139: »Alcimachus Dioxippum, qui pancratio Olympiae citra pulveris iactum, quod vocant ¢KONIT…, vicit«. In der Übersetzung von R. König: »Alkimachos schuf einen Dioxippos, der im Pankration zu Olympia gesiegt hat ohne Staub aufzuwirbeln, was man akonití nennt.« 97 Hyp. 2, 5: »Dioxippos und Euphraios, sein Sportskamerad, waren anerkanntermaßen die stärksten unter den Hellenen«. Vgl. D. Whitehead, Hypereides: The Forensic Speeches. Introduction, Translation and Commentary, Oxford 2000, 90-149. 98 Diod. 17, 100-101.
Die athenischen Olympioniken
95
pos vorausgeeilt, denn der nicht minder kampferfahrene Korrhagos, ein Mann im unmittelbaren Gefolge Alexanders, fordert den Olympioniken zu einem Zweikampf heraus, den Aelian so zusammenfasst: “/TI $IèXIPPOJ, PARÒNTOJ '!LEX£NDROU KAˆ -AKEDÒNWN, ÒPALON LABèN, +ÒRRAGON TÕN -AKEDÒNA ÐPL…THN μONOμAC»SAJ KAˆ ™KKROÚSAJ AÙTOà TÕ XUSTÕN KAˆ ¡RP£SAJ TÕN ¥NDRA SÝN TÍ PANOPL…v, ™PIB¦J ™Pˆ TÕN AÙCšNA AÙTOà KEIμšNOU T¾N μ£CAIRAN ¿N ØPšZWSTO ØFARP£SAJ ¢PšKTEINE TÕN ÐPL…THN.99 Der Kampf zwischen Korrhagos und Dioxippos ist nicht eine Rangelei unter Zeltgenossen, sondern eine Sache der Ehre, dafür spricht die Anwesenheit Alexanders, die ungleiche Ausrüstung beider und der tödliche Ausgang für den Unterlegenen. Deutlicher noch als Aelian stellt Diodor die Episode als einen Kampf von Mann zu Mann dar, der beginnt mit der Herausforderung des einen und der Aufstachelung des anderen durch die schaulustigen Anwesenden.100 Allen ist bewusst, dass es ein Kampf um die Ehre wird.101 Dioxippos steht bei Alexander offensichtlich in hohem Ansehen, denn er wird zu seinen Freunden gezählt bzw. er speist mit diesen an der Tafel des Makedonen.102 Der anstehende Zweikampf ist so wichtig, dass Alexander selbst den Termin dafür festlegt und am bestimmten Tage unzählige Soldaten als Zuschauer erscheinen. Diodor stilisiert die Szenerie auch zu einem Entscheidungskampf zwischen den Hellenen und den Makedonen. Das veranschaulichen unter anderem die unterschiedlichen Ausrüstungen beider Kämpfer, die für die verschiedenen Auffassungen von der rechten Art des Wettkampfes stehen: PROÁLQEN E„J TÕN ¢GîNA Ð μÒN -AKEDëN POLUTELšSIN ÓPLOIJ KEKOSμHμšNOJ, Ð D' '!QHNA‹OJ GUμNÕJ ØPALHLIμμšNOJ, œCWN ÒμALON SÚμμETRON. ... Ð μÒN G¦R -AKEDëN DI£ TE T¾N FÚSIN TOà SèμATOJ KAˆ T¾N LAμPRÒTHTA TîN ÓPLWN μEG£LHN ™PIFšRWN KAT£PLHXIN ”!REI PAREμFER¾J ØPELAμB£NETO, Ð DÒ $IèXIPPOJ ØPERšCWN TE TÍ èμV KAˆ DI¦ T¾N ™K TÁJ ¢QL»SEWJ μELšTHN, œTI DÒ DI¦ T¾N PERˆ TÕ ÒPALON „DIÒTHTA T¾N PRÒSOYIN
99 Ail. 10, 22: »Vor den Augen Alexanders und der Makedonen focht Dioxippos, bewaffnet mit einer Keule, einen Zweikampf aus gegen den schwerbewaffneten Makedonen Korrhagos. Er schlug ihm den Speer weg, packte den Mann samt seiner Rüstung, setzte den Fuß auf den Nacken des Liegenden, nahm ihm das Schwert weg, das er trug, und tötete den Hopliten.« 100 Diod. 17, 100, 2. 101 Diodor spricht von der FILOTIμ…A, die die Kämpfenden antreibt, 17, 100, 3.4, von der ØPERBOL¾ TÁJ ¢NDRAGAQ…AJ des Dioxippos, 101, 1, und von der EÙDOX…A, die Dioxippos durch seinen Sieg allen Griechen gebracht habe, 101, 2. 102 Diod. 17, 100, 2.
96
Der Agon als Wettkampf um Ehre
`(RAKLEWTIK¾N EÍCEN.103 Der Sieg des Dioxippos vertritt so für Diodor den Sieg der Athener über die Makedonen.104 Hinsichtlich der Olympioniken zeigt die Episode, dass ihre Ehre offensichtlich nicht von kurzer Dauer oder begrenzter Verbreitung sein musste. Der Ruhm eines erfolgreichen Pankratisten konnte sich in Windeseile in ganz Hellas herumsprechen, wozu einerseits die panhellenischen Agone, andererseits die vielen lokalen Feste, in denen die Athleten ihre Leistungen zur Schau stellten, beitrugen.105 Dioxippos ist nach seinem Sieg in Olympia nicht mehr irgendjemand unter den Hellenen, sondern seine agonal erworbene Ehre befördert ihn in einen außergewöhnlich hohen Status. Es wird nicht nur viel von ihm geredet, sondern er darf bei Diodor stellvertretend für alle Griechen zum Kampf antreten, nachdem ihn niemand geringerer als ein Freund des Königs herausgefordert hat. Das wirkt umso eindrucksvoller, als von seinen Vorfahren nichts bekannt ist, ebenso wenig wie von seinen Nachkommen, etwaigem politischen Ehrgeiz oder einem prestigeträchtigen Gebaren in der Öffentlichkeit. Die Einseitigkeit der ruhmreichen Taten des Dioxippos, die sich auf sein athletisches Talent beschränken, nehmen ihm nichts von den Ehrungen, die er durch seine Mitbürger und die späterhin Schreibenden erfährt, die ihm das Prädikat des stärksten aller damaligen Männer zuerkennen. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts überliefert die Tradition zwei weitere Olympioniken Athens, die nicht der Oberschicht entstammen. Mehr noch als die für einfache Bürger bestehende Möglichkeit, zu olympischen Ehren zu gelangen, zeigen ihre Fälle sehr deutlich die gegenseitige Ehre, die die siegreichen Athleten und die Polis Athen einander brachten.106 Nachdem der Athener Kallippos 332 im Pentathlon gesiegt hatte,107 stellten die Eleer fest, dass er seine Gegner zuvor bestochen hatte, so dass sie allen Teilnehmern des Kampfes ein Bußgeld auferlegten. Die Athener weigerten sich zunächst zu zahlen und versuchten erfolglos, die Angelegenheit auf diplomatischem 103 Ebd., 4-5: »Der Macedonier trat mit prächtigen Waffen geschmückt auf den Kampfplatz, der Athener hingegen unbekleidet und gesalbt, eine Keule von mäßiger Größe in der Hand. ... Der Macedonier nemlich, der durch seinen Körperbau und den hellen Glanz seiner Waffen Staunen erregte, wurde dem Ares gleichgeachtet, und Dioxippus, an Stärke überlegen und ein geübter Fechter, sah aus wie ein Hercules, besonders wegen seiner eigenthümlichen Waffe, der Keule.« 104 Schließlich unterliegt Dioxippos nach Diodor doch noch den Makedonen. Diese antworten auf die ¢RET» des Atheners mit Neid und einem Hinterhalt, der Dioxippos eines Gutteils seiner Ehre beraubt und ihn zur Selbsttötung veranlasst, Diod. 17, 101, 3-6. 105 Vgl. W. Decker, Zur Vorbereitung und Organisation griechischer Agone, in: Nikephoros 10 (1997), 77-102, der einen guten Eindruck von der notwendigen Reisefreudigkeit antiker Athleten vermittelt, 87-98. 106 Mann, Athlet, 297f., führt Kallippos und Aristophon als Belege für ein im 4. Jahrhundert entspannteres Verhältnis zwischen Athlet und Polis an: »Selbstdarstellung des siegreichen Athleten und Selbstdarstellung der pólis ließen sich nunmehr konfliktfrei miteinander verbinden.« 107 Moretti, Olympionikai, no. 460; Krause, Olympia, 306.
Die athenischen Olympioniken
97
Wege zu bereinigen. Erst als das Orakel von Delphi ihnen die Ableistung der Buße unter Androhung von Sanktionen nahe legte, stellten sie die sechs Zeusstatuen in Olympia auf.108 Kallippos wurde von den Athenern selbstverständlich als ein Vertreter ihrer Polis verstanden: Ebenso wie er ganz Athen die agonale Ehre eines olympischen Sieges brachte, büßte die Bürgergemeinschaft auch für sein regelwidriges Verhalten. Auch im Falle des Aristophon, der 312 im Pankration siegte,109 identifizierte sich die athenische Bürgerschaft mit der Ehre des Athleten. Die athenische Polis sorgte für eine angemessene Ehrung des Aristophon, indem sie für ihn eine Statue in der Altis aufstellen ließ, von der noch Pausanias schreiben konnte: ¢NšQHKE DÒ KAˆ Ð '!QHNA…WN DÁμOJ '!RISTOFîNTA ,US…NOU, PAGKRATIAST¦J ™N TîI ¢GîNI TîI ™N '/LUμP…AI KRAT»SANTA ¥NDRAJ.110 Die auf den olympischen Sieg folgenden Ereignisse in den Fällen dieser beiden Athleten gen Ende des 4. Jahrhunderts zeigen die Bedeutung der Olympioniken für die Ehre einer Polis. Beider Leben wird sich entsprechend nach ihrer Heimkehr entschieden anders gestaltet haben als zuvor. Es sind keine Zeugnisse einer politischen oder weiteren athletischen Karriere des Kallippos oder des Aristophon vorhanden, man kann aber davon ausgehen, dass beide Olympioniken von ihren Mitbürgern in hoher Ehre gehalten wurden. Für das 5. und 4. Jahrhundert bleibt insgesamt der prosopographisch ermittelte Befund festzuhalten, dass es unter den athenischen Olympioniken durchaus einige Männer gab, die sich durch ihre agonalen Ehrungen bei ihren Mitbürgern Ehre erwarben. Sie wurden bekannt durch ihre Siege, 108 Paus. 5, 21, 5: %ÙPèLOU DÒ ÛSTERÒN FASIN '!QHNA‹ON +£LLIPPON ¢QL»SANTA PšNTAQLON ™XWN»SASQAI TOÝJ ¢NTAGWNIOUμšNOUJ CR»μASI, DEUTšRAN DÒ ™Pˆ TA‹J DšKA TE KAˆ ˜KATÕN ÑLUμPI£DA EÍNAI TAÚTHN. ™PIBLHQE…SHJ DÒ TîI +ALL…PPWI KAˆ TO‹J ¢NTAGWNISAμšNOIJ ZHμ…AJ ØPÕ '(LE…WN, ¢POSTšLLOUSIN `5PER…DHN '!QHNA‹OI PE…SONTA '(LE…OUJ ¢FE‹NA… SFISI T¾N ZHμ…AN: ¢PEIPÒNTWN DÒ '(LE…WN T¾N C£RIN, ™CRîNTO ØPEROY…AI TOI©IDE ™J AÙTOÝJ Oƒ '!QHNA‹OI, OÜTE ¢PODIDÒNTEJ T¦ CR»μATA KAˆ '/LUμP…WN E„RGÒμENOI, PRˆN ½ SFISIN Ð QEÕJ [Ð] ™N $ELFO‹J OÙ PRÒTERON œFHSEN ØPÒR OÙDENÕJ CR»SEIN PRˆN À T¾N ZHμ…AN ¢PODO‹EN '(LE…OIJ. OÛTW D¾ ¢PODÒNTWN ™POI»QH TîI $Iˆ ¢G£LμATA, žX μÒN KAˆ TAàTA, GšGRAPTAI DÒ ™P' AÙTO‹J ™LEGE‹A OÙDšN TI DEXIèTERA ™J PO…HSIN À T¦ œCONTA T¾N ZHμ…AN T¾N %ÙPèLOU. »Nach Eupolos, sagt man, habe der Athener Kallippos als Fünfkämpfer seine Gegner mit Geld abgekauft, und das sei die 112. Olympiade gewesen. Als dem Kallippos und seinen Gegnern von den Eleern Strafen auferlegt wurden, schickten die Athener Hypereides, um die Eleer zu veranlassen, ihnen die Strafe zu erlassen. Da die Eleer ihnen diesen Gefallen nicht taten, mißachteten die Athener sie so sehr, dass sie das Geld nicht zahlten und von den Olympien fernblieben, bis ihnen der Gott in Delphoi sagte, er werde ihnen nicht eher über irgend etwas ein Orakel geben, als bis sie die Strafe an die Eleer gezahlt hätten. so zahlten sie und wurden die Statuen für Zeus gemacht, sechs auch diese, und auch auf ihnen stehen Epigramme, nicht besser gedichtete als die über die Bestrafung des Eupolos.« 109 Moretti, Olympionikai, no. 484; Kirchner, PA, 2111. 110 Paus. 6, 13, 1: »Auch das Volk von Athen stellte Aristophon, den Sohn des Lysinos, auf, der im Wettkampf in Olympia die Pankratiasten bei den Männern besiegte.«
98
Der Agon als Wettkampf um Ehre
aufgrund derer ihnen Ehre zugeschrieben wurde. Diese übertrugen sie unmittelbar auch auf ihre Polis, was wiederum zu ihrer eigenen Ehrenhaftigkeit als Bürger beitrug. Der Zeitfaktor scheint bei diesen Aussagen wichtig zu sein: Je länger die Demokratie in Athen währte, desto mehr Athener gab es, die, lediglich ausgestattet mit jener Ehre, über die sie als Mann und athenischer Bürger verfügten, zu höheren Ehrungen durch einen Sieg in den olympischen Agonen kamen.111 Das hatte sowohl Auswirkungen auf den Charakter der panhellenischen Agone als auch auf die gesellschaftspolitischen Bedingungen in Athen. In Olympia etablierte sich die Disziplin der hippischen Agone schnell als die Bastion der Reichen und Schönen, die mit einem glanzvollen Auftreten an der agonalen Ehre, der sie großen Wert beimaßen, teilhaben wollten. Das beste Beispiel hierfür ist Alkibiades; vor und nach ihm bewegte seine pferdezüchtenden Mitstreiter wohl dasselbe Motiv. Diese Männer verfügten bereits über familiär tradierte Ehre oder zumindest den notwendigen Reichtum, um mit der olympischen Bekränzung ihrer Ehre nurmehr die Krone aufzusetzen. In den anderen Disziplinen konnten sich auch Männer wie Kallias Didymiou, Philammon oder Dioxippos bewähren, die erst durch ihre agonalen Siege ein Maß an Ehre erstritten, das sie unter ihren Mitbürgern hervorhob. Ihre wie ein Preisgeld erworbene Ehre ging mit einem größeren Handlungsspielraum auch in anderen Lebensbereichen einher und wirkte so als ein dynamisches Element innerhalb der relativ starren sozialen Struktur der athenischen Gesellschaft. Ebenso wie in der demokratischen Polis Athen das reine Mehrheitsverhältnis der Stimmen aller Bürger für Entscheidungen ausschlaggebend war, so erwies sich zunehmend die reine Stärke oder Schnelligkeit eines Athleten als das Kriterium für die Teilnahme an den olympischen Agonen. Die zwar nicht zahlreichen, aber sicher belegbaren athenischen Olympioniken, die aufgrund ihrer agonalen Ehre zu einem höheren Status und einer in den Augen ihrer Mitbürger dauerhaften Ehre gelangten, beleuchten einige entscheidende Aspekte der Wirkung von Ehre in der athenischen Polis. Die Ehre eines Mannes kann im Laufe seines Lebens Schwankungen unterworfen sein, die seine lebensweltlichen Verhältnisse grundsätzlich verändern. Damit sind nicht jene alltäglichen Auseinandersetzungen und Be111 Vgl. D.G. Kyle, The First Hundred Olympiads: A Process of Decline or Democratization?, in: Nikephoros 10 (1997), 53-75, 74: »The shift from an elitism of birth to an elitism of wealth in Athenian athletics probably applies at Olympia. It was probable that athletes from families with resources and traditions were still predominant, but it was possible, increasingly so by 380, that more talented youths from humbler origins also were competing.« Vgl. D.C. Young, The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, Chicago 1984, 147.157; M.I. Finley und H.W.Pleket, Die Olympischen Spiele der Antike, Tübingen 1976, 94f.
Die athenischen Olympioniken
99
währungsproben gemeint, die die Ehre eines Atheners im Umgang mit seinen Mitbürgern erst konstituieren. Sondern es kommt vor, dass ein Athener Ehre erwirbt, die nicht an seinen bisherigen sozialen Status gekoppelt ist, seinen künftigen aber entscheidend beeinflusst. In einem solchen Fall wirkt die Ehre als eine Leitdimension für alle übrigen Kriterien des sozialen Status einer Person. Die Flexibilität des Begriffs Ehre, die von der Zuschreibung durch andere lebt, erleichtert die spontane Ehrung einer bis dato unauffälligen Person durch ihre Mitbürger. Ehre fungiert in der athenischen Gesellschaft also nicht nur als Stabilisator der bestehenden Ordnung, sondern sie kann wegen der vielfältigen Möglichkeiten, sie zu erwerben, auch vorübergehende Statusinkongruenzen verursachen. Letztere neigen dazu, sich auf höherem Niveau als zuvor wieder zu harmonisieren. Da die Ehre einer Person das entscheidende soziale Distinktionsmerkmal darstellt, pendeln sich auch die übrigen Statuskriterien auf den höheren Level ein. Die Agone markierten ein entscheidendes Terrain, auf dem um Ehre gewetteifert wurde. Sie boten die Gelegenheit, relativ unabhängig vom bisherigen sozialen Status außerordentliche Ehre zu erlangen. Die besondere Bedeutung gerade der Agone für die Ehre hat mehrere Gründe: Die Agone fanden unter Beisein der Öffentlichkeit statt, wurden begleitet von wiederholten Herausforderungen und Provokationen zum Kampf, der klar zwischen Siegern und Besiegten entschied und sie brachten dem Sieger sichtbare Ehrungen ein. Außerdem waren sie sehr populär; die Athener maßen ihnen einen hohen Stellenwert bei, der sich auf die in den Agonen Ausgezeichneten übertrug. Weil der Erfolg im Agon für einen athenischen Ehrenmann derart wichtig war, wurden die Olympioniken in besonderen Ehren gehalten. Die Ehre des siegreichen Athleten wurde bei seiner Heimkehr von den Polisbürgern aufwändig inszeniert, und auch fortan bot die Öffentlichkeit der Polis ihren Olympioniken den Resonanzraum für ihre besondere, agonale Ehre. Eine weitere politische Karriere oder eine Heirat in die Oberschicht etwa als Zeichen einer erfolgreichen Konvertierung der agonalen Ehre in einen dauerhaft privilegierten sozialen Status lässt sich zwar für keinen der Athleten des 5. und 4. Jahrhunderts sicher nachweisen. Aber die biographischen Angaben der athenischen Olympioniken machen folgende Punkte für die Frage nach dem Verhältnis zwischen (agonaler) Ehre und Polis deutlich: Durch agonale Erfolge auf dem separat gelegenen Feld der Ehre in Olympia konnte es den siegreichen athenischen Athleten gelingen, in Athen einen ehrenhaften Status zu erhalten und langfristig von ihren Mitbürgern Ehrbezeigungen zu erfahren. Der Agon – zumal der olympische – bot die nahezu einmalige Gelegenheit für einen Bürger, der nicht aus der Oberschicht stammte, zu höherer Ehre zu gelangen, die von allen seinen Mitbürgern einhellig akzeptiert wurde.
100
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Der Polis fiel in diesem Prozess die Rolle des Katalysators zu: ihre auf reinen Zahlenverhältnissen fußenden Entscheidungsmechanismen, die Gleichheit aller Polisbürger und die periodische Besetzung wichtiger Gremien durch eine willkürliche Auswahl von Bürgern förderte bei den Athenern die Anerkennung von Ergebnissen, die zähl- und messbar sowie unpersönlicher Natur waren. Zudem mag der politische Grundsatz der Gleichheit aller Polisbürger einige athenische Athleten veranlasst haben, sich auch auf dem prestigeträchtigen agonalen Felde der olympischen Ehre, die zuvor ein exklusiv aristokratisches Reservat war, mit ihren besonders ehrenhaften Mitbürgern zu vergleichen.
3. Das Stadion der Ehre: Athenische Ehrenmänner in Olympia Die wichtigsten griechischen Agone fanden außerhalb des Terrains der meisten Poleis statt. Die panhellenischen Agone, als deren bedeutendster der olympische galt, können auch in einem gesellschaftlichen Sinne als außerhalb der Polis Athen angesiedelt beschrieben werden. Denn sie stellen quasi ein separiertes Feld dar, auf dem die meisten sozialen Mechanismen, die die Ehre einer Person beweisen, beschädigen oder bestätigen konnten, in Reinkultur zu beobachten sind. Einige für die Ehre typische Phänomene treten weniger ausgeprägt in Erscheinung. So kann das Konfliktpotential der Ehre nicht voll zum Tragen kommen in einem Umfeld, in dem sich die Männer einerseits in einem rücksichtslosen Wettkampf miteinander befanden, andererseits aber ausnahmslos in ein festes Regelwerk eingebunden waren, das von allen akzeptiert wurde und Verstöße rigoros ahndete. Auf dem mikrokosmischen olympischen Feld der Ehre kann ein athenischer Bürger wie nirgendwo sonst ein Ehrenmann sein. Die Voraussetzungen für sein ehrenhaftes Verhalten sind durch Umstände und Ablauf des olympischen Agons gegeben. Etwaige störende Interferenzen durch ein gesellschaftliches oder politisches Leben, das nach anderen Regeln verläuft und immer wieder Konzessionen erfordert, gibt es in Olympia nicht. Die ansonsten sehr komplexen, interpretatorisch offenen Normen ehrenhaften Verhaltens sind hier auf ein überschaubares Maß reduziert und eingebunden in viele von allen Teilnehmern als solche definierte agonale Situationen. Das erleichtert nicht nur den Athleten die ausschließliche Konzentration auf ein kompetitives ehrenhaftes Verhalten, sondern ermöglicht die Analyse der basalen habituellen Formen und ihrer Ausgestaltung durch die athenischen Ehrenmänner. Neben der großen Bedeutung des Agons selbst sind die Öffentlichkeit und das soziale Wissen um den richtigen Habitus in Olympia äußerst wichtig. Auch das ambivalente Verhältnis zwischen der Gleichheit
Athenische Ehrenmänner in Olympia
101
und der Ungleichheit der wettstreitenden Männer und die komplementären Rollen von Männern und Frauen zeigen sich im Rahmen der Agone immer wieder. Diese eher strukturellen Merkmale ehrenhaften Verhaltens sind gekennzeichnet durch den Ehrgeiz, das provokative Gebaren und den Siegeswillen der athenischen Männer. Zugleich favorisieren die Agone ein Verhalten, das in engem Zusammenhang steht mit jener Auffassung von Ehre, wie sie die demokratischen Bürger haben. Der olympische Agon ist nicht nur für einen Ehrenmann, sondern zunehmend auch für einen athenischen Bürger der ideale Exerzierplatz. Ebenso wie in Athen kommt es in Olympia zu einer Überformung der aristokratischen Verhaltensmuster der Ehre durch die Bürger, deren demokratische Gesinnung auf dem Anspruch fußt, die aristokratische Exklusivität auf sie auszuweiten.112 Das erfordert bestimmte Modifikationen für den Wertekanon der alten Aristokraten. Die Ehre als hohes soziales Gut wird dabei formal nicht angetastet, ihr ohnehin sehr flexibel zu interpretierender Inhalt aber kann mit dem mehrheitlich gewünschten Verhalten gefüllt werden. Einige Aspekte der olympischen Agone erscheinen sehr egalitär, sie werfen ein bezeichnendes Licht auf die enge Verwandtschaft zwischen den aristokratischen und den demokratischen Verhaltensmustern, die oftmals dieselben sind, dabei aber einen unterschiedlichen Impetus haben. Eine der grundlegenden Regeln der Agone, die einen spannenden Wettkampf erst ermöglichten, war jene der Gleichheit aller Teilnehmer. Auch in Athen sorgten sowohl das Prinzip der Ehre als auch die Demokratie für die Vorstellung aller athenischen Männer als Gleiche. Die Gleichheit in Athen war immer eine janusköpfige: Es handelte sich sowohl um die der Norm der Ehre entsprechende virtuelle Gleichheit aller ehrenhaften Athener als auch um die gesetzlich verankerten gleichen Rechte aller Polisbürger. Gleich waren die athenischen Männer sowohl auf eine ehrenhafte als auch auf eine demokratische Weise, in beiderlei Hinsicht aber nur unter bestimmten Aspekten. Die für ihre Ehre grundlegende Geschlechtsidentität stellte alle männlichen Bürger Athens auf eine Stufe, gleichzeitig aber bestanden immense Statusunterschiede. Die Diskrepanz zwischen sozialer Ungleichheit und politischer, rechtlicher Gleichheit bestand ebenso innerhalb der Polisbürgerschaft. Die Polis und die Ehre vermittelten den Athenern eine Vorstellung von Gleichheit untereinander auf einer sehr elementaren Ebene, die in vielen Fällen nicht die Handlungsebene sehr ehrenhafter Bürger darstellte, sondern lediglich nominell, normativ oder nur vorgestellt bestand. 112 Vgl. Pleket, Soziologie, 79; Kyle, Olympiads, 71: »Like Athenian politics, competition at Olympia was democratic – fully so in theory, and arguably so in practice, at least to a significant degree. ... The Olympics were fully democratized in the sense of equal access and potential participation but, like Athenian democracy, Olympic competition retained aspects of privilege and elitsm.«
102
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Das ambivalente Verhältnis der Norm der Ehre zur Gleichheit kam in Olympia noch deutlicher zum Vorschein als in Athen. Besonders ehrenhafte athenische Bürger trafen in Olympia die Mitglieder der Oberschichten anderer Poleis und konnten so mit Ebenbürtigen wetteifern. Außer einem prunkenden Auftreten am Wettkampfort, das niemanden über den Status eines solchermaßen sich in Szene setzenden Mannes im unklaren lassen konnte, ergaben sich im Rahmen der eigentlichen Agone allerdings wenige Möglichkeiten der sozialen Distinktion. Eine davon war die traditionsreiche Disziplin der Wagenrennen, die einen erheblichen Aufwand an Zeit, Logistik und Kapital beanspruchte, und deshalb zum bevorzugten Agon der Männer der Oberschicht avancierte. Den Wunsch, sich durch die Wahl gerade dieser Disziplin von den übrigen Athleten abzusetzen, wurde von den aristokratisch gesinnten Pferdeliebhabern kaum verhohlen. Der Sohn des Alkibiades belegte die Motive seines Vaters für die Teilnahme an den olympischen Agonen mit der charakteristisch überheblichen Attitüde seines Vaters: OÙDENÕJ ¢FUšSTEROJ OÙD' ¢RRWSTÒTEROJ Tù SèμATI GENÒμENOJ TOÝJ μÒN GUμNIKOÝJ ¢GîNAJ ØPERE‹DEN, E„DëJ ™N…OUJ TîN ¢QLHTîN KAˆ KAKîJ GEGONÒTAJ KAˆ μIKR¦J PÒLEIJ O„KOàNTAJ KAˆ TAPEINîJ PEPAIDEUμšNOUJ, ƒPPOTROFE‹N D' ™PICEI-R»SAJ, Ö TîN EÙDAIμONEST£TWN œRGON ™STˆ, FAàLOJ D' OÙDEˆJ ¨N POI»SEIEN.113 Mit dieser Einstellung befand sich Alkibiades in der guten Gesellschaft vieler seiner Standesgenossen, diverser Tyrannen und auch seiner Intimfeinde. Er konnte sich direkt mit jenen Männern messen, deren Statusgleichheit er akzeptierte und auf die seine Präsentation der eigenen Ehre zielte, weil er sie daran zu übertreffen beabsichtigte. Diese ebenbürtigen Konkurrenten fand Alkibiades in den führenden Schichten anderer Poleis. Die panhellenischen Agone passten sich gut ein in die ganz Griechenland erfassenden familiären und freundschaftlichen Verbindungen der alten Aristokraten.114 Außer diesem gesellschaftsbildenen Aspekt boten die hippischen Agone einige entscheidende Vorzüge gegenüber anderen Disziplinen. Sie erforderten kein langwieriges, kräftezehrendes Training unter persönlichem Einsatz, 113 Isokr. 16, 33: »er interessierte sich nicht für die athletischen Wettkämpfe, obwohl er keinem an Begabung und physischer Stärke nachstand, weil er aber wußte, dass manche Athleten auch von geringer Herkunft waren, aus unbedeutenden Städten kamen und in niedrigen Verhältnissen aufgewachsen waren, widmete er sich statt dessen der Pferdezucht, die sich nur die Begütertsten leisten können, kein Mensch von niederer Herkunft aber betreiben könnte«. 114 Unter den Olympioniken in den hippischen Disziplinen finden sich so illustre Namen wie jene des Kleisthenes von Sikyon (Hdt. 6, 126; Moretti, Olympionikai, no. 94); des Königs Damaratos von Sparta (Hdt. 6, 70; Moretti, Olympionikai, no. 157); Gelon aus Gela (Moretti, Olympionikai, no. 185); der Tyrannen Theron von Akragas und Hieron von Syrakus (Pind. O. 1 bzw. 2; Moretti, Olympionikai, no. 220 bzw. no. 221); Arkesilaos von Sparta (Moretti, Olympionikai, no. 305, 311); vgl. Decker, Sport, 110-114.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
103
sondern lediglich das Betreiben einer Pferdezucht und die Auswahl eines fähigen Jockeys; der Preis dafür rechnete sich für den Eigentümer eher in Talenten als in Trainingsstunden.115 Gerade der finanzielle Aufwand machte die Teilnahme an den hippischen Agonen, die nicht nur den Besitz von Pferden, sondern auch das Personal für die Pflege, das Training und die Verschiffung der Tiere erforderte, zu einem idealen Mittel der Zurschaustellung des eigenen Vermögens.116 Nicht zuletzt, weil der Besitz von Pferden immer mit gesellschaftlich gebotenen Leistungen, namentlich militärischer Art, verbunden gewesen war. Die Ausführung der einzelnen hippischen Disziplinen war den kriegerischen Erfordernissen entlehnt.117 Einige lokale Agone knüpften an die militärischen Traditionen auch anderer Bevölkerungsschichten, wie etwa der Ritter in Athen an.118 In den panhellenischen Agonen in Olympia aber dominierten jene, die auch während der Kampfhandlungen ihren überlegenen Status demonstrieren konnten. Aus diesen Gründen, und weil die traditionsbewussten Aristokraten sich gerne mit den homerischen Rossebezwingern identifizierten,119 erwies sich der agonale Bereich, in dem Pferde den Wettstreit bestritten, als optimal für die Mitglieder der führenden Schichten der einzelnen Poleis, die sich in Olympia einfanden. Der elitäre Charakter der hippischen Disziplinen verhalf ihnen zu einer Sonderstellung unter den Agonen, die das Prinzip der Gleichheit aller Teilnehmer der Wettkämpfe zu umgehen suchte. Die exhibitionistische Zurschaustellung ihrer Möglichkeiten durch die reichen und aristokratischen Männer, die auch in ihren Heimatpoleis eine herausragende Rolle spielten, verlagerte sich während der Austragung der Agone auf einige ausgesuchte Disziplinen. Außerhalb ihrer agonalen Domänen nutzten die Aristokraten 115 Vgl. D. Bell, The Horse Race (KšLHJ) in Ancient Greece from the pre-classical period to the first century B.C., in: Stadion 15 (1989), 167-190, 177; Decker, Vorbereitung, 97f.; Golden, Sport, 169. 116 »Wenn man so will, fand ein doppelter Wettkampf statt: Die adligen Gespannbesitzer maßen sich nicht nur im Hippodrom hinsichtlich der Schnelligkeit ihrer Pferde; ihnen war ebenso daran gelegen, durch Prunk der Ausstattung und glanzvolles Auftreten der eigenen Leute die Konkurrenten auch auf außersportlichem Felde in den Schatten zu stellen.«, Decker, Vorbereitung, 98. 117 Vgl. zur wechselnden Ausgestaltung des ¢GëN ƒPPIKÒJ in Olympia Bell, Horse Race, 170-174; N.B. Crowther, Reflections on Greek Equestrian Events. Violence and Spectator Attitudes, in: Nikephoros 7 (1994), 121-133. 118 Vgl. Bell, Horse Race, 177-180: »These equestrian events at the Panathenaic games which seem to have been framed especially (or perhaps even exclusively) for the cavalry ... was organized to suit the requirements of the people of Athens, who had a strong inteest in their cavalry.«, 179f. Vgl. S.V. Tracy und C. Habicht, New and old Panathenaic Victor Lists, in: Hesperia 60 (1991), 187-236, 198-201. 119 Homerisches Vorbild für Pferde- und Wagenrennen sind die Leichenspiele des Patroklos, die mit dem berühmten Wagenrennen beginnen, Hom. Il. 23, 233-539.
104
Der Agon als Wettkampf um Ehre
das Forum Olympias und die Anwesenheit eines großen Publikums zur Darstellung ihrer Person und ihrer Ehre. Die Gelegenheit zur Selbstdarstellung in einem sozialen Raum, der die Resonanz der heimischen Marktplätze weit überstieg, infrastrukturell aber ähnlich ausgestattet werden konnte, ließen sich wohl nur wenige Männer entgehen.120 In Olympia fand sich an den Tagen der Agone eine panhellenische Öffentlichkeit ein, die das Bedürfnis der Ehrenmänner nach der Bezeigung ihres Anspruchs auf Ehre wie kaum an einem anderen Ort befriedigte. Die Akklamation der Ehre eines athenischen Mitgliedes der Oberschicht erfolgte hier durch an Ehre gleichrangige Männer, nicht nur durch einfache Bürger, wie es in der athenischen Polis der Fall war. Überliefert ist der in den athenischen Quellen viel besprochene Auftritt des Alkibiades, der den Mehrwert an Ehre, den eine gelungene Inszenierung in Olympia bringen kann, deutlich vor Augen hat: 0ERˆ DÒ TOÝJ AÙTOÝJ CRÒNOUJ ÐRîN T¾N ™N '/LUμP…v PAN»GURIN ØPÕ P£NTWN ¢NQRèPWN ¢GAPWμšNHN KAˆ QAUμAZOμšNHN, KAˆ TOÝJ “%LLHNAJ ™P…DEIXIN ™N AÙTÍ POIOUμšNOUJ PLOÚTOU KAˆ èμHJ KAˆ PAIDEÚSEWJ, KAˆ TOÚJ T' ¢QLHT¦J ZHLOUμšNOUJ KAˆ T¦J PÒLEIJ ÑNOμAST¦J GIGNOμšNAJ T¦J TîN NIKèNTWN, KAˆ PRÕJ TOÚTOIJ ¹GOÚμENOJ T¦J μÒN ™NQ£DE LVTOURG…AJ ØPÒR TîN „D…WN PRÕJ TOÝJ POL…TAJ EÍNAI, T¦J D' E„J ™KE…NHN T¾N PAN»GURIN ØPÒR TÁJ PÒLEWJ E„J ¤PASAN T¾N `%LL£DA G…GNESQAI.121 Kritische Zeitgenossen verurteilten ein allzu pompöses Auftreten in Olympia, für das Alkibiades das wahrscheinlich markanteste Beispiel liefert. Einerseits sollten die gymnischen Agone nicht ganz in den Schatten treten, andererseits bestand bei der unverhältnismäßigen Erstarkung einer Einzelperson immer die Befürchtung, die in Olympia gewonnene übermä120 I. Weiler, Olympia – jenseits der Agonistik: Kultur und Spektakel, in: Nikephoros 10 (1997), 191-213, schildert anschaulich eine »Festwiese«, »einen ›Tummelplatz der Eitelkeiten‹, der Renommiersucht und der Geschäftemacherei«, 198. »Olympia ist für das antike Nachrichtenwesen ohne Zweifel ein zentraler Treffpunkt. Leicht anachronistisch könnte man von Ansätzen einer Medienpolitik und einem propagandistischem Zentrum sprechen.«, ebd. 212. Auch U. Sinn, Das antike Olympia. Götter, Spiel und Kunst, München 2004, spricht von einem »Forum für Geselligkeit, Gelehrsamkeit und Handel«, 172f. und schon Krause, Olympia, 191f., berichtet von »einer großen Messe der Hellenen«, auf der ein »merkantilischer Verkehr« herrschte, »auch mochten sich einzelne reiche und vornehme Zuschauer so wie auch Agonisten sich prächtige Zelte errichten lassen, worin sie ihre Freunde bewirtheten.« 121 Isokr. 16, 32: »Um die gleiche Zeit nun konnte mein Vater erleben, dass die Festversammlung in Olympia von allen Menschen sehr geschätzt und bewundert wurde, dass die Griechen dort ihren Reichtum, ihre Körperkraft und ihre Bildung zur Schau stellten, die Wettkämpfer bewundert und die Poleis der Olympiasieger berühmt wurden. Außerdem war mein Vater der Ansicht, die Leiturgien hier in der Polis würden vor den Augen der Bürger in persönlichem Interesse geschehen, die Aufwendungen für jene Festversammlung aber würden im Interesse der Polis die Aufmerksamkeit von ganz Griechenland erregen.«
Athenische Ehrenmänner in Olympia
105
ßige Ehre könne in der Heimatpolis die demokratische Gleichheit der Bürger gefährden.122 Im Gegenzug verwiesen die Aristokraten auf die Ehre, die sie der eigenen Polis mit einem Sieg in Olympia brachten: Sie repräsentierten in Anwesenheit aller Hellenen die Pracht ihrer Heimatpolis. Entsprechend der Logik von Ehre konnte auch die Statusmanifestation einer Polis die beanspruchte Ehre darstellen und etwaigen Gegnern zeigen, mit wem sie sich anlegten. Diesen einschüchternden Effekt beansprucht Alkibiades für sein olympisches Auftreten.123 Mit der Legitimation seiner Prachtentfaltung in Olympia in einer athenischen Volksversammlung, die ihn zum Strategen für die sizilische Expedition wählen soll, macht Alkibiades auf den ambivalenten Charakter seiner olympischen Ehre aufmerksam. Er kann nicht umhin, sich ihrer zu rühmen, da die Zuschreibung von Ehre immer auch verbunden ist mit der Zuschreibung besonderer Fähigkeiten, was ihm in der aktuellen Situation zugute kommt. Auf der anderen Seite aber versucht er, seinen ungewöhnlichen Status in die Interessen der Polis Athen einzubinden. Seine Worte bezeugen ein gewisses Misstrauen bei seinen Zuhörern, die auf seine anmaßenden Eskapaden nicht mit ungeteilter Begeisterung reagierten. Obwohl die meisten Besucher Olympias die Pferde- und Wagenrennen sicherlich als spektakuläres und gefährliches Schauspiel schätzten, so beobachteten sie hier doch die gewohnte aufsehenerregende Selbstdarstellung der Aristokraten, wie sie sie bereits in kleinerem Maßstab aus ihren Heimatpoleis kannten. Außerhalb der hippischen Disziplinen galt die Aufmerksamkeit eher den Leistungen der Athleten als ihrem prunkvollen Auftreten, was dem öffentlichen Interesse und der Möglichkeit, zu Ehre zu gelangen, 122 Thuk. 6, 15, 3-4, schreibt mit Blick auf Alkibiades: íN G¦R ™N ¢XIèμATI ØPÕ TîN ¢STîN, TA‹J ™PIQUμ…AIJ μE…ZOSIN À KAT¦ T¾N ØP£RCOUSAN OÙS…AN ™CRÁTO œJ TE T¦J ƒPPOTROF…AJ KAˆ T¦J ¥LLAJ DAP£NAJ: ÓPER KAˆ KAQE‹LEN ÛSTERON T¾N TîN '!QHNA…WN PÒLIN OÙC ¼KISTA. FOBHQšNTEJ G¦R AÙTOà Oƒ POLLOˆ TÕ μšGEQOJ TÁJ TE KAT¦ TÕ ˜AUTOà SîμA PARANOμ…AJ ™J T¾N D…AITAN KAˆ TÁJ DIANO…AJ ... æJ TURANN…DOJ ™PIQUμOàNTI POLšμIOI KAQšSTASAN. »Denn hoch angesehen in der Stadt, frönte er großen Leidenschaften über sein Vermögen mit den Pferden, die er hielt, und sonstigem Aufwand. Und gerade das wurde einer der Hauptgründe für den Untergang Athens. Denn da die Menge erschrak vor dem Übermaß seiner persönlichen, ganz überbürgerlichen Lebensführung ... wurden sie, als wolle er Tyrann werden, seine Feinde...« Vgl. zu Alkibiades unvergleichlich auffälligem Verhalten in Olympia And. 4, 29. 123 Thuk. 6, 16, 2-3: die Demonstration der Pracht Athens zielt auf ihre (Kriegs-)Gegner: Oƒ G¦R “%LLHNEJ KAˆ ØPÒR DÚNAμIN μE…ZW ¹μîN T¾N PÒLIN ™NÒμISAN Tù ™μù DIAPREPE‹ TÁJ '/LUμP…AZE QEWR…AJ, PRÒTERON ™LP…ZONTEJ AÙT¾N KATAPEPOLEμÁSQAI ... KAˆ OÙK ¥CRHSTOJ ¼D' ¹ ¥NOIA, ÖJ ¨N TO‹J „D…OIJ TšLESI μ¾ ˜AUTÕN μÒNON ¢LL¦ KAˆ T¾N PÒLIN çFELÍ. »Denn die Hellenen hielten Athen, über all seine Macht hinaus, für noch größer wegen meines glanzvollen Auftretens als Festbote in Olympia, nachdem sie eine armgekämpfte Stadt erwartet hatten ... So ist diese Torheit nicht überflüssig, wenn einer auf eigne Kosten nicht bloß sich selbst, sondern auch der Stadt Vorteil schafft.« Vgl. zu dem Argumentationsmuster Isokr. 16, 34; Lys. 19, 63.
106
Der Agon als Wettkampf um Ehre
keinerlei Abbruch tat. Prinzipiell konnte jeder hellenische Bürger an den Agonen teilnehmen, so dass der Eindruck der Gleichheit aller Teilnehmenden hier der beherrschende war. Diese Gleichheit konnte umso besser wirken, weil es viele der in den Poleis dominierenden Männer ja vorgezogen hatten, in den hippischen Disziplinen zu reüssieren. Das machte es den übrigen Athleten leichter, sozial hierarchisch wirkende Faktoren wie die Ehre einer Person auszublenden und unter den gegebenen egalitären Bedingungen zu wetteifern.124 Die Exklusivität der Pferde- und Wagenrennen verhinderte so, dass die sozialen Strukturen der athenischen Gesellschaft personell ungebrochen in die olympischen Agone hineingetragen wurden.125 Auf den agonalen Feldern der Ehre teilten sich die Männer auf zwei verschiedene soziale Räume der kompetitiven Athletik auf, innerhalb derer sie als Gleiche unter Gleichen kämpfen konnten. Ein äußeres Merkmal der Gleichheit der Athleten war ihre Nacktheit. Die Einführung dieses Brauches ist wegen der widersprüchlichen Überlieferung der Quellen zeitlich schwierig zu bestimmen, wird aber von den meisten Forschenden in die archaische Zeit datiert.126 Zwischen der Nacktheit der Athleten und der Einrichtung des Gymnasions besteht – nicht nur etymologisch – ein enger Zusammenhang, der den militärischen Aspekt der Leibesübungen in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Welche hauptsächliche Funktion die Gymnasien erfüllen sollten, ist umstritten. Aufgrund ihrer Entstehungszeit in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts könnten sie ein Trainingsplatz für die in der Phalanx kämpfenden Hopliten gewesen sein, andererseits verweist die räumliche Institutionalisierung der athletischen Ausbildung auf den Einfluss der Oberschicht, die sich an den Erfordernissen des traditionellen Zweikampfes messen lassen wollte.127 In diesem Zusammenhang ist das Gymnasion vor allem als ein sozialer Raum von Bedeutung, in dem sich die Athener nackt zeigten, was sie 124 Vgl. Kyle, Olympiads, 73: »Without modern antielitism, lower class athletes may have had reservations about competing against their social superiors.« 125 Vgl. Golden, Sport, 175: »the Athenian demos was normally content to rein in its wealthy citizens and harness their resources for its own purposes, not to supplant them in their chosen pursuits, whether in athletic and equestrian competition or in political leadership.« 126 Vgl. J.A. Arieti, Nudity in Greek Athletics, in: ClW 68 (1975), 431-436, 431f.; Golden, Sport, 65f. 127 Vgl. die widersprüchlichen Thesen von Evjen, Athletics, 55: »These changes by the mid7th century B.C. in military tactics necessitated a well-conditioned citizen-body and possibly compelled the development of the public gymnasia«, und C. Mann, Krieg, Sport und Adelskultur. Zur Entstehung des griechischen Gymnasions, in: Klio 80, 1 (1998), 7-21, 20: »Die Veränderung des individuellen Handlungsrahmens durch die Herausbildung von Staatlichkeit führte zu einer Aufwertung des Sports als eines Forums für den adligen Wettbewerb, was sich ... in der Einrichtung von Gymnasien niederschlug.« Golden, Sport, 27, fasst zusammen: »All in all, the evidence supports the hypothesis that any link between the advent of the gymnasium, the expansion of athletic competition and warfare must be made through the elite.«
Athenische Ehrenmänner in Olympia
107
außerdem nur als Athleten bei den Agonen taten. Die Ungewöhnlichkeit des Aufzugs spricht gegen rein pragmatische Erwägungen der Hinderlichkeit von Kleidungsstücken und weckte schon in der Antike spottendes Interesse. Tatsächlich erscheinen diese mit der Athletik gegebenen Gelegenheiten als die einzigen, bei denen die gesellschaftlichen Normen den Verzicht auf verhüllende Kleidung nicht tabuisierten. Noch Sokrates spricht von den unbekleideten Männern in den Gymnasien als etwas zunächst Anstößigem in der athenischen Gesellschaft. Den damaligen Spöttern dieses Brauches ruft er in Erinnerung, ÓTI OÙ POLÝJ CRÒNOJ ™X Oá TO‹J “%LLHSIN ™DÒKEI A„SCR¦ EÍNAI KAˆ GELO‹A, ¤PER NàN TO‹J POLLO‹J TîN BARB£RWN, GUμNOÝJ ¥NDRAJ ÐR©SQAI, KAˆ ÓTE ½RCONTO TîI GUμNAS…WN ... !LL' ™PEID», OÍμAI, CRWμšNOIJ ¥μEINON TÕ ¢PODÚESQAI TOà SUGKALÚPTEIN P£NTA T¦ TOIAàTA ™F£NH, KAˆ TÕ ™N TO‹J ÑFQALμO‹J D¾ GELO‹ON ™XERRÚH ØPÕ TOà ™N TO‹J LÒGOIJ μHNUQšNTOJ ¢R…STOU.128 Erst längere Gewohnheit und Erfahrung haben die Griechen von diesem Brauch, der wenig kompatibel mit den gesellschaftlichen Normen und daher lächerlich erscheint, überzeugt. Sokrates führt nicht aus, welche Vorzüge das unbekleidete Training gegenüber dem bekleideten hat. Ebenso wenig wie Thukydides, der bei seiner kurzen Behandlung der Thematik bereits alle späterhin kontrovers diskutierten Aspekte anschneidet, indem er die Einführung des Brauches zu ermitteln sucht, ihn als erklärungswürdig darstellt und ihn zugleich in seine Theorie der Zivilisierung der Hellenen einbaut: ™GUμNèQHS£N TE PRîTOI KAˆ ™J TÕ FANERÕN ¢PODÚNTEJ L…PA μET¦ TOà GUμN£ZESQAI ºLE…YANTO: TÕ DÒ P£LAI KAˆ ™N Tù '/LUμPIKù ¢GîNI DIAZèμATA œCONTEJ PERˆ T¦ A„DO‹A Oƒ ¢QLHTAˆ ºGWN…ZONTO, KAˆ OÙ POLL¦ œTH ™PEID¾ PšPAUTAI. œTI DÒ KAˆ ™N TO‹J BARB£ROIJ œSTIN OŒJ NàN, KAˆ μ£LISTA TO‹J '!SIANO‹J, PUGμÁJ KAˆ P£LHJ «QLA T…QETAI, KAˆ DIEZWμšNOI TOàTO DRîSIN. POLL¦ D' ¨N KAˆ ¥LLA TIJ ¢PODE…XEIE TÕ PALAIÕN `%LLHNIKÕN ÐμOIÒTROPA Tù NàN BARBARIKù DIAITèμENON.129 Die thukydideischen Fragen sind bis heute offen und auch die Verwunderung über die Durchsetzung dieser Sitte bei den Hellenen hält an. In 128 Platon pol. 452 c-d: »dass es noch nicht lange her ist, als auch den Hellenen schimpflich und lächerlich schien, wie auch jetzt noch den meisten unter den Barbaren, dass sich Männer nackt sehen lassen ... Seitdem es sich aber, denke ich, durch die Erfahrung als besser bewährt hat, sich zu entkleiden als alles dieses zu verhüllen: so ist auch das für den Anblick Lächerliche verschwunden vor dem durch Gründe angezeigten Besseren.« 129 Thuk. 1, 6, 5-6: »Sie [die Spartaner, C.B.] waren auch die ersten, sich öffentlich nackt auszuziehn und beim Turnen sich mit Öl einzureiben. Ursprünglich kämpften nämlich sogar in Olympia die Wettkämpfer mit Gürteln um die Scham, es ist noch nicht viele Jahre her, seit das abkam, und noch heute gibt es bei den Barbaren manchenorts, besonders in Asien, Faust- und Ringkämpfe, und sie tun das gegürtet. So ließe sich noch an vielen andern Beispielen zeigen, wie das alte Hellenentum nach gleicher Sitte lebte wie die heutigen Barbaren.«
108
Der Agon als Wettkampf um Ehre
moderneren Forschungsansätzen wurden bei der Suche nach dem Sinn dieser griechischen Besonderheit die Bräuche anderer Kulturen verglichen und man konzentrierte sich auf die Wirkung des nackten menschlichen Körpers auf seine Umgebung, für die sein Anblick nicht die Norm darstellt. Die Hypothesen gehen einerseits von dem abschreckenden, apotropäischen Eindruck des entblößten männlichen Körpers aus,130 andererseits von seiner erotischen Anziehung, die die Gelegenheit zur Demonstration der Selbstbeherrschung gibt.131 Die athletische Nacktheit der Griechen wurde offenbar schon von Zeitgenossen wie Thukydides als etwas nicht Alltägliches erkannt, das nur nach Gewöhnung und in genau definierten sozialen Räumen existieren konnte, ohne gegen die gesellschaftlichen Normen zu verstoßen. Die besondere Stellung des Phänomens verweist auf die allgemeinere Frage nach seiner Bedeutung für den Zivilisationsprozess, dessen Verlauf sich unter anderem an den Kategorien ablesen lässt, innerhalb derer in einer Kultur über Nackheit und Scham verhandelt wird.132 Weil der griechischen Kultur jedoch immer ein linearer, vorbildlicher Weg in die Zivilisation unterstellt wird, gerät die jeweilige Erklärung eines speziellen Bereiches innerhalb dieser Kultur entweder zu einem weiteren Beleg für die übergreifende These oder aber zu einem Ausnahmefall, der die Regel bestätigt.133 Am gewinnbringendsten für eine Einordnung der nackten Athleten in den allgemeineren gesellschaftlichen Kontext erscheint deshalb die Entkopplung von zivilisationstheoretischen Vorannahmen und die Würdigung des Phänomens als ein spezifisch griechisches, das sich nur im Zusammenhang mit anderen spezifisch griechischen Entwicklungen erklären lässt.134 Die kulturellen Bindungen dieses Brauches lassen sich am zuverlässigsten 130 Vgl. J. Mouratidis, The Origin of Nudity in Greek Athletics, in: Journal of Sport History 12, 3 (1985), 213-232, 221: »The Greek warrior-athletes of these periods used their nudity to either inspire fear or horrify their adversaries. Apparently the Greeks believed that the naked body of the warrior-athlete was an object upon which the adversary looked with fear and panic.« Golden, Sport, 68, wendet dagegen zu Recht ein: »It is a nuisance for this view that the apotropaic penis is usually erect and athletes’, in so far as they were special at all, were infibulated, the foreskin drawn back against the body by a thong.« 131 Arieti, Nudity, 435f: »That the mind ought to control the body was a pervasive Greek ideal ... If the athlete went naked at the Olympic games, his intellectual sophrosynê would be as much subject to public scrutiny as his athletic aretê. ... The public nakedness ... enabled the athletes to show the complete control they exerted over their bodies.« 132 L. Thommen, Nacktheit und Zivilisationsprozess in Griechenland, in: Historische Anthropologie 4 (1996), 438-450, 441. 133 Mouratidis, Origin, 231, glaubt an eine Beibehaltung primitiver Verhaltensmuster: »The Greeks while winning their way to classical civilization retained the custom of nudity in athletics but they were not conscious of the aggressive aspect of it as were their remote ancestors.« 134 Vgl. Thommen, Nacktheit, 448f.; N.B. Crowther, Athletic Dress and Nudity in Greek Athletics, in: Eranos 80 (1982), 163-168, hält die athletische Nacktheit für eine ideologische Abgrenzung von den Barbaren, die nach den Perserkriegen aufgekommen ist, 167.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
109
aus den bildenden Werken der damaligen Zeit erschließen, die gegenüber den Textquellen den Vorzug haben, keine reflexiv gebrochene Erklärungen zu bieten, sondern in einer bestimmten Tradition der Veranschaulichung von Vorstellungen und Werten zu stehen. Eine dieser langen Bildtraditionen ist der in Griechenland sehr verbreitete Heroenkult, besonders die Imitation des häufig nackt dargestellten mythischen Begründers der olympischen Agone, Herakles.135 In der bildenden Kunst und auf Vasendarstellungen erscheint der nackte männliche Körper als ein Zeichen für Männlichkeit, Mut, Selbstbeherrschung und Schönheit.136 Das Gymnasion fungiert dabei als ein sozialer Raum, in dem die Knabenliebe ihre Heimstatt hat, und der nach außen hin gegenüber Nichtbürgern relativ abgeschlossen ist. Dieser strikte Ausnahmecharakter der Nacktheit bringt die situativ gebundene Freizügigkeit der Athener in die Nähe eines Initiationsritus.137 Die Nacktheit der griechischen Athleten scheint ein primär kulturhistorisch sich erschließendes Phänomen zu sein. Nichtsdestoweniger hat es aber einen konkreten sozialen Impetus, der nicht unterschätzt werden sollte. Als entscheidender sozialer Aspekt, der mittelbar seine Wirkung auf die Gesellschaft gezeitigt haben wird, ist der visuelle Eindruck der Gleichheit aller Bürger zu nennen. Obwohl sich die Statusdemonstration einer Person auch bei der Bekleidung durch einen Lendenschurz kaum besonders imponierend gestalten ließ, hat die Nacktheit doch noch eine völlig andere Dimension. Sie machte eine Behandlung der Athleten aufgrund sozialer Kriterien schwierig und die erwünschte Konzentration der Teilnehmer und Zuschauer auf den eigentlichen Wettkampf augenfällig: die Athleten unterschieden sich nicht mehr nach äußeren Merkmalen, sondern allein aufgrund ihres Erfolgs im Agon. Auch aus diesem Grunde waren die statusbewussten Aristokraten gut beraten, wohl bekleidet ihren Pferden zuzusehen. Bei den gymnischen Agonen vermittelte einerseits die Nacktheit aller Teilnehmer das Gefühl der Gleichheit aller Wettstreitenden, andererseits unterstützten die für alle geltenden Regeln des Wettkampfes diese Vorstellung. Unabhängig von seiner Person wurde die Leistung des einzelnen Athleten beurteilt, die sich an objektiven Kriterien wie Zeit, relativer Schnelligkeit und Anzahl der Gegner maß.138 135 Vgl. Mouratidis, Origin, 229f. 136 D. Steiner, Moving Images. Fifth-Century Victory Monuments and the Athlete’s Allure, in: ClA 17 (1998), 123-153, 132: »by the middle of the fifth century artists no longer attempted realistic representations of their subjects and instead portrayed figures that matched contemporary notions of the Body Beautiful.« Vgl. L. Bonfante, The naked Greek. How ancient art and literature reflect the costum of civic nudity, in: Archaeology 43 (1990), 28-35. 137 Thommen, Nacktheit, 445: »Nacktheit bedeutet in dieser Hinsicht Abstraktion von der Norm des bürgerlichen Alltags. Beim Athleten unterstrich sie die rituelle Enthaltsamkeit und Beherrschung des Körpers.« Vgl. Golden, Sport, 68. 138 Vgl. Miller, Democracy, 279; Mann, Krieg, 19.
110
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Die Vorstellung der Gleichheit aller Teilnehmer an einem Wettkampf entspricht der Norm der Ehre. Für jede ehrenhafte Auseinandersetzung gilt, nur die Herausforderungen von Statusgleichen anzunehmen und konsequent nur einen Sieg über einen Statusgleichen als ehrenhaft zu betrachten. Dementsprechend kann die Austragung der olympischen Agone als institutionalisierte Form des ehrenhaften Wetteiferns betrachtet werden. Die bei den Agonen sichtbare Gleichheit der Wettstreiter ist Teil des Vorstellungshorizonts eines Ehrenmannes. Außerdem trägt sie dazu bei, die Möglichkeit einer unter bestimmten Bedingungen und in gewisser Hinsicht gleichen Gemeinschaft von Bürgern als realistisch zu betrachten – mögen die Teilnehmer auch in Herkunft und Status noch so unterschiedlich sein. Die Übernahme der alten aristokratischen Werte durch eine neue Schicht von Bürgern und die inhaltliche Modifizierung entsprechend ihres eigenen Vorteils erfolgt auch in Olympia.139 Die Übertragung der agonalen Gleichheit Olympias auf eine politische Ebene in Athen, wo das Schlagwort der Isonomia im Umlauf ist, liegt nahe.140 So kann der ehemals exklusive Begriff der statusgleichen Ehrenmänner von der Gruppe der Bürger okkupiert werden, die – zumindest in Athen – ihre Ehre darein setzen, untereinander gleich zu sein. Zu der Vorstellung gleich zu sein, gehörte für die Ehrenmänner wie für die Polisbürger immer auch die Gewissheit, gleicher zu sein als andere. Als Ein- und Ausschlusskriterien fungierten dabei die Ehre ebenso wie die Polis: Während sich die athenischen Ehrenmänner gegenüber jenen abgrenzten, die über weniger Ehre verfügten als sie selbst, schlossen die athenischen Polisbürger alle anderen Gruppen der Bevölkerung Athens aus. Die Exklusivität des aristokratischen Status verlor zwar an Bedeutung, es blieben aber weiterhin die meisten Mitglieder der Bevölkerung davon ausgeschlossen. Bewusst setzten sich die athenischen Bürger von ihren Frauen ab, die wie sie zur privilegierten Gruppe der Bürgerschaft gehörten, dies allerdings in nur passiver, latenter Teilhabe. Bei der Auffassung des eigenen Handlungsradius beider Geschlechter spielte die Ehre als Verhaltensnorm eine entscheidende Rolle: Sie legte die Rollen von Männern und Frauen relativ schematisch fest. Die Erwartungen an die Repräsentanten beider Geschlechter waren unmissverständlich. Auch in Olympia spiegelten sich diese Verhältnisse in den Räumen, die Männer für sich beanspruchten, und jenen, die Frauen zugewiesen wurden. 139 Vgl. Pleket, Games, 71f. 140 Vgl. Miller, Democracy, 283: »The real point, however, is that the gymnic events were isonomic and isegoric, and that all classes could and did compete together on an equal footing, and floggings from the judges were based on fouls, not wealth or the lack of it. ... The gymnic competitions can therefore be understood as leveling agent that could easily have contributed to the development of democracy.«
Athenische Ehrenmänner in Olympia
111
Grundsätzlich war es den Frauen verboten, sich bei den Agonen blicken zu lassen, sie sollten weder als Teilnehmerinnen noch als Zuschauerinnen in Erscheinung treten. Pausanias vermittelt die einschlägige Information über die gesetzlichen Regelungen für Frauen bei den olympischen Agonen: +AT¦ DÒ T¾N ™J '/LUμP…AN ÐDÒN, PRˆN À DIABÁNAI TÕN '!LFEIÒN, œSTIN ÔROJ ™K 3KILLOàNTOJ ™RCOμšNWI PšTRAIJ ØYHLA‹J ¢PÒTOμON: ÑNOμ£ZETAI DÒ 4UPA‹ON TÕ ÔROJ. KAT¦ TOÚTOU T¦J GUNA‹KAJ '(LE…OIJ ™STˆN çQE‹N NÒμOJ, ÀN FWRAQîSIN ™J TÕN ¢GîNA ™LQOàSAI TÕN '/LUμPIKÕN À KAˆ ÓLWJ ™N TA‹J ¢PEIRHμšNAIJ SF…SIN ¹μšRAIJ DIAB©SAI TÕN '!LFEIÒN.141 Von diesem strikten und klaren Ausschluss gibt es allerdings wichtige Ausnahmen, wie Pausanias später berichtet, als er das Stadion beschreibt: ™Pˆ TOÚTOU KAQEZOμšNH TOà BWμOà QE©TAI GUN¾ T¦ '/LÚμPIA, ƒšREIA $»μHTROJ #AμÚNHJ, TIμ¾N TAÚTHN ¥LLOTE ¥LLH LAμB£NOUSA PAR¦ '(LE…WN. PARQšNOUJ DÒ OÙK E‡RGOUSI QE©SQAI.142 Das grundsätzliche Verbot der Anwesenheit von Frauen an bestimmten Tagen, an denen die eigentlichen Agone stattgefunden haben werden, und die Ausnahmeerscheinung der jeweiligen Demeterpriesterin als einziger Zuschauerin stehen im Einklang mit dem überlieferten Verlauf des olympischen Festes und dem Verhältnis der Frauen zur Athletik der Männer.143 Nicht in dieses Bild passt die letzte knappe Bemerkung des Pausanias, nach der die PARQšNOI nicht am Zusehen gehindert wurden. Die Vorstellung, die nackten griechischen Athleten hätten unter den Augen unverheirateter Frauen ihre Wettläufe abgehalten, ist in der der Forschung auf massive Erklärungsschwierigkeiten gestoßen. Wegen der offensichtlichen Unbefangenheit der Griechen im Umgang mit ihrer Nacktheit bei den athletischen Übungen wird das theoretisch nicht für abwegig gehalten, wegen der fast zwangsläufigen erotischen Aufladung der Agone aber wiederum für kaum denkbar.144
141 Paus. 5, 6, 7: »Am Weg nach Olympia von Skillous her befindet sich, bevor man den Alpheios überschreitet, ein Berg mit hohen schroffen Felsen, den man Typaion nennt. Die Eleer haben ein Gesetz, von diesem Berg die Frauen hinabzustoßen, wenn sie dabei ertappt worden sind, dass sie zu dem olympischen Fest gekommen sind oder auch nur an den für sie verbotenen Tagen den Alpheios überschritten haben.« 142 Paus. 6, 20, 9: »Den Hellanodiken gegenüber befindet sich ein Altar aus Marmor. Auf diesem Altar sitzend schaut eine Frau den Olympien zu, die Priesterin der Demeter Chamyne, wobei jeweils eine andere diese Ehre von den Eleern erhält. Jungfrauen schließen sie aber vom Zuschauen nicht aus.« 143 Das agonale Pendant zur männlichen Veranstaltung sind die auschließlich von Frauen abgehaltenen Heraia, Paus. 5, 16, 2-3. 144 Vgl. Burckhardt, Mensch, 106f: »Der Grund [für das Fernhalten von Frauen, C.B.] war ohne Zweifel die Besorgnis vor schrankenlosem weiblichen Beifall aus nicht gymnastischen, sondern anderm Motiv, nach nicht gymnastischen Qualitäten.« Vgl. W. Decker, Frauen und
112
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Will man Pausanias Glauben schenken, so sollte man den Aspekt der zivilisatorisch gebotenen Verhüllung vor dem anderen Geschlecht als den vermeintlich wichtigsten Erklärungsfaktor in den Hintergrund treten lassen. Denn er rechtfertigt nicht die Unterscheidung, die zwischen den unverheirateten Frauen (PARQšNOI) und den verheirateten (GUNA‹KEJ) gemacht wird. Vielmehr deutet gerade diese Einteilung der Frauen in verschiedene statusbezogene Kategorien auf eine allgemeine soziale Unterscheidung hin, die für die Erhellung des Phänomens relevant ist. Gerade der Wechsel der unverheirateten Frau in den Status der verheirateten Frau hat eine große transitorische Bedeutung, die von verschiedenen sozial und kulturell wichtigen Faktoren bestimmt wird.145 Die primäre gesellschaftliche Erwartung an eine Frau, die mit einem athenischen Bürger verheiratet ist, besteht darin, dass sie legitime Kinder gebiert und so die Aufrechterhaltung des Oikos, in den sie eingeheiratet hat, gewährleistet. Von der Erfüllung dieser Anforderungen hängt die Überlebensfähigkeit des jeweiligen Oikos und damit auch der Polis ab, deren Fundament die verschiedenen Oikoi bilden. Gerade die relativ einfach gehaltenen Ansprüche, die der dominante Diskurs der Männer an die Frauen stellt, erfordern wegen der komplex erscheinenden weiblichen Begabungen, die wenig geeignet scheinen, sich auf ein solch eingeschränktes Betätigungsfeld festlegen zu lassen, eine rigorose Kontrolle des weiblichen Teils der Bevölkerung. Denn neben ihrer Fruchtbarkeit wird den Frauen generell eine zu vitale Emotionalität und Irrationalität zugeschrieben, die sich leicht mit allen nur denkbaren schwer zu bändigenden Mächten der Natur verbünden.146 Aufgabe der Männer muss es daher sein, den Frauen in ihrem unberechenbaren Verhalten Grenzen zu setzen, um ein geordnetes Zusammenleben überhaupt zu ermöglichen. Dabei erweisen sich die verheirateten Frauen offenbar als gefährlicher, sie werden daher fester in die gesellschaftlichen Normen eingebunden.147 Die so genannten PARQšNOI dagegen sind aufgrund des niedrigen Heiratsalters noch kaum geschlechtsreif, sie unterscheiden sich in ihren sozialen Rollen Männer in Olympia, in: G. Völger (Hg.), Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich, Bd. 2, Köln 1997, 23-30, 24. 145 Vgl. A. Carson, Putting her in her place: Woman, Dirt, and Desire, in: Halperin, Sexuality, 155-169, 162-164; M. Douglas, Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Frankfurt a.M. 1988, 151-153. 146 Vgl. J. Gould, Law, Custom and Myth: Aspects of the social Position of Women in Classical Athens, in: JHS 100 (1980), 38-59, 57: »Women are not part of, do not belong easily in, the male ordered world of the ›civilised‹ community; they have to be accounted for in other terms, and they threaten continually to overturn its stability or subvert its continuity, to break out of the place assigned to them by their partial incorporation within it.« 147 Vgl. Carson, Place, 143: »United by a vital liquidity with the elemental world, woman is able to tap the inexhaustible reservoirs of nature’s procreative power. ... Marriage is the means, in the Greek view, whereby man can control the wild erôs of women and so impose civilized order on the chaos of nature.«
Athenische Ehrenmänner in Olympia
113
noch nicht gravierend von ihren männlichen Altersgenossen. Die PARQšNOI stehen außerhalb der eigentlichen Polisgesellschaft, sie gehören der spielerischen und kultischen Sphäre an.148 Diese Kategorisierung könnte eine Erklärung für die Tolerierung ihrer Anwesenheit sein. In Olympia zeigen sich die Männer in ihrer ganzen männlichen Pracht, zu der wesentlich ein ehrenhafter Habitus gehört. Die panhellenischen Agone, besonders der olympische, sind sozial und kultisch von erheblicher Bedeutung für alle Griechen. Sie spiegeln die zivilisatorischen Errungenschaften der Hellenen, die sie von den Barbaren absetzen und bilden den Höhepunkt des institutionalisierten Wettstreites um Ehre. Frauen werden in den peripheren Bereichen der olympischen Veranstaltung zwar einbezogen, bei den eigentlichen Agonen aber müssen weibliche Aspekte und Einflüsse abgewehrt werden, um den klaren und rationalen Ablauf der Wettbewerbe nicht zu gefährden. Mit ihrer komplementären Rollenzuweisung fungieren Frauen identitätsstiftend für die Männer, auch deshalb dürfen sie die ihnen zugedachten sozialen Räume nicht verlassen. Die Grenze, die den Frauen hier gesetzt wird, ist der Fluss Alpheios. Er scheidet die exklusive Kultur der griechischen Männer von bedrohlichen Einflüssen.149 Wenn Frauen sich innerhalb des abgezirkelten olympischen Gebiets befinden, fungieren sie als Negativum zum männlichen Status.150 Sie sind bei den kultischen Prozessionen und Festlichkeiten präsent und halten mit den Heraia ihre eigenen Agone ab.151 Neben der Verehrung des Zeus werden so die Ansprüche der Hera berücksichtigt, eventuell sogar jene einer viel älteren, an diesem Ort verehrten Muttergottheit. Der in Olympia praktizierte Kult für die weiblichen Gottheiten und die Athletik der Mädchen legen nahe, dass die von Pausanias erwähnten PARQšNOI als ein Bestandteil der ausschließlich männlichen Agone toleriert wurden, weil sie den komplementären weiblichen Part darstellten. In dieser Funktion eigneten sich die jungen Mädchen, die außerdem kaum sehr zahlreich zugegen gewesen sein
148 H.S. Versnel, The Festival for Bona Dea and the Thesmophoria, in: I. McAuslan und P. Walcot (Hg.), Women in Antiquity, Oxford 1996, 182-204, 200: »Additionally, the only phase of life in which the female can be equated with the male – at least in some respects – is the period in which she is still a parthenos.« 149 Ebd., 135: »Civilization is a function of boundaries. In such a society, individuals who are regarded as especially lacking in control of their own boundaries, or as possessing special talents and opportunities for confounding the boundaries of others, evoke fear and controlling action from the rest of society.« Gould, Law, 58, bezeichnet Frauen als »›boundary-crossers‹, anomalous beings who belong and do not belong, are ›within‹ and ›without‹«. Vgl. Golden, Sport, 176f. 150 Vgl. des Bouvrie, Gender, 66: »It seems, then, that a number of myths, images, and arrangements at Olympia were part of an unconscious symbolic process, creating a common basis for Greek social life and a Greek ›nature‹ specified for females and males.« 151 Vgl. zu den Heraia und allgemein zur Rolle der Frauen in Olympia, Kap. IV.
114
Der Agon als Wettkampf um Ehre
werden, um die geschlechtliche Identität der Männer zu bestätigen und sie gleichzeitig nicht zu bedrohen. Für diese Interpretation sprechen auch die Taten der Frauen, von deren Erscheinen in Olympia als etwas Aufsehenerregendem berichtet wird. In klassischer Zeit gab es zwei Frauen, die durch das Eindringen in eine Männerdomäne von sich Reden machten, und zwar sowohl als Zuschauerin als auch als Teilnehmerin an den Agonen. Pherenike aus Rhodos und Kyniska aus Sparta gelang es, den Ausschluss von Frauen von den olympischen Agonen zu unterlaufen: Im Jahre 404 verkleidete sich Pherenike als Trainer ihres Sohnes, der ihn zu den Agonen begleitete, und sie durfte, auch nachdem die Täuschung aufgeflogen war, als Zuschauerin bleiben. Kyniska gelang es als Tochter des Spartanerkönigs Archidamos I. sogar, sich direkt an den Agonen zu beteiligen, indem sie ein Wagengespann laufen ließ, das in den Jahren 396 und 392 den Sieg errang.152 Beide Frauen verweigerten sich der erwarteten Komplementarität der Geschlechter in Olympia am deutlichsten und bestätigten damit zugleich die Validität des höchsten männlichen Gutes, der Ehre, die an diesem Ort ihre Heimstatt hat. Die vereinzelt anwesenden Frauen sind nicht nur die Ausnahme, die die Regel der Nichtanwesenheit von Frauen bestätigt, sondern sie grenzen auch die peripheren, festlichen und ornamentalen Züge des olympischen Festes vom eigentlichen Arkanbereich des athletischen Wettstreites ab. Kyniska kann in Olympia nach ihrem Sieg im Wagenrennen bekränzt werden, weil sie die Disziplin gewählt hat, in der es zwar um die Ehre geht, in der diese aber nicht primär aufgrund von unveräußerlichen Eigenschaften eines Mannes wie Mut oder Schnelligkeit gewonnen wird, sondern in einem Wettkampf, bei dem die Schaulust und das Aufsehenerregende des Spektakels im Vordergrund stehen. Das sieht schon Agesilaos so.153 Die Ehre der Männer wird in den athletischen Wettbewerben, die ausschließlich unter Gleichen ausgetragen werden, ernsthaft auf die Probe gestellt. In diesen innersten Bereich des Gutes Ehre ist ein Vordringen der Frauen tatsächlich undenkbar. Entsprechend blieben die Auftritte der Frauen in Olympia ein Balanceakt. Sie wurden geduldet, solange sie das Bild der Männer von ihnen, das sich komplementär zur männlichen Geschlechtsidentität aufbaute, nicht zerstörten. Als Jungfrauen, Priesterin oder in wohl bemessener Distanz zu den eigentlichen ehrenhaften Agonen gelang Frauen die Präsenz bei den olympischen Agonen. Der Mechanismus des Erringens von Ehrungen und des Zuschreibens von Ehre, wie er sich in Olympia beobachten lässt, impliziert eine Verfüg152 Paus. 3, 8, 1. 153 Plut. Agesilaos 20; vgl. Crowther, Reflections, 133; Miller, Democracy, 280.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
115
barkeit über die Ehre, wie sie in Athen selten gegeben ist. Davon profitiert nicht nur Kyniska, sondern auch die männlichen Teilnehmer an den Agonen können eine zielgerichtete Politik der Ehre und Ehrungen betreiben. Einige Athleten instrumentalisieren den Prozess des Erwerbs von Ehre durch den agonalen Sieg. Das für die olympischen Agone aufgestellte Regelwerk, das die einzelnen Schritte der Athleten zu einem agonalen Erfolg begleitet, legt die Möglichkeiten ehrenhaften Verhaltens fest, wie es in der Polis Athen die athenischen Männer durch soziale Kontrolle tun. Im Unterschied zur athenischen Gesellschaft, die den ehrenhaften Habitus durch die Sozialisation des Einzelnen vermittelt, werden die Regeln in Olympia explizit ausgesprochen, sind für jedermann gleich und dulden keine Ausnahmen für Personen, die sich als gleicher betrachten. Wie in jeder ehrenhaften Gesellschaft kann das Spiel um Ehre nur innerhalb der anerkannten Regeln gespielt werden. Trotz relativ schwerer sozialer Sanktionsmöglichkeiten erstarrt das soziale Leben dennoch nicht zu einem Ritual, weil es innerhalb des Begriffes und der Zuschreibung von Ehre einen sehr großen Interpretationsspielraum für bestimmte, situativ gebundene Verhaltensweisen einer Person gibt. Ein gewisses Maß an Täuschung, Vorspiegelung und schönem Schein ist der handlungsleitenden Ehre immer inhärent, weil sie vom Urteil der anderen lebt.154 In Olympia wie im »wirklichen Leben« der Polis Athen machen sich diejenigen den Interpretationsspielraum für ehrenhaftes Verhalten zunutze, die zielgerichtet eine Politik der Ehre verfolgen. Bei einem derart auf die Verteilung von Ehrungen basierendem Spektakel, wie es Olympia darstellt, und einer so interessierten, breit vertretenen Öffentlichkeit reduziert sich die Ehre einer Person leicht auf den öffentlichkeitswirksamen Effekt, den sie in einem gegebenen Moment hat. Wegen der relativen Anonymität der Teilnehmer, die gerade nicht als Sieger im Fokus des Interesses stehen, kann das ehrenhafte Verhalten während der olympischen Agone einen instrumentellen Charakter erhalten, den es in Athen wegen der allseits anwesenden Bekannten niemals haben könnte. Ein Musterbeispiel für den Interpretationsspielraum ehrenhafter Handlungen gibt wieder einmal das Verhalten des Alkibiades, der in jeder Situation seiner Politik der Ehre treu bleibt. Plutarch berichtet von seiner Umdeutung einer agonalen Situation, die ihm zunächst durchaus nicht zur Ehre gereichte, ins Ehrenhafte: ™N μÒN G¦R Tù PALA…EIN PIEZOÚμENOJ ØPÒR TOà μ¾ PESE‹N ¢NAGAGëN PRÕJ TÕ STÒμA T¦ ¤μμATA TOà PIEZOàNTOJ OŒOJ ÃN DIAFAGE‹N T¦J CE‹RAJ. ¢FšNTOJ OâN T¾N LAB¾N ™KE…NOU KAˆ E„PÒNTOJ: ›D£KNEIJ ð '!LKIBI£DH KAQ£PER Aƒ GUNA‹KEJ:‹ ›OÙK
154 Vgl. zur »politics of reputation« Giordano, Ehrvorstellungen, 124-129.
116
Der Agon als Wettkampf um Ehre
œGWGE‹ EÍPEN ›¢LL' æJ Oƒ LšONTEJ.‹155 Alkibiades ist in vieler Hinsicht ein Sonderfall, dessen Ehrgeiz über das Ziel hinausschießt. Sein Handlungsspielraum war erheblich größer als der der meisten seiner Mitbürger. Die besonderen Bedingungen, unter denen in Olympia agonale Ehre gewonnen werden konnte, ermöglichte jedoch auch anderen Athleten einen Umgang mit ihren Ehrungen, der in ihren Poleis undenkbar gewesen wäre. Die Ehrung der Bekränzung des Siegers bedeutet eine Steigerung der Ehre des jeweiligen Athleten. Die Zuschreibung von überragender Ehre durch einen einmaligen, momentanen Sieg erscheint als etwas grundsätzlich anderes als die alltäglich erforderliche Bewährung eines ehrenhaften Atheners auf der Agora. Der olympische Sieg verkürzt die Kriterien für einen Ehrenmann auf den kurzfristigen Moment des agonalen Erfolges. Die überlieferten Fälle von Athleten, die Regeln übertraten oder zu umgehen versuchten, spiegeln die verschiedenen Arten, wie unter den olympischen Bedingungen eine Politik der Ehre betrieben werden konnte. Die Muster des von den Vorschriften der Hellanodiken abweichenden Verhaltens unterscheiden sich dabei qualitativ erheblich. Schon bei der Organisation der Agone versuchte man, die Teilnehmer in einen möglichst festen Rahmen der rein athletischen Vorbereitung einzubinden.156 Als bestimmendes Gremium mit der Autorität der ausrichtenden Polis fungierten die Hellanodiken. Sie überwachten die Zulassung der Athleten zu den Agonen, indem sie diese auf ihre griechische Abstammung, ihren Bürgerstatus und ihr Freisein von Blutschuld prüften.157 Für die Athleten gehörte zu den Teilnahmebedingungen außerdem die Absolvierung einer zehnmonatigen Trainingsperiode, eine dreißigtägige athletische Vorbereitungsphase in Olympia unmittelbar vor den Agonen und die Ablegung eines Eides vor Zeus Horkios, μHDÒN ™J TÕN '/LUμP…WN ¢GîNA œSESQAI PAR' AÙTîN KAKOÚRGHμA.158 Bei Zuwiderhandlungen konnten die Hellanodiken Strafen verhängen, die von einem Strafgeld über die körperliche Züchtigung bis zum Ausschluss von den Agonen reichten.159 Solchermaßen instruiert und vereidigt, sahen sich die Athleten einer Reihe von Regeln gegenüber, die 155 Plut. Alkibiades 2: »Als er einmal beim Ringen stark gepresst wurde, zog er, um nicht zu Fall zu kommen, die ihn umschlingenden Arme des Gegners an seinen Mund und war drauf und dran, seine Hände durchzubeißen. Als der darauf den Griff lockerte und sagte: ›Du beißt ja, Alkibiades, wie die Weiber!‹, erwiderte er: ›Nein, sondern wie die Löwen.‹« (Übersetzung von K. Ziegler). 156 Vgl. Sinn, Olympia, 58. 157 Vgl. Decker, Sport, 120-126; Krause, Olympia, 124-133. 158 Paus. 5, 24, 9: »dass sie sich keinen Verstoß gegen die olympischen Wettkämpfe zuschulden kommen lassen werden.« 159 Vgl. I. Weiler, Korruption in der olympischen Agonistik und die diplomatische Mission des Hypereides in Elis, in: A. Rizakes (Hg.), Achaia und Elis in der Antike, Athen 1991, 87-92, 89.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
117
sich auf den formalen Ablauf der Agone, die rechte Austragung einzelner Disziplinen und die allgemeinen Normen des gemeinsamen Wetteiferns bezogen. Es sind nicht viele Regelverstöße bekannt.160 Die schriftlichen Quellen werden in dieser Frage beweiskräftig unterstützt durch die in Restbeständen in situ gefundenen Zeusstatuen, die den Weg zum Stadion säumten. Welche Bewandtnis es damit hat, weiß Pausanias: PRÕJ DÒ TÁI KRHP‹DI ¢G£LμATA $IÕJ ¢N£KEITAI CALK©. TAàTA ™POI»QH μÒN ¢PÕ CRHμ£TWN ™PIBLHQE…SHJ ¢QLHTA‹J ZHμ…AJ ØBR…SASIN ™J TÕN ¢GîNA, KALOàNTAI DÒ ØPÕ TîN ™PICWR…WN :©NEJ.161 Die Inschriften auf den Statuen machten die Vergehen der Athleten, die ihre Anfertigung bezahlen mussten, publik, und warnten alle, die auf ihrem Weg zum Stadion die Statuen passierten, vor ähnlichem Tun. In den von Pausanias aufgeführten Fällen frevelnder Athleten in klassischer Zeit geht es um Korruption: Der Thessaler Eupolos hat 388 seine Gegner im Faustkampf mit Geld bestochen, ihm den Sieg zu überlassen, und der Athener Kallippos folgte 332 seinem Beispiel, indem er seine gegnerischen Pentathleten kaufte.162 Die normativ gehaltenen Epigramme machen deutlich, dass sich diese Betrugsmanöver gegen die elementaren Grundsätze der Agone richten, weil sie den agonalen Kampf um Ehre zu unterminieren trachten. Die in Olympia zu erlangenden Ehren sollten auf den ehrenhaften agonalen Verhaltensmustern sowie auf bestimmten männlichen Eigenschaften wie Körperkraft, Schnelligkeit und Tüchtigkeit (¢RET») basieren: ™QšLEI DÒ TÕ μÒN PRîTON TîN ™LEGE…WN DHLOàN æJ OÙ CR»μASIN ¢LL¦ çKÚTHTI TîN PODîN KAˆ ØPÕ „SCÚOJ SèμATOJ '/LUμPIK¾N œSTIN EØRšSQAI N…KHN.163 Der Einsatz von Geld in diesem Kampf um die höchsten Ehren bedeutet ein dem Agon wesensfernes Element, es kann als Voraussetzung oder Siegespreis fungieren, nicht aber als Mittel zur Auswahl des Ehrenhaftesten.
160 Vgl. C.A. Forbes, Crime and Punishment in Greek Athletics, in: CJ 47 (1951), 169-173, 169. 161 Paus. 5, 21, 2: »Vor dieser Stützmauer stehen bronzene Zeusstatuen. Diese wurden gemacht aus den Strafgeldern, die Athleten auferlegt wurden, die sich gegen den Wettkampf vergangen hatten, bei den Einheimischen heißen sie Zanes.« 162 Ebd., 2-6. 163 Paus. 5, 21, 4: »Das erste Epigramm will besagen, dass man einen Sieg in Olympia nicht mit Geld, sondern mit Schnelligkeit der Füße und Körperkraft erringen soll.« Weitere Epigramme besagen, ™Pˆ DÒ TîI ØPOLO…PWI DIDASKAL…AN P©SIN “%LLHSIN EÍNAI T¦ ¢G£LμATA μHDšNA ™Pˆ '/LUμPIKÁI N…KHI DIDÒNAI CR»μATA, vgl. ebd.: »dass sie eine Lehre für alle Griechen seien, dass niemand für einen olympischen Sieg Geld geben solle.« Ferner, TÕN '/LUμP…ASIN ¢GîNA ¢RETÁJ EÍNAI KAˆ OÙ CRHμ£TWN,ebd., 7: »dass es beim Wettkampf in Olympia um Tüchtigkeit und nicht um Geld gehe.«
118
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Offenbar hielten sich die meisten Athleten an ihren Eid und schätzten die Herausforderungen, die die agonalen Kämpfe um die Ehre an sie stellten.164 Formelle Verstöße gegen das Protokoll des zeremoniellen Ablaufs oder gegen die orthodoxe Ausführung einzelner Disziplinen werden am häufigsten notiert.165 Eine interessante Kategorie der Missachtung von Normen verkörpern jene Olympioniken, die die Ehre ihres olympischen Sieges auf andere Personen oder fremde Poleis übertrugen. Zwar gibt es keine Hinweise auf ein ausdrückliches Verbot dieser Praxis, sie verstieß aber zweifellos gegen die normativen Verhaltenserwartungen an einen Ehrenmann und wurden als solche gern verschwiegen bzw. nicht wahrgenommen.166 Aus klassischer Zeit sind zwei Athleten bekannt, die ihren olympischen Sieg auf eine fremde Polis übertrugen, indem sie sich als deren Bürger ausgaben. Astylos aus Kroton siegte im Jahre 488 im Stadionlauf und im Diaulos. Seinen dritten und vierten olympischen Sieg errang er als Astylos von Syrakus in der darauf folgenden 74. Olympiade, bevor er seine Karriere 480 mit drei Siegen in den Disziplinen Stadion, Diaulos und Waffenlauf beendete.167 Seine zahlreichen Bekränzungen hält Pausanias für weniger erzählenswert, als vielmehr den Wechsel seiner Heimatpolis: '!STÚLOJ DÒ +ROTWNI£THJ 0UQAGÒROU μšN ™STIN œRGON, TRE‹J DÒ ™FEXÁJ '/LUμP…ASI STAD…OU TE KAˆ DIAÚLOU N…KAJ œSCEN. ÓTI DÒ ™N DÚO TA‹J ØSTšRAIJ ™J C£RIN T¾N `)šRWNOJ TOà $EINOμšNOUJ ¢NHGÒREUSEN ˜AUTÕN 3URAKOÚSION, TOÚTWN ›NEKA Oƒ +ROTWNI©TAI T¾N O„K…AN AÙTOà DESμWT»RION EÍNAI KATšGNWSAN KAˆ T¾N E„KÒNA KAQE‹LON PAR¦ TÁI “(RAI TÁI ,AKIN…AI KEIμšNHN.168 Obwohl sich Pausanias hin-
164 Paus. 6, 2, 6, berichtet von der Zurückweisung eines Bestechungsversuchs durch einen Milesier; Plut. Lycurg 22, durch einen spartanischen Athleten. 165 Die Strafgewalt der Hellanodiken forderten jene Athleten heraus, die zu früh starteten, Hdt. VIII 59; oder mit faulen Ausreden zu spät kamen, wie der Ägypter Apollonio Rhantes, der angeblich »bei den Kykladen durch widrige Winde festgehalten worden« sei (æJ ™N TA‹J +UKL£SI N»SOIJ ØPÕ ¢NšμWN KATE…CETO ™NANT…WN), Paus. 5, 21, 12-14. Verletzungen der Kampfesregeln konnten den Tod eines Faustkämpfers zur Folge haben und für seinen Gegner die Aberkennung des Sieges, Paus. 6, 9, 6-9. 166 Vgl. Philostr. 45: STšFANON D' '!PÒLLWNOJ À 0OSEIDîNOJ, ØPÒR Oá KAˆ AÙTO… GE Oƒ QEOˆ μšGA ½QLHSAN, ¥DEIA μÒN ¢POD…DOSQAI, ¥DEIA DÒ çNE‹SQAI, PL¾N ÓSA '(LE…OIJ Ð KÒTINOJ ¥SULOJ μšNEI KAT¦ T¾N ™K PALAIOà DÒXAN: »den Kranz des Apollon oder Poseidon aber, um welchen die Götter selbst sich gewaltig bemühten, kann man ungestraft verkaufen, ungestraft kaufen, und nur bei den Eleern gilt der Ölkranz nach altem Glauben noch für unantastbar.« 167 Dion. Hal. ant. 8, 1 bzw. 77 findet den Sieg des '!STÚLOJ +ROTWNI£THJ bzw. vier Jahre später jenen des ”!STULOJ 3URAKOÚSIOJ verzeichnet. Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 178-179, 186-187, 196-198, 219. 168 Paus. 6, 13, 1: »Die Statue des Astylos von Kroton ist ein Werk des Pythagoras. In drei aufeinander folgenden Olympiaden hat er Siege errungen, im Stadion und im Diaulos... Weil er sich in den letzten beiden Siegen dem Hieron, Sohn des Deinomenes zu Gefallen als Syrakousaner
Athenische Ehrenmänner in Olympia
119
sichtlich der Person des damaligen Tyrannen von Syrakus irrt, denn es handelt sich nicht um Hieron, sondern um Gelon, wirkt die von ihm erzählte Episode glaubwürdig.169 Astylos überträgt die Ehre, die sein olympischer Sieg seiner Heimatpolis Kroton bringt, auf Syrakus. Ohne dass Pausanias einen Grund für den Wechsel der Polis nennt, ist er doch aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Angebot von Geld oder Geschenken zu suchen, das Gelon dem Olympioniken macht.170 Die Krotoniaten reagieren auf diese Handlung eines ihrer ehrenvollsten Bürger, indem sie die Ehre, die er in ihrer Polis genießt, destruieren. Wutentbrannt reißen sie die ihm zu Ehren errichtete Statue nieder, das Symbol für den überragenden Status, den Astylos aufgrund seiner olympischen Siege genossen hatte.171 Die Umfunktionierung seines Oikos in ein Gefängnis nimmt Astylos den ihm als Bürger angestammten sozialen Hort. Sein Haus geht in die Hände der Krotoniaten über, die es zu einem Ort erklären, in dem die am wenigsten Ehrenhaften der Polis zu finden sind. Ähnlich reagieren die Bürger Kretas auf die Bestechlichkeit des Sotades: 3WT£DHJ DÒ ™Pˆ DOL…COU N…KAIJ ÑLUμPI£DI μÒN ™N£THI KAˆ ™NENHKOSTÁI +R»J, KAQ£PER GE KAˆ ÃN, ¢NERR»QH, TÁI ™Pˆ TAÚTHI DÒ LABëN CR»μATA PAR¦ TOà '%FES…WN KOINOà '%FES…OIJ ™SEPO…HSEN AØTÒN: KAˆ AÙTÕN ™Pˆ TîI œRGWI FUGÁI ZHμIOàSIN Oƒ +RÁTEJ.172 Sotades wird wie Astylos der Bürgerstatus entzogen. Mit einem Beschluss über seine Verbannung, der auf dem sozialen Konsens seiner Mitbürger beruht, erlischt auch die Zuschreibung von Ehre an seine Person, die ebenso auf dem Urteil der übrigen Kreter basiert. Es ist anzunehmen, dass weder Astylos noch Sotades geplant hatten, in ihre Heimatpolis zurückzukehren, nachdem sie ihren Mitbürgern die Teilhabe an ihren olympischen Ehren verweigert hatten. Dennoch bemühten sich beide Poleis um eine angemessene Reaktion auf die Taten ihrer Olympioniken, die sie mittelbar in ihrer Ehre beschnitten hatten. Einerseits scheint die Vernichtung von Ehrungen und Ehren der beiden Männer für die Bürger der Poleis wichtig gewesen zu sein; sie wollten diese Enttäuschung ausrufen ließ, aus diesem Grunde verwandelten die Krotoniaten sein Haus in ein Gefängnis und beseitigten seine im Heiligtum der Hera Lakinia aufgestellte Statue.« 169 Hieron wird erst 478 Tyrann; vgl. Moretti, Olympionikai, no. 186-187. 170 Forbes, Crime, 169. 171 Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 186-187: »I Crotoniati, adirati per il suo ›tradimento‹, rovesciarono la statua che gli avevano eretto, verisilmente dopo le vittorie conseguite nella precedente olimpiade«; vgl. A. Hönle, Olympia in der Politik der Griechischen Staatenwelt (von 776 bis zum Ende des 5. Jahrhunderts), Diss. phil., Tübingen 1968, 84-87. 172 Paus. 6, 18, 6: »Sotades wurde im Dolichos (Dauerlauf) mit Siegen in der 99. Olympiade ausgerufen als Kreter, was er auch war, in der folgenden aber bezeichnete er sich als Ephesier, da er aus der ephesischen Staatskasse Geld erhalten hatte, deshalb bestraften ihn die Kreter mit Verbannung.«
120
Der Agon als Wettkampf um Ehre
ihres Anspruchs auf Ehre vergelten. Auf der anderen Seite konnten sie aber nur eine Ehre attackieren, die Astylos und Sotades bereits zugunsten materieller Vorteile und der Ehrung durch andere Poleis aufgegeben hatten. Die Beispiele für den Kauf und Verkauf von olympischen Ehren beruhen auf dem Gedanken, Ehre sei ein Gut, über das eine Person verfügen könne, das sie sogar transferieren könne. Wird Ehre als ein Besitz begriffen und nicht als ein Prädikat, das einer Person wegen ihrer Herkunft und persönlicher Eigenschaften anhaftet, so kann die Ehre einer Person zum Gegenstand ihres Handelns werden. Ehre ist dann nicht allein das höchste Gut, das es zu erstreben gilt, sondern gleichzeitig das hochwertigste Gut, das im Vergleich zu anderen Besitzständen den relativ größten Wert hat. Die Art, wie in Olympia Ehre gewonnen werden konnte, beförderte die Vorstellung der Griechen, dass zumindest diese agonale Ehre mehr mit dem Haben und weniger mit dem Sein zu tun habe. Die Entkoppelung der Ehre von persönlich nicht zu beeinflussenden Eigenschaften wie Herkunft oder Geschlecht geht mit den beschriebenen Phänomenen einher: Athleten ohne ruhmreiche Vorfahren erringen den Siegeskranz, eine Frau verkündet in einer Inschrift stolz den Sieg mit ihrem Pferdegespann173 und Olympioniken wie Astylos oder Sotades betrachten ihre agonale Ehre als disponibel und verkaufen sie ungeachtet der Kränkung ihrer Heimatpolis. Die Distanzierung der Ehre von persönlichen Eigenschaften räumt der Politik der Ehre einen weitaus größeren Handlungsspielraum ein, den einige der Olympioniken offenbar weidlich genutzt haben. Typisch für eine ehrenhafte Austragung von Agonen ist dabei die Auffassung, dass Verlieren schändlicher sei als ein gleichwie errungener Sieg. Für die Griechen verkörpert bereits Odysseus diese Einstellung.174 Auch in anderen ehrenhaften Gesellschaften werden das Lügen, Betrügen und Verschleiern als dem Zweck der Erhaltung oder Mehrung von Ehre angemessene Mittel eingestuft. Das Erreichen des erstrebten Zieles bildet den Maßstab für die Beurteilung des Verhaltens; sofern die Mittel dazu effizient eingesetzt werden, sind sie durch das Ergebnis gerechtfertigt.175 In Olympia ist es das Ziel der Athleten, den ersten Platz zu belegen, denn allein der Erste unter den Teilnehmern wird prämiert und namentlich in die Siegerliste der Hellanodiken eingetragen.176 Der Erfolg bemisst sich dabei relativ zu allen am jeweiligen Agon beteiligten Männern, eine Aufzeichnung absolu173 S. Kap. IV, es handelt sich um die spartanische Königstochter Kyniska. 174 Vgl. P. Walcot, Odysseus and the Art of Lying, in: AncSoc 8 (1977), 1-19. 175 Vgl. Campbell, Honour, 282f.; M. Gilsenan, Lying, Honor, and Contradiction, in: B. Kapferer (Hg.), Transaction and Meaning. Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behavior, Philadelphia 1976, 191-219, passim; Chaney, Spectacle, 151; Pitt-Rivers, Status, 33. 176 Krause, Olympia, 141.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
121
ter Leistungsstandards oder Rekorde gibt es nicht. Dem einzigen Sieger des Agons kommt ein enormes Maß an Ehre zu, und gemäß der Vorstellung von Ehre als einem Spiel mit einer Nullsumme fällt die Ehrenbilanz der übrigen Athleten negativ aus, was bedeutet: es ist eine Schande, teilgenommen und nicht gewonnen zu haben. Die antiken Quellen spiegeln die Unscheinbarkeit all jener Athleten, die nicht die besten ihrer Disziplin geworden sind, indem sie über sie schweigen. Die Namen der jeweiligen Zweit- oder Drittplazierten werden nur dort erwähnt, wo sie die Protagonisten von Anekdoten oder Skandalen sind, oder insofern es sich um berühmte Kämpfer handelt, die ausnahmsweise nicht den ersten Platz belegt haben.177 Philostratos berichtet von den hohen Erwartungen, die Gymnasiasten und Verwandte in die Athleten setzen: '!¸IC…WNA DÒ TÕN PAGKRATIAST¾N DÚO μÒN ½DH '/LUμPI£DAJ NIKîNTA, TR…THN DÒ ™P' ™KE…NAIJ '/LUμPI£DA μACÒμENON PERˆ TOà STEF£NOU KAˆ ½DH ¢PAGOREÚONTA '%RUX…AJ Ð GUμNAST¾J E„J œRWTA QAN£TOU KATšSTHSEN ¢NABO»SAJ œXWQEN: ›æJ KALÕN ™NT£FION TÕ ™N '/LUμP…v μ¾ ¢PEIPE‹N‹.178 Tatsächlich wird Arrhichion der Sieg posthum zugesprochen, weil sein Gegner aufgab, kurz bevor er Arrhichion erwürgte.179 Eine Möglichkeit für die Wettkämpfer, solch extreme Situationen zu vermeiden, bestand darin, trotz vorbereitenden Trainings in Olympia nicht an den Agonen teilzunehmen. Nachdem sie die Kraft und Geschicklichkeit ihrer Gegner während der gemeinsamen Vorbereitungsphase hatten einschätzen können, hielten es einige Athleten für klüger, sich erst gar nicht in den Ring zu begeben.180 Sie vermieden die Schande derjenigen Athleten, die an den olympischen Agonen teilgenommen, aber nicht gewonnen hatten und ohne den Siegeskranz in ihre Polis zurückkehren mussten. Pindar beschreibt das Verhalten der Verlierer anschaulich, das Alkimedon wegen seines Sieges erspart bleibt: ÖJ TÚCv μÒN DA…μONOJ, ¢NORšAJ D'OÙK ¢μPLAKëN ™N TšTRASIN PA…DWN ¢PEQ»KATO GU…OIJ NÒSTON œCQISTON KAˆ ¢TIμOTšRAN
177 Vgl. Buhmann, Sieg, 9-15. Bei lokalen Agonen scheint auch der zweite Platz mitunter von Wert gewesen zu sein, vgl. N.B. Crowther, Second-place finishes and lower in Greek Athletics (including the Pentathlon), in: ZPE 90 (1992), 97-103. 178 Philostr. 21: »Dem Pankratiasten Arrichion, der bereits in zwei Olympiaden Sieger war und in der folgenden dritten Olympiade um den Kranz kämpfte und sich bereits besiegt erklären wollte, flößte der Gymnasiast Eryxias Lust zum Sterben ein, indem er draußen ausrief: ›Welch herrlicher Totenschmuck, in Olympia sich nicht zu ergeben.‹« Ein weiteres Beispiel findet sich ebd., 23. 179 Paus. 8, 40, 1-2. Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 102. 180 Vgl. M.I. Finley und H.W. Pleket, Die Olympischen Spiele der Antike, Tübingen 1976, 116f.; Krause, Olympia, 154.
122
Der Agon als Wettkampf um Ehre
GLîSSAN KAˆ ™P…KRUFON OÍμON.181 Ähnlich schmachvoll wird die Heimkehr besiegter Athleten an anderer Stelle ausgemalt: OÙDÒ μOLÒNTWN P¦R μATšR' ¢μFˆ GšLWJ GLUKÝJ ðRSEN C£RIN: KAT¦ LAÚRAJ D'™CQRîN ¢P£OROI PTèSSONTI, SUμFOR´ DEDAGμšNOI.182 Das Verhalten der besiegten Athleten drückt die der Ehre entgegen gesetzte Scham aus, die sich in einem Habitus manifestiert, der das Gegenteil des ehrenhaften ist: Die Männer fürchten die Öffentlichkeit und das Reden ihrer Mitbürger. Beide Faktoren schaffen die Ehre eines Mannes, können aber auch ihre Beeinträchtigung bestätigen und Schande bringen, die Pindar hier durch die Körpersprache der Athleten ausdrückt.183 Insofern die Scham aus der Nichterfüllung bestimmter ehrenhafter Ansprüche resultiert, ist sie hier die Reaktion auf den gescheiterten Versuch eines olympischen Sieges. Auf der anderen Seite wird die große Menge der in den olympischen Wettkämpfen unterlegenen Athleten dafür gesorgt haben, dass die Schande des Einzelnen weniger groß und dauerhaft war. Auf einen olympischen Sieger kam stets eine stattliche Anzahl von Athleten, die besiegt worden waren, in den nächsten Wettkämpfen aber wiederum mit mehr Glück antreten konnten. Die übergroße Ehre eines Olympioniken fand ihre Negativbilanz deshalb nicht nur in der Schande einzelner erfolgloser Kämpfer, sondern wohl auch in der Summe derer, denen ein Sieg nicht zuteil wurde. Weil die agonalen Leistungen nicht an absoluten oder historischen Standards gemessen wurden, sondern an den jeweiligen athletischen Mitstreitern, wechselten die erfolgreichen Personen. So konnte potentiell jeder unterlegene Teilnehmer an den Agonen nach der nächsten Olympiade bereits ein Sieger sein, der Olympionike umgekehrt auch besiegt werden.184 Die agonale Ehre, die ein Sieg in Olympia brachte, lohnte den großen Einsatz der Wettstreiter: KAˆ T¦ «QLA, éSPER œμPROSQEN EÍPON, OÙ μIKR£, Ð œPAINOJ Ð PAR¦ TîN QEATîN KAˆ TÕ ™PISHμÒTATON GENšSQAI KAˆ DE…KNUSQAI Tù DAKTÚLJ ¥RISTON EÍNAI TîN KAQ' AØTÕN DOKOàNTA.185 Einige Athleten bzw. deren Angehörige soll vor Freu181 Pind. O. 8, 67-69: »Der – durch Götterfügung, doch Manneszucht nicht ermangelnd – auf vier Knabenleiber wälzte er höchlichst verhasste Heimkehr von sich ab und unrühmlichstes Reden wie auch verbergenden Schleichweg« (Übersetzung O. Werner). 182 Pind. P. 9, 85-88: »Kamen zur Mutter sie, schuf kein liebliches Lachen Lust ringsum; die Gassen entlang, fern den Feinden, ducken sie sich scheu, verwundet von des Unglücks Biss.« 183 Vgl. Cairns, Aidôs, 6-8; A. Wierzbicka, Human Emotions: Universal or Culture-Specific?, in: American Anthropologist 88 (1986), 584-594, 591: »the concept of ›shame‹ ... is associated with a desire not to be seen.« 184 Vgl. zu diesem Zusammenhang Golden, Sport, 177: »even the greatest champion might well become just another loser.« 185 Lukian. Anacharsis, 36: »Die Belohnungen aber sind, wie gesagt, so geringfügig nicht; oder was könnten die Sieger mehr verlangen, als von so ansehnlichen Zuschauern gelobt und im ganzen Griechenlande berühmt und mit den Fingern gezeigt und für die Besten unter ihren Kameraden erklärt zu werden?« Übersetzung C.M. Wieland.
Athenische Ehrenmänner in Olympia
123
de über den olympischen Sieg buchstäblich der Schlag getroffen haben.186 Die Ehre, die über ihr Fassungsvermögen ging, besteht hier in der Anerkennung durch die Öffentlichkeit, die den Sieger als den Ersten und Besten unter Seinesgleichen, d. h. unter den jeweiligen Teilnehmern betrachtet. Es ist die Vorstellung von der Ehre eines Mannes, wie sie sich in seinen Taten zeigt und daraufhin von den Beobachtern seiner Handlungen bestätigt wird. Die in Olympia abgehaltenen Agone vertreten dabei das abstrakte Prinzip des Agons, der den Ehrgeiz und das Wetteifern umfasst und die Ehre eines Mannes erweisen soll. Zugleich zeigen sich die Agone hier in einer so plastischen, personifizierten Gestalt, dass die Griechen in Olympia eine Statue des Agons aufstellten.187 Eine greifbare Dimension der in Olympia vergebenen Ehren zeigte sich am wahrscheinlich letzten Tag des Festes in Form der verschiedenen, den Olympioniken zukommenden Ehrungen.188 Die Namen der Sieger der einzelnen Disziplinen wurden öffentlich von einem Herold ausgerufen und so der gesamten Festversammlung bekannt gemacht. Die siegreichen Athleten wurden mit Ölbaumzweigen bekränzt, die das berühmte äußere Zeichen ihrer olympischen Ehren darstellten.189 Nach einer feierlichen Prozession der Olympioniken zu den Altären der Götter, denen sie Dankopfer darbrachten, wurde im Prytaneion der Eleer ein Festmahl für die Sieger abgehalten.190 Zusammen mit der Bekränzung erhielt jeder siegreiche Athlet das Recht, sich im geheiligten Bezirk von Olympia eine Siegerstatue aufstellen zu lassen. Die Kosten für diese Monumente trugen die Athleten selbst bzw. ihre Familien oder ihre Heimatpoleis, von denen manche eine solche Statue auch auf der heimischen Agora aufstellen ließen. Außerdem vergüteten einige Poleis ihre Olympioniken mit Geld oder anderen materiellen Leistungen, die die hohe olympische Ehre auch finanziell zu einem Gewinn machte.191 186 Diog. Laert. 1, 73. Vgl. zur Stellung der Olympioniken Hönle, Olympia, 98-106. 187 Paus. V 26, 3: '!GèN TE ™N TO‹J ¢NAQ»μAS…N ™STI TO‹J -IKÚQOU FšRWN ¡LTÁRAJ. »Unter den Weihgeschenken des Mikythos befindet sich auch ein Agon (›Wettkampf‹) mit Sprunggewichten.« 188 Zum Ablauf des olympischen Festes vgl. I. Weiler, Der Sport bei den Völkern der alten Welt, Darmstadt 1981, 109-113; Buhmann, Sieg, 53-58. 189 Paus. 5, 15, 3: œSTI DÒ ™N TÁI ”!LTEI TOà ,EWNIDA…OU PER©N μšLLONTI ™J ¢RISTER¦N '!FROD…THJ BWμÕJ KAˆ `7RîN μET' AÙTÒN. KAT¦ DÒ TÕN ÑPISQÒDOμON μ£LIST£ ™STIN ™N DEXI©I PEFUKëJ KÒTINOJ. »In der Altis befindet sich gegenüber dem Leonidaion, wenn man nach links geht, ein Altar der Aphrodite und nach ihm der Horen. Gerade am Opisthodom zur Rechten wächst ein wilder Ölbaum. Er heißt der schönkränzende Ölbaum, und den Olympiasiegern werden von ihm die Kränze gegeben.« Vgl. Lukian. Anacharsis 9. 190 Paus. 5, 15, 12. 191 Zur Problematik der materiellen Begleiterscheinungen des olympischen Kranzes vgl. Pleket, Games, 69-71; sowie I. Weiler, Einige Bemerkungen zu Solons Olympionikengesetz, in: P. Händel und W. Meid (Hg.), Festschrift Robert Muth, Innsbruck 1983, 573-582.
124
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Unter allen Ehrungen, die ein olympischer Sieg mit sich brachte, war die Aufstellung einer Statue sicherlich eine der wichtigsten für den Athleten. Denn neben seiner Aufzeichnung in den Siegerlisten und – sofern es sich um einen Stadioniken handelte – seiner eponymen Funktion, handelte es sich bei dieser Art der Auszeichnung um die dauerhafteste. Die Aufstellung einer Statue in der Heimatpolis wird sich für einen Bürger als kontinuierlich identitäts- und ehrstiftend erwiesen haben, weil er so den sozialen Raum besetzte, in dem sich die Öffentlichkeit der Polis konstituierte.192 Denn obwohl es sich bei der Ehre, die auf eine überlegene athletische Leistung folgte, um eine relative Einschätzung der Fähigkeiten eines Mannes zu einem bestimmten Zeitpunkt handelte, konnte sie doch seinen Status in der Gesellschaft seiner Polis erheblich verändern. Die olympische Ehre hatte diesen ungeheuren Effekt, weil sie all jene Qualitäten fokussierte, die das Verhalten eines Ehrenmannes leiten sollten. Die Besonderheit der olympischen Ehren speiste sich aus der Visualität ehrenhaften Verhaltens und dessen Belohnungen und aus der Dynamik, die sie in die bestehenden ehrenhaften Strukturen bringen konnte. Die Ehre eines Mannes musste sich in Athen in der Meisterung verschiedenster situativer Kontexte bewähren. In Olympia genügte ein Wettlauf, um die Ehre eines Mannes zu erweisen: den Athleten wurden von Seiten der zuschauenden Öffentlichkeit all jene Verhaltensmuster zugeschrieben, die die Ehre konstituierten. Zwar kam übermäßige Ehre nur dem Sieger zu, ihre männliche Ehrenhaftigkeit demonstrierten aber alle Teilnehmer, die sich auf die Herausforderung des Wettkampfes einließen. Solon schildert in einem Dialog des Lukian den Eindruck, den die Athleten bei den Zuschauern der Agone hinterlassen: OÙ G¦R OÛTW LšGWN ¥N TIJ PROSBIB£SEIšN SE TÍ ¹DONÍ TîN ™KE‹ DRWμšNWN, æJ E„ KAQEZÒμENOJ AÙTÕJ ™N μšSOIJ TO‹J QEATA‹J BLšPOIJ ¢RET¦J ¢NDRîN KAˆ K£LLH SWμ£TWN KAˆ EÙEX…AJ QAUμAST¦J KAˆ ™μPEIR…AJ DEIN¦J KAˆ „SCÝN ¥μACON KAˆ TÒLμAN KAˆ FILOTIμ…AN KAˆ GNèμAJ ¢HTT»TOUJ KAˆ SPOUD¾N ¥LEKTON ØPÒR TÁJ N…KHJ.193 So wenig die Athener in ihrem alltäglichen gesellschaftlichen Leben von Ehre reden, weil sie als die Grammatik des sozialen Handelns unausgesprochen bleibt, so sehr ist die Ehre das ausge192 Vgl. W.W. Hyde, Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art, Washington 1921, 361f.; Buhmann, Sieg, 107-109. 193 Lukian. Anacharsis 12: »Denn es ist unmöglich, dass dir jemand mit bloßen Worten einen solchen Geschmack von dem ungemeinen Vergnügen, das man dort erfährt, mitteilen könnte, als du haben würdest, wenn du selbst mitten unter den Zuschauern säßest und deine Augen an dem herrlichen Anblick dieses Schauspiels, an dem Mut und der Standhaftigkeit der Athleten, an den schönen Formen ihrer Körper, an ihrem kräftigen Gliederbau, ihrer unbegreiflichen Geschicklichkeit und Kunst, ihrer unbezwingbaren Stärke, ihrer Kühnheit, Ehrbegierde, Geduld und Beharrlichkeit und an ihrer unauslöschlichen Leidenschaft zu siegen weiden könntest.«
Athenische Ehrenmänner in Olympia
125
sprochene Ziel des Athleten und das Leitmotiv für die Zuschauer in Olympia. Die manchmal unberechenbare agonale Ehre entfaltet ihre volle Wirkung erst in den Heimatpoleis der Athleten, denn sie wird hauptsächlich nach Kriterien vergeben, die außer Kraft und Schnelligkeit kaum qualifizierende Eigenschaften erfordern. Durch die Vergabe von Ehrungen nach einem der Polisgesellschaft fremden Maßstab, der auf die Messung der athletischen Leistung zielt, bringen die Agone ein Element des Zufalls in die ansonsten sehr erwartbaren, durch Ehre geprägten sozialen Strukturen ein. Mit den agonalen Ehren können die Sieger deshalb freier umgehen und sie leichter konvertieren, als es in ihrem sozialen Umfeld, in dem sie eine feste, selten verrückbare Position einnehmen, gewöhnlich möglich ist. Während sich in der Polis Athen die Ehre eines Mannes durch ein Konglomerat von verschiedenen Attributen auszeichnet, verleihen die Hellanodiken nur den Kranz. Nach dem Sieg kann der Gewinner diesen aber so praktisch und unverhandelbar in den Händen halten wie seine olympische Ehre. Die Möglichkeit, über die eigene Ehre – oder zumindest ihren agonalen Aspekt – zu verfügen, resultiert aus der Erfahrung, dass diese Ehre durch eine Mischung von eigenen athletischen Fähigkeiten und glücklichem Zufall erworben ist, und damit zugleich als jederzeit reproduzierbar sowie als ein einmaliger Gewinn betrachtet werden kann. Beides hat wenig gemein mit der angestammten Ressource Ehre, die einem athenischen Bürger qua Geburt zur Verfügung steht und seine Position innerhalb der Gesellschaft bestimmt. Unter der Prämisse seiner eigenen Ehrenhaftigkeit kann ein Athener gewisse situative Bedingungen und Ausdrucksformen seiner Ehre verhandeln, er kann eine Politik der Ehre betreiben, solange diese selbst nicht zur Disposition steht. Die olympische Ehre dagegen erscheint als Ganzes disponibel, sie kann ad hoc gewonnen und ebenso entlehnt, verkauft oder eingetauscht werden, weil sie nicht unmittelbar an der Person haftet. Auf einer gesellschaftlich umfassenderen Ebene wirkt sich der dynamische Aspekt der agonalen Ehre in der Polis Athen durch die hohe Ehrung von Olympioniken aus, die unabhängig von den gewöhnlich erwarteten Eigenschaften und Prädikaten eines Ehrenmannes zu Auszeichnungen gekommen sind, die ihnen einen herausragenden Ehrenstatus in der Gesellschaft sichern. Die olympische Ehre spielt in der athenischen Gesellschaft – wie auch in jenen der anderen griechischen Poleis – eine besondere Rolle. Die Gründe dafür liegen in den Querverbindungen zwischen den athletischen Agonen in Olympia und der agonalen Ehre in Athen. Beide beziehen sich unmittelbar aufeinander: die olympischen Agone fungieren quasi als ein ausgelagerter Teilaspekt der Ehre eines athenischen Mannes, die zu einem Gutteil auf seinem agonalen Verhalten beruht. Das olympische Fest – wie auch in geringerem Maße die anderen panhellenischen sowie atheni-
126
Der Agon als Wettkampf um Ehre
schen Agone – geben einem Ehrenmann die Gelegenheit der Demonstration seiner für die Ehre fundamentalen habituellen Formen, deren eine das agonale Verhalten ist. Es zeichnet sich dadurch aus, dass ein Ehrenmann die Herausforderung zum Wettkampf annimmt und Konflikte nicht scheut, mit seinen ausschließlich männlichen Gegnern von gleich zu gleich kämpft, seinen ganzen Ehrgeiz auf das Siegen setzt und dabei innerhalb der allseits anerkannten Regeln wetteifert. Diese Verhaltensmuster sollten einen ehrenhaften Athener bei den olympischen Agonen ebenso wie in seiner Polis auszeichnen. Der gravierende Unterschied zwischen beiden Orten besteht zum einen in dem strukturellen Umstand, dass das Verhalten des Einzelnen in Olympia weniger in die eingespielten sozialen Regeln der Polis eingepasst sein muss, und er auch deshalb das Gefühl gehabt haben wird, mit seiner olympischen Ehre freier umgehen zu können. Zum zweiten werden die agonalen Verhaltensweisen, die einem Athener durch seine Sozialisation in einer ehrenhaften Gesellschaft vertraut sind, in Olympia explizit als Erwartung ausgesprochen und die dort anwesende Öffentlichkeit kann die Erfüllung oder Verfehlung dieser Norm durch den Einzelnen ausführlich diskutieren. Das hebt die agonalen Normen der Ehre auf eine Ebene der Verbalisierung, die in Athen nicht existiert. In Olympia können die Athener den Agon, der einen wichtigen Anteil an dem hohen Gut der Ehre hat, in einer sehr praktischen Form meistern. Das Erlebnis dieses für die athenische Gesellschaft so hohen Gutes in seiner reinen Form macht die olympische Ehre für die Athener so wichtig. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die homerische Tradition, in welche die griechischen Agone schon von den Zeitgenossen immer wieder gestellt werden. Sie bedeutet den Anschluss an eine Vergangenheit, in der das Leben eines Ehrenmannes weniger Regeln unterworfen war. Die ehrenhaften homerischen Helden waren Einzelkämpfer, die die kompetitive Seite ehrenhaften Verhaltens in den Vordergrund treten lassen konnten, ohne den Beschränkungen eines Gemeinwesens zu unterliegen. Gerade der Agon als ehrenhafte Verhaltensnorm befördert das Aufkommen von Konflikten und Ehrenhändeln unter den beteiligten Männern, die sich rasch verselbständigen können. Die olympischen Agone kommen dem Bedürfnis der Athener, sich in streitbarer Auseinandersetzung miteinander zu messen, sehr entgegen.194 Der kompetitive Charakter des Agons verleiht den olympischen 194 Vgl. J. MacClancy, Sport, Identity and Ethnicity, in: ders. (Hg.), Sport, Identity and Ethnicity, Oxford 1996, 1-20, 4: »Sport does not merely ›reveal‹ underlying social values, it is a major mode of their expression. Sport is not a ›reflection‹ of some postulated essence of society, but an integral part of society and one, moreover, which may be used as a means of reflecting on society.«, und ebd., 8: »One thing that is clear is that sports need not necessarily contain any competitive element.«
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
127
Agonen nicht nur den altehrwürdigen Glanz homerischen Heldentums, sondern hat für die Polis Athen einen direkten gesellschaftspolitischen Nutzen: die konfliktträchtigsten Elemente der Ehre werden an einen anderen Ort verlagert.
4. Der Agon als Schau-Spiel um Ehre: Hahnenkämpfe im Dionysostheater Wie in vielen ehrenhaften Gesellschaften, so fanden auch im Griechenland der Antike Hahnenkämpfe statt. Ob als öffentliche Veranstaltung oder auf offener Straße, für die stolzen Besitzer der Tiere oder für die Zuschauer, sei es wegen der mutmaßlichen Tapferkeit und Eitelkeit dieser Tiere – Hahnenkämpfe erfreuten sich einer beträchtlichen Faszination. Sie wird verständlich, wenn man mit Clifford Geertz davon ausgeht, dass sich die Athener – wie die Balinesen – nicht wirklich für die Hähne interessieren, sondern weit mehr für sich selbst und mithin dafür, was die kämpfenden Hähne ihnen über sie selbst erzählen können.195 Es gibt einen schon in den zeitgenössischen Quellen viel beschworenen Zusammenhang zwischen den athenischen Männern und ihren Hähnen, wobei letztere eine Art Spiegelfunktion innehatten und zur Identifikation einluden: +A…TOI T… ¥N P£QOIJ, E„ QE£SAIO KAˆ ÑRTÚGWN KAˆ ¢LEKTRUÒNWN ¢GîNAJ PAR' ¹μ‹N KAˆ SPOUD¾N ™Pˆ TOÚTOIJ OÙ μIKR£N; À GEL£SV DÁLON ÓTI, KAˆ μ£LISTA ÀN μ£QVJ æJ ØPÕ NÒμJ AÙTÕ DRîμEN KAˆ PROSTšTAKTAI P©SI TO‹J ™N ¹LIK…v PARE‹NAI KAˆ ÐR©N T¦ ÔRNEA DIAPUKTEÚONTA μšCRI TÁJ ™SC£THJ ¢PAGOREÚSEWJ; ¢LL' OÙDÒ TOàTO GELO‹ON: ØPODÚETAI G£R TIJ ¹RšμA TAˆJ YUCA‹J ÐRμ¾ EƒJ TOÝJ KINDÚNOUJ, æJ μ¾ ¢GENNšSTEROI KAˆ ¢TOLμÒTEROI FE…NOINTO TîN ¢LEKTRUÒNWN μHDÒ PROAPAGOREÚOIEN ØPÕ TRAUμ£TWN À KAμ£TOU ½ TOU ¥LLOU DUSCEROàJ.196 195 Vgl. C. Geertz, Deep Play. Notes on the Balinese Cockfight, in: ders., The Interpretation of Cultures, New York 1973, 412-453, 448, führt den seine Arbeit legitimierenden Gedanken lediglich in Klammern an: »like most of the rest of us, the Balinese are a great deal more interested in understanding men than they are in understanding cocks« und sagt es noch einmal ohne Umschweife: »For it is only apparently cocks that are fighting there. Actually, it is men«, 417. 196 Lukian. Anacharsis, 37: »Wenn dir aber dies schon so widersinnisch [sic!] vorkommt, was würdest du erst sagen, wenn du unsere Wachteln- und Hahnengefechte sähest und den Ernst, womit wir uns für dieselben verwenden? Du würdest ohne Zweifel laut auflachen, zumal wenn du hörtest, dass wir ein Gesetz haben, das allen erwachsenen Personen befiehlt, dabei zugegen zu sein und zuzusehen, wie diese Vögel so lange miteinander kämpfen, bis sie sich vor Kraftlosigkeit nicht mehr rühren können. Und doch ist auch darin nichts Lächerliches. Denn dieses Schauspiel erregt unvermerkt in den Gemütern den Trieb, jeder Gefahr zu trotzen, um sich nicht an Edelmut und Kühnheit von Wachteln und Hahnen übertreffen zu lassen und sich, wie sie, nicht eher als mit dem letzten Atem durch Wunden oder Anstrengung oder jeder andern Schwierigkeit mürbe machen zu lassen.«
128
Der Agon als Wettkampf um Ehre
Auf eine Klärung des Verhältnisses zwischen den athenischen Männern und ihren Hähnen zielen die erkenntnisleitenden Interessen des Kapitels: Warum faszinierte das Schauspiel der Hahnenkämpfe die athenischen Männer derart? Was verband die Hähne mit den Beobachtern und ihrer Ehre? Und was sagen die Äußerungen der Griechen über ihre Hähne und die Hahnenkämpfe über sie selbst und ihre Ehre aus? Diese Fragen, die auf den Projektionsgehalt oder auch die soziale Funktion von Hahnenkämpfen zielen, werden schon von den Athenern thematisiert. Neben einer systematischen agrarisch orientierten Behandlung von Hähnen, ihrem Lebensraum und Verhalten, bestehen die Aussagen der Quellen vor allem in beiläufigen Bemerkungen, die sich auf die als allgemein bekannt vorausgesetzte Natur von Hähnen beziehen. Die Anspielungen in den platonischen Dialogen, der Spott in den aristophanischen Komödien oder die pädagogischen Belehrungen der äsopischen Fabeln zeichnen ein relativ einheitliches Bild dessen, was den Hähnen an Merkmalen zugesprochen wird und als Eigenschaften auf die Menschen übertragbar ist. Die Zuschreibung spezifisch menschlicher Qualitäten an die Hähne erfolgte als bewusster Prozess, der in den Quellen als solcher reflektiert wird. Offensichtlich stellt die metaphorische Ebene schon für die Griechen einen wichtigen Aspekt ihrer Hahnenkämpfe dar.197 Die Beobachtungen, die Geertz bei den balinesischen Hahnenkämpfen macht, und die Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, lassen sich deshalb auf die athenische Gesellschaft anwenden. Seine zentrale Prämisse lautet, dass das Schauspiel der Hahnenkämpfe und das Interesse der Beteiligten verständlich werden, wenn man die Hahnenkämpfe als eine Inszenierung der sozialen Mechanismen begreift, die in der jeweiligen Gesellschaft wirksam sind: »the cockfight is – or more exactly, deliberately is made to be – a simulation of the social matrix, the involved system of cross-cutting, overlapping, highly corporate groups ... in which its devotees live. And as prestige, the necessity to affirm it, defend it, celebrate it, justify it, and just plain bask in it ..., is perhaps the central driving force in society, so also ... is it of the cockfight. This apparent amusement and seeming sport is, to take another phrase from Erving Goffman, ›a status bloodbath‹.«198 Diese Interpre197 Vgl. C.W. Schwabe, Animals in the Ancient World, in: A. Manning und J. Serpell (Hg.), Animals and Human Society. Changing Perspectives, London/New York 1994, 36-58, 36: »And, since metaphors are regarded as obviously exaggerated (or purely poetic) comparisons today, this tendency underestimates the importance of the considerable fusion in ancient minds not only of such notions as metaphor, symbol, simile, analogue and identity/sameness, but also of such activities/institutions as religion, animal husbandry and healing, which are now totally distinct.« 198 Geertz, Play, 436. Es ist bemerkenswert, dass Geertz an dieser Stelle von einer »äsopischen« Repräsentation spricht, ebd.: »Psychologically an Aesopian representation of the ideal/demonic, rather narcissistic, male self, sociologically it is an equally Aesopian representation
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
129
tation des Ereignisses von Hahnenkämpfen wird offenbar von vielen Athenern geteilt. Die reflexive Übertragung des tierischen Verhaltens auf die beobachtenden Männer und umgekehrt scheint schon den Zeitgenossen evident gewesen und als Zweck der Veranstaltung angesehen worden zu sein. Dabei lässt sich die Auswahl an Verhaltensweisen, die die Griechen den Hähnen zuschreiben, gut mit dem Kanon der habituellen Formen abgleichen, die ehrenhaftes Verhalten ausmachen. Die Basis dafür sind die Aussagen der Athener, wonach den Hähnen einige charakteristische Merkmale zu Eigen sind, durch die sich ein Mann von Ehre auszeichnet. Die Athener versahen ihre Hähne mit bestimmten wünschenswerten Attributen, die sie in mehr oder minder ausgeprägter Form bei allen Gattungsangehörigen und in besonderem Ausmaß bei einigen Exemplaren wirklich vorfanden.199 Ihre Zuschreibungen sind nicht vollends aus der Luft gegriffen, sondern knüpfen an Besonderheiten des Verhaltens einzelner Hähne im Vergleich zu anderen Tieren an. So zeichnen sich die Hähne als die männlichen Vertreter ihrer Gattung durch eine stattliche Erscheinung und ein selbstherrliches Auftreten aus. Sie zeigen angeblich körperliche Schönheit und Stolz sowie Mut, Tapferkeit und Potenz.200 Wie ehrenhafte Männer scheinen die Hähne ihren kampfbereiten Anspruch auf Überlegenheit gern in der Öffentlichkeit zu demonstrieren, sie stehen in beständiger Rivalität zueinander. Sie scheuen keine Konfliktsituation, im Gegenteil ist die latente agonale Bereitschaft Provokationen sehr zugänglich und führt leicht zum sporenbewehrten Kampf ›Mann gegen Mann‹.201 Ziel und Trophäe des Kampfes sind für den Sieger die totale Unterwerfung des Gegners und damit die eigene Erhöhung. Wenn Hähne mit diesen Qualitäten, die für einen Ehrenmann in der athenischen Gesellschaft so wichtig sind, versehen werden, bilden sie tatsächlich das Verhalten und die Interaktion ehrenhafter Männer ab.202 Der Kampf der Hähne fokussiert eine soziale Situation, die typisch ist für die Gesellschaft und die jedes ihrer Mitglieder schon oft erlebt hat. Die den Hahnenkämpfen zuschauenden Athener kennen den Kampf um Ehre, den
of the complex fields of tension set up by the controlled, muted, ceremonial, but for all that deeply felt, interaction of those selves in the context of everyday life.« 199 Vgl. Schwabe, Animals, 36; Geertz, Play, 417f. 200 Vgl. zur Ausstattung der Hähne mit körperlichen Vorzügen: Aristoph. Av. 486f.; Plat. Hipp. mai. 295d; Plat. leg. 789d. 201 Pind. O. 12, 13f.; Aisop. 21; Aristoph. Av. 833f.; Aristoph. Av. 1364-1369; Paus. 6, 26, 3. 202 Vgl. E. Csapo, Deep ambivalence. Notes on a Greek Cockfight, in: Phoenix 47 (1993), 127 u. 115-124, 25: »The Classical Athenian cock provides a very clear example of the way society may transform brute nature and recreate it in its own image to participate in a higher social ›reality‹.«
130
Der Agon als Wettkampf um Ehre
die Hähne ausfechten, und die ehrenhaften Verhaltensweisen und Rituale, die diesen begleiten, aus eigener alltäglicher Erfahrung. Über die faktischen Einzelheiten der Hahnenkämpfe informieren nur wenige Quellen. Sie vermögen jedoch einen Eindruck davon zu geben, wann und wo Hahnenkämpfe veranstaltet wurden, wie der Ablauf sich gestaltete, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Form beteiligt waren usw. So ist es möglich, einige nähere Angaben zur Veranstaltung von Hahnenkämpfen in Athen in klassischer Zeit zu machen, aber entscheidende Fragen müssen aufgrund der Quellenlage offen bleiben. Die größte hermeneutische Sicherheit besteht in der Tatsache, dass sich die Aussagen der verschiedenen Quellengattungen nicht widersprechen. Sie bestätigen einander mit einer ähnlichen stückweisen Herausgabe von immergleichen Detailinformationen, die häufig vereinzelt auftauchen und eher Indizien- als Beweischarakter haben. Noch die Römer sprechen von der Vorliebe der Griechen für Hahnenkämpfe, betrachten diese Art der Zerstreuung aber mit einem gewissen Abstand und zum Teil mit Skepsis.203 Den eindrücklichsten Beleg für die Existenz und die große Bedeutung von Hahnenkämpfen in Athen liefert die Geschichte, die Aelian in seiner 0OIK…LH ƒSTOR…A zur Institutionalisierung öffentlicher Hahnenkämpfe zwecks kämpferischer Erbauung der Bürger erzählt: -ET¦ T¾N KAT¦ TîN 0ERSîN N…KHN '!QHNA‹OI NÒμON œQENTO ¢LEKTRUÒNAJ ¢GWN…ZESQAI DHμOS…v ™N Tù QE£TRJ μI©J ¹μšRAJ TOà œTOUJ: PÒQEN DÒ T¾N ¢RC¾N œLABEN ÓDE Ð NÒμOJ ™Rî. ÓTE 1EμISTOKLÁJ ™Pˆ TOÝJ BARB£ROUJ ™XÁGE T¾N POLITIK¾N DÚNAμIN, ¢LEKTRUÒNAJ ™QE£SATO μACOμšNOUJ: OÙDÒ ¢RGîJ AÙTOÝJ EÍDEN, ™PšSTHSE DÒ T¾N STRATI¦N KAˆ œFH PRÕJ AÙTOÚJ: ›¢LL' OáTOI μÒN OÜTE ØPÒR PATR…DOJ OÜTE ØPÒR PATRóWN QEîN OÙDÒ μ¾N ØPÒR GONIKîN ºR…WN KAKOPAQOàSIN OÙDÒ ØPÒR DÒXHJ OÙDÒ ØPÒR ™LEUQER…AJ OÙDÒ ØPÒR PA…DWN, ¢LL' ØPÒR TOà μ¾ ¹TTHQÁNAI ˜K£TEROJ μHDÒ EÍXAI QATšRJ TÕN ›TERON.‹ ¤PER OâN E„PëN ™PšRRWSE TOÝJ '!QHNA…OUJ. TÕ TO…NUN GENÒμENON AÙTO‹J SÚNQHμA TÒTE E„J ¢RET¾N ™BOUL»QH DIAFUL£TTEIN KAˆ E„J T¦ ÓμOIA œRGA ØPÒμNHSIN.204 Einen solchermaßen zur Charakterbildung der Athener 203 Columella etwa stellt im 1. Jahrhundert n. Chr. das Phänomen der streitbaren sexuellen Aggression einiger Hähne fest; als Agrarökonom fällt er ein von der griechischen Vorstellung abweichendes Urteil: »tam hercule quam nec pugnacem nec rixosae libidinis marem. nam plerumque ceteros infestat et non patitur inire feminas, cum ipse pluribus sufficere non queat.« Colum. 8, 2, 14: »so wenig wie ich einen kämpferischen oder mit streitbarem Lusttrieb begabten Hahn schätze. Denn dieser belästigt meistens die anderen und lässt sie nicht an die Hennen herankommen, während er doch selbst auch nicht eine größere Zahl von ihnen befriedigen kann.« Übersetzung W. Richter. 204 Ail. var. 2, 28: »Nach ihrem Sieg über die Perser führten die Athener den Brauch ein, einmal im Jahre im Theater einen öffentlichen Hahnenkampf zu veranstalten. Woher dieser Brauch seinen Ursprung hat, will ich erzählen: als Themistokles mit dem Heer der Bürger Athens gegen
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
131
eingerichteten und wohl im Monat Posideon stattfindenden Hahnenkampf bestätigen Lukian und einige archäologische Zeugnisse, die das Dionysostheater in Athen mit dem von Aelian angesprochenen Spektakel in Verbindung bringen.205 Offensichtlich wurde an eine Art reziproken Transfers gedacht: Was die Männer an Eigenschaften auf die Hähne projizierten, kam verstärkt als Vorbild zurück und diente der belehrenden Bildung bzw. der moralischen Stärkung.206 Dass man die athenischen Männer nicht erst ermuntern musste, sich mit den Hähnen und ihrem Kampfgebaren zu identifizieren, zeigt die Beliebtheit von Hahnenkämpfen bei breiten Schichten der männlichen Bevölkerung: Auch abseits einer institutionalisierten Großveranstaltung fanden auf öffentlichen Plätzen und wohl auch in Gymnasien Hahnenkämpfe statt.207 Sie wurden von den stolzen Besitzern der Tiere betrieben und lockten immer eine Schar von umherstehenden, Wetten abschließenden Schaulustigen
die Barbaren zog, erblickte er zwei Hähne, die miteinander kämpften. Ihr Anblick erregte seine Aufmerksamkeit. Er ließ seine Truppen haltmachen und sagte zu den Soldaten: ›Seht, die Hähne dort nehmen Anstrengung und Schmerzen nicht für ihre Heimat auf sich, nicht für die heimischen Götter, nicht für die Gräber der Eltern, auch nicht für Ruhm, Freiheit oder für ihre Kinder, nein, jeder der beiden kämpft nur dafür, dass er nicht unterliegt und dem anderen weichen muss.‹ Mit diesen Worten stärkte er den Kampfgeist der Athener, und das Symbol, das ihnen damals Ansporn zur Tapferkeit gewesen war, wollte er als Mahnung zu ähnlichen Taten bewahren.« Übersetzung H. Helms. 205 Vgl. Lukian. Anacharsis 37, und zu den steinernen Hinterlassenschaften des Dionysostheaters H. Hoffmann, Hahnenkampf in Athen. Zur Ikonologie einer attischen Bildformel, in: Revue Archeologique 2 (1974), 195-220, bes. 195-200; C. Boetticher, Ergänzungen zu den letzten Untersuchungen auf der Akropolis zu Athen. Der antike Festkalender auf der Akropolis zu Athen, in: Philologus 22 (1865), 386-436, 397-399: J’. 0/3%)$%7.. !„GÒKERWJ. [11]-[14]. IV. Agonales fest der hahnenkämpfe im theater des Dionysos. Plinius weiß von einem alljährlichen Hahnenkampf in Pergamon zu berichten: »Pergami omnibus annis spectaculum gallorum publice editur ceu gladiatorum«, Plin. nat. 10, 25. 206 Vgl. Ail. var. 2, 28. Die Funktion der Hahnenkämpfe als Vorbild für Tapferkeit und Mut blieb lange ein wichtiges Anliegen der Veranstalter und Verfechter des Hahnenkampfes. Für O. Danaë, Combats de Coqs. Histoire et Actualité de l’Oiseau Guerrier, Paris 1989, dessen Monographie mit einem Vorwort des »Président de la Féderation des Coqueleux de la Région Nord de la France« E. Trinez beginnt, steht die Bedeutung von Hahnenkämpfen außer Zweifel: »Et pourtant aussi l’identification des hommes aux coqs est surabondamment présente dans notre mémoire collective«, 242. Der begeisterte Hahnenzüchter und -kämpfeliebhaber H. Atkinson, CockFighting and Game Fowl, Bath 1939, 152, macht das Verbot der Hahnenkämpfe für die Verweichlichung der englischen Jugend verantwortlich: »Are the youth of the country more virile and more fit to defend England in her dire need? The crowds that fill the music-halls, picture palaces, and attend the football matches, are these more virile, healthy, and better citizens than their grandfathers who attended the cock-pits and prize-ring?« 207 Aischines wirft Timarchos vor, seine Tage beim Spiel zu verbringen, 1, 53: OÙDÒ BELTIÒNWN DIATRIBîN ¼YATO, ¢LL¦ DIHμšREUEN ™N Tù KUBE…J Oá ¹ THL…A T…QETAI KAˆ TOÝJ ¢LEKTRUÒNAJ SUμB£LLOUSIN KAˆ KUBEÚOUSIN: Übersetzt von G. Benseler: »er ist nicht etwa in sich gegangen und hat sich an bessere Beschäftigungen gemacht, sondern er verlebte seine Tage im Spielhause, wo die Telia steht und man die Hähne aufeinander loslässt und würfelt.«
132
Der Agon als Wettkampf um Ehre
an.208 Das Risiko, dabei viel Geld zu gewinnen oder zu verlieren, erhöhte sicherlich die Attraktivität des Schauspiels – noch die Römer warnten vor dem unrentablen Wetteifer bei solchen Kämpfen, der schon manchen ruiniert hätte.209 Offensichtlich fand die Kombination von blutigem tierischen Spektakel und gespannter Erwartung des Wettausgangs sowie die angelegentlich geführten Gespräche über Merkmale und Zucht der Hähne und über ihr Kampfverhalten eine große Anhängerschaft unter den Griechen. Nicht wenige von ihnen zogen Hähne oder Wachteln nach allerlei Regeln der Kunst auf. Zu diesen gehörten die Auswahl der kampfbereitesten Tiere, ihre richtige Ernährung, das regelmäßige Training und ihre eigentliche Vorbereitung für den Kampf, den sie mit Metallsporen auszufechten hatten.210 Viele antike Autoren erwähnen Einzelheiten des Umgangs mit den Hähnen oder ihre körperlichen Merkmale, indem sie auf die den Hähnen zugeschriebenen Eigenschaften anspielen. So galten die aufgestellten Federn, der rote Kamm und das Krähen der Hähne als Zeichen von Kampfkraft und Potenz,211 das Anlegen von Sporen bedeutete die Rüstung zum Kampf: ›AÍRE PLÁKTRON, E„ μ£CEI‹,212 und das Füttern mit Knoblauch verstärkte die Aggressivität.213 Die Popularität von Kampfhähnen verbürgt Platon, der die intensive Beschäftigung mit den Hähnen mit einer gewissen Distanz beschreibt: ”%STI TO…NUN PAR' ¹μ‹N μ©LLON TÕ TOIOàTON KATANOE‹N DI¦ TÕ T¦J PAI208 Von ihrer Beliebtheit zeugen auch die bildlichen Darstellungen kämpfender Hähne auf Vasen und anderen Gebrauchsgegenständen, vgl. P. Bruneau, Le motif des coqs affrontés dans l’imagerie antique, in: BCH 89 (1965), 90-121 und B. Fellmann, Hahnenkampf, in: K. Vierneisel und B. Kaeser (Hg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Ausstellungskatalog Antikensammlung München, München 1990, 108-110. 209 Colum. 8, 2, 5, spricht von »illo studio Graecorum, qui ferocissimum quemque alitem certaminibus et pugnae praeparabant. nos enim censemus instituere vectigal industrii patris familiae, non rixiosarum avium lanistae, cuius plerumque totum patrimonium, pignus aleae, victor gallinaceus pyctes abstulit.« Jener »Ehrgeiz der Griechen, die die jeweils schärfsten Heißsporne für Konkurrenzen im Hahnenkampf ausbildeten. Denn uns kommt es auf den Ertrag des fleißigen Gutsbesitzers an, nicht auf den des Abrichters von Streitvögeln, dessen ganzes Vermögen, leichtfertig aufs Spiel gesetzt, oft ein einziger siegreicher Kampfhahn zerrinnen lässt.« 210 Die zeitraubende Pflege wird in den antiken Quellen kaum erwähnt, ist aber generell Voraussetzung für die Zucht von Kampfhähnen, vgl. die Anleitungen des begeisterten Züchters G.R. Scott: The History of Cockfighting, Hampshire 1975, 20-48. 211 Aristoph. Av. 1364-1366; Aristot. hist. an. 631 b 9-12; Ail. nat. 9, 26. 212 Aristoph. Av. 759: »Nimm den Sporn auf, wenn du kämpfst.« Vgl. Suda, s.v. PLÁKTRON, die Herleitung dieser gebräuchlichen Redewendung von den kämpfenden Hähnen: ÓPER PERIET…QESAN TO‹J ¢LEKTRUÒSI CALKOàN ™N Tù μ£CESQAI. KAˆ PAROIμ…A: AÍRE PLÁKTRON ¢μUNT»RION: K¢KE‹NOI G¦R œCOUSI PLÁKTRA, OŒJ μ£CONTAI. »Diesen ehernen [Sporn] legten sie den Hähnen zum Kämpfen um. Und es gibt das Sprichwort: Nimm den Sporn zur Abwehr auf. Jene, die Kämpfenden, haben nämlich Sporen.« 213 Aristoph. Equ. 494; Aristoph. Ach. 165; Xen. symp. 9.
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
133
DI¦J AÙTÒQI μEIZÒNWJ TIN¦J PA…ZEIN À DE‹: TRšFOUSI G¦R D¾ PAR' ¹μ‹N OÙ μÒNON PA‹DEJ ¢LL¦ KAˆ PRESBÚTERO… TINEJ ÑRN…QWN QRšμμATA, ™Pˆ T¦J μ£CAJ T¦J PRÕJ ¥LLHLA. '!SKOàNTAJ T¦ TOIAàTA TîN QHR…WN POLLOà D¾ DšOUSIN ¹GE‹SQAI TOÝJ PÒNOUJ AÙTO‹J EÍNAI TOÝJ PRÕJ ¥LLHLA μETR…OUJ, ™N OŒJ AÙT¦ ¢NAKINOàSI GUμN£ZONTEJ: PRÕJ G¦R TOÚTOIJ LABÒNTEJ ØPÕ μ£LHJ ›KASTOJ, ... POREÚONTAI PERIPATOàNTEJ STAD…OUJ PAμPÒLLOUJ ›NEKA TÁJ EÙEX…AJ OÜTI TÁJ TîN AØTîN SWμ£TWN, ¢LL¦ TÁJ TOÚTWN TîN QREμμ£TWN.214 Selbst Alkibiades soll seinen gefiederten Freund auf der Agora ausgeführt haben.215 Die geographischen Wurzeln der Leidenschaft für Hähne und Hahnenkämpfe liegen wohl in Persien, eine Annahme, die bereits den Athenern geläufig war.216 Nach den Perserkriegen galt die Zucht von Kampfhähnen als aristokratischer Luxus, die neue Sitte verbreitete sich allerdings schnell und verlor bald ihre Exklusivität. Vor diesem Hintergrund und wegen ihrer zeitaufwändigen und kostspieligen Aufzucht entwickelten sich Hähne zu Statussymbolen ihrer Besitzer.217 Neben der Zugehörigkeit zu bestimmten Rassen – die tanagrische und rhodische galten als die edelsten, weil kampflustigsten218 -, waren eine stattliche Erscheinung und der unbedingte Siegeswille von besonderer Bedeutung für den Wert eines Vogels. Auch wegen des sozialen Hintergrundes der Okkupation aristokratischer Privilegien durch breitere Bürgerschichten galten Hähne als Tiere, die einen Anteil an den begehrten Gütern der Gesellschaft, so etwa der Ehre, versprachen. Sie fungierten als lebendige Verkörperung der Eigenschaften, die in 214 Plat. leg. 789b-c: »Nun gut. Bei uns lässt sich so etwas leichter begreifen, weil da manche Leute ihre Spielereien weiter treiben, als sich gehört. Bei uns ziehen nämlich nicht bloß Kinder, sondern auch manche älteren Leute junge Vögel für den Kampf gegeneinander auf. Dabei sind sie weit entfernt zu glauben, dass zum Training solcher Tiere die Anstrengungen des gegenseitigen Kampfes ausreichen, in denen sie sie zur Übung aufeinanderhetzen; denn darüber hinaus nimmt sie ein jeder unter den Arm ..., und so gehen sie sehr viele Stadien spazieren zur Kräftigung nicht ihrer eigenen Körper, sondern der dieser Tiere«. 215 Plut. Alkibiades 10. Es ist allerdings eine Wachtel (ÔRTUX), die Alkibiades unter dem Mantel trägt. Diese schätzt er so, dass er Antiochos, der die davonfliegende einfängt, zu seinem besten Freund macht: LABE‹N D' AÙTÕN '!NT…OCON TÕN KUBERN»THN KAˆ ¢PODOàNAI: DIÕ PROSFILšSTATON Tù '!LKIBI£DV GENšSQAI. »gefangen habe ihn [den Vogel, C.B.] der spätere Steuermann Antiochos und zurückgebracht, wodurch er sich dem Alkibiades zum liebsten Freunde gemacht habe.« 216 Aristoph. Av. 483-485: AÙT…KA D' Øμ‹N PRîT' ™PIDE…XW TÕN ¢LEKTRUÒN', æJ ™TUR£NNEI ÃRCš TE 0ERSîN P£NTWN PRÒTEROJ $ARE…OU KAˆ -EGAB£ZOU, éSTE KALE‹TAI PERSIKÕJ ÔRNIJ ¢PÕ TÁJ ¢RCÁJ œT' ™KE…NHJ. »So war, zum Exempel, vorzeiten der Hahn souveräner Regent und Gebieter im persischen Reich, vor den Fürsten lang, vor Dareios und Megabyzos, drum heißt er denn auch, weil er einst dort gebot, der persische Vogel noch heute.« (Übersetzung L. Seeger) Vgl. Hoffmann, Hahnenkampf, 210. 216-217. 217 Plat. Hipp. mai. 295 d; Plat. Lys. 211 e; Ail. var. 8, 4. 218 Plin. nat. 10, 24; Colum. 8, 2, 4; Paus. 9, 22, 4; Suda, s.v. 4ANAGRA‹OI ¢LEKTOR…SKOI.
134
Der Agon als Wettkampf um Ehre
der Gesellschaft am meisten geschätzt wurden. Die von den Athenern gesehene und gesuchte Verbindung zwischen einem Ehrenmann und einem Hahn stellte sich durch Ähnlichkeiten her, die sich vor allem auf der Ebene des öffentlichkeitswirksamen ehrenhaften Gebarens zeigten. Schon die gewöhnliche Körperhaltung eines Hahnes gleicht der Beobachtung der Zeitgenossen zufolge der eines Atheners, der im Bewusstsein seiner überlegenen Ehre einherschreitet.219 Ein solches ehrenhaftes Auftreten in der Öffentlichkeit wird nach Ansicht der Athener bei Hähnen ebenso wie bei Männern von einem exhibitionistischen Zug begleitet. Die unmittelbare Identifikation der athenischen Bürger mit den Hähnen erfolgte über ihre Geschlechtsidentität. Hähne wurden als (fliegende) Phalloi abgebildet, begehrten Knaben zum Geschenk gemacht und als Urbild von Männlichkeit beschworen.220 Ein Teil der Forschung interpretiert die Kampfhähne der Athener deshalb als eine symbolische Inkarnation des Bürgerhopliten, die die Kerntugenden jedes männlichen Bürgers inszeniert.221 In den Hahnenkämpfen wird allerdings auch der gegenteilige, dazu komplementäre Status zum Ausdruck gebracht: Den jeweils unterlegenen Tier wird die weibliche Rolle zugeschrieben, die in jeder Hinsicht die Negation der männlichen ist. Die Beziehung zwischen Sieger und Besiegtem wird von den Athenern häufig mit jener zwischen Mann und Frau verglichen, wobei der sexuelle Aspekt des Kampfes um die Ehre in den Vordergrund rückt. Das asymmetrische Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern, so machen die Hähne deutlich, beruht auf der Überlegenheit an Ehre des einen, demgegenüber das andere nur einen Mangel an Ehre, was bedeutet: an Mut, Kraft, Potenz, Schönheit und Tapferkeit aufzuweisen hat. Wie leicht sich damit die Rollen beider Geschlechter und ihre in jeder Hinsicht bestehende Ungleichheit erklären lassen, zeigt der immer wieder angenommene und offenbar auch tatsächlich beobachtete Fall der Umkehrung geschlechtsspezifischen Verhaltens.
219 Ail. nat. 7, 7; Aristoph. Av. 486f: DI¦ TAàT' ¥R' œCWN KAˆ NàN, éSPER BASILEÝJ Ð μšGAJ, DIAB£SKEI ™Pˆ TÁJ KEFALÁJ T¾N KURBAS…AN TîN ÑRN…QWN μÒNOJ ÑRQ»N. »Drum stolziert er auch noch auf den heutigen Tag mit der aufrecht spitzen Tiara auf dem Kopf umher, wie der große Schah, er allein von sämtlichen Vögeln.« 220 Aristot. hist. an. 558 b 21; zur Abbildung der Vögel als Phalloi vgl. Hoffmann, Hahnenkampf, 206-209 und O. Taplin, Phallology, Phylakes, Iconography and Aristophanes, in: PCPhS 33 (1987), 92-104, bes. 92-96. Zu den geschenkten Hähnen vgl. G. Koch-Harnack, Knabenliebe und Tiergeschenke. Ihre Bedeutung im päderastischen Erziehungssystem Athens, Berlin 1983, 99: 221 Vgl. Csapo, Ambivalence,15: »the cock has all the essential characteristics of a ›real man‹ in ancient Greek society. An ideal hoplite and an assiduous lover, the cock excels at both poles of the masculine domain.« Ähnlich spricht J. Dumont, Les combats de coq furent-ils un sport?, in: Pallas 34 (1988), 33-44, von »certains traits qui ne peuvent qu’attirer la sympathie du guerriercitoyen«, 36.
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
135
Dabei gibt es zwei Varianten dieses Phänomens. Die erste tritt mit dem Tod eines Partners auf und besteht in der Erfordernis an den oder die Hinterbliebene, künftig bei der Aufzucht der Jungen beider Rollen zu übernehmen.222 Die zweite, kulturell bedeutsame Variante ergibt sich aus dem Sieg eines Weibchens über ein Männchen im Kampf. Ein solches Ereignis stellt die natürliche Ordnung auf den Kopf und erzeugt so symbolisch eine Umkehrung der Rollen, die jedoch im Gegensatz zum ersteren Fall nicht für die Zukunft gilt, sondern sich auf die Ebene der Gesten und Zeichen beschränkt. Aristoteles berichtet vom Gebaren der Henne nach einem Sieg: A† TE G¦R ¢LEKTOR…DEJ ÓTAN NIK»SWSI TOÝJ ¥RRENAJ, KOKKÚZOUS… TE μIμOÚμENAI TOÝJ ¥RRENAJ KAˆ ÑCEÚEIN ™PIXEIROàSI, KAˆ TÒ TE K£LLAION ™XA…RETAI AÙTA‹J KAˆ TÕ ÑRROPÚGION, éSTE μ¾ vD…WJ ¨N ™PIGNîNAI ÓTI Q»LEIA… E„SIN: ™N…AIJ DÒ KAˆ PLÁKTR£ TINA μIKR¦ ™PANšSTH.223 Keines Tieres Status wird wirklich verändert, es kommt nur zu Andeutungen von Veränderungen, die allerdings die strukturellen Verhältnisse, d. h. die Ordnung der Gesellschaft durch die Ehre, nicht betreffen.224 Die mentalen Voraussetzungen für einen solch abstrakten Vorgang schließen die Vögel als Akteure wohl aus; wieder einmal reden die Griechen über sich selbst. Die Hähne veranschaulichen in ihren Kämpfen für die Athener die legitimen geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen innerhalb der Gesellschaft. Die Überlegenheit der Hähne wie der Männer beruht auf ihrer überlegenen Ehre, die sich in agonalen Situationen, wie dem Kampf mit Art- bzw. Statusgenossen beweisen muss. Da die Möglichkeit des Versagens bei jedem dieser Kämpfe besteht, bleibt auch die grundlegende geschlechtsgebundene Ehre für die athenischen Männer immer ein gefährdetes Gut, auf dessen Besitz beständig neu Anspruch erhoben werden muss.225 Die habituelle Form des agonalen Verhaltens wird bei den Hahnenkämpfen naturgemäß am deutlichsten veranschaulicht. Die enge Verbindung 222 Aristot. hist. an. 631 b 13ff.; Plin. nat. 10, 155: »narrantur et mortua gallina mariti earum visi succedentes in vicem et reliqua fetae more facientes abstinentesque se cantu.« Übersetzt von R. König: »Es wird auch berichtet, man habe erlebt, wie nach dem Tod einer Henne sich die Hähne gegenseitig ablösten, sich auch im übrigen wie eine Glucke verhielten und sogar das Krähen unterließen.« Vgl. Ail. nat. 4, 29. 223 Aristot. hist. an. 631 b 9-12: »Wenn z. B. eine Henne über einen Hahn gesiegt hat, versucht sie zu krähen, ahmt das Männchen nach und will auch decken. Dabei hebt sich ihnen Kamm und Steiß, so dass sie nicht mehr leicht als Hennen zu erkennen sind. Bei manchen haben sich sogar schon kleine Sporen entwickelt.« Übersetzung von P. Gohlke. Vgl. Ail. nat. 5, 5. 224 Vgl. Geertz, Play, 443. 225 Csapo, Ambivalence, 26f: Die Hahnenkämpfe verdeutlichen »the ambivalent and contradictory status of the Athenian youth, who stands in a state of transition from a subordinate to a superordinate status ... this complex symbol has the power both to aggravate and to mediate an adolescent’s anxieties about his virility as he was about to enter the community of men.«
136
Der Agon als Wettkampf um Ehre
zwischen den Hähnen und der habituellen Form des agonalen Verhaltens ist evident, sie wird unter anderem auf den panathenäischen Preisamphoren verbildlicht, auf denen kämpfende Hähne dargestellt sind.226 Der ehrenhafte Agon zeigt sich hier von seiner aggressivsten Seite. Denn der Wettstreit, den die Hähne ausfechten, ist kein reines Schauspiel, sondern sein besonderer Reiz liegt in dem vielleicht tödlichen Ausgang für eines der beiden Tiere. Selbst wenn der physische Tod nicht eintritt, so erleidet der Besiegte doch den sozialen, der in der totalen Unterwerfung besteht. Die immer wieder aufgestellte, obwohl offensichtlich falsche Behauptung, Hähne würden eher sterben als sich geschlagen geben bzw. ein Hahnenkampf müsse notwendig mit dem Tod eines der beiden Hähne enden, verweist auf die Wichtigkeit dieser Aussage für die Männer.227 Ebenso wie der Kampf für die Hähne kein Spiel ist, sondern ihre momentane Realität ausmacht, so ist die Auseinandersetzung um die Ehre für die athenischen Männer immer auch ein spielerischer Agon und zugleich ein Kampf um die soziale Existenz.228 Der Agon dient nicht nur der Integration der ehrenhaften athenischen Gesellschaft, sondern weist auch destruktive Elemente auf, deren dysfunktionale Wirkung sich besonders im Rahmen der egalitären demokratischen Polisgesellschaft zeigt. Auch die konfliktträchtigen Aspekte des Agons werden von den Athenern anhand des Verhaltens der Hähne reflektiert. In den Quellen erscheint die Aggressivität, die die Tiere an den Tag legen, ambivalent: Einerseits bewegt sie die Tiere zum Kämpfen und ist unumgänglich für das Schauspiel des Agons, andererseits kann sie sich auch von ihrer destruktiven Seite zeigen. Das geschieht, wenn die Hähne nicht in einem abgezirkelten Raum nach bestimmten Regeln aufeinander losgehen, sondern einen alltäglichen Kleinkrieg um die Ehre und die Weibchen führen, wie Hähne es sprichwörtlich häufig tun.229 In diesen Fällen offenbaren sich die kleinen und großen Störungen für die Gesellschaft, die ein solches forciert ehrsüchtiges und aggressives Verhalten zur Folge haben. Eine eindeutige Warnung findet sich in den Eumeniden des Aischylos, wo das gewöhnliche Verhalten der Hähne als abschreckendes Beispiel für einen Bruderkrieg fungiert. Athena wendet sich an die Erinyen: SÝ D' ™N 226 Nach P.D. Valavanis, Säulen, Hähne, Niken und Archonten auf panathenäischen Preisamphoren, in: AA 1987, 467-480, handelt es sich bei den aufgemalten Hahnendarstellungen um das bis zum Ende des 5. Jahrhunderts übliche Dekor. 227 Plin. nat. 10, 47. Vgl. Csapo, Ambivalence, 10f. 228 Vgl. Huizinga, Homo, 90-105, 90: »Seitdem es Wörter für Kämpfen und Spielen gibt, hat man das Kämpfen gern ein Spielen genannt. ... Manchmal scheinen die beiden Begriffe tatsächlich ineinanderzufließen. Jeder an beschränkende Regeln gebundene Kampf trägt schon durch diese geregelte Ordnung die wesentlichen Merkmale des Spiels an sich.« Voraussetzung für ein solches Spiel ist u. a. die Anerkennung der Gleichwertigkeit des Gegners, ebd., 91. 229 Aisop. 21; Aristoph. Av. 1368; Colum. 8, 2, 11.
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
137
TÒPASI TO‹J ™μO‹SI μ¾ B£LHJ μ»Q' AƒμATHR¦J QHG£NAJ, SPL£GCNWN BL£BAJ NšWN, ¢O…NOIJ ™μμANE‹J QUμèμASIN, μ»T' ™XELOàS' æJ KARD…AN ¢LEKTÒRWN ™N TO‹J ™μO‹J ¢STO‹SIN ƒDRÚSVJ, ”!RH ™μFÚLIÒN TE KAˆ PRÕJ ¢LL»LOUJ QRASÚN. ™NOIK…OU D' ÔRNIQOJ OÙ LšGW μ£CHN.230 Aischylos dienen die Hähne zur anschaulichen Belehrung über die Gefahren einer ausufernden Streitlust: Sie kann die sozialen Bande kappen und eine Gesellschaft ohne inneren Zusammenhalt hinterlassen. Hier klingt die der Ehre inhärente, sozial desintegrierende Gefahr der Hybris leitmotivisch an. Es ist besonders die fragile soziale Balance zwischen dem übersteigerten Ehranspruch der einzelnen Athener und einer notwendig friedlichen Koexistenz in der Polis, die in den Hahnenkämpfen und in den Aussagen der Griechen über sie zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite werden die Hähne als gleichwertige Gegner beschrieben, die gleich gut bewehrt nach festgelegtem Reglement kämpfen.231 Auf der anderen Seite bestimmt der Ausgang des Kampfes die Rangordnung unter den beiden Kombattanten. Der besiegte Hahn, der eben nicht bis zu seinem Tode kämpft, sondern zuvor kapituliert, erweist dem siegenden Hahn alle Referenzen seiner Unterlegenheit. Nach der bis zum äußersten zugespitzten Konfliktsituation ist nur der absolute Sieg oder die völlige Unterwerfung möglich. Das Verhältnis der beiden Hähne nach dem Kampf wird verglichen mit dem zwischen Herrn und Sklaven, wobei beide ihren durch Kampf erworbenen, nun unterschiedenen Status übertrieben deutlich zur Schau stellen.232 Bei einem Hahnenkampf steht zwar für die Athener nur symbolisch etwas auf dem Spiel, aber in einer durch Ehre strukturierten Gesellschaft ist die Wertschätzung abstrakter Güter sehr hoch. Die Bedeutung des Geschehens, das nur für die Hähne wirklich real zu sein scheint, sollte deshalb nicht unterschätzt werden. Da es sich um einen Streit um die Ehre handelt, bei der einer an Ehre gewinnt, was der andere verliert, werden Gewinne und Verluste auf den klassischen Feldern der Ehre verbucht. Der Unterlegene wird zum Ungleichen, er hat sich als zu wenig agonal und potent erwiesen, 230 Aischyl. Eum. 858-866: »Drum wirf in meines Lands Gebiete nicht hinein blutigen Streits Wetzsteine, schädgend das Gemüt der Jugend, dass sie, weinlos trunken, rast in Wut, noch mach, aufreizend ihnen, Hähnen gleich, das Herz, bei meinen Bürgern heimisch hier den Gott des Streits, der Brüder eines Stammes aufeinanderhetzt! Vorm Tore nur soll Krieg sein, der unschwer entbrennt; dort such ihr Feld sich hehren Ruhms gewaltge Gier! Doch gleichen Hofs Geflügel sei der Kampf verwehrt!« Übersetzung O. Werner. P. Spahn, Oikos und Polis. Beobachtungen zum Prozess der Polisbildung bei Hesiod, Solon und Aischylos, in: HZ 231 (1980), 529-564, erweitert das Bild von der Oikos- auf die Poliseinheit, 556f. 231 Danaë, Combats, 238-241, überträgt die Statusgleichheit auch auf die Zuschauer: »dans tous ces pays, les amateurs se recrutent dans toutes les couches de la population, paysans ou citadin, riches ou pauvres.«, 238. 232 Aristoph. Av. 68-73; Aristoph. Vesp. 1490; Aristot. hist. an. 614 a 2ff.
138
Der Agon als Wettkampf um Ehre
um eine Gleichheit an Ehre und Behandlung beanspruchen zu können. Auch Ariston muss erfahren, dass seine Ehre wie die eines besiegten Hahnes für den Moment darnieder liegt, da er sich als zu wenig agonal erwiesen hat. Konon und seine Freunde jedenfalls sehen ihn in dieser Rolle und machen ihn hämisch darauf aufmerksam.233 Nach Aussage der Griechen besteht das Faszinosum der Hahnenkämpfe gerade darin, den Streit um Ehre allegorisch zu inszenieren.234 Ihre eigenen sozialen Mechanismen und gesellschaftlichen Alltäglichkeiten spielen sich hier vor aller Augen ab. Ungleich anderen sozialen Situationen, in denen um Ehre gestritten wird, befinden sich hier alle Hahnenkämpfer in der Rolle der Beobachter, die weder zu gewinnen noch zu verlieren haben. Einige Quellen stellen das Geschehen eines Hahnenkampfes dar, als wüßten die Hähne um ihre Rolle als Agenten und Vermittler von ehrenhaften Auseinandersetzungen. Zu gut verkörpern sie in ihren Reaktionen auf einen Sieg bzw. eine Niederlage das Bild des Atheners, der an Ehre gewonnen bzw. verloren hat.235 Wie bei den Männern äußert sich dann der Anspruch auf Ehre oder die Erfahrung der Ehrkränkung in einer demonstrativen gestischen Reaktion, die sich dem Zuschauer sofort vermittelt. Ganz offen identifizieren sich die Griechen mit den Hähnen, erklären, dass diese um Ehre kämpften, wie sie auch, und thematisieren dabei Mechanismen des sozialen Lebens, die sonst niemals zur Sprache gebracht werden. Gerade in dieser Ambivalenz zwischen Spiel und Ernst liegt der Reiz der Hahnenkämpfe.236 Die Tiere werden als Statussymbole bestaunt und dienen der spielerischen Zerstreuung, sie bieten Gelegenheit zu Wetten und Männergesprächen. Darüber hinaus halten sie den Athenern einen Spiegel vor, indem sie ihren täglich erfahrbaren Kampf um Ehre auf der allegorischen Ebene inszenieren. Die athenischen Beobachter der kämpfen233 Demosth. 54, 9. Vgl. Kap. VI. 1. 234 Neben Parabeln und pädagogischer Vorbildfunktion sehen die Griechen die Tier- bzw. Vogelwelt auch als mögliche Umkehrung und Reflexion der eigenen Normen, vgl. Aristoph. Av. 753-756: ›E„ μET' ÑRN…QWN TIJ ØμîN, ð QEATA…, BOÚLETAI DIAPLšKEIN ZîN ¹DšWJ TÕ LOIPÒN, æJ ¹μ©J ‡TW. ÓSA G¦R ™NQ£D' ™STˆN A„SCR¦ Tù NÒμJ KRATOÚμENA, TAàTA P£NT' ™STˆN PAR' ¹μ‹N TO‹SIN ÔRNISIN KAL£.‹ »Hat von euch Zuschauern etwa einer Lust, sein Leben froh mit den Vögeln hinzuspinnen? – Macht euch auf und kommt zu uns! Dann was hierzulande schändlich und verpönt ist durchs Gesetz, das ist unter uns, den Vögeln, alles löblich und erlaubt.« 235 Ail. nat. 4, 29; Aristoph. Av. 68-70. 236 So Geertz, Play, 440, der erklärt, wie es funktioniert: »You activate village and kingroup rivalries and hostilities, but in ›play‹ form, coming dangerously and entrancingly close to the expression of open and direct interpersonal and intergroup aggression (something which, again, almost never happens in the normal course of ordinary life), but not quite, because, after all, it is ›only a cockfight‹.« Huizinga, Homo, 16, verweist auf ein grundlegendes Merkmal des Spiels: »Der Gegensatz Spiel-Ernst bleibt stets schwebend. ... Das Spiel schlägt in Ernst um und der Ernst in Spiel. Es kann sich auf Höhen der Schönheit und Heiligkeit erheben, wo es den Ernst weit unter sich lässt.«
Hahnenkämpfe im Dionysostheater
139
den Hähne erkennen sich selbst in ihnen wieder, sie haben mit den Hahnenkämpfen eine Darstellung ihrer eigenen sozialen Bedingungen geschaffen. In spielerischer Weise wird dargestellt und kommunizierbar gemacht, was die Gesellschaft im innersten zusammenhält. Noch Augustinus reflektiert diesen Nexus ganz selbstverständlich, nachdem er einem zufällig auf seinem Wege stattfindenden Hahnenkampf gebannt zugesehen hat: »Multa quaerebamus. ... cur deinde nos ipsa pugnae facies aliquantum et praeter altiorem istam considerationem duceret in voluptatem spectaculi. Quid in nobis esset quod a sensibus remota multa quaereret. Quid rursum quod ipsorum sensuum invitatione caperetur.«237 Die Austragung der Hahnenkämpfe im öffentlichen Raum bietet den Athenern die Gelegenheit der Infragestellung und Ironisierung der Normen der Ehre und der Art, in der sie von einigen Männern erfüllt werden. Denn es sind die Hähne, die in ihren Gesprächen die Hauptrollen spielen, Ähnlichkeiten mit Alkibiades oder anderen Athenern sind rein zufällig. So zieht etwa der übertrieben demonstrativ zur Schau gestellte Anspruch auf Ehre bei den Hähnen offenen Spott auf sich. Einerseits handelt es sich schließlich nur um ordinäre Vögel, die sich für ungemein wichtig halten, so dass noch Seneca lakonisch feststellt: »gallum in suo sterquilino plurimum posse«.238 Andererseits kann ein betont narzisstisches und grandioses Gebaren, das den Anspruch eines Mannes auf Ehre deutlich macht, oftmals als bloße Angeberei entlarvt werden. &AINÒμEQ£ μOI ¢LEKTRUÒNOJ ¢GENNOàJ D…KHN PRˆN NENIKHKšNAI ¢POPHD»SANTEJ ¢PÕ TOà LÒGOU °DEIN.239 Auf der Ebene des Diskurses über die Hähne werden die Eigentümlichkeiten ehrenhaften Verhaltens sprachlich fassbar und kritisierbar. Da sich die Griechen der symbolischen Inszenierung ihrer eigenen sozialen Welt bewusst sind, können gesellschaftliche Normen durch das Medium der kämpfenden Hähne vermittelt werden. Die Aussagen der Griechen darüber, was Hähne darstellen oder was sie tun sollten, zielen immer auch auf ihre männlichen Mitstreiter um Ehre. So bieten die Hahnenkämpfe nicht nur eine Illustration der menschlichen Auseinandersetzungen, sondern liefern auch den Stoff für Gespräche, die sich weniger um Hähne, als viel237 Aug. de ordine, 1, 26: »Wir hatten uns vielerlei zu fragen. .... warum bietet unsereinem der Anblick eines solchen Streites neben der Veranlassung zu sehr ernsten Überlegungen auch noch den Grund eines Schauspiels? Was ist es, das in uns nach so vielem sucht, was unseren Empfindungen eigentlich fremd ist, und worin besteht andererseits der Reiz, der gerade diese Empfindungen zu fesseln vermag?« (Übersetzung: C.J. Perl). Vgl. Csapo, Ambivalence, 124. 238 Sen. apocol. 7, 3: »Ein Hahn sei eben nur auf dem eigenen Misthaufen der Größte.« Übersetzung G. Binder. Vgl. Aischyl. Ag. 1671. 239 Plat. Tht. 164 c: »Wir scheinen wie ein gewöhnlicher Hahn von der Untersuchung abzuspringen und loszukrähen, bevor wir gesiegt haben.« Übersetzung E. Martens. Babr. 5 warnt vor Imponiergehabe, das in trügerische Sicherheit wiegt, ebenso Phaedr. A 18. Protagonisten beider Parabeln sind die Hähne.
140
Der Agon als Wettkampf um Ehre
mehr um Männer drehen. Die sehr abstrakten und sprachlich kaum kommunizierbaren Normen der Ehre werden spielerisch so aufbereitet, dass sie verhandelbar werden oder zumindest transparenter und begründeter erscheinen.
Resümee: Das agonale Verhalten der Athener Das agonale Verhalten ist eine der wichtigsten habituellen Formen der Ehre. Ein athenischer Ehrenmann erweist seinen Anspruch auf Ehre in der alltäglichen Auseinandersetzung mit an Ehre Gleichen. Auch das Meistern dieser öffentlich ausgetragenen Bewährungsproben kann als die Erfüllung der agonalen Form betrachtet werden. Darüber hinaus aber mehrt die Ehre eines Mannes nichts so sehr wie ein Sieg in einem der Agone, die von den Athenern bzw. den Griechen als athletische oder musische Wettbewerbe veranstaltet werden. Die Popularität der großen agonalen Feiern bei den Griechen wurde in der Forschung besonders gewürdigt; Jakob Burckhardt initiierte eine Reihe von Beiträgen, die den Gedanken vertraten, die Kultur der Griechen sei aus »dem Geiste des Agonalen« erwachsen. »Das Agonale« fungierte dabei als die begrifflich gefasste Ursache für die Errungenschaften der griechischen, besonders der athenischen Kultur und für jene Besonderheiten, die ganz allgemein als fremd empfunden und zu Eigentümlichkeiten »des hellenischen Menschen« stilisiert werden konnten. Johan Huizinga stellte die Agone der Griechen in den größeren Rahmen seiner Theorie des Spiels, das grundsätzlich kulturschaffende Effekte hat, und sprach den Griechen gleichzeitig ihre Überlegenheit in dieser Hinsicht ab. Eine Abgrenzung des hier verwandten Begriffs des Agons ist schon wegen des durch seine Rezeption ideologisch aufgeladenen Terminus notwendig. Der Begriff des Agons ist dabei abhängig von jenem der Ehre: als habituelle Form trägt das agonal erfolgreiche Verhalten zur höheren Ehre eines Atheners bei, während auf der anderen Seite das Vorhandensein eines gewissen Maßes an Ehre für den Sieg und das ehrenhafte Auftreten in Olymia von Vorteil ist. Die in den Arenen Olympias gewonnene Ehre ist enorm. Entsprechende Ehrungen wurden den in ihre Heimatpoleis zurückkehrenden Olympioniken zuteil. Eine chronologisch angelegte Untersuchung der athenischen Olympioniken konnte belegen, dass ein besonderer Ehrenstatus zunehmend nicht die notwendige Voraussetzung, immer aber die Folge einer Bekränzung in Olympia war. Der Umgang mit der agonal erworbenen Ehre scheint abhängig zu sein von dem bisherigen Status des jeweiligen Atheners: Während Mitglieder der Oberschicht ihren Sieg in Olympia gezielt für ihre politische
Resümee: Das agonale Verhalten der Athener
141
Karriere zu nutzen suchten, lässt sich dies für die einfachen Athener nicht nachweisen. Anders als ihre aristokratischen Mitbürger blieben sie aufgrund ihrer olympischen Leistung und Ehre bei ihren Mitbürgern in Erinnerung. Das weist darauf hin, dass die Transformierbarkeit des symbolischen Kapitals in andere Privilegien der Polis grundsätzlich möglich war, von den Olympioniken aber unterschiedlich, entsprechend ihres sozialen Status’, genutzt wurde. In Olympia zeigte sich der Agon in Reinkultur. Als die bedeutendste habituelle Form basierte das agonale Verhalten auf der Gleichheit aller beteiligten Ehrenmänner und auf der strikt geschlechtsspezifisch zugewiesenen Ehre der Männer, die nahezu alle Frauen von der Beteiligung an den olympischen Agonen ausschloss. Die Ortsgebundenheit der olympischen Agone fernab der meisten Poleis verdeutlicht die durch Ehre bedingte und legitimierte Zuweisung der sozialen Räume an die Frauen sehr plastisch. Der Alpheios bildete die Grenze, die nicht überschritten werden durfte, denn jenseits des Flusses begann die Domäne der Ehrenmänner, deren Anspruch auf Ehre durch ein entsprechendes Verhalten gemäß der habituellen Formen eng mit ihrer Geschlechtsidentität verbunden war. Die männlich geprägte Öffentlichkeit Olympias bot den griechischen Aristokraten ein Forum für ihre Selbstdarstellung und die Inszenierung ihres ehrenhaften Status. Viele von ihnen zogen die hippischen Agone vor, in denen sie sich mit ihren angestammten Gegnern messen und dem Gleichheits- und Leistungsgedanken der olympischen Agone weitgehend entkommen konnten. Mit den Siegen und der Bekränzung nicht aristokratischer Athleten rückte ein neuer Aspekt der agonalen Ehre in den Vordergrund: Die durch den Agon erworbene Ehre haftete nicht an der Person dessen, der sie in einer der Wettkampfdisziplinen erworben hatte, sondern sie erwies sich als ein disponibles Gut, das in Sekunden erworben, an andere verkauft oder übertragen werden konnte. Offensichtlich trug der sehr überschaubare Prozess des Erringens von Ehre und Ehrungen in den Agonen zu einer anderen Einstellung zum sozialen Gut der Ehre bei, die in der athenischen Polisgesellschaft undenkbar wäre, weil die Ehre hier untrennbar mit bestimmten Personen verbunden war. Weil die Mechanismen der ehrenhaften Interaktion von den Athenern selten verbalisiert wurden, sind die von ihnen veranstalteten Hahnenkämpfe ein derart interessantes Phänomen. Sie weisen auf ein Bedürfnis nach Abbildung der sozialen Verhaltensmuster hin, das auf dieser Ebene der Reflektion zu funktionieren schien. In den Hähnen sahen die Athener, wie sie selbst in den Quellen sagten, sich selbst und ihr Verhalten angesichts der Konfrontation mit anderen Ehrenmännern. Die Identifikation der athenischen Ehrenmänner mit bestimmten, auf die Tiere projizierten Eigenschaften und die Zuschreibung eines agonalen, geschlechtsspezifischen und
142
Der Agon als Wettkampf um Ehre
sogar dysfunktionalen hybriden Verhaltens an die Hähne zeigt, dass die Athener diese Eigenschaften und Verhaltensweisen in ihrer eigenen Gesellschaft für verbreitet hielten und mit den Hahnenkämpfen eine Möglichkeit gefunden hatten, sich damit auseinanderzusetzen.
IV. Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
Wo Männer um ihre Ehre kämpfen, sind Frauen nicht präsent. Das gilt sowohl in sozialem als auch in physischem Sinne. Die ehrenhafte Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine strikte Trennung der sozialen Räume und Rollen von Männern und Frauen. Die Scheidung ihrer Lebensbereiche folgt der Trennungslinie von öffentlichem und privatem Leben. In Athen gehört die Polis als öffentlicher Raum den Männern, während der Oikos den Frauen vorbehalten bleibt. Bei dieser Aufteilung der sozialen Räume und Rollen handelt es sich um ein typisches Merkmal ehrenhafter Gesellschaften.1 Die Forschung streitet darum, inwiefern diese Trennung ein Fernhalten bzw. den völligen Ausschluss der athenischen Frauen vom gesellschaftlichen Leben bedeutete.2 Dass die Handlungs- und Bewegungsspielräume der griechischen Frauen bei weitem nicht an die der Männer heranreichten, steht außer Zweifel. Die durch die Ehre determinierten Geschlechterrollen können in ehrenhaften Gesellschaften als komplementär beschrieben werden: Die Männer partizipieren – sofern sie Bürger sind – an der politischen Macht und gestalten die juristischen Verfahren, sie verfolgen ihre ökonomischen Interessen und repräsentieren den Oikos nach außen, wohingegen die Frauen das Haus und die familiären Angelegenheiten verwalten und allgemein für den Fortbestand des Oikos sorgen.3 Auch in der charakterlichen Ausbildung und in
1 Bourdieu, Entwurf, 36-43; Campbell, Honour, 276-278; Gilmore, Introduction, 14: »A rigid spatial and behavioral segregation of the sexes and the consequent domestic division of labor is probably the most striking physical characteristic of Mediterranean community life.« 2 Vgl. zur Diskussion darum J. Blok, Sexual Asymmetry. A Historiographical Essay, in: dies. und P. Mason (Hg.), Sexual Asymmetry. Studies in Ancient Society, Amsterdam 1987, 1-57; C. Schnurr-Redford, Frauen im klassischen Athen. Sozialer Raum und reale Bewegungsfreiheit, Berlin 1996, passim; sowie bereits D. Cohen: Seclusion, Separation, and the Status of Women in Classical Athens, in: G&R 36 (1989), 3-15, 3: »While it is undeniable that women did not operate in public and political spheres in the way that men did, it does not necessarily follow that they did not have public, social, and economic spheres of their own.« 3 L. Dean-Jones, The Cultural Construct of the Female Body in Classical Greek Science, in: S.B. Pomeroy (Hg.), Women’s History and Ancient History, Chapel Hill/London 1991, 111-137, 112: »The sexual roles in ancient Greece were complementary; men were thought to be best suited to dealing with matters outside the home, the polis, and women with the concerns of the household, the oikos.«
144
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
der Zuschreibung von metaphysischen Qualitäten ergänzen sich Männer und Frauen in den Augen der Zeitgenossen komplementär.4 Diese so eindeutige Zuordnung der Lebensräume und ein entsprechend ausgerichteter Wirkungskreis für die Männer auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite scheint zunächst sehr unproblematisch zu sein und lässt lediglich nach den genaueren Ausgestaltungen der sozialen Räume beider Geschlechter fragen. Charakteristischerweise spiegeln die Aussagen der Quellen hier bereits den spezifischen Handlungsradius beider Geschlechter: während über die ehrenhafte soziale Interaktion der Männer in der Öffentlichkeit reichlich Quellen zur Verfügung stehen, beschränken sich die zeitgenössischen Informationen über das Verhalten der Frauen auf die wiederholten Feststellungen der ihnen zugedachten Rolle. Eine Differenzierung ergibt sich dabei zunächst aus dem unterschiedlichen Anspruch der athenischen Bürger an die zur Bürgergemeinschaft gehörenden Frauen einerseits, und die übrigen in Athen lebenden Frauen andererseits. Die strikte geschlechtsspezifische Verteilung der Rollen von Männern und Frauen ist das gesellschaftliche Ideal. Es wird die Realität vieler athenischer Bürgerfrauen geprägt haben. Ihre Aufgaben und Beschäftigungen sowie ihre Stellung innerhalb des Oikos werden im Oikonomikos des Xenophon lehrhaft beschrieben.5 Generell ermöglichte nur ein gewisser Wohlstand einer Familie die Umsetzung des Ideals einer Frau, deren Tätigkeit sich ausschließlich auf den häuslichen Bereich erstreckte und unter wirtschaftlich prosperierenden Umständen lediglich in der Aufsicht über die Sklaven und die Haushaltsführung bestand. Auf der anderen Seite bedeutete die Postulierung dieses Ideals durch einen Mann in der Öffentlichkeit nicht, dass es innerhalb der Mauern seines Oikos tatsächlich so aussah, wie er es vorgab. Es bedeutete nur, dass der Mann über das soziale Wissen darum vefügte, wie das Bild seines häuslichen Lebens ausgemalt werden musste, um öffentlichkeitswirksam kommuniziert zu werden. In der klassischen Zeit scheint sich die Separierung der Geschlechter voneinander verschärft zu haben, mit der konkreteren Ausbildung eines öffentlichen politischen Raumes ging offenbar eine energische Zurückdrängung gerade der Athenerinnen in den Oikos einher.6 4 Vgl. Bourdieu, Entwurf, 36-38; R. Just, Women in Athenian Law and Life, London/New York 1989, folgert am Schluss seines Kapitels »The Attributes of Gender«, 153-193, 193: »They were endowed with those characteristics of sensuality, irrationality, emotionality which, though recognized as always present in and even necessary to human existence, had to be restrained, controlled, and subjugated if civilized life was to be maintained.« 5 Xenophon: Oeconomicus, übers. u. komm. v. S.B. Pomeroy, Oxford 1994. 6 Vgl. das von Perikles in seiner Gefallenenrede vertretene Ideal, Thuk. 2, 45, 2: Dš μE DE‹ KAˆ GUNAIKE…AJ TI ¢RETÁJ, ÓSAI NàN ™N CHRE…v œSONTAI, μNHSQÁNAI, BRACE…v PARANšSEI ¤PAN SHμANî. TÁJ TE G¦R ØPARCOÚSHJ FÚSEWJ μ¾ CE…ROSI GENšSQAI Øμ‹N μEG£LH ¹ DÒXA KAˆ ÂJ ¨N ™P' ™L£CISTON ¢RETÁJ PšRI À YÒGOU ™N TO‹J ¥RSESI KLšOJ Ï. »Soll ich
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
145
Neben der Gruppe der athenischen Bürgerfrauen lebte eine nicht geringe Anzahl von Frauen in Athen, deren Alltag sich entschieden anders gestaltete, weil sie aus verschiedenen Gründen dem Idealbild der häuslichen Ehefrau eines athenischen Bürgers nicht entsprachen. Die größte Gruppe bildeten Frauen, die nicht als Bürgerin geboren waren und den Bürgerstatus deshalb nicht an ihre Nachkommen weitergeben konnten. Obwohl es keine gesetzliche Anerkennung des Bürgerrechts für Frauen gab, bildete die Abstammung einer Athenerin doch das grundlegende Kriterium für ihren Status innerhalb der Polis.7 Außerdem bestimmte sich die gesellschaftliche und personenrechtliche Position von Frauen durch die Stellung ihres jeweiligen kyrios.8 Die Untersuchung der Lebensumstände von Frauen in Athen, die weder Bürgerinnen noch Sklavinnen waren, sondern als hetairai oder pallakai von sich Reden machten, wirft ein erhellendes Licht auf die Einstellung der Athener zu Geschlecht und Familie.9 Als ergiebigste Quelle zur sozialen und rechtlichen Stellung von Frauen, die nicht athenischer Abstammung waren, erzählt die 59. pseudo-demosthenische Rede des Apollodor Gegen Neaira die Biographie zweier Frauen, Neaira und ihrer Tochter Phano, die ein wenig normgerechtes Leben geführt haben und sich unter anderem deshalb nun vor Gericht rechtfertigen müssen.10 Darüber hinaus beschränken sich die Informationen zu den Frauen Athens zumeist auf beiläufige Bemerkungen in den Quellen, gemacht aus männlicher Feder und Perspektive. Vor allem die Differenzen der verschiedenen personenrechtlichen Positionen der Frauen und die durch die athenischen Ehrenmänner vorgegebene Normerfüllung spiegeln sich in den Quellen wider. Abhängig von der Gattung der jeweiligen Quellen bzw. dem literarischen Genre, dem sie angehören, erscheinen Frauen in den unternun der Tugend der Frauen noch gedenken, die jetzt im Witwentum leben werden, so wird mit kurzem Zuspruch alles gesagt sein: für euch ist es ein großer Ruhm, unter die gegebene Natur nicht hinabzusinken, und wenn eine sich mit Tugend oder Tadel unter den Männern möglichst wenig Namen macht.« N. Demand, Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece, Baltimore 1994, 147-148; M.B. Arthur, Early Greece: The Origins of the Western Attitude toward Women, in: J. Peradotto und J.P. Sullivan (Hg.), Women in the Ancient World. The Arethusa Papers, New York 1984, 7-58, 36: »The Greek city-state gave women status as an aspect of men’s existence, rather than as existants in their own right.« 7 R. Sealey, Women in Athenian Law, in: ders., Women and Law in Classical Greece, Chapel Hill/London 1990, 12-49, 14: »The citizenship of male descendants was displayed through their membership in a phratry and in deme. Women were not members of those organizations ... Their citizenship was latent; it consisted in the capacity to bear children who would be citizens.« 8 E. Hartmann, Heirat, Hetärentum und Konkubinat im klassischen Athen, Frankfurt a.M. 2002, 123-125; Just, Women, 26-27. 9 Vgl. zur neueren Forschung Hartmann, Heirat, passim; J.N. Davidson, Kurtisanen und Meeresfrüchte. Die verzehrenden Leidenschaften im klassischen Athen, Darmstadt 1999. 10 Apollodor, Against Neaira [Demosthenes] 59, hg. u. übers. v. C. Carey, Warminster, Wiltsh. 1992.
146
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
schiedlichsten Rollen. Agieren sie im Zentrum des Geschehens, wie etwa in den athenischen Tragödien, so handelt es sich um fiktive Gestalten, die mit den realen Frauen in Athen wenig gemein haben. Bei größerem Realitätsbezug der komödiantischen oder philosophischen Texte tauchen Frauen zumeist nur als Randgestalten auf, die – sofern es sich um Bürgerfrauen handelt – total mit ihrer Rolle identifiziert werden oder aber in einem eindeutigen Dienstverhältnis zu den Männern stehen. Die Stimmlosigkeit der Frauen in der Antike erschwert eine Untersuchung vieler sie betreffender Themen erheblich. Auch die Ausweitung des Fokus auf die Geschlechterund Familiengeschichte leidet unter den einseitigen Aussagen. Fragen zum Alltag der Frauen, dem Verhältnis der Geschlechter zueinander oder den innerfamiliären Strukturen lassen sich selten zufrieden stellend beantworten. Betrachtet man die athenische Gesellschaft als eine ehrenhafte, so eröffnen sich durch diese veränderte Sicht neue Problemstellungen, deren Lösungsansätze aber wiederum leicht an die bekannten quellenbedingten Grenzen stoßen. Die Ergebnisse der Studien in unterschiedlichen ehrenhaften Gesellschaften und die Aussagen in den athenischen Quellen sprechen bezüglich der Frauen eine gemeinsame Sprache: Penelope, Aspasia und die namenlose Ehefrau des Euphiletos verbringen ihre Tage in vorwiegend weiblicher Gesellschaft, beschäftigen sich mit weiblich konnotierten Tätigkeiten wie weben, kochen oder verführen und unterscheiden sich darin wenig von ihren Geschlechtsgenossinnen in der montenegrinischen Gesellschaft der fünfziger Jahre oder eines griechischen Bergdorfes in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Beobachtung dieser Analogien aber bietet die Chancen auf eine erweiterte Fragestellung und womöglich nähere Informationen zu dem durch Ehre geprägten Leben der athenischen Frauen.11 Die Erfahrung vieler Anthropologen hat den Blick auf die Vergesellschaftungsformen von Frauen gelenkt, die sich abseits der Sphäre männlichen Einflusses entwickelt haben.12 Sofern die Quellen Aussagen in dieser Richtung zulassen, spricht alles für das Vorhandensein solcher sozialen Räume in Athen, die den Frauen vorbehalten waren. Die Vergesellschaftungsformen der athenischen Frauen werden von den alltäglichen Erfordernissen bestimmt worden sein und sich in der Bildung von Netzwerken mit 11 Vgl. N.R.E. Fisher, Violence, masculinity and the law in classical Athens, in: L. Foxhall und J. Salmon (Hg.), When Men were Men. Masculinity, power and identity in classical antiquity, London 1998, 68-97, 71. Vgl. als Gegenposition C. Sourvinou-Inwood, Männlich und weiblich, öffentlich und privat, antik und modern, in: Reeder, Pandora, 111-120, die methodische Vorbehalte äußert und auf »die gravierenden Unterschiede zwischen den ›mediterranen Gesellschaften‹ und dem Athen der klassischen Zeit« hinweist, 112. 12 Campbell, Honour, 275f.; Gilmore, Anthropology, 195-196.
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
147
weiblichen Verwandten und Nachbarn geäußert haben. Trotz der wahrscheinlich hohen Frequenz solcher sozialer Räume, die typischerweise wohl in Hinterhöfen oder um Brunnen herum lagen, sind die antiken Zeugnisse dazu eher unergiebig. Als besser dokumentiert erweisen sich Aktivitäten von Frauen, die kultischer bzw. agonaler Natur waren. Fassbar wird das Verhalten von Frauen dort, wo sie sich in der Öffentlichkeit bewegten. Das geschah bemerkenswert häufig im Zusammenhang mit agonalen Veranstaltungen. Dazu gehörten zum einen die exklusiv weiblichen kultischen Feiern, die regelmäßig zu Ehren von bestimmten Fruchtbarkeitsgöttinnen veranstaltet wurden, und zum anderen machten in Olympia Frauen von sich Reden, denen es gelang, an den Männern vorbehaltenen Agonen teilzunehmen. Über das agonale Verhalten legten die Frauen einen Anspruch auf Ehre an den Tag, der ihrer üblichen geschlechtsspezifischen Rolle wenig entsprach. Anhand der beiden Kontexte der Thesmophorien in Athen und der olympischen Agone soll das ehrenhafte Verhalten von Frauen untersucht werden. Dabei geht es wieder um die habituellen Formen, die nicht nur in der Sozialisation von Männern, sondern auch von Frauen in der athenischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielten. Ebenso wie die Athener wussten auch ihre Frauen um die normgerechte Erfüllung der Erfordernisse von Ehre. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass auch Frauen sich an den agonalen, konfliktträchtigen und elitären Verhaltensweisen orientierten, die die Ehre einer Person ausmachten. Ohne die Präsenz eines Mannes, der das Spiel um die Ehre aufgrund seines Geschlechts ohnehin schon gewonnen hatte, mögen sich auch bei den Frauen Verhaltensweisen gezeigt haben, die ihre Identifikation mit der ehrenhaften Gesellschaft zeigten.13 Sollte es in der ehrenhaften Gesellschaft Athens Möglichkeiten für die Frauen gegeben haben, sich relativ losgelöst von den normativen Erwartungen einer männlich dominierten Gesellschaft zu bewegen, so wohl am ehesten bei diesen Festlichkeiten. Da die Frauen bei ihren Festen nur in gleichgeschlechtlicher Gesellschaft sind, kann die Frage nach den ehrenhaften Verhaltensweisen von Frauen hier ganz andere Ergebnisse befördern als die üblichen, die durch ihre Komplementarität zu den Männern geprägt sind. Auch in der von Männern dominierten Öffentlichkeit der olympischen Agone verließen einige Frauen die ihnen zugedachten agonalen Reservate, wie sie etwa die Heraia darstellten, und legten ihren Ehrgeiz in die Teilnahme an den männlichen Agonen. Offensichtlich identifizierten sie sich nicht so vollkommen mit ihrer geschlechtsspezifischen Rolle, dass sie nicht 13 Gilmore, Introduction, 9: »To be sure, feminity is also competitive to a degree. Women’s status varies on the basis of fecundity and relative compliance with repressive norms; but these rivalries are often emically construed as passive or acquiescent rather than agressive.«
148
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
unter bestimmten Umständen versucht hätten, ihr zu entkommen. Charakteristischerweise handelte es sich bei den Frauen, denen es gelang, als Zuschauerin anwesend zu sein oder gar in den Agonen zu siegen, um Mitglieder besonders ehrenhafter Familien. Zwar handelt es sich bei Pherenike und Kyniska nicht um Athenerinnen, aber sie teilten mit diesen doch den Ausschluss vom heiligen Hain an jenen Tagen, die für die Männer reserviert waren. Sie sind deshalb Beispiele für Frauen, die die ihnen gesetzten Grenzen überschreiten, ebenso wie es die Athenerinnen anlässlich der Thesmophoria tun. Für Athen sind aus klassischer Zeit eine Handvoll Kulte bekannt, die sich der Verehrung der Demeter widmen und an deren Feierlichkeiten nur Frauen teilnehmen. Obwohl sicher nicht in allen Fällen geheime Kulte praktiziert wurden, überliefern doch die Quellen nur sehr spärliche Informationen. Über die durchgehend mit Fruchtbarkeitsriten assoziierten Festtage, die als Thargelia, Adonia, Haloa oder Lenaia an bestimmten Tagen des agrarischen Jahreszyklus gefeiert wurden, ist wenig bekannt. Fundamentale Fragen wie Inhalt und Bedeutung der Kulte oder die Zusammensetzung der Kultgemeinschaft müssen angesichts der Quellenlage weitgehend ungeklärt bleiben.14 Etwas besser sieht es indes für die Thesmophorien aus: diese in ganz Griechenland begangenen kultischen Feiern zu Ehren der Demeter können in groben Zügen nachvollzogen werden. Dank der Thesmophoriazusen des Aristophanes gilt auch die exklusiv weibliche Teilnehmerschaft an den Thesmophoria als gesichert.15 Die Thesmophorien fanden in Athen an drei aufeinander folgenden Tagen des Monats Pyanopsion statt. Das Fest dauerte vom 11. bis zum 13. des Monats, wobei die beiden vorangehenden Tage ebenfalls kultischen Feiern gewidmet waren.16 Jeder der drei Festtage besaß einen eigenen Charakter: am ersten Tag, dem ”!NODOJ, machten sich die Frauen auf den Weg hinauf zum Thesmophorion, wo sie behelfsmäßige Unterkünfte errichteten. In diesen Skenai verbrachten die Frauen den zweiten Tag, die .HSTE…A, mit Fasten und der Vorbereitung auf den dritten Tag. Dieser wurde Kalligeneia genannt und bildete wohl den Zielpunkt des Festes, das der Demeter ge14 Vgl. zu den Haloa L. Deubner, Attische Feste, Darmstadt 1969, 60-67; E. Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary, London 1983, 35-37; zu den Lenaia A. PickardCambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford 19882, 25-42; und allgemein zur Quellenlage Parke, Festivals, 13-25. 15 Aristoph. Thesm. 295-311. 1148-1152, ¼KETE D' EÜFRONEJ, †LAOI, PÒTNIAI, ¥LSOJ ™J ØμšTERON, ¥NDRAJ †N' OÙ QEμ…T' E„SOR©N ÔRGIA SEμN¦ QEO‹N, †NA LAμP£SI FE…NETON ¥μBROTON ÔFIN. »Naht euch freundlich und mild, ihr zwo Göttinnen, eurem geweihten Hain, wo den Männern verboten, die Orgien, die heil’gen, zu schaun, wo bei Fackellicht ein ambrosisches Schaun ihr uns gönnet.« 16 Vorgeschaltet waren die Stenia am 9. des Monats und die Thesmophoria von Halimus am 10., vgl. Deubner, Feste, 54; H.W. Parke, Festivals of the Athenians, London 1977, 88.
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
149
widmet war und die Fruchtbarkeit der Felder und der Frauen sichern sollte.17 Die Platzierung des zentralen Fruchtbarkeitsritus innerhalb dieser Agenda ist ungewiss. Die Quellen berichten vom Mythos der geraubten Kore und von Kulthandlungen der Frauen, die sich darauf beziehen sollen: Das auszubringende Saatgut wird mit den Überresten von in Spalten geworfenen Schweinen und nachgebildeten Phalloi gemischt, um so besondere Fruchtbarkeit zu entfalten.18 Die genaue Rekonstruktion des Ablaufs und der Utensilien dieser Kulthandlung sowie die Bedeutung der namengebenden QESμO… dabei sind ungeklärt. Für die Frage nach dem ehrenhaften Verhalten der Frauen in dieser exklusiv weiblichen Gesellschaft erweisen sich die Umstände des Festes als aussagekräftiger als die Zeremonie. Zwar sind für die Thesmophoria keine Agone bezeugt, der Ablauf des Festes lässt aber einige andere, für die Vorstellung von Ehre charakteristische strukturelle Merkmale erkennen. Bezogen auf die kultische Gemeinschaft ist es das Changieren zwischen Gleichheit und Ungleichheit der Frauen. Denn einerseits werden die Männer kollektiv ausgeschlossen, andererseits führt das nicht zu einer Vereinigung aller Frauen Athens anlässlich der Kulthandlungen. Der Aristophanische Chor spricht die versammelten Frauen als '!QHNîN EÙGENE‹J GUNA‹KEJ19 an. Der Schluss auf die Beschränkung der Kultteilnehmerinnen auf athenische Bürgerinnen liegt nahe und ist in der Forschung häufig gezogen worden. Es bedeutet sicher den Ausschluss von Sklavinnen, die Teilnahme von Hetären aber wird von anderen Zeugnissen in den Bereich des Möglichen gerückt.20 Auch eine rigorosere Beschränkung auf die verheirateten Frauen unter den athenischen Bürgerinnen ist denkbar.21 Die antiken Quellen erlauben hier keine abschließende Entscheidung. 17 Burkert, Religion, 369, spricht von dem »deutlichsten Beispiel von Agrarmagie in griechischer Religion«. Vgl. Parke, Festivals, 87f.: »The Greeks typically associated together all natural birth, and Demeter though chiefly goddess of the corn-crop also presided over human fertility.« 18 Hauptquelle ist ein kryptisches Schol. Luk. S. 275-276 (Rabe). 19 Ebd., 329-330. Vgl. Isaios 6, 50. 20 Bei Lukian. Dialogi Meretricii 2, 1 kann eine Hetäre von den Thesmophorien berichten: GAμE‹J D' OÙ KAL¾N PARQšNON: EÍDON G¦R AÙT¾N œNAGCOJ ™N TO‹J 1ESμOFOR…OIJ μET¦ TÁJ μHTRÒJ. Übersetzt von H. Gasse: »Aber schön ist deine Zukünftige nicht. Ich sah sie vor kurzem an den Thesmophorien mit ihrer Mutter«. W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1977, 365, folgert: »Kinder – außer Säuglingen – bleiben fern, Jungfrauen sind dabei, auch Hetären nach Einhaltung gewisser Keuschheitsfristen; Sklavinnen sind ausgeschlossen. Man kennt einander und weiß, wer dazugehört.« Vgl. zur Quellenlage A. Kledt, Die Entführung Kores. Studien zur athenisch-eleusinischen Demeterreligion, Stuttgart 2004, 115-120. 21 Vgl. Deubner, Feste, 53: »Man darf annehmen, dass die Frauen verheiratet waren: das ergibt sich schon aus dem Charakter der Kalligeneia.« Die Teilnahme von unverheirateten Frauen hält er für »ungriechisch«, ebd. »Wenn Lukian in einem Dialog, der attisches Kolorit zeigt, jemand von einer Jungfrau sagen lässt, er habe sie jüngst beim Thesmophorienfeste mit ihrer Mutter gesehen, so mag sich die Sitte in der Kaiserzeit gelockert haben.«
150
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
Sicher ist nur, dass das Geschlecht nicht als Kriterium für die Beteiligung am Kult fungierte. Ebenso wie sich die athenischen Männer in der Öffentlichkeit der Polis von den übrigen Bewohnern Athens abgrenzten, taten das offenbar auch die Frauen. Die Unterschiede zwischen den athenischen Bürgerfrauen und den übrigen weiblichen Bewohnerinnen Athens dürften deshalb gerade in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen worden sein. Das Bewusstsein der an den Thesmophorien beteiligten Frauen, zur Gruppe der Privilegierten zu gehören, schloss eine totale Infragestellung oder eine über das kultisch Erforderliche hinausgehende Umkehr der gewohnten männlich dominierten Polisordnung wohl aus.22 Selbst wenn man von der kleinsten möglichen Gruppe, den Bürgerfrauen, als ausübende des Kultes ausgeht, ist die Gleichheit unter ihnen ebenso fragil und virtuell, wie die der männlichen Bürger untereinander. Denn die Vorbereitung und Durchführung der kultischen Handlungen erforderten Führungspositionen innerhalb der Gruppe der Frauen. So nennt die Überlieferung eine Demeterpriesterin und zwei gewählte Frauen, die mit besonderen Aufgaben betraut waren: A† TE GUNA‹KEJ Aƒ TîN DHμOTîN μET¦ TAàTA PROÜKRINAN AÙT¾N μET¦ TÁJ $IOKLšOUJ GUNAIKÕJ TOà 0IQšWJ ¥RCEIN E„J T¦ 1ESμOFÒRIA KAˆ POIE‹N T¦ NOμIZÒμENA μET' ™KE…NHJ.23 Die Wahl dieser beiden Frauen scheint ähnlichen strukturellen Aspekten gefolgt zu sein wie eine entsprechende Veranstaltung bei den Männern. Auch hier spielt die für ehrenhafte Gesellschaften typische Kumulation von Statusmerkmalen eine Rolle: Es wird einige Frauen gegeben haben, die sich wegen ihres Vermögens und ihrer Ehre – bzw. jener ihrer Männer – unter den übrigen hervortaten, allen bekannt waren und über die meisten Ressourcen für die Organisation des Festes verfügten. Es kann sich dabei gut um die Ehefrauen besonders ehrenhafter athenischer Männer gehandelt haben, wie es bei der von Isaios erwähnten Ehefrau des Diokles wohl der Fall war.24 So lässt sich die soziale Ordnung der Polisgesellschaft, die wesentlich durch das Kriterium der Ehre einer Person strukturiert ist, auch in der rein weiblichen Gesellschaft der Kultteilnehmerinnen als gegeben postulieren. Das für eine ehrenhafte Gesellschaft typische Nebeneinan22 Zu einem solchen Schluss gelangt etwa L. Nixon, The cults of Demeter and Kore, in: R. Hawley und B. Levick: Women in Antiquity. New Assessments, London/New York 1995, 75-96, 95f: »If Demeter Thesmophoros was the bringer of order then perhaps it was an order in which women had some say.« 23 Isaios 8, 19: »Die Frauen der Demenangehörigen wählten jene nämlich zusammen mit der Frau des Diokles aus Pithos, bei den Thesmophorien zu herrschen und zusammen mit ihnen das Übliche zu tun.«; vgl. IG II/III2 1184. Vgl. Parke, Festivals, 85f: »The procession and the layingout of the encampment must have involved a good deal of organization and even at times the use of some degree of authority. Hence it is not surprising that in the case of the local Thesmophoria of Attica there are references to two women elected each year to act as ›officials‹ (Archousai).« 24 Demosth. 21, 62; vgl. Davies, APF no. 4048
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
151
der von Gleichheit und Ungleichheit spiegelt sich in der Organisation der rein weiblich veranstalteten Thesmophorien ebenso wider wie in der männlich dominierten Öffentlichkeit der Polis. Die für Frauen ungewöhnliche Präsenz in der Öffentlichkeit der Polis zeigt sich auch im Ort der kultischen Handlungen. In Athen lag das Heiligtum nahe der Pnyx, in unmittelbarer Nähe des Platzes der athenischen Volksversammlung und damit dem politischen Zentrum Athens.25 Die athenischen Männer erfuhren so eine zweifache Beeinträchtigung ihres gewohnten Lebens. Erstens befanden sich die Frauen tage- und nächtelang nicht in ihrem Oikos, d. h. nicht in den ihnen reservierten sozialen Räumen, und zweitens hielten sie sich nahe den öffentlichen Räumen auf, die sonst exklusiv von Männern besetzt waren.26 Diese Ausnahmesituation wird sich nicht nur auf das häusliche Leben der Männer, sondern auch auf ihre politischen Geschäfte störend ausgewirkt haben. Denn die strikte Trennung der sozialen Räume von Männern und Frauen musste aufrechterhalten bleiben, auch wenn die jeweiligen Plätze topographisch nahe beieinander lagen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass einige Gremien der Polis während der Thesmophorien und der Vereinnahmung der Pnyx durch die Frauen nicht tagten.27 Dennoch bedeutet die Aussetzung der politischen Geschäfte keinen aktiven Beitrag der Frauen für die Polis. Es gelingt ihnen aber, ihre Rolle für das Funktionieren der männlichen Öffentlichkeit deutlich zu machen.28 Denn entsprechend der Komplementarität der sozialen Rollen in der ehrenhaften Gesellschaft Athens verengte sich der Handlungsspielraum der Männer, sobald die Frauen den ihrigen erweiterten. 25 O. Broneer, The Thesmophorion in Athens, in: Hesperia 11 (1942), 250-274, bes. 250-256; vgl. Burkert, Religion, 365: »Die Thesmophorien-Heiligtümer liegen nicht selten außerhalb der Stadt, gelegentlich auch am Hang der Akropolis; in Athen ist das Thesmophorion nahe bei der Pnyx, dem Platz der Volksversammlung.« 26 Versnel, Festival, 187: »During these few days the women laid off the burden of their normal routine ... For once, they enjoyed privileges that were unimaginable in normal life: the right to organize a women’s society with complete autonomy and proper female archontes, to ward off male intervention (except for financial support), to leave their houses and stay outside, even during the night, to perform private and secret rituals.« 27 Aristoph. Thesm. 78: +Aˆ PîJ; ™PEˆ NàN G' OÜTE T¦ DIKAST»RIA μšLLEI DIK£ZEIN OÜTE BOULÁJ ™SQ' ›DRA, ™PE…PER ™STˆ 1ESμOFOR…WN ¹ μšSH.. »Wieso? Heut spricht ja kein Gerichtshof, auch der Rat hält keine Sitzung, denn es ist der dritte, der Mitteltag des Thesmophorenfestes.« Vgl. Parke, Festivals, 86: »The departure of a large number of women from their homes for three days would clearly disrupt the ordinary life of the male citizens. Hence we find that Aristophanes mentions that on the middle day of the festival there were no law courts held and no meeting of the city council.« 28 Vgl. L. O’Higgins, Women and Humor in Classical Greece, Cambridge 2003, 23: »The festival made an impact on civic activity, because on the second day prisoners were released and law courts and council meetings were suspended. The women formed temporary, self-sufficient societies, with their own magistrates and governing bodies, mimicking (conceivably mocking) the male institutions that ruled the city as a whole.«
152
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
Das nicht normgerechte Verhalten der Frauen kommt lautstark in einem weiteren kultischen Element des Festes zum Ausdruck, der so genannten Aischrologie. Den Sinn dieses für athenische Bürgerfrauen ungehörigen Verhaltens sieht noch Diodor mythologisch verankert: œQOJ D' ™STˆN AÙTO‹J ™N TAÚTAIJ TA‹J ¹μšRAIJ A„SCROLOGE‹N KAT¦ T¦J PRÕJ ¢LL»LOUJ ÐμIL…AJ DI¦ TÕ T¾N QEÕN ™Pˆ TÍ TÁJ +ÒRHJ ¡RPAGÍ LUPOUμšNHN GEL£SAI DI¦ T¾N A„SCROLOG…AN.29 Die Praxis der Aischrologie rundet das Bild der Thesmophorien als eines rein weiblichen Festes ab, an denen die Frauen Verhaltensweisen an den Tag legten, die ihrem gewohnten, normgerechten Leben krass zuwider liefen.30 Sie übernahmen die Regie bei der Ausübung eines wichtigen Kultes, verließen ihre angestammten sozialen Räume, drangen in jene der Öffentlichkeit vor, und übertraten nicht zuletzt verbal die ihnen gesetzten Grenzen der sexuellen Zurückhaltung.31 Die Duldung dieses Verhaltens durch die Männer erklärt sich aus der wichtigen Funktion, die der Kult der Demeter für die Polis hatte. Die Fruchtbarkeit, um die die Frauen baten, sollte eine reiche Ernte und gute Nachkommenschaft sichern. Die Bedeutung der Bürgerfrauen für die Polisgemeinschaft bestand in ihrem Vermögen, legitime Kinder zu gebären. In diesem Sinne hing die Zukunft der Polis von der Gebärfähigkeit der athenischen Bürgerinnen ab.32 Im Ausnahmezustand der ausschließlich weibli29 Diod. 5, 4, 7: »Und es ist bei ihnen Herkommen, während dieser Tage sich im gegenseitigen Verkehr unhöflicher Worte zu bedienen; wollen sie doch mit dieser Grobheit die durch den Raub ihrer Tochter Kore betrübte Göttin zum Lachen bringen.« (Übersetzung: O. Veh). Vgl. Aristoph. Thesm. 539; Apollod. 1, 30: ™N TO‹J 1ESμOFOR…OIJ T¦J GUNA‹KA J SKèPTEIN LšGOUSIN. »Es heißt, dass die Frauen bei den Thesmophoria höhnisch johlen.« (Übersetzt bei J. Winkler, Der gefesselte Eros. Sexualität und Geschlechterverhältnis im antiken Griechenland, München 1997, 287) 30 J. Henderson, The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy, New Haven/London 1975, 14f. O’Higgins, Humor, 36, begreift die Aischrologie als einen transgressorischen Akt, ähnlich dem der Hybris. Vgl. die Forschungsdiskussion der Aischrologie bei I. Stark, Die hämische Muse. Spott als soziale und mentale Kontrolle in der griechischen Komödie, München 2004, 12f. 31 Vgl. D.M. O’Higgins, Women’s Cultic Joking and Mockery, in: A. Lardinois und L. McClure (Hg.), Making Silence Speak. Women’s Voices in Greek Literature and Society, Princeton, N.J. 2001, 137-160; Versnel, Festival, 201: »Matrons did things that were unimaginable in terms of the normal codes of family and society. They usurped man’s political roles (dominant functions in the centre of the state), man’s cultural privileges (sacrifice, wine), man’s language (sexual jokes), and discarded their own specifically female roles (care for the house) and sexual roles (chastity by staying in the house and submission to the phallokratia of their husbands). In sum, during the festivals the ever lurking threat of matrons ›running wild‹ materialized.« 32 Ebd., 200; vgl. N.J. Lowe, Thesmophoria and Haloa. Myth, Physics and mysteries, in: S. Blundell und M. Williamson (Hg.), The Sacred and the Feminine in Ancient Greece, London/New York 1998, 149-173, 154, möchte die Thesmophorien nicht als magisches Fruchtbarkeitsritual, sondern als ein Dankesfest verstanden wissen für: »crops, because that is what Demeter is being thanked for providing, and humans, because that is who benefited from it. And how did they
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
153
chen Gesellschaft entledigten sich die Frauen dabei offenbar einiger kennzeichnender Züge ihres sonstigen sozialen Habitus. Ihre organisierte Struktur, die Besetzung eines öffentlichen Raumes über eine mehrtägige Frist und das Schwingen obszöner Reden ließen ihr Verhalten dem der Männer ähnlich erscheinen. Tatsächlich übernahmen sie einige der habituellen Formen in ihr Verhaltensrepertoire, die sie zu gewöhnlichen Zeiten nicht an den Tag legen durften. Dabei ging es wohl nicht um eine symbolische, zeitlich begrenzte und kultisch überhöhte Umkehr ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit, die von der männlichen Vorstellung von der weiblichen Ehre bestimmt wurde. Vielmehr fehlte den Frauen in rein weiblicher Gesellschaft das komplementäre Korrektiv, so dass sie – ebenso wie die Männer – ehrenhafte Verhaltensweisen an den Tag legten, deren Wert ihnen durch ihre Sozialisation in der athenischen Gesellschaft ebenso evident war wie ihren Männern. Für eine selbstverständliche Übernahme der männlichen Vorstellung von Ehre sprechen auch die Praktiken an anderen agonalen Feiern. In Olympia etwa, der Hochburg männlicher Agonistik und dem Streben nach unsterblicher Ehre, bemühten sich auch Frauen um ein Erringen des Kranzes im Agon. Dort wurden die Heraia, kultische Wettkämpfe zu Ehren der Hera veranstaltet. Pausanias berichtet vom Charakter dieser weiblichen Wettkämpfe: DI¦ PšμPTOU DÒ ØFA…NOUSIN œTOUJ TÁI “(RAI PšPLON Aƒ žX KAˆ DšKA GUNA‹KEJ. Aƒ DÒ AÙTAˆ TIQšASI KAˆ ¢GîNA `(RA‹A. Ð DÒ ¢GèN ™STIN ¤μILLA DRÒμOU PARQšNOIJ: OÜTI POU P©SAI ¹LIK…AJ TÁJ AÙTÁJ, ¢LL¦ PRîTAI μÒN Aƒ GEèTATAI, μET¦ TAÚTAJ DÒ Aƒ TÁI ¹LIK…AI DEÚTERAI, TELEUTA‹AI DÒ QšOUSIN ÓSAI PRESBÚTATAI TîN PARQšNWN E„S…. QšOUSI DÒ OÛTW: KAQE‹TA… SFISIN ¹ KÒμH, CITëN ÑL…GON ØPÒR GÒNATOJ KAQ»KEI, TÕN ðμON ¥CRI TOà ST»QOUJ FA…NOUSI TÕN DEXIÒN. ¢PODEDEIGμšNON μÒN D¾ ™J TÕN ¢GîN£ ™STI KAˆ TAÚTAIJ TÕ '/LUμPIKÕN ST£DION, ¢FAIROàSI DÒ AÙTA‹J ™J TÕN DRÒμON TOà STAD…OU TÕ ›KTON μ£LISTA: TA‹J DÒ NIKèSAIJ ™LA…AJ TE DIDÒASI STEF£NOUJ KAˆ BOÕJ μO‹RAN TEQUμšNHJ TÁI “(RAI, KAˆ D¾ ¢NAQE‹NA… SFISIN œSTI GRAYAμšNAIJ E„KÒNAJ.33 benefit? Not, as we might expect and as might seem more symbolically appropriate, by enhancements to their own fertility – but by becoming hemeros, civilised.« 33 Paus. 5, 16, 2-3: »Jedes fünfte Jahr weben die sechzehn Frauen der Hera ein Gewand; dieselben Frauen veranstalten auch den Wettkampf der Heraien. Dieser Wettkampf ist ein Wettlauf für Jungfrauen. Sie sind aber nicht alle gleichaltrig, sondern zuerst laufen die jüngsten, nach diesen die nächst älteren, und als letzte laufen die ältesten von den Mädchen. Sie laufen so: das Haar fällt lose herab, das Gewand reicht bis etwas übers Knie, und die rechte Schulter zeigen sie bis zur Brust. Auch ihnen wird für den Wettkampf das olympische Stadion angewiesen, doch ziehen sie ihnen beim Stadionlauf etwa den sechsten Teil ab. Den Siegerinnen geben sie Ölbaumkränze und einen Anteil von der der Hera geopferten Kuh. Sie dürfen sich auch Bilder malen lassen und weihen.«
154
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
Wie bei den Männern steht dieser Agon der Frauen in Verbindung mit dem kultischen Fest einer Gottheit. In der Art der Durchführung und dem Siegeswillen der Wettkämpferinnen scheint es keine Unterschiede zu den Männern zu geben, jedenfalls erwähnt Pausanias nichts dergleichen. Im Gegenteil deutet die von ihm explizit erwähnte Möglichkeit der Frauen, Statuen oder Inschriften aufstellen zu lassen, auf eine hohe Wertschätzung des Sieges in den Heraia hin. Dennoch müssen diese gemeinsamen Charakteristika nicht eine Imitation der männlichen Agone bedeuten, die Heraia können sich ebensogut parallel zu den agonalen Feiern des Zeus entwickelt haben, wobei ihnen aufgrund der geringeren Mobilität und Möglichkeiten der Frauen eine ähnlich prestigeträchtige Karriere wie den olympischen Agonen der Männer versagt blieb.34 Erklärungsversuche für dieses weibliche Analogon in der männlichen Domäne der konkurrierenden Kämpfe um die agonale Ehre verlagern die zu beobachtende Gleichheit zwischen Männern und Frauen in die göttliche Sphäre. Die Heraia bilden demnach den notwendigen Tribut an Hera, die in der olympischen Stätte womöglich länger residierte als ihr Gemahl.35 Sollte es sich bei dem Agon um eine Art Initiationsritus handeln, so schränkt das die Teilnahme und damit die Gleichheit wiederum auf die unverheirateten Frauen ein.36 Die Heraia in Olympia bilden einen Beweis für das ehrenhafte Verhalten von Frauen jenseits ihrer gewöhnlichen sozialen Rolle, die in der athenischen Gesellschaft durch die Ehre determiniert war. Im Rahmen der Polis blieb der Wirkungskreis der allermeisten Frauen in Athen an den Oikos gebunden. Das gewährleistete am sichersten die Erfüllung ihrer Aufgaben für die Polis: den Oikos zu erhalten und darüber hinaus wenig zu tun. Die kultische Dimension der politischen Gemeinschaft der Männer kam allerdings ohne ein weibliches Element nicht aus, so dass Frauen hier eine weitere Funktion für die Polis erfüllten, wenn sie in rituellen Handlungen die Fruchtbarkeit der Erde beschworen. Die Feste, die die Frauen zu Ehren ihrer Göttinnen feierten, bildeten den Rahmen für ein Verhalten, das nur 34 Vgl. S. des Bouvrie, Gender and the Games at Olympia, in: B. Berggreen und N. Marinatos (Hg.), Greece & Gender, Bergen 1995, 55-74, 62; P.A. Bernardini: Le donne e la pratica della corsa nella Grecia antica, in: dies. (Hg.), Lo sport in Grecia, Rom/Bari 1988, 153-184, 168: »gli Erei hanno mantenuto intatto il carattere di cerimonia esclusivamente sacra.« 35 Vgl. Sinn, Olympia, 80-84; W. Burkert: Homo necans, Berkeley/Los Angeles 19882, 118: »der Heratempel ist weit früher gebaut worden als der Zeustempel, nicht weil Zeus weniger wichtig war, sondern weil die Männer sich um die Stätte des Tötens scharen, den Aschenaltar, während die Göttin der Frauen im Hause, ihrem NAÒJ weilt. ... Indem man zusammennimmt, was im Fest getrennt wird, Männerkraft und Frauenmacht, schließt sich der Kreis des Lebens.« 36 T.F. Scanlon, The Footrace of the Heraia at Olympia, in: Ancient World 9 (1984), 77-91, 84, schlägt diese Interpretation vor: »Before entering marriage, girls competed in ›tests of strength‹ (usually footraces) reminiscent of or derived from initiation rituals in honor of a form of a goddess associated with fertility and nourishment of the young.«
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
155
hier möglich war. Sanktioniert von den kultischen Notwendigkeiten der Polis legten sie Verhaltensweisen an den Tag, die sich an der Norm der Ehre orientierten. In Olympia gelang es sogar vereinzelten Frauen, als Zuschauerin oder Gespannbesitzerin an den ausschließlich männlichen Agonen teilzunehmen. Das spricht für einen Ehrgeiz zumindest dieser Frauen, der kaum mit ihrer angestammten Rolle zu vereinbaren war, aber auffallend gut das agonale Bestreben der Männer teilte. Pherenike aus Rhodos konnte sich ihre Anwesenheit als Zuschauerin im Jahre 404 erschleichen. Pausanias kennt sie unter dem Namen Kallipateira und bezeichnet sie als die einzige Frau, die beim Überschreiten des Alpheios, der den heiligen Bereich markiert, ertappt worden sei: AÛTH PROAPOQANÒNTOJ AÙTÁI TOà ¢NDRÕJ ™XEIK£SASA AØT¾N T¦ P£NTA ¢NDRˆ GUμNASTÁI ½GAGEN ™J '/LUμP…AN TÕN UƒÕN μACOÚμENON: NIKîNTOJ DÒ TOà 0EISIRÒDOU, TÕ œRUμA ™N ïI TOÝJ GUμNAST¦J œCOUSIN ¢PEILHμμšNOUJ, TOàTO ØPERPHDîSA ¹ +ALLIP£TEIRA ™GUμNèQH. FWRAQE…SHJ DÒ ÓTI E‡H GUN», TAÚTHN ¢FI©SIN ¢Z»μION KAˆ TîI PATRˆ KAˆ ¢DELFO‹J AÙTÁJ KAˆ TîI PAIDˆ A„Dî NšμONTEJ – ØPÁRCON D¾ ¤PASIN AÙTO‹J '/LUμPIKAˆ N‹KAI –, ™PO…HSAN DÒ NÒμON ™J TÕ œPEITA ™Pˆ TO‹J GUμNASTA‹J GUμNOÝJ SF©J ™J TÕN ¢GîNA ™SšRCESQAI.37 Pherenike gelangt nicht von ungefähr in den verbotenen Bereich, sondern in eigener betrügerischer Absicht. Die Tatsache, dass sowohl ihre Vorfahren wie auch ihre Nachkommen Olympioniken waren und sie mit dem Ablauf der Agone vertraut gewesen sein wird, mag es ihr erleichtert haben, diesen kühnen Plan zu fassen.38 Die Konsequenzen ihres spektakulären gesetzwidrigen Auftritts sind nicht die angedrohten. Denn Pherenike wird nicht vom Typaion gestürzt, sondern geht straffrei aus. Allerdings werden die Gesetze bezüglich der Bekleidungsvorschriften verschärft. Einer anderen Version der Geschichte zufolge sitzt Pherenike als Folge ihres beherzten Auftretens sogar als Zuschauerin auf den Rängen.39 Der Grund 37 Paus. 5, 6, 8: »Sie richtete sich, als ihr Mann gestorben war, ganz wie ein Sportlehrer her und brachte ihren Sohn zum Mitkämpfen nach Olympia. Als Peisirodos siegte, übersprang Kallipateira die Umfriedigung, in der man die Sportlehrer abgetrennt hielt, und entblößte sich dabei. Obwohl sie nun als Frau ertappt war, ließen sie sie straffrei, aus Rücksicht auf ihren Vater und ihre Brüder und ihren Sohn. Sie alle hatten olympische Siege erfochten, und daraufhin machte man ein Gesetz in bezug auf die Sportlehrer inskünftig, dass sie nackt zum Kampf antreten müssten.«Vgl. Philostr. 17. 38 Paus. 6, 7, 2-4, klärt beim Anblick ihrer Ehrenmale noch einmal die genealogischen Zusammenhänge. Ihr Vater Diagoras siegte 464 im Faustkampf (Moretti, Olympionikai, no. 252), ihr Bruder Dorieus errang als Faustkämpfer drei olympische Siege in den Jahren 432, 428 und 424 (Moretti, Olympionikai, no. 322, 326, 330) und wurde Periodonike, vgl. Knab, Periodoniken, 57f. Zu ihrem Sohn, den sie 404 zu den olympischen Agonen begleitet, vgl. Moretti, Olympionikai, no. 356. 39 Ail. var. 10, 1.
156
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
dafür ist die hohe Ehre, die mehrere Mitglieder ihrer Familie in Olympia errungen haben. In der Beurteilung ihres Vergehens wird also nicht nur ihre Zugehörigkeit zu dem bei den Agonen unerwünschten weiblichen Geschlecht in Betracht gezogen, sondern auch ihre Verbundenheit mit einer athletisch sehr erfolgreichen Familie.40 Pherenike partizipiert an der Ehre ihrer Väter und Brüder. Sie vermittelt dabei den Eindruck, dass diese Ehre ihr durchaus zusteht. Denn sie leistet nicht nur einen physischen Beitrag zur Kontinuität der Familie, sondern auch einen athletischen. In der Beschreibung des Philostrat wirkt sie überhaupt nicht wie eine typische Vertreterin ihres Geschlechts: &EREN…KH ¹ `2OD…A ™GšNETO $IAGÒROU QUG£THR TOà PÚKTOU, KAˆ TÕ EÍDOJ ¹ &EREN…KH OÛTW TOI œRRWTO, æJ '(LE…OIJ T¦ PRîTA ¢N¾R DÒXAI. E†LHTO GOàN ØPÕ TR…BWNI ™N '/LUμP…v KAˆ 0EIS…DWRON TÕN ˜AUTÁJ UƒÕN ™GÚμNASE.41 Äußerlich und ihrem Verhalten nach passt sie eher zu den ihr verwandten Olympioniken als in das Bild der Griechen von ihren Ehefrauen und Müttern.42 Wegen ihrer »unweiblichen« Erscheinung und ihrer Verweigerung der geschlechtsspezifischen Rolle, wird Pherenike nicht primär als Frau behandelt, sondern als das Mitglied einer ehrenhaften Familie. Das zeigt zum einen, dass die Freiräume von Frauen sich trotz männlicher Verbote doch in Einzelfällen nach Bedarf gestalten ließen und zum anderen, dass die Normen der Männer in Bezug auf das geschlechtsspezifische Verhalten der Frauen im Wesentlichen Verhaltenserwartungen waren, die in der Realität nicht unbedingt erfüllt worden sein müssen.43 Aelian begreift den Vorfall als einen Triumph für Pherenike: KAˆ ™XEN…KHSE TÕN DÁμON KAˆ TÕN E‡RGONTA NÒμON TÁJ QšAJ T¦J GUNA‹KAJ, KAˆ ™QE£SATO '/LÚμPIA.44
40 Ebd. Aelian spricht ausdrücklich vom »Sieg« (™XEN…KHSE) dieser kämpferischen Frau. 41 Philostr. 17: »Pherenike aus Rhodos war die Tochter des Faustkämpfers Diagoras, und in ihrer äußeren Erscheinung war Pherenike so kräftig, dass sie den Eleern anfangs ein Mann zu sein schien. Sie war also in Olympia unter dem Mantel unkenntlich und konnte ihren Sohn Peisidoros trainieren.« (Übersetzung J. Jüthner) 42 Nach Ail. var. 10, 1, soll sie sogar selbst zu ihrer Verteidigung gesprochen haben: &EREN…KH TÕN UƒÕN ÃGEN E…J '/LÚμPIA ¢QLE‹N. KWLUÒNTWN DÒ AÙT¾N TîN `%LLANODIKîN TÕN ¢GîNA QE£SASQAI, PARELQOàSA ™DIKAIOLOG»SATO PATšRA μÒN '/LUμPION…KHN œCEIN KAˆ TRE‹J ¢DELFOÝJ KAˆ AÙT¾ PA‹DA '/LUμP…WN ¢GWNIST»N: »Pherenike begleitete ihren Sohn zu den Olympischen Spielen. Als die Kampfrichter sie daran hindern wollten, sich den Wettkampf anzusehen, trat sie vor die Menge und führte zu ihren Gunsten an, dass ihr Vater und drei Brüder Olympioniken gewesen sein und ihr Sohn als Kämpfer an den Olympischen Spielen teilnehme.« 43 Vgl. Luhmann, Systeme, 437, wonach Normen »auch im Enttäuschungsfall kontrafaktisch festgehalten« werden. 44 Ail. Var. 10, 1: »Sie besiegte das Volk und das Gesetz, das Frauen das Zuschauen verbietet, und sah den Spielen zu.« Vgl. M. Frass, Gesellschaftliche Akzeptanz »sportlicher« Frauen in der Antike, in: Nikephoros 10 (1997), 119-133, 128f.
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
157
Ein noch deutlicheres Signal für die Nichterfüllung normativer Erwartungen setzt Kyniska aus Sparta, die als erste Frau den olympischen Kranz erringt. Kyniska ist die Tochter des spartanischen Königs Archidamos I. und die Schwester Agesilaos II. Ihre olympischen Siege werden in die Jahre 396 und 392 v. Chr. datiert.45 Pausanias berichtet über sie folgendes: '!RCID£μOU DÒ æJ ™TELEÚTA KATALIPÒNTOJ PA‹DAJ ’!G…J TE PRESBÚTEROJ íN ¹LIK…AI PARšLABEN ¢NTˆ '!GHSIL£OU T¾N ¢RC»N. ™GšNETO DÒ '!RCID£μWI KAˆ QUG£THR, ÔNOμA μÒN +UN…SKA, FILOTIμÒTATA DÒ ™J TÕN ¢GîNA œSCE TÕN '/LUμPIKÕN KAˆ PRèTH TE ƒPPOTRÒFHSE GUNAIKîN KAˆ N…KHN ¢NE…LETO '/LUμPIK¾N PRèTH.46 Kyniska wird nicht die einzige Frau bleiben, die in den hippischen Agonen reüssiert, aber sie ist die erste.47 Zweifellos verdankt sie die Möglichkeit der Teilnahme und ihren Sieg den besonderen Faktoren, die bei den hippischen Disziplinen zum Tragen kommen und die nichts mit ihrer persönlichen athletischen Leistung zu tun haben. Für Kyniska reicht ihr hoher sozialer Status und der Reichtum ihrer Familie, um ihre Quadriga in Olympia laufen lassen zu dürfen. Als Besitzerin des Gespanns ist sie diejenige, die Anspruch auf die Bekränzung erheben kann, wenn ihre Pferde die schnellsten sind. Ihre Teilnahme an den olympischen Agonen erfordert so nicht einmal ihre Anwesenheit. Kyniska agiert damit gegen die Normen, die selbstverständlich von einer rein männlichen Teilnehmerschar ausgehen, verstößt aber nicht gegen die Wettkampfregeln. Einerseits bestätigt ihr durch die Wahl der Disziplin ermöglichtes Fernbleiben das eherne Gesetz des Ausschlusses von Frauen, auf der anderen Seite ist sie die erste Frau, die als Olympionikin bekränzt wird und mit Ehrenmalen und -inschriften an ihren Sieg erinnert. Die Spartanerin richtet sich nicht gegen die ausgesprochenen, wohl aber gegen die unausgesprochenen Normen. Diese gegenläufige Interpretation des Verhaltens hat schon in der Antike das Interesse auf sich gezogen und nach Motiven fragen lassen. Plutarch und Xenophon sehen Kyniska als Strohfrau ihres mächtigen Bruders Agesilaos: /Ù μ¾N ¢LL¦ ÐRîN ™N…OUJ TîN POLITîN ¢PÕ ƒPPOTROF…AJ DOKOàNTAJ EÍNA… TINAJ KAˆ μšGA FRONOàNTAJ, œPEISE T¾N ¢DELF¾N +UN…SKAN ¤RμA KAQE‹SAN '/LUμP…ASIN ¢GWN…SASQAI, BOULÒμENOJ 45 Vgl. Moretti, Olympionikai, no. 373 und no. 381. 46 Paus. 3, 8, 1: »Archidamos hatte auch eine Tochter mit Namen Kyniska. Diese nahm in einem besonderen Maße Anteil an den olympischen Spielen. Sie war auch die erste Frau, die sich mit Pferdezucht beschäftigte und als erste einen olympischen Sieg errang.« 47 Ebd.: +UN…SKAJ DÒ ÛSTERON GUNAIXˆ KAˆ ¥LLAIJ KAˆ μ£LISTA TA‹J ™K ,AKEDA…μONOJ GEGÒNASIN '/LUμPIKAˆ N‹KAI, ïN ¹ ™PIFANESTšRA ™J T¦J N…KAJ OÙDEμ…A ™STˆN AÙTHJ. »Nach der Kyniska haben auch andere Frauen, besonders aus Lakedaimon, olympische Siege errungen, von denen freilich im Hinblick auf die Siege keine berühmter ist als diese.« Vgl. Moretti, IAG, 17.
158
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
™NDE…XASQAI TO‹J “%LLHSIN æJ OÙDEμI©J ™STIN ¢RETÁJ, ¢LL¦ PLOÚTOU KAˆ DAP£NHJ ¹ N…KH.48 Auch die Forschung betrachtet Kyniska nicht als eine typische Vertreterin des weiblichen Geschlechts, die sich größere Handlungsspielräume eröffnet als ihr zugedacht waren, sondern betont ihren wenig repräsentativen Status.49 Als Hauptfaktoren, die sie zu einer Ausnahmeerscheinung machen, werden ihre mächtige Familie genannt und ihre Heimatpolis Sparta, in der athletische Frauen durchaus zum alltäglichen Erscheinungsbild gehören.50 Aus dieser Perspektive sind die Interpretationen des Plutarch und des Xenophon, die Agesilaos zum Initiator des Sieges der ersten Olympionikin machen, sehr glaubhaft.51 Auf der anderen Seite handelt es sich bei der Spartanerin Kyniska um den idealtypischen Fall einer Frau, der es gelingt, bisher nur Männern vorbehaltene soziale Räume zu betreten. Sie befindet sich bereits im überreichen Besitz der wichtigsten gesellschaftlichen Güter und kann ihren Status innerhalb der normativen Kategorien kaum weiter ausbauen. Ihre größte Einschränkung erfährt sie dabei durch ihre Rolle als Frau, der enge geschlechtsspezifische Grenzen gesetzt sind. Die Transgression der sozialen Normen, die Frauen bei den olympischen Agonen nicht erwarten, fällt Kyniska relativ leicht, eben weil sie ihre familiären Ressourcen als Rückhalt hat, und weil ihre Identifikation mit den Mitgliedern der Oberschicht unter Umständen ohnehin stärker ist als jene mit ihren Geschlechtsgenossinnen. Über Kyniskas eigene Worte und Taten stehen genug Quellen zur Verfügung, um den Fokus der Aufmerksamkeit von ihrem Bruder Agesilaos auf sie zu verschieben. Unabhängig davon, ob er sie zur Teilnahme an den Agonen motiviert hat, bleibt das Faktum ihrer Teilnahme und ihres Sieges. Dabei kann sich ihre eigene Einstellung zu ihrem zweimaligen überlieferten Erfolg sehr von der ursprünglichen ihres Bruders unterscheiden. Die Quellen lassen in ihrem Falle nicht nur die männlichen Deuter des Geschehens zu Wort kommen, sondern die epigraphischen Quellen sprechen eine deutliche Sprache. Denn Kyniska lässt zur Erinnerung an ihre Siege mehrere 48 Plut. Agesilaos 20: »Als er gewahrte, dass einige der Bürger für etwas galten, weil sie sich einen Rennstall hielten, und sich viel darauf einbildeten, veranlasste er seine Schwester Kyniska, einen Wagen in Olympia laufen zu lassen und sich an dem Wettkampf zu beteiligen, in der Absicht, den Griechen zu zeigen, dass ein solcher Sieg keine Sache der eigenen Tüchtigkeit, sondern des Reichtums und des Kostenaufwandes ist.« (Übersetzung K. Ziegler). Vgl. Xen. Ag. 9, 6. 49 Vgl. zu diesem Erklärungsmuster E. Goffman, Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt a.M. 19793, 39, der von »gruppenangehörigen Führern« spricht, die außerhalb ihrer Gruppe kommunizieren. Sie »hören so vermittels sozialer Partizipation auf, repräsentativ zu sein für die Menschen, die sie repräsentieren.« 50 Vgl. Frass, Akzeptanz, 125f. 51 Golden, Sport, 134, kann die Motivation des Agesilaos nachvollziehen: »Who would want a prize a woman could win?«; vgl. Decker, Frauen, 26f.
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
159
Monumente errichten.52 Darunter eine Ehrenstatue samt Inschrift, die sie in eine Reihe mit den anderen Olympioniken stellt: PEPO…HTAI DÒ ™N '/LUμP…AI PAR¦ TÕN ¢NDRI£NTA TOà 4RW…LOU L…QOU KRHPˆJ KAˆ ¤RμA TE †PPWN KAˆ ¢N¾R ¹N…OCOJ KAˆ AÙTÁJ +UN…SKAJ E„KèN, '!PELLOà TšCNH, GšGRAPTAI DÒ KAˆ ™P…GRAμμA ™J T¾N +UN…SKAN œCON. E„Sˆ DÒ ,AKEDAIμÒNIOI KAˆ ™FEXÁJ ¢NAKE…μENOI TÁI +UN…SKAI, †PPWN N‹KAI GEGÒNASIN AÙTO‹J:53 Die erwähnte Inschrift ist in situ gefunden. Aus ihren Worten spricht der Stolz der Olympionikin, wenn sie auf ihre königliche Herkunft und auf ihren einzigartigen Sieg bei den olympischen Agonen hinweist:54
Das Außergewöhnliche dieser Leistung ist sowohl Kyniska als auch den anwesenden und nachkommenden Männern bewusst. Letztere erwähnen sie gebührend oft als Kuriosum und stellen sogar Vermutungen über die Motive ihres Verhaltens an, die einem Mann zugeschrieben werden, nicht ihrer Person. Entgegen der Meinung der sie umgebenden Männer scheint Kyniska die Ehre, die ihr ein olympischer Sieg bringt, durchaus zu wertschätzen, und das, obwohl sie ihre geschlechtsspezifisch zugewiesene weibliche Ehre damit keineswegs mehrt. Kyniska gelingt es, ebenso wie Pherenike, den ihr zugedachten Handlungsspielraum zu erweitern. Beide Frauen sind sich sehr wohl der normativen Erwartungen an ihr Rollenverhalten bewusst, wie sie auch mit den Regeln des männlichen Kampfes um die Ehre vertraut sind. Gerade die Ehre entpuppt sich als ihr Bonus. Denn Kyniska und Pherenike können zwar ihre Möglichkeiten relativ zu ihren Geschlechtsgenossinnen ausbauen, aber sie schaffen das nur mit den Möglichkeiten und unter dem Schutz der 52 Pausanias findet im olympischen Bezirk ein Heroon der Kyniska vor (3, 15, 1), ein im Pronaos des Zeustempels aufgestelltes Weihgeschenk (5, 12, 5) und eine Statuengruppe mit Inschrift (6, 1, 6). 53 Ebd. 6, 1, 6-7: »In Olympia ist neben der Statue des Troïlos ein marmorner Sockel gebaut und darauf ein Pferdewagen und ein Wagenlenker und die Statue der Kyniska selbst, eine Arbeit des Apelleas, daran steht auch eine auf Kyniska bezügliche Inschrift. Lakedaimonier stehen da auch weiterhin anschließend an Kyniska; auch sie haben Siege mit Pferden errungen.« 54 »Könige Spartas sind mir Väter und Brüder. Als Siegerin mit dem Gespann der schnellfüßigen Pferde hat Kyniska dieses Bildwerk aufgestellt. Und ich erkläre: der Frauen einzige aus ganz Hellas bin ich, die diesen Kranz errungen.« J. Ebert (Hg.), Griechische Epigramme auf Sieger in gymnischen und hippischen Agonen, Berlin 1972, no. 33 (= IG V, 1 1564a).
160
Nike ist eine Frau! Das andere Geschlecht der Ehre
Ehre, die die männlichen Mitglieder ihrer Familien besitzen. Pherenike beruft sich explizit auf die olympischen Ehren ihrer Verwandten, und Kyniska ist mit einem Status ausgestattet, der sie für einfache Bürger unangreifbar macht. Bei bestimmten Gelegenheiten übernahmen athenische und andere griechische Frauen offenbar ehrenhafte, als »männlich« definierte Verhaltensweisen. Das geschah vornehmlich an Orten außerhalb der Polis und in sozialen Räumen, die von einer ausschließlich weiblichen Öffentlichkeit geprägt waren. Die Vergesellschaftung von Frauen an diesen Orten und zu diesen Gelegenheiten lässt ein Netzwerk von Beziehungen unter den Frauen Athens erahnen, wie es auch im alltäglichen Leben bestanden haben mag, in den kultischen Festen aber besonders bekräftigt und gefeiert wurde.55 Ohne in Bezug zu ihren Männern die von Passivität und Komplementarität geprägte Norm der weiblichen Ehre erfüllen zu müssen, wandten die Frauen ihr soziales Wissen, das sie aufgrund ihrer Sozialisation in einer ehrenhaften Gesellschaft erworben hatten, ähnlich an wie ihre Männer. Auch ihnen war es um die Erfüllung der habituellen Formen der Ehre zu tun, sie wetteiferten ebenso miteinander um die höhere Ehre.
55 Vgl. O’Higgins, Humor, 26: »The Thesmophoria had the effect (and among women, undoubtedly, the purpose) of reforming and strenghtening bonds among women, bonds that marriage might otherwise attenuate. Mothers, daughters, sisters, friends, and cousins would find each other at this and other festivals, even if geography and other constraints of married life had made it difficult for them to see each other on a daily basis.«
V. Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Die soziale Interaktion in einer ehrenhaften Gesellschaft beruht auf der Wahrnehmung der anderen als Gleiche. Die habituellen Formen der Reziprozität, des Agons, der nur als das Messen mit Ebenbürtigen seinen Reiz hat, und der Gedanke eines Nullsummenspiels um die Ehre setzen eine Gleichheit an Ehre unter allen Männern voraus.1 Diese Gleichheit ist auf dem kleinsten Nenner der männlichen Geschlechtsidentität, die von den Frauen abgrenzt, gegeben. Darüber hinaus erweist sich die Gleichheit unter den Ehrenmännern jedoch als eine Illusion. Die Vorstellung von Ehre gestaltet eine hierarchische Ordnung der Gesellschaft, die sich in der sozialen Interaktion in den feinen Unterschieden des Habitus und des sozialen Umgangs miteinander äußert. Auch diese durch Ehre strukturierte hierarchische Ordnung spiegelt sich in den habituellen Formen. Definiert sich ein Agon auch immer als ein Wettkampf unter Gleichen, so bedeutet das Ergebnis doch für die Kontrahenten stets ein Mehr oder Weniger an Ehre. Die Wahrung des ehrenhaften Status eines Mannes erfordert die beständige Auseinandersetzung mit anderen Statusgleichen, die zugleich als Rivalen angesehen werden.2 Die vorgebliche Gleichheit aller Ehrenhaften fungiert vor allem als Abgrenzung nach außen. Innerhalb der Gruppe der ehrenhaften Männer gibt es wenige wirklich Statusgleiche, die Statusunterschiede werden durch beständiges Rivalisieren aufrechterhalten.3 Das Nebeneinander von Gleichheit und Ungleichheit macht die fragile Balance aus, in der sich eine ehrenhafte Gesellschaft befindet. Die ehrenhafte Gesellschaft der athenischen Polisbürger war mit dieser Dichotomie von Gleichheit bei gleichzeitiger Ungleichheit in besonderem Maße konfrontiert. Denn zusätzlich zu der nur vorgestellten Gleichheit aller Polisbür1 Bourdieu, Entwurf, 16: »Das Gefühl der Ebenbürtigkeit in der Ehre, das durchaus mit faktischen Ungleichheiten koexistieren kann, liegt einer großen Anzahl von Verhaltensweisen und Bräuchen zugrunde«. 2 Giordano, Ehrvorstellungen, 121: »Diese Wettbewerbsmuster wären allerdings völlig überflüssig, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft diese als egalitär wahrnehmen würden. Der Kampf, um ›gleich zu bleiben‹, wird demzufolge stets vom Anspruch, sozial überlegen zu sein, neutralisiert.« 3 Peristiany, Village, 188: »each male individual finds it constantly necessary to assert either his superiority or his isotimia, that is his right to be treated as a person entitled to equal esteem. Hierarchical relations are resented and resisted as, whenever the superior stresses his rank, the inferior stresses his manliness.«
162
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
ger an Ehre etablierte sich mit der Ordnung der demokratischen Polis ein weiteres sinnstiftendes Bezugssystem für die Athener, das auf der Gleichheit aller basierte, während gleichzeitig erhebliche Statusunterschiede fortbestanden. Die politische Ordnung der Polis versprach jedem Bürger Athens gleiche politische Rechte und Chancen auf den Zugang zu politischen Ämtern, während dieselben Bürger weiterhin sozial sehr ungleich blieben. Der soziale Status eines Atheners bemaß sich nach seiner Ehre, die als soziale Leitdimension seinen Anspruch auf andere gesellschaftliche Güter regelte. Während der klassischen Zeit gewann die Norm der Polis, die ihre Bürger der Gleichheit untereinander versicherte, zunehmend an Einfluss. Aufgrund der kontinuierlich bestehenden sozialen Ungleichheiten waren die athenischen Bürger auf dem Gebiet des Politischen aber weiterhin rechtlich, nicht faktisch Gleiche. Die Egalität der Polisbürger fungierte vor allem als Mittel der Abgrenzung gegen minder privilegierte Bevölkerungsgruppen.4 Es ist allerdings nicht so, dass die normative Setzung der Gleichheit aller Bürger sich der Polis zuordnen lässt, und die bestehenden Ungleichheiten dem sozial weiterhin wirkungsmächtigen Faktor der Ehre zugeschrieben werden können. Vielmehr sind die athenischen Bürger sowohl in der Polis als auch hinsichtlich ihrer Ehre zugleich gleich und ungleich. Tendenziell jedoch verstärkt die Vorstellung der Ehre das Denken in Hierarchien, während die ausgeprägte Demokratie in Athen den Gedanken der Gleichheit beförderte. Aufgrund dieser Gemengelage erwies sich die Ausbalancierung der politischen Gleichheit einerseits und der sozialen Ungleichheit andererseits als existentiell für die Stabilität der athenischen Gesellschaft. Innerhalb der durch die Ehre strukturierten sozialen Interaktion der Bürger bildete das Maß der Ehre, das jedem zukam, einen wichtigen Faktor für die Vorstellung der, wenn auch nur gedachten, Gleichheit aller und der Vorhersehbarkeit des sozialen Miteinanders. Gefährdet wurde die Ausgewogenheit durch einen übermäßig zur Schau getragenen Anspruch auf Ehre, der mit dem Ehrgefühl anderer kollidierte und auf der anderen Seite durch ein Defizit an Ehre, das einen Bürger von der Kommunikation mit anderen Ehrenmännern ausschließen konnte. Die Hybris oder die Schande einer Person wirkten als Störfaktoren innerhalb der ehrenhaften Gesellschaft. Aus klassischer Zeit sind für beide Formen der Ungleichheit mit den übrigen Ehrenmännern Gesetze überliefert, die den Umgang mit diesen Personen regeln. Sie vermögen Aufschluss 4 Vgl. P. Cartledge: Comparatively Equal, in: Ober und Hedrick, Dêmokratia, 175-185, 176: »Inasmuch as, and to the extent that, the Greek citizen was by definition male not female, free not slave, native insider not stranger or outsider, adult not child, he was in those respects and to that extent equal to all other citizens, and deserving therefore of equal respect, privilege, consideration, and treatment.«
Das Phänomen der Hybris
163
zu geben über die Einstellung der Athener zu beiden Phänomenen und zur Art der Bedrohung, die beide Formen der Ungleichheit für die ehrenhafte Gesellschaft der athenischen Polisbürger darstellten.
1. Die Ehre als Bedrohung der Polis: Das Phänomen der Hybris Der Vorwurf der Hybris an einen Gegner gehört in den Gerichtsreden des 4. Jahrhunderts zu den verbreitetsten rhetorischen Topoi.5 Die Darstellung von Hybris als einem starken Motiv für menschliche Handlungen und die Warnung vor solchermaßen motivierten Taten durchzieht die gesamte griechische Geschichte von Achill bis Alkibiades. Trotz unterschiedlicher Bedeutungsschattierungen in verschiedenen Zeiten und Kontexten erscheint die Hybris kontinuierlich als ein negativer Begriff. Vor Hybris wird zu Recht gewarnt, nicht zuletzt deshalb, weil sie geeignet ist, die hybride Person als Charakter zu diskreditieren, wie es in den attischen Tragödien geschieht.6 Die Auffassung der Hybris als einer Bedrohung für das friedliche Zusammenleben ist sozial verankert, denn hybride Akte können eine Gesellschaft empfindlich stören, wie die athenischen Redner ständig betonen.7 Bei der ÛBRIJ handelt es sich um einen der wenigen Begriffe aus dem Themenkreis der Ehre, den die Griechen häufig und gern benutzten und der im Gegensatz zu der eher imaginierten als verbalisierten Vorstellung von Ehre auf sprachlicher Ebene stets präsent war. Der Zusammenhang zwischen Hybris und Ehre im Athen der klassischen Zeit ist evident. Zu fragen bleibt nach dem genauen Verhältnis von Hybris und Ehre zueinander: Welchen Einfluss hat das hybride Verhalten auf die Ehre eines Mannes, und zwar dessen, der Hybris ausübt und dessen, der sie erleidet? Was bedeutet der vor Gericht so oft wiederholte Vorwurf der
5 Besonders gern wird der Vorwurf in Reden verwendet, in denen es um die Ehre der Kontrahenten geht. Euphiletos geht noch sparsam mit dem Vorwurf um (Lys. 1, 4. 16. 25), er hat ja angeblich auch nicht aus Ehrgefühl gehandelt; Ariston hingegen macht die Hybris seines Gegners zum Leitmotiv, vgl. Demosth. 54, 1. 2. 4. 8. 9. 10. 11 13. 14, 15 etc.; auch Demosthenes spricht gern von der Hybris seines Gegners, Demosth. 21, 1. 4. 6. 11. 31. 35. 36. 38 etc. 6 Fisher, Hybris, 297: »Thus, while it is true that hybris has some (relatively small) part in the motivation of some of the major ›tragic‹ figures in Aeschylus’ plays, it is also the case that the more hybristic the acts, words and motives of any of his characters are, proportionately less does our inclination become to regard them with sympathy and their sufferings as tragic.« Vgl. R. Lattimore: Story Patterns in Greek Tragedy, London 1964, 23-25. 7 Vgl. Demosth. 21, 97. 130-131.142-144; Demosth. 22, 68; Demosth. 54, 42-43; Lys. 14, 28-29.
164
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Hybris und worin unterscheidet er sich von anderen Regelverstößen gegen die Norm der Ehre? Dass die Hybris als ein besonders normwidriges Verhalten gilt, wird in den Quellen überdeutlich. Welche Bedrohung stellt die Hybris eines ehrenhaften Mannes für die einzelnen Bürger Athens und für die Polis dar? Warum ist diese Bedrohung so mächtig? Bietet die GRAF¾ ÛBREWJ einen wirksamen gesellschaftlichen Sanktionsmechanismus dagegen? Die meisten dieser Fragen sind nicht neu und in der Forschung bereits – unterschiedlich – beantwortet worden. Die Eingliederung der Hybris in den größeren gesellschaftlichen Kontext der Ehre und die daraus erhellende Erklärung ihrer Prominenz in den Quellen aber bleiben ein Desiderat. Dennoch handelt es sich bei der Thematik der Hybris um einen Aspekt des Komplexes der Ehre, der in der Forschung eine sehr eingehende und aufschlussreiche Behandlung erfahren hat. Besonders aus sozialhistorischer Perspektive verspricht eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Hybris einen ergiebigen Beitrag zum Verständnis der gesellschaftlichen Reibungspunkte in der athenischen Demokratie. Die Ausrichtung eines Großteils der Forschung auf die Frage nach den dysfunktionalen Effekten, die hybride Personen bzw. hybride Akte haben können, gründet in der Quellenlage. Denn abgesehen von dem mannigfaltigen Gebrauch des Begriffs ÛBRIJ in den Quellen ist es der NÒμOJ ÛBREWJ, der über die Vorstellung der Griechen von der Hybris Auskunft gibt. Dieses Gesetz stellt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für jede Theorie zur Vorstellung von der Hybris in Athen dar. Denn die vermeintlich konkrete Verwendung des Begriffes der Hybris als juristischer Terminus und die gesetzlich gegebene Möglichkeit, Hybris begehende Athener zu verklagen, versprechen eine Erhellung des Begriffs, die sie nicht leisten. Im Gegenteil kommt es zu einigen Ungereimtheiten und Widersprüchen, die beständig in das Visier der Forschenden geraten und eine lexikalische Definition der Hybris sehr kompliziert werden lassen. Die demosthenische Rede Gegen Meidias überliefert den Wortlaut eines Nomos, der die Hybris zu einem gesetzeswidrigen Vergehen macht: '%£N TIJ ØBR…ZV E‡J TINA, À PA‹DA À GUNA‹KA À ¥NDRA, TîN ™LEUQšRWN À TîN DOÚLWN, À PAR£NOμÒN TI POI»SV E„J TOÚTWN TIN£, GRAFšSQW PRÕJ TOÝJ QESμOQšTAJ Ð BOULÒμENOJ '!QHNA…WN OŒJ œXESTIN, Oƒ QESμOQšTAI E„SAGÒNTWN E„J T¾N ºLIA…AN TRI£KONTA ¹μERîN ¢F' ÂJ ¨N ¹ GRAF», ™¦N μ» TI DHμÒSION KWLÚV, E„ DÒ μ», ÓTAN Ï PRîTON OŒÒN TE. ÓTOU D' ¨N KATAGNù ¹ ºLIA…A, TIμ£TW PERˆ AÙTOà PARACRÁμA, ÓTOU ¨N DOKÍ ¥XIOJ EÍNAI PAQE‹N À ¢POTE‹SAI. ÓSOI D' ¨N GR£FWNTAI [GRAF¦J „D…AJ] KAT¦ TÕN NÒμON, ™£N TIJ μ¾ ™PEXšLQV À ™PEXIëN μ¾ μETAL£BV TÕ PšμPTON μšROJ TîN Y»FWN, ¢POTEIS£TW CIL…AJ DRACμ¦J Tù DHμOS…J. ™¦N DÒ ¢RGUR…OU TIμHQÍ TÁJ ÛBREWJ,
Das Phänomen der Hybris
165
DEDšSQW, ™¦N [DÒ] ™LEÚQERON ØBR…SV, μšCRI ¨N ™KTE…SV.8 Weil der NÒμOJ ÛBREWJ den Akt der Hybris selbst nicht näher definiert, bleibt die Forschung auf die Kombination des Nomos mit den übrigen Quellen angewiesen, um den Bedeutungshorizont des für die Athener so wichtigen Phänomens überblicken zu können. Den einflussreichsten Beitrag zur Erforschung der ÛBRIJ hat zweifelsohne Nicolas Fisher mit seinem voluminösen Standardwerk »Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece« geleistet.9 Der programmatische Titel verweist dabei auf die Grundthese seines Buches, die lautet: »hybris is essentially the serious assault on the honour of another, which is likely to cause shame, and lead to anger and attempts at revenge.«10 Zu einem Akt der Hybris wird eine Tat mithin durch ihre ehrverletzende Intention, die von Täter und Opfer gleichermaßen als solche identifiziert werden muss.11 Hybris findet nicht nur auf interpersonaler Ebene statt, sondern existiert auch als repressive Maßnahme der Mächtigen, zwischen Gruppen der Bevölkerung oder ganzen Poleis.12 Fisher verfolgt den Terminus durch einige Jahrhunderte, er beginnt seine Analyse mit Homer und endet mit Platon. Dabei findet er in so unterschiedlichen Quellengattungen wie den Epen und Tragödien, den historiographischen Werken und philosophischen Schriften seine Grundannahme bestätigt, derzufolge sich Hybris durch die Verletzung der Ehre eines anderen auszeichnet.13
8 Demosth. 21, 47: »So jemand an irgend wem, sei’s Kind oder Frau oder Mann, sei’s Freier oder Knecht, Muthwillen oder sonst eine Gesetzwidrigkeit verübt, so soll jedweder Athener, so weit er dazu befugt ist, denselben bei den Thesmotheten belangen dürfen, diese aber von da an binnen dreißig Tagen die Klage vor den Gerichtshof bringen, dafern nicht ein öffentliches Hinderniß eintritt, und in diesem Falle sobald es immer möglich ist. Verurteilt ihn der Gerichtshof, so soll er sofort die Strafe schätzen, welche er zu erleiden oder zu entrichten hat. Hat der Kläger eine persönliche Klage angestellt nach dem Gesetz, so soll er, wenn er dieselbe nicht verfolgt, oder bei deren Verfolgung nicht den fünften Theil der Stimmen erhält, tausend Drachmen an den Fiscus zahlen. Wird aber der Angeklagte in eine Geldbuße verurtheilt, so soll er, falls er den Muthwillen an einem Freien verübt hat, in Haft genommen werden, bis dass er zahlt.« (Übersetzung A. Westermann). Vgl. Aischin. 1, 15, wo das Gesetz teilweise wörtlich zitiert wird. 9 Fisher, Hybris. 10 Ebd., 1. 11 Ebd., 122: »As an offence in itself, or as an important element in a variety of offences, hybris normally involves the open expression of hostility and contempt, and for the hybris to be effective it is necessary for the victim to be conscious of it, and feel shamed, at the time of the act or later.« 12 Ebd., 126-142. Vgl. zum Zusammenhang zwischen politischem Aufruhr und Hybris auch ders., Hybris, Revenge and Stasis in the Greek City-States, in: H. van Wees (Hg.), War and Violence in Ancient Greece, Guildford, Surrey 2000, 83-123. 13 Fisher, Hybris, 493: »The preceeding chapters have established beyond any doubt that the essence of hybris remained throughout these centuries the deliberate infliction of shame and dishonour; or, as Aristotle put it, ›Dishonour is characteristic of hybris‹.«
166
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Fishers Theorie zur Hybris basiert auf den Aussagen der Rhetorik des Aristoteles. Im zweiten Buch der Rhetorik entfaltet Aristoteles eine Art philosophischer Psychologie der Emotionen, die der geschickte Rhetoriker in seinem Sinne instrumentalisieren kann. In diesem Rahmen werden verschiedene Emotionen behandelt, die mit dem Gefühl der Ehre zusammenhängen, so unter anderem auch die Hybris. Aristoteles definiert sie folgendermaßen: œSTI G¦R ÛBRIJ TÕ PR£TTEIN KAˆ LšGEIN ™F' OŒJ A„SCÚNH œSTI Tù P£SCONTI, μ¾ †NA TI G…GNHTAI AØTù ¥LLO À Ó TI ™GšNETO, ¢LL' ÓPWJ ¹SQÍ: Oƒ G¦R ¢NTIPOIOàNTEJ OÙC ØBR…ZOUSIN ¢LL¦ TIμWROàNTAI. A‡TION DÒ TÁJ ¹DONÁJ TO‹J ØBR…ZOUSIN, ÓTI O‡ONTAI KAKîJ DRîNTEJ AÙTOˆ ØPERšCEIN μ©LLON.14 Es ist dieser von Aristoteles hergestellte Zusammenhang zwischen Hybris, verletzter Ehre und Rache, der zur These Fishers führt, die er mit einer beeindruckende Menge an Quellen belegen kann. Ohne die Voraussetzung einer ehrenhaften Gesellschaft gibt es für Fisher per definitionem keine Hybris. Ihre große Bedeutung entspricht dem Wert, den die Ehre für die athenische Gesellschaft hat. Denn Hybris ist »a concept of considerable moral and social significance, especially for societies like those of ancient (and modern) Greece, where individual honour was a ›value of universally accepted significance‹. Since outraged honour had potentially such disruptive and violent consequences, acts of hybris were often seen as causes of political unrest and of wars, and communities felt a strong need to restrict acts of hybris by law, and by other sanctions.«15 Es ist die fragile Gleichheit der Ehrenhaften, die für die Stabilität der Gesellschaft aufrechtzuerhalten ist. Um das Gleichgewicht der Kräfte in Athen nicht zu stören, müssen hybride Akte der jungen, reichen Männer auf ein Minimum reduziert werden.16 Das Gesetz gegen Hybris leistet einen Beitrag zur größeren Sicherheit der einzelnen Bürger vor Übergriffen und zu einem Gefühl der Gleichheit innerhalb der Polis. In diesem Sinne verhindert es nicht nur persönliche Feindschaften und erbitterte Kleinkriege der Bürger untereinander, sondern befördert Fisher zufolge den demokratischen Ge14 Aristot. rhet. 1378b23-26: »denn übermütige Behandlung liegt dann vor, wenn man jemandem etwas antut oder über ihn etwas redet, woraus demjenigen, der es erduldet, Schande entsteht, und zwar nicht, damit einem etwas anderes zuteil wird oder weil es einem selbst widerfahren ist, sondern nur um sich zu ergötzen; denn wer Vergeltung übt, behandelt nicht übermütig, sondern rächt sich nur. Der Grund für das Vergnügen, das den übermütig Handelnden zuteil wird, besteht darin, dass sie glauben, sie besäßen eine größere Überlegenheit, wenn sie anderen Übles antun.« 15 Fisher, Hybris, 1-2. Vgl. ebd., 498: »Overall, then, this study of hybris suggests, as does much other work, the importance of honour-based values inside and between Greek states; analysis needs to recognize the extent to which the drive for personal honour operated very strongly on all those engaged in public life«. 16 Ebd., 19-21.
Das Phänomen der Hybris
167
danken: »As we have seen, hybris is usually the offence of bringing home too forcibly a real or a self-asserted superiority over another; and in democratic gatherings it is regarded as particularly threatening, since it hits hard at the democratic principle that in important respects all citizens are to be treated as equals«.17 Eine der wichtigsten Funktionen der GRAF¾ ÛBREWJ besteht in der Möglichkeit des öffentlichen Anwurfs der Hybris in den athenischen Gerichtshöfen, wobei das Gesetz die Hybris zu einem strafrechtlichen Tatbestand macht. Letzteres erhöht die Eindrücklichkeit, mit der Akte der Hybris als sozial verdammenswert deklariert werden können: »it should be widely believed that acts of hybris can be satisfactorily dealt with in the courts.«18 Wegen der großen Bedeutung der in den Gerichtshöfen bestehenden Öffentlichkeit in einer ehrenhaften Gesellschaft passt dieser Gedanke gut in Fishers Prämisse, dass es sich bei der athenischen Gesellschaft um eine ehrenhafte gehandelt habe. Der grundlegende Nexus zwischen Hybris und Ehre wird von ihm durchgehend in den Quellen aufgefunden und auf theoretischer Ebene hergestellt. Fisher vernachlässigt allerdings den Begriff der Ehre, den er weder definiert noch ausführlicher bespricht. Seine Vorstellung der Wirkung von Ehre in der griechischen bzw. der athenischen Gesellschaft bleibt unbestimmt.19 Dazu trägt auch das Fehlen einer zeitlichen und räumlichen Differenzierung zwischen Homer und Aristoteles sowie zwischen den Verhältnissen in ganz Griechenland und jenen in der athenischen Polis bei.20 Die Veränderung einer ehrenhaften Gesellschaft aber ist eng mit einer Wandlung der Vorstellung von Ehre verbunden, und notwendigerweise auch mit einer Entwicklung des Begriffes der Hybris, wie Fisher ihn versteht. Das weitgehende Ausblenden der durch Ehre geprägten gesellschaftlichen Strukturen, die das Phänomen der Hybris erst erklärlich machen, führen zu einer konsistenten, wenn auch relativ frei schwebenden Auffassung von Hybris.21 Umso bemerkenswerter ist Fishers Beschreibung einiger durch diese Vorstellung von Hybris erklärlichen Verhaltensweisen der Athener in klassischer Zeit, die sich nahtlos in den Rahmen einer ehrenhaften Gesellschaft 17 Ebd., 65; vgl. ebd., 82: »Overall it did surely play a substantial part in the creation of a relatively democratic and egalitarian atmosphere in the social life of classical Athens.« 18 Ebd., 35; vgl. ebd., 62: »the law and the orators did conceive of hybris as an offence meriting public concern, and the lengthy disquisitions on the hybristic nature of their enemies ... provide in fact further evidence of the ways in which hybris, an offence against the honour of individuals, was felt to constitute a danger to society.« 19 Das Standardwerk Cohens, Law, konnte Fisher nach eigener Aussage nicht mehr rezipieren, ebd., 1, Anm. 2. 20 Ebd., 6. 21 Vgl. die Kritik von D.L. Cairns, Rez. N.R.E. Fisher, Hybris: A study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, in: ClR 44 (1994), 76-79.
168
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
einfügen. Leider bezieht der Autor die athenischen Gerichtsreden des 4. Jahrhunderts nicht mehr in seine Quellen ein, obwohl die Auswirkungen der Hybris auf der Ebene der sprachlichen und tätlichen alltäglichen Auseinandersetzung hier am besten zu fassen sind. Auch diese Einschränkung erklärt sich aus dem Unternehmen Fishers, eine Neudefinition des Begriffs der Hybris in Abgrenzung zur älteren Forschung zu installieren.22 Den Nachweis einer vorwiegend gesellschaftlichen und politischen Bedeutung der ÛBRIJ will er mit denselben Quellen zu führen wie die abzulösende These eines religiösen oder tragisch-moralischen Charakters der Hybris.23 Trotz Fishers recht allgemeiner Begrifflichlichkeit von Ehre erfasst er die Dynamik des ehrenhaften Verhaltens sehr gut. Bei der Besprechung der Handlungen von athenischen Männern in den Fällen des Eratosthenes, des Konon oder des Meidias, die Fisher im Zusammenhang mit seiner Analyse der GRAF¾ ÛBREWJ durchführt, kommt er zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Cohen später in seiner Studie zur Ehre.24 Beide Forscher unterscheiden sich vor allem in der Perspektive, die den Blick auf jeweils einen der beiden Begriffe der Achse Ehre–Hybris lenkt.25 Ihre Ergebnisse zeigen, wie eng die Begriffe der Hybris und der Ehre miteinander verbunden sind.26 Sie können zwar auf theoretischer Ebene getrennt werden, erhalten ihren Erklärungswert auf der Ebene des Verhaltens der Athener in den Quellen aber nur im Verbund. Cohen gehört zu jenen Forschenden, die sich nach Fisher mit dem Phänomen der Hybris beschäftigen und seine Interpretation der Hybris und der einzelnen Quellenstellen ihren Studien zugrundelegen. Sie setzten sich mit Fishers Vorgaben auseinander, indem sie den Begriff der Hybris präzisieren, ihn anders gewichten oder eine Neudefinition in Abgrenzung zu Fishers Thesen vorschlagen. Cohen legt für seinen Begriff der Ehre die Aus22 Als maßgeblich für die ältere Forschung, welche die Hybris vor allem als ein religiöses Vergehen sah, gilt L. Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique e morale en Grèce, Paris 1917, der das Gesetz gegen Hybris als Schutz der Polis betrachtet, 196: »Ainsi, lorsque la victime affirme que toute la cité a été lésée avec elle, ce n’est pas là un appel oratoire aux sympathies individuelles: une chose collective a été atteinte par le délit, un principe social qui exalte momentanément la valeur de l’individu e qui, d’un acte le plus souvent médiocre, peut faire un crime capital. Ce principe, c’est le principe religieux diffus dans toute la société.« 23 Fisher, Hybris, 3-4. 24 Ebd., 38-68; Cohen, Law, 90-130. 25 Fisher, Hybris, 1, Anm. 2, bezieht sich auf die verschiedene Vorarbeiten Cohens zu seiner umfassenden Studie, während Cohen, Law, vom früheren Erscheinen der Studie Fishers profitiert, passim, bes. in dem Kapitel zur Hybris, 143-162. Ein weiterer wichtiger Grund für die ähnliche Begrifflichkeiten ist das gemeinsame Fundament des aristotelischen Ansatzes. 26 Auch Cohen, Law, 161, kann Hybris nur im Rahmen einer ehrenhaften Gesellschaft begreifen: »Hubris, it has appeared, is a legal category which makes sense only in an agonistic society where the values of honor and shame, and the moral imperatives to which they give rise, play a central role.«
Das Phänomen der Hybris
169
sagen des Aristoteles zugrunde und betrachtet die Hybris deshalb, wie Fisher, als einen Anschlag auf die Ehre eines anderen. Die GRAF¾ ÛBREWJ bietet Cohen zufolge eine weitere Möglichkeit für die Ehrenmänner, ihre Auseinandersetzungen mit den Instrumenten der Polis zu führen.27 Die inhaltliche Unbestimmtheit des überlieferten Gesetzes und die fehlenden Fälle einer tatsächlich eingebrachten GRAF¾ ÛBREWJ behindern ihn in einer genaueren Klärung der als Hybris geltenden Sachverhalte.28 Ob ein Angeklagter der Hybris schuldig sei, konnten allein die athenischen Richter entscheiden: »The point to be emphasized is that in Athenian law hubris was defined by the normative expectations of those randomly selected citizens who represented the polis on a given day.«29 Cohen macht die in den Gerichtshöfen sitzenden Bürger damit zur öffentlichen Meinung, die über den sozialen Konsens einen Verstoß gegen die Norm der Ehre ahndet. Die Hybris wird damit als ein konkreteres Phänomen gekennzeichnet als die Ehre, sie ist gesetzlich fixierbar. Die Bestimmung der eigentlich hybriden Verhaltensweisen bleibt, analog zu den ehrenhaften Verhaltensweisen, dem sozialen Wissen und sozialen Konsens der athenischen Bürger überlassen. Den inhaltlichen Schwerpunkt eines Verhaltens, das Hybris konstituiert, setzt Cohen in seinem Kapitel zur Hybris auf sexuelle Übergriffe, die die Ehre einer Person beschädigen. Dabei kann das als Hybris gebrandmarkte sexuelle Verhalten eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Fällen umfassen. So fallen sowohl die Vergewaltigung von Frauen oder Kindern als auch der verbale Angriff auf die sexuelle Integrität eines freien Bürgers unter den Begriff der Hybris. Das hybride sexuelle Verhalten muss dabei nicht notwendig gewalttätig sein, denn die Verführung freier Frauen etwa und besonders das weite Feld der homoerotischen Beziehungen in Athen werden gleichermaßen mit dem Verdikt der Hybris belegt.30 Wie prekär ein Verstoß gegen die Norm der Ehre gerade im Bereich der Sexualität ist, zeigt Cohen zufolge die hohe Anzahl der in den Quellen überlieferten Fälle. Es ist eine der Hauptaufgaben des NÒμOJ ÛBREWJ, diese Angelegenheiten, bei 27 Cohen, Law, 162: »As a legal category, the prosecution for hubris must appear bizarre unless one views it as the institutionalized mediation of this agonistic realm of conflict, covering just the range of insults to honor which antrhopologists describe as provoking blood feud or blood revenge in agonistic societies.« 28 Ebd., 153: »The result of this situation is that unless we know of specific cases where a person accused of hubris was actually convicted we can not definitively say whether or not particular kinds of conduct were viewed as violating the statute. On the other hand, we similarly have no fixed criteria by which to exclude definitively almost any attested linguistic attribution of hubris.« 29 Ebd., 153. 30 Ebd., 147: »Indeed, contrary to conventional views, hubris can describe a wide range of heterosexual and homoerotic conduct which may either involve an element of coercion, or may be consensual.« Vgl. ders., Sexuality, 183-185.
170
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
denen die Ehre der gesamten Familie bzw. des Oikos auf dem Spiel steht, mit Hilfe der Instrumentarien der Polis zu regeln. Die Neigung der athenischen Bürger, Rache zu nehmen, ist in diesen Fällen ausgeprägt und kann eine ernste Bedrohung des öffentlichen Lebens darstellen: »Hubristic sexual aggression appears here as a transgression of social norms which dishonors its victims and their relations, and which gives rise to retaliatory or punitive responses which can escalate into full blood feud and engulf an entire community.«31 Insofern Fisher und Cohen die Aggression gegen andere betonen, die die Hybris umfasst, haben beide grundlegende Kritik durch Douglas M. MacDowell erfahren, der ein alternatives Konzept von Hybris verficht.32 Zwar hat er seine Position lange vor Fisher und Cohen veröffentlicht, in jüngster Zeit ist ihm allerdings Douglas L. Cairns zur Seite getreten, der seine These aufnimmt und ausbaut.33 MacDowell geht von der Beobachtung aus, dass nicht nur Menschen Hybris begehen können, sondern auch Tiere und Pflanzen.34 Die in den Quellen des 5. und 4. Jahrhunderts benannten Begleitumstände, die einen Akt der Hybris begünstigen oder hervorbringen, kann er auf eine Reihe von Faktoren reduzieren, die sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen: »The characteristic causes are youthfulness, having plenty to eat and drink, and wealth. The characteristic results are further eating and drinking, sexual activity, larking about, hitting and killing, taking other people’s property and privileges, jeering at people and disobeying authority both human and divine. ... Hybris is therefore having energy or power and using it self-indulgently.«35 MacDowell fokussiert mit dieser Beschreibung den Zustand einer Hybris begehenden Person, weniger die hybride Handlung selbst. Hybris ist gleichzusetzen mit einer bestimmten Disposition: »It means possessing a certain attitude of mind, self-indulgent egotism. An act is not an act of hybris unless it results from the appropriate attitude of mind.«36 Die Hybris einer Person äußert sich MacDowell zufolge in ihren Handlungen, diese müssen aber nicht, wie Fisher und Cohen meinen, gegen eine Person gerichtet sein. Die aus einer hybriden Disposition resultierenden Angriffe auf jemand anderen sind eine der möglichen Verhaltensoptionen, die als Hybris klassifiziert werden können, sie bilden aber nur einen kleinen Teil der Handlungen derer, die Hybris begehen. MacDowell spricht überhaupt nicht von der 31 32 33 34
Cohen, Law, 147. D.M. MacDowell, Hybris in Athens, in: G&R 23 (1976), 14-31. Douglas L. Cairns, Hybris, Dishonour, and Thinking Big, in: JHS 116 (1996), 1-32. MacDowell, Hybris, 15f. Vgl. A. Michelini, “5BRIJ and Plants, in: HSCP 82 (1978), 35-
44. 35 MacDowell, Hybris, 21. 36 Ebd., 27.
Das Phänomen der Hybris
171
Ehre, obwohl die von ihm beschriebene Disposition zur Hybris einem übersteigerten Ehrgefühl recht nahekommt. Anders als bei Fisher und Cohen kann ein Athener bei MacDowell die Hybris auch allein begehen, ohne eine andere Person zu involvieren. Geschieht das aber, so wird die zweite Person nicht durch die Hybris als Ehrverletzung geschädigt, sondern durch einen körperlichen Angriff. Es sind diese hybriden Akte der Gewalt, die die Hybris zu einer ernsten Bedrohung für die Mitmenschen und die Gemeinschaft machen.37 Der athenische NÒμOJ ÛBREWJ ahndet deshalb auch nur die Hybris, die sich schädigend gegen einen anderen richtet.38 Zwar geht auch MacDowell davon aus, dass das Gesetz deswegen so unspezifisch ist, weil es ein soziales Wissen darum gibt, was Hybris ist.39 Der große Nachteil und spärliche Gebrauch des Gesetzes aber erklärt sich daraus, dass vor den Geschworenengerichten dennoch bewiesen werden muss, dass es sich bei dem jeweiligen Affront um einen Akt der Hybris handelte: »An act of assault which is hybris is distinguished from an act of assault which is not hybris by the motive and state of mind of the offender.«40 Da diese Beweislast naturgemäß schwer wiegt, hatte der athenische NÒμOJ ÛBREWJ aus dem 6. Jahrhundert in klassischer Zeit keine nennenswerte Funktion mehr.41 MacDowell ordnet die Hybris nicht in einen größeren Zusammenhang der ehrenhaften gesellschaftlichen Strukturen Athens ein, deshalb kann das Gesetz für ihn keine übergreifende Schutzfunktion für die gesamte Gesellschaft haben. Das Fehlen einer gesamtgesellschaftlichen Einordnung der Hybris ist denn auch Cairns wesentlicher Kritikpunkt an der These MacDowells, die er im Übrigen gegen die Aussagen Fishers unterstützt.42 Es ist nicht schwierig, den Standpunkt MacDowells in den Termini der Ehre zu fassen und seine These in ein größeres gesellschaftliches Umfeld zu stellen. Nachdem Cairns das getan hat, kann er den Unterschied zu Fisher auf einen Punkt kondensieren: »But whereas Fisher demands a conscious intention deliber37 Ebd. 23: »But if a man uses his surplus energy in jeering or hitting or raping or killing, that does affect other people, and it is not surprising that these manifestations of hybris generally attract stronger criticism than those in which no victim is involved.« 38 Vgl. M. Gagarin, The Athenian Law against Hybris, in: G. Bowersock [u.a.] (Hg.), Arktouros. Festschrift Bernard M.W. Knox, Berlin/New York 1979, 229-236, 230: »A further restiction on the application of this law was that the injury done to another person probably had to be physical and not merely verbal. All certain examples of hybris subject to the law involve some physical injury«. 39 MacDowell, Hybris, 24: »The law makes no attempt whatever to define hybrizein. It takes for granted that everyone knows what the word means, and that it is unambiguous.« Vgl. auch J. Ober, Power and Oratory. Demosthenes 21, against Meidias, in: I. Worthington (Hg.), Persuasion. Greek Rhetoric in Action, London 1994, 85-108. 40 MacDowell, Hybris, 28. 41 Ebd., 26. 42 Cairns, Hybris, 32.
172
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
ately to insult a particular victim, I argue that hybris may be a subjective attitude or disposition which can be construed as an implicit affront. My emphasis is on that element of hybris which relates to one’s own honour, and I argue that the state of mind which over-values one’s own honour is decisive for hybris, even though hybris regularly involves an assault on the honour of others, and even though over-valuation of one’s own honour virtually always constitutes at least a potential affront.«43 Während Fisher die Verletzung der Ehre eines anderen als Hybris bezeichnet, bedeutet Hybris für Cairns lediglich die Überschätzung der eigenen Ehre, was zu einem Angriff auf die Ehre eines anderen führen kann, aber nicht muss. Der Unterschied zwischen beiden Positionen ist in der Tat nicht sehr groß, wie Cairns selbst zugibt.44 Er hat aber einige interessante Implikationen. So erklärt Cairns etwa die Hybris gegen die Götter als eine Überschätzung des menschlichen Status, der nicht unbedingt ein Affront gegen die Ehre der Unsterblichen sein muss. Da die Grenze zwischen Menschen und Göttern von letzteren allerdings eifersüchtig bewacht wird, damit niemandem Ehre zukomme, die ihm nicht gebührt, kann Hybris in diesem Sinne die Ehre der Götter beleidigen.45 Dabei ist hier nicht der Einbezug der religiösen Sphäre in den Begriff der Hybris von besonderem Interesse, sondern die Ausweitung des Kontextes, innerhalb dessen die Hybris erklärt wird. Neben der Ausstattung der Hybris mit einem moralischen Impetus erweitert sich auch ihre Wirkung auf das gesellschaftliche Feld. Cairns begreift die Hybris als integralen Bestandteil einer ehrenhaften Gesellschaft und verleiht ihr deshalb Züge, die auch dem ehrenhaften Handeln zu Eigen sind. Ohne die Vorstellung eines Nullsummenspiels der Ehre und einer grundsätzlichen Gleichheit aller Ehrenhaften sowie einem beständigen Agon um die Ehre ist auch die Vorstellung von Hybris in der athenischen Gesellschaft nicht erklärlich. Denn in einer ehrenhaften Gesellschaft hat die Überschätzung der eigenen Ehre fatale Konsequenzen: »Selfaggrandisement constitutes an incursion into the sphere of others’ honour, because the concept of honour is necessarily comparative.«46 Die Hybris bezeichnet damit lediglich die Übersteigerung des Ehrgefühls einer Person und die Konsequenzen, die das in einer ehrenhaften Gesellschaft haben 43 Ebd., 11. 44 Ebd. 45 Ebd., 17-22. Vgl. M.W. Dickie, Hêsychia and Hybris in Pindar, in: D.E. Gerber (Hg.), Greek Poetry and Philosophy. Studies in Honour of Leonard Woodbury, Chico, Calif. 1984, 83109, 104: »There are a number of other more concrete ways of describing the demeasure of hybris. It may be spoken of as discontent with one’s present lot, as thinking too great thoughts and as wanting too much. These are all ways of expressing a failure to comprehend the limits that define mortal existence.« 46 Cairns, Hybris, 32.
Das Phänomen der Hybris
173
kann. So gefasst, wird die fiktive Gleichheit der Ehrenhaften untereinander durch Hybris gestört, weniger die rechtlich-politische und ideologische Gleichheit der Polisbürger. Der NÒμOJ ÛBREWJ verteidigt in diesem Sinne nicht die Gleichheit der Polisbürger gegen die hybriden Übergriffe Ehrenhafter, sondern er versucht, die sich aus den agonalen Kämpfen um Ehre ergebenden Verwerfungen möglichst gering zu halten. Damit sind die Grundrichtungen der Forschung zur ÛBRIJ skizziert. Die wichtigsten Thesen beschäftigen sich mit der Art der Verbindung der Hybris mit dem Konzept der Ehre und mit dem Zusammenhang zwischen der Disposition des Hybris begehenden Atheners und den Auswirkungen seiner Handlungen auf andere. Diese Themen haben ihren Ursprung in der einschlägigen Stelle der aristotelischen Rhetorik, die den Grund für eine Theoretisierung der Hybris legt und in dem NÒμOJ ÛBREWJ, der eine ähnliche Interpretation begünstigt. Obwohl das Gesetz gegen die Hybris enorme Schwierigkeiten bereitet, verheißt es doch die Klärung einiger wichtiger Sachverhalte. Die Zitierung des Gesetzes gerade in der demosthenischen Rede Gegen Meidias verweist auf die enge Verbundenheit der Hybris mit der Ehre. Akzeptiert man diesen Nexus und begreift die Hybris als eine übersteigerte Form der Ehre, so erhält das Gesetz eine ähnliche Position zwischen der ehrenhaften Gesellschaft der Athener und der Gesetzgebung der demokratischen Polis, wie sie die gesamte Rede hat. Denn die Rede Gegen Meidias changiert gekonnt zwischen den Ansprüchen der Ehrenmänner Meidias und Demosthenes, die ihre Auseinandersetzung nach allen Regeln der Ehre führen, und den Normen der demokratischen Polis, deren Bürger die Adressaten der Ausführungen sein und sie gutheißen sollen. Die Überlieferung des NÒμOJ ÛBREWJ in der demosthenischen Rede gegen Meidias lässt keinen unmittelbaren Schluss auf die Entstehungszeit des Gesetzes zu. Der Datierungsversuche in der Literatur sind viele, zumeist erweisen sie sich als abhängig von den jeweiligen Thesen zum Inhalt und Nutzen des Gesetzes. Zur Debatte stehen vor allem zwei Vorschläge: Zum einen die Gesetzgebung durch Solon, der die Gemeinschaft der Bürger gegen das traditionell hybride Verhalten einiger Mitglieder der athenischen Oberschicht zu stärken beabsichtigte.47 Zum anderen die Gesetzgebung in perikleischer Zeit, deren Sinn unterschiedlich bewertet wird.48 In diesem 47 Fisher, Hybris, 68-82; O. Murray, The Solonian Law of Hybris, in: P. Cartledge, P. Millett und S. von Reden (Hg.), Kosmos. Essays in order, conflict and community in classical Athens, Cambridge 1998, 139-145, 140-142; MacDowell, Hybris, 26. 48 E. Ruschenbusch, “5BREWJ GRAF». Ein Fremdkörper im athenischen Recht des 4. Jahrhunderts v. Chr., in: ZRG. Rom.Abt. 82 (1965), 302-309, grenzt den Zeitraum auf die Jahre zwischen 450 und 422 ein, 207, und erklärt das Gesetz als »eine Ergänzung der bisherigen Gesetze wegen Vergehens gegen die Person«, 304, wobei dieser Sinn dann bei den juristisch wenig versier-
174
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Zusammenhang fungiert auch die Klausel ™£N TIJ ØBR…ZV E‡J TINA ... À PAR£NOμÒN TI POI»SV E„J ... TIN£ als Variable, denn das gesetzeswidrige Verhalten kann sich sowohl auf geschriebene wie auch auf ungeschriebene Gesetze, also soziale Normen, beziehen. Nimmt man an, dass es sich um die geschriebenen Gesetze Athens handelt, so überlappt sich die GRAF¾ ÛBREWJ mit vielen anderen Verfahren, die gegen einen Angriff wider die Person eingebracht werden konnten – das gilt insbesondere, wenn man das Gesetz in das 5. Jahrhundert datiert. Bezieht sich der Terminus PAR£NOμON auf die sozialen Normen, so unterstreicht das die Frage nach der Art des Vergehens, das vorliegen muss, um eine GRAF¾ ÛBREWJ einbringen zu können und nach der Möglichkeit des Beweises dafür.49 Die Schwierigkeit, die Hybris einer Person zu beweisen, könnte der Grund dafür sein, dass die Einbringung einer GRAF¾ ÛBREWJ so selten belegt ist.50 Einerseits verstärkt der Mangel an nachvollziehbaren Verfahren den Eindruck, bei dem Gesetz habe es sich um eine übergreifende Schutzmaßnahme für die Polisgemeinschaft gehandelt.51 Dafür spricht schon die Einrichtung der Klage als eine GRAF», mit der das Vergehen als ein öffentliches klassifiziert wird. Außerdem scheint die Nennung verschiedener Gruppierungen wie der Frauen, Kinder und Sklaven, die nicht zur Polisbürgerschaft gehören, ein universell verankertes Grundrecht aller Einwohner Athens zu garantieren. Explizit wird auch die Hybris gegen Nicht-Bürger als ein strafbares Vergehen behandelt, was die Frage aufwirft, wie die Ehre eines Sklaven verletzt werden kann.52 Auf der anderen Seite bleibt es erklärungsbedürftig, dass ein Gesetz, das die Gemeinschaft vor offensichtlich so bedrohlichen Gefahren schützen sollte, dermaßen selten angewandt worden
ten athenischen Geschworenen allmählich in Vergessenheit geraten ist, 308. M. Gagarin, The Athenian Law against Hybris, in: Bowersack, Arktouros, 229-236, 234, datiert das Gesetz in die Mitte des 5. Jahrhunderts und betont seine harten Strafen gegen nicht provozierte Angriffe, 232236. 49 Vgl. MacDowell, Hybris, 26: »we must remember that nomos can also mean an unwritten rule or custom or convention. The purpose of our law is to forbid hybris or ›any improper behaviour‹. That is still a very vague phrase ... Whether a particular act does amount to improper behaviour is left to the court to decide.« 50 Vgl. die Auflistung bei R. Osborne, Law in Action in Classical Athens, in: JHS 105 (1985), 40-58, 56: Einige Redner sprechen von ihnen bekannten Fällen, in denen eine GRAF¾ ÛBREWJ eingebracht wurde, so Is. 8, 41; Demosth. 45, 4, ein direkterer Nachweis fehlt. Vgl. die kurze Besprechung dieser Fälle N. Fisher: The law of hubris in Athens, in: Cartledge, Nomos, 123-138, 125f. 51 Fisher, Hybris, 46; Murray, Law, 144; Cantarella, Spunti, 90-91 52 Vgl. Fisher, Hybris, 59: »some brutal and degrading physical maltreatment, or non-judicial torture, could seem to be a denial of a slave’s status and honour as human beings, and therefore could be hybris, especially if done, as it might well be, for the sadistic delight in exercising such power.« Vgl. dagegen Murray, Law, 145.
Das Phänomen der Hybris
175
ist. Es scheint, als habe die Existenz des NÒμOJ ÛBREWJ allein eine Abschreckung potentieller Täter bewirkt.53 Die Überlegungen zu diesem Punkt verlaufen analog den Auseinandersetzungen um den Charakter der Hybris als der Disposition eines Akteurs, die einen Affront gegen jemand anderen zur Folge haben kann, oder aber als der Intention einer Handlung, die sich gegen die Ehre eines anderen richtet. Beide Ansätze machen die Hybris zu einem Charakteristikum von Handlungen, nicht zur Handlung selbst. Das als Hybris bezeichnete Verhalten kann eine Reihe von verschiedenen Verhaltensweisen umfassen.54 Entsprechend unspezifisch ist der NÒμOJ ÛBREWJ gehalten. Einige Studien tendieren zur Bewertung des Gesetzes als einer Absichtserklärung, deren Stärke in ihrem normativen Charakter liegt, die aber auf alltäglicher juristischer Ebene nicht wirklich anwendbar ist.55 Denn obwohl das Vergehen der Hybris und die Möglichkeit der Klage gegen Hybris in den Quellen vielfach besprochen werden, haben die Athener in fast jedem konkreten Fall die Einbringung einer D…KH vorgezogen. Die Vorzüge einer D…KH A„KE…AJ etwa im Vergleich mit der GRAF¾ ÛBREWJ liegen für den Kläger darin, dass er nicht das Risiko eingeht, für das Einbringen einer belanglosen Klage Strafe zahlen zu müssen, und vor allem darin, dass bei erfolgreicher Prozessführung das Strafgeld des Angeklagten in seine Taschen fließt und nicht an die Polis geht.56 Noch ist die Forschung von einer mehrheitlich akzeptierten, überzeugenden Lösung dieser kniffligen Fragen entfernt. Das Problem besteht wesentlich in der Quellenlage, wobei die unterschiedlichen theoretischen Ansätze zur Klärung des Phänomens der Hybris häufig in den verschiedenen Perspektiven der Forschenden liegen. Unabhängig davon können einige grund53 Gagarin, Law, 235f. 54 Ruschenbusch, “5BREWJ 'RAF», 303, sieht diesen Unterschied auf juristischer Ebene: »Allen diesen Ansichten ist nun ... gemeinsam, dass die Hybris nicht so sehr als ein eigener Tatbestand, sondern als ein Tatbestandsmerkmal betrachtet wird, derart, dass die Hybrisklage stets an die Stelle anderer Klagen tritt, wenn das jeweilige Vergehen ˜F' ÛBREI begangen worden ist.« 55 Fisher, Hybris, 67: »But the threat of bringing a graphe hybreos, and still more the use of the rhetoric of hybris in and out of the courts, whatever actual charge was brought, as we see it used in the speeches ... is very likely to have had no little effect both in reducing the amount of hybristic behaviour, and in achieving some verdicts in the courts and damaging the reputations of those accused of such behaviour in a variety of trials.« Vgl. D. Cohen, Sexuality, Violence, and the Athenian Law of Hybris, in: G&R 38 (1991), 171-188, 186: »Indeed, rather than seeing the law as instituting the absolute suppression of private violence, Athenian society incorporated litigation into its agonistic framework as an alternative, and considerably less risky, channel for the imperatives of honour.« 56 Vgl. ebd., 66; Gagarin, Law, 234f.; MacDowell, Law, 132: »Athenians thought honour and reputation important, but that does not mean that they ignored opportunities for material profits. Hybris was a fine subject for rhetorical denunciation, but for the practical purposes of the courts the other procedures for dealing with assault and abuse were more precise and more profitable.«
176
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
legende Aussagen zur Vorstellung von Hybris in Athen als gesichert gelten. Im Folgenden soll gezeigt werden, was diese Erkenntnisse über die Hybris zu einem besseren Verständnis der Ehre in der athenischen Gesellschaft beitragen. Unbestritten ist der Zusammenhang zwischen einer ehrenhaften Gesellschaft und dem Vergehen der Hybris. Trotz einiger Bedeutungswandlungen hat Hybris von homerischer Zeit an bis ins 4. Jahrhundert hinein immer eine negative, wertende Bedeutung. Offensichtlich ist Hybris mit der Ehre enger verbunden als mit der Polis, deren Ordnung sich später entwickelte. Auffällig sind ferner die Gemeinsamkeiten zwischen der Ehre und Hybris: Beide resultieren aus bestimmten Verhaltensweisen, die alle Athener als ehrenhaft bzw. als hybrid erkennen. Das legt den Schluss nahe, dass es sich bei Hybris um einen Verstoß gegen die Norm der Ehre handelt. Dieser ist so gravierend, dass er das fragile Gleichgewicht der durch Ehre strukturierten Gesellschaft aus der Balance bringen kann. Ebenso wie die habituellen Formen die Ehre eines Mannes konstituieren, so kann auch ihre Nichtbeachtung zu ernsthaften Störungen innerhalb der durch die Ehre geregelten sozialen Beziehungen führen. Das gilt schon für die Überschätzung der eigenen Ehre, nach MacDowell und Cairns das kennzeichnende Merkmal der Hybris. Denn da es sich bei der Ehre um ein Nullsummenspiel handelt, bedeutet die überproportionale Einschätzung der eigenen Ehre eine entsprechende Unterschätzung der Ehre der anderen.57 Die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes aller Ehrenhaften untereinander macht einen Agon um die Ehre überflüssig und beeinträchtigt so ein weiteres wichtiges Feld der ehrenhaften Betätigung.58 Auch der direkte Affront gegen die Ehre eines Mannes, als die Fisher und Cohen die Hybris fassen, kann leicht eine Dynamik in Gang setzen, die einen ehrenhaften Konflikt außer Kontrolle geraten lässt. Die wechselseitigen Akte der Vergeltung tragen nur bis zu einem gewissen Grad zur Ehre der Beteiligten bei, ihre Übertreibung zeitigt dagegen eher dysfunktionale Effekte für die gesamte Gesellschaft. Obwohl der Tatbestand der Hybris immer als gefährlich für die Ordnung der Ehre galt, ist die GRAF¾ ÛBREWJ mit ihren radikalen Sanktionsmög57 Cairns, Rez. Fisher, 79: »excessive self-assertion inevitably has an impact on the honour of others; if A overvalues himself as a bearer of honour than he implicitly under-values other members of the group who will not accept that the gap between A and themselves is as wide as A thinks it is.« 58 Cantarella, Spunti, 94: »Abbiamo già accennato a come fosse difficile l’equilibrio fra la necessità di mantenere una TIμ», la cui esistenza era legata al possesso e all’esercizio delle virtù competitive, da una parte, e, dall’altra la necessità di rispettare la regola secondo la quale non bisognava offendere la TIμ» altrui: e il concetto di ÛBRIJ, forse, nel momento della sua nascita, è legato proprio al mantenimento di questo equilibrio.«
Das Phänomen der Hybris
177
lichkeiten gegen Hybris begehende Athener relativ jungen Datums. Gleich ob das Gesetz aus solonischer oder perikleischer Zeit stammt, ein Zusammenhang mit der Entwicklung der Polis scheint evident, da sich in beiden Phasen grundlegende Verfassungselemente konstituierten. Durch die Fixierung der Hybris als ein gesetzlich anerkanntes Vergehen greift die Polis ein ungeschriebenes Gesetz auf, das innerhalb der ehrenhaften Gesellschaft Athens existiert und macht es zu einem Polisgesetz. Dieses ungeschriebene Gesetz lautet, die Normen der Ehre einzuhalten. Ein gravierender Verstoß gegen die soziale Norm der Ehre wird so zu einem Straftatbestand innerhalb der Polis. Die als Hybris bezeichneten Verhaltensweisen beziehen sich dabei zumeist auf eine Fehleinschätzung entweder der eigenen Ehre oder der Ehre eines anderen. Aus dem mangelnden sozialen Wissen um die Position jedes Mitgliedes einer ehrenhaft strukturierten Gesellschaft resultiert ein Verhalten, das als unangemessen gilt, weil es weder der eigenen noch der Ehre des anderen gerecht wird. Ein geläufiges Beispiel für die falsche Einschätzung der Ehre eines Mannes ist die Unterschätzung seiner Ehre. Naturgemäß ist es der Hybris erleidende Mann, den dieses Verhalten am meisten stört. Er ist nun herausgefordert, auf die Anmaßung seines Gegners entsprechend zu reagieren, indem er sich ebenso wie dieser verhält, idealiter dessen Hybris noch steigert und wieder gegen ihn richtet. Der Prozess der wechselseitigen Racheakte ist durch kaum ein Verhalten so leicht zu beginnen wie durch einen Akt der Hybris. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe der Polis als politischer und gesellschaftlicher Ordnung, durch Hybris gekennzeichnetes Verhalten zu unterbinden. Neben den hybriden Verhaltensweisen, die im Rahmen eines Agons um die Ehre stattfinden können, gibt es offenbar ein als Hybris bezeichnetes Verhalten, das sich nicht auf an Ehre Gleiche bezieht. Der NÒμOJ ÛBREWJ spricht explizit auch von Frauen, Kindern und Sklaven, gegen die Hybris verübt werden kann, aber nicht soll. Will man nun nicht annehmen, dass es sich um ein Verbot der Ausübung von Hybris durch einen Sklaven gegen eine Sklaven handelt, so muss die Hybris ein Verhalten darstellen, das sich potentiell gegen jeden richten kann. Die Fehleinschätzung der Ehre irgendeines Mitgliedes einer ehrenhaften Gesellschaft kann Handlungen generieren, die jeden betreffen können. Bezogen auf die Frauen athenischer Bürger wird in den Quellen zumeist dort von Hybris gesprochen, wo ihre sexuelle Ehre auf dem Spiel steht oder beschädigt worden ist.59 Ähnlich ist es bei den Sklaven und Kindern: auch hier spielt die sexuelle Ehre eine große Rolle. Nicht nur die Unterschätzung der Ehre eines anderen, auch deren 59 Die Ehre der Bürgerfrauen wird bereits durch das Eindringen nicht verwandter Männer in den Oikos gefährdet, vgl. Demosth. 21, 78-79; 47, 36-38. 56-59. 67. 80; Lys. 3, 6.
178
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Überschätzung bzw. Fehleinschätzung der eigenen Ehre ist bezüglich des sexuellen Verkehrs athenischer Männer mit Sklaven oder Kindern von Belang.60 Die Hybris besteht in solchen Fällen in der Nichtbeachtung des ehrenhaften Status einer Person innerhalb einer ehrenhaften Gesellschaft, so vergleichsweise gering er auch sein mag. Die Hybris erweist sich für eine ehrenhafte Gesellschaft als so dysfunktional, weil sie ihre Ordnung nachhaltig zu stören vermag. Das Nebeneinander einer relativ starren Hierarchie und einer fiktiven Gleichheit in einer ehrenhaften Gesellschaft ist sehr anfällig für Irritationen gerade in diesem Bereich. Das agonale Wetteifern der athenischen Männer um die Ehre hat nur Sinn, wenn sie ihre Konkurrenten zwar einerseits als gleiche betrachten, andererseits aber die Möglichkeit vor Augen haben, sie zu übertrumpfen und mehr Ehre zu erringen als alle anderen. Das soziale Wissen um die Norm der Ehre umfasst deshalb primär die angemessene Einschätzung der Ehre eines jeweils anderen Mitgliedes der Gesellschaft. Der Habitus eines Ehrenmannes zeichnet sich durch die Demonstration eines bestimmten Anspruches auf die ihm zukommende Ehre in Relation zu anderen aus. Da es sich bei der Hybris um ein Vergehen handelt, das die ehrenhafte Ordnung gefährdet, profitieren vom NÒμOJ ÛBREWJ in der athenischen Polis die Athener, die ein Interesse an einer wohlgeordneten, durch Ehre verfassten Gesellschaft haben. Weil das auffälligste Merkmal der Ehre im Gegensatz zur Polis eine hierarchische soziale Ordnung und die nicht in Frage zu stellenden Privilegien der Oberschicht sind, handelt es sich offenbar um jene, die durch den Gleichheitsgrundsatz, der in der Polis herrscht, am meisten zu verlieren haben, ergo um die besonders ehrenhaften Männer der athenischen Oberschicht. Ihnen bestätigt der NÒμOJ ÛBREWJ die Gültigkeit der Norm der Ehre auch im Rahmen der Polis.61 Schon bei Homer werden die Gefahren der Hybris für die Ehrenmänner und die gesamte Gemeinschaft reflektiert. Es wird deshalb nicht schwer gewesen sein, einen sozialen Konsens über die Strafwürdigkeit der Hybris zu erzielen. Neu ist dabei nur, dass die Hybris eines Mannes nicht nur sozial, sondern auch gesetzlich mit negativen Sanktionen belegt werden kann. Die mit dem NÒμOJ ÛBREWJ erfolgte Verankerung der Normen der Ehre in der Polis kommt vor allem den traditionell ehrenhaften Mitgliedern der Oberschicht 60 Cohen, Law, 158: »Given the social prominence of paederasty at Athens it would make perfect sense for the law of hubris to have dealt with the problems treated in modern systems under the rubric of statutory rape.« Vgl. K.J. Dover: Homosexualität in der griechischen Antike, München 1983, 39-43. 61 Vgl. Fisher, Hybris, 494: »the fundamental importance of the honour of the individual citizen was fully recognized by the lawmakers and by the community as a whole. Where we might talk of the basic rights of the citizen not to be abused or exploited or treated violently, Greeks often preferred to express such ideas in terms of honour and shame«.
Das Phänomen der Hybris
179
zugute und erst in zweiter Linie den einfachen Polisbürgern. Letzteren bietet es einen Schutz ihrer Ehre vor den Übergriffen einiger Ehrenmänner, die ihre eigene Ehre überschätzen. Die eigentlichen Kämpfe um die Ehre aber finden in den Reihen der Mitglieder der athenischen Oberschicht statt. Männer wie Demosthenes, Ariston oder Euphiletos haben nun die Möglichkeit, ihre Auseinandersetzungen vor Gericht auszutragen. Durch das Einbringen einer GRAF¾ ÛBREWJ kann ein Ehrenmann auf den hybriden Angriff eines anderen reagieren, ohne selbst – im Sinne des reziproken Erwiderns eines Affronts – Hybris begehen zu müssen. Das Gesetz gegen die Hybris beseitigt die letzten Zweifel, dass Ehrenhändel im Rahmen der Polis ausgetragen werden können. Eine Verhandlung vor dem öffentlichen Tribunal der Geschworenengerichte Athens kann eine adäquate Art der Vergeltung auf den hybriden Angriff eines rivalisierenden Mannes sein. Die Quantität und Gleichheit der athenischen Richter in einem solchen Prozess machen das Urteil gleichbedeutend mit dem sozialen Konsens, dessen die Anerkennung der Ehre eines Mannes bedarf. Die Gleichheit aller Beteiligten an diesem Gerichtsverfahren ist eine demokratische, nicht eine ehrenhafte, wie sie streng genommen für die Beurteilung der Ehre eines anderen notwendig ist. Dennoch ist das Urteil der an Ehre möglicherweise unterlegenen athenischen Geschworenen für die Ehre der Kontrahenten ausschlaggebend. Denn einerseits überwiegt die politische Gleichheit aller Polisbürger in den demokratischen Gremien die tatsächlich bestehende Ungleichheit an Ehre. Und andererseits fällt es den überlegenen Ehrenmännern nicht schwer, die Gleichheit mit allen Polisbürgern zu akzeptieren, weil auch die Gleichheit der Ehrenhaften untereinander immer eine fiktive ist. Das athenische Gesetz gegen die Hybris bestätigt die Bedeutung der Ehre und macht sie zu einer Angelegenheit, über die in der Polis verhandelt werden kann. Die ehemals soziale Domäne der Agone um die Ehre wird damit politisiert und erhält einen rechtlichen Rahmen. Die GRAF¾ ÛBREWJ zeigt, wie wichtig eine ausbalancierte, durch Ehre strukturierte gesellschaftliche Ordnung für die Polis ist. Mit den Institutionen der athenischen Demokratie können schwerwiegende Verstöße gegen die Normen der Ehre geahndet werden, die ehrenhaften Verhaltensweisen bekommen so eine rechtliche Relevanz. Indes scheint diese Einbindung des Vergehens der Hybris in den juristischen Apparat der Polis keine überwältigende Resonanz erzeugt zu haben. Die Verfahren einer GRAF¾ ÛBREWJ fanden wohl auch deshalb so selten statt, weil die Ehre und die Hybris in der Vorstellung vieler Zeitgenossen eben doch einen rechtsfreien Raum darstellten, den es mit eigenen Mitteln, ohne die Hilfe Dritter zu gestalten galt. Das Gesetz hatte demnach eine eher ideologische Funktion zwischen der Regelung von ehrenhaften Streitigkei-
180
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
ten auf eigene Faust und der pragmatischen Wahl einer D…KH A„KE…AJ, die eine finanzielle Kompensation versprach: Der NÒμOJ ÛBREWJ kennzeichnete die Hybris unmissverständlich als ein Vergehen gegen die gesamte Gemeinschaft der Athener. Diese Stigmatisierung machten sich vor allem die athenischen Redner zunutze. Auch ohne das Einbringen einer GRAF¾ ÛBREWJ konnte die Hybris als ein Verhalten gegeißelt werden, das die gesamte Polisbürgerschaft betraf und gefährdete. Der Verweis auf das Gesetz versicherte den Athenern, dass es sich nicht nur um einen Verstoß gegen die Norm der Ehre handelte, die den jeweiligen Streithähnen ihre herausgehobene Position einbrachte, sondern um eine wirkliche Bedrohung der gemeinsamen Ordnung. So bedeutete der in den Gerichtsreden so häufig verwandte Anwurf der Hybris gegen einen Gegner, dass dieser in schwerwiegender Weise die Normen der Ehre missachtet hatte. Die Annäherung der normativen Erwartungen von Ehre und Polis scheint dazu geführt zu haben, dass zunehmend auch Verstöße gegen die politische Ordnung und gegen die Bürgerschaft mit dem Verdikt der ÛBRIJ belegt wurden.62 Da die Normen auf sprachlicher Ebene kaum reflektiert werden, verlässt sich der Redner auf das soziale Wissen der Athener darum, welches Vergehen vorliegt und wie schwer es wiegt. Der Vorwurf der Hybris an einen Gegner wird zu einer nicht fassbaren Suggestivformel, die eine namenlose Bedrohung für die gemeinsame gesellschaftliche Ordnung beschwört.
62 Demosth. 21, 34: E„ DÒ CORHGÕN ÔNTA ØμšTERON ƒEROμHN…AJ OÜSHJ P£NQ' ÓSA ºD…KHKEN ØBR…SAJ FE…NETAI, DHμOS…AJ ÑRGÁJ KAˆ TIμWR…AJ D…KAIÒJ ™STI TUGC£NEIN: ¥μA G¦R Tù $HμOSQšNEI KAˆ Ð CORHGÕJ ØBR…ZETO. »Wenn er hingegen erwiesener Maßen alle jene Beleidigungen zur Zeit des Festes an eurem Choregen verübt hat, so hat er den öffentlichen Unwillen und öffentliche Züchtigung verdient: denn in der Person des Demosthenes ist zugleich auch euer Choreg beschimpft worden«; vgl. ebd., 32: ÓTI TOÝJ NÒμOUJ ½DH Ð TOàTO POIîN PROSUBR…ZEI KAˆ TÕN ØμšTERON KOINÕN STšFANON KAˆ TÕ TÁJ PÒLEWJ ÔNOμA: »Weil, wer dies tut, zugleich auch die Gesetze beschimpft und euren gemeinsamen Kranz und die öffentliche Autorität«.
Atimie als Schande
181
2. Die Polis als Bedrohung der Ehre: Atimie als Schande Die Vorstellung der Ehre bezieht ihre normative Kraft aus der Möglichkeit, die Ehre zu verlieren. Der Zustand einer Person, deren Ehre beschädigt oder verloren ist, wird als Schande bezeichnet, die ungleich der Hybris nicht aus einem vermeintlichen Zuviel, sondern aus einem Zuwenig an Ehre resultiert. Die Schande einer Person ist die Folge einer Entehrung bzw. einer Ehrverletzung, sie bezeichnet ein Defizit an Ehre. Wie durch die Hybris, so kann auch durch die Schande einer Person das prekäre Gleichgewicht einer ehrenhaften Gesellschaft, das auf der Annahme der grundsätzlichen Gleichheit aller Ehrenmänner beruht, aus der Balance geraten. In einer ehrenhaften Gesellschaft besteht vor allem für die Frauen die Gefahr, in Schande zu geraten, aber auch für die Männer bleibt die Scham ein Teil ihres Ehrgefühls. Die Bedeutung von Scham bzw. Schande für einen Mann von Ehre und für die gesamte Gesellschaft machen zwei definitorische Aspekte deutlich, die das Phänomen einerseits kognitiv-emotional, andererseits gesellschaftlich-funktional betrachten. Als individueller Affekt gefasst, wird unter Scham die Reaktion einer Person auf die Diskrepanz zwischen idealer und tatsächlicher Identität verstanden. Scham kann auftreten, wenn es einer Person nicht gelungen ist, der Norm der Ehre gerecht zu werden und dem Anspruch auf Ehre, den er formuliert hat, entsprechend zu handeln.63 Das Vermeiden dieses Affektes der Scham zeigt, dass ein Mann seine Ehre wertschätzt und das konstitutive Urteil der Öffentlichkeit über sie anerkennt.64 Die Funktion der Schande für die gesamte Gesellschaft ist eine stabilisierende, weil sie die Einhaltung der Normen der Ehre sichert. Die Zuschreibung von Schamlosigkeit an eine Person bedeutet, dass sie weniger um ihre Ehre besorgt ist, als sie es sein müsste, und dass sie das Spiel um die Ehre nicht nach den Regeln spielt.65 Für einen Ehrenmann ist 63 Goffman, Stigma, 11, spricht von einer »Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität«; vgl. Campbell, Honour, 307-310; Gilsenan, Lying, 204-206; Newbold, Sensitivity, 40: »Broadly, shame is experienced when, in the eyes of others or of ourselves, we fail to measure up to some ideal.« 64 Nach Pitt-Rivers, Status, 42, handelt es sich um einen »concern for repute, both as a sentiment and also as the public recognition of that sentiment. It is what makes a person sensitive to the pressure exerted by public opinion.« Vgl. du Boulay, Portrait, 104: »to have a sense of shame is to be aware of the significance of honourable and dishonourable actions, and to prefer the former.« 65 J.C. Baroja, Honour and Shame: A Historical Account of Several Conflicts, in: Peristiany, Honour, 79-137, 87: »›Shame‹ depicts for us the basis of an honourable life, and ›shamelessness‹ the road to infamy.«; Vgl. Herzfeld, Poetics, 233f. Das Verdikt der Schamlosigkeit kann auch auf Frauen angewandt werden, vgl. Campbell, Honour, 311: »She is also a girl ›with shame‹ in the sense that she carefully conforms to a strict code of modest behaviour and movement.«
182
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
eine schamlose Person deshalb nicht satisfaktionsfähig, sie partizipiert nicht an der Gleichheit aller Ehrenhaften.66 In den Quellen erscheint die Schande zumeist als ein Zustand, vor dem gewarnt wird und der gefürchtet ist, oder als der Vorwurf von Schamlosigkeit an einen persönlichen Feind.67 Die Zuschreibung von A„DèJ oder A„SCÚNH an eine Person bedeutet, dass sie die Norm der Ehre verfehlt hat.68 Abgesehen von der Warnung vor ihr wird die Schande auf sprachlicher Ebene von den Betroffenen selten reflektiert. Sie stellt für jede ehrenhafte Person eine latente Bedrohung dar, die eintritt, wenn die Normen der Ehre missachtet werden. Entsprechend findet sie am häufigsten als zu vermeidendes Übel in den Quellen Erwähnung. Die Schande einer Person äußert sich nicht in bestimmten, beobachtbaren Handlungen, wie das etwa die Hybris oder die Rache tun, sie ist eher Folge der Handlungen anderer, so etwa der Hybris eines anderen.69 In dieser Hinsicht wird sie in den Quellen 66 Pitt-Rivers, Status, 50: »The shameless escape for the obvious reason that people who have no honour cannot be stripped of it.« Vgl. Bourdieu, Entwurf, 11-18, der paradigmatische Fälle von schamlosen Personen in der kabylischen Gesellschaft beschreibt: »Amahbul – das ist der schamlose und freche Mensch, der die Grenzen des Anstands ....überschreitet, der eine willkürlich angeeignete Gewalt zu Taten missbraucht, die im Gegensatz zu dem stehen, was die Lebenskunst lehrt. Man geht diesen Imahbal ... aus dem Wege, weil man eine Auseinandersetzung mit ihnen lieber vermeidet, weil die Schande ihnen nichts anhaben kann, weil derjenige, der sich mit ihnen einließe, auf alle Fälle verlieren würde, auch wenn er das Recht auf seiner Seite hätte.« 67 Dem Zustand der Schande verfallen Männer, die Fahnenflucht begehen, vgl. Hom. Il. 15, 655-658; 6, 441-443. Das Misslingen einer wichtigen Mission wird von Agamemnon in ähnlichen Begriffen gewertet, ebd. 2, 114-119: NàN DÒ KAK¾N ¢P£THN BOULEÚSATO, KA… μE KELEÚEI DUSKLšA ”!RGOJ ƒKšSQAI, ™PEˆ POLÝN êLESA LAÒN. ... A„SCRÕN G¦R TÒDE G' ™STˆ KAˆ ™SSOμšNOISI PUQšSQAI. »Jetzt aber sann er bösen Betrug und heißt mich ruhmlos nach Argos kehren, nachdem ich viel Volk verloren. ... Denn schimpflich ist dies, auch für die Späteren zu erfahren«. Auch bei Thukydides bezieht sich A„SCÚNH auf die Feigheit vor dem Feind, Thuk. 6, 13. Für eine detaillierte Behandlung des jeweiligen Kontextes, in dem Begriffe wie A„DèJ, A„SCRÒN oder A„SCÚNH in den Quellen eine Rolle spielen, vgl. Cairns, Aidôs, sowie C.E. von Erffa, !)$73 und verwandte Begriffe in ihrer Entwicklung von Homer bis Demokrit, Leipzig 1937, die beide den gesamten Zeitraum von Homer bis ins 4. Jahrhundert abdecken. 68 Eine Verletzung der Gastfreundschaft bedeutet für Penelope ein normwidriges Verhalten, sie schilt ihren Sohn: OŒON D¾ TÒDE œRGON ™Nˆ μEG£ROISIN ™TÚCQH, ÖJ TÕN XE‹NON œASAJ ¢EIKISQ»μENAI OÛTWJ. PîJ NàN, E‡ TI XE‹NOJ ™N ¹μETšROISI DÒμOISIN ¼μENOJ ïDE P£QOI USTAKTÚOJ ™X ¢LEGEINÁJ; SO… K' AÍSCOJ LèBH TE μET' ¢NQRèPOISI PšLOITO. Hom. Od. 221-225: »Welch unwürdige Tat ist hier im Saale geschehen! Da man den Fremdling so sehr misshandelte, saßest du ruhig? Aber wie? wenn ein Fremdling bei uns in unserem Hause Hilfe sucht, und dann so schnöde Beleidigung duldet! Dieses bringt dir ja Schimpf und Verachtung unter den Menschen!« 69 Diesen Apekt betont Aristoteles bei seiner Behandlung der A„SCÚNH, Aristot. rhet. 1384a 15-18: P£SCONTEJ DÒ À PEPONQÒTEJ À PEISÒμENOI T¦ TOIAàTA A„SCÚNONTAI ÓSA E„J ¢TIμ…AN FšREI KAˆ ÑNE…DH: TAàTA D' ™STˆ T¦ E„J ØPHRET»SEIJ À SèμATOJ À œRGWN A„SCRîN, ïN ™STIN TÕ ØBR…ZESQAI. »Scham aber empfindet man dann, wenn man solches, was zu Verlust der Ehre und zu Verhöhnung führt, erlitten hat bzw. erleidet oder erleiden wird. Dazu aber gehören alle Akte der Person bzw. Ergebnisse schändlicher Handlungen, die auf den Dienst und die Unterwürfigkeit zielen: z. B. das Erdulden übermütiger Behandlung.«
Atimie als Schande
183
fassbar: Die Athener vor Gericht, deren Prozesse einen Versuch der Wiederherstellung ihrer Ehre darstellen, befinden sich in einem defizitären Zustand, in den sie durch die Ehrverletzung ihrer Gegner geraten sind. Besonders die Verhandlungen um die angegriffene Ehre des Demosthenes, des Ariston und des Euphiletos zeigen athenische Männer, die sich zumindest temporär im Zustand der Schande befinden. Die Reden dieser Athener können daher Auskunft geben über das negative Pendant zur Ehre. Es gilt zu untersuchen, wie die athenischen Ehrenmänner mit Ehrverletzungen umgehen und wie sie versuchen, ihre Ehre wiederherzustellen. Da sie sich vor Gericht befinden, ist es offenbar auch im Umgang mit einem Defizit an Ehre möglich, zwischen den normativen Ansprüchen der Ehre und der Polis zu wechseln. Wie argumentieren die Athener, die dabei sind, durch ein Gerichtsverfahren ihre Ehre wiederherzustellen: Orientieren sie sich in ihrem Verhalten vornehmlich an der Norm der Polis oder der Ehre? Oder versuchen sie, beide miteinander zu kombinieren? Auf eine solche Übernahme der Vorstellung von Schande durch die Polis deutet die juristische Sanktionsmöglichkeit der Atimie hin, die das politische Pendant zum sozialen Zustand der Schande zu sein scheint. Die anthropologische Forschung hat sich zu weiten Teilen auf die Ausprägungen der Ehre und den Erweis der Ehrenhaftigkeit einer Person konzentriert und sich mit der Schande eher peripher beschäftigt. Ihr wird jedoch eine nicht zu unterschätzende, selten aber explizit untersuchte Rolle in der Dynamik der ehrenhaften Verhaltensweisen zugesprochen. Denn die Vermeidung von Scham kann als handlungsleitendes Motiv für die Einhaltung der Norm der Ehre ausgeprägter sein, als es das Streben nach Ehre ist.70 In den meisten Studien hat die Schande als Domäne der Frauen ihren Platz in der Analyse geschlechtsspezifischen ehrenhaften Verhaltens.71 Hier fungiert die Schande als komplementärer Gegenpol zur Ehre: Während sich die Männer in der Öffentlichkeit durch ihr Verhalten als ehrenhaft erweisen, ist es die vornehmste Pflicht der Frauen, Scham und Schande zu vermeiden, 70 Vgl. Wikan, Shame, 635-637; S. Brandes, Reflections on Honor and Shame in the Mediterranean, in: Gilmore, Honor, 121-134, 123: »the concern with honour seems to predominate in some regions or linguistic groups, the preoccupation with shame in others.« Vgl. R.F. Newbold, Sensitivity to Shame in Greek and roman Epic, with particular reference to Claudian and Nonnus, in: Ramus 14 (1985), 30-45, 30: »Much human behaviour is influenced by fear of shame and embarrassment. Living in the face and eyes, shame is very close to the experienced self. Selfimage and self-esteem are heavily determined by one’s susceptibility to shame.« 71 C. Delaney, Seeds of Honor, Fields of Shame, in: Gilmore, Honor, 35-47, 40: »Women, on the contrary, are, by their created nature, already ashamed; the recognition of their constitutional inferiority constitutes the feeling of shame. Shame is an inevitable part of being female; a woman is honorable if she remains cognizant of this fact and its implications for behavior, and she is shameless if she forgets it.«
184
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
die sie und ihre Familie treffen, wenn sie nicht ihr Haus und ihre Sexualität hüten.72 Der weibliche Sinn für die Bewahrung ihrer Ehre ist von höchster Bedeutung für den Mann, denn seine Ehre ist abhängig von der ihrigen.73 Eine Folge dieser konträren Ehrvorstellungen der beiden Geschlechter ist die strikte Arbeits- und Raumteilung zwischen Männern und Frauen.74 Das duale Verhältnis von Ehre und Schande trennt und verbindet so die für die männliche Ehre extrem wichtige Öffentlichkeit mit dem privaten Bereich des Hauses. Schande erscheint als Möglichkeit bedrohlicher zu sein, als als Zustand, wenn er eingetreten ist. Das gilt allerdings nur für die Männer. Da sich die Ehre von Frauen vor allem anderen über ihr Geschlecht definiert, verfallen sie bei einem entsprechenden Fehltritt mit ihrer gesamten Person dem Verdikt der Schande. Die Ehre der Männer hingegen konstituiert sich über verschiedene habituelle Formen, so dass die Möglichkeiten der Kompensation etwaiger Defizite auf anderem Gebiet gegeben sind. Außerdem garantiert die relative Starrheit einer ehrenhaften Gesellschaft eine gewisse Stabilität des Status einer Person. Fällt sie in Schande, so handelt es sich dabei um einen temporären Zustand, der nicht – wie die Ehre – einem Urteil über die gesamte Person gleichkommt, sondern eine Verfehlung der Norm der Ehre in einem Teilbereich des Verhaltens konstatiert.75 Häufig resultiert diese Schande nicht aus einem normwidrigen Verhalten einer ehrenhaften Person selbst, sondern aus den Handlungen eines anderen Mannes, der die Ehre dieser Person beschädigt.76 Auch in in solchen Fällen ist es die Sache des ehrenhaften Mannes, seine Ehre wiederherzustellen. Das geschieht, indem er seine Ehre öffentlich demonstriert und so die Zugehörigkeit zur ehrenhaften Gesellschaft und das Innehaben eines bestimmten ehrenhaften Status beweist. Je gravierender der Bruch der Norm der Ehre ist, desto eindrücklicher muss der Anspruch auf die eigene Ehre öffentlich gestellt werden. Die Ehre eines in seiner Ehre 72 Pitt-Rivers, Status, 42: »The honour of a man and of a woman therefore imply quite different modes of conduct. This is so in any society. A woman is dishonoured, loses her vergüenza, with the tainting of her sexual purity, but a man does not. While certain conduct is honourable for both sexes, honour=shame requires conduct in other spheres, which is exclusively a virtue of one sex or the other. It obliges a man to defend his honour and that of his family, a woman to conserve her purity.« Vgl. Giordano, Ehrvorstellungen, 116-117; Peristiany, Village, 182. 73 Bourdieu, Entwurf, 38: »Diese Logik lässt es natürlich erscheinen, dass die Moral der Frau als Mittelpunkt der abgeschlossenen Welt hauptsächlich aus negativen Imperativen besteht«. Vgl. Wikan, Shame, 641. 74 Schneider und Schneider, Culture, 89-94; 75 Brandes, Reflections, 130: »In the short run, shameless behavior or a shamed state of being can be overcome; it is transitory, reversible, correctable.« Vgl. Wikan, Shame, 638: »Whereas shame arises from an identifiable act, one of the distinguishing marks of honour ... is that it is an attribute of the whole person.« 76 Pitt-Rivers, Status, 31; de Waardt, Ehrenhändel, 311; Adkins, Merit, 167.
Atimie als Schande
185
verletzten oder beschädigten Mannes ist wiederhergestellt, wenn es ihm gelingt, sich in die ehrenhafte Gesellschaft einzureihen. Das kann durch die einfache soziale Interaktion mit anderen ehrenhaften Männern geschehen, die einen Umgang mit nicht ebenbürtigen nicht zulassen würden, so dass allein die Reziprozität der Beziehungen die Ehre aller Beteiligten garantiert. Schwerwiegendere Ehrverletzungen, die durch den Angriff eines Rivalen erfolgt sind, müssen in einem spektakulären Akt der Rache behoben werden, der die Wertschätzung der eigenen Ehre zeigt und das soziale Wissen darum, wann sie auf dem Spiel steht.77 Der Zustand der Schande ist so in den allermeisten Fällen kein dauernder und definitorisch deshalb eher ein notwendiger Bestandteil der Ehre, nicht ihr Gegenteil. Entsprechend kann einer Person, die nicht über Ehre oder über ein Ehrgefühl verfügt, auch keine Schande gemacht werden. Weil die Schande das Vorhandensein von Ehre voraussetzt, handelt es sich bei der Differenzierung zwischen Ehre und Schande nicht um eine soziale. Es existiert keine gesellschaftliche Unterscheidung zwischen Personen, die über Ehre verfügen und solchen, die das nicht tun, sondern grundsätzlich jedes Mitglied einer ehrenhaften Gesellschaft besitzt Ehre. Diese speist sich bei Männern und Frauen aus ihrer geschlechtlichen Identität.78 Abgesehen von einigen wenigen Personen, die ein konstant schamloses Verhalten an den Tag legen, wie etwa »in Schande lebende« Frauen, sind die Unterschiede des ehrenhaften Status unter den Männern rein gradueller Natur. Der habituelle Umgang ehrenhafter Männer mit weniger oder sehr ehrenhaften Personen spiegelt diese feinen Unterschiede.79 Die antike griechische Gesellschaft zu diesem von Anthropologen konstruierten idealtypischen Bild einer ehrenhaften Gesellschaft in Beziehung zu setzen, ist kein neuer Ansatz. Gerade die so häufig in den Quellen ausgedrückte Warnung vor der Schande bzw. vor schamlosem Verhalten hat zu einer Diskussion darüber geführt, ob die homerische Gesellschaft charakteristische Merkmale einer so genannten »Schamkultur« aufweise. Das Aufgreifen des Begriffes der Schamkultur, der aus dem anthropologischen Bereich stammt, erfolgte durch Eric Dodds, der diese Klassifikation auf die homerische Gesellschaft anwandte, weil ihm das Motiv der Vermeidung von Scham bei den Handlungen der homerischen Krieger als dominant erschien.80 Neben der Häufigkeit der Termini A„DèJ und A„SCÚNH in den 77 Guttandin, Schicksal, 275-280; Boehm, Blood Revenge, 78-81. 78 Bourdieu, Entwurf, 16; Asano-Tamanoi, Shame, 116-117; Campbell, Honour, 269: »The intrinsic principles of honour refer to two sex-linked qualitities that distinguish the ideal moral characters of men and women: these are the manliness (¢NDRISμÒJ) of men, and the sexual shame (NTROP») of women.« 79 Ebd., 296. 80 Dodds, Griechen, 17-37.
186
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
homerischen Epen, erklärte das auch die verschiedenen religiösen und übersinnlichen Einflüsse auf das Geschick der homerischen Helden.81 Die Scham figuriert nicht als das Gegenstück zur Ehre, sondern als Alternative zur Schuld, wobei letztere eine innere moralische Instanz voraussetzt, nicht eine externe wie die Scham, die abhängig ist vom Urteil der anderen.82 In der archaischen Zeit, so Dodds These, entsteht in Griechenland eine Schuldkultur, die die ältere Schamkultur aber nie ganz habe ersetzen können.83 Zu dieser ungeheuer einflussreichen These ist erst in jüngerer Zeit mit Douglas Cairns’ »Aidôs. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature« eine quellenfundierte und systematische Gegendarstellung erschienen.84 Explizites Ziel des Autors ist es, die Schwierigkeiten aufzuzeigen, die eine Kategorisierung der griechischen Gesellschaft als Schamkultur mit sich bringt. Die von ihm auf die Begrifflichkeiten A„DèJ, A„SCRÒN und A„SCÚNH sowie anderer moralischer Termini untersuchten Quellen spannen sich von den Epen Homers bis zu den Schriften des Aristoteles. Sein hauptsächlicher Kritikpunkt besteht in der Auffassung des Begriffes »Schamkultur«, der antithetisch zu den modernen westlichen Gesellschaften als Schuldkulturen definiert wird und alle unterschiedlichen ethischen Merkmale beider Kulturen erklären soll.85 Die Kondensierung der beiden Gesellschaftstypen auf die Art der sozialen Sanktionen, der internen der Schuld und der externen der Scham, vereinfache die Differenzen zu sehr.86
81 Ebd., 16: »Die Lage, auf die die Konzeption der áte eine Antwort ist, entstand nicht nur aus der Impulsivität des homerischen Mannes, sondern aus der Spannung zwischen dem individuellen Impuls und dem Druck der sozialen Anpassung, die charakteristisch für eine Schamkultur ist.« 82 Benedict, Chrysanthemum, 223-224: »True shame cultures rely on external sanctions for good behavior, not, as true guilt cultures do, on internalized conviction of sin. ... The primacy of shame in Japanese life means, as it does in any tribe or nation where shame is deeply felt, that any man watches the judgment of the public upon his deeds.« B. Williams, Scham, Schuld und Notwendigkeit. Eine Wiederbelebung antiker Begriffe der Moral, Berlin 2000, 96, sieht die Trennung zwischen Scham und Schuld nicht so polar: »Auch wenn sich die Scham und ihre Motivation in der einen oder anderen Weise immer auf den Blick des anderen bezieht, ist es wichtig, festzuhalten, dass für viele ihrer Operationen der imaginierte Blick eines imaginierten anderen ausreicht.« 83 Ebd., 20f. 84 D.L. Cairns, Aidôs. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature, Oxford 1993. 85 Ebd., 32-47. 86 Ebd., 27: »Thus the basic distinction is between shame as a response to external sanctions and guilt as a response, uniquely, to internal sanctions. As I argued above, such a conception of shame and guilt is untenable, since at all stages both shame and guilt possess an internalized component, and neither is differentiated from the other by the fact that it may occur before a real audience, before a fantasy audience, or before oneself.«
Atimie als Schande
187
Ungleich Dodds bindet Cairns A„DèJ und die verwandten griechischen Termini fest in die Bedingungen einer ehrenhaften Gesellschaft ein. Zwar lege diese großen Wert auf die Kontrollfunktion der öffentlichen Meinung, das sei aber nicht gleichzusetzen mit dem Fehlen eines internalisierten Ehrenkodexes.87 Die griechische Vorstellung von Ehre impliziere naturgemäß auch einen Begriff von Scham und Schande, der sich nicht nur auf externe Sanktionen beschränke und nicht nur für die homerische Gesellschaft relevant sei. Abgesehen von ihrer Bedeutung für den Einzelnen hat A„DèJ auch eine wichtige gesamtgesellschaftliche Funktion: Cairns sieht hier den Ausdruck eines Ehrbewusstseins, das sich über die eigene Ehre hinaus auf die Aufrechterhaltung der ehrenhaften Ordnung erstreckt.88 Mit der Wahrung der ehrenhaften sozialen Ordnung argumentieren auch die athenischen Männer, die vor Gericht ihre Ehre wiederherzustellen suchen. Sie legen die Konflikte, die sie mit ihren Gegnern austragen, stets als Teil einer gesamtgesellschaftlich relevanten Auseinandersetzung dar. Die Stilisierung ihres persönlichen Feindes zu einer Gefahr für alle Bürger dient einem doppelten Zweck: Zum einen erleichtert es den Geschworenen die Identifikation mit dem Sprecher, der sich an die Stelle aller Bürger setzt, und zum anderen bedeutet das Eingeständnis einer Ehrverletzung durch den Gegner unter diesen Umständen nicht, dass es dem Sprecher an Ehre gemangelt hätte, sondern dass der Gegner sich zuviel Ehre angemaßt und Hybris verübt habe. Der beliebte Vorwurf der Hybris an den Gegner dient so auch dazu, Meidias oder Konon als den Urheber der Störung des Gleichgewichts zwischen den Ehrenmännern zu diffamieren. So bleibt den Rednern vor Gericht das Eingeständnis der eigenen Schande erspart. Zwar können Meidias, Ariston und Euphiletos bei der Erklärung ihrer Auseinandersetzungen ihre eigenen Demütigungen nicht verhehlen, auf sprachlicher Ebene aber verlagern sie den normwidrigen Part daran auf ihre Gegner. Deren Hybris und Schamlosigkeit bedeute eine Transgression der Normen der Ehre und der Polis. In den drei Reden finden sich wenige 87 Ebd., 43: »Concern for honour, even when it is acute, betokens no simple reliance on external sanctions alone. Homeric society, on account of the centrality of honour in Homeric ethics and etiquette, is frequently regarded as a paradigm shame-culture, but Homeric characters clearly do possess standards of their own; not only are they aware of what is expected of them by society, they have also internalized many of these expectations to the degree that deviation from them is unthinkable, and may, on occasion, manifest an awareness that the individual can, in a very real sense, make the values of the group his own.« 88 Ebd., 432: »The link between aidôs and timê is, of course, fundamental, but the crucial point is that aidôs includes concern both for one’s own timê and for that of others. As a result, part of the function of aidôs is to recognize the point at which self-assertion encroaches illegitimately upon the timê of others, and this means that aidôs, while always responding to a situation in which timê is relevant, is concerned not only with one’s own prestige, but also with the concepts of moderation and appropriateness in the pursuit of prestige.«
188
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Aussagen zur Scham oder Schande der Klagenden, obwohl dies nach den Ehrverletzungen, die sie erlitten haben, zu erwarten wäre. Vielmehr macht Demosthenes das Thema der ÛBRIJ des Meidias zu seinem Leitmotiv, neben dem immer wieder Begriffe wie ¢SšLGEIA, ¢SšBEIA, und ¢NA…DEIA anklingen, die die Unverschämtheit, Überheblichkeit und das Überschreiten der Normen und Gesetze durch Meidias suggerieren sollen.89 Auch Ariston vermeidet in seiner Rede Gegen Konon, die Darstellung seiner eigenen schmählichen Situation im Kampf mit Konon anders als durch die Begrifflichkeit auszudrücken, er habe unter dessen Hybris gelitten.90 Euphiletos hingegen stellt seine Ehre wieder her, indem er sich an seinem Nebenbuhler rächt und ihn tötet. Vor Gericht ist er bemüht, seine Tat in den normativen Rahmen der Polis einzubinden, und vermeidet es daher, von seiner eigenen Schande zu sprechen, um die Tötung des Eratosthenes nicht mit der Norm der Ehre zu assoziieren. Die verwickelte Erzählung der Entdeckung des Ehebruchs durch Euphiletos verfolgt auch diesen Zweck: Um nicht als ein gehörnter Ehemann dazustehen, der im Zustand der Schande verweilt, bis er Gelegenheit hat, sich Genugtuung zu verschaffen, was sowohl nach der Norm der Ehre als auch nach der Norm der Polis sehr problematisch wäre, präsentiert Euphiletos seine eigene Person lieber als leicht begriffsstutzig.91 Die Athener äußern sich selten zu ihrem Defizit an Ehre. Als Ehrenmänner sind sie bemüht, ihre Schande möglichst schnell und umfassend durch einen Erweis ihrer Ehre wieder wettzumachen. Euphiletos wählt dazu den der Norm der Ehre entsprechenden Weg der persönlichen Rache an seinem Gegner. Für diese Handlung muss er sich vor Gericht verantworten, wo er sie als der Norm der Polis entsprechend interpretiert. Demosthenes und Ariston entscheiden sich für eine Vergeltung durch ein Gerichtsverfahren. Offenbar wurden die Geschworenengerichte in der athenischen Polis als ein Mittel der Vergeltung für eine Ehrenkränkung akzeptiert.92 Allein durch den Prozess konnte so die Ehre des Klägers, der seinen Anspruch öffentlich
89 Demosth. 21, passim; Demosthenes beginnt die Rede mit der Thematik, ebd., 1: 4¾N μÒN ¢SšLGEIAN, ð ¥NDREJ DIKASTA…, KAˆ T¾N ÛBRIN, Î PRÕJ ¤PANTAJ ¢Eˆ CRÁTAI -EID…AJ, OÙDšNA OÜQ' ØμîN OÜTE TîN ¥LLWN POLITîN ¢GNOE‹N O‡OμAI. In der Übersetzung von A. Westermann: »Wie frech und übermütig allezeit sich Meidias gegen jedermann benimmt, das, Männer des Gerichts, ist, denk’ ich, euch so wie der übrigen Bürgerschaft männiglich bekannt.« Vgl. auch das gehäufte Auftreten ebd., 19, 32-34, 77-83, 114f., 126-131, 146-150, 193-195, 216f., 225. 90 Demosth. 54, 33: ¢LL' ØF' Oá GE PRèTOU ™PL»GHN KAˆ μ£LISQ' ØBR…SQHN, TOÚTJ KAˆ DIK£ZOμAI KAˆ μISî KAˆ ™PEXšRCOμAI. Übersetzt von A. Westermann: »Nein, eben der, von dem ich zuerst geschlagen und am meisten misshandelt worden bin, der ist’s den ich belange und hasse und verfolge.« Vgl. ebd., 28, 41. 91 Lys. 1. Erst in Paragraph 21 ist Euphiletos überzeugt und in Paragraph 26 ist Eratosthenes trotz lang geschilderter, umständlicher Vorbereitungen des Euphiletos bereits tot. 92 Vgl. Cohen, Law, 115-118.
Atimie als Schande
189
machte, wiederhergestellt werden.93 Der Ausgang des Verfahrens war dabei sekundär, als konstituierend für die Ehre galt die Weiterführung des Konfliktes unter Ehrenmännern nach den normativen Ansprüchen der Ehre und der Polis, die beide repräsentiert wurden durch die Öffentlichkeit der in den Gerichten anwesenden athenischen Bürger. In klassischer Zeit konnte die Ehrlosigkeit eines athenischen Bürgers nicht nur mit den Begriffen der persönlichen Schande oder des gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins für die Bedeutung der Ehre beschrieben werden, sondern es existierte parallel dazu der strafrechtliche Terminus der ¢TIμ…A. Die einem Bürger zugeschriebe TIμ» bezeichnete ebenso das Anerkennen seines sozialen Status in einer ehrenhaften Gesellschaft wie das politische Engagement in der demokratischen Polis. Der Terminus TIμ» steht dabei für einen bestimmten Status im Bereich der sozialen Ehre und in der Polis. Entsprechend ist ein Athener im Vollbesitz seiner bürgerlichen Rechte ™P…TIμOJ. Die ¢TIμ…A bedeutet ein Defizit an politischen Rechten, über die ein Bürger verfügt; sie mindert seinen Bürgerstatus. In den Zustand der Atimie gerät ein Bürger, wenn er gegen bestimmte Gesetze verstößt, auf deren Bruch Atimie steht, oder wenn dieses rechtswidrige Verhalten durch ein entsprechendes Urteil von den athenischen Gerichten festgestellt worden ist.94 Das heißt praktisch, dass ein ¥TIμOJ erstens bestimmte Stätten und Versammlungsorte der Polis, wie die Volksversammlung, die Agora, die Gerichte und die Heiligtümer nicht mehr aufsuchen darf und zweitens, dass er bestimmte bürgerliche Rechte, wie das Ausüben von Ämtern, das Sprechen in der Volksversammlung oder das Einbringen von Klagen nicht mehr für sich in Anspruch nehmen kann.95 Naturgemäß hängen beide Verbote miteinander zusammen. Allerdings sind die Informationen darüber, wie nachlässig oder restriktiv die verschiedenen 93 Vgl. die Anforderungen an frühneuzeitliche Duellanten: »Duelle waren Ehrenzweikämpfe, in denen man nicht um ein handfestes Ergebnis stritt, sondern seine Ehre unter Beweis stellte. Es kam nicht darauf an, wer am schnellsten zog oder die kräftigsten Hiebe austeilte; wichtig war allein die Tatsache, dass sich beide Gegner einem vielleicht tödlichen Kampf stellten und auf diese Weise zu erkennen gaben, dass sie ihre ›Ehre‹ höher schätzten als ihr Leben.« Frevert, Ehrenmänner, 11. 94 M.H. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration in the Fourth Century B.C., Odense 1976, geht von zwei Möglichkeiten der Auferlegung von Atimie aus: durch eine einfache Gesetzesübertretung und durch einen Urteilsspruch. 95 E. Ruschenbusch, Untersuchungen zur Geschichte des athenischen Strafrechts, Köln 1968, 18-19; vgl. die Aufzählung bei Hansen, Apagoge, 61-62: »an Athenian citizen was deprived of a) the right to move decrees (GR£FEIN), to speak in the Assembly (LšGEIN, DHμHGORE‹N) and indeed to take part in the Assembly at all (™KKLHSI£ZEIN); b) the right to serve as a juror (DIK£ZEIN) to act as a prosecutor in both private and public suits (DIK£ZESQAI, GR£FESQAI) and to give evidence (μARTURE‹N) c) the right to hold a magistracy (¥RCEIN) d) the right to enter the sanctuaries (E„SIšNAI E„J T¦ ƒER£) and e) the right to enter the Agora (E„SIšNAI E„J T¾N ¢GOR£N).«
190
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Sanktionen, die in einer Teilatimie auch einzeln verhängt werden konnten, gefasst worden sind, sehr spärlich.96 Als sicher gilt, dass die Atimie lebenslänglich ausgesprochen wurde und sich in einigen Fällen auf die Nachkommen des ¥TIμOJ erstreckte. Eine Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Rechte erreichten Staatsschuldner, die offenbar stets eine zahlreich vertretene Gruppe unter den ¥TIμOI ausmachten, durch die Zahlung ihrer Schulden, anderweitig zur Atimie verurteilte Athener nur in einer allgemeinen Amnestie.97 Die Vergehen, die mit der Strafe der Atimie belegt wurden, sind vielfältig. Sie reichen von der Desertion über die Verschwendung des eigenen Besitzes, die Bestechlichkeit im Amt, den Versuch des Umsturzes der Demokratie und anderes bis zur Prostitution.98 Straftatbestände wie Gewaltverbrechen oder Eigentumsdelikte wurden nicht mit Atimie geahndet, es sind zumeist Vergehen, die im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten als athenischer Bürger stehen.99 Die einzige übergreifende Einheit, die in allen mit Atimie belegten Vergehen geschädigt wird, scheint die Polis als die öffentliche Sache gewesen zu sein.100 Der Schutz, den die Sanktionsmöglichkeit der Atimie gewähren sollte, bezieht sich offenbar auf die Bürgerschaft als ganzes.101 In der Konsequenz wird der atimos in seinen Möglichkeiten der öffentlichen Präsenz beschnitten und möglichst ganz aus der Polisbürgerschaft entfernt.102 Auch die athenischen Bürgerfrauen konnten mit einer Art Atimie belegt werden. Hatten sie sich des Ehebruchs schuldig gemacht, so konnten sie von den Heiligtümern ausgeschlossen werden und
96 Die ausführlichsten Aussagen zur Einrichtung der Atimie liefern And. 1, 73-76 und Aischin. 1, 19-32. 97 Hansen, Apagoge, 67-68; MacDowell, Law, 74. 98 Vgl. die systematische Auflistung bei Hansen, Apagoge, 72-74. 99 Ebd., 74: »The offences of omission may all be described as neglect of civil duties ... Moreover, atimia was frequently imposed for offences against the constitution or public authorities ... instances of trespassing the laws by which citizen rights were reserved for legitimate Athenians.« 100 Ebd.: »We may conclude that atimia was the penalty par excellence which an Athenian might incur in his capacity of a citizen, but not for offences he had committed as a private individual.« 101 K. Latte, Beiträge zum griechischen Strafrecht II, in: Hermes 66 (1931), 127-158, 154: »Es sind durchweg Klagen, die sich auf die Lebensführung des Bürgers beziehen und mit jener sittenrichterlichen Haltung des attischen Staates zusammenhängen, die aus dem Bürgersinn der Polis herauswächst.« 102 Vgl. D.S. Allen, The World of Prometheus. The Politics of Punishing in Democratic Athens, Princeton, N.J. 2000, 230: »The expulsion of the atimos was memorialized and he was kept within networks of social knowledge and social memory. Atimia as disfranchisement memorialized the exclusion of a male citizen from the public sphere and his relegation to the private sphere. It memorialized the absence from and therefore also silence in the public sphere.«
Atimie als Schande
191
verloren bei Zuwiderhandlung dieses Verbots einen Teil ihres Rechtsschutzes.103 Es spricht vieles dafür, dass die im athenischen Strafrecht verankerte ¢TIμ…A das politische Analogon zur sozialen Sanktion der Schande war.104 Die Möglichkeit des Verlustes der Bürgerrechte durch die Atimie sollte die Loyalität der Bürger zur Polis sichern, wie die Vermeidung von Scham die Einhaltung der Norm der Ehre gewährleisten sollte. Dabei scheint es sich bei der Strafe der Atimie, wie sie im 4. Jahrhundert gehandhabt wurde, um eine mildere Form der noch im 6. Jahrhundert bestehenden Sanktion der Friedlosigkeit gehandelt zu haben.105 Diese lässt – wie die Schamlosigkeit – Personen vollkommen aus der jeweiligen sozialen Kommunikation herausfallen, bis zu dem Punkt ihres nicht nur sozialen, sondern physischen Todes. Wie schwerwiegend die Atimie einen Bürger treffen konnte, der nicht mehr die Möglichkeit eines juristischen Vorgehens gegen Angriffe wider seine Person hatte, hing wohl von seiner jeweiligen Situation und der Anzahl seiner Feinde ab. Da die Ehre eines Bürgers eng mit seiner politischen Rolle innerhalb der demokratischen Polis verbunden war, ist anzunehmen, dass mit dem Urteil der Atimie auch eine Beschädigung seiner Ehre verbunden war. Das erzwungene Fernbleiben von den politischen Institutionen und öffentlichen Räumen der Polis beraubte einen Bürger zumindest der Möglichkeit, seine Ehre durch ein Engagement in der Polis zu mehren. Die enge Verzahnung der Ehre mit der Polis machte die Ehre eines Bürgers sowohl auf sozialem wie auf politischem Gebiet angreifbar. Die Installation einer Beschneidung der Bürgerrechte für Athener, denen es an Loyalität zur Polis fehlte, zeigt auffällige Parallelen zur Beurteilung eines Bürgers als schamlos und damit ehrlos. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das soziale und das politische Urteil der Ehrlosigkeit bei den jeweils betroffenen Personen bündelte und verstärkte.
103 Schmitz, nomos, 89; Hansen, Apagoge, 56. 104 Der Sohn des Alkibiades zieht nach eigener Aussage die Verbannung der Atimie vor, Isokr. 16, 47. Vgl. Fisher, Violence, 70; Hansen, Apagoge, 60. 105 Latte, Beiträge II, , 158; Ruschenbusch, Untersuchungen, 17: »Obwohl nun die Atimie ... als Strafmittel nie aufgegeben wurde, ist doch die mit der Übernahme in das öffentliche Strafrecht entstandene ›Friedlosigkeit‹ im Laufe von gut zweihundert Jahren soweit verblasst, ja sogar in Vergessenheit geraten, dass die Atimie im 4. Jahrhundert nur noch die sog. bürgerliche Zurücksetzung bedeutete.«
192
Die fragile Gleichheit der ehrenhaften Polisbürger
Resümee: Gleichheit und Ungleichheit in der Polis Wie eng die Norm der Ehre und die Norm der Polis verknüpft sind, zeigen die Bemühungen der Athener, durch Ehre bedingte soziale Verwerfungen mit Gesetzen der Polis zu regeln. Im Falle der Hybris und der Schande einer Person existieren Gesetze, die den ehrenhaften Status und die jeweilige Strafe festlegen. Ein Übermaß an Ehre oder der gegenteilige Zustand, ein Defizit an Ehre, stellen offenbar nicht nur für die ehrenhafte Gesellschaft der Athener ein Problem dar, sondern auch für die athenische Polis. Die als Hybris bezeichneten Fehleinschätzungen des ehrenhaften Status der eigenen Person und der Ehre anderer werden als so bedrohlich empfunden, weil sie die fiktive Gleichheit aller ehrenhaften Personen gefährden. Ohne diese aber kann weder ein Agon stattfinden, noch kann ein Konflikt normgerecht geführt werden. Gerade letzterer Fall wird vor Gericht verhandelt, wie einige der Gerichtsreden bezeugen. Die Auseinandersetzung zwischen Ehrenmännern gerät außer Kontrolle, wenn die Normen der Konfliktaustragung in einer Weise verletzt werden, die weder eine Möglichkeit des angemessenen Gegenschlags noch der alternativen Interpretation der Situation eröffnet. Ein Athener, der Hybris begeht, ignoriert sein Wissen um die soziale Norm der Ehre, sein Habitus entspricht nicht seinem ehrenhaften Status. Deshalb stellt er sich außerhalb der ehrenhaften Gesellschaft, deren Ordnung er mit seinen Angriffen auf andere Ehrenmänner bedroht. Als weniger gefährlich, aber ebenso außerhalb der Gesellschaft stehend, erweisen sich jene Athener, die ein Defizit an Ehre haben. Auch sie wenden sich an die athenischen Gerichte, um mit Hilfe der institutionalisierten Prozesse in der Öffentlichkeit der anwesenden Geschworenen ihre Ehre wiederherzustellen. Zumeist ist der Zustand der Schande für einen Ehrenmann temporärer Natur und gleichbedeutend mit der Aufgabe, die eigene Ehre besonders demonstrativ unter Beweis zu stellen. Die Einbindung der Norm der Ehre in den normativen Rahmen der Polis erstreckt sich auch auf das Defizit an Ehre, das die Schande bezeichnet. Mit dem Gesetz zur Atimie existiert die Möglichkeit des Ausschlusses von Bürgern aus den politischen Gremien und von den öffentlichen Versammlungen der Polis. Die Straftatbestände richten sich zumeist gegen das Interesse des Gemeinwesens. Damit schaffen die Athener ein politisches Analogon zur sozialen Sanktion der Schande, das eine ganz ähnliche Funktion hat: Es schließt den Betreffenden von der Kommunikation und sozialen Interaktion mit seinen jeweils Gleichen aus, weil er sich nicht den Normen der Polis entsprechend verhalten hat.
VI. Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Ein Mann, der in seiner Ehre verletzt wird, hat ein subjektiv empfundenes und sozial anerkanntes Recht auf Sanktionen gegen seinen Angreifer. Worin dieses Recht und die Sanktionen genau bestehen, ergibt sich aus den situativen und kulturellen Gegebenheiten einer ehrenhaften Gesellschaft. Grundsätzlich unterliegt auch die Rache, die Vergeltung also für eine Ehrenkränkung, bestimmten sozialen Normen. Verschiedene Gesellschaften übergreifend und dem Prinzip der Ehre inhärent scheinen dabei die Faktoren der erstens autonomen, zweitens kompensierenden und drittens öffentlichkeitswirksamen Vergeltung zu sein. Eine wichtige Funktion der Rache besteht darin, die Autonomie desjenigen, der sie ausübt, zu wahren bzw. wiederherzustellen.1 Die rächende Person entscheidet über die Inszenierung des Racheaktes und demonstriert durch ihn, dass ihre durch die Ehrverletzung beschädigte Autonomie wieder intakt ist. Der Angriff auf die Ehre eines Mannes bedeutet das Eingreifen eines anderen in die vom ihm kontrollierte Handlungssphäre. Durch eine angemessene Vergeltung macht das angegriffene Individuum seine Grenzen deutlich und beschränkt die Verletzung auf jenen einen Zeitpunkt, an dem der Angreifer sie übertreten hat. Das Ziel der Demonstration von Autonomie durch den Rächenden verbietet die Einschaltung öffentlicher Institutionen, die das Machtmonopol des Staates exekutieren oder zur offiziellen Regelung von Konflikten eingesetzt sind.2 Der Verzicht auf Dritte bei der Vergeltung einer Ehrverletzung stärkt zwar das rächende Individuum, weil es seine ehrenwerten Eigenschaften wie Eigenmacht und Mut demonstrieren kann, es schwächt seine Position aber zugleich, weil es sich damit einer zusätzlichen Handlungsoption und der möglicherweise offiziellen Anerkennung seiner Schädigung beraubt.3 Um die beschädigte Ehre zu verteidigen bzw. wiederherzustellen, bedarf es eines Schlages gegen den Gegner, der die ursprüngliche Ehrverletzung nicht nur aufwiegt, sondern an Eindrücklichkeit übersteigt. Dieser kompen1 Vgl. Campbell, Honour, 299; J. Elster, Norms of Revenge, in: Ethics 100 (1990), 862-885, 867; C. Boehm, Blood Revenge. The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and other Tribal Societies, Pennsylvania 19912, 173. 2 Giordano, Ehrvorstellungen, 119; Pitt-Rivers, Honor, 509; vgl. ders., Honour, 30f. 3 Dinges, Ehre, 49; vgl. Schneider und Schneider, Culture, 96f.
194
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
sierende Charakter des Racheaktes wird erreicht durch das Fortschreiten der Handelnden auf der sozial geeichten Skala des Affronts und der Ehrverletzungen.4 Der antike Grundsatz, nach dem Freunden stets zu helfen, Feinden stets zu schaden sei,5 bekommt im Falle eines Racheaktes gegen einen durch eine Ehrverletzung entstandenen Feind eine dynamische, eskalierende Komponente. Der ehrenhafte Grundsatz der Reziprozität, nach dem Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist, wird unter negativem Vorzeichen befolgt: Der Rächende zielt einseitig auf die Vergeltung feindlicher Handlungen und bemüht sich, dem Gedanken des Nullsummenspiels der Ehre entsprechend, um ein Aufwiegen des erlittenen Schadens, womöglich um einen Bonus auf dem Konto der Ehre, indem er die Destruktivität seiner Attacke erhöht.6 Die Radikalisierung des Kampfes um die Ehre sichert den beteiligten Männern die notwendige Aufmerksamkeit der übrigen Mitglieder der Gesellschaft, die Rache wird zu einem öffentlichen Akt. Ebenso wie die Ehre selbst, so erfordert auch ihre Rächung ein Publikum; und es sind die Zeugen der verschiedenen Schritte der Auseinandersetzung, die die Einhaltung der sozialen Normen beobachten und die Ehre der Kämpfenden beurteilen. Dem Opfer der Rache muss klar sein, wer sich an ihm wofür rächt. Außerdem erfordert ein gelungener Racheakt die Anwesenheit einiger Männer, die die öffentliche Meinung repräsentieren und so in der Lage sind, das Weniger an Ehre des Opfers und das Mehr an Ehre des Rächers festzustellen.7 Nicht zuletzt durch dieses notwendige Signal an die Öffentlichkeit, dass die Rache vollzogen ist, gewinnt der ursprüngliche Konflikt an Brisanz. Das Opfer der Rache ist in Zugzwang, es befindet sich in der Position desjenigen, der den Schlag gegen seine Ehre erwidern muss, und wird nun seinerseits versuchen, den Racheakt seines Gegners an Öffentlichkeitswirksamkeit und angerichtetem Schaden zu übertreffen.8
4 G. Objartel: Die Kunst des Beleidigens. Materialien und Überlegungen zu einem historischen Interaktionsmuster, in: D. Cherubim [u.a.] (Hg.), Gespräche zwischen Alltag und Literatur, Tübingen 1984, 94-122, 99-104. 5 M. Blundell, Helping Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge 1989, 26. 6 H. de Waardt, Ehrenhändel, Gewalt und Liminalität. Ein Konzeptualisierungsvorschlag, in: Schreiner und Schwerhoff, Ehre, 303-319, 318: »die Gegenmaßnahmen [müssen, C.B.] so deutlich und theatralisch wirksam sein, dass sie die Ehrverletzungen ausgleichen können. Die Verteidigung muss also ein ritualisiertes, symbolisches und für alle Betrachter verständliches Element enthalten.« 7 Vgl. Elster, Revenge, 884: »honor is a triadic rather than a dyadic relation. A gains honor by humiliating B in the presence of C.« 8 Vgl. Bourdieu, Ehre, 30: »Aber die Unehre, die im Stadium des Virtuellen bleibt, solange die Möglichkeit zu einer Erwiderung besteht, wird mehr und mehr zur Realität, ja länger die Rache auf sich warten lässt.«
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
195
Die einen Racheakt begleitenden Merkmale der Wahrung von Autonomie, der Ausweitung des Konflikts und der Öffentlichkeitswirksamkeit definieren einen Vergeltungsakt als Rache. Ein solcher Racheakt wird nach den Regeln der Ehre vollzogen. Neben diesen wichtigen Merkmalen hat die Rache als ein sehr komplexes Phänomen, das in vielen Gesellschaften anzutreffen ist, eine Fülle von anderen Charakteristika und Funktionen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben besteht darin, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, d. h. die Gewaltbereitschaft und -ausübung innerhalb der Gesellschaft möglichst gering zu halten. Als Probe für die Bewältigung dieser Aufgabe gilt das Ereignis einer Gewalttat gegen ein Mitglied der Gesellschaft. In einem solchen Fall bietet die Rache für die geschädigte Person bzw. für ihre Angehörigen die Möglichkeit einer sozial legitimen Vergeltung, die sowohl den emotionalen Bedürfnissen der Betroffenen als auch den Werten der Gesellschaft Rechnung trägt.9 Durch das Wissen um die Norm der Ehre stehen dem Rächenden einige Handlungsoptionen zur Verfügung, die ihn ebenso in ein Regelwerk der Legitimität und Ehrenhaftigkeit einbinden, wie das in seinem alltäglichen Leben durch die Ehre geschieht. Die Rache als eine Reaktion eines ehrenhaften Mannes auf eine schwere Verletzung seiner Ehre verhindert eine regellose Vergeltung, sie sucht die Anzahl und Schwere der auf eine Gewalttat folgenden Gegenschläge möglichst gering zu halten. Durch die Übertragung des Gewaltmonopols auf nur einen Agenten soll so ein unkontrolliertes Ausufern verhindert werden.10 Doch das ist die ursprüngliche hauptsächliche Funktion von Rache. Sie kann sich als die optimale sozial akzeptierte Möglichkeit für einen Geschädigten erweisen, an seinen Gegnern Vergeltung zu üben. Am sinnvollsten erscheint diese Funktion der Rache in einer Gesellschaft mit einer sehr hohen Gewaltbereitschaft ihrer Mitglieder einerseits und sehr wenig ausgestalteten gemeinschaftlichen Institutionen der Konfliktregelung andererseits. Beide Umstände sind allerdings nicht der Regelfall in ehrenhaften Gesellschaften. Viele anthropologische und ethnologische Studien belegen eine gänzlich andere Einstellung der Menschen zur Rache: Sie wird nicht als eine mögliche Handlungsoption betrachtet, die die Reaktionen eines Geschädigten in einen normativen Rahmen einbindet und ihm so die Wahl seiner Handlungen erleichtert. Vielmehr ist die Rache ein zu vermeidendes
9 Vgl. Berger, Begriff, 77f.; Cairns, Aidôs, 432f. 10 Vgl. Boehm, Blood Revenge, 88f., 172f.; Gilmore, Anthropology, 191: »Struggles over an immaterial honor create a symbolic arena or outlet for male aggressions and competitive tensions. ... the field of ›honor‹ [is] a cultural displacement for powerful aggressive energies which might otherwise explode into open hostility.«
196
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Übel, das mehr Schaden als Nutzen bringt.11 Der Grund für diese Einschätzung liegt in der Eigendynamik, die ehrenhafte Handlungen entwickeln können, besonders wenn sie im Zusammenhang mit dem Verhalten im Konfliktfall stehen. Die relativ strikten Normen der Ehre zwingen einen Mann oftmals, eine Herausforderung angemessen und für alle sichtbar zu beantworten, um nicht sein Gesicht zu verlieren. Der Mechanismus von Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung ist sehr eingespielt, so dass sich die Strategien zu seiner Vermeidung im Vorfeld darauf verlegen zu interpretieren, was als Herausforderung gilt.12 Solange eine Auseinandersetzung nur mit Worten geführt wird, verfügen beide Kontrahenten noch über ein sehr breites Spektrum an ehrenhaften Handlungsmöglichkeiten, einschließlich der Option, die ganze Sache nicht ernst zu nehmen, nicht weiterzuverfolgen und die Szene zu verlassen. An bestimmten Stationen des wechselseitigen verbalen und symbolischen Schlagabtausches besteht die Möglichkeit, die Weichen für die künftig möglichen Handlungen neu zu stellen, indem das vergangene Geschehen in Kategorien gedeutet wird, die weniger ehrbezogen sind. Das muss in für den Gegner und das Publikum deutlich sichtbarer Form geschehen, mit dem erwünschten Effekt, dass die handlungsleitende Norm der Ehre auf die veränderte Situation weniger Einfluss hat.13 Je weiter die Auseinandersetzung fortschreitet und sobald sie mit tätlichen Mitteln geführt wird, desto schwieriger wird ein Rückzug aus dem Ehrenhändel, der nicht nach ehrloser Flucht oder Feigheit aussieht. Doch auch auf der Ebene des mit Fäusten und Waffen geführten Kampfes ergibt sich manchmal die Gelegenheit, aus dem ehrenhaften Mechanismus der gegenseitigen Rächung auszubrechen und neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Das gelingt am besten, wenn es außer der Ehre noch einen weiteren sozial akzeptierten Wert gibt, in dessen Kontext man überwechseln kann. Die ursprüngliche Funktion der Rache als gewaltbegrenzendem Mechanismus hat in vielen Gesellschaften aufgrund verschiedener sozialer Wand11 Boehm, Blood Revenge, 88: »feuding served as a kind of sanction, because it suppressed certain immoral behaviors that people knew were likely to start feuds. They also knew that feuds were dangerous, stressful, economically costly, and generally inconvenient from a practical standpoint. We must assume, therefore, that excessive quarreling and giving of insults, in addition to other provocative acts such as breach of contract, property disputes, and ›fooling around‹ with the women of other clans, tended to be avoided because of the perceived threat of starting a feud.« 12 Vgl. Bourdieu, Entwurf, 25: »jeder [kann] vor der als Richter und Komplize zugleich fungierenden öffentlichen Meinung die Ambiguität seines Verhaltens spielen lassen: ob eine Herausforderung aus Furcht oder zum Zeichen der Verachtung unbeantwortet bleibt – der Abstand zwischen den beiden Motiven ist oft nur gering... Aber jeder Kabyle ist ein Meister der Kasuistik, und das Tribunal der öffentlichen Meinung ist da, um im Einzelfall zu entscheiden.« 13 Dazu wird entweder die Person des Gegenübers als nicht satisfaktionsfähig definiert, vgl. Gilsenan, Lying, 201; Frevert, Mann, 195, oder der Kontext selbst wird uminterpretiert als nicht bedrohlich für die eigene Ehre, vgl. Pitt-Rivers, Status, 27.
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
197
lungen keine Bedeutung mehr. Da die Ehre aber weiterhin als die höchste Norm in diesen ehrenhaften Gesellschaften gilt, kann die Rache als eine ehrenhafte Art der Konfliktaustragung nur schwerlich aufgegeben werden. Einerseits, weil sie ein tradiertes und nicht hinterfragbares Handlungsmuster ist, das sich über den hohen Wert, der der Ehre zugeschrieben wird, legitimiert; und andererseits, weil es an Alternativen fehlt, wie sie etwa durch eine politisch oder rechtlich ausgestaltete Ordnung geschaffen werden. Diese traditionsgebundene Alternativlosigkeit schlägt sich in einigen Gesellschaften in einem erstarrten Ehren- bzw. Rachekodex nieder, der dem Einzelnen rigide Vorschriften für den Fall einer Verletzung seiner Ehre macht. Der Ehrenmann hat keine Möglichkeit, seine Handlungen zu wählen, es besteht allerdings auch keine Notwendigkeit, sie zu legitimieren, denn das einzig mögliche Verhalten ist bereits festgeschrieben in dem Kodex der Rache und in der Erwartung der Gesellschaft. Nur die Befolgung dieser Vorschriften weist einen Mann bzw. eine Familie als ehrenhaft aus. Diese ritualisierte Form der Rache, die bestimmte, sich stets wiederholende Handlungsabläufe unausweichlich macht, hat selten Funktionen, die den Beteiligten einsichtig sind. In gleichem Maße, in dem die Befolgung des Kodexes den Mitgliedern der Gesellschaft als zwingend erscheint, erweist sich sein Regelwerk als gottgegeben und nicht hinterfragbar, ja, als keine über sich selbst hinausgehenden Funktionen aufweisend. Tatsächlich sind die Leistungen eines Rachekodex, der sich auf eine hohe Wertschätzung von Ehre und sonst wenig stützt, für eine Gesellschaft äußerst gering.14 Neben tragischen Einzelschicksalen, die literarisch aufgearbeitet die Normierung des Verhaltens anklagen, sorgen der hohe Blutzoll und die schleichende Entwertung der Ehre gesamtgesellschaftlich für hohe Verluste.15 Die Erstarrung der Rache zu einem Regelwerk, das das gesamte soziale Leben dominiert, bildet eher den Ausnahmefall der Entwicklung einer ehrenhaften Gesellschaft.16 In vielen durch die Ehre charakterisierten Gemeinwesen hat sich das Ehrgefühl nicht so weit verselbständigt und ritualisiert, obwohl die Rache generell in überlieferten, reglementierten Verhaltensschemata abläuft, die unreflektiert wiederholt werden können. Doch im Unterschied zu dem lediglich einengenden Effekt eines genormten Rache14 Sie erfordern in der Regel hoch komplizierte normierte Verfahren, die jede Spontaneität, manchmal sogar jede intentionale Handlung ad absurdum führen. Vgl. zu den diktatorischen Regeln der Ausführung von Rache: Khalaf, Settlement, 227-232; und zu einem weniger streng, gleichwohl bestimmten Regeln folgendem Verhalten Boehm, Blood Revenge, 103-113. 15 Die Geschichte eines Rächers und der Gesellschaft, die ihm sein Verhalten vorschreibt, erzählt etwa der albanische Autor Isamil Kadaré in seinem Roman Der zerrissene April, Zürich 2001. 16 Gilmore, Honesty, 101, fasst die die verbreiteten Erscheinungsformen zusammen: »Mediterranean honor-and-shame consists of layered strata of community morality overlying a basic core of primordial sentiments.«
198
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
aktes, kann ein durch die Ehre normierter Handlungsablauf, der bestimmte, wohldefinierte Abweichungen zulässt, dem emotionalen Bedürfnis eines Menschen Rache zu nehmen, durchaus auch entgegenkommen. Denn der Wunsch nach Rache scheint ein universelles Phänomen zu sein, die strikte Normierung des Racheaktes hingegen ist es nicht.17 Als Indizien für eine ehrenhafte Rache, die sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft sinnvolle Funktionen erfüllt, können die Wahlmöglichkeit verschiedener Handlungen durch den Ehrenmann und die allgemeinen Modernisierungserscheinungen einer Gesellschaft gelten. Die Ehre ist dann zwar noch der höchste Wert einer Gesellschaft sein, aber nicht mehr der einzige.18 Andere Mittel der Konfliktaustragung bieten sich als Handlungsoption an. Die verbreitete Alternative zu ehrenhaften Strategien der Konfliktbewältigung bilden Gerichtsverfahren. Sie setzen ein gewisses Maß an Modernisierung in einer Gesellschaft voraus, was unter anderem bedeutet, dass die Ehre zwar noch virulent sein kann, das soziale Leben aber nicht ausschließlich dominiert. Selbst ein relativierter Ehrbegriff steht in einem Spannungsverhältnis zu dem offiziellen Verfahren eines Gerichtsprozesses.19 Der Appell an eine Institution, die mit einschneidenden Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet ist, die Bereitschaft, das Urteil Dritter in einem Konfliktfall zu akzeptieren und die Deeskalierung eines Streits von der Ebene der tätlichen Auseinandersetzung zur verbalen im Gericht, sind nur einige Punkte, die die grundsätzliche Unvereinbarkeit beider Mechanismen der Konfliktbewältigung zeigen. Trotz der schwierigen Koexistenz lässt sich in einigen ehrenhaften Gesellschaften die Austragung von Auseinandersetzungen vor Gericht beobachten; in der Regel bildet sie ein jüngeres Verfahren vor dem
17 Elster, Revenge, 872, spricht von einem »gap between the impulsive and the norm-guided – one might want to say compulsive – forms of revenge. Revenge is universal: norms of revenge are not.« 18 Gilsenan, Lying, 212, beobachtet in einem libanesischen Dorf Anfang der siebziger Jahre: »Honor has become more and more a primary value and resource over which men transact, while it less and less reflects the realities of power and structural position. Its real economic and political base has been undercut, since the family has been progressively separated by the lords from the independent means of administration and autonomy.« Vgl. M.A. Marcus, »Horsemen are the Fence of the Land«. Honor and History among the Ghiyata of Eastern Marocco, in: Gilmore, Honor, 49-60, 58: »Honor remains at the core of Ghiyata sociability, but it is in terms of generalized moral imperatives that it endures, not in terms of definite norms, rules or roles.« 19 Cohen, Feud, 115, spricht in diesem Zusammenhang von einer »uneasy relationship«. und Herman, Athens, 22 befindet: »Suing a killer in court would have appeared a travesty of vengeance«. H.-J. Gehrke, Die Griechen und die Rache. Ein Versuch in historischer Psychologie, in: Saeculum 38 (1987), 121-149, betont die Ambivalenz des Nebeneinanders, 141: »Einerseits war die Rache im Recht gebändigt, andererseits aber immer gerade auch dadurch – wie schon vorhin angedeutet – lebendig.«
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
199
Hintergrund älterer ehrenhafter Strukturen.20 Die Existenz von Gerichten, das Vertrauen in ihre Streitschlichtungskompetenz und die Einsicht in ihre Funktionalität lassen die tradierten Verhaltensnormen der Ehre vor dem Hintergrund sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse weniger zwingend und sinnvoll erscheinen. Die Gerichte stellen in einer sich modernisierenden ehrenhaften Gesellschaft das Mittel dar, mit dem sich der Bereich der Konfliktbewältigung an die allgemeinen Modernisierungstendenzen anpasst. Man kann für das Griechenland des 4. Jahrhunderts schlechterdings nicht von Modernisierung reden. Die Veränderungen in den gesellschaftspolitischen Verhältnissen der Polis Athen aber sind gerade in klassischer Zeit auf nahezu jedem Gebiet gravierend. Die Parallelen zwischen der athenischen und den mediterranen Gesellschaften lassen deshalb einige auf Analogschlüssen beruhende Thesen zu, deren Validität durch die Quellen untermauert werden kann. Innerhalb der ehrenhaften Gesellschaft, die die Athener auch im 5. und 4. Jahrhundert noch sind, haben sich neue Formen der politischen Entscheidungsfindung und des juristischen Verfahrens ausgebildet, die allein über die Dynamik der Ehre nicht zu erklären sind. Der Demokratisierungsprozess führt zu öffentlichen Einrichtungen für alle Bürger, die die Werte der Demokratie und nicht unbedingt jene der Ehre spiegeln. In Athen treten – wie in ehrenhaften Gesellschaften an der Schwelle zur Moderne – neue Verfahren zur Lösung von Konflikten in den Vordergrund, ohne die älteren Mechanismen des Ehrenhändels gänzlich zu verdrängen. Da die Koexistenz von Recht und Rache so schwierig ist und weil es sich gerade bei den Strategien zur Konfliktbewältigung um einen für jede Gesellschaft sensiblen Bereich handelt, wirft das Nebeneinander beider ein erhellendes Licht auf die Vorstellung der Athener von der Ehre und von ihrer Polis.21 Die Quellen zeigen die Bürger Athens in temperamentvollem Streit in ihren Gerichtshöfen, die nicht nur über nachbarliche Besitzstreitigkeiten, Erbschaftsangelegenheiten oder das Bürgerrecht zu entscheiden haben, sondern sogar Ehrkonflikte schlichten. In den letzteren Fällen wird das Recht sogar dann zu Rate gezogen, wenn sich bei Ehrenhändeln Konflikte ergeben. Offensichtlich bestehen hier beide Möglichkeiten der Konfliktaustragung nebeneinander, und sowohl das Recht wie auch die Rache werden 20 Pitt-Rivers, Honor, 509; Schneider und Schneider, Culture, 223; und Guttandin, Schicksal, 262-280, beschreiben die komplexe Verflochtenheit der Vorstellung von ehrenhaftem Handeln mit dem rechtlichen System unter zunehmendem Einfluss der Moderne. 21 Dinges, Ehre, 51: »Anders gesagt sind die Toleranzschwellen einer Gesellschaft für die Ehrverletzungen durch bestimmte Gruppen – insbesondere junger Männer oder Adeliger – ein interessanter Gradmesser für die Verwirklichung öffentlicher Ordnung und für weiterbestehende altersspezifische und standsmäßige Freiräume.«
200
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
von den Athenern mit Leidenschaft betrieben. Denn es können weder die Beliebtheit der Gerichte in Athen noch das Ehrgefühl der Polisbürger geleugnet werden, um die Möglichkeiten der Konfliktbeendigung in der athenischen Gesellschaft miteinander zu harmonisieren.22 Die Rache als eine Handlungsoption, die die Norm der Ehre bietet, hat sich bei den Athenern nicht in einem bestimmten Kodex der vorgeschriebenen Verhaltensweisen niedergeschlagen. Sie ist in den Köpfen der Streithähne noch präsent, und damit nicht als abstraktes Gesetz vorhanden, sondern noch geerdet in den spontanen intentionalen Handlungen der Athener. Sie hat zwar wenig Funktionen für die gesamte Gesellschaft – das übernehmen eher die Gerichte –, bietet aber dem Einzelnen die Möglichkeiten einer affektiven, sofortigen Reaktion auf einen Affront und die feste Vorstellung eines vertrauten weiteren Handlungsablaufs in den bekannt ehrenhaften Bahnen.23 Diese Funktion kann die Rache für den Einzelnen auch dann erfüllen, wenn sie nicht alleiniges Mittel der Konfliktaustragung ist, sondern durch Gesetze und Gerichte ergänzt wird. In den mediterranen ehrenhaften Gesellschaften ist der Übergang von der Rache als Mittel der Auseinandersetzung zu den Gerichten fließend, obwohl der Anpassungsdruck unter den äußeren Einflüssen der rechtsstaatlichen Industrienationen erheblich ist.24 In Athen ist das Rechtssystem mit der Entstehung der Demokratie gewachsen, es ist unter anderem das Produkt einer ehrenhaften Gesellschaft.25 Die Akzeptanz einer juristischen Konfliktführung, die fest22 Auf eine solchermaßen polarisierenden Auffassung basieren zum Teil die Beiträge von Cohen, Law; ders., Feud, auf der einen und von Herman, Codes; ders., Society; ders., Athens; ders., Reciprocity, auf der anderen Seite. Beide versuchen, die Irrelevanz entweder der gerichtlichen Prozesse (Cohen) oder aber der Ehre (Herman) durch das Vorhandensein des jeweiligen Gegenbegriffs zu beweisen. 23 Cohen, Law, 67, beschreibt den Effekt, den schon Aristoteles analysiert, für die athenische Gesellschft so: »Revenge, however, produces pleasure not only because in bringing victory it satisfies deep-rooted agonistic impulses, but also because it is pleasant in itself.« 24 Du Boulay, Village, 110, beschreibt einen Aspekt der Veränderung für die Einwohner des griechischen Bergdorfes in den sechziger Jahren so: »for the people of Ambéli the qualities necessary for the defence of the house are centred increasingly round the values of patience, hard work, non-interference with others, and the avoidance of excessive quarreling. ... The villagers have always been interested in ›progress‹ (PROKOP») ... While in the past this progress was seen in terms of activities which perpetuated the living village tradition ... the terms in which progress is now realized involve education, emigration, and final abandonment of the old way of life.« 25 J. Martin, Zwei Alte Geschichten. Vergleichende historisch-anthropologische Betrachtungen zu Griechenland und Rom, in: Saeculum 48 (1997), 1-20, 13, zählt zu den kontinuierlichen »Grundbedingungen für die Form der politischen Organisation« in Griechenland »das PersonVerständnis, der agonistische Charakter zwischenmenschlicher Beziehungen, ... schließlich die Wichtigkeit der öffentlichen Meinung.« Vgl. Cohen, Honor, 115: »Further, the Athenian legal system and the criteria by which its courts rendered judgment also express this agonistic social framework. One should not expect otherwise, for the law is not an autonomous entity which imposes order from above, but a product of the larger social system in which it is embedded.«
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
201
gelegte Verfahren hat, wird den Athenern nicht schwer gefallen sein, da sie selbst diese Prozessformen in der bestehenden Form vor nicht allzu langer Zeit geschaffen haben. Entsprechend zwiegestaltig vereint das athenische Gerichtswesen sowohl entscheidende Kriterien für ein rechtmäßiges wie auch für ein ehrenhaftes Urteil. Die der Norm der Ehre entsprechenden Merkmale der athenischen Gerichte und Gerichtsverfahren liegen auf mehreren Ebenen. Mit ihrem öffentlichen, auf dem Konsens der Bürger beruhenden und sicher auch als SchauSpiel zu begreifenden Charakter kommen die athenischen Gerichtsprozesse den Rahmenbedingungen für ehrenhaftes Verhalten sehr nahe, sie bilden quasi die Öffentlichkeit, die über die Ehre eines Mannes urteilt. Auf der anderen Seite bleibt auch die Norm der Ehre nicht unberührt: Ein ehrenhaftes oder gar die Ehre wiederherstellendes Gerichtsverfahren erweitert den Interpretationsspielraum dafür, was ehrenhaftes Verhalten ist, wie ein bestimmtes Verhalten überhaupt als ehrenhaft darzustellen ist, und der Konsens der Bürger in den Gerichten festigt und schafft das soziale Wissen um die Norm der Ehre. Die Athener bemühten die Gerichte gern und oft, um Streitigkeiten zu schlichten. Damit ist eine der zentralen Bedingungen für die Akzeptanz von Gerichten in einer ehrenhaften Gesellschaft erfüllt: die Bürger müssen auf die Glaubwürdigkeit und Effizienz der öffentlichen Einrichtungen vertrauen.26 Die allgemeine Beliebtheit der Gerichte in Athen weist darauf hin, dass das bei den Athenern der Fall war. So konnte sich ein athenischer Ehrenmann an der Norm der Ehre orientieren und gleichzeitig die Gesetze der Polis bemühen, um sich gegen seinen Kontrahenten durchzusetzen. Er konnte auch seine Racheakte mit den rechtlichen Möglichkeiten kombinieren oder sich in der Hitze des Augenblicks rächen und später dann einen Gerichtsprozess anstrengen. Es standen ihm nicht nur die verschiedenen Möglichkeiten ehrenhaften Verhaltens offen, sondern ein Athener konnte sich stets auch an die Gerichte wenden und die Gesetze der Polis für seine Sache streiten lassen.27 Das wirft die Frage nach dem Wie der Koexistenz von Recht und Rache auf. Die Klärung des Verhältnisses beider sozial akzeptierter Möglichkeiten zur Austragung von Konflikten soll in den folgenden Kapiteln im Zentrum der Untersuchung stehen. Dabei sind sowohl die ehrenhaften als auch die 26 Tun sie das nicht, entscheiden sie sich naturgemäß eher für die Autonomie und Selbstjustiz, die die Ehre bietet. Grundsätzlich geht ein vitales Interesse an der Ehre wohl einher mit einer schwachen staatlichen Infrastruktur. Vgl. Schneider und Schneider, Culture, 95; Fatheuer, Ehre, 147; Fisher, Violence, 86: »many Athenians felt a fair degree of confidence in their courts«. 27 Vgl. Martin, Geschichten, 15: »Charakteristisch für Athen ist nun, dass viele Verfehlungen überhaupt nicht vor Gericht gezogen wurden, sondern nur dann, wenn von ihnen eine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung ausging.« Vgl. Blundell, Friends, 54f.
202
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
rechtlichen Schritte der jeweiligen Kontrahenten nachzuvollziehen. Denn die Ehre und das Recht bestanden in Athen nicht nur nebeneinander, sondern sie traten miteinander in Korrespondenz, weil einzelne Akteure sich entschieden, sie wechselweise oder nacheinander bei demselben Streitfall heranzuziehen. Der Fluchtpunkt der Fragestellung zielt auf die ehrenhaften Verhaltensweisen der athenischen Streithähne, denn sie illustrieren die Vorstellung der Athener von Ehre. Mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse wird sich zeigen, wie sich die Normen der Ehre mit den im Interesse der Polis bestehenden Gesetzen vertragen. Die Verschränkung und Überlappung der normativen Ansprüche von Ehre und Polis stecken den Bezugsrahmen für das Verhalten der athenischen Bürger ab. Obwohl die Ehre und auch die Polis eine direkte handlungsleitende Funktion haben, schließen sie sich in ihrer Orientierungsmöglichkeit für den einzelnen Akteur nicht gegenseitig aus. Ehre und Polis können zwar als konkurrierende Loyalitäten begriffen werden, die Konkurrenz zwischen ihnen aber erweitert für einen athenischen Polisbürger, der sich als Ehrenmann begreift, eher das Repertoire seiner Handlungsmöglichkeiten in einer gegebenen Situation. Denn die Grenzen zwischen dem normgerechten Verhalten eines Ehrenmannes und dem eines Polisbürgers sind fließend, und sie werden von den einzelnen athenischen Bürgern vor Gericht in Fluktuation gehalten. Weil erst die richtige Interpetation eine Handlung zu einer ehrenhaften und ihren Akteur zu einem Ehrenmann macht, bilden die athenischen Gerichte das ideale Forum für die diskursive Auseinandersetzung um das richtige Verhältnis von Polis und Ehre. Eine besondere Herausforderung für die Kunst der Logographen bilden Fälle, in denen direkt um die Ehre eines athenischen Bürgers gestritten wird. In einer durch Ehre strukturierten Gesellschaft ist ein Verhalten, das sich nicht als ehrenhaft interpretieren lässt, schwerlich zu konstatieren. Denn einerseits ist jedes soziale Verhalten potentiell geeignet, von den Zeitgenossen als ehrenhaft interpretiert zu werden und andererseits verhindert dieser totale Deutungsanspruch methodisch die Verifizierung nicht ehrenhaften Verhaltens. Das gilt besonders für den Bereich des Agons und des Konfliktverhaltens in der athenischen Gesellschaft, denn hier muss die Ehre eines Mannes eindrücklich demonstriert werden. In allen Reden, die vor den athenischen Gerichten gehalten wurden, ging es deshalb mehr oder minder auch immer um die Ehre der involvierten Personen. Eine öffentliche Interpretation der Handlungen eines Mannes, wie sie vor den Geschworenengerichten erfolgte, brachte naturgemäß auch seinen Anspruch auf Ehre zur Geltung. Die im ersten Kapitel zu untersuchenden Reden Gegen Meidias, Gegen Konon und Gegen die Anschuldigung des Mordes an Eratosthenes unterscheiden sich in der Intensität, mit der sie die Ehre als Gegenstand der Aus-
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
203
einandersetzung umkreisen, nur graduell von anderen Reden. Für die Analyse ehrenhafter Konfliktführung in Athen sind sie deshalb besonders geeignet, weil alle drei einen Streit zwischen zwei Ehrenmännern behandeln, der in einer eklatanten Ehrverletzung kulminiert, für die sich die unterlegene Partei nach den Normen der ehrenhaften Konfliktführung kaum revanchieren kann, sofern sie sich nicht – wie Euphiletos – für die Tötung des Rivalen entscheidet. Mit der Ohrfeige im Theater im Falle des Meidias, der Misshandlung des Ariston im Falle des Konon und der Tötung des Eratosthenes durch Euphiletos haben die Kämpfe der Ehrenmänner ihr Finale erreicht. Meidias, Konon und Euphiletos sind als die klar Überlegenen aus dem Konflikt hervorgegangen, ihnen gebührt Sieg und Ehre. Die erneute Begutachtung der strittigen Angelegenheiten und der gesamten Konfliktführung des jeweiligen Gegners vor einem athenischen Gericht wechselt den normativen Bezugsrahmen und ermöglicht eine neuerliche Interpretation des Geschehenen. Die Ehre der Beteiligten steht erneut zur Verhandlung. Weniger krass verlaufen die im zweiten Kapital zu analysierenden Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen weniger prominenten Athenern, die sich teils auf der Straße, teils in den Gerichtshöfen abspielen. Die 3. und 4. Rede des Lysias Gegen Simon und Über eine vorsätzlich zugefügte Wunde, und die 53. und 47. demosthenische Rede Gegen Nikostratos und Gegen Euergos und Mnesiboulos wurden wegen ihrer detailgenauen Darlegung der einzelnen Stationen des sich zuspitzenden Konflikts zwischen den jeweiligen Kontrahenten ausgewählt. Die Streitigkeiten sind mitnichten beendet, durch den Prozess werden sie lediglich auf die juristische Ebene verlagert. Nach einem zumeist verbalen Schlagabtausch als Einstieg und darauffolgenden Tätlichkeiten führen die gerichtlichen Verfahren die Auseinandersetzungen mit veränderten Regeln, aber unverminderter Dynamik fort. Der Appell an die athenischen Gerichte und an die Norm der Polis ermöglicht es etwa Apollodor oder dem Gegner des Simon, ergänzende Schauplätze und veränderte Interpretationsmuster in ihren Auseinandersetzungen zu nutzen. Bei der Untersuchung dieser Reden ist besonders die von den Akteuren hergestellte Verzahnung der Schlägereien auf der Agora mit den Wortgefechten in den Gerichtshöfen von Interesse. Das dritte Kapitel schließlich behandelt Gerichtsreden, in denen es um die Rechtmäßigkeit von Ehrungen durch die Polis geht. Bei der Vergabe von Ehrungen fungierte die Polis als Souverän sowohl der politischen als auch der sozialen Ordnung. Sie honorierte besondere Leistungen vermögender Bürger für das Gemeinwesen, indem sie diese öffentlich auszeichnete und so die ohnehin bestehende soziale Privilegierung einiger sehr ehrenhafter Bürger innerhalb ihrer Normen und zu ihrem Vorteil sanktionierte. Da eine Ehrung durch die Polis bedeutete, dass der Bekränzte sowohl ein Mann von Ehre als auch ein guter Polisbürger war, erwies sich eine Verhin-
204
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
derung dieser Auszeichnung durch einen persönlichen Gegner als in ihrer Wirkung äußerst effektiv, weil umfassend für den Auserkorenen. Um zu zeigen, wie unwürdig jemand einer bestimmten, vorgesehenen Ehrung war, ergab sich vor Gericht die Gelegenheit, sein gesamtes Leben, sein Verhalten und seinen allgemeinen Habitus als weder den Normen der Ehre noch jenen der Polis genügend darzustellen. Das berühmteste Unternehmen zu diesem Zweck stammt von Aischines, dessen Rede Gegen Ktesiphon die Initiative zur Bekränzung des Demosthenes stoppen soll. Die von Demosthenes in eigener Sache geschriebene so genannte Kranzrede verteidigt seinen Anspruch auf die Ehrungen durch die Polis. Weil es sich bei der Kranzrede um eine der meistdiskutierten Reden des Demosthenes überhaupt handelt und weil hier offen die Argumente für oder wider den Anspruch einer Person auf Ehre bzw. Ehrung geführt werden, kann diese Rede die normativen Erwartungen der Athener an einen hervorragenden Ehrenmann und Polisbürger gut zeigen. Ergänzend sollen einige weitere, weniger aufsehenerregende Prozesse um Ehrungen betrachtet werden. Wie die demosthenischen Reden Gegen Androtion, Gegen Aristokrates und Über den trierarchischen Kranz belegen, nehmen auch weniger namhafte Bürger eine Ehrung durch die Polis zum Anlass, um den Sinn einer Ehrung zu reflektieren und ihren Gegner als deren unwürdig zu erweisen. Eine große Rolle spielt dabei immer die politische Gleichheit aller Bürger untereinander, die durch die Vergabe von Ehrungen durch die Polis und die damit verbundene Heraushebung einiger Personen aus der Bürgerschaft missachtet wird. Eine Stellungnahme zur bürgerlichen Gleichheit aus der Warte eines einfachen athenischen Bürgers bietet die 24. Rede des Lysias Für den Invaliden. Letzterer beansprucht zwar keine Ehrungen von der Polis, fordert aber einen Beitrag zu seinem Unterhalt ein, obwohl er außer seinem Bürgerstatus keinerlei Leistungen oder Ansprüche auf Privilegien geltend machen kann. Die Bürgerehre der athenischen Männer, die auf ihrer Zugehörigkeit zur Polisgemeinschaft beruht, ist hier das einzige Kriterium für die postulierte Gleichheit des Invaliden mit den übrigen Bürgern. Gerade weil er über keine nennenswerte soziale Ehre verfügt, vermag diese Rede die Auffassung der Athener von einer spezifischen Bürgerehre zu erhellen.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
205
1. Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes Das antagonistische Verhältnis zwischen der Ehre des einzelnen Atheners und dem Recht der Polis zeigt sich besonders in jenen Fällen, in denen die Ehre eines Mannes vor Gericht verhandelt wird. Das geschieht in den demosthenischen Reden Gegen Meidias und Gegen Konon und in der Verteidigung des Euphiletos wegen des Mordes an Eratosthenes durch Lysias. Diese drei Reden handeln von verletzter Ehre und von der Frage nach einer angemessenen Reaktion auf einen ehrenrührigen Affront. Die Dynamik des agonalen Spiels um die Ehre entfaltet sich durch ein bestimmtes Verlaufsmuster der Auseinandersetzungen und kann deshalb besonders gut in jenen Reden verfolgt werden, die langfristige Streitigkeiten zwischen zwei Kontrahenten spiegeln. In den demosthenischen Reden Gegen Konon und Gegen Meidias sind zwei Fälle überliefert, in denen die Ehre der Prozessierenden auf dem Spiel steht. Beide erzählen die Geschichten ihrer Feindschaften als langwierig und geprägt von verschiedenen Stationen des Kräftemessens, in denen sie immer wieder auf ihre Gegner treffen und dabei sowohl ihre eigene Ehre schützen als auch die der Gegner attackieren. Der Mechanismus dieser wechselseitigen Aktionen und Reaktionen bildet das ehrenhafte Verhalten des jeweiligen Atheners ab bzw. konstituiert es erst. Denn für einen ehrenhaften Mann bedeutet die Provokation eines anderen die ultimative Herausforderung sich zu beweisen – und zwar durch ein Verhalten, das demonstrativ den Regeln der Ehre folgt. In beiden Fällen stellt eine eklatante Ehrverletzung den Höhepunkt der Auseinandersetzung dar. Und in beiden Fällen reagiert der Geschädigte darauf, indem er seinen Gegner vor ein athenisches Gericht bringt. Der Fall des Euphiletos handelt ebenfalls vom Verhalten eines in seiner Ehre Geschädigten, ist aber etwas anders gelagert. Hier geht es um die einmalige Verletzung der sexuellen Ehre eines Mannes, dessen Reaktion darauf in der Tötung seines Rivalen besteht und der zugleich vor Gericht diesen Akt der Rache als die Exekutierung der Polisgesetze interpretiert. Euphiletos steht wegen seines unbestreitbar toten Nebenbuhlers Eratosthenes unter verstärktem Rechtfertigungsdruck, seine Selbstdarstellung ist gewagter und oszilliert mehr zwischen verschiedenen normativen Ansprüchen als die Berichte des Ariston und des Meidias. Euphiletos hat sich nicht an ein Gericht gewandt, sondern die Justiz in die eigenen Hände genommen. Von dieser verfolgt, sieht er sich nun genötigt, seine Handlungen vor einem Gericht konsensfähig zu machen.
206
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Allein die Tatsache der Verhandlung von Ehrendingen vor Gericht verweist auf die Anpassung der Vorstellung von Ehre und von gerichtlichen Verfahren an die Erfordernisse der athenischen Polis. Die vor der (idealiter) gesamten athenischen Bürgerschaft gehaltenen Reden stellen eine Metaebene der Konstruktion konsensfähigen Verhaltens dar, die nur durch eine rückblickende verbale Interpretation des Geschehens erreicht werden kann. Demosthenes, Ariston und Euphiletos stehen vor der nicht leichten Aufgabe, sich innerhalb der Polis als Ehrenmänner zu erweisen. Ihnen stehen für die Darstellungen ihrer Handlungen die beiden normativen Bezugssysteme der Ehre und der Polis zur Verfügung, die in ein Verhältnis zu bringen sind, das am ehesten jenem in den Köpfen der Zuhörer gleichkommt. Die Analyse der Reden folgt deshalb den formalen Kriterien für die Erfüllung der normativen Erwartungen an einen Ehrenmann einerseits und einen Polisbürger andererseits. Sollte sich Demosthenes ehrenhaft verhalten haben wollen, so müssten sich in der Rekonstruktion seiner Handlungen die agonalen Prinzipien der Reziprozität oder gar der Rache wiederfinden lassen. Sollte sich Euphiletos an den Gesetzen der Polis orientiert verhalten haben wollen, so müsste er sich bei Bedrängnissen an übergeordnete Autoritäten gewandt haben. Wenn Ariston sich an zumindest zwei alternativen Handlungsnormen orientieren konnte, so wird seine Rede das soziale Wissen um diese verschiedenen Optionen spiegeln. Welches Verhaltensmuster ist also erkennbar in den Gerichtsreden und wie begründen die Streitenden ihr Verhalten? Die spektakulärste und umstrittenste Rede, die auf einen Streit um die Ehre zurückgeht, ist die 21. Rede des Demosthenes Gegen Meidias. Demosthenes erzählt ausführlich die Geschichte der Feindschaft zwischen ihm und Meidias, deren Höhepunkt eine eklatante öffentliche Verletzung der Ehre des Demosthenes bildet, auf die letzterer mit einer Klage gegen Meidias reagiert. Demosthenes beginnt seine Rekonstruktion der Ereignisse mit den ersten feindseligen Handlungen des Meidias, die einige Jahre zurückliegen. Vor dem Hintergrund der demosthenischen Klage gegen die angeblich korrupte treuhänderische Verwaltung seines väterlichen Erbes und im Zuge eines folgenden Prozesses geraten Meidias und Demosthenes aneinander.28 Meidias gliedert sich durch seinen Bruder Thrasylochos und dessen Bekanntschaft mit den Treuhändern des demosthenischen Vermögens in die Reihen der Feinde des Demosthenes ein. Als solcher tritt er erstmalig für Demosthenes in Erscheinung, als er mit seinem Bruder, der ein Antidosisverfahren gegen Demosthenes führt, in dessen Haus eindringt. Obwohl auch Demos-
28 Demosth. 21, 78-80.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
207
thenes im taktischen Ausmanövrieren seiner Feinde versiert ist,29 übertreten Thrasylochos und Meidias als erste deutlich die Grenzen der juristischen Auseinandersetzung und machen sie zu einem Scharmützel um die Ehre der Beteiligten: Sie achten weder die Schwelle des demosthenischen Oikos als sakrosankt noch die Ehre der anwesenden Frauen.30 In dieser Situation wurzelt die ursprünglich zufällige Verfeindung des Demosthenes mit Meidias, der seinen Bruder unterstützen, nicht aber unbedingt dem Demosthenes, den er nicht kennt, schaden will. Demosthenes reagiert mit einem Prozess gegen Meidias wegen übler Nachrede (KAKHGOR…A).31 Er bekommt Recht, weil Meidias am festgesetzten Tag nicht vor dem Schiedsrichter erscheint. Anstatt sein Bußgeld zu zahlen, gelingt es Meidias, dem Schiedsrichter das Bürgerrecht entziehen zu lassen.32 Nach diesem Auftakt verstreichen einige Jahre, aus denen Demosthenes offenbar nichts für berichtenswert hält. Erst in den Frühling des Jahres 348 fällt das die Klage auslösende Ereignis, als Demosthenes sich freiwillig dazu bereit erklärt, für die Feier der Großen Dionysien als Chorege zu fungieren.33 Damit präsentiert er sich nicht nur als vorbildlicher Bürger, der sich der Öffentlichkeit und dem Kult seiner Polis verpflichtet fühlt, sondern er erstrebt die durch die Athener verliehene Ehre des Sieges für sich selbst und seine Phyle Pandionis. Die Funktion des Choregen bietet Demosthenes die perfekte Gelegenheit, sich sowohl als guter Polisbürger als auch als ein Mann von Ehre zu erweisen. Meidias tut alles Erdenkliche, um den Auftritt und Erfolg des Demosthenes zu sabotieren. Demosthenes zählt auf: Meidias versucht, die Befreiung der Choreuten vom Militärdienst zu verhindern, und er meldet sich für ein Amt bei den Dionysien.34 Dann bricht er in die Werk29 Vgl. die Erläuterungen zum Verfahren der Antidosis und den mutmaßlichen Motiven und Manövern des Demosthenes und seiner Gegner: Demosthenes, Against Meidias (Oration 21), eingel. übers. u. komm. v. D.M. MacDowell, Oxford 1990, 295-299. 30 Demosth. 21, 78-79: E„SEP»DHSAN ¢DELFÕJ Ð TOÚTOU KAˆ OáTOJ E„J T¾N O„K…AN ... KAˆ PRîTON μÒN KATšSCISAN T¦J QÚRAJ TîN O„KHμ£TWN ... EÍTA TÁJ ¢DELFÁJ, œT' œNDON OÜSHJ TÒTE KAˆ PAIDÕJ OÜSHJ KÒRHJ, ™NANT…ON ™FQšGGONTO A„SCR¦ KAˆ TOIAàTA OŒ' ¨N ¨NQRWPOI TOIOàTOI FQšGXAINTO ..., KAˆ T¾N μHTšRA K¢μÒ KAˆ P£NTAJ ¹μ©J HT¦ KAˆ ¥RRHTA KAK¦ ™XE‹PON: »[Es] überfielen mich Meidias und sein Bruder in meinem Hause ... Ohne weiteres fingen sie damit an, die Thüren zu den Zimmern aufzusprengen ... sodann scheueten sie sich nicht vor meiner Schwester, die damals als unverheirathetes Mädchen noch im Hause war, unflätige Reden zu führen, Reden, wie man sie von solchen Menschen nur erwarten kann, ... und schimpften auf meine Mutter und auf mich und auf uns alle zusammen in jeder erdenklichen Weise.« Übersetzung A. Westermann. 31 Demosth. 21, 81. 32 Ebd. 83-93. 33 Ebd. 13. 34 Ebd. 15. Demosthenes sagt nichts Näheres zu letzterem Punkt. Meidias möchte als einer der Epimeletai fungieren, was mit Arbeits- und Geldaufwand verbunden ist, und ihm von Demosthenes schwerlich zu seinen Ungunsten ausgelegt werden kann, vgl. MacDowell, Demosthenes, 238.
208
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
statt des Goldschmiedes ein, der von Demosthenes mit der Herstellung des Goldschmucks für das Fest beauftragt worden ist, und kann einen Teil davon zerstören, ehe er entdeckt und daran gehindert wird.35 Schließlich versucht Meidias, den Dirigenten des Chores zu bestechen, den präsidierenden Archon zu korrumpieren und die anderen Choregen gegen Demosthenes aufzuhetzen.36 Demosthenes äußert sich nicht zu seiner Reaktion auf diese Sabotageakte, er macht nur deutlich, dass Meidias sein Ziel nicht erreicht hat. Denn am gegebenen Tag steht Demosthenes prunkvoll geschmückt mit seinem Chor auf der Bühne, um den Siegespreis für seine Darbietung zu erstreiten. Was Meidias in dieser Situation tut, so Demosthenes, übertrifft alle seine bisherigen Handlungen: DÚO TAàTA æSPEREˆ KEF£LAIA ™F' ¤PASI TO‹J ˜AUTù NENEANIEUμšNOIJ ™PšQHKEN, ™μOà μÒN ÛBRISEN TÕ SîμA, TÍ FULÍ DÒ KRATOÚSV TÕN ¢GîN' A„TIèTATOJ TOà μ¾ NIKÁSAI KATšSTH.37 Meidias hat Demosthenes in aller Öffentlichkeit ins Gesicht geschlagen und zudem den verdienten Sieg seiner Phyle verhindert. Letzteres beurteilt Demosthenes als schwerwiegender, es bildet den dramatischen Höhepunkt der sich stetig steigernden Angriffe des Meidias. Die Reaktion des Demosthenes auf diesen Affront besteht in seiner Wendung an die Athener als urteilender Instanz. In einer außerordentlichen Volksversammlung am folgenden Tag erwirkt er durch das Verfahren der PROBOL» eine Vorverurteilung der Athener gegen Meidias.38 Die Volksversammlung bestätigt durch Mehrheitsentscheid, dass sich Meidias eines »Vergehens während der Festlichkeiten« schuldig gemacht hat. Da dieses Urteil keine rechtlichen Konsequenzen hat, bringt Demosthenes die Sache ein Jahr später vor ein athenisches Gericht. Zwischen besagtem Ereignis und dem Gerichtsverfahren belässt es Meidias nicht etwa bei dieser radikalen Attacke, sondern er setzt seine Angriffe fort: Er verklagt Demosthenes wegen Mordes und Desertion, versucht, ihn an der Übernahme öffentlicher Ämter zu hindern und tut einiges, um seine Person zu diskreditieren.39 Demosthenes lässt nichts über etwaige Aktionen seinerseits verlauten, er wartet das Urteil des athenischen Gerichts ab.
35 Demosth. 21, 16. 22. 36 Ebd. 17. 37 Ebd. 18: »Und schließlich ... führte er, um seinen Heldenthaten gleichsam die Krone aufzusetzen, noch zwei Hauptstreiche aus, indem er mich selbst persönlich verletzte und meinen Stamm des ehrenvoll bestandenen Wettkampfs ungeachtet um die Ehre des Siegs brachte.« 38 Ebd. 19. 39 Ebd. 110-116.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
209
Die demosthenische Selbstdarstellung entwirft das Bild einer Person, die bestrebt ist, ein friedfertiger und verantwortungsbewusster Bürger zu sein. Als solcher gilt ihm die Ehre nur insofern etwas, als er sie für seine Phyle oder die athenische Polis erringen kann. Ebenso stellt die athenische Gerichtsbarkeit den Bezugspunkt seines agonalen Verhaltens dar: Außer auf der juristischen Ebene lässt sich Demosthenes auf keinen Schlagabtausch ein. Sein Verhalten erscheint so tadellos und das des Meidias so skrupellos, dass die beiden zentralen Charaktere seiner Geschichte wenig glaubhaft sind. Offenbar erwarteten die athenischen Zuhörer eine Art Darstellung des »Soll«-Zustandes ihres Gemeinwesens und seiner Bürger; anders ist kaum zu glauben, dass Demosthenes seine Rede mit einer solchermaßen schematischen, holzschnittartigen Zeichnung der Protagonisten für überzeugend erachtete vor einem Publikum, das immerhin attische Tragödien zu schätzen wußte. Nichtsdestoweniger fand die klar positionierende Charakterisierung der Personen in der neueren Forschung ihre Anhänger, weil sie genau die beiden entgegengesetzten Pole möglichen Verhaltens beschreibt, die einander in einer Gesellschaft mit einem konsistenten Normensystem eigentlich ausschließen sollten. Die demosthenische Darstellung schlägt sich in der Forschung in der Konzentration auf jeweils eine der beiden Personen nieder, die zum typischen Athener jener Zeit stilisiert wird. Das Verhalten des jeweils anderen wird dabei vernachlässigt, man unterstellt rhetorische Übertreibung. Im Rahmen ihrer Untersuchungen zum Konfliktverhalten der Athener haben sich David Cohen und Gabriel Herman vor allem auf jene Reden konzentriert, in denen um die Ehre gekämpft wird. Beide betrachten die Einstellung der Athener zur Ehre als ausschlaggebend für die Intensität gewalttätiger Auseinandersetzungen und für die Chancen auf eine friedliche Beilegung. Die demosthenische Rede Gegen Meidias hat für beider Argumentationsführung eine Schlüsselfunktion, die sie direkt zu ihren antithetischen Auffassungen über die Rolle der Ehre bei den Athenern führt. Trotz identischer Quellenauswahl und gleichem analytischen Bezugsrahmen – den agonalen, ehrhaften, mediterranen Gesellschaften der anthropologisch Forschenden – widersprechen sich die Thesen Cohens und Hermans diametral. Letzterer verweist in einer Stellungnahme zu Cohens Werk auf die unterschiedlichen Perspektiven beider Forscher: »We may as well start with what might appear to be C.’s strongest claim, namely that enmity, revenge, envy, insult, honour and ÛBRIJ – features indeed typical of feuding societies – were central to the appeals made ›to the values of the mass courts‹. That such motifs played a central role in litigation is undeniable. The small proviso should be added, however, that this central role was ›negative‹. In other words, these motifs surfaced in assertions that, quite unlike one’s
210
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
opponent, one definitely had no such motivation: that on the whole such motivations were out of place in a city such as Athens.«40 Sowohl Cohen als auch Herman kennen also beide Seiten, differieren aber in ihrer Entscheidung, aus welcher Perspektive sie mehr von der Lebenswirklichkeit der Athener sehen können. Während Herman den erklärten Normenkonsens vor Gericht für die verbale Entsprechung des gewöhnlichen Verhaltens der meisten Athener – und des Demosthenes – hält, stellt für Cohen das wenig beschönigte Verhalten des Meidias ein Beispiel für den durchschnittlichen Athener und jeden anderen Mann in einer ehrenhaften Gesellschaft dar.41 Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass zwei Athener, die sich permanent bekämpfen, sich also auf irgendeiner Ebene immer wieder treffen müssen, gänzlich gegensätzliche Kommunikations- und Konfliktstile haben sollten. Allein die Tatsache, dass beide des öfteren prozessieren und sich im Verlaufe eines gerichtlichen Verfahrens erst kennen und hassen lernen, verweist auf einen zumindest partiell ähnlichen Vorstellungshorizont, was Zeit, Ort und Art der Attacke in einem Streit angeht. Denn auch wenn Meidias seine Handlungen nach ihrer Ehrenhaftigkeit ausrichtet und Demosthenes als sein Bezugssystem die Polis nennt, so befinden sich beide doch auffallend häufig in den gleichen sozialen Räumen, in denen sie sich nach beiderseits anerkannten Regeln miteinander messen. Zudem zielte die ausgeprägte agonale und vergeltende Ethik der Ehre ins Leere, wenn der Gegner sie nicht als solche anerkennen und erwidern würde. Wahrscheinlicher ist daher, dass beiden Athenern – ebenso wie allen anderen Bürgern – gleichzeitig die Normensysteme der Ehre und der Polis zur Einschätzung und Interpretation ihrer Handlungen zur Verfügung gestanden haben. Inwiefern ein Athener sich im Sinne des Abwägens der Vor- und Nachteile einer bestimmten Handlung wirklich »aussuchen« konnte, an welchen Normen er sich in seinem Verhalten jeweils orientieren wollte, ist sicher nicht zu beantworten und spricht dem Einzelnen vermutlich mehr Entscheidungsfreiheit zu, als er wirklich besaß. Unleugbar ist jedoch, dass die Norm der Ehre für sich genommen schon einen großen Interpretationsraum eröffnet, der dem Einzelnen eine sehr flexible Einordnung seines Verhaltens in den normativen Kodex ermöglicht, und dass dieser geräumige
40 Herman, Rez. Cohen, 613. 41 Cohen, Law, 90, beginnt seine Analyse der 21. demosthenischen Rede mit den Worten: »This complex case may serve as a kind of paradigm for the notion of litigation as feud advanced above.« Herman, Honour, 50, schließt seine Interpretation der Rede wie folgt: »The conclusion thus offers itself that the ideal of non-retaliation and self-restraint was put into practice at the cost of elevating the threshold of insult to uncommonly high levels: the ideal citizen of democratic Athens ... was expected to have a very limited sense of honour indeed.«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
211
Interpretationsspielraum wiederum komplementär ergänzt wird durch jenen, den die athenische Polis mit ihren politischen und gesetzlichen normativen Ansprüchen setzt. Für einen einzelnen Athener bedeutet das praktisch, dass er – insbesondere was die rückblickende Rekonstruktion seiner Handlungen betrifft, wie es die Situation erfordert, in der sich Demosthenes vor Gericht befindet – kaum jemals in die Schwierigkeit kommt, sein Verhalten weder in den einen noch in den anderen Kontext normativ einpassen und legitimieren zu können. Deviantes Verhalten ist damit in der athenischen Gesellschaft selten. Wenn es auftritt, macht die relative Leichtigkeit der Erfüllung der bestehenden Normen eine Person, die das nicht vermag oder zu schätzen weiß, umso weniger wünschenswert und sozial akzeptabel. Dies genau ist die Position, in die Demosthenes den Meidias zu manövrieren versucht, indem er argumentiert, Meidias habe sowohl die Normen der Ehre als auch jene der Polis in böswilliger Absicht missachtet. Auf der anderen Seite steht das von der Gemeinschaft der Athener erwünschte Verhalten des Demosthenes. Die Tatsache, dass sich das demosthenische Verhalten innerhalb der umgrenzten normativen Bereiche der Polis und der Ehre bewegt, bedeutet nicht, dass es unerheblich und gleichermaßen akzeptiert ist, wo genau er sich gerade befindet. Es scheint im Gegenteil von größter Wichtigkeit zu sein, sich sowohl als Ehrenmann als auch als Polisbürger zu erweisen und beide Eigenschaften in einem »stimmigen« Verhältnis zueinander an den Tag zu legen. Damit ist nicht die Harmonisierung beider nebeneinander bestehender normativer Bezugssysteme gemeint, sondern die Abstimmung der Aussagen des Demosthenes auf die Erwartungshaltung seiner Zuhörer. Die demosthenischen Aussagen werden jene Mischung der einander fließend begrenzenden Ansprüche der Polis und der Ehre abbilden, die er bei seinen Zuhörern vermutet. Dabei wird dieses Mischungsverhältnis flexibel und formbar sein, so dass Demosthenes in der Erzählung seiner Geschichte nach beiden Seiten hin übertreiben kann, ohne allzu unglaubhaft zu wirken. So abstrakt die demosthenische Situation damit beschrieben sein mag, so deutlich verweist seine Rede doch auf das Nebeneinander der normativen Konfliktverhaltensregeln von Polisgesetzen und Rachefeldzügen. In den Paragraphen 29 bis 34 skizziert Demosthenes quasi die Entwicklung rechtlicher Konfliktbeilegung durch die Eingrenzung der Möglichkeiten des rächenden Ehrenmannes. Formal führt Demosthenes diesen Passus an, um das Argument des Meidias antizipierend zu entkräften, bei ihrem Streit handele es sich um eine rein private Auseinandersetzung zwischen zwei reichen Ehrenmännern der Oberschicht. In der Tat ist die Zementierung des demosthenischen Anspruchs, er vertrete eine öffentliche Klage und stehe damit stellvertretend für alle Athener und ihre Gesetze, von zentraler Be-
212
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
deutung für seine rhetorische Position.42 Meidias werden in direkter Gegenposition dazu die Reaktionsstrategien des rächenden Ehrenmannes zugeordnet. Demosthenes unterstellt ihm, dass er von ihm eine ehrenhafte Vergeltungsstrategie befürchtet, wie er selbst sie anwenden würde: /ÍDA TO…NUN ÓTI KAˆ TOÚTJ POLLù CR»SETAI Tù LÒGJ, ›μ» μE $HμOSQšNEI PARADîTE, μHDÒ DI¦ $HμOSQšNHN μE ¢NšLHTE: ÓTI TOÚTJ POLEμî, DI¦ TOàTÒ μE ¢NAIR»SETE;‹43 Da Demosthenes aber den juristischen Weg gewählt hat, weist er die Maßnahmen, die der in seinem Ehrdenken befangene Meidias im Sinn hat, als für ihn und den athenischen Demos nicht angemessen zurück: œCEI D' OÙC OÛTW TAàTA, OÙD' ™GGÚJ. OÙDšNA G¦R TîN ¢DIKOÚNTWN ØμE‹J OÙDENˆ TîN KATHGÒRWN ™KD…DOTE: OÙDÒ G£R, ™PEID¦N ¢DIKHQÍ TIJ, æJ ¨N ›KASTOJ Øμ©J Ð PAQëN PE…SV POIE‹SQE T¾N TIμWR…AN.44 Demosthenes macht sein Anliegen damit zu einer allgemeinen Sache, er definiert seine Position als die aller Athener. Wichtiger noch ist allerdings die Zurückweisung der normativen Erwartungen, die Meidias aus der Welt der Ehrenmänner an ihn stellt. Ihr entgegen setzt Demosthenes die Gesetze und die athenischen Gerichte als alternative Mittel der Konfliktbeendigung: ¢LL¦ TOÙNANT…ON NÒμOUJ œQESQE PRÕ TîN ¢DIKHμ£TWN, ™P' ¢D»LOIJ μÒN TO‹J ¢DIK»SOUSIN, ¢D»LOIJ DÒ TO‹J ¢DIKHSOμšNOIJ. OáTOI DÒ T… POIOàSIN Oƒ NÒμOI; P©SIN ØPISCNOàNTAI TO‹J ™N TÍ PÒLEI D…KHN, ¨N ¢DIKHQÍ TIJ, œSESQAI DI' AÙTîN LABE‹N. ÓTAN TO…NUN TîN PARABAINÒNTWN TIN¦ TOÝJ NÒμOUJ KOL£ZHTE, OÙ TO‹J KATHGÒROIJ TOàTON ™KD…DOTE, ¢LL¦ TOÝJ NÒμOUJ Øμ‹N AÙTO‹J BEBAIOàTE.45 Er hebt die Unpersönlichkeit und Allgemeinheit der Gesetze hervor, um sich zusammen mit den Athenern unter ihren Schutz zu stellen und durch diese allgemeine Loyalitätsbekundung zu den Gesetzen wiederum ihre Durchsetzungskraft zu garantieren. 42 Vgl. Ober, Power, 93-95. Cohen, Rights, 38, liest das Argument so: »To find for Meidias would be to deprive ordinary citizens of their equal rights, their equal right to obtain redress from the courts, even against the wealthiest and most powerful citizens.« 43 Demosth. 21, 29: »Ich weiß ferner, dass er auch folgender Ausflucht gar fleißig sich bedienen wird. ›Gebt mich dem Demosthenes nicht preis; richtet mich nicht um des Demosthenes willen zu Grunde: weil ich mit ihm in Feindschaft lebe, deshalb wollet ihr mich zu Grunde richten?‹« 44 Ebd. 30: »Allein es ist kein wahres Wort daran. Niemals gebt ihr einen Verbrecher seinem Ankläger preis: denn wird ein Verbrechen begangen, so richtet ihr die Strafe nicht erst nach dem Vorschlag des Verletzten ...«. 45 Ebd. im Anschluss: »sondern nach Vorschrift der Gesetze ein, die ihr schon lange vorher erlassen habt, zu einer Zeit, wo niemand daran dachte, wer der Verbrecher sein würde und wer der Verletzte. Und diese Gesetze, was tun sie? Sie leisten allen im Staate Gewähr dafür, dass, wer in seinem Rechte gekränkt werde, durch sie Genugthuung erhalten könne. Bestraft ihr also einen Übertreter der Gesetze, so gebt ihr ihn nicht preis, sondern bringt nur eure Gesetze zur Geltung.« Vgl. ebd. 76.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
213
Demosthenes bezieht sein der gesamten Rede unterliegendes duales Konzept hier auf die beiden Möglichkeiten der Konfliktführung. Auf die eine Seite positioniert er Meidias mit seinem persönlichen, rächenden Verhalten, und auf die andere Seite stellt er sich selbst zusammen mit allen anderen Athenern, den Gesetzen und den Göttern.46 Abgesehen von der Isolation des Meidias, die ihn per se ins Unrecht setzt, macht Demosthenes auf einer anderen Ebene deutlich: Es gibt zwei unterschiedliche Bezugssysteme, die den Einzelnen mit verschiedenen normativen Verhaltenserwartungen konfrontieren. Sie sind – wenn man ihre Extreme betont, wie es Demosthenes hier tut – eindeutig voneinander unterscheidbar und jeweils als relativ zusammenhängende Komplexe von Einstellungen und Taten identifizierbar. Demosthenes weiß das, Meidias weiß das und die anwesenden athenischen Männer wissen es auch. Deshalb verwickelt sich Demosthenes nur oberflächlich gesehen in Widersprüche, wenn er neben seiner Betonung, ein gesetzestreuer Polisbürger zu sein, auch seinen Anspruch auf Ehrenhaftigkeit nicht ganz vernachlässigt. Zwar scheint es ihm sehr wichtig zu sein, seine eigenen Handlungen als für einen guten Polisbürger normgerecht zu interpretieren, auf der anderen Seite legt Demosthenes aber bestimmte charakteristische Handlungsweisen eines Ehrenmannes doch nicht ab. Zu diesen gehören vor allem jene Zeichen von Ehrenhaftigkeit, die den politischen Ablauf der Demokratie nicht stören, sondern ihn eher unterstützen. Die größte Schwierigkeit bei dem Versuch, Demosthenes einen Sinn für seine Ehre zuzuschreiben, besteht in einer schlüssigen Erklärung seines Konfliktverhaltens. Demosthenes Ehre wurde im Theater auf das schmählichste verletzt und Demosthenes nimmt diesen Schlag ins Gesicht seiner Ehre in Anwesenheit aller Athener hin. Ein solches Verhalten wird gemeinhin als Erweis gesehen dafür, dass jemand sich nicht als Ehrenmann begreift.47 Das für Demosthenes in dieser prekären Situation zu tun Gegebene 46 Sinnbildlich dafür steht die Szene bei der Übernahme der Choregie, Demosth. 21, 13f.: ›PARELQëN ØPESCÒμHN ™Gë CORHG»SEIN ™QELONT»J, KAˆ KLHROUμšNWN PRîTOJ AƒRE‹SQAI TÕN AÙLHT¾N œLACON, ÙμE‹J μšN, ð ¥NDREJ '!QHNA‹OI, P£NTEJ ¢μFÒTER' æJ OŒÒN TE μ£LIST' ¢PEDšXASQE, T»N TE ™PAGGEL…AN T¾N ™μ¾N KAˆ TÕ SUμB¦N ¢PÕ TÁJ TÚCHJ, KAˆ QÒRUBON KAˆ KRÒTON TOIOàTON æJ ¨N ™PAINOàNTšJ TE KAˆ SUNHSQšNTEJ ™POI»SATE, -EID…AJ D' OØTOSˆ μÒNOJ TîN P£NTWN, æJ œOIKEN, ºCQšSTH‹. »Da trat ich auf und bot mich freiwillig zum Choregen an, und als hierauf das Loos mich traf, zuerst den Flötenspieler mir zu wählen, da waret ihr insgesammt über beides, über mein Anerbieten sowohl als über jenen Glücksfall, hoch erfreut, Männer von Athen, und gabet eure Billigung und Freude durch lautes Beifallrufen zu erkennen; der einzige hingegen, der sich darüber ärgerte, war Medias, wie es scheint«. Vgl. ebd. 2. 7. 61. 108. 123-127. 140. 220. 47 Der Schlag ins Gesicht des Gegners markiert in vielen Gesellschaften eine direkte Aufforderung für den ultimativen Zweikampf. M. Gilsenan, Lying, Honor, and Contradiction, in: B. Kapferer (Hg.), Transaction and Meaning. Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behavior, Philadelphia 1976, 191-219, stellt für ein nordlibanesisches Dorf fest: »For a
214
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
kann nur sein, auf den Affront des Meidias unmittelbar und heftig, zumindest aber deutlich und auf gleicher Ebene, besser noch einen Schritt extremer, zu reagieren. Nichts in dieser Hinsicht geschieht. Stattdessen strengt Demosthenes erst ein Jahr später einen Prozess an, der sich eher auf Formalia denn auf persönliche Beschädigungen bezieht. Das Verfahren stellt er – einer Notiz des Aischines zufolge – ein, als Meidias ihm eine geringe Summe Geldes dafür bietet.48 Es überrascht wenig, dass G. Herman angesichts dieses Ganges der Ereignisse zu folgendem Schluss kommt: »The ideal citizen of democratic Athens was strongly immunized against offence ... he was expected to have a very limited sense of honour indeed.«49 Betrachtet man die Situation im Theater, so stellt sie sich für Demosthenes ohnehin als eine »no-win-situation« dar. Diese Kategorisierung aber kann zugleich als Argument dafür dienen, das demosthenische Ehrgefühl zu verteidigen: Der Angriff des Meidias ist nicht zu überbieten, Demosthenes hat keine Möglichkeit, den Affront gegen seinen Angreifer zu wenden, indem er ihn mit den gleichen Waffen stärker schlägt. Er ist nach allen Regeln der Kunst besiegt worden. Was immer ihn bewogen haben mag, Meidias im Theater zu diesem Schlag zu provozieren oder ihn nicht zu erwidern, ist nicht feststellbar. Unterstrichen sei hier nur, dass Demosthenes sich zwar nicht in diesem Moment, aber doch im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen als ein Mann mit Ehre im Leib erweist. Zunächst eröffnet er am folgenden Tag das Verfahren der PROBOL».50 Ebenso wie die im Theater anwesenden athenischen Männer seine Schmach mitangesehen und durch ihre Öffentlickeit verstärkt haben, so stellen sie nun über den sozialen Konsens das Unrecht des Meidias fest. Seine genauere Verfehlung bleibt unbestimmt, was für Demosthenes von Vorteil ist, denn so versammelt er erst einmal die Athener hinter sich und kann später selbst definieren, wessen sich Meidias schuldig gemacht hat. Zumindest hat Demosthenes mit dieser unverzüglichen Anberaumung der Volksversammlung die Situation des vorherigen Tages in gewissem Sinne umgekehrt: Nun face-to-face insult or blow, instant retaliation may be demanded, at least when an audience whose judgment is significant for the one challenged is present«, 200. 48 Aischin. 3, 52, konträr dazu Demosth. 21, 3. Die Glaubwürdigkeit der Aussagen und die möglichen Konsequenzen daraus sind viel diskutiert worden, ohne jedoch zu einem Konsens zu kommen; vgl. etwa Ober, Power, 91f., oder E.M. Harris, Demosthenes’ Speech against Meidias, in: HSPh 92 (1989), 117-136; MacDowell, Demosthenes, 23-28. Einzig Herman, Society, 107, referiert die Quellenaussage als Faktum. 49 Herman, Honour, 50. Vgl. ders., Society, 106f: »quite unlike the code of honour found in non-westernized modern, or pre-industrial European, societies ... the Athenian code prescribed that upon being provoked, offended, or injured a citizen should not retaliate, but should exercise selfrestraint, avoid violence, reconsider, or renegotiate the case; in brief, compromise.« 50 Vgl. E. Berneker, PROBOL», in: RE 23 (1957), 43-48, 44: »Der Gegenstand der p. war kein Recht oder Rechtsverhältnis, sondern ein Sachverhalt, dessen Bestehen oder Nichtbestehen durch den Volksbeschluss festgestellt wurde.«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
215
ist er an Meidias’ Stelle mit allen im Bunde gegen seinen Gegner.51 Meidias wird ins Unrecht gesetzt, sein Sieg fadenscheiniger, denn hätte er Demosthenes nach allen Regeln der Kunst der ehrenhaften Konfliktführung besiegt, so müsste er sich schon an diese gehalten haben. Der Konsens der athenischen Bürger bestätigt, dass Meidias nicht normgerecht gehandelt hat. Der Wettkampf zwischen beiden um die Ehre erscheint als ein von Meidias vorangetriebenes falsches Spiel.52 Dazu passt der scheinbar überlegene Schachzug des Meidias, den Demosthenes im Theater in eine ausweglose Situation zu bringen. Denn in einem Wettstreit um die Ehre gilt es immer auch, dem Gegner einen gewissen Interpretationsspielraum, eine Rückzugsmöglichkeit zu belassen.53 Sieger ist in diesem Sinne nicht, wer am Ende triumphiert, sondern wer das Spiel am besten gespielt hat. Die Entscheidung darüber fällen die Zuschauer bzw. die Beobachter. Ebenso wenig wie Meidias der überlegene Ehrenmann ist, so handelt Demosthenes ohne jegliches Ehrgefühl. Die demosthenische Rede stellt Meidias vielmehr als jemanden dar, der das angemessene Tun verfehlt, die Regeln sowohl der demokratischen Gemeinschaft als auch der Ehre übertreten hat und der Hybris verfallen ist.54 Demosthenes hingegen verhält sich als guter Polisbürger und als ein Ehrenmann. Es ist ein typisches Kennzeichen ehrenhafter Wertvorstellungen, dass Demosthenes zur Sanktionierung seines Verhaltens den sozialen Konsens der Mehrheit der athenischen Männer sucht. Nur durch die öffentliche Anerkennung kann die Ehrzuschreibung erfolgen, dieser Mechanismus scheint ihm stets präsent zu sein. Ebenso vergrößert die Öffentlichkeit im Theater natürlich das Gewicht seiner Ehrverletzung durch Meidias. Um den Vorfall zu relativieren, verlagert Demosthenes die Ehrverletzung auf seine Rolle als Chorege55 und spricht an der entscheidenden Stelle seiner Erzählung eher von der Hybris des Meidias als von seiner eigenen Person: ™μOà μÒN ÛBRI51 Vgl. Ober, Power, 90: »This prejudicial judgement in a probolê ... gave Demosthenes a boost in their future dealings by demonstrating that public opinion was behind him: the demos agreed that Meidias’ behaviour had been out of line.« 52 Huizinga, Homo, 18f., bezeichnet die gewonnene Ehre allgemein als den Preis für den Sieger eines Spiels, 55, in dem der Falschspieler immer ein irritierendes Moment darstellt. 53 J. Elster, Norms of Revenge, in: Ethics 100 (1990), 862-885, beschreibt die Einstellung der Wettstreiter so: »It was not always crystal clear whether an act required retaliation. Many triggering events deliberately left scope for interpretation. The insulting party usually took care to leave the door open for several interpretations because his goal was to humiliate the other party, not to provoke him to reply in kind. Some affronts, however, could not be overlooked without an intolerable loss of honor.« Ähnlich Gilsenan, Lying, 200. 54 Der Vorwurf der Hybris zieht sich durch die gesamte demosthenische Rede, komprimiert im Vergleich des Meidias mit Alkibiades, Demosth. 21, 143-150. Vgl. Cohen, Honour, 93-97; G.O. Rowe, The Many Facets of Hybris in Demosthenes’ Against Meidias, in: AJPh 114 (1993), 397-401, passim; Ober, Power, 89-99. 55 Demosth. 21, 26. 31. 34. 35.
216
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
SEN TÕ SîμA, TÍ FULÍ DÒ KRATOÚSV TÕN ¢GîN' A„TIèTATOJ TOà μ¾ NIKÁSAI KATšSTH.56 Einerseits kann er so Meidias zum Feind ganz Athens stilisieren, andererseits weist er damit die normative Verpflichtung der Rache als Reaktion auf eine so eklatante Ehrverletzung zurück: ¢LL¦ μ¾N PRÒJ GE TÕ TOIOàTON, ÓTI ›$HμOSQšNHJ‹ FHSˆN ›ÛBRISTAI‹, D…KAIOJ KAˆ KOINÕJ KAˆ ØPÒR ¡P£NTWN œSQ' Ð LÒGOJ. OÙ G¦R E„J $HμOSQšNHN ÔNTA μE ºSšLGAINE μÒNON TAÚTHN T¾N ¹μšRAN, ¢LL¦ KAˆ E„J CORHGÕN ØμšTERON:57 Demosthenes erklärt sein Vorgehen gegen Meidias, das in einem Prozess gegen ihn besteht und sich strikt im Rahmen des politischen Systems hält. Seine Legitimation wird ihm erleichtert durch das athenische Gerichtswesen, das entscheidend auf dem sozialen öffentlichen Konsens der athenischen Bürger beruht und selbst als ein Agon aufgefasst werden kann.58 Es bietet das ideale Forum für seine Selbstdarstellung als guter Bürger und als Ehrenmann. Auch vor besagtem Prozess legt Demosthenes ein forciert agonales Verhalten an den Tag. Soweit es nicht um ernsthafte persönliche Konflikte geht, beschränkt er sich wohlweislich auf jene Felder, die die Polis für den zivilisierten Wettstreit kultiviert hat: das Prozessieren vor Gericht59 und die Liturgien. Auf letztere einzugehen, bietet ihm seine Rede die optimale Gelegenheit. Nachdem er die Anzahl der geleisteten Liturgien relativ zum Lebensalter gesetzt und dabei im Vergleich zu Meidias besser abgeschnitten hat,60 konzentriert er sich auf den allgemein skandalösen Umgang des Meidias mit seinem Reichtum. Zwar besitze Meidias ein großes Vermögen, dies veranlasse ihn jedoch nicht, es zum Nutzen der Gemeinschaft und zu seiner eigenen Ehre einzusetzen, sondern lediglich, sich dessen unangebracht laut 56 Ebd. 18. Vgl. F. Blass, Die attische Beredsamkeit, III, 1, Hildesheim/New York 19793, 332: »Die Schilderung ist immer lebendig und kraftvoll, wird aber kürzer und kürzer, bis schliesslich die Misshandlung selbst in einem Satzgliede angegeben wird ... es ist eine Feinheit, dass Demosthenes eine Scene, bei der er selbst nicht vortheilhaft erscheinen konnte, auszumalen unterlässt«. 57 Demosth. 21, 31: »Behauptet er dann weiter, es sei doch nur Demosthenes der Beleidigte, so habe ich darauf von Rechtswegen und im Interesse aller folgendes zu erwidern. Nicht blos den Demosthenes verhöhnte er in mir an jenem Tage, sondern auch euren Choregen zugleich«. 58 Die Übertragung des Agons in die gerichtliche Sphäre ist eines der Hauptargumente Cohens für das Weiterleben ehrenhafter Verhaltensweisen im vierten Jahrhundert, vgl. Cohen, Law, dessen fünftes Kapitel den programmatischen Titel »Litigation as feud« trägt, 87-118. Den Grundgedanken der Ähnlichkeit bzw. Evolution von spielerischem Wettkampf und Gerichtsprozess vertritt auch Huizinga, Homo, 81. Mit Blick auf die alten Griechen sieht er, »wie die Idee des Gewinnens oder Verlierens, d. h. der rein agonale Gedanke – die Idee von Recht und Unrecht, also den ethisch-juridischen Gedanken, gewissermaßen überschattet. Das Element der Aussicht auf Gewinnen und damit unmittelbar auch das Spielelement treten immer mehr in den Vordergrund, je mehr wir uns in ein primitives Rechtsbewusstsein versetzen.« 59 Demosthenes beginnt sein Leben als mündiger Bürger mit den Verfahren gegen seine Vormünder, Demosth. 21, 78, und streitet seitdem kontinuierlich vor Gericht. 60 Demosth. 21, 154-157.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
217
zu brüsten61 und seinen Luxus aufdringlich zur Schau zu stellen. 4…J OâN ™STIN ¹ LAμPRÒTHJ, À T…NEJ Aƒ LEITOURG…AI KAˆ T¦ SEμN¦ ¢NALèμATA TOÚTOU; ™Gë μÒN G¦R OÙC ÐRî, PL¾N E„ TAàT£ TIJ QEWRE‹: O„K…AN òKODÒμHKEN '%LEUS‹NI TOSAÚTHN éSTE P©SIN ™PISKOTE‹N TO‹J ™N Tù TÒPJ, KAˆ E„J μUST»RIA T¾N GUNA‹K' ¥GEI, K¨N ¥LLOSš POI BOÚLHTAI, ™Pˆ TOà LEUKOà ZEÚGOUJ TOà ™K 3IKUîNOJ, KAˆ TRE‹J ¢KOLOÚQOUJ À TšTTARAJ AÙTÕJ œCWN DI¦ TÁJ ¢GOR©J SOBE‹, KUμB…A KAˆ UT¦ KAˆ FI£LAJ ÑNOμ£ZWN OÛTWJ éSTE TOÝJ PARIÒNTAJ ¢KOÚEIN.62 Dieser Exhibitionismus ist Teil des Habitus des Meidias, mit dessen Ausmalung Demosthenes noch einmal das Leitmotiv der Hybris anklingen lässt.63 Als Ehrenmann ist auch Demosthenes nicht frei von der Neigung zur Selbstdarstellung, aber er beschränkt sich auf die aristokratische Prachtentfaltung bei der Übernahme von Liturgien. Sein soziales Wissen um den rechten Geist des Agons teilt er seinen Zuhörern über die Negativskizze des Meidias mit: Ein Ehrenmann zögert nicht, in den Wettstreit mit anderen einzutreten, er kämpft bzw. er spielt nach bestimmten Regeln, und vor allem will er den Sieg erringen,64 was nichts anderes heißt als das überlieferte A„ÒN ¢RISTEÚEIN KAˆ ØPE…ROCON œμμENAI ¥LLWN.65 Unehrenhaft ist, was Meidias tut: zu vermeiden sich im Agon, hier dem Wettbewerb der
61 Ebd. 153. 62 Ebd. 158.: »Wie also steht’s mit seiner Liberalität und wo bleiben die Leistungen und der großartige Aufwand dieses Menschen? Ich wenigstens finde nichts der Art, man müßte denn dafür etwa gelten lassen, dass er zu Eleusis ein kolossales Haus gebaut, das allen Leuten am Orte das Licht benimmt, und dass er seine Ehehälfte zu den Mysterien, oder wohin sie sonst Lust hat, mit seinem Schimmelgespann aus Sikyon kutschirt, und dass er auf dem Markte nicht anders einherzieht als mit drei, vier Dienern hinter sich, zu denen er von seinen Humpen und Trinkhörnern und anderen Kostbarkeiten so laut spricht, dass die Vorübergehenden es hören müssen.« 63 Ebd. 159: ™Gë D', ÓSA μÒN TÁJ „D…AJ TRUFÁJ ›NEKA -EID…AJ KAˆ PERIOUS…AJ KT©TAI, OÙK OÍD' Ó TI TOÝJ POLLOÝJ ØμîN çFELE‹: § D' ™PAIRÒμENOJ TOÚTOIJ ØBR…ZEI, ™Pˆ POLLOÝJ KAˆ TOÝJ TUCÒNTAJ ¹μîN ¢FIKNOÚμENA ÐRî. »Ich weiß nun nicht, was euch, dem Volke, Dinge nützen sollen, die Meidias nur zu seinem Privatvergnügen und Zeitvertreib besitzt. Das aber seh’ ich nur zu gut, dass das beleidigende Benehmen, zu dem er sich dadurch verleiten lässt, gar manchen, ja jedweden von uns, der ihm in den Wurf kommt, trifft.« Vgl. N. Fisher, ›Let envy be absent‹: Envy, Liturgies and Reciprocity in Athens, in: D. Konstan und N.K. Rutter (Hg.), Envy, Spite and Jealousy. The Rivalrous Emotions in Ancient Greece, Edinburgh 2003, 181-215, 202: »The idea is then that the jury should rightly feel phthonos at Meidias for his deceptions, as they undoubtedly and legitimately felt phthonos at his lifestyle; what makes the people’s phthonos wholly legitimate in this case is his open contempt fort he people, his luxurious display, and the ways he used his wealth to oppress them and to avoid both punishment and the performance of liturgies.« 64 Gerade der Verlust des Sieges seiner Phyle ist für Demosthenes besonders schmerzlich, Demosth. 21, 5. 65 Hom. Il. 6, 208; 11, 784: »Immer Bester zu sein und überlegen zu sein den anderen«.
218
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Choregen, zu messen, ihn von außen zu sabotieren und die Preisrichter zu korrumpieren.66 Die Übernahme von Liturgien durch reiche Bürger verweist auf ein weiteres charakteristisches Merkmal, das den Status eines Ehrenmannes prägt: die Gleichzeitigkeit von Gleichheit und Ungleichheit. In Athen durchzieht diese Dissonanz das gesamte soziale Leben. Durch seine Choregie zeigt sich Demosthenes einerseits dem demokratischen Gemeinwesen verpflichtet und in dieses integriert, andererseits verleiht sie ihm ein Maß an Ehre, das ihn weit aus der Bürgerschaft heraushebt und jeden Gedanken an die demokratische Gleichheit der Bürger ad absurdum führt. Der Balanceakt zwischen politischer Gleichheit und sozialer Ungleichheit gelingt Demosthenes nach eigenem Bekunden, wohingegen Meidias das Gleichgewicht zwischen beiden nicht halten kann. Das bekunden nicht nur die öffentliche Prunkerei auf der Agora, sondern auch die Ereignisse im Theater. Meidias erkennt nicht, dass er sich in einer Szenerie befindet, die politisch-demokratisch ist und die Gleichheit aller Bürger zum Ausdruck bringt. Demosthenes spielt hier zwar eine Sonderrolle, diese ist aber räumlich und zeitlich begrenzt und zeremoniell eingebunden, so dass seine Person die grundsätzliche Gleichheit aller nicht aufhebt. Der soziale Kontext eines religiösen Festes der Polis, an dem sich die Gemeinschaft und Gleichheit aller Bürger präsentiert und zur Identifizierung einlädt, wirkt sehr homogen. Der Vergeltungsschlag des Meidias gegen seinen persönlichen Feind konfrontiert die Anwesenden unvermittelt mit den in dieser Situation deplazierten Elementen der Statusungleichheit an Ehre.67 Der beständige Kampf um Ehre und die Rache ist zudem ein besonderes Merkmal der Oberschicht Athens. Demosthenes paraphrasiert das Geschehen noch einmal im Hinblick auf die misslungene Integration des Meidias als besonders vermögendem Bürger in die Polisgemeinschaft: -EID…AN DÒ „DIèTHN ÔNTA, μHDÒN ¢NHLWKÒTA, ÓTI TJ PROSšKROUSEN KAˆ ™CQRÕJ ØPÁRCEN, TOàTON ¢NAL…SKONTA, CORHGOàNTA, ™P…TIμON ÔNTA PROPHLAK…ZEIN KAˆ TÚPTEIN, KAˆ μ»TE TÁJ ˜ORTÁJ μ»TE TîN NÒμWN μ»TE T… ØμEIJ ™RE‹TE μ»TE TOà QEOà FRONT…ZEIN;68 Die in dieser 66 Demosth. 21, 5; 17-18; 68. 67 Die Deplatziertheit dieser Situation wie der Person des Meidias allgemein, die Demosthenes seinen Zuhörern vermitteln will, drückt er mit Worten wie Hybris, Hyperbole, usw. aus. Vgl. MacDowell, Demosthenes, 239, der »Hyperbole« erklärt als: »literally ›going beyond‹, a favourite word of D.’s in passeges of moral condemnation. Sometimes it is not immediately clear what goes beyond what.« 68 Demosth. 21, 61: »Dagegen aber Meidias, der doch weder selbst am Feste betheiligt ist, noch etwas dazu gibt, so weit geht einen Ehrenmann, der bei der Choregie sein gutes Geld zusetzt, blos deshalb, weil er mit ihm in schlechtem Vernehmen und auf gespanntem Fuße steht, zu misshandeln und zu schlagen, und weder um das Fest, noch um die Gesetze, noch um das sich kümmert, was ihr dazu sagen werdet und was er der Gottheit schuldig ist?«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
219
Beschreibung versammelten Distinktionsmerkmale, die Meidias auszeichnen, werden von ihm nicht entschärft, indem er sie in den politischen Verband einbindet oder auf ihn Rücksicht nimmt.69 Im Theater – wie vermutlich auch sonst – trennt Meidias nicht zwischen dem präsenten Choregen Demosthenes und seinem als solchen nicht anwesenden Intimfeind Demosthenes.70 Er verkennt die Situation, in der er dem Demos lassen muss, was des Demos ist, und demonstriert damit einen Mangel an sozialem Wissen, das für die fragile Balance zwischen den Ansprüchen der Polis und jenen der Ehre so entscheidend ist. Nach Demosthenes rechtfertigt sich so der Vorwurf der Hybris: Meidias ist sozial nicht integrierbar, er ist aus der Bürgerschaft hinausdefiniert worden. Nur im Hinblick auf den Vorwurf der Hybris, welcher allerdings schwer wiegt, wird Meidias in die Rolle des nicht Satisfaktionsfähigen gedrängt. Sein Zuviel an Ehranspruch macht ihn allen anderen ungleich, deshalb kann er mit niemandem mehr wettstreiten um die Ehre. Bezogen auf die ideelle Gleichheit aller athenischen Polisbürger verliert er seinen Status in der Bürgergemeinschaft.71 Ganz anders Demosthenes. Er erweist sich als ein Mann von Ehre in einem von Ehre geprägten Umfeld. Neben den beschriebenen Grundzügen ehrenhaften Verhaltens, die Demosthenes an den Tag legt, gehören zu den konstituierenden Merkmalen einer ehrenhaften Gesellschaft außerdem die Bedeutung von Klatsch und Gerede in einem relativ kleinen Gemeinwesen,72 die Vorstellung eines Nullsummenspiels mit dem Gegenüber73 oder die Ausdehnung des Konfliktes auf Freunde, Verwandte und Nachkommen,74 die in der demosthenischen Rede ebenfalls erwähnt werden. Der einzige große Bereich, in dem Demosthenes überhaupt nicht ehrenhaft 69 Vgl. J. Roisman, The Rhetoric of Courage in the Athenian Orators, in: R.M. Rosen und I. Sluiter (Hg.), Andreia. Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity, Leiden 2003, 127-143, 139: »Unlike Demosthenes’ commendable manhood, Meidias ist he incarnation of aberrant masculinity. He is excessively aggressive, out of control, haughty, self-indulgent, cruel, disrespectful of laws and custom, a fifty-year-old man who behaves like a hot-headed youth.« 70 Den beiden Rollen, die Demosthenes einnehmen kann, entspricht die Unterscheidung in eine öffentliche und eine private Klage, ebd. 33-34. 71 Demosth. 21, 150 betitelt Meidias sogar als »Barbaren«. Vgl. Bourdieu, Entwurf, 11-13, dessen Auftakt die Beschreibung eines solchen Parias bildet. 72 Meidias verleumdet, indem er auf der Agora flaniert und plaudernd Andeutungen fallen lässt, Demosth. 21, 104: KAT¦ T¾N ¢GOR¦N PERIIëN ¢SEBE‹J KAˆ DEINOÝJ LÒGOUJ ™TÒLμA PERˆ ™μOà LšGEIN, æJ ™Gë TÕ PR©Gμ' E„μˆ TOàTO DEDRAKèJ: »Da strich er anfänglich auf dem Markt umher und versuchte unter gotteslästerlichen Reden mich für den Thäter auszugeben«. 73 Ebd. 100: OÙDEˆJ G£R ™STIN D…KAIOJ TUGC£NEIN ™LšOU TîN μHDšNA ™LEOÚNTWN, OÙDÒ SUGGNèμHJ TîN ¢SUGGNWμÒNWN. »Denn niemand hat Anspruch auf Erbarmen oder Nachsicht, der selbst mit andern kein Erbarmen und keine Nachsicht hat.« Vgl. ebd. 185. 204. 217. 74 Demosth. 21, 78: Meidias nimmt den Platz des ursprünglichen Feindes Thrasylochos ein. Vgl. MacDowell, Demosthenes, 3.
220
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
handelt und sich klar an den Normen der Polis orientiert, ist seine Konfliktführung. Er kämpft gegen Meidias nur mit den Waffen der Gerichtsbarkeit und lässt sich durch keine Provokation davon abbringen. Gemessen an anderen Kriterien für ehrenhaftes Verhalten kann man ihm allerdings ein Ehrgefühl nicht absprechen. In den meisten ehrenhaften Gesellschaften erweisen sich die auf ehrenhafte Art ausgetragenen Konflikte als dysfunktional für die Gemeinschaft. So auch in Athen: Das Verhalten des Meidias stört den Ablauf einer offiziellen kultisch verankerten Veranstaltung der Polis und gefährdet die Sicherheit einzelner Bürger vor hybriden Übergriffen. Demosthenes konzentriert sich in seiner Rede auf diese Punkte, um das Verhalten des Meidias zu desavouieren. In der dem Prozess vorangegangenen ehrenhaften Auseinandersetzung hatte Meidias den Sieg davongetragen, nach Demosthenes Interpretation aber nicht die Ehre. Nach demosthenischen Maßstäben besteht ein ehrenhaftes Verhalten vielmehr in der Einbindung der habituellen Formen in den Rahmen der Polis: hier streitet der Athener von Ehre im agonalen Wettbewerb, hier präsentiert er sein Vermögen, indem er Liturgien übernimmt, und hier setzt er sich vor einem der Gerichte mit seinen Gegnern auseinander. Auch Meidias sind die habituellen Formen der Ehre nicht fremd, ihm fehlt aber das entscheidende soziale Wissen um die notwendige Berücksichtigung der Normen der Polis zumindest an jenem Punkt, an dem die Ehre andere Handlungsoptionen favorisiert als die Polis. Demosthenes hingegen ist zugleich ein Mann von Ehre und ein guter Polisbürger, wobei letzteres sich eben darin erweist, dass er seinem Ehrstreben Grenzen setzt. Die demosthenische Rede Gegen Konon spiegelt eine ähnliche Verflechtung der verschiedenen normativen Ansprüche an den einzelnen Bürger. In ihr geht es um die Klage des Ariston auf körperliche Misshandlung durch Konon (KAT¦ +ÒNWNOJ A„KE…AJ). Ariston widmet sich ausführlich den vorangegangenen Streitigkeiten mit Konon bzw. dessen Söhnen, bevor er den eigentlichen Klagegrund erläutert: Den Höhepunkt der Auseinandersetzungen bildet der tätliche Angriff des Konon auf Ariston, der bei dieser Prügelei fast zu Tode kommt. Ariston legt viel Wert auf die Aussage, dass Konon ihre Feindschaft fortwährend aggressiv vorangetrieben hat, während er eigentlich nur seinen Frieden suchte. Schon ihre erste Begegnung zeigt das unterschiedliche Konfliktverhalten beider Parteien. Die Geschichte beginnt zwei Jahre zuvor, als sich Ariston und die Söhne des Konon zur Ableistung ihres Militärdienstes in einem Lager in Panakton befinden, wo sie benachbarte Zeltplätze zugewiesen bekommen und die Feindseligkeiten ihren Anfang nehmen können (™X ¢RCÁJ œCQRA).75 Konons Söhne waren laut Ariston schon am hellichten Tag betrunken, rabau75 Demosth. 54, 3. Die gesamte Szenerie in Panakton umfasst die Paragraphen 3-5.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
221
kenhaft übermütig und in gleichgesinnter Gesellschaft. Einmal fühlten sie sich durch den Rauch ihrer Nachbarn bei der Essenszubereitung gestört, so dass sie begannen, Aristons Sklaven zu belästigen, indem sie sie beschimpften, schlugen und ihre Nachttöpfe über sie leerten. Aristons Reaktion auf diese Schmähungen war ein verbaler formeller Protest gegen dieses Verhalten. Erst als das nichts nützte, und sie ihre unflätigen Reden nun gegen Ariston selbst richteten, wandte er sich hilfesuchend an die zuständige Autorität in Gestalt des Strategen, der umgehend bei ihren Zelten erschien und die Ruhestörer zur Ordnung rief. In der folgenden Nacht drangen Konons Söhne in Aristons Zelt ein und fingen an, ihn zu beschimpfen und zu verprügeln. Der Tumult, den sie dabei veranstalteten, rief wiederum den Strategen und einige andere auf den Plan, die die Ruhe wiederherstellten. Nach Aristons Aussage geschah das, bevor er sich entschieden hatte, ob er sich tätlich zur Wehr setzen wollte oder nicht. Nach Athen zurückgekehrt empfindet Ariston zwar Zorn (ÑRG¾) und Haß (œCQRA) für seine Feinde, kommt aber zu dem Schluss, dass es am besten sei, ihnen in Zukunft einfach aus dem Weg zu gehen.76 Eines Abends allerdings, als er mit seinem Freund Phanostratos auf der Agora spazierengeht, trifft er zufällig Ktesias, einen der Söhne des Konon. Das ist das Setting für die Klimax: die zentrale Auseinandersetzung, die zur Schlägerei ausartet und die den Anlass für Aristons Klage darstellt. Ariston beschreibt die sich überstürzenden Ereignisse wie folgt:77 Ktesias stößt einen Schrei aus, als er in dem Passanten Ariston erkennt und eilt von dannen. Wenig später kommt er mit Verstärkung zurück. Er hat seinen Vater und dessen Freunde, die in einem nahegelegenen Haus zusammengesessen haben, mitgenommen auf die Agora, wo sich noch immer Ariston und Phanostratos befinden. Konon, Ktesias und ihre Freunde gehen auf Ariston los. Einer von ihnen hält Phanostratos fest, die anderen werfen sich auf Ariston, ziehen ihn aus, verprügeln ihn und werfen ihn zu Boden in den Dreck. Als Ariston dort bewegungsunfähig und blutend liegt, erreicht die Schmähung ihren Höhepunkt: Einer der Peiniger des Ariston imitiert einen Hahn, der beim Kampf den Sieg davongetragen hat, indem er kräht und mit den Armen schlägt als seien es Flügel.78 Zweifellos handelt es sich bei der Dramaturgie des Überfalls und insbesondere bei der Spottszene, die ihn krönt, um eine eklatante Verletzung der Ehre des Ariston. Seine Gegner vollenden mit der Imitation des siegreichen Hahnes seine Demütigung, die von Ariston als so entehrend empfunden 76 Ebd. 6. 77 Ebd. 7-9. 78 Ebd. 9.
222
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
wird, wie sie gemeint war: KE…μENOJ D' AÙTîN ½KOUON POLL¦ KAˆ DEIN¦ LEGÒNTWN. KAˆ T¦ μÒN ¥LLA KAˆ BLASFHμ…AN œCEI TIN¦ KAˆ ÑNOμ£ZEIN ÑKN»SAIμ' ¨N ™N Øμ‹N œNIA, Ö DÒ TÁJ ÛBREèJ ™STI TÁJ TOÚTOU SHμE‹ON KAˆ TEKμ»RION TOà P©N TÕ PR©Gμ' ØPÕ TOÚTOU GEGENÁSQAI, TOàQ' Øμ‹N ™Rî: ÏDE G¦R TOÝJ ¢LEKTRUÒNAJ μIμOÚμENOJ TOÝJ NENIKHKÒTAJ, Oƒ DÒ KROTE‹N TO‹J ¢GKîSIN AÙTÕN ºX…OUN ¢NTˆ PTERÚGWN T¦J PLEUR£J.79 Nachdem Ariston von Passanten nach Hause getragen, ärztlich versorgt und schließlich trotz der Schwere der Verletzungen genesen ist, besteht seine Reaktion auf den Überfall darin, eine Klage gegen Konon einzureichen. Aristons Verhalten – so wie er selbst es darstellt – folgt konsequent dem Musterbeispiel eines gesetzestreuen Polisbürgers.80 Keines der verschiedenen Stadien der Auseinandersetzung verläuft bei ihm gemäß den Kriterien ehrenhaften Verhaltens. Während Konon und seine Söhne durchaus agonal agieren, bremst Ariston sie durch eine defensive, deeskalierende Konfliktstrategie immer wieder aus. Anstatt sich auf einen ehrenhaften Schlagabtausch einzulassen, ignoriert Ariston seine Angreifer, zieht von dritter Seite Schlichter hinzu und vermeidet ein offensives Verhalten. Nach Aussage des Redners mögen sich ehrenhafte Handlungen bei einigen Athenern noch eines hohen Ansehens erfreuen, er selbst aber hält nichts davon, sondern es für klüger, sich an die Polis als normativen Bezugspunkt zu halten. Auch Ariston spricht also von zwei unterschiedlichen, in sich relativ konsistenten Verhaltensmustern, die nebeneinander bestehen. Er selbst bevorzugt überlegt, nach Abwägen der Alternativen, die Orientierung seines Verhaltens an der Norm des pflichtbewussten, ruhigen Polisbürgers. Ehrenhafte Verhaltensweisen sind ihm nicht fremd, sie werden vom ihm allerdings als der Situation unangemessen disqualifiziert. Obwohl die gute Kenntnis der Gesetzeslage einen Prozessierenden in den Augen der Geschworenen eher suspekt macht,81 hält auch Ariston es für wichtig, den Sinn der athenischen Gesetze zu erklären. Die Gesetze sind 79 Ebd. 8-9: »Wie ich so dalag, hörte ich sie noch viel greuliche Reden führen, die ich nicht wiederholen will. Waren sie doch mitunter so ganz lästerlich, dass ich mich schäme sie auch nur in den Mund zu nehmen. Nur eins mag ich euch nicht verschweigen, da’s seinen Übermuth kennzeichnet und den Anstifter der ganzen Geschichte in ihm erkennen lässt. Er krähte nämlich wie ein Kampfhahn, der seinen Gegner bezwungen hat, und die Andern hießen ihn auch noch anstatt der Flügel mit den Ellenbogen sich die Seiten schlagen.« Übersetzung: A. Westermann. 80 Nicht einmal Cohen, Law, 121-130, kann in Aristons Verhalten ehrenhaften Rachedurst entdecken. Herman, Honour, 45, betont »the extraordinarily non-violent nature of this reaction or, more specifically, the glaring disproportion between the gravity of the insult and the mildness of the response.« 81 Ariston betont, dass er sich erst habe kundig machen müssen, Demosth. 54, 17. Vgl. Demosthenes, Selected Private Speeches, hg., übers. u. komm. v. C. Carey und R.A. Reid, Cambridge 1985, 89: »Obvious experience in speaking and familiarity with the law were viewed with suspicion, as suggesting a litigious nature.«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
223
gemacht, um die Eskalation eines Konfliktes bis hin zum Mord zu verhindern. Wie das funktioniert, erläutert er folgendermaßen: OŒON ... E„Sˆ KAKHGOR…AJ D…KAI: FASˆ TO…NUN TAÚTAJ DI¦ TOàTO G…GNESQAI, †NA μ¾ LOIDOROÚμENOI TÚPTEIN ¢LL»LOUJ PRO£GWNTAI. P£LIN A„KE…AJ E„S…: KAˆ TAÚTAJ ¢KOÚW DI¦ TOàT' EÍNAI T¦J D…KAJ, †NA μHDE…J, ÓTAN ¼TTWN Ï, L…QJ μHDÒ TîN TOIOÚTWN ¢μÚNHTAI μHDEN…, ¢LL¦ T¾N ™K TOà NÒμOU D…KHN ¢NAμšNV. TRAÚμATOJ P£LIN E„SˆN GRAFAˆ TOà μ¾ TITRWSKOμšNWN TINîN FÒNOUJ G…GNESQAI. TÕ FAULÒTATON, OÍμAI, TÕ TÁJ LOIDOR…AJ, PRÕ TOà TELEUTA…OU KAˆ DEINOT£TOU PROEèRATAI, TOà μ¾ FÒNON G…GNESQAI, μHDÒ KAT¦ μIKRÕN ØP£GESQAI ™K μÒN LOIDOR…AJ E„J PLHG£J, ™K DÒ PLHGîN E„J TRAÚμATA, ™K DÒ TRAUμ£TWN E„J Q£NATON, ¢LL' ™N TO‹J NÒμOIJ EÍNAI TOÚTWN ˜K£STOU T¾N D…KHN, μ¾ TÍ TOà PROSTUCÒNTOJ ÑRGÍ μHDÒ BOUL»SEI TAàTA KR…NESQAI.82 Ariston benennt an dieser Stelle die verschiedenen Stadien der Eskalation, die mit zunehmender Heftigkeit aufeinander folgen. Nach seiner Darstellung handelt es sich dabei um einen gewöhnlichen Stil der Konfliktführung, wie er allen Anwesenden vertraut ist. Es beginnt mit einer rein verbalen Auseinandersetzung, die zur tätlichen übergeht, sie steigert sich zu einem bewaffneten Kampf und endet schließlich mit einem Mord. Ariston skizziert mit diesem Ablauf der Auseinandersetzungen genau jenes ehrenhafte Verhalten, das dem Gegner nichts schuldig bleibt, auf jeden Angriff mit sich steigernder Aggression antwortet und den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nur innerhalb gewisser Grenzen selbst steuern kann. Denn hat sich eine solche Dynamik erst einmal entwickelt und folgen beide Gegner den Normen der Ehre, so kann eine Kettenreaktion entstehen, die mit einer Folgerichtigkeit abläuft, die kaum mehr zu stoppen ist.83 Die Ausstiegsmöglichkeit aus einer solchen ungewollten Dramatisierung der Situation bieten die Gesetze. Sie erlauben es, an jeder einzelnen Station den Schlagabtausch zu unterbrechen und ihn auf die gerichtliche Ebene zu verlagern. Die juristische Klärung oder Beendigung eines Streitfalls eröffnet so 82 Demosth. 54, 17-19: »So giebts zum Beispiel Klagen wegen Schmähungen, und diese sind, wie ich mir sagen lasse, deswegen angeordnet, damit nicht einer im Zorne sich verleiten lasse auf den, der ihn geschimpft hat, loszuschlagen. Dann wieder giebts Klagen wegen Schlägereien; auch diese sind, wie ich höre, deshalb eingeführt, damit nicht der Unterliegende mit einem Steine oder sonst einer derartigen Waffe sich zur Wehre setze, sondern die gesetzliche Genugthuung erwarte. Und ebenso giebts Klagen wegen blutiger Verletzungen, damit nicht von dem Verletzten ein Mord begangen werde. Die Absicht des Gesetzgebers ist’s offenbar gewesen, durch das Verfahren gegen das leichteste Vergehen, das Schimpfen, dem äußersten und schwersten, dem Morde, vorzubeugen und zu bewirken, dass nicht allmählich vom Schimpfen zum Schlagen und von Schlägen zu blutigen Verletzungen und von da zum Todtschlag fortgeschritten, sondern ein jedes dieser Vergehen nach dem Gesetze gerichtet werde und nicht nach Laune und Willkühr des Betroffenen.« 83 Vgl. Schneider und Schneider, Culture, 88, und Pitt-Rivers, Status, 29: »The ultimate vindication of honour lies in physical violence and when other means fail the obligation exists ... to revert to it.«
224
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
eine alternative Möglichkeit des Verhaltens zum ehrenhaften Vergeltungsdenken. Wieder stellt der Redner zwei unterschiedliche Handlungsmuster in Kontrast zueinander und wägt ab.84 Die Begründung, die Ariston für das Bestehen und die Akzeptanz von Gesetzen anführt, verweist auf ihre offensichtliche gesellschaftliche Funktion: Gesetze sollen die bedrohlichsten Situationen vermeiden helfen, die im Zusammenhang mit Konflikten auftreten können, sowie ihre schädlichste Lösung, den Mord. Das geschieht durch die Übergabe des Rechtes (und der Pflicht) der Vergeltung an überpersönliche Institutionen.85 Zugleich betont Ariston die Schwere der Vergehen gegen ihn und die Unmöglichkeit, auf das Geschehen pazifizierend Einfluss zu nehmen, indem er die Beschimpfungen, die er Jahre zuvor in Panakton erdulden musste, als Auftakt und Ankündigung der späteren Gewalt deutet. Ebenso wie Demosthenes bezieht sich auch Ariston auf zwei verschiedene Kontexte, innerhalb derer er sein eigenes und seines Gegners Verhalten deutet. Auch er schreibt Konon den Part des Ehrenmannes zu, der die Ehre eines anderen attackiert und dabei die Regeln der Polisgemeinschaft missachtet. Die Selbstdarstellung des Ariston sucht ein Gegenbild dazu zu schaffen und entwirft den Typus eines Mannes, der das tut, was der Polis dient und sich ansonsten auf keinerlei Händel einlässt. Obwohl Demosthenes als der Schreiber der Rede für Ariston sein Bestes tut, um den Geschworenen ein relativ konsistentes Bild seines Klienten zu vermitteln, ist seine elaborierte Darstellung doch auf Skepsis gestoßen. Bei der versuchten Rekonstruktion der Ereignisse wie Ariston sie beschreibt, melden moderne Historiker und Philologen ernsthafte Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit an.86 Besonders die in der Rede vehement dementierte Verbindung zu Hetairien lässt den Verdacht aufkommen, hier solle eine allseits bekannte Tatsa-
84 Herman, Society, spricht in diesem Zusammenhang von einem »classic example of double standards – coexisting codes competing with each other«, 109. Er argumentiert im Weiteren, dass es keine Quellen für ehrenhaftes Verhalten (pattern A) gebe, alle Belege dagegen für zivilisiertes Verhalten (pattern B) sprächen: »There are obvious dangers in drawing inferences from the silence of the sources, but the starting point of any discussion must be the fact that, whereas pattern B is amply documented, there is no evidence whatsoever for pattern A«. Dagegen ist zu sagen, dass erstens die Beschreibung von ehrenhaftem Verhaltens an sich schon ein Beleg für die Verbreitung des sozialen Wissens darum ist und zweitens dass es in diesem Fall zumindest eine von zwei Personen gibt, die sich exakt an ›pattern A‹ hält. 85 Vgl. Carey und Reid, Demosthenes, 90. 86 S. Feraboli, In margine à Demostene LIV, in: Studi in onore di Arnaldo Biscardi IV, Mailand 1983, 655-661, 660f., und E. Mensching, Zu Demosthenes’ 54. Rede, in: RhM 106 (1963), 307-312, 311, versuchen, eine systematische Übersicht des wechselseitigen Verhaltens beider Parteien zu erstellen, können aber nur mit der anzunehmenden Wahrscheinlichkeit argumentieren.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
225
che geleugnet werden.87 Ariston verwendet viele Worte darauf, sich gegen diese Einordnung zu verwehren, denn er befürchet, seine Klage könne als unangemessen und die Tat des Konon bzw. seiner Söhne als ausgeartete Rauferei unter Saufkumpanen betrachtet werden.88 Denn gerade das Milieu, in dem junge, reiche Männer sich zu imponieren suchen, ihre Rivalitäten untereinander und um Frauen austragen und des abends betrunken um die Häuser ziehen, ist in Athen sehr von Ehre geprägt. Der von Konon imitierte Hahn passt zu diesem Bild jugendlichen Übermuts und Kräftemessens und interpretiert die Verletzung des Ariston unzweideutig als gezielten Generalangriff auf seine Ehre.89 Ariston scheut sich nicht, dem Gericht das für ihn demütigende Vergehen des Konon lebhaft auszumalen; das Eingeständnis seiner Entehrung zeigt, dass er ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Denn Ariston gehört zur Oberschicht,90 bewegt sich wahrscheinlich im Umfeld von Hetairien, die viel Wert auf männliche Ehre legen, und ist selbst keineswegs so unschuldig, wie er es in seiner Rede darstellt, die denn auch massive Ungereimtheiten enthält. Der Gang der Ereignisse lässt sich ohne größere Schwierigkeiten so deuten, dass Ariston sich provokativ verhalten, den Streit gesucht und vielleicht sogar die Prügelei mit Konon begonnen hat.91 Ariston ist ebenfalls beschreibbar als ein Mann von Ehre, der sich eine ähnliche Strategie zu Eigen macht wie Demosthenes in seinem Streit mit Meidias: Nachdem er draußen in der Arena im Agon um die Ehre eindeutig unterlegen war, wechselt er den sozialen Ort und Bezugsrahmen und lässt die Athener im Gericht ein Urteil über die Qualität seines Verhaltens fällen.
87 Vgl. Carey und Reid, Demosthenes, 89; für M.P. Morford, Ethopoiia and CharacterAssassination in the Conon of Demosthenes, in: Mnemosyne 19 (1966), 241-248, 242-244, steht die Mitgliedschaft des Ariston in einer Hetairie fest. 88 Demosth. 54, 13-14; vgl. Cohen, Law, 126. 89 »Derjenige, der gegen die Norm verstieß, konnte in einer Gesellschaft, deren Verhaltenskodex sich auf Scham und Ehre gründete, lächerlich gemacht und ausgegrenzt werden. Denn das öffentliche Lachen über Normenabweichungen impliziert gleichzeitig eine Normenbestätigung.«, so Stark, Muse, 104f. Vgl. Carey und Reid, Demosthenes, 84; E. Csapo, Deep Ambivalence: Notes on a Greek Cockfight, in: Phoenix 47 (1993), 1-27, 115-124, 20. S. Halliwell, The Uses of Laughter in Greek Culture, in: CQ 41 (1991), 279-296, 287f. wertet den Spott Konons als Ausdruck von Hybris: »The accepted potency of laughter as a medium in which enmities may be publicly declared or pursued creates an emphatic Greek recognition of its dangers to the social fabric of the polis. ... Here, from an encounter in the night streets of Athens some time around 340 B.C., is a picture of the laughter of triumphant hostility which brings startlingly to life all those stock remarks, to which I have recently referred, about the fear of derision from one’s enemies: and it is a picture whose features are tellingly drawn by Demosthenes, whatever the reliability of its factual basis may have been.« 90 Demosth. 54, 44: Ariston leistet Liturgien. 91 Zu den offenen Fragen vgl. nur Morford, Ethopoiia, passim, der Ariston kein einziges Wort glaubt.
226
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Seine strikte Abwehr gegen das soziale Milieu, dem Konon angehört und in dem Ehre viel gilt, lässt auf die Grundproblematik seiner Rede schließen: Einerseits muss Ariston das Verhalten des Konon als hybrid klassifizieren, obwohl das nicht seine Klageform ist.92 Argumentativ setzt er ganz auf die suggestive Wirkung, die der Vorwurf der Hybris hervorruft.93 Auf der anderen Seite muss Ariston sich verwahren gegen den Vorwurf des Konon, er verhalte sich ebenfalls nicht ehrenhaft, weil er nicht selbst um seine Ehre kämpfe, sondern den Fall vor ein Gericht bringe.94 Während Ariston seinen Gegner aus dem Bereich akzeptablen Verhaltens herausdrängt, verteidigt er seine Position gleichzeitig dagegen, ebenfalls als nicht ehrenhaft zu gelten. Beider Verhalten kann als Transgression interpretiert werden: das des Konon, weil er sein Ehrgefühl bis zur Hybris steigert, und das des Ariston, weil er seine Ehre nicht auf gleicher Ebene verteidigt, sondern im institutionalisierten Rahmen der Polisgerichtsbarkeit. Auch die Rede Gegen Konon erzählt von zwei Personen, die sich ehrenhaft verhalten. Ihr alltägliches Leben spielt sich im öffentlichen Raum ab, sie bewegen sich im Kreise männlicher Freunde und Rivalen und orientieren sich an dem dort geltenden Ehrenkodex. Das wird nicht in Frage gestellt, solange es nicht zu Interferenzen mit den Ansprüchen der Polis kommt. Ariston stellt seine eigene Ehre hintan und räumt dort das Feld, wo er sich auf dem Hoheitsgebiet der Polis befindet. So bei seinem Militärdienst für Athen oder beim Verzicht auf eigenhändige Vergeltung, wo die Polis als Garant der körperlichen Unversehrtheit ihrer Bürger auftritt. Wie schwierig für Ariston der Dienst für zwei Herren – die Ehre und die Polis – ist, zeigt der Tenor seiner Rede, der sowohl normativ als auch rechtfertigend wirkt. Die Rede des Lysias ØPÒR TOà '%RATOSQšNOUJ FÒNOU ¢POLOG…A hat mit den beiden besprochenen vor allem den Anlass ihrer Entstehung gemein: das von Ehre geprägte Handeln eines Mannes, das ihn mit einem anderen Athener und mit dem Gesetz in Konflikt bringt. Wenig ehrenhaft erscheint die Auseinandersetzung zwischen Euphiletos und Eratosthenes, weil sie sich nicht persönlich kennen und nur ein einziges Mal aufeinander treffen. Sehr ehrenhaft dagegen ist die unbedingte Wertschätzung der männlichen sexuellen Integrität, die hier deutlich wird. Im Gegensatz zu Demosthenes und Ariston hat sich Euphiletos in der unmittelbaren Situation 92 Die Wahl einer A„KE…AJ D…KH anstatt einer ÛBREWJ GRAF» sehen Morford, Ethopoiia, 243, und Carey und Reid, Demosthenes, 76, durch die Bedingungen der beiden Klagen begründet, nicht durch die Art des Vergehens. 93 Demosth. 54, 1, beginnt mit den Worten `5BRISQE…J, ð ¥NDREJ DIKASTA…, KAˆ PAQëN ØPÕ +ÒNWNOJ TOUTOUˆ TOIAàTA und nimmt den Begriff der Hybris regelmäßig wieder auf, bei der Besprechung des Angriffs erscheint es mindestens einmal in jedem Paragraphen, ebd. 9-25. 94 Ebd. 13-14; vgl. ebd. 4-5.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
227
als überlegen erwiesen, denn er tötete den Eratosthenes, den er im Bett seiner Frau vorfand. Nun muss er sich vor Gericht wegen dieser Verteidigung seiner Mannesehre verantworten. Die Geschichte, die Euphiletos erzählt, ist nicht nur wegen ihrer zeitlos pikanten Thematik und ihres häuslichen Charmes denkwürdig, sondern vor allem wegen der Rolle, die Euphiletos sich selbst und seinem Ehrgefühl verleiht. Weit mehr noch als Ariston und Demosthenes stellt Euphiletos sich als Mann ohne Ehrgefühl dar. Er verkörpert das Klischee des gehörnten Ehemannes, der sich naiv und arglos hinters Licht führen lässt und den wahren Sachverhalt als letzter erfährt. Seine Rede beschäftigt sich nicht so sehr mit seinem Nebenbuhler Eratosthenes, den er ja auch nach eigenem Bekunden nicht gekannt hat, sondern vielmehr mit der Charakterisierung seiner eigenen Person. Der grundsätzliche Widerspruch, der die Spannung der lysianischen Rede erzeugt, liegt in der Selbstdarstellung des Euphiletos als eines Mannes ohne Ehrgefühl einerseits und seines Mordes an Eratosthenes andererseits. Euphiletos beginnt die chronologische Wiedergabe der Ereignisse, so wie sie sich ihm enthüllten, mit der Beschreibung des häuslichen Lebens seit seiner Eheschließung.95 Nach einer gewissen Zeit des Zusammenlebens und der Geburt eines Kindes beginnt Euphiletos seiner Frau zu vertrauen und sie als tüchtige Hauswirtschafterin zu schätzen.96 Um ihr die nächtliche Versorgung des Säuglings zu erleichtern, tauscht Euphiletos die Räume mit seiner Frau, so dass sie im Erdgeschoss schläft und er im ersten Stock.97 Nach dieser Klärung des Settings gibt Euphiletos in den Paragraphen 11 bis 14 einen kleinen häuslichen Vorfall zum Besten, den er detailliert und anschaulich ausmalt. Die Szene enthält die Botschaft der gesamten Rede in komprimierter Form. Ihr illustrativer Charakter schmückt, aber verhehlt nicht die wohldurchdachte Funktion, die sie für die gesamte Rede hat: Sie erweist Euphiletos als einen Mann, der weder intelligent noch kaltblütig genug ist, um die Ermordung eines anderen zielgerichtet zu planen.98 Die 95 Lys. 1, 6f. 96 Ebd: ™PEID¾ Dš μOI PAID…ON G…GNETAI, ™P…STEUON ½DH KAˆ P£NTA T¦ ™μAUTOà ™KE…NV PARšDWKA, ¹GOÚμENOJ TAÚTHN O„KEIÒTHTA μEG…STHN EÍNAI. ™N μÒN OâN Tù PRèTJ CRÒNJ, ð '!QHNA‹OI, PASîN ÃN BELT…STH, KAˆ G¦R O„KONÒμOJ DEIN¾ KAˆ FEIDWLÕJ [¢GAQ¾] KAˆ ¢KRIBîJ P£NTA DIOIKOàSA: »Als mir aber ein Kind geboren wurde, da begann ich ihr zu vertrauen und überließ ihr alle meine Angelegenheiten, weil ich glaubte, dass wir uns vollkommen vertrauen könnten. In der ersten Zeit, Athener, war sie also von allen die beste. Sie war eine fähige und sparsame Haushälterin und verwaltete alles mit Sorgfalt.« Übersetzung: G. Wöhrle. 97 Ebd. 8. 98 Vgl. Lysias, Selected Speeches, hg., übers. u. komm.v. C. Carey, Cambridge 1979, 61: »Through the medium of the narrative Lysias presents Euphiletos not only as a sympathetic figure, a man concerned for his wife’s welfare, but also as a simple man, a gullible, almost comic figure. ... The effect is to create the impression of a man so simple as to be incapable of the kind of
228
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Episode sagt über den Charakter des Euphiletos das Gegenteil dessen, was ihm unterstellt wird, sie bildet das notwendige Gegengewicht zur Beschreibung der Tat, die erst später folgt. Lysias kann sich sicher sein, dass die Szene den Zuhörern wegen des Amusements, das sie auslöst, im Gedächtnis bleiben wird. Euphiletos schildert in epischer Breite: 0ROÎÒNTOJ DÒ TOà CRÒNOU, ð ¥NDREJ, ÂKON μÒN ¢PROSDOK»TWJ ™X ¢GROà, μET¦ DÒ TÕ DE‹PNON TÕ PAID…ON ™BÒA KAˆ ™DUSKÒLAINEN ØPÕ TÁJ QERAPA…NHJ ™P…THDEJ LUPOÚμENON, †NA TAàTA POIÍ: Ð G¦R ¥NQRWPOJ œNDON ÃN: ÛSTERON G¦R ¤PANTA ™PUQÒμHN. KAˆ ™Gë T¾N GUNA‹KA ¢PIšNAI ™KšLEUON KAˆ DOàNAI Tù PAID…J TÕN TITQÒN, †NA PAÚSHTAI KL©ON. ¹ DÒ TÕ μÒN PRîTON OÙK ½QELEN, æJ ¨N ¢SμšNH μE ˜ORAKU‹A ¼KONTA DI¦ CRÒNOU: ™PEID¾ DÒ ™Gë çRGIZÒμHN KAˆ ™KšLEUON AÙT¾N ¢PIšNAI, ›†NA SÚ GE‹ œFH ›PEIR´J ™NTAàQA T¾N PAID…SKHN: KAˆ PRÒTERON DÒ μEQÚWN EŒLKEJ AÙT»N.‹ K¢Gë μÒN ™GšLWN, ™KE…NH DÒ ¢NAST©SA KAˆ ¢PIOàSA PROST…QHSI T¾N QÚRAN, PROSPOIOUμšNH PA…ZEIN, KAˆ T¾N KLE‹N ™FšLKETAI. K¢Gë TOÚTWN OÙDÒN ™NQUμOÚμENOJ OÙD' ØPONOîN ™K£QEUDON ¥SμENOJ, ¼KWN ™X ¢GROà. ™PEID¾ DÒ ÃN PRÕJ ¹μšRAN, ÂKEN ™KE…NH KAˆ T¾N QÚRAN ¢NšJXEN. ™ROμšNOU Dš μOU T… Aƒ QÚRAI NÚKTWR YOFO‹EN, œFASKE TÕN LÚCNON ¢POSBESQÁNAI TÕN PAR¦ Tù PAID…J, EÍTA ™K TîN GEITÒNWN ™N£YASQAI. ™SIèPWN ™Gë KAˆ TAàTA OÛTWJ œCEIN ¹GOÚμHN. œDOXE Dš μOI, ð ¥NDREJ, TÕ PRÒSWPON ™YIμUQIîSQAI, TOà ¢DELFOU TEQNEîTOJ OÜPW TRI£KONQ' ¹μšRAJ: ÓμWJ D' OÙD' OÛTWJ OÙDÒN E„PëN PERˆ TOà PR£GμATOJ ™XELQëN òCÒμHN œXW SIWPÍ.99 Die Komik der Situation geht voll auf Kosten des Euphiletos, der zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnte, was die Geschworenen bereits wissen, und jeder halbwegs intelligente Mann sofort geargwöhnt hätte: dass seine Frau trickery alleged by the prosecution.« Vgl. M. Weißenberger, Die erste Rede des Lysias, in: AU 36 (1993), 55-71, 60. 99 Ebd. 11-14: »Die Zeit verging, ihr Herren, da kam ich unerwartet vom Feld. Nach dem Essen aber begann das Kind zu schreien und mißvergnügt zu sein, weil es das Hausmädchen absichtlich zu diesem Zweck ärgerte. Der Mann war ja drinnen im Haus. Das habe ich alles später erfahren. So forderte ich meine Frau auf, zu gehen und dem Kind die Brust zu geben, damit es mit dem Geschrei aufhöre. Sie aber zeigte sich zunächst unwillig, als ob sie mich gern nach langer Zeit zu Hause sähe. Als ich aber ärgerlich wurde und sie gehen hieß, sagte sie: ›Damit du dich hier an das junge Mädchen heranmachen kannst? Schon früher hast du sie im Rausch an dich gezogen.‹ Und ich lachte, sie aber steht auf, geht hinaus, schließt die Tür – sie tut so, als ob sie scherzt – und zieht den Schlüssel ab. Ich denke mir nichts dabei, habe keinen Verdacht und schlafe, vom Feld gekommen, zufrieden ein. Als es aber Tag wurde, kam sie und öffnete die Tür. Auf meine Frage, warum die Türen nachts geknarrt hätten, sagte sie, dass die Lampe bei dem Kind verloschen sei, da habe sie sie bei den Nachbarn wieder angezündet. Ich blieb ruhig und meinte, dies werde wohl so sein. Sie schien mir aber, ihr Herren, ihr Gesicht gepudert zu haben, obwohl ihr Bruder vor noch nicht dreißig Tagen gestorben war. Gleichwohl sagte ich nichts dazu und ging still hinaus.«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
229
ihn betrügt. Während Euphiletos das Verhalten seiner Frau nach seinem damaligen Kenntnisstand als nicht weiter ungewöhnlich interpretiert, wird den Athenern klar, wie geschickt sie den Arglosen getäuscht hat bzw. wie lächerlich leicht er sich täuschen ließ. Die Szene wirkt fast wie ein Schwank.100 Ebenso komisch ist das langsame Begreifen des Euphiletos, der mit der Nase darauf gestoßen werden muss, was für jeden anderen längst offensichtlich gewesen wäre. Eine fremde Frau spricht ihn auf der Straße an. Sie will sich nicht in seine Angelegenheiten einmischen, sagt sie, es ärgere sie aber, dass ihr Liebhaber Eratosthenes mehr Zeit mit der Frau des Euphiletos verbringe als mit ihr. Jetzt kommt Euphiletos ein schlimmer Verdacht. Er tut, wie ihm von der Vernachlässigten geraten, und befragt seine Magd, die ihm schließlich von der Untreue seiner Frau und von ihren Mittlerdiensten berichtet.101 Um die Argumentation nicht ins Unglaubhafte kippen zu lassen und weil derselbe naive und treuherzige Euphiletos später auch den Mord begehen können muss, korrigiert Lysias im Folgenden seinen Charakter ins tatkräftig Entschlossenere.102 Euphiletos will die Sache selbst in die Hand nehmen, er braucht dazu nur die Hilfe der Magd, die er wie folgt anweist: ›¢XIî Dš SE ™P' AÙTOFèRJ TAàT£ μOI ™PIDE‹XAI: ™Gë G¦R OÙDÒN DšOμAI LÒGWN, ¢LL¦ TÕ œRGON FANERÕN GENšSQAI, E‡PER OÛTWJ œCEI.‹ æμOLÒGEI TAàTA POI»SEIN.103 So geschieht es denn einige Tage später: Euphiletos kann Eratosthenes in flagranti ertappen und tötet ihn. Die Umstände des betreffenden Abends werden ganz genau geschildert; es sind zeitraubende Umstände, die deutlich machen, dass Euphiletos gerade an diesem Abend überhaupt nicht darauf gefasst war, Eratosthenes gegenübertreten zu müssen. Die Argumentation der Verteidigung steht und fällt mit der Glaubwürdigkeit dieses Punktes. Denn rein rechtlich ist es einem Athener erlaubt, einen Mann, der in sein Haus eindringt und seine Frau verführt, zu töten, wenn er ihn auf frischer
100 Nach J.R. Porter, Adultery by the Book: Lysias I (On the Murder of Eratosthenes) and Comic Diegesis, in: EMC 40, n.s. 16 (1997), 421-453, 441, handelt es sich bei diesem Fall wegen der angedeuteten Umkehr der Geschlechterrollen und der kaum glaubhaften Häufung von Stereotypen nicht um eine Gerichtsrede, sondern um eine »form of practical rhetorical exercise – a fictional speech based upon a fictional case, designed not only to instruct and delight but, quite probably, to advertise the logographer’s skill.« 101 Lys. 1, 15-20. 102 Vgl. M. Edwards und S. Usher, Greek Orators I. Antiphon and Lysias, übers., komm. u. erl., Warminster, Wiltshire 1985, 224: »It is as if Euphiletus’ character suddenly reveals its other side: naïve trust gives way to anger and a righteous desire for revenge.« 103 Ebd. 21f: »›Ich fordere dich aber auf, mir ihre Schuld auf frischer Tat zu beweisen, denn ich brauche keine Worte, sondern die Sache muss offenbar werden, wenn sie sich wirklich so verhält.‹ Dem stimmte sie zu.«
230
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Tat ertappt.104 Das gilt nicht für den Fall, dass er ihm eine Falle stellt, indem er ihn mit List in sein Haus lockt, um sich später auf das Gesetz zu be rufen.105 Euphiletos befürchtet, dass die Kläger sich auf eben diesen Punkt konzentrieren werden. Und tatsächlich ist ja das Komplott mit der Magd, das er bestreitet, in seiner eigenen Erzählung mit Händen zu greifen. Er bittet deshalb die Zuhörer: 3KšYASQE Dš, ð ¥NDREJ: KATHGOROàSI G£R μOU æJ ™Gë T¾N QER£PAINAN ™N ™KE…NV TÍ ¹μšRv μETELQE‹N ™KšLEUSA TÕN NEAN…SKON106 und legt ausführlich dar, wie unvorbereitet und planlos er an jenem Abend war.107 Die detaillierte Schilderung der Tatumstände und der häuslichen Gegebenheiten wie auch der plaudernde und treuherzige Erzählstil der Rede dienen dazu, einen bestimmten Eindruck der Person des Euphiletos zu vermitteln. Das Hauptargument des Lysias besteht in der meisterhaften Charakterzeichnung des Euphiletos. Er wird portraitiert als ein unaufgeregter Zeitgenosse, der nicht allzu sehr um seine Ehre bekümmert ist, von Eratosthenes aber dazu gebracht wird, sie schlagkräftig zu verteidigen. Lysias stattet seinen Protagonisten sowohl mit einer gewissen Blauäugigkeit als auch mit einem gerechten Zorn aus, der sich gegen seinen Widersacher richtet, wenn er zu sehr provoziert oder hintergangen wird.108 Damit umgeht die Verteidigung einige Deutungen, die die Tat des Euphiletos nicht auszeichnen sollen: Erstens soll es sich nicht um eine spontane Rächung verletzter Ehre handeln, denn das hätte den Geruch des Gesetzlosen (und das Gesetz ist das einzige, das Euphiletos eindeutig auf seiner Seite hat). Deshalb werden erst noch Nachbarn zusammengetrommelt,
104 Vgl. W. Schmitz, Der nomos moicheias – Das athenische Gesetz über den Ehebruch, in: ZRG. Rom.Abt. 114 (1997), 45-140, 55-66. 105 Ebd. 58, 138. Selbst wenn der Umstand nicht per Gesetz fixiert war, so könnte Euphiletos doch auf Missbehagen seitens der Geschworenen stoßen: »To entice him in order to catch him in the act might not lose jury sympathy; to entice him in order to kill him probably would.«, gibt R. Scodel: Meditations on Lysias 1 and Athenian Adultery, in: Electronic Antiquity 1, 2 (1993), nicht paginiert, zu bedenken. 106 Lys. 1, 37: »Überlegt aber, ihr Herren: Sie bezichtigen mich, ich hätte an jenem Tag das Mädchen beauftragt, den jungen Mann herbeizuholen.« Aus dem gleichen Grund stellt Euphiletos klar, dass er mit Eratosthenes zuvor nicht im Streit lag, ja ihn nicht einmal gekannt hat, und einzig Eratosthenes’ Verbrechen sie zu Feinden gemacht habe, ebd. 4. 43. 107 Lys. 1, 22-24, mit der Versicherung, ohne Kalkül gehandelt zu haben noch einmal wiederholt in 39-42. 108 Vgl. Porter, Adultery, 439: Euphiletos wird geschildert als »an unsophisticated man of the earth whose response to learning of his wife’s affair, while excessive, was understandable, given both his personality and the outragous wrongs he had suffered. The speaker is presented as blunt in both word and deed, the very sort of person who would take matters into his own hands and insist on confronting the adulterous pair in the act.«
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
231
gemeinsam Fackeln gekauft usw.109 Es soll keine Tötung aus dem Affekt der verletzten Ehre sein. Zweitens soll es sich auch nicht um ein Verbrechen handeln, bei dem die Ehre keine Rolle spielt. Denn wenn Euphiletos ein anderes Motiv gehabt hätte, dann würden seine Vorbereitungen zu sehr nach dem Einrichten eines Hinterhalts für seinen Nebenbuhler aussehen. Die Anwesenheit des Eratosthenes in seinem Haus könnte Euphiletos nach dieser Lesart als ein willkommener Vorwand dienen, eine längst bestehende Feindschaft zu beenden. Um beide Interpretationen zu vermeiden, erfolgt der Umschwung in der Charakterisierung, der einsetzt, sobald Euphiletos um die Sache weiß: Seine männliche Ehre, einschließlich der Ehre seines Hauses, ist beschädigt. Aus diesem Grund wird er aktiv. Der Balanceakt, den Lysias bei der Komposition der Rede ausführt, hält sich zwischen den beiden Deutungen der spontanen Rächung und der geplanten Vergeltung als Motive für die Tat des Euphiletos. Beide Interpretationen werden mit großem rhetorischen Geschick als unzutreffend dargestellt: die Wahrheit liegt in der Mitte: Euphiletos war entschlossen, seine Ehre zu verteidigen, wollte aber der Untreue seiner Frau sicher sein und auf eigene Faust handeln.110 Er war vernünftig genug, nichts zu überstürzen, konnte sich aber angesichts des ehebrecherischen Paares nicht zurückhalten. Sein geradliniger Charakter war zu Kompromissen bei der Vergeltung nicht bereit.111 Das klingt legitim und war in Athen legal. Euphiletos weiß, dass er seinen Handlungsspielraum nicht überzogen hat, sondern im Rahmen des gesetzlich Geduldeten agierte. Dementsprechend fällt sein Passus zu den athenischen Gesetzen aus: Euphiletos hat lediglich die Handlungen durchgeführt, die die athenischen Gesetze, hier der nomos moicheias, in solchen Situationen vorsehen und – wie Euphiletos es ausdrückt – auf Befragen sogar anraten: ™Gë μÒN G¦R OÍμAI P£SAJ T¦J PÒLEIJ DI¦ TOàTO TOÝJ NÒμOUJ T…QESQAI, †NA PERˆ ïN ¨N PRAGμ£TWN ¢PORîμEN, PAR¦ TOÚTOUJ ™LQÒNTEJ SKEYèμEQA Ó TI ¹μ‹N POIHTšON ™ST…N.112 109 Herman, Codes, 417, glaubt Euphiletos alles, was er sagt: »The motive for killing Eratosthenes was grounded in a sober desire to implement civic justice. It was a manifestation of rational, utilitarian calculation, not the outcome of uninhibited, blind passion.« 110 Schon auf den Verdacht des Ehebruchs hin und mit der Zeugenaussage der Magd hätte Euphiletos eine GRAF¾ μOICE…AJ anstrengen können. Er will es aber mit eigenen Augen sehen, Lys. 1, 38. 111 Neben der Tötung des Ehebrechers gab es noch andere Formen der Vergeltung, vgl. Schmitz, nomos, 138f., und Carey, Lysias, 76. Dazu gehört u. a. die Möglichkeit, das von Eratosthenes angebotene Geld als Entschädigung zu nehmen, Lys. 1, 25. 112 Lys. 1, 35: »Denn ich glaube, dass alle Staaten sich deswegen Gesetze geben, damit wir uns in Fällen, in denen wir im unklaren sind, an diese wenden und fragen, was wir tun sollen.« Den gleichen Tenor haben die Worte, mit denen er Eratosthenes tötet, ebd. 26: OÙK ™Gè SE ¢POKTENî, ¢LL' Ð TÁJ PÒLEWJ NÒμOJ, ÖN SÝ PARABA…NWN PERˆ ™L£TTONOJ TîN ¹DONîN ™POI»SW, KAˆ μ©LLON E†LOU TOIOàTON ¡μ£RTHμA ™XAμART£NEIN E„J T¾N GUNA‹KA T¾N ™μ¾N KAˆ E„J TOÝJ PA‹DAJ TOÝJ ™μOÝJ À TO‹J NÒμOIJ PE…QESQAI KAˆ KÒSμIOJ EÍNAI. »Nicht
232
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Rein juristisch kann Euphiletos kaum etwas bewiesen werden, er hat sich nicht gesetzeswidrig verhalten. Die Zwielichtigkeit seiner Handlung gründet in der Rolle, die die Ehre in diesem Drama spielt. Weil die athenischen Richter nicht ermessen können, wie groß das Ehrgefühl des Euphiletos tatsächlich ist, können sie schlecht abschätzen, ob er sich tatsächlich nur hat rächen wollen oder ob er sich nüchtern an die Gesetze hielt.113 Die Verhaltenserwartungen der Polis – fixiert in den Gesetzen – und der Ehrenkodex des Rächers stehen sich hier nicht unvereinbar gegenüber, sondern heißen dasselbe Vorgehen gut. Euphiletos hat beiden Verhaltensnormen entsprochen, ist dadurch aber nicht etwa doppelt gerechtfertigt. Im Gegenteil: er wird gezwungen, die Motive und Umstände seiner Tat darzulegen. Erst dann entscheiden die Athener über die juristische und soziale Rechtmäßigkeit seines Verhaltens. Anders als bei den Reden des Demosthenes und des Ariston kann das Geschehen nicht nur von einer Warte aus interpretiert werden. Euphiletos kann nicht der empfindlich auf seine Ehre bedachte hintergangene Ehemann sein, dafür ist seine Tat zu wenig spontan. Er kann aber auch nicht der distanzierte gesetzestreue Beobachter einer Strafttat sein, dafür ist seine Tat zu eigenmächtig. Die nicht zu leugnenden und von Zeugen bestätigbaren Rahmenbedingungen der Tat bieten kaum Raum für eine konsistente Darstellung. Denn weil Euphiletos sowohl die normativen Ansprüche der Ehre als auch der Polis erfüllt hat, konnte er beide nur teilweise berücksichtigen. Ebenso hat er sie auch beide teilweise vernachlässigt. Die elaborierte Charakterisierung, die Lysias bietet, bemüht sich um eine Kombination beider normativer Erwartungen in einem relativ widerspruchsfreien Verhältnis. Lysias weiß, dass bestimmte Handlungen in der athenischen Gesellschaft trotz komplementärer Normenergänzung nicht beliebig gedeutet werden können. Das Verhalten des Euphiletos droht wegen der eindeutigen Nichterfüllung einiger normativer Erwartungen, die die Ehre und die Polis an ihn stellen, den sozialen Konsens zu verfehlen. Lysias tut sein Bestes, um die Ereignisse glaubhaft zu machen, ohne den von den bekannten Fakten gesetzen Rahmen zu sprengen.
ich werde dich töten, sondern das Gesetz der Stadt, das du übertreten und geringer als dein Vergnügen geachtet hast. Und du hast es vorgezogen, eine solche Verfehlung gegenüber meiner Frau und meinen Kindern zu begehen, anstatt den Gesetzen zu gehorchen und ein ordentlicher Bürger zu sein.« Vgl. ebd. 47-49; und die letzten Worte der Rede, in denen Euphiletos die Motive seiner Tat und der Anklage zusammenfasst, ebd. 50: ÓTI TO‹J TÁJ PÒLEWJ NÒμOIJ ™PIQÒμHN. »... weil ich den Gesetzen der Stadt gehorcht habe.« 113 Vlg. zu den Handlungsoptionen des Euphiletos und zur »Bestrafung des vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehrs« allgemein W. Schmitz, Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft im archaischen und klassischen Griechenland, Berlin 2004, 330-348.
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
233
Es ist auffällig, dass sich die Verteidigung gerade in diesem Fall als so schwierig erweist. Denn der nomos moicheias, das von Euphiletos angeführte Gesetz, das ihn zu seiner Tat berechtigt, stellt an sich schon eine Verbindung verschiedener Normen dar.114 Es bindet die Ehre bzw. das Rachebedürfnis des Individuums rechtlich ein, indem es Straffreiheit für eine unter sonstigen Umständen als Mord zu bezeichnende Tat zusichert. Diese widersprüchliche Konstruktion bildet eine Schnittstelle zwischen dem überkommenen Anspruch der athenischen Männer, ihre Ehre und die Integrität ihres Hauses zu rächen und dem Anspruch der Polis, die alleinige Autorität in Konfliktfällen zu sein und Gewalt bzw. Strafe zu exekutieren. Das Recht hat hier die wohl ältere Eigenmächtigkeit des Atheners nicht beschnitten, sondern sie ausdrücklich juristisch integriert. Obwohl Euphiletos seiner Ehre und der Polis Genüge getan hat, ist es für Lysias offensichtlich schwierig, sein Verhalten den Athenern plausibel zu machen. Das Gefüge von ehrenhaftem Verhalten einerseits und gesetzestreuem Verhalten andererseits ist hier sehr fragil, gerade weil Ehre und Polis die gleiche Handlung favorisieren: Die Tötung des Eratosthenes ist nach den Normen der Ehre als ein Akt der Rache definiert und nach den Gesetzen der Polis unter bestimmten Umständen noch legal. Der Kompromisscharakter des nomos moicheias tritt hier klar zutage: die Polis verzichtet auf ihr Gewaltmonopol, um die ältere, ehrenhafte Tradition der Selbstjustiz in den Gesetzeskodex einzubinden. Das Gesetz billigt unter wohldefinierten Bedingungen die Gesetzlosigkeit. Wegen dieser Diskrepanz kann Euphiletos sich sowohl bezogen auf die Ehre als auch bezogen auf die Polis normgerecht verhalten und kommt andererseits doch in Erklärungsschwierigkeiten. Lysias muss den Athenern eine Tat plausibel machen und entsprechend den Vorgaben eines Gesetzes darstellen, das selbst eine sehr widersprüchliche Konstruktion bildet. Welche Schwierigkeiten bei der Verschränkung der beiden Normen auftauchen, zeigt die Rede Über den Mord an Eratosthenes. Der Anspruch, ehrenhaft und gesetzestreu zugleich zu agieren, setzt ein hohes Maß unreflektierten sozialen Konsenses voraus. Erst die Notwendigkeit der Legitimierung, die auf Euphiletos lastet, erweist die Problematik, ein bestimmtes Verhalten mit seinen ehrenhaften und seinen gesetzestreuen Seiten gedanklich auszutarieren und einem Publikum – der Öffentlichkeit – glaubhaft zu machen. Die Unvereinbarkeit beider Normen sperrt sich gegen eine zu leichte Verbalisierung, die Verzahnung findet am reibungslosesten in der unbedachten Praxis statt.115 114 Vgl. Schmitz, nomos, 133. 115 Vgl. Bourdieu, Entwurf, 43: »Das Wertsystem der Ehre wird eher ›praktiziert‹ als gedacht.«
234
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Die drei besprochenen Reden haben alle die Ehre ihres Protagonisten zum Thema. Es geht immer darum, die soziale Akzeptanz des Handelns durch die athenischen Richter, die idealiter die athenische Öffentlichkeit darstellen, zu erreichen. Das Streben danach entspricht dem zentralen Gedanken der Ehrenhaftigkeit: das Verhalten muss durch andere legitimiert werden. Insofern ähneln die Kämpfe um Ehre und um den Sieg in einem Prozess einander, beide finden nur in verschiedenen Arenen statt. Während Ariston und Demosthenes die Auseinandersetzung vor den Gerichten der Straße vorziehen, auf der sie unterlegen waren, hat Euphiletos sich auf dem Feld der Ehre bewiesen. Er muss nun zeigen, dass dieses nicht außer Sichtweite der athenischen Agora liegt. Alle drei Reden belegen eine blühende athenische Streitkultur vor Gericht. Auch Ehrenangelegenheiten können hier offensichtlich verhandelt werden. Die Redner sind bemüht zu zeigen, dass sie sich in den leidigen Auseinandersetzungen mit ihren Gegnern an der Norm der Polis orientiert haben und stets vorbildliche Bürger waren. Die Geschichten des Ariston und des Demosthenes können aber nicht verhehlen, dass die vorangegangenen Konflikte in einer ehrenhaften habituellen Form ausgetragen worden sind, das sich ohne beiderseitige Beteiligung nicht hätte entfalten können. Euphiletos überzeugt durch die mannhafte Verteidigung seiner Ehre, um die sich sein Prozess dreht. Keineswegs ist es so, dass jemand von ihnen seinen Anspruch auf Ehre aufgibt, indem er seinen Fall vor Gericht darlegt. Wie an der Ehre, so haben alle Kontrahenten auch an der Polis teil. Der Vorteil eines zweiten normativen Bezugspunktes besteht in einem zusätzlichen Spielraum für normgerechte Handlungen. Die Gesetze und Normen der Polis relativieren diejenigen der Ehre schon allein durch ihre parallele Existenz. Hauptsächlich aber verdoppeln sie die Möglichkeiten, ein bestimmtes Verhalten durch entsprechende Interpretationen akzeptabel zu machen. Ariston, Demosthenes und Euphiletos nutzen das, indem sie den normativen Bezugspunkt wechseln. Ariston und Demosthenes haben innerhalb der Norm der Ehre kaum eine Chance, Vergeltung zu üben und ihre Ehre wiederherzustellen, wenn sie sich nicht für die völlige Vernichtung ihrer Gegner entscheiden wollen. Denn die Art ihrer Ehrverletzungen ist schwerlich noch zu übertreffen. Gemessen an den Normen der Polis aber kann ihr Verhalten ganz anders bewertet bzw. von ihnen selbst neu interpretiert werden. Euphiletos versucht durch ein geschicktes Plädoyer, sein Rachebedürfnis überzeugend mit der gerade noch tolerierten Eigenmacht eines einzelnen Atheners zu vereinbaren. Er zeigt, wie schwierig es trotz erweiterten Interpretationsspielraums sein kann, ein bestimmtes Verhalten sozial akzeptierbar zu machen. Diese Taktik des Wechselns der normativen Bezugspunkte funktioniert nur dann, wenn die Polis eine echte Alternative zur Ehre darstellt. Die Polis
Die Ehre vor Gericht: Meidias, Konon und Eratosthenes
235
kann nicht nur rein instrumentell dazu dienen, einen ehrenhaften Konflikt unterbrechen zu können, wenn es den Beteiligten gerade günstig erscheint, sondern ihre Normen müssen ähnlich internalisiert und sozial akzeptiert sein wie die der Ehre. Dabei wirken die instrumentelle und ideelle Dimension aufeinander zurück: Demosthenes und Ariston als Vertreter der besonders ehrenhaften Oberschicht bedienen sich der normativen Erwartungen der athenischen Bürger, um ihre Interessen durchzusetzen. Durch die normative Bestätigung dessen, was einen guten Polisbürger ausmacht, erhöht sich die Macht der athenischen Bürger als öffentlicher Meinung und letzter Instanz zur Beurteilung normgerechten Verhaltens. Je häufiger das geschieht, desto weniger kann zwischen Mittel und Zweck geschieden werden. Schließlich wissen die Akteure selbst nicht mehr, ob sie nur vorgeben, vortreffliche Bürger zu sein, oder ob sie es inzwischen wirklich sind, weil sie sich daran gewöhnt haben und es die Inszenierung erleichtert.116 Bezeichnenderweise wechseln die Athener in dem Moment auf den gerichtlichen Schauplatz der Rivalität, in dem die ehrenhafte Auseinandersetzung ihren agonalen, spielerischen Charakter verliert. Für Ariston und Demosthenes geht es um ihre persönliche Ehre, die nur noch durch einen Akt zu verteidigen wäre, wie ihn Euphiletos begeht. Dass dieser sich für die Rächung seiner Ehre verteidigen muss, weil den Athenern die Sache zwar nicht unbedingt gesetzwidrig, wohl aber erklärungsbedürftig erscheint, verweist auf eine Relativierung der Vorstellung von Ehre. Ehre ist nicht mehr der absolute Wertmaßstab des Handelns, sondern kann um einen zweiten ergänzt werden. Ob die Entscheidung der Athener, sich vor Gericht auseinanderzusetzen, nun auf reinem Kalkül beruht oder auf der Einsicht in die Absurdität des zum äußersten strapazierten Prinzips der Ehre, ist dabei zweitrangig.117 Entscheidend ist die Tatsache, dass Ehre in den Köpfen der Athener dort an 116 Zwar ist eine sich auftuende Kluft zwischen Schein und Sein ein typisches Merkmal ehrenhafter Gesellschaften, umgekehrt ist aber auch ein Ineinanderübergehen der Gegensätze denkbar, vgl. Cairns, Aidôs, 432: »Behind the idea of one’s own timê, moreover, lies a subjective claim to honour and an internalized self-image that is not wholly dependent on the opinions of others; to be concerned for one’s self-image in Greek is to be concerned for one’s timê, but at no stage does this necessarily imply concern for one’s outward reputation to the exclusion of one’s image in one’s own eyes. The code of honour to which aidôs relates demands individual determination actually to possess an excellence, not merely that one should seem to others to possess it.« 117 Gehrke, Griechen, 143, hingegen hält das Vertrauen der Athener in ihr Rechtssystem für relativ brüchig: »Im Bereich von Gefühlen und Einstellungen waren also ... Rachebegehren und Rachebereitschaft quicklebendig, die Kontrolle solcher Bereitschaft war eher äußerlich: durch ein Rechtssystem, das mit Rache eng verbunden war, ja teilweise geradezu von ihr gespeist wurde, nicht gerade eine feste Sicherung. Oft bestimmten infolgedessen nur die realen Möglichkeiten, also beim Individuum zweckrationale Überlegungen, ob man Rache nahm oder nicht – auch dieses nur ein externer Faktor, der oft lediglich von der sozialen Position, den wirtschafltichen Ressourcen und der politischen Macht abhing.«
236
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Macht verliert, wo sie ihre destruktivsten Wirkungen auf das Gemeinwesen zeigt. Damit werden nicht nur die extremsten Folgen des Ehrdenkens illegitim, sondern es ändert sich etwas in der prinzipiellen Auffassung dessen, was Öffentlichkeit ist, welche Bevölkerungsgruppen sie herstellen und wer daher Ehre zuschreiben kann. Ironischerweise werden nun die athenischen Bürger zu Richtern über jene Ehre, die den Mitgliedern der Oberschicht immer auch dazu diente, Gleichheitsansprüche zurückzuweisen. Denn es sind traditionell sehr ehrenhafte Streithähne, die sich in den Gerichten produzierten, um ihre alten Kämpfe vor interessiertem Publikum unvermindert fortzuführen.
2. Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos Zum agonalen Stil einer Auseinandersetzung unter Ehrenmännern gehört es, dass sie raumgreifend und expansiv verläuft. Zwar unterliegt sie bestimmten Regeln, die den Beteiligten und den Beoachtern bekannt sind, aber diese Normen halten den Streit nicht restriktiv im Zaum, sondern sehen eine Ausweitung räumlicher und personaler Art vor. Mit der eskalierenden Heftigkeit der gegenseitigen Attacken ist auf horizontaler Ebene eine breitere Involviertheit der Öffentlichkeit verbunden. In den athenischen Gerichtshöfen kommen immer wieder Fälle zur Verhandlung, deren Geschichte sich aus einem solchen klassischen Verlauf der Auseinandersetzung entwickelt hat. Der Gegenstand der Differenz kann dabei ein geringer sein, die Dynamik der ehrenhaften Konfliktführung sorgt für eine zunehmende Unversöhnlichkeit der Kontrahenten. Vor Gericht berichten die Männer von ihrem Streit und bemühen sich darzustellen, dass ihr eigenes Verhalten sie sowohl als Ehrenmann wie auch als Polisbürger ausweist. Die jeweiligen sozialen Räume für die Polisbürger sind die Gerichtshöfe und für die Ehrenmänner die Straße: hier tragen sie ihre Konflikte nach allen Regeln der Kunst aus. Die Gerichtsreden, die ausführlich einen langen Konflikt zwischen zwei Parteien schildern, ermöglichen es allgemein, die Auseinandersetzung zwischen zwei Athenern auf ihre ehrenhaften Verhaltensmuster hin zu untersuchen. Denn unter Ehrenmännern gelten das agonale Verhalten, die reziproke Erwiderung einer Herausforderung und die öffentliche Austragung eines Konfliktes als Kennzeichen für die Ehre und Satisfaktionsfähigkeit des Gegenübers. Weil die Reden detaillierte Auskunft über die einzelnen Stationen der Auseinandersetzung geben und sie gleichzeitig vor einem öffentlichen Publikum reflektieren, geben sie Auskunft über die Art des erwarteten
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
237
ehrenhaften Verhaltens und die Bereitschaft der Protagonisten, sich daran zu orientieren. Ein Redner hat dabei stets die Meinung der Geschworenen als Fluchtpunkt seiner Schilderung vor Augen: Als Öffentlichkeit können sie das ehrenhafte Verhalten einer Person sanktionieren, und zugleich können sie als Vertreter der Polis ein gesetzestreues, an der Gemeinschaft ausgerichtetes Verhalten akklamieren. Sowohl der Appell an die Polis als auch an die Ehre als ausschlaggebende Verhaltensnorm ist möglich. Beide fungieren für die Handlungen des Einzelnen als konkurrierende Loyalitäten. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung gilt dem normativen Bezugsrahmen, in den sich die Redner stellen. Der erzählte Verlauf der Streitigkeiten wird naturgemäß aus einseitiger Perspektive eines der Beteiligten dargestellt, was die Identifizierung der normativen Aspekte zwar erleichtert, einen Überblick über den wechselseitigen Verlauf der Auseinandersetzungen jedoch erschwert. Die hier zugrunde gelegte Abfolge der Ereignisse bzw. der Handlungen von Kläger und Angeklagtem stützen sich auf die Wahrscheinlichkeit des Berichteten, den Gesamtzusammenhang, den die jeweilige Rede herstellt, und das postulierte Verhalten in einer ehrenhaften Gesellschaft. Wie andere Reden zeigen, gehören agonale, kompetitive und rächende Handlungen durchaus zum gewöhnlichen Repertoire an Handlungsoptionen für einen Athener. Im Einzelnen kann kaum erschöpfend erklärt werden, welche Gründe einen Athener bewogen haben mögen, sich entsprechend der Norm der Ehre zu verhalten oder es im gegebenen Fall für klüger zu erachten, seinen Rachegelüsten nicht nachzugeben, sondern auf das Urteil der Geschworenen zu warten. Von Ausnahmefällen abgesehen wird diese Handlung nicht so bewusst gewesen sein, dass sie im Nachhinein vom Ankläger oder vom Angeklagten authentisch rekonstruiert worden sein könnte. Beide konzentrieren sich vielmehr auf eine Interpretation ihres Verhaltens gemäß den Erwartungen ihrer Zuhörer. Dabei können einzelne Handlungen zwar eindeutig als ehrenhaft oder als polisorientiert klassifiziert werden, das geschilderte und sozial akzeptierte Verhalten der Protagonisten erweist sich aber meistens als eine Vermengung beider normativer Haltungen. Konkret werden die 3. und 4. Rede des Lysias Gegen Simon und gegen einen Unbekannten untersucht, in denen es um das Delikt des TRAàμA ™K PRONO…AJ geht. Die Rede Gegen Simon wird in das Jahr 392 gesetzt, für eine Datierung der 4. Rede fehlt jeglicher Anhaltspunkt.118 Beide Reden rekapitulieren einen ehrenhaft ausgetragenen Konflikt zwischen zwei Athenern, dessen Höhepunkt die körperliche Verletzung eines der beiden Kontrahenten ist. Auch die beiden demosthenischen Reden Gegen Nikostratos 118 Vgl. zur Datierung der 3. Rede Carey, Speeches, 86; bei der zeitlichen Verortung der 4. Rede bekennt sich Blass, Beredsamkeit I, 583, ratlos.
238
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
und Gegen Euergos und Mnesiboulos resultieren aus einer längeren Auseinandersetzung. Sowohl die 53. als auch die 47. Rede des Demosthenes werden in die Mitte des 4. Jahrhunderts datiert.119 Allen Reden ist als Vorgeschichte ein langwieriger und expansiver Streit gemeinsam, der von den beteiligten Männern mit den unterschiedlichsten Mitteln geführt wird. Einige davon sind ehrenhafte, andere gesetzeskonforme Methoden, um den Gegner zu besiegen. Die Art und Weise, wie die Auseinandersetzung abgelaufen ist und wie sie den Athenern dargestellt wird, wirft ein erhellendes Licht auf die Einstellung der Athener zu Ehre und Polis. Die dritte Rede des Lysias verteidigt einen nicht namentlich genannten Athener gegen seinen Widersacher Simon, der ihn auf den Tatbestand des TRAàμA ™K PRONO…AJ hin verklagt. Simon wird beschuldigt, seinem Widersacher während einer Schlägerei eine schwere Kopfwunde zugefügt zu haben. Die in Rede stehende Verwundung liegt vier Jahre zurück, sie geschah auf dem Höhepunkt des Streits beider um den plataiischen Knaben Theodotos. Nach Darstellung des Redners bemühten sich beide Männer um Thodotos, KAˆ ™Gë μÒN Eâ POIîN AÙTÕN ºX…OUN EÍNA… μOI F…LON, OáTOJ DÒ ØBR…ZWN KAˆ PARANOμîN õETO ¢NAGK£SEIN AÙTÕN POIE‹N Ó TI BOÚLOITO.120 Diese Worte sollen nicht nur ein bezeichnendes Licht auf den Charakter des Simon werfen, sondern verweisen generell auf das Verhältnis, in dem der Plataier Theodotos, der wahrscheinlich nicht das athenische Bürgerrecht besitzt, zu den beiden athenischen Männern steht: Er ist ein käuflicher Knabe, der zunächst von Simon, später von dem Sprecher ausgehalten wird; ein Verhältnis, das bis zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung andauert.121 Außer in Bezug auf die Prozessgegner tritt Theodotos als Person kaum in Erscheinung, er ist lediglich das Objekt der Begierde, um das sich die beiden athenischen Männer in einem beachtlichen Crescendo der gegenseitigen Attacken streiten. Eine Auseinandersetzung auf verbaler Ebene, die die Vorgeschichte zur Erzählung des Sprechers bildet, wird mit dem Buhlen beider um die Gunst des Theodotos angedeutet. Der Redner belässt es bei dem Hinweis auf das Ergebnis des Streits, aus dem er siegreich hervorgegangen ist, und schließt 119 Davies, APF 7094 datiert die 47. Rede in das Jahr 357/6; Wankel, Demosthenes, Bd. 4., 147, vermerkt für die 53. Rede: »Es leuchtet ein, ... die Rede könne nicht vor 368 gehalten sein, aber sehr wohl ist es möglich, dass seitdem ein paar Jahre vergiengen, ehe Apollodor die Rechtmässigkeit der an dem Besitzthume des Arethusios vorgenommenen Pfändung vor Gericht darzuthun suchte.« 120 Lys. 3, 5: »Ich für mein Teil wollte seine Zuneigung durch Freundlichkeit gewinnen, er dagegen glaubte, er könne durch herrisches Wesen und durch Verachtung der Gesetze ihn zwingen zu tun, was er wollte.« Deutsche Übersetzung: U. Treu. 121 Vgl. Carey, Lysias, 87, diskutiert einen möglichen »sexual contract between Theodotos and Simon«, der zum Status des Theodotos passen würde und die Motive des Simon für die Klage erklären könnte, vgl. ebd., 92.
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
239
die Phase des verbalen Konfliktes damit ab. Was im Folgenden geschildert wird, spielt sich auf der Ebene der tätlichen Übergriffe ab. Während Simon den Angeklagten für die Eskalation des Streits verantwortlich macht, behauptet der Sprecher das Gegenteil: Simon habe ein Verhalten an den Tag gelegt, das von einem Ehrenmann nicht unbeantwortet bleiben konnte, auf das er aber nur gemäßigt reagiert habe, um den Streit nicht weiter zuzuspitzen. Es ist die Schwelle des Oikos des Sprechers, mit deren Übertretung Simon die eigentlichen Kampfhandlungen initiiert: PUQÒμENOJ G¦R ÓTI TÕ μEIR£KION ÃN PAR' ™μO…, ™LQëN ™Pˆ T¾N O„K…AN T¾N ™μ¾N NÚKTWR μEQÚWN, ™KKÒYAJ T¦J QÚRAJ E„SÁLQEN E„J T¾N GUNAIKWN‹TIN, œNDON OÙSîN TÁJ TE ¢DELFÁJ TÁJ ™μÁJ KAˆ TîN ¢DELFIDîN, A‰ OÛTW KOSμ…WJ BEBIèKASIN éSTE KAˆ ØPÕ TîN O„KE…WN ÐRèμENAI A„SCÚNESQAI.122 Um die Ernsthaftigkeit des Affronts zu betonen und seine Klassifizierung als ÛBRIJ zu untermauern, erwähnt der Verteidiger die erschrockene Reaktion selbst der Freunde des Simon: dessen Begleiter helfen den herbeigeeilten Nachbarn, den Frevler mit Gewalt aus dem Haus zu entfernen.123 Dieser erste, nach Darstellung des Redners in seiner Heftigkeit vollkommen unmotivierte Angriff charakterisiert Simon als einen unbeherrschten Menschen, der mit maßlosen Mitteln die Feindseligkeiten gegen den Sprecher eröffnet, der bis hierher als Agent noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist.124 Die Darstellung des Streits nach diesem Muster setzt der Redner auch für den nächsten, unmittelbar folgenden Angriff fort: KAˆ TOSOÚTOU ™DšHSEN AÙTù μETAμELÁSAI TîN ØBRISμšNWN, éSTE ™XEURëN Oá ™DEIPNOàμEN ¢TOPèTATON PR©GμA KAˆ ¢PISTÒTATON ™PO…HSEN, E„ μ» TIJ E„DE…H T¾N TOÚTOU μAN…AN. ™KKALšSAJ G£R μE œNDOQEN, ™PEID¾ T£CISTA ™XÁLQON, EÙQÚJ μE TÚPTEIN ™PECE…RHSEN:125 Das Handeln des Simon erscheint nicht in einem zusammenhängenden und für die Hörer verständlichen Kontext, als nahe liegende Erklärung drängt sich nur die vom Redner angedeutete auf: Simon verhalte sich mutwillig aggressiv und achte dabei 122 Lys. 3, 6: »Als er nämlich erfuhr, dass der Knabe bei mir weilte, kam er zu meinem Haus, des Nachts, betrunken, erbrach die Türen und drang ins Frauengemach ein, wo meine Schwester und meine Nichten waren, die so zurückgezogen leben, dass sie sich selbst vor den (männlichen) Verwandten nicht sehen lassen.« 123 Ebd., 7. Mehrmals wiederholt der Sprecher während seiner Rede die Ereignisse in seinem Haus, vgl. ebd., 23. 29. 124 Vgl. Schmitz, Nachbarschaft, 294: »Der Angeklagte ist also bemüht, in diesem Prozess das Vorgehen Simons und seiner Kumpanen als durch und durch gewaltsamen und rechtswidrigen Akt darzustellen, als Hybris gegen die Witwe und Waisen, die unter seiner Kyrieia standen. Solche rohen Angriffe, die aus persönlicher Rache entsprangen, waren vom Recht nicht gedeckt.« 125 Ebd., 7-8: »Und er dachte da gar nicht daran, sein frevelndes Handeln zu bereuen, nein, er kundschaftete aus, wo wir zu Gast waren, und handelte dort ganz unpassend – keiner würde es für möglich halten, der seine Verrücktheit nicht kennt! Er ließ mich nämlich dort herausrufen, und sobald ich herauskam, begann er auf mich einzuschlagen.«
240
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
weder die Gesetze der Polis noch die Gebote der Ehre, die ihn zu einem Handeln anhalten, das nicht in Relation zu jenem seines Gegenübers steht.126 Letzterer spricht zum ersten Mal in der gesamten Rede überhaupt von seinem eigenen Verhalten, das er aber als rein defensiv beschreibt. Als er die Offensive des Simon abwehrt, steigert dieser die Aggression, indem er den Sprecher mit Steinen bewirft.127 Zu wessen Gunsten sich der Kampf entscheidet, wird von dem Sprecher nicht erwähnt. Seine mittelfristige Reaktion auf die nächtliche Auseinandersetzung besteht darin, dass er – mit Theodotos – die Stadt verlässt, in der Hoffnung, Simon werde die Sache in der Zwischenzeit vergessen.128 Die latente Haltung des Sprechers, sich nicht auf eine offene Auseinandersetzung einzulassen, konkretisiert sich nach mehrmaligen Attacken des Simon in einem räumlichen Rückzug. Der Sprecher verweigert sich damit dem ehrenhaften reziproken Handlungsmuster und überlässt es ganz Simon, den Streit auf die Straße auszuweiten, seine Freunde zu involvieren, und vom Nahkampf zu Steinwürfen überzugehen. Als ein Ehrenmann erscheint Simon dennoch nicht; ihm fehlt der Widerstand seines Gegners, so dass seine Angriffe, die der Sprecher gezielt beziehungslos berichtet, deplaziert und planlos wirken. Der Redner reagiert darauf – nach seinen Aussagen – nicht aktiv, sondern zieht sich zurück. Seine Erklärung dieses Verhaltens steht in auffälligem Kontrast zu den – von ihm unterstellten – Motiven Simons und ist in seiner Glaubwürdigkeit umstritten. Dass der Sprecher für einen kurzen Zeitraum die Stadt verlassen hat, wird er nicht leugnen können, da sowohl Simon wie auch er selbst Zeugen bestellen. Seine Gründe aber, Athen zu verlassen, passt er der vermuteten Meinung seiner Zuhörer an. Wie er mehrmals in seiner Rede betont, schämt er sich, in seinem Alter noch um einen Knaben zu rivalisieren und fürchtet die Reaktionen seiner Mitbürger: ™Gë TO…NUN, ð BOUL», ¹GOÚμENOJ μÒN DEIN¦ P£SCEIN, A„SCUNÒμENOJ Dš, ÓPER ½DH KAˆ PRÒTERON EÍPON, TÍ SUμFOR´, ºNEICÒμHN, KAˆ μ©LLON ÅROÚμHN μ¾ LABE‹N TOÚTWN TîN ¡μARTHμ£TWN D…KHN À DÒXAI TO‹J POL…TAIJ ¢NÒHTOJ EÍNAI, E„DëJ ÓTI TÍ μÒN TOÚTOU PONHR…v PRšPONTA œSTAI T¦ PEPRAGμšNA, ™μOà DÒ POLLOˆ KATAGEL£SONTAI TOIAàTA P£SCONTOJ TîN FQONE‹N
126 Vgl. Carey, Lysias, 97, der zu dem Begriff μAN…AN erklärt: it »does not excuse but condemn; it describes irrational, abnormal and incomprehensible behaviour here rather than clinical madness«. 127 Lys. 3, 8: ™PEID¾ DÒ AÙTÕN ºμUN£μHN, ™KST¦J œBALLš μE L…QOIJ. »Da ich ihn abwehrte, zog er sich aus meiner Reichweite zurück und bewarf mich mit Steinen.« 128 Ebd., 9-11.
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
241
E„QISμšNWN, ™£N TIJ ™N TÍ PÒLEI PROQUμÁTAI CRHSTÕJ EÍNAI.129 Dieser Beweggrund für das Verlassen der Stadt kann mehrfach gedeutet werden: Man kann dem Sprecher seine erklärte Absicht, mit dieser Affäre kein öffentliches Aufsehen erregen und sich dem Spott der Mitbürger nicht aussetzen zu wollen, glauben.130 Man kann ihm auch grundsätzlich misstrauisch begegnen und jeden seiner Sätze auf etwaige Hintergedanken abklopfen.131 Denn immerhin steht dieser so friedliebende Sprecher wegen Körperverletzung vor Gericht. Eingebettet in eine Prämisse über den gesamtgesellschaftlichen Hintergrund kann sein Rückzug sowohl das Vorhandensein als auch das Nichtvorhandensein habitueller Formen in der athenischen Gesellschaft bedeuten. Herman begreift die Rede als ein typisches Exempel für die Friedfertigkeit der Athener im Allgemeinen und für ihre Verweigerung der Rache im Falle eines Konflikts. Die Erwartung einer Vergeltung auf gleicher Ebene oder mit größerer Härte wird enttäuscht, der Sprecher nimmt die Herausforderung nicht an und präsentiert sich stattdessen als ein Mann, dem seine Ehre nicht wichtig ist.132 Cohen dagegen interpretiert dieselbe Aussage vollkommen gegenteilig, sie bezeugt ihm »the agonistic nature of social life at Athens«.133 Cohen argumentiert nicht mit der Norm des erwarteten Verhaltens, sondern mit der Sorge des Protagonisten um seinen guten Ruf, seine Ehre, die er zu schützen sucht vor einigen potentiell feindlichen und neidischen Mitbürgern, die sich gern auf seine Kosten profilieren, indem sie sich über seine von Simon verursachten Niederlagen lustig machen und die 129 Ebd., 9: »Ich glaubte freilich, ihr Herren, dass mir bitteres Unrecht geschehen war, schämte mich aber, wie ich eben schon sagte, über mein Missgeschick, und so unternahm ich gar nichts und wollte lieber auf die Bestrafung dieser Vergehen verzichten als vor meinen Mitbürgern so unvernünftig dastehen. Wenn ich auch wußte, dass seine Taten seiner Schlechtigkeit entsprachen, so wußte ich auch, dass über mich, der solches auszuhalten hatte, viele aus der Schar derer spotten würden, die jedem neidisch sind, wenn er sich bemüht, ein guter Staatsbürger zu sein.« Vgl. ebd., 4. 30. 130 Blass, Beredsamkeit I, 581: »Darum ist es das Hauptbestreben dieses Sprechers ..., den Vorwurf einer unsinnigen Leidenschaft von sich abzuwehren: wenn er eine Leidenschaft nicht leugnen kann, so empfand er doch diese selbst als seiner unwürdig, und nahm sich in Acht, Aergerniss zu geben.« Diese Einschätzung erhält zusätzliches Gewicht durch die Tatsache, dass Blass die Angelegenheit weit vor der sexuellen Revolution 1968 beurteilt. 131 Carey, Lysias, 98, glaubt dem Sprecher zunächst einmal nichts: »The claim is somewhat suspicious, expecially when we learn that the speaker took the boy along. Possibly the speaker simply went abroad on a trading venture, and used this opportunity to strenghten his hold on the boy’s affections.« 132 Herman, Honour, 47, folgert aus den Worten des Sprechers Gegen Simon eine gänzlich andere Verhaltenserwartung: »The victim of aggression in ancient Athens was not supposed to retaliate but to forbear; he was expected to exercise self-restraint, to reconsider or re-negotiate the case, and to compromise – lest he fall short of the ideal standards of civic behaviour.« Vgl. ders., Society, 107; ders., Reciprocity, 213. 133 Cohen, Law, 133.
242
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Angriffe gegen seine Ehre in ein besseres Licht rücken. All dies seien Kennzeichen einer ehrenhaften, agonistischen und kompetitiven Gesellschaft.134 Nicht nur die Zeitgenossen verführt der große Interpretationsspielraum für ehrenhaftes Verhalten zu kühnen Konstruktionen, die dennoch nicht beliebig sind. Auch Cohen kann nicht leugnen, dass das Verhalten des Redners nicht ehrenhaft ist und sein Rückzug den Spott seiner Mitbürger kaum verhindern wird.135 Der Sprecher gibt an dieser Stelle zu, seine Ehre nicht verteidigt zu haben, ein Faktum, das zwar nicht gegen eine ehrenhafte Gesellschaft spricht, die Aussage als ein öffentliches Eingeständnis normenwidrigen Verhaltens aber problematisch macht. Auf der anderen Seite konzentriert sich Herman bei der Besprechung der Rede Gegen Simon lediglich auf diese eine Stelle, die ihm zum Beleg seiner These dienlicher erscheint als die übrigen Handlungen des Sprechers, die durchaus nicht so friedfertig sind.136 Beide Interpretationen der Quelle zeigen, dass der Text mitnichten konsistent an einen bestimmten Wertekanon appelliert. Gerade die Brüche in der Argumentation erschweren eine kategoriale Einordnung des Sprechers in die Gemeinschaft der gesetzestreuen Polisbürger, die Herman vornehmen möchte, oder in die Gesellschaft der ehrenhaften Männer der Polis, denen der Sprecher Cohen zufolge angehört. Mithilfe der hier vertretenen Vorstellung eines rivalisierenden Nebeneinanders der Loyalität zur Polis und der Loyalität zur Ehre bleiben die Ungereimtheiten in der Rede Gegen Simon weiterhin bestehen. Sie schließen sich auf der Ebene der Analyse nicht aus, weil sie auch für die Athener keine unvereinbaren Widersprüche bildeten. Den Redner immerhin scheinen sie nicht soweit zu stören, dass er meinte, sie übergehen oder marginalisieren zu müssen.137 Offensichtlich konnte er sie den Zuhörern, deren Urteil auf seiner Glaubwürdigkeit basierte, zumuten. Das Zwielicht, in dem jede Äußerung der Redner aus der Perspektive eines Ehrenmannes oder eines Po134 Ebd.: »That is, because he has fared well in competiton for civic status, some men will envy him his success and welcome an opportunity to revel in his humiliation.« 135 Ebd.: »a man who suffered certain kinds of insults might expect to be laughed at and mocked for his unrequited humiliation. ... The speaker’s subsequent actions are no less likely to arouse ridicule, though he portrays them as evidence of his moderation and avoidance of violence.« 136 Vgl. Herman, Honour, 46: »The story is a complex one, involving incidents and digressions which I will leave out. It will suffice for my immediate purposes to isolate some of the insults and injuries which Simon had allegedly inflicted upon the defendant, and to contrast them with his own response.« 137 Vgl. Cohen, Law, 131: »the trial ... was viewed by both parties as a test, as it were, of relative social strength at a particular moment rather than a simple determination of whether or not a dangerous act of violence had taken place.« Auch im Hinblick auf die Stärke sozialer Normen bedeutet die Rede eine Probe des präsentierbaren Verhaltens, das sich sowohl an den vorausgesetzten Erwartungen der Hörer orientiert als auch neue Normen setzt.
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
243
lisbürgers steht, ergibt sich aus den konkurrierenden Loyalitäten, denen sich die Athener verpflichtet fühlten. Es zeugt von einer reibungsvollen Dissonanz verschiedener handlungsleitender Wertesysteme. Die Athener, die diesen Ungereimtheiten ausgesetzt waren, spiegeln sie in ihren Reden und Aussagen. So kann der Sprecher durchaus betonen, dass es ihm ungleich Simon daran gelegen war, die Angelegenheit um den plataiischen Knaben nicht weiter eskalieren zu lassen, auch wenn das seine Ehre in eine fragwürdiges Licht rückt. Denn auf der anderen Seite stehen die Gesetze der Polis, und der Wunsch der athenischen Zuhörer, die Gesetze als handlungsleitende Normen beachtet zu sehen, ist ebenso stark wie ihre feste Vorstellung vom normgerechten ehrenhaften Handeln eines Mannes. Trotz aller friedfertigen Absicht gelingt es dem Sprecher nicht, durch seinen Rückzug den Streit zu beenden. Über die Umstände, die das verhindern, sagt er nichts, aber einige Zeit später befindet er sich mit dem Knaben wieder in der Stadt und just direkt bei Simons Haus. Warum der Sprecher den Knaben in der unmittelbaren Nachbarschaft Simons untergebracht hat und wieso er des Abends mit ihm dort spazierengeht, wird aus seinen Worten nicht klar.138 Er betont lediglich, dass Simon auf eine Gelegenheit zum Kampf lauert und übergeht seine eigene Involviertheit. Aus gutem Grund: wie nachfolgend in der Rede deutlich wird, wirft Simon dem Sprecher vor, ihn in eben dieser Situation die zur Verhandlung stehende Wunde zugefügt zu haben. Fassbar werden die Anklagen durch die dementierenden Sätze des Redners: &HSˆ D' ™Pˆ TA‹J AØTOà QÚRAIJ ØP' ™μOà DEINîJ DIATEQÁNAI TUPTÒμENOJ. ... ,šGEI D' æJ ¹μE‹J ½LQOμEN ™Pˆ T¾N O„K…AN T¾N TOÚTOU ÔSTRAKON œCONTEJ, KAˆ æJ ºPE…LOUN AÙTù ™Gë ¢POKTENE‹N, KAˆ æJ TOàTÒ ™STIN ¹ PRÒNOIA.139 Es handelt sich bei der Darstellung der folgenden Auseinandersetzung also um den entscheidenden Kampf. Er ist zugleich der Höhepunkt der agonalen Auseinandersetzung beider Männer und der Grund der Klage. Der Kampf findet auf der Straße vor dem Haus des Simon statt und wird später in der Werkstatt eines Walkers bzw. vor ihr auf der Straße fortgesetzt. Nach Simons Aussage hat der Sprecher die gewalttätige Eskalation provoziert und ihn verwundet, nach Aussage des Sprechers war es beide Male Simon, der den Knaben und auch ihn verfolgte und zur Verteidigung nötigte. Die Szenerie vor Simons Haus schildert der Sprecher relativ kurz: Als Simon und seine Freunde ihn mit dem Knaben auf der Straße vorbeige138 Lys. 3, 11. Carey, Lysias, 91, deutet die Gründe des Sprechers als weiteren Akt im Kampf der Ehrenmänner: »An alternative explanation of his presence in the vicinity of Simon’s house is that the speaker was deliberately parading his success with the boy in order to humiliate Simon.« 139 Ebd., 27-28: »Er sagt, er sei vor der Tür seines Hauses von mir halbtot geschlagen worden. ... Er stellt fest, ich sei mit Tonscherben in der Hand zu seinem Haus gekommen und ich hätte ihm gedroht, ihn umzubringen: das bedeute also ›Mit Vorsatz‹.«
244
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
hen sehen, stürzen sie sich auf Theodotos und versuchen, ihn von der Seite des Sprechers in das Haus Simons zu zerren. Dem Knaben gelingt es, sich loszureißen und zu fliehen, der Sprecher folgt seinem Beispiel, schlägt allerdings eine andere Richtung ein. Zu einer Schägerei, bei der jemand verletzt worden sein könnte, ist es nach Darstellung des Redners gar nicht gekommen.140 Der zweite Teil des Zusammenstoßes verläuft wesentlich dynamischer, und hier kann selbst der Sprecher nicht leugnen, dass das Handgemenge in eine Schlägerei auf der Straße ausartete, die schließlich immer weitere Kreise zog. Theodotos hatte sich in die Werkstatt eines Walkers geflüchtet, wohin ihn Simon und seine Freunde verfolgten. Sie zerrten ihn hinaus auf die Straße, wo der Knabe um Hilfe und Zeugen für seine Notlage rief. Nach Aussage des Sprechers liefen viele Menschen zusammen, die gegen das gewaltsame Vorgehen Simons protestierten. Der Walker Molon und einige andere versuchten, für den Knaben Partei zu ergreifen und wurden von Simon und seinen Helfern niedergeschlagen.141 Bis hierher sind die Ereignisse gediehen, als endlich wieder der Sprecher auf dem Plan erscheint. Eher beiläufig – so stellt er es dar – mischt er sich in die Angelegenheiten des Knaben ein: ½DH DÒ AÙTO‹J OâSI PAR¦ T¾N ,£μPWNOJ O„K…AN ™Gë μÒNOJ BAD…ZWN ™NTUGC£NW, DEINÕN DÒ ¹GHS£μENOJ EÍNAI KAˆ A„SCRÕN PERIIDE‹N OÛTWJ ¢NÒμWJ KAˆ BIA…WJ ØBRISQšNTA TÕN NEAN…SKON, ™PILAμB£NOμAI AÙTOà. OáTOI Dš, DI' Ó TI μÒN TOIAàTA PARENÒμENOUN E„J ™KE‹NON, OÙK ºQšLHSAN E„PE‹N ™RWTHQšNTEJ, ¢FšμENOI DÒ TOà NEAN…SKOU œTUPTON ™μš.142 Seine zurückgenommenen Handlungen wirken in dieser Situation zu harmlos, um glaubhaft zu sein. Selbst Fremde engagieren sich vehementer in der Verteidigung des Knaben als er, der lediglich defensiv und verbal agiert. Augenscheinlich verfolgt der Autor der Rede Gegen Simon die Strategie der antithetischen Charakterisierung des Angeklagten und des Anklägers, wozu auch ihre Handlungsweisen gehören. Simon wird ganz als der leicht zu provozierende Ehrenmann dargestellt, der Sprecher hingegen als ein 140 Ebd. 12-13. Der Sprecher beschließt den Vorfall mit folgenden Worten: K¢NTAàQA μšN, †NA FHSˆ 3…μWN T¾N μ£CHN GENšSQAI, OÜTE TOÚTWN OÜTE ¹μîN OÙDEˆJ OÜTE KATE£GH T¾N KEFAL¾N OÜTE ¥LLO KAKÕN OÙDÒN œLABEN, æJ ™Gë TOÝJ PARAGENOμšNOUJ Øμ‹N PARšXOμAI μ£RTURAJ. Ebd. 14. »Und dort, wo nach Simons Aussage die Schlacht getobt hat, ist keinem der Schädel eingeschlagen worden, weder von seinen Leuten noch von uns. Dafür lasse ich jetzt Zeugen auftreten, die damals anwesend waren.« 141 Ebd., 15-16. 142 Ebd., 17: »Sie waren schon bei Lampons Haus, da stieß ich auf sie – ich ging allein –, und da ich es für eine große Schande hielt, darüber hinwegzusehen, wenn so gegen das Gesetz gewalttätig mit dem Knaben verfahren würde, hielt ich ihn fest. Diese wollten auf meine Fragen, weshalb sie so gesetzwidrig mit ihm umgingen, gar nicht antworten, sondern ließen ihn los und begannen, auf mich einzuschlagen.«
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
245
Mann, der zwar um seine Ehre bemüht ist, dem die Gesetze der Polis im Zweifelsfalle aber wichtiger erscheinen und der jegliches öffentliche Aufsehen vermeiden will. Dass es sich bei der Zeichnung dieser Charaktere lediglich um grobe Skizzen handelt, wird durch eine wahrscheinliche Rekonstruktion der in der Rede geschilderten Ereignisse deutlich. Die beiden Protagonisten handeln manchmal ohne Bezug zueinander, weil der Redner die eigenen offensiven Akte verschweigt und Simon durchgehend als den Aggressor darstellen will. Selbst Lysias meistert es nicht, einen glatten Ablauf der Ereignisse für den Sprecher der Rede herzustellen. Es bleiben viele Punkte ungeklärt, einige Zeiten und Orte nicht genannt und vor allem: viele Beweggründe fingiert, erfunden oder vorgeschoben. Die Schilderung der Vorgeschichte des eigentlichen Kampfes, der den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Simon und dem Sprecher bildet, ist paradigmatisch für diese Strategie der Darstellung des Geschehenen. Das Verhalten des Sprechers, der angeblich zufällig des Weges kommt, ist kaum glaubhaft, da er sich einerseits als unbeteiligt geriert, andererseits sofort von Simon und seinen Freunden angegriffen wird. Die Reaktion der letzteren wiederum erscheint unmäßig, falls der Sprecher sie zuvor nicht provoziert hatte und zudem allein erscheint. Der Kampf, der aus dem Aufeinandertreffen beider Parteien resultiert, ist öffentlich ausgetragen worden und hat Zeugen. Der Sprecher kann sein Mitwirken daran nicht leugnen, ebenso wenig wie die Verwundung, die Simon davongetragen hat. So hüllt er das Ereignis in den undurchsichtigen Nebel der Turbulenz: μ£CHJ DÒ GENOμšNHJ, ð BOUL», KAˆ TOà μEIRAK…OU B£LLONTOJ AÙTOÝJ KAˆ PERˆ TOà SèμATOJ ¢μUNOμšNOU KAˆ TOÚTWN ¹μ©J BALLÒNTWN, œTI DÒ TUPTÒNTWN AÙTÕN ØPÕ TÁJ μšQHJ, KAˆ ™μOà ¢μUNOμšNOU, KAˆ TîN PARAGENOμšNWN æJ ¢DIKOUμšNOIJ ¹μ‹N ¡P£NTWN ™PIKOUROÚNTWN, ™N TOÚTJ Tù QORÚBJ SUNTRIBÒμEQA T¦J KEFAL¦J ¤PANTEJ.143 Das entscheidende Wort, neben der Betonung darauf, dass der Sprecher sich zu jedem Zeitpunkt nur verteidigt habe, ist hier QÒRUBOJ: der Kampf hinterlässt den Eindruck von Getümmel und Verwirrung. Alles ging so schnell, dass eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse unmöglich ist, und wie Simon zu seiner Wunde kam, kann keiner genau wissen.144 143 Ebd., 18: »Da gab es einen Kampf, ihr Herren, der Knabe warf sie mit Steinen, um sich zu verteidigen, sie warfen nach uns, und in ihrer Trunkenheit schlugen sie sogar ihn, und ich wehrte mich, Passanten mischten sich ein, um uns zu helfen, weil wir die Angegriffenen waren: in diesem Durcheinander zerschlugen wir uns alle die Köpfe.« 144 Vgl. Carey, Lysias, 100: »The effect is to create a breathless list of people and actions, all occurring simultaneously, to represent vividly the confused mêlée and prepare for the conclusion, SUNETRIBÒμEQA T¦J KEFAL¦J ¤PANTEJ. This is the speaker’s only reply to Simon’s claim that the speaker split his head open. All present were similarly hurt ..., and ... with so much happening
246
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Gerade weil sich der Sprecher als ein zurückhaltender Bürger stilisiert, dem jedes Aufsehen oder gewalttätige Gebaren fremd ist, fällt seine Involviertheit in Auseinandersetzungen, die nach einem sehr agonalen, typisch ehrenhaften Muster ablaufen, umso mehr auf. Die tätliche Auseinandersetzung um den Knaben wird in verschiedenen Stadien der Eskalation und Ausweitung des Konflikts geschildert. Simon fällt in dieser Rede der Part des agonalen Ehrenmannes zu, er tritt von vornherein gemeinsam mit seinen Freunden gegen seinen Widersacher an. Ob der Sprecher tatsächlich allein mit dem Knaben gegen ihn steht, wie er behauptet, ist nicht zu entscheiden, offensichtlich schlagen sich auch andere Personen für den Knaben. Aber auch unabhängig davon verhält sich der Redner entsprechend der Norm der reziproken Erwiderung: er lässt nicht von Simon ab und wird natürlich nicht so zufällig, wie er behauptet, immer wieder in Streitereien hineingezogen. Der Akt des Kampfes entwickelt sich nach der Logik der beständigen Expansion eines Streits unter Ehrenmännern: Dem Kampftypus nach entwickelt er sich von einem ungeordneten Handgemenge zu einem regelrechten Nahkampf der Kontrahenten, die sich schließlich wirksamer Waffen (in diesem Fall Steinen) bedienen. Räumlich verlagert sich der Kampf, der zuerst in oder direkt bei Simons Haus und danach im Haus des Walkers beginnt, auf die Straße. Personell stellen die Freunde des Simon schon eine Ausweitung der Feindschaft auf eine größere Personengruppe dar, zu ihr gesellen sich im Laufe der Auseinandersetzung Passanten, die herbeigerufen werden und Partei ergreifen, ein Walker, der dem Flüchtling Theodotos Schutz bietet und einige engagierte Männer, die dem Knaben beistehen. Die Merkmale einer ehrenhaften Auseinandersetzung unter athenischen Männern lassen sich in dieser Rede gut identifizieren. Obwohl der Redner sich alle Mühe gibt, die ehrenhaften Verhaltensweisen auf die Person seines Kontrahenten Simon zu verlagern, kann er seine eigene tatkräftige Beteiligung an einem typisch ehrenhaften Konfliktverlauf kaum verhehlen. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Athenern zeigt verschiedene Stationen der Eskalation des Konflikts. Sie sind geprägt von der reziproken, kompetitiven Aggression beider Seiten, die mit einer jeweils heftigeren Attacke auf die Herausforderung ihres Gegenübers reagieren. Die Austragung des Kampfes auf mehreren Schauplätzen und die Ausweitung auf weitere Personengruppen garantieren den Kontrahenten die notwendige Öffentlichkeit, die einen Streit um die Ehre erst wirksam werden lässt. Die vierte Rede des Lysias verteidigt ebenfalls einen namentlich nicht genannten Sprecher gegen einen unbekannten Ankläger in der Sache eines it would be difficult to find the perpetrator of any particular injury. The evasive nature of the reply ... suggests that there is some truth in the claim that the speaker split Simon’s head open.«
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
247
TRAàμA ™K PRONO…AJ vor dem Areopag.145 Da nur ein Stück der Rede erhalten ist, ist eine umfassende Rekonstruktion der Ereignisse illusorisch. Durch den erhaltenen, vorwiegend schlussfolgernden Teil der Rede aber wird klar, dass es sich um einen ähnlich gelagerten Fall handelt wie jener Gegen Simon.146 Darauf weist zum einen die gleiche Klageform, zum anderen das ganz ähnliche Handlungsmuster der Auseinandersetzung hin, das in dem erhaltenen Ausschnitt deutlich wird. Es handelt sich bei dem zurückliegenden Konflikt offenbar um einen ehrenhaften; das legen der soziale Raum des Symposions und der Gegenstand des Streits, eine Hetäre, nahe, die hier eine ähnliche Rolle für die männliche Ehre der Beteiligten spielt wie der Knabe Theodotos in der dritten Rede des Lysias. Der Streit zwischen Ankläger und Verteidiger ging um eine Hetäre, auf die beide Männer Anspruch erhoben. Beide scheinen eine längere gemeinsame Vorgeschichte des Rivalisierens hinter sich zu haben, die schließlich in eine ¢NT…DOSIJ mündete. Es gelang gemeinsamen Freunden, zwischen ihnen zu vermitteln, und der bereits eingeleitete Vermögenstausch wurde rückgängig gemacht. Die Wiederherstellung des Status quo galt auch für die Hetäre, die nach Aussage des Sprechers ursprünglich von beiden gemeinsam gekauft worden war: FANERîJ DÒ PERˆ P£NTWN DIALELUμšNON ¢RNE‹SQAI T¦ PERˆ TÁJ ¢NQRèPOU, μ¾ KOINÍ ¹μ©J CRÁSQAI SUGCWRÁSAI.147 Im Verlauf der Auseinandersetzung kommt es zu ganz ähnlichen Zusammenstößen beider Männer, wie sie auch in der Rede Gegen Simon die Hauptpunkte der Klage bildeten und offenbar zum üblichen Repertoire der gegenseitigen Feindseligkeiten zwischen Ehrenmännern gehören. Schauplatz der Auseinandersetzung, um die sich die Rede dreht, ist ein Symposion des Klägers, bei dem sich zwischen den beiden Männern eine Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf der Kläger verletzt wird. Wieder geht es um die Unantastbarkeit des Oikos als autonomer Handlungssphäre eines Mannes. Vor dem Hintergrund der Behauptung, er sei mit dem Kläger nicht mehr verfeindet gewesen, beteuert der Sprecher, er habe eine Einladung zum Symposion ins Haus des Klägers erhalten. Die Version seines Gegners offenbart sich in dem, was der Sprecher dementiert: OÙKOàN ÃLQON AÙTÕJ 145 Zwar handelte es sich beim Areopag um einen Gerichtshof, der nicht mit ausgelosten Geschworenen besetzt war, aber »the sociopolitical conditions of speeches delivered before the Areopagus would probably not have been radically different than in other Athenian courts«, vgl. Ober, Mass, 141; vgl. zum Besetzungsmodus des Areopags C. Schubert, Der Areopag. Ein Gerichtshof zwischen Politik und Recht, in: Burckhardt und von Ungern-Sternberg, Prozesse, 50-65, 53. 146 Vgl. Blass, Beredsamkeit I, 583. 147 Lys. 4, 1: »Was er jedenfalls leugnet, obwohl wir alles vertraglich festgelegt haben, ist, was wir über das Mädchen vereinbart hatten, nämlich dass sie uns gemeinsam gehören sollte.« (Übersetzung U. Treu). Vgl. ebd., 16.
248
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
AÙTÕN ¢POKTENîN, æJ OáTÒJ FHSI, KAˆ B…v E„J T¾N O„K…AN E„SÁLQON. ... FA…NETAI TO…NUN OÙD' AÙTÕJ A„TIèμENOJ TOIOàTÒN TI œCONTAJ ¹μ©J ™LQE‹N, ¢LL' ÑSTR£KJ FHSˆ PLHGÁNAI.148 Das Ergebnis des Kampfes ist eine Blessur, die dem Kläger vom Angeklagten zugefügt wird, nach Worten des letzteren allerdings geringerer Art: Ð D' E„J TOàTO BARUDAIμON…AJ ¼KEI, éSTE OÙK A„SCÚNETAI TRAÚμAT' ÑNOμ£ZWN T¦ ØPèPIA KAˆ ™N KL…NV PERIFERÒμENOJ.149 Obwohl der genaue Hergang des Geschehens nicht mehr geklärt werden kann, bietet der überlieferte Teil der Rede doch einen aussagekräftigen Ausschnitt des Streites. Den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen den Männern und zugleich den Klagegrund bildet die tätliche Auseinandersetzung im Hause des Klägers, der als verletzter Unterlegener aus dem Kampf hervorgeht. Einige Merkmale weisen auf einen ehrenhaft ausgetragenen Konflikt hin, der teilweise Elemente der Rache enthält. Der Ort des Geschehens ist ein sensibles Territorium, das vom Besitzer des Oikos dominiert werden sollte. Das Eindringen des Sprechers in diesen Bereich stellt an sich schon eine Probe der Unerschütterlichkeit der Ehre eines Mannes dar.150 Deshalb ist die Klärung der Fragen, ob beide Athener verfeindet oder befreundet waren und ob der Angeklagte eingeladen war oder nicht, von großer Bedeutung. Das engere soziale Umfeld des Kampfes ist vermutlich ein Symposion, eine typische Vergesellschaftungsform ehrenhafter Männer, bei der es leicht zu agonalen Zwistigkeiten kommen konnte.151 Dass es sich nicht um einen spontan entbrannten Streit zwischen dem Kläger und dem Angeklagten bei dieser Gelegenheit handelte, machen die Aspekte deutlich, für die beide Redner jeweils eine eigene Erklärung anbieten. Der Sprecher bekundet sein Bedauern darüber, dass die Hetäre nicht befragt werden kann, da der Kläger es ablehnt, sie foltern zu lassen: § μÒN G¦R ™KE‹NOI ÉDESAN, ™LQÒNTAJ ¹μ©J æJ TOàTON, KAˆ ¹μE‹J ÐμOLOGOàμEN: E„ DÒ μETAPEμFQšNTEJ À μ», KAˆ PÒTERON PRÒTEROJ ™PL»GHN À ™P£TAXA, ™KE…NH μ©LLON ¨N ÉDEI.152 Die entscheidenden Fragen 148 Ebd. 5-6: »Also kam ich, ihn umzubringen, wie er sagt, und erzwang mir den Zutritt zu seinem Haus. ... Aber nicht einmal er selbst beschuldigt mich, dass ich mit einer Waffe zu ihm gekommen bin. Er sagt nur, ich hätte ihn mit einer Tonscherbe geschlagen.« 149 Ebd., 9: »der aber ist so von allen guten Geistern verlassen, dass er ohne Scham ein blaues Auge eine ›Wunde‹ nennt, sich auf der Bahre herumtragen lässt«. 150 Campbell, Honour, 292: »The hut or house is inviolable. No stranger may invade it without an invitation. Similarly, whatever takes place within the sanctuary of its walls is private and sacred to the members of the family.« 151 Nach Cohen, Law, 135-137, ist dies das zentrale Argument des Verteidigers, 137: »the judges should regard such bruises as a normal part of such rivalries over prostitutes, matters which do not merit the attention of the Areopagus.« 152 Ebd., 15: »Was diese [die Haussklaven, C.B.] nämlich wissen, dass ich zu seinem Haus gekommen bin, das habe ich ja schon zugegeben. Ob er mich hat rufen lassen oder nicht und ob er zuerst geschlagen hat oder ich, das weiß das Mädchen wohl genauer.«
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
249
dabei sind, ob er eingeladen oder als Eindringling zu Simons Haus kam und wer von beiden die Schlägerei begann. Weil der Kläger auf TRAàμA ™K PRONO…AJ plädiert, argumentiert er, dass der Sprecher ungeladen in sein Haus kam mit der Absicht, ihn dort zu verwunden. Diesen Vorwurf scheint der Angeklagte gänzlich abbügeln zu wollen, indem er behauptet, eingeladen worden zu sein, und andeutet, sich lediglich gegen den Kläger verteidigt zu haben.153 Tatsächlich aber spricht die hohe Wertschätzung des Gastrechts durch die Athener gegen die Version, der Kläger habe den Sprecher in sein Haus geladen und dann den ersten Schlag ausgeteilt. Zwar hätte der Sprecher als Gast im Hause des Klägers tätlich werden können, dagegen steht aber die Überlegung, dass der Kläger sicherlich zwischen Freund und Feind unterscheiden konnte und letzteren nicht in seinen Oikos bitten würde. Geht man davon aus, dass der Angeklagte wirklich ungeladen in das Haus des Klägers kam, wird die Sache plausibler. Die Version des Klägers, nach der der Sprecher ungebeten kam und ihn attackierte, ist nicht unwahrscheinlich, es bleibt allerdings erklärungsbedürftig, warum der Herr des Hauses den Eindringling nicht sofort gemeinsam mit seinen Freunden wieder hinauswarf. Nach der Logik der größeren Wahrscheinlichkeit resultiert die entstandene Auseinandersetzung aus dem wechselseitig reagierenden Verhalten beider Parteien. So spricht einiges dafür, dass der Sprecher in den Oikos des Klägers kam, um ihn zu provozieren. Der Kläger nahm die Herausforderung an und versuchte, ihn gewaltsam hinauszuwerfen. Bei dem sich so entwickelnden Handgemenge trug der Kläger eine vorzeigbare Wunde davon, die ihm Gelegenheit zur Klage gab. Eine solche Deutung der Ereignisse entspricht dem Idealtypus einer ehrenhaften Konfliktführung, bei der beide Männer versuchen, mit ihren wechselseitigen Akten der Rache einander zu übertreffen. Der in seiner Ehre verletzte Kläger, dessen Autonomie durch das Eindringen eines Feindes in seinen Oikos in Frage gestellt ist, vergilt diesen Affront durch einen tätlichen Angriff. Die Anwesenheit einer interessierten Schar von Gästen garantierte beiden eine aufmerksame Öffentlichkeit. Nachdem die ehrenhafte Auseinandersetzung den Kläger mit einer klaren Niederlage in seinem eigenen Oikos zurücklässt, beschließt dieser, die Sache auf anderer Ebene zu klären und geht vor Gericht. Da diverse, von ihm inszenierte Racheakte und tätliche Angriffe ihm keine Genugtuung verschaffen konnten, wendet der Kläger sich an ein athenisches Gericht, das ihm sein Recht auf Unverletzlichkeit der Person und des Oikos bestätigen 153 Ebd., 8: EÍTA ØPÕ TÁJ ¢NQRèPOU PARWXUμμšNOJ ÑXÚCEIR L…AN KAˆ P£ROINÒJ ™STIN, ¢N£GKH DÒ ¢μÚNASQAI. »Und dann ist er, entflammt für das Mädchen, allzu schnell zum Schlagen bereit und dem Wein zu gut, da muss man sich doch wehren!«
250
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
soll. Die gewohnte soziale Ordnung wird über das Urteil der Richter, der Verstoß gegen sie sei ein sozial inakzeptabler Vorfall und der Initiator dieser Störung ein gesellschaftlich wenig gelittenes Individuum, bestätigt und für den Kläger wiederhergestellt. Die vierte Rede des Lysias zeigt trotz der Kürze ihrer sicher tradierten Teile einen Streit zwischen zwei Athenern, die sich als Ehrenmänner begreifen. Ihr Agieren im Konflikt miteinander orientiert sich an den Normen der Ehre. Beide Seiten scheuen sich aber nicht, die juristischen Möglichkeiten der Polis in Anspruch zu nehmen, wenn sie sich davon einen größeren Vorteil als in der persönlichen Auseinandersetzung versprechen oder wenn sie sich auf dem Feld der Ehre als der Unterlegene erwiesen haben. Die normative Kraft der athenischen Gerichte wird in dieser Rede sehr deutlich: Der Kläger erwartet eine negative Sanktionierung der Transgression seines Gegners, der die ehrenhafte Auseinandersetzung in den Oikos seines Gegners hineingetragen hat. Auch in diesem Fall ist es an der Polis, dem Streit um Ehre Grenzen zu setzen. Welche Rolle die Drohung mit einem Gerichtsverfahren spielen konnte bzw. wie sich ein schwebendes Verfahren auf den Konflikt zweier Ehrenmänner auswirken konnte, zeigt die 53. Rede des Demosthenes. Der Sprecher der Rede ist Apollodor, der mit Nikostratos und dessen Bruder Arethusios im Zwist liegt. Die Rede ist ein Glied einer langen Kette von Prozessen des Apollodor und behandelt eine Bagatelle, die erst über den gesamten Streit zwischen Nikostratos und Apollodor Bedeutung erlangt. Das Ziel des Sprechers ist der Nachweis, dass die zwei von Apollodor konfiszierten Sklaven dem Arethusios, seinem Schuldner gehörten, und nicht seinem Bruder Nikostratos. Apollodoros nutzt die Gelegenheit, die Geschichte ihrer Feindschaft von Beginn an aufzurollen und im Einzelnen darzulegen, wie sich der Streit zwischen Nikostratos und ihm entwickelte. Im Gegensatz zu den anderen beiden verfeindeten Paaren verband Apollodoros und Nikostratos nicht eine alte Feindschaft, sondern ihre Beziehung gestaltete sich wechselvoller. Sie lebten als Nachbarn auf ihren Landgütern nah beieinander, waren ungefähr im selben Alter und freundeten sich miteinander an, wie Apollodor erklärt: CRÒNOU DÒ PROBA…NONTOJ KAˆ P£NU O„KE…WJ DIEKE…μEQA, KAˆ ™Gè TE OÛTWJ O„KE…WJ DIEKE…μHN PRÕJ TOàTON, éST' OÙDENÕJ PèPOTE ïN ™DE»QH OáTOJ ™μOà ¢PšTUCEN, OáTÒJ TE Aâ ™μOˆ OÙK ¥CRHSTOJ ÃN PRÕJ TÕ ™PIμELHQÁNAI KAˆ DIOIKÁSAI, KAˆ ÐPÒTE ™Gë ¢PODHμO…HN À DHμOS…v TRIHRARCîN À „D…v KAT' ¥LLO TI, KÚRION TîN ™N ¢GRù TOàTON ¡P£NTWN KATšLEIPON.154 Seine 154 Demosth. 53, 4: »Die Zeit verging und wir waren uns sehr freundschaftlich gesinnt, und ich wurde so vertraut mit ihm, dass ich ihm niemals etwas abschlug, wenn er mich darum bat, und auch er war mir sehr nützlich, indem er für alles Sorge trug und es verwaltete. Wenn ich im Diens-
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
251
Beschreibung der Beziehung zwischen ihm und Nikostratos stellt Apollodor an den Beginn seiner Rede, denn sie ist für das Verständnis seines Verhaltens wichtig: Er handelt Nikostratos gegenüber nach dem Grundsatz der positiven Reziprozität und erwartet von seinem Freund, dass er es auch tut. Die Vergeltung gewährter Güter und Gefälligkeiten folgt dem gleichen Mechanismus wie die Rache, bezieht sich aber auf die Freunde eines Ehrenmannes und daher auf einen positiven Austausch. Nicht nur die normative Erwartung ehrenhaften Verhaltens, sondern auch sein besonderes Vertrauen zu Nikostratos unterstützen Apollodors Zuversicht, sein Nachbar sei ihm freundlich gesinnt.155 Die habituelle Form des reziproken Verhaltens wird den Athenern im Gerichtshof vertraut gewesen sein. Es weist Apollodor als einen Mann von Ehre aus und betont sowohl seine guten Absichten wie seine Arglosigkeit dem Nikostratos gegenüber, während letzterer ein nach den Normen der Ehre und nach jenen des guten Zusammenlebens zweifelhafter Charakter zu sein scheint. Doch Apollodor weiß noch nichts von der künftigen, den Hörern bereits evidenten Entzweiung beider Männer. Er handelt, wie jeder Athener es für richtig halten würde, als er von Nikostratos Unglück erfährt. Dieser nämlich war bei der Verfolgung entlaufener Sklaven selbst in Gefangenschaft geraten.156 Apollodor schickt Nikostratos Bruder mit einem Reisegeld von 300 Drachmen auf den Weg, um seinen Freund zurückzuholen.157 Nach seiner Rückkehr erzählt Nikostratos dem Apollodor, was ihm widerfahren ist, dankt ihm für seinen Freundschaftsdienst und bittet ihn um weiteres Geld für seine Auslösung. ¢PEKRIN£μHN AÙTù ÓTI KAˆ ™N Tù œμPROSQEN CRÒNJ E‡HN AÙTù F…LOJ ¢LHQINÒJ, KAˆ NàN ™N TÍ SUμFOR´ BOHQ»SOIμI AÙTù, KAˆ T£J TE TRIAKOS…AJ, §J Tù ¢DELFù AÙTOà œDWKA ™FÒDION ÓTE ™POREÚETO ™Pˆ TOàTON, ¢FIE…HN AÙTù, CIL…AJ TE DRACμ¦J œRANON AÙTù E„J T¦ LÚTRA E„SO…SOIμI.158 Noch einmal erläutert Apollodor seine Gründe dafür, der Bitte seines Nachbarn zu entsprechen und ihm zu helfen, indem er ihm Geld gibt: Nikostratos ist ein Freund von te des Demos als Triearch oder in eigener Angelegenheit in der Ferne war, überließ ich ihm die Entscheidung über alles auf dem Land.« 155 Herman, Reciprocity, 210: »The Nikostratos passage cited above is typical of the entire pattern of ›positive‹ reciprocity in classical Athens. The assumption is always that the gift of goods or the supply of services renders the recipient indebted, from which state he can extricate himself by giving goods and supplying services in return. These ›returns‹ need not be forthcoming at once, and need not be of the same order as the original goods or services, but must, in the long run and allowing for temporary imbalances, be equal in value and mutual in benefit.« 156 Demosth. 53, 6. 157 Ebd., 6-7. 158 Ebd., 8: »Ich antwortete ihm, dass ich ihm in früherer Zeit ein wahrer Freund gewesen sei und ihm nun in diesem Unglück helfen würde und ihm einen Beitrag von 1000 Drachmen für seine Auslösung geben würde, und ich erließ ihm die dreihundert, die ich seinem Bruder als Reisemittel gegeben hatte, um ihn wiederzusehen.«
252
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
ihm und Apollodor handelt habituell nach dem Grundsatz, seinen Freunden stets beizustehen, besonders, wenn sie in Not sind, was Nikostratos zweifelsohne ist. Das demonstriert er Apollodor, indem er ihm seine Wunden zeigt, was er in der Öffentlichkeit des Gerichts – so der Sprecher – aber ungern tun würde. Einerseits spricht diese Aussage für das Vertrauensverhältnis der beiden Männer, denn es ist anzunehmen, dass sich Nikostratos der Beweise für seine Versklavung schämt, andererseits aber werden die Richter möglicherweise darauf vorbereitet, an die Versklavung des Nikostratos zu glauben, auch wenn sie seine Narben als Beleg dafür nicht zu sehen bekommen. Apollodor verpfändet einen Teil seines Familiengoldes und schenkt Nikostratos die versprochenen 1000 Drachmen.159 Wenig später bittet ihn Nikostratos erneut um Geld, weil er mit den Zinsen für seine Schulden in Verzug gerät.160 An dieser Stelle macht Apollodor noch einmal deutlich, dass er in dem guten Glauben handelte, Nikostratos sei sein Freund und die Dinge, die er ihm erzählte, entsprächen der Wahrheit. Ob letzteres der Fall war, bezweifelt der Sprecher im Nachhinein – DOKîN OÙ YEÚDESQAI –, geht darauf aber nicht näher ein.161 Ihm scheint es vor allem darum zu tun zu sein, vor den Geschworenen nicht als ein leichtgläubiger Dummkopf zu stehen, sondern darzulegen, dass er sich entsprechend der Norm der Ehre verhalten hat, die gegenüber einem guten Freund und Nachbarn auch einen Vorschuss an gutem Glauben und Gaben vorsieht, wenn die reziproke Erwiderung nicht sofort erfolgt.162 Wegen seiner bisherigen Freundschaft mit Nikostratos nimmt Apollodor ein Darlehn auf seinen Besitz im Wert von 16 Minen auf, um sie Nikostratos für ein Jahr zinslos zu leihen.163 Obgleich Apollodor beständig beteuert, von welch freundschaftlichen Gefühlen seine Beziehung zu Nikostratos getragen ist, scheint es vor allem das Geld zu sein, das hier ausgetauscht wird. Es ist durchaus möglich, dass die Nachbarn eine Geschäftsbeziehung unterhielten und der Sprecher vor Gericht versucht, die Handlungen gemäß den Normen der Ehre zu schildern.164 159 Ebd., 9: KAˆ TOàTO œDWKA DWRE¦N AÙTù TÕ ¢RGÚRION, KAˆ ÐμOLOGî DEDWKšNAI. »ich gab ihm das Geld als ein Geschenk und es war nach Übereinkunft geschenkt.« 160 Ebd., 10-11. 161 Ebd., 12. 162 Ebd.; vgl. Herman, Reciprocity, 210: Die Norm der Reziprozität »helps to generate between the partners special relationships of trust (such as intimacy, friendship, or even love) whose effect is to introduce a certain laxity into the pattern of indebtedness: the partners may cease, after a while, strictly to reckon the value of the benefits bestowed or received, even allowing uncertainty to creep in as to who is in whose dept.« 163 Demosth. 53, 12-13. 164 So vermutet Christ, Athenian, 177: »Furthermore, when Apollodorus speaks of the friendly gifts and loans he made to his neighbor, one must keep in mind that Apollodorus – when not busy being a good neighbor – was a banker who sought profit through his financial transactions, and this may well be at the roots of his dealings with Nicostratus. That Apollodorus nonetheless
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
253
Sobald Nikostratos das Geld in Händen hält, zeigt er laut Apollodor sein wahres Gesicht und wendet sich feindlich gegen ihn: LABëN DÒ TÕ ¢RGÚRION OÙC ÓPWJ C£RIN TIN£ μOI ¢POD…DWSIN ïN Eâ œPAQEN, ¢LL' EÙQšWJ ™PEBOÚLEUš μOI, †NA ¢POSTER»SEIE TÕ ¢RGÚRION KAˆ E„J œCQRAN KATASTA…H.165 Die bisherige positive Reziprozität zwischen beiden Männern verwandelt sich in eine negative, die den Schaden des Gegners zum Ziel hat. Während Apollodor – nach seiner eigenen Darstellung – zu Zeiten seiner Freundschaft mit Nikostratos derjenige war, der sich der ehrenhaften Norm der Reziprozität besonders verpflichtet fühlte, ist es nun Nikostratos, der sich bemüht, seinem Feind in jeglicher Hinsicht zu schaden, selbst wenn es dem Apollodor nichts Schlechtes zu vergelten gibt. Die Gründe für die plötzliche Wendung des Nikostratos gegen seinen Freund bleiben im Dunkeln, Apollodor belässt es bei dem Hinweis auf die Falschheit seines Nachbarn, dessen betrügerische Absicht ihn das Darlehn nehmen und nicht zurückzahlen ließ. Unmissverständlich wird die nun offene Frontstellung des Nikostratos gegen Apollodor, als er sich mit dessen Prozessgegnern verbündet und ihnen Informationen gibt, die sein früherer Freund ihm anvertraut hatte, um ihnen einen strategischen Vorteil vor Gericht zu verschaffen.166 Auch der schwerste Schlag des Nikostratos gegen Apollodor findet mit Hilfe der Gerichte statt und bildet die prozessuale Vorgeschichte zur stattfindenden Verhandlung: Im Laufe eines Prozesses, den der Müller Lykidas gegen Apollodor führt, bei dem aber Nikostratos als Hintermann fungiert, soll Apollodor vorgeladen werden. Der Bruder des Nikostratos Arethusios und ein Unbekannter verantworten die Zustellung der Vorladung an Apollodor, die dieser aber nicht bekommen hat. Weil er an gegebenem Tag nicht vor Gericht erscheint, wird er in Abwesenheit zur Zahlung von 610 Drachmen an die Polis verurteilt. Nikostratos erreicht damit, dass sein Feind auf die Liste der Staatsschuldner gesetzt wird und somit nicht im vollen Besitz seiner Bürgerrechte ist. Als Konsequenz dieses an sich schon demütigenden Zustandes kann Apollodor seinen übrigen prozessualen Angelegenheiten nicht mehr folgen und muss weitere Einbußen befürchten.167 Als Arethusios translates his suit against Nicostratus into a test case of philia is testimony to his belief that the jurors will be anxious to preserve the social ideals at stake and therefore rule in his favor.« 165 Ebd., 13: »Als er aber das Geld hatte, vergolt er es mir keineswegs mit Dank, was ich für ihn getan hatte, sondern er schmiedete geradezu Pläne gegen mich, um mir mein Geld zu rauben und eine Feindschaft aufzubauen.« 166 Ebd., 14. 167 Ebd. Vgl. A. Schäfer: Demosthenes und seine Zeit, Bd. 4, Leipzig 1858 (ND Hildesheim 1967), 143f: »Die weitere Absicht seiner Gegner gieng, wie Apollodor wissen will, dahin, wenn er die Voruntersuchung in den gegen seine Verwandten anhängig gemachten Processen betriebe, ihn vermittelst einer Anzeige (œNDEIXIJ) zu belangen und wohl gar in Haft zu bringen: denn wer dem Staate schuldig blieb, gieng einstweilen der Ausübung des vollen Bürgerrechts verlustig, durfte
254
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
schließlich noch in den Oikos seines Nachbarn eindringt und als Pfand für dessen Schulden wertvollen Hausrat mitnimmt, beschließt Apollodor, seinerseits per Gericht gegen seine Gegner vorzugehen.168 Apollodor selbst ist im Prozessieren nicht unerfahren und nutzt nun, nach dem Vorbild seiner Widersacher, die athenischen Gerichte als Mittel der Rache. Er strengt gegen Arethusios einen Prozess wegen YEUDOKLHTE…A an. Das Ziel der Rächung über die Mittel der athenischen Gerichte ist eines der Grundthemen der Rede des Apollodor. Denn der Rache an seinen Gegnern dient auch der aktuelle Prozess, der ihm keinen weiteren Nutzen bringen soll als die Schädigung des Arethusios: AÙTù D' ™μOˆ TETIμWRÁSQAI ¢RKE‹ μÒNON.169 Offenbar lässt sich für den Sprecher ein Prozess vor den athenischen Gerichten nahtlos in seine Vorstellung einer angemessenen Vergeltung durch einen Ehrenmann integrieren.170 Eine wichtige Rolle für diese Wahl der Mittel wird auch gespielt haben, dass sich seine Kontrahenten zuerst auf diese Ebene der Auseinandersetzung begeben haben. Dabei sind die Gerichte für Apollodor aber der einzige Ort, an dem er seine Rächung vollzieht. Anders als seine Gegner hat er sich – nach eigenen Angaben – keiner Schlägereien auf der Straße, unbotmäßiger Anmaßung fremden Eigentums oder sonstiger Provokationen schuldig gemacht, wie er sie von Nikostratos und Arethusios so ausführlich berichtet. Die meisten der heftigeren Attacken des Brüderpaars gegen Apollodor scheinen sich während des Prozesses gegen Arethusios wegen der fälschlichen Vorladung abgespielt zu haben. Laut Apollodor kam Arethusios des Nachts abermals auf sein Landgut und verwüstete seine Felder.171 Die nächste Provokation zielte wieder auf die juristische Ebene. Diesmal wird Apollodor zunächst quasi herausgefordert, sich strafbar zu machen: PRÕJ DÒ TOÚTOIJ μEQ' ¹μšRAN PAID£RION ¢STÕN E„SPšμYANTEJ DI¦ TÕ GE…TONEJ EÍNAI KAˆ ÓμORON TÕ CWR…ON, ™KšLEUON T¾N ODWNI¦N BLAST£NOUSAN ™KT…LLEIN, †NA, E„ KATALABëN AÙTÕN ™Gë D»SAIμI À namentlich nicht vor Gericht erscheinen und konnte nur wenn er Bürgen stellte sich von persönlicher Haft befreien.« Vgl. Hansen, Apagoge, 90-94. 168 Demosth. 53, 15. 169 Ebd., 2: »mir selbst genügt es schon, Rache genommen zu haben«. Vgl. ebd., 1: O„ÒμENOJ DE‹N TIμWRE‹SQAI. »Ich war der Meinung, mich rächen zu müssen.« 170 Cohen, Law, 102f., interpretiert die demosthenische Rede als Beleg für seine These, die athenischen Gerichte hätten vornehmlich als Instrumente der Rache gedient. Die Kontrahenten unterscheiden sich vornehmlich durch ihre Motive für ihren Appell an die Gerichte: »The antithesis of sycophancy and revenge appears widely and plays off of the notion that sycophancy involves bringing actions for financial gain where one’s personal interests are not at stake, whereas honor requires a man to seek revenge. ... It is such abuse of legal process that Apollodorus uses to qualify Nicostratus as a sycophant, while portraying himself as legitimately resorting to the courts to obtain protection and revenge for these grievous wrongs.« 171 Demosth. 53, 15.
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
255
KAT£XAIμI æJ DOàLON ÔNTA, GRAF»N μE GR£YAINTO ÛBREWJ.172 Apollodor äußert sich nicht zu seinem eigenen Verhalten, er scheint aber nicht in die aufgestellte Falle getappt zu sein, sondern verfolgt den Prozess gegen Arethusios weiter. Daraufhin lauert Nikostratos dem Sprecher auf seinem Heimweg vom Piräus auf und versucht, ihn in die Steinbrüche zu werfen.173 Apollodor lässt sich auch durch den Mordversuch nicht aus der Reserve locken und gewinnt einige Tage später den Prozess gegen Arethusios. Bei der Festsetzung der Strafe ist er es, der um Milde bittet, woraufhin Arethusios mit der Strafzahlung von einem Talent belangt wird.174 Obwohl Arethusios zu den reichsten Bürgern Athens gehört, zahlt er die Geldstrafe nicht. Sein Bruder Nikostratos und seine Mutter besitzen angeblich das Geld, das zuvor ihm gehörte. Apollodor sieht sich deshalb ermächtigt, zwei Sklaven des Arethusios zu konfiszieren und dem Gericht die wahren Vermögensverhältnisse zu offenbaren.175 Alles das geschieht auf gesetzlicher Grundlage, wie Apollodor nicht zu betonen vergisst.176 Während der ganzen Rede stellt er sein Verhalten als mustergültig den Gesetzen folgend dar und erwähnt ehrenhafte Verhaltensweisen nur, wenn sie der Polis bzw. dem Gemeinwohl zugute kommen. So spricht er von seiner lange von positiver Reziprozität geprägten Freundschaft und dem gut nachbarlichen Verhältnis zu Nikostratos, von seinen Liturgien177 und von seinen Racheplänen, die sich mit legalen juristischen Mitteln der Polis vollziehen lassen. Die Rede des Apollodor spiegelt eine ehrenhafte Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wider, die sich in unterschiedlichem Maße der zur Verfügung stehenden Mittel für ihre Konfliktstrategie bedienen. Nikostratos verkörpert einen athenischen Ehrenmann nach überkommener Vorstellung: er greift seinen Gegner mit diversen Ausfällen an, die sich von der Verbrüderung mit dessen Feinden bis hin zum Mordversuch steigern. Aber er schaltet auch die Gerichte als Hilfsmittel für seine Racheaktionen ein. Da es sich bei Apollodor um einen prozessfreudigen Mitbürger handelt, versucht Nikostratos, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Apollodors erklärtes Ziel ist es, über den Weg der gerichtlichen Auseinandersetzung Rache an seinem Gegner zu üben. Nikostratos lässt sich auf einen Schlagabtausch 172 Ebd., 16: »Darüber hinaus sandten sie, weil sie Nachbarn waren und mein Land an ihres grenzte, unter Tage einen Jungen, der Athener war, auf mein Land. Sie forderten ihn auf, meinen keimenden Rosenstrauch zu zerrupfen, damit, wenn ich ihn finge und ihn, in der Annahme, er sei ein Sklave, anbände oder auspeitschte, sie eine Klagen wegen Hybris gegen mich anstrengen könnten.« Vgl. zu den Aussichten der Klage in diesem Fall: Fisher, Hybris, 56-57. 173 Ebd., 17. 174 Ebd., 18; vgl. eine etwas andere Version ebd., 26. 175 Ebd., 27-28. 176 Ebd., 18. 177 Ebd., 4-5
256
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
auf dieser Ebene ein. Auch ihm erscheinen die Gerichte offensichtlich als ein passender Ort für die Führung eines ehrenhaften Konflikts; mit dem konsensualen Urteil der athenischen Richter erweitert er sein Repertoire der Möglichkeiten zur Beschädigung der Ehre seines Gegners. Die Vorgehensweisen gegen den persönlichen Feind finden in dem Konflikt zwischen Nikostratos bzw. Arethusios und Apollodor sowohl im Gericht als auch auf der Straße statt. Dabei behindern die anhängigen Prozesse den tätlichen Verlauf der Auseinandersetzung in keiner Weise, der Eskalation der gewalttätigen Anschläge tun die eingesetzten juristischen Mittel keinen Abbruch. Der Konflikt zwischen Apollodor und seinen Gegnern findet daher parallel sowohl auf der Straße als auch im Gericht statt, die Verflechtung erfolgt lediglich über die Thematik der gegenseitig zu vergeltenden Schäden. Ein Patchwork der gerichtlichen und spontanen Racheakte gegen einen verfeindeten Mitbürger findet sich in der 47. Rede des Demosthenes gegen Euergos und Mnesiboulos wegen falschen Zeugnisses (YEUDOμARTÚRION). Der Sprecher ist Trierarch und Oberhaupt einer Symmorie (™Gë μÒN TRIHRARCîN KAˆ ™PIμELHT¾J íN TÁJ SUμμOR…AJ).178 Er hat damit eine klare Funktion in der Polis und gerät im Zuge seiner Amtshandlungen in eine Auseinandersetzung mit Theophemos, seinem Vorgänger im Amte. Der Sprecher hat als nachfolgender Trierarch das Recht, von Theophemos einbehaltenes Schiffsgerät zurückzufordern bzw. den finanziellen Gegenwert einzutreiben. Die anhängige Klage gegen Euergos und Mnesiboulos ergibt sich aus dem Verlauf dieses Streits, sie zielt auf den Bruder bzw. den Schwager des Theophemos, die letzterem als Zeugen in einem Prozess gegen den Sprecher halfen. Der eigentliche Gegner aber ist Theophemos, seine Auseinandersetzung mit ihm rekapituliert der Sprecher in Länge. Den Tenor seiner Klage schlägt der Sprecher zu Beginn der Erzählung seiner Feindschaft mit Theophemos an: Er selbst steht in den Diensten der Polis und handelt in ihrem Interesse, wohingegen sein Gegner nicht nur gegen den Sprecher agiert, sondern die Einrichtungen und Gesetze der Polis und damit die Autorität der Athener insgesamt in Frage stellt.179 Der Sprecher tritt ganz hinter sein Amt zurück, um aus Theophemos einen Gegner der politischen Angelegenheiten aller zu machen. Als solcher ignorierte dieser die Gesetze und die sozialen Normen der Polis. Die wechselseitigen Angriffe der Männer weisen eine auffällige Gemeinsamkeit auf, was die Wahl der Mittel und das Ziel der Aggressionen angeht. Die hauptsächlichen Attacken finden in und um den Oikos des einen und des anderen statt. Gerade weil die Vorgehensweise beider so 178 Demosth. 47, 22. 179 Ebd., 18.
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
257
ähnlich ist, hat der Sprecher einerseits Mühe zu zeigen, dass er aus unpersönlichen Motiven handelte, während sein Gegner von Rachegelüsten getrieben wurde, auf der anderen Seite ist er gezwungen, säuberlich zwischen den Normen der Polis und jenen der Ehre zu differenzieren, um seine legitime Frontstellung seinem Gegner gegenüber aufrechtzuerhalten. Diesem Zweck dient auch der Hinweis des Sprechers darauf, zu Theophemos zuvor in keinerlei Beziehung gestanden zu haben, die einen Ehrenhändel provoziert haben könnte, und sein Verweis auf ein von Volk und Rat erlassenes Psephisma, das ihn berechtigt, einbehaltenes Schiffsgerät von einem vorherigen Trierarchen zurückzufordern.180 Nach dieser konzeptionellen Einordnung des eigenen Interesses schildert der Sprecher seinen ersten Kontakt mit Theophemos: ™PEID¾ G¦R PARšLABON AÙTÕN PAR¦ TÁJ ¢RCÁJ, PROSELQëN AÙTù PRîTON μÒN ¢PÇTOUN T¦ SKEÚH: æJ DÒ TOàTÒ μOU E„PÒNTOJ OÙK ¢PED…DOU, ÛSTERON AÙTù PERITUCëN PERˆ TÕN `%RμÁN TÕN PRÕJ TÍ PUL…DI PROSEKALES£μHN PRÒJ TE TOÝJ ¢POSTOLšAJ KAˆ PRÕJ TOÝJ TîN NEWR…WN ™PIμELHT£J: OáTOI G¦R E„SÁGON TÒTE T¦J DIADIKAS…AJ E„J TÕ DIKAST»RION PERˆ TîN SKEUîN.181 Der Sprecher hält sich seiner eigenen Darstellung zufolge an ein klares Procedere, das ihn als Abgesandten der Polis ausweist, in deren Dienst er die Trierarchie leistet. Da Theophemos auf seine mündliche Aufforderung nicht reagiert, übergibt der Sprecher die Angelegenheit der zuständigen Polisbehörde, die derartige Fälle vor Gericht bringt. Theophemos wird zur Zahlung einer Entschädigung für das einbehaltene Schiffsgerät verurteilt.182 Trotz oder wegen des von persönlichen Angriffen unbeeindruckten bürokratischen Vorgehens des Sprechers ist das keineswegs das Ende des Ärgers mit Theophemos. Denn dieser ignoriert das Urteil des Gerichts und verlegt sich auf eine Verschleppungstaktik, die einen Aufschub seiner Zahlung bis zum Vergessen verfolgt.183 Der Sprecher wird erst wieder tätig, als der Rat ein Psephisma erlässt, das es den Trierarchen erlaubt, das Fehlende E„SPR£TTESQAI TRÒPJ ú ¨N DUNèμEQA.184 Sein zweiter Versuch, das Schiffsgerät oder die finanzielle Entsprechung zu erhalten, ähnelt dem ersten, indem er sich ausdrücklich auf die Autorität der Polis stützt; diese 180 Ebd., 19. 181 Ebd., 26: »Als ich vom Amtsträger über ihn erfahren hatte, ging ich zu ihm, um ihn als erstes nach dem Schiffsgerät zu fragen. Weil er es auf meine Rede hin nicht zurückgeben wollte, lud ich ihn später, als ich ihn bei der Herme nahe dem kleinen Tor zufällig traf, vor die Flottenkommissare und die Aufseher über das Schiffsarsenal. Jene nämlich führten damals die Pozesse bei den Gerichten über das Schiffsgerät.« 182 Ebd., 27f. 183 Ebd., 29-32. 184 Ebd., 33: »auf eine Weise einzutreiben, wie wir es vermochten«.
258
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
hat ihn inzwischen mit einem größeren Handlungsspielraum ausgestattet, so dass der Sprecher dieses Mal selbst tätig werden kann. Da Theophemos ihn offenbar meidet, wendet sich der Sprecher zunächst an dessen Bruder Euergos, den er mit der Übermittlung der Information über das Psephisma und über die erneute Forderung des Sprechers beauftragt.185 Doch Euergos verweigert die Kooperation und nimmt die Angelegenheit nicht ernst. Nachdem er herausgefunden hat, wo Theophemos wohnt, sucht ihn der Sprecher – gemeinsam mit einem Gehilfen des Rates – in seinem Oikos auf.186 Damit beginnt eine Schlüsselszene des Streits zwischen den beiden Männern, die vor und im Oikos des Theophemos ausgetragen wird. Da es sich um ein Terrain handelt, das das Hoheitsgebiet des Oikosherrn ist, stellt die Anwesenheit des Sprechers als Widersacher an sich schon eine Bedrohung der Ehre des Theophemos dar.187 Der Sprecher verfügt über das soziale Wissen darum, dass er sich hier in einer sozialen Situation befindet, in der jegliches Verhalten nach den Kriterien der Ehre gedeutet werden wird. Umso mehr bemüht er sich um ein normgerechtes Verhalten und um eine Darstellung seiner Person als einen korrekt agierenden Repräsentanten der Polis. Als er Theophemos nicht zu Hause antrifft, schickt er seine Sklavin, ihn zu holen. Das darauffolgende Zusammentreffen beider Männer gestaltet sich entsprechend ihrer verschiedenen Auffassungen des aktuellen Zwists: æJ DÒ ¢FIKNE‹TAI Ð 1EÒFHμOJ μETELQOÚSHJ AÙTÕN TÁJ ¢NQRèPOU, ¢PÇTOUN AÙTÕN TÕ DI£GRAμμA TîN SKEUîN, LšGWN ÓTI ½DH PERˆ ¢NAGWG¾N E‡HN, KAˆ ™DE…KNUON TÕ Y»FISμA TÁJ BOULÁJ. æJ DÒ TAàT£ μOU LšGONTOJ OÙK ¢PED…DOU, ¢LL¦ ºPE…LEI KAˆ ™LOIDORE‹TO, ™KšLEUSA TÕN PA‹DA KALšSAI E‡ TINAJ ‡DIOI TîN POLITîN PARIÒNTAJ ™K TÁJ ÐDOà, †NA μ£RTURšJ μOI E‡HSAN TîN LEGOμšNWN, KAˆ ºX…OUN P£LIN TÕN 1EÒFHμON À AÙTÕN ¢KOLOUQE‹N PRÕJ TOÝJ ¢POSTOLšAJ KAˆ T¾N BOUL»N, KAˆ E„ μ» FHSIN ÑFE…LEIN, ™KE…NOUJ PE…QEIN TOÝJ PARADÒNTAJ KAˆ ¢NAGK£ZONTAJ E„SPR£TTEIN, À ¢PODIDÒNAI T¦ SKEÚH: E„ DÒ μ», ™NšCURA œFHN L»YESQAI KAT£ TE TOÝJ NÒμOUJ KAˆ T¦ YHF…SμATA.188 185 Ebd., 34. 186 Ebd., 35. 187 Vgl. J.F. Gardner, Aristophanes and Male Anxiety – The Defence of the Oikos, in: G&R 36 (1989), 51-62, 54: »Going into someone else’s house uninvited was simply not done. It would be assumed that one was there for some nefarious purpose – particularly if there were free women inside.« Und allgemein: Asano-Tamanoi, Shame, 117: »And the household, as an impenetrable entity and last private sanctuary, is a dominant idea in the Mediterranean region.« 188 Demosth. 47, 36: »Nachdem die Frau ihn geholt hatte, kam Theophemos und ich fragte ihn nach dem Katalog des Schiffsgeräts, da die Schiffe schon am Auslaufen seien, und zeigte ihm den Beschluss des Rates. Da jener auf meine Rede antwortete, er gebe es nicht zurück, und mich stattdessen bedrohte und beschimpfte, befahl ich dem Sklaven einige auf der Straße befindliche Bürger zu rufen, damit sie für das Gesagte meine Zeugen wären. Und ich bat den Thephemos
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
259
Während der Sprecher ganz in seiner Rolle für die Polis aufgeht und dem Theophemos seine Autorisierung sowie die verschiedenen zukünftigen Behandlungen der Angelegenheit darlegt, die allesamt in eine offizielle politische oder juristische Maßnahme münden, verhält sich der Hausherr, vom Amtsgebaren des Sprechers vollkommen unbeeindruckt, als sei er persönlich angegriffen worden und müsse seine Ehre bzw. die Ehre seines Oikos verteidigen. Nach den beiderseitigen verbalen Drohungen reagiert Theophemos deshalb gewalttätig, als der Sprecher, der bisher wohl vor der Tür gestanden hatte, die Schwelle des Oikos übertritt, um die angekündigte Konfiszierung der Güter zu vollziehen: E„SIÒNTOJ Dš μOU PA…EI PÝX Ð 1EÒFHμOJ TÕ STÒμA, KAˆ ™Gë ™PIμARTUR£μENOJ TOÝJ PARÒNTAJ ºμUN£μHN.189 Theophemos’ Verhalten ist das eines Ehrenmannes, der der Herausforderung seines Widersachers auf tätlicher Ebene, als die er das Eindringen in seinen Oikos begreift, mit einem prompten Vergeltungsschlag begegnet. Beide Kontrahenten verhalten sich nicht nur entsprechend entgegengesetzter Vorstellungen von Ehre, sondern sie interpretieren auch das Verhalten ihres jeweiligen Gegners in ihrem eigenen Sinne. Der Sprecher erwartet, dass Theophemos sich an die von der Polis aufgestellten Regeln hält, weil er selbst das tut, wohingegen Theophemos dem Sprecher ein ehrenhaftes Verhalten unterstellt, das auf die Beschädigung seiner Ehre aus ist, weil er selbst sich an einem Ehrbegriff orientiert, der persönlich und agonal geprägt ist und der die Rache als Handlungsoption selbstverständlich einschließt. Der Sprecher konstruiert die Rolle des Theophemos in seiner Rede als Gegenpart seines eigenen Verhaltens. Da er selbst seine Interessen mit jenen der Polis gleichsetzt, richten sich die Angriffe seines Gegners direkt gegen diese und gegen alle Athener.190 Auch im speziellen Falle des Eindringens in einen fremden Oikos beteuert der Sprecher, er habe das erst nach Erklärung seines Anliegens und seiner vom Rat übertragenen Rechte getan und sich zuvor vergewissert, dass keine Bürgersfrau im Hause gewesen sei, deren Ehre er habe gefährden können.191 Wie anders sich Theophemos in der gleichen Situation verhalten hätte, hat der Sprecher anschließend Gelegenheit zu zeigen, denn die juristischen Voraussetzungen kehren sich im Verlauf des Streits um. Theophemos gelingt es nämlich, mit Hilfe der – erneut, entweder mir zu den Flottenkommissaren und zum Rat zu folgen und wenn er sage, er schulde nichts, jene davon zu überzeugen, die das Eintreiben übergeben und erzwungen hatten, oder aber das Schiffsgerät herauszugeben. Wenn er aber alles das nicht täte, sagte ich, würde ich Pfand nehmen im Einklang mit den Gesetzen und Volksbeschlüssen.« 189 Ebd., 38: »Als ich eintrat, schlug mir Theophemos mit der Faust auf den Mund und während ich die Anwesenden zu Zeugen berief, wehrte ich mich.« 190 Ebd., 40-41, 48, 71, 80. 191 Ebd., 38, vgl. ebd., 80.
260
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
falschen – Aussagen des Euergos und Mnesiboulos einen Prozess gegen seinen Gegner zu gewinnen, bevor das von diesem initiierte Verfahren zu einer Entscheidung gekommen ist.192 Der Sprecher befindet sich nun in der Rolle des säumigen Schuldners. Seine Bitte um Stundung der Zahlung beruht aber allein – wie er betont – auf dem Umstand, dass er just zu diesem Zeitpunkt für eine Trierarchie verpflichtet wurde, die sein Geld verschlang.193 Trotzdem Theophemos einen Zahlungsaufschub gewährt hat und obwohl er das Geld schließlich bekommen soll, greift er zu den gleichen Mitteln wie der Sprecher selbst es gegenüber seinem damaligen Schuldner getan hatte: Er geht zum Oikos seines Gegners und konfisziert dessen Güter, um sich für den Verlust zu entschädigen. Das gleiche Vorgehen bekommt bei Theophemos jedoch eine gänzlich andere Dynamik, weil er den Streit mit dem Sprecher wie eine ehrenhafte Auseinandersetzung führt. Er verbündet sich mit seinem Bruder Euergos und seinem Schwager Mnesiboulos und nimmt zunächst vom Eigentum des Sprechers, was ihm gerade über den Weg läuft: eine Herde Schafe samt Schäfer und einen Sklaven samt von ihm transportierter kostbarer Vase.194 Sind diese Handlungen noch durch das Ziel des ökonomischen Ausgleichs erklärlich, so verlassen die drei Freunde danach jegliche Legitimationsgrundlage für ein akzeptables Verhalten: ™LQÒNTEJ PRÕJ T¾N O„K…AN KAˆ ™KBALÒNTEJ T¾N QÚRAN T¾N E„J TÕN KÁPON FšROUSAN ... E„SELQÒNTEJ ™Pˆ T¾N GUNA‹K£ μOU KAˆ T¦ PAID…A ™XEFOR»SANTO ÓSA œTI ØPÒLOIP£ μOI ÃN SKEÚH ™N TÍ O„K…v.195 Theophemos handelt zwar vor dem Hintergrund eines ihn begünstigenden Gerichtsurteils, sein Verhalten orientiert sich aber nicht an seinem Recht oder den Interessen der Polis, sondern an seiner Ehre. Entsprechend versucht er, die Ehre seines Widersachers zu beschädigen, selbst wenn dabei der ökonomische Nutzen für ihn gering bleibt. Er ordnet die sachlichen und finanziellen Belange seines gerichtlich behandelten Falles seinen eigenen ehrenhaften Verhaltensmaximen unter, weil er einen Streit führt, in dem es hauptsächlich um die Ehre geht und erst nebensächlich um das Schiffsgerät oder die Schafe. Unmissverständlich deutlich wird diese Haltung des Theophemos an der Art, wie er sich im Oikos seines Kontrahenten verhält. Während sich der Sprecher im konträren Parallelfall von den Frauen des Oikos seines Wider192 Ebd., 39-40, 49-50. Zur Klärung der juristischen Umstände, vgl. Schäfer, Demosthenes, 193-199. 193 Ebd., 50. 194 Ebd., 52. 195 Ebd., 53: »Sie gingen zu meinem Haus und traten die Tür ein, die zum Garten führte ... und sie gingen in Anwesenheit meiner Frau und der Kinder ins Haus und trugen den Hausrat hinaus, der mir noch geblieben war.«
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
261
sachers fernhielt und die Schwelle nicht übertrat, ehe der Hausherr nicht heimgekommen und die Sachlage erklärt war, dringt Theophemos ungeniert in den Oikos seines Kontrahenten ein – in dessen Abwesenheit und in Anwesenheit der Frauen des Hauses. Ein solches Verhalten sei derart normwidrig, so führt der Sprecher aus, dass selbst die hilfsbereiten Nachbarn und Freunde den Oikos nicht betreten mögen, um ihn vor der Plünderung zu bewahren: PROSELQëN DÒ Ð `!GNÒFILOJ PROSKLHQEˆJ ØPÕ TOà QER£PONTOJ TOà '!NQEμ…WNOJ, ÓJ ™ST… μOI GE…TWN, E„J μÒN T¾N O„K…AN OÙK E„SÁLQEN (OÙ G¦R ¹GE‹TO D…KAION EÍNAI μ¾ PARÒNTOJ GE TOà KUR…OU).196 Im Folgenden verwüsten Theophemos und seine Freunde nicht nur den Oikos des Sprechers, sondern sie missachten auch den personenrechtlichen Status seiner Bewohner. So nehmen sie Gegenstände mit, die zur Mitgift der Ehefrau gehören: T¦ D' ™K TÁJ ¥LLHJ O„K…AJ ™XšFERON SKEÚH, ¢PAGOREUOÚSHJ TÁJ GUNAIKÕJ μ¾ ¤PTESQAI AÙTO‹J, KAˆ LEGOÚSHJ ÓTI AØTÁJ E‡H ™N TÍ PROIKˆ TETIμHμšNA,197 greifen seine im Haus lebende alte Amme an, die später an ihren Verletzungen stirbt,198 und behandeln seinen Sohn wie einen Sklaven, indem sie ihn mit sich nehmen: OÙ μÒNON TO…NUN, ð ¥NDREJ DIKASTA…, LABÒNTEJ μOU T¦ SKEÚH õCONTO, ¢LL¦ KAˆ TÕN UƒÕN ÃGON æJ O„KšTHN, ›WJ TîN GEITÒNWN ¢PANT»SAJ AÙTO‹J `%RμOGšNHJ EÍPEN ÓTI UƒÒJ μOU E‡H.199 Alle Vergehen des Theophemos in dem fremden Oikos sind für die dort befindlichen Personen in höchstem Maße ehrenrührig und als Reaktion auf die Taten des Sprechers vollkommen unangemessen. Sogar für eine vorhergehende ehrenhafte Auseinandersetzung wäre das Verhalten des Theophemos an der Grenze dessen, was als erwartbar und satisfaktionsfähig gilt. Und das ist das Hauptthema der 47. Rede: Das in jeder Hinsicht unangemessene Verhalten des Theophemos. Dieser verhält sich nämlich weder als ein guter Bürger, der die Gesetze der Polis achtet und seine Trierarchien vorbildlich absolviert, noch als ein Ehrenmann, der einen Konflikt nach den Maßgaben der Reziprozität und des Agons richtig zu führen weiß. Auf der 196 Ebd., 60: »Als Hagnophilos, von einem Diener meines Nachbarn Anthemion herbeigerufen, kam, ging er nicht in das Haus hinein (er glaubte, es sei nicht richtig, wenn der Herr nicht anwesend ist).« 197 Ebd., 56-57: »sie trugen weitere Gerätschaften aus dem Haus heraus, obwohl meine Frau ihnen verbot sie anzufassen und ihnen sagte, dass sie als Teil ihrer Mitgift ihr gehörten.« Vgl. dazu L. Foxhall, Household, Gender and Property in Classical Athens, in: CQ 39 (1989), 22-44, 35f: »It is not entirely clear whether a dowry could be seized by private creditors for the repayment of the husband’s debts. ... This woman, at least, was apparently convinced that her dowry was her own, and belonged first and foremost to herself!« 198 Demosth. 47, 55-56, 58-59, 67. 199 Ebd., 61: »Nicht nur, ihr Richter, nahmen sie meinen Hausrat mit sich, sondern sie führten auch meinen meinen Sohn weg wie einen Sklaven, bis dass ihnen einer meiner Nachbarn, Hermogenes, begegnete und ihnen sagte, dass er mein Sohn sei.«
262
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
normativen Ebene des Bürgerseins versagt er vollkommen, weil er die Autorität des momentanen Trierarchen und die der Polis bzw. ihrer Gesetze nicht anerkennt. Der Sprecher macht durch seine dichotome Gegenüberstellung der beiden Protagonisten seiner Erzählung sein eigenes Anliegen zu einer Sache des öffentlichen Interesses. Diese verbreitete Taktik der athenischen Redner gewinnt an Glaubwürdigkeit durch den steten Verweis des Sprechers auf sein Amt als Trierarch und sein vom Rat sanktioniertes Vorgehen. Aber auch auf der normativen Ebene des ehrenhaften Verhaltens bleiben die Handlungen des Theophemos fragwürdig. Der Sprecher hat ihm den Part des Ehrenmannes zugedacht, der auf die Direktiven der Polis aus seiner eigenen Perspektive reagiert und alle Handlungen seiner Mitbürger unter dem Vorzeichen der Ehre interpretiert. Doch selbst diese Rolle spielt Theophemos nicht richtig, weil er sich nicht an die Form der agonalen und reziproken Erwiderung hält, die ehrenhafte Handlungen stets kennzeichnen sollten. Er rächt sich an seinem Gegner, ohne die Angemessenheit der Mittel und den Gesamtzusammenhang der ehrenhaften Auseinandersetzung zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Theophemos zwar bereit ist, seine eigene Ehre um jeden Preis zu verteidigen, um als Sieger aus diesem Streit hervorzugehen, dass er diese Ziele aber nicht gemäß der Norm der Ehre verfolgt. Sein soziales Wissen um den rechten Habitus eines Ehrenmannes ist defizitär, und allein deshalb kann er in der Darstellung des Sprechers nicht als ein Mann von Ehre überzeugen. Offenbar steht zu befürchten, dass die Geschworenen das Verhalten eines ehrenhaften Atheners ebenso gutheißen könnten wie das eines guten Polisbürgers. Der Sprecher beugt einer solchen positiven Sanktionierung des Ehrenmannes Theophemos vor, indem er seinen Ehrbegriff als normenwidrig darstellt. Eine Charakterisierung des Gegners nach diesem Muster ist in vielen Reden zu finden, sie wird den athenischen Richtern daher geläufig gewesen sein. Der Sprecher der 47. Rede belässt es aber nicht bei der dichotomen Verteilung der Einstellungen und Handlungen auf die Seite des Ehrenmannes einerseits und des Polisbürgers andererseits. Vielmehr stellt er seinen Gegner als jemanden vor, der das Verhältnis der beiden Handlungsnormen nicht richtig einschätzen kann. Er scheint nicht über das diffizile soziale Wissen der Kombinierung beider Normen zu verfügen. Denn wo der Sprecher sich als einen Agenten der Polis ausweist und eine berechtigte Forderung vorträgt, reagiert Theophemos, als habe man ihn zu einem Beweis seiner Ehre herausgefordert. Er beginnt, sich buchstäblich um seine Ehre zu schlagen, als sei das die erfolgversprechendste Antwort auf eine Provokation des Sprechers, die letzterem zufolge überhaupt nicht stattgefunden hat. Dieses Verhalten zeugt von einem Ehrbegriff, so suggeriert der Sprecher, der sich vor allem in Kämpfen auf offener Straße, lautstarken Auseinander-
Die Ehre auf der Straße: Simon, Nikostratos und Euergos
263
setzungen und körperlicher Gewalt äußert. Entsprechend hält Theophemos die Übergabe des Schiffsgeräts für eine Frage der Ehre, ein Umstand, der den reibungslosen Ablauf der Trierarchien behindert und deshalb politisch relevant ist. Der Sprecher kann an dieser Stelle seine Charakterisierung des Theophemos mit den Erfordernissen der Polis verknüpfen und seinen Gegner als jemanden desavouieren, dessen soziales Wissen fragwürdig ist und der deshalb einen Störfaktor im politischen Ablauf darstellt. In dieses Bild passt die durchgängig wiederholte Aussage des Sprechers, Theophemos sei derjenige gewesen, der den ersten Schlag geführt habe. Offenbar konnte Theophemos im Prozess gegen den Sprecher behaupten, dieser habe als erstes zur Gewalt gegriffen.200 Auch deshalb entfernt sich der Sprecher in der Darstellung seiner Person so weit wie möglich von der Wahrscheinlichkeit eines solchen Affronts, indem er sein eigenes Verhalten als rein verbal und höchstens defensiv beschreibt. In der Rede des Sprechers ist es Theophemos, der die Handgreiflichkeiten beginnt und so den Normen der Polis zuwiderhandelt. Denn mit dieser Gewaltanwendung verlege Theophemos den Streit aus dem Hoheitsbereich der Polis und des Rechts hinaus auf die Straße, wo die Auseinandersetzung zwar ebenso öffentlich sei, aber nicht um die Sache der Polis kreise, sondern um die Ehre der beteiligten Männer. Der Sprecher kann die Handlung, mit der Theophemos den normativen Kontext wechselte, genau benennen: BOÚLOμAI Øμ‹N KAˆ TOÝJ μ£RTURAJ PARASCšSQAI, O‰ EÍDÒN μE PRÒTERON PLHGšNTA ØPÕ TOà 1EOF»μOU.201 Mit dem gewalttätigen Angriff hat Theophemos sich, was den Deutungskontext der Polis angeht, ins Unrecht gesetzt. Stattdessen gilt für ihn nun die Norm der Ehre, das Gesetz der Straße. Der Sprecher der Rede dagegen entscheidet sich bewusst – so sagt er – für einen Verzicht auf die ehrenhafte Rächung des Todes seiner Amme, den Theophemos und seine Freunde verschuldet haben. Weil der Sprecher nicht mit der Amme verwandt war, kann er die Sache nicht vor ein athenisches Gericht bringen.202 Er berät sich mit einigen Gesetzeskundigen und stellt fest, dass das athenische Recht hier seine Grenzen hat und dass die den Gesetzen der Polis zuwiderlaufende Rache eine Handlungsmöglichkeit ohne wirkliche Alternative darstellt. Seine Rechtsberater empfehlen ihm diesen Weg: ¢LL' ØPÒR SEAUTOà KAˆ TÁJ O„K…AJ ¢FOSIWS£μENOJ æJ
200 Ebd., 14-15. 201 Ebd., 40: »Ich möchte euch die Zeugen vorführen, die gesehen haben, wie ich als erster von Theophemos geschlagen worden bin.« Vgl. zu den Beteuerungen, Theophemos habe den ersten Schlag getan ebd., 35, 39, 45; und als Erklärung, dies konstituiere das eigentliche Vergehen ebd., 7, 47. 202 Ebd., 68-70, 72.
264
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
´STA T¾N SUμFOR¦N FšREIN, ¥LLV DÒ E‡ PV BOÚLEI, TIμWROà.203 Der ehrenhafte Akt des Sichrächens wird hier tatsächlich als eine Frage des Wollens und Wählens behandelt. Der Sprecher ist nicht einem festgelegten Kodex der Rache unterworfen, sondern frei, die Vor- und Nachteile seiner Handlungen abzuwägen, die Interpretation seines Verhaltens selbst zu beeinflussen und die Dynamik der Auseinandersetzung zu verstärken oder abzuschwächen. Was immer »die irgendwie andere« Art gewesen wäre sich zu rächen, wird leider nicht näher erläutert. Das Vorgehen, das der Sprecher als Vergeltung für den Totschlag der Amme erwägt, ist relativ moderat. Da er wegen der Gesetzeslage keinen regelrechten Prozess führen kann, besteht es in einer Klage vor Gericht, die sich auf falsche Aussagen und fragwürdige Zeugen stützt. Der Sprecher nimmt davon Abstand, weil das ein gesetzwidriges Verhalten bedeuten würde und äußert außerdem als Hauptgrund für seine Entscheidung folgende Überlegung: YEÚSASQAI DÒ PRÕJ Øμ©J KAˆ DIOμÒSASQAI AÙTÕJ KAˆ TÕN UƒÕN KAˆ T¾N GUNA‹KA OÙK ¨N ™TÒLμHSA, OÙD' ¨N E„ Eâ ÉDEIN ÓTI AƒR»SOIμI AÙTOÚJ: OÙ G¦R OÛTWJ TOÚTOUJ μISî, æJ ™μAUTÕN FILî.204 Der Preis für seine Rache erscheint ihm zu hoch, er verzichtet lieber auf eine ehrenvolle Vergeltung, als die Athener zu belügen und die Götter zu erzürnen. Diese Einstellung zeugt von einem sehr rationalen, pragmatischen Umgang mit der Ehre. Den hält der Sprecher offenbar für konsensfähig, sonst würde er ihn nicht so freimütig vor den Athenern äußern. Er lässt sich gut mit seiner Einstellung zur Polis und zu ihren Gesetzen vereinbaren: Letzteren entsprechend zu handeln ist der Habitus, den er gewöhnlich an den Tag legt. Erst wenn er seine Interessen von ihnen nicht mehr vertreten sieht oder wenn er auf einen Gegenspieler mit dezidiert ehrenvollem Habitus trifft, berücksichtigt er alternative Handlungsoptionen, die die Norm der Ehre bereitstellt. Die Sprecher aller vier analysierten Reden machen deutlich, dass sie grundsätzlich über zwei normative Bezugssysteme verfügen, zum einen jenes der Ehre und zum anderen jenes der Polis. Die Athener interpretieren vor Gericht sowohl ihr eigenes als auch das Verhalten ihrer Gegener entsprechend diesen beiden normativen Kategorien. Auf der Handlungsebene zeigen die Prozessierenden, dass sie auf der Straße und auf der Agora agieren wie Männer von Ehre: ihre Konflikte laufen nach einem ehrenhaften Muster von Herausforderung und deren Erwiderung ab und eskalieren leicht. Wie in einer ehrenhaften Gesellschaft üblich, werden die Auseinan203 Ebd., 70: »Aber nachdem du dich und dein Haus entsühnt hast, trage den Vorfall leicht und wenn du willst, räche dich irgendwie anders.« 204 Ebd., 73: »Vor euch aber zu lügen und sie bei dem Leben meines Sohnes und meiner Frau zu beschwören wagte ich nicht, wenn ich auch sicher wüßte, dass ich euch damit gewönne. Denn ich hasse jene nicht wie ich mich selbst liebe.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
265
dersetzungen in der Öffentlichkeit ausgetragen, um die Ehre der Beteiligten demonstrativ in Szene setzen zu können. Charakteristischerweise kommt es in den Reden dort zu problematischen Situationen, wo die Ehre ihren Anspruch als handlungsleitende Norm verliert. Sobald es um den Oikos als nicht-öffentlichen sozialen Raum oder um die Person eines Amtsträgers der Polis geht, wird ein Verhalten entsprechend den Normen der Ehre von den Rednern als nicht länger legitim interpretiert. Solche Fälle gehören zum Hoheitsgebiet der Polis, das dem ehrenhaften Handeln Grenzen setzt. Wie bei der Anerkennung ehrenhaften Verhaltens durch die Öffentlichkeit erfolgt die Nichtankennung über den sozialen Konsens der Gemeinschaft, wie sie in den athenischen Gerichten versammelt ist. Bezogen auf die Ausgestaltung der Konfliktführung haben die juristischen Verfahren der athenischen Gerichte einen ähnlichen Stellenwert erlangt wie die ehrenhaften Auseinandersetzungen auf der Straße. Die Konflikte zwischen athenischen Bürgern, die immer auch ein Agon um Ehre sind, werden selbstverständlich vor den Gerichten der Polis geführt. Die Vermengung von ehrenhaften Handlungen auf der Straße und der Anstrengung von juristischen Verfahren erfolgt dabei gänzlich regellos: In einigen Fällen verlaufen die beiden Konfliktstrategien parallel, in einigen lösen sie einander ab bzw. gehen ineinander über. Praktisch ergaben sich für die Athener offensichtlich kaum Schwierigkeiten in der Kombination beider Handlungsnormen.
3. Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide Die Ehre eines Mannes erkennt man nicht nur an der Art, wie er sich verhält, sondern sie lässt sich auch an den Ehrungen ablesen, die ihm zuteil werden. Diese zielen generell auf die öffentlich wirkende und visuell auffällig angelegte Inszenierung der Ehre ihres Trägers. In einer ehrenhaften Gesellschaft dienen Ehrungen der optisch unterstützenden Darstellung des Status einer Person, und sie sind das einfachste Mittel für den Geehrten, seine Position an bestimmten Anlässen in ritualisierter Weise offen zur Schau zu stellen. Für die Polis Athen hatte die Vergabe von Ehrungen darüber hinaus eine existentielle Bedeutung, weil sie herausragende Leistungen für das Gemeinwesen belohnte, die die Bürger zu weiteren Verausgabungen für die Polis anspornten. Zu diesen Ehrungen, die die Polis vergab, gehörten so unterschiedliche Dinge wie die lebenslange Speisung im Prytaneion, die Verleihung eines goldenen Kranzes für einen ehemaligen Amtsträger, die
266
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Aufstellung einer Ehreninschrift oder die Zahlung von zusätzlichem Preisgeld an einen Olympioniken. Den Ehrungen gemein ist dabei die statuserhebende Würdigung eines einzelnen Mannes vor der gesamten Bürgerschaft, Ziel ist die symbolische Distinktion. Zwar bringen einige Ehrungen auch materielle Verbesserungen mit sich, die Hauptsache aber ist der Eindruck auf die übrigen Athener und die öffentlich breit inszenierte Steigerung der eigenen Ehre.205 Die Ehrungen, die einer Person zuteil werden, sind die äußeren Bezeichnungen eines bestimmten Status, ihre Funktion erschöpft sich aber nicht in ihrer Symbolik.206 Bei der Ehre eines Mannes handelt es sich um ein fragiles Gut, das der Zuschreibung durch andere bedarf, die ein bestimmtes, normativ als ehrenhaft geltendes Verhalten positiv sanktionieren. Der berechtigte Anspruch eines Atheners auf Ehre wird öffentlich visualisiert und seine Leistungen dokumentiert. Ehrungen bilden das Mittel, mit dem die Zuschreibung von Ehre für alle sichtbar vollzogen wird. Dabei kann die Ehrung eines Atheners durch die Polis seine Ehre zwar bestätigen und steigern, weil sie die öffentlichen und visuellen Ansprüche erfüllt, die den exhibitionistischen Zug der Ehre ausmachen, sie kann sie aber nicht herstellen, denn das Tragen von Ehrungen durch einen ihrer unwürdigen Mann würde lediglich auf die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit verweisen und den Spott seiner Mitbürger auf sich ziehen.207 Auch in diesem Sinne wirkten die Ehrungen, die die Polis vergab, als Stabilisatoren des Systems: Sie bestärkten den Status der ohnehin sehr ehrenhaften Bürger und honorierten deren Leistungen für die Polis. Als besonders fruchtbar erwies sich das Wechselverhältnis zwischen der Polis und ihrer Möglichkeit, Ehrungen zu vergeben, auf dem Gebiet der finanziellen Ausstattung politischer Vorhaben, dem Bau von Trieren und öffentlichen Gebäuden und der Ausrichtung von dramatischen Aufführungen. Generell wurde die Leistung eines einzelnen Bürgers für die Polis mit Ehre 205 Vgl. Cohen, Law, 74; D. Whitehead, Competitive Outlay and Community Profit: FILOTIμ…A in Democratic Athens, in: C&M 34 (1983), 55-74; Hansen, Demokratie, 326f: »Gewöhnliche Bürger, die anonym und kollektiv am Prozess der Entscheidungsfindung teilnahmen, wurden in barem Geld bezahlt, während die aktiven Bürger, die persönlich als Redner und Magistrate auftraten, durch die Hoffnung angespornt wurden, die jährlichen Ehrungen zu erhalten: einen goldenen Kranz und eine Einladung zu einem Essen im Prytaneion. ... Der Wettbewerb um Ehrungen war für alle Griechen ein mächtiges Motiv in allen Lebensbereichen, von der Politik bis zum Sport; und bei formellen Gastmählern im Prytaneion saßen Olympioniken Seite an Seite mit führenden Rednern und Magistraten und den Nachkommen von Harmodios und Aristogeiton.« 206 Vgl. J. Pitt-Rivers, Honor, in: International Encyclopedia of the Social Sciences 5 (1968), 503-511, 504: »The significance of the acts of public honour and the granting of dignities is, therefore, this: they place the seal of public recognition on reputations that would otherwise stand in doubt and endow them with permanence. It is the function of the authority to impose consensus, and it does this with regard to the worth of persons: it converts prestige into status.« 207 Vgl. Pitt-Rivers, Status, 27; Halliwell, Uses, 280-284.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
267
belohnt. Die von der Polis vergebenen Ehrungen waren dabei wiederum der öffentlich dargestellte Fortsatz der eigentlichen, von den Athenern zugeschriebenen Ehre an einen Mann, der sich und sein Vermögen für das Gemeinwesen einsetzte.208 Die so attestierte Ehre eines Atheners brachte leicht auch politische Ämter und Aufgaben mit sich, denn sie ging gemeinhin mit einem hohen sozialen Status einher, dessen Verwendung für die öffentlichen Angelegenheiten eine Betrauung mit weiteren Kompetenzen rechtfertigte. Diese Kumulation von Statusmerkmalen ist in vielen ehrenhaften Gesellschaften zu finden und trägt wesentlich zu ihrem Funktionieren bei.209 Die über einen Polisbeschluss vergebenen Ehrungen an verdienstvolle Bürger fungierten vermittelnd zwischen der sozial durch Ehre strukturierten und politisch demokratisch organisierten Polisgesellschaft. Denn die durch die Polis verliehenen Ehrungen folgten zumeist auf für die politische Gruppe der Bürger erbrachten Leistungen. Damit machte sich die Polis den in einer ehrenhaften Gesellschaft beheimateten, selbstverständlich vollzogenen Mechanismus der Zuschreibung von Ehre zu Eigen. Der gesellschaftlich relevante Erweis von Ehre und die Bestätigung dieses Anspruchs durch ein Kollektiv wurde durch die Polis weitergeführt. Als signifikante andere für die Zuschreibung von Ehre an eine Person galt der zunehmend klarer umrissene Kreis der Polisbürger. Die Untrennbarkeit von Politik und Gesellschaft, die die athenische Polisverfassung charakterisierte, beruhte auf einer Austarierung des Widerspruchs zwischen dem überkommenen ehrenhaften und dem relativ neuen politischen System. Die Vergabe von Ehrungen an einen einzelnen – sozial privilegierten – Bürger durch den Beschluss aller – politisch gleichen – Bürger überbrückte die Diskrepanz zwischen ehrenhafter Gesellschaft und athenischer Polis. Die Polis befand sich quasi in der Rolle des Souveräns, der einer tradierten ehrenhaften Gesellschaft gegenübersteht: Auf der einen Seite pflegte er die bestehende soziale Hierarchie, indem er sich selbst als höchste Quelle von Ehre etablierte, auf der anderen Seite aber propagierte er die Gleicheit aller Untertanen, um besonders ehrgeizige Männer von einer Bedrohung seiner eigenen Autorität ab-
208 Vgl. P. Veyne, Brot und Spiele. Gesellschaftliche Macht und politische Herrschaft in der Antike, Frankfurt a.M. 1988, 163-311; C. Meier, Wie die Athener ihr Gemeinwesen finanzierten. Die Anfänge der Steuerpolitik in der griechischen Antike, in: U. Schultz (Hg.), Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kulturgeschichte der Steuer, München 1986, 25-42; S. Lauffer, Die Liturgien in der Krisenperiode Athens. Das Problem von Finanzsystem und Demokratie, in: E.C. Welskopf (Hg.), Hellenische Poleis, Bd. I, Darmstadt 1974, 147-159. 209 Campbell, Honour, 267: »In radical form, then, the hierarchy of prestige, considered objectively, has only three ranks: there are those who are first and those who are last, in either case they are few in number. The majority are in the interstitial category from which pride and their common interest against further differentiation prevent any of their number from moving in an upward direction.« Vgl. Davis, People, 94-96.
268
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
zuhalten und Kämpfe um Rang und Status zu beschränken.210 In der Tat bildeten vermögende Einzelne, die über ein großes Maß an Ehre verfügten, das im Wesentlichen gesellschaftlichen Ursprungs war, eine latente Bedrohung für das Gemeinwesen. Wie in einer ehrenhaften Gesellschaft üblich, streiten die Männer in der Polis Athen um die Zuweisung von Ehre und Ehrungen. Die ansatzweise institutionalisierten Verfahren, mit denen Bekränzungen oder Ehreninschriften beschlossen werden, machen die Zuweisung von Ehre an einen bestimmten Bürger so berechenbar und für alle konkret sichtbar, wie es der sehr abstrakt verlaufende, immatrielle Prozess der gegenseitigen Einschätzung von Ehre in einer ehrenhaften Gesellschaft selten vermag. Deshalb handelt es sich bei den Ehrungen durch die Polis um ein Feld der Ehre, auf dem auch verbal um einzelne zu vollziehende Ehrungen gestritten werden kann. Die Ehrung eines athenischen Bürgers soll ein deutlich sichtbares Zeichen seines für die Polis erwiesenen Einsatzes sein, und das Verfahren der Ehrung verläuft in gesetzlich definierten Aktionen durch Vertreter der Polis. Die Gerichtsreden um die Berechtigung einer Ehrung für bestimmte Bürger befassen sich ausführlich mit dem Charakter der Ehrung durch die Polis. Anders als bei dem wenig faßbaren Vorgang der Zuschreibung von Ehre durch die Gesellschaft bietet sich hier die einzigartige Möglichkeit für einen Athener, die Ehre eines persönlichen Rivalen anzugreifen, indem er die diesem bevorstehende Ehrung hintertreibt. Wie die Quellen bezeugen, wurde diese Gelegenheit der Klärung der Berechtigung von Ehrungen durch die Gerichte von den Athenern weidlich genutzt.211 Eine der berühmtesten Gerichtsreden überhaupt ist die 330 v. Chr. gehaltene so genannte Kranzrede des Demosthenes.212 Sie verficht den Standpunkt des Ktesiphon, der beantragt hatte, Demosthenes zu bekränzen. Demosthenes argumentiert hier also für eine Ehrung seiner eigenen Person. Aischines hatte in seiner dritten 210 Vgl. zu den Schwierigkeiten der Durchsetzung von staatlicher Autorität gegen einen tradierten Ehrbegriff Frevert, Mann, 171f., und vor allem Guttandin, Schicksal, 300-374. Ein Beispiel für den Umgang des Monarchen mit den Reziprozitätserwartungen des Adels findet sich ebd., 373: »Denn zwischen Monarch und Adel als Kern derjenigen Schicht, die sich duelliert, provoziert das Duell als Verletzung der vom Monarchen gegebenen oder repräsentierten gesetzlichen Ordnung eine Gegenwehr des Staates in Form von Vergeltung und Bestrafung. Dies wiederum könnte den Adel zu neuerlicher Vergeltung herausfordern. ... [Es] ist ... die Gnade des Königs, die einen potentiellen Handlungszyklus von Vergeltung und Gegenvergeltung unterbricht oder gar nicht erst aufkommen lässt. Die negative Reziprozität in Gestalt der Vergeltung wird überspielt durch einen Gnadenakt, indem der Monarch großherzig gibt, ohne zu nehmen.« 211 Vgl. etwa die Auflistung der als GRAF¾ PARANÒμWN überlieferten Verfahren bei M.H. Hansen: The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century B.C. and The Public Action against Unconstitutional Proposals, Odense 1974, 28-42, die sich um die Ehrung eines Atheners drehen: von 39 aufgeführten Fällen sind es 16. 212 Vgl. Zürcher, Demosthenes, S. 143, Anm. 2.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
269
Rede KAT¦ +THSIFîNTOJ den Antrag des Ktesiphon als gesetzeswidrig angegriffen und so die Bekränzung des Demosthenes zunächst verschieben und grundsätzlich in Frage stellen können. Demosthenes kann das Rede duell mit überwältigendem Erfolg für sich entscheiden.213 Doch auch auf weniger prominenter Ebene wird um die Legitimation der Ehrung eines Mitbürgers gestritten: Die 22. und 23. demosthenische Rede Gegen Androtion bzw. Gegen Aristokrates und die 51. Rede des Demosthenes PERˆ TOà STEF£NOU TÁJ TRIHRARC…AJ zeigen athenische Männer vor Gericht, die in ihren Reden Argumente für oder gegen die Ehrung eines Mitbürgers bzw. ihrer eigenen Person zu führen suchen. Ebenso wie die Reden des Kranzprozesses belegen sie die Wichtigkeit der Polisehrungen und verdeutlichen die Einstellung der Athener zu ihnen. Vor allem können sie das Verhältnis zwischen den Ehrungen der Polis und der Ehre eines Atheners verdeutlichen: An dieser Stelle zeigt sich, ob es der Polis gelungen ist, das Bewusstsein einer Bürgerehre zu etablieren, die die ältere, agonal und elitär geprägte Ehre der einzelnen Athener zunehmend vereinnahmt und ersetzt. Eine besonders aufschlussreiche Antwort auf diese Schlüsselfrage ist von der 24. Rede des Lyias Für den Invaliden zu erhoffen. Der invalide Sprecher dieser Rede kann sich allein auf seinen Status als Bürger berufen, um Ansprüche an das Gemeinwesen zu stellen. Ohne einen nennenswerten Einsatz für die Gemeinschaft anführen zu können, verweist er einerseits auf die Rechte, die ihm aufgrund seines Bürgerstatus zukommen, auf der anderen Seite argumentiert er mit seinem geringen Status und einer fundamentalen Ungleichheit, die ihm die Unterstützung der Polis sichern soll. Ausnahmsweise handelt es sich bei diesem Kläger nicht um ein Mitglied der Oberschicht, sondern um einen einfachen Bürger, der nach eigenem Bekunden Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht über besonders hohe Ehre verfügt. Sein Selbstverständnis als athenischer Bürger mit bestimmten Rechten und sein Anspruch auf Gleichheit können das Vorhandensein eines spezifisch ausgeprägten Ehrgefühls der athenischen Bürger belegen. Grundsätzlich sind die genannten Reden auf die formalen Kriterien für ehrenhaftes Verhalten hin zu untersuchen. Der geforderte Nachweis von agonalem, reziprokem und öffentlichkeitswirksamem Verhalten athenischer Bürger, der das Vorhandensein und die Bedeutung von Ehre erhellen soll, erfährt bei den Reden über die Ehrungen durch die Polis eine Erweiterung und eine Einschränkung. Einerseits werden die Berechtigung und der Sinn von Ehrungen direkt und öffentlich thematisiert. Die normativ korrekte 213 Aischines erhielt nicht einmal den fünften Teil der Richterstimmen und musste die für diesen Fall vorgesehene Buße von 1.000 Drachmen zahlen; vgl. H. Wankel, Demosthenes, Rede für Ktesiphon über den Kranz, erl. u. eingel., 2 Bde., Heidelberg 1974, 39f.
270
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Reflexion von Ehrungen in der athenischen Gesellschaft wird sichtbar. Das bedeutet eine zusätzliche Dimension der Analysemöglichkeiten. Auf der anderen Seite ist die Verbalisierung der Vergabemechnismen von Ehre eine Folge ihrer auf das Punktuelle, Ostentative reduzierten Form der Polis ehrungen. Die komplexen sozialen Prozesse, die mit der Ehre zusammenhängen, werden in dem Sprechen der Athener über die Ehrungen bestenfalls angedeutet, stehen aber in ihrer Gesamtheit nicht im Blick der Redner. Was die Reden zu zeigen vermögen, sind deshalb die verbreiteten Einstellungen der Athener zur Ehrung eines Mannes durch die Polis. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der Fragestellung in diesem Kapitel auf der Einbindung der Ehrenmänner in die Polis: Inwiefern legen sie ehrenhafte Verhaltensweisen an den Tag, wie sie sich in den habituellen Formen der agonalen, reziproken, öffentlichkeitswirksamen Handlungen manifestieren? Setzen sie ihre ehrenhaften Handlungen in Bezug zur Polis? Begreifen sie ihre Ehre als durch die athenischen Bürger hergestellt und im Rahmen der Polis exponierbar? Diese Fragen erhalten ihre Antworten sowohl auf der Ebene des in den Reden rekapitulierten Verhaltens einzelner Athener, als auch durch die Aussagen der Redner selbst, die die Handlungen ihrer Mitbürger danach bewerten, ob sie der Polis nützen oder nicht und ob sie daher eine Ehrung verdient haben oder nicht. Die beiden Reden um die Bekränzung des Demosthenes behandeln die Ehrung eines Atheners, der nicht zu den Geringsten unter den Bürgern zählt. Demosthenes hat sich sein Leben lang als Redner und Politiker hervorgetan und soll nun aus Anlass des von ihm initiierten Ausbaus einer der Befestigungsmauern und seiner finanziellen Schenkung dazu mit einem goldenen Kranz geehrt werden.214 Aischines gelingt es, die Bekränzung zunächst aussetzen zu lassen.215 Erst sechs Jahre später kommt es zu einem Prozess, dessen Ausgang zu einem Urteil über die gesamte Politik des Demosthenes und seiner Verdienste für die Polis gerät. Die athenischen Geschworenen entscheiden nach der Anhörung beider Reden für oder gegen die Person und die Politik des Demosthenes. Dieses pauschale abschließende Urteil und die große Beteiligung der athenischen Bürger an dem Prozess begründen die besondere Bedeutung der Reden um die Bekränzung des Demosthenes für die Einschätzung der Rolle von Ehrungen durch die Polis.216 Denn Aischines und Demosthenes müssen die Person des Demosthe-
214 Aischin. 3, 17; Demosth. 18, 112. 215 Vgl. zur juristischen Sachlage: Wankel, Demosthenes, 13-14. R.A. Baumann, Political Trials in Ancient Greece, London/New York 1990, 96-104, behandelt den Fall als bestbelegtes Beispiel für den Ablauf einer GRAF¾ PARANÒμWN. 216 Wankel, Demosthenes, 37, führt die politische Bedeutung als Grund dafür an; Blass, Beredsamkeit III, 1, 420, »die Wichtigkeit der Sache und die Bedeutung der beiden Gegner«.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
271
nes vollkommen widersprüchlich darstellen. Aischines wird einen Demosthenes zeichnen, der nicht nur durch seine Politik, sondern mit seiner gesamten Person die Polis schädigt. Demosthenes wird auf der anderen Seite versuchen, sich als guten Bürger zu beschreiben, der die normativen Erwartungen seiner Zuhörer in jeder Hinsicht erfüllt und damit gleichzeitig der Polis nützt. Da Demosthenes und Aischines ihre beiden Reden auf derselben Grundlage ihres Wissens über die normativen Erwartungen ihrer athenischen Mitbürger abfassen, verwundert es nicht, dass sich in ihren Reden mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede finden lassen. Abgesehen von ihrem Urteil über die rechtliche Lage und die Politik des Demosthenes zeigen sie sich bemerkenswert einig in ihrer Auffassung dessen, was einen guten Bürger ausmacht, welchen Sinn die Gesetze haben und an wen die Polis aus welchem Grund Ehrungen verleihen sollte. Die Auffassung zur Ehre als Abstraktum und zu den Ehrungen der Polis lässt sich in diesen beiden Reden umso besser zeigen, als sie zwei gänzlich unvereinbare Standpunkte propagieren. Beide Reden skizzieren das Ideal eines guten Polisbürgers und messen Demosthenes daran. Dabei gibt es eine große gemeinsame Schnittmenge zwischen den Verhaltensmustern, die einen guten Polisbürger auszeichnen und jenen, die einen Mann von Ehre ausmachen. Bezugspunkt beider ist die Polis. Wenn Demosthenes und Aischines sich in ihren Reden auf ehrenhafte Verhaltensweisen beziehen, binden sie deren Nutzen und Wert immer an die Polis zurück. In ihrer jeweiligen interessengeleiteten Auswahl von Erzählenswertem aus dem Leben des Demosthenes verlieren die gegnerischen Redner nie die beiden Pole aus den Augen, zwischen denen sich das Verhalten des Atheners Demosthenes bewegt: die Ehre und die Polis. Demosthenes deklariert sein eigenes Verhalten als normgerecht und vorbildlich, seiner erklärten Einschätzung nach ist er sowohl ein guter Polisbürger als auch ein guter Ehrenmann, wobei er Wert darauf legt, beides habituell in seiner Person zu vereinen. Aischines bestreitet das. Seine Rede soll zeigen, dass Demosthenes kein erfolgreicher Politiker ist, und dass er der Polis Athen mehr geschadet als genützt hat. Demosthenes als Ehrenmann zu betiteln, hat Aischines weniger Schwierigkeiten, dennoch versucht er, das Verhalten seines Gegners auch hier als den Normen nicht genügend zu interpretieren. Obwohl beide Redner dieselbe Person mit demselben Maß messen, kommen sie mithilfe selektiver biographischer Daten des Demosthenes zu konträren Ergebnissen. Eines der zentralen Themen beider Reden sind die – finanziellen – Leistungen des Demosthenes für die Polis. Entsprechend Ktesiphons Antrag soll Demosthenes wegen seiner Verdienste als TEICOPOIÒJ, zu dem ihn seine
272
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Phyle gemacht hatte, geehrt werden.217 Den Anlass des Prozesses bildet eine von Demosthenes’ liturgischen Tätigkeiten, und diese werden auch im Verlauf beider Reden immer wieder besprochen. Die Liturgien haben eine Mittlerfunktion zwischen der überlegenen Ehre einzelner Bürger und der ideellen Gleichheit aller Politen. Auch deshalb werden sie mit Vorliebe zur Auskunft über Demosthenes Qualitäten als Polisbürger, der sich in die egalitäre Gemeinschaft der athenischen Bürger einfügen muss, herangezogen. Die Wichtigkeit seiner Leistungen für die Polis und die Selbstverständlichkeit des ehrenhaften Habitus, mit dem er sich für das Gemeinwesen einsetzt, beschreibt Demosthenes folgendermaßen: '%μOˆ μÒN TO…NUN ØPÁRXEN !„SC…NH PAIDˆ μÒN ÔNTI FOIT©N E„J T¦ PROS»KONTA DIDASKALE‹A KAˆ œCEIN ÓSA CR¾ TÕN μHDÒN A„SCRÕN POI»SONTA DI' œNDEIAN, ™XELQÒNTI D' ™K PA…DWN ¢KÒLOUQA TOÚTOIJ PR£TTEIN, CORHGE‹N TRIHRARCE‹N E„SFšREIN, μHDEμI©J FILOTIμ…AJ μ»T' „D…AJ μ»TE DHμOS…AJ ¢POLE…PESQAI, ¢LL¦ KAˆ TÍ PÒLEI KAˆ TO‹J F…LOIJ CR»SIμON EÍNAI, ™PEID¾ DÒ PRÕJ T¦ KOIN¦ PROSELQE‹N œDOXš μOI, TOIAàTA POLITEÚμAQ' ˜LšSQAI, éSTE KAˆ ØPÕ TÁJ PATR…DOJ KAˆ ØP' ¥LLWN `%LL»NWN POLLîN POLL£KIJ ™STEFANîSQAI, KAˆ μHDÒ TOÝJ ™CQROÝJ Øμ©J, æJ OÙ KAL£ G' ÃN § PROEILÒμHN, ™PICEIRE‹N LšGEIN.218 Die Aufwendungen für die Polis fügen sich nahtlos in den Lebenswandel eines Ehrenmannes ein.219 Die demosthenischen Leistungen für das Gemeinwesen erhöhen seine eigene Ehre, weil die Ehrungen und die Ausübung von Ämtern im Rahmen der Polis dem besonders ehrenhaften Status des Demosthenes Rechnung tragen und ihn so immer wieder bestätigen. Außerdem tragen sie zur höheren Ehre Athens bei. Diesen Mechanismus spricht Demosthenes offen an, indem er ihn an einem konkreten Beispiel festmacht, in dem die Polis Athen bekränzt worden ist durch den Einsatz des Redners: KAˆ μ¾N ÓTI μÒN 217 Aischin. 3, 31; Wankel, Demosthenes, 10f. 218 Demosth. 18, 257: »Mir also war es vergönnt, Aischines, in meiner Kindheit standesgemäß zur Schule zu gehen und soviel zu besitzen, wie man braucht, um sich nicht aus Mangel schimpflichem Tun zuwenden zu müssen, und, nachdem ich herangewachsen war, jenen Verhältnissen entsprechend zu handeln: Chöre zu finanzieren, Kriegsschiffe auszurüsten, freiwillige Steuerbeiträge zu spenden, kurz, weder im privaten noch im öffentlichen Leben es an Freigebigkeit fehlen zu lassen, vielmehr dem Staat sowohl als meinen Freunden mich nützlich zu erweisen, des ferneren, als ich mich zum Eintritt in die politische Laufbahn entschlossen hatte, mich auf solche Weise für den Staat zu engagieren, dass ich sowohl von der Vaterstadt wie auch von vielen andern griechischen Staaten vielmals durch Verleihung eines Kranzes geehrt worden bin und dass nicht einmal ihr, meine Gegner, versucht habt zu behaupten, Weg und Ziel meiner Politik seien nicht wenigstens rühmlich gewesen.« Demosthenes lässt später detailliertere Zeugenaussagen über seine Liturgien verlesen, ebd., 167. 219 Demosthenes macht nach eigener Aussage keinen Unterschied zwischen seiner habituell ehrenhaften Großzügigkeit seinen Mitbürgern (™N DÒ TO‹J „D…OIJ) und der Polis (PRÕJ T¾N PÒLIN) gegenüber, ebd., 268.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
273
POLLOÝJ ™STEFANèKAT' ½DH TîN POLITEUOμšNWN, ¤PANTEJ ‡SASIN: DI' ÓNTINA D' ¥LLON ¹ PÒLIJ ™STEF£NWTAI, SÚμBOULON LšGW KAˆ »TORA, PL¾N DI' ™μš, OÙD' ¨N EŒJ E„PE‹N œCOI.220 Auf dieser Ebene funktioniert die gegenseitige Ehrung zwischen Polis und Bürger und stützt damit sowohl die überlieferte Auffassung von Ehre, wie auch den Ablauf der politischen Prozesse der Polis. Das Ziel für den einzelnen Bürger besteht in der Erhöhung seiner eigenen Ehre bzw. in der Erlangung einer konkreten Ehrung durch die Polis. Der Effekt für die Polis liegt in der Bereitschaft ihrer potenten Büger, ihr Vermögen für sie einzusetzen. Ein Funktionieren dieser Symbiose ist für beide Seiten wichtig. Es bleibt aber prekär und ist geeignet, die Integration der athenischen Ehrenmänner jederzeit empfindlich zu stören. Die Harmonie dieses Wechselverhältnisses wird bedroht durch die Tatsache, dass eine Ehrung durch die Polis naturgemäß immer einen einzelnen Bürger unter den übrigen hervorhebt. Einerseits liegt das im Wesen der für die Polis und die Ehre so wichtigen Vergabe von Ehrungen, auf der anderen Seite aber gehen sowohl die Ehrenmänner als auch die Polisbürger von einer prinzipiellen Gleichheit aller Statusgenossen aus. Dabei lassen sich diese Statusgleichen wiederum auf die soziale und auf die politische Ebene verteilen: Die Ebenbürtigen eines Ehrenmannes sind jene, die ihm an gesellschaftlich anerkannter Ehre gleich sind, wobei eine generelle Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft vorausgesetzt wird. Bei den Statusgleichen eines Polisbürgers hingegen handelt es sich um alle athenischen Bürger. Die Ehrungen der Polis nivellieren diesen feinen Unterschied zwischen ehrenhaft Gleichen und politisch Gleichen. Die Notwendigkeit der Balance zwischen politischer Gleichheit und sozialer Ungleichheit spricht Demosthenes selbst an: Er rühmt sich, diese nie aus den Augen verloren zu haben bzw. selbst planvoll an ihrer Aufrechterhaltung mitgewirkt zu haben: "OÚLOμAI TO…NUN ™PANELQE‹N ™F' § TOÚTWN ˜XÁJ ™POLITEUÒμHN: KAˆ SKOPE‹T' ™N TOÚTOIJ P£LIN Aâ, T… TÕ TÍ PÒLEI BšLTISTON ÃN. ÐRîN G¦R ð ¥NDREJ '!QHNA‹OI TÕ NAUTIKÕN ØμîN KATALUÒμENON KAˆ TOÝJ μÒN PLOUS…OUJ ¢TELE‹J ¢PÕ μIKRîN ¢NALWμ£TWN GIGNOμšNOUJ, TOÝJ DÒ μšTRI' À μIKR¦ KEKTHμšNOUJ TîN POLITîN T¦ ÔNT' ¢POLLÚNTAJ, œTI D' ØSTER…ZOUSAN ™K TOÚTWN T¾N PÒLIN TîN KAIRîN, œQHKA NÒμON KAQ' ÖN TOÝJ μÒN T¦ D…KAIA 220 Ebd., 94: »Und noch ein Punkt: dass ihr schon viele Staatsmänner mit einem Kranze geehrt habt, weiß jedermann; einen andern Mann aber, dem die Stadt selbst einen Kranz verdankt, einen Redner und Ratgeber meine ich, außer mir, vermöchte wohl niemand zu nennen.« Weitere Hinweise auf die Aufwendungen des Demosthenes für das Gemeinwesen finden sich ebd., 99. 112. 173. 193, und auch seine Ehrungen durch die Polis führt er mehrfach an, vgl. ebd., 83. 185. 248. Ein Resümee seines Einsatzes zieht er ebd., 297f., und schließt die Folgerung DI¦ TAàT' ¢XIî TIμ©SQAI. (»Deswegen glaube ich die Ehrung zu verdienen.«) an, ebd., 299.
274
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
POIE‹N ºN£GKASA, TOÝJ PLOUS…OUJ, TOÝJ DÒ PšNHTAJ œPAUS' ¢DIKOUμšNOUJ, TÍ PÒLEI D' ÓPER ÃN CRHSIμèTATON, ™N KAIRù G…GNESQAI T¦J PARASKEU¦J ™PO…HSA.221 Diese »Reichen« und »Armen« unter den athenischen Bürgern können nur in einem sehr relativen Sinne als solche bezeichnet werden, denn bei beiden Gruppen handelt es sich um Liturgiepflichtige.222 Die Elastizität, mit der Demosthenes diese Begriffe benutzt, weist auf seine Motive hin. In der Situation vor Gericht braucht er die Stimmen der »Armen«, unter denen die Athener alle Bürger verstanden haben werden, die nicht liturgiepflichtig waren. Die »Reichen« hingegen zeichneten sich durch ihr Vermögen und ihre hohe Ehre aus. Demosthenes will seine Wortwahl offenbar nicht im engeren Sinne verstanden wissen, sondern verlässt sich auf die assoziative Bedeutung beider Termini. Wenn er von einer Umverteilung der Belastungen von den »Armen« zu den »Reichen« spricht, so bindet er die sozial privilegierten Bürger in die Polis ein, in der Gleichheit unter allen Bürgern herrscht. Damit verlieren die an Ehre und anderen Statusmerkmalen Überlegenen an exklusiver Gleichheit, die sie nur gegenüber ihren Standesgenossen empfinden. Die von der Polis propagierte, jüngere politische Gleichheit aller freien Männer gewinnt an Wert. Demosthenes bekennt sich selbst, trotz seiner Liturgien und seines Reichtums, zur bürgerlichen Egalität seiner Zuhörer und deutet die von seinen Zuhörern favorisierte politische Gleichheit als vorrangig. Nachdem er das nach eigenen Worten auch gegen oppositionelle Kräfte in die Tat umgesetzt hat,
221 Ebd., 102: »Ich will nun auf meine politische Tätigkeit zurückkommen, die sich an jene Ereignisse anschloss. Erwägt dabei wiederum, was das Wohl des Staates erheischte. Ich beobachtete nämlich, ihr Bürger von Athen, wie eure Kriegsflotte allmählich verfiel und wie die Reichen dank der Geringfügigkeit ihres Aufwandes so gut wie leistungsfrei wurden, während die mäßig oder gering bemittelten Bürger ihr Vermögen einbüßten, dass zudem der Staat infolgedessen seine Gelegenheiten verpasste. Deshalb schuf ich ein Gesetz, durch welches ich die einen zur rechtmäßigen Leistung zwang, die Reichen nämlich, und andererseits der Ausbeutung der Armen ein Ende setzte, für den Staat aber, was besonders nützlich war, bewirkte, dass die Rüstungen jeweils rechtzeitig zustande kamen.« Vgl. ebd., 3-4; und aus gegnerischer Perspektive Aischin. 3, 222. Wankel, Demosthenes, 551-572, und L. Spengel, Demosthenes Verteidigung des Ktesiphon. Ein Beitrag zum Verständnis des Redners, in: U. Schindel (Hg.), Demosthenes, Darmstadt 1987, 2999, 58f., besprechen die überlieferten Hinweise auf diese trierarchische Reform des Demosthenes. 222 Vgl. Ober, Mass, 216: »Demosthenes’ use of the terminology of wealth and poverty in this passage is an example of emphasizing the relative economic inequalities that existed within the leisure class. The greater part of his audience would not personally have had to contribute to a trierarchy under either the new law or the old one. But Demosthenes assumes that his listeners will be sympathetic to the idea that the richest should be forced to pay heavily and should not be allowed to ›grind down the poor‹.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
275
nutzt er den Vorgang noch einmal rhetorisch zur Versicherung seiner Loyalität gegenüber der Polis.223 Aischines bestreitet, dass sich Demosthenes Athen gegenüber loyal verhalten habe. Dieses Urteil bezieht sich vor allem auf die demosthenische Haltung Philipp gegenüber und seine Politik im Namen Athens allgemein.224 Den Einsatz des Demosthenes für die Polis kann Aischines kaum bestreiten, deshalb beschränkt er sich auf eine Ausführung der juristisch relevanten Punkte und geht nur am Rande auf die Person des Demosthenes ein. Wo er das tut, führt er das gleiche Argument wie Demosthenes in umgekehrter Stoßrichtung: Demosthenes handele stets in seinem eigenen Interesse, ihm gehe es allein um die eigene Ehre und keineswegs um das Wohl des Gemeinwesens. Zu letzterem trage er nur bei, um seinen Anspruch auf Ehre öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Da Aischines ahnen kann, dass Demosthenes seine Leistungen für die Polis wortgewaltig in Szene setzen wird, mahnt er seine Zuhörer, den rhetorischen Finessen seines Gegners nicht zu glauben, sondern auf dessen Lebensführung zu achten: “)NA DÒ μ¾ ¢POPLANî Øμ©J ¢PÕ TÁJ ØPOQšSEWJ, ™KE‹NO μšμNHSQE, ÓTAN FÍ DHμOTIKÕJ EÍNAI: QEWRE‹T' AÙTOà μ¾ TÕN LÒGON, ¢LL¦ TÕN B…ON KAˆ SKOPE‹TE μ¾ T…J FHSIN EÍNAI, ¢LL¦ T…J ™STIN.225 Das Verhalten des Demosthenes demonstriert laut Aischines einen Anspruch auf Ehre, der nicht durch entsprechende Handlungen gerechtfertigt ist. Das gilt für das Verhalten des Demosthenes in der Polis, was die beantragte Ehrung seiner Person fragwürdig macht, und es gilt für die Ehre seiner Person allgemein, an der Aischines zweifelt. Dass Demosthenes die für einen wahren Ehrenmann notwendige Rigorosität der Vergeltung fehlt, macht Aischines mit dem Hinweis auf die Auseinandersetzung des Demosthenes mit Meidias deutlich. Deren einvernehmliche Beschließung durch einen Vergleich wertet Aischines als wenig ehrenhafte Entscheidung.226
223 Demosth. 18, 102-108, erläutert das Durchbringen der Reform, anschließend (ebd., 109) beteuert Demosthenes seine Treue zu Athen und seine Unabhängigkeit von Philipps Gunst und Gaben. 224 Aischin. 3, 54-57; 82f.; 106. 144. 157f. 253. 225 Ebd., 176: »Doch um bei der Sache zu bleiben, – höret meinen Rath. Sobald er sich für einen Volksfreund ausgibt, achtet nicht auf seine Worte, sondern auf sein Leben, und nehmt ihn, nicht wofür er gelten will, sondern so wie er in Wahrheit ist.« Übersetzung A. Westermann. 226 Ebd., 52: KAˆ TAàT' ½DH T¦ PERˆ -EID…AN KAˆ TOÝJ KONDÚLOUJ OÞJ œLABEN ™N TÍ ÑRC»STRv CORHGÕJ íN KAˆ æJ ¢PšDOTO TRI£KONTA μNîN ¤μA T»N TE E„J AØTÕN ÛBRIN KAˆ T¾N TOà D»μOU KATACEIROTON…AN ¿N ™N $IONÚSOU KATECEIROTÒNHSE -EID…OU. (»...oder endlich von den Ohrfeigen, die er als Choreg von Meidias inmitten der Orchestra empfing, und wie er um dreißig Minen ... zugleich die ihm zugefügte Schmach und das vom Volke im Heiligtume des Dionysos gegen Meidias ausgesprochene Vorurteil verschacherte.«) Vgl. ebd., 212, wo Aischines auf die Ohrfeige im Theater zurückkommt und den finanziellen Vergleich am Ende des Streits mit den Worten kommentiert: Ð G¦R ¥NQRWPOJ OÙ KEFAL»N, ¢LL¦ PRÒSODON
276
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Wiederum mahnt Aischines seine Zuhörer, dem Verhalten des Demosthenes, von dem jeder bezeugen könne, wie ehrenrührig es sei, Beachtung zu schenken, und nicht seinen Worten: œPEITA T… SUμBA…NEI TÍ PÒLEI; Oƒ μÒN LÒGOI KALO…, T¦ D' œRGA FAàLA.227 Diese Einschätzung des Aischines steht in engem Zusammenhang mit der Skizzierung seines Ideals eines guten Polisbürgers. Demosthenes zeichnet sich nach Aussage seines Gegners zwar durch öffentliche Auftritte und diverse Beiträge zum Gemeinwesen aus, sie sind aber nicht Produkt eines bestimmten Lebensstils, sondern entspringen den Launen und Interessen des Demosthenes: PERˆ DÒ T¾N KAQ' ¹μšRAN D…AITAN T…J ™STIN; ™K TRIHR£RCOU LOGOGR£FOJ ¢NEF£NH, T¦ PATRùA KATAGEL£STWJ PROšμENOJ: ¥PISTOJ DÒ KAˆ PERˆ TAàTA DÒXAJ EÍNAI KAˆ TOÝJ LÒGOUJ ™KFšRWN TO‹J ¢NTID…KOIJ, ¢NEP»DHSEN ™Pˆ TÕ BÁμA: PLE‹STON D' ™K TÁJ POLITE…AJ E„LHFëJ ¢RGÚRION, ™L£CISTA PERIEPOI»SATO.228 Ein konsistenter Habitus oder auch nur ein konsequentes Verhalten sind hier nicht zu erkennen, nach Aischines kann Demosthenes weder den Lebensstil eines Ehrenmannes noch jenen eines guten Polisbürgers reklamieren. Denn einzelne Beiträge für die Polis, persönliche Feindschaften mit einflussreichen Männern oder ein politischer Führungsstil mögen zwar rhetorisch wirksam aufgebauscht werden, sie bleiben aber episodisch, wenn sie nicht mit einem bestimmten erwarteten Habitus einhergehen.229 Dieser Habitus verknüpft die charakteristischen Verhaltensmuster eines Ehrenmannes mit der politischen Gemeinschaft, indem der Fluchtpunkt aller Handlungen die Polis ist. Das ehrenhafte, agonale, öffentlichkeitswirksame Handeln eines Ehrenmannes zeugt zugleich von der parallelen Zuschreibungsmöglichkeit eines guten Polisbürgers an seine Person, wenn KšKTHTAI. (»Kurz, nicht der Bestimmung der Natur gemäß gebraucht der Mensch den Kopf, sondern als ein Kapital, das Zinsen trägt.«). 227 Aischin. 3, 174: »Und was hat nun der Staat davon? Schöne Worte und unrühmliche Taten.« Und ebd.: DEINÕJ LšGEIN, KAKÕJ BIîNAI. (»So gewaltig er auch als Redner ist, so schlecht ist doch das Leben das er führt.«). 228 Ebd., 173: »Ich frage weiter, welchen Lebenswandel führt er? Zuerst war er Trierarch: nachdem er aber auf lächerliche Weise sich um sein Vermögen hatte bringen lassen, begann er in Rechtssachen Reden um Lohn zu schreiben. Auch hier setzte er sich gar bald in Misskredit, indem er die Reden seiner Clienten an die Gegenpartei verrieth. Und so schwang er sich endlich zur Rednerbühne auf. So weidlich er aber auch immer den Staat auszubeuten wußte, so wenig hat er doch dabei erübrigt.« 229 Die grundlegende Taktik beider Redner besteht laut Cohen, Law, 78f., darin, dem jeweiligen Gegner seine Ehre abzusprechen: »Both Demosthenes and Aeschines depict the other as so thoroughly scurrilous and dishonorable that to acknowledge him as a rival would seem to impugn themselves. Such attacks on the character of one’s opponent are, however, characteristic of insult relationships in a wide variety of cultures. In such relationships the quasi-ritualized act of denigrating the standing of one’s opponent as not within the community of rivals for honor is at the same time an affirmation of that standing. One does not duel, verbally or otherwise, with those genuinely beneath contempt.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
277
seine Handlungen auf das Gemeinwesen ausgerichtet sind, sich darin einbinden und interpretieren lassen und zum Wohl und zur Ehre der Polis beitragen. Einer der Anreize für ein solches Verhalten sind die Ehrungen, die die Polis vergibt. Entsprechend der ehrenhaften Vorstellung von Reziprozität bilden sie die Dankesgabe für den Einsatz für die Polis. Eine Bekränzung, wie sie Demosthenes erfahren soll, wird von beiden Rednern als ein angemessener reziproker Akt der Polis verstanden für eine Politik, die ihr genützt und ihre Ehre gesteigert hat.230 Demosthenes selbst resümiert sein bisheriges Wirken für die Polis in den Termini des reziproken Austausches von Verdiensten, Gaben und Dank: OÙKOàN μšCRI μÒN TîN CRÒNWN ™KE…NWN, ™N OŒJ TAàT' ™PR£CQH, P£NT' ¢NWμOLÒGHμAI T¦ ¥RISTA PR£TTEIN TÍ PÒLEI, Tù NIK©N ÓT' ™BOULEÚESQE LšGWN KAˆ GR£FWN, Tù KATAPRACQÁNAI T¦ GRAFšNTA KAˆ STEF£NOUJ ™X AÙTîN TÍ PÒLEI KAˆ P©SI GENšSQAI, Tù QUS…AJ TO‹J QEO‹J KAˆ PROSÒDOUJ æJ ¢GAQîN TOÚTWN ÔNTWN Øμ©J PEPOIÁSQAI.231 Das öffentliche politische Leben gestaltet sich als ein fortwährender Agon um Ehre. In einer ehrenhaften Gesellschaft hat das Wirken eines Mannes stets einen agonalen Zug. In der Polis wird nicht nur um die soziale Anerkennung der übrigen ehrenhaften Männer gekämpft, sondern der Wettbewerb richtet sich auf politische Ämter, öffentliche Ehrungen und die Führerschaft als Stratege. Auch mit den Zielen, die der Ehrgeiz der besonders ehrenhaften Athener anpeilt, erfolgt deren Bindung an die Polis. Unter den politisch gleichen Bürgern haben besonders privilegierte Athener weiterhin die Möglichkeit, sich mit ihren ungleichen Mitteln einen besonderen Status zu verschaffen, solange dieser mit dem Interesse der Polis begründet werden kann.232 Aischines vergleicht das agonale Wetteifern um die Ehrungen der Polis mit dem größten griechischen Agon: den Wettkämpfen in Olympia. Er 230 Vgl. P. Millett, the Rhetoric of Reciprocity in Classical Athens, in: Gill, Reciprocity, 227253, 230f: »public services are ostensibly mentioned as proof of good character ...; but always implicit is the idea of reciprocity: giving something good to the polis that deserves an appropriate return.« 231 Demosth. 18, 86: »Bis zu jener Zeit also, wo dies geschah, habe ich anerkanntermaßen in jeder Hinsicht das Beste für den Staat gewirkt: Meine Ratschläge und schriftlichen Anträge hatten in euren Beratungen Erfolg, meine Anträge wurden ausgeführt und brachten der Stadt und mir und allen Bürgern Ehrenkränze ein, und schließlich habt ihr in der Überzeugung, dass diese Politik erfolgreich war, für die Götter Opfer- und Dankfeste veranstaltet.« Vgl. ebd., 269; und zu Aischines ganz ähnlicher Auffassung des Austausches von Leistung und Bekränzung, Aischin. 3, 47. 49. 182. 196. 232 Vgl. Dover, Morality, 231: »When someone is honoured, the honour is necessarily withheld from others who wanted it just as badly; no one can win unless someone else loses, and an honour shared with everybody is a doubtful honour. Hence the FILOTIμ…A of individuals within the community as a whole took the form of a ›contest of good men‹«.
278
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
ermahnt die Athener, wie die olympischen Schiedsrichter nur die jeweils besten Leistungen zu honorieren, um die Anstrengung der ehrgeizigsten Männer zu fördern: ØPOL£BETE TO…NUN Øμ©J AÙTOÝJ EÍNAI ¢GWNOQšTAJ POLITIKÁJ ¢RETÁJ K¢KE‹NO ™KLOG…SASQE ÓTI, ™¦N μÒN T¦J DWRE¦J ÑL…GOIJ KAˆ ¢X…OIJ KAˆ KAT¦ TOÝJ NÒμOUJ DIDîTE, POLLOÝJ ¢GWNIST¦J ›XETE TÁJ ¢RETÁJ, ™¦N DÒ Tù BOULOμšNJ KAˆ TO‹J DIAPRAXAμšNOIJ CAR…ZHSQE, KAˆ T¦J ™PIEIKE‹J FÚSEIJ DIAFQERE‹TE.233 Das ehrenhafte Streben danach, erster und bester zu sein und allen anderen überlegen, verliert seinen Selbstzweck und dient der Polis. Zugleich hebt Aischines die Männer, die wegen ihrer Verdienste von der Polis geehrt worden sind, auf eine Stufe mit den bewunderten Olympioniken. Jeder von der Polis geehrte Athener kann sich mit ihnen in eine Reihe stellen, muss sich aber auch an ihnen messen lassen. Natürlich wird Demosthenes von Aischines als zu leicht für diese herausragende Ehrung befunden.234 Aischines führt den Vergleich des olympischen Agons mit dem Wetteifern der Athener um die Ehrungen der Polis hier explizit an, um seinen Gegner zu diskreditieren. Die Auffassung des öffentlichen Lebens als eines beständigen Agons um die Ehre und die Ehrungen der Polis durchzieht aber seine gesamte Rede.235 Auch Demosthenes teilt die Vorstellung, dass das Ehrstreben des Einzelnen in der Rivalität mit anderen Bürgern für die Polis von Vorteil ist. Der Polis als der Gesamtheit aller Bürger kommt dabei die Rolle der signifikanten anderen zu, die die Zuschreibung von Ehre an eine Person vornehmen. Voraussetzung dafür sind die öffentlichen ehrenhaften Taten einer Person, die mit einer ebenfalls öffentlichen Akklamation ihrer beanspruchten Ehre vergolten werden. Wie dieser soziale Mechanismus in einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Art in der Polis umgesetzt wird, erklärt Demosthenes so: +Aˆ μ¾N PERˆ TOà G' ™N Tù QE£TRJ KHRÚTTESQAI, ... ¢LL¦ PRÕJ QEîN OÛTW SKAIÕJ EÍ KAˆ ¢NA…SQHTOJ !„SC…NH, éST' OÙ DÚNASAI LOG…SASQAI, ÓTI Tù μÒN STEFANOUμšNJ TÕN AÙTÕN œCEI ZÁLON Ð STšFANOJ, ÓPOU ¨N ¢NARRHQÍ, TOà DÒ TîN STEFANOÚNTWN E†NEKA SUμFšRONTOJ ™N Tù QE£TRJ G…GNETAI TÕ K»RUGμA; Oƒ G¦R ¢KOÚSANTEJ ¤PANTEJ E„J TÕ POIE‹N Eâ T¾N PÒLIN PROTRšPONTAI, KAˆ TOÝJ ¢PODIDÒNTAJ T¾N C£RIN μ©LLON ™PAINOàSI TOà
233 Aischin. 3, 180: »Stellt euch nun vor, ihr säßet bei einem Wettkampf politischer Tüchtigkeit zu Gericht, und bedenket dass, wenn ihr die Belohnung nur Wenigen und Würdigen und in gesetzmäßiger Weise verleihet, ihr viele Bewerber um den Preis der Tüchtigkeit haben werdet, werfet ihr sie hingegen an den ersten Besten, den danach gelüstet, weg, dann auch Gefahr lauft die Gutgesinnten zu verderben.« 234 Ebd., 181f. Vgl. ebd., 186-188. 235 Ebd., 23. 42f. 169.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
279
STEFANOUμšNOU: DIÒPER TÕN NÒμON TOàTON ¹ PÒLIJ GšGRAFEN.236 Um seinem Gegner Aischines den Wind aus den Segeln zu nehmen, betont Demosthenes hier den Vorteil der Polis und spielt sein eigenes Interesse an einem möglichst großen Forum für seine Ehrung herunter.237 Selbst wenn man diese Interpretation seiner Worte in Rechnung stellt, so beschreibt Demosthenes doch offensichtlich ein für beide vorteilhaftes Verhältnis zwischen der Ehre des einzelnen Bürgers und der Polis. Die Ehrungen der Polis, darin sind sich Demosthenes und Aischines einig, können als ein Analogon zum Siegespreis in Olympia betrachtet werden, der ja auch aus einer vornehmlich symbolischen Auszeichnung besteht und hier lediglich in den politischen Raum verlegt ist. Das Ringen um die öffentliche Proklamation der eigenen Ehrenhaftigkeit ist ein unentbehrliches Rad im Getriebe der athenischen Demokratie. Die Polis hat es geschafft, sich eine der zentralen Verhaltensweisen ehrenhafter Männer, das agonale Streben nach öffentlicher Anerkennung ihrer Ehre, zunutze zu machen. Die erfolgreiche Integration des agonalen Zuges der Ehre in das politische System verdankt sich der Personalunion des athenischen Demos als politischer Souverän, der die Ehrungen vergibt, mit dem Kreis der an Ehre ebenbürtigen Männer, die die notwendige soziale Anerkennung verleihen. Weil die für die Anerkennung von Ehre notwendige Öffentlichkeit auch im politischen Rahmen in adäquater Weise hergestellt werden muss, ist der Ort der Proklamation der Bekränzung kein unwesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kontrahenten. Juristisch stellt die für Demosthenes beantragte Bekränzung im Theater einen der Hauptklagepunkte des Aischines dar. Ihm zufolge kann die Ehrung nicht an diesem Ort erfolgen, das sei gesetzeswidrig.238 Das von Aischines erwähnte und zitierte Gesetz ist nicht erhalten, ebenso wenig wie das von Demosthenes herangezogene, das die Bekränzung im Theater erlauben soll.239 Die Auseinandersetzung um diesen Punkt spitzt sich auf die Frage nach der Art der Öffentlichkeit in beiden Räumen zu. Ausschlaggebend scheinen bezeichnenderweise die Menge und Zusammensetzung des Publikums gewesen zu sein, vor dem die Ehrung 236 Demosth. 18, 120: »Was nun ferner die Ausrufung im Theater betrifft, ... Indessen, bei den Göttern, kannst du dir aus lauter Beschränktheit und Blödigkeit, Aischines, nicht klarmachen, dass der Kranz für den zwar, der bekränzt wird, dieselbe Auszeichnung bedeutet, wo immer sie bekannt gemacht wird, dass es aber im Interesse der Bekränzenden geschieht, wenn die Ausrufung im Theater stattfindet? Denn alle, die es hören, werden angespornt, dem Staat gute Dienste zu erweisen, und sie rühmen eher die, welche den Dank abstatten, als den Empfänger des Kranzes. Darum hat der Staat dieses Gesetz gegeben.« 237 Vgl. Spengel, Demosthenes, 60f. 238 Aischin. 3, 32-34. 239 Demosth. 18, 120. Vgl. zum juristischen Gefecht und zu den Forschungsbeiträgen zum Gesetzeslaut Wankel, Demosthenes, 644-650.
280
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
vollzogen wird. Der ursprüngliche Antrag des Ktesiphon sieht eine öffentliche Ehrung des Demosthenes im Theater vor, in dem auch Nichtathener und Nichtbürger präsent sein können. Aischines dagegen hält eine Bekränzung des Demosthenes im Bouleuterion für angemessen.240 Hier wären dann nur die Ratsmitglieder anwesend, alternativ würden sich in der Ekklesia die athenischen Bürger befinden. Ausgehend von einem proportionalen Verhältnis von Ehre und Öffentlichkeit, würde die potentiell größere und vielschichtigere Versammlung im Theater einen größeren Resonanzraum für die Ehre des Demosthenes darstellen als die per definitionem beschränkte athenische Volksversammlung. In diesen Zwist um den Grad an Öffentlichkeit, der der demosthenischen Ehrung zukommt, spielen einige Charakteristika von Ehre hinein, die sich weniger reibungslos in die Polis integrieren lassen, als das bei den Zügen der öffentlichen Anerkennung von Ehre und der Versicherung von Gleichheit gelingt. Aischines spricht von einer Rivalität der Ehrungen, die die Polis vergibt, mit Ehrungen und Ehre auf anderen Ebenen, die in der gleichen Öffentlichkeit proklamiert werden wie die vom athenischen Demos beschlossenen Auszeichnungen. Anlässlich der Aufführung von Tragödien etwa, so erläutert Aischines, könne man die Ankündigung der Bekränzung verdienter Männer durch ihre Phyle oder ihren Demos vernehmen, ja, es würden sogar die Ehrungen durch andere Poleis proklamiert.241 Genau diese Praxis ist Aischines ein Dorn im Auge, denn sie gefährdet die Souveränität der Polis als wichtigste Quelle von Ehre. KAˆ TAàT' œPRATTON OÙC éSPER Oƒ ØPÕ TÁJ BOULÁJ TÁJ ØμETšRAJ STEFANOÚμENOI À ØPÕ TOà D»μOU, PE…SANTEJ Øμ©J KAˆ μET¦ YHF…SμATOJ, POLL¾N C£RIN KATAQšμENOI, ¢LL' AÙTOˆ PROELÒμENOI, ¥NEU DÒGμATOJ ØμETšROU. ™K DÒ TOÚTOU TOà TRÒPOU SUNšBAINE TOÝJ μÒN QEAT¦J KAˆ TOÝJ CORHGOÝJ KAˆ TOÝJ ¢GWNIST¦J ™NOCLE‹SQAI, TOÝJ DÒ ¢NAKHRUTTOμšNOUJ ™N Tù QE£TRJ μE…ZOSI TIμA‹J TIμ©SQAI TîN ØPÕ TOà D»μOU STEFANOUμšNWN.242 Um die hohe Wertschätzung von Ehren, 240 Aischin. 3, 32: Ð G¦R NÒμOJ DIARR»DHN KELEÚEI, ™¦N μšN TINA ¹ BOUL¾ STEFANO‹, ™N Tù BOULEUTHR…J ¢NAKHRÚTTESQAI: ™¦N DÒ Ð DÁμOJ, ™N TÍ ™KKLHS…v, ›¥LLOQI DÒ μHDAμOà‹. (»Das Gesetz nämlich verordnet ausdrücklich, wenn einen der Rat bekränze, im Rathause dies bekannt zu machen, dagegen in der Volksversammlung, wenn einen das Volk bekränze, sonst aber nirgends.«) Vgl. dazu Wankel, Demosthenes, 14, nach dem der Antrag des Ktesiphon nach der Bewilligung durch die BOUL», aber vor dem Passieren der Ekklesia ausgesetzt worden war. 241 Aischin. 3, 41f. 242 Aischin. 3, 42f: »Und dies thaten sie nicht mit eurer Genehmigung und kraft eines deshalb von euch gefassten Beschlusses, wie bei allen ihren Ansprüchen auf Erkenntlichkeit doch die hier bei euch vom Rate oder Volke Bekränzten thun, sondern ohne euer Wissen und Willen aus eigener Machtvollkommenheit. Die Folge war, dass Zuschauer, Choregen und Schauspieler belästigt und die im Theater Ausgerufenen höher geehrt wurden, als die vom Volke Bekränzten«.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
281
die nicht im Poliskontext lagen, zu unterbinden, verboten die athenischen Bürger via Gesetz die Praxis der Ehrung im Theater. Eine Ausnahme bilden die Ehrungen durch andere Poleis, diese können weiterhin durchgeführt werden, allerdings muss der Kranz vom Geehrten später der Göttin Athena geweiht werden.243 Die Erklärung des Aischines für diese Regelung verknüpft den Aspekt der politischen Loyalität zur eigenen Polis mit der Absage an panhellenische Ehre: ¢LL' OÍμAI DI¦ TÕ XENIKÕN EÍNAI TÕN STšFANON KAˆ ¹ KAQIšRWSIJ G…GNETAI, †NA μHDEˆJ ¢LLOTR…AN EÜNOIAN PERˆ PLE…ONOJ POIOÚμENOJ TÁJ PATR…DOJ CE…RWN GšNHTAI T¾N YUC»N.244 Die Bedeutung der Ehre, die auf die Polis bezogen ist und aus dem Wirken in ihr resultiert, steht dem traditionellen Ehrbegriff der Aristokraten entgegen, der auch die panhellenische Ebene umfasst. Aischines hatte Demosthenes zwar nicht unter die Ehrenmänner gezählt, ihm aber zumindest soviel Ehre zugesprochen, dass das demosthenische Streben nach der polisübergreifenden Akklamation seiner Ehre und die Bereitschaft, dafür Freundschaften einzugehen, die den Interessen Athens zuwiderliefen, wahrscheinlich blieb.245 Aischines setzt sich hier quasi für ein Monopol der Polis auf die Vergabe von öffentlichen Ehrungen ein. Nach seiner Darstellung rangieren die übrigen Ehrungen durch konkurrierende Verbände in der Wertschätzung der Bürger hinter denen der Polis, was sich unter anderem in den Volksbeschlüssen zeigt. Aischines stellt die Priorität der Ehrung durch die Polis einerseits als unangefochtenes Faktum dar, andererseits haben seine Ausführungen den Charakter eines Postulats, das zwar weitgehend erfüllt wird, das aber in jedem Einzelfall wieder gestellt werden muss. Das strukturelle Problem besteht darin, dass jede Ehrung eines einzelnen Bürgers ein Ungleichgewicht in der grundsätzlichen Gleichstellung aller athenischen Bürger bewirkt. Auffälligerweise macht Aischines dem Demosthenes nicht den Vorwurf der Hybris, der ihm helfen könnte, die demosthenische Ehrung als zuviel des Guten und tendenziell polisgefährdend zu etikettieren. Die übergroße Ehre eines Mannes allein reicht offenbar für den Tatbestand der Hybris nicht aus. Der Habitus des Demosthenes lässt sich zwar als ehrenhaft charakterisieren – nicht zuletzt von Demosthenes selbst –, der entscheidende Schritt zur Hybris, d. h. zum unangemessenenen Anspruch auf Ehre und ihren Missbrauch aber fehlt. Hinzu kommt, dass die 243 Ebd., 44-46. Der historische Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist umstritten, inschriftliche Zeugnisse über die Bekränzung von Athenern im Theater widerlegen Aischines Worte, vgl. Wankel, Demosthenes, 647f. 244 Ebd., 46: »Ich denke vielmehr, weil der Kranz von auswärts kommt, deshalb wird er geweiht, damit niemand zum Nachteil seiner Gesinnungstüchtigkeit die Gunst des Auslandes höher als die des eigenen Vaterlandes achte.« 245 Aischin. 3, 54-57.
282
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Ehrung offiziell von der Polis vergeben wird, deren Bürger sich deshalb als dem Geehrten überlegen empfinden können, weil sie es sind, die die Entscheidung über die Ehrung getroffen haben. So klingt der in vielen anderen Gerichtsreden zu findende Vorwurf der Hybris des Demosthenes bei Aischines zwar an, er findet sich aber so versprengt in seinen Ausführungen, dass er eher wie eine stilistische Variation zur Beschreibung der Person des Gegners wirkt, als wie ein Politikum.246 Dagegen stehen Demosthenes leitmotivisch vorgetragenen Beteuerungen, ein guter Bürger und der Polis nützlich zu sein. Den Nutzen sieht er einerseits in der Artikulierung und Durchführung des Willens der athenischen Bürgerschaft und andererseits in der Vermehrung der Ehre und des Ruhms der Polis Athen.247 Demosthenes will sein Engagement deutlich so verstanden wissen, dass er dem Demos die Priorität vor seinen panhellenischen Verbindungen gibt und seine Ehre im Rahmen der Polis verwirklicht, nicht auf panhellenischer Ebene.248 Auch das generell so fruchtbare Feld der ehrenhaften Konfliktführung findet in den beiden Reden kaum Niederschlag. Die Rivalität des Aischines und Demosthenes erschöpft sich in gegenseitigen Beleidigungen, dem Absprechen der Ehrenhaftigkeit des jeweiligen Gegners und den Verhandlungen ihrer Streitigkeiten in diversen Prozessen. Für das Austragen eines Konflikts vor Gericht fordert Demosthenes dabei die offene, erklärte Annahme einer Herausforderung, wie sie unter Ehrenmännern üblich ist: EÍTA KATHGORE‹ μÒN ™μOà, KR…NEI DÒ TOUTON…, KAˆ TOà μÒN ¢GîNOJ ÓLOU T¾N PRÒJ ™μ' œCQRAN PROÏSTATAI, OÙDAμOà D' ™Pˆ TAÚTHN ¢PHNTHKëJ ™μOˆ T¾N ˜TšROU ZHTîN ™PITIμ…AN ¢FELšSQAI FA…NETAI.249 Die juristische Konfliktaustragung vor Gericht wird hier zum üblichen Prozede-
246 Ebd., 52. 94. 237. 245. 247 Demosth. 18, 10. 30. 86. 94. 108. 173. 180. 197f. 269. 321. 248 Vgl. ebd., 322: ÐR©TE Dš. OÙK ™XAITOÚμENOJ, OÙK E„J '!μFIKTÚONAJ D…KAJ ™PAGÒNTWN, OÙK ¢PEILOÚNTWN, OÙK ™PAGGELLOμšNWN, OÙCˆ TOÝJ KATAR£TOUJ TOÚTOUJ êSPER QHR…A μOI PROSBALLÒNTWN, OÙDAμîJ ™Gë PRODšDWKA T¾N E„J Øμ©J EÜNOIAN. TÕ G¦R ™X ¢RCÁJ EÙQÝJ ÑRQ¾N KAˆ DIKA…AN T¾N ÐDÕN TÁJ POLITE…AJ EƒLÒμHN, T¦J TIμ£J, T¦J DUNASTE…AJ, T¦J EÙDOX…AJ T¦J TÁJ PATR…DOJ QERAPEÚEIN, TAÚTAJ AÜXEIN, μET¦ TOÚTWN EÍNAI. »Schaut selber: Nicht, als meine Auslieferung gefordert wurde, nicht, als sie mich vor ein Aphiktyonengericht zitierten, nicht, wenn sie drohten, nicht, wenn sie Versprechungen machten, nicht, als sie diese verruchten Gesellen wie Hunde auf micht hetzten, in keinem Fall habe ich meine loyale Gesinnung euch gegenüber verraten. Denn gleich von Anfang an ist der Weg, den ich mit meiner Politik wählte, geradlinig und korrekt gewesen, nämlich der Ehre, der Macht, dem Ruhm des Vaterlandes zu dienen, sie zu mehren, ganz darin aufzugehen.« 249 Ebd., 15: »Ferner bin ich es zwar, den er beschuldigt, aber diesem hier macht er den Prozess. Das Motiv des ganzen Rechtsstreites ist seine Feindschaft gegen mich, und dennoch ist er mir bei keiner Gelegenheit entgegengetreten, um die Sache auszutragen, sondern sucht augenscheinlich einen andern um seine Bürgerehre zu bringen.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
283
re der Konfliktführung unter Ehrenmännern und unterliegt denselben Kriterien für ehrenhaftes Verhalten.250 Aischines und Demosthenes zeigen in ihren Reden ein ähnliches Bild von der Bedeutung und Funktion der Ehrungen, die die Polis vergibt. Ein Athener qualifiziert sich für eine Polisehrung durch seinen Einsatz für das Gemeinwesen, seine Leistung, die den Ruhm Athens erhöht und allgemein seinen Nutzen für die Polis. Beide Redner wissen um das für die Polis und für den Einzelnen gewinnbringende Verhältnis, das aus der willkommenen Bestätigung der Ehre eines athenischen Mannes und dem notwendigen Aufwand einzelner Bürger für die Polis besteht. Uneinig sind sich Demosthenes und Aischines lediglich darüber, ob Demosthenes dieser Ehrung würdig ist. Aischines behandelt das Thema der Polisehrungen zudem auf einer generalisierteren Ebene. Er bemängelt die Konkurrenz von Ehrungen verschiedener Provenienz, die um die Aufmerksamkeit des athenischen Demos buhlen. Außerdem beklagt er die Inflationierung der Ehrungen durch die Polis, die einen Qualitätsverlust der dafür erbrachten Leistungen im Vergleich zur Väterzeit bedeuten: DWREAˆ DÒ KAˆ STšFANOI KAˆ KHRÚGμATA KAˆ SIT»SEIJ ™N PRUTANE…J PÒTERA TÒTE ÃSAN PLE…OUJ À NUN…; TÒTE μÒN ÃN SP£NIA T¦ KAL¦ PAR’ ¹μ‹N KAˆ TÕ TÁJ ¢RETÁJ ÔNOμA T…μION: NUNˆ DÒ KATAPšPLUTAI TÕ PR©GμA KAˆ TÕ STEFANOàN ™X œQOUJ, ¢LL' OÙK ™K PRONO…AJ POIE‹SQE.251 Seiner Meinung nach wäre es für die Polis nützlicher, weniger Ehrungen zu vergeben, die dann gleich dem olympischen Kranze über alles geschätzt würden und einen eifrigen Wettkampf der Bürger untereinander provozieren würden.252 Tatsächlich ist die Anzahl der Ehrungen, mit der die Polis Athen ihre Bürger auszeichnete, im Laufe des 4. Jahrhunderts angestiegen.253 Die Aussagen des Aischines, die auf das Jahr 330 v. Chr. datiert werden können,254 verdeutlichen die Entwicklung, die die Polisehrungen gemacht haben. Sie sind zu einem selbstverständlichen Instrument der Polis geworden, mit dem die Verdienste von athenischen Bürgern belohnt werden. Auch auf der anderen Seite scheint ein entsprechender Adaptionsprozess stattgefunden zu haben: Die Ehrungen der Polis tragen in erheblichem Maße zur Ehre eines 250 Dies ist ein eindeutiger Beleg für die Grundthese Cohens, Law, passim, bes. das Kapitel »Litigation as feud«, 87-118. 251 Aischin. 3, 178: »Und waren Belohnungen und Bekränzungen und Auszeichnungen und Speisungen im Pritaneion damals häufiger als jetzt? Damals waren Auszeichnungen bei uns selten und der Ruf der Tüchtigkeit galt noch für ehrenvoll: jetzt aber ist das aus der Mode gekommen, und ihr bekränzt die Leute aus Gewohnheit, und nicht mit Vorbedacht.« 252 Ebd., 179f. 253 Veyne, Brot, 241-243. 254 Zürcher, Demosthenes, S. 143, Anm. 2.
284
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Mannes bei. Offensichtlich wird der Anspruch auf Ehre zunehmend an die Polis gestellt. D. h. die Gesamtheit des Demos fungiert als Öffentlichkeit, innerhalb derer Ehre beansprucht, verwirklicht und demonstriert werden kann. Damit erweist sich die Ehre am Ende des Integrationsprozesses in die Polis als stark an sie gebunden: Die Polisbürgerschaft ist die Quelle von Ehrungen und bietet zugleich den Resonanzraum für ihre öffentliche Darstellung. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft aller Bürger, sich politisch als gleich zu begreifen. Denn nur unter Statusgleichen kann ein Wettbewerb um die Ehre stattfinden und nur von Statusgleichen kann der Anspruch eines Mannes auf Ehre bestätigt werden. Gegen das Bewusstsein der Gleichheit aller Athener sprechen die von den Rednern gemachten elitären Aussagen, die ihre jeweiligen Gegner abwerten sollen, und zugleich ihre Zuhörer von ebenso geringer Herkunft deskreditieren.255 Demosthenes und seine Kollegen gehen offenbar nicht davon aus, mit solchen Äußerungen die Ablehnung ihrer Mitbürger zu provozieren, eine Schlussfolgerung, die D. Cohen zu den eindrucksvollsten der ganzen Kranzrede zählt.256 Das Verhalten der Athener zeigt sicherlich, wie Cohen ausführt, eine Gewöhnung an die elitäre Anpruchshaltung einiger Männer, die öffentlich geehrt werden.257 Die angedeutete Erklärung für dieses Phänomen liegt in der traditionell bedingten Tolerierung hierarchischer Positionierungen, wie sie in einer ehrenhaften Gesellschaft üblich sind.258 Der ehrenhafte Anspruch auf Distinktion hat jedoch gerade in der demokratischen Polisgesellschaft nichts verloren. Um das Verhalten der Athener zu verstehen, muss die Begründung Cohens um eine Differenzierung der Bezugsebenen erweitert werden: Gleichheit und Distinktion existieren in der athenischen Gesellschaft immer auf politischem und sozialem Gebiet. Die Distinktion, die Demosthenes beansprucht, ist sozialer Natur und wegen seiner herausragenden Persönlichkeit und Mittel allen Mitbürgern evident. Sie wird von ihnen sogar gesteigert, 255 Demosth. 18, 261-268 ist ein typisches Beispiel für diese Praxis. 256 Cohen, Law, 80f: »One of the most striking features of Demosthenes’ argument is its blatant anti-egalitarian stance. ... Why does he not fear that the audience will identify themselves with Aeschines and resent these arrogant imprecations?« 257 Cohen schließt die Anwort auf die von ihm aufgeworfene Frage direkt an, ebd., 81: »One part of the answer to these questions doubtless has to do with the fact that the case fundamentally rests upon a claim of extraordinary distinction. Demosthenes’ main strategy is to demonstrate his worthiness to receive the crown commemoration his life of service to Athens ... To accomplish this he must unequivocally demonstrate his entitlements to honor: birth, wealth, power, and civic service. Demosthenes’ success in this case indicates that the Athenian audience was prepared to accept such anti-egalitarian claims from those whom they acknowledged as worthy of such honor.« 258 Giordano, Ehrvorstellungen, 128, belegt, dass »Ehre schließlich von den Handelnden selbst als Instrument sozialer Differenzierung betrachtet wird.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
285
indem Demosthenes mit weiteren Ehrungen versehen wird. Gleichzeitig präsentiert sich Demosthenes aber als ein politisch Gleicher. Denn einerseits betont er immer wieder, wie er sein ungleiches Vermögen zum Nutzen der Polis einsetzt und auf der anderen Seite akzeptiert er den athenischen Demos als seine Statusgleichen, wenn er von ihnen eine Bestätigung seiner Ehre erwartet. Er legt die habituellen Formen eines Ehrenmannes an den Tag und wählt als die über seine Ehre entscheidende öffentliche Instanz die Polisgemeinschaft.259 Das Verhalten des Demosthenes zeigt exemplarisch die Verbindung zwischen Ehre und Polis: Ihre handlungsleitenden Normen ergänzen und unterstützen sich, soweit es möglich ist. Bei der Vergabe und Beanspruchung von Polisehrungen ist das hervorragend möglich. Diesen Befund bestätigen auch andere Reden des Demosthenes, in denen es um die Vergabe von Ehrungen durch die Polis geht. Im Zentrum der Klage- bzw. Verteidigungsreden steht dabei immer die Frage, ob eine Person der Ehre würdig ist, die ihr zuerkannt werden soll. Das fragt Diodoros die athenischen Geschworenen in der 355 v. Chr. gehaltenen Rede KAT¦ '!NDROT…WNOJ PARANÒμWN, ein unbekannter Kläger im Jahre 352 mittels einer Rede gegen Aristokrates, der eine Ehrung für den nicht zur athenischen Bürgerschaft gehörenden Charidemos von Oreos beantragt hatte; und der ebenfalls unbekannte Sprecher der 51. demosthenischen Rede sucht 359 v. Chr. in der Position des Verteidigers seinen berechtigten Anspruch auf die Ehre des trierarchischen Kranzes zu begründen.260 Den drei Reden ist die Beschäftigung mit den Kriterien für ehrenhaftes Handeln gemein. Unabhängig vom Anlass der jeweiligen Ehrung geht es den Sprechern immer auch darum, die Ehre der in Rede stehenden Person zu überprüfen und den Zuhörern ein Urteil darüber nahezulegen. Offensichtlich ist die Vergabe von Ehrungen nicht vollends und ausschließlich an eine Leistung für die Polis gekoppelt, sondern die zu ehrende Person muss sich in ihrem Habitus einer öffentlich sichtbaren Bestätigung ihres besonders ehrenhaften Status würdig erweisen. Um ihren eigenen Anspruch auf Ehre zu untermauern bzw. um die avisierte Ehrung ihrer Gegner zu hintertreiben, wird die Ehrenhaftigkeit der jeweiligen Person anhand ihrer habituellen Formen für gegeben befunden bzw. für unzulänglich erklärt. Das 259 Ober, Mass, 291: »Undeniably, aristocratic values were incorporated into the political ideology of classical Athens. However, the aristocratic ethos and terminology did not serve to suppress or undermine egalitarian ideals, but rather aristocratic ideals were made to conform to the needs of the democratic state. The ›nationalization‹ of the ideals of kalokagathia and nobility of descent does not represent a rejection of equality among citizens; rather, it demonstrates the power of popular ideology to appropriate and transvalue terms that had formerly implied the exclusivity of a few within the citizen group.« 260 Die Datierungen der Reden folgen jeweils Blass, Beredsamkeit, III, 258 (Demosth. 22), 292 (Demosth. 23), 243 (Demosth. 51).
286
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
agonale, öffentlichkeitswirksame und reziproke Verhalten der Protagonisten steht deshalb in allen drei Reden zur Diskussion. Die ehrenhaften habituellen Formen interessieren die Redner nicht nur als Attribute einer Person, sondern sie bilden darüber hinaus überhaupt einen Maßstab für das Verhalten athenischer Bürger. Es tauchen auch in überpersönlichem Kontext in den Aussagen des Demosthenes immer wieder die habituellen Formen auf. Ehrenhaft konnotierte Werte wie die Konfliktbereitschaft eines Mannes oder die Gleichheit aller Ehrenhaften werden in den Reden immer wieder auf einem höheren Reflexionsniveau und als generelles Problem der Polis behandelt. So geht Demosthenes in den drei Reden ausführlich und deutlich auf die funktionalen Defizite ein, die sich aus der Integration von Ehrenmännern in die athenische Polis ergeben. Hier setzen die 22., 23. und 51. Rede jeweils verschiedene Schwerpunkte, sie behandeln aber die gleiche Problematik des noch mangelhaften Funktionierens von Ehrungen und Ehre innerhalb des demokratischen Systems der Polis. Eine der ehrenhaften Verhaltensweisen, die in den Reden besprochen werden, ist das agonale Verhalten als Ausdruck der Konfliktbereitschaft des Ehrenmannes, das in der Bereitschaft zur Rache gipfelt. Diodoros beginnt seine Rede gegen Androtion in der erklärten Absicht der Vergeltung dessen, was ihm dieser angetan hat. Die Parteigänger Euktemon und Diodoros, die gemeinsam gegen Androtion stehen, verbindet eine lange persönliche Feindschaft mit dem Angeklagten. Zwar fällt auch das Wort »Hybris« bei der Rekapitulation der Attacken des Androtion, meistenteils scheinen sich die Auseinandersetzungen aber auf der gerichtlichen Ebene abgespielt zu haben.261 Diodoros will sich mit seiner Klage an Androtion rächen, hält es aber nicht für nötig, (erneut) die privaten Verfehlungen seines Widersachers aufzulisten, sondern beschränkt sich auf die sachlich relevanten Punkte, die das Auftreten des Androtion in der Öffentlichkeit betreffen.262 Auch hier haben sich die einzelnen Racheakte der Kontrahenten offensichtlich von der Straße in die Gerichte verlagert. Doch Diodoros deutet mit diesen Worten schon den interpretatorischen Balanceakt an, den das Prozessieren als Racheakt erfordert: Auf der einen Seite verunglimpft er nämlich seinen Gegner Androtion, die athenischen Gerichte mit seinen kleinlichen Privathändeln zu behelligen, und auf der anderen Seite definiert er seine eigene Klage als einen rächenden Akt in einer langfristig angelegten Feindschaft: ™Gë TO…NUN TAàTA μÒN OÙ PAR¦
261 Demosth. 22, 1-4. 262 Ebd.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
287
μIKRÕN ¢GWNIZÒμENOJ PAR' Øμ‹N ¢PELUS£μHN.263 Derselben Strategie bedient sich auf der anderen Seite Androtion, wenn er behauptet, Euktemon und Diodoros wollten sich für seine Tätigkeit als Eintreiber der Eisphora rächen, die er im Auftrag der Polis durchgeführt habe.264 Das rhetorische Lavieren zwischen dem offen erklärten Motiv der persönlichen ehrenhaften Rache einerseits und dem gleichzeitigen Dementi, die Gerichte als Mittel ihrer persönlichen Feindseligkeiten zu benutzen andererseits, ist in den athenischen Gerichtshöfen keine Seltenheit.265 Es verweist auf ein strukturelles Problem. Die Geschworenengerichte haben sich zu Foren entwickelt, in denen der Streit zwischen athenischen Männern ehrenhaft ausgetragen werden kann. Das bedeutet für die Polisgesellschaft eine erfolgreiche Neutralisierung bedrohlichen Konfliktpotentials. Der Preis dafür besteht in dem beständigen Versuch der athenischen Ehrenmänner, die Öffentlichkeit, die die Gerichte ihrer Selbstdarstellung bieten, für ihre eigenen Interessen zu okkupieren und andere juristische Aufgaben, wie etwa die Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen, als sekundäres Ziel zu betrachten. Diodoros macht mit seiner Identifizierung des Prozesses als einem Akt der Rache deutlich, dass er ein Mann von Ehre ist, der den Konflikt nicht scheut, sondern sich mit seinem Gegner auf gleicher Ebene und mit den gleichen Mitteln auseinandersetzt. Der Konflikt zwischen ihnen eskaliert nicht. Denn ungleich den Auseinandersetzungen auf der Straße bietet das athenische Rechtssystem keinen Weg, der automatisch oder intendiert zu einem neuen Level der Aggression führen könnte. Der Klage eines Ehrenmannes gegen seinen Widersacher folgt im nächsten Schritt die Gegenklage seines Kontrahenten. Eine Ausweitung des Konflikts lässt sich innerhalb der Gerichtshöfe nur durch die Einbeziehung von Freunden oder Verwandten der Gegenpartei oder durch die Beschuldigung schwerwiegenderer Vergehen erreichen. Soweit aus der 22. Rede ersichtlich, geben sich hier beide Prozessparteien mit wechselseitigem Klagen und Prozessieren zufrieden. Ebendas halten auch die Gegner des unbekannten Sprechers der 51. Rede des Demosthenes PERˆ TOà STEF£NOU TÁJ TRIHRARC…AJ für die beste Taktik. Der Redner, der sich schon im Besitze des trierarchischen Kranzes 263 Ebd., 3: »ihn aber will ich mit eurer Hülfe für jetzt sowohl als auch für alle Zukunft unschädlich zu machen suchen.« Übersetzung A. Westermann. 264 Ebd., 49f. 60-62. 265 Vgl. zum Sykophantentum D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, London 1978, 62-66; und Christ, Athenian, 48-71. Letzterer bringt das Problem strukturell auf den Punkt, ebd., 161: »On the one hand, Athenians expected a man not to shrink back from the aggression of others but to avenge, in or out of court, sligthts to himself and his dependents. On the other hand, Athenians viewed the unprovoked initiation of aggression or the unnecessary escalation of a conflict into a lawsuit as ugly manifestations of quarrelsomeness and contentiousness.«
288
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
wähnte, weil er mit der Ausrüstung seiner Triere als erster fertig war, sieht sich mit einem Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit seiner Ehrung konfrontiert.266 Er eröffnet seine Verteidigungsrede, indem er ironisch der Verwunderung über das Verhalten seiner Gegner Ausdruck verleiht: %„ μÒN ÓTJ PLE‹STOI SUNE…POIEN, ð BOUL», TÕ Y»FISμ' ™KšLEUE DOàNAI TÕN STšFANON, K¨N ¢NÒHTOJ ÃN E„ LABE‹N AÙTÕN ºX…OUN, +HFISODÒTOU μÒNOU μOI SUNEIRHKÒTOJ, TOÚTOIJ DÒ PAμPÒLLWN. NàN DÒ Tù PRèTJ PARASKEU£SANTI T¾N TRI»RH TÕN TAμ…AN PROSšTAXEN Ð DÁμOJ DOàNAI, PEPO…HKA DÒ TOàT' ™Gè: DIÒ FHμI DE‹N AÙTÕJ STEFANOàSQAI.267 Der Witz der Aussage besteht darin, dass die Vergabe des trierarchischen Kranzes an eine Bedingung geknüpft ist, die der Sprecher klar erfüllt hat, dass es aber auf der anderen Seite unausgesprochene Kriterien für den Erhalt der Ehrung gibt, von denen der Sprecher nichts zu wissen vorgibt. Die simple Frage, wer als erster mit seinem Projekt ins Ziel gekommen ist, tritt plötzlich in den Hintergrund zugunsten dominanterer Kriterien eines Anspruchs auf Ehre. Die Art, wie der unbekannte Redner der 51. Rede des Demosthenes die Situation schildert, legt einen Vergleich mit dem berühmten Wagenrennen in der Ilias nahe.268 Demnach befindet sich der Sprecher in der Lage des Antilochos: Nachdem er in einem Wettkampf mit zuvor festgelegtem Reglement eine bestimmte Platzierung erreicht hat, und damit den Preis bzw. die Ehrung beanspruchen kann, muss er erleben, wie seine langsameren Konkurrenten ihm die verdiente Ehre streitig machen. In beiden Fällen wird die Person des Schiedsrichters bzw. desjenigen, der die Ehrung vergibt, aufgefordert, das Urteil noch einmal zu überdenken. Da sich an dem Ergebnis des Zieleinlaufs nichts ändern wird, gibt es offenbar andere Kriterien für die Vergabe der Ehrung, die den Inhalt des nochmaligen Überdenkens bilden könnten. Wie bei Homer kommt auch hier der soziale Status der Beteiligten ins Spiel. Die in einem aktuellen Wettkampf Unterlegenen wollen die Rangfolge, die die Ehrung des Siegers herstellt, nicht akzeptieren, weil sie nicht die sozialen Positionen der Wettkämpfer in der athenischen Gesellschaft abbildet. Diejenigen Trierarchen, die sich dem Sprecher der Rede an Ehre überlegen fühlen, erwarten, ungeachtet des Ergebnisses eines speziellen Wettbewerbs, von der Polis geehrt 266 Es handelt sich dabei nicht um eine Klage, die vor ein Geschworenengericht kommt, sondern um einen formellen Einspruch an den Rat, vor dem wohl auch die Rede gehalten worden ist, vgl. Schäfer, Demosthenes, 152f. 267 Demosth. 51, 1: »Wenn der Volksbeschluss, Männer des Rates, anordnen würde, den Kranz jenen zu geben, die mit den meisten Männern gekommen sind, wäre es unnütz für mich, ihn zu fordern, weil mir nur Kephisodotos geholfen hat, jenen aber sehr viele. Das Volk aber hat den Schatzmeister angewiesen, ihn dem zu geben, der als erster die Triere ausgerüstet hat; und das bin ich gewesen. Deshalb erkläre ich, dass ich bekränzt werden sollte.« 268 Vgl. Cohen, Law, 77.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
289
zu werden.269 Ihr Anspruch auf Ehre, die ihnen aufgrund ihres hohen sozialen Status zukommt, steht gegen die von der Polis definierten Kriterien für die Vergabe einer bestimmten öffentlichen Ehrung. Die Unvereinbarkeit beider Seiten bezüglich ihrer Vorstellungen über die legitime Ehrung eines Atheners verdeutlicht nach Cohen ein Schlüsselproblem der athenischen Demokratie, das aus der durch Ehre geprägten sozialen Umgebung resultiert: »As profoundly illustrated by the chariot race at the funeral games at the end of the Iliad, rivalries cannot be adequately mediated by such ›artificial‹ competitions if all the participants think that they deserve to win because of who they are as opposed to what they do. Individuals who feel themselves as good as, or superior to, the ›winner‹, will simply not be content to accept the result. In the case of the trierarchs, even though the matter should have been entirely clear cut, it winds up before the Council because what is really at stake is a larger ongoing competition for honor, reputation, and supremacy in social and political hierarchies.«270 Sicherlich kämpfen die Trierarchen um die Gewinnung von Ehrungen bzw. Ehre, denn dabei handelt es sich um das in der athenischen Gesellschaft nach wie vor am höchsten gehandelte Gut. Die grundsätzlich einleuchtende Argumentation Cohens differenziert allerdings nicht zwischen sozialen und politischen Ehrungen und kann die weitgehende Integration der athenischen Ehrenmänner in die Polis daher weder konstatieren noch erklären. Einen enormen Reibungsverlust erleidet die athenische Demokratie zweifellos durch das kontinuierliche Bestreben einiger athenischer Männer, in einem offiziell egalitären System eine durch besondere Ehre herausgehobene Position zu erlangen.271 Cohen begreift die ehrenhafte, agonistische Gesellschaft Athens als der athenischen Demokratie so unvereinbar gegenüberstehend, dass weder die Akzeptanz der demokratischen Verfahren in der Gesellschaft noch auf der anderen Seite die Integration der ehrenhaften Verhaltensweisen in die politischen Bedingungen der Polis gelingt. Zwar erweitern die athenischen Männer das Repertoire ihrer Konfliktführung um 269 Bereits Adkins, Merit, 56, zieht die Verbindung zwischen der konfliktträchtigen Vergabe von Ehrungen nach dem Wagenrennen und der grundsätzlichen Situation in den athenischen Gerichtshöfen: »This is a hopeless tangle of values. Unless the allotment of prizes bears some relation to the result of the race, there is no point in running at all, since the prizes could be distributed before the race starts. Accordingly, some attention must be paid to the result; and yet clearly in this society some attention must be paid to the arete of the respective competitors as well. Such a situation can only lead to doubt, confusion, and argument. In a chariot race, this may be unimportant; but we have here in microcosm the tangle of values which prevailed in the Athenian law-courts and assembly, with such disastrous results.« 270 Cohen, Law, 77. 271 Ebd.: »This speech thus reveals the tension between the egalitarian democratic ideology of Athenian institutions and the hierarchical claims which are implicit within the agonistic framework in which those institutions are embedded.«
290
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
das Prozessieren in den athenischen Gerichtshöfen, dies stellt nach Cohen aber keine Einbindung in die Polis dar, sondern lediglich eine Beanspruchung demokratischer Institutionen zum Nutzen der Ehrenmänner.272 Ein so grundsätzlicher Antagonismus zwischen ehrenhafter athenischer Gesellschaft und demokratischer Polis lässt sich jedoch kaum aufrechterhalten.273 Ein wichtiger Grund dafür ist die Identität der ehrenhaften athenischen Gesellschaft mit der demokratischen Polis in Gestalt der Polisgesellschaft, die nicht nur das soziale Feld dominiert, sondern auch den politischen Souverän darstellt. Die Brüche und Unvereinbarkeiten zwischen der Ehre und der Polis resultieren aus den unterschiedlichen Regeln dieser Systeme der Vergesellschaftung. Bezogen auf den aktuellen Fall des Sprechers der 51. demosthenischen Rede besagen die öffentlich verkündeten Beschlüsse der Polis, dass derjenige Trierarch geehrt werde, der seine Triere als erster fertigstellt. Die unausgesprochenen Regeln der Ehre hingegen versichern allen Trierarchen wegen ihres hervorragenden sozialen Status einen Anspruch auf Ehre. Die Ehrungen durch und in der Polis sind die Ursache des Konflikts. Dabei resultieren die unvereinbaren Interessengegensätze, die die Rede spiegelt, aber nicht daraus, dass die Ehrenmänner ihren Streit nun auch in die Polis hineintragen, weil auch sie nun Ehrungen vergibt. Vielmehr gehören die Regeln, wie man in der Polis Ehre erlangt, nicht zum gefestigten sozialen Wissen derjenigen Trierarchen, die gegen die Ehrung des Sprechers Einspruch erheben. Die Ironie des Sprechers der 51. Rede deutet das an und kann durchaus als auf seine Gegner gemünzter Spott verstanden werden, der ihr offenbar mangelndes Wissen – bzw. dessen Vorschützen – darum, wie man in der Polis eine Ehrung erringt, ins Lächerliche zieht. So interpretiert stellen die Worte, mit denen der Sprecher seine Rede beginnt, die formal simple Anforderung der Polis, erster zu sein, den unangemessenen, weil sozial fundierten Einsprüchen seiner Gegner gegenüber. Nach dieser Lesart sind es die Gegner des Sprechers, die sich nicht entsprechend den gesellschaftlichen Normen verhalten, weil sie die für die Polisehrungen geltenden Normen übersehen. Diese verknüpfen eine öffentliche Ehrung mit einer Leistung für die Polis, ungeachtet des sozialen Status des Mannes, der sich für eine solche Ehrung qualifiziert. Die Nichtbeachtung des sozialen Status gilt dabei nur in einem sehr relativen Sinn, 272 Cohen, Law, 183. 273 Wie schwierig eine solch strikte Abgrenzung der beiden Systeme voneinander ist, zeigt sich an dieser Stelle etwa darin, dass Cohen selbst seine Klassifikationen nicht immer aufrechterhalten kann. Einerseits spricht er vom Wettbewerb um den Vorrang »in social and political hierarchies«, andererseits bescheidet er der athenischen Polis zwei Sätze später eine »egalitarian democratic ideology«, die in Spannung steht zu den »hierarchical claims« der Gesellschaft, ebd. [meine Hervorhebung].
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
291
weil es sich bei den Athenern, die um eine solche Polisehrung konkurrieren, schon um eine Auswahl der ehrenhaftesten handelt. Die unterschiedlichen Kriterien von Ehre und Polis für die Ehrung eines Atheners begründen die widerstreitenden Ansprüche der gegnerischen Parteien der 51. Rede. Hier stehen sich tatsächlich zwei Antagonisten gegenüber, die die rivalisierenden Normen der Ehre einerseits und der Polis andererseits personifizieren. Der offizielle Grund des Einspruchs gegen die Ehrung des Sprechers wird nur angedeutet, offensichtlich besteht er in der formalen Beschwerde vor dem Rat, der Sprecher habe nicht alle Bedingungen für die Bekränzung erfüllt.274 Das eigentliche Motiv für den Streit beider Parteien, das in den unterschiedlichen Ansichten über die Qualifikation für eine Ehrung liegt, wird nicht zur Sprache gebracht. Denn bei der Norm der Ehre handelt es sich um ein soziales Wissen, das schlecht verbalisiert werden kann. Hier ist der Sprecher eindeutig im Vorteil: seine Kriterien für die Vergabe von Ehrungen wurden zuvor von der Polis deklariert, während sich die Kriterien für die soziale Ehre nicht im Einzelnen darlegen lassen. An dieser Stelle endet die Parallele zwischen dem Wettkampf der Trierarchen und dem homerischen Wagenrennen: Die Ehrungen, die die Polis vergibt und die Ehre, die innerhalb der Polis erworben werden kann, sind nicht notwendiger Bestandteil der gesellschaftlich erworbenen Ehre eines Mannes. Eine ehrenhafte Gesellschaft ist ohne den agonalen Wettstreit schwerlich vorstellbar, sehr gut aber ohne ein politisches demokratisches System. Das Wagenrennen bei Homer ist geeignet, die soziale Rangfolge der Ehre unter den Helden zu demonstrieren bzw. herzustellen. Achill verfügt über das soziale Wissen um diese Funktion und schlägt deshalb eine vom Ergebnis des Rennens abweichende Platzierung vor.275 Als Veranstalter des Wettbewerbs räumt Achill der grundsätzlichen Einschätzung der Ehre des Eumelos den Vorrang ein vor dem durch einen Unglücksfall verfälschten Resultat eines einzigen Agons. Im Gegensatz zu den Trierarchen ist es jedoch nicht Eumelos, der trotz seines schlechten Abschneidens einen ihm gebührenden Rang fordert, sondern es ist die Idee und Entscheidung des Achill als dem Stifter der Ehrung. Erst als der Konsens aller Beteiligten – einschließlich des Antilochos – über diese Entscheidung feststeht, wird Eumelos überhaupt wieder erwähnt als derjenige, der seine Ehrung freudig in Empfang nimmt.276 Im Falle der Trierarchen sind es hingegen die Konkurrenten des Sprechers, die den Ausgang des Agons anfechten, und sie können sich nicht auf einen einmaliges, zufälliges Unglück berufen, wie es dem Eumelos geschehen ist. Dass sie 274 Demosth. 51, 17. 275 Hom. Il. 23, 536-538. 276 Ebd., 558-565.
292
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
dennoch ihren Einspruch vor den Rat bringen, zeigt die relative Fremdheit der demokratischen Polis in einer ehrenhaften Gesellschaft, deren Agone normalerweise für die Ehre eines Mannes und für die soziale Hierarchisierung konstituierend sind. Vermutlich würde es keinem der Trierarchen einfallen, ohne triftigen Grund den Ausgang eines olympischen Agons anzufechten. Die Agone der Polis hingegen, bei denen ebenfalls eine bestimmte Leistung mit der Bekränzung des Siegers belohnt wird, sind noch nicht voll integriert in die Vorstellungen eines ehrenhaften Agons, der einen Mann mit Ehre versieht. Die Kriterien für die Vergabe von Polisehrungen können grundsätzlich in Frage gestellt werden, sie bilden nicht einen selbstverständlich anerkannten Bestandteil der Ehre eines Mannes wie es etwa die olympischen Agone oder die täglichen verbalen Auseinandersetzungen auf der Straße tun. Auf der anderen Seite stehen die Ehrungen der Polis so hoch in der Wertschätzung der Athener, dass sie offensichtlich der Ansicht sind, es lohne sich, darum zu wetteifern und zu prozessieren. Diese ambivalente Einstellung wird in der 51. Rede repräsentiert durch den Sprecher und seine Gegner: Die gegnerischen Trierarchen zweifeln das Ergebnis des Agons an, weil ihnen die gesellschaftlichen Konsequenzen der Aufwertung der Ehre des Sprechers nicht angenehm sind. Der Sprecher macht sich über seine Gegner lustig, weil sie die Bedeutung des Agons der Polis unterschätzt und nicht begriffen haben, dass die politische Ehrung zwar nach anderen Regeln funktioniert als die soziale, nichtsdestotrotz aber deutliche Auswirkungen auf letztere hat. Die Szene vor dem Rat unterscheidet sich fundamental von der Preisvergabe nach dem Wagenrennen, weil die homerischen Helden einem Unglücksfall während des Wettstreits Rechnung tragen, um die ehrenhafte Rangfolge, die durch den Agon bestätigt wird, nicht zu verfälschen. Es ist dies eher eine systemstabilisierende Geste, die Achill einleitet. Die Trierarchen hingegen wenden sich gegen die Vergabe einer politischen Ehrung aufgrund eines zuvor klar definierten Agons und ziehen damit die konstituierende Wirkung der politischen Ehrung für die Ehre eines Atheners in Zweifel. Der Sprecher der 51. Rede reagiert belustigt auf diese Realitätsverweigerung seiner Gegner. Die Zweifel der Trierarchen an der Rechtmäßigkeit der Ehrung können innerhalb der demokratischen Polis ausgedrückt und gelöst werden. Es ist nicht so, dass mit den politischen Institutionen Athens die Ehre eines Mannes nicht beeinflusst und sein Status nicht definiert werden könnte, wie Cohen behauptet: »These institutions, moreover, are seen as unable to ›resolve‹ the questions of hierarchy, as opposed to merely providing another forum where they can be expressed and contested. Naturally, there will be a ›winner‹, who will, in the end, receive the crown. This hardly means, how-
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
293
ever, that the others will accept this result either as ›just‹, or as resolving the competition for honor, reputation, influence, and power which brought them before the Council in the first place. Indeed, whichever way the decision falls, those who are dissatisfied will only have further grounds to desire to assert their superiority. How could it be otherwise when the decision apparently has so little do with the official criteria for victory and so much to do with the influence and status of the antagonists? In such a case litigants could only take the decision to be a judgment about their honor and relative social standing.«277 Wiederum geht Cohen von einem Wettstreit um die Ehre aus, der sich unter den Athenern abspielt und in die Polis hineingetragen wird in dem Sinne, dass die politischen Institutionen als Mittel in diesem Kampf fungieren, ohne ihn zu beeinflussen. Diese Perspektive übersieht die Dynamik, die das Ringen um politische Ehrungen dem traditionellen Agon um Ehre verleiht. Denn die Polisbürgerschaft bietet eine aufmerksame Öffentlichkeit für die Demonstration und Eroberung von Ehre. Die Gleichheit aller Bürger gewährleistet ein Wetteifern mit Ebenbürtigen um eine politische Ehrung. Und das umso mehr, als sich praktisch an den Wettbewerben um die Polisehrungen nur besonders ehrenhafte Männer beteiligen, da nur sie über das Vermögen verfügen, Trieren auszurüsten oder Chöre auszubilden. Auch in diesem exklusiveren Sinne ringen die Beteiligten des Agons mit Gleichgestellten. Wegen der Identität der Polisbürger mit der Öffentlichkeit und wegen der ähnlichen Kriterien für politisches Handeln und für ehrenhaftes Handeln werden die Wettkämpfe um Ehre nicht in die Polis hineinverlagert, sondern die Polis wird integriert als eine wichtige Möglichkeit, die Ehre eines Atheners zu bestätigen und öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen. Die Polis ist ein Forum, auf dem – ebenso wie auf der olympischen Rennbahn – Ehre gewonnen werden kann. Deshalb sind die Intitutionen der Polis eben doch geeignet, den Kampf um Ehre zu entscheiden. Denn die offiziellen Kriterien für die Verleihung des Kranzes fallen zusammen mit der Entscheidung über den sozialen Status eines Mannes. Vor Gericht entscheidet eine Auswahl der Bürgerschaft über die Legitimation eines Anspruchs auf Ehre. Wie die langwierigen Prozesse und die langfristigen Feindschaften zwischen ehrenhaften Athenern zeigen, ist der Wettkampf um die Ehre mit dem abschließenden Urteil nicht beendet. Die Kontinuität der Wettkämpfe um Ehre ergibt sich aber nicht daraus, dass ein Urteil eines athenischen Geschworenengerichtes oder des athenischen Rates keine Bedeutung für die Ehre eines Mannes hat, sondern sie liegt in der Natur der Sache: Ehre erwirbt man in der andauernden Auseinandersetzung mit gleichgestellten Männern. 277 Cohen, Law, 77.
294
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Das bedeutet, dass die Polisehrungen nur als für die Ehre eines Mannes konstituierend angesehen werden, wenn die Polisbürgerschaft einen Verband von Gleichen bildet. Der Sprecher der 51. Rede spricht die noch unvollkommene Gleichheit aller Bürger der Polis offen an. Dabei bezieht er sich zum einen auf die relative Gleichheit der athenischen Bürger untereinander und zu den Trierarchen, zum anderen stellt er die Rhetoren den einfachen Bürgern gegenüber und bemängelt ihren zu großen Einfluss bei der Willensbildung in der Ekklesia und im Gericht. Der Sprecher unterstreicht die Gleichheit seines eigenen Status mit dem der Mitglieder des Rates, die ihm den Kranz verleihen wollten. Damit schmeichelt er nicht nur seinen Zuhörern, sondern er wertet auch die ihm zukommende Ehrung auf.278 Die Zuhörer werden aufgefordert, in ihrem eigenen Interesse die Ehrungen, die sie vergeben, so hoch zu halten, dass sie den Agon um sie lohnen und konsequent jene Bürger zu ehren, die den Rat und die Bürgerschaft als Stifter von Ehrungen anerkennen. Zum Punkt der Gleichheit macht der Sprecher der 51. Rede noch weitere, weit allgemeinere Bemerkungen, die eine Kritik an der Praxis der athenischen Demokratie überhaupt darstellen. Er fordert nicht nur generell die Gleichbehandlung armer und reicher Bürger,279 sondern kritisiert die Neigung der Bürger, das engagierte Betreiben der politischen Geschäfte den Reichen, den besonders Ehrenhaften und den Rednern zu überlassen, die das auch gerne übernehmen.280 Offensichtlich handelt es sich bei dem öffentlichen Auftreten um eine Frage der Ehre. Mit dem Verfügen über eine hohe Ehre geht in der Regel auch ein hohes Vermögen an materiellen Ressourcen und rhetorischer Bildung einher. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich in den Gremien der athenischen Demokratie jene Männer zu Wort melden, deren Familien seit Generationen zur athenischen Oberschicht gehörten. Hier wird die verfassungsmäßige Gleichheit aller in der Verfassungsrealität durch das Distinktionsmerkmal der Ehre eingeschränkt.281 Obwohl die Gleichheit aller Bürger in beständiger Spannung zur Gleichheit aller Ehrenhaften und zur Ungleichheit aller um Ehre wettstreitenden Athener steht, hatten die Polisehrungen doch offenbar eine so egalisierende Funktion, dass sich einige Männer bemüßigt fühlten, ihren in der Polis nicht mehr angemessen repräsentierten besonderen sozialen Status durch die Ausstattung ihres Oikos deutlich zu machen. Nach Ansicht des Redners der 23. demosthenischen Rede hat das Streben nach sozialer Distinktion unter den Männern, die in der Polis eine hervorragende Rolle spielen, zugenom278 Demosth. 51, 2. 279 Ebd., 11. 280 Ebd., 19; vgl. ebd., 21f.; Demosth. 22, 37. 281 Vgl. K. Raaflaub, Des freien Bürgers Recht der freien Rede, in: Eck, Studien, 7-57; S.S. Wolin, Transgression, Equality, and Voice, in: Ober und Hedrick, Dêmokratia, 63-90.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
295
men.282 In den verklärten Zeiten des Aristeides, Themistokles oder Kimon war dem nicht so, wie der Redner behauptet. Er beschreibt den Zustand einer ausgewogeneren Gleichheit unter den Polisbürgern so: KAˆ G£R TOI TÒTE μÒN T¦ μÒN TÁJ PÒLEWJ ÃN EÜPORA KAˆ LAμPR¦ DHμOS…v, „D…v D' OÙDEˆJ ØPE‹CE TîN POLLèN.283 Dass sich das geändert hat, ist unter anderem das Ergebnis einer falschen Politik bei der Vergabe von Ehrungen. Da die 23. Rede sich gegen die Vergabe einer bestimmten Ehrung an Charidemos von Oreos, einen Nicht-Athener, ausspricht, ist es für den Redner sinnvoll, die athenische Praxis der Ehrungen im Allgemeinen zu kritisieren. Trotz dieser eindeutig tendenziösen Interessenlage des Sprechers werfen seine Ausführungen ein bezeichnendes Licht auf die Auswirkungen der hohen Wertschätzung von Ehre auf die athenische Polis. Anhand der Beispiele des Themistokles und Miltiades entwirft der Redner ein Idealbild des Verhältnisses von ehrenhaften Männern und Bürgerschaft: OÙ CALKOàJ †STASAN OÙD' ØPERHG£PWN. OÙK ¥RA TO‹J ˜AUTOÝJ ¢GAQÒN TI POIOàSIN C£RIN EÍCON; SFÒDRA G', ð ¥NDREJ '!QHNA‹OI, KAˆ ¢PED…DOS£N GE KAˆ AØTîN K¢KE…NWN ¢X…AN: ÔNTEJ G¦R POLLOà P£NTEJ ¥XIOI PROÜKRINON ™KE…NOUJ AØTîN ¹GE‹SQAI. œSTI DÒ SèFROSIN ¢NQRèPOIJ KAˆ PRÕJ ¢L»QEIAN BOULOμšNOIJ SKOPE‹N POLÝ μE…ZWN TIμ¾ TÁJ CALKÁJ E„KÒNOJ TÕ KALîN K¢GAQîN ¢NDRîN KEKR…SQAI PRèTOUJ.284 Der Unterschied zum gegenwärtigen Zustand liegt einerseits in der veränderten Macht der Polis Athen, andererseits aber auch in dem Umgang der Bürger mit den politischen Möglichkeiten der Polis. Wie Aischines in seiner Rede gegen Ktesiphon, so beklagt der Sprecher der 23. demosthenischen Rede bereits 20 Jahre früher eine Inflationierung der Polisehrungen. Eine allzu große Freigiebigkeit und vor allem eine nicht konsequente Verknüpfung der Vergabe von Ehrungen mit dem Erbringen
282 Demosth. 23, 208: NàN D' „D…v μÒN ˜K£STJ TîN T¦ KOIN¦ PRATTÒNTWN TOSAÚTH PERIOUS…A [™STˆN] éSTE TINÒJ μÒN AÙTîN POLLîN DHμOS…WN O„KODOμHμ£TWN SEμNOTšRAJ T¦J „D…AJ KATESKEU£KASIN O„K…AJ, GÁN D' œNIOI PLE…W P£NTWN ØμîN TîN ™N Tù DIKASTHR…J SUNEèNHNTAI: »Jetzt aber besitzen unsere Staatsmänner durch die Bank ein derartiges Privatvermögen, dass mancher von ihnen schon ein Wohnhaus sich gebaut weit stattlicher als viele Staatsgebäude, und mancher sich mehr Land zusammengekauft als ihr hier im Gerichtshof allesammt besitzet«. Übersetzung A. Westermann. 283 Ebd., 206: »Damals freilich war auch der öffentliche Wohlstand ein gedeihlicher und blühender und der Einzelne ging in der Gesammtheit völlig auf.« 284 Ebd., 196f: »[Sie haben den Themistokles und den Miltiades und viele Andere] doch nicht in Erze aufgestellt, noch sonst mit Ehren überhäuft. So erwiesen sie sich also gegen ihre eigenen Wohltäter undankbar? Im Gegentheil, Männer von Athen, dankbar genug, und zwar in einer Weise, die ihrer selbst wie jener würdig war; denn obwohl sie alle brav und würdig waren, so übertrugen sie doch jenen den Oberbefehl über sich. Für Leute aber, welche verständig sind und die Dinge nach ihrem wahren Werthe würdigen, ist’s eine weit größere Ehre, denn ein Bild von Erz, unter wackeren Männern für die ersten erklärt zu werden.«
296
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
von Leistungen für die Polis entwerte die Ehrungen, so der Sprecher.285 Da die Polis aber auf den Agon der Athener um die Polisehrungen angewiesen ist, weil die wichtigsten kriegerischen und kultischen Aufgaben nur wegen des Ehrgeizes hervorragender Männer übernommen werden, ist der Prozess der Vermehrung von Ehrungen dazu geeignet, das Funktionieren der Polis zu gefährden. Ebenso kontraproduktiv wirke sich die Erwartung einiger Amtsträger aus, sie könnten sich durch die Ausübung ihrer politischen Tätigkeit bereichern.286 An dieser Entwicklung ist der athenische Demos selbst schuld, so der Redner, weil er eine falsche Politik der Ehrungen verfolgt habe, die aus einer grundsätzlichen Einstellung zur Ehre und zu besonders ehrenhaften Bürgern resultiert sei. Demosthenes erklärt die erdrückende Vormachtstellung einiger weniger Bürger in der Polis mit dem Verhalten der athenischen Bürger in der Ekklesia und den anderen demokratischen Gremien. Vor dem Hintergrund der strukturellen Einbindung der ehrenhaften Gesellschaft in die Polis lesen sich seine Ausführungen als ein Manifest zu großer Ungleichheit innerhalb der Polisbürgerschaft: A‡TIOI D' Oƒ T¦ TOIAàTA GR£FONTEJ, KAˆ SUNEQ…ZONTEJ Øμ©J ØμîN μÒN AÙTîN KATAFRONE‹N, ›NA D' À DÚO QAUμ£ZEIN ¢NQRèPOUJ. EÍQ' OáTOI KLHRONOμOàSI TÁJ ØμETšRAJ DÒXHJ KAˆ TîN ¢GAQîN, ØμE‹J D' OÙD' ÐTIOàN ¢POLAÚETE, ¢LL¦ μ£RTURšJ ™STE TîN ˜TšRWN ¢GAQîN, OÙDENÕJ ¥LLOU μETšCONTEJ À TOà ™XAPAT©SQAI.287 Die Kritik des Demosthenes zielt auf den Kern des Verhältnisses zwischen Polis und Ehre: Die politische Gleichheit aller Bürger steht der sozialen Ungleichheit einer durch Ehre strukturierten Gesellschaft gegenüber. Zwar ist die demokratische Gleichheit nicht nur nominell und wirkt namentlich in Abgrenzung von den übrigen Gruppierungen der Bevölkerung als ein Privileg, aber die traditionell wirksame Überlegenheit einiger besonders ehrenhafter Männer kann sich in Entscheidungs- und Krisensituationen immer wieder durchsetzen. So groß die Integrationsleistung der Polis auch ist, die Ehre wirkt kontinuierlich als ein Störfaktor in der Verfassung der Demokratie. Die Hinweise des Demosthenes auf die funktionalen Defizite der athenischen Demokratie sind zahlreich in den drei Reden, die wohl alle innerhalb eines Jahrzehnts gehalten worden sind. Immer wieder weist der Redner auf die Probleme hin, die die fragile Gleichheit der Bürger in der athenischen 285 Ebd., 198-203. 286 Demosth., 51, 14. 287 Demosth., 23, 210: »Hieran sind nun die Leute Schuld, die durch dergleichen Anträge euch gewöhnen euch selbst gering zu achten und einen oder zwei Menschen anzustaunen. Und diese sind es, die von eurem Ruhm und euren Gütern Besitz ergreifen, während ihr das leere Nachsehen habt und Zeugen seid, wie Andere sich güthlich thun, ohne weiter etwas davon zu haben als dass ihr die Betrogenen seid.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
297
Demokratie, die Beanspruchung der demokratischen Gremien durch ehrenhafte Streithähne oder aber die speziellen Kriterien der Polis für Ehrungen mit sich bringen. Trotz großer struktureller Ähnlichkeiten zwischen einer durch Ehre verfassten Gesellschaft und der Verfassung der athenischen Demokratie bleiben viele dysfunktionale Elemente bestehen. Sie werden von den Zeitgenossen vor allem auf politischem Gebiet benannt, weil die politische Verfasstheit der Athener als eine gemachte behandelt wird. Das erleichtert die Erkenntnis der nichtgewollten Prozesse und deren Verbalisierung. Die Vergabe von Ehrungen durch die Polis ist eine Praxis, die eine klar geplante Integrationsleistung erbringen soll. Die ehrenhaften Männer Athens werden zur agonalen Auseinandersetzung angespornt, damit eine bestimmte Leistung für die Gemeinschaft erbracht wird. Die gelungene Erfüllung einer prestigeträchtigen Aufgabe erhöht an sich schon die Ehre des Betreffenden; zusätzlich wird er mit einer öffentlichen Ehrung ausgezeichnet. Die Mechanismen, wie man zu Ehre gelangt, erscheinen innerhalb der Polis transparenter als auf gesellschaftlichem Gebiet, hier können sie ausgesprochen und kritisiert werden.288 Die Streitigkeiten um die Polisehrungen und die grundsätzlichen Kritikpunkte des Demosthenes zeigen, dass das Miteinander von Ehre und Polis selbst in dem Punkt große Schwierigkeiten bereitete, in dem es die größte strukturelle Ähnlichkeit zwischen beiden gab. Das von der Polis geförderte und für einen Ehrenmann unabdingbare Streben nach Ehre durch den agonalen Wettkampf ergänzte sich nicht nahtlos, sondern problematisch, konnte aber weitestgehend im Rahmen der Polis und ihrer Gremien gelöst werden. Ein völlig anderes Zeugnis für die Vorstellung der Athener über die Gleichheit aller Bürger bei gleichzeitiger Ungleichheit des ehrenhaften sozialen Status liegt mit der 24. Rede des Lysias vor. Die Rede verdankt ihre Prominenz einerseits ihrer Thematik, die ein seltenes Licht auf den Umgang der Athener mit behinderten Mitbürgern wirft, und andererseits ihrer Form, die auffallend unkonventionell ist, weshalb die Autorenschaft des Lysias mehrfach in Frage gestellt worden ist.289 Das Datum der Rede ist nicht zu ermitteln, sicher ist sie aber im 4. Jahrhundert gehalten worden.290 288 Das bedeutet allerdings keineswegs, dass die Polis die einzig legitime Quelle von Ehre war, wie D. Whitehead, Competitive Outlay and Community Profit: FILOTIμ…A in Democratic Athens, 60, meint: »As far as the polis was concerned, philotimia, even ... an excess of it, could be not merely accomodated but actively welcomed, provided always that the community itself was acknowledged to be the only proper source of tim» and thus the only proper object of the energy and (in particular) the expense that the philotimos sought to lay out.« 289 Blass, Beredsamkeit, 1, 637, führt die Gründe für die Echtheitsdiskussion an: »es schien undenkbar, dass Lysias für einen Menschen dieses Standes in solcher Sache eine Rede ausgearbeitet, und dass der athenische Rath über eine solche Kleinigkeit eine so ausgeführte Rede, noch dazu
298
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Der Fall ist ebenso singulär in der Überlieferung, wie die Person und der Status des Verteidigers ungewöhnlich sind. Über den Sprecher ist wenig bekannt: Es handelt sich um einen invaliden Bürger Athens, der wegen seiner Erwerbsunfähigkeit von der Polis täglich eine Obole bezieht. Das Recht eines Atheners auf diese finanzielle Unterstützung war gesetzlich festgelegt und wurde offenbar jedes Jahr vom Rat der 500 in einer Dokimasie neu geprüft. Der Antragsteller hatte nachzuweisen, dass er weitestgehend erwerbsunfähig war und weniger als drei Minen an Vermögen besaß.291 Nachdem der invalide Sprecher diese Zuwendung der Polis in Anspruch genommen hat, wird ihm bei einer aktuellen Dokimasie des Rates das Recht auf seinen Obolus von einem ungenannten Kläger streitig gemacht. Der Sprecher muss deshalb in seiner Rede nachweisen, dass er seinen Lebensunterhalt wegen seiner Invalidität nur sehr bedingt selbst aufbringen kann und dass er außerdem über kein nennenswertes Vermögen verfügt.292 Die Rede des Invaliden findet ihre Hörerschaft unter den Mitgliedern des Rates, sie ist nicht in einem Geschworenengericht gehalten worden.293 Anders als bei den meisten überlieferten Gerichtsreden handelt es sich beim Sprecher der 24. Rede des Lysias nicht um ein Mitglied der Oberschicht, sondern um einen einfachen Bürger, der die Geringfügigkeit seines Status vor dem Rat beweisen muss. Über die Person des Klägers ist nichts bekannt. Der Sprecher führt an, sein Widersacher sei ihm in jeder Hinsicht überlegen, das aber wird von den meisten athenischen Bürgern gelten, die in diesem spasshaften Tone, anzuhören Lust gehabt hätte. Aber weder wir noch die alten Kritiker können entscheiden, worüber Lysias zu schreiben und die Athener zu hören sich herbeiliessen.« 290 Vgl. ebd., 634. Terminus post quem ist die in Lys. 24, 25 erwähnte Herschaft der Dreißig, die noch nicht allzu weit zurückzuliegen scheint, vgl. Lisia, Orazione per l’ invalido, hg. u. eingel. v. N. Marinone, Turin 1986, 8. 291 Aristot. Ath. pol. 49, 4: $OKIμ£ZEI DÒ KAˆ TOÝJ ¢DUN£TOUJ ¹ BOUL»: NÒμOJ G£R ™STIN ÖJ KELEÚEI TOÝJ ™NTÕJ TRIîN μNîN KEKTHμšNOUJ KAˆ TÕ SîμA PEPHRWμšNOUJ éSTE μ¾ DÚNASQAI μHDÒN œRGON ™RG£ZESQAI DOKIμ£ZEIN μÒN T¾N BOUL»N, DIDÒNAI DÒ DHμOS…v TROF¾N DÚO ÑBOLOÝJ ˜K£STJ TÁJ ¹μšRAJ. In der Übersetzung von M. Chambers: »Der Rat prüft ferner die Invaliden; denn es gibt ein Gesetz, das bestimmt, dass diejenigen, welche (ein Vermögen von) weniger als drei Minen besitzen und so (schwer) körperbehindert sind, dass sie keine Arbeit verrichten können, vom Rat überprüft werden und vom Staat täglich einen Unterhalt von zwei Obolen pro Personen erhalten sollen.« Vgl. Aischin. 1, 103f. Der Betrag war offenbar zur Zeit des Aristoteles erhöht worden. 292 C. Carey, Structure and Strategy in Lysias XXIV, in: G&R 37 (1990), 44-51, 44, geht von einer liberalen Interpretation des von Aristoteles umschriebenen Gesetzes aus: »From the fact that our speaker freely admits that he is able to earn some money for himself (§ 6) we may conclude that the law was not interpreted literally. The level of assistance points to the same conclusion, since at the end of the fifth century an obol was only one third of the daily wage of an unskilled labourer; this probably represents a supplementary dole rather than a living wage, particularly for any recipient with dependents.« 293 Ebd., 44-45.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
299
nicht ebenfalls auf den täglichen Obolus der Polis angewiesen sind. Umso bemerkenswerter ist diese Strategie des Invaliden: Obwohl er klare gesetzliche Vorgaben zu erfüllen hat, entbehrt seine Rede jeder ernsthaften Argumentation oder eines schlüssigen Beweises. Die Vorwürfe des Gegners werden vom Sprecher aufgegriffen und nicht direkt widerlegt, sondern erweitert und ad absurdum geführt. Die an sich überschaubare Rede folgt keinem klaren Konzept, sondern spekuliert über die Motive des Gegners, schweift in allgemeine Betrachtungen zur Hybris und zum Treiben auf der Agora aus und macht die zu entkräftenden Vorwürfe lächerlich. Diese inhaltliche Planlosigkeit und die damit einhergehende burleske Sprache haben in der älteren Forschung die Zweifel an der Authentizität der Rede genährt. Der überdies sehr schwache Standpunkt des Sprechers lässt die Rede als die Fingerübung eines Logographen wirken, der einen fiktiven Fall verteidigt.294 Dagegen werden in den meisten neueren Studien die humoristischen Passagen als ein geschicktes Manöver in einem nur schwer zu gewinnenden Fall verstanden.295 Diese Merkmale lassen die Rede wie eine Parodie auf das Genre der Gerichtsreden wirken, die den jeweiligen Sprecher als einen guten Bürger definieren und ihre Argumentation mit möglichst großer rhetorischer Finesse zu führen suchen.296 Die karikierende Absicht der Rede passt zur Persönlichkeit des Sprechers, bei dem es sich offensichtlich um einen den meisten Athenern bekannten Mann gehandelt hat.297 Eine persönliche Bekanntschaft des Lysias mit dem Sprecher würde auch erklären, wie der Invalide trotz seines geringen Einkommens die Dienste des Logographen in Anspruch nehmen konnte, eine Ungereimtheit, die auch den Ratsmitgliedern aufgefallen sein mag.298 294 Zuletzt vertreten von J.A.E. Bons, Geen been om op te staan. Lysias’ De zaak von de invalide (or. 24), in: Lampas 34 (2001), 207-219, 218: »Wie ook ooit deze rede de titel PERˆ TOà ¢DUNATOà heeft meegegeven, hij heeft de wezenlijke ambiguïteit ervan weten te treffen: niet alleen kan deze titel verwijzen naar de invalide (Ð ¢DÚNATOJ), maar ook naar het onmogelijke van zijn zaak (TÕ ¢DÚNATON). Het is zeer wel denkbaar dat Lysias met het volbrengen van deze ›mission impossible‹ indruk heeft gemaakt.« 295 Edwards und Usher, Orators, 263: »The present case appears impossible to win by any form of orthodox handling. Lysias therefore resorts to an extraordinary mixture of humour and pathos. This line of approach must have been chosen because it suited the character of his client, who seems to have been a well-known and popular figure in the busiest part of the city«. Vgl. Carey, Structure, 49: »And of course ridicule serves an obvious rhetorical function, since by ridiculing and distorting the charges against him the speaker seeks to undermine their plausibility. But the unparalleled persistence of the humorous element also suggests implicitly that the whole case is an undignified and unimportant matter unworthy of the critical attention of the Boule, important as the dole may be to its recipient.« 296 Marinone, Lisia, 7: »sono tutti elementi che inducono a scorgere nel discorso quasi una parodia dell’ oratoria ateniese alla fine del V secolo.« 297 Lys. 24, 5. 19f. 298 So vermutet Marinone, Lisia, 6: »Teneva bottega nel centro di Atene: possiamo immaginare un barbiere, di cui Lisia stesso fosse cliente.«
300
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Tatsächlich lebt die Rede für den Invaliden von der antithetischen Gegenüberstellung der vom Kläger unterstellten Lebensweise des Sprechers und der Situation, in der er sich seiner eigenen Darstellung nach befindet. Beide Positionen werden dabei möglichst stark übertrieben. Wenn der Kläger behauptet, der Invalide habe ein gutgehendes Geschäft und verkehre mit namhaften Männern Athens, so spricht er ihm damit einen ehrenhaften Status zu, der dem seinen ebenbürtig ist. Der Invalide greift die postulierte Gleichheit an Ehre auf und wendet sie auf seine Lebensumstände an. Der komische Effekt entsteht durch die Diskrepanz zwischen dem unterstellten Lebensstil des Invaliden als eines Bürgers mit hoher Ehre und den Schilderungen seiner alltäglichen Situation, die eine Gleichheit mit den ehrenhaften Männern der Polis absurd macht. Die Charakteristika eines habituell ehrenhaften Atheners werden hier vom Sprecher benannt, um sie negieren zu können. Es finden sich in der Rede nicht nur die wohlbekannten stilistischen Elemente der Gerichtsreden, sondern sie enthält auch die Aufzählung typischer Verhaltensweisen, die einen Mann vor Gericht als einen Ehrenmann ausweisen und den Athenern sehr vertraut gewesen sein werden. Der Invalide beginnt seine Rede mit einer Aufzählung der klassischen Gründe für einen Ehrenmann, einen Streit zu beginnen und ihn öffentlich auszutragen: DI¦ G¦R OÙDÒN ¥LLO μOI DOKE‹ PARASKEU£SAI TÒNDE μOI TÕN K…NDUNON OáTOJ À DI¦ FQÒNON. KA…TOI ÓSTIJ TOÚTOIJ FQONE‹ OÞJ Oƒ ¥LLOI ™LEOàSI, T…NOJ ¨N Øμ‹N Ð TOIOàTOJ ¢POSCšSQAI DOKE‹ PONHR…AJ; E„ μÒN G¦R ›NEKA CRHμ£TWN μE SUKOFANTE‹ – : E„ D' æJ ™CQRÕN ˜AUTOà μE TIμWRE‹TAI, YEÚDETAI: DI¦ G¦R T¾N PONHR…AN AÙTOà OÜTE F…LJ OÜTE ™CQRù PÒPOTE ™CRHS£μHN AÙTù.299 Mit den Themen des Neides und der Rache benutzt der Redner genau jene Topoi, die zum Standardrepertoire der Vorwürfe gegen den jeweiligen Gegner gehören. Besonders Männer von Ehre sind auf diese Punkte ansprechbar, weil der Neid die Gleichheit unter den Ehrenhaften stört und weil die Rache die Konkurrenz untereinander mit einem fatalen Ausgang bedroht.300 Die Freundschaft und die Feindschaft zwischen den Ehrenmännern werden als gleichwertige Formen der Vergesellschaftung betrachtet, beide können zu einer ähnlich intensiven Involviertheit in ehrenhafte Händel eines anderen 299 Lys. 24, 1-2: »Denn aus keinem anderen Grund als aus Neid scheint dieser den Prozess hier angestrengt zu haben. Freilich, wer diejenigen beneidet, die von anderen bedauert werden: vor welcher Gemeinheit, glaubt ihr, schreckt ein solcher Mensch zurück? Denn falls er mich wegen Geldes anzeigt –; wenn er aber an mir als an seinem Feind Rache nehmen will, dann lügt er. Denn gerade wegen seiner Gemeinheit habe ich weder als Freund noch als Feind jemals mit ihm zu tun gehabt.« Übersetzung G. Wöhrle. 300 Vgl. Cohen, Law, 82; P. Walcot, Envy and the Greeks. A study of human behaviour, Warminster, Wiltsh. 1978, 21: »envy is related to the concept of honour and so an integral part of the Greek value system.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
301
führen. Alle Motive für einen Einspruch vor dem Rat setzen eine gewisse Gleichheit zwischen dem Kläger und dem Invaliden voraus, die nach Meinung des letzteren keineswegs besteht. Der Sprecher präsentiert die Feindschaft des Klägers deswegen als ihm völlig unverständlich, da er nicht zu den Männern gehöre, mit denen in Streit zu stehen Ehre einbringe. Auch seine Lebensumstände, so der Sprecher, wären von seinem Gegner beschrieben worden, als sei er ein vermögender Bürger mit einem Lebensstil, der dem Habitus eines Ehrenmannes gleichkomme: FHSˆ G¦R Ð KAT»GOROJ OÙ DIKA…WJ μE LAμB£NEIN TÕ PAR¦ TÁJ PÒLEWJ ¢RGÚRION: KAˆ G¦R Tù SèμATI DÚNASQAI KAˆ OÙK EÍNAI TîN ¢DUN£TWN, KAˆ TšCNHN ™P…STASQAI TOIAÚTHN éSTE KAˆ ¥NEU TOà DIDOμšNOU TOÚTOU ZÁN. KAˆ TEKμHR…OIJ CRÁTAI TÁJ μÒN TOà SèμATOJ èμHJ, ÓTI ™Pˆ TOÝJ †PPOUJ ¢NABA…NW, TÁJ D' ™N TÍ TšCNV EÙPOR…AJ, ÓTI DÚNAμAI SUNE‹NAI DUNAμšNOIJ ¢NQRèPOIJ ¢NAL…SKEIN. T¾N μÒN OâN ™K TÁJ TšCNHJ EÙPOR…AN KAˆ TÕN ¥LLON TÕN ™μÕN B…ON, OŒOJ TUGC£NEI, P£NTAJ Øμ©J O‡OμAI GIGNèSKEIN:301 Wieder ist es die Vergesellschaftung mit Gleichen, die als selbstverständlich gilt und den Beweis für den Status eines Bürgers erbringen kann. Der Invalide weist den Umgang mit reichen Freunden von sich und findet für die Pferde eine Erklärung, die das Argument des Gegners in der Logik und in der Sache ad absurdum führt.302 Wohl wegen seines Geschäftes nahe der Agora scheint der Invalide den meisten Athenern bekannt gewesen zu sein.303 Die Ratsmitglieder werden ausdrücklich dazu aufgefordert, aus seinem Erscheinen in der Öffentlichkeit auf seinen Status zu schließen. Das spricht zweifellos für den Wahrheitswert der Ausführungen des Invaliden, dessen berechtigten Anspruch auf den täglichen Obolos die meisten modernen Rezipienten der Rede bezweifeln.304 Unstreitig machen der Habitus und die öffentliche Meinung über den allgemeinen Lebensstil eines Atheners einen so wichtigen Eindruck auf seine Mitbürger, dass aus dem Auftreten in der Öffentlichkeit auf das Ver301 Lys. 24, 4-5: »Denn der Ankläger behauptet, ich bezöge zu Unrecht mein Geld von der Stadt, denn ich sei körperlich fähig und gehörte nicht zu den Unfähigen (Invaliden) und betriebe solch ein Gewerbe, dass ich auch ohne diese Zahlung, die man mir leistet, leben könne. Als Beweis für meine körperliche Stärke führt er nun an, dass ich auf Pferde steige. Als Beweis aber dafür, dass ich gut mittels meines Gewerbes lebe, gilt ihm, dass ich fähig bin, mit Menschen Umgang zu pflegen, die fähig zur Geldverschwendung seien. Nun, ich glaube, dass ihr alle über den Wohlstand, den mir mein Gewerbe bringt, und darüber, wie es mit meinem sonstigen Lebensunterhalt steht, Bescheid wißt.« 302 Ebd., 10-12. 303 Ebd., 19-20. 304 Vgl. Lisia, Per L’ invalido. hg., eingel., übers. u. komm. v. D. Alasia, 1951 (ND 1971), 11; Edwards und Usher, Orators, 263: »the speaker has no relevant facts on which to base positive argument.«
302
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
mögen, den Status und die Ehre eines Mannes geschlossen werden kann. Der Habitus bzw. das Verhalten in der Öffentlichkeit ist originär ausschlaggebend für die Zuschreibung von Ehre an einen Mann. Hier wird es vom Invaliden in eigener Sache und gezielt fern der Demonstrierung von Ehre angeführt: Die Agora als zentraler öffentlicher Raum ist auch geeignet, die nur moderate Ehre eines Mannes zu zeigen bzw. als ein Ort zu fungieren, der vornehmlich wirtschaftlichen und politischen Charakter hat. Gleichermaßen absurd ist eine Gleichheit zwischen dem Kläger und dem Invaliden hinsichtlich ihrer Rolle in der Polis, so der Sprecher. Die Möglichkeiten der Distinktion innerhalb des demokratischen Systems bleiben dem Invaliden verschlossen. Der Redner spricht das gesellschaftspolitische Engagement einiger potenter Athener an, das ihnen Ehre einbringt, weil es als ein Agon einen ehrenhaften Sieger produziert, der sich seinen Konkurrenten überlegen fühlen kann. Der Invalide konstatiert, dass sein Vermögen unmöglich an das dieser Männer heranreicht: E„ G¦R ™Gë KATASTAQEˆJ CORHGÕJ TRAGJDO‹J PROKALESA…μHN AÙTÕN E„J ¢NT…DOSIN, DEK£KIJ ¨N ›LOITO CORHGÁSAI μ©LLON À ¢NTIDOàNAI ¤PAX.305 Neben den liturgischen Ämtern ist der Sprecher aber – aufgrund seiner Invalidität – auch von einer generell allen Bürgern zugänglichen Partizipation am politischen Leben ausgeschlossen. So darf er nach eigenem Bekunden z. B. nicht für das Archontat kandidieren und ist von der Ämterauslosung ausgeschlossen: KA…TOI E„ TOàTO PE…SEI TIN¦J ØμîN, ð BOUL», T… μE KWLÚEI KLHROàSQAI TîN ™NNšA ¢RCÒNTWN, KAˆ Øμ©J ™μOà μÒN ¢FELšSQAI TÕN ÑBOLÕN æJ ØGIA…NONTOJ, TOÚTJ DÒ YHF…SASQAI ™LE»SANTAJ æJ ¢PAP»RJ; OÙ G¦R D»POU TÕN AÙTÕN ØμE‹J μÒN æJ DUN£μENON ¢FAIR»SESQE TÕ DIDÒμENON, Oƒ DÒ [QESμOQšTAI] æJ ¢DÚNATON ÔNTA KLHROàSQAI KWLÚSOUSIN.306 Seine Beteiligung am öffentlichen Leben beschränkt sich daher auf seine Präsenz auf der Agora; die demokratischen Ämter kann er nicht besetzen.307 Der geringe Status des Invaliden ist von der Polis offiziell anerkannt. Umso abwegiger erscheint die Übernahme einer Choregie für einen schon von den einfachsten Ämtern ausgeschlosse-
305 Lys. 24, 9: »Denn wenn ich veranlaßt wäre, eine Tragödienaufführung zu finanzieren, und ihn zum Vermögenstausch aufforderte, dann würde er es zehnmal eher vorziehen, die Aufführung zu übernehmen, als einmal das Vermögen zu tauschen.« 306 Ebd., 13: »Doch wenn er nur einige von euch darin überzeugt, Hoher Rat, was hindert dann mich, durchs Los an der Wahl der neun Archonten teilzunehmen, und euch, mir den Obolos als einem Gesunden zu entziehen, ihn aber voll Erbarmen diesem Mann als einem Gebrechlichen zuzusprechen? Denn ihr werdet doch wohl nicht einem, weil er körperlich fähig ist, die zugewiesene Rente entziehen, während die Thesmotheten denselben Mann, weil er unfähig ist, von der Teilnahme am Losverfahren fernhalten.« 307 Vgl. Edwards und Usher, Orators, 267; Marinone, Lisia, 22. Die Stelle bildet den einzigen Beleg für die Ausschließung behinderter Bürger von einigen Rechten der politischen Partizipation.
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
303
nen. Der Sprecher öffnet hier noch einmal die Schere zwischen den Vorwürfen seines Gegners und seinem tatsächlichen Status weitest möglich.308 Zur Vergrößerung dieser Diskrepanz trägt auch der Exkurs über die Hybris bei, den der Invalide in seine Rede einflicht. Seinen Worten zufolge hat ihm sein Gegner sogar das Verhalten eines Mannes mit übersteigertem Ehranspruch vorgehalten: ,šGEI D' æJ ØBRIST»J E„μI KAˆ B…AIOJ KAˆ L…AN ¢SELGîJ DIAKE…μENOJ ... ™Gë D' Øμ©J, ð BOUL», SAFîJ OÍμAI DE‹N DIAGIGNèSKEIN OŒJ T' ™GCWRE‹ TîN ¢NQRèPWN ØBRISTA‹J EÍNAI KAˆ OŒJ OÙ PROS»KEI.309 Die Unsinnigkeit dieser Unterstellung hat der Invalide im Laufe seiner Rede mit der Darstellung seiner Mittel und Lebensumstände zu Genüge deutlich gemacht. Dennoch ergeht er sich in ausschweifenden Spekulationen über den Status jener, die Hybris begehen.310 Nachdem er einige Beispiele dafür angeführt hat, was unter hybridem Verhalten zu verstehen ist, gelingt es ihm, die Spitze seiner Argumentation gegen seinen Gegner zu kehren, indem er andeutet, dass jener sich genau so benehme: éSTE μOI DOKE‹ Ð KAT»GOROJ E„PE‹N PERˆ TÁJ ™μÁJ ÛBREWJ OÙ SPOUD£ZWN ¢LL¦ PA…ZWN, OÙD' Øμ©J PE‹SAI BOULÒμENOJ æJ E„μˆ TOIOàTOJ, ¢LL' ™μÒ KWμJDE‹N BOULÒμENOJ, éSPER TI KALÕN POIîN.311 Diese Aussage leistet für den Sprecher rhetorisch zweierlei: Zum einen wirft sie den Verdacht der Hybris auf seinen Gegner zurück und zum anderen betont sie noch einmal die Lächerlichkeit der gesamten Klage, die jeglicher faktischen Grundlage entbehrt.312 Nachdem der Invalide gezeigt hat, dass er in keinerlei Hinsicht zu jenen Personen gehört, die über einen Status verfügen, der mit besonderer Ehre assoziiert werden könnte oder auch nur mit der Gleichheit anderen Bürgern oder gar dem Ankläger gegenüber, beschließt der Sprecher seine Rede, indem er ihren Gegenstand bagatellisiert. Vor dem Hintergrund der ironischen Schilderungen seines Mangels an Pferden oder reichen Freunden sowie eines gehobenen Lebensstil überhaupt, seines Ausschlusses von den politischen Ämtern und jeglicher Möglichkeiten, durch die Polis Ehre zu erlangen und seiner Absage an ein hybrides Verhalten mutet der Verweis darauf, die Klage verhandele lediglich einen Obolos tatsächlich grotesk 308 Vgl. Carey, Structure, 48: »the distortion resides in the assumption that people are either physically fit or disabled, wealthy or abjectly poor, as though fitness and wealth were not scales.« 309 Lys. 24, 15: »Er behauptet, ich sei übermütig, gewalttätig und sehr frech ... Ich glaube aber, Hoher Rat, ihr müßt klar unterscheiden zwischen den Leuten, die die Freiheit besitzen, übermütig zu sein, und denen, die diese Freiheit nicht haben.« 310 Ebd., 16-18. Vgl. dazu Fisher, Hybris, 96-105. 311 Ebd., 18: »So scheint mir der Ankläger, soweit es meinen Übermut betrifft, nicht ernsthaft, sondern im Scherz zu reden. Und er will euch nicht überzeugen, dass ich einen solchen Charakter hätte, sondern er will mit mir – als vollbrächte er eine Heldentat – seinen Spott treiben.« 312 Vgl. Edwards und Usher, Orators, 268: »perhaps an attempt to excuse the line (color) adopted in the defence: a masterly and impudent turning of the tables on the prosecutor.«
304
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
an.313 Die immense Ungleichheit zum Kläger äußert sich hier darin, dass jener über all die aufgezählten Dinge und Lebensumstände verfügen kann, während der Invalide gezwungen ist, all sein Geschick aufzuwenden, um sich überhaupt diesen einen Obolos zu seinem Lebensunterhalt zu sichern. Die Rede endet mit dem Appell an den überlegenen Gegner, sich seinem Status gemäß als Ehrenmann zu verhalten: OáTOJ DÒ TOà LOIPOà μAQ»SETAI μ¾ TO‹J ¢SQENESTšROIJ ™PIBOULEÚEIN ¢LL¦ TîN ÐμO…WN AÙTù PERIG…GNESQAI.314 Damit stellt der Redner noch einmal die Asymmetrie zwischen seiner Person und jener seines Gegners in den Begriffen der Ehre dar: Ein ehrenhafter Agon ist mit ihm nicht zu führen, durch einen Angriff auf ihn untergräbt der Kläger nur seine eigene Ehre, weil er sich mit einem nicht ebenbürtigen Mann auseinander setzt. Eine gewisse Gleichheit beansprucht der Invalide nur mit den übrigen Bürgern Athens. Sein wichtigstes Statusmerkmal ist für ihn die Bürgerschaft, sein Recht auf Unterstützung durch die Polis beruht gänzlich auf einem für alle Bürger geltenden Gesetz. Außer der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen für den täglichen Obolus kann der Invalide nichts anführen, was eine Leistung der Polis für ihn rechtfertigen würde. Im Gegensatz zu den ehrenhaften Männern, die als Begründung für ihre Bekränzung ihre Verdienste um die Polis und ihr Engagement im politischen Leben ins Feld führen, tut der Sprecher nichts dergleichen. Er verweist nicht einmal auf einen von ihm geleisteten Kriegsdienst für Athen, in dessen Verlauf er sich seine Behinderung zugezogen haben könnte.315 Er behauptet allerdings, ein besserer Bürger zu sein als sein Widersacher: ½DH TO…NUN, ð BOUL», DÁLÒJ ™STI FQONîN, ÓTI TOIAÚTV KECRHμšNOJ SUμFOR´ TOÚTOU BELT…WN E„μˆ POL…THJ.316 Zwar kann er keine positiven Leistungen für die Polis auflisten, er gibt aber an, der Polis nie geschadet
313 Lys. 24, 26. Vgl. Carey, Structure, 49f.; Edwards und Usher, Orators, 269: »Thus the speech concludes with a belittling of the charge (meiôsis) rather than a refutation of it.« 314 Ebd., 27: »Dieser aber wird für die Zukunft lernen, nicht den Schwächeren nachzustellen, sondern ihm Ebenbürtige zu überwinden.« 315 Art und Ursache der Invalidität des Sprechers sind unbekannt. Marinone, Lisia, 5, folgert aus der Wahrscheinlichkeit einer hohen Anzahl solcher Invaliden nach 400 v. Chr., dass auch der Sprecher zu ihnen gehörte: »il loro numero era certo notevole al tempo di Lisia in seguito alla guerra del Peloponneso e ai disagi causati dal governo dei Trenta.« Auch R. Garland, The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World, London 1995, 38, hält Kriegsveteranen für die Zielgruppe des Gesetzes: »If this is correct, then it would seem that Athens’ gesture of modest magnanimity was intended to send a strong signal to her fighting stock that even if they became unable to support themselves and their families as a result of injuries sustained in battle they would not be left wholly destitute, in the same way as the state undertook their orphans if they perished.« 316 Lys. 24, 3: »So beneidet er mich also offensichtlich, Hoher Rat, weil ich, obgleich von einem solchen Unglück geschlagen, ein besserer Bürger bin als er.«
Die Ehre (in) der Polis: Demosthenes, weitere Bürger und ein Invalide
305
und sich zur Demokratie stets loyal verhalten zu haben.317 Der einzige Nutzen, den er im Gegenzug von der Polis hat, ist der eine Obolos täglich: μHD' Oá μÒNOU μETALABE‹N œDWKEN ¹ TÚCH μOI TîN ™N TÍ PATR…DI, TOÚTOU DI¦ TOUTONˆ ¢POSTE-R»SHTš μE.318 Mit dem Hinweis auf die Erfüllung seiner Pflichten als Bürger fordert der Invalide sein Recht ein. Das entscheidende Statusmerkmal des Invaliden ist es, Bürger der Polis Athen zu sein. Er verfügt zwar über keine nennenwerte soziale Ehre und kann seine politischen Rechte auch nur beschränkt wahrnehmen, aber er führt seine Bürgerehre an, die jedem athenischen Bürger bestimmte Rechte zuspricht und ihn allen anderen Mitgliedern der Bürgerschaft gleichstellt. Diese Bürgerehre hat allein die Polis als normativen Bezugsrahmen, wobei der Invalide hier als ehrenwerte Leistungen anführen kann, sich weder hybrid verhalten noch sich mit den Dreißig solidarisiert zu haben. Diese wegen seiner begrenzten Mittel glaubhaften Aussagen stellen einen typischen Bestandteil nahezu jeder Gerichtsrede dar, gerade weil die Gefahr der Ignorierung der Polis als Resonanzraum für besonders ehrenhafte Männer sehr groß ist.319 Im Gegensatz zu letzteren versichert der der Invalide glaubhaft, seiner Bürgerehre Genüge getan zu haben und entsprechend der Reziprozität der Gaben nun Ansprüche an die Polis stellen zu können. In dieser Hinsicht fällt es dem Invaliden leichter, seine Bürgerehre zu demonstrieren als anderen Rednern. Denn Demosthenes und Aischines, wie auch die übrigen Athener der Oberschicht, stehen eher in der Gefahr, ihre Ehre nicht deutlich genug in die Polis einzubinden. Die Furcht der athenischen Bürger vor einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ist berechtigt. Die Kränze, die die Polis für herausragende Dienste vergibt, stellen eines der Mittel dar, mit denen die übermäßige Ehre entschärft werden soll: Die aus einer hohen Ehre resultierenden Ansprüche an einen besonderen Status innerhalb der Bürgerschaft werden befriedigt, indem symbolische Ehren vergeben werden, die von der Bürgerschaft und von den Gremien der Polis akklamiert werden müssen. Die Heraushebung einiger Bürger über diese symbolischen öffentlichen Akte bedeutet eine Einhegung der Ehre, weil sie die Polis als Quelle und Souverän der Ehrungen installieren und weil sie die Gleichheit aller Bürger in den politischen Rechten für die ungleich Ehrenhaften erträglich machen. Die Zwistigkeiten, die die Vergabe von Ehrungen durch die Polis zwischen namhaften Männern provoziert, zeigen die gelungene Einbeziehung des Agons um Ehre in die athenische Polis. Der Rat und die Gerichte fun317 Ebd., 24-25. 318 Ebd., 22: »Und beraubt mich nicht, durch diesen Mann hier verleitet, dessen, woran mir das Schicksal in dieser Stadt allein Anteil gewährte.« 319 Vgl. Carey, Structure, 48: »the speaker is indulging here, as in the proem, in ironic parody of arguments typically advanced in dokimasiai.«
306
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
gieren als oberste Instanzen der Lösung solcher Streitigkeiten, weil ihr Votum die Ehre eines Mannes im Vergleich mit jener seines Gegners beurteilt. Die Besetzung der politischen Gremien mit der repräsentativen Mehrheit aller Bürger garantiert den um Ehre Kämpfenden eine Öffentlichkeit, wie sie die Demonstration und Bestätigung ihrer Ehre verlangt. Die Gerichtsreden, die eine streitige Ehrung durch die Polis zum Thema haben, machen deshalb einerseits die erfolgreiche Integration des Ehrstrebens in die Polis deutlich, auf der anderen Seite verweisen sie aber auf die noch bestehenden Probleme bzw. Missstände, die in der Natur der Sache liegen. Zu diesen gehört etwa die beständige Okkupierung der Gerichtshöfe durch Athener, die dort ihre mitunter kleinlichen Ehrenhändel austragen. Gewichtiger sind die unterschiedlichen normativen Erwartungen hinsichtlich der Qualifikation für Ehrungen, die die Polis und die Ehre stellen. Wo diese Diskrepanz zum Konflikt führt, erweist sich die für Ehrenmänner und Polisbürger so wesentliche Gleichheit als sehr fragil. Wie fest das Bewusstsein der Bürgerehre aber auch verwurzelt sein kann, demonstriert der Invalide als ein einfacher Bürger, der auf der Basis seiner Bürgerehre Ansprüche an das Gemeinwesen stellt. Hier zeigen sich die fruchtbaren strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen Polis und Ehre, wie sie auch den einfachen Bürgern zugute kommen. Die Polisehrungen als Gelenk zwischen beiden Systemen eröffnen aber ebenso den Blick auf die strukturell bedingten Probleme, die sich für die athenische Demokratie aus der Verknüpfung der Verhaltensnormen der Ehre mit dem gewünschten Verhalten eines guten Polisbürgers ergeben.
Resümee: Die Verbindung von Recht und Rache Wenn die athenischen Bürger in Streit miteinander geraten, wenden sie sich zu dessen Beilegung an ein athenisches Gericht. Außerdem aber tragen sie ihre Auseinandersetzungen auf ehrenhafte Weise, d. h. außerhalb des Gerichts und entsprechend den agonalen, reziproken und öffentlichkeitswirksamen habituellen Formen der Ehre aus, die bis zur Rache führen können. Generell wirft das Konfliktverhalten der Mitglieder einer Gesellschaft ein bezeichnendes Licht auf sie, weil es geeignet ist, die erfolgte Vergesellschaftung massiv zu stören. Das gilt auch für die athenische Bürgerschaft: Vergeltungsschläge, wie sie Meidias im Theater und Euphiletos in der Kammer seiner Frau führen, drohen das friedliche Zusammenleben der Bürger zu beeinträchtigen. Einerseits, weil sie weitere ehrenhafte Vergeltungsmaßnahmen provozieren, und andererseits, weil diese Ausweitung der involvierten Personen und sozialen Räume früher oder später das Hoheits-
Resümee: Die Verbindung von Recht und Rache
307
gebiet der Polis tangiert, so dass ein reibungsloser Ablauf der politischen und kultischen Veranstaltungen nicht mehr gewährleistet ist. Die Fälle des Meidias, des Konon und des Eratosthenes erweisen die Norm der Ehre als so virulent, dass es im Konflikt tatsächlich zu drastischen Akten der Rache gekommen ist. Eine schlüssige Interpretation des Verhaltens der Protagonisten dieser Reden ist ohne die Norm der Ehre kaum möglich. Allerdings reicht die Prämisse ehrenhaften Verhaltens für die Erklärung nicht aus. Denn nach Beendigung des Kampfes um die Ehre stehen alle drei Parteien vor Gericht, um ihre Fälle vor der Öffentlichkeit der athenischen Geschworenen neu zu interpetieren und beurteilen zu lassen. Erst die Berücksichtigung der handlungsleitenden Norm der Polis ermöglicht Demosthenes und Ariston eine erneute Verhandlung ihrer Ehre. Nachdem sie im Agon um die Ehre unterlegen waren, bietet die Norm der Polis den drei Rednern zusätzliche Alternativen der Interpretation ihres Verhaltens. Euphiletos’ Mord an Eratosthenes bezeichnet genau die Schnittstelle zwischen den beiden Ordnungssystemen der Polis und der Ehre. Deshalb bereitet es ihm die größten Schwierigkeiten, sein Verhalten als plausibel und zugleich normgerecht darzustellen. Neben diesen sehr komplexen Fällen gibt es weitere, deren Ablauf für eine Auseinandersetzung zwischen Ehrenmännern sehr typisch ist. Die Handlungsmuster auch dieser Streitigkeiten erschließen sich über eine Kopplung der Norm der Ehre mit der Norm der Polis. Die Kämpfe zwischen Simon und seinem Gegner oder zwischen Apollodor und Nikostratos finden zeitweise auf offener Straße statt und zu einem anderen Teil in Prozessen vor Gericht. Bei längeren Auseinandersetzungen lässt sich die Vermengung der beiden Normen gut beobachten: sie werden von den Athenern alternierend eingesetzt, lösen einander ab oder resultieren ineinander. Die Querverbindungen zwischen den sozialen Räumen der Ehre und jenen der Polis sind mannigfach und werden von den einzelnen Bürgern immer wieder hergestellt. Denn eines wird aus den Worten der Redner sehr deutlich: Die Athener wissen um das Nebeneinander beider normativer Anforderungen. Sie bemühen sich immer darum, parallel oder zugleich ein guter Polisbürger und ein Mann von Ehre zu sein. So problematisch das auf theoretischer Ebene, besonders im Konfliktfall erscheinen mag, praktisch wird jeder Athener für sich eine Kombination beider Verhaltensstile gefunden haben, die seinen Interessen entsprach und von seinen Mitbürgern akklamiert wurde. Dabei scheinen die Handlungserwartungen der Polis jene der Ehre zu einem großen Teil ergänzt, und zu einem geringeren Teil dort zurückgedrängt zu haben, wo die Ehre sich für das Funktionieren des politischen Lebens als dysfunktional erwies.
308
Die ehrenhafte Art der Konfliktführung: Rache oder Recht?
Diesen Befund bestätigt die Untersuchung jener Reden, in denen es um Ehrungen von Seiten der Polis geht. Mit der Vergabe von Ehrungen macht sich die Polis den in einer ehrenhaften Gesellschaft stattfindenden Agon um die Ehre zunutze, um Leistungen für das Gemeinwesen zu erwirken. Die strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen einer ehrenhaften Gesellschaft, wie sie die Athener darstellten, und dem politischen System der Polis sind an dieser Stelle am größten. Zwar funktioniert der Agon um die Ehrungen der Polis gut, wie die Konflikte darum zeigen, aber der Kampf um die Auszeichnungen provoziert ehrenhafte Auseinandersetzungen, die leicht auch außerhalb des juristischen Rahmens der Polis ausgetragen werden können. Weitere Fehler im System, die schon den Athenern auffallen, sind die schleichende Inflationierung von Ehrungen, die permanente Beanspruchung der athenischen Gerichte durch die Auseinandersetzungen zwischen Ehrenmännern und die mögliche Diskrepanz zwischen der singulären Ehrung einer Person und ihrem ehrenhaften sozialen Status. Mit dem Invaliden taucht ein Verständnis von Ehre auf, das die Norm der Polis aufnimmt und konsequent in den Termini der Ehre deutet: Jeder Athener verfügt qua Bürgerstatus über eine Bürgerehre, die ihn mit allen Mitbürgern gleichstellt und ihm innerhalb der normativen Ansprüche der Polis einen Habitus analog dem eines Ehrenmannes ermöglicht. Mit diesem Gedanken ist die Eingliederung der Polis in die ehrenhafte Gesellschaft und die Integration der Ehre in die Polis abgeschlossen. Die Auffassung eines Nebeneinanders der Normen von Polis und Ehre ist in jeder der besprochenen Reden vertreten. Sie war den Athenern unmittelbar präsent – wenn nicht in ihrer theoretischen Konsequenz, so doch als praktisches Angebot. Zumeist sind beide Normen weniger gut zu trennen, als das methodisch in der Analyse der einzelnen Reden erfolgt ist. Die Sprecher verorten ihr eigenes Verhalten und das ihrer Gegner innerhalb der beiden Bezugsrahmen der Polis und der Ehre. Welchen sie jeweils für angemessen halten, ist nicht beliebig, sondern hängt vom gegebenen Kontext ab. Naturgemäß erscheint ein an den Normen der Polis ausgerichtetes Verhalten vor dem Gremium der Polis stets angemessener als ein ehrenhaftes. Deshalb sind es in den Reden eher die ehrenhaften Handlungen, die durch ihre Deplatziertheit oder Radikalität als normwidrig auffallen. So etwa das unangemessen ehrenhafte Verhalten eines Mannes, der im Auftrag der Polis unterwegs ist, oder das unangemessen ehrenhafte Konfliktverhalten eines Bürgers, der sich auf der Schwelle des Oikos eines anderen befindet. Inwiefern die Normen der Polis von der Umgebung als fragwürdig erfahren wurden, wird in den Reden nicht deutlich. Das liegt nicht nur an der Situation vor Gericht, die das Geschehen selektiv darbietet: Auch historisch spricht einiges dafür, dass die Norm der Polis als die neuere der alten ehrenhaften Tradition Grenzen gesetzt hat, und nicht umgekehrt.
VII. Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
Ausgangspunkt der Arbeit war die Frage nach dem Stellenwert der Ehre in Athen in klassischer Zeit. Eine genauere Fassung der Fragestellung ergab die Konzentration auf das Verhältnis zwischen der Ehre und der Polis als Verhaltensnormen, die den Athenern in Konkurrenz zueinander zur Verfügung standen. Ein so formuliertes Erkenntnisinteresse ermöglicht nicht nur Aufschlüsse über die Vorstellung und die Rolle von Ehre in der athenischen Gesellschaft, sondern auch der andere Pol des Begriffspaares rückt in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit: wo die Ehre die Angelegenheiten und die Organisation der Polis berührt, können sich neue Einsichten über diese ergeben. Zunächst galt es, die Prämisse, dass die Ehre in der athenischen Gesellschaft in klassischer Zeit eine prägende Rolle für den Einzelnen wie für den Aufbau der gesamten Gesellschaft gespielt habe, zu untermauern. Die Klassifikation der athenischen Bürgergemeinschaft als einer ehrenhaften Gesellschaft ermöglichte die Anwendung bestimmter Kriterien für diese Form der Vergesellschaftung auf sie. Die Sichtung verschiedener anthropologischer Studien zu kleinen Gemeinwesen, die hinsichtlich des Untersuchungszeitraumes und -ortes sehr verschieden waren, deren markantestes soziologisches Merkmal aber bei allen die Ehre war, ersetzte die Aufstellung einer lexikalischen oder soziologischen Definition. Denn die ohnehin sehr abstrakte Vorstellung von Ehre hat keinen materiellen Bezugspunkt und muss daher, um für eine Analyse operationalisierbar zu sein und sich nicht nur in Worten zu erschöpfen, empirisch geerdet werden. Die durch Ehre geprägten, typischen sozialen Interaktionsmuster der Mitglieder ehrenhafter Gesellschaften dienen als Untersuchungsgegenstand für die Wirkung von Ehre in einer Gesellschaft. Sie bilden die Ebene, auf der das abstrakte Prinzip der Ehre sich sowohl für die Mitglieder einer ehrenhaften Gesellschaft als auch für den Beobachter am deutlichsten manifestiert. Dabei erwies sich die Konzentration auf einige Verhaltensmuster, die in nahezu jeder ehrenhaften Gesellschaft einen Ehrenmann auszeichnen, als in zweifacher Hinsicht vorteilhaft: Zum einen sind diese habituellen Formen der Ehre so umfassend definiert, dass sie Raum lassen für die spezifisch athenische Ausprägung des normgerechten ehrenhaften Verhaltens, und zum anderen verweisen sie auf jene Bezugsfelder, in denen ehrenhaftes
310
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
Verhalten am besten erforscht und in seiner Wirkung analysiert werden kann. Der Aufbau der Arbeit orientiert sich daher an den habituellen Formen der Ehre und sucht das ehrenhafte Verhalten der Athener in verschiedenen Lebensbereichen, in denen diese Verhaltensformen am eindringlichsten von den athenischen Ehrenmännern gefordert werden und anhand derer sie sich deshalb am ehesten erweisen lassen. Wegen des gespannten Verhältnisses der Ehre zu jeglicher alternativen Form der Vergesellschaftung gerät bei einer näheren Betrachtung der Ehre in der athenischen Gesellschaft auch die Polis in den Fokus des Interesses. Die athenische Demokratie beeinflusste unweigerlich die Einstellung der Athener zur Ehre, weil beide Ordnungsmächte – die Ehre ebenso wie die Polis – nur funktionieren konnten, wenn sich die Mitglieder ihrer Gesellschaften an bestimmte Regeln hielten. Die Ehre und die Polis setzten Verhaltensnormen, die in klassischer Zeit nebeneinander bestanden und nicht unbedingt miteinander harmonierten. Da die athenische Demokratie sich in einer ehrenhaften Gesellschaft entwickelte, musste sie notwendig Mechanismen der Abgrenzung und Umdefinition tradierter ehrenhafter Verhaltensregeln installieren. Auf der anderen Seite gewährleistete die von der Bürgergemeinschaft getragene Demokratisierung eine organische Integration wichtiger politischer Abläufe in die Vorstellung von Ehre. Für einen Athener, der sich zugleich als ein Ehrenmann und als ein guter Polisbürger verstehen wollte, bestanden so zwei handlungsleitende normative Bezugssysteme, die sich gegenseitig überlappten und ergänzten. Die zentrale Frage ist, nach welchem er sein Verhalten ausrichtete. Analysiert wurde das Verhalten von Athenern in den einzelnen Bezugsfeldern, die abhängig von den habituellen Formen der Ehre gewählt wurden. Da sich die erschöpfende Darstellung einer athenischen Sozialgeschichte unter dem Vorzeichen der Ehre von vornherein verbot, versprach eine möglichst heterogene Fächerung der durch die Ehre geprägten Lebensräume die besten Chancen auf eine gewisse Sicherheit des induktiven Schließens von den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen auf die angenommene Verbreitung der Phänomene in der gesamten Gesellschaft. Die Einteilung der Kapitel entspricht den verschiedenen Bezugsfeldern, in denen einzelne ehrenhafte Verhaltensmuster jeweils besonders ausgeprägt beobachtet werden können. Sie beschäftigen sich mit unterschiedlichen Lebensräumen der Athener und versuchen so, eine Vorstellung zu vermitteln davon, wie die Norm der Ehre verschiedene Bereiche des sozialen Lebens strukturiert und sich in den habituellen Handlungen der Athener ausdrückt. Der Anspruch eines Atheners auf Ehre ist latent in seinem Verhalten präsent, ihn aber wirklich nachzuweisen gelingt am ehesten in jenen ausgewählten Situationen, die einen athenischen Ehrenmann zur Offenbarung seiner agonalen und konfliktorientierten Handlungen zwingen, die ihn
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
311
die Norm der Reziprozität und der Gleichheit beachten lassen, und die sich in der Öffentlichkeit abspielen müssen, wenn sie seiner Ehre zuträglich sein sollen. Das erste Kapitel über die Ehre in der homerischen Gesellschaft sollte die historische Dimension des ehrenhaften Verhaltens beleuchten. Es diente vornehmlich dazu, als Kontrastfolie zur entwickelten Polis der klassischen Zeit zu wirken und ihr Verhältnis zur Ehre klarer hervortreten zu lassen. Denn in homerischer Zeit hegt den Ehrbegriff kein verfasstes Gemeinwesen ein, die Kampfgemeinschaft der Achaier ist lediglich ein Zweckverbund, ihr Aufenthalt vor Troia von befristeter Dauer. Doch selbst unter diesen Bedingungen deuten sich bereits die dysfunktionalen Effekte an, die ein Ehrenmann auslösen kann, wenn er seinen Status falsch einschätzt, d. h. wenn er nicht über das soziale Wissen um die Norm der Ehre verfügt, das für einen Ehrenmann unabdingbar ist. Homer exerziert diese Gefahr am Beispiel seines Helden Achill, dessen einseitiger Begriff von Ehre die treibende Kraft des Dramas darstellt, das sich im Lager der Griechen entspinnt. Auch die Interaktion der übrigen Protagonisten der homerischen Epen bezeugt eine Vorstellung von Ehre, die sie als die wichtigste Handlungsnorm und das entscheidende strukturelle Merkmal der homerischen Gesellschaft definiert. Besonders die Schlüsselszenen der Ilias, wie die Auseinandersetzung Agamemnons und Achills um die Teilung der Beute oder die Veranstaltung der Leichenspiele des Patroklos zeigen die Bedeutung der Ehre für die Entscheidungen und Handlungen der homerischen Protagonisten. In der Öffentlichkeit der vor Troia Anwesenden messen sich die Führer der Griechen mit ihresgleichen, wobei ihre Anerkennung der gegenseitigen Gleichheit an Ehre zugleich die Ungleichheit ihrer Gefolgsleute bedeutet und damit ein Element der Legitimation und die Sicherung ihres Status bildet. Gerade weil sich die Aristokraten der homerischen Gesellschaft in einer derart komfortablen Position befinden und die Ehre in dieser Gesellschaft das unangefochtene Prinzip der sozialen Ordnung darstellt, das alle Lebensbereiche umfasst, treten die neuralgischen Punkte der konfliktorientierten Vorstellung von Ehre umso deutlicher hervor. Für die athenische Polis in klassischer Zeit kristallisiert sich damit eine zentrale Aufgabe heraus, die im Begriff der Ehre selbst gründet: Als konkurrierende Verhaltensnorm muss die Polis nicht nur ihr eigenes demokratisches Terrain verteidigen, sondern nach Möglichkeit auch die Folgen eines ausufernden Ehrbegriffes eindämmen. Dass gerade letzterer zu einer ernsthaften Gefahr für das Gemeinwesen werden kann, zeigt schon Achill, und es gilt umso mehr für die klassische Zeit mit ihren gefestigten demokratischen Strukturen und eingespielten politischen Mechanismen. Die Polis tritt als Verhaltensnorm nicht nur in Konkurrenz zur Ehre, indem sie alternative normative Vorgaben macht, sondern auch, indem sie die normativen An-
312
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
sprüche der Norm der Ehre beschneidet. Sie muss dem überhöhten Ehrgeiz einiger Ehrenmänner Grenzen setzen, indem sie die potentiell störenden habituellen Formen wie das agonale Konfliktverhalten, das in Rache ausarten kann, oder ihren aggressiven Exhibitionismus kanalisiert. Auf der anderen Seite scheint der Begriff der Ehre so flexibel zu sein, dass einige der typischen Verhaltensmuster in die politischen Gremien und Regeln eingebunden werden können, wie es etwa bei den athenischen Geschworenengerichten als Repräsentanten der Öffentlichkeit und bei der Aufrechterhaltung des Gedankens der Reziprozität geschieht. Den Athenern fiel es deshalb in vielen Einzelfällen nicht schwer, in ihren Handlungen beiden normativen Anforderungen gerecht zu werden. Die habituelle Form des agonalen Verhaltens erfüllten die Athener besonders eifrig, so dass einige Forscher glaubten, im Enthusiasmus der Griechen für ihre Agone das Geheimnis des Erfolgs der athenischen Kultur entschlüsselt zu haben. Tatsächlich spricht die Popularität der Agone für die spezifisch athenische Vorstellung, dass die Ehre eines Mannes sich wesentlich auf sein erfolgreiches agonales Verhalten gründe. In seiner basalen, ubiquitären Form besteht das agonale Verhalten in dem beständigen Rivalisieren und Wetteifern eines Mannes mit anderen ehrenhaften. Als für die Ehre konstituierend gilt dabei die Herausforderung an einen Ehrenmann, eine Auseinandersetzung gemäß den Normen der Ehre zu führen und wenn möglich, überlegen aus der Konfrontation hervorzugehen. Da die Ehre eines Mannes grundsätzlich vor anderen inszeniert werden muss, bieten solche kleinen agonalen Auseinandersetzungen die Gelegenheit, das soziale Wissen um die Ehre gesellschaftlich zu kommunizieren, den rechten Habitus an den Tag zu legen und so den Anspruch auf die Zuschreibung von Ehre zu stellen und zugleich zu legitimieren. Wegen der notwendig öffentlichen Wirkung des agonalen Verhaltens kann es als das ehrenhafte Verhalten schlechthin bezeichnet werden. Agonale Handlungen setzen die Erfüllung anderer formaler Normen der Ehre voraus. So ist etwa die Vorstellung der Gleichheit aller Ehrenhaften und die unbedingte Reziprozität der sozialen Beziehungen unerlässlich. In einer ehrenhaften Gesellschaft gibt es verschiedene soziale Räume, in denen sich das agonale Verhalten eines Ehrenmannes äußert, und in der athenischen Gesellschaft zeigt es sich auf verschiedenen Ebenen der Kommunikation und der Aktionen. In seiner alltäglichsten Variante spielt es sich in Athen auf der Agora ab: Das vergleichende Interagieren der athenischen Männer, das sich zumeist auf ein demonstrativ ehrenhaftes Gebaren und verbale Händel beschränkt, findet hier eine aufmerksame Öffentlichkeit, die die Zuschreibung von Ehre über den Konsens der Beobachtenden des Geschehens gewährleistet.
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
313
Weiter gefasst gehört auch das Konfliktverhalten der Männer gemäß der Norm der Ehre zum agonalen Verhalten. Auch hier sind Gleichheit und Reziprozität als normative Bezugspunkte wichtig, die Auseinandersetzung neigt in ihrer extremeren Form leicht zur Eskalation und widersetzt sich einer allzu leichten oder raschen Beendigung. Es sind dies die Fälle, die vor den Gerichten in Athen verhandelt werden: Die Grenzen zwischen dem angelegentlichen Wetteifern untereinander und dem handfesten Streit werden leicht überschritten, die verschiedenen Stationen, die die Ebenen voneinander trennen, werden eher als Herausforderungen zur Radikalität denn als Möglichkeiten der Beendigung des Streits begriffen. Konflikte, die entsprechend der Norm der Ehre ausgetragen werden, geraten leicht in einen Kreislauf der Vergeltung, in dem die wechselseitigen Racheakte bald die einzigen Handlungen sind, die die Ehre der Kontrahenten wiederherstellen können. Punktuell kann ein Mann seine agonale Ehre erweisen in einem als Wettkampf veranstalteten Agon, bei dem die Erlangung des Sieges von ausschlaggebender Bedeutung für die Mehrung der Ehre ist. Diese Möglichkeit, zu überragender agonaler Ehre zu gelangen, wurde in Griechenland vielfältig geboten und genutzt, die griechischen Poleis veranstalteten Agone, in denen sich die Männer nach unterschiedlichsten Kriterien aneinander maßen. Die prestigeträchtigsten dieser Agone waren die athletischen und musischen Wettkämpfe in Olympia. Einem Olympioniken wurde ein Vermögen an Ehre zugesprochen, das ans Unermessliche grenzte. In klassischer Zeit gelang es einigen Athenern, die zuvor nicht über einen herausragend ehrenhaften Status oder nennenswerte Privilegien verfügt hatten, zu dieser überreichen Ehre zu gelangen. Die sozialhistorisch interessante Hypothese, wonach die in Olympia außerhalb der athenischen Polis gewonnene Ehre, die einerseits in Sekunden errungen werden konnte und andererseits jegliche Vorstellung überstieg, zu einem vollkommen veränderten Status des Athleten in der Polis geführt hätte, konnte jedoch nur ansatzweise verifiziert werden. Die dafür erforderliche Transformation des agonal erlangten symbolischen Kapitels der Ehre leisteten jene Männer, die in Athen bereits über einflussreiche Positionen verfügten. Den einfacheren Bürgern gelang die Konvertierung ihrer agonalen Ehre nicht so leicht. Zwar sicherten sich diese Olympioniken einen lebenslangen ehrenhaften Status, aber die Zuschreibung von Ehre an sie beruhte eher auf einer, wie alle wohl wussten, einmaligen Leistung. Für diese Einstellung spricht auch der Umgang einiger Zeitgenossen mit der olympischen Ehre: Sie ist veräußerlich und haftet nicht attributiv an einer bestimmten Person. Der Unterschied zur Ehre, wie die Athener sie kannten, und wie sie fest mit der Polis verbunden war, zeigte sich schon in der geographischen Distanz: Alle etwaigen politischen oder
314
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
sozialen Erwägungen, die in der Interaktion der Ehrenmänner in der Polis eine Rolle spielten, relativierten sich in Olympia. Ohne störende Interferenzen durch normativ anders geartete Ansprüche der Poleis prägten die habituellen Formen den Charakter des olympischen Agons. Abgesehen von den liberalen Zugangsbedingungen, die außerhalb der athletischen Qualifikationen wenig verlangten, stellte die Nacktheit der Wetteifernden bei den Agonen das sichtbarste Zeichen der Gleichheit aller Teilnehmer dar. Der Sieg eines Mannes wurde nach objektiven Kriterien ermittelt, so dass die Zuschreibung von Ehre ebenso verlässlich erfolgte wie in einer ehrenhaften Gesellschaft üblich, aber keinerlei Interpretation über die Kongruenz von Sieghaftigkeit und Ehrenhaftigkeit eines Mannes mehr zuließ, wie sie etwa von Achill und Antilochos nach dem Wagenrennen diskutiert wurde. Dass die Griechen ihre Wettkämpfe fraglos in rein männlicher Gesellschaft austrugen, verweist auf die Grenzen der Verfügbarkeit über die agonale Ehre und ihrer Unabhängigkeit von der Person: Die Ehre als Element der männlichen Geschlechtsidentität wirkt auch in Olympia exklusiv. Das soziale Wissen um die Norm der Ehre manifestierte sich bei den olympischen Agonen in der Anerkennung des Reglements und der Beteiligung an den Wettbewerben, die situativ komprimiert die gewöhnliche Form des agonalen Umgangs der Ehrenmänner untereinander darstellte. Als sozialer Ordnungsfaktor kann die Ehre kaum von den Mitgliedern einer ehrenhaften Gesellschaft verbalisiert werden und entzieht sich der gewöhnlichen Kommunikation. Mit dem Schauspiel der Hahnenkämpfe fanden die Athener eine Möglichkeit, einige ihrer sozialen Mechanismen auf einer völlig anderen Ebene abzubilden. Schon für die Zeitgenossen setzten die Hähne, die im Dionysostheater und in den Straßen Athens miteinander kämpften, die Agone um die Ehre in Szene. Die Athener, die mit Leidenschaft diese Hähne züchteten und gegeneinander antreten ließen, sahen ihnen offenbar in dem Bewusstsein zu, dass sie das soziale Verhalten der Athener veranschaulichten. Die in der Öffentlichkeit stattfindenden Hahnenkämpfe ermöglichten dem Publikum eine Reflexion und Verbalisierung ihres eigenen durch Ehre geprägten Sozialverhaltens, wie sie in einer ehrenhaften Gesellschaft sonst nicht zum Repertoire der sozialen Verhaltensweisen gehört. Dabei spielte nicht nur das Ringen der Tiere um Ehre eine Rolle, sondern der theatralische, effektheischende Charakter der Hahnenkämpfe ist selbst ein notwendiger Bestandteil ehrenhaften Verhaltens, das von anderen gesehen und bestätigt werden muss, um sinnvoll zu sein. Ein agonales Verhalten in unerwartetem Ausmaß legten die athenischen Frauen an den Tag. Offenbar erschöpfte sich der Anspruch auf Ehre, den etwa athenische Bürgerinnen stellten, nicht zu jeder Zeit in der Wahrung ihrer sexuellen Integrität. Die Athenerinnen fungierten – wie die Frauen in jeder ehrenhaften Gesellschaft – als das komplementäre Gegenbild zu ihren
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
315
Ehrenmännern, was eine konsequente Einengung ihres Handlungsradius bedeutete, der in der Öffentlichkeit möglichst überhaupt nicht gegeben sein sollte. Bewegten sich die Athenerinnen aber in der – rein weiblichen – Öffentlichkeit, wie es zu einigen kultischen Anlässen erforderlich war, so gestaltete sich ihr Verhalten entsprechend den habituellen Formen der Ehre, wie sie für die Männer galten. Der Ehrgeiz des athletischen Wetteiferns, den die Frauen in Ausnahmesituationen an den Tag legten, deutet eine Kluft zwischen der Norm des von ihnen erwarteten Verhaltens und der Realität der von ihnen gestalteten Lebensräume an. Die Quellenlage verhindert eine Überbrückung oder Bemessung dieser Kluft, da sich das Leben der Frauen allermeistens eben doch in den Oikoi abspielte. Die Art der Transgression der Frauen aber zeigt, dass es für sie keine Alternative zu einer durch Ehre geprägten Gesellschaft gab, sondern dass sie vielmehr dort, wo sie die Möglichkeiten der Erweiterung ihres Handlungsspielraumes sahen, die Verhaltensnormen der Männer übernahmen. Charakteristischerweise wichen die Männer in gleichem Maße zurück, wie die Frauen ihre sozialen Räume okkupierten. So beugten sich die athenischen Männer auch dort den normativen Bedingungen der ehrenhaften Gesellschaft, die eine Komplementarität der Rollen und Räume von Männern und Frauen vorschrieb, wo sie an Terrain und Kontrolle verloren. Die zeitliche Befristung und die Bedeutung der Fruchtbarkeitskulte gaben vermutlich den Ausschlag für die Duldung dieser ausnahmsweisen Verschiebung der asymmetrischen Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern. Dennoch blieb die Abgrenzung der Ehrenmänner zum anderen Geschlecht der elementarste Mechanismus der Abgrenzung gegen nicht Ehrenhafte. Darüber hinaus existierten weitere Kriterien, die die Gleichheit sowohl aller Ehrenmänner wie aller Polisbürger und die Ungleichheit derer, die nicht über einen entsprechenden Status verfügten, definierten. Die Mechanismen der Inklusion und Exklusion der Normen von Ehre und Polis beruhten nicht auf identischen Auswahlverfahren und führten nicht zu den gleichen Ergebnissen. So verfügten die von athenischen Bürgern abstammenden Frauen über ein latentes Bürgerrecht, das sie vererben konnten, und hatten so einen gewissen Anteil an der Polisbürgerschaft, der sie von den anderen Frauen abgrenzte. Als in jeder Hinsicht privilegierte Gruppierung kristallisieren sich die athenischen Männer mit Bürgerstatus heraus, die zugleich Ehrenmänner und Polisbürger sind. In der Polis waren alle Bürger gleich, hinsichtlich der Norm der Ehre aber blieben sie weiterhin ungleich. Auch innerhalb der relativ homogenen Gruppe der ehrenhaften Polisbürger existierten feine Unterschiede des ehrenhaften Status, wie sie sich in der spezifischen Form der Kommunikation unter Ehrenmännern spiegelten. Wie in vielen ehrenhaften Gesellschaften, so konsolidierte auch in der athenischen die Norm der Ehre bestehende
316
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
soziale Ungleichheiten und legitimierte sie in ihren verschiedenen Abstufungen. Offenbar gelang den Athenern der Balanceakt zwischen politischer Gleichheit bei gleichzeitiger sozialer Ungleichheit, weil sie als Ehrenmänner mit diesem der Ehre inhärenten Phänomen der Gleichzeitigkeit von Gleichheit und Ungleichheit bereits vertraut waren. Als Polisbürgerschaft, die die athenischen Ehrenmänner auch waren, verankerten sie die sozialen Sanktionen, die auf eine Störung des Gleichgewichts von Gleichheit und Ungleichheit verhängt wurden, gesetzlich. Der NÒμOJ ÛBREWJ und das Gesetz zur Verhängung der Atimie legen Zeugnis ab für das Bemühen der Athener um eine Aufrechterhaltung des Status Quo. Vielleicht sind jene Gesetze auch deshalb so selten angewandt worden, weil sie im Grunde einen Tatbestand mit Sanktionen belegten, auf den nur auf sozialer, nicht aber politischer Ebene, angemessen reagiert werden konnte. Immerhin zeigt die Einbindung sowohl des übergroßen Anspruchs auf Ehre als auch eines Defizits an Ehre als ihr Gegenteil in die Terminologie und die Statuskriterien der athenischen Bürger ein Bemühen um eine möglichst weite Umfassung der Ehre durch die Polis. Für den Versuch der Einbindung der Normen der Ehre in den normativen Rahmen der Polis sprechen auch die athenischen Gerichtsreden, die die Auseinandersetzungen unter Ehrenmännern vor den Geschworenengerichten der Polis weiterführen. Die juristischen Verfahren in Athen stellen nicht in erster Linie eine Form der Konfliktbewältigung und -beendigung dar, unter anderem, weil sich ein Streit unter Ehrenmännern kaum vor Gericht beenden lässt. Vielmehr fungierten die Geschworenengerichte als öffentliche Foren, auf denen athenische Ehrenmänner ihren Schlagabtausch fortsetzten, den sie auf der Straße, in ihren Oikoi oder in den Gerichtssälen begonnen hatten. Die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen den ehrenhaften Konfliktbewältigungsstrategien und den gerichtlichen Verfahren der Polis erleichterten die Kombination der Mittel. Beide erforderten eine Öffentlichkeit, einen Agon auf verbaler Ebene, ein gewisses Maß an Exhibitionismus und vor allem ein Wissen um den rechten Habitus und die Norm der Ehre bzw. der Polis. Diese Gemeinsamkeiten gründen in der Entwicklung des athenischen Rechtswesens in und durch eine ehrenhafte Gesellschaft. Sie ermöglichen es den Athenern, speziell auf dem für die Stabilität einer Gesellschaft so sensiblen Gebiet wie der Konfliktbewältigung die normativen Bezugspunkte, nach denen sie ihr Handeln ausrichten, zu wechseln. Tatsächlich lässt sich bei der Analyse der Auseinandersetzungen zwischen athenischen Ehrenmännern besonders gut beobachten, wie diese die Normen der Ehre mit den Normen der Polis verbinden. Durch die nachträgliche Verbalisierung und Rationalisierung der einzelnen Handlungen und Aktionen während eines Streits stellen die Athener, die vor Gericht und vor den athenischen Geschworenen ihr Verhalten in einen allgemein akzeptierten
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
317
normativen Rahmen einbinden müssen, ihr Verhalten immer als gesetzesund den Normen der Polis getreu dar. Die von ihnen geschilderten Handlungen offenbaren dabei ihr Konfliktverhalten als durchaus ehrenhaft, auf verbaler Ebene aber wird es konterkariert durch eine Anpassung an die Normen der Polis. Die Untersuchung sowohl der Handlungs- wie auch der Verbalebene diverser Gerichtsreden ergab vor allem die Bedeutung der normgerechten Interpretation des Verhaltens. Angesichts der Tatsache, dass alle Kontrahenten ihre Handlungen sowohl nach der Norm der Ehre als auch nach der Norm der Polis ausrichten konnten, bieten die herangezogenen Reden eine Vorstellung von der Spannweite des Verhaltens athenischer Ehrenmänner und Polisbürger, das zwischen beiden normativen Bezugssystemen oszilliert. Die thematischen Schwerpunkte der verschiedenen Gerichtsreden bewegen sich zunehmend – kapitelweise gebündelt – näher an die Polis heran. In einigen Fällen kamen Konflikte vor Gericht, in denen die Ehre der Kontrahenten den eigentlichen Streitpunkt bildete und eine Ehrverletzung der Anlass der Klage war. Die Reden des Demosthenes gegen Meidias, des Ariston gegen Konon und des Euphiletos über die Tötung des Eratosthenes behandelten spektakuläre Fälle von Ehrverletzungen, bei denen die Norm der Ehre im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Die Schilderung des Verlaufs der verschiedenen Streitigkeiten ähnelte sich in den drei Reden in bestimmten Punkten: Dem Prozess war ein Streit zwischen zwei ehrenhaften Kontrahenten vorausgegangen, der bereits alle typischen Stationen eines solchen Schlagabtausches passiert hatte, bevor er vor Gericht gebracht wurde. Angesichts des mangelnden Interpretationsspielraums im normativen Kontext der Ehre entschlossen sich die Ehrenmänner für einen Wechsel des Bezugsrahmens und deuteten den Streit unter dem Vorzeichen der Norm der Polis, um über die Öffentlichkeit der athenischen Geschworenengerichte einen akklamierenden Konsens ihres Verhaltens zu erzielen. Die Reden verweisen sowohl auf die normative Kraft der Ehre, die weiterhin die Handlungen eines Mannes im Konfliktfall steuert, als auch auf die Deutungsmacht, über die die Polis als normativer Bezugsrahmen verfügte. Typischer für den Verlauf von Auseinandersetzungen in ehrenhaften Gesellschaften sind die weniger spektakulären Streitigkeiten, wie sie sich zu jeder Zeit auf den Straßen Athens zwischen zwei Männern anbahnen konnten. Diese Ehrenhändel, die teils auf der Straße, teils im Gericht abgehalten wurden, entwickelten sich entsprechend der Logik von Herausforderung, Vergeltung und Erwiderung der Herausforderung, die sich im weiteren Fortgang des Streites beständig wiederholten und an Radikalität gewannen. Die in Athen zu beobachtenden Auseinandersetzungen verliefen nach die-
318
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
sem Muster der ehrenhaften Auseinandersetzung, wie es in vielen ehrenhaften Gesellschaften gilt. Die athenische Besonderheit bestand in der Möglichkeit der Kontrahenten, jederzeit auf die Ebene der Polisnorm zu wechseln und den Streit aus dieser konkurrierenden Perspektive interpretieren zu können. Der Gegner des Simon, Apollodor und Nikostratos machen regen Gebrauch von dem Angebot der Polis, auf ein konkurrierendes normatives Bezugssystem umzuschwenken. Als Ehrenmänner bekämpfen sie ihre Widersacher mit allen Mitteln, wozu auch die Instrumente gehören, die die Polis für diesen Kampf bereitstellt: Sie verfolgen ihre Gegner mit Gerichtsverfahren, locken sie in Hinterhalte, um sie straffällig werden zu lassen und greifen, noch während die Verfahren laufen, zu den bewährten ehrenhaften Methoden der Beleidigung oder des körperlichen Angriffs ihrer Gegner. Die diskutierten Fälle zeigen einerseits, dass die Norm der Ehre das Konfliktverhalten der Athener, das nach den typischen Mustern ehrenhafter Auseinandersetzungen abläuft, entscheidend prägt. Andererseits wird die konkurrierende Norm der Ehre akzeptiert als Mittel der Auseinandersetzung, wobei die erfolgreiche Integration der Ehrenmänner in die juristischen Verfahren der Polis zuweilen den Preis dieses Arrangements enthüllte: Eine Instrumentalisierung der gerichtlichen Mittel der Polis für die Auseinandersetzungen der Männer um ihre Ehre. Selbst die Kämpfe um die Polisehrungen gerieten zu einem Teil der Konflikte unter Ehrenmännern. Die strukturellen Ähnlichkeiten der ehrenhaften Gesellschaft einerseits und der athenischen Polis andererseits ermöglichten ein Ineinandergreifen der Belohnungen und Sanktionen von Ehre und Polis. Das verschaffte den Athenern die Gelegenheit, in den Gerichtsreden den Sinn der Ehrungen zu reflektieren, die im Rahmen der Polis ein fassbares Privileg darstellten, und deshalb einen Verhandlungsspielraum boten, wie es die rein imaginative Zuschreibung von Ehre auf der sozialen Ebene verhinderte. Die direkteste Synthese von Ehre und Polis geschieht in der Rede des Invaliden, die in vieler Hinsicht eine Ausnahme unter den Quellen darstellt, unter anderem weil sie einen einfachen Bürger Athens die Stimme erheben lässt. Der Sprecher verfügt über eine Art Bürgerehre, die als eine Kombination der Norm der Ehre und der Norm der Polis auf der Ebene der Identität jener Personen gedacht werden kann, die in beiden Bezugssystemen zu den Privilegierten gehören. So drückt sich in der Bürgerehre eines Polisbürgers sowohl sein Ehrgefühl als auch sein Bürgerstatus aus. Weil er über beides verfügt, stehen ihm für seine Handlungen und für die Interpretation seines Verhaltens beide normativen Bezugssysteme zur Verfügung: die Ehre und die Polis.
Zusammenfassung: Das Zusammenspiel von Ehre und Polis
319
Für die athenischen Bürger bildeten in klassischer Zeit offenbar die Ehre und die Polis jene sinnstiftenden und handlungsleitenden Vorstellungen und Normen, die das Verhalten des einzelnen Bürgers bestimmten. Das Forschungspatt zwischen den beiden engagiertesten Historikern auf diesem Gebiet – David Cohen und Gabriel Herman – ist bezeichnend für die historische Gemengelage: Auch die Athener oszillierten zwischen den beiden Polen des agonalen, kompetitiven Ehrverhaltens und der Orientierung an den kooperativeren Werten der Polis. Ihr Verhalten zeigt jedoch keine feste Bindung an ein bestimmtes Bezugssystem, wie es in den Studien von Cohen und Herman geschildert wird. Eine detaillierte Rekonstruktion der Verhaltensweisen einiger Athener in charakteristischen sozialen Kontexten erwies vielmehr die Flexibilität der Akteure: Dieselbe Person verhält sich in verschiedenen Kontexten an aufeinander folgenden Tagen mal dezidiert ehrenhaft, mal macht sie sich die Institutionen der Polis zunutze und häufiger noch sucht sie beides zu verbinden. So stehen Ehre und Polis in einem Spannungsverhältnis zueinander, dessen Dynamik sich aus den Handlungen der Athener speist. Von einem wirklichen Gegeneinander beider normativer Ansprüche kann nur in wenigen Ausnahmefällen gesprochen werden. Selbst in scheinbar ausweglosen Situationen bietet das konkurrierende Bezugssystem eine Alternative, die die Athener geschickt zu nutzen wissen. Das Verhältnis zwischen Ehre und Polis mit ihren jeweiligen normativen Ansprüchen kann deshalb eher als ein Miteinander charakterisiert werden. Die Verknüpfung zwischen den Normen der Ehre und jenen der Polis gelang offenbar auf unterschiedlichen Gebieten recht gut. Der Hauptgrund dafür dürfte die organische Entwicklung der athenischen Demokratie aus der ehrenhaften Gesellschaft heraus gewesen sein. Sie ermöglichte es den Athenern, auch in den Zeiten der Demokratie Männer von Ehre zu sein.
Abkürzungen
ABG AA A&A AClass AJPh AncSoc APF AU BCH BMCRev CAH CJ ClR ClW C&M CPh CQ ClR CW DAA GG G&R GRBS GWU HPTh HSPh HZ IvOl JHS KZSS MGR IAG OAth OCD PCPhS QS RE REG RhM TAPhA WS ZPE ZRG
Archiv für Begriffsgeschichte Archäologischer Anzeiger Antike und Abendland Acta classica American Journal of Philology Ancient Society Athenian Propertied Families Der altsprachliche Unterricht Bulletin de Correspondance Hellénique Bryn Mawr classical review The Cambridge Ancient History The classical journal Classical Review The Classical World Classica et mediaevalia Classical Philology Classical Quaterly Classical Review The Classical world Dedications from the Athenian Acropolis Geschichtliche Grundbegriffe Greece and Rome Greek, Roman and Byzantine studies Geschichte in Wissenschaft und Unterricht History of political thought Harvard studies in classical philology Historische Zeitschrift Die Inschriften von Olympia Journal of Hellenic Studies Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Miscellanea greca e romana Iscrizioni agonistiche Greche Opuscula Atheniensia Oxford Classical Dictionary Proceedings of the Cambridge Philological Society Quaderni di storia Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Revue des Études Grecques Rheinisches Museum Transactions of the American Philological Association Wiener Studien Zeitschrift für Papyrologie und Ephigraphik Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
Quellen- und Literaturverzeichnis
I. Quellen 1. Textquellen Claudii Aeliani Varia Historia, hg. v. M.R. Dilts, Leipzig 1974. Claudius Aelianus, De natura animalium libri XVII, hg. v. R. Hercher, Leipzig 1864-1866 (ND Graz 1971). Claudius Aelianus, Bunte Geschichten, übers. v. H. Helms, Leipzig 1990. Corpus Fabularum Aesopicarum, Bd. 1, hg. v. A. Hausrath, Leipzig 1959. Antike Fabeln. Hesiod. Archilochos. Aesop. Ennius. Horaz. Phaedrus. Babrios. Avianus. Romulus, eingel. u. übers. v. L. Mader, hg. v. K. Hoenn, Zürich 1951. Sexti Iulii Africani '/LUμPI£DWN ¢NAGRAF», hg. u. komm. v. J. Rutgers, Diss. phil., Leiden 1862. Aischines Orationes, hg. v. M.R. Dilts, Stuttgart/Leipzig 1997. Aischines’ Reden, gr.-dt., 3 Bde., übers. u. erkl. v. G.E. Benseler, Leipzig 1855-1860. Aischyli Septem quae supersunt Tragoediae, recogn. G. Murray, Oxford 19662. Aischylus, Tragödien, gr.-dt., übers. v. O. Werner, hg. v. B. Zimmermann, Darmstadt 1996. Andocide, Discours, bearb. u. übers. v. G. Dalmeyda, Paris 1930 (ND 19663). [Andocide] Contro Alcibiade, eingel., übers., komm., erl. u. hg. v. P.C. Ghiggia, Pisa 1995. Andokides, Andokides, übers. u. erl. v. A.G. Becker, Leipzig 1832. I. Bekkeri Anecdota greca, 3 Bde., Berlin 1814-1821 (ND Graz 1965). Aristophanis Comoediae, recogn. F.W. Hall und W.M. Geldart, 2 Bde. Oxford 19072 (ND Oxford 1982). Scholia Graeca in Aristophanem, bearb. u. komm. v. F. Dübner, Paris 1877 (ND Hildesheim 1969). Aristophanes, Sämtliche Komödien, übers. v. L. Seeger, mit einer Einleitung und einer Übertragung von Fragmente der alten und mittleren Komödie v. O. Weinreich, Zürich/München 19682 (ND Zürich 1987). Aristotelis Ars rhetorica, recogn. W.D. Ross, Oxford 1959 (ND Oxford 1986). Aristotelis Atheniensium Respublica, recogn.F.G. Kenyon, Oxford 1920 (ND Oxford 1970). Aristotelis Historia animalium, ex rec. I. Bekker, Berlin 1829. Aristoteles, Der Staat der Athener, übers. v. M. Chambers, hg. v. H. Flashar, Darmstadt 1990. Aristoteles, Rhetorik, hg., übers. u. erl. v. F.G. Sieveke, München 1980. Aristoteles, Tierkunde, übers. v. P. Gohlke, Paderborn 19572. Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV, 2. Bd.: libri VI-X, recens. G. Kaibel, Stuttgart 1887 (ND Stuttgart 1965). Athenaeus (Naucratites): Das Gelehrtenmahl, eingel. u. übers. v. C. Friedrich, komm. v. T. Nothers, 2. Bd.: Buch IV-VI, Stuttgart 1998. Aurelii Augustini Contra adademicos, De beata vita necnon De ordine libri, recens. W.M Green, Utrecht/Antwerpen 1956. Aurelius Augustinus, Die Ordnung, übers. v. C.J. Perl, Paderborn 19664. Babrii Mythiambi Aesopei, hg. v. M.J. Luzzatto und A. La Penna, Leipzig 1986.
Anhang
323
Lucius Iunius Moderatus Columella, Zwölf Bücher über Landwirtschaft. Buch eines Unbekannten über Baumzüchtung, lat.-dt., hg. u. übers. v. W. Richter, 3 Bde., München 1981-1983. Demosthenis Orationes, recogn. S.H. Butcher, 3 Bde., Oxford 1903-1931 (ND Oxford 1971-1980). Apollodor, Against Neaira [Demosthenes] 59, hg. u. übers. v. C. Carey, Warminster, Wiltsh. 1992. Demosthenes, Against Meidias (Oration 21), hg., übers., eingel., u. komm. v. D.M. MacDowell, Oxford 1990. Demosthenes, Selected Private Speeches, hg. v. C. Carey und R.A. Reid, Cambridge 1985. Demosthenes, Rede für Ktesiphon über den Kranz, hg., übers. u. erl. v. W. Zürcher, Darmstadt 1983. Demosthenes, Ausgewählte Reden, übers. v. A. Westermann, Berlin 1855-1890. Diodori Bibliotheca Historica, 6 Bde., recogn. F. Vogel (Bd. 1-3) u. C.T. Fischer (Bd. 4-6), Stuttgart 1893-1906 (ND Stuttgart 19643). Diodoros, Griechische Weltgeschichte, Bd. 2: Buch XI-XIII, übers. v. O. Veh, eingel. u. komm. v. W. Will, Stuttgart 1998. Diodor’s von Sicilien historische Bibliothek, übers. v. J.F. Wurm, 4 Bde., Stuttgart 1827-1839. Diogenis Laertii Vitae Philosophorum, recogn. H.S. Long, 2 Bde., Oxford 19662. Dionysios Halicarnasseus antiquitates Romanorum quae supersunt, hg. v. C. Jacoby, 4 Bde., Stuttgart 1885-1905 (ND Stuttgart 19952-19972). Eustathii Commentarii at Homeri Iliadem Pertinentes, 4 Bde., hg. v. M. van der Valk, Leiden 1971-1987. Herodoti historiae, recogn. C. Hude, 2 Bde., Oxford 1908 (ND Oxford 1979). Herodot, Historien, übers. v. W. Marg, eingel. v. D. Fehling, erl. v. B. Zimmermann, München 1991. Homeri Opera, recogn. D.B. Monro u. T.W. Allen, Bd. 1 u. 2: Iliadis, Oxford 19203 (ND Oxford 1969-1971), Bd. 3 u. 4: Odysseae, Oxford 19172-19192 (ND Oxford 1966-1974). Homer, Odyssee, hg. v. P. Von der Mühll, übers. v. H. Voss, Zürich 1980. Homer, Ilias, übers. v. W. Schadewaldt, Frankfurt a.M. 1975. Hyperidis Orationes et Fragmenta, recens. F.G. Kenyon, Oxford 1907. Isaei orations cum deperditarum fragmentis, hg. V. T. Thalheim, Stuttgart 19032 (ND Stuttgart 1963). Isocrates, Discours, hg. u. übers. v. G. Mathieu und É. Brémond, Bd. 3, Paris 1966. Isokrates, Sämtliche Werke, übers. v. C. Ley-Hutton, hg., eingel. u. erl. v. K. Brodersen, Bd. 2, Stuttgart 1997. Luciani Opera, recogn. M.D. Macleod, 4 Bde., Oxford 1972-1987. Scholia in Lucianum, hg. v. H. Rabe, Leipzig 1906 (ND Stuttgart 1971). Lukian. Werke in drei Bänden, hg. v. J. Werner und H. Greiner-Mai, übers. v. C.M. Wieland, Berlin/Weimar 1974. Lysiae Orationes, recogn. C. Hude, Oxford 1912 (ND Oxford 1968). Lysias, Rede über die Verweigerung der Rente für einen Invaliden, in: Drei ausgewählte Reden, gr.-dt., hg. u. übers. v. G. Wöhrle, Stuttgart 1995, 5-19. Lisia, Orazione per L’invalido, hg. u. komm. v. N. Marinone, Turin 1986. Greek Orators I. Antiphon and Lysias, hg., übers., komm. u. erl. v. M. Edwards und S. Usher, Warminster, Wiltsh. 1985. Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene. hg., eingel. u. komm. v. G. Avezzù, Padua 1985. Treu, U.: Der Rächer seiner Ehre. Gerichtsreden, Stuttgart 1983. Lysias, Selected Speeches, hg., übers. u. komm. v. C. Carey, Cambridge 1979. Lisia, L’orazione per il soldato, hg. v. M. Marzi, Turin 1976. Lisia, I Discorsi, hg., eingel. u. übers. v. U. Albini, Florenz 1955. Lisia, Per L’ invalido, hg., übers., eingel. u. komm. v. D. Alasia, Florenz 1951 (ND Florenz 1971). Pausaniae Graeciae descriptio, recogn. F. Spiro, 3 Bde., Stuttgart 1903 (ND Stuttgart 1967). Pausanias, Reisen in Griechenland, 3 Bde., übers. v. E. Meyer, hg. v. F. Eckstein, Zürich/München 19863. Phaedrus, Fabeln, lat.-dt., hg. u. übers. v. E. Oberg, Zürich 1996.
324
Anhang
Philostratos, Über Gymnastik, hg. u. übers. v. J. Jüthner, Leipzig/Berlin 1909 (ND Amsterdam 1969). Pindari Carmina cum fragmentis, recogn. C.M. Bowra, Oxford 1935 (ND Oxford 19682). Scholia vetera in Pindari carmina, recens. A.B. Drachmann, Leipzig 1903-1927 (ND Amsterdam 1966-1969). Platonis Opera, recogn. I. Burnet, 5 Bde., Oxford 1900-1907 (ND Oxford 1968). Platon, Werke in acht Bänden, gr.-dt., hg. v. G. Eigler, übers. v. F. Scheiermacher, D. Kurz u. K. Schöpsdau, 8 Bde., Darmstadt 1977. C. Plini Secundi Naturalis Historiae libri XXXVII, hg. v. K. Mayhoff, 7 Bde., Stuttgart 1892-1909 (ND Stuttgart 1967). C. Plinius Secundus d.Ä., Naturkunde, lat.-dt., hg. u. übers. v. R. König, 37 Bände, Zürich/München 1971-1994. Plutarchi Vitae Parallelae, 3 Bde., hg. v. K. Ziegler, Leipzig 1964-1971 (Teubneriana). Plutarch, Große Griechen und Römer, übers. v. K. Ziegler u. W.Wuhrmann, 6 Bde., Zürich/Stuttgart 1954-1965. L. Annaeus Seneca, Apocolokyntosis, lat.-dt., hg. u. übers. v. G. Binder, Düsseldorf/Zürich 1999. Suidae Lexicon, hg. v. A. Adler, 5 Bde., Stuttgart 1928-1938 (ND 1967-1971). Thucydidis Historiae, recogn. H.S. Jones, 2 Bde., Oxford 1942 (ND 1986-1987). Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, übers., eingel. u. erl. v. G.P. Landmann, München 1976. Xenophontis Opera Omnia, recogn. E.C. Marchant, 5 Bde., Oxford 1900-1920 (ND 1968-1970) Xenophon, Hellenika, gr.-dt., hg. V. G. Strasburger, übers. v. P. Jaerisch, München/Zürich 20003. Xenophon, Oeconomicus, hg., übers. u. komm. v. S.B. Pomeroy, Oxford 1994.
2. Inschriften Ebert, J. (Hg.), Griechische Epigramme auf Sieger in gymnischen und hippischen Agonen, Berlin 1972. Dittenberger, W. und K. Purgold (Hg.), Die Inschriften von Olympia, 1896 (ND Amsterdam 1966). Moretti, L., Iscrizioni agonistiche Greche, Rom 1953. Raubitschek, E., Dedications from the Athenian Acropolis, Cambridge, Mass. 1949.
II. Literatur Adkins, A.W.H., Homeric Ethics, in: Morris und Powell, Companion, 694-713. –, Rez. N.R.E. Fisher, Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, in: CJ 90 (1995), 451-455. –, Gagarin and the »Morality« of Homer, in: CPh 82 (1987), 311-322. –, Values, Goals, and Emotions in the Iliad, in: CPh 77 (1982), 292-326. –, Problems in Greek Popular Morality. Rez. K.J. Dover, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, in: CPh 73 (1978), 143-158. –, Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece. From Homer to the end of the Fifth Century, New York 1972. –, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values, Oxford 1970. –, Threatening, Abusing and Feeling Angry in the Homeric Poems, in: JHS 89 (1969), 7-21. –, ›Honour‹ and ›Punishment‹ in the Homeric Poems, in: BICS 7 (1960), 23-32. Albini, U., L’orazione Lisiana per l’invalido, in: RhM 95 (1952), 328-338.
Anhang
325
Alexiou, E., Ruhm und Ehre. Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates, Diss. phil., Heidelberg 1995. Allen, D.S., The World of Prometheus. The Politics of Punishing in Democratic Athens, Princeton, N.J. 2000. Anderson, J.K., Ancient Greek Horsemanship, Berkeley/Los Angeles 1961. Arieti, J.A., Nudity in Greek Athletics, in: ClW 68 (1975), 431-436. Arnaoutoglou, I., Associations and Patronage in Ancient Athens, in: AncSoc 25 (1994), 5-17. Arnheim, M.T., Aristocracy in Greek Society, London 1977. Arthur, M.B., Early Greece: The Origins of the Western Attitude toward Women, in: J. Peradotto und J.P. Sullivan (Hg.), Women in the Ancient World. The Arethusa Papers, New York 1984, 7-58. Asano-Tamanoi, M., Shame, Family, and State in Catalonia and Japan, in: Gilmore, Honor, 104120. Atkinson, H., Cock-Fighting and Game Fowl, Bath 1938. Austin, M. und P. Vidal Naquet, Gesellschaft und Wirtschaft im alten Griechenland, München 1984. Ballin, T.N., A Commentary on [Demosthenes] 50 Against Polykles, Diss. phil., Ann Arbor, Mich. 1980. Bandy, S.F. (Hg.), Coroebus Triumphs. The Alliance of Sport and the Arts, San Diego 1988. Barkan, I., Capital Punishment in Ancient Athens, Diss. phil., Chicago 1935. Baroja, J.C., Honour and Shame: A Historical Account of Several Conflicts, in: Peristiany, Values, 79-137 Bauman, R.A., Political Trials in Ancient Greece, London/New York 1990. Beecroft, A.J., Rez. Jinyo Kim, The Pity of Achilles: Oral Style and the Unity of the Iliad, in: BMCRev 2001.10.01. Behrends, O., Der ungleiche Tausch zwischen Glaukos und Diomedes und die Kauf-TauschKontroverse der römischen Rechtsschulen, in: Historische Anthropologie 10,2 (2002), 245266. Bell, D., The Horse Race (KELHS) in Ancient Greece from the Pre-classical period to the first century B.C., in: Stadion 15 (1989), 167-190. Bellen, H., Der Rachegedanke in der griechisch-persischen Auseinandersetzung, in: Chiron 4 (1974), 43-67. Benedict, R., The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture, Tokyo 19833. Berger, P.L., Über den Begriff der Ehre und seinen Niedergang, in: ders., B. Berger und H. Kellner (Hg.), Das Unbehagen in der Modernität, Frankfurt a.M. 1987, 75-85. Bernardini, P.A., Le donne e la pratica della corsa nella grecia antica, in: dies. (Hg.), Lo sport in Grecia, Rom/Bari 1988, 153-184. Berneker, E., PROBOL», in: RE 23 (1957), 43-48. Berve, H., Vom agonalen Geist der Griechen, in: ders., Gestaltende Kräfte der Antike, München 1966, 1-20. Bethe, E., Die dorische Knabenliebe. Ihre Ethik und ihre Idee, in: RhM 62 (1907), 438-475. Biddiss, M., The invention of modern Olympic tradition, in: M. Wyke und M. Biddiss (Hg.), The Uses and Abuses of Antiquity, Bern 1999, 125-143. Bilinski, B., Efesto e l’ agonistica greca, in: Magna Graecia 26 (1991), 1-5. Blanchard, K. und A. Cheska, The Anthropology of Sport, South Hadley, Mass. 1985. Blass, F., Die attische Beredsamkeit, 3 Bde., Hildesheim/New York 19793 (1. Aufl. 1887-1898). Bleicken, J., Wann begann die athenische Demokratie?, in: HZ 260 (1995), 337-364. Blok, J., Virtual Voices: toward a Choreography of Women’s Speech in Classical Athens, in: Lardinois und McClure, Silence, 95-116. –, Sexual Asymmetry. A Historiographical Essay, in: dies. und P. Mason (Hg.), Sexual Asymmetry. Studies in Ancient Society, Amsterdam 1987, 1-57. Blundell, M.W., Helping Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge 1989.
326
Anhang
Boe, A.F. und L.I. Olsen, Beauty, Strength, and Wisdom: Aidos in Athletics, in: Arete 1,1 (1983), 165-176. Boegehold, A., At Home. Lysias 1.23, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 597600. – und A.C. Scafuro (Hg.), Athenian Identity and Civic Ideology, London/Baltimore 1994. Boehm, C., Blood Revenge. The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies, Pennsylvania 19992. Boehringer, D., Zur Heroisierung historischer Persönlichkeiten bei den Griechen, in: M. Flashar [u.a.] (Hg.), Retrospektive. Konzepte von Vergangenheit in der griechisch-römischen Antike, München 1996, 37-52. Boetticher, C., Ergänzungen zu den letzten Untersuchungen auf der Akropolis zu Athen. Der antike Festkalender auf der Akropolis zu Athen, in: Philologus 22 (1865), 386-436. Bonfante, L., The naked Greek. How ancient art and literature reflect the custom of civic nudity, in: Archaeology 43 (1990), 28-35. Bonner, R.J., The Legal Setting of Isocrates’ Antidosis, in: CPh 15 (1920), 193-197. Bons, J.A.E., Geen been om op te staan. Lysias’ De zaak von de invalide (or. 24), in: Lampas 34 (2001), 207-219. Borthwick, E.K., Two Emotional Climaxes in Lysias’ Against Eratosthenes, in: CW 84 (1990/91), 44-46. –, Death of a Fighting Cock, in: ClR 16 (1966), 4-5. Bourdieu, P., Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. 1987. –, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: R. Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheit, Göttingen, 1083, 183-198. –, Sport and Social Class, in: Social Science Information 17 (1978), 819-840. –, Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1976. Bowie, A., Exuvias Effigiemque. Dido, Aeneas and the body as a sign, in: Montserrat, Bodies, 5779. Brandes, S., Reflections on Honor and Shame in the Mediterranean, in: Gilmore, Honor, 121-134. Bremmer, J., An Enigmatic Indo-European Rite: Paederasty, in: Arethusa 13 (1980), 279-298. Broneer, O., The Thesmophorion in Athens, in: Hesperia 11 (1942), 250-274. Brophy, R.J., Rez. Robert Garland, The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Greco-Roman World, in: BMCRev 1979.09.04. Bruneau, P., Le Motif des Coqs affrontés dans l’imagerie antique, in: BCH 89 (1965), 90-121. Bruyère-Demoulin, N., La vie est une course. Comparaisons et métaphores dans la littérature grecque ancienne, in: AC 45 (1976), 446-463. Buckler, J., Demosthenes and Aeschines, in: Worthington, Demosthenes, 114-158. Buhmann, H., Der Sieg in Olympia und in den anderen panhellenischen Spielen, Diss. phil., München 1972. Burckhardt, J., Der koloniale und agonale Mensch, in: ders., Griechische Kulturgeschichte, Bd. IV, Basel 1956-57, 82-117 (ND München 1977). Burckhardt, L. und J. von Ungern-Sternberg (Hg.), Große Prozesse im antiken Athen, München 2000. Burkhart, D., Ehre. Das symbolische Kapital, München 2002. Burkert, W., Athenian Cults and Festivals, in: CAH2 V: The Fifth Century B.C., Cambridge 1992, 245-267. –, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1977. –, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen, Berlin 1972. Cairns, D.L., The Politics of Envy: Envy and Equality in Ancient Greece, in: Konstan und Rutter, Envy, 235-252. –, Hybris, Dishonour, and Thinking Big, in: JHS 116 (1996), 1-32. –, Rez. N.R.E. Fisher, Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, in: ClR 44 (1994), 76-79.
Anhang
327
–, AIDÔS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature, Oxford 1993. Campbell, B., Thought and Political Action in Athenian Tradition. The Emergence of the ‘Alienated’ Intellectual, in: HPTh 5 (1984), 17-59. Campbell, J.K., The Greek hero, in: Peristiany und Pitt-Rivers, Grace, 129-149. –, Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Oxford 1964. Cantarella, E., Moicheia. Reconsidering a Problem, in: Symposion 1990, Köln 1991, 289-296. –, Spunti di riflessione critica su ÛBRIJ E TIμ» in Omero, in: P. Dimakis (Hg.), Symposion 1979, Köln 1983, 85-96. Carawan, E.M., Akriton Apoktinai: Execution without Trial in Fourth-Century Athens, in: GRBS 25 (1984), 111-121. Carey, C., Observers of speeches and hearers of action: the Athenian orators, in: O. Taplin (Hg), Literature in the Greek and Roman Worlds, Oxford 2000, 192-216. –, Rape and Adultery in Athenian Law, in: CJ 89 (1995), 407-417. –, Structure and Strategy in Lysias XXIV, in: G&R 37 (1990), 44-51. Carson, A., Putting Her in her Place: Woman, Dirt, and Desire, in: Halperin, Winkler und Zeitlin, Sexuality, 135-169. Cartledge, P., P. Millett und S. von Reden (Hg.), Kosmos. Essays in order, conflict and community in classical Athens, Cambridge 1998. –, Comparatively Equal, in: Ober und Hedrick, Dêmokratia, 175-185. –, P. Millett und S. Todd (Hg.), Nomos. Essays in Athenian law, politics and society, Cambridge 1990. Cawkwell, G.L., The Crowning of Demosthenes, in: CQ 63 (1969), 163-180. Chaney, D., The Spectacle of Honour: The Changing Dramatization of Status: in, Theory, Culture & Society 12 (1995), 147-167. Christ, M.R., The Litigious Athenian, Baltimore, Maryl. 1998. Ciompi, L., Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer Affektlogik, Göttingen 1997. Cohen, D. (Hg., unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner): Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen, München 2002. –, Introduction, in: Cohen, Demokratie, V-IX. –, Democracy and Individual Rights in Athens, in: ZRG. Rom.Abt. 114 (1997), 27-44. –, Law, Violence, and Community in Classical Athens, Cambridge 1995. –, Classical Rhetoric and Modern Theories of Discourse, in: Worthington, Persuasion, 69-82. –, Honor, Feud, and Litigation in Classical Athens, in: ZRG. Rom. Abt. 109 (1992), 100-115. –, Sex, Gender, and Sexuality in Ancient Greece, in: CPh 87 (1992), 145-160. –, Law, Sexuality, and Society. The Enforcement of Morals in Classical Athens, Cambridge 1991. –, Sexuality, Violence, and the Athenian Law of Hubris, in: G&R 38 (1991), 171-188. –, The social context of adultery at Athens, in: Cartledge, Millett and Todd, Nomos, 147-165. –, Demosthenes’ Against Meidias and Athenian Litigation, in: M. Gagarin (Hg.), Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln 1991, 155-164. –, Greek Law. Problems and Methods, in, ZRG. Rom. Abt. 106 (1989), 81-105. –, Seclusion, Separation, and the Status of Women in Classical Athens, in, G&R 36 (1989), 3-15. Comaroff, J.L., Out of Control: an afterword, in: Cohen, Demokratie, 189-205. –, Roberts, S., Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in an African Context, London 1981. Connor, W.R., The Problem of Athenian Civic Identity, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 3444. –, Tribes, Festivals and Processions; Civic Ceremonial and Political Manipulation in Archaic Greece, in: JHS 107 (1987), 40-50. Connor, W.R., The New Politicians of Fifth-Century Athens, Princeton, N.J. 1971.
328
Anhang
Contarino, A., L’ ironia nei racconti popolari. Giufà ride anche del codice d’ onore, in: Fiume, Onore, 395-411. Corvisier, J.-N., Santé et société en Grèce ancienne, Paris 1985. Courtois, G., Le sens et la valeur de la vengeance, chez Aristote et Séneque, in: ders. (Hg.), La vengeance. Etudes d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Bd. 4: La vengeance dans la pensée occidentale, Paris 1984, 91-124. –, La vengeance, du désir aux institutions, in: ders. (Hg.), La vengeance. Etudes d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Bd. 4: La vengeance dans la pensée occidentale, Paris 1984, 9-45. Creed, J.L., Moral Values in the Age of Thucydides, in: CQ 67 (1973), 213-231. Crowther, N.B., Athlete and State: Qualifying for the Olympic Games in Ancient Greece, in: Journal of Sport History 23,1 (1996), 34-43. –, Team Sports in Ancient Greece: Some Observations, in: International Journal of the History of Sport 12 (1995), 127-136. –, Reflections on Greek Equestrian Events. Violence and Spectator Attitudes, in: Nikephoros 7 (1994), 121-133. –, Second-Place Finishes and lower in Greek Athletics (including the Pentathlon), in: ZPE 90 (1992), 97-103. –, Athletic Dress and Nudity in Greek Athletics, in: Eranos 80 (1982), 163-168. Csapo, E., Deep ambivalence. Notes on a Greek Cockfight, in: Phoenix 47 (1993), 1-27 und 115124. Culham, P., Ten Years after Pomeroy. Studies of the Image and Reality of Women in Antiquity, in: M. Skinner (Hg.), Rescuing Creusa. New Methodological Approaches to Women in Antiquity, Texas 1987, 9-30. Curtius, E., Olympia, Berlin 1935. –, Der Wettkampf, in: ders., Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden und Vorträge, Bd. 1, Stuttgart/Berlin 19035, 132-147. Danaë, O., Combats de Coqs. Histoire et Actualité de l’Oiseau Guerrier, Paris 1989. Daniel, U., Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft, in: GWU 48 (1997), 195-219, 259-278. Davidson, J.N., Kurtisanen und Meeresfrüchte. Die verzehrenden Leidenschaften im klassischen Athen, Darmstadt 1999. Davies, J.K., The Fourth Century Crisis: What Crisis?, in: Eder, Demokratie, 29-39. –, Athenian Propertied Families, Oxford 1971. Davis, J., Col divorzio c è differenza?, in: Fiume, Onore, 47-59. –, Family and State in the Mediterranean, in: Gilmore, Honor, 22-34. –, People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social Anthropology, London 1977. Davison, J.A., Addenda to ›Notes on the Panathenaea‹, in: JHS 82 (1962), 141-142. –, Notes on the Panathenaea, in: JHS 78 (1958), 23-41. De Jong, I.J.F., Between Word and Deed: Hidden Thoughts in the Odyssey, in: dies. und J. Sullivan (Hg.), Modern Critical Theory and Classical Literature, Leiden 1994, 27-50. Dean-Jones, L., The Cultural Construct of the Female Body in Classical Greek Science, in: S. Pomeroy (Hg.), Women’s History and Ancient History, London 1991, 111-137. Debrunner Hall, M., Even Dogs have Erinyes: Sanctions in Athenian Practice and Thinking, in: L. Foxhall und A.D. Lewis (Hg.), Greek Law in its Political Setting. Justifications not Justice, Oxford 1996, 73-89. Decker, W., Frauen und Männer in Olympia, in: G. Völger (Hg.), Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich, Bd. 2, Köln 1997, 23-30. –, Zur Vorbereitung und Organisation griechischer Agone, in: Nikephoros 10 (1997), 77-102. –, Sport in der griechischen Antike. Vom minoischen Wettkampf bis zu den olympischen Spielen, München 1985. Delaney, C., Seeds of Honor, Fields of Shame, in: Gilmore, Honor, 35-47. Demand, N., Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece, Baltimore/London 1994.
Anhang
329
des Bouvrie, S., Gender and the Games at Oympia, in: B. Berggreen und N. Marinatos (Hg.), Greece & Gender, Bergen 1995, 55-74. Detel, W., Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike, Frankfurt a.M. 1998. Detienne, M., Les Jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, Paris 1972. Dettenhofer, M.H., Die Frauen von Sparta: Gesellschaftliche Position und politische Relevanz, in: Klio 75 (1993), 61-75. Deubner, L., Attische Feste, Darmstadt 19693 (1. Aufl. 1932). Develin, R., From Panathenaia to Panathenaia, in: ZPE 57 (1984), 133-138. Dickie, M.W., Hêsychia and Hybris in Pindar, in: D.E. Gerber (Hg.), Greek Poetry and Philosophy. Studies in Honour of Leonard Woodbury, Chico, Calif. 1984, 83-109. Dinges, M., Die Ehre als Thema der Historischen Anthropologie. Bemerkungen zur Wissenschaftsgeschichte und zur Konzeptualisierung, in: Schreiner und Schwerhoff, Ehre, 29-62. Dodds, E.J., Die Griechen und das Irrationale, Darmstadt 1970. Donlan, W., The Homeric Economy, in: Morris und Powell, Companion, 649-667. –, Reciprocities in Homer, in: CW 75 (1981/82), 137-175. –, The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Attitudes of Superiority from Homer to the End of the Fifth Century B.C., Lawrence, Kan. 1980. –, The Role of Eugeneia in the Aristocratic Self-Image during the Fifth Century B.C., in: E.N. Borza und R.W. Carruba (Hg.), Classics and the Classical Tradition, Pensylvania 1973, 63-78. Douglas, M., Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Frankfurt a.M. 1988. Dover, K.J., Greek Homosexuality and Initiation, in: ders., Collected Papers II, Oxford 1988, 115134. –, Homosexualität in der griechischen Antike, München 1978. –, Greek Popular Morality. In the Time of Plato and Aristotle, Berkeley/Los Angeles 1974. –, Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour, in: Arethusa 6 (1973), 59-73. –, Lysias and the Corpus Lysiacum, Berkeley/Los Angeles 1968. Doyle, R.E., ”/LBOJ, KÒROJ, ÛBRIJ, and ¥TH from Hesiod to Aeschylus, in: Traditio 26 (1970), 293-303. du Boulay, J., Portrait of a Greek Mountain Village, Oxford 1974. Duchemin, J., L’ AGWN dans la tragédie grecque, Paris 19682 (1. Aufl. 1945). Dumont, J., Les combats de coq furent-ils un sport?, in: Pallas 34 (1988), 33-44. Dutton, K.R., The Perfectible Body. The Western Ideal of Physical Development, London 1995. Dyck, A.R., The Function and Persuasive Power of Demosthenes’ Portrait of Aeschines in the Speech On the Crown, in: G&R 32 (1985), 42-48. Eder, W. (Hg.), Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Vollendung oder Verfall einer Verfassungsform?, Stuttgart 1995. –, Monarchie und Demokratie im 4. Jahrhundert. Die Rolle des Fürstenspiegels in der athenischen Demokratie, in: ders., Demokratie, 153-173. Ehrenberg, V., Anfänge des griechischen Naturrechts, in: ders., Polis und Imperium. Beiträge zur alten Geschichte, Zürich 1965, 359-379. –, Das Agonale, in: ders., Ost und West. Studien zur geschichtlichen Problematik der Antike, Brünn [u.a.] 1935, 63-96. Elias, N., Die Genese des Sports als soziologisches Problem, in: ders. und E. Dunning, Sport im Zivilisationsprozess, Münster 1983, 9-46. Ellen, R.F., Anatomical Classification and the Semiotics of the Body, in: J. Blacking (Hg.), The Anthropology of the Body, London 1977, 343-373. Elster, J., Norms, Emotions and Social Control, in: Cohen, Demokratie, 1-13. –, Norms of Revenge, in: Ethics 100 (1990), 862-885. Engelmann, H., Zu Inschriften aus Ephesos, in: ZPE 26 (1977), 154-156. Englert, L., Die Gymnastik und Agonistik der Griechen als politische Leibeserziehung, in: H. Berve (Hg.), Das neue Bild der Antike, Bd. 1: Hellas, Leipzig 1942, 218-236. Erbse, H., Über Antiphons Rede über den Choreuten, in: Hermes 91 (1963), 17-35.
330
Anhang
–, Über die Midiana des Demosthenes, in: Hermes 84 (1956), 135-151. Evjen, H.D., Competitive Athletics in Ancient Greece: The Search for Origins and Influences, in: OAth 16 (1986), 51-56. Faraone, C.A., Curses and Social Control in the Law Courts of Athens, in: Cohen, Demokratie, 7792. Fatheuer, T., Ehre und Gerechtigkeit. Studien zur Entwicklung der gesellschaftlichen Ordnung im frühen Griechenland, Münster 1988 (= Diss. phil. Münster 1987). Feher, M. (Hg.), Fragments for a History of the Human Body, 3 Bde., New York 1989. –, Introduction, in: ders., Fragments, Bd. 1, 11-17. Fellmann, B., Hahnenkampf, in: K. Vierneisel und B. Kaeser (Hg)., Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Ausstellungskatalog Antikensammlung München, München 1990, 108-110. Fenno, J., Rez. Mark Golden, Sport and Society in Ancient Greece, in: BMCRev 1999.07.19. Feraboli, S., In margine a Demostene LIV, in: Studi in onore di Arnaldo Biscardi IV, Mailand 1983, 655-661. Ferla, K., Von Homers Achill bis zur Hekabe des Euripides. Das Phänomen der Transgression in der griechischen Kultur, Diss. phil., München 1996. Ferrante, L., Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d’onore (Bologna sec. XVII), in: Fiume, Onore, 105-127. Finkelberg, M., Timê and Aretê in Homer, in: CQ 48 (1998), 14-28. Finley, M.I., Antike und moderne Demokratie, Stuttgart 1980. – und H.W. Pleket, Die Olympischen Spiele der Antike, Tübingen 1976. –, Anthropology and the Classics, in: ders., The Use and Abuse of History, London 1975, 102-119. –, Die Welt des Odysseus, Darmstadt 1974. Fisher, N.R.E., ›Let envy be absent‹: Envy, Liturgies and Reciprocity in Athens, in: Konstan und Rutter, Envy, 181-215. –, Hybris, Revenge and Stasis in the Greek City-States, in: H. van Wees (Hg.), War and Violence in Ancient Greece, Guildford, Surrey 2000, 83-123. – und H. van Wees (Hg.), Archaic Greece, London 1998. –, Violence, masculinity and the law in classical Athens, in: L. Foxhall und J. Salmon (Hg.), When Men were Men. Masculinity, Power and Identity in Classical Antiquity, London, 1998, 68-97. –, Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, Wiltsh. 1992. –, The Law of Hybris in Athens, in: Cartledge, Millett und Todd, Nomos, 123-138. –, Drink, Hybris and the Promotion of Harmony in Sparta, in: A. Powell (Hg.), Classical Sparta: Techniques behind her success, London 1989, 26-50. –, Rez. S.C. Humphreys, Anthropology and the Greeks, in: ClR 30 (1980), 58-61. –, Hybris and Dishonour I, in: G&R 23 (1976), 177-193. –, Hybris and Dishonour II, in: G&R 26 (1979), 32-47. Fiume, G., Introduzione, in: dies., Onore, 5-23. – (Hg.), Onore e storia nelle società mediterranee. Atti del seminario internazionale (Palermo 3-5 dicembre 1987), Palermo 1989. Flaig, E., Menschenrechte ohne Gleichheit? Die athenische Demokratie im neoliberalen Gegenlicht, in: Rechtshistorisches Journal 16 (1997), 62-113. –, Tödliches Freien. Penelopes Ruhm, Telemachs Status und die sozialen Normen, in: Historische Anthropologie 3 (1995), 364-388. –, Amnestie und Amnesie in der griechischen Kultur. Das vergessene Selbstopfer für den Sieg im athenischen Bürgerkrieg 403 v. Chr., in: Saeculum 42 (1991), 129-149. Flashar, H., Aristoteles, Das Lachen und die Alte Komödie, in: Jäkel und Timonen, Laughter, 5970. Flashar, M., Die Sieger von Marathon - Zwischen Mythisierung und Vorbildlichkeit, in: ders. [u.a.] (Hg.), Retrospektive. Konzepte von Vergangenheit in der griechisch-römischen Antike, München 1996, 63-85.
Anhang
331
Flensted-Jensen, P., T.H. Nielsen und L. Rubinstein (Hg.), Polis & Politics. Festschrift Mogens Herman Hansen, Kopenhagen 2000. Forbes, C.A., Crime and Punishment in Greek Athletics, in: CJ 47 (1951), 169-173. Ford, A., Reading Homer from the rostrum: poems and laws in Aeschines’ Against Timarchus, in: Goldhill und Osborne, Performance, 231-256. Forster, E.S., Guilty or not Guilty? Four Athenian Trials, in: G&R 12 (1943), 21-27. Förster, H., Die Sieger in den olympischen Spielen, Zwickau 1891-92. Foster, G.M., The Anatomy of Envy. A Study in Symbolic Behavior, in: Current Anthropology 13 (1972), 165-202. Foxhall, L. und A.D. Lewis (Hg.), Greek Law in its Political Setting. Justifications not Justice, Oxford 1996. –, The Law and the Lady: Women and Legal Proceedings in Classical Athens, in: dies. und Lewis, Law, 133-152. –, Women’s ritual and men’s work in ancient Athens, in: Hawley und Levick, Women, 97-110. –, Household, Gender and Property in Classical Athens, in: CQ 39 (1989), 22-44. Frank, A.W., For a Sociology of the Body: An analytical review, in: M. Featherstone, M. Hepworth und B.S.Turner (Hg.), The Body. Social Process and Cultural Theory, London 1991, 36102. Frass, M., Gesellschaftliche Akzeptanz »sportlicher« Frauen in der Antike, in: Nikephoros 10 (1997), 119-133. Frevert, U., »Mann und Weib, und Weib und Mann«. Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München 1995. –, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, München 1991. Friedrich, R., The Hybris of Odysseus, in: JHS 111 (1991), 16-28. Friese, H., La prassi dell’onore femminile. La politica delle liti tra donne in un paese della Sicilia, in: Fiume, Onore, 315-348. Froleyks, W.J., Der !'7. ,/'7. in der antiken Literatur, Diss. phil., Bonn 1973. Frost, F.J., Aspects of Early Athenian Citizenship, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 45-56. Fuks, A., 4O‹J ¢POROUμšNOIJ KOINWNE‹N: The Sharing of Property by the Rich with the Poor in Greek Theory and Practice, in, ders.: Social Conflict in Ancient Greece, Jerusalem 1984, 4663. –, Isokrates and the Social-economic Situation in Greece, in: AncSoc 3 (1972), 17-44. Furley, W.D., Andokides IV (›Against Alkibiades‹): Fact or Fiction?, in: Hermes 117 (1989), 138156. Gagarin, M., Women’s Voices in Attic Oratory, in: Lardinois und McClure, Silence, 161-176. –, Morality in Homer, in: CPh 82 (1987), 285-306. –, Early Greek Law, Los Angeles 1986. –, Antilochus’ Strategy: The Chariot race in Iliad 23, in: CPh 78 (1983), 35-39. –, The Athenian Law against Hybris, in: G. Bowersack [u.a.] (Hg.), Arktouros. Festschrift Bernard M.W. Knox, Berlin 1979, 229-236. –, The Prosecution of Homicide in Athens, in: GRBS 20 (1979), 301-323. Galsterer, H., ›Mens sana in corpore sano‹ - Der Mensch und sein Körper in römischer Zeit, in: A.E. Imhof (Hg.), Der Mensch und sein Körper. Von der Antike bis heute, München 1983, 3145. Gardiner, E.N., Athletics of the Ancient World, Oxford 1930 1930 (ND Chicago 1980). Gardner, J.F., Aristophanes and Male Anxiety - The Defence of the Oikos, in: G&R 36 (1989), 5162. Garland, R., The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World, London 1995. –, The Mockery of the Deformed and Disabled in Graeco-Roman Culture, in: Jäkel und Timonen, Laughter, 71-84. Garner, R., Law & Society in Classical Athens, London 1987.
332
Anhang
Geertz, C., »From the Native’s Point of View«: On the Nature of Anthropological Understanding, in: K.H. Basso und H.A. Selby (Hg.), Meaning in Anthropology, Univ. of New Mexico/Albuquerque 19802, 221-237. –, Deep Play. Notes on the Balinese Cockfight, in: ders., The Interpretation of Cultures, New York 1973, 412-453. –, The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man, in: J.R. Platt (Hg.), New Views of the Nature of Man, Chicago 1965, 93-118. Gehrke, H.-J., Gesetz und Konflikt. Überlegungen zur frühen Polis, in: J. Bleicken (Hg.), Colloquium aus Anlaß der 80. Geburtstages von Alfred Heuß, Kallmünz 1993, 49-67. –, Die Griechen und die Rache. Ein Versuch in historischer Psychologie, in: Saeculum 38 (1987), 121-149. –, Die Olympischen Spiele im Rahmen des antiken Sports, in: AU 28 (1985), 14-31. –, Die klassische Polisgesellschaft in der Perspektive griechischer Philosophen, in: Saeculum 36 (1985), 133-1983. Gemoll, W., Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch, erw. v. K. Vretska, eingel. v. H. Kronasser, München 19919. Gerhards, J., Soziologie der Emotionen. Fragestellungen, Systematik und Perspektiven, München/Weinheim 1988. –, Soziologie der Emotionen. Ein Literaturbericht, in: KZSS 38 (1986), 760-771. Gernet, L., Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Paris 1917. Gibert, J., Rez. A.P. Burnett, Revenge in Attic and Later Tragedy, in: BMCRev 1999.09.02. Gildenhard, I. und M. Ruehl (Hg.), Out of Arcadia. Classics and Politics in Germany in the age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz, London 2003. Gill, C., Is Rivalry a Virtue or a Vice?, in: Konstan und Rutter, Envy, 29-49. –, N. Postlethwaite und R. Seaford (Hg.), Reciprocity in Ancient Greece, Oxford 1998. Gilmore, D.D., Honor, Honesty, Shame: Male Status in Contemporary Andalusia, in: ders., Honor, 90-103. – (Hg.), Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean, Washington 1987. –, Introduction: The Shame of Dishonor, in: ders., Honor, 2-21. –, Anthropology of the Mediterranean Area, in: Annual Review of Anthropology 11 (1982), 175205. Gilsenan, M., Lying, Honor, and Contradiction, in: B. Kapferer (Hg.), Transaction and Meaning. Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behaviour, Philadelphia, Pennsylv. 1976, 121-219. Giordano, C., Mediterrane Ehrvorstellungen: archaisch, anachronistisch und doch immer aktuell, in: Soziologisches Jahrbuch 7,2 (1991), 113-138. Giovannini, M.J., Female Chastity Codes in the Circum-Mediterranean: Comparative Perspectives, in: Gilmore, Honor, 61-74. Giugnoli, G., A proposito della Midiana demosthenica. Il problemà cronologico, in: Atene et Roma 20 (1975), 170-183. Gluskina, L.M., Studien zu den sozial-ökonomischen Verhältnissen in Attika im 4. Jh. v. u. Z., in: Eirene 12 (1974), 111-138. Goffman, E., Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt a.M. 19793. Göhler, J., Olympioniken als Krieger und Politiker. Zur sozialen Stellung der Olympiasieger im Altertum, in: Die Leibeserziehung 19 (1970), 190-195. Golden, M., Demosthenes and the Social Historian, in: Worthington, Demosthenes, 159-180. –, Sport and Society in Ancient Greece, Cambridge 1998. –, Equestrian Competition in Ancient Greece. Difference, Dissent, Democracy, in: Phoenix 51 (1997), 327-344. –, Demosthenes and the Age of Majority at Athens, in: Phoenix 33 (1979), 25-38.
Anhang
333
Goldhill, S., Representing Democracy: Women at the Great Dionysia, in: Osborne und Hornblower, Ritual, 347-369. Gomme, A.W., The Working of the Athenian Democracy, in: ders., More Essays in Greek History and Literature, Oxford 1962, 177-193. –, The Position of Women in Athens in the fifth and fourth centuries, in: CPh 20 (1925), 1-25. Gould, J., Law, Custom and Myth. Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens, in: JHS 100 (1980), 38-59. Grant, M.A., The Ancient Rhetorical Theories of the Laughable. The Greek Rhetoricians and Cicero, Diss. phil., Madison, Wisc. 1924 (ND London 1980). Graßl, H., Zur materiellen Situation der arbeitenden Frauen im Altertum, in: Ulf, Ideologie, 243253. Gribble, D., Alcibiades and Athens. A Study in Literary Presentation, Oxford 1999. –, Rhetoric and History in [Andocides] 4, Against Alcibiades, in: CQ 91 (1997), 367-391. Grupe, O., Spiele - Definitionen, Diskussionen und Theorien, in: Pfister, Niewerth und Steins, Spiele, 25-33. Gschnitzer, F., Zur homerischen Staats- und Gesellschaftsordnung: Grundcharakter und geschichtliche Stellung, in: J. Latacz (Hg.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung. Rückblick und Ausblick, Stuttgart/Leipzig 1991, 182-204. –, Griechische Sozialgeschichte. Von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, Wiesbaden 1981. Guazzoni Foà, V., Il rapporto A„DèJ, TIμ», P…STIJ nel mondo greco, in: Maia 26 (1974), 141-148. Guttandin, F., Das paradoxe Schicksal der Ehre. Zum Wandel der adeligen Ehre und zur Bedeutung von Duell und Ehre für den monarchischen Zentralstaat, Berlin 1993. Hall, E., Lawcourt Dramas: The Power of Performance in Greek Forensic Oratory, in: BICS 40 (1995), 39-58. Halliwell, S., The Uses of Laughter in Greek Culture, in: CQ 41 (1991), 279-296. Halperin, David M., How to Do the History of Homosexuality, London/Chicago 2002. –, One Hundred Years of Homosexuality, London/New York 1990. –, J.J. Winkler und F.I. Zeitlin (Hg.), Before Sexuality. The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, Princeton 1990. –, Sexual Ethics and Technologies of the Self in Classical Greece. Rez. M. Foucault: L’usage des plaisirs, in: AJPh 107 (1986), 274-286. Halverson, J., Social Order in the ‘Odyssey’, in: Hermes 113 (1985), 129-145. Hansen, M.H., Die Athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes. Struktur, Prinzipien und Selbstverständnis, Berlin 1995. –, The 2500th Anniversary of Cleisthenes’ Reforms and the Tradition of Athenian Democracy, in: Osborne und Hornblower, Ritual, 25-37. –, Solonian Democracy in Fourth-Century Athens, in: C&M 40 (1989), 71-99. –, Demos, Ekklesia, and Dikasterion. A Reply to Martin Ostwald and Josiah Ober, in: C&M 40 (1989), 101-106. –, On the Importance of Institutions in an Analysis of Athenian Democracy, in: C&M 40 (1989), 107-113. –, The Number of Rhetores in the Athenian Ecclesia, 355-322 B.C., in: GRBS 25 (1984), 123-155. –, The Prosecution of Homicide in Athens: A Reply, in: GRBS 22 (1981), 11-30. –, Seven Hundred Archai in Classical Athens, in: GRBS 21 (1980), 151-173. –, Atimia in Consequence of Private Debts?, in: Symposion 1977, Köln/Wien 1982, 113-120. –, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration in the Fourth Century B.C.,Odense 1976. –, Private process in fourth-century Athens, in: ders. und S. Isager, Aspects of Athenian Society in the Fourth Century B.C., Odense 1975, 107-137. –, The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century B.C. and The Public Action against Unconstitutional Proposals, Odense 1974.
334
Anhang
Harlow, M., Metamorphoses. Rez. D. Montserrat (Hg.), Changing Bodies, Changing Meanings. Studies on the Human Body in Antiquity, in: ClR 50 (2000), 536-538. Harris, E.M., A Note on Adoption and Deme Registration, in: Tyche 11 (1996), 123-127. –, Rez. C. Carey, Apollodoros, Against Neaira [Demosthenes] 59, in: ClR 44 (1994), 21-23. –, Law and Oratory, in: Worthington, Persuasion, 130-150. ders., Demosthenes’ Speech against Meidias, in: HSCPh 92 (1989), 117-136. Harris, H.A., Greek Athletes and Athletics, Bloomington 19662. Harris, W.V., Lysias III and Athenian Beliefs about Revenge, in: CQ 91 (1997), 363-366. Hartmann, E., Heirat, Hetärentum und Konkubinat im klassischen Athen, Frankfurt a.M. 2002. Harvey, F.D., Two Kinds of Equality, in: C&M 26 (1965), 101-146. Hawley, R., The Dynamics of Beauty in Classical Greece, in: Montserrat, Bodies, 37-54. – und B. Levick (Hg.), Women in Antiquity. New assessments, London/New York 1995. Heftner, H., Ps.-Andokides’ Rede gegen Alkibiades ([And.] 4) und die politische Diskussion nach dem Sturz der ‘Dreißig’ in Athen, in: Klio 77 (1995), 75-104. Henderson, J., The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy, London/New Haven 1975. Héritier-Augé, F., Semen and Blood: Some Ancient Theories concerning their Genesis and Relationship, in: Feher, Fragments, Bd. 3, 159-175. Herman, G., Rez. David Cohen: Law, Violence, and Community in Classical Athens, in: Gnomon 70 (1998), 605-615. –, Reciprocity, Altruism, and the Prisoner’s Dilemma: The special case of classical Athens, in: Gill, Postlethwaite und Seaford, Reciprocity, 199-225. –, Ancient Athens and the Values of Mediterranean Society, in: Mediterranean Historical Review 11 (1996), 5-36. –, Honour, Revenge and the State in Fourth-Century Athens, in: Eder, Demokratie, 43-66. –, How Violent was Athenian Society, in: Osborne und Hornblower, Ritual, 99-117. –, Tribal and Civic Codes of Behaviour in Lysias I, in: CQ 87 (1993), 406-419. Herrmann, H.-V., Olympia. Heiligtum und Wettkampfstätte, München 1972. Herzfeld, M., »As in Your Own House«: Hospitality, Ethnography, and the Stereotype of Mediterranean Society, in: Gilmore, Honor, 75-89. –, The Poetics of Manhood. Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton 1985. –, The Horns of the Mediterraneanist Dilemma, in: American Ethnologist 11 (1984), 439-454. –, Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis of Moral Systems, in: Man 15 (1980), 339-351. Hoffmann, H., Hahnenkampf in Athen. zur Ikonologie einer attischen Bildformel, in: Revue Archeologique 2 (1974), 195-220. Hölkeskamp, K.-J., Nomos, Thesmos und Verwandtes. Vergleichende Überlegungen zur Konzeptualisierung geschriebenen Rechts im klassischen Griechenland, in: Cohen, Demokratie, 115146. Hönle, A., Olympia in der Politik der griechischen Staatenwelt (von 776 bis zum Ende des 5. Jh.), Diss. phil., Tübingen 1968. Hooker, J.T., Homeric Society: A Shame-Culture?, in: G&R 34 (1987), 121-125. –, The Original Meaning of “5BRIJ, in: ABG 19 (1976), 125-137. Hose, H.F., /,5-0)/.)+!3, in: G&R 1 (1931), 30-35. Hubbard, T.K., Envy and the Invisible Roar: Pindar, Pythian, 11.30, in: GRBS 31 (1990), 343-351. Huizinga, J., Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 1956. Humphreys, S.C., Family Quarrels, in: JHS 109 (1989), 182-185. –, The family, women and death. Comparative studies, London 1983. –, Rez. K.J. Dover, Greek Homosexuality und P. Friedrich: The Meaning of Aphrodite, in: ClR 30 (1980), 61-64. Hunter, V.J., The Politics of Reputation: Gossip as a Social Construct, in: dies., Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuit 420-320, Princeton, N.J. 1994, 96-119. Hyde, W.W., Olympic Victor Monuments and Greec Athletic Art, Washington 1921.
Anhang
335
Iwersen, J., Die Frau im Alten Griechenland. Religion, Kultur, Gesellschaft, Düsseldorf/Zürich 2002. Jäger, W., Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Bd. 1, Berlin/Leipzig 1934. Jäkel, S. und A. Timonen (Hg.), Laughter down the Centuries, Bd. 1, Turku 1994. Jäkel, S., The Phenomenon of Laughter in the Iliad, in: ders. und Timonen, Laughter, 23-27. Jameson, M.H., The spectacular and the obscure in Athenian religion, in: Goldhill und Osborne, Performance, 321-340. Janell, W., Chronicon Olympicon, in: Klio 21 (1927), 344-349. Jones, A.H.M., The Athenian Democracy and its Critics, in: ders., Athenian Democracy, Oxford 19695, 41-72. Jones, A.H.M., The Athens of Demosthenes, Cambridge 1952. Just, R., Freedom, Slavery and the Female Psyche, in: P.A. Cartledge und F.D. Harvey (Hg.), Crux. Essays in Greek History presented to G.E.M. de Ste. Croix, London 1985, 169-188. –, Women in Athenian Law and Life, London/New York 1989. Jüthner, J., Zur Geschichte der griechischen Wettkämpfe, in: WS 53 (1935), 68-79. –, Körperkultur im Altertum, Jena 1928. Katz, M., Ideology and ‘the status of women’ in ancient Greece, in: dies. und Levick, Women, 2143. Keller, O., Die antike Tierwelt, Bd. II, Hildesheim 1909 (ND 1963). Keuls, E.C., History without Women: Necessity or Illusion?, in: DHA 12 (1986), 125-145. –, The Reign of the Phallos: Sexual Politics in ancient Athens, New York 1985. Khalaf, S.N., Settlement of Violence in Bedouin Society, in: Ethnology 29 (1990), 225-242. Kienast, D., Die innenpolitische Entwicklung Athens im 6. Jahrhundert und die Reformen von 508, in: HZ 200 (1965), 265-283. King, H., Anthropology and the Classics, in: OCD3 (1996), 102-103. Kirchner, J. (Hg.), Prosopographia Attica, 2 Bde., Berlin 1901-1903. Kledt, A., Die Entführung Kores. Studien zur athenisch-elausinischen Demeterreligion, Stuttgart 2004. Kluwe, E., Meinungsbildung in der athenischen Polis und ihren Gliederungseinheiten, in: Oikumene 4 (1983), 25-36. –, Nochmals zum Problem: Die soziale Zusammensetzung der athenischen Ekklesia und ihr Einfluss auf politische Entscheidungen, in: Klio 59 (1977), 45-81. Knab, R., Die Periodoniken. Ein Beitrag zur Geschichte der gymnischen Agone an den 4 griechischen Hauptfesten, Diss. phil, Gießen 1934 (ND Chicago 1966). Koch-Harnack, G., Knabenliebe und Tiergeschenke. Ihre Bedeutung im päderastischen Erziehungssystem Athens, Berlin 1983 Köhler, C.S., Das Tierleben im Sprichwort der Griechen und Römer, Hildesheim 1967. Konstan, D. und N.K. Rutter, Envy, Spite and Jealousy. The Rivalrous Emotions in Ancient Greece, Edinburgh 2003. Konstan, D., Pity Transformed, London 2001. –, Premarital Sex, Illegitimacy, and Male Anxiety in Menander and Athens, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 217-235. Kornexl, E., Begriff und Einschätzung der Gesundheit des Körpers in der griechischen Literatur von ihren Anfängen bis zum Hellenismus, München 1970. Krause, J.H., Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen, o.O. 1841 (ND o.O. 1971). –, Olympia oder Darstellung der großen olympischen Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten, Wien 1838 (ND Hildesheim 1972). Krenkel, W.A., Männliche Prostitution in der Antike, in: Das Altertum 24 (1978), 49-55. Kroll, W., Philammon, in: RE 19 (1938), 2123. Kron, U., Frauenfeste in Demeterheiligtümern: Das Thesmophorion von Bitalemi. Eine archäologische Fallstudie, AA 1992, 611-650. Kyle, D.G., The First Hundred Olympiads: A Process of Decline or Democratization, in: Nikephoros 10 (1997), 53-75.
336
Anhang
–, Athletics in Ancient Athens, Leiden 1987. Lahr, S. von der, Rez. Thomas Fatheuer: Ehre und Gerechtigkeit, in: Gnomon 62 (1990), 650-652. Lämmer, M., Hier irrte Huizinga. Zum Begriff des Spiels in der griechischen Antike, in: Pfister, Niewerth und Stein, Spiele, 34-39. Lane Fox, R., Aeschines and Athenian Democracy, in: Osborne und Hornblower, Ritual, 135-155. Laqueur, T., Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, Mass. 1990. Lardinois, A. und L. McClure (Hg.), Making Silence Speak. Women’s Voices in Greek Literature and Society, Princeton, N.J. 2001. Latte, K., Der Rechtsgedanke im archaischen Griechentum, in: A&A 2 (1946), 63-76. –, Beiträge zum griechischen Strafrecht II, in: Hermes 66 (1931), 127-158. –, Beiträge zum griechischen Strafrecht I, in: Hermes 66 (1931), 30-48. Lattimore, R., Story Patterns in Greek Tragedy, London 1964. Lattimore, S., The Nature of Early Greek Victor Statues, in: Bandy, Coroebus, 245-256. Lauffer, S., Die Liturgien in der Krisenperiode Athens. Das Problem von Finanzsystem und Demokratie, in: E. Welskopf (Hg.), Hellenische Poleis, Bd. 1, Darmstadt 1974, 147-159. Lavrencic, M., Krieger und Athlet? Der militärische Aspekt der Beurteilung des Wettkampfes der Antike, in: Nikephoros 4 (1991), 167-175. Ledl, A., Das attische Bürgerrecht und die Frauen, in: WS 29 (1907), 173-227. Lefkowitz, M.R., Die letzten Stunden der Parthenos, in: Reeder, Pandora, 32-37. Lendon, J.E., Homeric Vengeance and the Outbreak of Greek Wars, in: H. van Wees (Hg.), War and Violence in Ancient Greece, Guildford, Surrey 2000, 1-30. Lepsius, M.R., Nation und Nationalismus in Deutschland, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990, 232-246. –, Soziologische Theoreme über die Sozialstruktur der »Moderne« und die »Modernisierung«, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990, 211-231. Leutzsch, M., Die Bewährung der Wahrheit. Der dritte Johannesbrief als Dokument urchristlichen Alltags, Trier 1994. Lipsius, J.H., Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905 (ND Hildesheim 1966). Lloyd-Jones, H., Ehre und Schande in der griechischen Kultur, in: A&A 33 (1987), 1-28. –, A Note on Homeric Morality, in: CPh 82 (1987), 307-310. –, The Justice of Zeus, London 1973. Long, A.A., Morals and Values in Homer, in: JHS 90 (1970), 121-139. Loonis, W.T., Pay differentials and Class Warfare in Lysias’ Against Theozotides: Two Obols or Two Drachmas?, in: ZPE 107 (1995), 230-236. Loraux, N., Therefore, Socrates is Immortal, in: Feher, Fragments, Bd. 2, 13-45. Lotze, D., Die Teilhabe des Bürgers an Regierung und Rechtsprechung in den Organen der direkten Demokratie des klassischen Athen, in: E. Kluwe (Hg.), Kultur und Fortschritt in der Blütezeit der griechischen Polis, Berlin 1985, 52-76. –, Entwicklungslinien der athenischen Demokratie im 5. Jh. v. Chr., in: Oikumene 4 (1983), 9-24. Lowe, N.J., Thesmophoria and Haloa. Myth, Physics and Mysteries, in: S. Blundell und M. Willamson (Hg.), The Sacred and the Feminine in Ancient Greece, London/New York 1998, 149173. Lubig, E., Wie die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt kam. Transformation ökonomischer und sozialer Strukturen in einem türkischen Dorf, Stuttgart/Fort Lauderdale 1988. Luhmann, N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M. 1984. MacC. Armstrong, A., Trial by Combat among the Greeks, in: G&R 20 (1951), 73-79. MacClancy, J., Sport, Identity and Ethnicity, in: ders. (Hg.), Sport, Identity and Ethnicity, Oxford 1996, 1-20. MacCormack, G., Revenge and Compensation in Early Law, in: The American Journal of comparative Law 21 (1973), 69-85. MacDowell, D.M., The Length of Trials for Public Offences in Athens, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 563-568. –, The Case of the Rude Soldier (Lysias 9), in: Symposion 1993, Köln 1994, 153-168.
Anhang
337
–, The Oikos in Athenian Law, in: CQ 83 (1989), 10-21. –, The Authenticity of Demosthenes 29 (Against Aphobos III) as a Source of Information about Athenian Law, in: Symposion 6 (1985), Köln/Wien 1989, 253-262. –, Athenian Laws about Choruses, in: Symposion 1982, Köln 1989, 65-77. –, The Law in Classical Athens, London 1978. –, Rez. M.H. Hansen: Atimistraffen i Athen i klassisk tid, in: JHS 96 (1976), 228. –, Hybris in Athens, in: G&R 23 (1976), 14-31. –, '!RET» and Generosity, in: Mnemosyne, Ser. 4, 16 (1963), 127-134. MacKendrick, P., The Athenian Aristocracy 399 to 31 B.C., Cambridge, Mass. 1971. Macurdy, G.H., Apollodorus and the Speech Against Neaera (Pseudo-Dem. LIX), in: AJPh 63 (1942), 256-271. Majer, E., Mensch- und Tiervergleich in der griechischen Literatur bis zum Hellenismus, Diss. phil., Tübingen 1932. Malten, L., Die Sprache des menschlichen Antlitzes im frühen Griechentum, Berlin 1961. Mann, C., Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland, Göttingen 2001. –, Krieg, Sport und Adelskultur. Zur Entstehung des griechischen Gymnasions, in: Klio 80,1 (1998), 7-21. Manville, P.B., Toward a New Paradigm of Athenian Citizenship, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 21-33. –, Solon’s Law of Stasis and Atimia in Archaic Athens, in: TAPhA 110 (1980), 213-221. Marcus, M.A., »Horsemen are the Fence of the Land«: Honor and History among the Ghiyata of Eastern Morocco, in: Gilmore, Honor, 49-60. Martin, J., Zwei Alte Geschichten. Vergleichende historisch-anthropologische Betrachtungen zu Griechenland und Rom, in: Saeculum 48 (1997), 1-20. –, Von Kleisthenes zu Ephialtes. Zur Entstehung der athenischen Demokratie, in: Chiron 4 (1974), 5-42. Mauss, M., Sociology and Psychology, London 1979. McDougall, L., Symbols and Somatic Structures, in: J. Blackening (Hg.), The Anthropology of the Body, London 1977, 391-403. Meier, C., Zur Funktion der Feste in Athen im 5. Jahrhundert vor Christus, in: W. Haug und R. Warning (Hg.), Das Fest, München 1989, 569-591. – und P. Veyne, Kannten die Griechen die Demokratie?, Berlin1988. –, Wie die Athener ihr Gemeinwesen finanzierten. Die Anfänge der Steuerpolitik in der griechischen Antike, in: U. Schultz (Hg.), Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kulturgeschichte der Steuer, München 1986, 25-42 –, Die Entstehung des Begriffs ›Demokratie‹. Vier Prolegomena zu einer historischen Theorie, Frankfurt a.M. 1970. Meier, P.J., Agones, in: RE 1 (1894), 836-867. Mensching, E., Zu Demosthenes’ 54. Rede, in: RhM 106 (1963), 307-312. Meskell, L., The Irresistible Body and the Seduction of Acheology, in: Montserrat, Bodies, 139161. Metcalfe, A., Structure and Agency. The Search for a Way to Explain the Changes from PreIndustrial to Industrial Sport, in: Pfister, Niewerth und Steins, Spiele, 40-44. Michelini, A., “5"2)3 and Plants, in: HSCP 82 (1978), 35-44. Milani, C., Il lessico della vendetta e del perdono nel mondo classico, in: M. Sordi (Hg.), Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico, Mailand 1997, 3-18. Miller, S., Naked Democracy, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 277-296. Millett, P., The Rhetoric of Reciprocity in Classical Athen, in: Gill, Reciprocity, 227-253. Mion, M.R., Tolerance and Aretê in Fifth Century Athens, in: A.W. Adkins [u.a.] (Hg.), Human Virtue and Human Excellence, New York 1991, 45-71. Miralles, C., Laughter in the Odyssey, in: Jäkel und Timonen, Laughter, 15-22. Mommsen, A., Heortologie. Antiquarische Untersuchungen über die Feste der Athener, Leipzig 1864 (ND Hildesheim 1968).
338
Anhang
Monsacré, H., Weeping heroes in the Iliad, in: J.-C. Schmitt (Hg.), Gestures, Warwood 1984 (=History and Anthropology 1). Montserrat, D. (Hg.), Changing Bodies, Changing Meanings. Studies on the Human Body in Antiquity, London 1998 –, Introduction, in: ders., Bodies, 1-9. Moretti, L., Nuovo supplemento al catalogo degli Olympionikai, in: MGR 12 (1987), 67-91. –, Supplemento al catalogo degli Olympionikai, in: Klio 52 (1970), 295-303. –, Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici, Rom 1957. Morford, M.P., Ethopoiia and Character-Assassination in the Conon of Demosthenes, in: Mnem. 19 (1966), 241-248. Morgan, G., Euphiletos’ House: Lysias I, in: TAPhA 112 (1982), 115-123. Morris, I. und B. Powell (Hg.), A New Companion to Homer, Leiden 1996. Morrissey, E.J., Studies in Inscriptions Listing the Agonistic Festivals, in: HSPh 79 (1975), 367370. Mossé, C., Status e/o funzione. Aspetti della condizione della donna-cittadina nelle orazioni civili di Demostene, in: QS 9 (1983), no. 17, 151-158. –, Die politischen Prozesse und die Krise der athenischen Demokratie, in: E. Welskopf (Hg.), Hellenische Poleis, Bd. 1, Darmstadt 1974, 160-187. Mouratidis, J., The Origin of Nudity in Greek Athletics, in: Journal of Sport History 12,3 (1985), 213-232. Muhawi, I., L’ideale onorifico nella società palestinese tradizionale, in: Fiume, Onore, 263-276. Murray, O., The Solonian Law of Hybris, in: Cartledge, Millett und Todd, Nomos, 139-145. Myrick, L.D., The way up and down: Trace Horse and Turning Imagery in the Orestes Plays, in: CJ 89 (1994), 131-148. Newbold, R.F., Sensitivity to Shame in Greek and Roman Epic, with Particular Reference to Claudian and Nonnus, in: Ramus 14 (1985), 30-45. Nietzsche, F., Homers Wettkampf, in: ders., Der griechische Staat, Stuttgart 1942, 236-246. Nilsson, M.P.: Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluß der attischen, Stuttgart 1906 (ND Leipzig 1995). Nippel, W., Griechen, Barbaren und »Wilde«. Alte Geschichte und Sozialanthropologie, Frankfurt a.M. 1990. –, Die Heimkehr der Argonauten aus der Südsee. Ökonomische Anthropologie und die Theorie der griechischen Gesellschaft in der klassischen Zeit, in: Chiron 12 (1982), 1-39. Nixon, L., The cults of Demeter and Kore, in: Hawley und Levick, Women, 75-96. Ober, J. und C. Hedrick (Hg.), Dêmokratia. A Conversation on Democracies, Ancient and Modern, Princeton, N.J. 1996. –, Power and Oratory in Democratic Athens. Demosthenes 21, against Meidias, in: Worthington, Persuasion, 85-108. –, Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in the Politics, in: C. Lord [u.a.] (Hg.), Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science, Oxford 1991, 112-135. –, Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton 1989. Objartel, G., Die Kunst des Beleidigens. Materialien und Überlegungen zu einem historischen Interaktionsmuster, in: D. Cherubim [u.a.] (Hg.), Gespräche zwischen Alltag und Literatur. Beträge zur germanistischen Gesprächsforschung, Tübingen 1984, 94-122. Ogden,D., Rape, Adultery and the Protection of Bloodlines in Classical Athens, in: S. Deacy und K.F. Pierce (Hg.), Rape in Antiquity, Chippenham, Wiltsh. 1997, 25-41. O’Higgins, D.M., Women’s Cultic Joking and Mockery: Some Perspectives, in: Lardinois und McClure, Silence, 137-160. O’Higgins, L., Women and Humor in Classical Greece, Cambridge 2004. Olivia, P., Solon - Legende und Wirklichkeit, Konstanz 1988. Omitowoju, R., Regulating Rape. Soap Operas and Self Interest in the Athenian Courts, in: S. Deacy und K.F. Pierce (Hg.), Rape in Antiquity, Chippenham, Wiltsh. 1997, 1-24.
Anhang
339
Orlandos, A.-C., Le sanctuaire de Némésis a Rhamnonte, in: BCH 48 (1924), 305-320. Orth, W., »Gleichheit« der Bürger im Urteil des Isokrates, in: W. Eder und K.-J. Hölkeskamp (Hg.), Volk und Verfassung im vorhellenistischen Griechenland, Stuttgart 1997, 177-189. Orwell, G., Animal Farm, London 1993. Osborne, R., Rez. D. Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens, in: ClR 47 (1997), 86-87. – und S. Hornblower, Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts presented to David Lewis, Oxford 1994. –, Law in Action in Classical Athens, in: JHS 105 (1985), 40-58. Padgug, R.A., Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in History, in: Radical History Review 20 (1979), 3-23. –, Classes and Society in Classical Greece, in: Arethusa 8 (1975), 85-117. Paoli, U.E., Die Geschichte der Neaira. Und andere Begebenheiten aus der alten Welt, Bern 1953. Papakonstantinou, Z., Rez. Judith Swaddling, The Ancient Olympic Games (2nd ed.), in: BMCRev 2000.06.24. Pape, W., Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, Bd. 1 A-K, bearb. v. M. Sengebusch, Braunschweig 19143. Parke, H.W., Festivals of the Athenians, London 1977. Parker, R., Miasma. Pollution and Purification in early Greek Religion, Oxford 1983. Patterson, C., The Case against Neaira and the Public Ideology of the Athenian Family, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 199-216. Patteson, A.J., Commentary on [Demosthenes] LIX: Against Neaera, Diss.phil., Pennsylvania 1978. Pearson, L., Popular Ethics in Ancient Greece, Stanford 1966². Peristiany, J.G. und J. Pitt-Rivers (Hg.), Honor and Grace in Anthropology, Cambridge 1992. –, (Hg.), Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, London 1966. –, Honour and Shame in a Cypriot Highland Village, in: ders., Honour, 171-190. –, Introduction, in: ders., Honour, 9-17. Petermandl, W., Der verlachte Athlet. Überlegungen zu Sport und Humor im Altertum, in: Ulf, Ideologie, 185-200. Pfister, G., T. Niewerth und G. Steins (Hg.), Spiele der Welt im Spannungsfeld von Tradition und Moderne, Berlin 1996 (=Proceedings of the 2nd ISHPES Congress. Games of the World - the World of Games, Berlin 1993, Part I). Pickard-Cambridge, A., The Dramatic Festivals of Athens, Oxford 19882. Pitt-Rivers, J., Postscript: The Place of Grace in Anthropology, in: Peristiany und Pitt-Rivers, Grace, 215-246. –, Honour and Social Status, in: Peristiany, Honour, 19-77. –, Honor, in: International Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 5, New York 1968, 503-511. Pleket, H.W., Sport and Ideology in the Graeco-Roman World, in: Klio 80,2 (1998), 315-324. –, Games, Prizes, Athletes and Ideology. Some Aspects of the History of Sport in the GrecoRoman World, in: Stadion 1 (1975), 49-89. –, Zur Soziologie des antiken Sports, in: MededRom 36 (1974), 57-87. Pólay, E., Der Schutz der Ehre und des guten Rufes im römischen Recht, in: ZRG. Rom.Abt. 106 (1989), 502-534. Poliakoff, M.B., Kampfsport in der Antike. Das Spiel um Leben und Tod, München 1989. Pollard, J., Birds in Greek Life and Myth, Plymouth 1977. Pomeroy, S.B., Women’s identity and the family in the classical polis, in: Hawley und Levick, Women, 111-121. –, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves. Women in Classical Antiquity, New York 1975. Popp, H., Zur Frage der Eliten in der Attischen Demokratie des 5. Jahrhunderts v. Chr., in: P. Neukam (Hg.), Information aus der Vergangenheit, München 1982, 202-228. Porter, John R., Adultery by the Book: Lysias I (On the Murder of Eratosthenes) and Comic Diegesis, in: EMC XL, n. s. 16 (1997), 421-453.
340
Anhang
Postlethwaite, N., Rez. W.G. Thalmann: The Swineherd and the Bow. Representations of Class in the ›Odyssey‹, in: ClR 51 (2001), 374-375. Powell, B.B., Homer, Bodmin, Cornw. 2004. Powell, R.E., Jr., Sport, social Relations and Animal Husbandry: Early Cock-fighting in North America, in: International Journal of the History of Sport 10 (1993), 361-381. Primmer, A., Homerische Gerichtsszenen, in: WS 83 (1970), 5-13. Quass, F., Nomos und Psephisma. Untersuchung zum griechischen Staatsrecht, München 1971. Raaflaub, K.A., Homeric Society, in: Morris und Powell, Companion, 624-648. –, Equalities and Inequalities in Athenian Democracy, in: Ober und Hedrick, Dêmocracy, 139-179. –, Homer und die Geschichte des 8 Jh. v. Chr., in: J. Latacz (Hg.), Zweihundert Jahre HomerForschung. Rückblick und Ausblick, Stuttgart/Leipzig 1991, 205-256. –, Contemporary Perceptions of Democracy in Fifth-Century Athens, in: ders. [u.a.], Aspects of Athenian Democracy, Kopenhagen 1990, 33-70. –, Des freien Bürgers Recht der freien Rede. Ein Beitrag zur Begriffs- und Sozialgeschichte der athenischen Demokratie, in: W. Eck [u.a.] (Hg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff, Köln 1980, 7-57. –, Beute, Vergeltung, Freiheit? Zur Zielsetzung des Delisch-Attischen Seebundes, in: Chiron 9 (1979), 1-22. Rakoczy, T., Böser Blick, Macht des Auges und Neid der Götter. Eine Untersuchung zur Kraft des Blickes in der griechischen Literatur, Tübingen 1996. Raubitschek, A.E., Sport und Zivilisation, in: Nikephoros 4 (1991), 9-11. –, Zum Ursprung und Wesen der Agonistik, in: W. Eck [u.a.] (Hg.), Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff, Köln 1980, 1-5. –, Phokides, in: RE 20 (1950), 457. –, The Case against Alcibiades (Andocides IV), in: TAPhA 79 (1948), 121-210. Reeder, E.D. (Hg.), Pandora. Frauen im klassischen Griechenland, Mainz 1996. Reiner, H., Ehre, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Darmstadt/Basel 1972, 319323. Reinmuth, O.W., Rez. Luigi Moretti, Iscrizione agonistiche greche, in: Gnomon 27 (1955), 211212. Rhodes, P.J., Enmity in fourth-century Athens, in: Cartledge, Millett und von Reden, Kosmos, 144-161. –, Who Ran Democratic Athens?, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 465-477. –, Political Activity in Classical Athens, in: JHS 106 (1986), 132-144. –, Athenian Democracy after 403 B.C., in: CJ 75 (1979/80), 305-323. Richter, D., The Position of Women in Classical Athens, in: CJ 67 (1971), 1-8. Riedinger, J.-C., Remarches sur la TIμ» chez Homère, in: REG 89 (1976), 244-264. Robert, C., Die Ordnung der Olympischen Spiele und die Sieger der 75.-83. Olympiade, in: Hermes 35 (1900), 141-195. Roberts, J.T., Athenian Equality. A Constant Surrounded by Flux, in: Ober und Hedrick, Dêmokratia, 187-202. –, Aristocratic Democracy: The Perseverance of Timocratic Principles in Athenian Government, in: Athenaeum N.S. 64 (1986), 355-369. –, Athens’ so-called Unofficial Politicians, in: Hermes 110 (1982), 354-362. Roisman, J., The Rhetoric of Courage in the Athenian Orators, in: R.M. Rosen und I. Sluiter (Hg.), Andreia. Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity, Leiden 2003, 127-143. Romilly, J. de, La vengeance comme explication historique dans l’ oeuvre d’ Hérodote, in: REG 84 (1971), 314-337. Rosenthal, L.N., The Definition of Female Sexuality and the Status of Women among the Gujerati-speaking Indians of Johannesburg, in: J. Blackening (Hg.), The Anthropology of the Body, London 1977, 199-210. Rowe, G.O., Anti-Isocratean Sentiment in Demosthenes’ Against Androtion, in: Historia 49 (2000), 278-302.
Anhang
341
–, The Charge against Meidias, in: Hermes 122 (1994), 55-63. –, The Many Facets of Hybris in Demosthenes’ Against Meidias , in: AJPh 114 (1993), 397-401. –, The Nature of Homeric Morality, in: C. Rubino und C.W. Shelmerdine (Hg.), Approaches to Homer, Texas 1983, 248-275. –, The Portrait of Aeschines in the Oration On the Crown, in: TAPhA 97 (1966), 397-406. Roy, J., Rez. Christoph Ulf (Hg.), Ideologie-Sport-Außenseiter. Aktuelle Aspekte einer Beschäftigung mit der antiken Gesellschaft, in: BMCRev 2001.06.14. Rubinstein, L., Stirring up Dicastic Anger, in: D.L. Cairns und R.A. Knox (Hg.), Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Feschrift Douglas M. MacDowell, Swansea 2004, 187-203. Rudolph, W., Zu den Formen des Berufssports zur Zeit der Poliskrise, in: E. C. Welskopf (Hg.), Hellenische Poleis, Bd. 3, Darmstadt 1974, 1472-1483. –, Olympischer Kampfsport in der Antike. Faustkampf, Ringkampf und Pankration in den griechischen Nationalspielen, Berlin 1965. Ruschenbusch, E., Europe and Democracy, in: Osborne und Hornblower, Ritual, 189-197. –, Über die rechte Art, das Recht Athens zu studieren, in: Symposion 1985, Wien/Köln 1989, 294296. –, Untersuchungen zur Geschichte des athenischen Strafrechts, Köln 1968. –, SOLONOS NOMOI. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Wiesbaden 1966. –, “5BREWJ GRAF». Ein Fremdkörper im athenischen Recht des 4. Jahrhunderts v. Chr., in: ZRG Rom.Abt. 82 (1965), 302-309. Saglio, E., Alektryonôn Agônes, in: Ch. Daremberg und ders., Dictionaire des antiquités grecques et romaines, Bd. I, 1, Paris 1877 (ND Graz 1962-1969). Salkever, S.G., Women, Soldiers, Citizens. Plato and Aristotle on the Politics of Virility, in: D.K. O’Connor und C. Lord (Hg.), Essays on the Foundation of Aristotelian Political Science, Berkeley/Los Angeles 1991, 165-190. Salter, M.A., A Cross-Cultural Glance at Pre-Industrial Leisure, in: Pfister, Niewerth und Steins, Spiele, 57-65. Saurer, E., Auf der Suche nach Ehre und Scham. Europa, sein mediterraner Raum und die Mittelmeeranthropologie, in: Historische Anthropologie 10,2 (2002), 206-224. Scafuro, A.C., Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in FourthCentury Athens, in: Boegehold und dies., Identity, 156-198. Scanlon, T.F., Combat and Contest: Athletic Metaphors for Warfare in Greek Literature, in: Bandy, Coroebus, 230-244. –, The Footrace of the Heraia at Olympia, in: Ancient World 9 (1984), 77-91. –, The Vocabulary of Competition: Agôn and Aethlos, Greek Terms for Contest, in: Arete 1,1 (1983), 147-162. Scaraffia, L., Riflessioni ai margini del convegno, in: Fiume, Onore, 413-421. Schachermeyr, F., Vornehmheit und Geschäft im klassischen Athen, in: ders., Forschungen und Betrachtungen zur griechischen und römischen Geschichte, Wien 1974, 253-278. Schäfer, A., Demosthenes und seine Zeit, Bd. IV, Leipzig 1858 (ND Hildesheim 1967). Schäfer, H., Besonderheit und Begriff der attischen Demokratie im V. Jahrhundert, in: ders., Probleme der alten Geschichte, Göttingen 1963, 136-152. –, Timokrates, in: RE 30 (1937), 1263-1264. Schindel, U., Doppeltes Recht oder Prozesstaktik? Zu Aischines’ Erster und Dritter Rede, in: Hermes 106 (1978), 100-116. Schmitt, J.-C. (Hg.), Gestures, Warwood 1984 (=History and Anthropology 1). –, Introduction and General Bibliography, in: ders., Gestures, 1-23. Schmitz, W., Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft im archaischen und klassischen Griechenland, Berlin 2004. –, Der nomos moicheias - Das athenische Gesetz über den Ehebruch, in: ZRG. Rom.Abt. 114 (1997), 45-140.
342
Anhang
–, Reiche und Gleiche: Timokratische Gliederung und demokratische Gleichheit der athenischen Bürger im 4. Jahrhundert v. Chr., in: Eder, Demokratie, 573-597. Schneider, J. und P. Schneider, Culture and Political Economy in Western Sicily, New York 1976. Schneider, K., Hahnenkämpfe, in: RE 7 (1912), 2210-2215. Schnurr-Redford, C., Frauen im klassischen Athen. Sozialer Raum und reale Bewegungsfreiheit, Berlin 1996. Schreiner, K. und G. Schwerhoff (Hg.), Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Köln 1995. –, Verletzte Ehre. Überlegungen zu einem Forschungskonzept, in: diess., Ehre, 1-28. Schubert, C., Der Areopag. Ein Gerichtshof zwischen Politik und Recht, in: Burckhardt und von Ungern-Sternberg, Prozesse, 50-65. Schuller, W. und M. Dreher, Auswahl und Bewertung von Dramatischen Aufführungen in der athenischen Demokratie, in: Flensted-Jensen, Nielsen und Rubinstein, Polis, 523-539. ders., Der Kranzprozess des Jahres 330 v. Chr. oder: Der Abgesang auf die klassische Polis, in: Burckhardt und von Ungern-Sternberg, Prozesse, 190-200. –, Frauen in der griechischen und römischen Geschichte, Konstanz 1995. Scodel,R., Meditations on Lysias 1 and Athenian Adultery, in: Electronic Antiquity I, 2 (1993), nicht paginiert. Scott, G.R., The History of Cockfighting, Hill Brow, Hampsh. 1975. Scott, M., Aidôs und Nemesis in the works of Homer, and their relevance to Social or Cooperative Values, in: AClass 23 (1980), 13-35. Sealey, R., Women in Athenian Law, in: ders., Women and Law in Classical Greece, Chapel Hill/London 1990, 12-49. –, Elitism and Democracy in Classical Athens, in: F.C. Jaher (Hg.), The Rich, the Well born and the Powerful. Elites and Upper Classes in History, Chicago 1973, 7-26. –, Alcibiades and the Charge of Aiming at Tyranny, in: Historia 16 (1967), 6-18. Segal, C., The Theme of the Mutilation of the Corpse in the Iliad, Leiden 1971. Segal, E., »To Win or Die«: A Taxonomy of Sporting Attitudes, in: Journal of Sport History 11,2 (1984), 25-31. Seidensticker, B., »Ich bin Odysseus«. Zur Entstehung der Individualität bei den Griechen, in: Gymnasium 108 (2001), 389-406. Sennett, R., Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Berlin 1995. Shear, T.L. Jr., The Athenian Agora, in: Hesperia 40 (1971), 270-275. Simon, E., Spott zum Schutz vor Nemesis, in: G. Alföldy [u.a.] (Hg.), Römische Lebenskunst. Interdisziplinäres Kolloquium zum 85. Geburtstag von Viktor Pöschl, Heidelberg 1995, 119130. –, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary, Madison 1983. Sinclair, R.K., Democracy and Participation in Athens, Cambridge 1988. Sinn, U., Das antike Olympia. Götter, Spiel und Kunst, München 2004. Sissa, G., Subtle Bodies, in: Feher, Fragments, Bd. 3, 133-156. Sourvinou-Inwood, C., Männlich und weiblich, öffentlich und privat, antik und modern, in: Reeder, Pandora, 111-120. Spahn, P., Oikos und Polis. Beobachtungen zum Prozess der Polisbildung bei Hesiod, Solon und Aischylos, in: HZ 231 (1980), 529-564. –, Mittelschicht und Polisbildung, Frankfurt a.M. 1977. Stark, I., Die hämische Muse. Spott als soziale und mentale Kontrolle in der griechischen Komödie, München 2004. Starr, C.G., The Aristocratic Temper of Greek Civilization, New York 1992. –, Individual and Community. The Rise of the Polis 800-500 B.C., New York 1986. Stein-Hölkeskamp, E., Adelskultur und Polisgesellschaft, Stuttgart 1989. Steiner, D., Moving Images. Fifth-century Vicotry Monuments and the Athlete’s Allure, in: ClA 17 (1998), 123-153.
Anhang
343
Steinkopf, G., Untersuchungen zur Geschichte des Ruhmes bei den Griechen, Diss. phil., Halle a.d.S. 1937. Steinwenter, A., Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Rechte, München 19712. Stewart, Z., Laughter and the Greek Philosphers: A Sketch, in: Jäkel und Timonen, Laughter, 2957. Strasburger, H., Einleitung zu Thukydides, in: ders., Studien zur Alten Geschichte, hg. von R. Zoepffel und W. Schmitthenner, Bd. 2, Hildesheim 1987, 709-776. –, Der Einzelne und die Gemeinschaft im Denken der Griechen, in: HZ 177 (1954), 227-248. –, Der soziologische Aspekt der Homerischen Epen, in: Gymnasium 60 (1953), 97-114. Strauss, B.S., Oikos/Polis: Towards a Theory of Athenian Paternal Ideology 450-399 B.C., in: W.R. Connor [u.a.] (Hg.), Aspects of Athenian Democracy, Kopenhagen 1990, 101-127. Strohm, H., Eine Demosthenes-Interpretation, in: U. Schindel (Hg.), Demosthenes, Darmstadt 1987, 233-248. Taplin, O., Phallology, Phlyakes, Iconography and Aristophanes, in: PCPhS N.S. 33 (1987), 92104. Taylor, C.C., Popular Morality and Unpopular Philosophy, in: E.M. Craik (Hg.), ›Owls to Athens‹. Essays on Classical Subjects presented to Sir Kenneth Dover, Oxford 1990, 233-243. Thomas, J., Technologies of the Self and the Constitution of the Subject, in: Archaeological Review from Cambridge 8,1 (1989), 101-107. Thomas, R., Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law, in: Foxhall und Lewis, Law, 9-31. Thommen, L., Nacktheit und Zivilisationsprozess in Griechenland, in: Historische Anthropologie 4 (1996), 438-450. Thompson, D.A.W., A Glossary of Greek Birds, London 1936 (ND Hildesheim 1966). Thompson, H.A., The Panathenaic Festival, in: AA 76 (1961), 224-231. –, The Excavation of the Athenian Agora, Twelfth Season: 1947, in: Hesperia 17 (1948), 149-196. Thorp, J., The Social Construction of Homosexuality, in: Phoenix 46 (1992), 54-61. Thür, G., Das Gerichtswesen Athens im 4. Jahrhundert v. Chr., in: Burckhardt und von UngernSternberg, Prozesse, 30-49. Timpe, D., Der Barbar als Nachbar, in: Ulf, Ideologie, 203-230. Todd, S.C., The rhetoric of enmity in the Attic orators, in: Cartledge, Millett und von Reden, Kosmos, 162-169. –, Lady Chatterley‘s Lover and the Attic Orators: The Social Composition of the Athenian Jury, in: JHS 110 (1990), 146-173. –, The Purpose of Evidence in Athenian Courts, in: Cartledge, Millett und ders., Nomos, 19-39. –, Rez. C. Carey, Lysias: Selected Speeches, in: ClR 41 (1991), 310-311. Too, Y.L., The Rhetoric of Identity in Isocrates. Text. Power. Pedagogy, Cambridge 1995. Tracy, S.V. und C. Habicht, New and Old Panathenaic Victor Lists, in: Hesperia 60 (1991), 187236. Ulf, C. (Hg.), Ideologie - Sport - Außenseiter. Aktuelle Aspekte einer Beschäftigung mit der antiken Gesellschaft, Innsbruck 2000. Ulf, C., Die Mythen um Olympia - politischer Gehalt und politische Intention, in: Nikephoros 10 (1997), 9-51. Usher, S., Rez. Douglas M. MacDowell, Demosthenes, Against Meidias, in: ClR 41(1991), 28-29. –, Individual characterisation in Lysias, in: Eranos 63 (1965), 99-119. Valavanis, P.D., Säulen, Hähne, Niken und Archonten auf panathenäischen Preisamphoren, in: AA 1987, 467-480. Van Wees, H., Homeric Warfare, in: Morris und Powell, Companion, 668-693. Vernant, J.-P., Between Shame and Glory: The Identity of the Young Spartan Warrior, in: ders., Mortals and Immortals. Collected Essays, Princeton, N.J. 1991, 220-243. –, One ... two ... three: ERÔS, in: Halperin, Winkler und Zeitlin, Sexuality, 265-478.
344
Anhang
Versnel, H.S., The Festival for Bona Dea and the Thesmophoria, in: I. McAuslan und P. Walcot (Hg.), Women in Antiquity, Oxford 1996, 182-204. Veyne, P., Brot und Spiele. Gesellschaftliche Macht und politische Herrschaft in der Antike, Frankfurt a.M. 1988. –, Olympia in der Antike, in: Freibeuter 34 (1987), 32-43. Vlahogiannis, N., Disabling Bodies, in: Montserrat, Bodies, 13-26. Vogt, L. und A. Zingerle, Zur Aktualität des Themas Ehre und zu seinem Stellenwert in der Theorie, in: diess., Ehre, 9-34. – (Hg.), Ehre. Archaische Momente in der Moderne, Frankfurt a.M. 1994. Vogt, L., Identität und Integrität. Aspekte ehrgenerierter Identitätsentwürfe im Spannungsfeld von Individuum und Gruppe, in: H. Willems und A. Hahn (Hg.), Identität und Moderne, Frankfurt a.M. 1999, 509-528. –, Ehre in traditionalen und modernen Gesellschaften. Eine soziologische Analyse des »Imaginären« am Beispiel zweier literarischer Texte, in: dies. und Zingerle, Ehre, 291-314. von Erffa, C.E., !)$73 und verwandte Begriffe in ihrer Entwicklung von Homer bis Demokrit, Leipzig 1937 (=Philologus Suppl. 30,2). von Reden, S., The well-ordered polis: topographies of civic space, in: Cartledge, Millett und dies., Kosmos, 170-190. –, Exchange in Ancient Greece, London 1995. Waardt, H. de, Ehrenhändel, Gewalt und Liminalität: Ein Konzeptualisierungsvorschlag, in: Schreiner und Schwerhoff, Ehre, 303-319. Wagner-Hasel, B., »Das Private wird politisch«. Die Perspektive »Geschlecht« in der Altertumswissenschaft, in: A.J. Becker und J. Rüsen (Hg.), Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive, Frankfurt a.M. 1988, 11-50. Walbank, M.B., Regulations for an Athenian Festival, in: Hesperia Suppl. 19 (1982), 173-182. Walcot, P., Envy and the Greeks. A study of human behaviour, Warminster, Wiltsh. 1978. –, Odysseus and the Art of Lying, in: AncSoc 8 (1977), 1-19. Wallace, R.W., Private Lives and Public Enemies: Freedom of Thought in Classical Athens, in: Boegehold und Scafuro, Identity, 127-155. –, The Athenian Law against Slander, in: Symposion 1993, Köln/Wien 1994, 109-124. Wankel, H., Demosthenes: Rede für Ktesiphon über den Kranz, erl. u. eingel., 2 Bde., Heidelberg 1974. Weiler, I., Gymnastik und Agonistik im hellenistischen Gymnasion, in: D. Kah und P. Scholz (Hg.), Das hellenistische Gymnasion, Berlin 2004, 25-46. –, Olympia - jenseits der Agonistik: Kultur und Spektakel, in: Nikephoros 10 (1997), 191-213. –, Korruption in der olympischen Agonistik und die diplomatische Mission des Hypereides in Elis, in: A. Rizakes (Hg.), Achaia und Elis in der Antike. Akten des 1. Internationalen Symposiums Athen, 19.-21. Mai 1989, Athen 1991, 87-92. –, Einige Bemerkungen zu Solons Olympionikengesetz, in: P. Händel und W. Meid (Hg.), Festschrift Robert Muth, Innsbruck 1983, 573-582. –, Der Sport bei den Völkern der alten Welt, Darmstadt 1981. –, !„ÒN ¢RISTEÚEIN. Ideologiekritische Bemerkungen zu einem vielzitierten Homerwort, in: Stadion 1 (1975), 199-227. –, Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf, Darmstadt 1974. Weißenberger, M., Die erste Rede des Lysias, in: AU 36 (1993), 55-71. Welwei, K.-W., Die Entwicklung des Gerichtswesens im antiken Athen. Von Solon bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr., in: Burckhardt und von Ungern-Sternberg, Prozesse, 15-29. –, Adel und Demos in der frühen Polis, in: Gymnasium 88 (1981), 1-23. Whitehead, D., Hypereides. The Forensic Speeches. Introduction, Translation and Commentary, Oxford 2000. Whitehead, D., Competitive Outlay and Community Profit: FILOTIμ…A in Democratic Athens, in: C&M 34 (1983), 55-74.
Anhang
345
Wierzbicka, A., Human Emotions: Universal or Culture-Specific?, in: American Anthropology 88 (1986), 584-594. Wikan, U., Shame and Honour: A Contestable Pair, in: Man 19 (1984), 635-652. Will, É., Die ökonomische Entwicklung und die antike Polis, in: H. Kippenberg (Hg.), Seminar: Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft, Frankfurt a.M. 1977, 100-135. Williams, B., Scham, Schuld und Notwendigkeit. eine Wiederbelebung antiker Begriffe der Moral, Berlin 2000. Wilson, P.J., Demosthenes 21 (Against Meidias): Democratic Abuse, in: PCPhS 37 (1991), 164195. Winkler, J.J., Der gefesselte Eros. Sexualität und Geschlechterverhältnis im antiken Griechenland, Marburg 1994. –, Phallos Politikos: Representing the Body Politic in Athens, in: Differences 2 (1992), 29-45. –, Laying down the Law. the Oversight of men’s sexual behaviour in classical Athens, in: Halperin, ders. und Zeitlin, Sexuality, 171-209. Wolin, S.S., Transgression, Equality, and Voice, in: Ober und Hedrick, Dêmokratia, 63-90. Wooten, C.W., Clarity and Obscurity in the Speeches of Aeschines, in: AJPh 109 (1988), 40-43. Worthington, I. (Hg.), Demosthenes. Statesman and orator, London/New York 2000. – (Hg.), Persuasion. Greek Rhetoric in Action, London 1994. –, History and Oratorical Exploitation, in: ders., Persuasion, 109-129. –, Once more, the Client/Logographos Relationship, in: CQ 87 (1993), 67-72. Yiannakis, T.B. und S.T. Yiannaki, The Meaning of Names in Greek Antiquity, with Special Reference to Olympic Athletes, in: The International Journal of the History of Sport 15,3 (1998), 103-114. Young, D.C., The Riddle of the Rings, in: Bandy, Coroebus, 257-276. –, The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, Chicago 1984. Young, M.W., Fighting with Food. Leadership, Values and Social Control in a Massim Society, Cambridge 1971. Zanker, G., Rez. G. Wöhrle, Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt, in: ClR 50 (2000), 372-373. –, The Heart of Achilles. Characterization and Personal Ethics in the Iliad, Ann Arbor, Mich. 1994. Ziegler, K., Pythostratos, in: RE 24 (1963), 618. Zingerle, A., Historische und semantische Vorüberlegungen zu einer Soziologie der Ehre, in: Soziologisches Jahrbuch 7,2 (1991), 15-32. Zinsmaier, T., Wahrheit, Gerechtigkeit und Rhetorik in den Reden Antiphons. Zur Genese einiger Topoi der Gerichtsrede, in: Hermes 126 (1998), 398-422. Zoepffel, R., Aufgaben, Rollen und Räume von Mann und Frau im archaischen und klasschen Griechenland, in: dies. und J. Martin (Hg.), Aufgaben, Rollen und Räume von Frau und Mann, Bd. 2, München 1989, 443-499. Zunkel, F., Ehre, Reputation, in: GG 2 (1975), 1-63.
Register
I. Personenregister Achill 9f., 40-60, 163, 291f., 311, 314 Aelian 95, 130f., 156 Aesop 128 Anm. 198 Africanus, Sextus Iulius 33 Anm. 60, 85 Anm. 58, 90 Anm. 77 Agamemnon 9, 40-60, 311 Agesilaos 114, 157f. Aias 9, 53 Aischines 92, 204, 214, 268-284, 295, 305 Aischylos 136f. Alexander der Große 68, 94f. Alkibiades 33 Anm. 61, 34 Anm. 62, 61 Anm. 2, 82-86, 89 Anm. 76, 98, 102, 104f., 115f., 133, 139, 163, 191 Anm. 104, 215 Anm. 54 Alkimedon 121 Alkmaion 33 Anm. 61, 86 Androtion 204, 269, 286 Antikles 91 Antilochos 50-52, 288, 291, 314 Apllodor 203, 237, 250-256, 307, 318 Apoll 46, 51 Arethusios 237 Anm. 119, 250-256 Aristokrates 204, 269, 285 Aristokrates Skeliou 91 Aristolochos 91 Ariston 138, 163 Anm. 5, 179, 183, 188, 203, 205f., 220-226, 232-235, 307, 317 Aristophon 95 Anm. 106, 97 Arrhichion 121 Astylos 118-120 Augustinus 139
Cohen, David 25-27, 167 Anm. 19, 168171, 176, 200 Anm. 22, 209f., 216 Anm. 58, 241f., 254 Anm. 170, 284, 289, 292f., 319 Coubertin, Pierre de 73 Anm. 31
Bourdieu, Pierre 14 Anm. 10, 18 Anm. 20, 27 Anm. 48f., 63, 70 Anm. 20, 78 Anm. 42, 182 Anm. 66 Briseis 44, 55 Burckhardt, Jacob 65-68, 70, 72, 76, 79, 111 Anm. 144, 140, 247 Anm. 145
Hektor 44, 56-58 Hera 113, 153f. Homer 27, 40, 42, 50, 65f., 69, 87, 165, 167, 178, 186, 288, 291, 311 Huizinga, Johan 71f., 140
Demeter 111, 148-150, 152 Demosthenes 32, 92f., 173, 179f., 183, 188, 204-220, 224-226, 232-235, 237, 250, 256, 265-286, 287f., 296, 307, 317 Diodorus Siculus 90 Anm. 77, 94-96, 152 Diodoros 285-287 Diomedes 53f. Dioxippos 94-96, 98 Dodds, Eric 24, 45 Anm. 16, 185-187 Ehefrau des Diokles 150 Elias, Norbert 73f. Epichares 91f. Eratosthenes 22 Anm. 28, 168, 188, 202f., 205, 226-233, 307, 317 Euergos 203, 237, 256-260, Euktemon 286 Eumelos 50-52, 291 Euphiletos 146, 163, 179, 183, 187f., 203, 205f., 226-235, 306f., 317 Eupolos 97 Anm. 108, 117 Fisher, Nicolas 165-172, 176 Geertz, Clifford 127f. Glaukos 53
Isokrates 24 Anm. 38, 32, 86 Anm. 61 Cairns, Douglas L. 170-172, 176, 182, 186f. Charidemos von Oreos 285, 295
Kallias Didymiou 87-89, 98
Anhang
347
Kallias, Sohn des Hipponikos 86 Kallippos 96f., 117 Kimon, Sohn des Stesagoras 86 Konon 138, 168, 187f., 202, 205, 220-226, 307, 317 Kore 149f. Korrhagos 94f. Kroton 118f. Ktesiphon 204, 279, 295, Kyniska 114f., 120 Anm. 173, 148, 157-160
Pausanias 33 Anm. 60, 69, 85 Anm. 58, 97, 111-113, 117-119, 153-155, 157 Perikles 88, 144 Anm. 6, Pherenike aus Rhodos (Kallipateira) 114, 148, 155-160 Philammon 92-94, 98 Philostratos 85 Anm. 58, 121 Pindar 61 Anm. 1, 89, 121f., 172 Priamos 57f. Pythostratos 91
Lysias 32, 203-205, 226f., 229, 230-233, 237f., 244, 246f., 297-299
Simon 203, 237-248, 307 Solon 124, 173 Sosippos 90f. Sotades 119f.
Meidias 92 Anm. 89, 164, 168, 173, 187f., 202f., 205-220, 275, 306f., 317 Miltiades, Sohn des Kypselos 86 Minos aus Athen 90 Mnesiboulos 203, 237, 256, 259f. Neaira 36 Anm. 64, 145 Nietzsche, Friedrich 75f. Nikostratos 203, 237, 250-255, 307, 318 Odysseus 9, 43, 54, 56, 87 Anm. 65, 120
Theodotos 238, 240, 243f., 246f. Thrasylochos 206, 219 Anm. 74 Thukydides 82 Anm. 54, 83, 85 Anm. 58, 107f., 182 Anm. 67 Timodemos 89 Timokrates, Sohn des Antiphon 92 Zeus 47 Anm. 21, 48 Anm. 25, 53, 58 Anm. 62, 97 Anm. 108, 113, 154, 159 Anm. 52 – Zeus Horkios 116
Patroklos 50, 56-58, 69, 77, 311
II. Sachregister Agon – agonale Ehre cf. Ehre – agonaler Geist 64f., 80, 217 – agonales Verhalten 28, 30, 33, 49f., 59, 61, 77, 117, 125f., 136, 140f., 147, 209, 216, 236, 286, 312-314 – agonistisch 92, 200 Anm. 25, 205, 242, 289 – hippischer Agon 90, 92, 98, 102-106, 141, 157-159 Agora 34 Anm. 62, 87f., 116, 123, 133, 189, 203, 218f., 221, 264, 299, 301f., 312 Aidôs, A„DèJ 44, 107, 155, 182, 185-187 Aischrologie 152 Aischunê, A„SCÚNH 166, 182, 185f., 239, 248 Alpheios 111 Anm. 141, 113, 141, 155 Angeklagter 165 Anm. 8, 169, 175, 237, 239, 244, 248f., 286
Anthropologie, anthropologisch 13-15, 20, 25, 65 Anm. 4, 68 Anm. 15, 72f., 146, 183-185, 195, 209, 309 Antidosis 206f. Apotropäisch 108 Aretê, ¢RET» 40f., 108 Anm. 131, 117, 130f., 158, 278, 283 Argument, Argumentation 82, 183, 187, 204, 209, 211f., 214, 241f., 248f., 269, 275, 284 Anm. 256, 268f., 289, 299, 301, 303 Aristokraten 55, 80, 84, 89, 101-105, 109, 141, 281, 311 – aristokratisch 22, 25 Anm. 39, 55, 66, 80, 90, 93, 100-103, 110, 131, 141, 217 Arme, Armut 18 Anm. 20, 274, 294 Athletik 89, 93, 106f., 111, 113 – Athlet 89, 123 – athletisch 77, 79f., 85, 87-97, 102 Anm. 113, 106, 108, 111, 114, 116, 122, 124f., 140, 156-158, 313-315
348
Anhang
Atimie, ¢TIμ…A 37f., 182f., 189-192, 316 Autonomie, autonom 20, 78, 151 Anm. 26, 193, 195, 201, 247, 249 Barbaren, barbarisch 70, 107f., 113, 130 Anm. 204, 219 Anm. 71 Beobachter 45, 123, 128, 138, 215, 232, 309 Besitz 45, 53 Anm. 41, 69 Anm. 28, 83, 103, 120, 135, 158, 252f. Bestechung, Bestechlichkeit 118f., 190, 208 Betrunken 220, 225, 239 Anm. 122 Bürgerschaft, Polisbürgerschaft 31, 84, 97, 101, 110, 174, 180, 188 Anm. 89, 190, 204, 206, 218f., 266, 282, 284f., 293296, 304-306, 315f. – Bürgerehre (s. Ehre) – Bürgerfrau, Bürgerin 23, 35f., 144-146, 149, 150, 177 Anm. 59, 152, 190, 314 – Bürgergemeinschaft 97, 144, 219, 309f. – Bürgerrecht 22f., 145, 191, 199, 207, 238, 253, 315 – Bürgerstatus cf. Status Buße, Bußgeld 96f., 165 Anm. 8, 207, 269 Anm. 213 Charakterisierung 209, 227, 231f., 244, 262f. Chor 77, 149, 208 – Chorege 180 Anm. 62, 207f., 213, 215f., 217-219, 280 Anm. 242 Demokratie 10f., 23, 25, 32, 66f., 69 Anm. 17, 80, 84, 90, 98, 101, 162, 164, 179, 190, 199f., 213, 279, 289, 294, 296f., 305f., 310, 319 – demokratisch 9f., 20-23, 28, 62, 98, 101, 105, 139, 162, 166, 173, 179, 189, 191, 215, 218, 267, 284, 286, 289-292, 296f., 302, 311 Desertion 190, 208 Diaulos 118 Dionysostheater 131, 314 Dionysien, Große 207 Distinktion 63, 102, 266, 284, 294, 302 – Distinktionsmerkmal 83, 90, 99, 219, 294 Dokimasie 298 Dynamik 13, 20, 23f., 27, 39, 40, 49, 124, 168, 176, 183, 199, 203, 205, 223, 236, 260, 264, 293, 319 – Eigendynamik 196 Dysfunktional 59, 83, 136, 142, 164, 176, 178, 220, 297, 307, 311
Ebenbürtige 102, 161, 273, 293, 304 Anm. 314, s. auch Gleiche – Ebenbürtigkeit, ebenbürtig 54, 102, 161 Anm. 1, 185, 279, 300, 304 Ehebruch, ehebrecherisch 188, 190, 231 Ehre – agonale Ehre 63, 78, 80, 83f., 85, 88, 92, 97-99, 116, 120, 122, 125, 141, 154, 209, 246, 313f. – Bürgerehre 78, 204, 269, 282 Anm. 249, 305f., 308, 318 – Ehrbegriff 9, 14, 16-19, 40, 42, 49, 55-59, 77, 198, 259, 262, 268 Anm. 210, 281, 311 – Ehrbewusstsein 187 – Ehrenhaftes Verhalten(smuster) 9f., 12f., 15, 18-22, 24f., 27f., 33-35, 37, 42f., 45, 52, 54, 59-62, 64, 77, 79, 81, 83, 100f., 115, 117, 124, 126, 129f., 139, 147, 149, 153f., 168f., 179, 183, 201f., 205f., 219f., 222-224, 236f., 242, 246, 251, 255, 259f., 262, 265, 269-271, 283, 286, 289, 307-311, 312, 314 – Ehrenhändel 126, 179, 194 Anm. 6, 196, 199, 257, 306, 317 – Ehreninschrift 266, 268 – Ehrenmann 9, 21f., 24, 26, 28f., 31, 33, 43, 47f., 52, 61, 63, 83, 99-101, 110, 116, 118, 124-126, 129, 134, 140f., 145, 161-163, 169, 173, 178f., 181, 183, 187189, 192, 197f., 201-204, 206, 211-213, 215-218, 224, 236, 239f., 242-244, 246f., 250f., 254f., 259, 261f., 270-273, 275f., 281-290, 297, 300f., 304, 306-318 – Ehrgefühl 9, 13f., 17, 19 Anm. 22, 27 Anm. 48f., 40f., 44, 48f., 58f., 162f., 171f., 181, 185, 197, 200, 214f., 220, 226f., 232, 269, 318 – Ehrgeiz, ehrgeizig 64, 66 Anm. 10, 69, 71, 76, 79, 83, 96, 101, 116, 123, 126, 132 Anm. 209, 147, 155, 267, 277f., 296, 312, 315 – Ehrgeschenke 46-51, 53f. – Ehrlosigkeit 189, 191 – Ehrstiftend 124 – Ehrverletzung 15 Anm. 12, 29, 38, 40, 165, 171f., 176, 181-188, 193-195, 197, 199 Anm. 21, 203, 205f., 215f., 221, 234, 317 – Ehrverlust 30, 38, 182 Anm. 69 – Ehrzuschreibung 215, 17-19, 31, 40, 43, 61, 84, 99, 105, 115f., 119, 128, 266268, 276, 278, 302, 312-314, 318
Anhang – Entehrung 181, 225 – Konvertierbarkeit von Ehre 58 Anm. 62f., 83-85, 99, 125, 141, 313 – männliche Ehre 124, 184, 225, 231, 247 – Politik der Ehre 115f., 120, 125 Ehrung 12, 32, 40, 43, 45-47, 50-53, 59, 61, 63, 79, 83-85, 88, 94, 96-99, 114-116, 119f., 123-125, 140f., 203f., 265-273, 275, 277-297, 305f., 308, 318 – Polisehrung 269, 283, 285, 290-297, 306, 318 Ekklesia, Volksversammlung 55 Anm. 50, 105, 151, 189, 208, 214, 280, 294, 296 Eleer 96f., 111 Anm. 141f., 118 Anm. 166, 123, 156 Anm. 41 Elite 23, 55, 106 Anm. 127, Emotion, emotional, Affekt 13, 44 Anm. 14, 112, 144 Anm. 4, 166, 181, 195, 198, 200, 231, Eskalation 31, 223, 239, 243, 246, 256, 313 Ethnologie, ethnologisch 13, 72, 195 Exklusivität, exklusiv 35, 66, 72, 90, 100f., 106, 110, 113, 133, 147-149, 151, 274, 293, 314 Familie 83, 86, 89, 91, 98, 123, 144-146, 148, 156-158, 160, 170, 184, 197, 252, 294, 304 Anm. 315 Faustkampf, Faustkämpfer 92f., 117f., 155 Anm. 38, 156 Anm. 41 Feigheit 182 Anm. 67, 196 Feind 29, 55, 102, 105 Anm. 122, 122 Anm. 182, 182, 187, 191, 194, 206f., 216, 218f., 221, 230 Anm. 106, 249, 253, 255f., 300 Anm. 299 – feindlich, feindselig 29, 32, 53, 194, 206, 241, 253 – Feindschaft 166, 205-207, 212 Anm. 43, 220, 231, 239, 246f., 250, 253 Anm. 265, 256, 276, 282 Anm. 249, 286f., 293, 300f. – verfeindet 247f., 250, 256 Fest, Feier 33, 35, 62 Anm. 2, 73, 96, 111, 114, 123, 125, 140, 147-150, 152-154, 160, 180 Anm. 62, 207f., 218 Flügel 221 Frau 17, 34-36, 46f., 50 Anm. 33, 51, 57 Anm. 60, 101, 110-114, 120, 124, 141, 143-161, 165 Anm. 8, 169, 174, 179, 181, 183-185, 207, 225, 227-229, 231f., 239, 258 Anm. 188, 260f., 264 Anm. 204, 306, 314f.
349
Freund 10, 29, 54 Anm. 48, 57f., 83, 95f., 104 Anm. 120, 133, 138, 194, 219, 221, 226, 239f., 243-247, 249, 251-253, 260f., 263, 272 Anm. 218, 287, 300f., 303 – Freundschaft, freundschaftlich 24 Anm. 38, 53f., 102, 250-253, 255, 281, 300 – Gastfreund, Gastfreundschaft 53f., 182 Anm. 68 Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeitsriten 112, 147149, 152, 154, 315 Gabe 9, 53-56, 252, 273 Anm. 223, 277, 305 – Gabentausch 52f., 59 Gast 54, 239 Anm. 125, 249 Gefängnis 119 Geld 83, 88, 97 Anm. 108, 117, 119, 123, 132, 207 Anm. 34, 218 Anm. 68, 231 Anm. 111, 251-255, 260, 266 Anm. 205, 300 Anm. 299, 301 Anm. 301 Gemeinwesen 9, 20, 29, 46-48, 56, 126, 192, 197, 203, 209, 218f., 236, 265-269, 272f., 275-277, 283, 306, 308f., 311 Gericht – Gerichtshof 31f., 151 Anm. 27, 165 Anm. 8, 167, 169, 199, 203, 236, 247 Anm. 145, 251, 287, 289f., 295 Anm. 282, 306 – Gerichtsrede 31, 38, 92, 163, 168, 180, 192, 203, 206, 229 Anm. 100, 236, 268, 282, 298-300, 30f., 316-318 – Gerichtsverfahren, Prozess 30f., 93, 179, 183, 188, 192, 198, 200f., 203-208, 210, 214, 216, 220, 234, 238f., 250, 253-256, 260, 263f., 266 Anm. 205, 268-272, 282f., 287, 290, 292f., 300 Anm. 299, 307, 317f. Geschlecht 112, 120, 145, 150, 156, 284, 315 – Geschlechterrollen 17, 35f., 101, 110, 112f., 134f., 143-146, 151, 159, 229 Anm. 100, 315 – Geschlechtsidentität 18, 101, 114, 134, 141, 161, 185, 314 Geschworene 174 Anm. 48, 179, 184, 192, 222, 224, 228, 230, 237, 247 Anm. 145, 252, 262, 270, 285, 307, 316 Gewalt 25, 73-75, 171, 182 Anm. 66, 224, 233, 239, 263, – Gewaltbereitschaft 75, 195 – Gewalttat, gewalttätig 30, 49, 55, 74f., 169, 195, 209, 243f., 246, 256, 259, 263, 303 Anm. 309
350
Anhang
Gleiche 28f., 78, 101, 106, 114, 140, 161192, 194, 267, 273, 285, 294, 301, s. auch Ebenbürtige Götter 54, 57, 84, 118 Anm. 166, 123, 131 Anm. 304, 172, 213, 264, 277 Anm. 231, 279 Anm. 236 Göttin 40 Anm. 1, 147f., 152 Anm. 29, 154, 281 Graphe hybreos, GRAF¾ ÛBREWJ 164, 167169, 174-176, 179f. Gymnasion 106, 109
Interpretation 11, 13, 15, 27, 32, 37, 41f., 56, 64, 79 Anm. 45, 114, 157f., 168, 173, 192, 202f., 206, 210, 215 Anm. 53, 220, 231, 234, 237, 242, 264, 279, 298 Anm. 292, 307, 314, 317f. – Interpretationsspielraum 13, 32, 38, 81, 115, 201, 210, 215, 234, 242, 317 Invalide 204, 269, 298-306, 308, 318
Habitus 27, 27 Anm. 48f., 30, 37, 41, 59, 61, 63, 100, 113, 115, 122, 153, 161, 178, 192, 204, 217, 262, 264, 272, 276, 281, 285, 301f., 308, 312, 316 – habituelle Form 11, 19-22, 27-29, 32f., 36, 39, 41-43, 51f., 59, 61, 63f., 100, 126, 129, 135f., 140f., 147, 153, 160f., 176, 184, 220, 234, 251, 270, 285f., 306, 309f., 312, 314f. Hahn 33f., 63f., 66, 127-142, 221, 225, 314 – Hahnenkampf 33, 34, 63, 77, 127-142, 314 Handlungsspielraum, Handlungssphäre 42, 98, 116, 120, 151, 158f., 194, 231, 247, 258, 315 Hellanodiken 111 Anm. 142, 116, 118 Anm. 145, 120, 125 Heraia 77, 111 Anm. 43, 113, 147, 153f. Herausforderung 27-32, 70 Anm. 20, 83, 95, 99, 110, 118, 124, 126, 164, 196, 202, 205, 236, 241, 246, 249, 264, 312f., 317 Herkunft 18, 102 Anm. 13, 110, 120, 284 Hetairie 224f. Hetäre 149, 247f. Homerische Gesellschaft 9, 40-60, 185, 187, 311 Hybris, ÛBRIJ 25, 37f., 48, 84 Anm. 55, 137, 152 Anm. 30, 162-182, 187f., 192, 209, 215, 217-219, 225f., 238f., 255 Anm. 172, 281f., 286, 299, 303 – hybrides Verhalten, hybride Akte 38, 142, 163f., 166, 169-171, 173, 176f., 179, 220, 226, 303, 305
Kampf 9, 30, 33, 49, 63, 66, 70, 72-74, 77f., 81, 85 Anm. 58, 87 Anm. 65, 93-96, 99, 117f., 121f., 129, 132-138, 155 Anm. 37, 154, 156 Anm. 42, 160f., 173, 179, 188f., 194, 196, 203, 218, 221, 223, 234, 236, 240, 243, 245f., 248, 262, 268, 293, 306-308, 318 – Kampfgemeinschaft 49, 53, 56-59, 311 Kinder 56 Anm. 54, 57 Anm. 60, 112, 131 Anm. 204, 133 Anm. 214, 149 Anm. 20, 152, 165 Anm. 8, 169, 174, 177f., 227f., 232 Anm. 112, 260 Anm. 195 Klage, Anklage 165 Anm. 8, 165, 174f., 189f., 206f., 211, 219-223, 225f., 232 Anm. 112, 238 Anm. 121, 243, 247-249, 255f., 264, 285-288, 303, 317 – Kläger 165 Anm. 8, 175, 188, 230, 237, 247-250, 269, 285, 188, 298, 300-302, 304 Klatsch, Gerede 96, 219 Knabe 61 Anm. 1, 91f., 134, 238-240, 243247 – Knabenliebe 109 Knoblauch 132 Kompetitiv 21f., 29, 41, 52, 77, 100, 106, 126, 237, 242, 246, 319 Komplementär, Komplementarität 17, 35, 45, 101, 113f., 134, 143f., 147, 151, 153, 160, 183, 210, 232, 314f. Konflikt 9, 12, 16 Anm. 23, 21, 26, 29-32, 38, 40, 43, 46-49, 51f., 55f., 58f., 126, 176, 187, 189, 192, 193f., 199, 201, 203, 216, 219f., 223f., 226, 234-237, 239, 247f., 250, 256, 261, 264f., 287, 306308, 313, 317f. – Konfliktaustragung 31, 192, 197-200, 282 – Konfliktbewältigung 39, 60, 198f., 316 – Konfliktführung 26, 30, 200, 203, 213, 215, 220, 223, 236, 259, 265, 282f., 289 – Konfliktpotential 24, 49, 52, 63, 100, 287
Identität 22, 73 Anm. 31, 114, 181, 290, 293, 318 Ilias 40-60, 67, 288, 311 Initiationsritus 109, 154 Inszenierung 104, 128, 139, 141, 193, 235, 265
Jungfrauen 111 Anm. 142, 114, 149 Anm. 20f., 153 Anm. 33,
Anhang – Konfliktverhalten 25f., 202, 209, 211, 213, 220, 306, 308, 312f., 317f. Konkurrenz, Rivalität 28, 30, 33, 39, 52, 72, 76, 81, 83, 129, 132, 202, 225, 235, 278, 280, 282f., 300, 309, 311 – Konkurrenten, Rivalen 61, 93, 102f., 161, 178, 185, 203, 205, 226, 268, 288, 291, 302 – Konkurrierende Loyalitäten 21f., 31f., 202, 237, 243, 311, 318f. Kooperativ 21f., 29, 41, 51f., 56, 319 Korruption 117 Krähen 132, 135 Anm. 222f., 139 Anm. 239, 221f. Kranz 36, 77, 81, 87, 89-91, 93 Anm. 91, 94 Anm. 95, 118 Anm. 166, 120f., 123 Anm. 191, 125, 153, 157, 159 Anm. 54, 180 Anm. 62, 204, 264, 269 Anm. 13, 270, 272 Anm. 218, 273 Anm. 220, 279 Anm. 236, 281, 283, 285, 287f., 293f. – bekränzen, Bekränzung 66 Anm. 10, 69, 89 Anm. 74, 92f., 98, 114, 116, 118, 123, 140f., 157, 203f., 268-270, 272, 277, 279-281, 283 Anm. 251, 288, 291f., 304 – Kranzrede 204, 268-285 Krieg, kriegerisch 40-43, 47, 49f., 55, 68 Anm. 15, 70-74, 85 Anm. 58, 103, 105 Anm. 123, 108 Anm. 134, 133, 136f., 166, 185, 196, 304 Lächerlich 107, 127 Anm. 196, 225 Anm. 89, 229, 276 Anm. 228, 290, 299, 303 Leichenspiele des Patroklos 50, 69, 77, 103 Anm. 219, 311 Leistung 50, 52, 62 Anm. 2, 67, 70, 75-77, 79, 83, 85 Anm. 58, 89, 92-94, 96, 103, 105, 109, 121-125, 141, 157, 159, 197, 203f., 217 Anm. 62, 265-267, 271f., 274278, 283, 285, 290, 296f., 304f., 308, 313 Liturgien 216-218, 220, 225 Anm. 90, 255, 272, 274 Logograph 202, 229 Anm. 100, 299 Männlich, Männlichkeit 17, 22, 35f., 101, 108f., 111 Anm. 143, 113-115, 117, 124, 126, 129, 131, 134, 139, 141, 145-147, 150f., 153-161, 184, 225f., 231, 239 Anm. 222, 247, 314 Militärisch 49, 81 Anm. 52, 103, 106 Mitgift 261 Mitleid 51
351
Mittelmeerraum 14 Anm. 11, 17 Anm. 15, 26, 34 Anm. 64, 27 Anm. 72, 143 Anm. 1, 146 Anm. 21, 197 Anm. 16, 199f., 209, 258 Anm. 187 Modern, Moderne 15-17, 20, 64, 72-75, 78f., 186, 199, 224, 301 – Modernisierung 16, 198f. Mord 202, 205, 208, 223f., 227, 229, 233, 255, 307 Muße 78 Mut 9 Anm. 1, 57, 109, 114, 124 Anm. 193, 129, 131 Anm. 206, 134, 193 Nachbarn 147, 199, 220f., 228 Anm. 99, 230, 239, 243, 250-255, 261 Nachkommen 96, 145, 152, 155, 159, 190, 219, 266 Anm. 205 Nackheit, nackt 106-109, 111, 155 Anm. 37, 314 Neid, neidisch 76, 96, 241, 300 Netzwerk 146, 160 Nicht-öffentlich 34f., 265 Niederlage, Unterlegenheit, Besiegtsein 37, 49f., 95, 99, 120-122, 127f., 134, 136138, 179, 203, 214f., 225, 234, 241, 248250, 288, 307, 238 Nomos hybreos, NÒμOJ ÛBREWJ 164-180, 316 Nomos moicheas 231, 233 Norm – normgerecht 21, 31, 38, 42f., 45, 145, 147, 152, 192, 202, 213, 215, 233-235, 243, 258, 271, 307, 309, 317 – Norm der Polis 21f., 27-29, 35, 162, 183, 188, 192, 203, 220, 234, 256f., 263, 307f., 316-318 – normative Erwartungen/Ansprüche 9f., 20f., 28, 36 Anm. 67, 118, 147, 157, 159, 169, 180, 183, 189, 202, 204-206, 211, 213, 220, 232, 235, 251, 271, 306-308, 311f., 319 – Verhaltensnorm cf Verhalten Nullsummenspiel 29, 46f., 49f., 121, 161, 172, 176, 194, 219 Oberschicht 22f., 25, 78-80, 83-86, 88-90, 92, 96, 99, 102, 104, 106, 140, 158, 173, 178f., 211, 218, 225, 235f., 269, 294, 298, 305 Obolus 298f., 304 Öffentlichkeit – öffentliche Meinung 10, 17, 30, 45, 82, 159, 169, 181 Anm. 64, 187, 194, 196
352 Anm. 12, 200 Anm. 25, 215 Anm. 51, 235, 237, 240, 301 – öffentlicher Raum 17f., 34f., 43, 139, 143, 151, 159, 191, 226, 302 – öffentlichkeitswirksam 34f., 39, 63, 115, 134, 144, 193, 195, 269f., 275f., 286, 293, 306 Oikos, Haus 17 Anm. 15, 21, 34f., 55, 86 Anm. 61, 112, 119, 137 Anm. 230, 143f., 151, 154, 170, 177 Anm. 59, 182 Anm. 68, 184, 206f., 217 Anm. 62, 221f., 228233, 239, 243-250, 254, 256, 258-261, 264f., 294, 308 Ölbaum, Ölbaumzweige 123, 153 Anm. 33 Olympia 33, 35f., 61-63, 66, 68f., 71, 73, 77, 79f., 82-126, 140f., 147, 153-159, 277, 279, 313f. – Olympioniken 32f, 62f., 69, 82-100, 102 Anm. 114, 118-120, 122f., 125, 140f., 155f., 159, 266, 278, 313 – Olympionikenlisten 85 Anm. 58, 90 Anm. 77 Opfer, opfern 46f., 54, 62, 123, 153 Anm. 33, 165, 194, 277 Anm. 231 Ostraka 87f. Panathenäen 61, 64, 77, 87, 89, 103 Anm. 118, 136 Pankration, Pankratisten 74, 87, 89, 94, 96f., 121 Anm. 178 Pentathlon, Pentathleten 96, 117 Persien, Perser 70, 108 Anm. 134, 130 anm. 204, 133 Pferde 50f., 62, 66, 86f., 89-91, 98, 102105, 109, 120, 157, 159 Anm. 53, 301, 303 Phalloi 134, 149, 152 Anm. 31 Phyle 107f., 217 Anm. 64, 272, 280 Pnyx 151 Polis – Polisbürger 21f., 28, 35, 85, 99, 99-101, 110, 161-163, 173, 179f., 200, 202-204, 206f., 211, 213, 215, 219f., 222, 235f., 242, 262, 267, 271-273, 276, 293, 295, 306f., 310, 315, 317f. – Polisbürgerschaft cf. Bürgerschaft – Polisehrung cf. Ehre – Polisgesellschaft 113, 125, 136, 141, 150, 267, 284, 287, 290 – Polisgemeinschaft 152, 174, 204, 218, 224, 285 – Polisnorm cf. Norm der Polis Potenz 129, 132, 134
Anhang Preis 50-52, 61 Anm. 1, 63, 66, 69, 73, 81, 98, 103, 215 Anm. 52, 218, 262, 264, 278 Anm. 233, 287f., 292, 318, cf. Siegespreis – Preisamphore 61 Anm. 1, 64, 136 – Preisgeld 63, 98, 266 Primitiv 22 Anm. 28, 46, 70, 75, 108 Anm. 133, 216 Anm. 58 Privilegiert 19 Anm. 23, 78, 90, 99, 110, 150, 162, 267, 274, 277, 315, 318 Provokation 99, 129, 205, 220, 254, 262 Rache, Vergeltung 26, 29-31, 41, 49, 55, 57f., 166, 170, 176, 179, 182, 185, 188, 193-206, 216, 218, 222 Anm. 80, 224, 226, 231, 233-235, 239 Anm. 124, 241, 248f., 251, 254-256, 259, 264, 268 Anm. 210, 275, 286f., 300, 306f., 312f., 317 – Racheakt, Vergeltungsschlag 29, 177, 193-195, 198, 201, 211f., 218, 224, 249, 255f., 259, 286, 306, 313 – Rachegelüste, Rachedurst 57, 222 Anm. 80, 233-235, 237, 255, 257 – Rachekodex 197 – Rächer, Rächender 30, 193-197, 230-232, 235, 254, 263 – Rächung, rächen 57, 116 Anm. 14, 188, 194, 201, 232f., 254, 262, 264, 286f. Rat 55 Anm. 50, 151 Anm. 27, 199, 257259, 262, 280, 288 Anm. 266f., 291-294, 297-299, 301, 301-305 Regeln 10,11, 13, 21, 24, 27 Anm. 49, 2830, 33, 36, 70, 74, 79, 81, 100f., 108f., 111, 114-116, 126, 132, 136f., 160, 173, 179, 181, 193, 195, 197, 203, 205, 210, 214-217, 224, 236, 259, 281, 288, 290, 292, 294, 310, 312, 314 – Regelverstöße 80, 117, 163 Reichtum 18 Anm. 20, 79, 82, 86 Anm. 61, 98, 104 Anm. 121, 157f., 216, 274 – reich 104 Anm. 120, 218, 225 Reziprozität, reziprok 9, 29-31, 39, 41, 52, 54, 56, 58f., 63, 70 Anm. 20, 131, 161, 179, 185, 194, 206, 236, 240, 246, 251253, 255, 261f., 268-270, 277, 286, 305f., 311-313 Rhetorik, rhetorisch 13, 27 Anm. 47, 41, 93, 163, 166, 173, 209, 212, 231, 275f., 287, 294, 299, 303 Ritual 27 Anm. 49, 54 Anm. 46, 115, 130, 151 Anm. 26, 152 Anm. 32, 154 Anm. 36
Anhang – Ritualisierung, ritualisiert 30 Anm. 57, 41, 70 Anm. 20, 194 Anm. 6, 197, 265, 276 Anm. 229 Sanktion, sanktionieren 38, 44, 52, 97, 115, 155, 164, 176, 178, 183, 186f., 190-193, 198, 203, 215, 237, 250, 262, 266, 316, 318 Satisfaktionsfähigkeit, satisfaktionsfähig 182, 196 Anm. 13, 219, 236, 261 Scham 35 Anm. 66, 43-45, 58 Anm. 62, 75, 107f., 122, 165, 181 Anm. 65, 183-188, 191, 197 Anm. 16, 225 Anm. 89, 248 Anm. 149, – Schamkultur 45, 65 Anm. 4, 185-187 – Schamlosigkeit 181-183, 185, 187, 191 Schande 37f., 43f., 121f., 162, 166, 181192, 244 Anm. 142 Schiedsrichter 207, 278, 288 Schlägerei, Prügelei 203, 220f., 223 Anm. 82, 238, 244, 247, 249, 254 Schönheit, schön 64, 68f., 75, 82, 87 Anm. 65, 98, 109, 124 Anm. 193, 129, 134, 138 Anm. 136, 149 Anm. 20, 210, 276 Anm. 227 Schuld 45 Anm. 17, 186, 229 Anm. 103, 296 – Schulden 190, 251f., 254, 261 Anm. 197 – Schuldkultur 186 Selbstdarstellung 73, 96 Anm. 106, 104f., 141, 205, 208, 216f., 224, 227, 287 Selbstjustiz 29, 201 Anm. 26, 233 Sexualität 184 – sexuelle Ehre/Scham 152, 169, 177f., 184f., 205, 226, 319, 238 Anm. 128 – sexuelle Aggression 130 Anm. 203, 134, 169f. Sieg 32f., 44, 49, 52, 61-67, 69f., 72, 77-79, 81-87, 89f., 92-98, 105, 110, 114-125, 130 Anm. 204, 135, 137f., 140, 155-159, 203, 207f., 215, 217, 220f., 234, 313f. – Sieger, Gewinner 33, 50 Anm. 33, 62f., 66, 69, 71-73, 78 Anm. 44, 81-94, 99, 115f., 121-125, 129, 134, 159 Anm. 54, 215, 262, 288, 292, 302 – Siegerstatue 123 – Siegespreis, Siegesprämie 50f., 80f., 117, 208, 279 Sklaven 137, 144, 174, 177f., 221, 248 Anm. 152, 250f., 255, 258 Anm. 188, 260f. – Sklavinnen 145, 149, 258
353
Soziale Kontrolle 16, 20 Anm. 24, 43f., 112, 115, 152 Anm. 30 Soziale Mobilität 16, 79 Soziale Räume 17, 34, 106, 108, 110, 113, 141, 143f., 146f., 151f., 158, 160, 210, 227, 236, 279, 306f., 312, 315 Soziales Wissen 12 Anm. 7, 19, 28, 34, 37f., 47, 70, 81, 100, 144, 160, 169, 171, 177f., 180, 185, 192, 195, 201, 206, 217, 219f., 224 Anm. 84, 258, 262f., 271, 290f., 311f., 314, 316 Sozialisation 20 Anm. 24, 37, 115, 126, 147, 153, 160 Sparta 102 Anm. 114, 107 Anm. 129, 114, 118 Anm. 164, 120 Anm. 173, 157-159 Spiel 19 Anm. 23, 28, 33, 70-74, 115, 121, 127, 131 Anm. 207, 132 Anm. 209, 136138, 140, 147, 170, 181, 201, 205, 215 Sporen 129, 132, 135 Anm. 223 Sport 73f., 78, 80, 94 Anm. 96f., 106 Anm. 127, 126 Anm. 194, 155 Anm. 37, 266 Anm. 205 Spott, spotten 107, 128, 139, 221, 225 Anm. 89, 241f., 266, 290, 303 Anm. 311 Stadioniken 91 Anm. 80, 124 – Stadionlauf 90, 92 Anm. 87, 118, 153 Anm. 33 Status – Bürgerstatus 78, 116, 119, 145, 189, 204, 269, 308, 315 – Statusgleiche, Statusgleichheit 9, 102, 110, 135, 137 Anm. 231, 161, 273, 284f., s. auch Ebenbürtige – Statusinkongruenz 84, 99 – Statusmerkmal 63, 81, 150, 267, 274, 304f. – Statussymbol 133, 138 – Statusunterschied 101, 161f. Straße 17 Anm. 15, 35, 63, 77, 127, 203, 229, 234, 236, 243-246, 256, 258 Anm. 188, 262-265, 286f., 292, 307, 314, 316f. Stratege 82f., 93 Anm. 93, 105, 221, 277 Symbolisches Kapital 63, 141, 313 Symposion 247f. Tapferkeit 41f., 127, 129, 131 Anm. 204 und 206, 134 Thesmophoria 35f., 147-152, 160 Anm. 55 Timê, TIμ» 40, 189 Tradition, traditionell 17 Anm. 16, 22f., 7375, 86, 89f., 96, 98 Anm. 111, 102f., 106, 109, 126, 173, 178, 197, 200 Anm. 24, 233, 236, 281, 284, 293, 296, 308
354 Tragödie 146, 163, 165, 209, 280, 302 Anm. 305 Training, trainieren 67, 73 Anm. 30, 80, 85 Anm. 58, 87 Anm. 65, 102f., 106f., 116, 121, 132f., 156 Anm. 41 Transgression 24, 30, 37f., 55, 158, 170, 187, 226, 250, 315 Trauma ek pronoias, TRAàμA ™K PRONO…AJ 237f., 247 Trierarch, trierarchisch 204, 256f., 260-263, 274 Anm. 221, 276 Anm. 228, 285, 287292, 294 Typaion 111 Anm. 141, 155 Ungleichheit 11, 18f., 23 Anm. 32, 36-38, 54f., 63, 101, 134, 149, 151, 161-163, 179, 192, 218, 269, 273, 294, 296f., 304, 311, 315f. Unzivilisiert 74f. Urteil 10, 75, 78, 115, 119, 130, 179, 181, 184, 186, 189, 191, 198, 201, 208, 225, 237, 242, 250, 256f., 270f., 275, 285, 288, 293 Verbalisierung, verbalisieren 12, 126, 141, 163, 233, 270, 21, 297, 314, 316 Vergewaltigung 169 Verhalten – Verhaltensnorm, -erwartung 21, 24, 29f., 34, 37, 110, 118, 126, 156, 199, 213, 232, 237, 241 Anm. 132, 306, 309-311, 315 – agonales Verhalten cf. Agon – ehrenhaftes Verhalten cf. Ehre – exhibitionistisches Verhalten 34, 103, 134, 217, 266, 312, 316 – Konfliktverhalten cf. Konflikt – Verhaltensnorm, -erwartung 21, 24, 29f., 34, 37, 110, 118, 126, 156, 199, 213, 232, 237, 241 Anm. 132, 306, 309-311, 315
Anhang Vermögen 84 Anm. 56, 86 Anm. 61, 88, 90, 103, 105 Anm. 122, 132, 150, 152, 206, 216, 230, 267, 273, 274, 276 Anm. 228, 285, 293f., 298, 302, 313 – Vermögenstausch 247, 302 Anm. 305 Verwandte 74, 121, 147, 160, 219, 239 Anm. 122, 253 Anm. 167, 287 Visuell 45 Anm. 17, 53, 109, 124, 265f. Vorfahren 82 Anm. 53, 92, 96, 120, 155 Vormodern 15-17, 78f. Wachtel 66, 127 Anm. 196, 132f. Waffenlauf 118 Wagenrennen 50, 52, 80, 86, 102f., 105f., 114, 288f., 291f., 314 Wetteifern 66, 68 Anm. 16, 72, 102, 106, 110, 117, 123, 178, 277f., 292f., 312-315 Wetten 66, 131, 138 Wettkampf 52, 61f., 67-76, 81, 84, 87 Anm. 65, 95, 97 Anm. 110, 100-102, 109f., 114, 117 Anm. 161, 123 Anm. 187, 124, 141, 153 Anm. 33, 156-158, 161, 208 Anm. 37, 215f., 278 Anm. 233, 283, 288, 293, 297, 313 Wettstreit 45, 61, 67-69, 71, 76f., 83, 101, 103, 109f., 113f., 122, 136, 215-217, 291-294 Zanes, Zeusstatuen 97, 117 Zivilisation 74, 75, 77, 108 – Zivilisationsprozess 75, 108 – zivilisiert 22 Anm. 28, 74-76, 107, 216, 224 Anm. 84 Zuschauer 33, 36, 75, 95, 104, 109, 111, 114, 122 Anm. 185, 124f., 127, 137 Anm. 231, 138, 145, 155f., 215, 280 Anm. 242 Zweikampf 35, 53, 94f., 106, 213 Anm. 47
Historische Semantik Band 1: Egon Flaig Ritualisierte Politik
Band 6: Matthias Müller Das Schloß als Bild des Fürsten
Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom
Herrschaftliche Metaphorik in der Residenzarchitektur des Alten Reichs (1470–1618)
2. Auflage 2003. 288 Seiten, gebunden ISBN 3-525-36700-7 E. Flaigs innovative Studie behandelt politische Rituale, Gesten und Performanzen der römischen Senatoren und ihre Interaktion mit dem Volk.
Band 3: Mireille Schnyder Topographie des Schweigens Untersuchungen zum deutschen höfischen Roman um 1200 2003. 447 Seiten, gebunden ISBN 10: 3-525-36701-5 Grundmuster der Schweigewahrnehmung und ihre Darstellungsformen im deutschen höfischen Roman um 1200.
Band 4: Thomas Maissen Die Geburt der Republic Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft 2006. Ca. 654 Seiten mit 48 Abb., gebunden ISBN 3-525-36706-6 Thomas Maissen untersucht am schweizerischen Beispiel den Übergang vom Reichsverständnis und Reichsrecht zum westlichen Staats- und Völkerrecht und stellt die gesellschaftlichen Träger des Prozesses vor, der den souveränen Staat schuf.
2004. 560 Seiten mit 208 Abbildungen, gebunden ISBN 3-525-36705-8 Die ästhetische Vergegenwärtigung fürstlichen Regententums im Medium der Schlossbaukunst des Alten Reichs.
Band 7: Marion Oswald Gabe und Gewalt Studien zur Logik und Poetik der Gabe in der frühhöfischen Erzählliteratur 2004. 372 Seiten, gebunden ISBN 3-525-36707-4 Aus interdisziplinärer Perspektive wird der diskursive Zusammenhang von ›Gabe und Gewalt‹ untersucht.
Band 9: Christian Kiening Das wilde Subjekt Kleine Poetik der Neuen Welt 2006. 311 Seiten mit 32 Abbildungen, gebunden ISBN 10: 3-525-36709-0 ISBN 13: 978-3-525-36709-4 Eine nuancenreiche, gut lesbare Rekonstruktion des Prozesses, in dem die Neue Welt zum Terrain des Imaginären wurde.
Zum Weiterlesen empfohlen Carl Werner Müller Legende – Novelle – Roman Dreizehn Kapitel zur erzählenden Prosaliteratur der Antike 2006. IX, 509 Seiten mit 18 Abb., gebunden ISBN 10: 3-525-25756-2 ISBN 13: 978-3-525-25756-2 Die dreizehn Kapitel dieses Buches bilden eine Folge von Interpretationen narrativer Prosatexte der Antike vom sechsten Jahrhundert vor bis zum sechsten Jahrhundert nach Chr. An ausgewählten Beispielen werden in der Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen auf das menschliche Leben variierende Formen des Verhältnisses von Realität und Fiktionalität, von Wirklichkeit und Möglichkeit aufgezeigt.
Ernst Heitsch Platon und die Anfänge seines dialektischen Philosophierens 2004. 221 Seiten, kartoniert ISBN 10: 3-525-30145-6 ISBN 13: 978-3-525-30145-6 Ernst Heitsch zeigt in seiner Interpretation der frühen Dialoge Platons, dass diese ihren philosophischen Gehalt verschlüsselt darbieten und zum Weiterfragen anregen sollen. Folgende Dialoge werden interpretiert: Ion, Kleinerer Hippias, Laches, Gorgias, Protagoras, Charmides, Lysis, Euthy-
dem, Menon,Euthyphron, Apologie, Kriton, Phaidon. Anhang: Franz von Kutschera: Die Entdeckung der Ideen. »Ein Buch, das insbesondere dem philosophisch, aber auch den literarisch und historisch interessierten Leser reichlich belohnt und überdies ein gelungener Protreptikos zur Lektüre Platons!« Forum Classicum
Georg Rechenauer (Hg.) Frühgriechisches Denken 2005. 461 Seiten, gebunden ISBN 10: 3-525-30147-2 ISBN 13: 978-3-525-30147-0 Der Band präsentiert erstmals nach langer Zeit wieder ein umfassendes Spektrum frühgriechischen Denkens und Philosophierens für den deutschsprachigen Raum.
Bruno Snell Die Entdeckung des Geistes Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen 8., unveränderte Auflage 2000. 334 Seiten, kartoniert ISBN 10: 3-525-25731-7 ISBN 13: 978-3-525-25731-9 Das 1946 in 1. Auflage erschienene Buch gehört längst zu den Klassikern der Literatur zum antiken griechischen Denken.
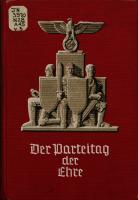


![Ehre und Beleidigungsfähigkeit von Verbänden [1 ed.]
9783428408627, 9783428008629](https://dokumen.pub/img/200x200/ehre-und-beleidigungsfhigkeit-von-verbnden-1nbsped-9783428408627-9783428008629.jpg)

![Die Ehre den Liedern der Troubadours [Reprint 2022 ed.]
9783112692943](https://dokumen.pub/img/200x200/die-ehre-den-liedern-der-troubadours-reprint-2022nbsped-9783112692943.jpg)
![Die Ehre und ihre Verletzbarkeit [1 ed.]
9783428561582, 9783428161584](https://dokumen.pub/img/200x200/die-ehre-und-ihre-verletzbarkeit-1nbsped-9783428561582-9783428161584.jpg)
![Die Ehre / Der Zweikampf: Zwei Vorträge. (Die Ehre und ihre Verletzbarkeit. 3. u. 4. Aufl. / Der Zweikampf und das Gesetz. 2. u. 3. Aufl.) [3 ed.]
9783428561599, 9783428161591](https://dokumen.pub/img/200x200/die-ehre-der-zweikampf-zwei-vortrge-die-ehre-und-ihre-verletzbarkeit-3-u-4-aufl-der-zweikampf-und-das-gesetz-2-u-3-aufl-3nbsped-9783428561599-9783428161591.jpg)


