Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts [1 ed.] 9783428548378, 9783428148370
Das Verständnis des Wahlrechts als subjektives Individualrecht ist fester Bestandteil der deutschen Literatur und Rechts
122 91 3MB
German Pages 306 Year 2019
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1393
Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts
Von
Katrin Verena Franz
Duncker & Humblot · Berlin
KATRIN VERENA FRANZ
Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1393
Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts
Von
Katrin Verena Franz
Duncker & Humblot · Berlin
Die Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen hat diese Arbeit im Jahr 2015 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
© 2019 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: 3w+p GmbH, Rimpar Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 978-3-428-14837-0 (Print) ISBN 978-3-428-54837-8 (E-Book) ISBN 978-3-428-84837-9 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Das Verständnis des Wahlrechts als Individualrecht ist fester Bestandteil der deutschen Literatur und Rechtsprechung. Es war auch Voraussetzung für die Erweiterung des Wahlrechts um materielle Gehalte durch das Bundesverfassungsgericht, durch die es weite Bereiche der Staatlichkeit über die Verfassungsbeschwerde rügefähig machte. Das Gesetz zur Verbesserung des Wahlrechtsschutzes aus dem Jahr 2012 unterstrich die individual-rechtliche Sichtweise auch des Gesetzgebers auf das Wahlrecht. Die Arbeit war zunächst als Abhandlung zu diesem Thema geplant. Die Beschäftigung hiermit machte jedoch deutlich, dass das Wahlrecht sich von den Grundrechten wesentlich unterscheidet, Literatur und Rechtsprechung die Eigenschaft dieses Rechts als grundrechtsgleiches Recht aber ganz überwiegend unhinterfragt annehmen. Die Rechtsnatur des Wahlrechts leitet sich aber aus der Stellung des Volkes als höchstes Staatsorgan in der Demokratie ab: Es ist ein Recht, das dem Einzelnen als Teil des Staatsorgans Volk zusteht, ein organschaftliches Recht. Die Arbeit wurde im Frühjahr 2015 von der Georg-August-Universität als Dissertation angenommen. Das Manuskript befindet sich auf dem Stand vom Februar 2015, vereinzelt wurden Literatur und Rechtsprechung bis September 2017 berücksichtigt. Großer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Frank Schorkopf für die Anregung des Themas, sein Bestärken in der Entwicklung der eigenen These, die der herrschenden Meinung diametral entgegenläuft, seine stete Diskussionsbereitschaft, die Freiräume, die er mir als wissenschaftlicher Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl für die Anfertigung der Arbeit gelassen hat, sowie für die rasche Begutachtung. Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Werner Heun gilt mein Dank insbesondere für die treffende und wertvolle Kritik in der Zweitbegutachtung. Der Stiftung der Deutschen Wirtschaft danke ich für die großzügige Gewährung eines Promotionsstipendiums, dem Deutschen Bundestag für die Unterstützung bei der Veröffentlichung der Arbeit. Mein herzlicher Dank gilt denen, die die Entstehung der Arbeit als Diskussionspartner, durch Anregungen zum Manuskript oder auf andere Art gefördert haben. Vor allem danke ihnen ich für die moralische Unterstützung, ohne die diese Arbeit nicht entstanden wäre. Berlin, im Spätsommer 2017
Katrin Verena Franz
Inhaltsverzeichnis A. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I. Problemstellung und Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 II. Terminologische Grundannahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1. Unterscheidung zwischen subjektivem und objektivem Wahlrecht . . . . . . . . . 17 2. Der Begriff des subjektiven Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa in unterschiedlichen historischen Kontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I. Historische Deutung des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Französische Lehre nach 1789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Englische Lehre ab 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Deutsche Staatslehre ab 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 a) Verfassung des Deutschen Reiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 b) Weimarer Reichsverfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4. Schweizer Lehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 II. Kategorisierung der Ansichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. Individual-rechtliche Theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2. Funktionale Theorien/Organtheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3. Dualistische Theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 III. Schlussfolgerungen für den weiteren Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . 47 C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 D. Die überwiegend individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht in der Literatur und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts . . . . . . . . . . . . . 56 I. Kategorisierungen des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1. Das Wahlrecht als politisches/demokratisches Grundrecht . . . . . . . . . . . . . . . 59 2. Das Wahlrecht als Recht des „status activus“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. Das Wahlrecht als Teilhaberecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4. Das Wahlrecht als Zusammensetzung aus Abwehr- und Leistungsrechten . . . 65
8
Inhaltsverzeichnis II. Nicht ausschließlich individual-rechtliche Auffassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Das Wahlrecht zugleich als „Bewirkungsrecht“ und Organkompetenz . . . . . . 68 2. Das Wahlrecht zwischen organschaftlichem Recht und Individualrecht . . . . . 69 III. Uneinheitliche normative Anknüpfung des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 IV. Inhalt des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1. Unklarheiten über den Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2. Die Wahlgrundsätze als eigene Individualrechte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3. Recht auf tatsächliche Einflussnahme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 a) Die Wirkung von Wählerstimmen in unterschiedlichen Wahlsystemen . . . 82 aa) Die Wirkung von Wählerstimmen im Mehrheitswahlsystem . . . . . . . . 83 bb) Die Wirkung von Wählerstimmen im Verhältniswahlsystem . . . . . . . . 84 b) Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1. Herleitung aus dem Wortlaut des Art. 38 Abs. 2 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2. Herleitung aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3. Herleitung aus der Menschenwürde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4. Herleitung aus dem Grundsatz der freien Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5. Herleitung aus dem Demokratieprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 VI. Gründe für die individual-rechtliche Betrachtung des Wahlrechts . . . . . . . . . . . 99 1. Sprachliche Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2. Vermischung bürgerlicher Freiheitsrechte und staatsbürgerlicher Mitwirkungsrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3. Uneindeutigkeit des Begriffs „Bürger“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 VII. Ergebnis zur individual-rechtlichen Sicht der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1. Keine Aufzählung des Wahlrechts im Grundrechtsteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2. Wechselbezügliche Abhängigkeit des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3. Keine Rückführbarkeit der Wählerstimme auf den Wähler . . . . . . . . . . . . . . 105 4. Rechtsträgerschaft erst ab Beginn der Rechtsmündigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5. Ausschlussmöglichkeit vom Wahlrecht wegen strafgerichtlicher Verurteilung 110 6. Die Aberkennung des Wahlrechts nach Art. 18 GG i. V. m. § 39 Abs. 2 BVerfGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 7. Strafbarkeit der Wählerbestechung nach § 108b StGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 8. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Inhaltsverzeichnis
9
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes . . . . . . . . . . . . . . 116 I. Das Volk als Staatsorgan in der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 II. Das Volk als Staatsorgan in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 119 III. Organschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 IV. Staatsorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Das Volk als nicht-staatliche, gesellschaftliche Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2. Das Volk als pouvoir constituant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3. Das Volk als pouvoir constitué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 a) Das Volk als Träger der Staatsgewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 b) Das Volk in der Ausübung von (innerstaatlicher) Staatsgewalt: die Aktivbürgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 c) Künstliches Auseinanderfallen von Volk und Aktivbürgerschaft aufgrund der unzureichenden Verwirklichung des Grundsatzes der allgemeinen Wahl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 d) Das Volk in Wahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 e) Das Volk in Abstimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 VI. Handeln des Volkes für den Staat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 1. Handeln des Volkes für sich selbst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2. Rechtsqualität der Entscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3. Legitimation der Staatsgewalt durch kontinuierliches Rechtssubjekt . . . . . . . 151 VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes . . . . . . . . . 152 1. Handlungsunfähigkeit des Volkes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. Uneinheitlichkeit des Volkswillens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 a) Unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Volkswillen“ . . . . . . . . . . . . . 156 b) Gesellschaftliche Willensbildung keine Volkswillensbildung . . . . . . . . . . . 156 c) Volkswille als Staatswille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 d) Volkswille ist vermittlungsbedürftig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 e) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3. Unvereinbarkeit der souveränen Stellung des Volkes mit einer staatsorganschaftlichen Stellung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 VIII. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 IX. Eigenschaften des Staatsorgans Volk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1. Gleichordnung des Volkes mit den obersten Staatsorganen? . . . . . . . . . . . . . 167 2. Das Volk als ständiges Organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3. Abhängigkeit des Volkes von seinen Organwaltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
10
Inhaltsverzeichnis 4. Die Gesellschaft als „Forum“ des Volkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 X. Rechte des Volkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
F. Der Einzelne im Wahlakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 I. Das Wahlrecht des einzelnen Bürgers als Recht der gesellschaftlichen Sphäre? 176 II. Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Die demokratische Freiheitsidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Die Metamorphose von der individuellen Freiheit zur demokratischen Freiheit des Einzelnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Notwendigkeit von individueller Freiheit neben der demokratischen Mitwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1. Der Amtsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2. Gemeinwohlbindung des Wählers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 a) Bindung an ein vorher bestimmtes Gemeinwohl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 b) Bildung des Gemeinwohls durch Kumulierung der Individualinteressen? 191 c) Bildung des Gemeinwohls durch Kumulierung der individuellen Vorstellungen vom Gemeinwohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 d) Einbeziehung welcher Interessen in das Gemeinwohl? . . . . . . . . . . . . . . . 197 e) Ergebnis zur Gemeinwohlbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3. Organisatorisches Amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1. Der Grundsatz der gleichen Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 2. Der Grundsatz der unmittelbaren Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3. Der Grundsatz der freien Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4. Der Grundsatz der geheimen Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 5. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 a) Vergleichbarkeit der Allgemeinheit der Wahl mit anderen Rechten des „status activus“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 b) Umfang des Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 c) Abstraktes Recht des Einzelnen auf Mitwirkung an der Staatsgewalt . . . . 210 6. Normative Anknüpfung des Wahlrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 V. Verhältnis der Rechte der Aktivbürgerschaft zu den Rechten des Aktivbürgers 211 VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1. Wahlpflicht aus der Rechtsnatur des Wahlrechts ableitbar? . . . . . . . . . . . . . . 217 2. Verstoß gegen die (negative) Wahlfreiheit oder das Wesen des Wahlrechts?
219
Inhaltsverzeichnis
11
3. Verstoß gegen das Demokratieprinzip? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 4. Verletzung von Grundrechten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 a) Verletzung von Grundrechten durch faktischen Eingriff durch die Pflicht, zur Wahl zur gehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 b) Verletzung von Grundrechten durch direkten Eingriff durch die Pflicht, zur Wahl zu gehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 c) Verletzung von Grundrechten durch die Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 aa) Geltung der Grundrechte bei der Stimmabgabe? . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 bb) Verstoß gegen Freiheitsrechte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 cc) Verstoß gegen die Menschenwürde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 dd) Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 VII. „Verschmelzung“ von grundrechtlichem und staatsrechtlichem Status des Wählers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 G. Prozessuale Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 1. Die Wahlprüfungsbeschwerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 a) Die Wahlprüfungsbeschwerde bis zum „Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 b) Kritik der Literatur am Verfahrensgegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 c) Änderungen der Wahlprüfungsbeschwerde vom 12. 07. 2012 . . . . . . . . . . . 247 2. Die Verfassungsbeschwerde als Rechtsbehelf in Wahlrechtsfragen . . . . . . . . 248 a) Die Verfassungsbeschwerde als „Popularklage“ in Wahlrechtsfragen . . . . 249 b) Weitere Friktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung . . . . . . . . 254 1. Das Organstreitverfahren als einschlägiger Rechtsbehelf . . . . . . . . . . . . . . . . 254 a) Parteifähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 aa) Parteifähigkeit des Volkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 bb) Prozessstandschaft für das Volk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 cc) Parteifähigkeit des wahlberechtigten Bürgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 b) Antragsgegenstand und Antragsgegner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 aa) Erlass eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 bb) Nichterlass eines Wahlgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 cc) Nichtanordnung von Neuwahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 dd) Entleerung der Herrschaftsgewalt des Volkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
12
Inhaltsverzeichnis ee) Nichtzulassung zur Wahl (Nichtausstellen eines Wahlscheins / Nichteintragung in das Wählerverzeichnis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 c) Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2. Bewertung des Wahlprüfungsverfahrens und der Änderung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe vor diesem Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3. Die Verfassungsbeschwerde als Rechtsbehelf zur Durchsetzung des Grundsatzes der allgemeinen Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 III. Ergebnis zu den prozessualen Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
H. Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
A. Einleitung I. Problemstellung und Gang der Untersuchung Das Wahlrecht sei „das vornehmste Recht des Bürgers in der Demokratie“, so formulierte das Bundesverfassungsgericht in einer seiner ersten Entscheidungen.1 Damit legte es den Grundstein für eine individual-rechtliche Perspektive auf das Wahlrecht in der grundgesetzlichen Ordnung. Das Recht des Bürgers, an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilzunehmen, erscheint so vornehmlich als Recht, das diesem zur freien Ausübung zur Verfügung steht. Mit der Ausübung des Wahlrechts verwirklicht der Bürger aber nicht primär seine persönliche Freiheit. Er nimmt an einem staatsorganisationsrechtlichen Kreationsakt teil: der Wahl zum Deutschen Bundestag. Durch seine Rechtsausübung wirkt der Einzelne in den Staat hinein, er verbleibt nicht im Bereich individueller Freiheit. Das Wahlrecht bietet damit einen doppelten Interpretationszugang: Vom Einzelnen her gedacht erscheint es als Recht, das die Mitbestimmung am Gemeinwesen verwirklicht. Aus Sicht der Staatsorganisation ist es Voraussetzung für die Kreation des Bundestages. Das Wahlrecht bewegt sich damit an der Schnittstelle zwischen staatlicher Sphäre und Individualsphäre.2 Entsprechend diesem doppelten Zugang wurde die Rechtsnatur des Wahlrechts in der geschichtlichen Entwicklung unterschiedlich beurteilt.3 Rudolf Smend bezeichnete die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts 1912 als „alte und immer neue Streitfrage“.4 Zum einen wurde es als subjektives Individualrecht gesehen, also als Recht, das dem Einzelnen zur Selbstentfaltung gewährleistet ist und ihm deshalb zur freien Verfügung steht. Zum anderen wurde es aber auch als organschaftliches Recht – als Organkompetenz – charakterisiert, also als Recht, innerhalb eines Staatsorgans als dessen Teil zu wirken. Mit der zweiten Ansicht geht einher, das Volk 1
BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1951. Den Schnittstellencharakter betont S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 458, Fn. 609. Dem Wahlrecht wird auch eine „Scharnierfunktion“ zwischen Staat und Gesellschaft zugeschrieben, so U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (437). 3 Hierzu ausführlich unten in Abschnitt B., S. 22 ff. 4 R. Smend, Maßstäbe des parlamentarischen Wahlrechts (1912), in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 1955, S. 19 (37, Fn. 18). 2
14
A. Einleitung
in der Demokratie als Staatsorgan anzuerkennen. Zudem fanden und finden sich Auffassungen, die das Wahlrecht zugleich als individuelles Recht und als organschaftliches Recht sehen und es damit als Hybrid betrachten. Die Ansichten spiegeln die unterschiedlichen Perspektiven auf das Wahlrecht wider. Wird das Wahlrecht als subjektives Individualrecht eingeordnet, treten der einzelne Bürger und die Verwirklichung seiner Freiheit durch Mitbestimmung an Entscheidungen, die das Gemeinwesen betreffen, in den Vordergrund. Das Wahlrecht ist von diesem Standpunkt aus das Recht, das primär die Selbstbestimmungsmöglichkeit des Einzelnen sicherstellen will, indem es dem Bürger ein Recht auf Teilhabe an den Entscheidungen über Belange der Allgemeinheit gibt. Wird das Wahlrecht hingegen als organschaftliches Recht betrachtet, wird der staatsorganisationsrechtlichen Funktion, die das Volk und damit der einzelne Bürger als dessen Teil durch die Wahl in der Demokratie erfüllt – das Parlament zu wählen –, Rechnung getragen. Es ist dann nicht der Einzelne, sondern das Volk, das bei der Betrachtung des Wahlrechts im Mittelpunkt steht. Außerdem rückt aus dieser Perspektive die Gemeinschaftsbezogenheit des Wahlrechts in den Vordergrund. Denn das Wahlrecht kann nur in Gemeinschaft ausgeübt werden und bezieht sich auch auf diese. Ebenso wird das Wahlrecht erst in der Gemeinschaft erforderlich, weil nur hier der Einzelne nicht mehr ausschließlich über sich selbst herrschen kann, sondern staatliche Ordnung eine Staatsgewalt erfordert, die immer die Herrschaft über eine Vielzahl von Personen beinhaltet. In der grundgesetzlichen Ordnung wird das Wahlrecht sowohl von der Literatur als auch vom Bundesverfassungsgericht ganz überwiegend als subjektives Individualrecht betrachtet.5 Die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts wird damit von den meisten Autoren zugunsten eines subjektiven Rechts entschieden. Die Ansicht speist sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass Art. 38 GG, in dem die Wahl zum Deutschen Bundestag normiert ist, im Katalog derjenigen Rechte aufgezählt ist, deren Verletzung mit der (Individual-)Verfassungsbeschwerde gerügt werden kann.6 Diese materiell-rechtliche Bewertung hat also einen prozessrechtlichen Ursprung. Der Einzelne wird, indem er in die Lage versetzt wird, eine Verletzung des Wahlrechts zu rügen, befugt, staatsorganisationsrechtliche Akte und Normen zu rügen.7 Gerade die prozessuale Dimension einer subjektiv-rechtlichen Einordnung dieses sich auf die Staatsorganisation beziehenden Rechts wie auch die Probleme, die sich daraus ergeben, werden in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besonders deutlich. Je weiter die subjektiv-rechtlichen Gewährleistungen, die durch das Wahlrecht verbürgt sein sollen, gefasst werden, desto weiter reicht auch der 5 Siehe hierzu unten in Abschnitt D., S. 56 ff. Nach B. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 148, wird diese Ansicht in Rechtsprechung und Literatur sogar „einstimmig für richtig gehalten […]“. 6 Siehe Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG. 7 A. Wolf, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils, 1999, S. 192 f.; M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 326 f.
I. Problemstellung und Gang der Untersuchung
15
prozessuale Einfluss des Wahlberechtigten auf die Staatsorganisation. So wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Wahlrecht materiell mit weiteren Gehalten wie einem Recht auf Demokratie, also auf wirksame Volksherrschaft, sowie auf Einhaltung des Sozialstaatsprinzips und sogar auf den Erhalt der Staatlichkeit angereichert.8 Dies geschieht gerade, um den Einzelnen in die Lage zu versetzten, diese Rechte als eine Verletzung des Wahlrechts auch prozessual zu verteidigen.9 Diese materielle Anreicherung hat in der Literatur wenig Zustimmung erfahren;10 überwiegend wurde sie kritisiert,11 insbesondere auch im Hinblick auf die prozessuale Möglichkeit, die dem Einzelnen hiermit eingeräumt wird, die Staatsorganisation an sich zu verteidigen. Während die Kritik der Literatur an der Ausweitung des Gewährleistungsgehalts des Wahlrechts ansetzt, gibt diese Entwicklung jedoch Anlass, zu überprüfen, ob das Wahlrecht in einem individual-rechtlichen Rechtsbehelf richtig verortet ist. Da das Prozessrecht gegenüber dem materiellen Recht eine prinzipiell dienende Funktion einnimmt,12 stellt sich mit anderen Worten die Frage, ob das Wahlrecht unter dem Grundgesetz tatsächlich ein subjektives Individualrecht ist. Ohne dass unter Geltung des Grundgesetzes je eine Diskussion über die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts stattgefunden hätte, wurde sie schon als zugunsten eines subjektiven Rechts geklärt bezeichnet.13 Dieser These wurde wenig
8 BVerfGE 89, 155 (171 f.) – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993; BVerfGE 123, 267 (330 f.) – Lissabon, Urteil vom 30. 6. 2009; BVerfGE 129, 124 (168 f.) – EFS, Beschluss vom 7. 9. 2011. 9 So auch C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit“ und Bundesstaatsverbot, Der Staat 34 (2009), S. 535 (540); C. Tomuschat, Die Europäische Union unter Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 1993, S. 489 (493); (dem jeweils ablehnend gegenüberstehend). 10 Zustimmend aber D. Murswiek, Art. 38 GG als Grundlage eines Rechts auf Achtung des unabänderlichen Verfassungskerns, JZ 2010, S. 702 (704, 707); K. F. Gärditz/C. Hillgruber, Volkssouveränität ernst genommen – Zum Lissabonurteil des BVerfG, JZ 2009, S. 872 (873); D. Grimm, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union, Der Staat 2009, S. 475 (480 f.). 11 U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (430 f.); C. Tomuschat, Die Europäische Union unter Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 1993, S. 489 (493); J. Kokott, Deutschland im Rahmen der Europäischen Union – Zum Vertrag von Maastricht, AöR 119 (1994), S. 207 (210 f.); C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit“ und Bundesstaatsverbot, Der Staat 2009, S. 535 (541); M. Jestaedt, Warum in die Ferne streifen, wenn der Maßstab liegt so nah?, Der Staat 2009, S. 497 (503 f.). 12 E. Klein, Verfassungsprozeßrecht, AöR 108 (1983), S. 560 (562 ff.); A. Kollmann, Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht, 1996, S. 658. 13 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 582, Fn. 447.
16
A. Einleitung
entgegengesetzt.14 Sie wurde im Gegenteil nicht nur durch Literatur und Bundesverfassungsgericht, sondern auch durch den Gesetzgeber weiter gestärkt. Dieser hat den Rechtsschutz des subjektiven Wahlrechts ausgedehnt, indem er die Wahlprüfungsbeschwerde auch zur Überprüfung der Verletzung des Wahlrechts des einzelnen Bürgers durch Wahlverfahrensakte geöffnet hat.15 Aufgrund der Entwicklung der Subjektivierung des Wahlrechts und damit einhergehend fast des gesamten Staatsorganisationsrechts16 ist es jedoch angezeigt, diese These kritisch zu hinterfragen. Hierfür soll zunächst ein Einblick in die Behandlung des Wahlrechts in früheren Epochen gegeben werden, um aufzuzeigen, dass um diese Frage seit langer Zeit eine Kontroverse besteht, und so den historischen Kontext der Frage zu beleuchten. Aus diesem werden im Folgenden auch Argumente fruchtbar gemacht, die in der gegenwärtigen Literatur oftmals keine Berücksichtigung mehr gefunden haben. Sodann soll der Blick auf das Grundgesetz gerichtet werden. Hierzu werden zunächst die Diskussionen im Parlamentarischen Rat, die die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts tangieren, nachgezeichnet. Daraufhin wird die Sichtweise der Literatur und des Bundesverfassungsgerichts auf das Wahlrecht – die ganz überwiegend eine subjektiv-rechtliche ist – dargestellt. Diese Auffassung soll dann kritisch beleuchtet werden, indem eine vom Volk ausgehende Denkweise zugrunde gelegt wird. Denn das Wahlrecht des Bürgers besteht nicht isoliert, sondern immer ist es das gesamte Volk, das zur Wahl berufen ist.17 Es wird die Frage zu klären sein, welche Rolle das Volk in der grundgesetzlichen Ordnung innehat. Dabei wird dann zu zeigen sein, dass die Rolle des Volkes bei der Wahl diejenige eines Staatsorgans ist. Hieraus soll dann eine Antwort auf die Frage nach der Stellung des Einzelnen in der Demokratie und im Wahlakt und damit der Rechtsnatur des Wahlrechts des einzelnen Bürgers gefunden werden. Aus dieser rechtlichen Einordnung lässt sich dann eine Antwort auf die Frage finden, wessen Interesse der Wahlberechtigte bei der Ausübung seines Wahlrechts zu berücksichtigen hat: nur sein eigenes oder das Interesse der Allgemeinheit? Von diesen Überlegungen ausgehend soll auch die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht beantwortet werden. Zuletzt lassen sich zudem Schlussfolgerungen für das Prozessrecht ziehen. Welche Rechtsmittel sind geeignet, Verletzungen des Wahlrechts zu rügen?
14 In der neueren Literatur wendet sich nur S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (89), entschieden dagegen. 15 Siehe Art. 2 und 3 des Gesetzes zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. 7. 2012 (BGBl. I S. 1501). 16 Hierzu auch S. Recker, Subjektivierung der Staatsstruktur, 2014, S. 149 ff. 17 Genauer gesagt, die Aktivbürgerschaft, also der wahlberechtigte Teil des Volkes, siehe hierzu unten in Abschnitt E. V. 3. b), S. 137 ff.
II. Terminologische Grundannahmen
17
II. Terminologische Grundannahmen Das unterschiedliche Verständnis des Begriffs „subjektives Recht“ macht es erforderlich, die in der Arbeit verwendete Bedeutung zu klären. Die Begriffe des subjektiven Rechts und des organschaftlichen Rechts sind deshalb terminologisch abzugrenzen, weil insbesondere dem Begriff „subjektives Recht“ ein unterschiedlicher Bedeutungsgehalt zugemessen wird.18 Aber auch der Begriff „Wahlrecht“ ist uneindeutig und soll deshalb zunächst erläutert werden.
1. Unterscheidung zwischen subjektivem und objektivem Wahlrecht Das Wort „Recht“ hat im Deutschen zwei unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen wird es gebraucht, um die objektive Rechtsordnung zu beschreiben, zum anderen wird es im Sinne einer individuellen Berechtigung, als Rechtsmacht des Einzelnen verstanden.19 Während manche Sprachen hierfür unterschiedliche Begriffe verwenden, das Englische etwa die Begriffe „law“ and „right“, und damit bereits durch die Wortwahl deutlich machen, ob von der objektiven Rechtsordnung oder einer subjektiven Berechtigung die Rede ist, geht dies im Deutschen erst aus dem Kontext hervor.20 So ist auch beim Gebrauch des Wortes „Wahlrecht“ unklar, ob die Berechtigung des einzelnen Wählers zu wählen gemeint ist oder die objektiven Regelungen über das Wahlrecht, wie sie z. B. in den Begriffen „Mehrheitswahlrecht“ oder „Verhältniswahlrecht“ gebraucht werden.21 Für den Teil des (objektiven) Wahlrechts, der die Umsetzung von Stimmen in Mandate regelt, hat sich auch der Begriff „Wahlsystem“22 herausgebildet, der aber weniger etabliert ist als der Begriff „Wahlrecht“. Aus dieser Bedeutungsmehrheit ergeben sich bisweilen Unklarheiten, in welchem Sinn der Begriff gebraucht wird, zumal sowohl das objektive Wahlrecht 18 H. Bauer, Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 1986, S. 136 f.; A. Scherzberg, Grundlagen und Typologie des subjektiv-öffentlichen Rechts, DVBl. 1988, S. 129 (132); S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 276: „Kaum eine Rechtsfigur liegt derart im dichten Nebel aus Fragezeichen, Kontroversen, theoretischen wie terminologischen Divergenzen und unübersichtlicher Kasuistik.“ 19 So auch A. Scherzberg, Grundlagen und Typologie des subjektiv-öffentlichen Rechts, DVBl. 1988, S. 129 (129); H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, 1979, hrsg. von K. Ringhofer und R. Walter, S. 111, hält die Bezeichnung einer durch das objektive Recht verliehenen Rechtsmacht als „Recht“ für irreführend. 20 So allerdings auch im Französischen (droit), Spanischen (derecho) und Italienischen (diritto). 21 Die Doppeldeutigkeit des Wortes heben auch J. Krüper, Wahlrechtsmathematik als gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, JURA 2013, S. 1147 (1147 f.), und T. Spies, Die Schranken des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland, 1979, S. 2 f., hervor. 22 Z. B.: W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 109. Zum Begriff des Wahlsystems H. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1996, S. 153 ff.
18
A. Einleitung
als auch das subjektive Wahlrecht in Art. 38 GG ihren einzigen Anknüpfungspunkt im Grundgesetz finden. Außerdem hängen sie insoweit zusammen, als das objektive Wahlrecht, das Wahlsystem, die Berechtigung des Einzelnen zu wählen ausgestaltet. Es legt die Modalitäten fest, nach denen der Wähler wählt, und es bestimmt, inwieweit seine Stimme Einfluss auf das Wahlergebnis nimmt. Insofern sind das Wahlsystem und die Berechtigung des einzelnen Wahlberechtigten zu wählen, untrennbar miteinander verbunden;23 subjektives Wahlrecht und objektives Wahlrecht sind eng verknüpft. Wird in dieser Abhandlung der Begriff „Wahlrecht“ gebraucht, ist die Berechtigung des Einzelnen zu wählen gemeint, die den Gegenstand der Arbeit bildet.
2. Der Begriff des subjektiven Rechts Soll die Frage geklärt werden, ob das Wahlrecht ein subjektives Recht ist, bedarf es der Klärung der Frage, ob subjektive Rechte nur solche Rechte sein können, die Individuen zustehen. Zunehmend wird der Begriff des subjektiven Rechts auch für die Befugnisse von Organen benutzt,24 während insbesondere die frühere Staatsrechtslehre von einer strengen Dichotomie von subjektiven Rechten und Organkompetenzen ausging.25 Diese Ansicht wird jedoch auch in der jüngeren Literatur noch vertreten.26 Organkompetenzen und subjektive Rechte werden dann als so wesensverschieden betrachtet, dass jene keinesfalls als subjektive Rechte anzuerkennen seien.27 Eine Gleichsetzung von subjektiven Rechten und Organrechten wird für grundsätzlich ausgeschlossen gehalten, weil Organrechte sich durch ihren
23 Ähnlich W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (518); dies gilt allgemein für subjektives und objektives Recht, hierzu A. Scherzberg, Grundlagen und Typologie des subjektiv-öffentlichen Rechts, DVBl. 1988, S. 129 (129 f.). 24 M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, S. 94, Rn. 305; D. Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, 2000, § 25 Rn. 5; C. Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, 1991, § 7 II Rn. 29, S. 113, setzt das „subjektiv“ in diesem Zusammenhang allerdings in Klammern. 25 So R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 397. 26 Zur Unübersichtlichkeit der Diskussion über „das Wahlrecht“ trägt bei, dass in diesem Zuge auch dann, wenn im Wahlrecht eine Organkompetenz gesehen wird, diese aber nicht als subjektiv-rechtlich anerkannt wird, von „objektiv-rechtlichen“ Gehalten des Wahlrechts gesprochen wird. So etwa von A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 190 f.; M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 254. 27 H. H. Rupp, Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, 1991, S. 100; R. Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre, 1983, S. 68 f.; H.-U. Erichsen, Der Innenrechtsstreit, in: Festschrift für Menger, S. 211 (226); W. Krebs, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, in: Festschrift für Menger, S. 191 (209); G. Jellinek, System subjektiver Rechte, S. 227: „Die Kompetenz ist aber niemals subjektives, sondern stets objektives Recht.“
II. Terminologische Grundannahmen
19
apersonalen Charakter und ihre Pflichtenorientierung auszeichneten,28 während subjektive Rechte Ausdruck der Individualität und des freien Beliebens des Rechtsinhabers seien.29 Das subjektive Recht sei dem Einzelnen gerade um seiner selbst willen verliehen,30 und damit Ausdruck individueller Freiheit. Dagegen seien Kompetenzen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben und somit zweckgebunden verliehen. Mit ihnen solle nicht dem eigenen Interesse der Rechtsausübenden, sondern dem des Staates gedient werden.31 Die Befugnis zur Ausübung einer Kompetenz lässt sich jedoch ebenfalls als Recht bezeichnen. Auch das Bundesverfassungsgericht bezeichnet aus Kompetenzen folgende Befugnisse als „Recht“.32 Rechte von Organen lassen sich als organschaftliche Rechte bezeichnen, weil sie dem Organ oder Teilorgan in dieser Eigenschaft zustehen.33 Es finden sich auch vermehrt Stimmen in der Literatur, die organschaftliche Rechtspositionen als subjektiv-öffentliche Rechte beschreiben und die Unterscheidung zwischen subjektiven Rechten und organschaftlichen Rechten weitgehend aufgeben.34 Diese wird als „fruchtlose Antithetik“35 empfunden. Wolfgang Roth kommt das Verdienst zu, den Begriff des subjektiven Rechts näher herausgearbeitet zu haben. So zeigt er die Unzulänglichkeit überkommener Theorien wie der Willens-36 und Interessentheorie sowie des häufig angesetzten Kriteriums 28
R. Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre, 1983, S. 68 f.; E-W. Böckenförde, in: Festschrift für Wolff, S. 269 (303); R. Wahl, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO-Kommentar, Vorb. Art. 42 Abs. 2 Rn. 120. 29 R. Wahl, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO-Kommentar, Vorb. Art. 42 Abs. 2 Rn. 120. 30 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 400; H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 31 f. 31 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 65; E.-W. Böckenförde, Organ, Organisation, Juristische Person, in: Festschrift für Wolff, S. 269 (303); H. J. Wolff/ O. Bachof, Verwaltungsrecht, Bd. II, 4. Aufl., 1976, § 72 I c 5, S. 17, § 73 III c 2, S. 38. 32 BVerfGE 2, 143 (152) – EVG-Vertrag, Urteil vom 7. 3. 1953; BVerfGE 96, 231 (240 f.) – Müllkonzept, Beschluss vom 9. 7. 1997. 33 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 129, weist jedoch darauf hin, dass nicht alle organschaftlichen Rechte als „Kompetenzen“ bezeichnet werden können. So z. B. diejenigen Rechte des Abgeordneten, die lediglich seinen Status absichern, wie beispielsweise Immunitäts- und Indemnitätsrechte. 34 So z. B. H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 63 Rn. 7, § 90 Rn. 84; C. Hillgruber, in ders./Goos, Verfassungsprozessrecht, 2011, Rn. 22; D. Diemert, Der Innenrechtsstreit, 2002, S. 186 f., 192 f.; insbesondere bei Innenrechtsstreitigkeiten ist die Zuerkennung subjektiver Rechte von Belang; kritisch aber W. Löwer, Zuständigkeiten und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts, in: HStR, Bd. III, 2005, § 70 Rn. 9; U. Müller/K.-G. Mayer/L. Wagner, Wider die Subjektivierung objektiver Rechtspositionen im Bund-Länder-Verhältnis, Verwaltungsarchiv 93 (2002), S. 585 (590); die Unterscheidung zwischen subjektiven Rechten und Kompetenzen, die als Organrechte verstanden werden, bejahend auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 58 ff. 35 H. Bethge, Grundfragen innerorganisationsrechtlichen Rechtsschutzes, DVBl. 1980, S. 309 (312). 36 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 347 ff.
20
A. Einleitung
der Rechtsmacht37 auf. Diese erfassten zwar überwiegend die Eigenschaften von subjektiven Rechten, kennzeichneten diese aber nicht ausschließlich, weil sich stets auch Beispiele subjektiver Rechte finden ließen, die das jeweilige Definitionskriterium nicht erfüllen.38 Deshalb lasse sich das subjektive Recht anhand dieser materiellen Kriterien nicht beschreiben. Aufgrund des Scheiterns des Versuchs, das subjektive Recht materiell zu charakterisieren, entwickelt er einen formalen Begriff des subjektiven Rechts.39 Er definiert dasjenige Recht als subjektives, „das einen ausübbaren Inhalt hat und durch Rechtssatz einem Rechtssubjekt zur grundsätzlich alleinigen und alle anderen ausschließenden Ausübung sowie erforderlichenfalls Geltendmachung zugewiesen ist“.40 Unter diesen Begriff lassen sich dann nicht nur Rechte von Individuen fassen, die diesen um ihrer selbst willen verliehen sind, sondern gerade auch Rechte von Organen, die diesen innerhalb der staatlichen Ordnung gegenüber anderen Organen zustehen.41 Letztlich wird damit der Streit, ob organschaftliche Rechte auch subjektive Rechte sind, vor allem zu einem Streit terminologischer Natur.42 Organschaftliche Rechte lassen sich ihrer Rechtstechnik nach auf diese Weise als subjektive Rechte bezeichnen, unzweifelhaft unterscheiden sich diese subjektiven Rechte der Organe aber von den personalen, individuellen Rechten der Bürger,43 zu denen insbesondere die Grundrechte zählen. Diese zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie um des Individuums willen bestehen und seine individuelle Rechtssphäre zu schützen bestimmt sind. Es soll hier deshalb eine Unterscheidung zwischen organschaftlichen Rechten und solchen Rechten des Einzelnen, die die diesem um seiner selbst willen verliehen sind, vorgenommen werden. Diese sollen als Individualrechte bezeichnet werden. 37 So z. B. vertreten durch L. Enneccerus/H. C. Nipperdey, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd. I/1, 1959, § 72, S. 428 ff. 38 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 347 ff. 39 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 419 f. 40 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 421. 41 Indes gibt es auch Vertreter, die zwar subjektive organschaftliche Rechte anerkennen, jedoch nicht jedes organschaftliche Recht als subjektives Recht qualifizieren, sondern hierfür gesonderte Kriterien anlegen. So z. B. G. Kisker, Insichprozeß und Einheit der Verwaltung, 1968, S. 37 f.; ders., Organe als Inhaber subjektiver Rechte, JuS 1975, S. 704 (704), der die Eigenschaft als „Kontrastorgan“ voraussetzt. 42 So auch E. Wendelin, Der Hochschulverfassungsstreit, 2010, S. 110; K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 40; a. A. R. Wahl, in: Schoch/ Schneider/Bier, VwGO-Kommentar, Vorb. Art. 42 Abs. 2 Rn. 120. Die Kritik an der Benennung von organschaftlichen Rechten als subjektive Rechte liegt dann auch gerade darin, dass sie die Unterscheidung zwischen den subjektiven Rechten der Organe und den subjektiven Individualrechten einebnen würde, so E.-W. Böckenförde, Organ, Organisation, Juristische Person, in: Festschrift für Wolff, S. 269 (303); W. Krebs, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, in: Festschrift für Menger, S. 191 (209). 43 H. Bethge, Grundfragen innerorganisationsrechtlichen Rechtsschutzes, DVBl. 1980, S. 309 (314); ders., Zwischenbilanz zum verwaltungsrechtlichen Organstreit, DVBl. 1980, S. 824 (825).
II. Terminologische Grundannahmen
21
Organrechte und Individualrechte lassen sich auch danach unterscheiden, ob sie im Innenrechtskreis44 oder im Außenrechtskreis45 des Staates angesiedelt sind.46 Während sich Organrechte im Innenrechtskreis des Staates bewegen, lassen sich Individualrechte gerade daran erkennen, dass sie im Außenrechtskreis angesiedelt sind.47 Sie sichern gerade die staats(eingriffs)freie Sphäre des Bürgers. Wird im Rahmen dieser Abhandlung von diesen Rechten des Außenrechtskreises gesprochen, werden sie im Folgenden als Individualrechte bezeichnet, weil sie gerade dem Schutz individueller Freiheitsbereiche dienen.48 Wird die Diktion der Literatur übernommen und „subjektive Rechte“ zitiert, sind ebenfalls die Rechte des Außenrechtskreises gemeint, wenn nicht ausdrücklich von subjektiven organschaftlichen Rechten gesprochen wird. Als organschaftliche Rechte werden hingegen solche Rechte bezeichnet, die einem Staatorgan oder Teilen eines solchen in dieser Eigenschaft zustehen.
44
Im Innenrechtskreis des Staates kann es keine Grundrechte bzw. Individualrechte geben, deshalb können diese auch nicht im Wege des Organstreits geltend gemacht werden, BVerfGE 21, 360 (370) – Sozialversicherungsträger, Beschluss vom 2. 5. 1967; BVerfGE 68, 193 (211) – Zahntechniker-Innungen, Beschluss vom 31. 10. 1984; BVerfGE 75, 192 (196) – Sparkassen, Beschluss vom 14. 4. 1987. 45 Zu dieser Unterscheidung auch F. Ossenbühl, Die Verwaltungsvorschriften in der gerichtlichen Praxis, AöR 92 (1967), S. 1 (5); T. Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, 1999, S. 17. 46 H. Bethge, Grundfragen innerorganisationsrechtlichen Rechtsschutzes, DVBl. 1980, S. 309 (312); ders., in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 63 Rn. 7. 47 Ähnlich H.-U. Erichsen, Der Innenrechtsstreit, in: Festschrift für Menger, S. 211 (226). 48 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 400.
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa in unterschiedlichen historischen Kontexten Die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts wurde in verschiedenen Rechtsordnungen in unterschiedlichen historischen Kontexten sehr unterschiedlich beurteilt. Die Sichtweisen wurden dabei auch jeweils davon geprägt, ob es überhaupt eine Anerkennung von gegen den Staat gerichteten Individualrechten gab.1 Die jeweilige Antwort auf die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts ist also von der Sichtweise auf die Stellung des Einzelnen im Staatswesen und von der Staatsauffassung insgesamt abhängig.2 Allerdings war die Rechtsnatur des Wahlrechts nicht nur über die unterschiedlichen Kontexte hinweg umstritten, sondern stets auch eine Streitfrage zwischen den Vertretern einer Rechtsordnung. Gerade die Deutung des Wahlrechts in der früheren deutschen Staatsrechtslehre und insbesondere der Weimarer Republik ist für das Vorverständnis des Wahlrechts in der Bundesrepublik von Interesse, weil das Grundgesetz vor dem Hintergrund der Weimarer Reichsverfassung entwickelt wurde.3 Es sollen deshalb die Meinungsstände im Deutschen Reich ab 1871 und der Weimarer Republik über die Rechtsnatur des Wahlrechts ermittelt werden. Die deutsche Staatslehre blickte dabei stets auch intensiv auf die französische Lehre. Da die deutsche Staatslehre zum Teil auf dieser aufbaut, soll der Rückblick mit ihr begonnen werden. Die französische Lehre konnte dabei wiederum auf Vorüberlegungen zurückgreifen, die nach der Französischen Revolution bereits die französischen Verfassungsgebungen beeinflusst haben. Auch dieser Zeitraum soll deswegen berücksichtigt werden. Neben der französischen Lehre war die Rechtsnatur des Wahlrechts auch in der englischen Wahlrechtsdiskussion ab 1830 stark umstritten, dort hatte die Diskussion aber einen anderen Impetus, weshalb auch ein Blick auf die englische Lehre Erkenntnisse verspricht. Auch wenn die Diskussion keine unmittelbaren Auswirkungen auf die deutsche Staatsrechtslehre genommen hat, zeigt auch diese Lehre einen eigenen theoretischen Zugang zum Wahlrecht auf. Außerdem soll auf 1 M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 152; so schon O. Bühler, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, 1914, S. 249; dort jeweils als „subjektive Rechte“ bezeichnet. 2 So auch W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 4. 3 Dennoch stellt das Grundgesetz keine Rezeption der WRV war, diese wurde vielmehr überlagert von einem Bestreben zur Differenzierung, so F. K. Fromme, Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz, S. 7. Die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch das Grundgesetz verkörpern zudem einen Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Herrschaft, BVerfGE 124, 300 (327) – Wunsiedel, Beschluss vom 4. November 2009.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
23
die Schweizer Lehre eingegangen werden, die sich als einzige Staatsrechtswissenschaft bis in die heutige Zeit hinein in nennenswertem Maße mit der Rechtsnatur des Wahlrechts auseinandersetzt. In Bezug auf die Schweizer Lehre soll der Fokus deshalb auf der Literatur des 20. Jahrhunderts liegen, auch ein Blick auf die neue Bundesverfassung erscheint lohnenswert. Die rechtshistorische Analyse soll zum einen dazu dienen, hieraus unterschiedliche Sichtweisen auf das Wahlrecht herauszuarbeiten, die sich in den Rechtsordnungen in unterschiedlicher Form finden. Es soll aber besonders auch gezeigt werden, dass der Streit um die Rechtsnatur des Wahlrechts innerhalb einiger Rechtssysteme äußerst kontrovers geführt wurde. Aus diesem Grund wird ein historischer Ansatz gewählt.
I. Historische Deutung des Wahlrechts 1. Französische Lehre nach 1789 Schon in der französischen Assemblée Constituante von 1789 wurden verschiedene Ansichten über die Rechtsnatur des Wahlrechts vertreten. Ein Großteil der Abgeordneten4, unter denen namentlich stets Barnave und Thouret hervorgehoben werden,5 war der Ansicht, dass das Wahlrecht eine öffentliche Funktion sei. Der Einzelne wähle nicht für sich selbst, sondern für die gesamte Nation.6 Die Vertretung in dieser öffentlichen Angelegenheit könne von der öffentlichen Gewalt geregelt werden, auch der Kreis der Wahlberechtigten könne demzufolge vom Staat bestimmt werden. Aufbauend auf der zuvor schon von Jean-Jacques Rousseau vertretenen Lehre wurde aber auch die Ansicht geäußert, dass das Wahlrecht ein individuelles Recht sei. Vorherrschend war hier wie bei Rousseau die Auffassung, dass dieses ein Naturrecht sei, das dem Menschen angeboren ist.7 Für Rousseau war die staatliche Souveränität die Summe der individuellen Souveränität der Bürger, die diese durch den Gesell4
So A. Esmein; Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I., 1927, S. 406. Siehe R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 434, 435 und A. Esmein; Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1927, S. 400, Fn. 281; K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 6; G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, S. 422, Fn. 1. 6 Die Abgeordneten Thouret und Barnave in der Sitzung vom 11. August 1791, Archives parlementaires, 1re série, Bd. I, XXIX, S. 356; zitiert nach R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 421, und A. Esmein; Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I., 1927, S. 400, Fn. 281; Hinweise hierauf finden sich auch bei K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 6. 7 So beispielsweise Robespierre in der Sitzung vom 22. Oktober 1789 und Condorcet in der Sitzung vom 23. Februar 1793; zitiert nach R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 426. 5
24
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
schaftsvertrag in den Staat eingebracht haben, wie auch der Staat selbst nur die Summe seiner Bürger darstelle.8 Nach dieser Vorstellung gebe es einen staatlichen Gesamtwillen, die volonté générale, der sich aus den Einzelwillen zusammensetze. Jeder habe demnach ein individuelles Recht, an der Bildung des Gesamtwillens teilzuhaben, das ihm kraft seines Menschseins zustehe. Hieraus folge auch das Recht, an Wahlen teilzunehmen. Das Recht zu wählen könne dem Bürger deshalb auch nicht entzogen werden.9 Demzufolge ist das Wahlrecht nach dieser Ansicht ein Recht, das dem Einzelnen aufgrund seines Menschseins zusteht, obwohl es erst innerhalb der staatlichen Ordnung entsteht.10 Diesem Konzept der individuellen Souveränität folgend vertrat namentlich Robespierre die Auffassung, dass jeder das Recht haben müsse, über das Gesetz mitzubestimmen, durch das er verpflichtet werde. Es dürfe deshalb keine Privilegien und Unterschiede geben, jeder habe das Recht, sich in jedem Stadium der Repräsentation zu behaupten,11 also auch an Wahlen teilzunehmen. Die nachrevolutionären französischen Verfassungen entfernten sich dann – mit Ausnahme der Verfassung von 179312 – zunehmend von dieser naturrechtlichen Betrachtungsweise und waren mehr und mehr von einer funktionalistischen Sicht des Wahlrechts getragen.13 Diese Ansicht entsprach auch der Beschränkung des Wahlrechts auf einen sehr ausgesuchten Kreis von Wahlberechtigten. Denn die Verfassungen unterschieden zwischen Aktivbürgern und Passivbürgern,14 also solchen, die an der Ausübung der öffentlichen Gewalt teilhatten, somit auch das Wahlrecht ausübten, und solchen, die davon ausgeschlossen waren. Die Wähler wurden als Funktionäre gesehen, die damit beauftragt sind, den Willen der Nation zu vertreten. Auch durch die Einführung eines sogenannten allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1848 wurde diese Konzeption nicht aufgegeben,15 denn dieses schloss immer noch weite Teile der Bevölkerung – darunter Frauen – vom Wahlrecht aus.
8
J.-J. Rousseau, Contrat social, Buch III, Kapitel 1, S. 63 f. J.-J. Rousseau, Contrat social, Buch IV, Kapitel 1, S. 115. 10 Diese Ansicht besprechen auch A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1927, S. 384, und R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 425. 11 Zitiert nach A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1927, S. 385. 12 K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 4, sieht die Konventverfassung vom 24. Juni 1793 im Gegenteil gerade als „juristische[n] Niederschlag“ der individualistischen Auffassung. 13 M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 156, Fn. 28. 14 Hierzu R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 436. 15 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1927, S. 400. 9
I. Historische Deutung des Wahlrechts
25
Adhémar Esmein lehnte die Ansicht, dass das Wahlrecht ein subjektives Recht sei, wegen der Konsequenzen, die sie nach sich zieht, im Rückblick ab.16 Schon die These von der individuellen Souveränität, die in der französischen Staatsrechtslehre zur Grundlage dieser Sichtweise gemacht wurde, lehnte er ab, weil sich die Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit nicht mit ihr vereinbaren lasse.17 Eine Anerkennung des Wahlrechts als subjektives Recht habe zur Folge, dass niemand vom Wahlrecht ausgeschlossen werden könne. So müssten demnach auch Frauen, Minderjährige, Personen ohne festen Wohnsitz und Unwürdige wählen können. Ausgeschlossen sei bei Zugrundelegung dieser Ansicht zudem, das Wahlrecht aus Gründen zu verwehren, die ausschließlich der allgemeinen Ordnung oder der Zweckmäßigkeit dienen. Außerdem sei auch eine Wahlpflicht, deren Nutzen er zwar bezweifelte, kategorisch ausgeschlossen, wenn diese Ansicht richtig sei.18 Auch Raymond Carré de Malberg beschäftigte sich 1922 in seiner „Contribution à la théorie générale de l’État“ in aller Ausführlichkeit mit der Rechtsnatur des Wahlrechts. Der Wählerschaft widmet er hier ein ganzes Kapitel.19 Er sah in der Ausübung des Wahlrechts zunächst eine Funktion, die der Einzelne von Verfassung wegen erfülle.20 Die These von der individuellen Souveränität und dem damit einhergehenden Recht jedes Bürgers zu wählen sah er dadurch widerlegt, dass die Wahl der Regierung nur indirekt stattfand, die individuelle Souveränität der Bürger aber die Direktwahl der Regierung erfordere. Dass die Verfassung den Wählern aber lediglich die Macht zu wählen einräumte, beweise schon für sich, dass es sich dabei nur um eine Funktion handeln könne.21 Zudem sei trotz der Einführung eines sogenannten universellen Wahlrechts bei weitem nicht jeder Bürger berechtigt, zu wählen. Vielmehr sei das Recht zu wählen an zahlreiche Bedingungen geknüpft. Dies sei aber unvereinbar mit der Theorie, dass das Wahlrecht an das Bürgersein anknüpfe.22 Während andere Autoren – insbesondere der deutschen Staatsrechtslehre jener Zeit – ein subjektives Recht des Wählers rigide ablehnten, weil es kein subjektives Recht an der Organstellung gäbe,23 räumte Carré de Malberg unter Bezugnahme auf Léon Duguit ein, dass die Fähigkeit zu wählen dem Einzelnen eine gewisse Rechtsmacht und in diesem Sinne ein Recht gewähre.24 Es sollten gerade die 16 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1921, S. 356, 357; K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 4, rechnet Esmein – allerdings ohne Nachweis – den Vertretern der individualistischen Theorie zu. 17 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1921, S. 356. 18 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Bd. I, 1921, S. 367. 19 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, Kapitel III, S. 411 – 481. 20 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 438. 21 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 439. 22 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 439, 440. 23 So G. Jellinek. Siehe hierzu unten in Abschnitt B. I. 3. a), S. 28 f. 24 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 443.
26
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
Vorschriften zur Errichtung eines Parlaments, das durch Wahl zustande kommt, den einzelnen Wähler individuell berücksichtigen, indem sie ihm das Recht zur Stimmabgabe garantierten. Die Rechtsmacht zu wählen räume dem Einzelnen zudem eine individuelle Befugnis ein, die die Natur eines Rechts habe. Die Tatsache, dass das französische Recht dem Bürger die Möglichkeit einräume, seine Qualität als Wähler durch Klage feststellen zu lassen und so die Ausübung seines Wahlrecht zu sichern, sowie die Möglichkeit des Einzelnen, die Rechtsmacht, die ihm durch das objektive Recht gewährt wird, zu seinem Vorteil zu nutzen, impliziere ein Recht auf die Wählerstellung.25 Allerdings ergebe sich aus dem französischen Konzept der nationalen Souveränität, die ein Überwiegen des nationalen oder generellen Interesses vor den diversen Einzelinteressen beinhalte, dass auch das Wahlrecht nicht um den Nutzen des Einzelnen willen gewährleistet sei, sondern im Allgemeininteresse. Jeder solle aber in der Lage sein, seine Meinung über allgemeine Belange abzugeben.26 Es sollen nicht individuelle Interessen über das allgemeine Interesse gestellt werden, jeder solle nur in die Beurteilung des Allgemeininteresses einbezogen werden. Hieraus sei wiederum zu schließen, dass das Wahlrecht einzig eine Funktion ist, die im Interesse der Allgemeinheit ausgeübt wird, und kein Privileg, das zum Vorteil des Wählers eingerichtet ist, wie ein subjektives Recht. Der Wähler könne nicht, wenn er wählt, gleichzeitig ein subjektives Recht und eine Funktion ausüben, weil diese einander entgegenstünden und sich gegenseitig ausschlössen.27 Ein subjektives Recht könne auch nicht die Ausübung einer öffentlichen Funktion zum Inhalt haben.28 Die Möglichkeit, dass der Einzelne seine Wählerstellung durch Klage feststellen lassen könne, zeige jedoch, dass er ein subjektives Recht besitze. Allerdings stelle sich die Frage, in welchem Maß bzw. zu welchem Zeitpunkt dieses bestehe. Carré de Malberg sah ein solches Recht im Vorfeld der Stimmabgabe. Die Situation des Wählers unterteile sich also in zwei Phasen, die sukzessive aufeinanderfolgen. Vor der Stimmabgabe übe der Bürger noch keine staatliche Funktion aus, weswegen man von einem subjektiven Recht sprechen könne. Sobald die Wahl stattgefunden habe, sei er aber so anzusehen, dass er eine Funktion erfüllt habe. Erst nachdem die Stimme abgegeben worden ist, mache sich der Staat diese als Teil eines staatlichen Gesamtaktes zu eigen.29 Im Moment der Stimmabgabe wandle sich das Recht, aufgrund dessen der Wähler zur Wahl gegangen ist, in eine Funktion. Carré de Malberg wendete sich damit insbesondere gegen die Meinung, nach der das Recht zu wählen zugleich ein Recht und eine Funktion sei. Diese schrieb er Léon Duguit und Adhémar Esmein zu. Er hielt sie außerdem für die zu jener Zeit herr25 26 27
448. 28 29
R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 444. R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 446. R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 447, R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 447. R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 450.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
27
schende Ansicht in Frankreich.30 Dass diese Meinung von Esmein vertreten wurde, ist jedoch nicht ersichtlich. Auch Duguit vertrat sie nicht so, wie es zunächst scheinen mag. In der Tat schrieb Duguit zwar ausdrücklich, dass das Wahlrecht zugleich ein Recht und eine Funktion sei.31 Dieses Recht bestehe allerdings darin, als Staatsbürger anerkannt zu werden, welches dann die Stellung als Wähler herbeiführe, wenn noch weitere Voraussetzungen vorliegen. Nicht das Recht zu wählen selbst war also seiner Ansicht nach ein subjektives Recht, Duguit machte vielmehr ein vorausliegendes Recht zur Grundlage der staatlichen Funktion. Auch er ging damit von einem sukzessiven Aufeinanderfolgen verschiedener Rechtspositionen aus. Aus der Eigenschaft als öffentliche Funktion folge, dass der Wähler verpflichtet sei, die Funktion auch zu erfüllen, auch wenn diese Verpflichtung nicht festgeschrieben sei. Auch folge daraus, dass der Gesetzgeber die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit das Wahlrecht ausgeübt werden darf, jederzeit verändern könne. Ebenso könne er festlegen, in welcher Form die Bürger an der öffentlichen Gewalt beteiligt werden und etwa eine zweistufige Wahl einführen. Aus dem subjektiven Recht folge aber für die Berechtigten, dass sie als Wähler anerkannt werden und die Formalitäten der Rechtsausübung erfüllt werden müssten. Es handle sich hierbei aber immer auch um eine Frage des objektiven Rechts. Aus diesem Grund könnten Anträge auf Eintragung in die Wählerliste oder die Streichung von dieser nicht nur von dem Berechtigten, sondern auch von jedem anderen Wähler des Wahlkreises gestellt werden.32 Hieran zeige sich der Charakter des Wahlrechts als öffentliche Funktion besonders deutlich.33 Der Überblick zur früheren französischen Staatsrechtslehre zeigt, dass es zwar Ansätze gab, das Wahlrecht als individuelles Recht zu betrachten, die Ansicht, dass das Wahlrecht eine öffentliche Funktion ist, jedoch deutlich vorherrschend war. Wer das Wahlrecht als Individualrecht betrachtete, führte dies auf einen naturrechtlichen Ansatz zurück. Mit der Qualifizierung des Wahlrechts als öffentliche Funktion hingegen ließ sich der Ausschluss eines Teils der Bevölkerung von den politischen Rechten begründen, während eine individualistische Herleitung die Verleihung des Wahlrechts an alle Staatsbürger zur Folge hätte haben müssen.34 Es herrschte jedoch bei den Rechtswissenschaftlern jener Zeit auch eine Sensibilisierung dafür vor, dass das Wahlrecht einen starken Individualbezug hat.
30 31 32 33 34
R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Bd. II, 1922, S. 445. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Bd. I, 1911, S. 318. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Bd. I, 1911, S. 318. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Bd. II, 1911, S. 212. So auch L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Bd. I, 1911, S. 315.
28
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
2. Englische Lehre ab 1830 Individual-rechtliche Ansätze finden sich nicht nur in der französischen Lehre der Nachrevolutionszeit und des 19. Jahrhunderts. Auch die englische Lehre entwickelte zur gleichen Zeit individual-rechtliche Betrachtungsweisen des Wahlrechts.35 Die individual-rechtliche Rechtsnatur des Wahlrechts wurde allerdings auf eine andere Begründung gestützt. Das Wahlrecht wurde hier als Privatrecht des Einzelnen entwickelt – ähnlich dem Recht auf Eigentum. Es wurde deshalb vom Bodenbesitz oder dem Besitz eines Hauses oder Geschäfts abhängig gemacht. Begründet wurde dies allerdings ähnlich wie beim naturrechtlichen Ansatz: Nur wer sich der Staatsgewalt nicht entziehen könne, müsse auch berechtigt sein, an ihr mitzuwirken. Dies treffe aber nur auf denjenigen zu, der durch Besitz an das Land gebunden sei.36 Genau wie die französische Lehre kannte indes auch die englische Lehre zu dieser Zeit die entgegenstehende Ansicht. Die These, dass das Wahlrecht kein subjektives Recht, sondern ein politisches Amt sei, das dem Einzelnen anvertraut sei, wurde besonders in der englischen Wahlrechtsdiskussion zwischen 1830 und 1870 vertreten.37 Mit ihr ließ sich die Vorzugswürdigkeit der Öffentlichkeit der Stimmabgabe vor der Geheimwahl begründen. In seiner Schrift „On the duties of voters and on the vote by ballot“ begründete Thomas Lewin 1837 die Notwendigkeit einer öffentlichen Stimmabgabe damit, dass nur diese dem Wähler seinen Amtsstatus vor Augen führe. Jeder Wähler habe die Pflicht, das allgemeine Wohl zum Maßstab seiner Wahl zu machen, denn wenn die gewählten Parlamentarier für die Förderung dieses Wohls verantwortlich seien, müssten auch die Wähler dieses zum Maßstab ihrer Wahl machen. Der Wähler, der hingegen nach privaten Interessen wähle, verletze diese Pflicht.38 Das Wahlrecht wurde in der englischen Lehre dieser Zeit als ein „trust“ angesehen, der für die Gemeinschaft ausgeübt werde. Die Wähler wurden so als Vertreter des ganzen Volkes gesehen. Die politische Gemeinschaft, insbesondere diejenigen, die kein Wahlrecht hatten, hätten deshalb ein Interesse daran, zu erfahren, wie die Wähler ihre Stimme ausüben, jedenfalls gäbe es kein Recht auf Geheimhaltung.39 Auch aus diesem Grund habe die Wahl offen stattzufinden. Auch John Stuart Mill wendete sich aus diesen Erwägungen heraus in seinen „Considerations on representative government“ gegen die geheime Wahl.40 Er sah das Wahlrecht als anvertrautes Gut, als öffentliche Funktion, nicht als Recht. Denn jede Macht über andere, die einem Einzelnen zugebilligt würde, sei ein anvertrautes Gut, das vom Wähler so ausgeübt werden müsse, wie das Interesse der Allgemeinheit 35 36 37 38 39 40
Siehe K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 5. So K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 5. H. Buchstein, Öffentliche und geheime Stimmabgabe, 2000, S. 625. T. Lewin, On the duties of voters and on the vote by ballot, 1837, S. 3, 4. Hierzu H. Buchstein, Öffentliche und geheime Stimmabgabe, 2000, S. 626 ff. J. S. Mill, Considerations on representative government, 1861, S. 167 ff.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
29
es ihm zu erfordern erscheine. Diese moralische Verpflichtung treffe den Wähler bei der allgemeinen Wahl, noch eindeutiger aber bei der beschränkten Wahl.41 Jeder habe die Stimme nach bestem Gewissen so abzugeben, wie er es zu tun verpflichtet wäre, wenn die Wahl nur von ihm abhinge. Das Wahlrecht sei so vergleichbar mit dem Recht eines Geschworenen. Würde das Wahlrecht als Recht angesehen, könne nichts dagegen sprechen, es zu verkaufen oder es zugunsten eines anderen zu verwenden. Die geheime Wahl würde aber das Denken der Wähler dahin gehend prägen, dass sie denken, das Wahlrecht sei ihnen zum persönlichen Vorteil gewährt und sie seien zu keiner Rücksichtnahme auf andere verpflichtet. Das Wahlrecht sei also, wie jede öffentliche Funktion, „unter dem kritischen Auge der Öffentlichkeit“ auszuüben.42 Auch in der englischen Lehre ist eine Divergenz von Ansichten über die Rechtsnatur des Wahlrechts zu verzeichnen. Allerdings werden diese aus anderen Gründen als in der französischen Staatsrechtslehre vertreten. Während in der englischen Lehre die funktionelle Betrachtungsweise des Wahlrechts dazu benutzt wurde, eine öffentliche Stimmabgabe zu begründen, wurde sie in der französischen Staatsrechtslehre vorwiegend zur Begründung einer Beschränkung der Wahlberechtigung auf wenige Bürger herangezogen. Auch die Herleitung einer jeweils daneben ebenfalls vertretenen subjektiv-rechtlichen Rechtsnatur des Wahlrechts erfolgte unterschiedlich: Während ein subjektives Wahlrecht in der französischen Lehre als Menschenrecht betrachtet wurde, leitete die englische Lehre konträr hierzu ein individuelles Recht des Bürgers zu wählen als Privatrecht her.
3. Deutsche Staatslehre ab 1871 a) Verfassung des Deutschen Reiches Das Wahlrecht in der Verfassung des Deutschen Reiches ist vor dem Hintergrund der konstitutionellen Monarchie und der Stellung des Parlaments in dieser Staatsform zu sehen. Das Parlament ist hier nicht – wie in der repräsentativen Demokratie – das Staatsorgan, das allen anderen Staatsorganen Legitimation vermittelt. Es ist ein Organ, das die Interessen der Gesellschaft gegenüber dem Staat vertritt.43 Durch das Wahlrecht wird also nicht das zentrale Organ des Staates gewählt, sondern nur ein in der staatlichen Organisation nicht tragendes Organ. Die Verfassungslehre jener Zeit ist auch vor dem Hintergrund der gescheiterten Paulskirchenverfassung zu betrachten.
41
J. S. Mill, Considerations on representative government, 1861, S. 169. J. S. Mill, Considerations on representative government, 1861, S. 169. 43 Siehe hierzu ausführlich C. Schönberger, Das Parlament im Anstaltsstaat, 1997, S. 318 ff. 42
30
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
Paul Laband wies in seinem „Staatsrecht des Deutschen Reiches“ 1876 dem Wahlrecht als politischem Recht die Qualität eines subjektiven Rechts zu,44 während er im Übrigen subjektive Rechte gegen den Staat ablehnte.45 1911 vertrat er diese Ansicht in der fünften Auflage seines Lehrbuchs dann auch bezüglich des Wahlrechts, das ihm als Recht formuliert schon suspekt erschien: „Das ,Wahlrecht‘46 ist überhaupt kein subjektives, im individuellen Interesse begründetes Recht, sondern lediglich der Reflex des Verfassungsrechts“,47 also der „Reflex der verfassungsrechtlichen Regeln behufs Bildung des Landtags oder Reichstages“.48 Laband verglich es mit dem Recht, einer Schwurgerichtsverhandlung beizuwohnen; dieses sei ebenfalls nur Reflex der Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung. Ebenso sei das „Recht zu appelieren“, nur ein Reflex über die in der Prozessordnung anerkannten Grundsätze über Rechtsmittel. Aus dieser Rechtsnatur des Wahlrechts ergaben sich für Laband verschiedene Konsequenzen.49 Zum einen sei das Wahlrecht ein Zustand und verändere sich deswegen mit dem Verfassungsrecht. Dieses könne uneingeschränkt ohne Rücksicht auf den einzelnen „Wahlberechtigten“ – Laband setzte die Worte „Wahlrecht“ und „Wahlberechtigter“ in Anführungsstriche, um seine Ablehnung eines solchen Rechts auszudrücken – geändert werden. Denn erst aus dem Verfassungsrecht ergebe sich, wer wahlberechtigt sei, nämlich derjenige, der die Bedingungen erfüllt, die das Gesetz aufstellt, damit die Stimme rechtliche Wirkung auf die Zusammensetzung des Parlaments haben kann. Außerdem folge aus der Rechtsnatur des Wahlrechts, dass über dieses nicht privatrechtlich verfügt werden, es nicht vererbt, veräußert oder sonst übertragen werden könne. Zudem könne der Wahlberechtigte nicht verlangen, dass Hindernisse, die seinem Wahlrecht entgegenstehen, beseitigt werden, wie dies für Strafgefangene, Wehrpflichtige oder dienstpflichtige Beamte der Fall sein könnte. Laband sah die Vorschriften zur Sicherung der Ausübung des Wahlrechts – hier bemerkenswerterweise ohne Anführungsstriche – darin, das Wahlrecht als objektive Institution des Verfassungsrechts zu schützen. Dennoch gestand er zu, dass diese sekundär, nämlich infolgedessen, auch dazu dienten, die Teilnahme des Einzelnen an der Wahl zu schützen.50 Er erkannte damit eine individual-schützende Funktion dieser Vorschriften an, wenn auch nur als Konsequenz des objektiven Rechts. Otto Mayer erblickte im Wahlrecht 1895 eine Verbindung aus Sondervorteil und öffentlichem Zweck. Er benutzte in Bezug auf das Wahlrecht erstmals den Terminus „Mitwirkungsrecht“. Der Wahlberechtigte, dessen Bestimmung merkwürdigerweise der Wahlbehörde durch die Feststellung des Wahlergebnisses obliegen sollte, habe 44
P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 1876, S. 149, 155 f., 547. P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 1876, S. 149, 155 f. 46 Hervorhebung im Original. 47 O. Bühler, Zur Theorie des subjektiven öffentlichen Rechts, in: Festgabe für Fleiner, 1927, S. 26 (32), bezeichnet dies als eine „ganz künstliche[…] Konstruktion[…]“. 48 P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 1911, § 34, S. 331. 49 P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 5. Aufl., 1911, § 34, S. 331. 50 P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 5. Aufl., 1911, § 34, S. 332. 45
I. Historische Deutung des Wahlrechts
31
einen Rechtsanspruch darauf, dass seine Abstimmung angenommen und bei der Feststellung des Wahlergebnisses mitgezählt werde. Dies sei ein „Mitwirkungsrecht an dem staatlichen Akt in Gestalt einer Forderung“. Seiner Meinung nach diente das Wahlrecht zum einen dem öffentlichen Wohl. Indem die Staatsbürger dadurch zur Geltung kämen, dass sie dabei ihre Meinungen über das Wohl des Staates abgeben dürften, sei es aber zum anderen auch ein subjektives Recht.51 Auch Otto Mayer sah das subjektive Recht also als mittelbare Konsequenz der durch das objektive Recht begründeten Wählerstellung. Nach Georg Meyer sei die Befugnis zu wählen, wie alle Rechte, Ausfluss der staatlichen Rechtsordnung. Auch er schloss hieraus die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber den Kreis der Wahlberechtigten nach seinem Ermessen regeln könne. Nach Ansicht Georg Meyers sei es jedoch unmöglich, Kindern und Geisteskranken das Wahlrecht zu gewähren, deshalb sei dem Gesetzgeber dies auch verwehrt. Denn bei der Ordnung des Wahlrechts sei das Staatswohl maßgebend. Die Gesetzgebung „würde pflichtwidrig handeln, wenn sie die Befugniss, zu wählen, solchen Personen einräumte, von denen zu befürchten wäre, dass sie von derselben einen dem Staatgefährlichen oder dem allgemeinen Wohl nachtheiligen Gebrauch machten“.52 Georg Meyer nahm so zwar nicht ausdrücklich Stellung zur Rechtsnatur des Wahlrechts, er stellte die Funktion des Wählens jedoch in den Vordergrund. Das Wahlrecht, verstanden als das Recht zu wählen, also an der Staatsgewalt tatsächlich teilzunehmen, sei nach Ansicht Georg Jellineks an sich kein subjektives Recht, vielmehr handele der Einzelne bei der Ausübung der Staatsgewalt als Teil des Staatsorgans Volk.53 Das Wahlrecht vermittle ihm jedoch ein eigenes subjektives Recht auf Anerkennung seiner Wählerstellung. „Das Wahlrecht besteht daher, so paradox dies klingen mag, keineswegs in dem Recht zu wählen.“54 Denn Subjekt des Wahlrechts sei ausschließlich der Staat, „[…] nur Reflexwirkung ist es, wenn der einzelne als solcher ein derartiges Recht zu besitzen scheint“.55 Wählen sei nach Jellinek eine staatliche Funktion, deren Subjekt niemals der Einzelne sein könne.56 Allerdings sei auch ein individuelles Interesse am Wahlakt berücksichtigt, indem der Einzelne einen Anspruch auf die Anerkennung als Wähler habe.57 Hierauf beschränke sich das im Wahlrecht enthaltene subjektive Recht jedoch. Dieses Recht sei dem „status activus“ zuzuordnen, dem Status des Bürgers zum Staat, dem Rechte auf Mitwirkung am Staat entspringen.58 Im Moment der Wahl werde der Wähler dann 51 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. I, 1. Aufl., 1895, S. 114, Fn. 21; so auch noch in der 3. Aufl., 1924, S. 110, Fn. 12. 52 G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, 1901, S. 412. 53 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 138, 159. 54 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 159, 160. 55 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 160. 56 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 138. 57 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 161. 58 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 139.
32
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
aber zum Staatsorgan, um unmittelbar nach der Wahl in seine individual-rechtliche Stellung zurückzufallen. Die Individualtätigkeit höre da auf, wo die Organtätigkeit beginne.59 Der individuelle Anspruch solle sich aber nicht in der Anerkennung als Wähler und damit einhergehend auch in der Eintragung in das Wählerverzeichnis und in der Zulassung zur Wahlhandlung, also in positiven Leistungen, erschöpfen. Er solle sich darüber hinaus auf Unterlassen von Handlungen des Staates, die den Einfluss des Einzelnen an der Organbildung verringern, erstrecken. Dies seien auch solche Unterlassungen, die über den Wahlakt hinausreichen, wie die unrichtige Stimmenzählung und die Zuerkennung der Gewählteneigenschaft an eine disqualifizierte Person.60 Denn das Interesse an der Einhaltung der Wahlvorschriften sei sowohl ein Gemeininteresse als auch ein individuelles. Das individuelle Interesse sei auf Anerkennung als Wahlberechtigter gerichtet, der Staat sei an der gesetzmäßigen Tätigkeit der Wahlorgane interessiert.61 Dies führe dazu, dass der gleiche Sachverhalt sowohl eine Verletzung der Rechte des Staates als auch der Wähler sein könne. Der individuelle Anspruch richte sich jedoch nur auf Verschaffung der rechtlichen Möglichkeit zu wählen, nicht der faktischen. So könne die Erfüllung einer anderen staatlichen Pflicht, beispielsweise die eines Beamten, die Ausübung des Rechts verhindern, ohne dass dies das Recht verletze.62 Georg Jellinek vertrat damit die Ansicht, dass subjektives Recht und Organrecht aufeinanderfolgen. Dennoch wurden seine Aussagen zum Wahlrecht in verschiedene Richtungen gedeutet. Während Georg Meyer ihn zur Untermauerung seiner eigenen These, das Wahlrecht sei eine öffentliche Funktion, den Vertretern dieser Lehre zuordnete,63 rechnete Paul Laband ihn den Vertretern der Lehre vom Wahlrecht als subjektivem Individualrecht zu.64 Laband verstand Jellinek in der Weise, dass dieser auch „das Recht zu wählen“ als subjektiv-individual-rechtlich betrachtete. Diese Fehlinterpretation seiner Ansicht durch Laband deckte Jellinek selbst in seiner Allgemeinen Staatslehre auf.65 Braunias wiederum sah die Ansicht Jellineks im Rückblick mit der Labands verwandt.66 Der Satz Jellineks, das Wahlrecht bestehe keineswegs in dem Recht, zu wählen, wurde oftmals auch als widersinnig oder
59
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, S. 422, Fn. 2. G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 161. Dass Jellinek andererseits einen Anspruch darauf, dass jemand als gewählt zu betrachten sei, ausschloss, weil ein individueller Anspruch auf die Abgeordnetenstellung nicht denkbar sei, ist auf eine mangelnde Unterscheidung zwischen Anerkennung des Gewähltseins und der Abgeordnetenstellung zurückzuführen. 61 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 161. 62 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 164. 63 G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, 1901, S. 413. 64 P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 5. Aufl., 1911, S. 331, Fn. 1. 65 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, S. 422, Fn. 2. 66 K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 8. 60
I. Historische Deutung des Wahlrechts
33
paradox bezeichnet.67 Diese unterschiedliche Deutung schon durch Vertreter der gleichen Epoche zeigt zum einen das Vorverständnis der Autoren durch ihre eigene Lehre, zum anderen aber auch das Unverständnis gegenüber Jellineks Konstruktion. Auch Leo von Savigny – Enkel Friedrich Carl von Savignys – qualifizierte das Wahlrecht 1907 in seiner Abhandlung über „Das Parlamentarische Wahlrecht im Reiche und in Preußen und seine Reform“ „ganz überwiegend“ als öffentliche Funktion. Denn der beherrschende Zweck der Norm sei nicht das Interesse des Einzelnen, sondern das des Staates. Der Zweck der Wahlrechtsnorm sei eine umfassende Teilnahme der Regierten am Staat. Die Berücksichtigung des subjektiven Interesses des Einzelnen erscheine nur als Reflex der Fürsorge für die Interessen des Staates. Das Individualinteresse könne deshalb auch nur insoweit Berücksichtigung finden, als es in einer Zweckbeziehung zu dem zu berücksichtigenden Staatsinteresse stehe.68 Es seien deshalb auch Ungleichheiten in der individuellen Interessenberücksichtigung zulässig, soweit das Gemeininteresse sie fordere. Savigny nutzte diese Argumentation, um ein allgemeines und gleiches Wahlrecht als nicht erforderlich zu qualifizieren. Ein Wahlsystem sei nur danach zu beurteilen, ob es die an das System gestellten Funktionen erfülle. Eine Differenzierung bei der Teilnahme an der Wahl habe sich an deren Tauglichkeit für den Staat zu orientieren.69 Eine solche Differenzierung lässt sich in der Tat nur mit der Qualifikation des Wahlrechts als öffentlicher Funktion erklären. Virulent wurde die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts immer auch dann, wenn die Zulässigkeit einer Wahlpflicht in Frage stand. Im Jahr 1909, zwei Jahre nach Savignys Schrift, veröffentlichte Heinrich Geffcken in der Zeitschrift für Politik einen Aufsatz über die Wahlpflicht, in dem er darlegte, dass das Wahlrecht nicht als subjektives Recht betrachtet werden könne. Es sei ausgeschlossen, „dass der kollektivistische Staat, indem er seine Bürger zur Schaffung des Staatsorgans der Volksvertretung heranzieht, damit etwas anderes als die unmittelbare Förderung staatlicher Gesamtinteressen bezweckt“. Die Staatsbürgerschaft sei Staatsorgan, in der Monarchie anders als in der Demokratie jedoch nicht Ur-Organ des Staates, das mit nur einer einzigen Funktion betraut ist, der „Teilnahme an der Zusammensetzung des Parlaments“.70 Diese öffentliche Funktion sei aber in erster Linie eine Pflicht. Die Wahltätigkeit des einzelnen Staatsbürgers habe den gleichen rechtlichen Charakter wie die Wahltätigkeit der Staatsbürgerschaft als ganzer. Das Organ könne aber gleichzeitig ein Recht auf seine Organstellung haben; auch dem Einzelnen könne so gleichzeitig ein Recht auf seine Organstellung zustehen. Das Gesamtinteresse des 67 F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 15; E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 1988, S. 864, Fn. 20, bezeichnet dies als „akrobatisch anmutendes Gedankenspiel“; auch O. Bühler, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, 1914, S. 250, Fn. 366, hielt diese Ansicht für „sonderbar“. 68 L. von Savigny, Das parlamentarische Wahlrecht im Reiche und in Preußen, 1907, S. 12. 69 L. von Savigny, Das parlamentarische Wahlrecht im Reiche und in Preußen, 1907, S. 13. 70 H. Geffcken, Die Wahlpflicht, ZfP 2 (1909), S. 159 (177).
34
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
Staates sei identisch mit den innerstaatlichen Sonderinteressen. Aus diesem Grund müsse der Wähler dieses Sonderinteresse auch zur Geltung bringen können. Auch nach Ansicht von Fritz Fleiner sei das Wahlrecht in erster Linie eine Pflicht, das Wählen eine staatliche Funktion, nämlich die Bildung eines Staatsorgans. Nichtsdestotrotz besprach Fleiner dies als Fußnote zu der Bemerkung, dass der Berechtigte von der Ausübung seines Rechts absehen könne, soweit es sich nicht um die Kehrseite einer Pflicht handele.71 Das impliziert, dass er das Wahlrecht auch als Recht sah, das allerdings Kehrseite einer Pflicht sei. Er bezeichnete die Ansprüche des Bürgers auf Teilhabe an der Staatsgewalt als öffentliche Rechte, diese seien sogenannte „politische Rechte“, zu ihnen gehöre auch das Wahlrecht.72 Allerdings war er ebenso der Ansicht, dass das Wahlrecht nur deshalb als Recht erschiene, weil es die Möglichkeit verschaffe, Einfluss auf die Staatsgewalt auszuüben. Eingebettet war diese Sicht auf das Wahlrecht in die Ansicht Fleiners, das Individualrechte ohnehin nicht ausschließlich im individuellen Interesse des Bürgers stünden, sondern auch Bestandteil der öffentlichen Rechtsordnung wären.73 Die Befriedigung des Individualinteresses wäre damit nur Teilstück des Gesamterfolges. Der Gesamterfolg würde aber vom Gesetze im Gemeininteresse angestrebt.74 Hans Kelsen charakterisierte das Wahlrecht in seiner Abhandlung über die „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre“ (1911) hingegen als subjektives Recht. Der Wähler mache durch die Abgabe seiner Wahlerklärung die Pflicht des Staates, seinen Stimmzettel in Empfang zu nehmen, geltend. Die subjektiven Wahlrechte seien aber nicht auf Handlungen der Wähler gerichtet, sondern auf die pflichtgemäßen Wahlakte des Staates, weil ein subjektives Recht auf ein eigenes Verhalten unmöglich sei.75 Ein subjektives Wahlrecht hänge auch nicht davon ab, dass die Verletzung desselben rechtlich verfolgt werden könne.76 Trotz der subjektiv-rechtlichen Natur des Wahlrechts sei es möglich, den Wähler zur Ausübung seines Wahlrechts zu verpflichten, also eine Wahlpflicht einzuführen.77 Er wendete sich aber dezidiert gegen die Ansicht, dass eine solche aus der „öffentlichen Natur“78 des Wahlrechts folge. Sie bestehe vielmehr nur dann, wenn das Nichtwählen strafrechtlich sanktioniert sei.79
71 72 73 74 75 76 77 78 79
F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 1912, § 11, S. 162, Fn. 38. F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 1912, § 11, S. 160. F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 1912, § 11, S. 161. F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 1912, § 11, S. 161. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 680. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 680. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 681. Hervorhebung im Original. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 682.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
35
Auch Ottmar Bühler gehörte zu denjenigen, die das Wahlrecht als subjektives Recht betrachteten.80 Er zeigte dies an der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, das indes nur ein allgemeines Männerwahlrecht war. Dieses sei eingeführt worden, um die Interessen der Einzelnen an der Mitwirkung an der Gesetzgebung zu befriedigen, es sei also um individueller Interessen willen gewährt. Dies entspreche aber gerade dem Begriff des subjektiven Rechts. Es gebe also jedenfalls ein subjektives Recht, im Einzelfall an der Wahl teilzunehmen. Hiervon unterschied er aber die Frage, ob auch die dauernd vorhandene Eigenschaft, an einer Wahl teilnehmen zu dürfen, ein Recht ist. Denn zwischen den Wahlen könne der Einzelne aus dieser Eigenschaft heraus nichts verlangen. Er verglich dies aber mit bestimmten Privatrechten, die zwar immer bestünden, jedoch nur manchmal ausgeübt werden können. Ebenso sei auch das Wahlrecht ein dauernd bestehendes, aber nur manchmal ausübbares Recht, ohne dass dieses in der Zwischenzeit unterginge.81 Erstaunlicherweise hielt Bühler trotz dieser Ausführungen den Begriff des Wahlrechts für einen „einfachen Begriff“. Wenn Unklarheit über diesen bei „anerkannten Autoritäten des öffentlichen Rechts“ bestehe, sei es nur folgerichtig, dass in anderen Gebieten ebenfalls keine Klarheit zu erzielen sei.82 Fritz Stier-Somlo war 1918 der Ansicht, dass zwar der Zweck der Wahl – die Schaffung eines Organs – im Interesse des Staates liege, der Wähler hingegen nicht Organ des Staates, sondern der „unentbehrliche persönliche Mittler zur Schaffung der Volksvertretung“ sei. Das Wahlrecht sei damit die staatsrechtliche Befugnis des Einzelnen, an der Bildung des Staatswillens – allerdings nur mittelbar – teilzunehmen.83 Erst durch die Erhebung dieser Befugnis zu einem Recht werde dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, diese Mittlerstellung einzunehmen. Es seien aber die Wahl als Funktion im Interesse des Staates und das Wahlrecht als eine subjektive Berechtigung auseinanderzuhalten.84 Diese entspreche auch dem Zweck des Staates, der weder Selbstzweck sei, noch nur um der Einzelperson willen bestehe. So sei auch das Wahlproblem ein doppeltes. Die Organtheorie hingegen sei zu einseitig, ebenso aber auch die Theorie, die dem subjektiven Wahlrecht die Funktion des Wahlvorgangs als Mittel der Schaffung einer Volksvertretung aberkenne, sie sei der „Rüstkammer eines überlebten politischen Individualismus entnommen“.85 Die Theorie, das Wahlrecht sei lediglich ein Rechtsreflex, lehnte er hingegen komplett ab, umgekehrt ließe sich seines Erachtens sagen, dass die Regeln über das Verfahren 80 O. Bühler, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, 1914, S. 249. Er machte aber auch „erhebliche Differenzen“ aus, die bei der Betrachtung des Wahlrechts bis dato bestanden hätten. 81 O. Bühler, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, 1914, S. 250. 82 O. Bühler, Zur Theorie des subjektiven öffentlichen Rechts, in: Festgabe für Fleiner, 1927, S. 26 (32). 83 F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 15. 84 F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 16. 85 F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 16.
36
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
zur Schaffung der Volksvertretung Reflexe des subjektiven Wahlrechts seien. Dies würde deutlich an der Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten im 19. Jahrhundert. Die Funktion der Wahl, die Bildung der Volksvertretung, könne auch ohne deren Zusammentreten gesichert werden. Es werde damit deutlich, dass die anderen hinzutretenden Wähler ein subjektives Recht haben müssten.86 1901 konstatierte Georg Meyer, dass die Meinung, welche das Wahlrecht als öffentliche Funktion sehe, die der Wähler im Interesse des Staates auszuüben habe, stets herrschend gegenüber derjenigen gewesen sei, nach der das Wahlrecht ein angeborenes Recht des Individuums sei. Er war sogar der Ansicht, dass Letztere „kaum noch einen Verteidiger finden“ würde.87 Er führte dies darauf zurück, dass die Theorie der angeborenen Rechte insgesamt überholt sei. Schon 1918 war Fritz StierSomlo allerdings der Meinung, dass die Lehre, die das Wahlrecht als öffentliche Funktion sieht, keineswegs mehr die herrschende sei.88 Es ist Georg Meyer im Rückblick darin zuzustimmen, dass die Qualifizierung des Wahlrechts als öffentliche Funktion im Kaiserreich vorherrschend gewesen ist.89 Das Wahlrecht hatte nach Einschätzung der meisten Autoren keinerlei individual-begünstigenden Charakter. Der Wähler erfüllte nach der herrschenden Meinung einzig und ausschließlich eine Funktion für den Staat. Bezeichnend für diese Ära ist die von Laband entwickelte These von der reflexartigen Begünstigung des Einzelnen durch das Wahlrecht.90 Nur ausnahmsweise wurde neben dieser öffentlichen Funktion auch ein subjektives (Individual)-Recht anerkannt, ohne dass die Voraussetzungen eines solchen dabei offengelegt wurden. Die strikte Ablehnung jedes subjektiven Rechts lag überwiegend an der Ablehnung derartiger Rechte insgesamt.91 Die Konstruktion Jellineks ist insofern eine Besonderheit, weil sie ein subjektives Recht am Wahlakt zugesteht, ohne aber die staatliche Willensbildung selbst individual-rechtlich auszugestalten. Es zeigt sich hier besonders, dass die Ansicht, nach der das Wahlrecht eine öffentliche Funktion ist – ähnlich wie in der französischen Lehre – auch deshalb vertreten wurde, weil sich damit eine Beschränkung des Wahlrechts auf einen eingeschränkten Personenkreis rechtfertigen ließ.92 Wäre das Wahlrecht als individuelles Recht gesehen worden, hätte sich eine Beschränkung hingegen schwerlich begründen lassen. Bestrebungen, ein „allgemeines“ Wahlrecht einzuführen, das aber dennoch bestimmte Personengruppen, darunter Frauen, vom Wahlrecht ausschließt, 86
F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 18. G. Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht, 1901, S. 412. 88 F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, Endnote 10 (S. 251). 89 So auch M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 153. 90 Siehe oben in diesem Abschnitt S. 29 f. 91 So insbesondere bei Laband. 92 Auch M. Breuer, Verfassungsrechtliche Anforderungen an das Wahlrecht der Auslandsdeutschen, 2001, S. 40, sieht diesen „wahlrechtlichen Paradigmenwechsel“ als Grund dafür, dass Wohnsitzklauseln im Wahlrecht im 19. Jahrhundert unbedenklich erschienen. 87
I. Historische Deutung des Wahlrechts
37
stehen in dieser Linie. Auch die Abgrenzung eines allgemeinen Wahlrechts von einem beschränkten, wie sie Georg Meyer vornahm, dadurch, dass ein allgemeines Wahlrecht vorliege, wenn es keine „besonderen“ Ausschlussgründe gebe, half nicht weiter, sondern versuchte nur, ein „allgemeines“ Wahlrecht trotz zahlreicher Ausschlussgründe zu behaupten. Ernst Rudolf Huber interpretierte die Bismarcksche Reichsverfassung im Rückblick (1963) so, dass sie das Wahlrecht zugleich als persönliches Recht verstanden habe. Allerdings nicht als ein solches in der Form eines dem privaten Interesse des Inhabers dienenden Privatrechts, sondern als subjektives öffentliches Recht des staatsbürgerlichen Status, von dem der Wähler in einer dem Gemeinwohl dienlichen Weise Gebrauch zu machen hatte. Die Bismarcksche Reichsverfassung habe das Wahlrecht damit gleichzeitig als öffentliche Aufgabe verstanden.93 Das persönliche Recht entnahm er der Formulierung des Reichswahlgesetzes, das in §§ 2, 3 RWahlG von der „Berechtigung zu wählen“ sprach.94 Dass das Wahlrecht zugleich eine öffentliche Funktion war, die in einer dem Gesamtwohl dienlichen Weise auszuüben war, leitete er aus den strafrechtlichen Schutzbestimmungen für das Wahlrecht ab.95 In der zeitgenössischen Rezeption der Verfassung scheint aber von dem angeblich in der Verfassung zugestandenen subjektiven Wahlrecht – wie gesehen – wenig durch. Die Staatsrechtslehre interpretierte das Wahlrecht vielmehr vorherrschend als öffentliche Funktion, die Sichtweise als Individualrecht trat dahinter sehr deutlich zurück. b) Weimarer Reichsverfassung Das Wahlrecht der Weimarer Reichsverfassung steht in einem besonderen Kontext. Es ist das Wahlrecht der ersten gesamtdeutschen Demokratie mit parlamentarischem Regierungssystem. In der Weimarer Reichsverfassung wurde mit der Einführung des Frauenwahlrechts 191896 auch erstmals ein allgemeines Wahlrecht weitgehend verwirklicht. Wahlberechtigt waren alle Frauen und Männer im Alter von über zwanzig Jahren.97 Hervorzuheben ist, dass der Grundrechtekatalog der 93
E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 1988, S. 864 f. E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 1988, S. 863. 95 E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 1988, S. 865, insb. Fn. 22. 96 Im ersten Revolutionsgesetz des Rates der Volksbeauftragen vom 12. 11. 1918, (RGBl. 1918, S. 1303) wurde das Frauenwahlrecht erstmals rechtlich postuliert. Bei den Wahlen zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung waren Frauen dann erstmals wahlberechtigt gemäß § 2 der Verordnung über die Wahlen zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung (Reichswahlgesetz) vom 30. 11. 1918, RGBl. 1918, S. 1345. 97 Während die Formulierung der Verordnung über die Wahlen zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung noch die Formulierung „Männer und Frauen, die am Wahltag das 20. Lebensjahr vollendet haben“ wählte, sprach das Reichwahlgesetz von 1920 (§ 1 Abs. 1 Reichswahlgesetz vom 27. 4. 1920; RGBl. 1920, S. 627) nur noch von „Reichsangehörigen“, 94
38
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
Weimarer Reichsverfassung in Art. 125 WRV die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis aufzählte. Die Wahlfreiheit wurde jedoch nicht als Freiheit gesehen, der Wahl fernzubleiben, sondern lediglich als Freiheit vom Zwang, eine bestimmte Wahlentscheidung zu treffen,98 also als Freiheit bei der Wahlausübung. Das Wahlgeheimnis bildete hierzu dann das Korrelat.99 Eine Wahlpflicht war hingegen nicht vorgesehen. Im Verfassungsausschuss war auch diskutiert worden, die Ausübung des Wahlrechts und die Wahrung des Wahlgeheimnisses als „staatsbürgerliche Rechte“ zu garantieren; letztlich hatten dessen Mitglieder diese Überlegung jedoch verworfen.100 Das Wahlrecht selbst wurde somit nicht als Grundrecht normiert. Gerhard Anschütz ordnete das aktive Wahlrecht als subjektives Recht ein.101 Er vertrat damit die gegenteilige Ansicht wie Georg Meyer, dessen Lehrbuch er seit der sechsten Auflage 1905 fortführte. Dieser hatte zwar die subjektiv-rechtliche Qualität des Wahlrechts nicht explizit ausgeschlossen, er hatte jedoch den funktionellen Charakter desselben hervorgehoben.102 Das passive Wahlrecht qualifizierte Anschütz hingegen weiterhin als bloße Fähigkeit, die keinen Rechtscharakter habe. Dennoch sah er die Ausübung des Wahlrechts als staatsorganschaftliche Handlung, weil sie Beteiligung an der Bildung des Staatswillens darstelle.103 Auch Richard Thoma zählte das Wahlrecht im von ihm und Gerhard Anschütz herausgegebenen Handbuch des Staatsrechts von 1932 zum Kreis der staatsbezogenen subjektiven öffentlichen Rechte der Deutschen. In expliziter Anlehnung an Jellinek rechnete er das Wahlrecht dem „status activus“ zu. Er sah das Wahl- und Stimmrecht als „Kombination von negatorischen Ansprüchen auf Nichthinderung und positiven Ansprüchen auf Eintragung in Verzeichnisse sowie Entgegennahme und Verwertung des Wahl- und Stimmzettels“.104 Allerdings räumte er ein, dass die am Wahltag über 20 Jahre alt sind, hob also die Wahlberechtigung von Frauen nicht mehr eigens hervor. 98 G. Kaisenberg, Artikel 125, Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis, in: Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. II, 1930, S. 161 (165). 99 G. Kaisenberg, Artikel 125, Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis, in: Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. II, 1930, S. 161 (165). 100 G. Kaisenberg, Artikel 125, Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis, in: Nipperdey, Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. II, 1930, S. 161 (162). 101 G. Meyer, Deutsches Staatsrecht, Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von G. Anschütz, 7. Aufl., 1919, S. 345 f. In seinem Kommentar zur Weimarer Reichsverfassung, G. Anschütz, Die Verfassung der Deutschen Reiches vom 11. August 1919: Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 14. Auflage, 1933, äußerte er sich hingegen nicht zur Rechtsnatur des Wahlrechts. 102 Sie hierzu oben in diesem Abschnitt unter B. I. 3. a), S. 29 ff. 103 G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts. Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von G. Anschütz, 7. Aufl., 1919, § 99, S. 346, Fn. 2. 104 R. Thoma, Das System der subjektiven öffentlichen Rechte und Pflichten, in: Anschütz/ ders., HStR, Bd. II, 1932, § 102, S. 607 (618).
I. Historische Deutung des Wahlrechts
39
sowohl in der Reichsverfassung als auch in den Landesverfassungen die Wahlrechte nicht als klagbare subjektive Rechte ausgestaltet seien. Auch in der deutschen Staatsrechtslehre der späten Weimarer Zeit (1928) wurde diese Theorie namentlich von Carl Schmitt vertreten: „Das Wahl- und Stimmrecht ist nicht ein Recht in dem Sinne, dass es zur freien Verfügung des Einzelnen stünde (wie das Wahlgeheimnis, dessen Heterogenität sich an diesem Gegensatz besonders zeigt), es ist aber auch nicht bloßer ,Reflex‘ des Verfassungsgesetzes, sondern eine öffentliche Funktion und konsequenterweise ebenso sehr eine Wahl- und Stimmpflicht, weil es nicht vom Einzelnen als Privatmann, sondern als Staatsbürger, also kraft eines öffentlich-rechtlichen Status ausgeübt wird.“105 Als Konsequenz sah Schmitt die Wahl- und Stimmpflicht, die aber dennoch in den meisten Staaten nicht gezogen sei.106 Dezidiert in Ablehnung der konstitutionellen Lehre vom Wahlrecht beschrieb Herbert Graichen 1932 in seiner Dissertation über „Das Wahlrecht in der repräsentativen Demokratie“ die Funktion des Wahlrechts in der Demokratie und schloss dadurch auf seine Rechtsnatur.107 Für den Bürger im demokratischen Staat sei der Wahlakt „Ausdruck seiner Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft, sein Bekenntnis zu seinem Staat“. In der Demokratie erübrige sich die Streitfrage, ob das Wahlrecht ein individuelles Recht oder eine Funktion sei. Die Demokratie habe den Dualismus zwischen Staat und Volk beseitigt, das Wahlrecht könne sich also nicht mehr gegen den Staat richten. Es sei vielmehr Grundlage der staatlichen Ordnung der Demokratie. Als Funktionseinrichtung des Staates sei es eine öffentlich-rechtliche Funktion, die der Wähler als Ausdruck seiner Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft ausübe. Diese Betrachtung sah er gerade in Abgrenzung zum „konstitutionellen Konservatismus“, nach dem das Wahlrecht ein vom Staat gewährtes Privileg gewesen sei, und zum liberalen Standpunkt, der das Wahlrecht als im individuellen Interesse begründetes Recht sehe. Diese Ansicht ist besonders hervorzuheben, weil sie eine funktionelle Stellung des Wählers gerade in der Demokratie als gegeben sah. Einige der Stimmen, die sich im Kaiserreich zum Wahlrecht geäußert hatten, wiederholten sich in der Weimarer Republik in gleicher Weise und übertrugen die in der Monarchie entwickelten Ansätze auf den demokratischen Kontext der Weimarer Reichsverfassung. So übernahm Otto Mayer seine in der ersten Auflage seines Lehrbuchs geäußerte Ansicht, das Wahlrecht sei zugleich ein Recht und eine Funktion, unverändert in die nächsten Auflagen seines Lehrbuchs.108 Ebenso sah Hans Kelsen das Wahlrecht 1925 in seiner „Allgemeine[n] Staatslehre“ weiterhin als 105 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 254; aber auch H. Liermann, Das Deutsche Volk als Rechtsbegriff, 1927, S. 140 f., sah das Volk zu dieser Zeit als Staatsorgan. 106 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 254. 107 Hierzu und zum Folgenden: H. Graichen, Das Wahlrecht in der repräsentativen Demokratie, 1932, S. 10. 108 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrechts, Bd. I, 1895, S. 114, Fn. 21, wie auch in der 3. Aufl. 1924, S. 110, Fn. 12.
40
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
ein subjektives Recht der Wähler,109 wie er es auch schon 1911 in seinen „Hauptprobleme[n] der Staatsrechtslehre“ getan hatte.110 Auch wenn Kelsen seine Ausführungen in der allgemeinen Staatslehre explizit auf die mittelbare Demokratie bezog, stimmen seine Ausführungen im Ergebnis mit denen von 1911 überein: Kelsen vertrat 1925 die Auffassung, die Bürger hätten ein subjektives Recht „auf Mitgliedschaft im Parlament und das Recht hier mitzureden und mitzustimmen“. Er rechnete es den „politsche[n] Rechte[n]“ zu, zu denen die Rechte gehörten, die der Rechtserzeugung dienen.111 Auch Fritz Fleiner vertrat 1928 weiterhin die Ansicht, dass das Wahlrecht primär eine Pflicht und das Wählen eine staatliche Funktion sei.112 Dies zeigt, dass die Rechtsnatur des Wahlrechts auch als abstraktes Problem unabhängig von einer bestimmten Staatsform beurteilt wurde. In der Weimarer Staatsrechtslehre hat sich die Lehre vom Wahlrecht als subjektivem Recht gegenüber dem Kaiserreich weit mehr durchgesetzt. Dies entsprach der schon in der Verfassung angelegten subjektiv-rechtlichen Sicht auf die Modalitäten der Wahl (Wahlfreiheit, Wahlgeheimnis), war aber auch der neuen parlamentarisch-demokratischen Staatsform geschuldet. Dennoch fanden sich weiterhin Vertreter, die das Wahlrecht nicht als subjektives Recht sahen. Die von Laband entwickelte Ansicht von der lediglich reflexartigen Begünstigung des Einzelnen durch das Wahlrecht, die eine Gewährung des Wahlrechts um des Einzelnen willen gänzlich ablehnt, ist allerdings in dieser Zeit sehr zurückgetreten. Ersetzt wurde sie durch eine organschaftliche Betrachtungsweise des Volkes, die zwar die individuelle Begünstigung des Einzelnen durch das Wahlrecht nicht in den Vordergrund stellt, allerdings auch den Einzelnen nicht bloß als reflexartig begünstigt sieht. Es lässt sich wohl davon sprechen, dass der Einzelne in der Weimarer Staatsrechtslehre auch im Wahlrecht mehr in den Blick gerückt ist, obwohl die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts auch in der Weimarer Republik bis zum Schluss offengeblieben ist.113
4. Schweizer Lehre Die Ansichten über die Rechtsnatur des Wahlrechts sind in der Schweiz vor dem Hintergrund der Referendumsdemokratie zu sehen. Die Mitwirkung des Volkes an der staatlichen Willensbildung erschöpft sich hier nicht in der Teilnahme an Wahlen, vielmehr stehen dem Volk darüber hinaus Gesetzgebungsrechte zu, die es durch die Initiative und das Referendum ausüben kann.114 Die auch als „halbdirekte“115 De-
109 110 111 112 113 114
H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 152. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, S. 680 f. H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 152. F. Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 1928, § 12, S. 179, Fn. 46. So auch E. Schiffer, Wahlrecht, in: HVerfR, 1983, S. 295 (306). Art. 138 ff. Schweizer Bundesverfassung.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
41
mokratie bezeichnete Schweizer Demokratie erscheint dabei als „Verunklarung des ursprünglichen Demokratiekonzepts“,116 also einer direkten Demokratie. Das Volk als verfassungsrechtliche Größe ist dementsprechend in der Schweiz deutlich stärker präsent als in Deutschland. Das Wahlrecht existiert hier neben dem Stimmrecht der Bürger bei Referenden, beide werden meist zusammen erwähnt. Überwiegend wird der Begriff des Stimmrechts für alle Formen der Stimmabgabe, also auch für solche bei Wahlen verwendet.117 Die Schweizer Lehre beschäftigte und beschäftigt sich noch immer mit diesen Rechten intensiver als die deutsche unter dem Begriff „Volksrechte“ oder „politische Rechte“.118 Eine widersprüchlich scheinende Stellung zu der Rechtsnatur politischer Rechte insgesamt bezog 1936 Hans Huber.119 Er stellte fest, dass die „politischen Staatsbürgerrechte“ eigentlich Pflichten seien, die allerdings nicht mit Sanktionen versehen seien. Zu diesen zählte er im Wesentlichen Rechte auf Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung, also auch das aktive Wahlrecht. Eine Nichtausübung dieser Rechte durch alle Bürger könne den Staat stilllegen. Außerdem sei in der Demokratie das Volk auch Staatsorgan und es läge hier ein Widerspruch im Grundrechtsgebäude. Denn Staatsorgane hätten keine Rechte auf ihre Zuständigkeiten; ebenso hätten die Personen, die die Staatsorgane bilden, auch kein Recht, Organ sein zu dürfen. Die Ausgestaltung der politischen Staatsbürgerrechte als Grundrechte – die er dennoch anerkennt – hätte aber den Sinn, diese Rechte als „Errungenschaften“ zu kennzeichnen. Die Ausübung von Rechten werde nach Ansicht Hubers verantwortungsvoller gehandhabt als die von Pflichten. Außerdem ermögliche die Ausgestaltung als Grundrecht die gerichtliche Kontrolle der politischen Rechte, die aus Gründen der Rechtssicherheit auch nötig wäre. Huber qualifizierte die politischen Rechte also letztendlich sowohl als Organkompetenzen und als subjektive Rechte in Form von Grundrechten, auch wenn er dies selbst für widersprüchlich hielt. Insgesamt blieben seine Ausführungen im Vagen und er scheint versucht zu haben, sich so wenig wie möglich festzulegen. Zaccaria Giacometti vertrat 1941 die Auffassung, dass die Gesamtheit der Stimmberechtigten das höchste Staatsorgan bilde.120 Alle Stimmfähigen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, seien automatisch zum Staatsorgan berufen. Die politischen Rechte, zu denen Giacometti neben dem Stimmrecht bei Referenden 115
P. Mahon, La citoyenneté active en droit public suisse, in: Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, § 20, S. 335 (337). 116 P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 15. 117 So z. B. P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 16. 118 Zur Uneinheitlichkeit der Begriffe P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 15, der darauf hinweist, dass unter „Volksrechten“ traditionell nur die Initiative und das Referendum einschließlich der darauf folgenden Volksabstimmungen verstanden würden. 119 Hierzu und zum Folgenden: H. Huber, Die Garantie der individuellen Verfassungsrechte, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 55 (1936), S. 1a (131a). 120 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 207.
42
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
auch das Wahlrecht zählte, seien Organkompetenzen121 und damit objektives Recht.122 Die politischen Rechte seien deshalb keine subjektiven Rechte, weil sonst der Gesamtakt, der aus der Zusammenfassung der einzelnen Stimmabgaben hervorgeht, den einzelnen Stimmberechtigten als Rechtssubjekt zugerechnet werde, dieser dann aber nicht Staatsakt wäre. Auch liege es nicht im Interesse des Stimmberechtigten, ein subjektives Recht auszuüben, sondern vielmehr, an der Bildung des staatlichen Willens im Sinne der Erzeugung eines Gesamtaktes teilzunehmen. Es widerspreche gerade dem Wesen des Volkes als höchstem Staatsorgan, dass die politischen Rechte als subjektive Rechte gedeutet würden, denn als Anspruchsgegner kämen nur untergeordnete Staatsorgane in Betracht, was theoretisch nicht möglich wäre. Die Konstruktion der politischen Rechte als subjektive Rechte widerspreche dem Wesen der Referendumsdemokratie. Nur dann, wenn politische Rechte nicht als tatsächlich durchgesetzt erschienen, sondern nur als Postulate oder Konzessionen, sei eine Konstruktion als politische Rechte jedenfalls verständlich, wenngleich sie theoretisch unmöglich bleibe.123 Auch als objektives Recht stünden die politischen Rechte aber auch im Interesse des einzelnen Stimmberechtigten, sie wiesen einen hohen Grad an Individualisierung auf124 und dienten dem Schutz des Eigenwerts des Individuums.125 Denn die politische Freiheit erfahre ihre Realisierung in den politischen Rechten.126 Die Idee der politischen Freiheit bestehe gerade darin, dass die staatliche Herrschaft von einer möglichst großen Zahl von Bürgern ausgeübt werden müsse.127 Es sei aber begrifflich unmöglich, dass die Stimmberechtigten ein subjektives Recht auf die Organtätigkeit hätten.128 Wenn das Wahlrecht als subjektives Recht erscheine, dann deshalb, weil es dessen Träger gegenüber anderen Staatseinwohnern als privilegiert erscheinen lasse.129 Die Ablehnung Giacomettis politischer Rechte als subjektive öffentliche Rechte fügte sich ein in eine generelle Ablehnung subjektiver öffentlicher Rechte.130 Giacometti lehnte diese aber nicht ab, um den Einzelnen und seine Interessen zu verleugnen; vielmehr seien im freiheitlichen Staate subjektive öffentliche Rechte nicht erforderlich. Diese seien nur
121 Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. I, 1960, S. 4, 313, 314. 122 F. Fleiner/Z. Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949, § 43, S. 429. 123 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 209. 124 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 210. 125 Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. I, 1960, S. 4, 313, 314. 126 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 68, 210; F. Fleiner/Z. Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949, § 43, S. 429. 127 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 68. 128 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 211. 129 F. Fleiner/Z. Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949, § 43, S. 429. 130 Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. I, 1960, S. 312 ff.
I. Historische Deutung des Wahlrechts
43
denkbar als Schranke einer staatlichen Allmacht. Im freiheitlichen Staate sei der Einzelne aber ohnehin nicht schutzloses Objekt der Staatsgewalt.131 Diese Interpretation des Wahlrechts ist von Giacomettis Schüler Urs Affolter 1948 weitergeführt worden. Auch er war der Ansicht, dass das Volk das höchste Staatsorgan in der Demokratie sei.132 Die Organträger würden von Rechts wegen bei Erfüllung bestimmter normativer Voraussetzungen, die sich unmittelbar aus der Verfassung ergeben, berufen.133 Auch er maß den politischen Rechten einen hohen Individualisierungsgrad bei und definierte sie als den objektiv-rechtlichen individualisierten Ausdruck der normativen Stellung des Aktivbürgers als unmittelbar berufenes Teilorgan des Staatsorgans Volk.134 Die Formel, dass politische Rechte objektiv-rechtliche Organkompetenzen seien, würde den funktionellen Standort der politischen Rechte vernachlässigen, die sich nicht aus der demokratischen Rechtsorganisation lösen ließen. Ein subjektives öffentliches Recht als eine im individuellen Interesse geschaffene Berechtigung des Individuums, vom Staate ein gewisses Verhalten zu verlangen, dessen Ausübung in das Belieben des Rechtsinhabers gestellt ist,135 scheide daneben aus. Auch er machte dazu das Argument seines Lehrers fruchtbar, dass aus der Summe individueller Rechtsausübungen kein Staatswille hervorgehen könne.136 Die Willen müssten dann den Handelnden selbst zugerechnet werden und könnten nicht dem Staat über die Handlung des Organs zugerechnet werden. Affolter schloss aber auch deshalb subjektive Rechte aus, weil zwischen Staat und Organ solche nicht konstruiert werden könnten. Die gleichzeitige Qualifizierung der politischen Rechte als Organkompetenzen und subjektiv-öffentliche Rechte sei damit ausgeschlossen.137 1995 konstatierte dann Pierre Tschannen, dass die Ansicht, das Stimmrecht sei zugleich Individualrecht und Organkompetenz, fester Bestandteil der Schweizer Rechtsprechung sei.138 Er selbst ist der Ansicht, das Stimmrecht entziehe sich einer dogmatisch eindeutigen Klassifikation. Dem Stimmrecht wohne die Zweiheit der 131
Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. I, 1960, S. 315. 132 U. Affolter, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie und der Begriff der politischen Rechte, 1948, S. 60. 133 U. Affolter, ebenda, S. 83. 134 U. Affolter, ebenda, S. 101. 135 U. Affolter, ebenda, S. 107. 136 U. Affolter, ebenda, S. 109 f. 137 U. Affolter, ebenda, S. 110, 111. 138 P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 20, mit Nachweisen aus der Schweizer Rechtsprechung in Fn. 34. Gleiches könnte man auch von der Schweizer Literatur behaupten; ähnlich sieht dies z. B. auch K. Spühler, Die Schranken der poltischen Rechte nach der Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1962, S. 9: das Recht des Bürgers an Wahlen teilzunehmen, sei „in erster Linie Ausdruck der Freiheit des Bürgers zum Staat“, auch demokratische Freiheit genannt, aber gleichzeitig auch Organkompetenz; C. Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, 1990, S. 93 f.
44
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
Perspektive, die des Einzelnen und die des Kollektivs, inne. Dieser Dualismus auch in der Einordnung sowohl als Individualrecht als auch als Organkompetenz sei deshalb theoretische Notwendigkeit.139 Die neue Schweizer Bundesverfassung vom 18. April 1999140 garantiert die politischen Rechte, darunter das Wahlrecht, im Grundrechtskatalog.141 Der Inhalt der politischen Rechte ist allerdings im Abschnitt über Volk und Stände festgelegt.142 Die Verfassungsgeber scheinen die Deutungen, die das Wahlrecht sowohl als individuelles Recht als auch als Organkompetenz sehen, in der Verfassungsgebung berücksichtigt zu haben. Dementsprechend wird in der Schweizer Literatur – beispielsweise von Pascal Mahon – nun verstärkt vertreten, dass die politischen Rechte Grundrechte seien, mit der Ausübung der politischen Rechte die Wahlberechtigten aber zugleich eine Aufgabe des Staatsorgans „Aktivbürgerschaft“ erfüllen.143 Aus diesem Grund seien die politischen Rechte auch ein Amt und eine Pflicht – jedenfalls des Wahlkörpers als Ganzem. Die Schweizer Lehre war und ist sich der Funktion des Wahlrechts deutlich bewusster als die Staatslehre in anderen Ländern. Sie erkennt die Funktion des Volkes innerhalb der demokratischen Staatsorganisation, aber auch die Bedeutung der Partizipation des Einzelnen hieran. Dementsprechend hat sie ein differenziertes Bild vom Wahlrecht entwickelt. Die Bestrebungen, das Wahlrecht ausschließlich als Organkompetenz zu sehen, haben den individual-begünstigenden Charakter des Wahlrechts bereits registriert und berücksichtigt, auch haben sie die Bedeutung der Beteiligung des Einzelnen an der Staatswillensbildung zur Verwirklichung der politischen Freiheit in ihre Lehre eingeschlossen. Wenn sie daneben eine Qualifizierung als subjektiv-öffentliches Recht ausschließen, resultiert dies nicht aus einer Aberkennung der Individualbegünstigung, sondern aus der angenommenen Unvereinbarkeit des subjektiven Rechts mit der Organstellung oder der angenommenen mangelnden Notwendigkeit subjektiver öffentlicher Rechte im freiheitlichen Staat. Die jüngere Lehre versucht die Individualbegünstigung in ein subjektives-öffentliches Recht zu deuten, zugleich aber die Qualifikation als Organkompetenz anzuerkennen. Sie erkennt aber, dass diese Konstruktion nicht ohne Spannungen ist.
139
P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 20. Diese hat die Verfassung vom 29. Mai 1874 ersetzt und hatte zum Ziel, „die verfassungsrechtlichen Entwicklungen ausserhalb des eigentlichen Verfassungstextes einzufangen“, außerdem sollte sie formelle und inhaltliche Mängel der revidierten Verfassung beheben (BBl 1997 I 19 f.). 141 Art. 34 Schweizer Bundesverfassung, der sich im Abschnitt „Grundrechte“ befindet. 142 Art. 136 Schweizer Bundesverfassung. 143 P. Mahon, La citoyenneté active en droit public suisse, in: Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, § 20, S. 335 (337, Rn. 6, 7). 140
II. Kategorisierung der Ansichten
45
II. Kategorisierung der Ansichten Ein kurzer Überblick über die behandelten Rechtsordnungen in unterschiedlichen historischen Kontexten zeigt, dass über die Rechtsnatur des Wahlrechts zu keiner Zeit Einigkeit bestand. Es standen sich vielmehr stets konträre und sich gegenseitig ausschließende Ansichten gegenüber. Auffällig ist, dass die unterschiedlichen Ansichten unabhängig von der Staatsform vertreten wurden. Sie lassen sich hauptsächlich in drei Kategorien unterteilen: die funktionalen Theorien, die individualrechtlichen Theorien, die das Wahlrecht als Recht des Individuums betrachten, und die dualistischen Theorien, die beide Elemente im Wahlrecht enthalten sehen.144
1. Individual-rechtliche Theorien Individual-rechtliche Theorien wurden – wie gezeigt – schon nach der Französischen Revolution vertreten. Sie lassen sich danach unterscheiden, ob ein individuelles Recht aus dem Naturrecht abgeleitet oder das Wahlrecht als ein vom Staat verliehenes Recht betrachtet wird.145 Während in der französischen Lehre ein individuelles Recht des Einzelnen an der Staatswillensbildung als Naturrecht verstanden wurde, wurde ein solches Recht sowohl in der englischen als auch in der deutschen und der schweizerischen Lehre als subjektives Recht aufgefasst, das sich erst aus dem positiven Recht ergibt. Aus diesem Grund werden die Konzeptionen zum Teil auch unterschieden.146 Ihnen ist jedoch gemeinsam, dass sie den Einzelnen als individuell berechtigt sehen, an der Staatswillensbildung teilzunehmen. Diese Ansicht hatte in allen Rechtsordnungen Befürworter. Sie wurde konsequenterweise von denen nicht vertreten, die subjektive Rechte gegen den Staat insgesamt ablehnten.147 Andererseits wurde sie auch nicht als zwangsläufige Konsequenz der Anerkennung subjektiver Rechte an sich gezogen.148 Die Anerkennung einer subjektiv-rechtlichen Qualifizierung des Wahlrechts nimmt gegenüber der Anerkennung subjektiver Rechte insgesamt eine separate Entwicklung. Die Folge individualrechtlicher Theorien – insbesondere naturalistischer – dass das Wahlrecht ausnahmslos allen Personen zustehen müsste, wurde von Kritikern dieser Theorie er144
Die Kategorien stammen von M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 152 ff., der diese in Bezug auf die Rechtsnatur politischer Rechte insgesamt entwickelt und sich ausführlich mit der Rechtsnatur, dem Inhalt und der Geschichte politischer Grundrechte auseinandersetzt, zu denen er auch das Wahlrecht zählt. Ähnliche Systematisierungen werden aber teilweise auch nur anhand der Einordnung des Wahlrechts vorgenommen; so z. B von W. Keitz; Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 4 f. 145 So auch A. Auer, Les droit politiques dans les cantones suisses, 1978, S. 10 ff. 146 So z. B. bei A. Auer, Les droits politiques dans les cantones suisses, 1978, die Unterscheidung in „la conception jusnaturaliste“ (S. 11) und „la conception subjective“ (S. 14). 147 So auch schon F. Stier-Somlo, Vom parlamentarischen Wahlrecht, 1918, S. 252; Endnote 13; M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 152. 148 M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 152.
46
B. Theoretische Zugänge zum Wahlrecht in Europa
kannt.149 Von den Verfechtern dieser Theorie wurde die Tatsache, dass das Wahlrecht tatsächlich nicht allen zustand, der Kreis der Wahlberechtigten vielmehr oftmals sehr beschränkt war (Ausschluss von Frauen, Klassenwahlrecht), nicht als Hindernis ihrer Richtigkeit gesehen. An der individual-rechtlichen Theorie der englischen Lehre, die das Wahlrecht an Grundbesitz knüpfte und es als Privatrecht verstand, wurde zu Recht Kritik geübt, denn sie verkannte, dass der Einzelne nicht als Privatmann, sondern als Staatsbürger wählt.150
2. Funktionale Theorien/Organtheorien Die funktionalen Theorien zur Rechtsnatur des Wahlrechts lassen sich unterscheiden in solche, die das Wahlrecht als bloße Funktion sehen und den Einzelnen nur als reflexartig vom objektiven Recht begünstigt betrachten – sie werden als rein funktionale oder ganzheitliche Auffassung bezeichnet151 – und in die sog. Organtheorien. Rein funktionale Ansichten wurden – wie gezeigt – vor allem im Deutschen Reich vertreten. Sie sprechen dem Wähler jedwedes durch das Wahlrecht berücksichtigte Interesse ab. Der alleinige Zweck des Wahlrechts ist nach diesen Theorien die Sicherstellung staatlicher Funktionen. Daneben bestehen die Organtheorien. Sie sehen im Wahlrecht ebenfalls kein individuelles Recht des Einzelnen, sie erkennen jedoch einen „hohen Individualisierungsgrad“152 dieser Normen an. Durch die Anerkennung des Einzelnen als Teil eines Staatsorgans wird demnach auch seinem individuellen Interesse an der Mitwirkung bei der staatlichen Willensbildung Rechnung getragen; das Wahlrecht wird zum individualisierten Ausdruck der Organstellung.153 Die Organtheorie bettet den Einzelnen zwar ebenfalls funktionell ein, allerdings in einer organschaftlichen Position, die ihn aber gerade als Individuum berücksichtigt. Das Wahlrecht wird als Ausdruck der politischen Freiheit des Einzelne gesehen.154 Sie unterscheiden sich von den individualistischen Theorien dadurch, dass dem Einzelnen kein Anspruch auf oder durch die Wählerstellung gewährt wird.
149 Z. B. von A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 8. Aufl., 1927, S. 398 ff. 150 K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 5. 151 M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 152; K. Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht, Bd. II, 1932, S. 6, spricht von „ganzheitlichen Auffassungen“. 152 M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 154. 153 U. Affolter, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie und der Begriff der politischen Rechte, 1948, S. 89. 154 Z. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 1941, S. 210, 229.
III. Schlussfolgerungen für den weiteren Gang der Untersuchung
47
3. Dualistische Theorien Nach den dualistischen Auffassungen hat das Wahlrecht eine doppelte Rechtsnatur. Es ist demnach sowohl subjektives Recht als auch organschaftliches Recht. Die dualistischen Auffassungen lassen sich danach unterscheiden, ob sie die Organkompetenz und das subjektive Recht als gleichzeitig vorliegend sehen oder subjektives Recht und Organkompetenz sukzessive aufeinanderfolgen sollen. Während die aktuelle Schweizer Lehre eine dualistische Auffassung vertritt, in der das Organrecht und das subjektive Recht gleichzeitig bestehen, waren frühere Lehren hiermit deutlich zurückhaltender. In der deutschen Staatsrechtslehre der Kaiserzeit war es Georg Jellinek, in der französischen Lehre war es Carré de Malberg, die subjektives Recht und Organkompetenz als unvereinbar ansahen, jedoch – mit jeweils unterschiedlicher Konstruktion – sowohl ein subjektives Recht als auch die Organstellung des Wählers annahmen. Die dualistischen Theorien erwecken den Anschein einer Verlegenheitslösung, in der nicht klar zu einer der Theorien Stellung bezogen wird. Dies lässt sich insbesondere denjenigen dualistischen Theorien vorwerfen, die das subjektive Recht und die Organkompetenz als gleichzeitig verwirklicht sehen, weil das Wahlrecht bei ihnen eine Zwitterstellung einnimmt und keiner Kategorie ganz zugerechnet wird. Es wird nicht klar, wie die Unterschiede der Kategorien in ihrer Konstruktion Berücksichtigung finden können. Sie selbst sehen hierin aber die Konsequenz der Doppelfunktionalität des Wahlrechts.155
III. Schlussfolgerungen für den weiteren Gang der Untersuchung Es lässt sich festhalten, dass das Meinungsspektrum über die Rechtsnatur des Wahlrechts sowohl in der deutschen Lehre vor Inkrafttreten des Grundgesetzes als auch in anderen Staatslehren breit war und weiterhin ist. Zwar lassen sich die Theorien durchaus kategorisieren, erstaunlich ist jedoch die Vielfalt der Konstruktionen, die hierzu vertreten wurden. Auch die für die Beratungen im Parlamentarischen Rat besonders interessante Weimarer Staatsrechtslehre hat keine einheitliche Ansicht über das Wahlrecht hervorgebracht, auf die in den Beratungen über das Grundgesetz hätte aufgebaut werden können. Festzuhalten ist jedoch, dass funktionalistische Theorien, die dem Wahlrecht lediglich den Wert eines Rechtsreflexes beimessen und den Einzelnen lediglich zum Funktionär der staatlichen Ordnung machen, in der Demokratie keinen Bestand haben können, weil sie den Eigenwert des Individuums negieren.
155
P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 24.
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat Die Frage des Wahlsystems wurde im Parlamentarischen Rat ausführlich diskutiert. Auffällig vor dem Hintergrund des Streitstandes noch in der Weimarer Republik ist jedoch, dass die Frage, ob das Wahlrecht ein Individualrecht ist, hingegen nicht diskutiert wurde. Es wurde vielmehr die Prämisse zugrunde gelegt, dass das Wahlrecht ein solches sei, jedenfalls von der Verfassung zu einem solchen gemacht werden könne. Während der Beratungen des Parlamentarischen Rats war die Einführung eines Grundrechtsartikels geplant, der das Wahlrecht gewährleisten sollte. Die Beratungen über ein subjektives Wahlrecht fanden also nicht im Rahmen der Beratungen über den jetzigen Art. 38 GG statt. Hier wurden vielmehr nur Fragen des Wahlsystems erörtert.1 So wurden das Wahlsystem und das Wahlrecht der Bürger unabhängig voneinander behandelt, was auch zu Unklarheiten darüber führte, inwieweit das Wahlsystem das Wahlrecht einschränken dürfe, wie die Darstellung der Diskussion im Parlamentarischen Rat zeigen wird. Auch kam im Zusammenhang mit dem Wahlrecht die Diskussion über eine Wahlpflicht auf. Diese wurde aber ohne eine Erörterung der Frage geführt, ob das Wahlrecht ein organschaftliches Recht und seine Ausübung deshalb ohnehin verpflichtend sein könnte. Als organschaftliches Recht wurde das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat zu keiner Zeit diskutiert. Grundlage der Diskussionen über das Wahlrecht war der Art. 12 des Verfassungsentwurfs von Herrenchiemsee, der lautete: „Wahl- und Stimmrecht der Staatsbürger werden gewährleistet.“
Zuständig für die Beratungen über die Grundrechte war der Ausschuss für Grundsatzfragen, während die Zuständigkeit für die Beratungen über das Wahlsystem dem Wahlrechtsausschuss oblag. Auch das Wahlrecht wurde dementsprechend im Ausschuss für Grundsatzfragen beraten. Dieser beriet in seiner sechsten Sitzung am 5. Oktober 1948 über einen von einem Unterausschuss ausgearbeiteten Grundrechtekatalog, der in seinem Art. 14 erweiterte Ausführungen über das Wahlrecht enthielt. Die Fassung des Herrenchiemseer Entwurfs schien zu eng gefasst. Diese neue Fassung war an Art. 125 WRV angelehnt, der die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis verbürgt hatte. Der Entwurf wurde aber um weitere Ausführungen zur Wahlfreiheit ergänzt. Diese erschien ihrerseits zu unbestimmt, weil unklar war, ob hiermit die Freiheit der Wahl oder nur die Freiheit der Wahlentscheidung 1 Fälschlich zieht deshalb auch M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 148 f., den Schluss, dass über ein subjektives Wahlrecht im Parlamentarischen Rat nicht gesprochen worden sei.
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
49
gemeint sei. Außerdem sollte zwischen Wahlen und Abstimmungen unterschieden werden.2 Die Fassung lautete wie folgt: Art. 14: „Die Freiheit des Rechts zu wählen oder abzustimmen sowie das Wahlgeheimnis werden gewährleistet. Jede Beschränkung der Freiheit der Entscheidung bei einer Wahl oder Abstimmung ist verboten. Eine solche Beschränkung ist insbesondere gegeben, wenn die Wahlvorbereitungen oder das Wahlverfahren dem Wähler die freie Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten, Parteien oder Parteiengruppen unmöglich macht.“
An der Formulierung dieses Artikels zeigt sich besonders die enge Verknüpfung des Rechts zu wählen und des Wahlsystems. Es tritt hier die Befürchtung zutage, dass das Wahlsystem das Recht zu wählen konterkarieren könnte. Der Redaktionsausschuss äußerte später dann auch Bedenken, dass der Artikel insofern zu eng sein könnte, als er selbst das Wahlsystem zu sehr einschränken würde, indem er eine Mindestzahl für die Unterstützung von Wahlvorschlägen ausschließen könnte.3 Auch über die Verankerung des gleichen und geheimen Stimmrechts in diesem Artikel des Grundrechtekatalogs war in der Sitzung des Unterausschusses des Parlamentarischen Rates nachgedacht worden. Stattdessen wurde dann aber der Satz 3 eingefügt, der lediglich die Beschränkung der Wahlfreiheit näher umschrieb. Außerdem war die Regelung einer Wahlpflicht in diesem Entwurf vom Unterausschuss diskutiert worden. Abgesehen davon, dass sie von den meisten Ausschussmitgliedern des Unterausschusses abgelehnt wurde, sollte die Frage der Wahlpflicht aber der späteren Rahmengesetzgebung überlassen werden.4 Die vom Redaktionsausschuss übernommene Fassung5 des Artikels wurde dann in der 25. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 24. November 1948 noch einmal vor dem Hintergrund der Frage diskutiert, was mit der „Freiheit der Wahl“ gemeint sei.6 Hierbei verteidigte der Abgeordnete Heile die Ansicht, dass das Wahlrecht zugleich eine Pflicht beinhalte; diese sei die wichtigste Bürgerpflicht.7 Es 2 So die Ausführungen des Berichterstatters H. Wunderlich (SPD) in der sechsten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 5. 10. 1948, abgedruckt in: Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/I, S. 132. 3 Siehe die Anmerkung zu Art. 14 der Stellungnahme des Allgemeinen Redaktionsausschusses zu den Formulierungen der Fachausschüsse, Drucks. Nr. 282 vom 16. 11. 1948, Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7, S. 40. 4 So die Angaben des Berichterstatters Wunderlich in der sechsten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 5. 10. 1948, abgedruckt in: Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/I, S. 133. 5 Siehe Art. 14 der Stellungnahme des Allgemeinen Redaktionsausschusses zu den Formulierungen der Fachausschüsse, Drucks. 282 vom 16. November 1948, abgedruckt in: Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7, S. 40. 6 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 706 ff. 7 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 706; so auch schon am Rande in der dritten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 21. September 1948, Bd. 5/I, S. 57.
50
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
könne deshalb nicht auf eine Stufe mit jedem beliebigen anderen Recht gestellt werden. Das Wählen habe den Zweck, dass der Staat, bzw. diejenigen, die den Staat zu führen haben, erkennen können, was das Volk denkt. Das Fernbleiben von der Wahl sei aber sehr oft keine Wahl. Vielmehr sei ein sich Fernhalten von politischen Dingen im Allgemeinen ein Relikt der Nazizeit. Das Nichtwählen sei mehr „Drückebergerei“, die er auch als „Wählerstreik“ bezeichnete.8 Er schlug deshalb vor, der Verletzung der Wahlpflicht – aus heutiger Sicht eher fernliegend – mit einer Verdoppelung der Einkommenssteuer zu begegnen.9 Er untermauerte die Notwendigkeit einer Wahlpflicht auch mit der Möglichkeit der Einflussnahme auf die Entscheidung, zur Wahl oder Abstimmung zu gehen, dadurch, dass bisweilen die die bloße Teilnahme an der Wahl oder Abstimmung schon das Stimmverhalten erkennen lasse. Im Ausschuss fand schon die Wahlpflicht selbst, besonders aber ihre Sanktionierung, jedoch keine Zustimmung.10 Der Vorsitzende des Ausschusses für Grundsatzfragen von Mangoldt11 versuchte die Diskussion über eine Wahlpflicht mit dem Hinweis zu ersticken, dass über diese im Ausschuss schon eingehend gesprochen worden sei. Davon kann indes keine Rede sein. Die Wahlpflicht wurde zuvor nur in der Dritten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen vom 21. September 1948 im Zusammenhang mit der Pflicht zur ehrenamtlichen Tätigkeit angesprochen, die in einem ersten Entwurf der Grundrechte des Abgeordneten Bergsträßer in einem eigenen Artikel festgeschrieben werden sollte.12 Von Mangoldt hatte in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, diese Pflicht mit dem „status activus“ zu verbinden, ohne dass deutlich würde, was genau hiermit gemeint war. Auch die Frage des Rechts auf ein Amt hänge damit zusammen. Heile schlug hier vor, von einer Pflicht zur Ausübung bürgerlicher Ehrenrechte zu sprechen, was Heuss als die „Normierung einer Art Wahlpflicht“ identifizierte, die Heil als einziger mit Nachdruck befürwortete. Bergsträßer fragte daraufhin, wie „Drückeberger“ denn wirkungsvoll zur Ausübung des Wahlrechts gezwungen werden sollten. Auf den Vorschlag Heiles der Verdoppelung der Einkommensteuer ging Bergsträßer als Berichtender kommentarlos zum nächsten Artikel über. Trotz dieser bis dahin kargen Diskussion über die Wahlpflicht hat der Vorsitzende von Mangoldt weitere Diskussionen unterbunden. 8 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 708. Die Formulierung scheint zur Untermauerung seiner These etwas unglücklich gewählt, da gerade der Streik eine bewusste, zweckverfolgende Handlung ist. 9 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 707, so auch schon in der dritten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 21. September 1948, Bd. 5/I, S. 57. 10 Die Äußerungen des Abgeordneten Bergsträßer waren gar außerordentlich ablehnend. Siehe seine Äußerungen in der 25. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 24. November 1948, abgedruckt in: Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 707. 11 Zum Leben und Wirken Hermann von Mangoldts: A. O. Rohlfs, Hermann von Mangoldt (1895 – 1953). Das Leben des Staatsrechtlers vom Kaiserreich bis zur Bonner Republik, 1997. 12 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/I, S. 57.
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
51
In der 25. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 24. November 1948 äußerte der Abgeordnete Erhard, dass ihm eine gesonderte Gewährleistung des Rechts zu wählen in einem eigenen Artikel neben der Normierung der Wahl des Bundestages und einer Vorschrift über Wahlen in Länderverfassungen überflüssig zu sein schien.13 Es wurde in dieser Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen außerdem diskutiert, ob Sperrklauseln die Freiheit der Wahl, die ja grundrechtlich ausgestaltet werden sollte, beeinflussen. Heuss sah dies als Einschränkung dieser Freiheit,14 während von Mangoldt der Meinung war, dass Sperrklauseln sich nicht auf die Freiheit der Wahl, sondern nur auf das Wahlergebnis auswirken würden.15 Die Bedeutung der Freiheit der Wahl wurde in dieser Sitzung nicht mehr geklärt. Der Artikel 14 erhielt dann zum Abschluss der 25. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen die folgende Fassung: Das Recht zu wählen oder abzustimmen, die Wahlfreiheit sowie das Wahlgeheimnis werden gewährleistet. Jede Beschränkung in der Freiheit der Entscheidung bei einer Wahl oder Abstimmung ist verboten. Insbesondere darf durch die Vorschriften über die Wahlvorbereitungen und das Wahlverfahren dem Wähler die Möglichkeit freier Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten, Parteien oder Parteigruppen nicht genommen werden.16
In der 26. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 30. November 1948 hatte der Vorsitzende von Mangoldt einen Nachtrag zu dieser Fassung.17 Er wollte einen Hinweis einführen, dass über die Wahlberechtigung Verfassung oder Gesetz entscheiden. Denn das Recht zu wählen könne nicht allgemein gewährleistet werden, weil es hierzu Ausnahmen, beispielsweise Kinder, gäbe. Wenn es aber allgemein gewährleistet würde, müsse es jedem Staatsangehörigen zustehen. Deswegen müsste hier die Einschränkung durch Gesetz festgelegt werden, um nichts Falsches zu gewährleisten. Die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis müssten aber unbedingt daneben garantiert werden. Er unterschied explizit das Recht zur Wahl von der Wahlfreiheit, die die Freiheit darstelle, dieses Recht auszuüben. Dieses stehe hinter der Gewährung des Rechts zu wählen. Denn das Recht zu wählen könne zwar gewährt werden, ohne dass aber die Freiheit der Ausübung gewährt würde, wie dies
13
Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 707. 14 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 708. 15 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 709. 16 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 711. 17 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 712.
52
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
etwa in der Nazizeit oder der Ostzone der Fall gewesen wäre und sei. Man einigte sich deshalb auf die folgende Fassung des Absatzes 1: „Das Recht zu wählen oder abzustimmen, die Wahlfreiheit sowie das Wahlgeheimnis werden gewährleistet. Wer wahlberechtigt ist, entscheiden Verfassung oder Gesetz.“
Diese Fassung wurde in der vom Hauptausschuss in erster Lesung angenommenen Fassung des Grundgesetzes durch den Redaktionsausschuss in Art. 18 übernommen.18 In der 32. Sitzung am 11. Januar 1949 wurde der ehemalige Art. 14 in dieser ergänzten Fassung nun als Art. 18 im Ausschuss für Grundsatzfragen diskutiert.19 Das Recht zu wählen und die Wahlfreiheit waren nun also als unterschiedliche Rechte abgefasst. Es läge nahe, daraus zu schließen, dass die Wahlfreiheit dann auch die Freiheit umfassen sollte, der Wahl fern zu bleiben. Der Vorsitzende von Mangoldt unterschied nochmals explizit das Recht zu wählen und die Nichtentziehbarkeit dieses Rechts durch ein Gesetz zum einen und zum anderen die Wahlfreiheit, die bedeute, dieses Recht auch frei ausüben zu können. Ob damit allerdings auch die Freiheit gemeint war, der Wahl fernzubleiben erläuterte er nicht. Der Abgeordnete Hesse erklärte, die Wahlfreiheit heiße: „Ich darf wählen, wen ich will.“ Im Redaktionsausschuss war zuvor die Frage einer Wahlpflicht aufgeworfen worden, nämlich ob diese gesetzlich möglich wäre.20 Dies blieb aber im Ausschuss für Grundsatzfragen ebenfalls weiterhin unklar. Auch die 32. Sitzung des Grundsatzausschusses, in der letztmals der Art. 18 diskutiert wurde, brachte hierzu keine Lösung.21 Im Hauptausschuss wurde in zweiter Lesung in der 44. Sitzung am 19. Januar 1949 vom Abgeordneten Seebohm die Frage aufgeworfen, ob der Begriff der Wahlfreiheit die Gleichheit der Wahl einschließe. Seiner Auffassung nach sei diese ein Grundrecht, man könne sie wohl in der Wahlfreiheit sehen. Dies müsse aber ausdrücklich und unwidersprochen festgestellt werden.22 Er entfachte damit eine Diskussion darüber, dass eine dahin gehende Interpretation der Wahlgleichheit in Art. 18, dass die Stimme jedes Wahlberechtigten hinterher gleichwertig zum Ausdruck komme, eine Determinierung des Wahlsystems auf ein Verhältniswahlrecht sei.23 Der Abgeordnete Renner stellte aber fest, dass dies im Widerspruch zu den bisherigen Beratungen über das Wahlgesetz stünde, das eine gleichwertige Aus18
S. 96.
Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7,
19 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/ II, S. 948. 20 Siehe die Anmerkung 1 zu Art. 18 der vom Allgemeinen Redaktionsausschuss redigierten Fassung der Präambel und der Art. 1 – 29c vom 13. Dezember 1948, Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7, S. 143. 21 Ausschuss für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 948. 22 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1419. 23 So der Abgeordnete Kaufmann (CDU), Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1420.
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
53
wirkung der Stimmen vorsehe.24 Auch wurde von der Abgeordneten Wessel geäußert, dass eine Sperrklausel einen Eingriff in das Grundrecht der Wahlfreiheit bedeute, weil dadurch die Möglichkeit freier Entscheidung nicht gegeben sei.25 Sie wies außerdem darauf hin, dass es sich bei Art. 18 nicht um das Wahlrecht als solches handele, sondern darum, dass durch ein Wahlverfahren dem Wähler die freie Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten oder Parteien dem Wähler nicht genommen werden dürfe. Diese würde aber gerade durch eine Sperrklausel verhindert.26 Die Abgeordnete Wessel hatte also einen anderen Zugang zu dieser Grundrechtsbestimmung; sie sah das Recht zu wählen selbst nicht in ihr verbürgt. Die Diskussion im Hauptausschuss wurde ausgesetzt. Es sollte dem Wahlrechtsausschuss die Entscheidung darüber übertragen werden, was vom Inhalt des Art. 18 Grundrechtscharakter habe und was sich lediglich auf den Wahlvorgang und damit zusammenhängende Funktionen beziehe.27 Dieser besprach in seinem hierzu vorgelegten Gutachten, das das Ergebnis der Beratungen der 21. Sitzung vom 1. Februar 1949 war, allerdings nur die Frage der Vereinbarkeit von Sperrklauseln mit der Wahlfreiheit. Diese verneinte er und gab dementsprechend eine Empfehlung für die Streichung des Art. 18 ab.28 In dieser Sitzung des Wahlrechtsausschusses wurde die Frage einer Wahlpflicht auch hier diskutiert. Es wurden verschiedene Bedenken geäußert. Zum einen wurden Bedenken gegen einen Zwang an sich geäußert, es wurde aber auch die Wirksamkeit einer Wahlpflicht zur Bewusstmachung der Verpflichtungen gegenüber dem Staat bezweifelt. Der Abgeordnete Diederichs hielt einen Wahlzwang für unvereinbar mit einem Wahlrecht. Außerdem zog er die Parallele zum Abgeordneten und warf die Frage auf, ob dieser sich der Stimme enthalten könne, wenn der Wähler zur Abstimmung gezwungen würde.29 Er hielt die Nichtteilnahme an der Wahl ebenfalls für eine Wahlentscheidung. Ob die Nichtteilnahme stets eine Wahlentscheidung sei, bezweifelte der Abgeordnete Becker, er hielt eine Wahlpflicht allerdings mit der Wahlfreiheit aus Art. 18 für unvereinbar. Außerdem würde die Normierung eines Zwanges zur Wahl die wirkliche Anteilnahme der Menschen an den demokratischen Einrichtungen schwächen.30 Der Abgeordnete Finck wies darauf hin, dass eine moralische und demokratische Wahlpflicht ohnehin bestehe, die Einführung eines 24
Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1419 f. Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1419. 26 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1421. 27 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1423. 28 Siehe die Beratungen hierzu in der 21. Sitzung des Ausschusses für Wahlrechtsfragen vom 1. 2. 1949, Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Wahlrechtsfragen, Bd. 6, S. 650 f.; der Beschluss wurde als Kurzprotokoll der Sitzung beigefügt (Drucks. Nr. 605). 29 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschusses für Wahlrechtsfragen, Bd. 6, S. 658. 30 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Wahlrechtsfragen, Bd. 6, S. 659. 25
54
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
Zwanges in der aktuellen Lage aber nicht richtig wäre.31 In der Abstimmung darüber wurde die grundsätzliche Einführung einer Wahlpflicht mit vier zu einer Stimme bei drei Enthaltungen abgelehnt. Die Frage, ob das zu schaffende Wahlgesetz eine Wahlpflicht enthalten sollte, wurde noch deutlicher mit sechs zu null Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.32 In seinem Vorschlag vom 5. Februar 1949 regte der interfraktionelle Fünferausschuss an, Art. 18 aus dem Grundrechtekatalog zu streichen und ihn zwischen den Bestimmungen über die Staatsform und die politischen Parteien aufzunehmen.33 Dies wurde in der 47. Sitzung am 8. Februar 1949 in der dritten Lesung des Hauptausschusses besprochen.34 Von Mangoldt sprach sich jedoch für eine Beibehaltung des Artikels aus, weil sonst der Art. 19, der das Recht auf freie Zeit zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und zur Ausübung von Ehrenämtern regelte, vollkommen in der Luft hänge. Zudem würde dann eine Bestimmung fehlen, welche die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis gewährleiste.35 In seinem Vorschlag vom 2. bis 5. Mai 1949 empfahl der Fünferausschuss dann die Streichung des Art. 18, „da diese Fragen landesgesetzlich bereits überall geregelt sind und für den Bund ihre Regelung im Bundeswahlgesetz finden können“.36 In der vierten Lesung im Hauptausschuss in der 57. Sitzung am 5. Mai 1949 beantragte dementsprechend der Abgeordnete Zinn mit den Abgeordneten Dehler und von Mangoldt eine Streichung des Art. 18 „um das Grundgesetz zu entlasten“. Diese Materie sei in den Länderverfassungen geregelt und werde außerdem im Bundeswahlgesetz geregelt.37 Gegen eine Stimme wurde der Antrag im Hauptausschuss angenommen.38 Der Grundrechtsartikel über das Recht zu wählen, die Wahlfreiheit und das Wahlgeheimnis fand keinen Eingang in das Grundgesetz. Es zeigt sich, dass das Recht zu wählen vom Parlamentarischen Rat ursprünglich als Grundrecht gedacht wurde. In den Diskussionen stand nicht eine Abgrenzung zu einer Organkompetenz im Vordergrund, den Beratungen lag vielmehr schon die Prämisse zugrunde, dass das Wahlrecht Grundrechtscharakter habe. Die Diskussionen kreisten vielmehr um eine Vereinbarkeit des Wahlsystems mit der Wahlfreiheit und die Unterscheidung in das eigentliche Recht zu wählen und die Wahl31 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Wahlrechtsfragen, Bd. 6, S. 659. 32 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Wahlrechtsfragen, Bd. 6, S. 660. 33 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7, S. 345. 34 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1498 f. 35 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1499. 36 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Entwürfe zum Grundgesetz, Bd. 7, S. 501. 37 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1791. 38 Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Hauptausschuß, Bd. 14/2, S. 1791.
C. Das Wahlrecht im Parlamentarischen Rat
55
freiheit sowie das hierauf bezogene Wahlgeheimnis. Dabei konnte man sich aber nicht darüber einigen, welchen Inhalt dieses Recht haben solle. Auch die Vereinbarkeit einer Wahlpflicht mit dem Wahlrecht und der Wahlfreiheit spielten eine Rolle. Unklar war auch, inwieweit die Gewährung der Gleichheit der Wahl das Wahlsystem determiniere. Der Rat entschied sich letztendlich, den Grundrechtsartikel nicht in das Grundgesetz aufzunehmen. Er ging dabei zwar davon aus, dass die Materie in den Länderverfassungen und im Bundeswahlgesetz geregelt sei, was dafür sprechen könnte, dass der Rat das subjektive Recht in anderen Bestimmungen verankert sah. Allerdings muss ein Bewusstsein dafür unterstellt werden, dass dies keinesfalls eine grundrechtliche Gewährleistung der Materie, nicht einmal eine einheitliche verfassungsrechtliche Regelung bedeutete. Denn bei den Gesetzen, in denen die Materie als schon geregelt gesehen wurde, handelte es sich zum einen um Landesverfassungen, zum anderen um ein einfaches (Bundes-)Gesetz, das spätere Bundeswahlgesetz. Das letztendliche Ausscheiden des Rechts zu wählen aus dem Grundrechtekatalog muss also so verstanden werden, dass der Parlamentarische Rat auf eine grundrechtliche Ausgestaltung des Rechts zu wählen bewusst verzichtete.
D. Die überwiegend individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht in der Literatur und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Obwohl das Wahlrecht im Grundgesetz damit nicht eindeutig als Grundrecht ausgestaltet ist, wird es ganz überwiegend als Grundrecht1 bzw. „grundrechtsgleiches“2 oder „grundrechtsähnliches Recht“3 oder schlicht als „subjektives Recht“4 oder als „subjektives öffentliches Recht“5 betrachtet.6 Die Benutzung des Wortes „subjektives Recht“ in diesem Zusammenhang wirkt konsensstiftend, weil unausgesprochen vorausgesetzt wird, dass hier ein wie auch immer geartetes Individual1 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 583; W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 1; H. Bauer/W. Kahl, Europäische Unionsbürger als Träger von DeutschenGrundrechten?, JZ 1995, S. 1077 (1077), rechnen Art. 38 Abs. 1 und 2 GG zu den „DeutschenGrundrechten“; trotz der Nichtaufzählung des Rechts im Grundrechtskatalog ausdrücklich R. Wiethölter, Rechtswissenschaft, 1970, S. 340; W. R. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2440); B.-D. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, 1970, S. 106; K. A. Lamers, Repräsentation und Integration der Ausländer, 1977, S. 33; H. Jarass, Funktionen und Dimensionen der Grundrechte, in: Merten/Papier (Hrsg.), HGR, Bd. II, § 38 Rn. 14; P. Badura, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 161. Lfg. (Stand: Mai 2013), Bd. VIII, Anh. z. Art. 38: Bundeswahlrecht, Rn. 4. 2 BVerfGE 112, 118 (133) – Zählverfahren für Sitzanteile, Urteil vom. 8. 12. 2004; BVerfGE 129, 124 (167) – EFS, Beschluss vom 7. 9. 2011; J. Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011, S. 31, nach Abwägung gegen die Eigenschaft als Grundrecht; J. Ipsen, Nachwahl und Wahlrechtsgleichheit, DVBl. 2005, S. 1465 (1465); J. Krüper, Wahlrechtsmathematik als gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, JURA 2013, S. 1147 (1148); W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (499); B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2011, S. 156; U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 244; R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218. 3 P. Badura, Staatsrecht, 2012, Rn. E 5, S. 514; A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 189. R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65; W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 17. 4 D. Grimm, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union, Der Staat 48 (2009), S. 475 (480). 5 W. Pauly, Das Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 123 (1998), S. 232 (280); K.-H. Seifert, Bundeswahlrecht, 1976, BWG § 12 Rn. 1. 6 A. Greifeld, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit des Abgeordneten, Der Staat 23 (1984), S. 503 (511); P. Badura, Staatsrecht, Rn. C 104, S. 300; C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl des Deutschen Bundestages, JuS 2009, S. 805 (805); von einem individuellen Recht spricht R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 31; D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (304); W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 481.
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
57
recht gemeint ist, ohne dass dieses näher spezifiziert werden müsste.7 Das Bundesverfassungsgericht prägte diese individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht stark mit. Bereits in einer seiner ersten Entscheidungen bezeichnete es das Wahlrecht als „vornehmste[s] Recht des Bürgers im demokratischen Staat“,8 später fand es noch stärker individual-rechtlich geprägte Bezeichnungen wie „politisches Grundrecht“ und „subjektive[s] Recht“9, oder „subjektiv öffentliches Recht […] des einzelnen Bürgers“10. Nährboden erhielt diese Ansicht durch die Aufnahme des Art. 38 GG, in dem die Wahl zum Deutschen Bundestag geregelt ist, in den Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte zunächst des Art. 90 BVerfGG, dann des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG.11 Besonders deutlich wird die individual-rechtliche Sicht auf das Wahlrecht am Beklagen des „defizitären subjektiven Rechtsschutzes“, den das Wahlrecht bis zur Änderung des Wahlprüfungsgesetzes im Jahr 2012 nach Ansicht eines Teils der Literatur genoss.12 Viele Autoren sahen das Wahlrecht als subjektives (Individual-) Recht der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG unterworfen und forderten deshalb umfassenderen Rechtsschutz des subjektiven Wahlrechts.13 Auch wenn das Wahlrecht nicht immer ausdrücklich als Grundrecht bezeichnet wird, sondern es eine Einordnung als grundrechtsgleiches oder grundrechtähnliches Recht erfährt, wird versucht, es in die Grundrechtssystematik einzupassen.14 Dabei 7
Die Formulierung „subjektives Recht“ wird hier jeweils in der Bedeutung „Individualrecht“ gebraucht, obwohl – wie oben in Abschnitt A. II. 2. S. 18 f. gesehen – auch organschaftliche Rechte als „subjektive Rechte“ bezeichnet werden können. 8 BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1951. Zwar wird aus dieser Formulierung die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht noch nicht eindeutig, weil das „Recht eines Bürgers“ nicht denknotwendig ein Individualrecht sein muss. Allerdings wird dann aus der weiteren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eindeutig ersichtlich, dass es das Wahlrecht nicht als ein irgendwie geartetes Recht des Bürgers sieht, sondern als ein Individualrecht. 9 BVerfGE 1, 208 (242) – Sperrklausel, Urteil vom 5. 4. 1952. 10 BVerfGE 4, 27 (30) – Klagebefugnis politischer Parteien, Beschluss vom 20. 7. 1954, (Hervorhebung nicht im Original). 11 Mit dem 19. ÄndG zum Grundgesetz vom 19. 1. 1969 (BGBl. I, S. 97), wurde die Verfassungsbeschwerde in das Grundgesetz eingefügt. Zuvor war sie lediglich einfachgesetzlich in § 90 BVerfGG normiert. Das BVerfGG ist seinerseits erst am 12. 3. 1952 in Kraft getreten; BGBl. I S. 243. 12 W. Pauly, Das Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 123 (1998), S. 232 (280); H. Meyer, Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlaß der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 (356); W. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2441 f.). 13 H. Meyer, Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlaß der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 (356 f.); B. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, 1970, S. 107 f.; W. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2441 f.). 14 R. Grawert, Wechselwirkungen zwischen Bundes- und Landesgrundrechten, in: HGR, Bd. III, § 81, Rn. 12, sieht den rechtsdogmatischen Unterschied zwischen Grundrechten und
58
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
wird auf die Besonderheiten dieses Rechts als ein auf die Staatsorganisation bezogenes Recht meist nicht näher eingegangen, sondern sich darauf beschränkt, die Besonderheit nur durch Zuordnung zu einer Rechtekategorie, zu der das Wahlrecht gehöre, herauszustellen. Wenn indes eine nähere Auseinandersetzung mit dem Wahlrecht erfolgt, werden seine Besonderheiten jedoch sehr deutlich hervorgehoben.15 Auffällig ist, dass es der Literatur erhebliche Schwierigkeiten bereitet, das Wahlrecht in die Grundrechtssystematik einzupassen.16 Wenn eine Kategorisierung des Rechts versucht wird, werden seine Besonderheiten, die es von den Grundrechten des Grundrechtekatalogs unterscheidet, aber besonders deutlich, weil eine Einordnung des Rechts gerade anhand dieser Besonderheiten erfolgt. Das Wahlrecht unterscheidet sich von den Grundrechten sowohl hinsichtlich seines sachlichen Gegenstandes als auf die Staatsorganisation bezogenes Recht als auch hinsichtlich seiner Rechtstechnik.17 Denn anders als die Freiheitsrechte des Grundrechtekatalogs stellt es sich nicht als Abwehrrecht gegen den Staat dar.18 Es ist vielmehr gerade auf die Teilnahme an staatlichen Entscheidungen gerichtet. Es kann sich deshalb auch nicht darin erschöpfen, einen Bereich der persönlichen Freiheit abzustecken, sondern ist darauf gerichtet, im Staate und an dessen Organisation mitzuwirken. Dies beschreibt auch seine besondere Rechtstechnik: es schützt nicht primär ein bestimmtes Handeln, sondern ist auf Wirkung gerichtet. Zudem wird diese Wirkung nicht durch einen Rechtsausübenden allein, sondern gemeinsam mit anderen erzielt. Die Kategorisierungen, die in der Literatur vorgenommen werden, werden im Folgenden dargestellt, weil diese in unterschiedlicher Weise die besondere Funktion des Wahlrechts hervorheben19 und dessen schwierige Integration in die Grundgrundrechtsgleichen Rechten nur darin, dass nur erstere in einem Grundrechtsteil zusammengefasst sind, sieht sie aber in ihrer normativen Qualität als gleich an. T. Wolf, Das negative Stimmgewicht als wahlgleichheitswidriger Effekt, S. 102, hält zwar „[d]ie genaue Einordnung des Wahlrechts zwischen Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten“ aber auch den „sonstigen Normen des Grundgesetzes“ für „noch klärungsbedürftig“, versucht dann aber doch auch nur, es in die Grundrechtssystematik einzupassen (S. 103). 15 Besonders deutlich bei W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 f.; W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 ff. 16 N. Luhmann, Grundrechte als Institution, 1974, S. 137, bezeichnet das Wahlrecht als ein „irgendwie untypisches, verirrtes Grundrecht“. Darüber kann auch die von M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 193, getroffene Einschätzung, es stehe „von der Struktur her in weiten Teilen den Abwehrrechten zumindest sehr nahe“, nicht hinwegtäuschen. 17 Die mangelnde Herausarbeitung der Rechtstechnik wird von W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498), beklagt. 18 Zur Funktion der Freiheitsgrundrechte als Abwehrrechte: H. D. Jarass, Funktionen und Dimensionen der Grundrechte, in: HGR, Bd. II, § 38 Rn. 15. 19 So ausdrücklich H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 227.
I. Kategorisierungen des Wahlrechts
59
rechtssystematik aufzeigen.20 Dass diese Kategorisierungen nicht ausschließlich sind, sondern nur Annäherungsversuche, zeigt sich daran, dass das Wahlrecht von manchen Autoren mehreren Kategorien zugeordnet wird und die Kategorien nicht trennscharf sind.
I. Kategorisierungen des Wahlrechts 1. Das Wahlrecht als politisches/demokratisches Grundrecht Das Wahlrecht wird in der Literatur als u. a. „politisches Grundrecht“ bezeichnet.21 Diese Kategorisierung als „politisch“, was so viel bedeutet wie „die Bürgerschaft betreffend, zur Staatsverwaltung gehörend“,22 hebt deutlich hervor, dass das Wahlrecht sich nicht auf den Freiheitsraum des Individuums bezieht, sondern in einem überindividuellen Kontext steht. Hierdurch wird der Bezug des Wahlrechts auf das Gemeinwesen und damit auch seine Funktion herausgestellt. Gleiches gilt, wenn es – meist äquivalent gebraucht – als staatsbürgerliches Recht bezeichnet wird.23 Etwas differenzierter wird vom Wahlrecht auch als „politischem Mitwirkungsrecht“ gesprochen.24 Mit diesem Begriff wird die Wirkweise des Rechts angesprochen. Er impliziert, dass das Wahlrecht nicht nur in irgendeiner Form auf den Staat bezogen ist, sondern eine Mitwirkungsmöglichkeit im Staat gewährleisten soll, also auf Wirkung gerichtet ist. 20
N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 48. E. Schiffer, Wahlrecht, in: HVerfR, 1983, S. 295 (306); M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 150 f.; W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 1; M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 55; W. von Niederhäusern, Zur Konstruktion des subjektiven öffentlichen Rechts, 1955, S. 19, bezeichnet es als „politisches Recht“; W. O. Schmitt, Die Verwirkung des Wahlrechts und der Wählbarkeit nach § 39 Abs. 2 BVerfGG, NJW 1966, S. 1734 (1734); B. Schmidt-Bleibtreu, in: Maunz/ders./Klein/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 90 Rn. 65; S. Magiera, in: Sachs, GGKommentar, Art. 38 Rn. 100; K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 64 III 9, S. 466 ff.; K.-H. Seifert, Bundeswahlrecht, 1976, BWG, § 12 Rn. 4; R. Junck, Strafrechtliche Grenzen der Beeinflussung von Wählern im Wahlkampf, 1995, S. 111; H. Sendler, Auf jede Stimme kommt es an! – Das Bundesverfassungsgericht und der Schutz der Wahlbeteiligungsfreiheit, NJW 2002, S. 2611 (2612); P. Badura, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 161. Lfg. (Stand: Mai 2013), Bd. VIII, Anh. z. Art. 38: Bundeswahlrecht, Rn. 4, bezeichnet es als „grundrechtlich ausgestaltetes Element der politischen Freiheit“. 22 U. Kraif, in: Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.), Duden – Das große Fremdwörterbuch, S. 1069, 1070, Stichwort „politisch“. 23 S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 100; W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 1; H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, S. 40: „staatsbürgerschaftliches Recht“. 24 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376; K. Stern, Idee und Elemente eines Systems der Grundrechte, in: HStR, Bd. IV, 2011, § 184 Rn. 65. 21
60
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Die Bezeichnung als „demokratisches Grundrecht“25 betont den engen Zusammenhang des Wahlrechts mit dem Demokratieprinzip, ohne dass dabei schon eine Aussage darüber getroffen würde, wie das Recht wirkt. Gegenüber der Bezeichnung „politisches Grundrecht“ macht sie nicht nur einen irgendwie gearteten Bezug des Rechts auf das Gemeinwesen deutlich, sondern gerade den Bezug auf die konkrete Staatsorganisation. Diesen Bezeichnungen ist gemein, dass sie das Wahlrecht nicht nur unspezifisch als Individualrecht verstehen, sondern es als Grundrecht charakterisieren.
2. Das Wahlrecht als Recht des „status activus“ Das Wahlrecht wird oftmals auch als Recht des „status activus“ bezeichnet.26 Dies geschieht in Anlehnung an die Statuslehre Georg Jellineks, in der dieser den Status der „aktiven Zivität“ als den Status der Mitwirkung des Bürgers an der staatlichen Willensbildung definierte.27 Zu den Rechten dieses Status rechnete er auch das Wahlrecht. Jellinek bildete in seinem „System der subjektiven Rechte“ eine umfassende Theorie der subjektiven Rechte. Die Besonderheit dieser Kategorisierung ist, dass Jellinek die Rechte nicht nach ihrem Inhalt unterteilte, sondern ein System erstellte, in dem er eine Einteilung der Rechte danach vornahm, welcher Beziehung zum Staat sie entspringen. Diese unterschiedlichen Beziehungen des Bürgers zum Staat wurden von Jellinek als „Status“ bezeichnet,28 weswegen seine Lehre „Statuslehre“ genannt wird. Sie wurde von Jellinek zwar im Spätkonstitutionalismus entwickelt, aufgrund ihres verfassungstheoretischen Anspruchs beschränkt sie sich aber nicht auf diese
25
W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 f., der freilich bei dieser Kategorisierung nicht stehen bleibt, sondern auf die Rechtstechnik des Wahlrechts näher eingeht, siehe hierzu unten unter D. II. 1., S. 68 ff.; H. Meyer, Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlass der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 (356). 26 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 1: „das Wahlrecht ist Ausprägung der mitgliedschaftlichen Stellung des Bürgers im Staat, des status aktivus“; W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (91): „aktives Statusrecht“; P. Badura, Staatsrecht, Rn. C 104, S. 300; K.-P. Dolde, Die politischen Rechte der Ausländer in der Bundesrepublik, 1972, S. 25; D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (304); B.-D. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, 1970, S. 106; W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 3; M. W. Fügemann, Die Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (347); M. Sachs, in: ders., GG-Kommentar, Art. 20 Rn. 19; für die aus den Wahlgrundsätzen fließenden Rechtspositionen P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 32; BVerfGE 122, 304 (306) – Wahlprüfungsbeschwerde nach Bundestagsauflösung, Beschluss vom 15. Januar 2009, das Wahlrecht stelle sich „essentiell als Teilhabe an der Staatsgewalt, als ein Stück Ausübung von Staatsgewalt im status activus“ dar. 27 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 136 f. 28 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 86 f.
I. Kategorisierungen des Wahlrechts
61
Staatsform, sondern ist in der Lage, Grundrechte theoretisch zu beschreiben.29 Diese Theorie darf als die wohl prominenteste gelten, die die Staatsrechtswissenschaft hervorgebracht hat. Robert Alexy hebt sie als „Beispiel großer juristischer Theoriebildung“ hervor.30 Sie ist für die heutige Grundrechtstheorie maßgeblich, und sie liegt der Grundrechtsdogmatik weiterhin zugrunde.31 Aber auch an Versuchen, sie zu erneuern und erweitern, mangelt es nicht.32 Teilweise wird aber – insbesondere im Hinblick auf den „status activus“ – auch nur die jellineksche Terminologie übernommen, der Begriff aber anders definiert, indem verschiedenste Rechte33 unter diesen Begriff gefasst werden.34 In seinem System der subjektiven öffentlichen Rechte unterscheidet Jellinek vier Status, in denen der Bürger zum Staat steht.35 Den verschiedenen Status ordnet Jellinek Rechte zu, die der Bürger gegenüber dem Staat haben kann. Er unterscheidet den status libertatis, den status positivus, den status activus und den status passivus. Letzterer bildet den Status der Staatsfreiheit, aus dem keine Rechte entspringen.36 Der status negativus, der negative Status, ist in dieser Systematisierung der Status, aus dem der Einzelne Rechte gegen den Staat herleitet, durch die die individuelle Freiheitssphäre gesichert wird.37 Diese Rechte sind Abwehrrechte gegen den Staat im Sinne der klassischen Funktion der Grundrechte38, sie richten sich auf ein Unterlassen des Staates.39 Aus dem status positivus zieht der Einzelne nach Jellinek hingegen Leistungsrechte gegen den Staat, er hat also nicht negativ gewendete
29
J. Kersten, Georg Jellineks System – Eine Einleitung, 2011, S. 43 f. R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 229. 31 Siehe B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 4 I 2 Rn. 75 ff.; F. Hufen, Grundrechte, § 5 Rn. 1; K. Stern, Idee und Elemente eines Systems der Grundrechte, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 184 Rn. 56 f. 32 J. Kersten, G. Jellinek – System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2011, Vorwort, S. 51, weist auf die Anschlussfähigkeit der Statuslehre für Neuerungen in der Grundrechtsdogmatik hin. So wurde die Terminologie Jellineks teilweise erweitert, es wurden neue Status erdacht. Kersten nennt hierzu einige Beispiele: Am prominentesten ist der Versuch von P. Häberle, Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL 30 (1972), S. 43 (80), die Statuslehre „vom ihrem spätabsolutistischen Kopf auf demokratische Füße zu stellen“ durch den Entwurf eines „status activus processualis“; auch E. Denninger, Polizei in der freiheitlichen Demokratie, 1968, S. 34 f., der den „status constituens“ entworfen hat; siehe hierzu unten in Abschnitt D II. 2., S. 70 f. 33 Insbesondere solche, die auf Meinungsbildung gerichtet sind. So z. B. H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, S. 140. 34 So auch Jürgen Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 278 f. 35 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 87. 36 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 86. 37 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte,1905, S. 87, 94 ff. 38 Vgl. BVerfGE 7, 198 (198) – Lüth, Urteil vom 5. Januar 1958. 39 B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 4 I 2 Rn. 76. 30
62
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Abwehransprüche, sondern positiv gewendete Ansprüche auf Leistungen des Staates.40 Demgegenüber ist der status activus der Status der Teilhabe am Staat, an der staatlichen Gewalt, aus ihm entspringt das Recht des Bürgers auf „Organstellung, d. h. auf Anerkennung seiner Individualität als Träger staatlicher Kompetenzen“.41 „Indem der Staat dem Individuum die Fähigkeit zuerkennt, für den Staat tätig zu werden, versetzt er es in einen Zustand gesteigerter, qualifizierter, aktiver Zivität.“42 Im status activus wird der Einzelne für den Staat tätig. Das Wahlrecht bildet das Paradebeispiel eines Rechts des status activus. An ihm zeigt sich besonders deutlich die jellineksche Konstruktion dieses Status. Nach Jellinek entspringen aus dem Status nämlich keine Rechte innerhalb des Staates, er verschafft nur ein Recht, das außerhalb des Staates steht, darauf, als Organ des Staates anerkannt zu werden.43 Das Wahlrecht besteht nach Jellinek, „so paradox dies klingen mag“ eben „keineswegs in dem Recht zu wählen“,44 sondern ist lediglich auf Anerkennung als Staatsorgan gerichtet. Das Wählen selbst ist dann eine staatliche Kompetenz, eine staatliche Funktion und damit selbst Organtätigkeit.45 Rechte des status activus zeichnen sich nach Jellinek demnach dadurch aus, dass sie Kompetenzen auf Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung zum Gegenstand haben. Es handelt sich um Rechte auf eine Kompetenz, auf eine Organtätigkeit. Das Wirken innerhalb der staatlichen Sphäre und das individuelle Recht werden dabei klar unterschieden.46 Unter dem Grundgesetz wird der status activus auch als Zusammenfassung aller als „politische Mitwirkungsrechte“ oder „staatsbürgerliche Rechte“47 bezeichneten Rechte gebraucht.48 Er wird aber nicht mehr nur für Rechte verwendet, die sich auf die Staatsorganisation beziehen, sondern oftmals allgemein für Rechte, die auf die öffentliche Meinungsbildung gerichtet sind.49 Anders als in Jellineks Konstruktion 40
G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 87, 114 ff. G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 147. 42 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 87. 43 Siehe hierzu auch schon oben unter B. II. 3. a), S. 29 f. 44 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 159 f. 45 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 159. 46 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 140. 47 B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 4 I 4 Rn. 83 f., S. 23; es findet sich auch die Bezeichnung als „öffentliche Freiheiten“, so H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, S. 139. 48 So auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 37; dabei wird verkannt, dass der status activus nach der jellinekschen Konstruktion keine Gruppe von Rechten ist, sondern ein Status, aus dem Rechte entspringen. 49 Zur Uneindeutigkeit der Verwendung des Begriff des „status activus“ und den dazu zählenden Rechten J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 278 ff.; positiv hierzu H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993, S. 40: die „aktivbürgerliche Dimension“ der Grundrechte gewinne im demokratischen Verfassungsstaat eine eigene Bedeutung. 41
I. Kategorisierungen des Wahlrechts
63
des status activus werden aus dem Status in der heutigen Interpretation meist keine Rechte auf Kompetenzen hergeleitet. Die gegenwärtige Literatur versucht gerade, die Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung selbst (von Jellinek als das Recht zu wählen bezeichnet) als individual-rechtlich hervorzuheben. Sie versteht diesbezügliche Rechte aber dennoch als Rechte des status activus.50 Die überwiegende Ansicht, die das Wahlrecht als Recht des status activus deklariert, vertritt damit gerade nicht die Ansicht einer dualistischen (sukzessiven) Rechtsnatur des Wahlrechts, wie sie von Jellinek angenommen wurde, sondern einer individualistischen Rechtsnatur gerade des Rechts zu wählen selbst. Nur Robert Alexy beschreibt „das Recht aus Art. 38 Abs. 1 GG“ differenzierend als Recht auf „eine grundrechtsgemäße, einfachrechtliche Normierung der Kompetenz zu wählen“.51 Diese Beschreibung erinnert stark an ein Recht auf eine Kompetenz im klassischen Sinn des jellinekschen status activus. Besonders unklar wird die intendierte Bedeutung des Begriffs des „status activus“, wenn er nur schlagwortartig im Zusammenhang mit dem Wahlrecht gebraucht wird, ohne dass ein Bezug zwischen dem Recht und dem Status hergestellt wird.52 Das Bundesverfassungsgericht benutzt den Begriff der „Rechte des status activus“ uneinheitlich. Zum einen benutzt es ihn, um zu beschreiben, dass ein Recht in der staatlichen Sphäre liegt, wenn es ausführt: „Sie [die Bürger, die in der Volksbefragung ihre Stimme abgeben, Anm. der Verf.] betätigen sich dabei im status activus; ihre Stimmabgabe gehört nicht in den Bereich des Gesellschaftlichen.“53 In der gesellschaftlichen Sphäre verortet das Bundesverfassungsgericht die Rechte des status activus auch dann, wenn es gerade die Abstimmung der Bürger als „Ausübung von Staatsgewalt im status activus“54 beschreibt. Zum anderen benutzt es den Begriff aber – allerdings wiederum nicht ausdrücklich in Bezug auf das Wahlrecht – gerade als Abgrenzungsbegriff zu staatlichen Kompetenzen, wenn es ausführt, dass die Unterzeichner eines rechtsgültigen Volksbegehrens nicht nur ihre „politischen Individualrechte aus dem status activus“ zur Geltung brächten, sondern daneben die von ihnen gebildete Gruppe eine Funktion im Verfassungsleben wahrnehme. Die Gruppe als Ganze habe ein Geset-
50
R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376; B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/ R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 4 I 4 Rn. 83 ff. 51 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 453. Die Kompetenz zu wählen ist indes schon im Grundgesetz normiert, nur ihre genaue Ausgestaltung ist durch Art. 38 Abs. 3 GG dem einfachen Gesetzgeber überlassen. 52 C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl zum Deutschen Bundestag, JuS 2009, S. 805 (806): „subjektives Wahlrecht im Sinne eines status activus“; H. Quintern, Das Familienwahlrecht, 2010, S. 220: „Charakter des status activus des Wahlrechts“. Unklar auch die Ausführungen der Antragsteller in BVerfGE 60, 175 (189) – Startbahn West, Beschluss vom 24. 3. 1982, die von der „Verletzung ihres status activus“ sprechen. 53 BVerfGE 8, 122 (122) – Volksbefragung Hessen, Urteil vom 30. 7. 1958. 54 BVerfGE 8, 104 (115) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958.
64
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
zesinitiativrecht inne, das auf einer Kompetenz beruhe und sich gerade von den Individualrechten aus dem status activus der einzelnen Bürger unterscheide.55 An anderer Stelle hebt es wiederum hervor, dass die „politischen Rechte des Aktivstatus“, zu denen es insbesondere auch das Wahlrecht zählt, nicht zu den „eigentlichen, die Freiheitssphäre des Einzelnen negatorisch sichernden Grundrechte[n]“56 gehören, ebenso wenig wie sie als „politische Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsrechte“ – wie z. B. in Art. 38 GG gewährleistet – dem Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit zugerechnet werden können, weil sie nicht Ausdruck der persönlichen Freiheitssphäre des Bürgers seien.57 Die Verschiedenheit der Rechte des status activus von den übrigen Rechten, dadurch, dass die Rechte des status activus nicht die Individualsphäre schützen, wird auch in der Literatur anerkannt.58 Während mit der Einordnung des Wahlrechts als ein dem status activus entspringendes Recht durch Jellinek die eindeutige Aussage über das Recht getroffen wurde, dass es ein Recht auf eine Organstellung sei, wird mit der Verortung des Wahlrechts im „status activus“ durch das Bundesverfassungsgericht und die gegenwärtige Literatur wenig gewonnen. Denn der Begriff des status activus wird nicht nur uneinheitlich, sondern sogar konträr verwendet, so dass er nicht nur konturenlos, sondern weitergehend inhaltslos ist.59 Eine Einordnung des Wahlrechts als Recht des status activus drückt somit lediglich aus, dass das Wahlrecht auf den Staat bezogen ist. Ob es dabei aber im gesellschaftlichen oder im staatlichen Bereich wirkt und auf was genau es damit ein Recht verschafft, lässt sich aus der bloßen Zuordnung zu diesem Status – so sich hiervon überhaupt noch sprechen lässt – nicht mehr feststellen.
3. Das Wahlrecht als Teilhaberecht Das Wahlrecht wird zum Teil, insbesondere vom Bundesverfassungsgericht, aber auch als „Teilhaberecht“ beschrieben: „Das Wahlrecht gewährleistet als grundrechtsgleiches Recht die Selbstbestimmung der Bürger, garantiert die freie und gleiche Teilhabe an der in Deutschland ausgeübten Staatsgewalt.“60„Das Wahlrecht ist der wichtigste vom Grundgesetz gewährleistete subjektive Anspruch der Bürger auf demokratische Teilhabe.“61 55
BVerfGE 96, 231 (240) – Müllkonzept, Beschluss vom 9. 7. 1997. BVerfGE 4, 27 (30) – Klagebefugnis politischer Parteien, Beschluss vom 20. 7. 1954. 57 BVerfGE 49, 15 (23) – Volksentscheid Oldenburg, Beschluss vom 1. 8. 1978. 58 So auch G. Roth, Zur Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, S. 214 (216). 59 In diese Richtung auch J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 278. 60 BVerfGE 129, 124 (177) – EFS, Urteil vom 7. September 2011 (Hervorhebung nicht im Original). 61 BVerfGE 123, 267 (340) – Lissabon, Urteil vom 30. Juni 2009 (Hervorhebung nicht im Original); so auch W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (91): „Teilhabe- bzw. 56
I. Kategorisierungen des Wahlrechts
65
Der Begriff der „Teilhabe“ hebt den Anspruchscharakter hervor und erinnert auch an die Teilhaberechte an staatlichen Leistungen.62 In Abgrenzung hierzu wurde der Begriff der „Teilnahmerechte“ entwickelt.63 Er drückt etwas zurückhaltender aus, dass der Einzelne aufgrund dieser Rechte „am Staat teilnimmt“.
4. Das Wahlrecht als Zusammensetzung aus Abwehr- und Leistungsrechten Bisweilen wird das Wahlrecht nicht in seiner Funktion zu wählen erfasst, sondern es werden Rechte auf die hierfür nötigen Handlungen (und Unterlassungen, insbesondere des Staates) als vom Wahlrecht gewährleistet gesehen. Auf diese Weise wird das Wahlrecht als Zusammensetzung aus negativen und positiven Ansprüchen definiert.64 Das Wahlrecht wird dann nicht in seiner Eigenschaft, an der Ausübung der Staatsgewalt teilzuhaben, beschrieben, sondern durch Ansprüche gegen den Staat auf die Vornahme von Handlungen.65 Dass diese Einordnung bereits eine inhaltliche Beschreibung des Wahlrechts enthält, zeigt die enge Verknüpfung zwischen Inhaltsbestimmung und Kategorisierung des Rechts. Der negatorische, abwehrrechtliche Charakter des Wahlrechts sei auf Abwehr staatlicher, aber auch privater Eingriffe gerichtet,66 die den Wahlberechtigten daran hindern, sein Wahlrecht auszuüben. Gleichzeitig habe der Wähler aber auch Ansprüche auf Leistungen gegen den Staat aus dem Wahlrecht; beispielsweise darauf, dass Wahlkabinen zur Verfügung gestellt werden oder der Wahlzettel entgegengenommen wird,67 aber auch darauf, dass die Stimme im Wahlergebnis Berücksichtigung findet.68 aktives Statusrecht“; H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (§ 77 Rn. 6): „subjektiv-demokratische Rechte auf Teilhabe an der innerstaatlichen Bildung des Volkswillens“, T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (863). 62 Zum Begriff der „Teilhaberechte“ als Rechte an staatlichen Leistungen: V. Epping, Grundrechte, 2015, Rn. 15, S. 5. 63 C. Starck, Teilnahmerechte, in: HGR, Bd. II, § 41 Rn. 1. 64 Siehe z. B. K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 147 f.; J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 280 f.; D. Wilke, Die Verwirkung der Pressefreiheit, 1964, S. 18; so auch T. Wolf, Das negative Stimmgewicht als wahlgleichheitswidriger Effekt, S. 105, der seine Konstruktion aber der der Bewirkungsrechte (dazu sogleich in Abschnitt D. II. 1. S. 68 f.) gleich sieht. 65 So auch M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 180, 184 f. 66 Auch wenn der Adressat des Wahlrechts ausschließlich der Staat sei, entfalte das Wahlrecht insofern Wirkung zwischen Privaten, als beispielsweise eine vertragliche Vereinbarung über die Ausübung des Wahlrechts in einer bestimmten Weise sittenwidrig sein könne, so M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 184. 67 D. Wilke, Die Verwirkung der Pressefreiheit, 1964, S. 18; J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 280 f.
66
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Diese Beschreibung wird verwendet, wenn die Kategorie des status activus für überflüssig gehalten wird69 oder der status activus gerade als aus positiven und negativen Ansprüchen bestehend gesehen wird.70 Der status activus ist aber nach grundlegend anderen Kriterien als der status negativus und der status positivus definiert. Anders als die Kategorien der Leistungs-, Abwehr- und Gleichheitsrechte71 werden die Rechte des status activus nicht nach ihrer Wirkweise, ihrer Rechtstechnik, sondern von ihrem Zweck, ihrem Gegenstand her definiert.72 Sie unterscheiden sich deshalb grundsätzlich von jenen. Während der negative Status Abwehrrechte enthält und der positive Status Leistungsrechte, die unabhängig davon, welchen Zweck sie verfolgen, diesen Status zugerechnet werden, verfolgen die Rechte des status activus gerade den Zweck der Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung.73 Eine eigene Rechtstechnik dieser Rechte erkennen die Vertreter dieser Ansicht hingegen nicht, weshalb sie zur Kategorisierung des Wahlrechts auf eine Aufteilung der Rechte in Unterlassungs- und Leistungsansprüche angewiesen sind. H. Jarass plädiert dann auch für eine Aufteilung des „Grundrechts der Wahl“ in zwei Grundrechte, die sich jeweils einer dieser Kategorien zurechnen ließen: Das Grundrecht der Wahlfreiheit und das der Wahlgleichheit.74 Betrachtet man das Wahlrecht als subjektives Recht, das sich aus positiven Ansprüchen zur Ermöglichung der Wahlhandlung und negativen auf Nichthinderung derselben zusammensetzt, so erscheint das Wählen an sich, das sich erst daraus ergibt, dass den tatsächlichen Handlungen der Wähler eine Bedeutung und Wirkung zugemessen wird, nicht vom Recht umfasst.75 Denn das entscheidende Verhalten des 68 69
(357).
D. Wilke, Die Verwirkung der Pressefreiheit, 1964, S. 18. H. Jarass, Bausteine einer umfassenden Grundrechtsdogmatik, AöR 120 (1995), S. 345
70 D. Wilke, Die Verwirkung der Pressefreiheit, 1964, S. 18; J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 280 f.; dies hat als erster R. Thoma, Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der Deutschen Reichsverfassung im allgemeinen, in: Nipperdey (Hrsg.), Kommentar zum 2. Teil der Reichsverfassung, Bd. I, S. 1 (26) vertreten. 71 Die Kategorie der Gleichheitsrechte fügt Jarass den Grundrechtskategorien hinzu: H. Jarass, Bausteine einer umfassenden Grundrechtsdogmatik, AöR 120 (1995), S. 345 (357). 72 H. Jarass, Bausteine einer umfassenden Grundrechtsdogmatik, AöR 120 (1995), S. 345 (357); J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 282. So auch W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (497). Hierin liegt dann auch gerade die Kritik dieser Lehre. Weil die Status nach unterschiedlichen Kriterien definiert werden, ergeben sich Überschneidungen, so T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 115. Dennoch ist das Wahlrecht als Handlungsgrundrecht schlecht erfasst. Eine Kategorie, die auf Handlungsmodalitäten abstellt und das Wahlrecht erfasst, könnte die der Bewirkungsrechte sein; siehe hierzu sogleich in Abschnitt D. II. 1., S. 68 f. 73 So auch W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (496 f.). 74 H. Jarass, Bausteine einer umfassenden Grundrechtsdogmatik, AöR 120 (1995), S. 345 (357). 75 Dezidiert gegen die Aufspaltung des Wahlrechts in Rechte des status negativus und des status positivus wendet sich auch W. Schmitt Glaeser, Mißbrauch und Verwirkung von
II. Nicht ausschließlich individual-rechtliche Auffassungen
67
Wählers ist nicht, dass ihm von staatlicher Seite ermöglicht wird, einen Zettel in die Urne zu legen, und dass er hieran nicht gehindert wird. Der Zweck des Wahlrechts ist vielmehr, (jedenfalls potentiell) Einfluss auf das Wahlergebnis zu gewinnen und somit Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages zu haben. Dies kann eine solche Konstruktion jedoch nicht abbilden.76 Sie sichert nur die Wahlhandlung als solche ab, nicht aber ihre eigentliche Intention. Soll aber die Einflussnahme des Bürgers auf die staatliche Willensbildung beschrieben werden, reicht eine Kategorisierung in Abwehr- und Leistungsrechte nicht mehr aus. Es muss dann die eigene Rechtstechnik des Wahlrechts erkannt und berücksichtigt werden.
II. Nicht ausschließlich individual-rechtliche Auffassungen Neben diesen ausschließlich individual-rechtlichen Sichtweisen gibt es auch in der grundgesetzlichen Literatur Sichtweisen, die zwar individual-rechtlich geprägt sind, das Wahlrecht jedoch nicht ausschließlich als Individualrecht auffassen. Demokratische Mitwirkungsrechte werden dann entweder zugleich als subjektive Rechte und Organfunktionen qualifiziert,77 es wird also die Theorie von der Doppelnatur des Wahlrechts vertreten. Oder sie werden zwischen diesen Kategorien verortet, da sie den Übergang vom nicht-staatlichen in den staatlichen Bereich markierten.78 Ihnen wird auch die Funktion eines Scharniers zwischen Staat und Gesellschaft zugeschrieben.79 Die inneren Spannungen, die sich aus dieser Konstruktion ergeben würden, seien deshalb auszuhalten.80
Grundrechten, 1968, S. 113. Auch er sieht das Wahlrecht so nicht in seinem Wesen erfasst, weil der status negativus die staatsfreie Individualsphäre schützte, der status activus hingegen die politische Sphäre des Citoyen; in diesem würde die „grundsätzliche Harmonie zwischen Bürger und Staat besonders deutlich“. Es bleibt nur fraglich, warum er das Wahlrecht dennoch als Grundrecht einordnet, und nicht als Recht der staatlichen Sphäre. 76 Auch G. Jellinek erfasst zwar das Wahlrecht als Zusammensetzung aus positiven und negativen Ansprüchen, er erkennt jedoch darüber hinaus gerade das Recht zu wählen als eigenes Recht – als organschaftliches Recht – an. 77 W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498); ders., Die liechtensteinische Grundrechtsordnung, S. 55, 148; H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 224 ff., insbesondere die Schweizer Lehre vertritt diese Ansicht. 78 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 372. 79 U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (437); für die Schweizer Konstruktion P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 24; R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 363, sieht auch das Demokratieprinzip als „das zentrale verfassungsrechtliche Prinzip der Koppelung von Staat und Gesellschaft“ (Hervorhebung auch im Original). 80 P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 24.
68
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
1. Das Wahlrecht zugleich als „Bewirkungsrecht“ und Organkompetenz Auch in der gegenwärtigen Literatur wird das Wahlrecht bisweilen zugleich als Individualrecht und als Organkompetenz qualifiziert81 und damit als Hybrid betrachtet. Auch hier wird die Betrachtung des Wahlrechts aber meist vornehmlich unter einer individual-rechtlichen Perspektive vorgenommen. Die gleichzeitige organschaftliche Sichtweise tritt dahinter deutlich zurück.82 So erscheint auch in diesem Kontext die organschaftliche Natur des Wahlrechts nur als andere Seite einer Medaille, die selten vertieft behandelt wird. Es lässt sich feststellen, dass auch unter den Vertretern der Doppelnatur des Wahlrechts in der jüngeren Literatur der individual-rechtliche Aspekt immer stärker betont wird. So wurde die Einräumung eines Individualrechts 1974 von A. von Heyl noch als „Hilfsmittel“ zur Wahrung objektiver Wahlrechtsprinzipien gesehen.83 Mit der expliziten Annahme einer Doppelnatur des Wahlrechts werden indes aber die Besonderheiten, die es aufweist, deutlicher hervorgehoben.84 Wer die organschaftliche Natur des Wahlrechts anerkennt, erkennt damit gleichzeitig an, dass das Wahlrecht innerhalb der Staatsorganisation Wirkung entfaltet, und durch Ausübung des Wahlrechts nicht nur auf den Staat eingewirkt wird, sondern dieses bereits innerhalb der Staatsorganisation angesiedelt ist. Besonders deutlich wird dabei, dass das Wahlrecht nicht vorstaatlich denkbar ist, weil es gerade erst innerhalb der Staatsordnung besteht.85 Es wird damit einhergehend auch nach einer Rechtekategorie gesucht, die den Eigenschaften des Rechts entspricht. Diese Kategorie versucht, das Recht zu wählen an sich einzufangen und seine Besonderheiten herauszustellen. Deshalb wird neben der sachgegenständlichen Einordnung des Wahl81
H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 229; M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 176; A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 188, dieser sieht diese „doppelfunktionale Auffassung“ als herrschende. 82 M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 176, sieht das Wahlrecht zugleich als Menschenrecht, andererseits „[trage] das Grundgesetz auch der positivistischen Auffassung von der Wahl als Staatsfunktion [Rechnung], der zufolge das Volk bei der Wahl als Staatsorgan tätig wird“. Die Formulierungen „organschaftliches Recht“ oder „Organkompetenz“ werden dabei aber sogar vermieden. Dennoch nennt er diese Auffassungen in einem Atemzug, weswegen er den dualistischen Auffassungen zuzuordnen ist; m. V. a die Äußerung des BVerfG in BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. Anders nur M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 130 f., der das Wahlrecht zwar nicht explizit als organschaftliches Recht betrachtet, aber die Parteifähigkeit des Wahlberechtigten (Aktivbürgers) im Organstreitverfahren bejaht, hierneben aber das Wahlrecht auch als subjektives Recht bezeichnet. 83 A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 189. 84 Anders argumentiert H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 228 f.: der Begriff „Bewirkungsrecht“ bringe die Doppelnatur des Wahlrechts zum Ausdruck. 85 A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 190; K. A. Lamers, Die Repräsentation und Integration der Ausländer, 1977, S. 33.
II. Nicht ausschließlich individual-rechtliche Auffassungen
69
rechts, als Recht, das sich auf die Staatsorganisation bezieht, die rechtstechnische Seite des Wahlrechts hervorgehoben.86 Denn das Wahlrecht unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich seines sachlichen Bezuges, als auf die Staatsorganisation bezogenes Recht, sondern auch hinsichtlich seiner Wirkweise von den Grundrechten des Grundrechtekatalogs. Das Wahlrecht wird, wenn es zugleich als Organfunktion verstanden wird, in der neueren Literatur als Bewirkungsrecht kategorisiert.87 Die Kategorie der „Bewirkungsrechte“ wurde zunächst von Klaus Stern entwickelt,88 später wurde sie dann von Wolfram Höfling übernommen. Bewirkungsrechte zeichnen sich nach diesen Autoren dadurch aus, dass sie (Grund)-Rechtspositionen enthalten, die es dem Berechtigten ermöglichen, durch die Rechtsausübung eine Änderung der Rechtslage herbeizuführen. Erst durch die Anerkennung der Kategorie der Bewirkungsrechte sei es möglich, das Wahlrecht als Recht zu wählen zu beschreiben und nicht auf Hilfsrechte ausweichen zu müssen, wie z. B. auf das von Jellinek beschriebene Recht auf Anerkennung der Wählerstellung.89 Die Beschreibung dieses Rechts in seiner speziellen Wirkdimension sei möglich gewesen, indem das subjektive Recht aus seiner Fixierung auf den Anspruch gelöst wurde und eben auch das Recht zur Bewirkung selbst als subjektives Recht anerkannt wurde.90 Das Wahlrecht sei unter den Bewirkungsrechten der Gruppe der Mitwirkungsrechte zuzuordnen, was seine Beschränktheit auf einen Teil der Wirkung besonders gut zum Ausdruck bringe.91 Sowohl Höfling als auch Stern erkennen somit die Kompetenz zu wählen selbst als Individualrecht an. Höfling beschreibt gerade diejenigen Rechte, die eine Teilnahme an der Staatsgewalt als Teil des Staatsorgans Volk zum Gegenstand haben, als demokratische Grundrechte.
2. Das Wahlrecht zwischen organschaftlichem Recht und Individualrecht Uneindeutig und unentschieden bezüglich einer rechtlichen Kategorisierung des Wahlrechts bleibt Rainer Grote. Er verortet die politischen Mitwirkungsrechte und 86 Zur Unterscheidung von Rechten sowohl nach dem sachlichen Gegenstand als auch nach der Rechtstechnik W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498). 87 W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498); H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 229. Nicht immer aber wird es, wenn es als Bewirkungsrecht qualifiziert wird, auch als Organrecht qualifiziert, so z. B. von K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 580 ff. 88 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 573. 89 Für G. Jellinek stellte die Beschreibung des Wahlrechts als Recht auf Anerkennung der Wählerstellung jedoch kein Ausweichen dar, sondern es sollte gerade das Recht zu wählen an sich als organschaftliches Recht beschrieben werden. 90 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 583. 91 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 583 f.
70
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
damit auch das Wahlrecht zwischen „individuellen Freiheitsrechten und (reinen) Organfunktionen“92 und ordnet sie damit zunächst keiner Kategorie eindeutig zu. Das Grundgesetz folge hier einer differenzierenden Betrachtungsweise, weil es diese nicht im Zusammenhang mit den individuellen Freiheitsrechten, sondern in den Abschnitten über die Staatsorganisation regele, sie aber zugleich in den Anwendungsbereich der Verfassungsbeschwerde einbeziehe.93 In diese Richtung sind wohl auch die Ausführungen von Sebastian Graf von Kielmannsegg zu deuten, der die Frage aufwirft, „ob die Dichotomie zwischen subjektivem Recht und Kompetenz für die Beurteilung demokratischer Mitwirkungsbefugnisse angesichts deren Schnittstellencharakter sehr hilfreich ist“.94 Die Differenzierung zwischen organschaftlicher Funktionsausübung und grundrechtlicher Individualfreiheit verliere sich, wenn das Volk unmittelbar Staatsgewalt ausübe. Die Rolle des Bürgers in Wahlen und rechtsverbindlichen Abstimmungen bilde den Grenzfall funktionaler Eingliederung.95 Wenn er letztlich doch zugesteht, dass das Wahl-, wie auch das Abstimmungsrecht, als „subjektive Rechtsposition“96 gedeutet werden können, dann nicht ohne zu erwähnen, dass das Wahlrecht, billige man ihm Grundrechtsqualität zu, jedenfalls einen „Grundrechtstyp sui generis“ bilde. Diese Ansätze der Kategorisierung sind deshalb wenig hilfreich, weil sie sich darauf beschränken, die Friktionen aufzuzeigen, die sich aus der kategorialen Einordnung des Wahlrechts ergeben. Indem sie sich aber nicht auf eine Kategorie festlegen, jedoch auch darauf verzichten, eine weitere Kategorie zu benennen, in die sich das Recht einordnen ließe, tragen sie über die Feststellung der Besonderheit des Wahlrechts hinaus zu seiner Kategorisierung und näheren Beschreibung wenig bei. Einen Vorschlag, eine neue Kategorie von Rechten zu konstruieren, in der das Wahlrecht Platz findet, macht Erhard Denninger, indem er einen „status constituens“97 konstruiert. Diesen beschreibt er als „staatserzeugenden Rechtsstand“, als „die verfassungsrechtlich gesicherte Stellung des einzelnen Bürgers, der durch sein politisches Handeln zu der permanent zu erneuernden Erzeugung seines Staat beiträgt“. Von diesem „status constituens“ mache der Bürger Gebrauch, „wenn er als Mitglied einer politischen Partei auf die Bestimmung des Gemeinwohls Einfluß“ nehme, ebenso wie „der Aktivbürger, der seine Wahlstimme abgebe“. Außerdem fielen hierunter alle Handlungen, die „die Vorformung der politischen Willensbildung des
92
R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376. R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376. 94 S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 458, Fn. 609, dieser Einwand entspricht hier nicht der üblichen Kritik an der Beschreibung von Organrechten als subjektive Rechte. Siehe hierzu oben in Abschnitt A. II. 2., S.18 ff. 95 S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 457. 96 Auch hier ist dies i. S. von „Individualrechtsposition“ gemeint. 97 E. Denninger, Polizei in der freiheitlichen Demokratie, 1968, S. 34 f.; ders., Demonstrationsfreiheit und Polizeigewalt, ZRP 1968, S. 42 (44). 93
III. Uneinheitliche normative Anknüpfung des Wahlrechts
71
Volkes zum Gegenstand haben“.98 Auch wenn dies einen Versuch darstellt, eine Rechtekategorie zu konstruieren, die weder innerhalb der staatlichen Sphäre liegt und damit organschaftliche Rechte enthält, noch reine Individualrechte innerhalb der gesellschaftlichen Sphäre,99 erweist sich diese Kategorie als „verfassungsdogmatische Fehlkonstruktion“.100 Denn der Status beschreibt nur den politischen Grundrechtsgebrauch und versucht durch die Konstruktion eines eigenen Status eine Privilegierung desselben zu erwirken. Durch die Aufnahme auch des Wahlrechts in diesen Status werden auch hier nur Kategorien verwischt, ohne klar abgrenzbare neue zu schaffen. Insgesamt hat die Staatsrechtslehre des Grundgesetzes keine tragbare Konstruktion hervorgebracht, das Wahlrecht zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre zu verorten. Die Theorien, die das Wahlrecht zugleich als Individualrecht als auch als Organkompetenz auffassen, verkennen, dass Rechte entweder dem Außenrechtskreis oder dem Innenrechtskreis zuzuordnen sind. Denn in diesen herrschen jeweils unterschiedliche Prinzipien, die sich gegenseitig ausschließen. Die Verortung eines Rechts gleichzeitig in beiden Sphären ist deshalb nicht möglich.
III. Uneinheitliche normative Anknüpfung des Wahlrechts Die normative Anknüpfung des Wahlrechts wird in Rechtsprechung und Literatur uneinheitlich vorgenommen. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil es offenlegt, dass das Wahlrecht im Grundgesetz nicht eindeutig normiert ist. Weitgehender Konsens besteht lediglich darüber, dass das subjektive Wahlrecht in Art. 38 GG seine normative Verankerung hat.101 Innerhalb des Art. 38 GG finden sich hingegen unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Die Uneinheitlichkeit in der nor-
98
E. Denninger, Demonstrationsfreiheit und Polizeigewalt, ZRP 1968, S. 42 (44). M. Flitsch, Die Funktionalisierung der Kommunikationsgrundrechte, 1998, S. 159, beschreibt dies als Versuch der Konstruktion einer dritten Sphäre zwischen Staat und Gesellschaft. Er lehnt einen solchen Status ab, weil hier Staatsbürgerrechte mit Menschenrechten vermischt würden und es deshalb nicht klar sei, wem aus diesem Status Rechte entspringen sollen. 100 H. H. Klein, Zur Auslegung des Rechtsbegriffs der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, DVBl. 1971, S. 233 (24); kritisch auch J. Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik, 1977, S. 279; eher zustimmend M. Sachs, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, DVBl. 1995, S. 873 (885). 101 A. A.: K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 147; T. Maunz, Deutsches Staatsrecht, 1. Aufl., 1951, § 27 I, S. 192, so auch noch in der 21. Aufl. 1977, § 37 I, S. 344; nach denen das Wahlrecht im Grundgesetz nicht ausdrücklich normiert ist. So auch S. MüllerFranken, Familienwahlrecht und Verfassung, 2013, S. 71, es sei aber „hinter den Art. 38 Abs. 1 S. 1, Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG mitzudenken“. 99
72
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
mativen Anknüpfung durchzieht dabei sowohl die Literatur als auch die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung.102 Die Mehrheit der Autoren verortet das Wahlrecht ausschließlich in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG103 oder etwas ungenauer in Art. 38 Abs. 1 GG104. Dieser besagt jedoch lediglich, wie die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewählt werden; er enthält ausschließlich die Modalitäten der Wahl, die Wahlgrundsätze.105 Man könnte vermuten, dass mit der Anknüpfung des Wahlrechts an Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG auch eine inhaltliche Reduzierung des Wahlrechts auf die Wahlgrundsätze stattfinden würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Auch Autoren, die „das Wahlrecht“ als eigenes Recht sehen, machen dieses häufig an Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG fest, selbst wenn dann die Einhaltung der Wahlgrundsätze bei der Wahl als vom Wahlrecht mit umfasst gesehen wird.106 Ebenso wird Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG i. V. m. Art. 94 Abs. 1 Nr. 4a GG als normativer Anknüpfungspunkt gesehen.107 Andere Autoren leiten das subjektive Wahlrecht aus Art. 38 Abs. 2 GG her, der die Wahlberechtigung bei der Wahl zum Deutschen Bundestag regelt.108 Wieder andere Autoren ziehen Art. 38 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 2 GG als normativen Anknüpfungspunkt heran109 oder etwas unspezifischer Art. 38 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 GG.110 102 Die normative Anknüpfung des Wahlrechts wird bisweilen in derselben Entscheidung unterschiedlich bezeichnet. So wird z. B. in BVerfGE 89, 155 (171) – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993, das Wahlrecht zunächst in Art. 38 Abs. 1 GG und unmittelbar danach in Art. 38 Abs. 1 und 2 GG, im Folgenden dann nur noch in Art. 38 GG verortet. 103 So z. B. W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 4; M. Jestaedt, Warum in die Ferne schweifen, wenn der Maßstab liegt so nah?, Der Staat 48 (2009), S. 497 (503); A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (405); B. Pieroth/ B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 4 I 4 Rn. 83 f.; J. Ipsen, Nachwahl und Wahlrechtsgleichheit, DVBl. 2005, S. 1465 (1465); H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (773 Rn 69); B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 159; etwas ungenauer in Art. 38 Abs. 1 GG verortet es D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1995), S. 5 (24). 104 M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 55 f. 105 Diese werden auch als Wahlrechtsgrundsätze bezeichnet. 106 W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498); C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit“ und Bundesstaatsverbot, Der Staat 48 (2009), S. 535 (539). 107 W. Pauly, Das Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 123 (1998), S. 232 (280). 108 E. Schiffer, Wahlrecht, in: HVerfR, 1983, S. 295 (306). 109 C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl des Deutschen Bundestages, JuS 2009, S. 805 (805). 110 J. Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011, S. 27, C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl zum Deutschen Bundestag, JuS 2009, S. 805 (805 f.); so für die Wählbarkeit auch U. Wagner, Verwirkung der Wählbarkeit, S. 26; W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 59.
IV. Inhalt des Wahlrechts
73
Bisweilen wird aber auch ganz darauf verzichtet, genau anzugeben, aus welchem Absatz des Art. 38 GG sich ein subjektives Wahlrecht ergeben soll, und das Wahlrecht unspezifisch an Art. 38 GG geknüpft.111 Auch Art. 20 Abs. 2 GG wird mitunter – gemeinsam mit anderen Normen – als normativer Anknüpfungspunkt des Wahlrechts genannt.112 Diese unterschiedliche normative Verankerung zeigt erhebliche Unsicherheiten darüber, woraus sich ein wahlrechtliches Individualrecht ableiten lässt. Auffällig ist, dass auch diese unterschiedliche Anknüpfung nicht aufgedeckt wird, sondern jede Ansicht ihre normative Rückbindung als eindeutig darstellt. Dennoch spiegeln die Differenzen den Umstand wider, dass ein individuelles Wahlrecht im Grundgesetz nicht eindeutig normiert ist.113
IV. Inhalt des Wahlrechts 1. Unklarheiten über den Inhalt Die Unklarheiten, die über die normative Anknüpfung des Wahlrechts herrschen, erstrecken sich auch auf dessen Inhalt. Auch dieser darf als deutlich ungesichert gelten.114 Es herrscht allgemeine Unklarheit darüber, was vom Wahlrecht umfasst ist, worauf „das Wahlrecht“ ein Recht verleiht.115 Von einer „klar abgrenzbare[n] individuelle[n] Rechtsposition des einzelnen Wählers“, die aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG
111
D. Grimm, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union, Der Staat 48 (2009), S. 475 (480). 112 BVerfGE 37, 217 (241) – Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen, Beschluss vom 21. 5. 1974: Art. 20 Abs. 2 S. 2, Art. 38 GG i. V. m. § 12 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 BWahlG; M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 130. 113 Dies bemängelt T. Maunz, Deutsches Staatsrecht, 1. Aufl., 1951, § 27 I, S. 192, der aber davon ausgeht, dass „durch diese Unterlassung (oder dieses Versehen) das individuelle Wahlrecht offensichtlich nicht in seinem Bestand geschwächt oder gefährdet werden“ sollte; in der 21. Aufl., 1977, § 37 I, S. 344, geht er davon aus, „daß der der Bürger in der Verfassungsbeschwerde nach § 90 BVerfGG Schutz findet“; ähnlich: K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 147; S. Müller-Franken, Familienwahlrecht und Verfassung, 2013, S. 71. Die vorhandene Normierung der Wählbarkeit (auch passives Wahlrecht genannt) stellt U. Wagner, Verwirkung der Wählbarkeit, S. 26, fest. 114 Schon 1962 kritisierte P. Karpenstein, Die Wahlprüfung und ihre verfassungsrechtlichen Grundlagen, 1962, S. 119, dass die Versuche der deutschen Literatur, das Wahlrecht inhaltlich abzugrenzen, spärlich seien. So auch K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 582: Das aktive Wahlrecht habe „lange allen Versuchen, es inhaltlich näher zu erfassen, besondere Schwierigkeiten bereitet“. W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 2, konstatiert, das Wahlrecht sei „komplizierterer Natur als es zunächst scheine“. 115 Ausweichend erscheint es daher, wenn M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 55 – 57, dem „überkommenen Schutzbereich des Art. 38 Abs. 1 GG“ keine zwei Seiten widmet.
74
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
folge, kann keine Rede sein.116 Da die Unsicherheiten über den Inhalt gerade auch mit der Unsicherheit über die Rechtsnatur des Rechts in Zusammenhang stehen, sollen sie hier aufgezeigt werden. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gewährleistet „Art. 38 Abs. 1 und 2 GG […] den wahlberechtigten Deutschen das subjektive Recht, an der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages teilzunehmen“.117 Dies umfasse sowohl das aktive und passive Wahlrecht, also das Recht zu wählen und gewählt zu werden, wie auch das Wahlvorschlagsrecht,118 also das Recht, Vorschläge für Kandidaten zu unterbreiten. Verbürgt sei, „dass dem Bürger das Wahlrecht zusteht und dabei die Wahlgrundsätze eingehalten werden“.119 Als Inhalt des Wahlrechts sieht das Bundesverfassungsgericht wohl auch, dass Wahlen überhaupt stattfinden, denn das Wahlrecht sei auch dann verletzt, wenn fällige Wahlen hinausgeschoben werden.120 Eine Bestandskraft der Wirkung der Wählerstimme während der gesamten Legislaturperiode sieht das Bundesverfassungsgericht hingegen nicht vom Wahlrecht verbürgt. Denn das Wahlrecht sei nicht betroffen, wenn der Bundestag vorzeitig aufgelöst werde. Hiervon seien nur „de[r] Deutsche[…] Bundestag und seine Abgeordneten, nicht aber im Rechtssinne unmittelbar de[r] einzelne[…] Bürger“ betroffen.121 Das Wahlrecht sei jedoch kein Recht, das aus Anlass jeder Wahl neu zur Entstehung kommt, sondern bestehe auch dann, wenn gerade keine Wahl stattfindet.122 So beschrieben wird das Wahlrecht zum bloßen Handlungsrecht.123 Das Recht erschöpft sich dann darin, die Wahlhandlung vorzunehmen, also in der Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag und der Einhaltung der objektiv-rechtlichen Modalitäten. Diese Lösung erscheint deshalb unbefriedigend, weil sie das, was mit 116 So aber C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie?, JZ 2010, S. 1160 (1161). 117 BVerfGE 89, 155 (171) – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993; so schon BVerfGE 47, 253 (269) – Gemeindeparlamente Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15. 2. 1978. 118 E. Schiffer, Wahlrecht, in: HVerfR, 1983, S. 295 (311). 119 BVerfGE 89, 155 (171) – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993. 120 BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1951: „Zur Demokratie, wie sie das Grundgesetz will, gehört nicht nur, daß eine Volksvertretung vorhanden ist, die die Regierung kontrolliert. Wesentlich ist ihr auch, daß den Wahlberechtigten das Wahlrecht nicht auf einem in der Verfassung nicht vorgesehenen Wege entzogen oder verkürzt wird. Das Wahlrecht wird auch beeinträchtigt, wenn fällige Wahlen hinausgeschoben werden.“ 121 BVerfGE 63, 73 (75 f.) – Verfassungsbeschwerde gegen Bundestagsauflösung – Beschluss vom 12. 1. 1983. 122 BVerfGE 5, 2 (6 f.) – Inlandswohnsitz von Abgeordneten, Urteil vom 3. 5. 1956. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb das Innehaben eines Mandats, das damals von Innehaben des aktiven Wahlrechts abhängig war, vom dauernden Innehaben des aktiven Wahlrechts während der Wahlperiode und damit auch vom Inlandswohnsitz des Abgeordneten abhängig gemacht. 123 Als solches beschreibt auch D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (304), das Wahlrecht.
IV. Inhalt des Wahlrechts
75
der Wahl bezweckt wird, nicht im Kern trifft. Die Wahl hat zum Zweck, eine Wirkung, nämlich die Besetzung des Parlaments, herbeizuführen und erschöpft sich nicht in dem Akt der Stimmabgabe der Wähler. Es soll gerade aus dem aus den abgegebenen Stimmen ermittelten Wahlergebnis die Konsequenz der Besetzung des Bundestages mit Abgeordneten gemäß dem Wahlergebnis gezogen werden.
2. Die Wahlgrundsätze als eigene Individualrechte? Ein Fokus bei der Beschreibung des Inhalts des Wahlrechts liegt oftmals auf den Wahlgrundsätzen.124 Die Wahlgrundsätze werden meist selbst als individuell berechtigend betrachtet.125 Dies wird an Formulierungen wie „die Wahlrechtsgrundsätze vermitteln [den] Berechtigten subjektive Rechte“126 deutlich.127 Bisweilen scheint auch gerade nur den Wahlgrundsätzen ein eigener individual-rechtlicher Gehalt beigemessen zu werden, gerade in ihnen wird „das Wahlrecht“ gesehen.128 Deutlich wird dies, wenn in Kommentaren das Wahlrecht vorwiegend unter dem Blickwinkel der Wahlgrundsätze betrachtet wird und diese gerade in individualrechtlicher Diktion besprochen werden.129 Derartige Tendenzen zeigt auch das 124
So auch A. Wolf, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils, 1999, S. 24. K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 6, S. 321, sie seien Rechte des status activus, grundrechtsähnliche Rechte; eher bejahend E. Schiffer, Wahlrecht in: HVerfR, 1983, S. 295 (306); C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl zum Deutschen Bundestag, JuS 2009, S. 805 (806); H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 84; M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 150, sieht die in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG enthaltenen wahlrechtlichen Aussagen sämtlich auch subjektiv-rechtlich gewährleistet, der Satz habe deshalb keinen objektiven Mehrwert; G. Roth, Die Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, S. 214 (215 ff.); A. Voßkuhle/A.-K. Kaufhold, Die Wahlrechtsgrundsätze, JuS 2012, S. 1078 (1078); P. Badura, Staatsrecht, Rn. C 104, S. 300; ders., Über Wahlen, AöR 97 (1972), S. 1 (11); ders, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 32; B. Grzeszick, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, Art. 38 Rn. 5 f, erörtert die Wahlgrundsätze in einem „GrundrechteKommentar“; zurückhaltender: K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 148: Die Wahlgrundsätze könnten sich „im Einzelfall zu Rechten des Einzelnen konkretisieren“. 126 M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 60, sieht die subjektive Berechtigung gar vor der objektiven Funktion, er spricht von ihrer „auch objektiv-rechtliche[n] Qualität“. Ähnlich H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ders., BVerfGG-Kommentar, § 90 Rn. 84. 127 Auch die Terminologie der Grundrechte wird hier übernommen; so werden die Wahlgrundsätze von M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 61, als „vorbehaltlos gewährleistet“ beschrieben. 128 M. Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. I, 2011, § 71 III Rn. 97, S. 171; ausdrücklich H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 1. 129 Dies sieht auch A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (417). Als Beispiel dienen die Kommentierung von M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, 125
76
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Bundesverfassungsgericht, wenn es ausführt: „Eine mit der Verfassungsbeschwerde verfolgbare Verletzung des subjektiven Rechts aus Art. 38 GG kommt also zunächst nur in Betracht, wenn ein Wahlgesetz gegen die Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit oder Gleichheit der Wahl oder das Wahlgeheimnis verstößt.“130 Es hat dann auch gerade die „in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG niedergelegten Stimmrechtsgrundsätze“ als, wie es schreibt, „ungeschriebenes demokratisches Verfassungsrecht“ auch auf sonstige politische Abstimmungen angewendet und diese – und darin liegt die hier interessierende implizite Individualisierung – als mit der Verfassungsbeschwerde rügefähig erklärt.131 Dadurch löst es zum einen die Wahlgrundsätze von ihrem eigentlichen Gegenstand: der Wahl zum Deutschen Bundestag. Gleichzeitig – und das ist besonders bemerkenswert – macht es aber einen eigenständigen individual-rechtlichen Gehalt der in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG normierten Wahlgrundsätze aus. Es erkennt dabei allerdings nicht, wie es behauptet, die Stimmrechtsgrundsätze als „ungeschriebenes Verfassungsrecht“ an.132 Denn ungeschriebenes Verfassungsrecht wäre nicht mit der Verfassungsbeschwerde rügefähig. Erst die Anknüpfung an Art. 38 GG kann die Wahlgrundsätze auch in anderen Kontexten als in Bundestagswahlen zu rügefähigen Rechten machen. Das Bundesverfassungsgericht bildet hier vielmehr eine Analogie bei der Anwendung der Grundsätze.133 Damit sieht das Bundesverfassungsgericht die Wahlgrundsätze de facto als eigenständige Individualrechte an, die unabhängig von ihrem Bezug zur Bundestagswahl bestehen, auch wenn sie ihren normativen Anknüpfungspunkt in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG finden.134 Von einigen Autoren werden die Wahlgrundsätze hingegen lediglich als Ausgestaltungen des subjektiven Wahlrechts betrachtet. So erfahre das Wahlrecht immer dann Einschränkungen, wenn die Wahlgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG be-
Bd. II, Art. 38 Rn. 59, und N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GGKommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 119 f. 130 BVerfGE 13, 54 (91) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961; so spricht es auch in BVerfGE 99, 1 (11) – Bayerische Kommunalwahlen, Beschluss vom 16. 8. 1998, vom „Recht, die Beachtung aller fünf Wahlgrundsätze im Wege der Verfassungsbeschwerde einzufordern“. Dass das Bundesverfassungsgericht aber in anderen Entscheidungen auch andere individualrechtliche Gehalte des Art. 38 GG erkennt, wurde oben bereits gezeigt. 131 BVerfGE 13, 54 (91) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961; BVerfGE 28, 220 (224) – Heimatbund Badenerland, Beschluss vom 6. 5. 1970; BVerfGE 49, 15 (19) – Volksentscheid Oldenburg, Beschluss vom 1. 8. 1978. 132 So auch H.-U. Erichsen, Die Wahlrechtsgrundsätze, Jura 1983, S. 635 (635). 133 Zum Vorliegen der Voraussetzungen einer Analogie in diesem Fall B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 136 ff. 134 Darauf, dass die Betitelung als „Stimmrechtsgrundsätze“, entgegen der üblichen Bezeichnung der Grundsätze als „Wahlrechtsgrundsätze“ (oder – wie hier – „Wahlgrundsätze“) die Anwendbarkeit auch auf Abstimmungen bereits vorbereitet, weist B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 141, Fn. 45, hin.
IV. Inhalt des Wahlrechts
77
einträchtigt sind.135 Das Wahlrecht steht zwar in einem engen Zusammenhang mit den Wahlgrundsätzen, lässt sich aber dennoch getrennt von ihnen denken. Die Wahlgrundsätze gestalten die Modalitäten der Wahl zwar aus, regeln aber nicht die Wahl selbst. So werden die Wahlgrundsätze auch als vom Wahlrecht mit umfasst angesehen.136 Die Wahlgrundsätze werden dann nur als „Absicherung“ des individuellen Wahlrechts verstanden.137 Bisweilen werden die Wahlgrundsätze zwar nicht explizit als eigene Rechte bezeichnet, es werden jedoch Begriffe der Grundrechtsdogmatik wie „Schutzbereich“ und „Eingriff“ explizit auf die Wahlgrundsätze angewendet.138 Besonders der Wahlgleichheit wird Grundrechtscharakter zugeschrieben. Hier findet sich besonders häufig die grundrechtliche Diktion von „Schutzbereich“ und „Eingriff“ in das gleiche Wahlrecht.139 Es finden sich auch Deutungen, in denen das Wahlrecht überwiegend aus der Perspektive der Gleichheit betrachtet wird.140 Das Wahlrecht erscheint dann als Gleichheitsrecht in der Teilnahme an staatlichen Entscheidungen141 und wird nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass es den Bürgern das gleiche Recht auf Teilnahme an Wahlen einräumt.142 Auf den Inhalt des Rechts an sich kommt es dann wenig bis gar nicht mehr an.143 Das Bundesverfassungsgericht hat seine grundrechtliche Betrachtungsweise der Wahlrechtsgleichheit lange Zeit dadurch manifestiert, dass es diese als Anwen-
135 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG-Kommentar, 68. Lfg. Jan. 2013, Bd. IV, Art. 38 Rn. 147; E. Stein/G. Frank, Staatsrecht, 2010, § 52 I, S. 430, sehen das Wahlrecht demgegenüber als „subjektiv-rechtliche Seite der objektiv-rechtlichen demokratischen Wahlgrundsätze“. 136 So z. B. K.-H. Seifert, Bundeswahlrecht, 1976, Art. 38 Rn. 4, S. 41. Sie seien aber dennoch grundrechtsähnliche Rechte, S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 103. 137 N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 59. 138 Zur Übertragung der Begriffe auf den staatsorganisationsrechtlichen Bereich aber A. Heusch, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Staatsorganisationsrecht, 2003, S. 86 f. Die Begrifflichkeiten sind im Bereich der Staatsorganisation jedoch nicht etabliert, so dass anzunehmen ist, dass sie von den genannten Autoren grundrechtlich verstanden werden sollen. Auch R. Grote, Verfassungsorganstreit, S. 188, 412 f., verwendet die Begriffe jedoch auch für mitgliedschaftliche Rechte des Bundestages. 139 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 3, S. 304 f.; H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 29 f. 140 BVerfGE 1, 208 (242) spricht vom „gleichen“ Wahlrecht des einzelnen Staatsbürgers; so auch H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 4, Fn. 12. 141 A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395 (418). 142 Der Grundsatz der gleichen Wahl ist von allen Wahlgrundsätzen auch der praktisch bedeutsamste. So auch W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 42; N. Achterberg/ M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 130. 143 A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (418) fragt deshalb kritisch, „ob das Wahlrecht in der Gleichheit der Wahlberechtigung aufgeht oder ob es die politische Freiheit selbst umfasst“.
78
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
dungsfall des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 GG angesehen hat.144 So sah das Bundesverfassungsgericht in der Verletzung des Grundsatzes der Wahlgleichheit stets auch eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Im Gegensatz zum allgemeinen Gleichheitssatz sollte die Wahlrechtsgleichheit aber aufgrund ihres „formalen Charakters“145 nur durch „zwingende Gründe“ eingeschränkt werden können, was sie vom allgemeinen Gleichheitssatz unterschied. Was zunächst nach einem strengen Maßstab klingt, wurde aber durch die Ableitung des Grundsatzes vom allgemeinen Gleichheitssatz erst möglich. Erst die Herstellung eines Gleichlaufes zwischen allgemeinem und „speziellem“ Gleichheitssatz implizierte die Einschränkbarkeit der Wahlrechtsgleichheit schon dogmatisch.146 Dass hierbei ein deutlich strengerer Maßstab gelten musste als beim allgemeinen Gleichheitssatz – der zu Beginn dieser Rechtsprechungslinie lediglich als Willkürverbot ausgestaltet war147 – ist im Hinblick auf den Anwendungsbereich der Wahlrechtsgleichheit ohnehin evident. Die Gründe für die Anknüpfung der Wahlgleichheit an den allgemeinen Gleichheitssatz waren jedoch vornehmlich prozessualer Natur.148 Die Ableitung der
144
BVerfGE 1, 208 (237 u. 242) – 7,5 %-Sperrklausel, Urteil vom 5. 4. 1952; 4, 375, (382) – Schwerpunktparteien, Urteil vom 6. 2. 1956; BVerfGE 11, 266 (271) – Wählervereinigung, Beschluss vom 12. 7. 1916; 11, 351 (360); BVerfGE 51, 222 (232) – 5 %-Klausel bei EP-Wahlen – Beschluss vom 22. 5. 1979; Inkompatibilität Ruhestandsbeamter, Beschluss vom 7. 4. 1981; BVerfGE 71, 81 (94) – Arbeitnehmerkammern Bremen, Beschluss vom 22. 10. 1985; zitiert nach BVerfGE 99, 1 (8) – Bayerische Kommunalwahlen, Beschluss vom 16. 8. 1998; BVerfGE 36, 139 (141) – Wahlrecht Auslandsdeutscher, Beschluss vom 23. 10. 1973; zweifelnd hieran aufgrund unterschiedlicher Entstehungsgeschichten schon J. A. Frowein, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht, AöR 99 (1974), S. 72 (81). Diese Auffassung hat auch in der Literatur Unterstützung erfahren: H.-J. Rinck, Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl, in: Festschrift für Geiger, S. 677 (685); W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (93); kritisch aber G. Roth, Zur Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, S. 214 (216). 145 BVerfGE 13, 242 (246) – Wahlgebietsgröße, Beschluss vom 6. 12. 1981; BVerfGE 28, 220 (225) – Heimatbund Badenerland, Beschluss vom 6. 5. 1970; BVerfGE 51, 222 (234) – 5 %Sperrklausel, Beschluss vom 22. 5. 1979, BVerfGE 82, 322 (337) – Gesamtdeutsche Wahl, Urteil vom 29. 9. 1990. 146 So auch das Bundesverfassungsgericht selbst in BVerfGE 4, 375, (382): „Nur diese Überordnung [die Überordnung des allgemeinen Gleichheitssatzes über die Wahlrechtsgleichheit, Anm. der Verf.] macht es verständlich, daß die Wahlrechtsgleichheit trotz ihrer unter dem Verhältniswahlsystem ,radikalen‘ Formalisierung unter gewissen Voraussetzungen überhaupt durchbrochen werden darf“, und in BVerfGE 13, 243 (247): „Vielmehr gibt es Ausnahmen von diesem Gebot [der Wahlrechtsgleichheit, Anm. des Verf.], die sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben, weil Zweck und Natur des Wahlverfahrens sie zwingend erfordern.“ (Hervorhebungen nicht im Original). 147 BVerfGE 1, 14 (52) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1951. 148 Dies wurde bereits herausgearbeitet: J. A. Frowein, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht, AöR 99 (1974), 71, 81, 84; H. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1996, S. 144 f., ders., Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 32; für die Abkehr von dieser Rechtsprechung macht C. Lenz, Das
IV. Inhalt des Wahlrechts
79
Grundsätze der Gleichheit und Allgemeinheit der Wahl aus Art. 3 Abs. 1 GG machte es möglich, wahlrechtliche Verfassungsbeschwerden auch auf den allgemeinen Gleichheitssatz zu stützen. Während sich Verfassungsbeschwerden gegen das Bundeswahlrecht auf Art. 38 GG stützen ließen, war dies für landeswahlrechtliche Regelungen nicht möglich,149 da das Homogenitätsprinzip des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG laut Bundesverfassungsgericht nicht den subjektiv-rechtlichen Gehalt des Art. 38 GG umfasse.150 So blieb als einzige Möglichkeit, um auch Verfassungsbeschwerden gegen Landtags- und Kommunalwahlen zuzulassen, ein Rückgriff auf Art. 3 GG im wahlrechtlichen Bereich. Dies erweiterte den möglichen Beschwerdegegenstand wahlrechtlicher Verfassungsbeschwerden auf Landtags- und Kommunalwahlen. Mit der Deklarierung der Wahlgleichheit als Anwendungsfall des allgemeinen Gleichheitssatzes unterstrich das Bundesverfassungsgericht aber auch seine Auffassung vom individual-rechtlichen Charakter der Wahlgleichheit.151 Jedenfalls im Bereich der Landes- und Kommunalwahlen gelang die Subjektivierung nur über eine „subjektiv-rechtliche Aufladung“ durch Art. 3 GG.152 Darüber hinaus übertrug es unausgesprochen die Schrankendogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes auf die Gleichheit und implizit auch auf die Allgemeinheit der Wahl. Diese Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss vom 16. Juli 1998 ausdrücklich geändert.153 Mit der Aufgabe der Rechtsprechungslinie sieht das Bundesverfassungsgericht die Wahlrechtsgleichheit zwar nicht mehr als Anwendungsfall des in Art. 3 Abs. 1 GG garantierten Gleichheitssatzes, dennoch qualifiziert es sie weiterhin als dessen „spezialgesetzlich normierte[…] Ausprägung[…]“.154 Auch die grundrechtliche Betrachtungsweise hat es hiermit nicht aufgegeben.
Bundesverfassungsgericht zwischen Selbstentlastung und Selbstbelastung, NJW 1999, S. 34 f., dann auch nicht Gründe der Rechtsüberzeugung, sondern der Gerichtsentlastung aus. 149 A. A. H. Butzer, in: Epping/Hillgruber, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 35, nach dem die Wahlgrundsätze als allgemeine Rechtsgrundsätze über den Regelungsbereich des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG hinaus auch für alle sonstigen Wahlen und politische Abstimmungen und Volksentscheide gelten. 150 BVerfGE 1, 208 (236), – 7,5 %-Sperrklausel, Urteil vom 5. 4. 1952: Da Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG sich im Abschnitt „Der Bund und die Länder“ befindet, regele er nur Rechte und Pflichten von Bund und Ländern. 151 A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 199, ist der Ansicht, dass der Rückgriff auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz u. a. die Bedeutung gehabt habe, die traditionell zu enge Auffassung der Wahlrechtsgleichheit als bloß formaler Gleichheit zu relativieren. 152 Der Begriff ist entlehnt von C. Lenz, Das BVerfG zwischen Selbstbelastung und Selbstentlastung, NJW 1999, S. 34 (34). 153 BVerfGE 99, 1 (7) – Bayerische Kommunalwahlen, Beschluss vom 16. 7. 1998. 154 BVerfGE 99, 1 (10) – Bayerische Kommunalwahlen, Beschluss vom 16. 7. 1998.
80
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Auch im Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl wurde ein Gleichheitssatz gesehen, der im Hinblick auf den Zugang zur Wahl Wirkung entfaltet.155 Ebenso wie bezüglich der Wahlrechtsgleichheit hat das Bundesverfassungsgericht bei diesem Grundsatz der Wahl die Rückgriffsmöglichkeit auf Art. 3 Abs. 1 GG mit seiner Rechtsprechungsänderung zwar aufgegeben, jedoch nicht die Annahme vom grundrechtlichen Charakter des Grundsatzes. Die grundrechtliche Betrachtungsweise wird auch hier durch die Betrachtung als Gleichheitssatz impliziert. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl gelte allerdings nicht nur – wie der Grundsatz der gleichen Wahl – für die Wähler, sondern für alle Bürger. Denn es handle sich hier um das Recht auf Gleichbehandlung bei der Einräumung eines Rechts,156 nicht aber um das Recht auf Gleichbehandlung der Wählerstimmen. Zugleich bestimme der Grundsatz der allgemeinen Wahl selbst den personellen Schutzbereich des (aktiven und passiven) Wahlrechts und der Rechte auf Einhaltung der übrigen Wahlgrundsätze.157 Der Grundsatz der freien Wahl wird in der Literatur besonders oft als Individualrecht beschrieben. Dieses umfasse sowohl das Recht, bei der Wahl in seiner Entscheidung frei zu sein, als auch das Recht, frei darüber zu entscheiden, überhaupt zur Wahl zu gehen.158 Es enthalte also neben der sogenannten Wahlentscheidungsfreiheit auch eine Wahlentschließungsfreiheit.159 Der Begriff „Freiheit“ wird auch als Chiffre für ein Individualrecht gedeutet.160 Der Grundsatz geheimer Wahl wird in Bezug zur Freiheit der Wahl gesetzt, weil er nach allgemeinem Verständnis die Funktion hat, den Grundsatz der Freiheit der Wahl institutionell abzusichern,161 indem die Geheimheit den sozialen Druck von der Entscheidung nimmt.162 Die Rechtsqualität des Grundsatzes wird unterschiedlich 155 M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 174; N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II Art. 38 Abs. 1 Rn. 120. 156 M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 174; N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 109. 157 N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 109; er beschreibt dies als „funktionale Eigentümlichkeit“ des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl. 158 D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (309 ff.), K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 217 f.; H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254). 159 Die Begriffe wurden eingeführt von D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (309 ff.); sie wurden von der Literatur übernommen, z. B. von W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 21. Siehe hierzu auch unten unter F. VI. 2., S. 219 ff. 160 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 103. Hieraus wird auch die individual-rechtliche Ausgestaltung des Wahlrechts an sich gefolgert. Siehe hierzu ausführlich unten unter D. V. 4., S. 42. 161 H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 20; B. Grzeszick, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, Art. 38 Rn. 32. 162 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 151; W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, S. 166, 168 f.
IV. Inhalt des Wahlrechts
81
beurteilt. Er wird aufgrund seiner Schutzfunktion bisweilen gerade für nicht verzichtbar und deshalb auch nicht für ein Individualrecht gehalten.163 Andere halten die Regelung zwar für eine Regelung des objektiven Rechts, daneben aber für ein Individualrecht,164 obwohl sie eingestehen, dass es insoweit unverzichtbar sei, als über die Verdeckung der Stimmabgabe vor anderen nicht disponiert werden könne. Daher steht hier eine objektiv-rechtliche Betrachtung des Grundsatzes im Vordergrund. Nicht eigens als Individualrecht betrachtet wird der Grundsatz der unmittelbaren Wahl. Er wird meist nur als objektiver Rechtsgrundsatz beschrieben.165 Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass er insgesamt die unbedeutendste Rolle unter den Wahlgrundsätzen spielt, weil es kaum Zweifelsfälle gibt, die mit diesem Grundsatz in Zusammenhang stehen.166 Es zeigt sich, dass insbesondere die Grundsätze der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl selbst als Individualrechte betrachtet werden, das Wahlrecht gelegentlich auch auf ein Gleichheitsrecht reduziert wird. Die übrigen Wahlgrundsätze werden jedoch mitunter explizit als Individualrechte betrachtet, allerdings wird dies weniger stark hervorgehoben. Auch hier herrscht keine Einheitlichkeit, was die bestehenden Unsicherheiten bestätigt.
3. Recht auf tatsächliche Einflussnahme? Mit dem Wahlrecht stimmt der einzelne Bürger – anders als in Abstimmungen, die eine Entscheidung über Sachfragen zum Gegenstand haben167 – über die Besetzung des Parlaments mit Personen ab.168 Die Mitentscheidung über Sachfragen ist in der repräsentativen Demokratie nur eine mittelbare, die effektiven Einflussmöglichkeiten des Bürgers auf staatliche Entscheidungen sind hierdurch beschränkt.169 Das freie Mandat der Abgeordneten schränkt die tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit 163
N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 151. 164 M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 110; H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 20. 165 M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 74; N. Achterberg/ M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 151; H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 16. 166 Den Grundsatz der unmittelbaren Wahl hat das Bundesverfassungsgericht jedoch durch das „negative Stimmgewicht“ verletzt gesehen. BVerfGE 121, 266 (307 f.) – Landeslisten, Urteil vom 3. 7. 2008. 167 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 1, S. 13; K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2 Rn. 161. 168 Dass der Bezugspunkt des Wahlrechts nur das Staatsvolk im Sinne des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG sein kann, wurde bereits oben verdeutlicht. So auch N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 108. 169 C. Gusy, Das Mehrheitsprinzip im demokratischen Staat, AöR 106 (1981), S. 329 (350 f.).
82
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
auf dieselben zusätzlich ein.170 Dennoch kann der Bürger über die Teilnahme an der Wahl die Entscheidung darüber beeinflussen, wie die Mandate im Bundestag verteilt werden. Es ist deshalb naheliegend, dass auch der Gewährleistungsgehalt des Wahlrechts die Einflussnahme auf die Besetzung des Parlaments mit Abgeordneten umfassen müsste.171 Dann würde sich der Inhalt des Wahlrechts nicht in der Wahlrechtsgleichheit erschöpfen, sondern dieses würde die tatsächliche Einflussnahmemöglichkeit beinhalten. Dass ein Recht des Einzelnen darauf, tatsächlich auf die Zusammensetzung des Parlaments Einfluss zu nehmen, jedoch nicht in jedem Wahlsystem verwirklicht werden kann, soll im Folgenden aufgezeigt werden. a) Die Wirkung von Wählerstimmen in unterschiedlichen Wahlsystemen Die Wirkung von Wählerstimmen ist in verschiedenen Wahlsystemen unterschiedlich, die Wahlsysteme lassen sich gerade danach unterscheiden, welche Wirkung der einzelnen Wählerstimme vom Wahlsystem intendiert ist, inwieweit es also die Wählerstimmen selbst sind, die das Wahlergebnis beeinflussen, und nicht erst die Wahltechnik.172 Dabei sollen nur die beiden „Grundtypen“173 von Wahlsystemen, das Verhältniswahlsystem und das Mehrheitswahlsystem,174 herangezogen werden, von denen zahlreiche Misch- und Zwischenformen denkbar sind. Beide 170 O. Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 90 (116, Fn. 96); A. Greifeld, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit des Abgeordneten, Der Staat 23 (1984), S. 503 (503). 171 M. Morlok, Demokratie und Wahlen, in: Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 559 (595); ders., in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 97; H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 34: „Beim Wähler ist insbesondere der Anspruch auf gleiche Behandlung seiner Stimme bei der Umsetzung in Mandate der eigentliche Zweck der Wahl.“ Ähnlich: A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (418). 172 H. Meyer, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: HStR, Bd. III, § 45 Rn. 25 f. 173 D. Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, 2009, S. 85; K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 4, S. 295; P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 44; H. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1996, S. 153 f., weist allerdings darauf hin, dass die Mehrheitswahl von ihrer Wahltechnik her beschrieben wird (S. 157), während die Verhältniswahl nach ihren Auswirkungen definiert wird (S. 156 f.). Er selbst plädiert aufgrund des politischen Charakters der Materie dafür, Wahlsysteme nicht nach ihrer Technik, sondern nach ihren Auswirkungen zu unterscheiden (S. 158). 174 H. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1996, S. 168 f.; ders, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: HStR, Bd. III, 2005, § 45 Rn. 28, bezeichnet die Wahlsysteme – zu Recht – nur als Enden eines Kontinuums, weil dazwischen auch noch andere Wahlsysteme denkbar wären, so z. B. die Mehrheitswahl im Dreierwahlkreis. Siehe hierzu die Gutachten, die dem Bundesministerium des Inneren hierzu erstattet wurden: R. Herzog, Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit eines Verhältniswahlsystems in (kleinen) Mehrmandatswahlkreisen, 1968, und J. A. Frowein, Rechtsgutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen (Dreier-Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, 1968. Der Vereinfachung halber sollen aber dennoch diese beiden Enden des Kontinuums als Beispiel genommen werden.
IV. Inhalt des Wahlrechts
83
Systeme werden von der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre als mit der Verfassung im Einklang stehend angesehen,175 könnten also vom einfachen Gesetzgeber als Ausgestaltung des Wahlsystems nach Art. 38 Abs. 3 GG eingeführt werden.176 aa) Die Wirkung von Wählerstimmen im Mehrheitswahlsystem Das Mehrheitswahlsystem ist in seiner Grundform ein Einmannwahlsystem in einer Vielzahl von Wahlkreisen. Dabei gibt es so viele Wahlkreise wie Mandate zu vergeben sind. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Wahlkreis erhält.177 Bei der geforderten Mehrheit kann es sich entweder um eine absolute Mehrheit handeln, bei der erst mit mindestens 50 Prozent der Stimmen ein Erfolg erzielt wird,178 oder um eine relative Mehrheit, bei der gewählt ist, wer mehr Stimmen als alle anderen Kandidaten erhalten hat. Das Mehrheitswahlsystem ist nicht darauf angelegt, dass allen Stimmen der Erfolg beschieden ist, Einfluss auf das Wahlergebnis zu nehmen. Im Mehrheitswahlsystem haben gerade nur die Stimmen, die auf den Bewerber entfallen, für den die meisten Stimmen abgegeben worden sind, Erfolg. Nur sie nehmen also tatsächlich Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages.179 Alle Stimmen, die auf die unterlegenen Bewerber entfallen, bleiben hingegen ohne Erfolg.180 Das bedeutet, sie entfalten keine Wirkung und haben keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages. Vereinfacht gesagt: Wer den Verlierer wählt, hätte auch zuhause bleiben können. Dies gilt bei der einfachen Mehrheitswahl sogar für den überwiegenden Teil der Stimmen, da der obsiegende Kandidat hier gerade keine absolute Stimmenmehrheit benötigt, sondern lediglich mehr Stimmen als die jeweils 175 BVerfGE 1, 208 (248) – 7, 5 %-Sperrklausel, Urteil vom 5.4. 1952; BVerfGE 6, 84 (90) – Sperrklausel, Urteil vom 23. 1. 1957; BVerfGE 95, 335 (349) – Überhangmandate III, Urteil vom 10. 04. 1997; H.-U. Erichsen, Wahlsysteme, Jura 1984, S. 22 (23 f.); P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 44. Die Weimarer Reichverfassung legte hingegen die Verhältniswahl fest (Art. 22 WRV). 176 Ob die dem geltenden Bundeswahlgesetz zugrunde gelegte sogenannte „personalisierte Verhältniswahl“ (§ 1 Abs. 1 S. 1 BWahlG spricht von einer „mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“) dem Grunde nach ein Verhältniswahlsystem darstellt, ist indes streitig. Dafür P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 52; BVerfG, Urteil vom 25. 7. 2012. Dagegen aber J. Ipsen, Wahlrecht im Spannungsfeld von Politik und Verfassungsgerichtsbarkeit, DVBl. 2013, S. 265 (270 ff). 177 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 4, S. 295. 178 Dabei kann noch danach unterschieden werden, ob sich die Mehrheit auf die abgegebenen Stimmen bezieht, auf die Zahl der möglichen Stimmen oder die Zahl der Anwesenden. Zu den unterschiedlichen Arten von Mehrheiten W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, S. 127 f. 179 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 4, S. 295. 180 M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 97. m. w. N.; E. Schiffer, Wahlrecht, in: HVerfR, 1983, S. 295 (299); H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254).
84
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
anderen Bewerber. Die zum Sieg genügenden Stimmen, und damit die erfolgreichen Stimmen, können umso weniger Stimmen sein, je mehr Kandidaten sich zur Wahl stellen und je gleichmäßiger die Wählerstimmen sich auf die Kandidaten verteilen. Die Mehrheitswahl ist also gerade darauf angelegt, dass ein Großteil der Wählerstimmen keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments hat und damit keine Wirkung entfaltet. Das Recht zu wählen kann unter Geltung eines Mehrheitswahlsystems allenfalls die Chance auf eine Einflussnahme sichern. So muss der Grundsatz der Gleichheit der Wahl dann dementsprechend so verstanden werden, dass hier neben dem gleichen Zählwert der Stimmen nur die gleiche „Erfolgschance“ gewährleistet ist,181 jede Stimme also die gleiche Chance haben muss, auf das Wahlergebnis Einfluss zu nehmen. Dies ändert aber nichts daran, dass es bei der Mehrheitswahl systemimmanent ist, dass die Chance der meisten Stimmen, tatsächlich Einfluss zu nehmen, sich gerade nicht verwirklicht, sondern diese ohne jeden Erfolg bleiben. Sie haben keine tatsächliche Wirkung.182 bb) Die Wirkung von Wählerstimmen im Verhältniswahlsystem Das Verhältniswahlsystem ist hingegen darauf angelegt, im Parlament ein möglichst originalgetreues Abbild der politischen Meinungen in der Wählerschaft abzubilden.183 Das Verhältnis der Wählerstimmen soll sich auch im Wahlergebnis wiederfinden. Hierfür wird auch die Metapher des Spiegelbildes benutzt.184 Es ist also das Ideal des Verhältniswahlsystems, jede Stimme nicht nur gleich zu zählen, sondern ihr auch die gleiche Einwirkung auf das Wahlergebnis zu verschaffen. 181 BVerfGE 95, 335 (353) – Überhangmandate II, Urteil vom 10. 4. 1997; R. Herzog, Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit eines Verhältniswahlsystems in (kleinen) Mehrmandatswahlkreisen, 1968, S. 54. 182 BVerfGE 1, 208 (248) – 7, 5 %-Sperrklausel, Urteil vom 5.4. 1952: „Es gibt Wahlverfahren, wie die Mehrheitswahl, die als unbedingt demokratisch angesehen werden, bei denen die politischen Anschauungen großer Teile des Volkes im Parlament unvertreten bleiben oder nicht ihrer Stärke gemäß vertreten sind.“ 183 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 4, S. 295; J. A. Frowein, Rechtsgutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen (Dreier-Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, 1968, S. 11. 184 So z. B. H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254). Auch wenn diese Metapher insofern nicht trägt, weil es bei der Wahl gerade darum geht, eine große Menge (Volk) auf eine kleine Menge (Parlament) abzubilden. Ohne eine partielle Verschiedenheit von Wählern und Gewählten wäre die Wahl überflüssig, das Volk könnte selbst die Aufgaben des Parlaments übernehmen (C. Gusy, Das Mehrheitsprinzip im demokratischen Staat, AöR 106 (1981), S. 329 (344). (Zur Vorzugswürdigkeit der mittelbaren Demokratie vor der direkten aber E.-W. Böckenförde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie, in: Festschrift für Eichenberger, S. 301 [301 ff.]). Ein Spiegelbild bildet die Realität aber gerade in Originalgröße, nur eben spiegelverkehrt ab. Es handelt sich bei der Verhältniswahl wohl eher um eine „zentrische Streckung“ im metaphorischen Sinn. Mirabeau beschreibt dies treffend so, dass das Parlament die Karte der Nation im verkleinerten Maßstab darstellen müsse, vgl. hierzu: G. Jellinek, Mirabeau und das demokratische Wahlrecht, in: ders., Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. II, S. 82 (86).
IV. Inhalt des Wahlrechts
85
Dieses Wahlsystem zielt in seinem Grundgedanken also darauf ab, dem Wahlberechtigten eine Mandatsverschaffungsmacht einzuräumen. Aus der Sicht der Wahlgleichheit bedeutet dies, dass alle Stimmen den gleichen „Erfolgswert“ haben, also im gleichen Maße zum Wahlergebnis beitragen.185 Das Verhältniswahlsystem ist also darauf angelegt, dass jede einzelne Stimme tatsächlich den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments nimmt.186 Verhältniswahlsysteme setzen notwendig eine Parteienwahl voraus, denn nur eine Gruppe von Menschen kann den auf sie verhältnismäßig entfallenen Anteil an Sitzen ausfüllen. Eine Umrechnung der Wählerstimmen in die auf die einzelnen Parteien entfallenden Mandate kann dabei durch unterschiedliche Sitzzuteilungsverfahren erfolgen, die das Ideal der Proportionalität in unterschiedlich exakter Weise verwirklichen.187 Ihnen gemeinsam ist jedoch, dass sie dieses Ideal nie in Gänze erfüllen können, weil sich bei der Abbildung einer großen Menge auf eine kleine notwendigerweise Rundungsfehler ergeben.188 Es führen so zwar die allermeisten, jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alle Stimmen zum Erfolg.189 Dennoch kann die Gleichheit des Erfolgswerts im Grundsatz des Wahlsystems sehr weitgehend verwirklicht werden.190 Dem Anspruch der Verhältniswahl, dass eine abgegebene Wählerstimme sich auf das Wahlergebnis auswirkt und zwar in gleicher Weise wie alle anderen Stimmen, kann damit überwiegend genüge getan werden, dies unterliegt jedoch mathematischen Grenzen. Welche Stimmen es sind, die ohne Erfolg geblieben sind, also für das Wahlergebnis unerheblich, lässt sich hingegen nicht ermitteln. Es gibt nicht die Stimme, die ohne Erfolg geblieben ist, sondern nur eine Anzahl von Stimmen, die ohne Erfolg geblieben sind.191 Diese lassen sich nur zahlenmäßig erfassen. 185 BVerfGE 1, 208 (248 f.) – 7, 5 %-Sperrklausel, Urteil vom 5.4. 1952; BVerfGE 79, 169 (170) – Überhangmandate II, Beschluss vom 24. 11. 1968. 186 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 4, S. 295. 187 Es ergeben sich notwendig aus jedem Sitzzuteilungsverfahren Verzerrungen. Am wenigsten der proportionalen Verteilung entspricht das d’Hondt’sche Höchstzahlverfahren, das große Parteien bevorzugt. Die Standardquotenmethode mit Ausgleich nach größten Resten nach Hare/Niemeyer entspricht der Erfolgswertgleichheit mehr. Das mittlerweile bei Bundestagswahlen eingeführte Divisorverfahren mit Standardrundung nach St. Laguë/Schepers trägt der Erfolgswertgleichheit bestmöglich Rechnung; so auch W. Schreiber, Novellierungen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, NVwZ 2002, S. 1 (7); ders., Novellierung des Bundestagswahlrechts, NJW 1985, S. 1433 (1436). Hierzu auch P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 48. Die im Bundestagswahlrecht benutzten Verfahren haben sich im Hinblick auf die Verwirklichung der Erfolgswertgleichheit dann auch stets verbessert, obwohl alle Verfahren für verfassungsmäßig gehalten wurden. 188 H. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1996, S. 169: „Parteien werden so gut wie nie genau ein Vielfaches des Wahlquotienten an Stimmen erzielen.“ 189 M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 178. 190 Auch wenn im geltenden Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland der absolut gleiche Erfolgswert aller Stimmen durch die sogenannte 5 %-Hürde gerade vermieden werden soll. 191 Hier verhält es sich ähnlich wie bei den sogenannten Überhangmandaten. Auch hier wurde im Fall des Ausscheidens eines Abgeordneten versucht, die Frage zu beantworten, wer ein Überhangmandat inne hat. Diese Frage lässt sich nicht beantworten, weil es nur einen zahlenmäßigen Überhang an Mandaten, aber nicht „das Überhangmandat“ gibt. Hierzu
86
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
b) Ergebnis Es zeigt sich, dass jedenfalls das Mehrheitswahlrecht mit einem Recht des Einzelnen auf tatsächliche Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Bundestages nicht in Einklang steht.192 Konsequent wird das Mehrheitswahlrecht dann auch von denjenigen, die ein Recht des Einzelnen auf tatsächliche Einflussnahme annehmen – weil das grundgesetzliche Demokratieprinzip „stark[…] individual-rechtlich“ geprägt sei193 – für verfassungswidrig gehalten.194 Jedenfalls sei eine „Präferenz der Wahlrechtsgleichheit zugunsten des Verhältniswahlrechts“ anzunehmen.195 Das Verhältniswahlsystem sei im Gegensatz zum Mehrheitswahlrecht „streng individualistisch“196 und würde deshalb den verfassungsrechtlichen Anforderungen am besten gerecht. Wie gesehen, gelingt es aber auch dem Verhältniswahlrecht nicht vollständig, seinen Anspruch zu erfüllen, jeder Stimme Einfluss auf das Wahlergebnis zu verschaffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stimme erheblich ist, ist allerdings deutlich höher als bei der Mehrheitswahl.197 Beschreibt man die Unerheblichkeit von Wählerstimmen für das Wahlergebnis und damit für die Zuteilung von Mandaten als Problem der Wahlgleichheit, lässt sich dieses Problem durch eine entsprechende Definition der Wahlgleichheit umgehen. Beschränkt man das Erfordernis der Gleichheit der Stimmen auf den Vorgang der Wahlauszählung und sieht in der Wahlgleichheit nur eine Zählwert- und Erfolgschancengleichheit, ergibt sich durch die fehlende Einflussnahme vieler Stimmen keine Verletzung der Wahlrechtsgleichheit. Aber auch dann, wenn man im Verhältniswahlsystem die Wahlgleichheit als Erfolgswertgleichheit beschreibt, lassen sich die Ungleichbehandlungen als Gleichheitsproblem leichter rechtfertigen. Wird aber über die Wahlgleichheit hinaus ein Recht zu wählen an sich anerkannt und ihm ein Inhalt beigemessen, der über die bloße Abgabe einer Stimme hinausgeht und in einer tatsächlichen Einflussnahme besteht, stellt sich die fehlende Mandatsrelevanz im Mehrheitswahlsystem demgegenüber als völliges Leerlaufen des
H. Meyer, Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlass der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 (315 ff.); in diese Richtung auch schon J. A. Frowein, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht, AöR 99 (1974), S. 72 (92). 192 J. Krüper, Wahlrechtsmathematik als gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, Jura 2013, S. 1147 (1156); H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254). 193 J. Krüper, Wahlrechtsmathematik als gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, Jura 2013, S. 1147 (1156). 194 H. Meyer, Demokratische Wahl und Wahlsystem in: HStR. III, 2005, § 45 Rn. 22; H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254). 195 M. Morlok, Demokratie und Wahlen, in: Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 559 (595 ff.); ders., in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 97. 196 H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254). 197 J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 58.
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
87
Rechts derjenigen Wähler dar, die einen unterlegenen Kandidaten gewählt haben.198 Der Rechtfertigungsaufwand hierfür erscheint dann deutlich höher. Aber auch das Verhältniswahlsystem sieht sich unter dieser Prämisse Rechtfertigungsnöten ausgesetzt, da es aus mathematischen Gründen nicht jedem „sein Recht“ gewähren kann. Hält man aber an der Verfassungsmäßigkeit der Mehrheitswahl fest, kann das Wahlrecht erst recht nicht als Recht auf tatsächliche Einflussnahme verstanden werden, sondern nur auf Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag. Als Mitwirkungsrecht lässt sich das Wahlrecht – jedenfalls in einem Mehrheitswahlsystem – nur dann charakterisieren, wenn man mitwirken im Sinne von „mitmachen“ versteht und nicht im Sinne von „tatsächlich eine Wirkung erzielen“.
4. Ergebnis Insgesamt zeigt sich, dass Unklarheit darüber herrscht, welchen Inhalt das von Literatur und Rechtsprechung angenommene individuelle Wahlrecht hat. Insbesondere ist sich die Literatur darüber uneinig, ob auch die Wahlgrundsätze eigene Individualrechte darstellen oder ob diese lediglich das individuelle Wahlrecht ausgestalten. Auffällig ist, dass die Literatur diese Diskrepanzen nicht aufdeckt, der Inhalt des Wahlrechts wird vielmehr nicht als streitig dargestellt. Dies zeigt insbesondere, dass für die eigene Interpretation kein Begründungsbedarf gesehen wird.
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht Dass das Wahlrecht ein Individualrecht sei, wird aus unterschiedlichen Begründungsansätzen hergeleitet. Dabei stützen sich manche Autoren auf mehr als einen dieser Ansätze.
198
Auch wenn – wie im Verhältniswahlsystem – der Maßstab der Erfolgswertgleichheit angelegt wird, der als Wahlrechtsinhalt die Mandatsverschaffungsmacht korrespondiert, lassen sich angelegte Ungleichbehandlungen wie Sperrklauseln am Grundsatz der Gleichheit der Wahl gemessen harmloser darstellen. Die Nichtberücksichtigung von Wählerstimmen erscheint dann als (gerechtfertigte) Ungleichbehandlung. Würde man Sperrklauseln als Eingriff in das Wahlrecht bezeichnen, müsste man den Entzug des Wahlrechts rechtfertigen, was deutlich drastischer erscheint. Das Feststellen einer „Ungleichbehandlung“ verharmlost diesen Umstand deshalb, weil es sich immer auch um eine graduelle Ungleichbehandlung handeln könnte.
88
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
1. Herleitung aus dem Wortlaut des Art. 38 Abs. 2 GG Manche Autoren schließen aus Art. 38 Abs. 2 GG, der formuliert: „Wahlberechtigt ist, wer…“, die Qualität des Wahlrechts als Individualrecht.199 Die Formulierung „berechtigt“ benutzt das Grundgesetz aber auch in Zusammenhängen, die keine Individualrechte beschreiben, sondern Rechte von Organen oder von Bund oder Ländern. Auch im Grundrechtsteil wird das Wort zwar in Art. 3 Abs. 1 GG im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen genannt sowie in Art. 6 GG im Hinblick auf die Erziehungsberechtigung der Eltern. In Art. 29 Abs. 4 und 6 GG findet das Wort dann in Bezug auf die Wahlberechtigung zum Deutschen Bundestag Verwendung; diese Verwendung kann aber deshalb nicht zur Auslegung des Art. 38 GG dienen, weil sie gerade an diesen anknüpft.200 Auch in Art. 47 GG wird im Hinblick auf das Zeugnisverweigerungsrecht der Bundestagsabgeordneten von einer „Berechtigung“ gesprochen. Hier wird zwar überwiegend davon ausgegangen, dass es sich nicht um ein organschaftliches Recht des Abgeordneten handelt, das Recht dem Abgeordneten vielmehr persönlich zusteht.201 Dies scheint überwiegend zunächst für eine individual-rechtliche Verwendung des Begriffs zu sprechen. Jedoch wird der Begriff im Grundgesetz auch anderweitig verwendet, und zwar in Art. 76 Abs. 2 GG im Hinblick auf das Recht des Bundesrates, zu den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzesinitiativen Stellung zu nehmen, sowie in Art. 110 Abs. 3 GG in Bezug auf das Recht des Bundestages zur Stellungnahme zu Haushaltsgesetzen. Im Zusammenhang mit dem Länderfinanzausgleich wird in Art. 107 Abs. 2 GG von „ausgleichsberechtigten Ländern“ gesprochen. Wenn auch die weitere Verwendung des Begriffs in Art. 137 Abs. 6 GG im Hinblick auf das Steuererhebungsrecht von Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für eine individual-rechtliche Verwendung des Begriffs streiten mag, wird deutlich, dass der Begriff im Grundgesetz unabhängig von der Zuordnung zu Individuen oder zu Organisationen und Organen benutzt wird.
199 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. IV, Art. 38 Rn. 136, spricht von einer andeutungsweisen Erwähnung, nicht eindeutig auch W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 15 der Begriff „wahlberechtigt“ spreche mehr für ein subjektives Recht; C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (216 Fn. 28), benutzt zwar den neutralen Begriff „Recht“, meint aber gerade das Individualrecht. 200 Ebenso wie die Verwendung des Wortes in Art. 118 a GG. 201 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 47 Rn. 3; K. Schulte, Volksvertreter als Geheimnisträger, 1987, S. 14; H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 47 Rn. 7; W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 50, spricht von einem „Statusrecht[…]“ des Abgeordneten, das von seinen Amtswalterrechten zu unterscheiden sei; K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 44; für eine Rechtsposition mit Doppelcharakter hält es D. C. Umbach, in: ders./Clemens/Dollinger, BVerfGG-Kommentar, §§ 63, 64 Rn. 42, ebenso wie die Diätenregelungen; hierzu schon ders., Abgeordnete und Fraktionen als Antragsteller im Organstreit, in: Festschrift für Zeidler, Bd. II, S. 1235 (1245 f.).
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
89
Aus der Formulierung des Art. 38 Abs. 2 GG „Wahlberechtigt ist, wer…“ lässt sich damit jedenfalls kein Individualrecht herleiten.
2. Herleitung aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG Die Eigenschaft des Wahlrechts als Individualrecht wird von einigen Autoren aus der Aufzählung des Art. 38 GG im Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG hergeleitet.202 Durch die Aufnahme des Art. 38 GG in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG sei das Wahlrecht den Grundrechten verfassungsrechtlich gleichgestellt.203 Die Verfassungsbeschwerde wurde jedoch erst 1969 mit der 19. Änderung des Grundgesetzes in das Grundgesetz aufgenommen.204 Zuvor war sie lediglich in den §§ 90 ff. BVerfGG einfachgesetzlich geregelt. Über eine einfachrechtliche Normierung lässt sich indes kein verfassungsrechtliches subjektives Recht konstruieren.205 Es kann auch nicht angenommen werden, dass das Wahlrecht mit der Aufnahme der Verfassungsbeschwerde in das Grundgesetz seinen Rechtscharakter geändert hat.206 Zudem zählt Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG das Wahlrecht nicht ausdrücklich auf, sondern spricht von den „in Art. 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechten“. Ob damit in Bezug auf Art. 38 GG ein Recht oder mehrere Rechte gemeint sind und welche Gehalte des Art. 38 GG damit als verfassungsbeschwerdefähige Rechte gelten sollen, lässt der Artikel sprachlich völlig offen. Denn der Plural „Rechte“ könnte sich erst aus der gemeinsamen Nennung der Artikel ergeben, er könnte sich aber auch bereits auf jeden einzelnen der genannten Artikel beziehen. Fest steht jedenfalls, dass Art. 38 GG nicht in Gänze, sondern nur, insoweit er Individualrechte enthält, verfassungsbeschwerdefähig ist.207 Der individual202 U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 244; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218; C. Labrenz, Die Wahlpflicht, ZRP 2011, S. 214 (216 Fn. 28); R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65; S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 458; R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65, zudem ergebe sie sich aber „aus seiner Stellung in der Verfassung“. 203 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013) Bd. IV Art. 38 Rn. 136; B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 148, 159 f.; H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 227: Art. 38 GG sei durch die Aufnahme in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG zum grundrechtsgleichen Recht erklärt worden. 204 BGBl. I S. 97. 205 H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 82; a. A. K. A. Schachtschneider, Anspruch auf Demokratie, JR 1970, S. 401 (403): Die Aufnahme der Rechte habe ihnen die Qualität als subjektive Rechte „verliehen“. 206 Deshalb hält W. Keitz., Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, S. 15 Rn. 6, die Schlussfolgerung eines subjektiven Rechts aus diesem Artikel jedenfalls nicht für zwingend, sieht sie jedoch als Indiz. 207 C. Gusy, Die Verfassungsbeschwerde, in: Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 641 (644); H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg.
90
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
rechtliche Gehalt ist für jeden Teil des Art. 38 GG gesondert nachzuweisen.208 Gemeint sein könnten somit ein oder mehrere Wahlgrundsätze oder das Wahlrecht, als das Recht zu wählen, an sich. Auch das Bundesverfassungsgericht sieht den Art. 38 GG – ebenso wie den Art. 33 GG – nicht in seinem gesamten Umfang durch Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG prozessual geschützt, sondern nur „soweit sie in ähnlicher Weise wie die übrigen Artikel des Grundgesetzes, in die sie hier eingereiht sind, Individualrechte garantieren“.209 Es erkennt damit an, dass das Prozessrecht vom materiellen Recht abhängig ist und nicht umgekehrt das Prozessrecht das materielle Recht ausgestaltet. Auch durch Aufnahme der Verfassungsbeschwerde in das Grundgesetz wurden damit keine neuen Individualrechte geschaffen, sondern diese gerade vorausgesetzt.210 Inwieweit Art. 38 GG tatsächlich Individualrechte enthält, ist aber – wie dargelegt – äußerst unklar. Aus der Aufnahme des Art. 38 GG in den Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte lässt sich zunächst nur entnehmen, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber überhaupt individual-rechtliche Gehalte in Art. 38 GG gesehen hat.211
3. Herleitung aus der Menschenwürde Die Mitbestimmung des Menschen am politischen Prozess wird mitunter zum Gehalt der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG gezählt und das Wahlrecht dementsprechend hieraus abgeleitet.212 Die Menschenwürde gebiete es, dass der Einzelne (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 84: Das „grundrechtliche Substrat“ ist darzutun. R. Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2013, Rn. 386, S. 130 in Rn. 488 f., S. 171 f., sieht explizit die fünf Wahlgrundsätze geschützt, die sich auch auf das passive Wahlrecht bezögen. 208 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 6, S. 321; verallgemeinernd für alle in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG aufgezählten Rechte: ders, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 63 IV 3, S. 361; H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 82, 84. 209 BVerfGE 6, 445 (445, Leitsatz 1; 449) – Mandatsverlust, Beschluss vom 14. 5. 1957; allerdings noch in Bezug auf § 90 BVerfGG. 210 H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013), § 90 Rn. 82; gegen eine Ableitung individual-rechtlicher Gehalte des Art. 38 GG aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG auch M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 149. 211 Bei den Beratungen über die Aufnahme des Wahlrechts in die Verfassungsbeschwerde im Ausschuss für Rechtswesen und Verfassungsrecht im Rahmen der Normierung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz erwog man auch, es dem Bundesverfassungsgericht anheim zu stellen, neben den Grundrechten andere Rechte mit der Verfassungsbeschwerde rügbar zu machen. Hierzu W. Boulanger, Die geschichtlichen Grundlagen der heutigen Verfassungsbeschwerde, S. 139 ff. 212 W. Maihofer, Menschenwürde im Rechtsstaat, in: ders./Behrendt, Die Würde des Menschen. Untersuchungen zu Art. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, S. 7 (56); die Demokratie sei deshalb die einzig menschenwürdige Gesellschaftsform, so R. F. Behrendt, Menschenwürde als Problem der sozialen Wirklichkeit, in: ders./Behrendt, Die Würde des Menschen. Untersuchungen zu Art. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
91
an Entscheidungen des Gemeinwesens teilhaben kann und so letztlich selbstbestimmt bleibt.213 Diese politische Mitbestimmung werde nur in der Demokratie verwirklicht, so dass die Demokratie die „organisatorische Konsequenz“ der Menschenwürde sei.214 Das Wahlrecht habe dann einen doppelten Bezug, zum einen in der Menschenwürde und zum anderen im Demokratieprinzip.215 So wird das Wahlrecht als Individualrecht mitunter unmittelbar aus der Menschenwürde hergeleitet.216 Aufgrund der Menschenwürde werde das Wahlrecht als Mitwirkungsmöglichkeit dann zum subjektiven Mitwirkungsrecht.217 Hierbei ist zu unterscheiden zwischen einer Begründung des Wahlrechts unter Herleitung aus der Menschenwürde als weitgehendes Selbstbestimmungspostulat, das sich dann in die Mitbestimmung an Gemeinschaftsentscheidungen wandelt, und einer Begründung, die ein subjektives Wahlrecht als Mitbestimmungsrecht aufgrund anderer Erwägungen aus der Menschenwürde ableitet. Auch das Bundesverfassungsgericht stellt einen engen Bezug zwischen Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen an der Gemeinschaft und der Würde des Menschen her.218 Es führte hierzu in seiner Entscheidung zum Verbot der KPD aus dem Jahre 1956 aus: „Um seiner Würde willen muß ihm [dem Einzelnen] eine möglichst weitgehende Entfaltung seiner Persönlichkeit gesichert werden. Für den politisch-sozialen Bereich bedeutet das, daß es nicht genügt, wenn eine Obrigkeit sich bemüht, noch so gut für das Wohl von ,Untertanen‘ zu sorgen; der Einzelne soll vielmehr in möglichst weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidungen Deutschland, Bd. II, S. 9 (57); F. Münch, Die Menschenwürde als Grundforderung unserer Verfassung, 1952, S. 6; H. Rolvering, Politische Betätigung von Ausländern, 1970, S. 119 f.; S. Huster/J. Rux, in: Epping/Hillgruber, GG-Kommentar, Art. 20 Rn. 72. 213 W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 57; so auch das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 123, 267 (341) – Lissabon, Urteil vom 30. 06. 2009: „Der Anspruch auf freie und gleiche Teilhabe an der öffentlichen Gewalt ist in der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) verankert.“ Zustimmend hierzu auch F. Schorkopf, Der Mensch im Mittelpunkt, in: R. Müller, Staat und Recht, S. 30 (30). 214 P. Häberle, Die europäische Verfassungsstaatlichkeit, KritV 1995, S. 298 (303); Ähnlich A. Bleckmann, Staatsrecht II, 1997, § 21 Rn. 19, S. 546: „Die Menschenwürde verlangt […], dass das Individuum über die demokratische Wahl der Staatsorgane die anonyme Einwirkung der Gesellschaft wenigstens teilweise mitlenken kann.“ 215 Dagegen aber D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 (27). 216 Kritisch zu dieser unmittelbaren Herleitung aber A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395 (400), der diese über das Konzept der „politischen Freiheit“ herleitet. 217 W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 57, die Mitwirkungsmöglichkeit des Bürgers stelle „einen wichtigen Teil seiner Persönlichkeitsentfaltung und damit seiner Menschenwürde dar“. Deshalb sei sie auch als subjektives Mitwirkungsrecht mit Verfassungsrang zu verstehen. (Hervorhebung nicht im Original). 218 BVerfGE 5, 85 (204 f.) – KPD-Verbot, Urteil vom 17. 8. 1956; allerdings bezieht sich diese Aussage nicht ausdrücklich auf das Wahlrecht, sondern auf den „politisch-sozialen“ Bereich.
92
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
für die Gesamtheit mitwirken.“219 Jedoch ging es in dieser Entscheidung nicht um das Wahlrecht, also um Mitbestimmung in formalisierter Form, sondern um die „Geistesfreiheit“ als Voraussetzung der Demokratie. Peter Häberle leitet die Notwendigkeit politischer Teilhabe ebenfalls aus der Menschenwürde ab, allerdings bemüht er einen anderen Begründungsansatz. Er sieht einen engen Bezug zwischen Volkssouveränität und Menschenwürde. In der Menschenwürde habe die Volkssouveränität „ihren ,letzten‘ (und ersten!) Grund“220. Es bestehe so ein „Fortsetzungszusammenhang“ zwischen Menschenwürde und freiheitlicher Demokratie.221 Die Demokratie sei die „organisatorische Konsequenz“ der Menschenwürde222 als „kulturanthropologischer Prämisse des Verfassungsstaates“.223 Menschenwürde als Recht auf politische Mitbestimmung sei mit dieser Maßgabe ein Grundrecht auf Demokratie.224 Daraus folge dann ein Verständnis der Wahlrechte225 und der Grundrechte auf demokratische Teilhabe226 als „funktionelle Grundlage der Demokratie“ und damit als „konkrete Ausformung der aktivbürgerlichen ,Schicht‘ der Menschenwürdeklausel.“227 Das Wahlrecht als Individualrecht des Einzelnen wird so unmittelbar aus der Menschenwürde in Form eines Rechtes auf Selbstbestimmung hergeleitet. Einen Begründungsansatz, der nicht auf das aus der Menschenwürde folgende Selbstbestimmungsrecht des Menschen zurückgeht, wählt hingegen Hans Meyer. Ein aus dem Wesen des Menschen abgeleitetes politisches Teilhaberecht ist nach Meyer auf die Gemeinschaft gerichtet. Es geht für den Einzelnen nach dieser Ansicht bei der 219
BVerfGE 5, 85 (204 f.) – KPD-Verbot, Urteil vom 17. 8. 1956. P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 65, Hervorhebung im Original. 221 P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 66; zustimmend auch W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (529); ders., Wahlrecht – Wahlpflicht?, ZRP 1994, S. 91 (93); E. Stein/G. Frank, Staatsrecht, 2010, S. 61: „Das demokratische Prinzip ist eine Konsequenz dieses Rechts der einzelnen Menschen auf Selbstbestimmung“; W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 57, 87 – 91. 222 P. Häberle, Die europäische Verfassungsstaatlichkeit, KritV 1995, S. 298 (303); zustimmend A. Rinken, Demokratie und Hierarchie, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Demokratie und Grundgesetz, S. 125 (136), ähnlich B.-O. Bryde, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, Staatswissenschaft und Staatspraxis, 1994, S. 305 (322): Die Demokratie sei die menschenwürdigste, weil größtmöglicher Selbstbestimmung verpflichtete Staatsform. 223 P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1998, S. 4. 224 P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 68. 225 Worunter P. Häberle die Rechte aus Art. 38 und 29 aber auch 33 GG zählt. 226 Als Verstärkung dieses Arguments sieht Häberle die politische Dimension des Art. 5 und 8 GG (Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit). 227 P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 69. 220
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
93
Mitwirkung an Gemeinschaftsentscheidungen nicht um die Verbesserung und Ausgestaltung der individuellen Position, sondern um eine Mitwirkung an politischen Entscheidungen der Gemeinschaft und damit an den Gemeinschaftsinteressen. Es gehöre „in einer Demokratie zu der in Art. 1 für unantastbar erklärten Würde des Menschen, daß er an der Gestaltung der Gemeinschaft, der er angehört, teilhaben kann und zwar nicht primär, weil er sich dadurch vor Akten dieser Gemeinschaft besser schützen oder seine Bedürfnisse und materiellen Interessen am besten verfolgen oder genereller gefaßt, damit er Autonomie verwirklichen könne, sondern, weil die politische Gestaltung mit zu den natürlichen Lebensmöglichkeiten des Menschen als homo politicus gehört.“228 Als Mittel zur Gestaltung der Gemeinschaft sieht Meyer gerade auch das Wahlrecht aus Art. 38 GG. Seine Argumentation setzt jedoch nicht zwingend ein wahlrechtliches Individualrecht voraus, weil das Recht seiner Ansicht nach nicht zur Durchsetzung individueller Interessen gewährt wird, sondern um der Mitwirkung an der Gemeinschaft willen. Es ist nicht ersichtlich, warum nicht eine Ausgestaltung als organschaftliches Recht dieser Anforderung Genüge tun sollte. Wohlgemerkt muss dieses dann nach Meyers Forderung im Prinzip allen zustehen. Auch Meyers Forderung ist damit eigentlich eine Forderung nach Demokratie. Die Brüche, die dadurch entstehen, dass aufgrund der erforderlichen Einsichtsfähigkeit das Wahlrecht nicht restlos allen zustehen kann, vermögen jedoch nicht überwunden zu werden.229 Dass die Demokratie einen Bezug zur Menschenwürde hat, ist unbestritten.230 Sowohl die Demokratie als auch die Menschenwürde wurzeln in dem Gedanken der Autonomie des Menschen.231 Inhalt der Menschenwürde ist das Verbot, dass der Mensch zum bloßen Objekt herabgewürdigt wird.232 Ob sie nur bloßes Verfassungsprinzip ist oder Individualrecht des Einzelnen,233 kann hier dahingestellt bleiben, weil das Wahlrecht zwar u. a. auf die Menschenwürde als Grundrecht zu228 H. Meyer, Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes, VVDStRL 33 (1975), S. 69 (75 f.). 229 Siehe hierzu sogleich in diesem Abschnitt. 230 Mit dieser Einschränkung auch A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395 (398). 231 H. Steinberger, Die Europäische Union im Lichte der Entscheidung des BVerfG, in: Festschrift für Bernhardt, S. 1313 (1325). Dennoch ist Art. 1 Abs. 1 GG nicht der unmittelbaren Anknüpfungspunkt demokratischer Mitbestimmungsrechte. U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (444), spricht von der „Funktion der Menschenwürdeklausel als staatsorganisationsrechtliche[r] Residualkategorie“. Den Bezug der Demokratie zur Freiheit arbeitet E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 35 f., heraus. 232 Zuerst J. Wintrich, Über Eigenart und Methode verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung, in: Festschrift für Laforet, S. 227 (235 f.); G. Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, AöR 81 (1956), S. 117 (127); ders., in: Maunz/ders., GG-Kommentar, Art. 1 Abs. 1 Rn. 28; C. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, 1997, S. 176 ff. 233 M. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 55. Lfg. (Stand: Mai 2009) Bd. I, Art. 1 Abs. 1 Rn. 29.
94
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
rückgeführt wird,234 die Wertung sich aber in gleicher Form und mit den gleichen Einwänden auch aus dem objektiven Prinzip der Menschenwürde herleiten ließe. Gegen eine zwingende Ableitung des Wahlrechts aus der Menschenwürde sprechen indes mehrere Argumente:235 Wie gesehen folgt aus dem Wahlrecht nicht notwendig eine tatsächliche Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Parlaments. Die aus der Menschenwürde abgeleitete Mitwirkung erschöpft sich dann in einer Chance auf Mitwirkung und damit Mitbestimmung.236 Wenn aber die Menschenwürde eine Mitbestimmung an Gemeinschaftsentscheidungen zwingend erfordern soll, könnte dieser Forderung nicht Genüge getan werden. Zudem lässt sich mit der Stimmabgabe bei Wahlen keine differenzierte Aussage treffen, sondern es kann lediglich die Zustimmung zu einer politischen Richtung kundgetan werden.237 Dies führt unmittelbar zum zweiten Argument: Leitet man das Wahlrecht aus der Menschenwürde her, tut sich die Frage auf, welche konkrete Mitwirkung an staatlichen Entscheidungen die Menschenwürde fordert.238 Kann ein repräsentativ-demokratisches System der Forderung der Menschenwürde an die Selbstbestimmung des Einzelnen Genüge tun? Dieses bringt die Beschränkung der Mitbestimmung des Einzelnen auf die Entscheidung über die Zusammensetzung des Parlaments mit sich. Würde die Menschenwürde tatsächlich eine umfassende Mitwirkung an Entscheidungen der Allgemeinheit erfordern, wäre äußerst fraglich, ob die nur mittelbare Mitwirkung an Entscheidungen, die die Gemeinschaft betreffen, über die Wahl von Abgeordneten diese Anforderungen erfüllen. Denn die Freiheit der Abgeordneten schränkt die tatsächliche Entscheidungsmöglichkeit des Wählers über Sachfragen erheblich ein.239 Zudem ist fraglich, ob ein Wahlrecht des Bürgers, das sich auf die Wahl des Deutschen Bundestages beschränkt, ausreichend ist. Beispielsweise wird 234 So P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 67. 235 Dagegen auch D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 (27): „Wer in der Menschenwürde die ,Wurzel‘ des demokratischen Wahlrechts sieht, radikalisiert sie und unterwirft die Verfassung der ungehemmten WürdeDiktatur“; U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (445), spricht von einer „Überfrachtung der Menschenwürdeklausel“, ähnlich A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (398). 236 Dem entspricht die Erfolgschancengleichheit, in der sich die Wahlrechtsgleichheit im Mehrheitswahlsystem erschöpfe: BVerfGE 95, 335 (370) – Überhangmandate II, Urteil vom 10. 4. 1997. 237 W. Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, 1992, S. 29. 238 So auch M. A. Wiegand/B. Zabel, Der Demokratische Verfassungsstaats zwischen Ideal und Wirklichkeit, Der Staat (2011); S. 73 (80); C. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, 1997, S. 88 f., der auch auf die Unbestimmtheit der Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts und P. Häberles hinweist, die aus dieser Unsicherheit resultieren. 239 Hierzu A. Greifeld, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit des Abgeordneten, Der Staat 23 (1984), S. 503 (504): „Wahlrecht und Abgeordnetenfreiheit können lediglich aneinander ihre äußeren Grenzen finden.“
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
95
der Bundesrat, der jedenfalls im Gesetzgebungsverfahren ebenfalls eine gewichtige Aufgabe hat,240 nicht von den Wahlberechtigten gewählt.241 Als Lackmustest der Verwirklichung der Menschenwürde durch das Wahlrecht – sei es als Umsetzung der Selbstbestimmung, sei es als Verwirklichung der Mitbestimmungsmöglichkeiten des homo politicus – kann der Ausschluss bestimmter Personengruppen vom Wahlrecht betrachtet werden. Das Wahlrecht steht nach dem Grundgesetz nur Deutschen zu, die das Wahlalter erreicht haben und bei denen keine Wahlrechtsauschließungsgründe vorliegen.242 Ausländern, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, und Kindern steht das Wahlrecht damit nicht zu.243 Wäre das Wahlrecht unmittelbare Konsequenz der Menschenwürde, würden diese Wahlrechtsausschließungsgründe die Würde der betroffenen Personen verletzen. Der Ausschluss vom Wahlrecht würde zunächst einen Eingriff in die Menschenwürde darstellen.244 Jeder Eingriff in die Menschenwürde stellt aber zugleich eine Verletzung des Rechts dar, weil die Menschenwürde nicht abwägungsfähig ist.245 Die Rechtfertigungsgründe, die von den Befürwortern eines aus der Menschenwürde abzuleitenden Wahlrechts angeführt werden, sind dementsprechend unzureichend. W. Bausback erklärt den Ausschluss von Ausländern so, dass diese nicht in einem vergleichbaren Pflichtenverhältnis zum deutschen Staat stünden wie deutsche Staatsbürger. Nur wo ein solches Pflichtenverhältnis einen Ausgleich verlange, sei das „Wahlrecht als Korrelat […] im Hinblick auf die Eigenverantwortlichkeit des Menschen als Teil seiner personalen Würde“ erforderlich.246 Nicht aber das Wahlrecht wird dann aus der Menschenwürde hergeleitet, sondern ein Ausgleich für das Pflichtverhältnis zum Staat. Zudem wird das Wahlrecht zu einem Ausgleichsmechanismus für ein Pflichtenverhältnis degradiert.247 Das Wahlrecht steht zwar mit 240 Unabhängig davon, ob es sich um Einspruchs- oder Zustimmungsgesetze handelt, siehe Art. 77 GG. 241 C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie?, JZ 2010, S. 1160 (1161). 242 Art. 38 Abs. 2 GG i. V. m. § 13 BWahlG. 243 Darüber hinaus sind auch Personen ausgeschlossen, die infolge eines Richterspruchs vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 13 Nr. 1 BWahlG), diejenigen, denen zur Besorgung ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist (§ 13 Nr. 2 BWahlG), und wer sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet (§ 13 Nr. 3 BWahlG). 244 Von einem Eingriff lässt sich indes nur sprechen, wenn man die Menschenwürde als Grundrecht anerkennt. Auch sonst würde sich an der Verletzung des Rechtsprinzips aber nichts ändern. 245 C. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, 1997, S. 102 ff., 106; BVerfGE 30, 1 (25), Abhörurteil, Urteil vom 15. 12. 1970; B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/ R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 7 IV Rn. 381 a. 246 W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 91. 247 Gegen dieses „Ausgleichsargument“ wendet sich auch M. Breuer, Kinderwahlrecht vor dem BVerfG, NVwZ 2002, S. 43 (44): Die Pflicht zur Befolgung staatlicher Normen werde
96
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
dem Pflichtenverhältnis des Einzelne zum Staat im engen Zusammenhang, weil beide aus dem Staatsbürgerstatus folgen. Es ist aber kein Ausgleich hierfür. Der Ausschluss Minderjähriger vom Wahlrecht trage nach Bausback hingegen „dem Umstand objektiver Gründe in der Person der Betroffenen Rechnung, die eine verantwortliche Ausübung des Wahlrechts durch diese Person ausgeschlossen erscheinen lassen“.248 Deshalb sei die personale Würde dieser Personen nicht einmal berührt. Die Unfähigkeit dieser Menschen, das Wahlrecht verantwortlich auszuüben, könnte zwar als Rechtfertigung für einen Eingriff in die Menschenwürde dienen, wäre diese rechtfertigungsfähig. Dies ist sie jedoch gerade nicht. Warum aber aufgrund des Vorliegens objektiver Gründe die Würde gerade dieser Menschen nicht einmal berührt sein soll, während die Würde „verantwortungsvoller“ Menschen das Wahlrecht gerade fordern soll, bleibt unverständlich. K.-P. Dolde, der der Menschenwürde ebenfalls einen sozialen Bezug beimisst, löst das Problem des Ausschlusses von Ausländern dadurch, dass er aus Art. 1 GG nur das Erfordernis eines Minimums an politischer Beteiligung ableitet. Eine formalisierte Mitwirkung an der Staatswillensbildung erfordere diese hingegen gerade nicht,249 sondern nur eine „wie auch immer geartete Mitwirkung an der Schaffung der Normen, denen das Individuum unterworfen ist.250 Die Mitwirkung an Normen durch Ausübung von nicht formalisierten „Mitwirkungsrechten“, also im Wesentlichen durch die sogenannten Kommunikationsgrundrechte,251 ist indes äußerst gering, und – was entscheidend ist – alles andere als sicher.252 Der Ausschluss von Ausländern lässt sich nach dieser Theorie noch so erklären, dass der Ausländer den Normen des deutschen Staates nicht „unterworfen“ ist, sondern sich ihnen selbst unterstellt und sich ihnen jederzeit durch Ausreise entziehen kann. Der Ausschluss von Staatsangehörigen vom Wahlrecht lässt sich jedoch auch nach dieser Theorie nicht erklären.253
vielmehr durch den Schutz, den die Rechtsordnung jedem von Hoheitsgewalt Betroffenen gewährt, kompensiert. 248 W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 91. 249 K.-P. Dolde, Die politischen Rechte der Ausländer in der Bundesrepublik, 1972, S. 75. 250 K.-P. Dolde, Die politischen Rechte der Ausländer in der Bundesrepublik, 1972, S. 49. 251 Der Begriff ist geprägt von H.-P. Schneider, Eigenart und Funktionen der Grundrechte im demokratischen Verfassungsstaat, in: Perels (Hrsg.), Grundrechte als Fundament der Demokratie, S. 11 (30). Er umfasst diejenigen Grundrechte, die insbesondere die zwischenmenschliche Kommunikation schützen, wie die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die Meinungsfreiheit. Diese Aufzählung nimmt auch H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993, S. 38, vor. 252 Siehe hierzu oben in Abschnitt D. IV. 3, S. 81 ff. 253 K. F. Gärditz/C. Hillgruber, Volkssouveränität ernst genommen – Zum Lissabonurteil des BVerfG, JZ 2009, S. 872 (873), folgern aus der Bezugnahme auf die Menschenwürde gerade den „Exklusionsanspruch demokratischer Selbstbestimmung“.
V. Begründung des Wahlrechts als Individualrecht
97
Gegen eine Ableitung des Wahlrechts aus der Menschenwürde spricht zudem, dass das Völkerrecht die Ausübungsmöglichkeit des Wahlrechts auf fremdem Staatsgebiet nicht zwingend vorschreibt. Die Lehre von den Mindeststandards, die ihren Grund eben in der Menschenwürde findet, gebietet es den Staaten lediglich, den auf ihrem Staatsgebiet lebenden Ausländern einen Grundbestand an persönlichen und wirtschaftlichen Rechten zu gewähren. Dazu zählt nach herrschender Meinung jedoch nicht die Ausübung politischer Rechte.254 Es zeigt sich, dass jegliche Ausschlussgründe vom Wahlrecht dann, wenn man es aus der Menschenwürde herleitet, sich nicht mehr rechtfertigen lassen.255
4. Herleitung aus dem Grundsatz der freien Wahl Auch der Grundsatz der freien Wahl aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG wird als Begründung dafür angeführt, dass das Wahlrecht subjektiv-rechtlich sei. Dieser gestalte das Wahlrecht subjektiv-rechtlich aus,256 denn der Begriff „Freiheit“ verweise auf subjektive Rechte.257 Dieser Grundsatz zeige, dass das Wahlrecht dem Bürger zu freier Entscheidung und unumschränkter Willensmacht übertragen sei258 und damit Ausdruck der Selbstbestimmung.259 Allein aus der Modalität der Wahl als „frei“ lässt sich jedoch eine individual-rechtliche Ausgestaltung nicht herleiten. Denn der Begriff der Freiheit muss nicht notwendigerweise als Beliebigkeit verstanden werden. Es lässt sich vielmehr auch die Freiheit von etwas beschreiben. Dass das Grundgesetz „Freiheit“ nicht stets im Sinne von „Beliebigkeit“ interpretiert, zeigt sich dann auch im nächsten Satz, Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG, der von der ausschließlichen Gewissensunterworfenheit des Abgeordneten spricht. Diese wird als „Freiheit des Mandats des Abgeordneten“ interpretiert.260 Dennoch ist dies nach richtiger Auffassung des 254 D. Siegrist, Hoheitsakte auf fremdem Staatsgebiet, 1987, S. 219; K. Doehring, Die allgemeinen Regeln des völkerrechtlichen Fremdenrechts, 1963, S. 80 f. 255 So auch N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 91. Kritisch zum Menschenwürdebezug des Wahlrechts auch E. Peuker, Die demokratische Auslegung des Völkerrechts, EuR 2013, S. 75 (78). 256 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 103, 159. 257 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 103, 148, 154; W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 16. Dies setzt wohl auch R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65, voraus, wenn er „das Recht auf freie Wahl“ als „Freiheitsrecht“ deutet. 258 W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 16, allerdings mit unzutreffender Bezugnahme auf BVerfGE 7, 63 (69) – Listenwahl, Beschluss vom 3. 7. 1957. Hier wird nur festgestellt, dass die Freiheit der Wahl bedeute, dass der Wähler sein Wahlrecht ohne Zwang oder sonstige unzulässige Beeinflussung ausüben könne. 259 W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (519). 260 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 41; H. H. Klein, Der Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 2 ff.
98
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Bundesverfassungsgerichts261 und der Literatur262 keine grundrechtliche Freiheit, sondern eine organschaftliche und damit gebundene Freiheit.263 Das Wahlrecht des Bürgers und das Mandat des Abgeordneten stehen aber in engem Zusammenhang. Werden sie auch als sich gegenseitig einschränkende Berechtigungen begriffen,264 hat das Bundesverfassungsgericht ihre Parallelität in seinem Diätenurteil265 aufgedeckt.266 Es hat hier die Gleichheit der Abgeordneten im Parlament aus der Gleichheit der Wähler bei der Wahl abgeleitet und dabei ausdrücklich seine frühere Rechtsprechung geändert, in der es die Gleichheit der Abgeordneten lediglich aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG herleitete.267 Darüber hinaus hat es aber auch gerade die Freiheit des Mandats als Ausdruck der freien Ausübung des Wahlrechts interpretiert.268 So wird auch die Freiheit des Mandats zur Fortwirkung der Freiheit der Wahlausübung, beide damit zu „parallelen“ Berechtigungen. Soll dies nicht im Sinne einer „Vergrundrechtlichung“ der Abgeordnetenstellung gedeutet werden, die sicher fehlgehen muss,269 kann es nur so verstanden werden, dass auch der Grundsatz der freien Wahl nicht im Sinne einer grundrechtlichen, ungebundenen Freiheit zu verstehen ist. Aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl lässt sich damit die angenommene individualrechtliche Qualität des Wahlrechts nicht begründen.
5. Herleitung aus dem Demokratieprinzip Die individual-rechtliche Qualität des Wahlrechts wird auch aus der systematischen Beziehung des Art. 38 GG mit dem Demokratieprinzip hergeleitet. Da er dessen Konkretisierung diene und dieser auch „das Innehaben aktiver staatsbürgerlicher Rechte durch die große Masse der Bevölkerung“ beinhalte, sei hieraus die subjektiv-rechtliche Natur des Wahlrechts zu folgern.270 Die Annahme beruht jedoch auf einem Zirkelschluss: Welche Rechtsnatur die „aktiven staatsbürgerlichen 261
BVerfGE 6, 445 (447 f.) – Mandatsverlust, Beschluss vom 14. 5. 1957. H. H. Klein, Der Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 4. 263 Es gibt Tendenzen, die Grundrechte und den Status des Abgeordneten zu vermischen. So beschreibt T. Oppermann, Parlamentarisches Regierungssystem des Grundgesetzes, VVDStRL 33 (1975), S. 43 f., das freie Mandat als „Ausformung der Individualität, Personalität und politischen Meinungs- und Handlungsfreiheit seines Trägers im Sinne der Art. 1, 2 und 5“. Ausführlich hierzu unten in Abschnitt F. VII., S. 238 ff. 264 A. Greifeld, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit des Abgeordneten, Der Staat (1984), S. 501 (502). 265 BVerfGE 40, 296 (317 f.) – Abgeordnetendiäten, Urteil vom 5. 11. 1975. 266 Zur Parallelität der Berechtigungen auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 400. 267 BVerfGE 102, 224 (238) – Funktionszulagen, Urteil vom 21. 7. 2000; anders noch in BVerfGE 84, 304 (325) – Gruppenstatus der PDS/Linke, Urteil vom 16. 7. 1991. 268 BVerfGE 102, 224 (238 f.) – Funktionszulagen, Urteil vom 21. 7. 2000. 269 Siehe hierzu unten in Abschnitt F. VII., S. 238 ff. 270 W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 15. 262
VI. Gründe für die individual-rechtliche Betrachtung des Wahlrechts
99
Rechte“ haben, ist ja gerade zu klären. Aus dem Demokratieprinzip lässt sich eine individual-rechtliche Natur des Wahlrechts somit nicht ableiten.
VI. Gründe für die individual-rechtliche Betrachtung des Wahlrechts 1. Sprachliche Implikationen Wie gesehen, hat das Wort „Recht“ und damit auch das Wort „Wahlrecht“ zwei unterschiedliche Bedeutungen.271 Wird aber von der Berechtigung zu wählen als „Wahlrecht“ gesprochen, so legt dies zunächst die Vorstellung von einer individuellen Berechtigung, einem subjektiven Individualrecht, nahe, weil das Wort „Recht“ im Sinne einer Berechtigung im allgemeinen Sprachgebrauch zunächst den Bezug auf Individuen und nicht auf Organe suggeriert. Denn Rechte werden ganz überwiegend in Bezug auf Individuen definiert, wie z. B. Grundrechte oder Menschenrechte. Von Rechten von Organen und Organteilen ist weniger die Rede, sie wurden auch erst mit Aufgabe der Vorstellung der Impermeabilität des Staates überhaupt für denkbar gehalten.272 Der Gebrauch des Wortes „Wahlrecht“ für die Berechtigung zu wählen ist aber umso erstaunlicher und nur aus einem historischen Gebrauch des Wortes zu erklären, weil es an keiner Stelle des Grundgesetzes gebraucht wird. Vielmehr benutzt das Grundgesetz lediglich die Formulierung „wahlberechtigt ist, wer…“.273 Deutlicher wird dies noch am sogenannten „passiven Wahlrecht“, das als Individualrecht darauf, gewählt werden zu können, verstanden wird.274 Hier liegt der Sprachgebrauch des Grundgesetzes weit von einer individual-rechtlichen Formulierung entfernt.275 Das Grundgesetz zielt hier auf die Wählbarkeit ab, wenn es in Art. 38 Abs. 2 GG formuliert „[w]ählbar ist, wer…“. Eine individual-rechtliche Deutung würde jedenfalls eine aktive Formulierung wie: „Das Recht, gewählt zu werden, hat, wer…“ vermuten lassen. Auch einer solchen würde sich freilich die Rechtsnatur des Rechts, gewählt zu werden, nicht eindeutig entnehmen lassen. Die Beschreibung durch das Adjektiv „wählbar“ hingegen impliziert viel eher eine rechtserhebliche Eigenschaft einer
271
Siehe oben in Abschnitt A. II. 1., S. 17. Siehe hierzu oben in Abschnitt A. II. 2., S. 18 ff. 273 Zur teilweise vertretenen Begründung der individual-rechtlichen Sicht gerade aus dieser Formulierung siehe oben unter D. V. 4, S. 97. 274 Statt vieler S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 100. 275 Auch P. M. Huber, Selbstbestimmung in Europa, ZSE 11 (2013), S. 484 (489), spricht von einem „objektiv-rechtlich gehaltenen Wortlaut“. 272
100
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Person als ein subjektives Individualrecht, weil Adjektive als Wortart zur Beschreibung von Eigenschaften gebraucht werden.276 Die Folgerung auf ein subjektives Individualrecht ist bei der Formulierung „[w]ahlberechtigt ist, wer…“ zwar naheliegender, aber ebenso keinesfalls zwingend, weil der Begriff des „berechtigt Seins“ zwar individual-rechtliche Assoziationen weckt, aber nicht nur in diesem Zusammenhang verwendet wird.277 Auch ist zu bedenken, dass das Wort „wahlberechtigt“ ebenfalls ein Adjektiv ist und damit das Innehaben der Berechtigung hier gerade als Eigenschaft einer Person konnotiert wird. Dennoch hat sich die Diktion vom „Wahlrecht“ durchgesetzt und mit ihr die Vorstellung eines Individualrechts.
2. Vermischung bürgerlicher Freiheitsrechte und staatsbürgerlicher Mitwirkungsrechte Ein weiterer Grund für die individual-rechtliche Betrachtung des Wahlrechts ist die Vermischung von bürgerlichen Freiheitsrechten und staatsbürgerlichen Mitwirkungsrechten.278 Diese mag daher rühren, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes sowohl einen umfassenden Grundrechtekatalog enthält als auch die Selbstbestimmung des Volkes gewährleistet ist.279 Damit rückt die Unterschiedlichkeit der Rechte in den Hintergrund, sie erscheint kaum mehr notwendig. Diese Vermischung wirkt dabei auch in die andere Richtung: nicht nur wird das Wahlrecht als Individualrecht betrachtet, auch werden mitunter Grundrechte, die eine gesteigerte Bedeutung für die Demokratie besitzen, also insbesondere die sogenannten Kommunikationsgrundrechte, – jedenfalls auch – funktionell betrachtet.280 Dies führt dann bisweilen gar dazu, den „politischen“ Grundrechtsgebrauch vor dem „privaten“ bevorzugt zu behandeln.281 276 P. Gallmann, in: Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.), Duden – Die Grammatik, Rn. 459. Als lediglich rechtserhebliche Eigenschaft qualifiziert dann auch W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 12 Rn. 6, die Wählbarkeit. 277 Siehe oben in Abschnitt D. V. 1., S. 88. 278 So auch S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (84). 279 So S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (84). 280 G. F. Schuppert, Grundrechte und Demokratie, EuGRZ 1985, S. 525 (528); K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 1 Rn. 84. So wurde das ursprünglich auf die Meinungsfreiheit bezogene, zum geflügelten Wort gewordene Zitat, die Meinungsfreiheit sei „schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“, BVerfGE 7, 198 (208) – Lüth, Urteil vom 15. 1. 1958, später auch auf andere Kommunikationsgrundrechte bezogen: BVerfGE 62, 230 (247) – Boykottaufruf, Urteil vom 15. 11. 1982.
VI. Gründe für die individual-rechtliche Betrachtung des Wahlrechts
101
Diese Tendenzen haben zur Folge, dass das Wahlrecht des Bürgers sich in einer Rechtskategorie mit den Kommunikationsgrundrechten wiederfindet. Hierdurch wird ein Gleichlauf dieser Rechte suggeriert und die Unterscheidung zwischen Freiheitsrechten und dem Wahlrecht verwischt. Die Vermischung von bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechten und die damit einhergehende Vermischung von individueller und staatlicher Freiheit wird durch eine Vermischung der Begriffe „politisch“ und „staatlich“ befördert. Dass ein „trennscharfer Grenzverlauf“282 zwischen individueller und politischer Freiheit nicht existiert, somit schlechthin apolitische Grundrechte nicht existieren,283 ist unbestritten. Dennoch ist zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre zu unterscheiden.284 Die individuelle Freiheit kann nur in der gesellschaftlichen Sphäre ausgeübt werden. Diese kann dann aber auch zu politischen Zwecken genutzt werden. Die „staatliche (demokratische) Freiheit“, die durch das Wahlrecht gesichert wird, kann jedoch nur in der staatlichen Sphäre verwirklicht werden. Die „politische Freiheit“ bildet dann einen Grenzbegriff. Mit ihr kann sowohl das Wirken in der staatlichen Sphäre gemeint sein, das seiner Definition nach politisch, nämlich auf die Gemeinschaft bezogen ist, aber auch die Ausübung von individual-rechtlichen Grundrechten zu gemeinschaftlichen Zwecken.285
3. Uneindeutigkeit des Begriffs „Bürger“ Die Vermischung von bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechten wird dadurch befördert, dass mit dem Begriff „Bürger“, der das Individuum im staatlichen Kontext bezeichnet, der Bürger in unterschiedlichen Rollen bezeichnet wird. Zum einen wird hiermit der Staatsbürger bezeichnet, der Teil des Souveräns und Mitinhaber staat281 Dies entspricht einer Zwischenform der demokratisch-funktionalen Grundrechtstheorie, nach der die Grundrechte primär nicht von ihrer Funktion als das Individuum schützende Normen her betrachtet werden, sondern von ihrer Funktion für die Demokratie; siehe hierzu E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 1529 (1534 f.). H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993, S. 40, möchte den politischen Grundrechtsgebrauch vor dem privaten zwar nicht privilegieren, nimmt aber eine Doppelfunktionalität an. Er hebt hervor, dass diese Doppelfunktionalität andere Grundrechte von staatsbürgerlichen Rechten unterscheidet, weil diese nicht rein staatsabwehrend gebraucht werden können. 282 N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 49. 283 W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (496), einschränkend N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 50, Fn. 337. 284 E.-W. Böckenförde, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, S. 46; er weist jedoch auch auf die Wechselwirkungen zwischen Staat und Gesellschaft hin und spricht deshalb nicht von „Trennung“, sondern von „Unterscheidung“ (S. 8); schärfer unterscheidet R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 146. 285 Zur Unterscheidung eines politischen und eines privaten Lebensbereiches A. Schüle, Demokratie als politische Form und als Lebensform, in: Festgabe für Smend, S. 321 f.
102
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
licher Gewalt ist.286 Zum anderen wird aber auch der Bürger als Herrschaftsunterworfener und Teil der Gesellschaft so bezeichnet. Sollen die Begriffe klar getrennt werden und eindeutig verwendet werden, greift die deutsche Literatur auf die französische Terminologie „bourgeois“ und „citoyen“ zurück.287 Diese Doppeldeutigkeit des Begriffs ist deshalb möglich, weil das Grundgesetz ihn nicht verwendet,288 ihn damit aber auch nicht besetzt. Der allgemeine Sprachgebrauch ist jedoch uneindeutig. Dies führt dazu, dass die Doppelrolle des Bürgers als Bourgeois und Citoyen nicht gegenwärtig ist und auch die Rechte des Einzelnen in diesen verschiedenen Rollen kaum unterschieden werden.
VII. Ergebnis zur individual-rechtlichen Sicht der Literatur Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Wahlrecht in der Literatur ganz überwiegend als Grundrecht betrachtet wird. Als „grundrechtsgleiches Recht“ bezeichnen es diejenigen, die den Umstand problematisieren, dass das Wahlrecht nicht im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes aufgezählt ist, diesen aber als abschließend im Hinblick auf den Umfang der Grundrechte betrachten.289 Zwischen den grundrechtsgleichen Rechten und den Grundrechten wird aber kein anderer Unterschied gemacht als der, dass Grundrechte sich im Grundrechtsteil des Grundgesetzes finden, grundrechtsgleiche Rechte hingegen nicht.290 Für diese individual-rechtliche Sicht werden verschiedene Begründungsansätze fruchtbar gemacht, die sich aber allesamt nicht als tragfähig erweisen. Die Idee, das Wahlrecht sei ein Individualrecht, ergibt sich aus dem Umstand, dass das Grundgesetz sowohl Grundrechte als auch staatsbürgerliche Rechte gewährt, die nicht hinreichend unterschieden werden, auch sprachliche Implikationen spielen eine Rolle. Im Folgenden soll diese individualrechtliche Sichtweise anhand einiger Besonderheiten des Wahlrechts und seiner Kontextualisierung kritisch hinterfragt werden.
286 H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 18; W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 3. Zum Staatsbürger als Mitinhaber staatlicher Gewalt A. Epiney, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 f. 287 So z. B. W. Schmitt Glaeser, Mißbrauch und Verwirkung von Grundrechten, 1968, S. 113; A. Epiney, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 f.; H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993, S. 39. 288 M. Sachs, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, DVBl. 1995, S. 873 (874). 289 Etwa J. Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011, S. 31. 290 R. Grawert, Wechselwirkungen zwischen Bundes- und Landesgrundrechten, in: HGR, Bd. III, § 81, Rn. 12. Grundrechtsgleiche Rechte zeichnen sich demnach – ebenso wie Grundrechte – durch ihren primär individual-rechtlichen Charakter aus.
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
103
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht Eine individual-rechtliche Sicht auf das Wahlrecht ist zweifelhaft, weil das Wahlrecht einige Besonderheiten aufweist, die im Vergleich zu anderen Individualrechten Anomalien darstellen und jedenfalls die Eigenschaft als Grundrecht per se ausschließen.
1. Keine Aufzählung des Wahlrechts im Grundrechtsteil Gegen die Einordnung als verfassungsrechtliches Individualrecht, als Grundrecht, spricht zunächst, dass das Wahlrecht nicht im Grundrechtsteil des Grundgesetzes aufgeführt ist,291 der Parlamentarische Rat hierauf vielmehr explizit verzichtet hat.292 Das Wahlrecht ist lediglich im organisationsrechtlichen Teil des Grundgesetzes normiert, und hier – wie gesehen293 – auch nicht als solches benannt. Lediglich in Bezug auf die Staatsorganisation ist in Art. 38 GG geregelt, wer an der Wahl des Deutschen Bundestages teilzunehmen berechtigt ist.294 Auch wenn sich die Literatur an dieser Einordnung nicht orientiert295 und den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes insoweit als nicht abschließend sieht, kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hieraus ein starkes Indiz für die Rechtsnatur des Wahlrechts ergibt.
2. Wechselbezügliche Abhängigkeit des Wahlrechts Gegen die Einordnung des Wahlrechts als Individualrecht spricht auch, dass es im Wechselbezug zu den Rechten der anderen Wahlberechtigten steht und gerade in seiner Wirkung von diesen abhängt. Die Gemeinschaftsbezogenheit des Wahlrechts zeigt sich nicht nur hinsichtlich seiner Intention, Legitimation für die Staatsgewalt zu schaffen, die dann allen gegenüber allen verbindlich ist, also daran, dass der Zweck des Rechts sich auf die Gemeinschaft bezieht.296 Auch der Ausübung und Wirkung des Wahlrechts wohnt der Gemeinschaftsbezug unabdingbar inne.
291 Hieraus wird mitunter auch die Eigenschaft des Wahlrechts als „grundrechtsgleiches Recht“ abgeleitet; so z. B. J. Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011, S. 31. 292 Hierzu oben in Abschnitt C., S. 48 ff. 293 Siehe oben in Abschnitt D VI. 1, S. 101. 294 So auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376. 295 So auch H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 227. 296 Diesen stellt auch H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 225, heraus.
104
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Die Ausübung des Wahlrechts durch jeden einzelnen Wahlberechtigten steht in Beziehung mit der Ausübung des Rechts durch andere Wahlberechtigte; die einzelnen Wähler geben ihre Stimme nicht unabhängig voneinander, sondern gemeinsam ab, die Wahl bildet einen Gesamtakt. Eine gemeinsame Ausübung des Rechts allein würde aber nicht gegen seine Einordnung als Individualrecht sprechen. Auch bestimmte Grundrechte sind gruppenbezogen, ihre Ausübung ist von der Ausübung des Grundrechts durch andere Grundrechtsträger abhängig. So kann z. B. das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG erst ausgeübt werden, wenn sich die für die Anerkennung einer Versammlung erforderlichen Personen297 zu einem gemeinsamen Zweck versammeln wollen, also ihre grundrechtliche Freiheit gemeinsam ausüben möchten.298 Auch die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 GG kann nur von mehreren Rechtsträgern gemeinsam ausgeübt werden, die dann in ihrer Grundrechtsausübung voneinander abhängig sind.299 So kann sich bei diesen Grundrechten der Eingriff in das Recht eines anderen als Eingriff in das eigene Grundrecht darstellen. Wird z. B. durch das rechtswidrige Fernhalten eines Versammlungsteilnehmers von der Versammlung der Bestand einer Versammlung insgesamt gefährdet, wird auch in die Versammlungsfreiheit eines jeden anderen Versammlungsteilnehmers eingegriffen, weil auch diese dann von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in diesem konkreten Fall keinen Gebrauch mehr machen können. Diese Rechte unterscheiden sich aber vom Wahlrecht dadurch, dass die Rechtsträger zwar in der Ausübung ihrer Rechte voneinander abhängig sind, nicht aber in deren Wirkung, auf die das Wahlrecht gerade zielt. Denn nicht nur der Akt der Stimmabgabe findet gemeinsam statt.300 Gerade auch die Wirkung der Stimmen ist ein gemeinsames Produkt aus allen Stimmen. Erst in ihrem Zusammenwirken entfalten die Stimmen eine Wirkung.301 Denn erst aus der 297
Für die Anzahl der erforderlichen Personen werden unterschiedliche Zahlen genannt. Nach herrschender Meinung sind zwei Personen ausreichend, so H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. I, Art. 8 Rn. 23; W. Höfling, in: Sachs, GG-Kommentar, Bd. I, Art. 8 Rn. 9. 298 Hier zeigt sich der ideengeschichtliche Zusammenhang zwischen Wahlen und Versammlungen. Hierzu auch C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 244. 299 So wird für die Vereinigungsfreiheit z. T. neben dem Individualgrundrecht auch ein Kollektivgrundrecht der Vereinigung angenommen, so z. B. H. Bauer, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. I, Art. 9 Rn. 34 f.; dagegen aber W. Höfling, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 9 Rn. 26. 300 K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 147. Wobei sich das Volk aus organisatorischen Gründen nicht an einem Ort versammeln kann, sondern jeder Bürger wohnortsnah seine Stimme abgibt. Die Gemeinschaftlichkeit des Wahlaktes kommt aber besonders in dem gemeinsamen Zeitpunkt der Stimmabgabe zum Ausdruck. Zur Notwendigkeit der Gleichzeitigkeit der Stimmabgaben (bei Mehrheitsentscheidungen) W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, 1983, S. 165. 301 Theoretisch könnte zwar auch die Ausübung einer einzelnen Stimme allein eine Wirkung hervorrufen, weil die Vorschriften über die Wahl zum Deutschen Bundestag keine Mindestquoren vorsehen, sondern die Wahl unabhängig von der Zahl der Wählenden Geltung hat. Allerdings ist diese Annahme nur theoretisch. Faktisch werden stets eine Vielzahl an
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
105
Gesamtheit der Stimmen wird das Wahlergebnis gebildet, aus dem dann die Sitzzuteilung im Bundestag hervorgeht. Dieser Zusammenhang ruft ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, einen Wechselbezug der Rechte der einzelnen Rechtsinhaber hervor. Durch diese Wechselbezüglichkeit ist die Wirkung der Stimmabgabe der einzelnen Wahlberechtigten miteinander verbunden. Das Wahlrecht ist dann nicht nur in seiner Wirkung verknüpft, auch „Eingriffe“ in das Recht treffen damit nicht nur denjenigen, der die Stimme abgegeben hat. Auch dann, wenn die Stimme eines anderen nicht gezählt wird oder ein anderer nicht zur Wahl zugelassen wird, kann dies Auswirkungen auf die Wirkung der Stimme der anderen haben. Denn gerade die Stimmen von anderen Wählern verhelfen der eigenen Stimme zum Erfolg. So hat das Nichtmitzählen einer Stimme unter Umständen zur Folge, dass auch andere Stimmen keine Wirkung entfalten.302
3. Keine Rückführbarkeit der Wählerstimme auf den Wähler Dabei ergibt sich durch die geheime Wahl zudem die Besonderheit, dass die einzelne Stimme nicht auf die Person des Wählenden zurückgeführt werden kann und so auch eine Rechtsverletzung nicht auf eine einzelne Person rückführbar ist. Denn nach der Stimmabgabe ist die Stimme von ihrem Urheber abgeschnitten und lässt sich nicht mehr mit diesem in Verbindung bringen. Wird also ein Stimmzettel nicht mitgezählt oder das Wahlergebnis falsch berechnet, kann sich dies nicht als individuelle Rechtsverletzung darstellen, da nicht klar ist, wessen Recht verletzt sein könnte.303 Die Stimme ist mit der Abgabe entindividualisiert. Somit lassen sich nach der Stimmabgabe nicht mehr die einzelne Stimme und gegebenenfalls die einzelne Rechtsverletzung dem Einzelnen zurechnen, sondern nur noch alle Stimmen und alle Rechtsverletzungen der gesamten Gruppe.304 Selbst dann, wenn offen gewählt würde, würden sich die Rechtsverletzungen nicht auf einzelne Wähler zurückführen lassen, sondern nur auf Wählergruppen. Der Wählerstimmen abgegeben, die gemeinsam die Grundlage für das Wahlergebnis bilden. Ob die eigene Stimme eine Wirkung erzielt, hängt dabei auch davon ab, in welcher Weise die anderen Stimmen abgegeben werden. 302 Dies gilt sowohl für die Verhältniswahl als auch für die Mehrheitswahl. Bei der Mehrheitswahl ist dies evident, aber auch bei der Verhältniswahl bedarf es zur Erlangung eines Mandates mehrerer Stimmen, so dass es für das nächste Mandat genau an einer weiteren Stimme fehlen kann. 303 Für Abstimmungen in diesem Sinne auch K. Hermann, Volksgesetzgebungsverfahren, 2003, S. 113. 304 K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 114, sieht auch das Wahlvorschlagsrecht nicht als Individualrecht, sondern als Gruppenrecht, weil es mehreren Wahlberechtigten gemeinsam zusteht.
106
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Kreis der möglicherweise Betroffenen würde sich zwar deutlich verengen, die Betroffenen könnten jedoch auch dann nicht individualisiert werden.305 Da es bei der Wahl aber gerade auch auf die Wirkung der Stimme nach der Stimmabgabe ankommt, und das Recht als bloßes Recht auf Stimmabgabe wertlos erscheint, spricht dieser Befund dafür, dass es sich nicht primär um das Recht von Individuen, sondern vor allem um das Recht einer Gruppe handelt.
4. Rechtsträgerschaft erst ab Beginn der Rechtsmündigkeit Jedenfalls spricht gegen die Grundrechtseigenschaft des Wahlrechts auch, dass die Rechtsträgerschaft bezüglich dieses Rechts erst mit der Rechtsmündigkeit beginnt. Der Rechtsträger wird erst dann Inhaber des Rechts, wenn er für fähig gehalten wird, dieses auch auszuüben. Grundrechte hingegen stehen dem Träger ab seiner Geburt zu.306 Für das Recht auf Leben wird bisweilen sogar schon der Nasziturus als Grundrechtsträger angesehen.307 Jedoch ist der Grundrechtsträger mit der Geburt noch nicht in der Lage, alle Grundrechte auch selbst auszuüben.308 So setzt die Ausübung mancher Grundrechte körperliche und geistige Fähigkeiten voraus, die bei Kindern noch nicht ausgeprägt sind. Zur Ausübung der Gewissensfreiheit – entsprechend der Definition des Schutzbereiches, die eine „ernste sittliche, d. h. an den Kategorien von ,Gut‘ und ,Böse‘ orientierte Entscheidung“ voraussetzt, „die der einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so dass er gegen sie nicht ohne Gewissensnot handeln könnte“309 – bedarf es beispielsweise der Fähigkeit, Wertungen in den Kategorien von „Gut“ und „Böse“ zu treffen, die Kinder erst im Laufe ihrer Entwicklung erlernen, nicht aber ab Geburt besitzen.
305 So lässt sich beim Effekt des „negativen Stimmgewichts“ stets nachweisen, wie viele Stimmen für eine Partei in welchem Bundesland sich negativ ausgewirkt haben. Selbst dann jedoch, wenn man die Wähler dieser Partei in dem betroffenen Land ausmachen könnte, ließe sich nicht sagen, wessen Stimme positiven und wessen Stimme negativen Effekt gehabt hat. 306 W. Roth, Die Grundrechte Minderjähriger, 2003, S. 17. 307 A. von Mutius, Der Embryo als Grundrechtssubjekt, Jura 1987, S. 109 ff.; allerdings konnte es das Bundesverfassungsgericht in der betreffenden Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch offen lassen, ob der Nasziturus Grundrechtsträger ist oder nur den objektiven Schutz der Verfassung genießt: BVerfGE 39, 1 (42) – Schwangerschaftsabbruch I, Urteil vom 25. 2. 1975. 308 Zu beachten ist auch, dass nicht alle Grundrechte der Ausübung bedürfen, wie beispielsweise die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), so W. Roth, Die Grundrechte Minderjähriger, 2003, S. 26. 309 BVerfGE, 12, 45 (55) – Kriegsdienstverweigerung I, Beschluss vom 20. 12. 1960; ähnlich BVerfGE 48, 127 (173) – Wehrpflichtnovelle, Urteil vom 30. 04. 1978.
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
107
Es wird deshalb zwischen der Fähigkeit, Träger von Grundrechten zu sein – der Grundrechtsträgerschaft – und der Fähigkeit und Berechtigung, diese selbstständig auszuüben – der Grundrechtsmündigkeit310 – unterschieden.311 Wann die Grundrechtsmündigkeit einsetzt, ist umstritten. Spätestens mit Eintritt der Volljährigkeit wird dem Grundrechtsträger aber die Fähigkeit zugesprochen, alle ihm zustehenden Grundrechte auch selbst auszuüben.312 Die Grundrechtsmündigkeit beginnt jedoch nicht für alle Grundrechte zum gleichen Zeitpunkt, sondern hängt von der Reife des Minderjährigen sowohl in physischer als auch psychischer Hinsicht ab, die Grundrechte auszuüben. Sie beginnt also meist schon wesentlich vor der Volljährigkeit.313 Beim Wahlrecht hingegen wird schon die Berechtigung, an der Wahl teilzunehmen, erst mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres von der Verfassung selbst in Art. 38 Abs. 2 GG zugesprochen. Würde sich das Wahlrecht in den Kreis der Grundrechte einfügen, müsste es den Grundrechtsträgern aber grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Geburt zustehen.314 Art. 38 Abs. 2 GG könnte dann lediglich als Grenze der Wahlrechtsmündigkeit, nicht der Wahlrechtsfähigkeit aufgefasst werden.315 Dies würde dazu führen, dass das Recht, weil es nicht nur in einer natürlichen, sondern in einer rechtlichen Handlung besteht,316 während der Unmündigkeit des Rechtsträgers durch den gesetzlichen Vertreter ausgeübt werden könnte, im Regelfall
310 Der Begriff stammt von H. Krüger, Grundrechtsausübung durch Jugendliche, FamRZ 1956, S. 329 ff., hierzu auch A. von Mutius, Grundrechtsfähigkeit, Jura 1983, S. 30 (31); ders., Grundrechtsmündigkeit, Jura 1987, S. 272. 311 Bezeichnenderweise erwähnt A. von Mutius, Grundrechtsfähigkeit, Jura 1983, S. 30, Fn. 1, in seinem Aufsatz über die Grundrechtsfähigkeit unter dem Hinweis, dass nicht nur die Grundrechte aus dem sog. „Grundrechtskatalog“ gemeint seien, sondern auch andere subjektive Rechte, die er beispielhaft aufzählt, Art. 38 GG gerade nicht, während er Art. 33 GG erwähnt. 312 Zur Kritik des Begriffs der Grundrechtsmündigkeit K.-H. Hohm, Grundrechtsträgerschaft und „Grundrechtsmündigkeit“ von Minderjährigen, NJW 1986, S. 3107 (3112); ähnlich W. Roth, Die Grundrechte Minderjähriger, 2003, S. 63 ff. Auch dann, wenn der Begriff der „Grundrechtsmündigkeit“ nicht anerkannt wird, so wird doch die „Grundrechtsreife“ als Voraussetzung der Grundrechtsausübung gesehen. Jedoch soll nach dieser Ansicht nicht die zusätzliche Hürde der Grundrechtsmündigkeit dem Minderjährigen die Grundrechtsausübung verwehren. 313 Beispielsweise wird die Grundrechtsmündigkeit bezüglich der Religionsfreiheit entsprechend dem Gesetz über die religiöse Kindererziehung bereits mit 14 Jahren angenommen, J. Kokott, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 4 Rn. 8. 314 A. A.: D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 (27). Dieser sieht das Auseinanderfallen von Grundrechtsträgerschaft und Grundrechtsmündigkeit zwar als „grundrechtsuntypisch[…]“, nicht aber als gegen die Grundrechtseigenschaft sprechend. 315 So W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (518). Für eine (allerdings erst noch einzuführende) Unterscheidung zwischen Trägerschaft des Wahlrechts und Ausübungsfähigkeit plädiert J. Oebbecke, Wahlrecht von Geburt an, JZ 2004, S. 987 (990). 316 Bei natürlichen Handlungen wäre eine Stellvertretung schon praktisch nicht denkbar.
108
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
also durch die Eltern.317 Verfassungspolitische Vorstöße für ein so oder ähnlich gestaltetes Wahlrecht für Kinder sind zahlreich zu finden.318 Dass ein solches bereits bestehen würde, wird dabei jedoch nicht angenommen.319 Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Ausübung des Wahlrechts der Kinder durch die Eltern wird zudem angezweifelt, weil sie gegen den Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Wahl verstoße320 und das Wahlrecht ein unübertragbares Recht sei.321 Auch Verstöße gegen das gleiche Wahlrecht werden diskutiert, wenn die Stimme des Kindes den Eltern zur eigenen, grundsätzlich unüberprüfbaren Ausübung zustehen soll.322 Die Möglichkeit, das Kind schon ab dem Zeitpunkt der Geburt als Rechtsträger anzusehen und während der Zeit der Unmündigkeit die Eltern in Vertretung zur Ausübung zu ermächtigen, scheitert jedoch an der Möglichkeit der Vertretung in diesem Fall. Es mangelt hier an dem Rechtsgrund für die Vertretung des Kindes durch die Eltern. Diese rührt aus dem elterlichen Erziehungsrecht des Art. 6 Abs. 2 GG her. Dieser bestimmt: „Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Art. 6 Abs. 2 GG fordert also verfassungsrechtlich, dass die Eltern die persönlichen Angelegenheiten des Kindes regeln. Hieraus leiten sich die zivilrechtlichen Vertretungsbefugnisse der Eltern nach §§ 1626 f. BGB ab.323 An diese Vertretungsbefugnis wollen einige Autoren, die ein Stellvertreterwahlrecht befürworten, anknüpfen.324 Die Wahl ist aber keine persönliche Angelegenheit des Kindes: Die Wirkungen des Wahlrechts treffen weit 317
§ 1626 BGB. Sie schlagen dabei entweder ein Stellvertreterwahlrecht der Eltern oder aber ein eigenes Elternwahlrecht zugunsten des Kindes (auch Familienwahlrecht genannt) vor: A. Adrian, Grundsatzfragen zu Staat und Gesellschaft am Beispiel des Kinder-/Stellvertreterwahlrechts, 2017; I. Rupprecht, Das Wahlrecht für Kinder, 2012; W. Schreiber, Wahlrecht von Geburt an, DVBl. 2004, S. 1341 ff.; K. Nopper, Minderjährigenwahlrecht, 1999; J. Oebbecke, Wahlrecht von Geburt an, JZ 2004, S. 987 ff., M. Pechstein, Wahlrecht für Kinder, FuR, 1991, S. 142 ff., mit dem Hinweis, dass die Geschichte der Forderung des Minderjährigenwahlrechts selbst bereits ein Dissertationsthema sei (S. 13); H. Quintern, Das Familienwahlrecht, 2010; G. Meixner, Plädoyer für ein „höchstpersönliches Elternwahlrecht zugunsten des Kindes“, ZParl 44 (2013), S. 419 ff. Einen Überblick über die verschiedenen Formen eines „Familienwahlrechts“ bietet S. Müller-Franken, Familienwahlrecht und Verfassung, 2013, S. 5. 319 Statt aller: H. Quintern, Das Familienwahlrecht, 2010, S. 186. 320 H. Holste, Wahlrecht von Geburt an: Demokratie auf Abwegen?; DÖV 2005, S. 110 (112); W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, Teil 1 Rn. 19, § 1 Rn. 16. Dieser Grundsatz wird meist aus dem Demokratieprinzip abgeleitet. Ursprünglich richtete er sich gegen den Missbrauch des Wahlrechts durch Stimmenkauf; hierzu H. Hattenhauer, Über das Minderjährigenwahlrecht, JZ 1996, S. 9 (16), und I. Rupprecht, Das Wahlrecht für Kinder, 2012, S. 180. 321 W. Schroeder, Familienwahlrecht und Grundgesetz, JZ 2003, S. 917 (919); M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Rn. 115; S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 100. 322 H. Holste, Wahlrecht von Geburt an: Demokratie auf Abwegen?, DÖV 2005, S. 110 (112); I. von Münch, Kinderwahlrecht, NJW 1995, S. 3165 (3165). 323 P. Badura, in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 69. Lfg. (Stand: Mai 2013) Bd. II, Art. 6 Rn. 97. 324 J. Oebbecke, Wahlrecht von Geburt an, JZ 2004, S. 987 (991). 318
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
109
mehr andere Personen als das Kind selbst.325 Zwar betrifft die von den Eltern für das Kind getroffene Wahlentscheidung auch das Kind, jedoch ebenso alle anderen der Staatsgewalt unterworfenen Personen. Die Ausübung des Wahlrechts des Kindes durch die Eltern würde dazu führen, dass die Eltern nicht primär der Sorge des Kindes dienen, sondern über Allgemeinbelange entscheiden,326 was dem Gedanken der elterlichen Sorge zuwider laufen würde. Die zivilrechtlichen Vertretungsregeln lassen sich im Bereich des Wahlrechts auch deshalb nicht anwenden, weil das Wahlrecht eine Übertretung der Vertretungsmacht anders als das Zivilrecht nicht hinnehmen kann.327 Aus Art. 6 Abs. 2 GG lässt sich damit weder direkt noch mittelbar über die zivilrechtlichen Vertretungsregeln eine Vertretungsbefugnis der Eltern für das Kind im Wahlrecht ableiten. Eine Vertretung des Kindes durch die Eltern im Wahlrecht scheidet damit aus. Es zeigt sich, dass das Wahlrecht kein Recht ist, das durch andere ausgeübt werden kann, sondern ein höchstpersönliches Recht, weil es dem Berechtigten nicht zur Entscheidung über sich selbst, sondern primär über andere verliehen ist. Wer Träger des Rechts ist, muss auch gleichzeitig fähig und berechtigt sein, es auszuüben. Rechtsmündigkeit und Rechtsfähigkeit können hier nicht auseinanderfallen. Art. 38 Abs. 2 GG kann damit nicht als Grenze der Wahlrechtsmündigkeit, sondern nur als Grenze der Wahlrechtsinhaberschaft gesehen werden. Das Recht steht damit erst volljährigen Personen zu. Damit unterscheidet es sich grundsätzlich von den Grundrechten, die ihrem Träger ab der Geburt zustehen.
325 So auch W. Roth, Die Grundrechte Minderjähriger, 2003, S. 76. Dieses Argument versuchen auch I. Rupprecht, Das Wahlrecht für Kinder, 2012, S. 177, und L. Peschel-Gutzeit, Unvollständige Legitimation der Staatsgewalt, NJW 1997, S. 2861 (2862), in anderer Richtung fruchtbar zu machen. Die Wahlentscheidung treffe das Kind weit weniger als so manche finanzielle Entscheidung, weswegen es mit anderen höchstpersönlichen Rechtsgeschäften, für die eine elterliche Vertretung ausgeschlossen ist, nicht vergleichbar wäre. Dies verkennt die Bedeutung der Wahl im demokratischen Staat und blendet die Gemeinschaftsbezogenheit des Wahlrechts aus. Es offenbart zudem, dass es Peschel-Gutzeit nicht, wie ihr Titel impliziert, um die Legitimation von Staatsgewalt geht, sondern um Durchsetzung von Kinder- und Familieninteressen. 326 Dies scheint bei J. Oebbecke, Wahlrecht von Geburt an, JZ 2004, S. 987 (991), durch, wenn er als Vertretungsberechtigte diejenigen Personen ausscheiden lassen will, denen das Wahlrecht selbst entzogen wurde. Der Ausschluss der Vertretung ergibt sich also nicht daraus, dass das Wahlrecht Selbst- und gerade keine Fremdbestimmung garantieren soll – so aber H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 GG Rn. 138 – sondern daraus, dass es gerade Fremdbestimmungsmacht verleiht. Ähnlich S. MüllerFranken, Familienwahlrecht und Verfassung, 2013, S. 72. 327 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 155.
110
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
5. Ausschlussmöglichkeit vom Wahlrecht wegen strafgerichtlicher Verurteilung Gegen die Eigenschaft des Wahlrechts als Individualrecht spricht auch die Möglichkeit, das Wahlrecht als Nebenfolge einer strafgerichtlichen Verurteilung zu entziehen. § 45 Abs. 5 StGB sieht als Nebenfolge einer strafrechtlichen Verurteilung die Möglichkeit vor, dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis fünf Jahren das Recht abzuerkennen, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist. Dieser Ausschluss umfasst dann gerade auch das Recht, an den Wahlen zum Deutschen Bundestag teilzunehmen. Nach § 13 Nr. 1 BWahlG sind diejenigen Personen, die durch einen solchen Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen. § 45 StGB ist die Nachfolgevorschrift des § 32 Reichsstrafgesetzbuch,328 der Strafgerichten die Möglichkeit einräumte, auf den „Verlust bürgerlicher Ehrenrechte“ zu erkennen, wenn eine Zuchthausstrafe von mindestens drei Monaten verhängt wurde. Dieser „Ehrenstrafe“ lag die Erwägung zugrunde, dass der Straftäter sich selbst entehrt hätte, so dass ihm das Wahlrecht als „bürgerliches Ehrenrecht“ nicht mehr zugestanden werden konnte.329 Der 1970 eingeführten Nachfolgevorschrift § 45 Abs. 5 StGB wurden dann aber andere Erwägungen zugrunde gelegt. Es wurden „gewichtige Interessen der Allgemeinheit“, „erheblich straffällig gewordene Personen von der Wahrnehmung besonderer Aufgaben im Gemeinschaftsleben fern[zu]halten“ als Grund angeführt, bei einer Freiheitsstrafe auch auf den Verlust des Wahl- oder Stimmrechts zu erkennen.330 Dies entspricht dem Umstand, dass die Möglichkeit der Nebenfolge des § 45 Abs. 5 StGB nur bei Delikten vorgesehen ist, die den Staat und seine Einrichtungen vor Beeinträchtigungen schützen sollen.331 Nur demjenigen, der sich durch eine Straftat gegen den Staat gewendet hat, kann das Wahlrecht als Nebenfolge einer strafrechtlichen Verurteilung entzogen werden. Wer sich in seinem Verhalten gegen den Staat gewendet hat, bietet keine Gewähr dafür, dass er seine Wahlentscheidung am Wohl der Allgemeinheit ausrichtet. Der Entzug des Wahlrechts ist nur 328
Dieser stand unter dem Titel „Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte“. K. Stein, Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und der Ausschluss vom Wahlrecht wegen strafgerichtlicher Verurteilung, GA 2004, S. 22 (29); hier auch zur Kritik hieran im demokratischen Staat; U. Sacksofsky, Wer darf eigentlich wählen?, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), Festschrift für Bryde, S. 313 (324). 330 Erster Schriftlicher Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, BTDrucks. V/4094, S. 15 f. 331 Die Entziehung des Wahlrechts kann als Nebenfolge neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen Friedensverrats, Hochverrats und Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats (§ 92a StGB), Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§ 101 StGB), wegen Wahlbehinderung, Wahlfälschung, Wählernötigung oder Wählerbestechung (108c StGB) oder wegen Abgeordnetenbestechung (§ 108e Abs. 2) verhängt werden; hierzu H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 4, Fn. 4. 329
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
111
dann erklärlich, wenn das Wahlrecht als Recht gesehen wird, das der Wähler für die Allgemeinheit und nicht für sich selbst ausübt, und damit gerade nicht als Individualrecht.332 Zwar kann das einfache Recht die Rechtsnatur des Wahlrechts als aus der Verfassung folgendem Recht nicht determinieren, jedoch spricht die Einführung der Norm in das Strafgesetzbuch unter Geltung des Grundgesetzes dafür, dass jedenfalls der einfache Gesetzgeber das Wahlrecht nicht als Individualrecht betrachtet hat.
6. Die Aberkennung des Wahlrechts nach Art. 18 GG i. V. m. § 39 Abs. 2 BVerfGG Im selben Zusammenhang steht die Entzugsmöglichkeit des Wahlrechts und der Wählbarkeit im Verfahren der Verwirkung von Grundrechten gemäß Art. 18 S. 2 GG i. V. m. § 39 Abs. 2 BVerfGG. Hiernach können im Falle einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verwirkung von Grundrechten für die Dauer der Verwirkung dem Grundrechtsträger das Wahlrecht, die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt werden. Voraussetzung für die Entscheidung über die Verwirkung von Grundrechten nach Art. 18 GG ist, dass der Grundrechtsträger die entsprechenden Grundrechte im Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht. Die in Art. 18 GG genannten Grundrechte sind überwiegend Grundrechte, die gerade den Meinungsaustausch in der Demokratie, also ihre Grundlage schützen.333 Art. 18 GG ist deshalb eine Selbstschutznorm der Demokratie.334 Auch hier ist, wie bei dem Verlust des Wahlrechts wegen strafgerichtlicher Verurteilung, Voraussetzung, dass der Wahlberechtigte sich in seinen Handlungen gegen den Staat und seine Grundordnung gewendet hat. Der Ausschluss vom Wahlrecht nach § 39 Abs. 2 BVerfGG wird teilweise für unvereinbar mit Art. 18 GG gehalten, weil das Wahlrecht nicht in Art. 18 GG unter den verwirkbaren Grundrechten genannt ist, dieser den Kreis der Grundrechte, die verwirkt werden können, aber abschließend aufzähle.335
332 Für die Verfassungswidrigkeit dieser Norm aber U. Sacksofsy, Wer darf eigentlich wählen?, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), Festschrift für Bryde, S. 313 (324); H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 4, weil sie der Eigenschaft des Wahlrechts als Individualrecht zuwider laufe. 333 Nach K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, 1994, § 87 III 2, S. 957, handelt es sich um Grundrechte, die „stärker die öffentliche Sphäre als die Privatsphäre berühren“. 334 E. M. Schnelle, Freiheitsmissbrauch und Grundrechtsverwirkung, 2014, S. 207; M. Pagenkopf, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 18 Rn. 8. 335 W. O. Schmitt, Die Verwirkung des Wahlrechts und der Wählbarkeit nach § 39 Abs. 2 BVerfGG, NJW 1966, S. 1734 (1737).
112
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
Die Regelung beruht auf der Überlegung, dass es schwer verständlich wäre, dass jemand, der Grundrechte verwirkt hat, indem er sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingesetzt hat, dennoch ins Parlament einziehen oder als Wahlberechtigter über die Zusammensetzung des Parlaments bestimmen dürfte.336 Deshalb wird nach Lösungen für eine Verfassungskonformität der Regelung gesucht. Ein Ansatz ist es hierbei, den Kreis der in Art. 18 GG aufgezählten Grundrechte als nicht abschließend zu betrachten. Es werde durch § 39 Abs. 2 BVerfGG der ungeschriebene Satz, dass im Gefolge der aberkannten Grundrechte auch solche Grundrechte, die nicht in Art. 18 GG aufgezählt sind, tangiert werden dürfen, ausdrücklich hervorgehoben.337 Eine Erweiterung von Art. 18 GG auf nicht aufgezählte Grundrechte ist jedoch unzulässig,338 so dass dieser Ansatz den angenommenen Widerspruch zu Art. 18 GG nicht zu überwinden vermag. Daneben wird versucht, die Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts nach den Regeln der allgemeinen Grundrechtsbegrenzungen zu rechtfertigen.339 Zu bedenken ist, dass es sich bei der Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit nicht selbst um eine Verwirkung von Rechten handelt,340 sondern um eine Aberkennung von Rechten als Nebenfolge einer Verwirkung von Grundrechten. Es handelt sich also selbst nicht um eine Verwirkung nach Art. 18 GG. Die Möglichkeit des akzessorischen Entzugs des Wahlrechts wäre eine unzulässige Umgehung der abschließenden Regelung des Art. 18 GG, wenn das Wahlrecht selbst ein Grundrecht wäre. Auch hier zeigt sich jedoch, dass der einfache Gesetzgeber das Wahlrecht offensichtlich nicht als Grundrecht aufgefasst hat, dessen Verwirkungsmöglichkeit in Art. 18 GG vorgesehen sein muss.341 Die Möglichkeit des Entzugs des Rechts im Zusammenhang mit der Verwirkung von Grundrechten zeigt, dass demjenigen das Wahlrecht entzogen können werden soll, der durch die Ausübung seiner grundrechtlichen Freiheiten bereits deutlich gemacht hat, dass er mit den Grundwerten der Verfassung nicht nur nicht übereinstimmt, sondern sich sogar aktiv gegen diese wendet. Dies spricht dafür, dass auch der einfache Gesetzgeber das Wahlrecht nicht als Recht, das nach freiem Belieben ausgeübt werden kann, sondern gerade als eine Verantwortung für das politische 336 F. Klein, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 39 Rn. 20. 337 F. Klein, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 39 Rn. 20. 338 E. M. Schnelle, Freiheitsmissbrauch und Grundrechtsverwirkung, 2014, S. 126 ff. m. w. N. in Fn. 127. 339 U. Wagner, Die Verwirkung der Wählbarkeit, 1956, S. 46. 340 Die Verwirkung stellt auch nur ein handlungsbezogenes Geltendmachungshindernis und kein konkretes Betätigungsverbot dar, so E. M. Schnelle, Freiheitsmissbrauch und Grundrechtsverwirkung, 2014, S. 207. 341 J. Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011, S. 32, folgert daraus, dass Wahlrecht in Art. 18 GG nicht aufgezählt ist, aber auf dem gezeigten Wege aberkannt werden kann, dass es ein grundrechtsgleiches Recht sein müsse.
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
113
Gemeinwesen erachtet, das grundsätzlich zwar jedem zustehen muss, im Einzelfall aber auch entzogen werden kann. Dabei ist es zwar überwiegend richtig, dass die Ausübung des aktiven Wahlrechts sich nur auf Wahlbewerber beziehen kann, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Einklang stehen.342 Dies gilt jedoch nur bei der Abgabe der Zweitstimme, die sich auf die Landesliste einer Partei bezieht. Die Wahlkreisbewerber können sich hingegen unabhängig von einer verfassungskonformen Einstellung zur Wahl stellen. Auch wenn diese zwar in der Regel Parteien mit einer verfassungskonformen Grundhaltung entstammen,343 wäre es damit theoretisch denkbar, sich durch Ausübung des Wahlrechts gegen die Verfassungsordnung zu wenden. Es kommt jedoch ohnehin nicht entscheidend darauf an, dass der Grundrechtsträger sich mit der Ausübung seines Wahlrechts gegen die Verfassung richtet, sondern dass er sich als verfassungsfeindlich gezeigt und damit zum Ausdruck gebracht hat, dass er nicht bereit ist, seine Entscheidung an Grundwerten der Gemeinschaft zu orientieren.
7. Strafbarkeit der Wählerbestechung nach § 108b StGB Eine weitere einfachgesetzliche Norm des Strafgesetzbuches ließe sich mit einem als Individualrecht verstandenen Wahlrecht nicht vereinbaren: Der Tatbestand der Wählerbestechung nach § 108b StGB.344 Hiernach wird, wer einem anderem dafür, dass er nicht oder nicht in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile, anbietet, verspricht oder gewährt, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nach § 108b Abs. 2 StGB wird, wer dafür, dass er nicht oder nicht in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, ebenso bestraft. Sowohl der „Stimmenkauf“ als auch der „Stimmenverkauf“ sind damit unter Strafe gestellt. Das Schutzgut des § 108b StGB ist dabei nicht, wie das der §§ 108 und 108a StGB, in denen die Wählernötigung und die Wählertäuschung unter Strafe gestellt werden, der Schutz der Wahlfreiheit,345 denn 342
Aus diesem Grund halten E. M. Schnelle, Freiheitsmissbrauch und Grundrechtsverwirkung, 2014, S. 208, und W. O. Schmitt, Die Verwirkung des Wahlrechts und der Wählbarkeit nach § 39 Abs. 2 BVerfGG, NJW 1966, S. 1734 (1736), die Regelung für verfehlt. 343 Dass das Wahlsystem davon ausgeht, dass auch die Wahlkreisbewerber in der Regel einer Partei angehören, die ebenfalls mit einer Liste zur Wahl steht, zeigt sich daran, dass nach § 6 Abs. 4 S. 1 BWahlG, die „von der Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze“ auf die für jede Landesliste ermittelte Abgeordnetenzahl angerechnet werden. 344 Hierzu T. Zimmermann, Die Wahlfälschung im Gefüge des strafrechtlichen Schutzes der Volkssouveränität, ZIS 2012, S. 982 (988). Dass die Vorschrift trotz der geringen Zahl der praktisch gewordenen Fälle von präventiver Bedeutung ist, zeigt sich an Umfragen, nach denen jeder siebte Deutsche für 500 E seine Stimme verkaufen würde; FAZ vom 17. 9. 2002, S. 8. 345 R. Junck, Strafrechtliche Grenzen der Beeinflussung von Wählern im Wahlkampf, 1995, S. 110. Anders wäre die Strafbarkeit auch der Wählerbestechlichkeit nach § 108b Abs. 2 auch nicht zu erklären.
114
D. Die individual-rechtliche Sichtweise auf das Wahlrecht
die Freiheit der Wahl bleibt durch den Stimmenkauf und -verkauf unberührt, lediglich die Beweggründe für die Stimmabgabe in einer bestimmten Weise werden verändert. Durch § 108b StGB soll vielmehr die Sachlichkeit der Stimmabgabe und damit die demokratische Willensbildung bei Wahlen geschützt werden.346 Der Bestechende verleitet den Wähler nämlich dazu, dass dieser bei seiner Willensbildung „sachfremden und eigennützigen Beweggründen den Vorrang vor politischen Überzeugungen“ einräumt.347 Läge die Ausübung des Wahlrechts im individuellen Belieben, würde es dem Wahlberechtigten gerade freistehen, aus welchen Motiven er in einer bestimmten Weise wählt und welche Motive er möglicherweise für eine Nichtbeteiligung an der Wahl hat. Es wäre ihm damit auch überlassen, für die Ausübung seines Wahlrechts „unsachliche“ Erwägungen, also solche, die sich nicht auf den Zweck der Wahl beziehen, wie beispielsweise pekuniäre Interessen, zugrunde zu legen.348 Er könnte sein Recht nach Belieben und aus individuellen Erwägungen ausüben. Die Pönalisierung des Stimmenkaufs und des Stimmenverkaufs bringt jedoch zum Ausdruck, dass auch der einfache Gesetzgeber vom Wähler eine Orientierung seiner Stimmabgabe auf „sachliche“ Erwägungen, nämlich auf politische Überzeugung stützt.349 Das Recht erwartet nicht nur von den mit dem Wahlrecht betrauten Personen, dass ihre Wahlentscheidung ein Bild ihrer politischen Überzeugung, als ihrer Überzeugung zum Besten für die Allgemeinheit ist,350 es sanktioniert im Extremfall sogar ein Abweichen von dieser Motivation.351 Dass nur der Stimmenkauf und der Stimmenverkauf unter Strafe gestellt sind, nicht aber andere Versuche der Einflussnahme auf den Wähler dahingehend, dass 346 T. Müller, in: Joecks/Miebach, Münchener Kommentar zum StGB, Bd. II/2, § 108b Rn. 1; A. Eser, in: Schönke/Schröder, StGB-Kommentar, § 108b Rn. 1; W. Wohlers/W. Kargl, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB-Kommentar, Bd. II, § 108b Rn. 1; G. Bauer/ D. Gmel, Leipziger Kommentar zum StGB, Bd. IV, § 108b Rn. 1. 347 R. Junck, Strafrechtliche Grenzen der Beeinflussung von Wählern im Wahlkampf, 1995, S. 111. 348 So auch A. Vutkovich, Wahlpflicht, 1906, S. 70. 349 Dies deutet auch BVerfGE 6, 84 (92) – Sperrklauseln, Urteil vom 23. 1. 1957, an: „Die Wahl hat […] das Ziel, den politischen Willen der Wähler als einzelner zur Geltung zu bringen, also eine Volksrepräsentation zu schaffen“. Diese Aussage wird von W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 17, aber dazu genutzt, die Eigenschaft des Wahlrechts als Individualrecht zu begründen. 350 H. Quaritsch, Staatsangehörigkeit und Wahlrecht, DÖV 1983, S. 1 (11): „Politik ist immer das politisch Allgemeine.“ 351 T. Zimmermann, Die Wahlfälschung im Gefüge des strafrechtlichen Schutzes der Volkssouveränität, ZIS 2012, S. 982 (988), sieht die Berechtigung der Norm unter dem Gesichtspunkt des freien Wettbewerbs der politischen Ideen gegeben. Zwar könne der einzelne krass egoistisch motivierte Wahlentscheidungen treffen, allerdings seien die zur Wahl stehenden politischen Konzepte begriffsnotwendig allgemeinwohlbezogen, auch wenn sie Einzelne bevorteilen. Auch solche einzelbegünstigenden Konzepte seien jedoch zulässig. Durch die Begünstigung von Wahlentscheidungen aus dem Privatvermögen würden jedoch die Wettbewerbschancen der unterschiedlichen Konzepte verzerrt. Die Argumentation scheint zunächst schlüssig, sie kann jedoch nur die Strafbarkeit der Wählerbestechung, nicht aber der Wählerbestechlichkeit erklären.
VIII. Kritik an der individual-rechtlichen Sicht
115
dieser sich von anderen Erwägungen als seiner politischen Überzeugung leiten lässt, lässt sich zum einen aus der Ultima-Ratio-Funktion des Strafrechts herleiten.352 Erst bei der Motivation der Stimmabgabe durch finanzielle Vorteile liegen die Erwägungen so erheblich „neben der Sache“, dass die Rechtsordnung sie nicht nur missbilligt, sondern unter Strafe stellt. Zum anderen ist die Strafbarkeit des Verhaltens auch deshalb erst denkbar, weil es sich im Vorfeld der Wahl und damit außerhalb des schützenden Schleiers der geheimen Wahl vollzieht.353 Die Wählerbestechung betrifft eine Tathandlung, die nach außen erkennbar ist. Das Wählen aus jedweden „unsachlichen“ Motiven unter Strafe zu stellen, würde hingegen auf ein Gesinnungsstrafrecht hinauslaufen. Die Festlegung des Schutzgutes der Sachlichkeit der Stimmabgabe zeigt aber, dass die Erwägungen des Wählers für eine bestimmte Stimmabgabe nicht in seinem Belieben liegen sollen. Damit ist die Entscheidung zwar noch nicht inhaltlich determiniert, jedoch in ihrer Motivation, was gegen die Einordnung als Grundrecht oder sonstiges Individualrecht spricht. Darüber hinaus ist eine Parallelisierung der Wählerbestechung (und -bestechlichkeit) mit der Abgeordnetenbestechung (und -bestechlichkeit), deren Strafbarkeit in § 108e StGB normiert ist, erkennbar. So finden sich beide Normen in einem gemeinsamen Abschnitt, der mit „Straftaten gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und Abstimmungen“ überschrieben ist. Dies zeigt, dass das Wahlrecht von seiner Funktion und Wirkungsweise dem Abgeordnetenrecht ähnelt, das ein organschaftliches Recht ist. Diese Gleichordnung entspricht der Tatsache, dass die Funktionsfähigkeit von Wahlen und Abstimmungen der Funktionsfähigkeit von Staatsorganen in ihrer Bedeutung für die Staatsorganisation gleichkommt.
8. Ergebnis Die dargestellten Besonderheiten des Wahlrechts machen deutlich, dass es sich schwerlich als Individualrecht charakterisieren lässt. Es liegt vielmehr nahe, es als organschaftliches Recht zu klassifizieren, der Einzelne also als Teil des Staatsorgans Volk wählt. Hierzu ist im Folgenden zu untersuchen, ob und inwieweit das Volk in der grundgesetzlichen Demokratie Teil der staatlichen Sphäre ist und ob es als Staatsorgan betrachtet werden kann. 352
BVerfGE 39, 1 (47) – Schwangerschaftsabbruch I, Urteil vom 25. 2. 1975; H.-H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts AT, S. 3. 353 A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395 (405), kommt zu dem Schluss, dass, wer berechtigt sei, seine Entscheidung geheim zu halten, diese auch nicht rechtfertigen müsse. Die Gründe für die Wahlentscheidung würden dann bedeutungslos. Die Geheimheit bezieht sich aber nur auf die Stimmabgabe. Die Willensbildung im Vorfeld der Wahl ist gerade nicht geheim. Dass die Einwirkung auf den Willensbildungsprozess im Vorfeld der Wahl u. U. strafbar sein kann, zeigt, dass die Gründe für die Wahlentscheidung nicht bedeutungslos sind.
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes Die Stellung des Volkes könnte sich in der grundgesetzlichen Demokratie als diejenige eines Staatsorgans erweisen. Das Volk könnte insbesondere dann, wenn es den Bundestag wählt, die Funktion eines Staatsorgans erfüllen. Dann könnte sich auch das Recht des Einzelnen, zu wählen, als organschaftliches Recht darstellen. Es sollen zunächst Literatur und Rechtsprechung darauf untersucht werden, ob sie das Volk als Staatsorgan einordnen. Sodann sind die Eigenschaften eines Staatsorgans aufzuzeigen und es ist zu überprüfen, ob und in welcher Rolle das Volk diese Anforderungen erfüllt.
I. Das Volk als Staatsorgan in der Literatur Das Volk scheint auf den ersten Blick in der Literatur nicht als Staatsorgan behandelt zu werden. In Lehrbüchern des Staatsorganisationsrechts ist es unter den Staatsorganen ganz überwiegend nicht aufgezählt.1 Es wird aus der Staatsorganisation des Grundgesetzes weitgehend ausgeblendet. So mag die Vorstellung des Volkes als Staatsorgan zunächst befremdlich erscheinen. Auf den zweiten Blick jedoch wird das Volk nicht selten als Staatsorgan bezeichnet.2 Bisweilen wird sogar 1 So im Lehrbuch von C. Degenhart, Staatsorganisationsrecht, 2012, Inhaltsverzeichnis, S. XIII bis XV, unter dem Abschnitt „Staatsorgane“; H. Maurer, Staatsrecht I, 2010, Inhaltsverzeichnis, S. XIV bis XVII, unter dem Abschnitt „Die Verfassungsorganisation“; anders jedoch K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, Inhaltsverzeichnis, S. XIII, er behandelt das Volk unter dem Abschnitt „Organe“, allerdings nicht in dessen Unterabschnitt „Verfassungsorgane“; auch T. Maunz, Deutsches Staatsrecht, 1977, § 37 I, S. 243, behandelt das Volk zwar nicht in einem eigenen Abschnitt, nennt es aber in der Gruppe der Verfassungsorgane. 2 E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986, S. 24; M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 163, 189, 207; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 I 2, S. 10, § 25 II 4, S. 22, § 26 I 1, S. 38; M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 130; K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 146; W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498); G. Küchenhoff/E. Küchenhoff, Allgemeine Staatslehre, 1977, S. 117, 160; A. Hollerbach, in: Görresgesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, Bd. V, 1989, Spalte 770 „Volk“; W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 4 (für die Aktivbürgerschaft); A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 188: „Wahl […] als staatsorganschaftliches Handeln“; aber auch R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 31; H. Kloepfer, Öffentliche Meinung, Massenmedien, in: HStR, Bd. III, 2005, § 42 Rn. 20; E. Stein/G. Frank, Staatsrecht, 2010, § 51 III, S. 428; H. Dreier, in: ders, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 (Demokratie) Rn. 86, spricht vom „Ver-
I. Das Volk als Staatsorgan in der Literatur
117
behauptet, es sei herrschende Meinung in der staatsrechtlichen Literatur, dass das Volk Staatsorgan sei, diese Vorstellung des Volkes als Staatsorgan läge sowohl der Literatur als auch der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde.3 Misst die Literatur dem Volk eine organschaftliche Stellung bei, so wird diese meist nicht näher begründet; eine entsprechende Einordnung erfolgt eher nebenbei, ohne dass diese Ansicht hergeleitet oder hieraus weitere Konsequenzen gezogen würden. Besonders auffällig ist, dass aus der organschaftlichen Stellung des Volkes bei der Wahl eine organschaftliche Qualität des Wahlrechts nicht abgeleitet wird.4 Im Gegenteil behaupten einige der Autoren, die das Volk als Staatsorgan beschreiben, unabhängig davon dezidiert, dass das Wahlrecht ein subjektives Individualrecht sei.5 fassungsorgan“; in der Kommentierung zu Art. 38 Rn. 119, spricht er vom „Staatsorganvolk“; F.-J. Peine, Volksbeschlossene Gesetze und ihre Änderung durch den Gesetzgeber, Der Staat 18 (1979), S. 375 (384, 388) hält die organschaftliche Stellung in einem demokratischen Staat für „eine Selbstverständlichkeit“; J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 19, 40; G. Lang, Das Problem der Wahl- und Stimmpflicht, 1962, S. 43, C. Arndt, Zum Begriff der Partei im Organstreitverfahren, AöR 87 (1962), S. 197 (235, Fn. 179); C.-F. Menger, Zur verfassungsrechtlichen Stellung der deutschen politischen Parteien, AöR 78 (1952/1953), der den einzelnen Aktivbürger aber ausdrücklich nicht als Staatsorgan anerkennen will, S. 149 (160); E. Schiffer/H.-J. Wolff, Staatliche Willensbildung und nichtstaatliche Organisationen, AöR 116 (1991), S. 169 (173); H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 64. Lfg. (Stand: Jan. 2012), Bd. III, Art. 21 Rn. 156; W. Heun, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2012, S. 104; auch schon G. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, 1929, S. 29; aus rechtstheoretischer Sicht: H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, S. 160, 267; für das baden-württembergische Landesvolk: U. Preuß, Das Landesvolk als Gesetzgeber, DVBl. 1985, S. 719 (711); a. A.: K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 192; W. Löwer, Zuständigkeiten und Verfahren des Bundesverfassungsgericht, in: HStR, Bd. III, 2005, § 70 Rn. 18.; G. Robbers, in: Bonner Kommentar zum GG, Art. 20 Abs. 2, 165. Lfg. (Stand: Jan. 2014), Bd. V, Rn. 3033. 3 So kritisch W. Leisner, Das Volk, 2005, S. 42, jedoch ohne dies zu belegen; sowie U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 240; ohne Wertung I. Ebsen, Abstimmungen des Bundesvolkes als Verfassungsproblem, AöR 110 (1985), S. 2 (6), er bezeichnet es als „unbestritten“, dass Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG die Aktivbürgerschaft als Staatsorgan meine; ähnlich M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (345), K. Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, 1997, S. 115. 4 C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (216, Fn. 29), interpretiert hingegen in Aussagen anderer Autoren, die im Zusammenhang mit dem Wahlrecht das Volk als Staatsorgan nennen oder den einzelnen als „citoyen“, als „Mitinhaber staatlicher Gewalt“ beschreiben, dass diese das Wahlrecht auch als Kompetenz, also als Organrecht sehen würden. Hierfür ergeben sich jedoch keine Anhaltspunkte, weil sie das Wahlrecht unter diesem Aspekt nicht beleuchten, sondern gerade die subjektiv-rechtliche Erzählweise stärken. Bei diesen Autoren meint er dann auch herauszulesen, dass sie das Wahlrecht „inhaltlich auf Teilhabe an einer Kompetenz“ (Fn. 33) gerichtet sehen. Dies scheint in den zitierten Ausführungen von H. H. Klein, in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. IV, Art. 38 Rn. 135, zunächst so, wenn er schreibt, dass das Wahlrecht den „Inhaber mit der Befugnis ausstattet, als selbst[…]bestimmtes Individuum an der staatlichen Willensbildung verantwortlich teilzuhaben“. Dann hebt er jedoch hervor, dass das Wahlrecht ein „grundrechtgleiches Recht“ sei (Rn. 136). 5 So z. B. M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, einerseits S. 163, 207, auf S. 183 spricht er dagegen von „politischen Freiheits- und Beteiligungsrechten“;
118
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
So entsteht der Eindruck, dass die Bezeichnung des Volkes als Staatsorgan oftmals keine ernstliche Behauptung einer These ist, da fast kein Autor eine nähere Begründung gibt.6 Deshalb ist es sehr zweifelhaft, ob es sich tatsächlich um die herrschende Meinung in der Literatur handelt. Vielmehr werden hier nur bekannte Begrifflichkeiten ohne vertiefte Auseinandersetzung auf das Volk angewendet. Auffällig ist jedoch, dass im Schrifttum der jungen Bundesrepublik die staatsorganschaftliche Stellung des Volkes tendenziell stärker vertreten wurde.7 In frühen Kommentierungen zu Art. 20 GG findet sich eine Einordnung Volkes als Staatsorgan häufiger,8 während sich in aktuellen Kommentaren an dieser Stelle zur Rolle des Volkes innerhalb der Staatsorganisation – soweit ersichtlich – nichts findet, oder die staatsorganschaftliche Stellung gerade abgelehnt wird.9 Einer Lesart des Grundgesetzes, die die Stellung des Volkes im Grundgesetzes im Kontext der Demokratie vor der Stellung des Einzelnen stärker betont, entsprechen auch die Ausführungen von Theodor Maunz in der ersten Auflage seines „Deutschen Staatsrechts“ von 1951. Er bemängelt, dass die sich durch Wahlen vollziehende Mitwirkung des Bundesvolkes an der Staatsgewalt nur insofern verfassungsmäßig gewährleistet sei, als sie die Wahl als solche betreffe, nicht aber, soweit sie sich auf das individuelle aktive und passive Wahlrecht der einzelnen Staatsbürger beziehe.10 Dies zeigt, dass es das Volk ist, das Maunz als vom Grundgesetz bei der Wahl in den Fokus gestellt sieht. Rechte des Einzelnen vermag er dem Wortlaut des Grundge-
K. O. Nass, Wahlorgane und Wahlverfahren, 1959, S. 146 einerseits, S. 147 f. andererseits; G. Küchenhoff/E. Küchenhoff, Allgemeine Staatslehre, 1977, einerseits S. 117, 160, andererseits S. 52. W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 10 f., 14 f., vertritt hingegen dezidiert eine dualistische Auffassung. 6 Die einzige Ausnahme bildet S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 ff. 7 Siehe hierzu insbesondere die Auseinandersetzung mit der Frage der Stellung des Volkes in der Demokratie bei K. Kind, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie, 1955, die später nicht mehr in dieser Form gestellt wurde. In der Schweiz erschien etwas früher die Monographie von U. Affolter, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie und der Begriff der politischen Rechte, 1948. 8 F. Klein, in: von Mangoldt/Klein, GG-Kommentar, Bd. II, 1957, Artikel 20 Anm. 4 a), S. 595; K. G. Wernicke, Bonner Kommentar zum GG, Erstbearbeitung, Art. 20 II. 2. b), bezeichnet es als „Organ des Volkes im weiteren Sinne“; sie alle beziehen sich jedoch nur auf den wahlberechtigten Teil des Volkes. Die Ausführungen K. G. Wernickes waren dabei „geprägt von seinen profunden Kenntnisse der Materialien des Parlamentarischen Rates“, er hatte als wissenschaftlicher Assistent im Ausschuss für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates gearbeitet. Zum Wirken Wernickes: H. C. Hillner, Kurt Georg Wernicke †, NJW 1998, S. 1469 (1469). 9 So G. Robbers, in: Bonner Kommentar zum GG, Art. 20 Abs. 2, 165. Lfg. (Stand: Jan. 2014), Bd. V, Rn. 3033. 10 T. Maunz, Deutsches Staatsrecht, schon in der 1. Aufl., 1951, § 27 I, S. 192, aber auch noch in der 21. Aufl., 1977, § 37 I, S. 344, das Volk als Organ qualifizierend auch § 9 II, S. 62.
II. Das Volk als Staatsorgan in der Rechtsprechung des BVerfG
119
setzes gerade nicht zu entnehmen, während die gegenwärtige Literatur dem Grundgesetz das Gegenteil entnimmt.11 Mit Fortschreiten der Interpretationshistorie des Grundgesetzes und insbesondere der Entwicklung einer ausgefeilten Grundrechtsdogmatik schwindet der Fokus der Literatur vom Volk als Staatsorgan. Der Einzelne und seine Individualität rücken stärker in den Blick des Staatsrechts, das zunehmend auf ihn und seine Freiheit bezogen und entwickelt wird.12 Der Einzelne wird auch im Wahlakt aus seinem demokratischen Zusammenhang als Teil des Volkes gelöst und überwiegend als Individuum betrachtet. Zwar schwingt die These vom Volk als Staatsorgan weiterhin in der Literatur mit, allerdings mehr als paradox erscheinende Nebenerzählung zum individual-rechtlichen Wahlrecht.13
II. Das Volk als Staatsorgan in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Auch das Bundesverfassungsgericht hat die These von der staatsorganschaftlichen Stellung des Volkes aufgegriffen. Erstmals führte es seine Auffassung vom Volk als Staatsorgan in seinem Urteil aus dem Jahr 1958 zur Volksbefragung über Atomwaffen in Hamburg und Bremen aus. In dem Verfahren ging es zwar nicht um Wahlen, sondern um eine Volksbefragung, dennoch stellte das Bundesverfassungsgericht heraus, dass sich das Staatsvolk bei einer Befragung in gleicher Weise wie bei verbindlichen Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheiden äußern soll, und die Aktivbürger in derselben Weise und nach denselben Regeln wie bei Wahlen zum Parlament und bei Volksabstimmungen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen sollen, indem die Stimmabgabe geheim erfolgt und unter demselben strafrechtlichen Schutz steht. Dementsprechend erfolge hier – ebenso wie bei Wahlen und Abstimmungen – eine „Betätigung des Bürgers im status activus, […] eine Teilnahme des Bürgers als Glied des Staatsvolkes bei der Ausübung der Staatsgewalt“. Die Stellung des Volkes als Staatsorgan im Grundgesetz betont es, wenn es weiter ausführt: „nach den Gesetzen soll das Volk als Verfassungsorgan des demokratischen Staates an der Bildung des Staatswillens teilhaben.“ Auch zeigt das Bundesverfassungsgericht hier auf, wo es die organschaftliche Stellung des Volkes normativ verankert sieht, wenn es formuliert: „…andererseits handelt Art. 20 Abs. 2 GG von der Bildung des Staatswillens, und zwar von der Ausübung der vom Volk 11 Siehe zu der der Annahme, dass das aktive und passive Wahlrecht in Art. 38 GG normiert seien, oben in Abschnitt D. III., S. 71. 12 So sind Grundpflichten hingegen weitgehend unterbelichtet. Hierzu J. Isensee, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers, DÖV 1982, S. 609 ff. 13 Auch U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 244, hält den Charakter des Wahlrechts als grundrechtsgleiches Recht und die staatsorganschaftliche Stellung des Volkes für einen Widerspruch.
120
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
ausgehenden und unter Umständen auch vom Volk selbst als Staatsorgan wahrgenommenen Staatsgewalt.“14 Die 1958 erstmals aufgestellte These der staatsorganschaftlichen Stellung des Volkes hat das Bundesverfassungsgericht dann zwar auch weiterhin vereinzelt vertreten, allerdings weniger ausgeführt als in dieser ersten Entscheidung.15 Es wiederholte in seiner weiteren Rechtsprechung im Wesentlichen die hier ausgeführten Passagen. In seinem Urteil zur Parteienfinanzierung von 1966 bezeichnete es das Volk dementsprechend als „Verfassungs- und Kreationsorgan“, das in Wahlen und Abstimmungen selbst die Staatsgewalt ausübe.16 Nur mittelbar hebt das Bundesverfassungsgericht dann hervor, dass auch die Stimmabgabe des Einzelnen organschaftliches Handeln darstellt.17 Es beschränkt sich im Übrigen darauf, zu betonen, dass der Bürger sich im „status activus“18 betätige.19 Immer dann, wenn es das Narrativ der organschaftlichen Stellung des Volkes verfolgt und den einzelnen Bürger dazu in Beziehung setzt, löst das Bundesverfassungsgericht das Verhältnis des Gesamtvolkes zum Einzelnen zugunsten des Volkes.20 Der Bürger handele als Glied des Volkes.21 Dies lässt den Einzelnen im Wahlakt hinter das Volk in seiner Gesamtheit zurücktreten. Der Wähler wird so als über das Volk mediatisiert beschrieben. Das Wahlrecht erscheint dann als Recht, das dem Einzelnen gerade als Teil des Staatsorgans Volk und nicht aus sich selbst heraus zusteht.
14
Alle Zitate in diesem Abschnitt stammen aus BVerfGE 8, 104 (114) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. 15 In der Formulierung abgeschwächter dann BVerfGE 83, 37 (40) – Ausländerwahlrecht (Schleswig-Holstein), Urteil vom 31. 10. 1990, wo nur noch vom Volk als „Legitimations- und Kreationssubjekt“ die Rede ist. 16 BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966, W. Löwer, Zuständigkeiten und Verfahren des Bundesverfassungsgericht, in: HStR, Bd. III, 2005, § 70 Rn. 18, tut dies jedoch als „Redeweise“ ab. 17 BVerfGE 8, 122 (133) – Volksbefragung Hessen, Urteil vom 30. 7. 1958: „Gehört demnach die Stimmabgabe der wahlberechtigten Gemeindebürger nicht in den Bereich des Gesellschaftlichen […], so muß sich die gemeindliche Volksbefragung als organschaftliches Handeln […] im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit halten.“ 18 BVerfGE 8, 104 (115) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958; BVerfGE 8, 122 (133) – Volksbefragung Hessen, Urteil vom 30. 7. 1958. 19 Obwohl dieser Begriff vom Bundesverfassungsgericht – wie oben in Abschnitt D. I. 2., S. 60 f. gezeigt – gerade uneinheitlich verwendet wird. 20 Ähnlich BVerfGE 41, 399 – Wahlkampfkostenpauschale, Beschluss vom 9. 3. 1976. Wahlen müssten periodisch wiederkehrend stattfinden, „um dem Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, die Möglichkeit zu geben, seinen Willen kundzutun“. Die Passage ist wörtlich übernommen aus BVerfGE 20, 56 (113) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. 21 BVerfGE 8, 104 (114) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958.
II. Das Volk als Staatsorgan in der Rechtsprechung des BVerfG
121
Auch in seiner Entscheidung zum Ausländerwahlrecht in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1990 hat das Bundesverfassungsgericht nicht den Einzelnen als Träger des Wahlrechts, sondern das Volk in seiner Gesamtheit hervorgehoben: „Ist also die Eigenschaft als Deutscher nach der Konzeption des Grundgesetzes der Anknüpfungspunkt für die Zugehörigkeit zum Volk als dem Träger der Staatsgewalt, so wird auch für das Wahlrecht, durch dessen Ausübung das Volk in erster Linie die ihm zukommende Staatsgewalt wahrnimmt, diese Eigenschaft vorausgesetzt.“22 Diese Anknüpfung des Wahlrechts an die Staatsangehörigkeit und damit an die Zugehörigkeit zum Staatsvolk zeigt ebenfalls die Mediatisierung des Einzelnen durch das Volk, die der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts vornimmt. Es ist das Volk, das zu wählen berechtigt ist, und nicht primär der Einzelne. Aus diesem Grund kann nur derjenige, der zum Volk gehört, als Teil desselben wählen.23 Neben dieser Deutung findet sich jedoch in der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auch die umgekehrte Sichtweise. Die Rechte des Volkes scheinen in dieser Lesart in den Rechten der Bürger aufzugehen, wenn das Bundesverfassungsgericht ausführt, dass „Rechte des Volkes […] nur in den subjektiven öffentlichen Rechten des aktiven Status des Bürgers greifbar [werden]“.24 Das Bundesverfassungsgericht erweckt hier im Gegenteil den Anschein, die Rechte des Volkes aus den Rechten der Bürger abzuleiten. Das Volk als Inhaber von Rechten gibt es in dieser Deutung dann nicht, es sind vielmehr die einzelnen Bürger, die Rechte innehaben. Das Volk wird so nur als die Summe seiner Bürger verstanden:25 „Rechte des Volkes“ sind dann auch nur die Summe der Rechte des „status activus“ seiner Bürger.26 In Anlehnung an diese Auffassung ist deshalb in der Literatur vereinzelt auch dafür plädiert worden, den einzelnen Bürger selbst als Staatsorgan zu betrachten, weil „das Volk“ im demokratischen Staat nicht losgelöst von seinen Einzelgliedern gedacht werden könne.27 Die Gegensätzlichkeit solcher Sichtweisen deckt das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht auf, es führt sie vielmehr nebeneinander fort. Der Bezugspunkt des Wahlrechts wechselt aber nicht nur in unterschiedlichen Entscheidungen zwischen dem Volk und den Bürgern, das Gericht wechselt auch innerhalb derselben Entscheidung, wenn es davon spricht, dass die Wähler ihr Urteil in einem freien, offenen 22
1990. 23
BVerfGE 83, 37 (51, 52) – Ausländerwahlrecht (Schleswig-Holstein), Urteil vom 31. 10.
Zur Kritik an dieser „volksdemokratischen“ Sicht des Zweiten Senats B.-O. Bryde, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, Staatswissenschaft und Staatspraxis 1994, S. 305 (322). 24 BVerfGE 13, 54 (85) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961. 25 So auch K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 186: „Eine Gesamtheit ist logisch nicht mehr als die Summe ihrer Teile.“ 26 Wenn das Bundesverfassungsgericht die Rechte des Volkes über die Rechte des Bürgers „aus dem status activus“ definiert, dann benutzt es den Begriff der Rechte des status activus gerade, um Rechte der gesellschaftlichen Sphäre zu beschreiben. 27 C. Arndt, Zum Begriff der Partei im Organstreitverfahren, AöR 87 (1962), S. 197 (236).
122
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Prozess der Willensbildung fällen können, im nächsten Satz aber gerade von der Willensbildung des Volkes die Rede ist.28 Ebenso wie das Bundesverfassungsgericht sich auf einen primären Akteur beim Wahlrecht nicht festlegt, ist es sich unsicher darüber, wessen Selbstbestimmungsrecht sich im Wahlrecht verwirklicht. Es bezieht sich zum einen auf das Volk als Träger des Selbstbestimmungsrechts, wenn es von „rechtsstaatliche[r] Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit“29 oder vom „Selbstbestimmungsrecht des Landesvolkes“30 spricht oder vom „Wahlrecht, durch dessen Ausübung das Volk in erster Linie die ihm zukommende Staatsgewalt wahrnimmt“31. In anderen Entscheidungen wiederum stellt es den Einzelnen als Träger des Selbstbestimmungsrechts dar, indem es vom „Selbstbestimmungsrecht der Einwohner“32 spricht oder der „Idee der freien Selbstbestimmung aller“33. Ebenso spricht es davon, dass das Wahlrecht einen Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung begründe.34 Es zeigt sich, dass das Bundesverfassungsgericht das Volk zwar als Staatsorgan betrachtet, entfaltet wird diese Annahme jedoch nur in seiner früheren Rechtsprechung. In der Folgezeit wiederholt es diese Ansicht nur und entwickelt – ebenso wie die Literatur – daneben auch eine konträre Sichtweise, die den Fokus der demokratischen Selbstbestimmung auf den Einzelnen legt. In der jüngeren Rechtsprechung nimmt das Bundesverfassungsgericht dann auch vollständig Abstand davon, das Volk als Staatsorgan zu bezeichnen. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die These, dass das Volk ein Staatsorgan sei, sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur zwar angerissen, aber kaum entfaltet oder näher belegt wird. Da aber eine staatsorganschaftliche Stellung die Rolle des Volkes in der Demokratie treffend beschreiben könnte, soll diese These im Folgenden näher untersucht werden.
28
1977. 29
BVerfGE 44, 125 (139) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3.
BVerfGE 2, 1 (12 f.) – SRP-Verbot, Urteil vom 23. 10. 1952. BVerfGE 1, 14 (50) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1951. 31 BVerfGE 83, 37 (37) – Ausländerwahlrecht, Urteil vom 31. 10. 1990; BVerfGE 107, 59 (92) – Lippeverband, Beschluss vom 5. 12.2002. 32 BVerfGE 13, 54 (63) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961. 33 BVerfGE 44, 125 (142) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3. 1977. 34 BVerfGE 123, 267 (340) – Lissabon, Urteil vom 30. 6. 2009. 30
III. Organschaft
123
III. Organschaft Um bestimmen zu können, ob das Volk in der Demokratie des Grundgesetzes Staatsorgan ist, muss zunächst Klarheit darüber geschaffen werden, was die Wesensmerkmale eines Staatsorgans sind. Das Prinzip der Organschaft ist dem Umstand geschuldet, dass tatsächliche Handlungen nur von natürlichen Personen vorgenommen werden können und auch nur diese einen tatsächlichen Willen bilden können.35 Organisationen fehlt diese Fähigkeit jedoch, weil sie lediglich von der Rechtsordnung geschaffene Subjekte sind. Sie führen zwar eine juristisch reale Existenz, diese ist aber nur durch eine gedankliche Abstraktion erfassbar.36 Da sie aber selbst keine tatsächlichen Handlungen vornehmen und auch selbst keinen eigenen Willen bilden können, bedarf es eines Zurechnungsprinzips, durch das der Wille natürlicher Personen der Organisation als eigener Wille zugerechnet werden kann, um dieser zur Handlungs- und Willensbildungsfähigkeit zu verhelfen.37 Dieses Zurechnungsprinzip ist die Organschaft. Über die Bestellung von Organen erlangt die juristische Person Handlungs- und Willensbildungsfähigkeit und damit auch eine „reale“ Existenz. Auch die Organe selbst erlangen Handlungsfähigkeit aber erst darüber, dass die ihnen übertragenen Aufgaben von natürlichen Personen wahrgenommen werden. Es ist damit zu unterscheiden zwischen dem Organ, das mit den Aufgaben der Organisation betraut ist, und den Organwaltern, also den natürlichen Personen, die berufen sind, die dem Organ zugewiesenen Zuständigkeiten wahrzunehmen.38 Die individuelle Rechtsphäre der Organwalter als natürliche Personen wird dabei um die organschaftliche Rechtssphäre lediglich ergänzt, bleibt im Übrigen aber bestehen.39 Das Prinzip der Organschaft bewegt sich somit im Dreieck zwischen Organisation, Organ und Organwalter. Das Organ ist damit betraut, Zuständigkeiten, die der Organisation obliegen, zu erfüllen. Organisationen bedienen sich meist verschiedener Organe zur arbeitsteiligen Erfüllung ihrer Aufgaben. Bei den Zuständigkeiten, die die Organe für die Organisation wahrnehmen, handelt es sich dementsprechend aus Sicht der Organe nicht um Eigen-, sondern um Fremdzuständigkeiten.40 Organe sind dabei vom 35
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, S. 540. W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 21. 37 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 1; W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 25, weist aber darauf hin, dass der Begriff „Zurechnung“ die Überbrückung einer Distanz suggeriert, die aber von vornherein nicht besteht; das Handeln des Organwalters und des Organs sind der Organisation von vornherein rechtlich zugeordnet. 38 H. J. Wolff, Organschaft und juristische Person, Bd. II, 1934, S. 230, G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 559 f. 39 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 25. 40 H. Pollmann, Repräsentation und Organschaft, 1969, S. 115, Fn. 6. 36
124
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Wechsel ihrer Organwalter unabhängig. Ihre Existenz reicht über die Besetzung mit bestimmten Organwaltern hinaus, denn die Aufgaben der Organisation sind ihnen zur Erfüllung zugewiesen, und nicht den Organwaltern als höchstpersönliche Pflicht überantwortet.41 Zur näheren Beschreibung eines Organs kann die Definition von Hans Julius Wolff herangezogen werden, die in der heutigen Rechtslehre gemeinhin zugrunde gelegt wird:42 Ein Organ ist nach dieser Definition ein „durch organisierende Rechtssätze gebildetes eigenständiges, institutionelles Subjekt von Zuständigkeiten zur transitorischen Wahrnehmung der Eigenzuständigkeiten einer juristischen Person“.43 Wenn H. Pollmann meint, dass die Rechtsdogmatik über einen einheitlichen Organbegriff, der allgemein anerkannt wäre und alle Eigenschaften eines Organs abbilden würde, nicht verfüge,44 dann zeigt dies nur, dass auch der wolffsche Organbegriff aufgrund seiner Komplexität nicht in der Lage ist, abschließend über die Organeigenschaft Auskunft zu geben, sondern es vielmehr Abweichungen von dieser Definition geben kann, ohne dass deshalb die Organeigenschaft eines Gebildes zu verneinen wäre.45
IV. Staatsorgan Der wolffsche Organbegriff wurde dabei für Organe jedweder Organisation im Kontext des Verwaltungsrechts entwickelt und ist damit zunächst auf Verwaltungsträger zugeschnitten. Das Volk kommt aber nur als Organ des Staates, nicht aber einer Organisation von untergeordneter Bedeutung in Frage. Auch der Staat bedarf als Organisation verschiedener Organe, um seine Aufgaben zu erfüllen. Denn als rechtliche Organisation ist auch er nur durch Organe, die mit natürlichen Personen besetzt sind, handlungsfähig. Die Konstruktion des Staates als juristische Person und damit als Organisation wurde zunächst von Wilhelm Eduard Albrecht in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen“ entwickelt,46 in denen er Romeo Maurenbrechers Werk über das deutsche
41
W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 22. Z. B. von G. Küchenhoff/E. Küchenhoff, Allgemeine Staatslehre, 1977, S. 117. 43 H. J. Wolff, Verwaltungsrecht, Bd. II, 1976, § 74 I f., S. 43. 44 H. Pollmann, Repräsentation und Organschaft, 1969, S. 115, Fn. 6. 45 Ähnlich M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (346). 46 W. E. Albrecht, Romeo Maurenbrecher: Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts, Rezension, Göttingische gelehrte Anzeigen 1837, Bd. 2, S. 1489 (1492); hierzu H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 41. 42
IV. Staatsorgan
125
Staatsrecht rezensierte.47 Diese Konstruktion machte den Staat selbst und nicht mehr den Monarchen zum Subjekt der Rechte. Der Staat wurde damit rechtlich von der Person des Monarchen gelöst.48 Der Staat als juristische Person ist damit zunächst als Zurechnungsschema entwickelt worden.49 Das „Dogma“ des Staates als juristischer Person wird aber deswegen infrage gestellt, weil es die Volkssouveränität nicht juristisch darstellen könne.50 Vielmehr erkläre diese Konstruktion den Staat selbst zum Souverän und die Verfassungsorgane zu Organen des staatlichen Willens.51 Dass aber gerade die Volkssouveränität sich in dieser Konstruktion des Staates sehr wohl abbilden lässt, werden die Ausführungen über die unterschiedlichen Rollen, die das Volk im demokratischen Staat des Grundgesetzes einnimmt, zeigen.52 Auch der Staat verfügt damit über eine Vielzahl von Organen, derer er sich zur Erfüllung seiner weit gefächerten Aufgaben bedient.53 Die wahrgenommenen Zuständigkeiten sind zahlreich und von unterschiedlich engem Bezug zum Staat. So gibt es Organe, deren Existenz für die Verfassungsordnung konstituierend ist, und solche, die von nachrangiger Bedeutung für die Gesamtkonzeption des Staates sind. Die Organe unterteilen sich entsprechend in oberste und sonstige Organe des Staates.54
47 W. Pauly, Der Methodenwandel im deutschen Spätkonstitutionalismus, S. 77, 78, betont jedoch, „dass die Leistung von Albrecht nur in einer ganz besonderen Fassung und Ausarbeitung vom Staat als juristischer Person liegen kann.“ Die Idee liege jedoch deutlich weiter zurück. 48 H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 41. 49 E-W. Böckenförde, Organisation, Organisation, juristische Person, in: Menger (Hrsg.), Festschrift für Wolff, S. 269 (297); R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 2010, § 13 II, S. 79. 50 H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 168; K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 192; E.-W. Böckenförde, Organ, Organisation, Juristische Person, in: Festschrift für Wolff, S. 269 (295, 296). Er tritt für eine anstaltliche Konstruktion des Staates ein, weil sich die Stellung des Volkes als Ausgangspunkt der staatlichen Ordnung innerhalb der juristischen Person „Staat“ nicht darstellen ließe. Diese sei vielmehr darauf ausgelegt, dass sie sich gegenüber ihren Gründern verselbstständige. Diese Ansicht übergeht die Unterscheidung zwischen dem (Gesamt-)Volk als Träger der Staatsgewalt und der Aktivbürgerschaft als Staatsorgan, die – wie noch unten in Abschnitt E. V., S. 129 ff., zu zeigen sein wird – im Grundgesetz angelegt ist. 51 H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 168. 52 Siehe hierzu unten in Abschnitt E. V. 3., S. 129 ff. 53 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 2; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 32 II 2, S. 343. 54 Es findet sich auch – nur terminologisch unterschiedlich – die Abgrenzung zwischen Verfassungsorganen und den übrigen Staatsorganen: K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 32 II 2, S. 343. Zur Überlegenheit des Begriffs „Staatsorgan“ vor dem Begriff „Verfassungsorgan“, weil zwar juristische Personen (wie der Staat), nicht aber Gesetze und Normenkomplexe (wie die Verfassung) Organe haben, W. Knies, Auf dem Weg in den „verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat“?, in: Festschrift für Stern, 1997, S. 1155 (1166) mit Fn. 49. Er vermutet, dass mit dem Begriff „Verfassungsorgan“ diejenigen Staatsorgane herausgehoben werden sollen, „deren Besonderheit darin besteht, dass sie durch die Verfassung selbst als notwendige Staats(!)-organe eingerichtet und mit verfassungsmäßig geordneten Aufgaben und Befugnissen
126
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Das Grundgesetz selbst hält keine Definition darüber bereit, was es unter einem Staatsorgan versteht. Ebenso benennt es keine Staatsorgane explizit als solche.55 Die Definition eines Staatsorgans formulierte Heinrich Triepel bereits im Jahr 1911: „Staatsorgan ist, wer namens des Staates handelt, in dem wir uns den Staat als selber handelnd vorstellen müssen.“56 Die wolffsche Organdefinition erscheint im Rückblick als Ausdifferenzierung dieser lediglich auf Organe des Staates bezogenen Definition. Unter den Staatsorganen nehmen die obersten Staatsorgane eine herausgehobene Stellung ein. Gegenüber den übrigen Staatsorganen zeichnen sie sich dadurch aus, dass ihr Vorhandensein, ihr Aufbau, ihre Zuständigkeiten und ihr Zusammenwirken dem Verfassungsgefüge ihr Gepräge geben. Ohne ihr Vorhandensein würde sich auch die Struktur des Staates ändern.57 Ihre Existenz und ihre Zuständigkeiten sind deshalb regelmäßig in der Verfassung normiert. Dabei lässt das Grundgesetz einen Interpretationsspielraum, welche Organe für die Staatsorganisation tragend sind und daher zum Kreis der obersten Staatsorgane zählen. Das Volk würde – wäre es als Staatsorgan zu qualifizieren – diesem Kreise jedoch unstreitig angehören, weil es die Grundlage der Staatsform „Demokratie“ bildet. Es gibt der Staatsform nicht nur ihr Gepräge, sondern ist ihre Voraussetzung. Es ist deshalb auch keinem Staatsorgan untergeordnet. Im Folgenden konzentrieren sich die Ausführungen deshalb auf oberste Staatsorgane. Es hat sich in der Literatur eine herrschende Meinung darüber gebildet, welche Organe als oberste Staatsorgane zu qualifizieren sind. Im Kreise der obersten Staatsorgane finden sich jedenfalls unstreitig der Bundestag,58 der Bundesrat,59 der Bundespräsident60 und die Bundesregierung61.62 betraut sind“ (Hervorhebung im Original). Gleichwohl wird der Begriff „Verfassungsorgan“ auch im BVerfGG in § 31 verwendet. 55 Oberste Staatsorgane werden jedoch in Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 f. GG vorausgesetzt. Hier werden sie als „oberste Bundesorgane“ bezeichnet, um sie gegenüber den obersten Staatsorganen der Länder abzugrenzen. Oberste Bundesorgane meinen hier oberste Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland. 56 H. Triepel, Emil Spira: Die Wahlpflicht, Besprechung, ZfP 4 (1911), S. 597 (602); ähnlich G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, S. 544 für „unmittelbare Organe“ im Allgemeinen. 57 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 96, der dies auf den Begriff „Verfassungsorgane“ bezieht, diesen aber gleichbedeutend mit dem Begriff „Staatsorgane“ verwendet. 58 Seine Stellung als oberstes Staatsorgan ist so selbstverständlich, dass sie eher beiläufig festgestellt wird, so z. B. H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 37, er spricht von dem „Beziehungsverhältnis zu den anderen obersten Staatsorganen“. 59 T. Maunz/R. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 36. Lfg. (Stand: Okt. 1999), Bd. IV, Art. 50 Rn. 1: „föderativ-demokratisches Bundesorgan“; R. Herzog, Stellung des Bundesrates im demokratischen Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. III, 2005, § 57 Rn. 2; H. Bauer, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 50 Rn. 17: „oberste Bundesorgane“; zur Organstellung des Bundesrates: H. Pollmann, Repräsentation und Organschaft, 1969, S. 114 ff.
IV. Staatsorgan
127
Bei diesen lassen sich sowohl ihr Zustandekommen, aber auch ihre Auflösung und ihre innere Organisation, der Zeitraum ihres Bestehens, ihre Aufgaben und Zuständigkeiten explizit der Verfassung entnehmen. Ihnen widmet das Grundgesetz auch jeweils einen eigenen Abschnitt, in dem sich die spezifischen Organisationsnormen finden.63 Die Kollegialorgane unter ihnen, also diejenigen, die aus mehreren gleichberechtigten Organwaltern bestehen,64 besitzen eine eigene Geschäftsordnung. In dieser sind organisatorische und verfahrensrechtliche Fragen detailliert geregelt,65 ihr Erlass ist jeweils auch im Grundgesetz festgelegt oder vorausgesetzt.66 Überwiegend werden aber auch das Bundesverfassungsgericht67 sowie die Bundesversammlung68 und der Gemeinsame Ausschuss69 zu den obersten Staatsorganen gezählt, obwohl ihnen kein eigener Abschnitt im Grundgesetz gewidmet ist. Das Bundesverfassungsgericht wird lediglich im Abschnitt X des Grundgesetzes „Die Rechtsprechung“ zwischen den Vorschriften über die übrigen Gerichte und die Gerichtsbarkeit in seinen Zuständigkeiten und seiner Organisation beschrieben. 60 R. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 54. Lfg. (Stand: Jan. 2009), Bd. V, Art. 54 Rn. 16, 29: „oberstes Verfassungsorgan“. 61 R. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 52. Lfg. (Stand: Mai 2008), Bd. V, Art. 62 Rn. 1: „oberstes Verfassungsorgan“. 62 Für die gesamte Aufzählung: C. Degenhart, Staatsorganisationsrecht, 2014, Inhaltsverzeichnis S. XIII ff.; H. Maurer, Staatsorganisationsrecht, 2010, Inhaltsverzeichnis S. XIV ff. führt diese unter dem Abschnitt „Die Verfassungsorganisation“ auf. 63 Die Regelungen über den Bundestag finden sich in Abschnitt III. des Grundgesetzes, Art. 38 bis 48, über den Bundesrat in Abschnitt IV., Art. 50 bis 53, den Bundespräsidenten in Abschnitt V., Art. 54 bis 61, die Bundesregierung in Abschnitt VI., Art. 62 bis 69. Dass dem Bundesverfassungsgericht kein eigener Abschnitt gewidmet ist, lässt sich daraus erklären, dass seine Stellung als oberstes Staatsorgan erst später „erkämpft“ wurde. 64 R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 2010, § 14 IV, S. 87; W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 29, P. Dagtoglou, Kollegialorgane und Kollegialakt der Verwaltung, S. 33 f. 65 Geschäftsordnung des Bundestages (GOBT) vom 2. Juli 1980 (BGBl. I S. 1237), Geschäftsordnung des Bundesrates (GOBR) vom 26. November 1993 (BGBl. I S. 2007) zuletzt geändert durch Beschluss des Bundesrates vom 8. Juni 2007 (BGBl. I S. 1057), Geschäftsordnung der Bundesregierung (GOBReg) vom 11. Mai 1951 (BGBl I S. 137). 66 Für die GOBT in Art. 40 Abs. 1 Satz 2; für die GOBR Art. 52 Abs. 3 Satz 2; für die GOBReg Art. 65 Satz 4. 67 G. Roellecke, Das Bundesverfassungsgericht, in: HStR, Bd. III, 2005, § 67 Rn. 17 – 21; G. Leibholz, JöR 6 (1957), Der Status des Bundesverfassungsgerichts – Einleitung, JöR 6 (1957), S. 110 (112). Er verweist darauf, dass sich der Parlamentarische Rat der Stellung der Verfassungsgerichtsbarkeit für den funktionellen Gesamtaufbau der Verfassungsorgane nicht bewusst war. 68 M. Nettesheim, Die Bundesversammlung und die Wahl des Bundespräsidenten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 63 Rn. 1; R. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 54. Lfg. (Stand: Jan. 2009), Bd. V, Art. 54 Rn. 29, (in Fn. 1 bezeichnet er dies als „absolut herrschende Meinung“). 69 So in der Aufzählung von S. Korioth, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 50 Rn. 10.
128
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Diese Sonderstellung des Gerichts unter obersten Bundesgerichten ergibt sich aus einer Selbstdefinition des Gerichts als oberstes Staatsorgan, mit der es sich aus dem Kreis der obersten Bundesgerichte gelöst hat.70 Zwar war das Bundesverfassungsgericht als Gericht bereits zuvor ein Staatsorgan gewesen, in den Kreis der obersten Staatsorgane ist es jedoch erst durch die Selbstdefinition vorgerückt. Diese Stellung des Gerichts war vom Parlamentarischen Rat nicht vorgesehen, sie wurde aber von den übrigen Staatsorganen anerkannt und das Bundesverfassungsgericht auch organisatorisch verselbstständigt.71 Auch die Lehre sieht das Bundesverfassungsgericht ganz überwiegend unstreitig als oberstes Staatsorgan.72 Der Bundesversammlung ist ebenfalls kein eigener Abschnitt gewidmet, ihre Organisation und Zuständigkeit ist allein in Art. 54 GG geregelt, einer Vorschrift, die sich im Abschnitt über den Bundespräsidenten befindet. Damit ist die Bundesversammlung nur im Kontext ihrer einzigen Kompetenz – der Wahl des Bundespräsidenten – geregelt. Dennoch wird ihr als Kreationsorgan eines obersten Staatsorgans selbst die Stellung eines obersten Staatsorgans beigemessen.73 Ihre Verfassungsorganqualität ergibt sich gerade daraus, dass sie mit der Wahl eines anderen Verfassungsorgans betraut ist.74 Zudem finden sich Regelungen über oberste Staatsorgane in Abschnitten, die andere oberste Staatsorgane betreffen. So ergibt sich z. B. aus Art. 67 GG, der im Abschnitt über die Bundesregierung steht, die Möglichkeit des Bundestages, dem Bundeskanzler das Misstrauen auszusprechen; auch das Recht des Bundespräsidenten, den Bundestag aufzulösen, ist hier geregelt. Dass die Bundesorgane miteinander in enger Beziehung stehen, führt dazu, dass sich die Vorschriften im Grundgesetz verschränken und Normen, die sich auf zwei verschiedene Organe beziehen, jeweils nur in einem Abschnitt verortet sind. 70 Siehe hierzu die „Denkschrift des Bundesverfassungsgerichts“ vom 27. 6. 1952, JöR 6 (1957), S. 144 (145). Die Stellung als Verfassungsorgan ergebe sich „aus seiner „grundsätzlichen Stellung und der Fülle an Kompetenzen, die ihm im Grundgesetz […] zugewiesen und im BVerfGG näher umschrieben sind“, außerdem setze das BVerfGG in § 1 die Verfassungsorganqualität des Bundesverfassungsgerichts voraus. 71 Hierzu C. Schönberger, Anmerkungen zu Karlsruhe, in: Jestaedt/Lepsius/Möllers/ders. (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, 2011, S. 9 (24 f.); G. Roellecke, Roma locuta – Zum 50jährigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichts, NJW 2001, S. 2924 (2927 f.); ders., Das Bundesverfassungsgericht, in: HStR, Bd. III, 2005, § 67 Rn. 16. 72 Siehe die Nachweise bei K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 32 II 2, S. 342, Fn. 52; kritisch zur Stellung des Gerichts als oberstes Staatsorgan aber B. Großfeld, Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz, NJW 1998, S. 3544 (3544 ff.), weil der dem Gericht im Parlamentarischen Rat eigentlich zugedachte Abschnitt dann doch nicht in das Grundgesetz eingeführt wurde. 73 M. Nettesheim, Die Bundesversammlung und die Wahl des Bundespräsidenten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 63 Rn. 1, R. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 54. Lfg. (Stand: Jan. 2009), Bd. V, Art. 54 Rn. 29; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 29 I 1, S. 179. 74 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 120; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 29 I 1, S. 179.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
129
Es zeigt sich jedenfalls, dass auch Organen, denen kein eigener Abschnitt im Grundgesetz gewidmet ist, die Stellung eines obersten Staatsorgans eingeräumt wird. Dass dem Volk im Grundgesetz kein eigener Abschnitt zugedacht ist, spricht somit zunächst einmal nicht gegen seine Eigenschaft als oberstes Staatsorgan. Hingegen wäre das Volk, wenn seine Stellung als organschaftlich qualifiziert werden könnte, unstreitig zu den obersten Staatsorganen zu zählen, weil es jedenfalls der staatlichen Ordnung ihr maßgebliches Gepräge verleiht und es keinem Organ untergeordnet ist. Es bleibt also bei der Frage, ob das Volk im Wahlakt im Namen des Staates handelt, „ob wir uns in ihm den Staat als selber handelnd vorstellen müssen“,75 ob das Volk also Fremdzuständigkeiten des Staates wahrnimmt.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz Was genau unter dem Begriff „Volk“ zu verstehen ist, ist philologisch nicht eindeutig. Der Begriff „Volk“ ist zunächst sprachlich unbestimmt und hat unterschiedliche Bedeutungen.76 Für die juristische Untersuchung der Stellung des Volkes im Grundgesetz und der Frage, ob es Fremdzuständigkeiten des Staates wahrnimmt, ist es jedoch hinreichend, den Begriff des Volkes in dem Sinne zu klären, wie ihn das Grundgesetz benutzt. Auch das Grundgesetz verwendet den Begriff jedoch nicht einheitlich.77 So weist schon die Verwendung des Begriffs mit unterschiedlichen adjektivischen Zusätzen – es findet sich als „Deutsches Volk“ (Präambel, Satz 1; Art. 1 Abs. 2 GG), als „gesamte[s] Deutsche[s] Volk“ (Präambel, Satz 2) aber auch kleingeschrieben als „deutsches Volk“ (Art. 56; Art. 139; Art. 146 GG) und als „gesamte[s] deutsche[s] Volk“ (Art. 146 GG) – darauf hin, dass das Grundgesetz von einer variierenden Bedeutung ausgeht. Aber auch dort, wo die Verfassung den Begriff „Volk“ in Reinform, also ohne adjektivische Zusätze, benutzt (Art. 20 Abs. 2 S. 1 und 2; Art. 21 Abs. 1 S. 1; Art. 28 Abs. 1 S. 2; Art. 38 Abs. 2 GG), ergibt sich nicht von selbst, dass hiermit stets dasselbe bezeichnet ist.78 Vielmehr liegt es nahe, dass das 75
H. Triepel, Emil Spira: Die Wahlpflicht, Besprechung, ZfP 4 (1911), S. 597 (602). H. Liermann, Das deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichsstaatsrecht der Gegenwart, 1927; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 I 2, S. 5, beschreibt neun verschiedene Deutungsvarianten des Begriffs; hierzu auch G. Küchenhoff/E. Küchenhoff, Allgemeine Staatslehre, 1977, S. 41 ff. 77 D. Breer, Die Mitwirkung von Ausländern an der politischen Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland, 1982, S. 63; D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 58, ist hingegen der Auffassung, dass das Grundgesetz mit dem „Volk“ als Rechtssubjekt immer das Staatsvolk meine. 78 A. Wallrabenstein, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, 1999, S. 107, für die Nichtgleichsetzung des Volksbegriffs in Art. 20 Abs. 2 und 146 GG sowie der Präambel. 76
130
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Grundgesetz den Begriff je nach Kontext mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Das Volk wird im Grundgesetz nicht nur innerhalb der staatlichen Ordnung als Größe beschrieben. Nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus, nach dessen Satz 2 wird sie vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Das Volk wird von der Präambel des Grundgesetzes als der Verfassung bereits vorausliegend, als deren Schöpfer beschrieben.79 Schon diese unterschiedliche Stellung des Volkes außerhalb und innerhalb der Verfassung weist auf durchaus unterschiedliche Funktionen und Rollen des Volkes hin, die das Grundgesetz voraussetzt.80 Es liegt nahe, dass mit dieser funktionellen Unterscheidung auch eine personelle einhergeht, dass mit dem Begriff „Volk“ also unterschiedliche Personengruppen adressiert sind.81 Diese variierenden Rollen des Volkes und sein jeweiliges personales Substrat werden im Folgenden untersucht.
1. Das Volk als nicht-staatliche, gesellschaftliche Größe Mit dem Begriff „Volk“ wird zum einen die Gesellschaft bezeichnet. Auf diese nimmt Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG Bezug, wenn hier von der „politischen Willensbildung des Volkes“ die Rede ist. So gebraucht, beschreibt der Begriff das Volk nicht als verfassungsrechtliche Größe, sondern als neben der verfassungsrechtlichen Ordnung stehend.82 Denn die Gesellschaft bezeichnet die Einzelnen in ihren sozialen Zusammenhängen.83 Die Gesellschaft ist der Raum des individuellen Beliebens, der
79 Zur tatsächlichen Unrichtigkeit dieser Annahme aber D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 88 f. 80 So auch E-W. Fuß, Die Nichtigerklärung der Volksbefragungsgesetze, AöR 83 (1958), S. 383 (393 f.); A. Bleckmann, Das Nationalstaatsprinzip im Grundgesetz, DÖV 1988, S. 437 (437); zu den unterschiedlichen Stellungen des Volkes sowohl innerhalb und außerhalb der Staatsorganisation auch C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 238 ff. 81 Eine Dimension der personellen Unterscheidung ist allerdings mit der Wiedervereinigung Deutschlands weggefallen. Über die Frage, ob mit dem Volk jeweils in concreto auch die in DDR lebenden Deutschen gemeint sind, braucht sich die Staatsrechtswissenschaft keine Gedanken mehr zu machen. Diskussionen über den Volksbegriff des Grundgesetzes vor der Wiedervereinigung waren oftmals hiervon geprägt. Die Frage nach dem Volksbegriff des Art. 20 Abs. 2 GG hat aber im Hinblick auf die Zuwanderung und der weiteren Ausgestaltung an neuer Aktualität gewonnen, so G. Robbers, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 165. Lfg. (Stand: Jan. 2014), Bd. V, Art. 20 Abs. 2, Rn. 3028. 82 C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 251. 83 E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 1529 (1530); ders., Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, S. 17; ähnlich J. Isensee, Der Dualismus von Staat und Gesellschaft, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, S. 317 (317).
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
131
„individuellen oder gruppenmäßigen Selbstentfaltung, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung“84, der „Bereich unorganisierter Selbstregulierung“85. Die Gesellschaft bleibt aber trotz ihrer Nicht-Staatlichkeit nicht ohne Bezug zum Staat und seiner Organisation, weil sich hier die öffentliche Meinung bildet, die in der Demokratie zum einen Einflussfaktor auf die organisierte Staatsgewalt, zum anderen der Ort der Vorformung des Volkswillens ist.86 Die Gesellschaft besteht zwar aus Individuen und ist von der grundrechtlichen Freiheit dieser Individuen geprägt,87 reicht aber in ihrer Bedeutung über deren Summe hinaus.88 Der Begriff der Gesellschaft bezeichnet damit nicht nur die Gruppe von Menschen, die auf deutschem Staatsboden leben, die deutsche Öffentlichkeit teilen und sich der Gesellschaft zugehörig fühlen, sondern ist die „staatstheoretische Chiffre für die Gesamtheit aller grundrechtsfähigen Rechtssubjekte und für den Raum, in dem sich ihre grundrechtlich-legitimierte Wirksamkeit öffentlich entfaltet“.89 Die Gesellschaft definiert sich nicht über eine formelle Zugehörigkeit, sondern über eine faktische. Sie umfasst alle Grundrechtsträger, die auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland leben. Sie ist damit nicht personenidentisch mit dem Volk, sondern umfasst einen größeren Personenkreis.90 Sie kann auch als das „unorganisierte Volk“ beschrieben werden.91 Als solche ist sie nicht das Subjekt, sondern das Objekt der Demokratie.92
2. Das Volk als pouvoir constituant Das Volk liegt der Verfassung bereits als verfassungsgebende Gewalt, als pouvoir constituant, voraus.93 Dies geht aus der Präambel hervor, die das „Deutsche Volk“ als 84 H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 26. 85 R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 146. 86 Hierzu auch unten in Abschnitt E. IX. 4., S. 172 f. 87 Dies hebt H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 27, hervor. 88 H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 49, sieht deshalb den grundrechtlichen Individualrechtsschutz als nicht hinreichenden Schutz der Gesellschaft vor staatlichen Übergriffen, weil er an die Person gebunden ist. 89 J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (166). 90 A. A.: W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (521, 522), der Begriff „Volk“ sei nur „Funktion“ der Gesellschaft (S. 523); ebenso R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 146. 91 E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986, S. 24. 92 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (753 Rn. 23); J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (166): „Die Gesellschaft ist nicht der Ursprung der Staatsgewalt, sondern ihr Wirkungsfeld.“ 93 Die Unterscheidung zwischen pouvoir constitué und pouvoir constituant geht zurück auf den Abbé Sieyès: so K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 182, Fn. 13, und
132
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Verfassungsgeber der aktuellen Verfassung beschreibt. Aufgrund dieser vorkonstitutionellen Existenz wird der Begriff des pouvoir constituant auch als verfassungsrechtlicher „Grenzbegriff“94 beschrieben. Das Volk als pouvoir constituant ist im Grundgesetz aber nicht nur der aktuellen Verfassung vorausgesetzt, sondern auch einer möglichen auf sie folgende. Für eine zukünftige Verfassungsordnung ist die verfassungsgebende Gewalt des Volkes in Art. 146 GG95 geregelt, der den Fortbestand des Grundgesetzes davon abhängig macht, dass das Volk als Verfassungsgeber sich nicht selbst eine neue Verfassung gibt, die es in freier Entscheidung beschlossen hat.96 Die Norm bezeichnet das Volk als „Grundgesetz-ablösende“97, verfassungsneuschaffende Gewalt. Das Volk ist damit vorkonstitutionell als Verfassungsgeber tätig, es hat die verfassungsgebende Gewalt inne. Es steht damit bereits vor der staatlichen Ordnung und ist deren Schöpfer.98 Im Akt der Verfassungsgebung handelt das Volk als Souverän,99 die Verfassungsgebung ist Ausdruck der ungebundenen Herrschaftsmacht des Volkes. Obwohl das Volk mit dem Akt der Verfassungsgebung die rechtliche Ordnung des Staates, in dem es lebt, erst schafft, wird das Volk in diesem Akt nicht als Nation, sondern schon als Volk eines existierenden Staates tätig.100 Der Begriff des Volkes in der Verfassungsgebung ist somit nicht ethnisch zu verstehen.101 Denn der Akt der Verfassungsgebung setzt seinerseits einen Staat voraus, in dem die zu schaffende Verfassung wirken kann. Die Verfassungsgebung ist damit vorkonstitutionell, aber nicht vorstaatlich. W. Heun, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 105. U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 240, sieht diese Unterscheidung als Behelfskonstruktion an, um Widersprüche bei der Einordnung des Volkes als Staatsorgan zu verdecken, ebenso wie die Unterscheidung zwischen Volk und Gesellschaft. 94 C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie?, JZ 2012, S. 1161 (1163); so auch schon der Titel der Monographie von E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986. 95 Der Art. 146 GG wird bisweilen für verfassungswidrig gehalten, weil er die pouvoir constituant verfassungsrechtlich zu binden versuche; so B. Kempen, Grundgesetz oder neue deutsche Verfassung?, NJW 1991, S. 964 (967). 96 Art. 146 GG ist damit Ausdruck der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes und nicht seiner verfassten Gewalt: M. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 67. Lfg. (Stand: Nov. 2012), Bd. VII, Art. 146 Rn. 25. 97 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 209. 98 D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 35; T. Maunz, in: ders./Dürig, GG-Kommentar, Präambel, Rn. 12. 99 D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 164 f.; E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 5; H. Dreier, in: ders., GGKommentar, Bd. II, Art. 20 Rn. 86. 100 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 29: „Die Vorstellung einer Nicht-Formiertheit der verfassungsgebenden Gewalt kann sich nur auf das Entscheidungsverfahren beziehen, nicht aber auf das verfassungsgebende Volk selbst“. 101 T. Maunz, in: ders./Dürig, GG-Kommentar, 29. Lfg. (Stand: Sep. 1991), Bd. I, Präambel, Rn. 25.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
133
Personell umfasst das verfassungsgebende Volk nicht nur die wahl- und abstimmungsberechtigten Deutschen,102 sondern das gesamte Volk.103 Ausgeübt wird die verfassungsgebende Gewalt aber durch den wahl- und abstimmungsberechtigten Teil des deutschen Volkes.104 Durch den adjektivischen Zusatz des „Deutschen“ Volkes hat die Präambel deutlich gemacht, dass hier die Gesamtheit der deutschen Staatsangehörigen gemeint ist. Das Volk unterliegt im Akt der Verfassungsgebung noch keiner positivrechtlichen Bindung, dennoch sind seiner verfassungsgebenden Gewalt Grenzen gesetzt.105 Im Akt der Verfassungsgebung kann das Volk, obwohl es staatlich formiert ist, nicht als Staatsorgan qualifiziert werden; eine staatliche Rechtsordnung, in die es organisationsrechtlich eingebettet sein könnte und aus der heraus ihm Aufgaben des Staates zugewiesen werden könnten, gibt es in diesem Moment gerade noch nicht. Lediglich der Staat, für den die Ordnung geschaffen wird, existiert in diesem Augenblick.106 Erst durch den Akt der Verfassungsgebung wird die staatliche Ordnung geschaffen, in der sich das Volk dann selbst einen Platz zumisst.
3. Das Volk als pouvoir constitué Das Volk steht aber auch innerhalb der staatlichen Ordnung und nimmt staatliche Funktionen wahr. Das Volk als Verfassungsgeber hat sich in die staatliche Ordnung, die es durch Verfassungsgebung geschaffen hat, selbst funktionell eingebettet.107 Dabei hat es sich zum Ausgangspunkt der Staatsgewalt, zum Souverän auch innerhalb der staatlichen Ordnung, erklärt, und sich damit eine herausgehobene Stellung innerhalb der Staatsorganisation geschaffen. Im Inneren der staatlichen Ordnung kann Souveränität jedoch nicht mehr als ungebundene Entscheidungsmacht verstanden werden; das Volk hat sich vielmehr selbst durch die Verfassung gebunden.108
102 So aber T. Maunz, in: ders./Dürig, GG-Kommentar, 29. Lfg. (Stand: Sep. 1991), Bd. I, Präambel, Rn. 25, der den Begriff nur aus diesem Grund nicht als ethnischen Begriff verstehen möchte. 103 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 26. 104 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 29. 105 T. Maunz, in: ders./Dürig, GG-Kommentar, 29. Lfg. (Stand: Sep. 1991), Bd. I, Präambel, Rn. 17, 18; zur Frage, inwieweit eine Bindung des pouvoir constituant besteht: D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 134 f., 176 f., 205 f.; W. Henke, Staatsrecht, Politik und verfassungsgebende Gewalt, Der Staat 19 (1980), S. 181 (210). 106 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (759 Rn. 37). 107 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (759 Rn. 38): „Die Demokratie ist Produkt einer autonomen Verfassungsentscheidung.“ 108 J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (164).
134
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Die souveräne Stellung des Volkes wird in Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG sichtbar, nach dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das Volk ist aber innerhalb der Staatsorganisation nicht nur Ausgangspunkt und damit Träger der Staatsgewalt, es übt diese gerade auch selbst aus (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG). Ohne die tatsächliche Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk könnte das Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht verwirklicht werden.109 Es bliebe bei einer bloß theoretischen Aussage über die Selbstherrschaft des Volkes. Erst durch praktische Handlungsmöglichkeiten des Volkes kann das Demokratieprinzip auch vollzogen werden, das Volk zum Regierenden über sich selbst werden. In Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG wird diese Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk beschrieben, nach dem die Staatsgewalt vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe ausgeübt wird. Das Grundgesetz unterscheidet damit die Trägerschaft und die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk klar.110 a) Das Volk als Träger der Staatsgewalt Nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Das Volk ist demnach Ursprung und Träger der Staatsgewalt und damit Legitimationssubjekt aller staatlichen Gewalt. Der Bezug auf das Volk als Träger der Staatsgewalt scheint zunächst mehr rechtsideeller denn rechtstatsächlicher Natur,111 denn Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG regelt keine Zuständigkeiten des Volkes, sondern enthält ein Legitimationsund Verantwortungsprinzip.112 Die Norm selbst macht nicht deutlich, wie diese Trägerschaft umgesetzt wird. Der Satz hat aber bereits normativen Inhalt im Hinblick auf das Volk: Dieses ist nur in seiner Gesamtheit Ausgangspunkt aller staatlichen Gewalt, nur das Volk als Ganzes kann Legitimation vermitteln, es ist „Legitimationseinheit“.113 Die Norm bringt damit zum Ausdruck, dass sie dem Volk als verfassungsrechtlicher Größe und nicht den einzelnen dahinterstehenden Personen Legitimationskraft beimisst.114 Mit anderen Worten: Die Staatsgewalt geht vom 109
Rn. 8.
E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24
110 J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 40; F. Klein, in: von Mangoldt/ders., GG-Kommentar, Bd. I, 1957, Art. 20 Anm. V. 4. d), S. 595; M. Kriele, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL, 29 (1970), S. 46 (60); ähnlich W. Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, 1992, S. 27. 111 F. Klein, in: von Mangoldt/ders., GG-Kommentar, Bd. I, 1957, Art. 20, Anm. V. 4. b), S. 595. 112 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 39. 113 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 27; BVerfGE 83, 37 (51) – Ausländerwahlrecht (Schleswig-Holstein), Urteil vom 31. 10. 1990; M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 205. 114 Zur Kritik an dieser „monistischen“ Legitimationstheorie siehe B.-O. Bryde, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie; Staatswissenschaft und Staatspraxis 1994, S. 305 (322); ders., Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes als Opti-
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
135
Volke als Gesamtheit und nicht von den einzelnen Menschen aus.115 Sie spricht damit auch innerhalb des Volkes stehenden Gruppen, die nicht das Volk in seiner Gesamtheit repräsentieren, jegliche Legitimationskraft ab; auch können außerhalb des Volkes stehende Personen der Staatsgewalt keine Legitimation vermitteln.116 Damit wird die Frage bedeutend, wen das Volk des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG personell umfasst. Hierüber gibt die Funktion des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG Aufschluss. Die Norm beschreibt den Ausgangspunkt staatlicher Gewalt innerhalb der staatlichen Ordnung und damit auch dessen personales Substrat. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG muss somit notwendig das Gesamtvolk meinen,117 also die Gesamtheit der Staatsangehörigen.118 Denn nur diese als Gesamtheit sind als politische Schicksalsgemeinschaft der Bezugspunkt der Demokratie und damit Träger der Staatsgewalt.119 Art. 20 Abs. 1 S. 1 GG ist damit nicht nur Ausdruck des Demokratieprinzips, sondern auch des Nationalstaatsprinzips.120 mierungsaufgabe, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Demokratie und Grundgesetz, S. 59 (59 ff.), m. w. N. in Fn. 3. 115 J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (166); K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 186. Dass dies schon von den Verfassungsschöpfern vorausgesetzt wurde, zeigt die Äußerung von Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat in der 20. Sitzung des Grundsatzausschusses am 10. 11. 1948 (abgedruckt in: Der Parlamentarische Rat, Akten und Protokolle, Ausschuß für Grundsatzfragen, Bd. 5/II, S. 526 f..), dass „das konkret lebende Volk, die Summe der jeweils lebenden einzelnen Deutschen“ „die letzte Quelle der irdischen Gewalt im Staate“ sei; a. A. P. Häberle, Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 22 Rn. 65: Das Volk bestehe aus Bürgern, aus Grundrechtsträgern, von denen letztlich die Staatsgewalt ausgehe; ähnlich A. Rinken, Demokratie und Hierarchie, in: Demokratie und Grundgesetz, S. 125 (136); kritisch auch T. Groß, Postnationale Demokratie – Gibt es ein Menschenrecht auf transnationale Selbstbestimmung?, Rechtswissenschaft 2011, S. 125 (135); wohl auch A. Epiney, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 (563); jedenfalls missverständlich auch BVerfGE 118, 277 (353) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007: „die im Wahlakt liegende Willensbetätigung des einzelnen Bürgers als Ursprung der Staatsgewalt“. Auch J. Habermas, Zur Prinzipienkonkurrenz von Bürgergleichheit und Staatengleichheit, Der Staat 53 (2014), S. 167 (183), sieht nur Individuen, nicht aber das Volk als Kollektiv als Zurechnungssubjekt von Rechten als fähig an, Träger von Rechten zu sein, und stellt zur Begründung darauf ab, dass „moderne Verfassungssysteme auf Grundrechten [auf]bauen“, was allerdings nur eine Vernachlässigung des organisationsrechtlichen Teils der Verfassung zeigt. 116 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 160. 117 F. Klein, in: von Mangoldt/ders., GG-Kommentar, Bd. I., 1957, Art. 20 Anm. V. 4. d), S. 595. 118 B. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 57. Lfg. (Stand: Jan. 2010) Art. 20 Rn. 78; K. P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2; Rn. 148; eine umfangreiche Prüfung dieser Gegebenheit findet sich bei M. Birkenheier, Wahlrecht der Ausländer, S. 75; M. Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. I, 2011, § 7 II Rn. 85; K. A. Lamers, Repräsentation und Integration der Ausländer, 1977, S. 33. 119 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 26, der allerdings nicht zwischen dem Volk des Satzes 1 und des Satzes 2 des Art. 20 Abs. 2 GG differenziert. 120 A. Bleckmann, Das Nationalstaatsprinzip im Grundgesetz, DÖV 1988, S. 437.
136
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Die Zugehörigkeit zum Staatsvolk wird durch die Staatsangehörigkeit vermittelt.121 Die Staatsangehörigkeit knüpft das rechtliche Band zwischen dem Staat und seinem Angehörigen, das diesen auch der Hoheitsgewalt des Staates nicht nur in ihrer territorialen, sondern auch in ihrer personalen Dimension unterwirft.122 Dem Staatsangehörigkeitsrecht kommt die Funktion zu, über die Zugehörigkeit zum Staatsvolk zu bestimmen. Anders als in der Präambel verwendet das Grundgesetz allerdings in diesem Zusammenhang den Volksbegriff ohne adjektivischen Zusatz und spricht schlicht vom Volk. Gerade aus diesem Verzicht auf den Staatsangehörigkeitsbezug wird zum Teil auch gefolgert, dass das Volk des Art. 20 Abs. 2 GG nicht das Volk im Sinne der Staatsangehörigkeit meine, sondern „die Bevölkerung“, also alle, die auf deutschem Hoheitsgebiet leben und dadurch von den politischen Entscheidungen in der Bundesrepublik nachhaltig beeinflusst werden und damit eine „Lebens- und Schicksalsgemeinschaft“ bilden.123 Diese Interpretation wird meist herangezogen, um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines Wahlrechts für Ausländer zu begründen.124 Sie versucht, den Kreis der an der Staatsgewalt Berechtigten an der „Betroffenheit“ durch diese festzumachen.125 Mit einer solchen Betrachtung löst sie die Demokratie aber vom Volk als rechtliche Größe und stützt sich gerade auf den Personenkreis, der die nicht-rechtliche, vagere Größe der Gesellschaft ausmacht. Diese umfasst aber auch Personen, die sich der Staatsgewalt ohne weiteres entziehen können, weil sie bei Ausreise aus dem Staat weder der Personal- noch der Territorialgewalt des Staates unterstehen würden. Sie bilden damit gerade keine Schicksalsgemeinschaft mit den Staatsangehörigen. Der in Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG gemeinte Personenkreis findet deshalb seine äußere Grenze im Kreis der Staatsangehörigen. Die entsprechende Norm der Weimarer Reichsverfassung, Art. 1 Abs. 2 WRV, die dem heutigen Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG beinahe wortidentisch war,126 meinte mit dieser
121
BVerfGE 83, 37 (51) – Ausländerwahlrecht, Urteil vom 31. 10. 1990; R. Zippelius/ T. Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, 2008, § 4 Rn. 1. 122 R. Grawert, Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft, Der Staat 23 (1984), S. 179 – 204. 123 M. Zuleeg, Menschen zweiter Klasse?, DÖV 1973, S. 361 (363); ders., Grundrechte für Ausländer, DVBl. 1974, S. 341 (347, 348); B.-O. Bryde. Ausländerwahlrecht und grundgesetzliche Demokratie, JZ 1989, S. 257 (260); H. Meyer, Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 7 ff. 124 Erst seit Aufkommen dieser Diskussion widmen sich Literatur und Rechtsprechung dem Volksbegriff des Grundgesetzes intensiver, weil diese These erst hiermit rechtfertigungsbedürftig wurde. So auch M. Birkenheier, Wahlrecht für Ausländer, 1976, S. 23. 125 Kritik an dieser „Betroffenheitsdemokratie“ übt J. Isensee, Schriftsatz für die CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, in ders./Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, S. 25; dagegen auch E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungslegitimation als Rechtsbegriff, AöR 116 (1991), S. 329 (348). 126 Er lautete: „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
137
Formulierung hingegen nur den mit dem Wahlrecht ausgestatteten Teil des Volkes.127 Dies ist damit zu erklären, dass die WRV eine dem Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG entsprechende Norm, die die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk regelt, nicht kannte, und so in die Norm auch die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk hineingelesen werden musste. Trotz des gleichen Wortlauts ist die grundgesetzliche Norm deshalb ohne diese Einschränkung zu interpretieren: Träger der Staatsgewalt in der grundgesetzlichen Ordnung ist das gesamte deutsche Volk128 – unabhängig von der Wahlberechtigung der einzelnen Staatsangehörigen. Souverän ist das gesamte Staatsvolk, nicht die Mehrheit des Volkes oder gar der einzelne Wähler.129 b) Das Volk in der Ausübung von (innerstaatlicher) Staatsgewalt: die Aktivbürgerschaft Art. 20 Abs. 2 GG beschreibt in seinem Satz 2 demgegenüber die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk. Das Volk übt demnach in Wahlen und Abstimmungen unmittelbar Staatsgewalt aus.130 Wahlen und Abstimmungen stellen sich dabei als konkrete Handlungsformen des Volkes dar. Die Norm enthält damit „latente Kompetenzen“ des Volkes, aus denen noch nicht hervorgeht, in welchen konkreten Fällen das Volk zu handeln berechtigt ist, und die deshalb noch der näheren Konkretisierung bedürfen.131 Wenn auch der Satz 2 des Art. 20 Abs. 2 GG die Kompetenzen des Volkes noch nicht abschließend nennt, enthält er doch einen Numerus clausus der
127
Zur Interpretation des Begriffs „Volk“ in Art. 1 Abs. 1 WRV: M. Birkenheier, Wahlrecht der Ausländer, S. 23; und M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 130, Fn. 534; D. Breer, Die Mitwirkung von Ausländern an der politischen Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland, 1982, S. 63; jeweils m. w. N. 128 Differenzierend hinsichtlich der Souveränität als Eigenschaft des Volkes: K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 186. 129 Fehlgeht deshalb die Aussage von A. Greifeld, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit des Abgeordneten, Der Staat (1984), S. 501 (505), der Wähler finde sich neben dem freien Mandat des Abgeordneten „in eine Stellung gerückt, die seiner Stellung als demokratischer Souverän nicht entspricht.“; ders., Zur Entstehung des Staatswillens aus dem Bürgerwillen, in: Marko/Stolz (Hrsg.), Demokratie und Wirtschaft, S. 123 (133), spricht auch von „Wählersouveränität“. 130 R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 27; a. A. M. Kriele, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL, 29 (1970), S. 46 (60), nach dem alle Staatsgewalt durch besondere Organe ausgeübt wird (Hervorhebung im Original). 131 Um echte Kompetenztitel handelt es sich indes nicht. Es bedarf hierfür einer konkreten Zuweisung von Kompetenzen. Lediglich die Handlungsformen des Volkes sind in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG beschrieben. A. A. C.-H. Obst, Chancen direkter Demokratie, 1986, S. 254, der Art. 20 Abs. 2 GG als unabhängige, neben Art. 76 ff. GG stehende Kompetenznorm sieht; ähnlich C. Pestalozza, Der Popularvorbehalt, 1981, S. 12, der die Zuständigkeiten des Volkes „weder enumeriert noch limitiert“ sieht.
138
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Handlungsformen des verfassungsimmanenten Volkes.132 Das Volk kann die Staatsgewalt unmittelbar nur durch Wahlen und Abstimmungen ausüben. Dies ergibt sich daraus, dass sich das Personalpronomen „[s]ie“ auf die in Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG genannte „alle Staatsgewalt“ bezieht.133 Dieser Bezug macht deutlich, dass der Satz 2 abschließend regelt, wie die Staatsgewalt ausgeübt wird. Sie wird zum einen unmittelbar durch das Volk in den vorgesehenen Handlungsformen ausgeübt; zum anderen durch besondere Organe, für die das Grundgesetz keine Beschränkung hinsichtlich ihrer Handlungsformen vorsieht, sondern sie lediglich insofern determiniert, als sie einer der drei Gewalten zugeordnet werden müssen.134 Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG zeigt damit die Beschränkung des Volkes in seiner Funktion als pouvoir constitué auf die in der Verfassung vorgesehenen Handlungsformen auf. Das Volk besitzt innerhalb der staatlichen Ordnung keine Allzuständigkeit, sondern ist selbst an die Kompetenzordnung des Grundgesetzes und die dort vorgesehenen Handlungsformen gebunden.135 Zugleich kann erst durch die Schaffung von konkreten Handlungsformen das Volk die ihm in Satz 1 zugewiesene Staatsgewalt auch praktisch ausüben. Dies bildet den Zusammenhang zwischen den beiden Sätzen. Ohne Regelungen über die Ausübung der staatlichen Gewalt liefe auch seine Trägerschaft ins Leere. Auf diese Weise wird durch den Satz 2 auch das Demokratieprinzip verwirklicht. Ebenso wie die Funktionen sich unterscheiden, die das Volk in den beiden Sätzen des Art. 20 Abs. 2 GG erfüllt, – zum einen als Zurechnungssubjekt aller Staatsgewalt,136 zum anderen als deren Ausübender – aber dennoch miteinander in Verbindung stehen, verhält sich auch das jeweilige personelle Substrat, das in beiden Sätzen mit dem Begriff „Volk“ bezeichnet ist, zueinander: es ist nicht identisch,137 steht aber doch miteinander in engem Zusammenhang. Der Volksverband als solcher ist nicht 132 H. Grefrath, Exposé eines Verfassungsprozessrechts von den Letztfragen?, AöR 135 (2010), S. 221 (240), spricht von einem „besonderen Bestimmtheitsgrundsatz“ für „Volkes Stimme“. 133 So auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 92. 134 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 92, spricht von einem „Numerus clausus der Ausübung von Staatsgewalt“, die sich aufteile in Wahlen, Abstimmungen, Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. 135 U. Steiner, Verfassungsgebung und verfassungsgebende Gewalt des Volkes, 1966, S. 190; dagegen aber C. Pestalozza, Der Popularvorbehalt, 1981, S. 12, in Art. 20 Abs. 1-3 GG sei eine „Generalvollmacht des Volkes“ angelegt, das Volk habe eine uneingeschränkte „Personal- und Sachkompetenz“. 136 K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2 Rn. 148. 137 G. Robbers, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 165. Lfg. (Stand: Jan. 2014), Bd. V, Art. 20 Abs. Rn. 3026; A. Janssen, Die verfassungsrechtliche Bedeutung des Volkswillens für die Legitimation der Staatsgewalt, DÖV 2010, S. 949 (949); a. A. S. Huster/J. Rux, in: Epping/Hillgruber, GG-Kommentar, Art. 20 Rn. 66, die den Zweck der Unterscheidung der Volksbegriffe in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG nur darin sehen, den Widerspruch aufzulösen, dass tatsächlich nur die Wahlberechtigten in Wahlen und Abstimmungen die Staatsgewalt ausüben.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
139
zur Ausübung der Staatsgewalt berufen – nur derjenige Teil des Volkes, der mit dem Wahl- und Stimmrecht ausgestattet ist, ist befugt, die Staatsgewalt, die dem Volk als Ganzem zusteht, in Wahlen und Abstimmungen auch tatsächlich auszuüben. Während Satz 1 die Gesamtheit der Staatsangehörigen anspricht, meint Satz 2 nur denjenigen Teil der Staatsangehörigen, der wahlberechtigt ist.138 Die Begriffe sind also nur teilidentisch.139 Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass das in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG gemeinte Volk ein Teil des in Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG beschriebenen Volkes ist und seine Grenzen in dessen Personenverband, also im Kreis der Staatsangehörigen, findet. Dieser zur Ausübung der Staatsgewalt berufene Teil des Volkes, der sich auch als der „organisierte Teil des Volkes“140 bezeichnen lässt, wird dabei als „Aktivbürgerschaft“141, bisweilen auch als „Aktivvolk“142 oder „Staatsbürgervolk“143 bezeichnet, weil er denjenigen Teil des Volkes beschreibt, der nicht nur als passiver Ausgangspunkt der Staatsgewalt dient, sondern aktiv Ausübender derselben ist.144 Die Diskrepanz zwischen der Zahl der Wahlberechtigten und den tatsächlich Wählenden145 könnte es nahelegen, auch nur jenen Teil des Volkes als Aktivbür138 D. Breer, Die Mitwirkung von Ausländern an der politischen Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland, 1982, S. 63; K. A. Lamers, Repräsentation und Integration der Ausländer, 1977, S. 33. 139 J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 40; R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 31, spricht von einer „Immanenzverbindung“; a. A. A. Bleckmann, Das Nationalstaatsprinzip im Grundgesetz, DÖV 1988, S. 437 (439): es könne schwerlich davon ausgegangen werden, dass der Volksbegriff in diesen beiden Sätzen ein unterschiedlicher ist. Allerdings liegt der Impetus dieser Aussage darauf, dass in beiden Sätzen der Volksbegriff jedenfalls durch die Staatsangehörigkeit begrenzt ist, was der hier vertretenden Meinung entspricht. 140 E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986, S. 22. 141 Z. B. von D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 59; I. Ebsen, Abstimmungen des Bundesvolkes als Verfassungsproblem, AöR 110 (1985), S. 2 (6); K. Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991, S. 356; E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt, S. 23; D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 (27); W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, Teil I, Rn. 10, S. 31; R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 29; K. A. Lamers, Repräsentation und Integration der Ausländer, 1977, S. 33. 142 F. Müller, Wer ist das Volk?, 1997, S. 23. 143 H. Liermann, Das deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichsstaatsrecht der Gegenwart, S. 140; K. Kind, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie, 1955, S. 29. 144 Die Aktivbürgerschaft konstituiert sich dabei zwar aus den Wahlberechtigten, indem Art. 38 Abs. 2 GG nur den Kreis der Wahlberechtigten, nicht aber die Aktivbürgerschaft explizit definiert. Rechtstheoretisch leitet sich das Wahlrecht aber aus der Zugehörigkeit zur Aktivbürgerschaft her; so auch K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323. 145 Diese Gruppen klaffen immer weiter auseinander. So lag die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen 2009 bei 70,8 %, 2013 bei 71,5 %, während sie bis zu den Bundestagswahlen 2005 stetig bei über 75 % lag, zwischen 1953 und 1983 sogar bei über 85 %. Ihren Höchststand hatte sie 1972: Bei den damals stattfindenden Wahlen gaben 91,1 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Quelle: „Ergebnisse früherer Bundestagswahlen“ S. 20 f., veröffentlicht durch den
140
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
gerschaft zu bezeichnen, der von den Rechten auch tatsächlich Gebrauch macht.146 Dies würde jedoch dazu führen, die Zugehörigkeit zu einem Staatsorgan vom Handeln seiner potentiellen Mitglieder abhängig zu machen. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verleiht aber als „latente Kompetenznorm“ demjenigen Teil des Volkes die Kompetenz und damit das Recht zur Ausübung der Staatsgewalt, der gemäß Art. 38 Abs. 2 GG wahlberechtigt ist. Alle Kompetenzinhaber sind somit zum Organteil bestellt, unabhängig davon, ob sie von der Kompetenz Gebrauch machen. Als Aktivbürgerschaft ist deshalb die Gruppe der Wahlberechtigten, nicht aber der tatsächlich Wählenden zu bezeichnen. Die Aktivbürgerschaft handelt im Namen des gesamten Volkes und repräsentiert dieses,147 seine Handlungen werden dem Gesamtvolk als Träger der Staatsgewalt als eigene zugerechnet.148 Die Aktivbürgerschaft übt also die dem Volk (als Gesamtheit der Staatsangehörigen) zustehende Staatsgewalt aus.149 Die Volksbegriffe des Art. 20 Abs. 2 S. 1 und 2 GG weisen also nicht nur funktionelle Unterschiede auf, sondern auch personelle.150 Wenn auch eine echte „Doppelung des Volksbegriffes“151 nicht vorliegt, weil hier nicht zwei völlig unterschiedliche Personengruppen bezeichnet sind, sondern der eine Begriff dem anderen innewohnt, ist der Unterschied entscheidend. Er wird jedoch aufgrund der Nähe der beiden Begriffe oftmals nicht deutlich genug hervorgehoben. Es wird sich vielmehr darauf konzentriert, das Volk des Art. 20 Abs. 2 GG gegen einen sich aus der Hoheitsunterworfenheit ableitenden, ausufernden Volksbegriff abzugrenzen und Bundeswahlleiter, Stand: 18. 8. 2017, abrufbar unter https://www.bundeswahlleiter.de ! Bundestagswahl ! Publikationen ! Heft: Ergebnisse früherer Bundestagswahlen (aufgerufen am 19. 3. 2018). 146 So – vielleicht auch nur uneindeutig formuliert – F. Klein, in: von Mangoldt/ders., GGKommentar, Bd. I, 1957, Art. 20 Anm. V. 4 d), S. 595. 147 D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt nach dem Grundgesetz, 1978, S. 203; H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (772 Rn. 67); J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 40; N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 200. 148 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207; H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetz, Jura 1997, S. 249 (251); H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (772, Rn. 67). Dies bestätigt das Bundesverfassungsgericht, wenn es die Wahlkreise grundsätzlich nach der Zahl der Wahlberechtigten und nicht nach der Wohnbevölkerung zugeschnitten wissen will, BVerfGE 130, 212 (229) – Wahlkreiseinteilung, Beschluss vom 31. 1. 2012. 149 D. Murswiek, Die verfassungsgebende Gewalt, 1978, S. 59; andeutungsweise E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986, S. 23; K. G. Wernicke, in: Bonner Kommentar zum GG, Erstbearbeitung, Art. 20 II. 2. b). 150 I. Rupprecht, Das Wahlrecht für Kinder, 2012, S. 106, hält dies nicht für „zwingend erforderlich“. 151 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 206; jedenfalls zeigt sich hier aber auch die Doppelrolle des Volkes als Träger der Staatsgewalt und als deren höchstes Subjekt: S. Haack, Verlust der Staatlichkeit, 2007, S. 297.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
141
zu verteidigen und dabei den Volksbegriff in beiden Absätzen als Gesamtheit der Staatsangehörigen zu definieren.152 Wird diese Unterscheidung aber vernachlässigt, erscheint das Volk in Trägerschaft und Ausübung der Staatsgewalt personell identisch. Dies ist deshalb problematisch, weil damit einhergehend die im Grundgesetz angelegte funktionelle Unterscheidung der Volksbegriffe in beiden Sätzen nicht zur Geltung kommt.153 c) Künstliches Auseinanderfallen von Volk und Aktivbürgerschaft aufgrund der unzureichenden Verwirklichung des Grundsatzes der allgemeinen Wahl? Der personelle Unterschied von Aktivbürgerschaft und Gesamtvolk könnte auf eine unzureichende Umsetzung des Prinzips der allgemeinen Wahl zurückzuführen sein. Lediglich die funktionelle, nicht aber personelle Unterscheidung zwischen Gesamtvolk und Aktivbürgerschaft wäre dann in der Verfassung angelegt. Das die Staatsgewalt ausübende Volk, die Aktivbürgerschaft, würde dann mit dem Volk als Inhaber der Staatsgewalt personell übereinstimmen. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl, der in Art. 38 Abs. 1 GG verankert ist, verbürgt, dass grundsätzlich jeder Staatsbürger sowohl aktiv als auch passiv wahlberechtigt sein soll.154 Würde der Grundsatz ohne Einschränkungen umgesetzt, ergäbe sich hieraus eine personelle Identität zwischen der Aktivbürgerschaft des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG und dem Gesamtvolk des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG. Jeder, der als Staatsangehöriger zum Volk gehört, wäre automatisch berechtigt, an der Ausübung der Staatsgewalt als Teil der Aktivbürgerschaft teilzunehmen. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl gilt jedoch nicht absolut und uneingeschränkt.155 Die Verfassung selbst beschränkt in Art. 38 Abs. 2 GG die Wahlberechtigung ausdrücklich auf Personen über achtzehn Jahren und sieht damit bereits eine verfassungsimmanente Einschränkung des Grundsatzes vor. Der Grundsatz der 152 So z. B. H. Dreier, in: ders., GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 (Demokratie) Rn. 94 f.; K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2; Rn. 148 f., H. Maurer, Staatsrecht I, 2010, § 7 Rn. 22. 153 So z. B. E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 26, der die Trägerschaft und Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk in einem Atemzug nennt und dabei auch nicht zwischen den beiden Sätzen des Art. 20 Abs. 2 GG unterscheidet, obwohl er Trägerschaft und Ausübung an anderer Stelle (Fn. 8) klar unterscheidet. K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2, Rn. 149, bezeichnet dementsprechend das Volk des Art. 20 Abs. 2 S. 1 als „Staatsorgan“. 154 Statt aller: N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 121. 155 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 121 f.; allerdings werden zwingende Gründe zu seiner Einschränkung überwiegend für erforderlich gehalten. Hierzu M. Breuer, Verfassungsrechtliche Anforderungen an das Wahlrecht der Auslandsdeutschen, 2001, S. 109, m. w. N. in Fn. 526.
142
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
allgemeinen Wahl ist also per se eingeschränkt zu interpretieren.156 Aber auch die Funktion der Wahl lässt Einschränkungen hinsichtlich des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl zu. Im Lichte dessen, dass bei der Wahl verbindliche Entscheidungen getroffen werden, lässt sich auch der Grundsatz der allgemeinen Wahl verstehen: Nur wer tatsächlich in der Lage ist, eine ernstliche Entscheidung zu treffen, kann auch wahlberechtigt sein.157 Ein Auseinanderfallen der Gesamtheit des Volkes und des wahlberechtigten Teils des Volkes ist also in der Verfassung vorgesehen. Diese personelle Unterscheidung zwischen Volk und Aktivbürgerschaft unterstreicht zugleich die funktionelle Unterscheidung von beiden im Grundgesetz. Das Volk als Souverän hat sich damit nicht nur selbst innerstaatlich zum Ausgangspunkt der staatlichen Gewalt gemacht. Es hat auch sein eigenes Handeln auf diejenigen verlagert, denen es die Ausübung von Staatsgewalt geistig zutraut und damit den aktiv berechtigten Teil seiner selbst zum Handelnden für sich selbst gemacht. Ist im Folgenden vom „Volk“ die Rede, ist das Volk im Sinne des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, die Aktivbürgerschaft, gemeint, wenn der Begriff nicht ausdrücklich anders verwendet wird. d) Das Volk in Wahlen Als eine der Handlungsformen des Volkes sind gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG Wahlen vorgesehen.158 Wahlen sind im Gegensatz zu Abstimmungen, die Sachentscheidungen zum Gegenstand haben,159 Entscheidungen über die Besetzung von Organen mit Personen.160 Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG selbst gibt keine Auskunft über die konkrete Ausgestaltung der Wahlen, er legt nicht einmal fest, welches Organ das Volk zu wählen hat. Eine Konkretisierung dieser Norm findet sich erst in Art. 38 GG, der die Wahl speziell zum Deutschen Bundestag regelt.161 Dieser nimmt zwar nicht 156 T. Spies, Die Schranken des allgemeinen Wahlrechts, S. 7, bezeichnet es als „selbstverständlich, daß nicht jeder wählen darf“, und somit der Grundsatz der allgemeinen Wahl Einschränkungen enthält; jede Einschränkung bedarf entgegenstehender Gründe, so H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 88; N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 103. 157 Hierbei werden aufgrund der großen Zahl von Personen, die von den Regelungen über die Wahlberechtigung betroffen sind, Pauschalierungen des Gesetzgebers notwendig. 158 K. Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991, S. 113. 159 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 1, S. 13; K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2, Rn. 161. 160 M. Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. I, 2011, § 7 II Rn. 92; zu den weiteren Unterschieden zwischen Wahlen und Abstimmungen K. Engelken, Der Bürgerentscheid im Rahmen des Verfassungsrechts, DÖV 2002, S. 977 (979 ff.). 161 BVerfGE 44, 125 (138) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3. 1977; BVerfGE 47, 253 (272) – Gemeindeparlamente NRW, Beschluss vom 15. 2. 1978.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
143
ausdrücklich Bezug auf Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, die Wahl des Deutschen Bundestag ist jedoch eine Ausprägung der in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG umschriebenen Wahlen. Zugleich beschränkt sich die „Wahlkompetenz“ des Volkes auf die Wahl des Bundestages, weil andere Wahlen durch das Volk im Grundgesetz nicht vorgesehen sind. Der Begriff des Volkes findet zwar in Art. 38 GG keine Erwähnung, durch die implizite Anknüpfung an Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG ist jedoch determiniert, dass es nur das dort gemeinte Volk sein kann, das den Bundestag wählt. Gleichzeitig legt Art. 38 GG in seinem Absatz 2 den Kreis der Aktivbürgerschaft des Art 20 Abs. 2 S. 2 GG erst fest. Er kann deren Grenzen nur innerhalb der Grenzen des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG ziehen, auch wenn er selbst nur eine Altersuntergrenze für die Wahlberechtigung festlegt, nicht aber eigens Bezug auf die Staatsangehörigkeit nimmt. Der Artikel kann also nur Staatsangehörige in den Kreis der Wahlberechtigten einbeziehen, weil der Kreis derjenigen, die die Staatsgewalt tatsächlich ausüben, nicht weiter sein kann als der Kreis derjenigen, die gemeinsam Träger der Staatsgewalt sind. Umgekehrt konkretisiert Art. 38 Abs. 2 GG damit Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, indem er den Kreis der Wahlberechtigten absteckt und damit die Aktivbürgerschaft definiert. Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG und Art. 38 GG stehen auf diese Weise in einer Wechselbeziehung zueinander.162 Die Besonderheit der Ausübung der Staatsgewalt durch die Aktivbürgerschaft in Wahlen besteht darin, dass durch diese Ausübung von Staatsgewalt den übrigen Staatsorganen Legitimation zur weiteren Ausübung von Staatsgewalt im Namen des Volkes vermittelt wird. Indem das Volk den Bundestag wählt, setzt es eine Legitimationskette163 in Gang, die sich auf alle Organe, die Staatsgewalt ausüben, erstrecken muss.164 Das Volk ist dabei das erste Glied dieser Legitimationskette.165 Die Notwendigkeit von Wahlen ist damit unmittelbare Konsequenz des Demokratieprinzips.166 Dieses macht die Wahlen für die Staatsorganisation zur notwendigen 162 BVerfGE 123, 267 (331) Lissabon – Urteil vom 30. 6. 2009, hier allerdings zum Wechselbezug zwischen Art. 38 Abs. 1 S. GG und Art. 20 Abs. 1 und 2 GG. Der Wechselbezug zwischen Art. 38 GG und Art. 20 Abs. 2 GG besteht nicht nur in personeller Hinsicht, auch inhaltlich gestaltet Art. 38 GG das Demokratieprinzip des Art. 20 GG aus, insbesondere durch die in Art. 38 Abs. 1 S. 1 enthaltenen Wahlgrundsätze. So auch M. Birkenheier, Wahlrecht für Ausländer, 1976, S. 20: „Wahlrecht und Staatsform bedingen einander“. 163 Der Begriff der Legitimationskette wurde entwickelt von E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR Bd. I, 1987, § 22, Rn. 11; ebenso ders., in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Demokratie und Grundgesetz, S. 8 (10); in der 3. Aufl. des HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 11, spricht er dann nur noch „effektive[r] demokratische[r] Legitimation“. 164 BVerfGE 47, 253 (257) – Gemeindeparlamente NRW, Beschluss vom 15. 2. 1978; BVerfGE 44, 125 (138). W. Schmitt Glaeser, Partizipation an Verwaltungsentscheidungen VVDStRL 31 (1973), S. 179 (215), spricht von der „über das institutionalisierte Verfahren der Volkswahl zu knüpfende[n] Legitimationskette“. 165 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 362, beschreibt das Volk lediglich als „Impulsgeber“ für die Ausübung der staatlichen Gewalt. 166 C. Starck, Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: HStR, Bd. III, 2005, § 33 Rn. 32.
144
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Bedingung: Sie müssen zur vorgeschriebenen Zeit stattfinden und zu einem Ergebnis führen.167 Denn erst der Wahlakt schafft den Legitimationszusammenhang zwischen den besonderen Staatsorganen und dem Volk. Erst auf diese Weise wird es möglich, dass Staatsgewalt durch jemand anderen als seinen Träger, das Volk, ausgeübt wird. In Wahlen hingegen „erschöpft“ sich die Ausübung von Staatsgewalt in diesem Kreations- und Legitimationsvermittlungsvorgang. Das Volk tritt den Normunterworfenen nicht selbst gegenüber, die Wirkung der von ihm ausgeübten Staatsgewalt verbleibt innerhalb der Staatsordnung. Diese Beschränkung auf die Ausübung staatlicher Gewalt durch Legitimationsvermittlung auf die anderen Staatsorgane hat es jedoch durch seine Einbettung in das Verfassungsgefüge selbst herbeigeführt. Es wäre durch eine Neuordnung des Verfassungsgefüges jederzeit in der Lage, diese Selbstbeschränkung aufzuheben.168 e) Das Volk in Abstimmungen Das Grundgesetz sieht in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG als Handlungsform des Volkes neben Wahlen auch Abstimmungen vor. In Abstimmungen als Entscheidungen über Sachfragen169 werden inhaltliche Entscheidungen getroffen, die gegenüber den Normunterworfenen unmittelbare Wirksamkeit entfalten. Konkretisierungen dieser Handlungsform finden sich im Grundgesetz jedoch kaum. Lediglich Art. 29 GG sieht im Fall der Neugliederung des Bundesgebietes einen Volksentscheid in denjenigen Ländern vor, die von der Neugliederung betroffen sind.170 Ob es sich hierbei allerdings um Abstimmungen i. S. d. Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG handelt, ist umstritten,171 weil Art. 29 GG nicht Abstimmungen des gesamten Bundesvolkes vorsieht, sondern lediglich Abstimmungen der von einer Neugliederung betroffenen Landesvölker. Im Übrigen kennt das Grundgesetz für die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG vorgesehenen Abstimmungen jedenfalls keinen Anwendungsfall. Die Demokratie des Grundgesetzes ist de constitutione lata rein repräsentativ ausgestaltet. Auch wenn Abstimmungen des (Bundes-)Volkes in der Verfassung nicht vorgesehen sind, wären sie aber 167 K. Engelken, Der Bürgerentscheid im Rahmen des Verfassungsrechts, DÖV 2002, S. 977 (980). 168 Anders müsste dies wohl E.-W. Böckenförde sehen, der die mittelbare Demokratie als einzig praktisch mögliche Demokratieform betrachtet. Siehe hierzu E.-W. Böckenförde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie, in Müller (Hrsg.) Festschrift für Eichenberger, S. 301 (306 – 313). 169 E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungslegitimation als Rechtsbegriff, AöR 116 (1991), S. 329 (354); K. Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991, S. 113, definiert Abstimmungen negativ als „alle Akte, die nicht Wahlen sind“. 170 Eine Ausnahme hierzu bildet wiederum Art. 118 GG. 171 Dagegen: H. Dreier, in: ders., GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 (Demokratie) Rn. 104; I. Ebsen, Abstimmungen des Bundesvolkes als Verfassungsproblem, AöR 110 (1985), S. 2 (8); K. Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991, S. 117 ff.; S. Blasche, Die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung, 2006, S. 101.
V. Die unterschiedlichen Rollen des Volkes im Grundgesetz
145
jedenfalls durch Verfassungsänderung einführbar,172 weil sie gerade in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG als Handlungsform des Volkes vorgesehen sind. Sie würden sich dann innerhalb der angelegten Kompetenzen des Volkes halten.173 Auch wenn das Handeln des Bundesvolkes in Abstimmungen keinen Anwendungsfall hat, kann es damit aber jedenfalls aus theoretischer Sicht rechtlich eingeordnet werden. Als Parallelfall kann das Handeln der Landesvölker in Abstimmungen betrachtet werden. Dieses ist im Gegensatz zum Grundgesetz in allen Landesverfassungen explizit vorgesehen.174 Das jeweilige Verfahren ergibt sich aus den verfassungsrechtlichen Regelungen in Verbindung mit besonderen Ausführungsgesetzen.175 Da die verfassungsrechtliche Ordnung in den Ländern nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch den Grundsätzen der Demokratie im Sinne des Grundgesetzes entsprechen muss, ist die Stellung der Landesvölker im Land bei der Ausübung von Staatsgewalt mit der Stellung des Bundesvolkes im Bund vergleichbar. Entscheidet das Volk im Wege eines Volksentscheids, einer Abstimmung, über einen Gesetzentwurf, wird es selbst als Gesetzgeber tätig. Auch das Abstimmungsrecht ist eine Kompetenz.176 Bei Abstimmungen zeigt sich noch deutlicher als bei Wahlen, bei denen die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk auch Legitimationsvermittlung bedeutet, dass nicht jedes Handeln des Volkes Ausübung oberster Staatsgewalt ist.177 Aus diesem Grund besitzen vom Volk beschlossene 172 H. Dreier, in: ders., GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 (Demokratie) Rn. 110; S. Blasche, Die grundsätzliche Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung, S. 102. Ob sie auch durch einfaches Gesetz einführbar wären, ist zweifelhaft, kann hier aber dahinstehen. Dagegen K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 2, S. 16; K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/ Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Abs. 2; Rn. 162, H. Maurer, Plebiszitäre Elemente in der repräsentativen Demokratie, 1997, S. 15 f. Bisweilen werden sie aber bereits aufgrund von Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG ohne weiteres für zulässig gehalten, so von C.-H. Obst, Chancen direkter Demokratie, 1986, S. 254. 173 Denn Abstimmungen sind als Handlungen des Bundesvolkes in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG aufgeführt. 174 Alle Länder sehen die Möglichkeit der Gesetzgebung durch das Volk vor: Art. 73,74 By VF; Art. 59, 60 BW Vf; Bl Vf Art. 59, 62, 63; Art. 22, 75 – 79, 155,166 BB Vf: Art. 69 bis 74 HB Vf; Art. 48 und 50 HH Vf, Art. 116, 117 Hs VF; Art. 55, 60 MV Vf; Art. 42, 48, 59 Nds Vf; Art. 68 NW Vf; Art. 107, 108, 109, 115 RP Vf; Art. 63 Sl Verf.; Art. 70 – 74 Ss Vf.; Art. 81 SA Vf; Art. 42 SH Vf.; Art. 81 – 83 Th Vf. Dabei gibt es zweistufige Verfahren, bei denen auf das Volksbegehren der Volksentscheid folgt, sowie dreistufige Verfahren, bei denen noch eine Volksinitiative vorgeschaltet ist. Hierzu J. Ennuschat, Volksgesetzgebung in den Ländern, in: Kluth/Krings (Hrsg.), Gesetzgebung, § 27 Rn. 2. 175 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 26; ausführlich zu den Regelungen in den einzelnen Ländern: J. Ennuschat, Volksgesetzgebung in den Ländern, in: Kluth/Krings (Hrsg.) Gesetzgebung, § 27 Rn. 26 ff. 176 Hierzu auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 148. 177 F.-J. Peine, Volksbeschlossene Gesetze und ihre Änderung durch den Gesetzgeber, Der Staat 18 (1979), S. 375 (388). Dies verleitet mitunter dazu, nur das Handeln des Volkes in Abstimmungen als Kompetenz anzusehen, das Handeln in Wahlen hingegen nicht. So B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 148, 158 ff. Auch P. Badura, in: Bonner Kommentar zum GG, 165. Lfg. (Stand: Jan. 2014), Bd. V, Art. 20 Abs. 2 Rn. 3033, und
146
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Gesetze auch keinen Vorrang vor Parlamentsgesetzen178 und können durch das Parlament geändert werden,179 ebenso wie sie verfassungsgerichtlich überprüfbar sind.180
VI. Handeln des Volkes für den Staat? Es zeigt sich, dass das Volk innerhalb und außerhalb der staatlichen Ordnung unterschiedliche Rollen einnimmt. Nur in seiner Rolle als Aktivbürgerschaft, als tatsächlich handlungsfähiges Subjekt, kommt eine organschaftliche Stellung in Frage. Als Gesellschaft steht es schon außerhalb der staatlichen Ordnung, so dass ein Handeln für den Staat von vornherein ausscheidet. Als verfassungsgebende Gewalt schafft es die staatliche Ordnung erst, aus der heraus sich Kompetenzen ergeben; Organe des Staates existieren in diesem Moment noch nicht. Auch als Träger der Staatsgewalt i. S. d. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG nimmt es keine Aufgaben für den Staat wahr, sondern bleibt Legitimationssubjekt der staatlichen Gewalt, ohne je selbst zu handeln und (Staats-)Aufgaben zu erfüllen. Lediglich in Form der Aktivbürgerschaft, wie sie in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG beschrieben ist, handelt das Volk tatsächlich innerhalb der staatlichen Ordnung. Es stellt sich die Frage, ob das Volk, wenn es in Wahlen oder Abstimmungen tätig wird, für den Staat handelt oder lediglich für sich selbst zur Verwirklichung der (innerstaatlichen) Souveränität des Gesamtvolkes. Denn es wäre vorstellbar, dass die Zuständigkeiten des Volkes seine eigenen und nicht die des Staates sind, weil der Staat nur um des Volkes willen existiert und so letztlich alle Handlungen der staatlichen Organe zugunsten des Volkes (im Sinne des souveränen Gesamtvolkes) vollzogen werden.181 So handeln auch alle Organe im Namen des Volkes.182 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 371, halten nur das abstimmende, nicht aber das wählende Volk für ein Staatsorgan. Dagegen spricht aber auch, dass das Volk in beiden Fällen im gleichen „Aggregatzustand“, nämlich als Aktivbürgerschaft, handelt. 178 J. Ennuschat, Volksgesetzgebung in den Ländern, in: Kluth/Krings (Hrsg.), Gesetzgebung, § 27 Rn. 23. 179 F.-J. Peine, Volksbeschlossene Gesetze und ihre Änderung durch den Gesetzgeber, Der Staat 18 (1979), S. 375 (388, 389, 401); M. Borowski, Parlamentsgesetzliche Änderungen volksbeschlossener Gesetze, DÖV 2000, S. 481 (491); U. Steiner, Verfassungsgebung und verfassungsgebende Gewalt des Volkes, 1966, S. 196 f. Auch ergibt sich zur Lösung von Konflikten zwischen Staatsvolk und mittelbaren Staatsorganen nicht schlechthin das Gebot der Auslegung „in dubio pro populo“. 180 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 170. 181 So wird auch bisweilen der Staat als „Organ des Volkes“ bezeichnet. So O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 14. 182 Deutlich wird dies besonders in zivilrechtlichen Urteilen, die explizit im Namen des Volkes verkündet werden; so auch W. Thieme, „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, JZ 1955, S. 657 (657). Durch die Einfügung des § 311 in die ZPO im Jahre 1950 sollte auch gerade
VI. Handeln des Volkes für den Staat?
147
1. Handeln des Volkes für sich selbst? Das Volk könnte damit auch gerade für sich selbst und nicht für den Staat handeln. Dafür könnte streiten, dass das Grundgesetz das Volk nicht nur als Ausübenden der von ihm selbst unmittelbar in Wahlen und Abstimmungen ausgeübten Staatsgewalt, sondern als Ausübenden der gesamten Staatsgewalt sehen könnte. Das Grundgesetz formuliert in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG: „Sie [die Staatsgewalt, Anm. d. Verf.] wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Die Formulierung der Vorschrift ist uneindeutig, weil das Grundgesetz hier eine passive Konstruktion wählt, aus der nicht deutlich wird, ob das „Volk“ als Subjekt nur auf den ersten Teil (in Wahlen und Abstimmungen) oder auch auf den zweiten Teil (durch besondere Organe) bezogen ist.183 Die Vorschrift wird zum einen in die Richtung gedeutet, dass die Ausübung der Staatsgewalt durch die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung neben der des Volkes in Wahlen und Abstimmungen steht.184 Dann würde sich das Subjekt „Volk“ nur auf den ersten Teil des Satzes beziehen. Die Norm könnte dann ebenso lauten: „Sie [die Staatsgewalt] wird durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung sowie vom Volk selbst in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt.“ Nach anderer Meinung ist es stets das Volk, das die Staatsgewalt ausübt, nämlich entweder in Wahlen und Abstimmungen oder durch besondere Organe, die einer der drei Gewalten zuzuordnen sind.185 Der Begriff „Volk“ wird dann auf beide Satzteile bezogen. Die Norm wäre dann im Sinne von: „Das Volk übt sie [die Staatsgewalt] in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus“,186 zu verstehen.
die demokratische und republikanische Neuordnung betont werden, so H.-J. Musielak, in: MünchKomm zur ZPO, Bd. I, § 311, Rn. 1. 183 So auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 93. 184 A. Bleckmann, Das Nationalstaatsprinzip im Grundgesetz, DÖV 1988, S. 437 (439); I. Ebsen, Abstimmungen des Bundesvolkes als Verfassungsproblem, AöR 110 (1985), S. 2 (4); A. Katz, Staatsrecht, 2010, § 9 III Rn. 144; B. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 57. Lfg. (Stand: Jan. 2010) Art. 20 Rn. 61. 185 BVerfGE 83, 37 (50) – Ausländerwahlrecht (Schleswig-Holstein), Urteil vom 31. 10. 1990; BVerfGE 83, 60 (71) – Ausländerwahlrecht II, Urteil vom 31. 10. 1990; M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 169; C. Pestalozza, Der Popularvorbehalt, 1981, S. 12; C.-H. Obst, Chancen direkter Demokratie, 1986, S. 67; C. Degenhart, Staatsorganisationsrecht, 2014, § 2 I 1 Rn. 25, W. Bausback, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 1998, S. 62; W. Thieme, „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, JZ 1955, S. 657 (657); dezidiert K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 192; M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (347). 186 So fast wörtlich P. Badura, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 161. Lfg. (Stand: Mai 2013), Bd. VIII, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 2.
148
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Für die Auslegung der Norm ist die Verwendung der unterschiedlichen Präpositionen „von“ und „durch“ von Bedeutung.187 Das Grundgesetz spricht nicht etwa davon, dass die Staatsgewalt „vom Volke“ und „von besonderen Organen“ ausgeübt wird, sondern verwendet im Hinblick auf die besonderen Organe die Präposition „durch“. Sowohl die Präposition „von“ als auch die Präposition „durch“ können gebraucht werden, um den Handelnden, den Agens, in einer passiven Satzkonstruktion hervorzuheben. In beiden Fällen könnte der Satz ebenso gut aktiv formuliert und das auf die Präposition folgende Nomen zum Subjekt des Satzes gemacht werden. Während aber die Präposition „von“ in einer passiven Formulierung den eigentlichen Träger des Geschehens einführt, kann mit der Präposition „durch“ gerade das Handeln einer Mittelsperson beschrieben werden.188 Werden die beiden Präpositionen im gleichen Satz verwendet, spricht dies dafür, dass dies nicht zufällig geschehen ist, sondern die unterschiedlichen Rollen der Akteure gerade hervorgehoben werden sollen.189 Im Grundgesetz werden die Präpositionen auch konsequent in ihrer intendierten Bedeutung verwendet.190 Das Volk ist also gerade das Subjekt der unmittelbaren und mittelbaren Ausübung von Staatsgewalt. Daraus könnte sich ergeben, dass die Organe nur für das Volk und nicht für den Staat handeln und auch das Volk (i. S. der Aktivbürgerschaft) folglich nicht für den Staat, sondern für sich selbst (i. S. des Gesamtvolkes) handelt. Allerdings spricht der Wortlaut der Norm im Übrigen für eine Organschaft auch des Volkes, und damit dagegen, dass das Volk für sich selbst handelt. Das Attribut des „besonderen“, als das die Organe beschrieben werden, erhält einen Sinn nur dadurch, dass hier ein Gegensatz aufgezeigt werden soll zu einem (so nicht explizit benannten) allgemeinen Organ – dem Volk. Die Spezialisierung der übrigen Organe macht deutlich, dass das Grundgesetz das Volk in Form der Aktivbürgerschaft, wie es in
187
So auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 93. C. Fabricius-Hansen, in: Dudenredaktion (Hrsg.), Duden – Die Grammatik, Rn. 804. 189 So auch, C. Fabricius-Hansen, in: Dudenredaktion (Hrsg.), Duden – Die Grammatik Rn. 804. 190 Auf die Stellen, in denen die Präpositionen nebeneinander verwendet werden, weist auch B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 94, hin. So wurde das Grundgesetz laut Verkündungsformel „durch die Volksvertretungen von mehr als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder“ angenommen. Art. 10 Abs. 2 GG spricht von einer „Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe, gemäß Art. 53a Abs. 1 S. 2 GG wird jedes Land „durch ein von ihm bestelltes Mitglied“ im Gemeinsamen Ausschuss von Bundestag und Bundesrat vertreten. Aber auch dann, wenn die Worte einzeln verwendet werden, werden sie gerade nach diesem Muster gebraucht. So dürfen nach Art. 13 Abs. 2 GG Durchsuchungen nur „durch den Richter“ angeordnet werden. Nach Art. 18 GG wird die Verwirkung von Grundrechten durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Nach Art. 53 GG ist der Bundesrat aber von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten. Auffällig ist auch, dass Art. 19 Abs. 3 GG den Rechtsweg bei Verletzungen „durch die öffentliche Gewalt“ gewährleistet. Dies zeigt, dass die Verletzung gerade von einer dahinterstehenden Größe – dem Staat – begangen wird. 188
VI. Handeln des Volkes für den Staat?
149
Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG gemeint ist, selbst als Organ sieht. Anders wäre der Zusatz „besondere“ in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG nicht zu erklären.191 Auch spricht das Grundgesetz in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG ausdrücklich von „Staatsgewalt“, also von Gewalt des Staates, und nicht schlicht von „Gewalt“ oder „hoheitlicher Gewalt“, die vom Volk ausgeübt wird. Dass das Volk selbst als Hauptakteur der Ausübung von Staatsgewalt erscheint, und sich zu deren Ausübung anderer Organe bedient, heißt also nicht, dass es nicht für den Staat handelt.192 Es zeigt lediglich, dass es der Hauptakteur der Ausübung von Staatsgewalt ist. Dies entspricht seiner Stellung als Ur-Organ, als erstes Organ in der Legitimationskette.
2. Rechtsqualität der Entscheidung Für die staatsorganschaftliche Stellung des Volkes im Wahlakt spricht auch deutlich die Rechtsqualität der Entscheidung, die es im Wahlakt trifft. Hier kreiert das Volk das Parlament,193 es bringt also ein Staatsorgan hervor und hat damit or191 S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (89, Fn. 50); M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 130; M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (347), gesteht jedenfalls zu, dass die Formulierung „durch besondere Organe“ einen Ausschluss der Organstellung des Volkes nicht zulasse. 192 F. Klein, in: von Mangoldt/ders., GG-Kommentar, Bd. I, 1957, Art. 20 Anm. V. 5. a), S. 595, bringt es auf den Punkt: „Unmittelbar übt das Volk, d. h. die Aktivbürgerschaft […], die als rechtswirklich handelnder Teil des (Gesamt-) Volkes ebenso wie die ,besonderen‘ Organe des Satzes 2 ein Organ des vom Volke in seiner Gesamtheit getragenen Staates ist, die Staatsgewalt […] in Wahlen und Abstimmungen und damit nur ausnahmsweise aus.“ 193 Die Formulierung der „Kreation“ eines Organs durch ein anderes ist insofern irreführend, als das Organ nicht erst durch die Wahl oder Bestellung geschaffen wird, sondern sein Bestehen bereits in Verfassung oder Gesetz vorgesehen ist. Er ist also der verfassungsgebende Gesetzgeber, der das abstrakte Organ konstituiert hat (S. Magiera, Parlament und Staatsleitung in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes, S. 103). Gewählt oder bestellt werden lediglich die Organwalter. Dies ist sehr eindeutig bei kontinuierlichen Organen wie dem Bundesrat, bei dem die Organwalter ständig ausgetauscht werden können (Art. 51 Abs. 2 GG). Weniger eindeutig ist dies bei den diskontinuierlichen Organen wie dem Bundestag. Die Zusammensetzung des Bundestages ist für die Legislaturperiode festgelegt, in jeder Legislaturperiode wird von einem neuen Bundestag gesprochen. Dennoch besteht der Bundestag als Organ kontinuierlich, es gibt keine logische Sekunde seines Nichtbestehens. Die Wahlperiode des „alten“ Bundestages (i. S. seiner alten Zusammensetzung) endet erst mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages (i. S. seiner neu gewählten Zusammensetzung). Der Bundestag als Organ besteht also durchgehend weiter, er ist abstrakt-institutionell immer vorhanden. Auch Art. 38 Abs. 1 GG spricht deshalb zutreffend von der Wahl der Abgeordneten; wenn Art. 39 Abs. 1 GG auch irreführend von der „Wahl des Bundestages“ spricht, ist damit nur die Wahl der Organwalter, der Abgeordneten des Bundestages, gemeint. So auch BVerfGE 4, 144 (152) – Abgeordnetenentschädigung, Urteil vom 16. März 1955: „[D]ie Identität einer gesetzgebenden Körperschaft [wird] durch die Neuwahl ihrer Mitglieder nicht berührt“. Auch bei einer Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG amtiert der „alte“ Bundestag mit seinen Rechten und Pflichten bis zum Zusammentritt eines „neuen Bundestages“
150
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
gankonstituierende Gewalt.194 Es ist also in die Staatsorganisation eingebettet und nimmt organisationsrechtliche Befugnisse wahr. Die Bestellung eines Staatsorgans stellt eine für den Staat tragende öffentlich-rechtliche Funktion und damit einen staatsorganschaftlichen Akt dar.195 Die Eigenschaft, Staatsorgane personell besetzen zu können, also in ihrer konkreten Besetzung hervorzubringen, kann somit als Merkmal von Staatsorganen gelten. Denn die Bestellung der Staatsorgane ist zur Erfüllung der Aufgaben des Staates notwendig und damit selbst Staatsaufgabe. Sie kann nicht durch Private wahrgenommen werden, sondern nur durch Träger öffentlicher Gewalt, weil die Besetzung eines Staatsorgans staatliches Handeln ist und als privater Akt gerade nicht gedacht werden kann.196 Wer nicht privat, sondern hoheitlich handelt, handelt für den Staat. Wer ein Staatsorgan hervorbringt, muss selbst ebenfalls ein Staatsorgan sein.197 Die Eigenschaft des Volkes, im Wahlakt ein Staatsorgan zu kreieren, macht es somit selbst zum Staatsorgan.198 Umgekehrt können Organe ihre personelle Legitimation nur entweder durch andere Organe oder aber durch Normen erhalten.199 Das Volk selbst ist seinerseits nicht durch ein anderes Staatsorgan kreiert. Vielmehr bestimmt bereits die Verfassung in Art. 20 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Art. 38 Abs. 2 GG den Kreis derer, die zum aktivberechtigten Volk, zur Aktivbürgerschaft gehören.200 So ist schon durch das Verfassungsrecht die personelle Zusammensetzung des Staatsorgans Volk vorgesehen. Es ist damit „geborenes“ Staatsorgan.201 Diese Besonderheit resultiert aus seiner
weiter, Art. 39 Abs. 1 S. 2 GG findet auch auf diesen Fall Anwendung, so V. Epping, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 68 Rn. 40; dies gilt selbstverständlich auch für den Fall des Art. 115 h GG. Die Diskontinuität ist also eine materielle und personelle und betrifft nicht das Organ selbst, sondern nur die Organwalter. „Kreiert“ wird also nicht das Organ als Institution, sondern nur seine Zusammensetzung. In diesem Sinne ist die Formulierung zu verstehen. 194 H. Cˇ opic´, Grundgesetz und politisches Strafrecht neuer Art, 1967, S. 54. 195 E-W. Fuß, Die Nichtigkeitserklärung der Volksbefragungsgesetze, AöR 83 (1958), S. 383 (392). 196 S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (89). 197 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 132, S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (89). 198 Erst aus diesem Grund ist beispielsweise auch die Bundesversammlung ein Staatsorgan: M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 97. 199 W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 34; S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (87). Dabei muss die Legitimation aber stets vom Volk i. S. des Gesamtvolkes herrühren, es muss sich die Legitimationskette auf das Volk zurückführen lassen. 200 Das BWahlG nimmt hierzu noch notwendige Konkretisierungen vor; deshalb ist es materielles Verfassungsrecht; W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, Teil I, Rn. 2, S. 26; BVerfGE 20, 56 (113) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. 201 R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 2010, § 14 III, S. 85; R. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 57. Lfg. (Stand: Jan. 2010), Bd. III, Art 20 Rn. 52.
VI. Handeln des Volkes für den Staat?
151
Stellung als Ur-Organ des demokratischen Staates,202 von dem alle anderen Organe ihre Legitimation herleiten.
3. Legitimation der Staatsgewalt durch kontinuierliches Rechtssubjekt Die Stellung des Volkes als Staatsorgan ist auch für die Legitimation der übrigen Organe und damit für die Legitimation von Staatsgewalt unerlässlich. Um die Ausübung von Staatsgewalt zu legitimieren, bedarf jeder einzelne Amtswalter der demokratischen Legitimation.203 Über die zu ihm führende Legitimationskette, deren Ursprung das Volk in seiner Gesamtheit ist, lässt sich auch das Handeln eines jeden Amtswalters, das dieser im Rahmen seiner Kompetenz vornimmt, auf das Volk zurückführen.204 Die Amtsdauer von Amtsinhabern geht aber in der Regel deutlich über die Legislaturperiode des vom Volk gewählten Bundestages hinaus. Die im Amt befindlichen Amtswalter leiten ihre Legitimation also auch mittelbar nicht aus dem Wahlakt des Wahlvolkes in seiner aktuellen Zusammensetzung, das für das Gesamtvolk in seiner aktuellen Zusammensetzung handelt, her, sondern vom Volk in einer früheren personellen Zusammensetzung. Würde die Legitimation aber nicht vom Volk als Staatsorgan, sondern von den einzelnen zum Volk gehörenden Personen vermittelt, könnten diese stets nur das gegenwärtige Gesamtvolk vertreten, die einzelnen Amtswalter könnten ihre Legitimation stets nur vom Volk in seiner aktuellen Zusammensetzung beziehen, müssten also ständig neu legitimiert werden. Es gäbe kein verbindendes Element zwischen dem jetzigen und dem früheren Staatsvolk, das den bereits im Amt befindlichen Amtswaltern dauerhafte Legitimation verschaffen könnte. Erst wenn das Wahlvolk als verfassungsrechtliche Größe, als Staatsorgan, gedacht wird, das die Existenz seiner Teile überdauert, lässt sich eine weiterhin bestehende Legitimation durch das Volk herleiten. Das Volk ist dann nicht mehr nur die Gesamtheit der aktuellen Bürger, sondern ein darüber hinausgehendes kontinuierliches verfassungsrechtliches Subjekt, die Aktivbürgerschaft nicht nur eine zufällige Zusammensetzung gerade wahlberechtiger Bürger, sondern eine verfassungsrechtliche Größe.
202 S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (86), mit Verweis auf H. Geffcken, ZfP 2 (1909), S. 159 (178). 203 Dies ist die sogenannte „organisatorisch-personelle demokratische Legitimation“: E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 16. 204 Statt aller E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 16.
152
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Das Volk (als Aktivbürgerschaft) ist ein kontinuierliches Organ, das sich stetig selbst erneuert. Es kennt keine Perioden seiner eigenen Existenz, weil es keinen „Bestellungsakt“ des gesamten Volkes, sondern nur jedes einzelnen Bürgers gibt.205
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes 1. Handlungsunfähigkeit des Volkes? Es könnte gegen die Stellung des Volkes als Staatsorgan der Einwand erhoben werden, dass dieses weitgehend handlungsunfähig ist,206 und damit nicht in der Lage, Aufgaben für den Staat wahrzunehmen. So wird argumentiert, gerade aufgrund seiner mangelnden Handlungsfähigkeit müsse das Volk sich zur Ausübung der Staatsgewalt anderer Organe bedienen, und nur deshalb benötige es ein Repräsentationsorgan, das Parlament, dem die Ausübung der Herrschaft obliege, die dem Volk zustehe.207 Die Handlungsfähigkeit der übrigen Organe ist dadurch sichergestellt, dass sie durch verfassungsrechtliche und unterverfassungsrechtliche Regelungen formiert sind und ihre Entscheidungsfindungsregeln, soweit sie als Kollegialorgane solcher bedürfen, normiert sind. Die Möglichkeit der Organisation des Volkes könnte aufgrund der großen Zahl an Mitgliedern fraglich sein. Auch gibt es keine Organisationsregeln, die das Volk in jeder Hinsicht handlungsfähig machen. Die Vorstellung des „unorganisierten Volkes“ ergibt sich daraus, dass das Volk überwiegend im unorganisierten Zustand als Gesellschaft existiert.208 Es ist in der Regel nicht als staatliche, sondern als gesellschaftliche Größe sichtbar. Der Gesellschaft fehlt auch jede Formiertheit, weil diese ihrem Ordnungsprinzip diametral entgegen laufen würde. Im entscheidenden Akt seiner organisationsrechtlichen Zuständigkeit jedoch, der Wahl, handelt das Volk formiert und organisiert.209 Es ist
205 Dieser wird indes nicht förmlich vollzogen. Der Einzelne wird vielmehr dann, wenn er die Voraussetzung der Normen, die die Wahlberechtigung regeln, erfüllt, kraft Gesetzes Teil der Aktivbürgerschaft. 206 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 14; BVerfGE 13, 54 (85) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961, im Hinblick auf seine prozessuale Handlungsunfähigkeit. 207 M. Morlok/C. Hientzsch, Das Parlament als Zentralorgan der Demokratie, JuS 2011, S. 1 (1). 208 Hierzu oben in diesem Abschnitt unter E. V. 1., S. 130 ff. 209 So auch K. G. Wernicke, Bonner Kommentar, Erstbearbeitung, Art. 20 II. 2. b): „Das [die ,handlungsfähige Größe‘, Anm. der Verf.] aber sind jene, die als ,verfassungsgesetzlich formierte und organisierte Größe‘ auf Grund dieser Organisationsnorm die Volksentscheidung fällen, nämlich wählen bzw. abstimmen dürfen.“
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
153
gerade die Organisation der Wahl, die das Volk formiert und es dadurch in seiner Gesamtheit handlungsfähig macht. Die Wahlberechtigung der einzelnen Bürger und die damit einhergehende Fähigkeit, durch die Teilnahme an der Wahl an der Kreation eines Organs mitzuwirken, existiert nicht nur abstrakt. Ihr wird mit der Führung von Wählerverzeichnissen und der Gesamtorganisation der Wahl so zur Geltung verholfen, dass die Aktivbürgerschaft als Ganze tatsächlich in der Lage ist, eine eigene staatsorganisationsrechtliche Handlung vorzunehmen. Damit wird das Volk durch seine staatsorganisationsrechtliche Tätigkeit formiert. Nur auf seine Formiertheit und Handlungsfähigkeit bei Ausübung seiner Kompetenzen kommt es an, denn nur hierfür ist seine Formiertheit erforderlich. Dass es daneben – in anderer Zusammensetzung – wesentlich als nichtorganisierte und nichtformierte Größe besteht, ist für eine Stellung als Staatsorgan unschädlich. Seine hauptsächlich zu konstatierende Unformiertheit bedeutet nicht, dass es kein Organ ist: Das Volk besteht eben nicht nur als staatsorganisationsrechtliche Größe, sondern auch gesellschaftlich; es hat damit eine Zwitterstellung inne und existiert in unterschiedlichen „Aggregatzuständen“.210 Anders als andere Staatsorgane kann sich das Volk für seine staatsorganisationsrechtliche Tätigkeit der Wahl in Gänze aber nicht selbst formieren. Das Volk besitzt – im Gegensatz zu anderen Staatsorganen – keine Geschäftsordnung, in der die Regeln seines Zusammentritts normiert würden. Es hat seinerseits auch keine Unterorgane, insbesondere keinen „Präsidenten“, die das Volk „einberufen“ könnten. Das Volk bedarf zu seiner Organisation vielmehr stets anderer Organe.211 Diese sind es, die den Wahlablauf organisieren und so dem Volk zu situativer Handlungsfähigkeit verhelfen. Zwar ist es im Rahmen von Volksbegehren möglich, dass Teile des Volkes das Tätigwerden des gesamten Volkes initiieren. Diese handeln aber nicht als Volk oder im Namen des Volkes212 und repräsentieren es auch nicht.213 Es ist also nicht das Volk, das hier die Entscheidung über das Tätigwerden des Volkes herbeiführt. Zudem organisiert die Gruppe der Initiatoren eines Volksbegehrens die
210 R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 145, bezogen auf den „Staat“ und die „Gesellschaft“, die unterschiedliche Aggregatzustände des Volkes seien. 211 Es obliegt den verfassten Staatsorganen, die Wahlen und damit die Tätigkeit des Volkes zu organisieren: BVerfGE 20, 56 (113) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966; BVerfGE 41, 399 – Wahlkampfkostenpauschale, Beschluss vom 9. 3. 1976; E. W. Fuß, Die Nichtigkeitserklärung der Volksbefragungsgesetze, AöR 83 (1958), S. 383 (393). Auch die Wahlorgane werden mit wahlberechtigten Bürgern besetzt. Diese handeln jedoch nicht für das Volk, sondern für den Staat. 212 Ob den Initiatoren eines Volksbegehrens selbst Organqualität zukommt, ist umstritten. Sie muss indes abgelehnt werden, denn diese Teile des Volkes handeln nicht für das Volk, sie haben auch keine Legitimation durch das Volk, sondern handeln im eigenen Interesse. So auch W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 68 f.; K. Ritgen, Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, 1997, S. 116 f.; G. Hüllen, Rechtsschutzprobleme beim Bürgerbegehren, 1999, S. 197 f. 213 So auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 301.
154
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Tätigkeit nicht, sondern initiiert sie lediglich; es bedarf zum Tätigwerden des Volkes darüber hinaus stets der Organisation durch andere Organe. Das Volk als staatsorganisationsrechtliche Größe kann folglich stets nur mithilfe anderer Organe als Ganzes tätig werden. Allerdings hängen das Tätigwerden des Volkes und seine Formierung dabei nicht vom ungebundenen Willen anderer Organe ab. Diese organisieren nur die Organtätigkeit des Volkes, initiieren sie aber nicht. Das Handeln ist vielmehr verfassungsrechtlich vorgesehen. Es obliegt zwar dem Bundespräsidenten, das Tätigwerden der Aktivbürgerschaft anzuordnen, indem er den Wahltag festlegt.214 Art. 39 GG sieht jedoch vor, in welchem Zeitraum der Wahlakt stattzufinden hat, das Volk also organisationsrechtlich tätig wird. Gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 3 GG findet eine Wahl frühestens sechsundvierzig, spätestens aber achtundvierzig Monate nach dem Beginn der Legislaturperiode statt, die ihrerseits spätestens dreißig Tage nach der letzen Wahl beginnt. Nur innerhalb dieser engen Grenzen kann der Bundespräsident einen Wahltag aussuchen.215 Lediglich im Fall der Bundestagsauflösung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 2 GG wird das Volk „außerordentlich“ in Wahlen tätig. Sein Tätigwerden ist jedoch auch in diesem Fall verfassungsrechtlich in Art. 39 Abs. 1 Satz 4 GG angeordnet. Ob es tätig wird, hängt zum einen vom Handeln des Bundestages ab und ist zum anderen in das gebundene Ermessen des Bundespräsidenten gestellt, das von dem Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 68 GG abhängig und damit nicht beliebig ist.216 Das Stattfinden von Wahlen liegt damit auch hier nicht im Belieben anderer Staatsorgane. Das Bundesverfassungsgericht und ein Teil der Literatur erkennen das Volk jedoch nicht als prozessual handlungsfähig und deshalb auch nicht als beteiligungsfähig im Organstreit an,217 selbst wenn eine materielle Organstellung anerkannt wird. 214
§ 16 S. 1 BWahlG. E. Klein/T. Giegerich, Grenzen des Ermessens bei der Bestimmung des Wahltages, AöR 112 (1987), S. 544 (546). 216 Dies zeigt sich auch gerade daran, dass dem Parlament kein Selbstauflösungsrecht zusteht, sondern seine Auflösung an die Voraussetzungen des Art. 68 GG gebunden und zudem in das Ermessen des Bundespräsidenten gestellt ist. Die Voraussetzungen des Art. 68 GG wurden vom Bundesverfassungsgericht zudem um die ungeschriebene materielle Tatbestandsvoraussetzung der „politisch instabilen Lage“ ergänzt. BVerfGE 62, 1 – Bundestagsauflösung I, Urteil vom 16. 2.1983; BVerfGE 114, 121 – Bundestagsauflösung II, Urteil vom 25. 8. 2005. 217 BVerfGE 13, 54 (85) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961; J. Pietzcker, Organstreit, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 587 (594), weitergehend jedoch D. Lorenz, Der Organstreit vor dem Bundesverfassungsgericht, in: Starck (Hrsg.), Festschrift 25 Jahre BVerfG, S. 225 (246), der den Ausschluss nicht nur aus „formellen“ Gründen vornimmt, sondern aus „materiellen“: das Volk könne nicht mit anderen Staatsorganen im Streit liegen. Bemerkenswert ist, dass die behauptete Prozessunfähigkeit des Volkes im Organstreitverfahren begründungsbedürftig erscheint, wodurch implizit oder explizit (wie z. B. bei M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 290) die Organstellung des Volkes anerkannt wird. 215
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
155
Denn das Volk könne nicht selbst vor dem Bundesverfassungsgericht erscheinen, hierzu hätte ihm durch das Grundgesetz oder das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ein Vertreter bestellt werden müssen. Es sei keine „stets präsente handlungsfähige Einheit[…]“ und damit auch nicht „Organ im engeren Sinne“,218 womit die Beteiligtenfähigkeit im Organstreitverfahren gemeint ist. Der Einwand des Bundesverfassungsgerichts deckt nur auf, dass das Volk nicht initiativ tätig werden kann, weil es aus sich heraus keinen Entschluss des Tätigwerdens fassen kann, sondern für sein Tätigwerden von der Organisation durch andere Organe abhängig ist. Es kann jedoch im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Zuständigkeit handeln, weil es hier nicht aus eigenem Entschluss, sondern aus verfassungsrechtlicher Vorgabe zum Tätigwerden berufen und die Organisation durch andere Organe gerade vorgesehen ist. Das Volk ist dann aber gerade durch die Organisation hinreichend formiert, um als Organ zu fungieren.219 Es ist handlungsfähig gerade zu den ihm verfassungsrechtlich zukommenden Aufgaben.220 Dass es zu anderen Handlungen – wie z. B. Prozesshandlungen – aufgrund der gegenwärtigen Ausgestaltung des Prozessrechts nicht in der Lage ist, ist für seine Stellung als Staatsorgan dagegen unschädlich.
2. Uneinheitlichkeit des Volkswillens? Für die Handlungsfähigkeit des Volkes bedarf es der Fähigkeit, einen einheitlichen Willen zu bilden. Diese Fähigkeit wird dem Volk aber mitunter abgesprochen, da es aus unterschiedlichen Rechtssubjekten mit sehr unterschiedlichen Meinungen und Ansichten bestehe. Diese Meinungspluralität innerhalb des Volkes stehe einem einheitlichen Volkswillen entgegen.221 Der Volkswille sei in der modernen, freiheitlichen Demokratie vielmehr heterogen und plural. Er könne deshalb gerade nicht als Wille eines Organs verstanden werden.222
218
BVerfGE 13, 54 (85) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961. Dass auch stets die Möglichkeit besteht, dass die Entscheidungsfindungsregeln von Kollegialorganen das Organ im Einzelfall aufgrund der unterschiedlicher Meinungen nicht in den Stand versetzen, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, ändert an seiner grundsätzlichen Handlungsfähigkeit nichts. 220 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 I 1, S. 38 f. 221 U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 242, 243; H. Dreier, in: ders., GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 (Demokratie) Rn. 107; P. Badura, Die parlamentarische Demokratie, in: HStR, Bd. II, § 25 Rn. 28 f. 222 U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 245; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 2, S. 23, geht hingegen ebenso nicht davon aus, dass das Grundgesetz einen einheitlichen Volkswillen „fingier[e]“, obwohl er das Volk als Staatsorgan anerkennt. 219
156
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
a) Unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Volkswillen“ Die Vorstellung von der Unvereinbarkeit eines einheitlichen Volkswillens mit der Pluralität der Einzelwillen der Bürger beruht auf unterschiedlichen Verwendungen des Begriffs „Volkswillen“. Aus der unterschiedlichen Verwendung des Begriffes „Volk“ und dem Wirken des Volkes sowohl in der staatlichen als auch in der gesellschaftlichen Sphäre jeweils in verschiedenen personellen Zusammensetzungen und „Aggregatzuständen“ folgt auch eine Verwischung der Begriffe „Volkswillen“ und „Volkswillensbildung“.223 Mit dem Begriff „Volkswillensbildung“ wird zweierlei bezeichnet: zum einen die Willensbildung des „unorganisierten Volkes“, der Gesellschaft, die entsprechend im gesellschaftlich-politischen Bereich stattfindet, zum anderen die Willensbildung des verfassten Volkes, die sich im staatlichen Bereich vollzieht. b) Gesellschaftliche Willensbildung keine Volkswillensbildung Die Willensbildung des unorganisierten Volkes, der Gesellschaft, unterliegt den Regeln der Gesellschaft und ist damit geprägt durch das subjektive Prinzip, durch individuelles Belieben und grundrechtliche Freiheit.224 Dieser Prozess vollzieht sich dementsprechend „frei, offen und unreglementiert“.225 Er besteht aus einem Kampf der Meinungen, der sich stets aufs Neue artikuliert. Als „Jedermann-Wettbewerb“226 ist er nicht nur inhaltlich frei, sondern auch die Partizipation hieran steht jedem Grundrechtsträger, unabhängig von seiner Zugehörigkeit zum Staat, offen. An diesem Willensbildungsprozess kann der einzelne Bürger genauso mitwirken wie Interessengruppen, Verbände und Parteien. Wer an diesem Prozess tatsächlich teilnimmt und in welchem Maß ihn ein jeder Teilnehmer beeinflusst, bleibt aufgrund seiner Offenheit und Unreglementiertheit unbestimmt. Das Prinzip der schematischen Gleichheit gilt hier nicht, jeder Akteur nimmt nach dem Maß seiner tatsächlichen Überzeugungskraft auf den Prozess Einfluss.227 Der gesellschaftliche Willensbildungsprozess ist durch die Eigenschaft gekennzeichnet, dass er nie einen fertigen Willen darstellt, sondern stets dynamisch und somit ergebnisoffen bleibt.228 Deshalb lässt sich von einem „Willen“ in diesem Zusammenhang kaum sprechen, der 223
Hierzu auch M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 185, Fn. 26. 224 W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 28, der gerade darauf hinweist, dass dies auf seine „grundrechtlichen Quellen“ zurückzuführen ist. 225 BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. 226 W. Schmitt Glaeser, Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 28. 227 BVerfGE 8, 104 (115) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. 228 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 186; H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 369.
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
157
Begriff der „Willensbildung“ oder des „Willensbildungsprozesses“ ist gegenüber dem Begriff des „Willens“ in diesem Zusammenhang vorzugswürdig.229 Der Begriff des „plébiscite de tous le jours“, als der dieser Prozess zum Teil gedeutet wird,230 trifft diesen Vorgang nur insoweit, als er zum Ausdruck bringt, dass hier getroffene „Entscheidungen“ revidierbar sind und ständig revidiert werden; er vermittelt aber deshalb ein falsches Bild, weil er durch die Verwendung des Begriffs „plébiscite“ suggeriert, dass hier verbindliche Entscheidungen hervorgebracht würden.231 Wird dieser Willensbildungsprozess als Volkswillensbildung bezeichnet, so wird er benutzt, um diesen Prozess von der staatlichen Willensbildung abzugrenzen,232 um so auch die Notwendigkeit der Staatsfreiheit zu betonen. Aufgrund seiner Ergebnisoffenheit fehlt ihm im Gegensatz zu staatlichen Willensbildungsprozessen auch die Möglichkeit, zu verbindlichen Entscheidungen zu kommen, die staatliche Willensbildungsprozesse haben (müssen).233 Der Versuch, hier einen (einheitlichen) Willen festzustellen, muss in der Tat scheitern, weil ein solcher aus dem in ständiger Veränderung begriffenen Prozess nicht hervorgehen kann. Zudem fehlt ihm die Institutionalisierung, die Voraussetzung für die Verbindlichkeit einer Entscheidung wäre.234 Aber auch der Bezug auf das Volk führt hier in die Irre, weil nicht deutlich wird, dass nicht das verfasste Volk des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG gemeint ist, sondern die Gesellschaft. Wird dieser „Wille“ als „Vorformung der politischen Willensbildung des Volkes“235 beschrieben, charakterisiert dies den Vorgang treffender. Dieser Willensbildungsprozess spielt sich zwar im gesellschaftlichen Bereich ab, aufgrund der weitgehenden Personeniden-
229 Insofern ist die Formulierung von H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 369, missverständlich, weil er zwar die Dynamik betont, aber mit dem Begriff des „Volkswillens“ auf etwas Fertiges abzielt. 230 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 186. 231 J. Isensee, Demokratie – verfassungsrechtlich gezähmte Utopie, in: Matz (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen der repräsentativen Demokratie, S. 43 (47), bezeichnet diesen Prozess als „informelle Plebiszitärdemokratie“, wobei er den Begriff „Demokratie“ nicht im verfassungsrechtlichen Sinne verstanden wissen will. 232 BVerfGE 8, 104 (104, 113) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958: „Öffentliche Meinung und politische Willensbildung kann aber nicht identifiziert werden mit staatlicher Willensbildung“; so auch W. Schmitt Glaeser, Partizipation an Verwaltungsentscheidungen, VVDStRL 31 (1973), S. 179 (222), er beschreibt den gesellschaftlichen Willensbildungsprozess (auch von ihm als „Volkswillensbildung“ bezeichnet) als „offenen“, den staatlichen als „geschlossenen“ Bereich der Willensbildung. 233 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 364. 234 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 364. 235 BVerfGE 8, 104 (113) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. BVerfGE 8, 122 (133) – Volksbefragung Hessen, Urteil vom 30. 7. 1958. (Hervorhebung nicht im Original).
158
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
tität236 zwischen dem Volk i. S. d. Aktivbürgerschaft und der Gesellschaft ist er aber gleichzeitig Vorstufe der organschaftlichen Willensbildung des Volkes.237 Um jedoch deutlich zu machen, dass hier das Volk in seiner gesellschaftlichen Formation gemeint ist, sollte der Prozess als „gesellschaftlicher Willensbildungsprozess“ oder „Prozess der Willensbildung der Gesellschaft“ bezeichnet werden.238 Als „Volkswille“ sollte hingegen der Wille des organisierten Volkes beschrieben werden.239 Die Entkoppelung dieses Willensbildungsprozesses vom staatlichen Willensbildungsprozess240 soll jedoch nicht über seine Bedeutung hinwegtäuschen, die er für die Demokratie hat. Die „der staatlichen Willensbildung vorgelagerte[…] und nicht formalisierte[…] gesellschaftliche[…] Willensbildung“241 verleiht zwar nicht selbst der Staatsgewalt Legitimation, sie ist jedoch Voraussetzung für die legitimationsstiftende Wirkung des Wahlaktes.242 Denn dieser kann nur aufgrund seiner Freiheit legitimierend wirken. Ohne einen freien Willensbildungsprozess, der der Wahl voraus liegt, kann von einer freien Wahl nicht gesprochen werden.243
236 So auch K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, § 1 Rn. 11, S. 9, der allerdings die Überschneidung als Argument dafür benutzt, dass die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft aufzuheben sei; sie sei allenfalls eine „funktionale Differenzierung“. Er schlägt deshalb den umfassenderen Begriff des „Gemeinwesen[s]“ vor. 237 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 I 1, S. 39; ähnlich BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966: „Der permanente Prozeß der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mündet ein in den für die Willensbildung im Staat entscheidenden Akt der Parlamentswahl.” (Hervorhebung nicht im Original). 238 Unglücklich erscheint deshalb auch die Wortwahl des Grundgesetzes in Art. 21 Abs. 1 GG, demgemäß die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Gemeint ist hier gerade die gesellschaftliche Willensbildung, während sich Art. 20 GG nur auf das Volk als staatliche Größe bezieht. An der tatsächlichen Willensbildung des Volkes haben die Parteien aber insofern Anteil, als sie eine bedeutende Rolle im Wahlsystem innehaben. 239 Ähnlich R. Grawert, Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: HStR, Bd. II, 2004, § 16 Rn. 32. 240 W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 31. 241 K.-P. Dolde, Zur Beteiligung von Ausländern am politischen Willensbildungsprozess, DÖV 1973, S. 370 (372); BVerfGE 8, 104 (113) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. 242 W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 31, 34; ders., Private Gewalt im politischen Meinungskampf, 1992, S. 28, bezeichnet ihn als „Lebensstrom der Demokratie“. Die in diesem Bereich stattfindende politische Betätigung ist „funktional notwendiges Element der Demokratie als Staats- und Regierungsform“, so U. K. Preuß, Plebiszite als Form der Bürgerbeteiligung, ZRP 1993, S. 131 (131). 243 Ähnlich BVerfGE 118, 277 (353) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007. Dennoch gewährleistet der Grundsatz der freien Wahl nicht die Freiheit des gesellschaftlichen Willensbildungsprozesses, siehe unten in Abschnitt F. IV. 3., S. 203 f.
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
159
c) Volkswille als Staatswille Die Willensbetätigung des (verfassten) Volkes im Wahlakt ist indes selbst Staatswillensbildung.244 Sie steht zwar mit der gesellschaftlichen Willensbildung in einem Fortsetzungszusammenhang,245 ist aber rechtlich von dieser entkoppelt.246 Die Willensbildung des Volkes in Wahlen ist also nicht juristischer Endpunkt der gesellschaftlichen Willensbildung, sondern nur faktischer. Wird der Begriff des Volkswillens zutreffend nur in dieser Bedeutung verwendet, fällt im Wahlakt aber nicht nur die Äußerung (und Bildung) des Volkswillens mit der Bildung des Staatswillens zusammen, weil das Volk hier als „Verfassungs- oder Kreationsorgan selbst die Staatsgewalt ausübt“.247 Das Wahlergebnis wird dann auch zum einzigen Ausdruck des Volkswillens,248 da mit dem „Willen des Volkes“ im Übrigen der Wille bzw. die Willensbildung der Gesellschaft gemeint ist.249 Deutlich wird dann auch, dass sich nicht der Volkswille und der Staatswille als gegensätzliche Größen gegenüberstehen mit einem sich in der Wahl abbildenden Schnittpunkt, sondern dass der Volkswille in Gänze im staatlichen Bereich liegt, sich zuvor aber eine andersgeartete Willensbildung, die gesellschaftliche Willensbildung, vollzieht. Der 244 BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966: „Nur dann, wenn das Volk als Verfassungs- und Kreationsorgan selbst die Staatsgewalt ausübt (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG), fällt die Äußerung des Volkswillens mit der Bildung des Staatswillens zusammen.“ So auch W. Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, 1992, S. 29; ders., Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 30. 245 Wenn das Bundesverfassungsgericht BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966, feststellt, Wahlen seien „der für die Willensbildung des Staates eine Voraussetzung bildende Akt, in den der permanente Prozeß der Meinungs- und Willensbildung des Volkes gipfelt“, dann betont dies zwar den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Willensbildung und der Volkswillensbildung, allerdings werden Wahlen hier fälschlich nicht als Staatswillensbildung, sondern nur als deren Voraussetzung aufgefasst. 246 M. Stolleis, Parteienstaatlichkeit, VVDStRL 44, S. 7 (16 f.), meint aber, dass mit der Unterscheidung „falsche Dichotomien und faktische Trennbarkeit suggeriert würden“. Zu welchen Fehldeutungen es führt, wenn Prinzipien des staatlichen Willensbildungsprozesses auf den gesellschaftlichen Willensbildungsprozess übertragen werden, zeigt sich, wenn das Bundesverfassungsgericht den Gleichheitssatz nicht nur im Bereich des Wahlrechts im engeren Sinne, sondern auch im Vorfeld der politischen Meinungsbildung streng formal versteht: BVerfGE 14, 121 (132) – Rundfunksendezeiten, Beschluss vom 30. 5. 1962; BVerfGE 8, 51 (68) – Parteispenden, Urteil vom 24. 6. 1958. 247 BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966; a. A. P. Badura, Staatsrecht, 2012, Rn. C 104, S. 209: Wahlen seien nicht ein „Vorgang der Willensbildung des Staates“, sondern der „für die Willensbildung des Staates eine Voraussetzung bildende Vorgang“. Dies geht dann auch (notwendigerweise) mit einer Verwischung des gesellschaftlichen und des Volkswillensbildungsprozesses einher: In Wahlen würde der „fortdauernde und diffuse Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes verbindlich zum Ausdruck kommen“. 248 Dezidiert dagegen aber J. C. von Waldthausen, Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, 2000, S. 183. 249 So auch M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 185 (Fn. 26).
160
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Volkswille, der im Wahlakt zum Ausdruck kommt, entspricht auch gerade dem formalisierten Prinzip staatlicher Willensbildungsprozesse, die auf verbindliche Entscheidungen gerichtet sind, um staatliches Handeln zu ermöglichen.250 Zur Unklarheit trägt bei, dass die gesellschaftliche Willensbildung und die staatliche Willensbildung nicht voneinander isoliert, sondern miteinander verschränkt sind und in Wechselwirkung stehen.251 Zum einen deshalb, weil die gesellschaftliche Willensbildung sich stets im Vorfeld der Willensbildung des Volkes im staatlichen Bereich bewegt und aufgrund der weitgehenden personellen Überschneidung die Willensbildung des Volkes in von der Verfassung intendierter Weise vom gesellschaftlichen Willensbildungsprozess beeinflusst wird.252 Zum anderen deshalb, weil die Gesellschaft auch aus ihrer grundrechtlich geprägten Sphäre heraus berechtigt und bestimmt ist, auf die staatliche Willensbildung – etwa durch Petitionen oder schlicht durch Meinungsäußerung – Einfluss zu nehmen.253 Hierbei muss aber stets dieses Handeln, das aus dem gesellschaftlichen Bereich stammt, von dem Handeln des Staatsvolkes unterschieden werden. d) Volkswille ist vermittlungsbedürftig Den Zweiflern an der Möglichkeit eines einheitlichen Volkswillens ist zuzugestehen, dass es einen einheitlichen Volkswillen im Sinne eines natürlichen, menschlichen Willens nicht geben kann. Nicht einmal ein heterogener Wille des Volkes ist als natürlicher feststellbar.254 Heterogen erscheint der Volkswille nur dann, wenn nicht im eigentlichen Sinn auf den Willen des Volkes abgestellt wird, sondern auf die Willen der einzelnen Bürger, die in der pluralen Gesellschaft notwendigerweise unterschiedlich sind. Der Wille des Volkes bedarf zu seiner Artikulation vielmehr der Vermittlung. Es bedarf eines rechtlich geordneten Verfahrens,255 das die Einzelwillen zu einem
250 Die Wahl ist institutionalisierter Ausdruck einer Legitimationskette vom Volk zu den „besonderen Organen“, so W. Schmitt Glaeser, Private Gewalt im politischen Meinungskampf, 1992, S. 28. 251 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 4, S. 25. 252 BVerfGE 14, 121 (132) – Sendezeiten, Beschluss vom 30.5.96; BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. 253 Hierzu W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 11 ff. 254 E.-W. Böckenförde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie, in Müller (Hrsg.) Festschrift für Eichenberger, S. 301 (306 f.), sieht den Volkswillen zwar als reale Größe, er sei aber „aus sich selbst heraus unformiert, diffus und […] daher der Formung bedürftig.“ 255 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 I 1, S. 39; J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (162).
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
161
einheitlichen Willen256 formt, der dann Grundlage staatlichen Handelns sein kann.257 Dieser einheitliche Wille ist eine „Kunstschöpfung des Rechts“.258 Er ist eine Schöpfung aus den Einzelwillen, die über das Wahlverfahren in ein Ergebnis umgesetzt werden, das dann als „der Volkswille“ besteht.259 Wie aus diesen Einzelwillen ein Gesamtwille wird, bestimmt das Wahlverfahren, das vom demokratisch gewählten Gesetzgeber festgelegt wird. Über dieses Verfahren werden die unterschiedlichen Einzelwillen, die in der Tat sehr verschieden sein können, in einen einheitlichen Gesamtwillen umgesetzt.260 Die eigentliche Volkswillensbildung ist dann von äußerst kurzer Dauer, sie beschreibt nur den Umsetzungsprozess der abgegebenen Stimmen in ein einheitliches Wahlergebnis. Der Volkswille ist dann nicht uneinheitlich und diffus, wie es die Einzelwillen sind, aus denen sich der Volkswille zusammensetzt, sondern durch das Wahlverfahren soweit förmlich vereinheitlicht, dass er zur Grundlage allen weiteren staatlichen Handelns gemacht werden kann. Der Wahl wird deshalb auch eine Integrationsfunktion bei der politischen Willensbildung des Volkes beigemessen,261 also die Funktion, die unterschiedlichen Meinungen zu bündeln und in einen gemeinsamen Willen zu integrieren. Wie weit eine Vereinheitlichung des Willens des Volkes auf dieser Stufe reicht, hängt dabei insbesondere vom Wahlsystem ab. Während ein Mehrheitswahlsystem eine stärkere Vereinheitlichung des Willens herbeiführt, lässt das Verhältniswahlsystem die Pluralität der Einzelwillen auch im Wahlergebnis als ermitteltem Volkswillen sehr deutlich durchscheinen. Dem so ermittelten Volkswillen lässt sich dann in seiner Eigenart als Kunstschöpfung aber keine Beliebigkeit entgegenhalten, weil auch das Verfahren seiner Ermittlung nicht beliebig ist, sondern vom demokratisch gewählten Gesetzgeber nach den Vorgaben der Wahlgrundsätze festgelegt wird. Der Volkswille ist dann zwar
256 E.-W. Böckenförde, Mittelbare/repräsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie, in Müller (Hrsg.) Festschrift für Eichenberger, S. 301 (307), betont, dass der Volkswille Antwortcharakter habe, er werde durch die Erfragung „in seiner konkreten Bestimmtheit [erst] hervorgerufen und aktualisiert“. 257 E.-W. Böckenförde, Demokratische Willensbildung und Repräsentation, in: HStR, Bd. II, 2005, § 34 Rn. 4. 258 J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (162). 259 A. Greifeld, Zur Entstehung des Staatswillens aus dem Bürgerwillen, in: Marko/Stolz (Hrsg.), Demokratie und Wirtschaft, S. 123 (130 f.). 260 Die Problematik, eine Vielzahl von Einzelwillen einen einheitlichen Willen umzusetzen, besteht bei allen Kollegialorganen. Es bedarf dabei immer eines Verfahrens, das die Einzelwillen in einen Gesamtwillen umsetzt, der dann als einheitlich fingiert wird. Hierzu W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 29. 261 BVerfGE 95, 40 (418) – Grundmandatsklausel, Urteil vom 10. 4. 1997; BVerfGE 6, 84 (93) – Sperrklausel, Urteil vom 23. 1. 1957; BVerfGE 71, 81 (87) – Arbeitnehmerkammern Bremen, Beschluss vom 22.10.198; BVerfGE 14, 121 (135) – Sendezeiten, Beschluss vom 30.5.96; BVerfGE132, 39 (50) – Wahlberechtigung der Auslandsdeutschen, Beschluss vom 4. 7. 2012.
162
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
künstlich geschaffen, aber dennoch keine fiktive Größe,262 sondern real, weil er sich nach bestimmten Regeln aus den Einzelwillen ermitteln lässt. Fiktiv erscheint der Volkswille nur dann, wenn er mit einem natürlichen Willen verglichen wird. e) Zwischenergebnis Der Organstellung des Volkes lässt sich nicht entgegenhalten, es sei nicht in der Lage, einen einheitlichen Willen zu bilden. Die Annahme beruht auf der Vorstellung, dass das Volk stets in seiner gesellschaftlichen Formation verbleibe und aus dieser heraus einen einheitlichen Willen zu bilden in der Lage sein müsste. Dies ist aber nicht der Fall. Die Frage nach der Willensbildungsfähigkeit des Volkes ist nicht für seine gesellschaftliche, sondern für seine organisationsrechtliche Formation zu beantworten. Dem verfassten Volk steht mit dem Wahlverfahren durchaus ein Mittel zur Verfügung, das darauf ausgerichtet ist, die pluralen Einzelwillen zu einem einheitlichen Willen zu integrieren.
3. Unvereinbarkeit der souveränen Stellung des Volkes mit einer staatsorganschaftlichen Stellung? Gegen die Einordnung des Volkes als Staatsorgan wird jedoch das Argument angeführt, dass die Stellung des Volkes als Souverän einer funktionellen Einordnung des Volkes in das staatliche Gefüge als Staatsorgan widerspreche.263 Die Stellung des Volkes als Organ des Staates werde seiner Rolle als Souverän nicht gerecht. Die Souveränität des Volkes drücke sich gerade auch durch seine Stellung als Ausgangspunkt aller staatlichen Gewalt aus, also seiner souveränen Stellung auch innerhalb der Staatsorganisation. Diese Staatsträgerschaft lasse sich nicht mit einer Organstellung des Volkes vereinbaren.264 Als Organ werde es den anderen Organen gleichgestellt und dem Staat als „übergeordnete“ juristische Person untergeordnet,265 indem es zum Handelnden für den Staat gemacht werde. So werde letztlich nicht mehr das Volk, sondern der Staat als souverän betrachtet.266 Dies entspreche der Rolle des Volkes im demokratischen Staat jedoch nicht. Der Staat sei lediglich eine 262
(418). 263
So aber A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395
U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 240; H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 168. 264 E.-W. Böckenförde, Organ, Organisation, Juristische Person, in: Festschrift für Wolff, S. 269, 291 (Fn. 75); U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 240. 265 H. Uhlenbrock, Der Staat als juristische Person, 2000, S. 168; E.-W. Böckenförde, Organ, Organisation, Juristische Person, in: Festschrift für Wolff, S. 269, 278; U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 239, 240. 266 U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 239.
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
163
„Selbstorganisation des Volkes zur einheitlichen Willensbildung und Betätigung“,267 das Volk bringe den Staat durch den Wahlvorgang erst hervor, es handle deshalb nicht für den Staat, sondern als Staat.268 Diese Argumentation scheint die organschaftliche Stellung des Volkes auf den ersten Blick auszuschließen. Ihr liegt jedoch eine bestimmte Vorstellung von den Erfordernissen der Volkssouveränität zugrunde: Volkssouveränität erfordert hiernach nicht nur, dass das Volk (i. S. d. Gesamtvolkes)269 die staatliche Ordnung, in der es lebt, selbst schafft, sondern dass es innerhalb der staatlichen Ordnung auch selbst regiert. Zum anderen muss sich diese Selbstregierung dann auch gerade als Ausdruck der „Allmachtstellung“ des Volkes darstellen. Eine Unvereinbarkeit der Organstellung des Volkes mit dem Prinzip der Volkssouveränität lässt sich nur dann erklären, wenn man Volkssouveränität als Allmachtstellung innerhalb der Staatsordnung versteht. Ob dies vom Begriff der Volkssouveränität erfasst ist, ist jedoch umstritten. Die Reichweite der Volkssouveränität ist vielmehr uneindeutig, wie auch der Begriff der Souveränität an sich nicht klar umrissen ist.270 Als gemeinsamer Nenner der Ansichten über die Volkssouveränität lässt sich festhalten, dass diese erfordert, dass das Volk die Rechtsordnung, in der es lebt, selbst schafft, dass das Volk also Träger der verfassungsgebenden Gewalt ist.271 Meist wird dem Begriff der Volkssouveränität aber neben der vorkonstitutionellen Souveränität auch eine innerstaatliche Souveränität des Volkes entnommen. Nach dieser Meinung beinhalte der Begriff der Volkssouveränität darüber hinaus auch, dass das Volk innerhalb der staatlichen Ordnung Ausgangspunkt der staatlichen Gewalt sei und diese zu legitimieren habe.272 In diesem Fall stellt sich das souveräne Volk als Selbstherrscher dar; eine Herrschaft lediglich für das Volk und im Interesse des Volkes würde dem Grundsatz der Volkssouveränität dann nicht gerecht.273 So würde auch eine vom Volk errichtete 267 U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 243; so auch O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 14. 268 D. Lorenz, Der Organstreit vor dem Bundesverfassungsgericht, in: Starck (Hrsg.), Festschrift 25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 225 (246), (Hervorhebung im Original); allerdings erkennt er an, dass das Volk nicht im „Naturzustand“ handelt, sondern der Verfassung unterliegt, S. 248. 269 In diesem Abschnitt wird der Begriff „Volk“ sowohl i. S. des souveränen Gesamtvolkes als auch i. S. der Aktivbürgerschaft verstanden. Dies lässt sich deshalb nicht vermeiden, weil die zu widerlegende Meinung den Unterschied der unterschiedlichen Rollen des Volkes negiert und deshalb den Begriff „Volk“ in beiderlei Sinn gebraucht. Siehe U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 240. 270 A. Randelzhofer, Staatsgewalt und Souveränität, in: HStR, Bd. II, 2004, § 17 Rn. 1. 271 K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 5 I 3, S. 151; E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 5. 272 K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 25 II 2, S. 23; P. Unruh, Weimarer Staatsrechtslehre und Grundgesetz, 2004, S. 30. 273 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 5.
164
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Monarchie, bei der die Macht des Herrschers durch das Volk rücknehmbar bleibt, nach dieser Ansicht die Anforderungen an die Volkssouveränität nicht erfüllen.274 Nach anderer Meinung wird aber eine innerstaatliche Souveränität nicht für erforderlich gehalten. Denn das Volk gebe seine Souveränität auf, wenn es von seiner verfassungsgebenden Gewalt Gebrauch macht,275 so dass es innerhalb der staatlichen Ordnung keine Souveränität mehr besitze. Jedoch ist die hier in Rede stehende Frage umstritten, ob der Grundsatz der Volkssouveränität neben einer ihm etwa zu entnehmenden Selbstherrschaft des Volkes auch die Selbstregierung des Volkes umfasst.276 Vieles spricht dafür, die Selbstregierung des Volkes nicht schon aus dem Prinzip der Volkssouveränität herzuleiten, sondern erst aus dem Demokratieprinzip, das ebenfalls als Verfassungsprinzip normiert ist. Denn das Demokratieprinzip selbst verankert die Selbstregierung des Volkes innerhalb der staatlichen Ordnung. Um es mit dem Worten E.-W. Böckenfördes zu sagen: „Das Volk herrscht nicht nur, es regiert auch.“277 Die Prinzipien der Volkssouveränität und der Demokratie sind jedoch nicht deckungsgleich, auch ist das Demokratieprinzip nicht ein Teil der Volkssouveränität. Die Prinzipien stehen aber nicht unverbunden nebeneinander, das Demokratieprinzip stellt vielmehr eine Ausgestaltung des Prinzips der Volkssouveränität dar.278 Der Zusammenhang wird bisweilen aber so weit überdehnt, dass das Prinzip der Volkssouveränität mit dem Demokratieprinzip gleichgesetzt wird und ihre Unterschiedlichkeit nicht mehr zur Geltung kommt.279 Dass Volkssouveränität und Demokratie aber gleichsam „ineinandergreifen“, erschwert die normative Abgrenzung der beiden Prinzipien. Die „normative Grenzlinie“ zwischen Souveränität und Demokratie wird – wie aufgezeigt – gelegentlich an der Marke der Verfassungsschöpfung gezogen: Volkssouveränität wird 274 Dies wäre aber dann möglich, wenn die Volkssouveränität auf die Schaffung der staatlichen Ordnung beschränkt wäre: E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 5. 275 M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, 2003, S. 225 f.; i. E. ähnlich W. Heun, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2012, S. 104; dieses „Aufgeben“ kann nicht so verstanden werden, dass sich das Volk seiner Souveränität entledigt, sondern nur so, dass es auf sie verzichtet, solange es sich an die staatliche Ordnung, die es geschaffen hat, bindet. 276 Zu dieser Unterscheidung E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 8. 277 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 8; D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 (23), bezeichnet die Demokratie als „effektive Herrschaft“. 278 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24 Rn. 5. 279 P. Kirchhof, Die Identität der Verfassung in ihren unabänderlichen Inhalten, in: HStR, Bd. II, 2004, § 21 Rn. 89.
VII. Mögliche Einwände gegen die organschaftliche Stellung des Volkes
165
dann als vorkonstitutionelles Prinzip, Demokratie hingegen als konstitutionelles Prinzip betrachtet. Eine solche Interpretation verkennt aber, dass auch das Ausgehen der Staatsgewalt vom Volk Ausdruck der Souveränität des Volkes ist. Die innerstaatliche Souveränität ist dabei aber zwangsläufig andersgeartet als die vorkonstitutionelle Souveränität. Innerstaatlich ist ein rechtlich unbeschränkter Souverän nicht vorstellbar, weil alles, was sich innerhalb Rechtsordnung bewegt, an deren Grenzen gebunden ist. Souveränität innerhalb der Rechtsordnung muss deshalb eine gebundene, „verfassungstemperierte Volkssouveränität“ sein.280 Eine solche ist keine Allmachtstellung des Volkes, sondern lediglich eine Position der „Höchstgewalt“ innerhalb des Staates. Die vorkonstitutionelle Volkssouveränität hingegen, die außerhalb der Verfassungsordnung wirkt,281 ist weitestgehend ungebunden. Eine konkrete Bindung ist erst aufgrund ihrer Extrakonstitutionalität282 denkbar, weil sie gerade in keine Rechtsordnung eingebettet ist. Die innerstaatliche Souveränität des Volkes muss damit ohnehin mit dieser Einschränkung verstanden werden. Das Volk ist Träger der staatlichen Gewalt, es ist „verfassungskonstituierte[r] Souverän“.283 Das Prinzip der Volkssouveränität endet damit an der Grenze zwischen Art. 20 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG. Der Satz „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ ist noch Ausdruck der Volkssouveränität,284 während aber die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk nicht mehr Ausdruck der Souveränität ist, sondern ausschließlich das demokratische Prinzip verwirklicht.285 Entsprechend der Meinung, dass auch die Selbstregierung des Volkes Teil des Prinzips der Volkssouveränität sei,286 wird vertreten, dass auch Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG die Volkssouveränität verwirkliche.287
280
M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207. M. Kriele, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL 29 (1971), S. 46 (58); M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 158. 282 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207; auch die Bezeichnung als „Grenzbegriff des Verfassungsrechts“, so E.-W. Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, 1986, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie außerhalb des Verfassungsrechts steht. 283 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207. 284 Zudem ist der Satz aber auch bereits Ausdruck des Demokratieprinzips: BVerfGE 83, 37 (50) – Ausländerwahlrecht, Urteil vom 31. 10. 1990: „Der Verfassungssatz ,Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.‘ (Art. 20 Abs. 2 Satz 2) enthält […] nicht allein den Grundsatz der Volkssouveränität.“ (Hervorhebung nicht im Original). 285 Dezidiert dafür E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2005, § 24, Rn. 8; M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207, hier auch Fn. 12. 286 BVerfGE 93, 37 (66) – Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss vom 24. 5. 1995: „Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 2 GG für die Volkssouveränität“. 287 Unklar BVerfGE 93, 37 (66) – Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Beschluss vom 24. 5.1995. 281
166
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Diese Ansicht wiederum verkennt den Unterschied zwischen der Volkssouveränität und dem Demokratieprinzip als deren Umsetzung.288 Eine staatsorganschaftliche Stellung widerspricht damit der Allmachtstellung des Volkes nicht, weil diese innerhalb der staatlichen Ordnung ohnehin nicht existiert. Es stellt sich dann nur noch die Frage, ob die Stellung des Volkes als Staatsorgan mit seiner Stellung als „Höchstgewalt“ innerhalb des Staates kollidiert. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das Prinzip der Volkssouveränität muss vielmehr zur Konsequenz haben, dass das Volk i. S. d. Aktivbürgerschaft Staatsorgan ist.289 Denn die Höchststellung des Volkes innerhalb der Staatsorganisation, seine Trägerschaft der innerstaatlichen Staatsgewalt, erfordert die Möglichkeit des staatsorganisationsrechtlichen Tätigwerdens des Staatsvolkes. Die innerstaatliche Souveränität des Volkes erfordert das Prinzip der Demokratie, das zum Inhalt hat, dass das Volk innerhalb der staatlichen Ordnung selbst regiert. Die Demokratie ist Ausübungsform des souveränen Volkes.290 So ist auch Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG nicht mehr Ausdruck der innerstaatlichen Souveränität, sondern nur des Demokratieprinzips. Die Norm setzt die Trägerschaft der Staatsgewalt durch das Volk praktisch um. In Wahlen und Abstimmungen ist das Volk nicht mehr nur Bezugsgröße, die als Ausgangspunkt der Staatsgewalt gedacht wird,291 sondern es übt die Staatsgewalt auch tatsächlich aus. Nur durch das Demokratieprinzip kann das Gebot der Volkssouveränität auch praktisch umgesetzt werden. Um innerhalb der Staatsorganisation tatsächlich handeln zu können, ist aber eine staatsorganisationsrechtliche Stellung des Volkes erforderlich. Die Stellung des Volkes als Staatsorgan ist also nicht nur vereinbar mit seiner Souveränität, sondern zu deren Umsetzung sogar erforderlich. Denn das Grundgesetz unterscheidet ausdrücklich zwischen der Trägerschaft der Staatsgewalt, die Ausdruck der Volkssouveränität ist, und deren Ausübung, die Ausdruck des hieraus gerade folgenden Demokratieprinzips ist. Die Ausübung von Staatsgewalt lässt sich nur staatsorganschaftlich beschreiben, so dass auch das Volk als Ausübender von Staatsgewalt als Staatsorgan zu kategorisieren ist.
288
Lediglich der Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG ist damit Ausdruck zugleich der (innerstaatlichen) Souveränität und des Demokratieprinzips, weil er schon andeutet, dass die Souveränität des Volkes auch einer Verwirklichung bedarf. Nicht zufällig stehen deshalb der Art. 20 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG im selben Absatz unmittelbar hintereinander. 289 W. Heun, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2012, S. 104, der allerdings keine souveräne Stellung des Volkes innerhalb der Staatsorganisation anerkennt und die staatsorganschaftliche Stellung deshalb aus der vorkonstitutionellen Souveränität abzuleiten scheint. 290 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 161: „Das Prinzip der Volkssouveränität und jenes der Demokratie stehen zueinander im Verhältnis von Ziel und Mittel. [… D]as Demokratieprinzip [stellt] Mittel und Instrumente jeder auf das Staatsvolk rückführbaren Rechtfertigung von Herrschaft bereit.“ 291 Zum rechtlichen Gehalt von Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 158 ff.
IX. Eigenschaften des Staatsorgans Volk
167
Als Träger der Staatsgewalt ist das Volk hingegen kein Staatsorgan, sondern Ausgangspunkt der staatlichen Gewalt. Erst für die Umsetzung der Staatsgewalt nimmt es die Stellung eines Organs ein, weil es sich dann in die Staatsorganisation – an oberster Stelle – einbettet. So ist dann auch nur das Volk in Form der Aktivbürgerschaft Staatsorgan.
VIII. Zwischenergebnis Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft, des wahl- und stimmberechtigten Teils des Volkes, Aufgaben für den Staat wahrnimmt, indem es Staatsgewalt ausübt. Die Aktivbürgerschaft ist somit Staatsorgan.292 Kein Staatsorgan ist hingegen das Gesamtvolk, denn es agiert nicht selbst, sondern stiftet lediglich als Bezugssubjekt Legitimation aufgrund seiner (innerstaatlichen) Souveränität. Denn auch zur Übertragung der Herrschaftsmacht des Gesamtvolkes bedarf es der Ausübung von Staatsgewalt, weil das Volk hier innerhalb der Staatsorganisation agieren muss, um Legitimation zu vermitteln. Es steht gerade nicht außerhalb der staatlichen Ordnung, weil es so die Legitimation für die Ausübung von Staatsgewalt nicht übertragen könnte. Seine Sonderstellung im Staat als legitimationsvermittelndes Organ ist mit der Beschreibung als „Ur-Organ“293 hervorgehoben. Die Aktivbürgerschaft weist als Organ aber einige Besonderheiten auf. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden. Die staatsorganisationsrechtlichen Kompetenzen des Volkes als Organ liegen in Wahlen und Abstimmungen, sie bedürfen aber der weiteren Konkretisierung. Auf diese Handlungsformen ist es zur Ausübung der Staatsgewalt beschränkt, es kann sich nicht beliebiger Handlungsformen bedienen.
IX. Eigenschaften des Staatsorgans Volk 1. Gleichordnung des Volkes mit den obersten Staatsorganen? Die obersten Bundesorgane sind einander grundsätzlich gleichgestellt.294 Sie üben gemeinsam die dem Staat obliegenden Aufgaben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich aus. Eine Qualifizierung des Volkes als Staatsorgan könnte das Volk den anderen Staatsorganen des Bundes gleichstellen. Dem Volk kommt jedoch in der 292 „Das Volk wächst hierbei über seine Rolle als Träger der Staatsgewalt hinaus und wird selbst zum Verfassungsorgan“, S. Haack, Verlust der Staatlichkeit, 2007, S. 290. 293 S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 80 (86). 294 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961, S. 96; U. Preuß, Das Landesvolk als Gesetzgeber, DVBl. 1985, S. 710 (712); K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 I 2, S. 42.
168
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Staatsorganisation eine hervorgehobene Position zu, die zwar aus der Eigenschaft des Gesamtvolkes als Träger der Staatsgewalt resultiert, aber auch darüber hinausgeht. Ohne sein Handeln erhalten die übrigen Organe keine demokratische Legitimation, sein Handeln legitimiert die Ausübung von Staatsgewalt durch andere Organe erst. Es ist das Ur-Organ295 des demokratischen Staates, von dem alle anderen Organe ausgehen. Damit hebt es sich qualitativ von den anderen Organen ab, es ist ihnen übergeordnet. Schon der Bundestag wird gerade aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals, der unmittelbaren Legitimation, bisweilen gar als „höchstes Staatsorgan“ bezeichnet.296 Es ist die unmittelbare Legitimation durch das Volk, die dazu führt, den Bundestag als hervorgehobenes Organ zu qualifizieren. Mit diesen Erwägungen kann es nur einhergehen, nicht dem Bundestag, sondern dem Volk die höchste Stellung im Staat zuzubilligen. Es ist höchstes Staatsorgan297 und entzieht sich damit der Gleichordnung der übrigen obersten Staatsorgane.298
2. Das Volk als ständiges Organ Es stellt sich auch die Frage, ob das Staatsorgan Volk ständig vorhanden ist, oder ob es nur dann, wenn es zusammentritt, als Staatsorgan existiert. In Erscheinung tritt das staatsorganschaftliche Volk nur im Zusammenhang mit seiner einzigen Zuständigkeit: der Wahl des Parlaments.299 Der Zeitpunkt der Parlamentswahl ist der einzige Zeitpunkt seines „Zusammentritts“.300 Im Übrigen ist es innerhalb der Staatsorganisation als formierte Größe nicht sichtbar, es scheint auf den ersten Blick lediglich in seiner unformierten Gestalt, als gesellschaftliche Größe, zu existieren. Dies liegt vor allem daran, dass das Volk keinen festen Raum hat, in dem es tätig wird,
295
S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 86. K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 I 2, S. 42: Der Bundestag stehe an der Spitze der Organe des Staates. 297 So auch M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 167, 189, m. V. a. U. Affolter, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie, 1948, S. 60 f. und 83 f. 298 Damit ist auch die die Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes widerlegt, die Willensbildung im demokratischen Staat vollziehe sich „von unten nach oben“. Sie vollzieht sich vielmehr von oben, nämlich vom Volk als höchstem Staatsorgan, nach unten bis zum in der Hierarchie untersten Amtswalter. So auch M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 189, hier auch Fn. 49. 299 Dies gerade, weil Abstimmungen im Grundgesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sind. 300 Der sich freilich nicht als Treffen aller gestaltet, sondern sich durch das Einfinden eines jeden in der Wahlkabine abspielt. C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 245, kritisiert die geheime Einzelwahl deshalb, weil sich der Citoyen in einen Privatmann verwandle und so das Volk nicht mehr als Volk wähle. 296
IX. Eigenschaften des Staatsorgans Volk
169
der während seiner Untätigkeit an seine Existenz als Organ erinnern würde. Dies legt prima facie den Schluss nahe, dass es auch nur dann besteht, wenn es tätig wird.301 Es sei jedoch klargestellt, dass auch dies seine Organqualität nicht infrage stellen würde, weil die ständige Präsenz nicht Voraussetzung der Organeigenschaft ist. Für die Eigenschaft als Organ ist es vielmehr ausreichend, dass ein Organ nur dann besteht, wenn es seine Zuständigkeiten wahrnimmt, denn dies ist der Zweck, um dessen Willen es existiert. Deutlich zeigt sich dies am Beispiel der Bundesversammlung. Diese tritt ausschließlich dann zusammen, wenn sie tätig wird, indem sie den Bundespräsidenten wählt; sie existiert darüber hinaus aber auch nur bis zum Abschluss ihres Tätigwerdens. Für jedes Tätigwerden wird sie neu konstituiert, die zu wählenden Mitglieder werden neu gewählt. Die Bundesversammlung besteht zwar zur Hälfte auch aus Mitgliedern, die qua Amt Mitglieder der Bundesversammlung sind, den Abgeordneten des Bundestages,302 zur anderen Hälfte besteht sie aber aus jeweils neu zu wählenden Mitgliedern,303 die nur aus Anlass des Tätigwerdens der Bundesversammlung zu Organwaltern bestellt werden. Für Wahl des Bundespräsidenten ist also jeweils ein anlassbezogener Kreationsakt vonnöten. Damit ist die gesamte Bundesversammlung als Organ nur während ihrer Tätigkeit existent, sie ist dennoch Organ des Bundes, jedoch kein ständiges Organ.304 Das Volk hingegen besteht als Staatsorgan nicht nur dann, wenn es tätig wird. Da es nur aus „geborenen“ Mitgliedern besteht, existiert es vielmehr permanent. Wird das Volk in Wahlen tätig, sei es regelmäßig oder außerordentlich nach einer Bundestagsauflösung gemäß Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG, bedarf es keines Bestellungsaktes seiner Mitglieder. Die Mitglieder des Staatsorgans Volk stehen stets schon fest, die Summe der Aktivbürger ist in der Verfassung in Art. 20 Abs. 2 S. 2, Art. 38 Abs. 2 GG weitgehend festgelegt, im Übrigen im Bundeswahlgesetz, das gemäß Art. 38 Abs. 3 GG das Wahlsystem näher ausgestaltet.305 Auch die Aufnahme in das Wählerverzeichnis, die nach § 14 Abs. 1 BWahlG Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist, ist für die Zugehörigkeit zum Staatsorgan „Aktivbürgerschaft“ nicht konstitutiv, sondern deklaratorisch. Nicht das Innehaben des Wahlrechts, sondern lediglich dessen Ausübbarkeit ist von der Eintragung ins Wählerverzeichnis
301 So für die Bürgerschaft in Abstimmungen U. Dustmann, Die Regelung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, 2000, S. 127, 230; in Wahlen sei die Bürgerschaft nach Dustmann ohnehin kein Organ, weil sie dann keine Entscheidungen für die Gemeinde treffe. 302 Art. 54 Abs. 3 GG. 303 U. Fink, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 54 Abs. 4, 5 Rn. 34. 304 M. Nettesheim, Die Bundesversammlung und die Wahl des Bundespräsidenten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 63 Rn. 1. 305 Ähnlich C. Gusy, Das Mehrheitsprinzip im demokratischen Staat, AöR 106 (1981), S. 329 (344). Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG und Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG sagen hingegen entgegen seiner Annahme nichts über die personelle Zusammensetzung des Wahlvolkes aus.
170
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
abhängig.306 Das Wählerverzeichnis dient nur der Organisation der Wahl, nicht der Konstituierung des Wahlorgans.307 Das Volk ist also als Staatsorgan stets existent, auch wenn es nicht tätig ist und deshalb in seiner organschaftlichen Rolle nicht sichtbar wird.308
3. Abhängigkeit des Volkes von seinen Organwaltern Als geborenes Organ ergibt sich für das Volk die Besonderheit, dass es in seiner Existenz von seinen Organwaltern abhängt. Unabhängig von seinen Organwaltern wird ein Organ im Normalfall zunächst abstrakt durch die Rechtsordnung geschaffen, erst durch die Besetzung mit Organwaltern erhält es dann eine konkrete Besetzung und damit eine konkrete Form. Denkt man aber die Organwalter hinweg, besteht das Organ immer noch als Teil des institutionellen Gefüges mit seinen Kompetenzen und Funktionen. Aus diesem Grund kann die Besetzung eines Organs mit Organwaltern in der Regel zeitlich nur auf die Existenz des Organs folgen. Die Organwalter des Staatsorgans Volk liegen jedoch dem Organ voraus. Denn die Aktivbürgerschaft besteht aus der Gruppe der wahlberechtigten Bürger, dem wahlberechtigten Teil des Staatsvolks. Ohne Bürger gibt es kein Wahlvolk, keine Aktivbürgerschaft. Das Staatsorgan Volk ist deshalb schon in seiner Existenz abhängig von der Existenz seiner Organwalter.309 Allerdings wird das Volk als verfassungsrechtliche Größe dennoch nicht durch die Bürger konstituiert,310 sondern durch das Recht. Denn die Gruppe der Menschen, aus denen sich das Volk zusammensetzt, wird ohne Rechtsordnung nicht zum (verfassten) Volk, sondern verbleibt im Status eines vorrechtlichen, diffusen Volkes. Erst die Rechtsordnung weist dem Volk die Stellung als Organ im Verfassungsgefüge zu, indem sie es mit Kompetenzen 306 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 156; zumindest missverständlich aber W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 17 Rn. 2, nach dem der Kreis der Wahlberechtigten durch das Wählerverzeichnis festgelegt wird. Das Wählerverzeichnis stellt den Kreis der Wahlberechtigten aber nur fest, nur die Wahlrechtsausübungsmöglichkeit hängt von der Eintragung ins Wählerverzeichnis ab (vgl. 14 BWahlG). Die Nichteintragung ins Wählerverzeichnis spricht dem Wahlberechtigten nicht das Wahlrecht ab, sie ist nur Wahlrechtsausübungshinderungsgrund. Die Voraussetzung der Eintragung in ein Wählerverzeichnis ist nur deshalb verfassungsrechtlich zulässig, weil das Wahlrecht ein Recht innerhalb der Staatsorganisation ist, und dies eine Organisation des Wahlaktes erforderlich macht. 307 Durch die Wahl wird damit die Aktivbürgerschaft zwar organisiert, aber nicht konstituiert. 308 So auch H. Liermann, Das deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichsstaatsrecht der Gegenwart, S. 143. 309 Für die Bürgerschaft der Gemeinde: M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (346). 310 So aber – wiederum für die Bürgerschaft – M. W. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (346).
IX. Eigenschaften des Staatsorgans Volk
171
betraut. Aus diesem Grund ist es legitim, vom Volk als einer „rechtlichen Kunstgröße“ zu sprechen.311 Die Besonderheit des Handelns des Volkes als höchstem Staatsorgan liegt darin, dass es das einzige staatliche Handeln ist, das seinerseits nicht legitimierungsbedürftig ist, sondern ausschließlich selbst legitimierend wirkt.312 Es ist kein Bestellungsakt für das Volk denkbar, weil ein solcher immer legitimationsstiftend wirkt. Das Volk bedarf aber der Legitimation nicht nur nicht, jeder Legitimationsakt würde vielmehr seine Souveränität untergraben. Es muss deshalb notwendigerweise durch eine Norm konstituiert werden, die es in seiner Eigenschaft als pouvoir constituant selbst geschaffen hat. Hieran zeigt sich die Bedeutung des Volkes als Träger nicht nur der Staatsgewalt, sondern auch des gesamten Staates. Der Staat als Organisation ist von der Existenz des Volkes nicht nur faktisch, sondern auch institutionell abhängig.313 Weil alles staatliche Handeln nur um des Volkes willen vonnöten ist, macht auch erst das Existieren eines Staatsvolkes den Staat und damit auch die staatliche Ordnung erforderlich. Nur auf diese Weise kann das Volk als Staatsorgan, als Ausgangspunkt und Mittler der Legitimation aller staatlichen Gewalt in die Staatsorganisation eingebettet sein.
4. Die Gesellschaft als „Forum“ des Volkes Das Volk als Staatsorgan zeigt sein Antlitz als Staatsorgan nur im Wahlakt selbst. Im Übrigen tritt es staatsorganschaftlich nicht in Erscheinung, auch wenn es – wie gesehen – als solches immer besteht.314 Es hat deshalb auch kein institutionalisiertes Diskussionsforum, in dem politische Alternativen diskutiert, Anliegen formuliert werden könnten und Austausch stattfinden könnte, wie es beispielsweise für den Bundestag der Fall ist. Dessen Willensbildung vollzieht sich nicht nur im Moment der Abstimmung institutionalisiert, sondern auch in seiner „Vorformung“.315 Der Meinungsbildungsprozess des Volkes findet hingegen – wie oben gezeigt – im gesellschaftlichen Bereich statt. Es ist der gesellschaftliche Willensbildungsprozess, der die Funktion eines „Plenums des Volkes“ übernimmt. Innerhalb dieses Wettbewerbs der Meinungen werden die relevanten Themen besprochen, hier werden 311
M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 189. M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 18. Gerade die mangelnde Legitimierungsbedürftigkeit des Handelns des Volkes in Wahlen nimmt W. Frenz, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (521), als Argument dafür, dass das Wahlrecht dem gesellschaftlichen Bereich zuzuordnen sei. 313 E.-W. Böckenförde, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, 1973, S. 26. 314 Auch wenn es – wie gesehen – als solches immer besteht. 315 Zum parlamentarischen Verfahren ausführlich: W. Zeh, Parlamentarisches Verfahren, HStR, Bd. III, 2005, § 53 Rn. 28 ff. 312
172
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
Meinungen präsentiert und es wird versucht, diese als herrschend zu platzieren und andere von den eigenen Ansichten zu überzeugen. Das Diskussionsforum des Staatsorgans Volk wird so nicht staatsorganisationsrechtlich gebunden organisiert, sondern die Vorformung der politischen Willensbildung des Volkes vollzieht sich eben gerade „frei, offen und unreglementiert“.316 Für diesen Prozess bedarf es der Grundrechte nicht nur als Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat, sondern als Rechte, die dem Einzelnen die Teilhabe an einem Kommunikationsprozess ermöglichen, der Voraussetzung dafür ist, dass der Einzelne eine ernsthafte, informierte Wahlentscheidung treffen kann.317 Aus diesem Grund sind die Kommunikationsgrundrechte „schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“,318 weil sie die öffentliche Meinung erst möglich machen, die die Aufgabe der „Vorformung der politischen Willensbildung des Volkes“ übernimmt.319 Damit wird die Ausübung von Staatsgewalt hier im gesellschaftlichen Bereich vorbereitet, während die Vorbereitung von Hoheitsakten im Übrigen „nicht weniger eine organschaftliche Funktionsausübung als ihr Beschluss“ ist.320 Es ergibt sich also beim Staatsorgan Volk die weitere Besonderheit, dass nur der Beschluss sich als organschaftliche Funktionsausübung, deren Vorbereitung sich aber als Grundrechtsausübung und damit als Ausübung von Individualrechten darstellt.321
X. Rechte des Volkes Das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft besitzt damit gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG die latente Kompetenz zu Wahlen und Abstimmungen. Die Kompetenz der Aktivbürgerschaft zu wählen ist in Art. 38 GG näher konkretisiert. Hiernach ist sie zuständig, den Deutschen Bundestag zu wählen. Da sich die Befugnis zur Wahrnehmung der Kompetenz als „Recht“ beschreiben lässt,322 steht der Aktivbürgerschaft damit das Recht zu, den Bundestag zu wählen. Fraglich ist jedoch, welche
316
BVerfGE 20, 56 (98) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. W. Schmitt Glaeser, Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 38 Rn. 3. Die demokratisch-funktionalen Grundrechtstheorie versteht die Grundrechte gerade von ihrer öffentlichen und politischen Funktion her, die liberale Grundrechtstheorie aber blendet diese Funktion der Grundrechte zwar nicht aus, definiert sie aber nicht über diese Funktion. Hierzu E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 1529 (1531, 1534 f.). 318 H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (256). 319 BVerfGE 8, 104 (113) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. 320 S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 455. 321 P. Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, 1995, S. 184 f.: „Unter ihren Bedingungen verharrt die Entscheidungsfindung der Stimmbürgerschaft bis zuletzt in gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen.“ 322 Siehe hierzu oben in Abschnitt A. II. 2., S. 18. 317
X. Rechte des Volkes
173
Rechte die Kompetenz zu wählen außerdem beinhaltet. W. Roth unterscheidet Rechte von Organen aus, auf und an ihrer Kompetenz.323 Organe hätten kein Recht auf ihre Kompetenz, also kein Recht auf Übertragung von Kompetenzen, weil es der Organisation freistehe, Kompetenzen zu übertragen.324 Eine Ausnahme könne allenfalls da bestehen, wo ein Mindestmaß an Kompetenzen eines Organs verfassungsänderungsfest gesichert ist.325 Auch dies bezweifelt Roth jedoch deshalb, weil auch diese Kompetenzen zur Disposition des verfassungsgebenden Souveräns stünden und deshalb durch diesen entzogen werden könnten. Indes kann auch der verfassungsgebende Souverän die Rechte nur dann entziehen, wenn gleichzeitig die geltende Verfassungsordnung aufgegeben wird und damit auch das Organ selbst untergeht. Zwar mag dann die Organisation als solche fortbestehen, das Organ besteht dann aber jedenfalls als solches nicht mehr fort. Solange aber die Verfassungsordnung und damit auch das Organ Bestand haben, kann die Kompetenz dem Organ nicht entzogen werden. Es lässt sich also durchaus davon sprechen, dass dem Organ dann ein Recht auf seine Kompetenz zusteht. Dagegen anerkennt Roth Rechte von Organen an ihrer Kompetenz, also auf Durchführung ihrer Kompetenz, welche er an der Gesetzgebungskompetenz des Bundestages deutlich macht. Diese verleihe dem Bundestag das Recht, die Kompetenz auszuüben, nicht aber das Recht, Gesetze als eigene zu erlassen. Deshalb verletzten nachgeordnete Verwaltungsstellen, wenn sie ein Gesetz missachten, nicht Rechte des Parlaments, sondern den allgemeinen Normbefolgungsanspruch der Rechtsgemeinschaft.326 Auch sieht Roth keine Rechte von Organen aus der Kompetenz. Sie hätten also keine Rechte auf diejenigen Wirkungen, die sie aufgrund ihrer Kompetenz herbeizuführen vermögen. Er veranschaulicht dies an dem fehlenden Anspruch einer Behörde auf Vollzug eines von ihr gegenüber einem Bürger erlassenen Verwaltungsakts. Dieser stünde nur der hinter ihr stehenden juristischen Person zu.327 Allerdings klärt er nicht, inwieweit Organe Rechte aus ihrer Kompetenz gegenüber anderen Organen darauf haben, dass der Ausübung ihrer Kompetenz zur Wirkung verholfen wird. Solche Rechte sind durchaus anzuerkennen. Ohne derartige Rechte würden die Rechte des Organs an der Kompetenz zur Farce, denn es könnte die Kompetenz zwar ausüben, dort aber, wo die Wirkung nicht aus der Wahrnehmung der Kompetenz unmittelbar folgt, liefen die Rechte an der Kompetenz ins Leere. So hat der Bundestag beispielsweise ein Recht auf Ausfertigung eines von ihm in verfassungsmäßiger Weise beschlossenen Gesetzes gegenüber dem Bundespräsi-
323 324 325 326 327
W. Roth, Verwaltungsgerichtliche Organstreitigkeiten, S. 487 – 493. W. Roth, Verwaltungsgerichtliche Organstreitigkeiten, S. 489. W. Roth, Verwaltungsgerichtliche Organstreitigkeiten, S. 490. W. Roth, Verwaltungsgerichtliche Organstreitigkeiten, S. 491 f. W. Roth, Verwaltungsgerichtliche Organstreitigkeiten, S. 488.
174
E. Das Volk als Staatsorgan in der Demokratie des Grundgesetzes
denten.328 Solche Rechte sind jedoch keine Rechte an der Kompetenz, denn sie betreffen nicht die Ausübung der Kompetenz durch das Organ selbst. Sie sind vielmehr Rechte aus der Kompetenz, weil sie auf das Handeln anderer Organe gerichtet sind und sich gerade aus der Kompetenz (und ihrer rechtmäßigen Ausübung) ergeben. Rechte aus der Kompetenz sind also nur insoweit abzulehnen, als sie gegenüber anderen Rechtsträgern, insbesondere dem Bürger, bestehen sollen. Die Wirkung des Rechts des Volkes, den Bundestag zu wählen, verbleibt aber ohnehin innerhalb der Staatsorganisation. Hier lässt sich durchaus davon sprechen, dass es ein Recht gegenüber den Wahlorganen329 hat, dass der Bundestag seinem Willen entsprechend zusammengesetzt wird, das gerade aus seiner Kompetenz zu wählen folgt. Die Wahlkompetenz des Volkes beinhaltet also sowohl das Recht, dass Wahlen in dem in Art. 39 Abs. 1 GG genannten Zeitraum stattfinden – dies folgt aus dem Recht an der Kompetenz – als auch das Recht, dass der Bundestag nach seinem Willen zusammengesetzt wird, das ein Recht aus der Kompetenz darstellt. Dabei kann es allerdings nicht darüber bestimmen, wie aus den Einzelwillen der einzelnen Wahlberechtigten der Wille gebildet wird. Denn es kommen hierfür unterschiedliche Verfahren in Betracht, die lediglich die in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG gestellten Anforderungen erfüllen müssen. Die Wahlgrundsätze determinieren damit den Willensbildungsprozess des Volkes. Werden die Wahlgrundsätze verletzt, liegt damit auch eine Verletzung des Rechts des Volkes auf eine seinem Willen entsprechende Zusammensetzung des Bundestages vor, wenn die Verletzung Einfluss auf das Wahlergebnis und damit auf die Besetzung des Bundestages gehabt hat oder haben könnte.330 Die Durchführung der Wahl ist auch davon abhängig, dass es tatsächlich ein dem Art. 38 Abs. 1 GG entsprechendes Wahlsystem gibt. Deswegen wird dem Gesetzgeber in Art. 38 Abs. 3 GG die Ermächtigung erteilt, ein Wahlgesetz zu erlassen, in dem die Modalitäten der Wahl geregelt sind; gleichzeitig ist der Gesetzgeber zum
328
Dem entspricht die Pflicht des Bundespräsidenten, verfassungsgemäß zustande gekommene Gesetze auszufertigen, F. Ossenbühl, Verfahren der Gesetzgebung, in: HStR V, 2007, § 102 Rn. 70. 329 Insbesondere gegenüber dem Bundeswahlausschuss, der gemäß § 42 Abs. 2 BWahlG feststellt, wie viele Sitze auf die einzelnen Landeslisten entfallen und welche Bewerber gewählt sind. Aber auch gegenüber den untergeordneten Organen, den Wahlvorständen, den Kreiswahlausschüssen sowie den Landeswahlausschüssen, auf deren Feststellung das Ergebnis des Bundeswahlausschusses beruht (§§ 40 bis 42 Abs. 1 BWahlG). 330 Es ist nicht bei der Verletzung eines jeden Wahlgrundsatzes ersichtlich, ob sie sich tatsächlich auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat. So ist es z. B. bei einem Verstoß gegen den Grundsatz der geheimen Wahl nicht klar, welches Wahlergebnis bei Einhaltung des Grundsatzes zustande gekommen wäre. Es kommt dann darauf an, ob die der Verstoß sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben könnte, was insbesondere davon abhängt, wie viele Wahlberechtigte von dem Verstoß betroffen sind. Im Wahlprüfungsverfahren wird dies als Grundsatz der „Mandatsrelevanz“ beschrieben. Siehe hierzu unten in Abschnitt G. I. 1., S. 243 ff.
X. Rechte des Volkes
175
Erlass einer solchen Norm verpflichtet.331 Die Kehrseite dieser Verpflichtung ist wiederum ein Recht des Volkes, das aus seiner Kompetenz zu wählen folgt. Darüber hinaus hat das Volk aber auch ein Recht auf seine Kompetenz zu wählen. Dieses Recht auf die Kompetenz, durch Wahlen die Ausübung der Staatsgewalt zu legitimieren, folgt aus der latenten Kompetenz des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, der durch Art. 79 Abs. 3 GG der Disposition des verfassungsändernden Gesetzgebers entzogen ist. Zwar folgt hieraus nicht das konkrete Recht auf Wahlen zum Deutschen Bundestag, jedoch muss das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft in die Lage versetzt werden, die Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen in einer Form auszuüben, durch die die (innerstaatliche) Souveränität des Gesamtvolkes des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG verwirklicht wird. Die Aktivbürgerschaft muss den legitimatorischen Konnex zwischen dem Gesamtvolk und der Staatsgewalt bilden können.
331 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 3 Rn. 157; H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 164.
F. Der Einzelne im Wahlakt Nachdem die Untersuchung ergeben hat, dass die Aktivbürgerschaft, der wahlberechtigte Teil des Volkes, im Wahlakt als Staatsorgan handelt, soll nun die Stellung des Einzelnen im Wahlakt untersucht werden. Es läge nahe, auch den Einzelnen als Teil des Volkes im Wahlakt als Organteil der Aktivbürgerschaft zu qualifizieren und so auch das Wahlrecht als Ausübung eines organschaftlichen Rechts zu verstehen. Dem könnte jedoch entgegenstehen, dass die Demokratie auf Freiheitsverwirklichung des Einzelnen angelegt ist. Die Ausübung einer Kompetenz, eines organschaftlichen Rechts, hingegen ist nicht der Freiheitsverwirklichung der Organwalter zu dienen bestimmt, sondern der Erfüllung von Staatsaufgaben.
I. Das Wahlrecht des einzelnen Bürgers als Recht der gesellschaftlichen Sphäre? Dass sich das Wahlrecht an der Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft bewegt,1 könnte es zulassen, das Handeln des Gesamtvolkes vom Handeln des Einzelnen zu unterscheiden. So könnte erst das Wahlergebnis als das Resultat aus der Gesamtheit der abgegebenen Stimmen als Handlung des gesamten Volkes aufzufassen sein, während die Stimmabgabe des einzelnen Bürgers noch in die gesellschaftliche Sphäre und damit in den Bereich seines individuellen Beliebens fallen könnte. Das Wahlrecht des Einzelnen würde dann als Individualrecht aufzufassen sein, während sich das Handeln des Volkes in Form der Aktivbürgerschaft als Organtätigkeit darstellt.2 Dies setzt eine Unterscheidung zwischen der Stimmabgabe der einzelnen Bürger und dem Resultat aus allen Stimmabgaben, dem aus ihnen resultierenden Volks1
H. Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im Verfassungsstaat, JZ 1994, S. 741 (741 f.), sieht diese beiden Sphären aber nicht als „kategorial getrennt“ an, diese wirkten vielmehr ineinander und stünden im wechselseitigen Bezug. Dass die Sphären aufeinander einwirken, ist zwar richtig, dies darf aber nicht über die Trennung beider Sphären hinwegtäuschen. Diese „diffundieren“ nicht etwa ineinander. Bisweilen wird der Wahlakt als Übergang zwischen den Sphären beschrieben; so etwa von W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92). 2 Auch für Abstimmungen wird teilweise angenommen, dass das Abstimmungsrecht des Einzelnen zwar ein subjektiv-öffentliches Recht sei, die Gemeinde (als Äquivalent zum Volk auf kommunaler Ebene) aber eine Kompetenz ausübe: so M. Fügemann, Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger, DVBl. 2004, S. 343 (347, 349); kritisch aber U. Schliesky, Aktuelle Rechtsprobleme bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, DVBl. 1998, S. 369 (370).
I. Das Wahlrecht des Bürgers als Recht der gesellschaftlichen Sphäre?
177
willen, voraus.3 Eine solche Unterscheidung unternimmt Walter Frenz.4 Er verortet die Stimmabgabe des Bürgers dementsprechend in der gesellschaftlichen Sphäre.5 Durch die Stimmabgabe bringe der Bürger sein Sonderinteresse in den Staat ein; sein Votum sei Ausdruck seiner persönlichen Autonomie und Selbstbestimmung, die den Bereich der Gesellschaft kennzeichneten. Das Interesse an einem bestimmten Wahlausgang, das mit der Stimmabgabe verbunden ist, sei notwendig immer ein Sonderinteresse. Erst die Zählweise und Gewichtungen, die als Wahlsystem aus den Einzelwillen den Gesamtwillen des Volkes formen, beraubten den Einzelwillen ihrer Natürlichkeit und formten den Volkswillen, der als Grundlage der Zusammensetzung des Parlaments diene. Dabei sieht Frenz aber einen Ausgleich der Sonderinteressen darüber hinaus nicht bereits in der Bildung des Volkswillens, auf dessen Grundlage das Parlament geformt wird, vielmehr seien die unterschiedlichen Sonderinteressen auch im Parlament noch vertreten. Erst hier würden durch Entscheidungen von Sachfragen durch die Abgeordneten und durch die Wahl der Regierung, die selbst oder durch die unterstehende Verwaltung Entscheidungen trifft, Einzelinteressen und Gemeinwohlbelange zum Ausgleich gebracht und hierdurch ein relativ einheitlicher Wille geschaffen. Erst dieser bilde dann die Basis für die auf Bindung und Rechtsgehorsam angelegte Staatsgewalt. Die Stimmabgabe bei Wahlen als demokratische Teilhabe sei damit lediglich der Weg, auf dem die Sonderinteressen in den Staat gelangen, stehe aber selbst noch im gesellschaftlichen Bereich. Frenz unterscheidet aber nicht nur zwischen der Stimmabgabe des Einzelnen und dem Volkswillen als Ganzem, er rechnet auch den Volkswillen als Ganzes noch der gesellschaftlichen Sphäre zu. Denn die Staatsorgane bedürften einer Legitimation durch einen außerhalb der eigentlichen Staatsgewalt stehenden Träger.6 Die Scheidelinie zwischen Staat und Gesellschaft sei deshalb auch keine Funktions-, sondern eine Legitimationsgrenze zwischen dem, was der Legitimation bedarf, und dem, was ohne Herleitung auskomme. Weil der demokratische Legitimationsvorgang selbst aber keiner Legitimation bedürfe, gehöre er in den gesellschaftlichen Bereich.7 Für eine Verortung der Stimmabgabe in der gesellschaftlichen Sphäre bedürfte es nach Frenz’ Konstruktion einer Unterscheidung zwischen Stimmabgabe 3 So J. Hatschek, Kommentar zum Wahlgesetz und zur Wahlordnung im Deutschen Kaiserreich, 1920, S. 184. 4 Hierzu und zum Folgenden W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (516 f.). 5 So ausdrücklich auch BVerfGE 118, 277 (353) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007. 6 W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (521); so auch D. Ehlers, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGOKommentar, 9. Lfg., (Stand: Sep. 2003), § 40 Rn. 153. 7 W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (523).
178
F. Der Einzelne im Wahlakt
der einzelnen Bürger und dem Wahlergebnis als dem Willen des Gesamtvolkes deshalb nicht. Nach der hier zugrunde gelegten Ansicht vollzieht sich aber die Bildung des Volkswillens in der staatlichen Sphäre. Denn das Volk übt bei der Wahl staatsorganisationsrechtlich relevante Handlungen aus, die es nur innerhalb der Staatsorganisation erfüllen kann. Die Staatsorgane bedürfen der Legitimation nicht durch einen außerhalb der Staatsgewalt stehenden Träger, sondern durch das Volk, das durch den Legitimierungsakt selbst Staatsgewalt ausübt, die dann innerhalb der staatlichen Sphäre wirkt. Ein Handeln des Einzelnen dennoch in der gesellschaftlichen Sphäre im Gegensatz zum Handeln des Volkes in der staatlichen Sphäre setzt voraus, dass sich die Stimmabgabe des Einzelnen vom Wahlresultat als Ganzem nicht nur logisch, sondern auch rechtlich trennen lässt. Auf den ersten Blick scheint es zwar möglich, dem Volk als Gesamtheit nur das Gesamtergebnis der Wahl zuzurechnen, die Stimmabgabe aber den einzelnen Bürgern. Doch lässt sich dadurch nicht verdecken, dass das Wahlergebnis auf das Volk als Ganzes und nicht auf die Summe der Bürger rückführbar sein muss, weil nur das Wahlvolk in seiner Gesamtheit der Staatsgewalt die nötige Legitimation verschaffen kann, nicht aber die einzelnen Wahlberechtigten, die tatsächlich abgestimmt haben.8 Dabei ist Ausgangspunkt der Legitimation nicht erst der Volkswille, sondern das Volk selbst, das, obwohl es als eigene Entität gedacht wird, aus den einzelnen Bürgern besteht. Denn die Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht von seinem Willen. Sein Wille, der durch den Modus des Wahlsystems aus dem „Rohmaterial“ der Einzelstimmen als „Kunstschöpfung des Rechts“9 geformt wird, ist nur das Mittel, durch das das Volk Legitimation stiftet. Das bedeutet aber, dass das Volk schon in seiner Wahlhandlung als Volk und nicht als Summe der Bürger handelt. Nicht erst die „Willensvereinheitlichung“ durch die Bildung des Wahlergebnisses formt das Volk zur Legitimationseinheit, es besteht als Subjekt schon zuvor. Die Ermittlung des Wahlergebnisses fasst nur die heterogenen Einzelwillen innerhalb des Volkes zur „Einheit“ zusammen. Die Stimmabgabe des Einzelnen und die Wahlhandlung des ganzen Volkes lassen sich nicht unterscheiden.10 Die Stimmabgabe des einzelnen Bürgers ist vielmehr schon Teil der Gesamthandlung des Volkes. Dies bedeutet auch, dass der Einzelne nicht als isoliertes Individuum wählt, sondern gerade als Teil des Volkes; sein Wille wird nicht nur gemeinsam mit anderen zur Grundlage des Volkswillens gemacht, sondern er tritt bereits rechtlich als Teil des Volkes an die Wahlurne. Damit befindet sich bereits der einzelne Bürger bei der
8
Hierzu oben in Abschnitt E. V. 3. b), S. 137 ff. J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (164). Siehe hierzu auch oben in Abschnitt E. VII. 2. d), S. 160 f. 10 So auch A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 190. 9
II. Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen
179
Stimmabgabe im staatlichen Bereich.11 Er handelt schon als Teil des Staatsorgans Volk, auch sein Recht kann damit nur als organschaftliches Recht, als Ausübung einer Kompetenz, verstanden werden.12
II. Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen Dieser Befund wirft die Frage auf, wie das Eingebundensein in das Rechtssubjekt „Volk“ sich mit der Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen vereinbaren lässt. Der Demokratietheorie, die das Volk „als Größe eigenen Rechts“13 sieht, wird gerade zum Vorwurf gemacht, dass sie den Rückbezug auf das Individuum verleugnen würde, der Ziel der modernen Demokratietheorie sei.14 Die individuelle Freiheit löse sich dann in der kollektiven Autonomie auf und führe zur Aufgabe der natürlichen Freiheit in diesem Zusammenhang.15 Demokratie sei aber nicht Herrschaft des Volkes im rousseauschen Sinne, sondern Herrschaft der Bürger.16 Dieser Ansicht ist zuzugeben, dass der Demokratie als Staatsform die Idee der Freiheit des Einzelnen zugrunde liegt,17 was der Subjektstellung des Volkes und der Mediatisierung des Einzelnen über das Volk im Wahlakt zunächst zuwider zu laufen scheint. Innerhalb der staatlichen Ordnung lässt sich die Freiheit als natürliche Freiheit aber nicht verwirklichen. Die Aufgabe der natürlichen Freiheit innerhalb des staatlichen Bereichs ist notwendige Konsequenz auch der Staatsform „Demokratie“. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.
1. Die demokratische Freiheitsidee Die Demokratie und damit auch das Wahlrecht als ihr Grundpfeiler entspringen der Idee der Freiheit und Autonomie des Einzelnen.18 Der Demokratie liegt dabei 11 So auch für die Bürger in der Gemeinde: H. G. Fischer, Rechtsschutz der Bürger bei Einwohneranträgen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, DÖV 1996, S. 181 (183). 12 Eine gleichzeitige Annahme eines Individualrechts und eines Organrechts hingegen ist deshalb ausgeschlossen, weil eine Handlung entweder im Außenrechtskreis oder im Innenrechtskreis des Staates stattfinden kann. Außerdem ist nur eine Wahlhandlung im eigenen oder im fremden Interesse möglich. So auch K. Herrmann, Volksgesetzgebungsverfahren, 2003, S. 79. 13 So vor allem J. Isensee, Abschied der Demokratie vom Demos, in: Schwab/Giesen/Liste/ Strätz (Hrsg.), Festschrift für Mikat, S. 705 (712). 14 A. Wallrabenstein, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, 1999, S. 127. 15 A. Wallrabenstein, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, 1999, S. 127. 16 P. Häberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, JZ 1975, S. 297. 17 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 35 f.; BVerfGE 44, 125 (142) – Öffentlichkeitsarbeit, Urteil vom 2. 3. 1977. 18 E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, 1971, S. 86.
180
F. Der Einzelne im Wahlakt
eine Freiheitsidee zugrunde, die über die individuelle Freiheit hinausgeht: die Idee der demokratischen Freiheit.19 Der Einzelne soll seine Freiheit nicht nur trotz des Staates verwirklichen können, sondern gerade durch den Staat. Die Demokratie baut damit auf zwei Freiheitskonzepten auf: dem der individuellen und dem der demokratischen Freiheit, die zwei Quellen der Legitimation des Staates bilden.20 Die Freiheit des Einzelnen wirkt nicht nur als natürliche Freiheit, die sich herrschaftsbeschränkend äußert,21 auch die Herrschaftsbegründung ist in der Demokratie ihrer Idee nach freiheitlich zu erklären.
2. Die Metamorphose von der individuellen Freiheit zur demokratischen Freiheit des Einzelnen Allerdings lässt sich die demokratische Freiheitsidee nicht in einer tatsächlichen Freiheit im Sinne einer freien Selbstbestimmung im Staate verwirklichen. Freiheit im Staat kann nicht im Sinne eines Freiseins von Fremdbestimmung verstanden werden.22 Vielmehr bleibt der Bürger auch in der Demokratie herrschaftsunterworfen.23 Denn staatlicher Ordnung liegt notwendigerweise ein einheitlicher Ordnungsrahmen zugrunde, den jeder gegen sich gelten lassen muss. Diese Verbindlichkeit der Rechtsordnung setzt der unbegrenzten Freiheit Schranken, macht aber freies Handeln im Sinne der individuellen Freiheit auch erst möglich, weil sie die im Naturzustand unsichere Freiheit eines jeden Einzelnen rechtlich absichert und verteidigt.24 Jedem Einzelnen muss dabei ein möglichst großer Bereich individueller Selbstbestimmung verbleiben; seine individuelle Freiheit muss weitestgehend unangetastet bleiben. Die Mitwirkung an Entscheidungen der Allgemeinheit, die die demokratische Freiheit verwirklicht, kann hingegen nicht mehr als Selbstbestimmung gedeutet
19
H. Dreier, Grenzen demokratischer Freiheit im Verfassungsstaat, JZ 1994, S. 741 f.; C. Starck, Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: HStR, Bd. III, 2005, § 33 Rn. 29 f.; H. H. Klein, Demokratie und Grundrechte, S. 48. 20 Zur Unterscheidung der demokratischen und individuellen Freiheit C. Möllers, Gewaltengliederung, 2005, S. 15 f., 29 f.; C. Starck, Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: HStR, Bd. III, 2005, § 33 Rn. 1 f. Zur Gleichwertigkeit dieser Freiheiten H. H. Klein, Grundrechte im demokratischen Staat, 1972, S. 39; er bezeichnet sie als „politische“ und „bürgerliche“ Freiheit. 21 Indes ist beständige Freiheit ohnehin nur als rechtlich begrenzte Freiheit denkbar, weil sie sonst nur unbegrenzte Macht des Stärkeren bedeuten würde: E.-W. Böckenförde, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, S. 45. 22 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (765 Rn. 52). 23 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929, S. 4 ff. 24 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (766 Rn. 53).
II. Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen
181
werden.25 Eine verbindliche Rechtsordnung wäre nicht möglich, würde sich das Prinzip der Selbstbestimmung tatsächlich auch innerhalb der Staatsordnung voll verwirklichen. Denn demokratisch getroffene verbindliche Entscheidungen stimmen in der Regel nicht mit dem Willen aller überein. Es ist die Aufgabe des Mehrheitsprinzips, möglichst vielen der Einzelwillen zur Verwirklichung zu verhelfen. So ist das Mehrheitsprinzip die größtmögliche Annäherung an die Freiheit (und Gleichheit) der Staatsbürger.26 Stets bleibt dabei aber ein Teil der Einzelwillen unverwirklicht.27 Die individuelle Selbstbestimmungsfreiheit muss sich also innerhalb des Staates wandeln. Das bedeutet, dass auch das aus ihr folgende Produkt nicht mehr mit der Selbstbestimmung wesensgleich sein kann. Die individuelle Freiheit durchläuft vielmehr „einen mehrfach gestuften Vermittlungsprozess“.28 Das Resultat dieser Metamorphose ist kein Selbstbestimmungsrecht mehr, ihm liegt vielmehr nur noch die Idee der Selbstbestimmung zugrunde.29 Die Selbstbestimmung ist nur noch eine vermittelte.30 Das Ergebnis der verwandelten Selbstbestimmungsfreiheit ist ein Mitbestimmungsrecht, ein Recht auf Teilnahme an den staatlichen Entscheidungen.31 E.-W. Böckenförde beschreibt den auf diese Weise entstehenden Zusammenhang zwischen individueller Selbstbestimmung, Volkssouveränität und demokratischen Mitwirkungsrechten so, dass sich durch den Wandlungsprozess die individuelle Freiheit des Einzelnen in eine Freiheit zur demokratischen Mitwirkung umwandle.32 Diese beinhalte „das Recht und die Freiheit, an der Festlegung der gemeinsamen
25
A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (417): „der Inhalt politischer Freiheit [lässt] sich nicht beschreiben, indem man die natürliche, individuelle Freiheit als Vorbild nimmt“; so aber W. Frenz, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (514): „Wahl als Ausdruck der Selbstbestimmung des einzelnen“. 26 W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, 1983, S. 100. 27 H. Dreier, Das Majoritätsprinzip im demokratischen Verfassungsstaat, ZParl 17 (1986), S. 94 f. 28 M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 506. 29 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929, S. 7: „Daß noch von Selbstbestimmung die Rede ist und davon, daß jeder nur seinem eigenen Willen untertan, wenn der Wille der Mehrheit Geltung beansprucht, das ist ein weiter Schritt in der Metamorphose des Freiheitsgedankens.“ 30 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 37. 31 So auch E. Stein/G. Frank, Staatsrecht, 2010, § 51 I, S. 427. Zwischen den Freiheitsrechten und den Aktivbürgerrechten bestehe daher ein durch das Demokratieprinzip vermittelter „normsystematischer Zusammenhang“. 32 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 38; missverständlich H. Steiger, Organisatorische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems, 1973, S. 162: Selbstbestimmung könne in einem sozialen Verband immer nur Mitbestimmung sein.
182
F. Der Einzelne im Wahlakt
Ordnung, der man unterworfen ist, mitzuwirken“.33 In einem zweiten Schritt forme sich aus dieser demokratischen Mitwirkungsfreiheit eines jeden Einzelnen die kollektiv-autonome Freiheit des Volkes,34 also die Volkssouveränität. Diese sei dann in der demokratischen Mitwirkungsfreiheit aller Bürger verankert.35 Die Metamorphose nimmt indes einen anderen Weg. Aus den individuellen Selbstbestimmungsrechten der einzelnen Bürger formt sich zunächst die Volkssouveränität als das Recht des Kollektivs, über sich selbst zu bestimmen:36 „An die Stelle der Freiheit des Individuums tritt die Souveränität des Volkes.“37 Erst aus diesem Recht des Kollektivs leiten sich dann wiederum Rechte der einzelnen Bürger ab, die in demokratischen Mitwirkungsbefugnissen bestehen.38 Die demokratischen Mitwirkungsbefugnisse ergeben sich aber erst aus der Souveränität des Volkes und der Zugehörigkeit des Einzelnen zum Volk.39 Denn wie sich die individuelle Freiheit unmittelbar in demokratische Mitwirkungsfreiheit wandeln soll, ohne dass das Volk dazwischentritt, ist nicht zu erklären. Der Einzelne erhält sein Mitentscheidungsrecht gerade als Teil des Volkes „zurück“, er wird also über das Volk mediatisiert.40 Andersherum erhält das Volk seine Souveränität nicht aus der demokratischen Mitentscheidungsfreiheit der Einzelnen, diese tauschen vielmehr unmittelbar ihre individuelle Freiheit ein, um mittels der Mediatisierung über das Gesamtvolk politische Mitbestimmungsrechte zurück zu erhalten. Das wird auch daran deutlich, dass der Demokratie zwar die Idee der Freiheit des Einzelnen zugrunde liegt, sie sich aber 33 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 38; er zählt dazu aber neben dem Wahlrecht auch den Zugang zu öffentlichen Ämtern sowie die Kommunikationsgrundrechte. 34 E.-W. Böckenförde, in: Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 38, zustimmend M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 507. 35 So auch J. Isensee, Abschied der Demokratie vom Demos, in: Schwab/Giesen/Liste/ Strätz (Hrsg.), Festschrift für Mikat, S. 705 (705): „Demokratie ist Selbstbestimmung des Volkes. Diese geht hervor aus der Mitbestimmung derer, die zum Volk gehören.“ 36 Klarer: P. Graf Kielmannsegg, Volkssouveränität, 1977, S. 99: „Das individuelle Selbstbestimmungsrecht verwandelt sich in gesellschaftliche Verfügungsgewalt durch die Übertragung des Rechts, über sich selbst zu bestimmen, auf den Souverän.“ 37 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929, S. 11, 13. 38 Richtiger: H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (753 f.): „Auf diesem Weg aus dem Zustand der Natur in den der staatlichen Demokratie durchläuft der ursprüngliche Herrschaftswille jedes einzelnen einen Prozess der Politisierung und Sozialisierung, in der er sich auf die von allen begründete Macht des Staates verlagert und zur Mitwirkung an der Bildung des herrschenden Willens im Staat wandelt.“ 39 Allerdings bestimmt Art. 38 Abs. 2 GG nur, wer wahlberechtigt ist, und nicht den Kreis der Aktivbürgerschaft. Rechtstheoretisch leitet sich aber das Wahlrecht aus der Zugehörigkeit zur Aktivbürgerschaft ab. So auch K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323. 40 Gegen eine solche Mediatisierung über das Volk und der Bildung eines Kollektivs A. Augustin, Das Volk der Europäischen Union, 2000, S. 390, U. Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 683 ff.
II. Anknüpfung der Demokratie an den Einzelnen
183
vom Volk her konzeptioniert, das Volk also Legitimationssubjekt der Staatsgewalt in der Demokratie ist.41 Demokratie ist Selbstbestimmung des Volkes, nicht des Einzelnen über sich selbst.42 Der Einzelne kann deshalb Rechte gerade nur als Teil des Volkes erhalten. Die demokratische Mitwirkungsfreiheit ist dann notwendigerweise wesensverschieden von der individuellen Selbstbestimmung. Schon ihrem Inhalt nach ist sie auf einen anderen Gegenstand gerichtet: sie besteht ganz überwiegend nicht in der Bestimmung über sich selbst, sondern in der Fremdbestimmung über andere.43 Denn Bezugspunkt der demokratischen Entscheidung ist immer das Gemeinwesen, von dem der Mitbestimmende stets nur einen sehr kleinen Teil darstellt.44 Zwar gewährleisten Mehrheitsentscheidungen „die größtmögliche Annäherung an das Ideal der Selbstbestimmung aller und eines hierauf gerichteten Konsenses aller“.45 Dennoch bleibt die Selbstbestimmung in Gemeinschaftsbelangen eine Utopie. Die durch alle gemeinsam geschaffene Herrschaftsordnung stellt sich aus der Sicht des Einzelnen als Herrschaftsunterworfenem andersherum vorwiegend als Fremdbestimmung durch andere dar, an der er lediglich minimal mitwirkt. Er selbst ist von Entscheidungen betroffen, die überwiegend von anderen als ihm selbst getroffen wurden.46 Dass die demokratische Mitwirkung keine Selbstbestimmung ist, zeigt sich besonders auch daran, dass der Einzelne von der Entscheidung, die er unter Ausübung seiner demokratischen Mitwirkungsfreiheit getroffen hat, mitunter gar nicht betroffen ist. So gibt es eine Vielzahl an Gesetzen, die abstrakte Sachverhalte regeln, die den Wählenden nicht betreffen (können), weil er nicht in den Kreis der Norm41 S. Haack, Demokratie mit Zukunft? JZ 2012, S. 753 (755); M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 507; H. Holste, Wahlrecht von Geburt an: Demokratie auf Abwegen?, DÖV 2005, S. 110 (111); K.-P. Sommermann, Demokratie als Herausforderung des Völkerrechts, 2006, in: Festschrift für Tomuschat, S. 1051 (1062 f.), sieht die Möglichkeit, eine überstaatliche Demokratie auf mehrere demoi zur gründen. 42 H. Holste, Wahlrecht von Geburt an: Demokratie auf Abwegen?, DÖV 2005, S. 110 (111). 43 P. Graf von Kielmannsegg, Volkssouveränität, 1977, S. 235; R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 373; S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 457. 44 So auch P. Graf Kielmannsegg, Das Experiment der Freiheit, S. 94 f.: „… der Einfluss des Wählers ist infinitesimal klein“; ebenso A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), 395 (403): „Die einzelne Stimme ist nahezu bedeutungslos.“ Jedenfalls irreführend ist es, wenn M. Sachs, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, DVBl. 1995, S. 873 (884), behauptet, wer seine Stimme abgebe, müsse „so gut wie sicher damit rechnen, dass es auf seine Stimme in keiner Weise ankommen wird“. Denn gerade die Summe der Stimmen ist es, die in einer Kollektiventscheidung etwas bewirken. Die Summe der Stimmen ist aber gerade ohne jede einzelne Stimme nicht denkbar. A. Funke, ebenda, erkennt dieses Zählen der Stimme dann aber auch an (S. 412). 45 R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 2010, § 22 II, S. 142. 46 Ob seine eigene Entscheidung überhaupt Einfluss nimmt, bleibt – wie oben in Abschnitt D. IV. 3. a), S. 82 ff., gesehen – ohnehin fraglich.
184
F. Der Einzelne im Wahlakt
adressaten fällt. Dennoch bestimmt er durch seine Wahlentscheidung in der mittelbaren Demokratie auch über die Regelungen von Sachverhalten mit, die ihn nicht betreffen.47 Zwar gehen von vielen Regelungen auch mittelbare Wirkungen auf andere als die Normadressaten aus, weil die Bürger als Normbetroffene – gewollt oder ungewollt – auch in faktischen Zusammenhängen mit anderen stehen,48 jedoch ist selbst über eine mittelbare Mitbetroffenheit nicht jeder von allen Regeln betroffen,49 so dass der Selbstbezug der Regelungen nicht Voraussetzung für die Mitbestimmung ist.50 Die volle Selbstbestimmung verwandelt sich durch mehrfache Metamorphose in der demokratischen Staatsordnung in eine Teilhabe an der Bestimmung über das Gemeinwesen. Damit kann eine demokratische Freiheit nur eine Idee bedeuten,51 die der Demokratie zugrunde liegt, sich aber nicht in einer tatsächlichen Freiheit des Einzelnen im Staat verwirklicht.
3. Notwendigkeit von individueller Freiheit neben der demokratischen Mitwirkung Indes ist es für die Legitimität demokratischer Herrschaft Voraussetzung, dass nicht die gesamte Selbstbestimmung des Einzelnen von der Staatlichkeit aufgenommen wird und so der einzelne „voll und ganz Glied des demokratischen Kollektivs ist“52. Dem Bürger muss vielmehr ein Bereich individueller Selbstbestimmung verbleiben, der auch durch demokratische Entscheidungen unverfügbar ist.
47
Von Regelungen betroffen ist der Einzelne aber auch, wenn diese Gruppen betreffen, denen er nicht angehört, sich aber finanziell auswirken. Dann sind alle dem Gemeinwesen Zugehörigen betroffen, weil der Staat nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügt und sich finanzielle Entscheidungen zugunsten einer Gruppe zwangsläufig zulasten einer anderen auswirken. 48 So betrifft etwa die Entscheidung über das Bestehen eine Wehrpflicht nicht nur die Wehrpflichtigen selbst, sondern auch die Familien und Partner der unter die Norm fallenden Personen. Regelungen über Steuerbefreiungen für Unternehmen betreffen mittelbar deren Kunden etc. 49 Dabei ist der Einzelne tendenziell von umso mehr Regelungen (jedenfalls mittelbar) betroffen, in je mehr soziale Zusammenhänge er eingebunden ist und in Zukunft sein wird. Je älter Personen werden und je weniger Lebenszeit ihnen verbleibt, desto weniger sind sie von den Langzeitfolgen von Regelungen betroffen. Dies ist bei alternder Bevölkerung dann ein Problem für die Demokratie, wenn Wähler bei ihrer Wahlentscheidung nur die eigene Betroffenheit von Regelungen im Auge haben. Hierzu sogleich unten in Abschnitt F. III. 2., S. 189 ff. 50 Es ist allerdings faktisch wohl jeder von Regelungen betroffen, über die er durch das Wahlrecht als politischer Richtungsentscheidung mittelbar mitentscheidet. 51 So wörtlich auch das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 44, 125 (142) – Öffentlichkeitsarbeit, Urteil vom 2. 3. 1977: „Idee der freien Selbstbestimmung aller Bürger“. 52 E.-W. Böckenförde, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, S. 36; hierzu auch A. Wallrabenstein, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, 1999, S. 126 f.
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
185
Jedem muss dabei das gleiche Maß an Freiheit zukommen.53 Erst dadurch wird die Demokratie zur freiheitlichen Staatsform.54 Dieser Bereich ist der durch Grundrechte gesicherte Bereich der individuellen Freiheit. Diese vornehmlich als Abwehrrechte gegen den Staat ausgestalteten Rechte schaffen dem Einzelnen einen Freiheitsbereich, über den auch die Mehrheit nicht verfügen kann.55 Erst aus diesem Grund kann die von der Mehrheit gestaltete staatliche Ordnung als legitim gelten.
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger? Da das Wahlrecht damit auch in der freiheitlichen Demokratie ein organschaftliches Recht, eine Kompetenz, ist,56 scheint es naheliegend, den einzelnen Bürger als Amtsträger anzusehen.57 Denn er handelt als Organteil der Aktivbürgerschaft. Organe des Staates sind regelmäßig mit Amtsträgern besetzt, die als Organwalter die Aufgaben des Organs wahrnehmen.58 Es soll deshalb im Folgenden überprüft werden, ob auch der einzelne Bürger Amtsträger ist, wenn er wählt, und dementsprechend den rechtlichen Bindungen eines Amtsträgers unterliegt. Hierzu soll zunächst der Amtsbegriff geklärt werden, sodann seine Anwendbarkeit auf die Wähler überprüft werden.
1. Der Amtsbegriff Das Amt ist geprägt durch seine ausschließliche Fremdnützigkeit und die Unabhängigkeit von persönlichen Interessen. Der Amtsträger darf die Ausführung 53
H. Jahrreiß, Demokratie, in: Festschrift für Thoma, 1950, S. 71 (75). J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (165). 55 J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (164): „Mitbestimmung wiegt Selbstbestimmung nicht auf.“ Wenn S. Huster/J. Rux, in: Epping/Hillgruber, Beck’scher OK GG, Art. 20 Rn. 11, die Grenze der Freiheit des Einzelnen dort sehen, „wo die Mehrheit im Wege eines demokratischen Verfahrens eine Schranke errichtet hat“, ist dem entgegenzusetzen, dass die Grenzen in einer von der Freiheit des Einzelnen her denkenden Rechtsordnung genau anders herum verlaufen: Die Verfügbarkeit durch die Mehrheit findet dort ihre Grenze, wo die Freiheit des Einzelnen beginnt und nicht einschränkbar ist. Dementsprechend bezeichnet M. Nettesheim, Ein Individualrecht auf Staatlichkeit? – Die LissabonEntscheidung des BVerfG, NJW 2009, S. 2867 (2869), Individualrechte als „Trümpfe, mit denen die demokratische Entscheidung noch überspielt werden kann“. 56 Siehe oben in diesem Abschnitt unter F. I., S. 176 ff. 57 So ausdrücklich D. Rauschning, Die Sicherung der Beachtung von Verfassungsrecht, 1969, S. 189; H. Loschelder, Das aktive Wahlrecht und die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, 1968, S. 65; zunächst auch O. Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 90 (115), der diese These im Folgenden dann aber nicht stützt. 58 Zur statusverändernden Funktion des Eides und dem noch im 19. Jahrhundert gebräuchlichen Bürger- und Wählereid H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 313. 54
186
F. Der Einzelne im Wahlakt
seines Amtes ausschließlich am Gemeinwohl59 orientieren, eigene Interessen müssen dabei außen vor bleiben.60 Der Amtswalter hat sein Amt selbstlos, unparteiisch und ohne Eigennutz auszuüben.61 Zudem beinhaltet das Amtsprinzip die Trennung von Person und Amt, das Amt muss sich unabhängig von der konkreten Person, die es ausübt, denken lassen, weil sich so das Gemeinwohl am besten verwirklichen lässt.62 Die Vorstellung des Amtes ist in der grundgesetzlichen Ordnung stark vom beamtenrechtlichen Amtsbegriff geprägt, weil dieser ausdrücklich im Grundgesetz vorausgesetzt wird (Art. 33 GG).63 Der Beamte gilt als Idealtypus des Amtswalters,64 den das auf Lebenszeit angelegte Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn zu „unbedingter Dienstbereitschaft im Dienst des Gemeinwohls“ verpflichtet65 und ihn an die Weisungen seines Dienstherrn bindet. Die Fremdnützigkeit und Gemeinwohlorientierung des Amtes des Beamten zeigen sich besonders auch an den Ausschlussregelungen für befangene Amtswalter, nach denen Beamte dann, wenn die Besorgnis besteht, dass sie in der zu entscheidenden Angelegenheit Eigeninteressen haben, von der Entscheidung ausgeschlossen werden.66 Die Unbefangenheit und Unparteilichkeit des Beamten gehören aber auch zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums.67 Der Ausschluss der Wahrnehmung von (jenseits des Gemeinwohls liegenden) Fremdinteressen durch den Amtswalter zeigt 59 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 78, schlägt im Hinblick auf den Missbrauch des Begriffs in der nationalsozialistischen Zeit vor, von „gemeinsamen Interessen aller“ oder den „Belangen der Allgemeinheit der Bürger“ zu sprechen. Eine Renaissance des Gemeinwohlbegriffs stellt T. Streit, Entscheidung in eigener Sache, 2006, S. 92, m. N. in Fn. 62, fest. 60 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 46. Nach R. Balzer, Republikprinzip und Berufsbeamtentum, 2009, S. 94, ist der Amtsgedanke gerade zur Verwirklichung des Gemeinwohls entwickelt worden. 61 J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, 2006, § 71 Rn. 12. 62 H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 265: Das Amt sei gerade deshalb konstruiert, um die Staatstätigkeit von den Unzulänglichkeiten des Menschen unabhängig zu stellen. 63 Auch O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. II, 1924, S. 139, definierte das Amt als Zusammenfassung aller aufgrund einer Dienstpflicht zu besorgenden Geschäfte. Hierzu A. Köttgen, Das anvertraute öffentliche Amt, in: Festgabe für Rudolf Smend, 1962, S. 119 (124). 64 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 23; K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 38; M. Schröder, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S. 300, spricht vom „Prototypen“ des herkömmlichen Amtsinhabers, so auch J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, 2006, § 71 Rn. 146. 65 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 23. 66 § 65 BBG und § 21 VwVfG, der jedoch nicht auf Beamte im statusrechtlichen Sinn beschränkt ist. 67 BVerfGE 9, 268 (286) – Bremer Personalvertretung, Urteil vom 27. 4. 1959; M. Jachmann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 33 Abs. 5 Rn. 46. Zur einfachrechtlichen Ausgestaltung im Bundesbeamtengesetz: K. J. Grigoleit, in: Battis, BBGKommentar, § 61 Rn. 7.
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
187
sich auch an der strafrechtlichen Sanktionierung der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit.68 Der so verstandene Amtsbegriff wird von der „hierarchisch-bürokratischen“ Staatsorganisation geprägt.69 Das Amt als eigene Kategorie ist vom Beamtenrecht jedoch überlagert.70 Dem Grundgesetz sind dennoch auch andere Ämter bekannt, die der starren Schablone des beamtenrechtlichen Amtsbegriffes nicht entsprechen.71 Auf diese findet das Beamtenrecht folglich keine – auch keine analoge – Anwendung.72 So weichen die politischen Führungsämter, durch die Aufgaben der obersten Staatsorgane erfüllt werden, hiervon ab, indem die Gemeinwohlverpflichtung zwar besteht, insofern aber deutlich schwächer ausgeprägt ist, als den Amtswaltern ein politisches Gestaltungsermessen zukommt; es gibt für sie weder eine positive Pflichtenordnung noch eine Disziplinargewalt.73 Ihre Gemeinwohlbindung ist nicht explizit gesetzlich normiert, sie hat primär rechtsethischen Charakter.74 Die Ämter der politischen Führung und die durch das Beamtentum wahrgenommenen Ämter der fachlichen Ausführung unterscheiden sich somit hinsichtlich ihrer rechtlichen Determination und ihrer Pflichtenbindung erheblich.75 Insbesondere beim Abgeordneten ist die abgeschwächte Pflichtenbindung augenfällig,76 weil ihm aufgrund der Freiheit des Mandats ein Ermessen über seine Amtsführung explizit eingeräumt ist und er gemäß Art. 38 Abs. 2 GG an Aufträge und Weisungen nicht gebunden ist. Er „schuldet keine Dienste, sondern nimmt sein Amt in Freiheit und Unabhängigkeit wahr“.77 Auch wird sein Gewissen zum Maßstab seines Handelns erhoben, und damit eine subjektive Pflichtenbindung impliziert. Der Begriff „Gewissen“ ist hier allerdings nicht in dem Sinne zu verstehen, wie er in Art. 4 Abs. 1 GG gebraucht wird.78 Er ist vielmehr im Sinne eines „Amtsgewissens“ zu verstehen, als politische Überzeugung über das, was dem Gemeinwohl nützt.79 Die 68
§§ 331 ff. StGB. R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 366. 70 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 6. 71 W. Leisner, Öffentliches Amt und Berufsfreiheit, AöR 93 (1968), S. 161 (166), ist gar der Ansicht, dass „Amt“ im Verfassungsraum der Exekutive einen gewissen Gegensatz zum öffentlichen Dienst bezeichne. 72 G. Roellecke, Das Bundesverfassungsgericht, in: HStR, Bd. III, 2005, § 67 Rn. 17. 73 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR, Bd. III, 2005, § 36 Rn. 24, A. Köttgen, Das anvertraute öffentliche Amt, in: Festgabe für Rudolf Smend, 1962, S. 119 (140). 74 J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, 2006, § 71 Rn. 145, 146. 75 J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, 2006, § 71 Rn. 146. 76 K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 39. 77 BVerfGE 40, 296 (316) – Abgeordnetendiäten, Urteil vom 5. 11. 1975; BVerfGE 76, 256 (341) – Beamtenversorgung, Beschluss vom 30. 09. 1987. 78 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 123. 79 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 124; ähnlich E. V. Heyen, Über Gewissen und Vertrauen des Abgeordneten, Der Staat 25 (1986), S. 35 (49): Das in Art 38 Abs. 1 S. 2 genannte Gewissen sei „keine institutionenfremde Instanz, sondern 69
188
F. Der Einzelne im Wahlakt
Verwendung des Begriffs „Überzeugung“ in der Verfassung wäre deshalb treffender gewesen.80 Die Berufung auf „das Gewissen“ ist somit nicht nur in echten Gewissensfragen, sondern in jeder Sachfrage nötig.81 Weder die Überzeugung noch das Gewissen sind jedoch objektivierbar.82 Es gibt keinen allgemeinen Maßstab des Gewissens, sondern dieser gilt für jeden persönlich. Eine Gewissensentscheidung ist stets individueller Natur.83 Dennoch ist sie im Kontext des Abgeordnetenamtes nicht privater Natur.84 Das Grundgesetz erhebt hier explizit individuelle Gewissensanforderungen zu verfassungsrechtlichen Maßstäben. Die vom Abgeordneten gegen sein Gewissen getroffene Entscheidung ist verfassungswidrig.85 Das individuelle Gewissen wird damit zum Maßstab der Verfassungsmäßigkeit.86 Insofern ist das Amt des Abgeordneten subjektiviert,87 das heißt auf die Person des Abgeordneten selbst bezogen, insoweit bringt der Abgeordnete seine Individualität in das Amt ein, weil diese selbst zum Maßstab seines Amtes wird.88 Selbstverständlich ist der Abgeordnete aber nicht nur an sein Gewissen, sondern auch an das Recht gebunden.89 Die Besonderheiten des Amtes des Abgeordneten werden mitunter als so weitgehend betrachtet, dass er aus dem Kreis der Amtsträger herausgenommen wird. Hierbei wird über den Wortlaut des Art. 48 GG hinweggesehen, der ausdrücklich
Inbegriff intellektueller Anstrengung zur Erfüllung der Aufgabe einer Institution“. Zustimmend H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 195. 80 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 195; nicht ausdrücklich K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 53. 81 K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 53 f. 82 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 129; J. C. von Waldthausen, Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, 2000, S. 140. 83 F.-J. Peine, Der befangene Abgeordnete, JZ 1985, S. 914 (920). 84 So aber J. C. von Waldthausen, Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, 2000, S. 140. 85 P. Krause, Freies Mandat und Kontrolle der Abgeordnetentätigkeit, DÖV 1974, S. 325 (331). Auch wenn die Gewissensentscheidung der rechtlichen Überprüfbarkeit entzogen ist. So auch W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 129 f. 86 Dieses ist indes nicht judizierbar. W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 130. 87 So auch J. C. von Waldthausen, Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, 2000, S. 140; K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 39. 88 Dass dies eine für den „herkömmlichen Amtswalter unvorstellbare Konsequenz“ ist, so M. Schröder, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S. 295, zeigt nicht, dass es sich nicht um ein Amt handelt, sondern nur, dass dieses von der Person des Abgeordneten geprägt ist. 89 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 195.
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
189
vom „Amt eines Abgeordneten“ spricht.90 Von Meinhard Schröder ist sogar ein „struktureller Gegensatz von Amtsrecht und Parlamentsrecht“ behauptet worden.91 Dies insbesondere deshalb, weil er die Verfassungsbindung des Abgeordneten negiert. Dem Abgeordneten wird auch ein eigener verfassungsrechtlicher Status beigemessen.92 Wenn hiermit der Ausschluss eines Amtes bekräftigt werden soll,93 wird jedoch verkannt, dass auch der Abgeordnete in seinen Handlungen der Verfassungsbindung unterliegt, diese aber teilweise versubjektiviert ist. Auch der Abgeordnete ist Amtsträger, selbst wenn sich sein Amt deutlich von dem des Beamten unterscheidet. An diesem Abweichen vom Amtsbegriff des Beamtenrechts zeigt sich, dass das Grundgesetz viele unterschiedliche Ämter kennt, die einer unterschiedlichen Pflichtenbindung unterliegen. Als gemeinsame Eigenschaft aller dieser Ämter ergibt sich lediglich, dass sie alle um des Gemeinwohls willen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben geschaffen sind.94
2. Gemeinwohlbindung des Wählers? Es stellt sich also die Frage, ob auch der Wähler im Wahlakt der Gemeinwohlbindung unterliegt.95 Denn dies stellt sich als Bedingung für das Innehaben eines Amtes dar. Dann hätte er sich bei der Wahl nicht daran zu orientieren, welche Wahlalternative seine persönlichen Interessen am besten zu befriedigen scheint, sondern an überindividuellen Gemeinwohlinteressen. Dass eine Gemeinwohlpflicht des Wählers nicht expressis verbis normiert ist, spricht nicht gegen seine Bindung, 90 Das Organwalterverhältnis des Abgeordneten sei nicht „Amtsverhältnis“, sondern „Abgeordnetenverhältnis“, so N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Art. 38 Abs. 1 Rn. 72 (Fn. 115), Art. 48 Abs. 2 sei „irreführend“. Für die Eigenschaft des Abgeordnetenmandats als Amtsinhaber H. H. Klein, Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 1; auch C. Waldhoff, Das missverstandene Mandat, ZParl 2006, S. 251 (254), geht von einem „ganz eigene[n] Amt verfassungsrechtlicher Art“ aus, hält die Verwendung des Begriffs des Amtes aber dennoch für „missverständlich“. 91 M. Schröder, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S. 288, macht dies an verschiedenen Kriterien fest. Zum einen müsse man es für erforderlich halten, dass der Begriff des Amtes nicht Sachzuständigkeiten einer bestimmten Person voraussetzt, sondern Mitwirkungs- und Verfahrensrechte in Kollegialorganen genügen lässt. 92 W. Leisner, Öffentliches Amt und Berufsfreiheit, AöR 93 (1968), S. 161 (167): „unvergleichliche Sonderkonstruktion: Verfolgung öffentlicher Interessen unter minimaler Bindung an die Staatsgewalt, zeitlicher Begrenzung und organisationsrechtlicher Einzelausgestaltung nach beamtenrechtlichem Vorbild“; K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 II 1, S. 46; P. Häberle, Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit des Abgeordnetenstatus NJW 1976, S. 537 (538 ff.); BVerfGE 4, 144 (149) – Abgeordnetenentschädigung, Urteil vom 16. 3. 1955. 93 S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 53, macht mit dem Ausdruck indes nur die Unterschiedlichkeit des Amtes des Abgeordneten von dem des Beamten deutlich. 94 S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 54: „Amt bedeutet Dienst an der Allgemeinheit, nicht zum persönlichen Nutzen.“ 95 So H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 763 ff.; in diese Richtung auch R. Junck, Strafrechtliche Grenzen der Beeinflussung von Wählern im Wahlkampf, 1995, S. 111.
190
F. Der Einzelne im Wahlakt
weil die Gemeinwohlverpflichtung ihrem Ursprung nach ohnehin rechtsethischer Natur ist.96 Es ist dafür zunächst zu klären, wie sich „das Gemeinwohl“ bildet. Es könnte sich um ein vorher bestimmtes Gemeinwohl handeln, an das der Wähler und damit das gesamte Volk gebunden sind. „Das Gemeinwohl“ könnte sich aber auch gerade erst aus den Individualinteressen der Wähler ergeben. Als dritte Möglichkeit kommt in Betracht, dass sich das Gemeinwohl aus den Vorstellungen der einzelnen Wähler über das Gemeinwohl bildet. Hieraus lässt sich ableiten, ob und in welcher Form der Wähler an „das Gemeinwohl“ gebunden ist. a) Bindung an ein vorher bestimmtes Gemeinwohl?97 Der Wähler könnte bei der Wahl an ein vorher bestimmtes Gemeinwohl gebunden sein. Diese Bindung des Wählers an ein vor der Wahl bereits feststehendes Gemeinwohl könnte sich aus dem Republikprinzip ergeben. Dieses bildet zunächst den Gegensatz zum monarchischen Prinzip und enthält den formalen Grundsatz, dass das Staatsoberhaupt nicht aufgrund von Erbfolge in das Amt gelangt, sondern durch Wahl auf Zeit.98 Es ist in Art. 20 Abs. 1 GG verankert und gehört damit zum „Verfassungskern“, der nach Art. 79 Abs. 3 GG auch durch den verfassungsändernden Gesetzgeber in seinen Grundsätzen nicht abgeschafft werden kann.99 Über seinen formellen Inhalt hinaus wird ihm verschiedentlich ein materieller Gehalt entnommen.100 Dies erscheint insofern schlüssig, als die Frage des Staatsoberhauptes bereits in Art. 54 GG geregelt ist. Eine Aufzählung in Art. 20 GG könnte somit allenfalls den Zweck haben, das Monarchieverbot im änderungsfesten Teil der Verfassung zu verankern.101 Es liegt daher nahe, dass das Republikprinzip auch materielle Norminhalte hat. Das Republikprinzip entfaltet Wirkung für die Zukunft. Es wird im Gegensatz zum Demokratieprinzip nicht durch den Herrschaftsträger, sondern durch das Herrschaftsziel konstituiert und beinhaltet den Grundsatz der Herrschaft nicht durch,
96
J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, 2006, § 71 Rn. 12. Jedes Handeln der Bürger im Staat unterliege der Bindung an ein „normativ nicht zu fixierende[s] Gemeinwohlziel.“ 98 B. Grzeszick, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG-Kommentar, 51. Lfg. (Stand: Dez. 2007), Bd. III, Art. 20 Abs. 3, Rn. 9; B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 61. 99 W. Henke, Die Republik, in: HStR, Bd. I, 1987, § 21 Rn. 1; a. A. K. Löw, Was bedeutet „Republik“?, in: DÖV 1979, S. 819 Rn. 2. 100 H.-D. Horn, Demokratie, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, S. 743 (753 f.); a. A. K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 17 II, S. 580 f., der neben dem Monarchieverbot keine materiellen Gehalte im Republikprinzip sieht. 101 Gar überflüssig wäre die Aufzählung nach Meinung von W. Henke, Die Republik, in: HStR, Bd. I, 1987, § 21 Rn. 7. 97
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
191
sondern für das Volk.102 Die Orientierung der gesamten Staatsgewalt am Gemeinwohl ergibt sich aus dem Republikprinzip.103 Da auch das Volk im Wahlakt Staatsgewalt ausübt und der einzelne Bürger schon als Teil des Volkes wählt, liegt es nahe, dass auch er an das Gemeinwohl gebunden ist, denn er übt die Herrschaft des Volkes aus. Ein feststehendes Gemeinwohl, an das der Wähler gebunden sein könnte, gibt es zum Zeitpunkt der Wahl jedoch nicht. Das Republikprinzip verpflichtet zwar auf das Gemeinwohl, ohne es allerdings näher zu konkretisieren. Das Gemeinwohl muss deshalb durch die demokratische Willensbildung immer wieder neu konkretisiert werden.104 b) Bildung des Gemeinwohls durch Kumulierung der Individualinteressen? Das Gemeinwohl könnte daher erst im Wahlakt durch die Kumulierung von Individualinteressen zustande kommen. Dass sich das Gemeinwohl erst aus den Einzelinteressen der Wähler ergebe, wird in der Literatur mitunter vertreten.105 Es handle sich bei der Findung eines feststehenden Gemeinwohls um einen „Auswahlprozess von konkurrierenden Partikularinteressen“, die als „latent öffentliche Interessen“ zu bezeichnen seien, da sie sich erst um die Anerkennung als öffentliches Interesse bemühen. Das „Öffentliche“ eines Interesses sei „mithin die durch die rechtsverbindliche Entscheidung staatlicher Organe erlangte Zusatzqualität eines ursprünglichen Partikularinteresses“.106 Leitfaden des Bürgers bei der Wahl könne das Gemeinwohl hingegen nicht sein, dieser müsse sich nicht an einem höheren Gemeinwohl orientieren. Dies würde einen mündigen, politisch informierten Bürger voraussetzen, der sachkundig genug ist, das 102 J. Isensee, Republik – Sinnpotential eines Begriffs, JZ 1981, S. 1 (6); M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 160. 103 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1999, § 4 Rn. 118 – 122, S. 56; B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 61; W. Henke, Das subjektive öffentliche Recht, S. 53. 104 K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 Abs. 1 Rn. 14. Auch kommt hier zum Tragen, dass der Wähler zur Verwirklichung des Gemeinwohls ohnehin nur durch die von ihm gewählten Abgeordneten beitragen kann. Es müsste dann also Kandidaten geben, die das das Gemeinwohl aus der Ex-ante-Perspektive objektiv besser zu verwirklichen imstande sind. Das objektiv richtige Gemeinwohl gibt es aber gerade nicht. 105 Z. B. von B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 150. Er nimmt allerdings für Abstimmungen ein anderes Verfahren der Gemeinwohlfindung an. Sowohl bei Wahlen als auch bei Abstimmungen ergebe sich das Gemeinwohl als Resultante der Wahl- oder Abstimmungsentscheidungen. Allerdings habe der Stimmberechtigte seine Entscheidung bei Abstimmungen daran auszurichten, was der Gemeinschaft am besten dient, während sich bei der Wahl die Entscheidung nach individuellen Präferenzen richten solle. 106 W. Schmidt, Organisierte Einwirkungen auf die Verwaltung, VVDStRL, 33 (1974), S. 183 (198); so auch G. F. Schuppert, Bürgerinitiativen als Bürgerbeteiligung an staatlichen Entscheidungen, AöR 102 (1977), S. 369 (401).
192
F. Der Einzelne im Wahlakt
Gemeinwohl mit formen zu können, was aber nicht der Realität entspreche. Der Bürger dürfe darauf vertrauen, dass sich das Gemeinwohl im Widerstreit der individuellen Interessen – mögen sie gemeinnützig oder privat sein – forme.107 Die Demokratie könne ihren Bürgern nur zumuten, was diese auch bewältigen können. Es sei nicht jedem Bürger möglich, sich neben seinen anderen Verpflichtungen so umfassend zu informieren, dass er eine am Gemeinwohl orientierte Entscheidung treffen könne. Deswegen werde dem Bürger auch keine Sachentscheidung zugemutet, sondern die Komplexität der Entscheidung dadurch reduziert, dass nur eine Personalentscheidung zu treffen sei. Bürgerverantwortung werde so im Wahlakt nicht eingefordert. Auf diese Weise werde die Funktionsfähigkeit des politischen Systems von der Mündigkeit der Bürger abgekoppelt.108 Diese Ansicht zeichnet zum einen ein pessimistisches Bild von der Entscheidungsfähigkeit der Bürger. Zwar überträgt das Grundgesetz die Sachentscheidungen den Abgeordneten und hält sie damit von den Bürgern fern. Jedoch sollen durch die Wahl die Personen, die die Sachentscheidungen treffen, ausgewählt werden. Würden den Bürgern sachkundige Entscheidungen nicht zugemutet werden können, würde sich die auch die Personenwahl als überflüssig darstellen. Es könnte unter den Bewerbern ebenso gut gelost werden. Durch die Normierung einer Personenwahl überträgt das Grundgesetz den Bürgern aber die Verantwortung dafür, Personen auszuwählen, die aus ihrer Sicht „gute“ Sachentscheidungen treffen. Zum anderen kann das Gemeinwohl zwar theoretisch in gewissem Maße aus Einzelinteressen gebildet werden, dies allerdings nicht unbeschränkt. Denn die Verfassung setzt hierfür einen Rahmen, aus dem auch dann, wenn die Resultante der Individualinteressen in eine andere Richtung weisen würde, nicht ausgebrochen werden darf. Nur das, was sich innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung bewegt, kann zum Gemeinwohl erklärt werden.109 Dabei ist zu wiederum beachten, dass der Wähler im Wahlakt eben nur eine Personenentscheidung trifft, sich seine Entscheidung damit in sachlicher Hinsicht ohnehin nur auf die Konzepte bezieht, von denen er hofft, dass sie von den jeweiligen Kandidaten durch die Mitwirkung im Bundestag verwirklicht werden.110 107 O. Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 90 (115); derartige Gemeinwohlfindungsprozesse bezeichnet H. H. von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977, S. 51, als wert- und erkenntnisorientierte Verfahren. 108 O. Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 90 (115). 109 Eine erste Konkretisierung des Gemeinwohls findet sich in den Grundrechten und den Staatszielbestimmungen, so K.-P. Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 Abs. 1 Rn. 14. 110 Wenn aber M. Sachs, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, DVBl. 1995, S. 873 (884), annimmt, dass die Ausübung der Wahl- und Stimmrechte keine individuelle Bürgerverantwortung fordere, weil die einzelne Stimme ohnehin kaum je Mandatsrelevanz hat, liegt hierin eine Verkennung des Prinzips der Verantwortung. Verantwortung besteht nicht nur,
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
193
Bei fast allen Kandidaten für die Bundestagswahl ist gewährleistet, dass ihre Konzepte innerhalb der Grenzen der Verfassung liegen. Denn fast alle Kandidaten gehören einer Partei an. Aufgrund der im Grundgesetz in Art. 21 Abs. 2 GG vorgesehenen Möglichkeit, Parteien für verfassungswidrig zu erklären, die darauf abzielen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, ist gewährleistet, dass die Parteien und die für sie antretenden Kandidaten sich mit verfassungskonformen Konzepten zur Wahl stellen.111 Dass beinahe alle Kandidaten für eine Partei zu Wahl stehen, ergibt sich daraus, dass Parteien in der Verhältniswahl allein befugt sind, Listen mit wählbaren Kandidaten aufzustellen.112 Darüber hinaus stellen sie tatsächlich auch den Großteil der Kandidaten, die über die Personenwahl zur Wahl stehen. Das Bundeswahlgesetz geht gar von diesem Fall als Regelfall aus,113 wenn es die „durch die Partei“ in der Personenwahl errungenen Mandate auf die Zahl der Mandate anrechnet, die der Partei nach der Verhältniswahl zustehen.114 Nach dem Bundeswahlgesetz sind es also im Wesentlichen die Parteien, die Kandidaten zur Wahl aufstellen, auf deren Auswahl sich der Wählerwille also richten kann. Dies ist zwar auf das Wahlsystem zurückzuführen, dass seinerseits nur einfachgesetzlich ausgestaltet ist. Allerdings zählt das Wahlrecht zum materiellen Verfassungsrecht,115 weil es trotz seines formell unterverfassungsrechtlichen Ranges Verfassungsrecht näher ausgestaltet.116
wenn Entscheidungen allein getroffen werden, sondern auch dann, wenn lediglich an Gemeinschaftsentscheidungen mitgewirkt wird. Andernfalls wären Gemeinschaftsentscheidungen von niemandem zu verantworten. 111 Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist aber ein Parteiverbot erst dann auszusprechen, wenn die Partei nicht nur verfassungswidrige Ziele verfolgt, sondern durch planvolles Vorgehen auf die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgeht und dies auch möglich erscheint, so BVerfG, BvB 1/13 – NPD-Verbotsverfahren II, Urteil vom 17. Januar 2017. 112 § 27 Abs. 1 S. 1 BWahlG. 113 Auch tatsächlich spielen Einzelbewerber eine deutlich untergeordnete Rolle. Hierzu C. Nestler, Einzelbewerber bei Bundestagswahlen von 1949 bis 2013: zahlreich, aber chancenlos, ZParl 45 (2014), S. 796 ff. So gelang nur in den ersten Bundestag, zu dem ein EinStimmen-Wahlsystem galt, drei unabhängigen Kandidaten der Einzug (S. 803). 114 § 6 Abs. 4 BWahlG. 115 BVerfGE 20, 56 (114) – Parteienfinanzierung I, Urteil vom 19. 7. 1966. 116 Hierzu auch – jedenfalls dem Titel nach – B. Grzeszick/H. Lang, Wahlrecht als materielles Verfassungsrecht, 2012. Welche Folgen aus der Eigenschaft als materiellem Verfassungsrecht darüber hinaus noch abzuleiten sind, ist indes streitig (S. 17). Greszick und Lang folgern hieraus vor allem, dass die Wahlgrundsätze stets unter Berücksichtigung des vom einfachen Gesetzgeber eingeführten Wahlsystems auszulegen seien (S. 20), und sehen hierdurch den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts konturiert (S. 27 – 59). Die Monographie behandelt jedoch im Wesentlichen nicht – wie der Titel impliziert – die Eigenschaft des Wahlrechts als materielles Verfassungsrecht, sondern eine detaillierte verfassungsrechtliche Prüfung des durch die 19. Wahlrechtsnovelle geänderten Wahlsystems. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es sich im Wesentlichen um die im Bundesverfassungsgerichtsverfahren
194
F. Der Einzelne im Wahlakt
Nicht jedes Individualinteresse kann also über die Wahl Eingang in die staatliche Willensbildung finden, sondern ganz überwiegend nur solche Interessen, die sich auf verfassungsgemäße Konzepte beziehen. Auf diese ist die Möglichkeit der Gemeinwohlbindung von vornherein begrenzt. Es findet also schon eine Vorauswahl statt, das Gemeinwohl ist in seinen äußersten Grenzen bereits abgesteckt, bevor es gebildet wird. Es kann deshalb nicht erst aus den Einzelinteressen entstehen.
c) Bildung des Gemeinwohls durch Kumulierung der individuellen Vorstellungen vom Gemeinwohl Es lässt sich damit weder ein normativ vorgegebenes, konkretes Gemeinwohl, an dem der Wähler seine Entscheidung auszurichten hat, ermitteln, noch kann das Gemeinwohl uneingeschränkt aus den kumulierten Individualinteressen gebildet werden. Daraus ist zu folgern, dass die Wahl dem Wahlberechtigten nicht die Gelegenheit geben soll, seine Individualinteressen unabgewogen in den Staat einzubringen.117 Es ist vielmehr ethische Voraussetzung der Demokratie, dass die Bürger bereit sind, Entscheidungen im Hinblick auf gemeinsame Interessen aller zu treffen.118 Die Demokratie beruht gerade darauf, dass die Bürger grundsätzlich allen anderen in gleicher Weise zumuten, dass diese nicht lediglich individuelle Interessen durchsetzen.119 „Die Bürger dürfen voneinander erwarten, dass niemand bei der Ausübung des Wahlrechts diese Gemeinsamkeit negiert und eine insoweit unvernünftige Entscheidung trifft.“120 Dabei kann der Wähler individuelle Interessen im Wahlakt ohnehin nicht isoliert wahrnehmen. Er kann sich durch die Wahl von Abgeordneten nur für politische Konzepte entscheiden, die von diesen vertreten werden. Diese Konzepte betreffen stets auch Fragen, die den einzelnen Wähler nicht tangieren und auch deshalb nicht in seinem eigenen Interesse liegen. Der Wähler ist aber gehalten, politische Konzepte nicht nur nach den Aspekten auszusuchen, die ihn selbst betreffen oder interessieren, (BVerfGE 131, 316 – Landeslisten, Urteil vom 25. 7. 2012) eingereichten Schriftsätze der Verfasser handelt. 117 So auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376. 118 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 78 f.; D. Merten, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1995), S. 5 (24), spricht von der „Verantwortung des Bürgers“ bei Wahlen und Abstimmungen. A. A.: A. Adrian, Grundsatzfragen zu Staat und Gesellschaft am Beispiel des Kinder-/Stellvertreterwahlrechts, 2017, S. 69, hält es hingegen für eine Einschränkung des Grundsatzes des Freiheit des Wahl, wenn bei der Wahlentscheidung die Interessen des nichtwahlberechtigen Teil des Volkes mitberücksichtigt werden müssen und hält deswegen die Einführung eines Kinderwahlrechts für geboten. 119 A. Funke, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit, Der Staat 46 (2007), S. 395 (415), allerdings mit dem Hinweis, dass sich die Stimmabgabe nur in engen Grenzen überhaupt am Gemeinwohl orientieren könne, weil der Inhalt des Wahlrechts durch die Personenwahl „stark beschränkt“ sei. 120 A. Funke, ebenda.
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
195
was eine Durchsetzung individueller Präferenzen bei der Wahl beinhalten würde; vielmehr ist er aufgefordert, das Gesamtkonzept zu berücksichtigen, das mit den Kandidaten zur Wahl gestellt wird. Würde jeder Wähler seine Wahlentscheidung nur aufgrund der für ihn relevanten Gesichtspunkte treffen, ergäbe sich das Paradox, dass die ausgewählten Konzepte nicht in ihrer Gesamtheit vom Volkswillen getragen wären, sondern Teile der Konzepte nur stillschweigend mit akzeptiert würden. Auch die Abhängigkeit des Innehabens des Wahlrechts von der Einbezogenheit in einen Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen sowie in den Kommunikationsprozess innerhalb des Volkes zeigt, dass das Wahlrecht nicht zur unreflektierten individualistischen Interessenwahrnehmung verliehen ist. Nur wer sich innerhalb des Kommunikationsprozesses befindet, in dem Meinungen ausgetauscht und dadurch gerade auch gebildet werden, wer sich fremden Meinungen damit auch aussetzt,121 wird in die Lage versetzt, am Wahlakt teilzunehmen. Dies zeigt, dass das Wahlrecht nicht vorbehaltlos nur zur eigenen Interessenwahrnehmung gewährt wird. Es wird vielmehr eine „gute“, weil über die allgemeinen Belange informierte Entscheidung erwartet. Dieser muss notwendigerweise ein Meinungsbildungsprozess vorausgehen, in den auch andere Meinungen jedenfalls die Chance hatten, einzufließen. Dass sich der einzelne Wähler im Vorfeld der Wahl tatsächlich in einen Kommunikationsprozess begibt, in dem Meinungen gebildet werden, bleibt indes eine Verfassungserwartung,122 die nicht erzwungen werden kann, weil sie auf der Ausübung von Freiheitsgrundrechten beruht. Hier zeigt sich zum einen, dass der Bürger in „zwei Reichen“ lebt, zum anderen zeigt sich aber, dass Grundbedingungen der Demokratie auch in der gesellschaftlichen Sphäre liegen. Ein völliges Enthalten vom (gesellschaftlichen) Kommunikationsprozess scheint in einer freiheitlichen Gesellschaft nahezu unmöglich. Welchen Diskursen sich der Einzelne aussetzt und wodurch er sich seine Meinung bildet, bleibt jedoch seine persönliche Entscheidung. Das Wahlrecht ist also jedenfalls nicht nur zur Durchsetzung von Individualinteressen verliehen, sondern um das Allgemeininteresse durch das Einfließenlassen der individuellen Auffassung vom Allgemeinwohl zu fördern.123 Ein feststehendes Gemeinwohl gibt es im Moment der Wahl nicht. Der Wähler bleibt frei, seine Überzeugung vom Gemeinwohl in seiner Wahlentscheidung zum Ausdruck zu bringen. Hierin liegt der Bezugspunkt seiner Wahlfreiheit. Die im Wahlakt getroffene 121
Da dies nicht individuell überprüfbar ist, ist es zulässig, hier zu pauschalieren. Die Demokratie muss notwendigerweise Verfassungserwartungen an die Bürger richten: J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, § 71 Rn. 1325. Hierzu auch H. Krüger, Verfassungsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen, in: Festschrift für Scheuner, S. 285 ff., zu Beispielen S. 293 ff. 123 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, 2010, S. 376, der jedoch dieser Pflichtenbindung eine „staatsbürgerliche[…]“ Natur zumisst, der keine positivrechtlichen Pflichten entsprächen. Dies zeigt die rechtsethische Natur dieser Pflicht; H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. IV, Art. 38 Rn. 138: „Der Wahlberechtigte steht zum Staat (Staatsvolk) in einem Verhältnis persönlicher Verantwortlichkeit.“ 122
196
F. Der Einzelne im Wahlakt
Entscheidung unterscheidet sich von einer privaten Entscheidung dadurch, dass sie sich nicht nach individuellen Präferenzen zu richten hat.124 Zu Recht wird daraus der Schluss gezogen, dass Volksbefragungen ungeeignet sind, den Willen des Volkes zu erfahren, weil der Befragte im Zwiespalt ist, seine individuelle Interessenpräferenz kundzutun oder seine reflektierte politische Entscheidung.125 Die Freiheit der Wahl beinhaltet damit nicht die ungebundene Freiheit, seine unabgewogenen Interessen in den Staat einzubringen, sondern die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, was dem Gemeinwohl entspricht.126 Das Bewusstsein hierfür ist in der Realität allerdings nicht geschärft. Der Bürger agiert ganz überwiegend in der gesellschaftlichen, freiheitlichen Sphäre, die durch die Wahrnehmung von Eigeninteressen geprägt ist. Er ist ganz als „Interessenbürger“ angesprochen und agiert als solcher.127 Diese empfundene ausschließliche Freiheitlichkeit resultiert auch aus der geringen Bedeutung von Grundpflichten im Grundgesetz.128 Dies lässt die verpflichtende Seite der Freiheit, die in der Organisation des Gemeinwesens notwendig ist, in den Hintergrund treten.129 Auch der Wahlkampf der Parteien spricht die Bürger als von Eigeninteressen geleitete Personen an, oftmals wird mit der Verfolgung von Partikularinteressen bestimmter Wählergruppen für die Stimmabgabe geworben. Die Stellung als Citoyen erfordert jedoch eine andere, nämlich eine gemeinschaftsbezogene Haltung, die jedoch nicht eingeübt ist. In Zeiten, in denen schon die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im gesellschaftlichen Bereich abnimmt, verwundert es nicht, wenn auch bei der Mitwirkung im staatlichen Bereich tatsächlich vornehmlich Eigeninteressen verfolgt werden. Dies ändert jedoch nichts
124 Ähnlich BVerfGE 44, 125 (142) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3. 1977: „… nur wenn die Mehrheit […] bei ihren Entscheidungen das – je und je zu bestimmende – Gemeinwohl im Auge hat, insbesondere die Rechte der Minderheit beachtet und ihre Interessen mitberücksichtigt […], kann die Entscheidung der Mehrheit bei Ausübung der Staatsgewalt als Wille der Gesamtheit gelten […].“ (Hier allerdings bezogen auf die Parlamentsmehrheit). 125 P. Krause, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie, HStR, Bd. III, 2005, § 35 Rn. 23. 126 J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 51; a. A. W. Frenz, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 (518), die Wahlentscheidung sei „in zunehmendem Maße durch bloße Interessen namentlich wirtschaftlicher Art geprägt“. 127 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: HStR, Bd. II, 2004, § 24 Rn. 80 Fn. 165. 128 Hierzu O. Luchterhandt, Grundpflichten als Verfassungsproblem in Deutschland, 1988, S. 22 f.; A. Randelzhofer, Grundrechte und Grundpflichten, in: Merten/Papier (Hrsg.), HGR, Bd. II, § 37 Rn. 3. Dennoch sind die im Grundgesetz vorhandenen Grundpflichten des Grundgesetzes in der Staatsrechtswissenschaft unterbelichtet. 129 „Die ,Grundrechtseuphorie‘ verdrängt den Blick auf die Grundpflichten der Bürger“, J. Isensee, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers, DÖV 1982, S. 609 (609).
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
197
daran, dass der Anspruch an die Wähler in der Förderung des Gemeininteresses besteht.130 Auch der Ausschluss von Auslandsdeutschen vom Wahlrecht rechtfertigt sich u. a. aus dieser Gemeinwohlbindung. Er gründet sich zwar auch darauf, dass diese nicht unbedingt hinreichend in das „Forum“ des Staatsorgans Volk einbezogen sind, und damit keine Gewähr dafür bieten, dass sie sich mit den zur Verfügung stehenden Alternativen in hinreichendem Maße auseinandergesetzt haben.131 Darüber hinaus lässt sich der Ausschluss aber auch dadurch begründen, dass diejenigen, die von den Entscheidungen des Staates weniger betroffen sind, weil sie zwar seiner Personalhoheit, nicht aber seiner Territorialhoheit unterworfen sind, wenig bis keine Gewähr dafür bieten, dass sie eine verantwortliche Entscheidung für das Gemeinwesen treffen, weil sie von der Staatsgewalt kaum betroffen sind.132 Gerade weil dem Volk und damit auch dem einzelnen Bürger eine Gemeinwohlbindung seines Wahlrechts auferlegt ist, wird den nicht im Staatsgebiet lebenden Personen kein bedingungsloses Wahlrecht zugestanden. Die Entscheidung der Wähler ist jedoch nicht justitiabel, weil nicht nur die Wahl an sich geheim ist, sondern auch die Motive für die Wahlentscheidung. Besonders die geheime Stimmabgabe mag den Eindruck vermitteln, dass die Entscheidung vorwiegend an persönlichen Interessen ausgerichtet werden kann oder gar soll und der Wähler aus diesem Grund für seine Wahlentscheidung nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann.133 Die geheime Wahl soll jedoch nur die Freiheitlichkeit der Entscheidung der Wähler sichern, bei der diese jedoch das Gemeinwohl berücksichtigen müssen. d) Einbeziehung welcher Interessen in das Gemeinwohl? Es fragt sich dann, wessen Interessen bei der Gemeinwohlbindung zu berücksichtigen sind. Dies müssen die Interessen derjenigen sein, die von den Entscheidungen, die durch die Wahl legitimiert werden, betroffen sind. Die Aktivbürgerschaft und damit die wahlberechtigten Bürger treffen ihre Entscheidungen jedoch nicht nur für sich und den nicht wahlberechtigten Teil des Volkes. Auch die Interessen der zukünftigen Generationen müssen durch die aktuell handelnde Aktivbürgerschaft vertreten werden. Denn die Einführung von Legislaturperioden in der Demokratie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Entscheidungen in ihren Wirkungen 130
Wird dies berücksichtigt, erübrigen sich auch Forderungen nach einem Familienwahlrecht. Selbstverständlich sind alle Wähler gehalten, die Interessen von Kindern und Familien in ihre Wahlentscheidung einzubeziehen. 131 BVerfGE 132, 39 (50 f.) – Wahlberechtigung Auslandsdeutscher. 132 J. Henkel, Wahlrecht für Deutsche im Ausland, AöR 99 (1974), S. 1 (8). 133 So auch H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 250 f.: „Daß der Wähler eine öffentliche Person ist und daher nach allgemeinen Erwägungen seine Stimme abzugeben hat, wird dadurch verdunkelt, dass er geheim abstimmt.“ Auch C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 245, hatte derartige Bedenken.
198
F. Der Einzelne im Wahlakt
weit über die aktuelle Legislaturperiode134 hinausreichen.135 Zwar sind in der Demokratie grundsätzlich alle Entscheidungen reversibel, ihre Wirkung lässt sich jedoch oftmals auch bei einer Revidierung der Entscheidung nicht rückgängig machen. Die Entscheidung des jetzigen Wahlvolkes bindet somit auch zukünftige Generationen, deren Interessen bei der Ausübung von Staatsgewalt mitberücksichtigt werden müssen.136 Dabei können aus praktischen Gründen nicht deren tatsächliche Interessen, sondern nur die durch das jetzige Volk angenommen Interessen zugrunde gelegt werden. e) Ergebnis zur Gemeinwohlbindung Der Wähler ist also in der Wahl nicht an ein vorher bestimmtes Gemeinwohl gebunden, sondern vielmehr gehalten, an der Bildung desselben mitzuwirken. Seine Entscheidung ist somit zwar dem Gemeinwohl verpflichtet, nicht aber an das Gemeinwohl gebunden. Das Gemeinwohl bildet sich aus den Vorstellungen der Wähler darüber, was dem Gemeinwohl dient. Dies kann in der repräsentativen Demokratie nur die Vorstellung davon meinen, welche Repräsentanten das, was der einzelne Wähler persönlich für das Beste für die Gemeinschaft hält, voraussichtlich am besten verwirklichen.
3. Organisatorisches Amt Das Amtsprinzip ist zudem gekennzeichnet durch eine vom jeweiligen Amtsinhaber unabhängige Stellung des Amtes.137 Das Amt muss sich also von der Person des
134
So auch P. Henseler, Verfassungsrechtliche Aspekte zukunftsweisender Parlamentsentscheidungen, AöR 108 (1983), S. 490 (539 f.). 135 Auch ihnen hat der Staat deshalb zu dienen: H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, S. 131 f., er rechnet deshalb auch die zukünftigen Mitglieder des Volkes dem Volk i. S. d. Art. 20 Abs. 1 S. 1 zu. Die Einbeziehung der Interessen der zukünftigen Mitglieder entspricht dem Umstand, dass das Volk eine kontinuierliche Größe ist, die sich über Generationen erstreckt. Das jetzige Volk bildet auch mit den vorhergegangenen und zukünftigen Generationen eine Schicksalsgemeinschaft. Die Einbeziehung der zukünftigen Mitglieder in das souveräne Volk geht jedoch zu weit. Zur Schicksalsgemeinschaft: J. Isensee, Abschied der Demokratie vom Demos, in: Schwab/Giesen/Liste/Strätz (Hrsg.), Festschrift für Mikat, S. 705 (712); N. Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl, 2004, S. 81; H. SchulzSchaeffer, Der demokratische Rechtsstaat als Republik, als „gemeinsame Sache aller“, JZ 2003, S. 554 (557). 136 Wenn B. Großfeld, Götterdämmerung, NJW 1995, S. 1719 (1722), für eine Einschränkung der „Macht der Toten“ plädiert, dann ist dies in der umgekehrten Richtung zu verstehen, die lebende Generation solle sich nicht übermäßig an die nachfolgende Generationen binden. 137 M. Schröder, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S. 288; H.-J.Wolff/O. Bachof, Verwaltungsrecht, Bd. II, 4. Aufl., 1976, § 74 I; a. A. A. Köttgen, Das
III. Der Bürger im Wahlakt als Amtsträger?
199
Amtswalters unabhängig denken lassen. Es umschreibt einen Zuständigkeitsbereich, mit dem dann ein Amtswalter betraut wird. Dies wird als das organisatorische Amt beschrieben. Das Amt an sich ist damit selbst „unsterblich“ und überdauert seinen Inhaber.138 Diese Trennung besteht aber für den Wahlbürger nicht. Es gibt kein vom einzelnen Bürger unabhängiges Amt, das dann mit Personen besetzt wird. Die Kompetenz, an Wahlen zum Deutschen Bundestag teilzunehmen, wird jedem Staatsbürger aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Volk zugewiesen, sie entsteht für jeden Einzelnen individuell. Es gibt keine bestimmte Zahl an Ämtern, deren Aufgaben dann zu bestimmenden Personen übertragen werden, sondern eine bestimmte Zahl an Personen, die gemeinsam ein Staatsorgan bilden. Dies spiegelt die Besonderheit des Staatsorgans Volk, das sich aus seinen Teilen erst zusammensetzt und in seiner Existenz von ihnen abhängig ist.139 Das „organisatorische Amt“ und der Amtswalter fallen in der Person des Wahlbürgers zusammen.
4. Ergebnis Es zeigt sich, dass auch die Stellung des Wählers Unterschiede zum Amtsprinzip aufweist. Zum einen ist er nicht an ein vorher bestimmtes Gemeinwohl gebunden, sondern nur der Bildung des Gemeinwohls verpflichtet, indem er seine Vorstellung vom Gemeinwohl einbringt. Zum anderen gibt es die dem Amtsbegriff innewohnende Unterscheidung zwischen Amt und Person nicht. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass staatliche Ämter dem (beamtenrechtlichen) Amtsbegriff immer weniger entsprechen, je näher sie innerhalb der Legitimationskette dem Volk als erstem Glied sind. Je näher sie an das Volk heranrücken, desto weniger ist ihre Amtsführung an das Gemeinwohl gebunden, sondern auf die Bestimmung desselben gerichtet. Auch die Pflichtenbindung wird dementsprechend umso unbestimmter, je näher ein Organ und dessen Amtswalter dem Volk stehen. So unterliegt der Sachbearbeiter in einer Behörde dem strengen Regiment des Beamtenrechts, während der Abgeordnete nur dem Gesetz und seinem Gewissen unterworfen ist. Dennoch lassen sich die Aufgaben der übrigen Staatsorgane unabhängig von den konkreten Organwaltern denken, so dass diese noch als Amtsträger bezeichnet werden können. Für das Volk und den einzelnen Bürger gilt dies jedoch nicht mehr. Der Einzelne wird vom Demokratieprinzip als Person in die staatliche Sphäre aufanvertraute öffentliche Amt, in: Festgabe für Smend, 1962, S. 119 (123): „Amtsrecht ist Statusrecht, so eng dies auch mit dem Organisationsrecht verbunden sein mag.“ 138 O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: Isensee/Kirchhof, HStR, Bd. III, § 36 Rn. 59. 139 Siehe oben in Abschnitt D. IX. 3. S. 170.
200
F. Der Einzelne im Wahlakt
genommen und nicht zur Erfüllung eines Amtes. Dies ist aber nicht als eine Verzwecklichung des Einzelnen für die Staatsordnung zu verstehen, sondern im Gegenteil als eine Erweiterung seines Rechtskreises in die staatliche Sphäre hinein. Der Einzelne wird – im Gegensatz zu allen anderen Organwaltern, die entweder durch Wahl oder Ernennung oder aufgrund des Beamtenrechts, das auf Qualifikation beruht,140 – vorbehaltlos und ausschließlich aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Staatsvolk in die Staatsorganisation aufgenommen. Von einem „Amt des Wahlbürgers“ lässt sich deshalb nicht sprechen. Für den Bürger gelten auch keine Befangenheitsregeln, es liegt vielmehr in der Natur seiner Entscheidung, dass diese ihn (jedenfalls potenziell) auch selbst trifft. Seine Entscheidung ist zwar überwiegend fremdbestimmend, weil sie mehrheitlich andere trifft, sie trifft aber in gewissem Umfang oft auch ihn selbst. Die Demokratie beinhaltet damit die Entscheidungsmöglichkeit über das, was alle angeht.
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze Während sich das Recht zu wählen als organschaftliches Recht, als Kompetenz erwiesen hat, könnten jedoch den Wahlgrundsätzen individual-rechtliche Gehalte entnommen werden. Denn die Wahlgrundsätze regeln nicht die Wahl an sich, sondern nur ihre verfahrensmäßige Ausgestaltung. Sie sind deshalb vom Wahlrecht – als dem Recht zu wählen – logisch zu trennen, auch wenn sie dieses ausformen. Sie finden jeweils in unterschiedlichen Phasen der Wahl Anwendung, haben also jeweils einen unterschiedlichen Wirkbereich.141 Einen individual-rechtlichen Gehalt kann ein Wahlgrundsatz nur dann haben, wenn er sich nicht nur unmittelbar auf die Wahl an sich bezieht und nicht nur während der Wahl Wirkung entfaltet. Denn diese spielt sich – wie erläutert – im staatlichen Bereich ab, hier wird das Volk und damit auch der einzelne Aktivbürger staatsorganschaftlich tätig.142 Soweit die Wahlgrundsätze also den Wahlvorgang selbst ausgestalten und sich nur auf diesen auswirken, sichern sie nur den staatlichen Bereich und hierin enthaltene Rechte ab. Dass ihnen dann individual-rechtlicher Gehalt zukommt, kann dann nicht angenommen werden. Es sind somit die einzelnen
140 Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG werden Ämter nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vergeben. 141 A. A. H. Meyer, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: HStR, Bd. III, 2005, § 45 Rn. 17; N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 120; einschränkend H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 GG Rn. 83: „Die Wahlrechtsgrundsätze erfassen – nicht stets mit gleicher Stringenz – den gesamten Wahlvorgang.“ 142 Siehe hierzu oben in Abschnitt E. VIII., S. 167, und F. I., S. 176 ff.
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze
201
Wahlgrundsätze143 darauf zu untersuchen, auf welches Stadium der Wahl sie sich beziehen und inwiefern somit Raum für einen individual-rechtlichen Gehalt ist.
1. Der Grundsatz der gleichen Wahl Der Grundsatz der gleichen Wahl entfaltet Wirkung sowohl vor als auch nach der Stimmabgabe. Vor der Stimmabgabe gebietet er, dass alle Wahlberechtigten mit nur einer Stimme ausgestattet werden, was praktisch mit der einmaligen Eintragung ins Wählerverzeichnis und der Ausstellung nur eines Wahlscheins und der damit verbundenen einmaligen Möglichkeit der Stimmabgabe umgesetzt wird.144 Nach der Stimmabgabe entfaltet er Wirkung, indem er gebietet, dass alle abgegebenen Stimmen dann jedenfalls gleich gezählt werden. Äußerst strittig ist, ob der Grundsatz auch gebietet, dass die Stimmen gleiche Wirkung auf das Wahlergebnis haben müssen.145 Unabhängig davon, wie dieser Streit zu entscheiden ist, betrifft dies aber die Bildung des Willens des Volkes aus den Einzelwillen der einzelnen Wähler und fällt damit in den staatlichen Bereich. Die Ableitung eines Individualrechts scheidet damit in dieser Hinsicht aus. Die Verletzung eines solchen könnte auch dem Berechtigten – wie oben bereits gezeigt146 – auch nicht mehr zugeordnet werden. Deshalb scheidet auch die Verletzung des organschaftlichen Rechts des einzelnen Wählers nach der Wahl aus. Das Recht auf Gleichbehandlung der Stimmen nach der Wahl kann deshalb nur als Recht des gesamten Volkes gedeutet werden. Ein nicht nach Grundsätzen der Gleichheit zustande gekommenes Wahlergebnis entspricht nicht dem Recht des Volkes auf ein richtiges Wahlergebnis und ist zugleich eine Verletzung des objektiven Grundsatzes der Gleichheit der Wahl. 143 Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG beschreibt ausdrücklich fünf Wahlgrundsätze: die der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl. Zunehmend wird der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl als sechster Wahlgrundsatz behandelt; so etwa A. Voßkuhle/A.-K. Kaufhold, Die Wahlrechtsgrundsätze, JuS 2013, S. 1078 (1080); A. Guckelberger, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze, Teil 2, JA 2013, S. 641 (645); S. Schiedermair, Gefährden Wahlcomputer die Demokratie?, JZ 2007, S. 162 (166). Dieser Grundsatz soll hier nicht behandelt werden. 144 Fehler können dann unterlaufen, wenn der Wahlberechtigte in den Monaten vor der Wahl seinen Wohnsitz ändert und dann eine Eintragung in die Wählerverzeichnisse beider Wohnorte sowie eine doppelte Ausstellung des Wahlscheins erfolgt. Dennoch ist der Wahlberechtigte dann nur zur einmaligen Ausübung des Wahlrechts berechtigt. Als strukturell hat sich dieses Problem bei Wahlen zum Europäischen Parlament erwiesen. Da die Wahl hier in den Mitgliedstaaten durchgeführt wird, erhalten Personen mit mehrfacher Staatsangehörigkeit und mehrfachem Wohnsitz auch mehrere Wahlscheine. Auch wenn der Grundsatz der gleichen Wahl bei den Wahlen zum Europäischen Parlament keine Anwendung findet, weil die den einzelnen Staaten zustehenden Sitze nicht proportional zur Zahl der Wahlberechtigten vergeben werden, widerspricht die doppelte Wahl durch eine Person grundlegend dem demokratischen Prinzip. 145 Zur Zählwert- und Erfolgswertgleichheit siehe oben in Abschnitt D IV. 3 a), S. 82 ff. 146 Siehe oben in Abschnitt D. VIII. 3., S. 105 f.
202
F. Der Einzelne im Wahlakt
Aber auch vor der Wahl im Hinblick auf die Zuteilung gleicher Wahlchancen ist der einzelne Bürger nicht als Individuum, sondern als Teil der Aktivbürgerschaft berechtigt. Denn der Wahlberechtigte wird nicht durch die Erteilung eines Wahlscheins zum Teil der Aktivbürgerschaft, sondern ist dies bereits zuvor, die Aktivbürgerschaft ist permanentes Organ.147 Alle Glieder des Staatsorgans Volk müssen in Bezug auf die Möglichkeit der Ausübung der Kompetenzen gleich behandelt werden. Auch bei der Zuteilung gleicher Wahlchancen ist in der Gleichheit der Wahl damit kein Individualrecht zu sehen. jedoch besteht hier ein organschaftliches Recht nicht nur des gesamten Volkes, sondern zugleich auch ein organschaftliches Recht des einzelnen Aktivbürgers. Es ist auch nicht möglich, die Kompetenz zu wählen – das organschaftliche Recht – durch ein individuelles Recht auf Gleichheit der Wahl „flankiert“ zu sehen, wie es Bernd Hartmann annimmt.148 Die Intention der Annahme eines solchen individuellen „Begleitrechts“ liegt dann auch nicht in materiell-rechtlicher Einsicht, sondern in prozessualem Pragmatismus: Durch die Annahme eines solchen Rechts wird die Klagbarkeit verstärkt, was der Bedeutung der Gleichheit der Wahl gerecht werde.149 Die Gleichheit „flankiert“ aber das Recht nicht, sondern durchwirkt es, weil sich die Gleichheit nur in Bezug auf das Recht, nicht aber unabhängig von diesem denken lässt. Sie kann deshalb nur den gleichen Rechtscharakter haben wie das Recht selbst. In der Literatur wird mitunter angenommen, dass der Bürger nur im Moment der Stimmabgabe Teil des Staatsorgans Volk sei, sich davor und danach aber in der grundrechtlichen Sphäre befinde. Nur während der Stimmabgabe könne er deshalb im staatsorganschaftlichen Bereich betroffen sein.150 Dies hätte jedoch die Konsequenz, dass sich Beeinträchtigungen der Wahlrechtsgleichheit nach der Wahl in der grundrechtlichen Sphäre der Wahlberechtigten auswirken würden. Es würde das Paradox auftreten, dass die Verletzungen der Wirkung eines Rechts, das der einzelne Wähler im staatlichen Rechtskreis ausgeübt hat, sich als Verletzung gerade dieses Rechts in seiner persönlichen Sphäre darstellen würden. Auch wurde bereits gezeigt, dass sich derartige Rechtsverletzungen nicht mehr den einzelnen Wahlberechtigten zuordnen lassen, so dass auch eine Auswirkung in deren individual-rechtlicher Sphäre sich nicht mehr individualisieren ließe.151 Die Annahme, der Bürger sei nur während der Stimmabgabe Teil des Staatsorgans Volk, resultiert aus der – wie gezeigt – falschen Vorstellung vom Volk als lediglich 147
Siehe hierzu oben unter Abschnitt E. IX. 2., S. 168 f. So aber B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 155, (in Bezug auf Abstimmungen). 149 B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 155; zur Finalität dieser Einordnung eindeutig auch S. 180. 150 Franzke, Der Schutz des aktiven Wahlrechts durch die Verwaltungsgerichte, DVBl. 1980, S. 730 (731); B.-D. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, 1970, S. 112; H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 155. In diesem Sinne auch schon G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1905, S. 162 f. 151 Siehe oben in Abschnitt D. VIII. 3., S. 105 f. 148
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze
203
punktuell existentem Organ. Der Wahlberechtigte als Teil eines permanenten Organs kann von Wahlverfahrensakten wie der Auszählung der Stimmen und der Zuteilung der Mandate nur in seinem organschaftlichen Recht als Recht, das der staatlichen Sphäre entspringt, betroffen sein. Auf seinen individuellen Rechtskreis, der neben dem staatsorganschaftlichen besteht, haben diese Akte jedoch keinen Einfluss. Der Wähler fällt nicht von der Ausübung der Kompetenz in seinen grundrechtlichen Rechtskreis zurück; beide Sphären bestehen vielmehr nebeneinander, jedoch wird der Bürger nur bei Wahlen und Abstimmungen im Innenrechtskreis des Staates tätig.
2. Der Grundsatz der unmittelbaren Wahl Der Grundsatz der unmittelbaren Wahl fordert, dass zwischen den Willen der Wähler und dem Wahlergebnis keine Zwischenschritte treten, dass sich also im Wahlergebnis unmittelbar der Wille des Volkes abbildet. Jede abgegebene Wählerstimme muss deshalb bestimmten oder bestimmbaren Wahlbewerbern zugerechnet werden können.152 Der Grundsatz wirkt damit nach der Stimmabgabe, weil er sich auf die Umsetzung der Stimme bezieht. Er entfaltet aber insofern Wirkung auf die Phase vor der Stimmabgabe, als er schon sicherstellt, dass sich die Entscheidung des Wählers, die er vor seiner Stimmabgabe trifft, nur auf Kandidaten richten darf, die dann auch in das Parlament einziehen können, und für den Wähler vor der Wahl erkennbar sein muss, welche Wirkung seine Stimmabgabe entfalten kann.153 In jedem Fall aber ist es der Bürger in seiner organschaftlichen Rolle, der von dem Grundsatz der unmittelbaren Wahl geschützt wird. Dieser Grundsatz enthält deshalb keine individual-rechtlichen Gehalte.
3. Der Grundsatz der freien Wahl Der Grundsatz der freien Wahl soll die Entscheidungsfreiheit des Wählers bei der Wahl garantieren. Es soll hierdurch vor allem die freie Wahlbetätigung geschützt werden.154 Dies aber nicht um der individuellen Freiheitsverwirklichung des Einzelnen willen, sondern weil nur die freie Willensbekundung der Aktivbürger demokratischen Grundsätzen entspricht, nur sie kann demokratische Legitimation vermitteln.155 Es handelt sich um eine organschaftliche Freiheit, nicht um eine 152 B. Grzeszick, Verfassungsrechtliche Grundsätze des Wahlrechts, Jura 2014, S. 1110 (1113); A. Guckelberger, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze, JA 2012, S. 561 (564). 153 B. Grzeszick, Verfassungsrechtliche Grundsätze des Wahlrechts, S. 1110 (1113); C. Burkiczak, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl zum Deutschen Bundestag, JuS 2009, S. 805 (808); BVerfGE 97, 317 (326) – Nachrücken in den Überhang, Beschluss vom 26. 2. 1998. 154 BVerfGE 15, 165 (166) – Vorauswahl, Beschluss vom 29. 11. 1962. 155 A. Guckelberger, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze, JA 2012, S. 561 (564).
204
F. Der Einzelne im Wahlakt
Freiheit der individuellen Rechtssphäre. Insofern beinhaltet auch die Freiheit der Wahl ausschließlich ein organschaftliches Recht. Dem Grundsatz der freien Wahl wird jedoch auch eine Wirkung im Vorfeld der Wahl beigemessen. Wahlfreiheit erfordere nicht nur, dass der Wähler frei von unzulässigem Zwang oder Druck bleibt, sondern auch, dass die Wähler ihr Urteil in einem freien, offenen Prozess der Willensbildung fällen können.“156 Weil sich der Bürger im Vorfeld der Wahl noch in seiner individual-rechtlichen Sphäre befindet, könnte dem Grundsatz der freien Wahl insofern individual-rechtlicher Gehalt beigemessen werden. Fraglich ist indes, inwiefern es tatsächlich der Grundsatz der freien Wahl ist, der im Vorfeld der Wahl die freie Willensbildung sichert. Zwar ist der freie Willensbildungsprozess Voraussetzung für eine freie Willensentscheidung; eine Wahl ist auch dann nicht frei im eigentlichen Sinn, wenn der Wähler im Vorfeld der Wahl einseitig beeinflusst wird, während der Wahl aber keine Beeinflussungen stattfinden. Es zeigt sich hier besonders deutlich, dass sich der Wähler in zwei Sphären bewegt, in der gesellschaftlichen und in der staatlichen. Er bleibt derselbe Mensch, der sich im gesellschaftlichen Bereich eine Meinung bildet und schließlich als Teil des Staatsorgans Volk im staatlichen Bereich wählt. Beeinflussungen des Bourgeois können auf den Citoyen fortwirken. Die freie Meinungsbildung in der Gesellschaft ist deshalb Voraussetzung für eine freie Wahl;157 sie kann jedoch nicht selbst von dem Grundsatz der freien Wahl erfasst sein, weil dieser sonst unmittelbar und unbegrenzt die Freiheit des gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses sichern würde und so die Grenze zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre verwischen würde. Da der Grundsatz der freien Wahl sich somit nur auf den staatlichen Bereich bezieht, hat er keinen individual-rechtlichen Gehalt.
4. Der Grundsatz der geheimen Wahl Der Grundsatz der geheimen Wahl bezieht sich unmittelbar auf die Stimmabgabe. Diese hat geheim, das heißt für andere als den Wählenden nicht ersichtlich, zu erfolgen.158 Die Stimmabgabe des einzelnen Bürgers fällt – wie gesehen159 – bereits in den staatlichen Bereich, nicht erst das Wahlergebnis als Wille des gesamten Volkes. Der Grundsatz der geheimen Wahl ist dazu bestimmt, die Geheimheit der Stimm156
1977.
BVerfGE 44, 125 (139) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3.
157 P. Badura, in: Bonner Grundgesetz, 161. Lfg. (Stand: Mai 2013), Bd. VIII, Anh. z. Art. 38 Bundeswahlrecht, Rn. 29. 158 C. Burkiczak, Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl zum Deutschen Bundestag, JuS 2009, S. 805 (808); A. Guckelberger, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze, JA 2012, S. 561 (565). 159 Siehe oben in diesem Abschnitt unter F. I., S. 176.
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze
205
abgabe und damit die Freiheit der Wahlentscheidung eines jeden Wählers zu sichern. Damit enthält der Grundsatz selbst ein organschaftliches Recht.160 Nur dann, wenn man den Grundsatz der geheimen Wahl als Schutz der Kompetenz zu wählen erkennt, erklärt sich, warum der Wähler über die Geheimheit seiner Stimmabgabe nicht verfügen kann.161 Der Wähler ist vielmehr verpflichtet, die zur Geheimhaltung getroffenen Einrichtungen wie die Stimmkabine und bei der Briefwahl das Stimmkuvert zu benutzen.162 Die bloße Mitteilung über die Art und Weise der Wahlausübung verstößt jedoch nicht gegen den Grundsatz der geheimen Wahl, weil sie stets nur eine Behauptung bleibt, die getroffene Entscheidung aber nur tatsächlich offengelegt werden könnte, indem der ausgefüllte Stimmzettel gezeigt würde. Die Geheimheit der Wahl soll die Freiheit der Willenskundgabe schützen163 und gewährleisten, dass es der Wille des einzelnen Wählers ist, der in die Willensbildung des Volkes eingeht, und nicht der Wille eines Dritten, der über den beeinflussten Wähler mittelbar Einfluss nimmt. Dies geschieht aber nicht um der Freiheit des Einzelnen willen – die geheime Wahl soll nicht den Wähler davor schützen, sich selbst Beeinflussungen auszusetzen –, sondern weil nur eine freie Stimmabgabe jedes einzelnen Wählers gewährleistet, dass sich im Wahlergebnis der wirkliche Wille des Volkes als Resultante der Wählerwillen abbildet. Dies ist nicht nur dann gefährdet, wenn der Wähler durch nicht Wahlberechtigte und damit nicht zur Aktivbürgerschaft gehörende Dritte beeinflusst wird, sondern auch dann, wenn der Druck von selbst wahlberechtigten Personen ausgeht. Denn mögliche Beeinflussungen durch Wahlberechtigte gingen von deren privater Sphäre aus, weil sie diese nicht als Teil des Staatsorgans Volk ausüben würden. Eine Beeinflussung der Wähler in ihrer Wahlentscheidung im Akt der Wahl würde nicht zu Ungleichgewichtungen der Willen der einzelnen Organteile führen, sondern dazu, dass private Meinungen in die Willensbildung des Volkes Eingang fänden. Aus diesem Grund ist es auch ge160 A. A. B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 157, der (in Bezug auf Abstimmungen) von „subjektiv-rechtlichem Begleitschutz“ des „kompetenz-rechtlich organisierte[n] Recht auf Stimmabgabe“ spricht. Eine Begründung dafür, warum dieser „Begleitschutz“ subjektiv-rechtlicher Natur sein soll, erfolgt nur andeutungsweise daraus, dass der Abstimmende sonst gesellschaftlichem Druck ausgesetzt wäre. Die Frage ist jedoch nicht, woher der abzuwehrende Druck kommt, nämlich aus der Gesellschaft, sondern wohin er wirkt. Er wirkt vorwiegend gerade auf den Wähler als Ausübender von Staatsgewalt. Zu darüber hinaus gehenden Wirkungen auch in der gesellschaftlichen Sphäre sogleich. 161 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 106, S. 160, § 33 Rn. 3, S. 575; B. Pieroth, Offene oder geheime Wahlen und Abstimmungen, JuS 1991, S. 89 (91), sieht die Unverzichtbarkeit als Ausfluss des objektiven Grundsatzes, der den freiheitlichen Gehalt des grundrechtsgleichen Rechts einschränke. Wäre die geheime Wahl ein Individualrecht des einzelnen Wählers, wäre es nicht rechtfertigungsbedürftig, dass hilfsbedürftige Personen ihre Wahlhandlung für die Hilfsperson ersichtlich durchführen können. 162 Auch muss der Stimmzettel so gefaltet sein, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, § 34 Abs. 1 S. 2 BWahlG. 163 M. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 1 Rn. 151.
206
F. Der Einzelne im Wahlakt
rechtfertigt, Verstöße gegen die Geheimhaltungspflicht strafrechtlich zu sanktionieren,164 weil sie keine bloße Obliegenheit ist, sondern eine Pflicht,165 die dem gesamten Volk gegenüber besteht. Ein Schutz auch der freiheitlichen, individual-rechtlichen Sphäre des Wählers ist aber mittelbar denkbar, weil der Grundsatz der geheimen Wahl auch die nachträgliche Geheimhaltung der Wahlentscheidung gebietet. Er schützt damit den Wähler auch nach der Stimmabgabe, wenn er nicht mehr in der staatsorganschaftlichen, sondern nur noch in der grundrechtlichen Sphäre agiert, und hinsichtlich seiner organschaftlich abgegebenen Entscheidung in seiner individuellen Rechtsphäre privaten Rechtfertigungszwängen ausgesetzt sein könnte, wenn seine organschaftlich abgegebene Entscheidung nicht auch weiterhin geheim bliebe. Die über die Stimmabgabe hinausgehende Wirkung der Geheimheit der Wahl166 kann daher als Individualrecht begriffen werden.167
5. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl Der Grundsatz der allgemeinen Wahl sichert die Gleichheit im Hinblick auf den Zugang zur Wahl und damit Gleichheit bezüglich der Wahlberechtigung.168 Er sagt aus, dass jeder, der zum Gesamtvolk gehört und in der Lage ist, verantwortliche Entscheidungen zu treffen, zur Aktivbürgerschaft gehören, also wahlberechtigt sein muss. Der Grundsatz vermittelt somit ein Recht nicht aus der aktivbürgerschaftlichen Stellung, sondern auf die aktivbürgerschaftliche Stellung. Der Einzelne hat hier nicht ein organschaftliches Recht aus seiner Stellung als Teil der Aktivbürgerschaft, sondern ein vorgelagertes Recht auf Zugehörigkeit zur Aktivbürgerschaft. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl kommt so zur Anwendung, bevor der Einzelne in den staatlichen Bereich eintritt. Er entfaltet seine Wirkung noch in der gesellschaftlichen Sphäre. Dass er in der staatlichen Sphäre keine Wirkung mehr entfaltet, zeigt sich auch daran, dass der Grundsatz während der Wahl nicht mehr von Bedeutung ist. Stets ist es der Grundsatz der Gleichheit der Wahl, der im weiteren Verlauf der Wahlen die Gleichbehandlung der Wähler und ihrer Stimmen festlegt. 164 A. A.: B. Pieroth, Offene oder geheime Wahlen und Abstimmungen, JuS 1991, S. 89 (92); M. Nowak, Politische Grundrechte, 1988, S. 370. 165 H. Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: HStR, Bd. III, 2005, § 46 Rn. 20. 166 B. Pieroth, Offene oder geheime Wahlen und Abstimmungen, JuS 1991, S. 89 (91), und B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 157, nehmen auch eine Wirkung vor der Stimmabgabe an. 167 Wenn man jedes Individualrecht, das sich außerhalb des Grundrechtekatalogs befindet, als „grundrechtsgleiches Recht“ begreift, dann enthält auch der Grundsatz der geheimen Wahl ein grundrechtsgleiches Recht. 168 M. Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 174. Er ist jedoch kein „Sonderfall“ der Gleichheit der Wahl, sondern ein eigener Gleichheitssatz. So aber B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 154.
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze
207
Der Grundsatz der allgemeinen Wahl hat so als einziger Wahlgrundsatz neben seiner objektiv-rechtlichen Funktion ausschließlich individual-rechtlichen Gehalt. Er vermittelt ein Individualrecht auf ein organschaftliches Recht, ein Recht darauf, mit dem Wahlrecht zum Deutschen Bundestag ausgestattet zu werden.169 Der Grundsatz der allgemeinen Wahl gilt allerdings nur mit der verfassungsimmanenten Einschränkung des Art. 38 Abs. 2 GG;170 nur wer volljährig ist, ist berechtigt, an Wahlen zum Deutschen Bundestag teilzunehmen. Auch darüber hinaus können einfachgesetzliche Einschränkungen stattfinden, wenn sie sich als Konkretisierung des Demokratieprinzips darstellen. Nur insoweit der Grundsatz der allgemeinen Wahl nicht durch verfassungskonkretisierendes Recht eingeschränkt ist, vermittelt er individuelle Rechte. a) Vergleichbarkeit der Allgemeinheit der Wahl mit anderen Rechten des „status activus“ Die Rechte, die dem status activus oder den politischen Grundrechten171 zugerechnet werden, zielen zwar alle darauf ab, dass der Einzelne für den Staat tätig werden kann,172 sie unterscheiden sich aber dennoch wesentlich vom Wahlrecht selbst. Das Wahlrecht wie auch das Abstimmungsrecht verschaffen die Rechtsmacht, unmittelbar auf den staatlichen Willen einzuwirken.173 Andere Rechte hingegen, die dem status activus zugerechnet werden, wie die Wählbarkeit nach Art. 38 GG oder das Recht auf gleichen Ämterzugang nach Art. 33 Abs. 2 GG,174 verschaffen erst ein Recht darauf, nach bestimmten Kriterien – sei es Wahl oder Qualifikation – als Amtsträger eingesetzt zu werden und so den staatlichen Willen mitzuformen.175 Erst 169
Ähnlich A. Voßkuhle/A.-K. Kaufhold, Die Wahlrechtsgrundsätze, JuS 2013, S. 1078 (1079). Zum Recht auf das Amt als persönliches subjektives Recht W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 76. 170 B. Grzeszick, Verfassungsrechtliche Grundsätze des Wahlrechts, Jura 2014, S. 1110 (1112). 171 So die Terminologie von W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498). 172 So auch W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498). 173 Nur diese Rechte bezeichnet W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (499), als „demokratische Grundrechte“. 174 W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (499), nennt daneben noch die staatsbürgerliche Gleichheit im engeren Sinne nach Art. 33 Abs. 1 GG, sowie Art. 33 Abs. 5 GG, soweit er Grundsätze für die Ämterbesetzung beinhaltet, die eventuell begünstigenden Wirkungen der Wehrdienstfähigkeit nach Art. 12a Abs. 1 GG, sowie die Fähigkeit zu allen Diensten, die mit der Ausübung von Staatsgewalt verbunden sind, nach Art. 12a Abs. 2, 3 und 4 GG sowie Art. 12 Abs. 2 GG. 175 Diese Unterscheidung findet sich auch bei K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 64 III 9, S. 468 f., der zu der Gruppe der staatsbürgerlichen Rechte zum einen diejenigen zählt, „die die Beteiligung des Einzelnen als Teil des Staatsorgans Volk an Wahlen und Abstimmungen zum Gegenstand haben“, und zum anderen „diejenigen, die die Besetzung der
208
F. Der Einzelne im Wahlakt
als solcher ist der Einzelne dann berechtigt, an der staatlichen Willensbildung teilzunehmen. Es handelt sich also bei den Rechten des status activus um zweistufige Rechte, bei dem das Recht auf die Organstellung und Rechte aus der Organstellung klar unterschieden werden.176 Auch die unterschiedliche Rechtsnatur der Rechte wird dabei deutlich: Während es sich bei dem Recht auf die Organstellung um ein Individualrecht der gesellschaftlichen Sphäre handelt, handelt es sich bei Rechten aus der Organstellung um organschaftliche Rechte der staatlichen Sphäre.177 Vergleichbar mit dem Recht auf gleichen Ämterzugang und dem Recht auf Wählbarkeit ist dann nicht das Wahlrecht, das ein organschaftliches Recht ist, sondern das Individualrecht des Einzelnen aus der allgemeinen Wahl. Dieses verschafft – wie soeben gezeigt – ebenfalls erst ein Recht darauf, ein organschaftliches Recht zu erhalten. Der Unterschied ist jedoch, dass die Forderung des Grundsatzes der allgemeinen Wahl ohne Mitwirkung des Berechtigten erfüllt wird, der Grundsatz der allgemeinen Wahl also ein unbedingtes Recht enthält. Der Einzelne muss sein Individualrecht auf das Wahlrecht nicht geltend machen, weil es bereits durch das objektive Wahlrecht umgesetzt und ausgestaltet wird, während es bei den anderen Rechten einer irgendwie gearteten Auswahl der Organwalter sowie eines Bestellungsaktes bedarf und es sich somit nur um bedingte Rechte handelt. Weil es bei den „demokratischen Grundrechten“, also bei solchen, die die unmittelbare Mitwirkung des Einzelnen an der staatlichen Willensbildung zum Gegenstand haben, einen solchen Bestellungsakt nicht gibt, scheinen das Recht auf die Organstellung, das schon durch die Aufnahme in den Kreis der Aktivbürgerschaft verwirklicht wird, und das organschaftliche Recht selbst hier auf den ersten Blick zusammenzufallen. Die organschaftliche Mitwirkung des Einzelnen an der Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk erscheint dann als Individualrecht, was ihrem Wesen – wie gesehen – nicht entspricht.178 Zwischen dem Recht auf Anerkennung als Wähler und dem Recht zu wählen ist vielmehr logisch zu trennen. Der Grundsatz der allgemeinen Wahl vermittelt ein Individualrecht darauf, als Teil der Aktivbürgerbesonderen Organe durch Personen aus dem Volke betreffen“; W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (498), hat diese Kategorisierung unter der Bezeichnung „politische Grundrechte“ übernommen und nur die erste Gruppe als „demokratische Grundrechte“ definiert. 176 Zur Unterscheidung dieser Rechte auch W. Roth, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten, 2001, S. 75 f. 177 Nicht zu verwechseln ist dies mit den Rechten des Organs auf die Kompetenz und aus und an der Kompetenz, (hierzu oben unter E. X., S. 172 ff.). Dies sind allesamt Rechte aus der Organstellung und damit organschaftliche Rechte des Gesamtorgans. 178 In dieser Differenziertheit beschreibt dies in der gegenwärtigen Literatur R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 453: „Die Unterscheidung zwischen dem an den Gesetzgeber adressierten Recht auf die einfachgesetzliche Normierung der Kompetenz zu wählen und der Kompetenz zu wählen macht den Zusammenhang zwischen Grundrechten und demokratischer Prozedur besonders deutlich.“Anders als hier vertreten, nimmt Alexy jedoch an, dass das Recht zu wählen sich erst aus der einfachgesetzlichen Normierung ergibt. Hierzu schon oben unter D I. 2., S. 63, Fn. 51.
IV. Individual-rechtlicher Gehalt der Wahlgrundsätze
209
schaft anerkannt und als Teil dieses Staatsorgans mit dem organschaftlichen Wahlrecht ausgestattet zu werden. b) Umfang des Rechts Fraglich ist indes, welchen Inhalt das aus dem Grundsatz der allgemeinen Wahl entspringende Recht hat. Er könnte zum einen lediglich zum Inhalt haben, als Teil der Aktivbürgerschaft und damit als Teil eines Staatsorgans anerkannt zu werden, sich also in einem Recht auf Organstellung erschöpfen. Andererseits könnte es auch den gesamten Inhalt des organschaftlichen Rechts des Aktivbürgers zum Gegenstand haben. Dann würde der Inhalt des organschaftlichen Rechts mittelbar zum Inhalt des Individualrechts werden. Rechtsverletzungen in der staatlichen Sphäre würden dann auch auf die individuelle Sphäre des Wählers durchschlagen. Prozessual hätte dies zur Folge, dass dem Einzelnen aufgrund der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG die Befugnis eingeräumt werden müsste, die in der staatlichen Sphäre liegende Rechtsverletzung als Verletzung eines Individualrechts zu rügen. Vergleichbar ist das aus dem Grundsatz der allgemeinen Wahl folgende Recht – wie gerade gezeigt – mit dem Recht des Amtswalters auf Verschaffung der organschaftlichen Stellung, denn das Recht aus dem Grundsatz der allgemeinen Wahl verschafft ebenso ein Recht auf eine organschaftliche Stellung. Hier wird nicht angenommen, dass die Kompetenz des Amtes auf diese Weise zum Individualrecht des Amtswalters wird.179 Andernfalls würden auch diejenigen Personen, die ein Amt innehaben, unverhältnismäßig privilegiert, weil sie aus ihrer individuellen Stellung heraus Einfluss auf die Staatsorganisation nehmen könnten, da sie – anders als Personen, die kein Amt innehaben – von staatsorganisationsrechtlichen Vorgängen persönlich betroffen wären und damit aus persönlicher Rechtsstellung gegen diese vorgehen könnten. Das Recht des Amtswalters erschöpft sich somit in einem Recht auf Innehaben des Amtes. Rechte, die aus dieser Stellung folgen, sind Rechte innerhalb der staatlichen Sphäre und damit nicht Gegenstand des Rechts. Ebenso können auch Störungen des Wahlrechts, die sich auf die Ausübung des organschaftlichen Rechts auswirken, nicht das Individualrecht des Bürgers auf seine Organstellung beeinträchtigen. Die Allgemeinheit der Wahl verschafft nur ein Recht darauf, als Teil des Staatsorgans „Volk“ und damit als wahlberechtigt anerkannt zu werden.
179 So für den Abgeordneten W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 50; K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten des Deutschen Bundestages, S. 41.
210
F. Der Einzelne im Wahlakt
c) Abstraktes Recht des Einzelnen auf Mitwirkung an der Staatsgewalt Es könnte darüber hinaus aber ein abstraktes Recht des Einzelnen bestehen, an der Ausübung der Staatsgewalt mitzuwirken, das nicht nur auf die konkrete Mitwirkung durch Teilnahme an Wahlen zielt. Ein solches Recht klingt in der Literatur bisweilen an, ohne dass ein normativer Anknüpfungspunkt genannt wird: So bemerkt Astrid Epiney: „Nach der […] Verfassungsordnung des Grundgesetzes ist es im wesentlichen [das Wahlrecht], das die Teilnahme des citoyen an der Ausübung hoheitlicher Gewalt und damit an ihrer Legitimation sicherstellt und verwirklicht.“180. Auch H. H. Rupp bemängelt, dass „des citoyen demokratisches Herrschaftsrecht [als] Elementargrundrecht jeder Demokratie auf Wahlen zusammengeschrumpft und nicht grundrechtlich formuliert“ sei.181 Dies führt er auch in seinem Plädoyer im Verfahren zum Maastricht-Urteil weiter aus.182 Auch das Bundesverfassungsgericht stellt eigentlich auf eine zunächst abstrakte Rechtsstellung des Bürgers ab, wenn es das Wahlrecht des Bürgers um staatsorganisationsrechtliche Prinzipien wie das Demokratieprinzip, das Bestehen der Staatlichkeit etc. anreichert.183 Nominell knüpft es hierbei zwar an Art. 38 GG an, dieser wird aber ersichtlich nur als prozessualer Notanker benutzt, weil sich eine andere normative Anknüpfung, die im Verfassungsbeschwerdeverfahren rügbar wäre, nicht findet. Art. 38 GG bezieht sich jedoch nur auf Wahlen zum Deutschen Bundestag. Er enthält damit auch nur das Recht, an Wahlen zum Deutschen Bundestag teilzunehmen, nicht aber auf Legitimation der gesamten Staatsgewalt.184 Wenn auch das Wahlrecht des Bürgers das Demokratieprinzip umsetzt und konkretisiert,185 indem es die hierfür erforderliche Legitimierung der Staatsgewalt durch das Volk konkret umsetzt, enthält es selbst kein Recht auf Erhalt der Demokratie, auf Herrschaft des Volkes. Das Wahlrecht müsste sonst ein Recht auf sein eigenes Bestehen umfassen.186 180
A. Epiney, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 (568). H. H. Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: HStR, Bd. II, 2004, § 31 Rn. 18, (Fn. 41). 182 H. H. Rupp, in: Winkelmann (Hrsg.), Das Maastrichturteil, 1994, S. 544. 183 So auch R. Lehner, Die Integrationsverfassungsbeschwerde nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 52 (2013), S. 535 (545). 184 C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie – Zur Entgrenzung von Art. 38 GG im Europaverfassungsrecht, JZ 2010, S. 1160 (1161); U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (438). 185 A. Epiney, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 (568). 186 D. Murswiek, Art. 38 GG als Grundlage eines Rechts auf Achtung des unabänderlichen Verfassungskerns, JZ 2010, S. 702 (707), hält es indes für „zwingend, anzunehmen, daß die Garantie des Wahlrechts die Garantie seiner objektiv-institutionellen Voraussetzungen mitumfaßt“, weil das Wahlrecht das „objektive demokratische Institutionengefüge“ notwendig voraussetze. Zwar ist dieses Institutionengefüge Voraussetzung des Wahlrechts, jedoch gewährleistet nicht jedes Recht seine Voraussetzungen. 181
V. Verhältnis der Rechte der Aktivbürgerschaft zu denen des Aktivbürgers
211
Die Verletzung des Demokratieprinzips stellt zwar eine Verletzung des „demokratischen Herrschaftsrechts des Citoyen“ dar, dieses ist im Grundgesetz indes nicht eigens normiert. Es ist aber in dem Recht der Aktivbürgerschaft auf Legitimierung der Staatsgewalt aus Art 20 Abs. 2 S. 2 GG beinhaltet.187 Das Verhältnis eines solchen Herrschaftsrecht des Aktivbürgers zum konkret in der Verfassung ausgestalteten Wahlrecht entspricht dem Verhältnis des Rechts des Volkes auf Ausübung der Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen aus Art 20 Abs. 2 S. 2 GG zu seinem Recht, den Bundestag zu wählen: Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag stellt eine konkrete Ausgestaltung eines in der Staatsordnung angelegten Herrschaftsrechts dar, das auch anders hätte ausgestaltet werden können. Das „demokratische Herrschaftsrecht des Citoyen“ folgt damit nur aus dem Recht des Volkes auf Legitimierung der Staatsgewalt, ohne dass es über das Wahlrecht hinaus näher ausgestaltet wäre.
6. Normative Anknüpfung des Wahlrechts Hieraus ergibt sich dann auch die normative Anknüpfung des Wahlrechts. Das Recht des einzelnen Wahlberechtigten zu wählen ist in Art. 38 Abs. 2 GG verankert. Aus den Wahlgrundsätzen kann es nicht abgeleitet werden, denn diese regeln nur die Modalitäten der Wahl. Eine Anknüpfung an Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG scheidet damit aus. Aus dem in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG normativ verankerten Grundsatz der allgemeinen Wahl ergibt sich – wie eben gesehen – lediglich das Recht darauf, dass ein Recht zu wählen eingeräumt wird, das aber durch Art. 38 Abs. 2 GG unmittelbar verwirklicht wird. Zugleich enthält Art. 38 Abs. 2 GG aber auch eine verfassungsimmanente, mit dem Demokratieprinzip vereinbare Einschränkung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl.
V. Verhältnis der Rechte der Aktivbürgerschaft zu den Rechten des Aktivbürgers Das Volk besteht aus einer Vielzahl von Organteilen, die mit gleichem Recht berechtigt sind, an Handlungen des Volkes mitzuwirken, was durch den Grundsatz der gleichen Wahl zum Ausdruck gebracht wird. Es ist somit Kollegialorgan.188 Entsprechend der Bezeichnung der Gesamtheit der Wahlberechtigten als „Aktivbürgerschaft“ wird der einzelne Wahlberechtigte auch als „Aktivbürger“ bezeich-
187 188
S. 13.
Zu diesem Recht siehe oben in Abschnitt E. X., S. 175. Zum Begriff: P. Dagtoglou, Kollegialorgane und Kollegialakte der Verwaltung, 1960,
212
F. Der Einzelne im Wahlakt
net.189 Dies entspricht dem Status als „Staatsbürger“ in Abgrenzung zum Staatsangehörigen.190 Teile von Kollegialorganen sind meist mit eigenen Rechten innerhalb des Organs ausgestattet, die über die Kompetenzen des Organs hinausgehen und den Binnenbereich des Organs betreffen. Zugleich stellt sich die Frage, ob sie an den Rechten aus der Kompetenz des Gesamtorgans teilhaben. Dies lässt sich am Beispiel des Bundestages verdeutlichen: Dem Bundestag als Ganzem stehen verschiedene Kompetenzen innerhalb der Staatsorganisation zu, wie die Kompetenz zur Teilhabe am Gesetzgebungsverfahren191, der Wahl des Kanzlers192 etc.193 Der Bundestag nimmt seine Kompetenzen wahr, indem er Entscheidungen trifft. Innerhalb des Organs werden diese Entscheidungen durch Abstimmungen getroffen. Das Recht des Abgeordneten, an der Ausübung der Kompetenz teilzuhaben, stellt sich dann u. a. als Recht zur Teilnahme an der Abstimmung dar. Man könnte also in der Beeinträchtigung der Gesetzgebungs- und Kontrollrechte des Bundestages zugleich eine mittelbare Beeinträchtigung der Abgeordnetenrechte sehen. Allerdings würde dies die organisatorische Verselbständigung des Bundestages gegenüber den einzelnen Abgeordneten negieren.194 Dem Abgeordneten steht deshalb kein über die Teilnahme an der Entscheidung hinausgehendes Recht zu, das außerhalb des Organs Wirkung entfaltet; sein Abstimmungsrecht beinhaltet nicht,
189 BVerfGE 8, 104 (114) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30.7. 1958; BVerfGE 14, 121 (133) – Rundfunksendezeiten, Beschluss vom 30. 5. 1962; BVerfGE 15, 165 (167) – Vorauswahl, Beschluss vom 29. 11. 1962; BVerfGE 44, 125 (145) – Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, Urteil vom 2. 3. 1977; J. Isensee, Der Dualismus von Staat und Gesellschaft, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, S. 317 (320); ders., Abschied der Demokratie vom Demos, in: Schwab/Giesen/Liste/Strätz (Hrsg.), Festschrift für Mikat, S. 705 (713); K. Kind, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie, 1955, S. 52; J. Pietzcker, Organstreit, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 587 (594); K. Grimmer, Demokratie und Grundrechte, 1980, S. 192; W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 12. Der Begriff ist auf den Abbé Sièyes zurückzuführen, der ihn in seinen „Vorarbeiten für eine Verfassung“, die er der Nationalversammlung am 20. und 21. 7. 1789 vorlegte, einführte, so P. Badura, in: Bonner Kommentar zum GG, Art. 38 Rn. 37. 190 Der Begriff des Staatsbürgers wird in BVerfGE 13, 54 (55, 69, 95) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 9. 7. 1961, verwendet. 191 Art. 76 Abs. 1 GG für das Initiativrecht aus der Mitte des Bundestages, Art. 77 GG für das weitere Beschlussverfahren. 192 Art. 63 GG. 193 Zu den Kompetenzen und Funktionen des Bundestages H. H. Klein, Stellung und Aufgaben des Bundestages, in: HStR, Bd. III, 2005, § 50 Rn. 15. 194 BVerfGE 90, 286 (342 f.) – Out-of-area-Einsätze, Urteil vom 12. 7. 1994: „Die Kompetenzen des Bundestages lassen sich nicht als Bündel inhaltsgleicher Kompetenzen der Abgeordneten verstehen. Der Bundestag ist nicht lediglich die Summe seiner Mitglieder; er ist selbst Organ und als solches Inhaber originärer Kompetenzen.“ Hierzu auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, S. 195.
V. Verhältnis der Rechte der Aktivbürgerschaft zu denen des Aktivbürgers
213
dass die Entscheidungen des Bundestages auch umgesetzt werden.195 Der Abgeordnete ist nicht in seinen Rechten verletzt, wenn z. B. der vom Bundestag gewählte Bundeskanzler nicht vom Bundespräsidenten ernannt wird, es ist lediglich der Bundestag, der dann in seinem Recht verletzt ist. Andernfalls wären Diskussionen darüber, ob der Abgeordnete als Prozessstandschafter Rechte des Bundestages im Organstreitverfahren geltend machen kann,196 hinfällig. Er wäre stets auch in eigenen Rechten verletzt; er müsste nicht fremde Rechte des Bundestages in eigenem Namen geltend machen, sondern könnte die Rechte als eigene im eigenen Namen durchsetzen.197 Allerdings ist das Recht des einzelnen Abgeordneten verletzt, wenn der Bundestag vorzeitig aufgelöst wird. Denn dies lässt auch die Rechtsstellung des einzelnen Abgeordneten unmittelbar untergehen.198 Auch der einzelne Abgeordnete kann sich deshalb gegen die Auflösung im Wege eines Organstreitverfahrens wehren.199 Über sein Recht, an Abstimmungen des Bundestages teilzunehmen, hinaus ist der Abgeordnete innerhalb des Bundestages mit weiteren eigenen Rechten ausgestattet.200 Dies sind Rechte, die auf die Willensbildung innerhalb des Organs gerichtet sind, deren Ausübung jedoch keine unmittelbare Wirkung außerhalb des Organs entfaltet. Hierzu zählen das Rederecht,201 das Recht, Mitglied eines Ausschusses zu sein,202 aber auch das freie Mandat gemäß Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG.203 Auch diese sind organschaftliche Rechte des Bundestagsabgeordneten, die aus seinem Amt fließen, 195 Hierzu R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, S. 195 f.; a. A. H. H. Klein, Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 2: „An diesen Rechten [den Rechten des Bundestages, Anm. der Verf.] hat der Abgeordnete aus eigenem Recht Anteil.“ 196 Hierzu z. B. C. Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, 1991, § 7 II Rn. 12, S. 105, Fn. 58. 197 So auch R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, S. 195 f. 198 Fraglich ist indes, ob der Bundestag hierdurch in seinen Rechten verletzt ist. Denn als abstraktes Organ besteht der Bundestag ohnehin weiter, nur in seiner aktuellen Zusammensetzung nicht mehr. Das Recht des aktuellen Bundestages an seiner konkreten Zusammensetzung müsste dann über die Rechte der Abgeordneten auf Bestehen ihrer Mandate während der in Art. 39 Abs. 1 GG vorgesehen Legislaturperiode hinausgehen. Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin eine Verletzung des Rechts des Bundestages auf „wirksame und kontinuierliche Erfüllung seiner Aufgabe“, BVerfGE 62, 1 (32) – Bundestagsauflösung I, Urteil vom 16. 2. 1983; BVerfGE 114, 121 (147) – Bundestagsauflösung II, Urteil vom 25. 8. 2005. 199 BVerfGE 62, 1 (32) – Bundestagsauflösung I, Urteil vom 16. 2. 1983; BVerfGE 114, 121 (146) – Bundestagsauflösung II, Urteil vom 25. 8. 2005. 200 H. H. Klein, Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 31 ff., der jedoch nicht zwischen Rechten innerhalb des Organs und nach außen wirkenden Rechten unterscheidet. 201 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 471 ff. 202 W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 353 f., allerdings mit Einschränkungen. 203 Eine abschließende Aufzählung findet sich selbst in der GOBT nicht. Hierzu W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 280 ff.
214
F. Der Einzelne im Wahlakt
nicht die individuellen Rechte der Person des Bundestagsabgeordneten.204 Es handelt sich hierbei um ein ganzes Bündel an Rechtspositionen, die nicht mit den Rechten des gesamten Bundestages parallel laufen, sondern innerhalb des Bundestages ausschließlich den Abgeordneten zustehen. Sie lassen sich als „kommunikative Teilhaberechte“205 bezeichnen, weil sie darauf gerichtet sind, an der Kommunikation innerhalb des Gesamtorgans teilzunehmen. Diese unterscheiden sich von den nach außen wirkenden Rechten auf Teilnahme an Entscheidungen des Bundestages.206 Ferner werden dem Abgeordneten dann auch noch aus seiner Stellung als Abgeordneter fließende Rechte in seiner persönlichen Sphäre zugeordnet, die allerdings ebenfalls allesamt dazu bestimmt sind, die Freiheit des Mandats zu sichern.207 Diese werden treffend auch als „akzessorische Statusrechte“ 208 bezeichnet. Innerhalb des Staatsorgans Volk gibt es solche „überschießenden Innenrechte“ hingegen nicht. Das Recht des Einzelnen als Teil des Volkes erschöpft sich darin, an den Handlungen des Volkes teilzunehmen. Ein internes Forum des (staatsorganschaftlichen) Volkes, der Aktivbürgerschaft, in dem es handelt, ohne damit bereits nach außen hin tätig zu werden, gibt es nicht. Die Vorformung der Willensbildung des Volkes findet vielmehr in der gesellschaftlichen Sphäre, und damit außerhalb der Staatsorganisation, statt.209 Die Funktion der überschießenden Innenrechte, die der Abgeordnete innerhalb des Bundestages hat, wird beim Volk und den Wahlberechtigten von den (Kommunikations-)Grundrechten erfüllt. Diese stellen sich aber – anders als die Rechte der Abgeordneten innerhalb des Bundestages – als Individualrechte der Wahlberechtigten dar, weil sie hier – anders als dort – im gesellschaftlichen Bereich wirken und keinesfalls ausschließlich funktional sind.210 Die Handlungen des Staatsorgans 204
K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 42, der zwar annimmt, dass auch der einzelne Amtswalter ein subjektives (Individual-)Recht darauf habe, die Kompetenz wahrzunehmen, der Inhalt dieses Rechts aber mit dem Inhalt der Kompetenz verknüpft sei und ihm deshalb keine eigenständige Bedeutung zukomme. 205 R. Grote, Verfassungsorganstreit, S. 177. 206 Nach R. Grote, Verfassungsorganstreit, S. 177, lassen sich Rede- und Stimmrecht nicht voneinander trennen, weil sie einen einheitlichen Kommunikationsvorgang darstellen. Zwar zielen auch Redebeiträge darauf ab, das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen, allerdings macht das Rederecht die Vorformung der Willensbildung innerhalb des Parlaments möglich, während es beim Abstimmungsrecht um nach außen verbindliche Willensbildung geht. Die Abstimmung ist zwar von der Beratung beeinflusst und soll dies auch sein, sie ist aber logisch und rechtlich von dieser zu unterscheiden. 207 H. H. Klein, Status des Abgeordneten, in: HStR, Bd. III, 2005, § 51 Rn. 35. Hierzu zählt die Abgeordnetenentschädigung nach Art. 48 Abs. 3 GG. 208 R. Grote, Verfassungsorganstreit, S. 169. 209 Siehe hierzu oben in Abschnitt E. VII. 2. b), S. 156 f. 210 Die demokratisch-funktionale Grundrechtstheorie versteht die Grundrechte und insbesondere die Kommunikationsgrundrechte jedoch nicht nur als Freiheitsrechte gegenüber dem Staat, wie es die liberale Grundrechtstheorie tut, sondern gerade von ihrer öffentlichen und politischen Funktion her. Hierzu E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsin-
V. Verhältnis der Rechte der Aktivbürgerschaft zu denen des Aktivbürgers
215
Volk erschöpfen sich in solchen, die unmittelbar auf Wirkung außerhalb des Organs gerichtet sind. Das Wahlrecht des einzelnen Aktivbürgers ist – entsprechend dem Recht des Abgeordneten – nicht verletzt, wenn der Bundestag nicht dem Volkswillen gemäß zusammengesetzt wird. Dies stellt lediglich eine Verletzung des Rechts der Aktivbürgerschaft als ganzer dar. Das Wahlrecht des einzelnen Aktivbürgers ist hingegen verletzt, wenn Wahlgrundsätze bei der Wahl verletzt werden – sei es aufgrund eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes, sei es aufgrund von Handlungen der Wahlorgane – und er selbst hiervon betroffen ist. Denn die Wahlgrundsätze verschaffen dem Aktivbürger eigene organschaftliche Rechte,211 weil sie den Modus der Wahl regeln. Dann ist jedoch immer auch das Recht des Volkes an einem richtigen Wahlergebnis verletzt. Denn das Recht des Volkes besteht nicht erst darin, dass der Bundestag entsprechend seinem Willen zusammengesetzt wird, sondern bereits darin, dass sein Wille, der sich allein im Wahlergebnis niederschlägt, richtig festgestellt wird.212 Der Wahl kommt nämlich neben der Legitimationsfunktion auch eine Kommunikationsfunktion213 zu. Es soll also nicht nur der Bundestag gewählt und damit eine Legitimationskette in Gang gesetzt werden;214 in der Wahl soll das Volk darüber hinaus auch mit den anderen Staatsorganen kommunizieren können.215 Darüber hinaus kommuniziert es auch mit sich selbst und gibt sich selbst Auskunft über die innerhalb des Volkes herrschenden Ansichten. Dieses Recht ist jedoch nicht erst dann verletzt, wenn sich falsche Stimmabgaben oder Auszählungen, die auf der Verletzung von Wahlgrundsätzen beruhen, auf die Zusammensetzung des Bundestages ausgewirkt haben, sondern schon dann, wenn das „Zwischenergebnis“, das darüber Auskunft gibt, wie viele Stimmen auf welche Partei und welche Wahlbewerber entfallen sind, falsch ist.
terpretation, NJW 1974, S. 1529 (1532 f.). Problematisch wird dies, wenn die „funktionsdienliche Freiheitsausübung“ privilegiert wird. Zum Ganzen: M. Flitsch, Die Funktionalisierung der Kommunikationsgrundrechte, 1998, S. 118 f. 211 Individualrechte gewähren hingegen nur der Grundsatz der allgemeinen Wahl und der Grundsatz der geheimen Wahl. Siehe oben in Abschnitt F IV. 4. und 5., S. 204 f. und S. 206 f. 212 Zur Ungültigkeitserklärung der Wahl können Wahlfehler und damit Rechtsverletzungen des Volkes jedoch nur dann führen, wenn sie Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundestages gehabt haben können, dieser Grundsatz wird „Mandatsrelevanz von Wahlfehlern“ genannt. Dies ist deshalb der Fall, weil auch am Bestand des gewählten Parlaments ein aus dem Demokratieprinzip folgendes Interesse besteht. Hierzu unten in Abschnitt G. I. 1. a), S. 244 ff. 213 BVerfGE 132, 39 (50 f.) – Wahlberechtigung Auslandsdeutscher, Beschluss vom 4. Juli 2012; M. Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 20 Rn. 83. 214 BVerfGE 95, 408 (418) – Grundmandatsklausel, Urteil vom 10. 4. 1997; BVerfGE 120, 82 (107) – Sperrklausel bei Kommunalwahlen, Urteil vom 13. 2. 2008. 215 BVerfGE 132, 39 (50 f.) – Wahlberechtigung Auslandsdeutscher, Beschluss vom 4. Juli 2012.
216
F. Der Einzelne im Wahlakt
Auch ist sowohl das Recht der gesamten Aktivbürgerschaft als auch des einzelnen Aktivbürgers verletzt, wenn Wahlen über die in Art. 39 Abs. 1 GG festgesetzte Periode hinausgezögert werden oder gar nicht stattfinden.216 Denn dann ist nicht nur die Aktivbürgerschaft gehindert, ihr Recht zu wählen auszuüben, auch dem einzelnen Aktivbürger wird die Ausübung des Wahlrechts unmöglich gemacht. Rechte des Aktivbürgerschaft und der Aktivbürger sind damit ebenso wenig deckungsgleich wie es die Rechte des Bundestages und des Bundestagsabgeordneten sind.217 Während deren Rechte jedoch jeweils über die gemeinsame Schnittmenge hinaus gehen, gibt es keine Rechte des Aktivbürgers, die über die Rechte der Aktivbürgerschaft hinausreichen. Dafür hat der Aktivbürger aber als Bürger Rechte in der gesellschaftlichen Sphäre oder, aus der Sicht des Einzelnen gesprochen, in seiner Individualsphäre, an denen die Aktivbürgerschaft schon deshalb nicht teilhaben kann, weil sie außerhalb der staatlichen Sphäre angesiedelt sind. Sehr wohl hat die Aktivbürgerschaft aber über die Rechte des einzelnen Aktivbürgers hinausgehende Rechte.218,219
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht? Aus der Erkenntnis, dass das Wahlrecht des einzelnen Bürgers ein organschaftliches Recht ist, könnte sich auch eine Neubewertung der Frage ergeben, ob eine Wahlpflicht verfassungsgemäß wäre.220 Bereits aus der organschaftlichen Qualität des Rechts könnte eine Pflicht zur Wahrnehmung folgen.221 Jedoch könnten andere Verfassungsgrundsätze einer Wahlpflicht entgegenstehen und eine solche im Ergebnis verfassungswidrig machen. Dies ist im Folgenden zu untersuchen. 216 So auch BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1953. Allerdings geht es dabei nicht davon aus, dass es sich beim Wahlrecht um ein organschaftliches Recht handelt. 217 Dass Rechte des Volkes und des einzelnen Bürgers aber in der Literatur nicht auseinandergehalten werden, zeigt sich z. B., wenn K. Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991, S. 367, C.-H. Obst, Chancen direkter Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, 1986, S. 254, unterstellt, er würde „das Wahlrecht als individuell durchsetzbare subjektive Rechtsposition“ in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG verorten, worin dieser aber lediglich – richtigerweise – eine „Volkskompetenz“ sieht. 218 Zu den Rechten des Volkes siehe oben in Abschnitt E. X. S. 172 f. 219 Wenn das Bundesverfassungsgericht ausführt, Rechte des Volkes würden nur in den subjektiv-öffentlichen Rechten des Aktivstatus des Bürgers greifbar, BVerfGE 13, 54 (85) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 11. 7. 1961, verwundert es jedoch nicht, wenn es später Rechte der Bürger dort annimmt, wo primär Rechte des Volkes verletzt sind. 220 So wird die Rechtsnatur des Wahlrechts – wo sie diskutiert wird – als richtungsweisend für die Bewertung einer Wahlpflicht gesehen. So insbesondere von S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (81 f.), aber auch bereits von A. Vutkovich, Wahlpflicht, 1906, S. 66 f. 221 „Objektive und subjektive Aspekte“ des Wahlrechts würden hier in Konkordanz gebracht, so A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 192.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
217
Bemerkenswert ist, dass die Literatur eine Wahlpflicht ausschließlich im Hinblick auf die aktive Wahlberechtigung diskutiert. Eine Pflicht, sich wählen zu lassen, wird jedoch – soweit ersichtlich – in der deutschen Literatur von niemandem angenommen oder auch nur angedacht.222 Weil in dieser Arbeit nur das aktive Wahlrecht behandelt wird, wird auch hier nur die Pflicht zur Ausübung desselben untersucht.
1. Wahlpflicht aus der Rechtsnatur des Wahlrechts ableitbar? Es stellt sich zunächst die Frage, ob das Grundgesetz schon dadurch eine Wahlpflicht statuiert, dass es das Wahlrecht als organschaftliches Recht, als Kompetenz, ausgestaltet.223 Es stellt sich also die Frage nach dem Pflichtcharakter von Kompetenzen. Verpflichtet das Innehaben von Kompetenzen dazu, diese auch auszuüben?224 Aus der Berechtigung durch Kompetenzen wird überwiegend die grundsätzliche Pflicht abgeleitet, von diesen Gebrauch zu machen,225 weil die den Staatsorganen zugewiesenen Kompetenzen die Verfassungsstrukturen determinieren.226 Würden die Organe über die Ausübung der ihnen zugewiesenen Kompetenzen disponieren, würde sich das in der Verfassung vorgesehene Funktionsgefüge verschieben.227 Es gibt jedoch auch Kompetenzen, die fakultativ ausgeübt werden können. Dies zeigt sich an den Gesetzgebungskompetenzen der Art. 70 f. GG. Würden Kompetenzen ihren Inhaber schlechthin zur Ausübung verpflichten, müsste zu jeder denkbaren Sachmaterie ein Bundes- oder Landesgesetz bestehen.228 Zudem wäre die 222 Das Schweizerische Bundesgericht hingegen hält die Pflichtkandidatur in den Kantonen für zulässig: BGE 95 I 223 D. 4. a.) – 33. Arrêt du 13 juin 1969. 223 W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, 1971, S. 16, und W. Höfling, Demokratische Grundrechte, Der Staat 33 (1994), S. 493 (504), halten eine Wahlpflicht jedenfalls aufgrund der organrechtlichen Natur des Wahlrechts für denkbar. Dass jedenfalls eine „moralische Pflicht“ zu wählen existiert, nimmt R. Stober, Vom sozialen Rechtsstaat zum egoistischen Rechthaberschutzstaat, DÖV 1998, S. 775 (777), an. 224 Hierzu auch B. Pieroth, Materiale Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 114 (1989), S. 422 (448). 225 J. Oebbecke, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, 1996, S. 104 f.; M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 353 (auch in Bezug auf das Volk); K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 30 II 4, S. 235. 226 E.-W. Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964, S. 72 f.; W. Löwer, Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts, in HStR III, 2005, § 70 Rn. 8, spricht zwar nicht ausdrücklich von der Verpflichtung zur Wahrnehmung, betont aber den Pflichtcharakter von Kompetenzen. 227 T. Emde, Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung, 1991, S. 310. 228 B. Pieroth, Materiale Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 114 (1989), S. 422 (436); B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 63, Fn. 146.
218
F. Der Einzelne im Wahlakt
Konstruktion einer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz, wie sie Art. 72, 74 GG vorsehen, in der ein Kompetenzinhaber nur dann zu handeln berechtigt ist, wenn der andere nicht handelt, nicht denkbar. Es kann deshalb keine ausnahmslose Pflicht bestehen, Kompetenzen auch auszuüben.229 Allerdings lässt sich der Pflichtcharakter von Kompetenzen jeweils aus dem Wortlaut ihrer Zuweisungsnorm und ihrer Bedeutung für das Verfassungsgefüge ableiten. Ist die Aufgabenzuweisung im Indikativ formuliert, ist dies ein erstes Indiz dafür, dass sie nicht fakultativ zugewiesen und damit verpflichtend sind. Lässt sich das Funktionieren der Staatsorgane ohne das Ausüben einer Kompetenz nicht denken, muss ihre Wahrnehmung notwendigerweise verpflichtend sein,230 weil sonst das Verfassungsgefüge aus dem Lot geraten würde. Dass das Volk die Pflicht besitzt, seine Kompetenz, den Bundestag zu wählen, auch auszuüben, ergibt sich daraus, dass die Wahl durch das Volk die Legitimationskette in Gang setzt, durch die alle anderen Staatsorgane ihre Legitimation erhalten. Ohne den Akt der Volkswahl würde das gesamte Verfassungsgefüge zusammenbrechen. Unterstrichen wird dies durch den Wortlaut der Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG i. V. m. Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, die im Indikativ formulieren, dass das Volk die Staatsgewalt in Wahlen ausübt und dass die Abgeordneten nach den aufgezählten Wahlgrundsätzen gewählt werden. Diese Kompetenz ist also für das Volk verpflichtend.231 Es hat den Bundestag zu wählen. Die Pflicht zum Handeln trifft jedoch zunächst das Organ selbst.232 Erst in einem zweiten Schritt liegt es am Organwalter oder – im Falle von Kollegialorganen – den Organwaltern, die Verpflichtung des Gesamtorgans zum Handeln wahrzunehmen. Dabei trifft bei nur mit einem Organwalter besetzten Organen die Pflicht des Organs zum Handeln ausschließlich diesen einzigen Organwalter, weil nur dieser in der Lage ist, Entscheidungen für das Organ zu treffen und damit für das Organ zu handeln. Die Handlungspflicht des Organs setzt sich hier beim Organwalter fort. Bei Kollegialorganen hingegen hängt die Entscheidungsfähigkeit des Gesamtorgans nicht notwendigerweise vom einzelnen Organwalter ab. Nur dann, wenn die Entscheidungsfindungsregeln des Gesamtorgans eine Beteiligung jedes einzelnen Organwalters zur Voraussetzung machen, hängt auch hier die Entscheidungsfähigkeit des Gesamtorgans von jedem einzelnen Organwalter ab. Ist dies nicht der Fall, ergibt sich aus dem verpflichtenden Charakter von Kompetenzen für das Gesamtorgan nicht notwendig eine Handlungspflicht des einzelnen Organwalters. 229 Der Nichtgebrauch von Kompetenzen ist jedoch nicht in das Belieben, sondern in das Ermessen des Kompetenzinhabers gestellt. 230 So im Ergebnis auch M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 46 ff. 231 So auch M. Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 353; wohl dagegen aber C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (216). 232 Das Volk in seiner Gesamtheit kann sich schon deshalb nicht für oder gegen das Handeln entscheiden, weil es sich nicht selbst organisiert. Siehe oben in Abschnitt E. VII 1., S. 152 f. Das Handeln hängt vielmehr von den einzelnen Organwaltern, den Wahlberechtigten, ab.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
219
Die Wahl zum Deutschen Bundestag erfordert nicht notwendig das Handeln der gesamten Aktivbürgerschaft, denn nicht einmal Mindestbeteiligungsquoren werden zur Voraussetzung der Gültigkeit der Wahl gemacht.233 Damit hängt auch die Möglichkeit des Volkes, im Rahmen seiner Zuständigkeit handlungsfähig zu bleiben, nicht vom einzelnen Wahlberechtigten ab. Solange ein Großteil des Volkes sich aus freien Stücken an der Wahl beteiligt, ist die Handlungsfähigkeit der Aktivbürgerschaft auch ohne Wahlpflicht nicht gefährdet. Allerdings muss aufgrund des verpflichtenden Charakters der Kompetenz des Gesamtorgans Aktivbürgerschaft, den Bundestag zu wählen, die Möglichkeit bestehen, eine Wahlpflicht einzuführen.234 Es ist daher zu untersuchen, ob die Wahlpflicht mit anderen Verfassungsprinzipien in Widerstreit steht.
2. Verstoß gegen die (negative) Wahlfreiheit oder das Wesen des Wahlrechts? Die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht wird in der Literatur meist als Frage der Vereinbarkeit einer solchen mit der Wahlfreiheit aufgefasst.235 Die Verfassungsmäßigkeit wird von der Frage abhängig gemacht, ob diese auch die Freiheit enthalte, nicht an der Wahl teilzunehmen. Es wird diskutiert, ob neben der Wahlentscheidungsfreiheit auch die Wahlbeteiligungsfreiheit236 geschützt sei, ob sich der Grundsatz der Freiheit der Wahl also nicht nur auf das „Wie“, sondern auch
233 Anders ist dies z. T. bei Kommunalwahlen, bei denen insbesondere bei der Besetzung von Wahlämtern Mindestbeteiligungsquoren zur Voraussetzung gemacht werden. 234 Dass die Möglichkeit bestünde, eine Wahlpflicht – jedenfalls durch Verfassungsänderung – einzuführen, wird auch in der Literatur bisweilen angenommen, so z. B. H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254); H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 108 m. w. N.; D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (315), nimmt auch eine Änderungsmöglichkeit durch einfaches Gesetz an. 235 So z. B. H. H. Klein, in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 107; B. J. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 13; R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 64; W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 21, S. 100; B. Grzeszick, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, Art. 38 Rn. 24; J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 62; S. Magiera, in: Sachs, GG-Kommentar, Art. 38 Rn. 83; K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 I 7, S. 323. Dies stellt auch W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (91) fest. 236 Diese Unterscheidung hat D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (309 f.), herausgearbeitet; sie wird in der Literatur rege aufgenommen, z. B. von W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 21. Sie ist vergleichbar mit der Zeugenpflicht: Während die Pflicht, als Zeuge vor Gericht zu erscheinen, stets besteht (§ 48 Abs. 1 S. 1 StPO), ist hiervon die Frage zu trennen, ob auch eine Aussage gemacht werden muss (§ 48 Abs. 1 S. 2 StPO).
220
F. Der Einzelne im Wahlakt
auf das „Ob“ der Wahl beziehe.237 Überwiegend wird angenommen, die Wahlfreiheit würde als subjektives Recht nicht nur die negative Freiheit enthalten, keine Stimme abzugeben, sondern darüber hinaus die negative Freiheit, nicht zur Wahl zu gehen.238 Dass die Wahlfreiheit aber kein Individualrecht enthält, wurde bereits gezeigt.239 Sie hat deshalb auch keine negative Seite, die der Wahlpflicht entgegenstehen könnte.240 Die Annahme einer Wahlbeteiligungsfreiheit zeigt jedoch deutlich, dass die Wahlfreiheit als in der Individualsphäre des Einzelnen liegendes Grundrecht betrachtet wird.241 Die „negative Wahlfreiheit“ wäre indes auch dann der falsche Anknüpfungspunkt des Ausschlusses einer Wahlpflicht, wenn die Wahlfreiheit ein Individualrecht beinhalten würde. Denn die negative Seite der Wahlfreiheit als eigenes Recht wäre nicht das Recht, nicht zu wählen, sondern das Recht, unfrei zu wählen, sich also unzulässig beeinflussen oder gar in der Entscheidung zwingen zu lassen. Dies würde jedoch dem Demokratieprinzip zuwider laufen, weil eine unfreie Wahl im demokratischen Staat den anderen Staatsorganen keine Legitimation verschaffen könnte,242 selbst dann nicht, wenn die Unfreiheit freiwillig herbeigeführt ist. Aus diesem Grund kann die Freiheit der Wahl auch keinen individual-rechtlichen Gehalt
237 D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (309 f.); K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 217 f.; H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254); wenn T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (863), die Unterscheidung zwischen Wahlentscheidungsfreiheit und Wahlbeteiligungsfreiheit für problematisch hält, weil schon in dem Fernbleiben von der Wahl selbst eine Willensbekundung und der Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem politischen System liegen könne (ähnlich K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323, R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218), verkennt dies, dass die Wahl nicht primär die Kundgabe einer Meinung, sondern eine staatliche Entscheidung bezweckt. Ob die Nichtteilnahme an der Wahl tatsächlich eine von der Meinungsfreiheit geschützte Meinungskundgabe ist, wird noch zu klären sein; siehe unten in diesem Abschnitt F. VI. 4. b), S. 225 ff. 238 T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (863), D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (309 f.); R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65; T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218; a. A. W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, S. 167; H. Dreier, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 (254), nimmt zwar an, dass die Wahlfreiheit (die er mit dem Wahlrecht gleichsetzt) ein Grundrecht sei, es aber als „Recht des status activus […] anderen Gesetzlichkeiten folg[e] als grundrechtliche Freiheitsgarantien des status negativus“. 239 Siehe oben in Abschnitt F. IV. 3., S. 203. 240 C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (217), zeigt auf, dass es hier gerade nicht die staatsbürgerliche, sondern die bürgerliche Freiheit ist, die der Wahlpflicht entgegengesetzt werden soll. Diese Unterscheidung gelingt nur deshalb, weil auch er das Wahlrecht als Kompetenz anerkennt und damit die Wahlfreiheit als „staatsbürgerliche“ Freiheit, die dem Demokratieprinzip und nicht den Grundrechten entspringt. 241 Die wird besonders deutlich daran, dass dann meist eventuelle Grundrechtsverletzungen nicht mehr diskutiert werden, weil das Wahlrecht selbst als Grundrecht gesehen wird. 242 A. Guckelberger, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze, JA 2012, S. 561 (564).
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
221
haben.243 Die eigentliche Herleitung müsste aus der negativen Seite des Wahlrechts selbst folgen. Auch hieran wird eine Verfassungswidrigkeit der Wahlpflicht mitunter festgemacht.244 Das Recht zu wählen selbst ist jedoch ein organschaftliches Recht und hat keine negative Seite, es enthält nicht als Kehrseite das Recht, nicht davon Gebrauch zu machen.245 Der Grundsatz der freien Wahl verbürgt damit nur die Wahlentscheidungsfreiheit, nicht aber die Wahlbeteiligungsfreiheit. Weder aus einer negativen Seite der Wahlfreiheit noch aus einer negativen Seite des Wahlrechts lässt sich somit der Ausschluss einer Wahlpflicht ableiten, weil eine solche jeweils nicht existiert.
3. Verstoß gegen das Demokratieprinzip? Gegen eine Wahlpflicht wird bisweilen eingewendet, eine durch Wahlpflicht „erzwungene“ Stimmabgabe könne dem Bundestag nur formelle Legitimation vermitteln, jedoch nicht die zur Erfüllung des Demokratieprinzips notwendige materielle.246 Das Fernbleiben von der Wahl sei oftmals Ausdruck des Zustandes, sich mit den Bewerbern nicht identifizieren zu können, nicht hingegen Ausdruck mangelnden Verantwortungsbewusstseins.247 Auch die Legitimation verlaufe aber, wie die Willensbildung, vom Volk zu den Staatsorganen. Die Staatsorgane müssten deshalb bei der Wahl das Vertrauen des Volkes gewinnen. Wahlen seien die Reaktion auf das Verhalten der Staatsorgane; eine Unzufriedenheit mit den Staatsorganen könne durch eine Nichtteilnahme an der Wahl – deutlicher als durch eine Enthaltung – zum Ausdruck gebracht werden.248 Auch hier wird der Wahlpflicht aber nicht aus dem Demokratieprinzip begegnet, sondern ihr die bürgerliche Freiheit des Bourgeois entgegengesetzt. Dann geht es nicht um die Legitimation der Staatsge-
243
Hierzu oben unter F. IV 3., S. 203 f. W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 21, Rn. 100. Unklare Anknüpfung bei H. Bethge, Die verfassungsrechtliche Problematik der Grundpflichten, JA 1985, S. 249 (259): „Eine Wahlpflicht ist mit dem Grundgedanken des Art. 38 GG unvereinbar.“ (Hervorhebung auch im Original). 245 J. Hellermann, Die sogenannte negative Seite der Freiheitsrechte, 1993, S. 163 f. Zu unterscheiden ist dies jedoch von der Frage, ob eine Kompetenz per se zur Ausübung verpflichtet. Daraus, dass eine Kompetenz nicht aus sich selbst heraus verpflichtend ist (siehe hierzu oben in diesem Abschnitt unter F. VI. 2., S. 219 f.), ergibt sich noch nicht, dass es ein Recht auf freien Nichtgebrauch gibt. Die Wahrnehmung des Rechts ist vielmehr nur in das Ermessen des Kompetenzinhabers gestellt. 246 H.-U. Erichsen, Die Wahlrechtsgrundsätze, Jura 1983, S. 635 (641): Die Wahl solle „den unverfälschten Wählerwillen zum Ausdruck bringen“, was dieser durch eine Wahlpflicht anscheinend gefährdet sieht. 247 W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92). 248 W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92). 244
222
F. Der Einzelne im Wahlakt
walt, sondern um eine aus den Grundrechten herrührende Freiheit auf Nichtteilnahme an der Wahl.249 In eine ähnliche Richtung geht das Argument, eine Wahlpflicht sei eines demokratischen Staates unwürdig, sie sei mehr für totalitäre Systeme charakteristisch.250 Jedenfalls sei der Demokratie mit einem Rechtszwang zu politischem Handeln nicht gedient.251 Die Argumentation verkennt die Tatsache, dass das Parlament in seiner konkreten Zusammensetzung durch die Wahl gerade erst gebildet, bzw. über seine konkrete Besetzung mit Organwaltern entschieden wird. Abstrakt besteht das Organ ohnehin immer. Es fragt sich dann, wogegen sich die Unzufriedenheit, die mit der Nichtteilnahme zum Ausdruck gebracht werden soll, richtet. Denkbar ist, dass sie aus einer Unzufriedenheit mit dem Parlament der letzten (oder vielmehr der gerade aktuellen) Legislaturperiode resultiert. Dieses soll durch die Wahl aber gerade ersetzt werden, so dass eine Ablehnung gegen seine Besetzung nicht als Einwand gelten kann. Sie könnte sich auch aus der Unzufriedenheit mit den vorhandenen Alternativen speisen, die aufgrund der relativen Homogenität der politischen Landschaft in Deutschland meist im Wesentlichen mit denen übereinstimmen, die bei der vorherigen Wahl bestanden. Jeder, der berechtigt ist, zu wählen, kann sich aber auch selbst zur Wahl stellen252 und so die Alternativen verändern.253 Wenn daran bemängelt wird, dass die Chancen, dann gewählt zu werden, sehr gering sind, und die eigene Bewerbung damit ohnehin nutzlos sei, mag dies zwar faktisch stimmen, es steht dann jedoch eine Wahlalternative zur Verfügung, auf die die eigene Stimme gerichtet werden kann.254 Wird hingegen nur beklagt, dass die eigene Stimme ohnehin keine Auswirkungen habe, bringt dies nur den Missmut darüber zum Ausdruck, dass der eigene Beitrag an der Gesamtentscheidung im Hinblick auf die Zahl der im politischen Gemeinwesen lebenden Menschen notwendig äußerst gering sein muss und Gesamtentscheidungen auch anders ausfallen können, als es der eigenen Präferenz entspricht. Es würde aber 249
Ob eine solche besteht, wird sogleich geprüft. T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218; O. Luchterhandt, Grundpflichten, S. 498 f. spricht von einem „Armutszeugnis“. 251 H. H. Klein, Grundrechte im demokratischen Staat, 1972, S. 41. 252 Dies ist ohne Partiezugehörigkeit nur über den Kreiswahlvorschlag als Direktkandidat (§ 20 Abs. 1 BWahlG) möglich, im Übrigen können Wahlvorschläge nur von Parteien gemacht werden (§ 18 Abs. 1 BWahlG). Der Beitritt zu einer Partei oder die Gründung einer Partei steht jedoch jedem Wahlberechtigten frei. 253 Der Kreis der aktiv und passiv Wahlberechtigten unterscheidet sich nur insoweit, als dass für die aktive Wahlberechtigung ein Wohnsitz im Inland (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 BWahlG), ein früherer Wohnsitz im Inland (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 BWahlG) oder eine sonstige persönliche und unmittelbare Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BWahlG) Voraussetzung ist, für die Wählbarkeit (§15 BWahlG) hingegen nicht. Der Kreis der aktiv Wahlberechtigten ist damit enger als der der Wählbaren. Jeder aktiv Wahlberechtigte kann sich damit wählen lassen. 254 In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit etwa 60 Millionen Menschen wahlberechtigt. 250
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
223
Grundannahmen der Demokratie erschüttern, wenn diejenigen, die im Prozess der Entscheidungsfindung der Mehrheit unterliegen, sich aus dem Prozess herausnehmen. Die Möglichkeit der Minderheit, zur Mehrheit zu werden, wäre damit verspielt.255 Das Prinzip der Demokratie besteht gerade darin, dass Entscheidungen, die für alle verbindlich sind, von allen getroffen werden – in der repräsentativen Demokratie freilich nur die Entscheidung über die eigentlichen (Sach-)Entscheidungsträger –, und diese Entscheidung dann auch Legitimation dadurch erfährt, dass alle sich an ihr beteiligen.
4. Verletzung von Grundrechten? Die Einführung einer Wahlpflicht könnte jedoch Freiheitsgrundrechte verletzen.256 Stellte sie einen ungerechtfertigten Eingriff in diese dar, würde dies zu ihrer Verfassungswidrigkeit führen. In Betracht kommt insbesondere eine Verletzung der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG und der Gewissensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG. Denn in der Stimmabgabe könnte ebenso eine Gewissensentscheidung wie eine Meinungskundgabe liegen, zu denen der Wähler durch eine Wahlpflicht gezwungen würde. Fraglich ist indes, ob die Grundrechte als Maßstab der Beurteilung der Wahlpflicht herangezogen werden können. Stefan Haack ist der Ansicht, dass die Verfassungsmäßigkeit der Wahlpflicht deshalb am Maßstab der Grundrechte gemessen werden könne, weil es selbst eben kein Grundrecht ist, sondern ein organschaftliches Recht. Wäre es selbst Grundrecht, würde es den (aus dieser Sicht anderen) Grundrechten als lex specialis vorgehen, diese würden selbst keinen Maßstab der Verfassungsmäßigkeit bilden.257 Als Kompetenz müsse die verpflichtende Ausübung desselben aber einer Prüfung an Grundrechten, insbesondere an Art. 5 Abs. 1 GG und 4 Abs. 1 GG, standhalten. Dementsprechend wäre eine klassische Grundrechtsprüfung vorzunehmen, in der es insbesondere auf die Frage ankommen würde, ob ein möglicher Eingriff in die Grundrechte durch Einführung einer Wahlpflicht verhältnismäßig ist. Ob Grundrechte den Maßstab der Verfassungsmäßigkeit bilden, hängt indes davon ab, in welcher Sphäre der Bürger durch die Wahlpflicht betroffen ist. Nur wenn er in seiner Individualsphäre betroffen ist, die stets neben der staatlichen Sphäre 255 W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, 1983, S. 195 f.: „Diese potentielle Möglichkeit des Wechsels [von der Minderheit zur Mehrheit, Anm. d. Verf.] muß sich jedenfalls bis zu einem gewissen Grad auch verwirklichen.“ 256 Durch die Wahl werden auch ohne Wahlpflicht Eingriffe in Grundrechte vorgenommen. So werden z. B. personenbezogene Daten in das Wählerverzeichnis aufgenommen. Dies stellt einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG dar, der aber durch das Erfordernis der öffentlichen Kontrolle der Wahlberechtigung gerechtfertigt ist. Hierzu W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 14 Rn. 4, S. 350. 257 S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (94).
224
F. Der Einzelne im Wahlakt
besteht, sind Grundrechtsverletzungen möglich. Durch die Wahlpflicht sind unterschiedliche Grundrechtsverletzungskonstellationen denkbar. Zum einen lassen sich direkte Grundrechtseingriffe denken, wenn die beim Wählen ausgeübte Tätigkeit, die Stimmabgabe, in den Schutzbereich von Grundrechten fallen würde und die Wahlpflicht dann direkt in das Recht, von den Grundrechten keinen Gebrauch zu machen, eingriffe. Der Grundrechtseingriff würde dann in der Pflicht zur Stimmabgabe liegen. Zum anderen lassen sich Eingriffe in Grundrechte durch die bloße Verpflichtung, zur Wahl zu gehen, denken. Durch diese Verpflichtung sind sowohl direkte als auch faktische Eingriffe denkbar. a) Verletzung von Grundrechten durch faktischen Eingriff durch die Pflicht, zur Wahl zur gehen Erkennt man mit der ganz herrschenden Meinung auch faktische Eingriffe als Eingriffe in die Grundrechte an, also jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht,258 auch wenn es nicht final auf die Beschränkung des grundrechtlichen geschützten Verhaltens gerichtet ist, dann stellt eine Wahl(beteiligungs-) pflicht einen Eingriff in den Schutzbereich aller Grundrechte dar, an deren Ausübung der Grundrechtsträger während der Zeit der Teilnahme an der Wahl faktisch gehindert ist. Allen diesen Eingriffen ist gemeinsam, dass sie nicht intendiert sind, sondern Nebenfolge einer Wahlpflicht. Ebenso ist ihnen gemeinsam, dass sie schon beginnen, bevor der Wähler die Wahlkabine betritt und sich damit auch in die staatliche Sphäre begibt. Sie treffen den Wahlberechtigten also bereits in seiner Individualsphäre. Dass er also vollumfänglich Grundrechtsschutz genießt und sich die Hindernisse tatsächlich als Eingriff in Grundrechte darstellen, steht außer Frage. Eine Wahlbeteiligungspflicht hindert den Grundrechtsträger faktisch daran, während der Zeit, die er sich der Wahl widmet, andere grundrechtlich gewährte Freiheiten auszuüben. In die allgemeine Handlungsfreiheit wird dabei nicht eingegriffen, weil nach herrschender Meinung der Annahme faktischer Eingriffe in dieses Grundrecht aufgrund des weiten Schutzbereiches mit Zurückhaltung begegnet werden muss.259 Ein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff ist hier erst bei einer gewissen Intensität anzunehmen, die bei einer Pflicht, zur Wahl zu gehen, aufgrund des geringen Aufwandes noch nicht vorliegt. In Betracht kommt aber z. B. ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG, aber auch in die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG, die Glaubensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 GG. Kurz gesagt, in alle Grundrechte, die eine Handlung schützen, die während des Wahlaktes nicht ausgeübt 258 B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, § 6 III 2; F. Hufen, Grundrechte, § 8 Rn. 10 f. 259 F. Hufen, Grundrechte, § 14 Rn. 19.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
225
werden kann.260 Die durch die Wahlpflicht in alle diese Grundrechte vorgenommenen möglichen Eingriffe bedürfen dann der Rechtfertigung. Die Intensität der Eingriffe ist dabei jeweils als äußerst gering einzustufen,261 weil sie nur in einer Hinderung der Ausübung durch zeitliche Inanspruchnahme liegen, die auch noch sehr kurz ist, weil die Wahllokale wohnortsnah aufzustellen sind und im Zweifel die Möglichkeit besteht, Briefwahl zu beantragen.262 Als Rechtfertigung können hingegen die Funktionsfähigkeit des Staates und die Legitimation der Staatsgewalt ins Feld geführt werden. Auch wenn das Grundgesetz durch den Verzicht auf eine Mindestwahlbeteiligung die Funktionsfähigkeit des Staates weitgehend von der Beteiligung der Bürger an der Wahl abkoppelt, muss jedoch auch von dem Grenzfall her gedacht werden, dass sich niemand an staatlichen Wahlen beteiligt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die demokratische Legitimation des Bundestages schon dann gefährdet ist, wenn die Wahlbeteiligung ein bestimmtes Maß – über das indes gestritten werden kann – unterschreitet. Dem Gesetzgeber steht hierzu eine Einschätzungsprärogative zu. Eine Wahlpflicht wäre jedenfalls dann verhältnismäßig, wenn die Wahlbeteiligung auf ein die demokratische Legitimation gefährdendes Maß absinkt.263 b) Verletzung von Grundrechten durch direkten Eingriff durch die Pflicht, zur Wahl zu gehen Die Pflicht, an der Wahl teilzunehmen, wird in der Literatur oftmals als Eingriff in die Meinungsfreiheit gedeutet. Dem Grundrechtsträger werde hierdurch die Möglichkeit verschlossen, seine Ablehnung gegenüber der Demokratie durch Fernblei-
260 Für einen Eingriff in die Berufsfreiheit verlangt das Bundesverfassungsgericht jedoch eine objektiv berufsregelnde Tendenz, BVerfGE 70, 191 (214) – Fischereibezirke, Beschluss vom 19. 6. 1985. 261 Deshalb könnte eine Ansicht, die für einen Eingriff eine gewisse Erheblichkeit des staatlichen Handelns fordert (so M. Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. II, 2010, § 71 III Rn. 26, S. 87; B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte, 2014, § 6 III 2 Rn. 260), hier auch bereits einen Eingriff verneinen. Jedoch gibt es „keine allgemeine Geringfügigkeitsgrenze für Grundrechtsbeeinträchtigungen“, so K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/2, 1994, § 78 IV 1 a), S. 204 f. 262 Zu Verminderung der Belastung der Bürger durch die Möglichkeit der Briefwahl auch W. Berg/R. Dragunski, Die Partei der Nichtwähler, JuS 1995, S. 238 (242). Diese Möglichkeit hat sich sogar noch dadurch vereinfacht, dass die Briefwahl nun ohne Begründung möglich ist. 263 O. Luchterhandt, Grundpflichten, S. 498; ihm folgend T. I. Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 218. Eine Wahlpflicht wird jedoch – jedenfalls zurzeit – bisweilen für unverhältnismäßig gehalten, weil ihre Durchsetzung einen hohen Verwaltungsaufwand bedeuten würde. Denn aufgrund der ohnehin „traditionell und stabil hohen Wahlbeteiligung in Deutschland“ würden sich Sanktionen ohnehin nur gegen eine geringe Zahl an Wahlberechtigten richten. Dieses Argument scheint sich nicht in den Kosten für den „überflüssigen“ Verwaltungsaufwand zu erschöpfen. Es scheint vielmehr so, als würde eine Wahlpflicht eigentlich in Bezug auf die Grundrechtseingriffe als unverhältnismäßig gesehen.
226
F. Der Einzelne im Wahlakt
ben von der Wahl zu demonstrieren.264 Eine Wahlenthaltung müsse deshalb möglich sein, weil sie politisch motiviert und Ausdruck einer Meinung sein könne.265 Schon die Wahlbeteiligungspflicht stelle somit einen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar. Eine Verletzung der Meinungsfreiheit durch diese Pflicht setzt jedoch voraus, dass das Fernbleiben von der Wahl als Kundgabe einer Meinung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 GG gesehen werden kann und damit überhaupt in den Schutzbereich der Meinungs(äußerungs)freiheit fällt.266 Als problematisch könnte sich erweisen, dass die Meinungskundgabe durch ein Unterlassen – das Nicht-zur-Wahl-Gehen – bewirkt werden soll. Wenn der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 GG nur die Äußerung und Verbreitung einer Meinung in Wort, Schrift und Bild nennt, ist dies nur eine exemplarische Aufzählung; auch die Meinungsäußerung durch bloßes Verhalten ist geschützt, wenn diese als Teilnahme an einem Kommunikationsprozess gedeutet werden kann.267 Auch in einem Unterlassen kann also eine von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung liegen. Hierfür ist jedoch die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Dritte erforderlich, da ein Kommunikationsprozess nur dann stattfinden kann, wenn die Kommunikation von anderen wahrgenommen werden kann. Das schlichte Nichthandeln lässt sich also nur dann als Meinungskundgabe deuten, wenn zum einen das Nichthandeln als solches wahrgenommen werden kann und zum anderen dem Nichthandeln der intendierte Erklärungswert jedenfalls potentiell entnommen werden kann. Das schlichte Nichtzur-Wahl-Gehen hat allerdings kaum eine Chance, von Personen, die sich im Umfeld des Wahlberechtigten befinden, als solches wahrgenommen zu werden. Selbst wenn allerdings das Nicht-zur-Wahl-Gehen von Personen, die etwa im gleichen Haushalt leben, wahrgenommen wird, ergibt sich die Meinungskundgabe erst aus dazukommenden Äußerungen des Wahlberechtigten. Denn das Nichthandeln unterstreicht 264 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 1 Rn. 21; C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (218); ähnlich K. Doehring, Staatsrecht, 1984, D III 2 a); H.-U. Erichsen, Die Wahlrechtsgrundsätze, Jura 1983, S. 635 (641); K. Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1984, § 10 II 8, S. 323; R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 65. 265 Dies scheint zunächst als Privilegierung des „politischen“ Gebrauchs der Grundrechte. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass das Fernbleiben von der Wahl aus „unpolitischen“ Gründen wie Indifferenz oder Vergesslichkeit noch nicht einmal eine Aussage enthält und deshalb von vornherein nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sein kann. Dennoch wird hier durch die Charakterisierung der Äußerung als „politisch“ die Grenze zwischen grundrechtlichem und staatlichem Bereich verwischt. Zum Bezug des Begriffs „politisch“ sowohl auf die staatliche als auch auf die gesellschaftliche Sphäre siehe oben in Abschnitt D. VI. 2, S. 100 f. 266 Der Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst neben der Äußerung der Meinung auch die Meinungsbildung sowie das Recht, eine Meinung zu haben: H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Bd. I, GG-Kommentar, Art. 5 I, II Rn. 67. 267 C. Grabenwarter, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. I, Art. 5 Rn. 82.; dies entspricht dem Schutzzweck der Meinungsfreiheit, die gerade dazu gewährt wird, den öffentlichen Kommunikationsprozess aufrechtzuerhalten. Ein Recht auf „Publikum“ ergibt sich daraus jedoch nicht: C. Grabenwarter, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG-Kommentar, 70. Lfg. (Stand: Dez. 2013), Bd. I, Art. 5 Rn. 110.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
227
dann nur den Erklärungswert dieser Äußerungen, ein eigener Erklärungswert kommt ihm hingegen nicht zu. Das Nichthandeln des Wahlberechtigten schlägt sich aber auch in einer Nichtabzeichnung seines Namens im Wählerverzeichnis nieder, da, um doppelte Stimmabgaben zu vermeiden, die Stimmabgabe vermerkt werden muss.268 Das Wählerverzeichnis gibt damit Auskunft darüber, wer nicht gewählt hat. Es ist jedoch der Öffentlichkeit nicht zugänglich.269 Über die Wahlbeteiligung insgesamt wird hingegen der Öffentlichkeit Auskunft gegeben,270 so dass hierin eine Wahrnehmbarkeit des Nichthandelns einer Vielzahl von Personen gesehen werden könnte. Allerdings lässt sich aus der bloßen Information, dass ein gewisser Prozentsatz der Wahlberechtigten nicht gewählt hat, das Nichtwählen noch nicht an eine konkrete Person anknüpfen, so dass sich die Frage stellt, ob für den Schutz der Meinungsäußerung durch Art. 5 Abs. 1 GG die Rückführbarkeit der Meinung auf eine konkrete Person erforderlich ist. Dies kann nicht angenommen werden, denn auch derjenige, der durch aktives Tun von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch macht, kann hinter seiner Meinung unerkannt bleiben und seine Meinung geheim äußern.271 Es entspricht dem Schutzzweck der Meinungsäußerungsfreiheit, dass es nur um die Wahrnehmung des Kommunikationsgehalts und nicht des Kommunizierenden gehen kann.272 Die bloße Möglichkeit des Wahrnehmens des Erklärungswertes seiner Äußerung ist für den Schutz seiner Äußerung ausreichend. Allerdings liegt in der Information über die Wahlstatistik erst die Kenntnis vom Nichtwählen einer bestimmten Anzahl von Personen. Dem kann jedoch nicht der 268
§ 56 Abs. 4 S. 3 BWahlO. Das Wählerverzeichnis ist ohnehin nur vor der Wahl einsehbar. Dies ist im Hinblick auf die eigene Person voraussetzungslos möglich (§ 17 Abs. 1 S. 1 BWahlG), im Hinblick auf andere Personen nur dann, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergibt (§ 17 Abs. 1 S. 3 BWahlG). Seit dem 15. Änderungsgesetz zum Bundeswahlgesetzes vom 27. 4. 2011 (BGBl. I S. 698), wird das Wählerverzeichnis nicht mehr offen ausgelegt; dies soll dem Datenschutz Rechnung tragen. 270 Das Prinzip der Öffentlichkeit der Wahl gebietet, dass das Wahlergebnis öffentlich festgestellt wird, W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 37 Rn. 2 Das Wahlergebnis der Wahlkreise, der Länder und des gesamten Wahlgebietes wird dann öffentlich bekannt gemacht, § 79 Abs. 1 BWahlG. 271 C. Starck, in: von Mangoldt/Klein/ders., GG-Kommentar, Bd. I, Art. 5 Abs. 1, 2 Rn. 32. 272 So ist auch die Handlung desjenigen, der – gerade unerkannt bleibend – Plakate, die Meinungskundgaben enthalten, aufhängt, vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst. D. Heckmann, Anonymität der IT-Nutzung, NJW 2012, S. 2631 (2632), spricht gar von einem „Grundrecht auf Anonymität“, das in der informationellen Selbstbestimmung, der Meinungsfreiheit und Gewährleistung von Privatheit verankert sei. Allerdings fehle anonymen Äußerungen nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 97, 391 (398) – Missbrauchsbezichtigung, Beschluss vom 25. 3. 1998, häufig „dasjenige Maß an Authentizität und Glaubhaftigkeit, welches ihnen den gewünschten Einfluss verleiht und Reaktionen hervorruft“. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese Äußerungen von der Meinungsfreiheit geschützt sind. 269
228
F. Der Einzelne im Wahlakt
Erklärungswert einer ablehnenden Haltung gegenüber den zur Wahl stehenden Kandidaten entnommen werden. Denn das Fernbleiben kann andere Gründe haben als gerade das Verdeutlichen einer ablehnenden Haltung und wird dies in den meisten Fällen auch haben. Das Nichthandeln müsste deshalb vielmehr demonstrativ in dem Sinne geschehen, dass nicht nur das Nichthandeln, sondern auch der Erklärungswert des Nichthandelns wahrnehmbar ist. So könnte sich der Wahlberechtigte z. B. während der gesamten Wahlzeit an einem Ort etwa neben der Wahlkabine aufhalten, während er von dieser jedoch demonstrativ keinen Gebrauch macht. Allerdings wäre dieser Nichthandlung von einem objektiven Dritten der Erklärungsgehalt einer ablehnenden Haltung selbst dann nicht zu entnehmen, wenn dieser die Permanenz der Nichthandlung während des gesamten Wahlzeitraums wahrnehmen würde. Denn es wäre nicht ausgeschlossen, dass der Nichthandelnde bereits von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht hat. Dass ein Dritter diesen Erklärungswert wahrscheinlich aber erahnen würde, läge dann nicht an dem Nichtwählen, sondern an dem aktiven Tun, des Sich-Aufhaltens, das das Unterlassen erst wahrscheinlich scheinen lassen würde. Das Nichtwählen wäre allerdings eindeutig für die Wahlhelfer aus dem Wählerverzeichnis ersichtlich, wenn der Nichthandelnde seine Identität offen legen würde. Aus der Verbindung mit dem demonstrativen Nichthandeln würde sich für sie durchaus der Erklärungswert einer Ablehnung gegenüber der Wahl oder dem politischen System als Ganzem ergeben. Dass der genaue Erklärungswert der (Nicht-) Handlung dabei nicht entnommen werden könnte, muss dabei unschädlich sein, weil sonst die richtige Deutung der Meinung durch den Empfänger über den Schutz der Meinung durch die Meinungsfreiheit entscheiden würde. Auch ist unschädlich, dass die Wahlhelfer den Erklärungswert des Nichthandelns nicht als Grundrechtsträger, sondern in ihrer staatlichen Funktion als Wahlhelfer273 wahrnehmen würden – nur als solche haben sie Einsicht in das Wählerverzeichnis. Die Meinungsfreiheit schützt auch die Einflussnahme auf die staatliche Sphäre und setzt nicht etwa einen potentiellen Rezipienten in der gesellschaftlichen Sphäre voraus. Auch wäre eine demonstrative Nichthandlung als Kontrast zu einem Handeln denkbar, das dann auch für andere Grundrechtsträger erkennbar wäre. Etwa wenn ein Wahlberechtigter in das Wahlbüro kommt und seinen Wahlschein vorlegen, die Entgegennahme eines Stimmzettels dann aber – für andere ersichtlich – verweigern würde. Es sind somit – jedenfalls theoretisch – Konstellationen denkbar, in denen dem Nichtwählen gerade der Erklärungswert der ablehnenden Haltung gegenüber den Wahlalternativen oder dem politischen System entnommen werden kann. Die Pflicht, zur Wahl zu erscheinen, würde direkt darauf abzielen, dem Einzelnen diese 273 Die Wahlhelfer sind ehrenamtlich tätig, § 11 S. 1 BWahlG. Sie üben öffentliche Aufgaben aus, jedoch ist ihr Handeln keiner der drei Staatsgewalten, auch nicht der vollziehenden Gewalt, zuzuordnen: W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 11 Rn. 2, S. 292 f.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
229
Möglichkeit der Äußerung seiner ablehnenden Haltung gegenüber der Wahl zu nehmen und damit einen unmittelbaren Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellen. Dieser Eingriff ist dann zwar als erheblicher als die daneben liegenden faktischen Eingriffe zu qualifizieren. Dennoch bleibt es dem Wahlberechtigten auch bei bestehender Wahlpflicht unbenommen, seine Unzufriedenheit mit dem politischen System oder den Wahlalternativen in vielfältiger Form kundzutun. Es wird ihm nur eine Möglichkeit einer bestimmten Form der Meinungskundgabe, deren Rezipientenkreis ohnehin sehr beschränkt ist und deren tatsächlicher Kommunikationsgehalt ohnehin fraglich ist, verschlossen. Zwar ist auch die Form der Meinungsäußerung dezidiert Teil des Schutzbereiches, so dass der Grundrechtsträger nicht auf andere Formen der Meinungsäußerung verwiesen werden kann.274 Jedoch mindert sich durch die Alternativen die Eingriffsintensität, so dass auch dieser Eingriff als sehr gering einzustufen ist. Auch er ist leicht aus den oben genannten Gründen zu rechtfertigen. Der Wahlberechtigte wird zudem nicht zu einer positiven Meinungskundgabe, etwa der Zustimmung zum politischen System, gezwungen. Denn wenn eine Verpflichtung zur Wahlteilnahme besteht, kann dem Wahrnehmen dieser Pflicht kein Erklärungswert entnommen werden. Es könnte jedoch anderen Wahlberechtigten, die auch ohne Verpflichtung zur Wahl gehen würden, die Möglichkeit genommen werden, gerade durch die Teilnahme an der Wahl ihre Zustimmung zum politischen System kundzutun, weil eben der aufgrund einer Verpflichtung ausgeübten Handlung kein Kommunikationsgehalt beigemessen werden kann. Auch bei Nichtbestehen einer Wahlpflicht ergibt sich der Erklärungswert der Zustimmung zum politischen System oder der Wahlalternativen jedoch erst durch Hinzutreten weiterer Äußerungen. Der Wahlberechtigte könnte auch deshalb zur Wahl gehen, weil er sich moralisch verpflichtet fühlt oder weil er die Notwendigkeit des Wählens innerhalb des Systems empfindet, nicht aber um Zustimmung auszudrücken. Auch hier ergibt sich die Kundgabe von Zustimmung erst aus dem Kontext. Der tatsächlichen Handlung kommt dann auch hier kein eigener Erklärungswert zu, sie unterstreicht nur den Erklärungswert der weiteren Meinungskundgaben. Eine Wahlpflicht würde deshalb keinen Eingriff in die (positive) Meinungsfreiheit darstellen. Es kommt aber auch ein Eingriff in die Gewissens- oder Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG in Betracht. Verbietet dem Wähler sein Gewissen oder seine Religion die Teilnahme an Wahlen,275 so stellt schon die Verpflichtung zur Teilnahme an Wahlen und nicht erst die Pflicht zur Stimmabgabe einen Eingriff in die Religionsoder Gewissensfreiheit dar. Ob dieser Eingriff noch durch die Funktionsfähigkeit des Staates gerechtfertigt werden kann, ist fraglich, da der Eingriff von nicht unerheb274 C. Degenhart, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 122. Lfg. (Stand: Juli 2006), Bd. II, Art. 5 Abs. 1 und 2 Rn. 140. 275 So verbietet der Glaube der Zeugen Jehovas diesen die Teilnahme an staatlichen Wahlen.
230
F. Der Einzelne im Wahlakt
lichem Gewicht ist, die Verpflichtung entgegen der Gewissensnot aber nur sehr wenige Wahlberechtigte trifft und damit auch nur wenig zur demokratischen Legitimation der Staatsgewalt und somit der Funktionsfähigkeit des Staates beiträgt.276 Es wäre deshalb an Ausnahmen von der Wahlpflicht aus Religions- oder Gewissensgründen zu denken. Als Beispiel für Religions- oder Gewissensnöte, die staatlichen Pflichten entgegenstehen, kann die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen dienen. c) Verletzung von Grundrechten durch die Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels Es könnten aber auch Grundrechte durch einen direkten Eingriff, der in der Pflicht zur Stimmabgabe, verstanden als die Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels, selbst liegt, verletzt sein. aa) Geltung der Grundrechte bei der Stimmabgabe? Es stellt sich zunächst die Frage, ob bei der Stimmabgabe die Grundrechte Wirkung entfalten, weil der Bürger hier im staatlichen Bereich in seiner Rolle als Citoyen tätig wird und nicht in seiner bürgerlichen Rolle als Bourgeois. Fraglich ist also, ob für die Wirkung der Grundrechte noch Raum bleibt, ob der Wähler im gleichen Moment grundrechtsberechtigter Bürger bleibt, wenn er als Staatsbürger wählt. Denn die Grundrechte sind vornehmlich auf Staatsdistanz zugeschnitten,277 sie stellen primär Abwehrrechte gegen den Staat dar,278 während der Wähler als Ausübender von Staatsgewalt in den Staat eingegliedert ist.279 Nur wenn die Grundrechte aber auch innerhalb dieser Eingliederungslage gelten, könnten sie durch eine Stimmpflicht verletzt werden. Die Frage nach der Geltung der Grundrechte bei Eintritt in die staatliche Sphäre stellt sich in zwei Richtungen. Einerseits fragt sich, ob die Grundrechte auch die Ausübung von Staatsgewalt individual-rechtlich schützen, ob der Grundrechtsträger also die Grundrechte in den organschaftlichen Bereich „mitnehmen“ und auch hier von seinen Grundrechten Gebrauch machen kann. Dies ist abzulehnen, weil der Staatsbürger als Funktions276
Das Argument der geringen Zahl nutzte auch das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 102, 370 (398 f.) – Körperschaftsstatus der Zeugen Jehovas, Urteil vom 19. Dezember 2000, für seine Begründung, warum durch die ablehnende Haltung der Zeugen Jehovas keine „Gefährdung der unantastbaren Gehalte des Demokratieprinzips“ stattfinde. 277 W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 28, S. Graf von Kielmannsegg, Das Sonderstatusverhältnis, JA 2012, S. 881 (882). 278 Daneben beinhalten sie aber auch staatliche Schutzpflichten. Hierzu J. Isensee, Grundrechte als Abwehrrechte, HStR, Bd. IX, 2000, § 191 Rn. 1. 279 Er ist Organteil des Staatsorgans Volk.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
231
träger hier selbst Staatsgewalt ausübt; könnte er hier seine grundrechtlichen Freiheiten geltend machen, käme es zur Konfusion der Grundrechtswirkungen – Grundrechte würden dann nicht gegen, sondern für den Staat geltend gemacht. Auf den Status des Wählers übertragen bedeutet dies, dass dieser nicht von Grundrechten Gebrauch machen kann, wenn er an Wahlen teilnimmt. Er kann sich also nicht positiv auf diese berufen, wenn er von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Etwas anderes könnte sich aber daraus ergeben, dass der Wähler – anders als der Beamte oder andere Amtsträger – als Individuum in die staatliche Sphäre aufgenommen wird. Er ist um seiner selbst willen, nicht aber aufgrund von Qualifikation oder Wahl Teil der staatlichen Sphäre. Dies könnte dafür sprechen, dass er auch innerhalb der staatlichen Sphäre von seinen Grundrechten Gebrauch machen kann. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Einzelne zwar als Individuum Teil der staatlichen Sphäre wird, dann aber Teil dieser Sphäre ist, in der Grundrechte keine Wirkung entfalten. Denn die Geltung von Grundrechten hängt nicht am Rechtsträger, sondern an der Sphäre, in der dieser tätig wird. Der Rechtsträger kann sowohl als Privatmann in der gesellschaftlichen Sphäre agieren als auch – nicht mehr privat – als Teil des Staates. Der Wähler befindet sich, wenn er wählt, in der staatlichen Sphäre und damit auch in einer anderen Rolle als der, in der er sich gewöhnlich als Bourgeois bewegt. In der gesellschaftlichen Sphäre wirken Grundrechte, während diese in der staatlichen Sphäre keine Wirkung entfalten; hier gibt es nur organschaftliche Rechte. Auch der Wähler, der als Individuum Teil der staatlichen Sphäre wird, kann deshalb innerhalb der staatlichen Sphäre nicht von Grundrechten Gebrauch machen.280 Andererseits stellt sich hier aber nicht nur die Frage, ob die Grundrechte für den organisationsrechtlichen Status geltend gemacht werden können, und dann innerhalb dieses Status wirken. Es ist außerdem fraglich, ob sie daneben weiterwirken und gegen die organisationsrechtlichen Pflichten des Einzelnen geltend gemacht werden können. Dies ist die zweite Stoßrichtung, in die Grundrechte im Eingliederungsverhältnis wirken könnten. Würde die Weitergeltung von Grundrechten neben der funktionalen Eingliederung des Einzelnen in den Staat ausgeschlossen, würde sich hier ein „grundrechtsfreier“ Raum ergeben. Grundrechtsfreie Räume wurden in früherer Zeit unter dem Stichwort des „besonderen Gewaltverhältnisses“ angenommen für Personen, die sich aufgrund einer Eingliederung in einem besonderen Näheverhältnis zum Staat befanden, wie Beamte, Schüler und Soldaten, aber auch Strafgefangene.281 Denn durch 280
Verfehlt ist es deshalb, wenn W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92), die Meinungsäußerung, die in der Stimmabgabe zum Ausdruck kommt, nur deshalb nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sieht, weil diese keine Wirkung nach außen entfaltet, der Schutzbereich also sachlich nicht eröffnet ist. Die Meinungsfreiheit ist hier vielmehr schon gar nicht anwendbar. So auch W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, Teil 1, Rn. 23, S. 41; A. von Heyl, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, 1975, S. 196; BVerfGE 8, 104 (115) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7. 1958. 281 Der Begriff wurde geprägt durch O. Mayer, Die Lehre vom öffentlichen Vertrage, AöR 3, 1888, S. 3 (53 f.).
232
F. Der Einzelne im Wahlakt
die funktionelle Eingliederung in den Staat wird nicht nur die räumliche, sondern auch die sachliche Distanz zum Staat aufgegeben.282 Eine Ausschlusswirkung von Grundrechten wurde hier deshalb angenommen, weil sich die Grundrechtsträger in einer besonderen „Gewaltunterworfenheit“, die über die allgemeine Unterworfenheit des Bürgers unter die Gesetze hinaus geht, befänden, und aufgrund dieser besonderen Verpflichtung kein Raum für die Geltung der Grundrechte bliebe, die auf die Distanz zwischen Bürger und Staat zugeschnitten sind.283 Mit seiner „Strafgefangenenentscheidung“284 hat das Bundesverfassungsgericht jedoch klargestellt, dass die Grundrechte auch in Verhältnissen, in denen sich der Bürger nicht in der gewohnten Distanz zum Staat befindet, nicht grundsätzlich „in einer unerträglichen Unbestimmtheit“ relativiert werden können.285 Die Probleme der Grundrechtswirkungen, die sich ergeben, wenn der Grundrechtsberechtigte ein besonderes „Näheverhältnis“286 mit dem Staat eingeht oder zu einem solchen verpflichtet wird,287 sind durch die bloße Anerkennung der Grundrechtsgeltung und der Abschaffung der Aufgabe der Rechtsfigur des „besonderen Gewaltverhältnisses“ indes nicht gelöst.288 Dies zeigt sich deutlich an den weiterhin aktuellen rechtlichen Fragen, die beispielsweise über religiöse Bekleidung im Schuldienst289 bestehen. Wird der Einzelne im staatlichen Bereich tätig, handelt er nicht mehr nur in seiner individuellen Sphäre, sondern tritt in den staatlichen Rechtskreis ein. Auch wenn die beiden Sphären theoretisch strikt zu trennen sind, lässt sich nicht vermeiden, dass Ausgestaltungen der staatlichen Sphäre den Einzelnen in seiner individuellen Sphäre, die grundrechtlichen Schutz genießt, treffen. Dies liegt an der doppelten Rolle, die der Einzelne als eine Person zu erfüllen hat.290 Tritt der Einzelne in den Staat ein, werden seine individuelle und die staatliche 282 N. Klein, Grundrechte und Wesensgehaltsgarantie im besonderen Gewaltverhältnis, DVBl. 1987, S. 1102 (1106); W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 8 ff. 283 Nicht nur die Grundrechte, sondern der gesamte Rechtsstaat ist auf Distanz zwischen Bürger und Staat ausgerichtet. Siehe hierzu J. Isensee, Staat und Verfassung, in: HStR, Bd. II, 2004, § 15 Rn. 150. 284 BVerfGE 33, 1 – Strafgefangene, Beschluss vom 14. 3. 1972. 285 S. Graf von Kielmannsegg, Das Sonderstatusverhältnis, JA 2012, S. 881 (883), W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 9. 286 Mit Bezug auf die Monographie von S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012. 287 Ein verpflichtendes „Sonderstatusverhältnis“ ergibt sich bei der Schulpflicht, bei der Wehrpflicht aber auch bei der hier untersuchten Wahlpflicht. 288 M. Schladebach, Besprechung: S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, DÖV 2014, S. 31 (31); für den Beamten auch F. Rottmann, Der Beamte als Staatsbürger, 1981, S. 227. 289 Hierzu M. Kögl, Religionsgeprägte Kleidung des Lehrers, 2006; BVerfGE 138, 296 (326) – Kopftuch II, Beschluss vom 27. 1. 2015. 290 Auf die Unteilbarkeit der Person weist auch S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 365, hin.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
233
Sphäre praktisch (aber auch nur praktisch) jedenfalls teilweise „ineinandergeschoben“.291 Zur Bewältigung der Probleme, die daraus resultieren, dass eine Person in zwei unterschiedlichen Sphären tätig wird, werden Versuche unternommen, die beiden Status weitest möglich auseinander zu halten. Es wird danach gefragt, in welcher Rolle die Person von einer Regelung angesprochen ist. Die Abgrenzung verläuft danach, ob das „Grundverhältnis“ tangiert ist, Einzelne also noch in seiner individuellen Sphäre betroffen ist, oder ob das „Betriebsverhältnis“ betroffen ist, der Einzelne also schon in der Rolle als Beamter, Schüler, Häftling, etc. von einer Regelung erfasst ist.292 Eine solche Differenzierung ist zwar in gewissem Maße möglich, eine trennscharfe Abgrenzung der beiden Sphären kann aber nicht bewirkt werden. Es ist auch denkbar, dass eine Regelung, die den Einzelnen in seiner funktionalen Sphäre treffen soll, auf seine individuelle Sphäre durchschlägt. So lassen sich beispielsweise Vorschriften über Haarschnitte nicht auf die funktionale Sphäre beschränken, sondern wirken sich notwendig auch in der individuellen Sphäre aus. Aber auch innerhalb des „Betriebsverhältnisses“ ist die Grundrechtswirkung nicht suspendiert, sondern jede dienstliche Handlung stellt einen Eingriff in die Grundrechte des betroffenen Funktionsträgers dar. Zu lösen ist das Problem auf der Schrankenebene der Grundrechte.293 Dabei bildet das Funktionsinteresse der jeweiligen Einrichtung, in der der Grundrechtsträger wirkt, eine verfassungsimmanente Schranke der Grundrechte.294 Diese wird in manchen Bereichen durch spezielle Eingriffsnormen – wie etwa Art. 17a GG für Wehrdienstleistende oder Art. 33 GG für Beamte – konkretisiert.295 Es ist also im Einzelnen abzuwägen, ob die Grundrechte vor dem Funktionsinteresse der durch das Näheverhältnis geschützten Einrichtung Vorrang genießen. Auch wenn der Bürger als Teil des Volkes staatlich tätig wird, gelten daneben seine Grundrechte somit weiter und können gegen eine Verpflichtung zur Stimmabgabe geltend gemacht werden, soweit die Pflicht zur Stimmabgabe in den Schutzbereich der Grundrechte eingreift. Es muss dann eine Abwägung zwischen der Wahlpflicht und dem beeinträchtigten Grundrecht stattfinden. Anders als beim Beamten, dessen gesamtes Dasein von seinem Amt durchwirkt ist,296 ist die
291
W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 23. S. Graf von Kielmannsegg, Das Sonderstatusverhältnis, JA 2012, S. 881 (885). 293 W. Loschelder zufolge können hingegen Grundrechte im Einzelfall vom Zweck der Sonderbindung überlagert sein. So gilt die Freizügigkeit für Gefangene gerade nicht. 294 Ähnlich schon BVerfGE 33, 1 (11) – Strafgefangene, Beschluss vom 14. 3. 1972. 295 So auch S. Graf von Kielmannsegg, Das Sonderstatusverhältnis, JA 2012, S. 881 (883). 296 W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 24, 25. Das Beamtenrecht enthält Vorschriften auch für das außerdienstliche Verhalten des Beamten. 292
234
F. Der Einzelne im Wahlakt
Grundrechtsbeeinträchtigung, die von der Rolle des Einzelnen als Organteil297 des Volkes ausgeht, allerdings besonders gering, weil die Zuständigkeiten des Volkes von geringem Umfang und mit geringem Handlungsaufwand verbunden sind. Nur in der einen Konstellation der Stimmabgabe kommt eine Kollision mit Grundrechten des Wahlberechtigten in Betracht.298 bb) Verstoß gegen Freiheitsrechte? Die Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels könnte eine Verletzung der negativen Seite der Meinungsfreiheit darstellen. Denn diese enthält das Recht, keine Meinung zu äußern.299 Würde die Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels eine Meinungskundgabe i. S. d. Art. 5 Abs. 1 GG erfordern, läge hierin ein Eingriff in die (negative) Meinungsfreiheit, denn sie würde dann zu einer Meinungskundgabe zwingen. Dabei kann die Wirkung der negativen Seite des Grundrechts aber nicht weitergehen als die positive. Nur dann, wenn sich das staatliche Handeln, zu dem verpflichtet wird, unter den Schutzbereich eines Grundrechts fassen lässt, lässt sich die Verpflichtung hierzu als ein Eingriff in die negative Seite des Rechts deuten. Dass die Abgabe eines Stimmzettels dann staatliches Handeln ist, kann den Schutzbereich der Meinungsfreiheit nicht verschließen, weil es darum geht, den Grundrechtsberechtigten zu einem Verhalten zu verpflichten, dessen Unterlassen eventuell von der Meinungsfreiheit geschützt ist, die neben der staatlichen Sphäre – wie gerade gesehen – weiterhin Anwendung findet. Fraglich ist jedoch, ob die Stimmabgabe bei Wahlen eine Meinungskundgabe i. S. d. Art. 5 Abs. 1 GG darstellt. Die Stimmabgabe fällt nicht schon deshalb aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit heraus, weil sie geheim ausgeübt wird. Auch eine geheime Meinungsäußerung ist – wie erläutert – vom Schutzbereich der Meinungsäußerung umfasst. Sie könnte jedoch deshalb aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit herausfallen, weil die einzelne Stimmabgabe auch geheim bleibt.300 Jedoch wird das Wahlergebnis und damit die Stimmabgabe der Gesamtheit der Wähler veröffentlicht. Eine Rückführbarkeit der Meinungskundgabe auf den Äußernden ist – wie gesehen301 – für ihren Schutz durch die Meinungsfreiheit nicht erforderlich. Der Stimmabgabe für eine Partei oder einen Kandidaten lässt sich – anders als dem Nichtwählen – durchaus der Erklärungswert einer irgendwie gearteten Zustimmung entnehmen, weil es jedem Wahlberechtigten gerade auch frei297 Gegen die Stellung des Bürgers als Teil eines Staatsorgans H. Meyer, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: HStR, Bd. III, 2005, Rn. 45 Rn. 4: „Er wählt als Bürger, nicht als Teil eines Verfassungs-(Staats-)organs.“ 298 W. Loschelder, Grundrechte im Sonderstatus, in: HStR, Bd. IX, 2011, § 202 Rn. 9. 299 C. Grabenwarter, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. I, Art. 5 Rn. 95; F. Fechner, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, Art. 5 Rn. 98. 300 So W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92). 301 Siehe oben in diesem Abschnitt unter F. VI. 4. b), S. 225 ff.
VI. Verfassungsmäßigkeit einer Wahlpflicht?
235
gestanden hätte, eine ungültige Stimme abzugeben. Die Stimmabgabe nimmt, jedenfalls dann, wenn sie positiv abgegeben wird, durchaus Einfluss auf einen Kommunikationsprozess. Der Wahl wird auch gerade eine Kommunikationsfunktion zwischen dem Volk und den übrigen Staatsorganen beigemessen. Die Stimmabgabe stellt damit eine von der Meinungsfreiheit geschützte Meinungsäußerung dar.302 Da aber aufgrund der Geheimheit der Wahl stets auch die Möglichkeit besteht, sich seiner Stimme zu enthalten,303 wird durch eine Pflicht, einen Stimmzettel abzugeben, keine Stimmabgabe und damit keine Meinungskundgabe, noch nicht einmal irgendeine Handlung in der Wahlkabine abverlangt. 304 Aus diesem Grund ist auch die Gewissensfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG nicht betroffen, weil keine Entscheidung und damit auch keine Gewissensentscheidung abverlangt wird.305 Deutlich wird aber, dass eine Stimmabgabepflicht wohl nicht verfassungsgemäß sein könnte. Sie wird jedoch auch durch den Grundsatz der geheimen Wahl verhindert. cc) Verstoß gegen die Menschenwürde? Auch die Kollision einer Wahlpflicht mit der Menschenwürde wird in Betracht gezogen.306 Dies würde per se zur Verfassungswidrigkeit der Pflicht zur Abgabe eines Stimmzettels führen, weil Eingriffe in die Menschenwürde nicht rechtfertigungsfähig sind, sondern unmittelbar zur Verletzung des Rechts führen.307 Angeknüpft wird der Bezug zur Menschenwürde an die Meinung, die die Mitbestimmung am Gemeinwesen als Konsequenz der Menschenwürde betrachtet.308 Eine Wahlpflicht würde die „vernunftgeleitete Selbstbestimmung des Menschen“ beeinträchtigen.309 Eine Verletzung wird dann aber meist ausgeschlossen, weil der „unantastbare Kern der Menschenwürde“ nicht berührt sei.310 302
1958. 303
A. A. BVerfGE 8, 104 (115) – Volksbefragung Hamburg und Bremen, Urteil vom 30. 7.
C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (217) weist darauf hin, dass das bundesdeutsche Wahlrecht aber nur „unechte Stimmenthaltungen“ kenne, weil Enthaltungen keine Wirkung entfalten, indem etwa Sitze im Parlament leer bleiben. Aus diesem Grund hält er eine Wahlpflicht unter Beibehaltung des bundesdeutschen Wahlrechts für verfassungswidrig, weil sie die positive Seite des Wahlgrundsatzes „frei“ beeinträchtigten würde. Allerdings wird nicht klar, warum die Wahlfreiheit nicht auch ohne Wahlpflicht beeinträchtigt sein soll, wenn es keine echten Wahlenthaltungen i. S. v. wirksamen Wahlenthaltungen gibt. Jedenfalls aber ist eine Stimmenthaltung möglich. 304 So auch S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (94). 305 So auch S. Haack, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 81 (94). 306 T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (862); W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (92 f.). 307 W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (93). 308 Siehe hierzu oben in Abschnitt D. V. 3, S. 90 ff. 309 W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (93); T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (862); der Autor verwischt hier aber mehrere Grundrechte miteinander, indem er zugleich die „Beteiligung sowie die Nichtbeteiligung an der Wahl
236
F. Der Einzelne im Wahlakt
Selbst wenn die Menschenwürde aber eine Mitbestimmung am Gemeinwesen gebieten würde, wäre nicht zu erkennen, warum in der Verpflichtung, diese dann auch auszuüben, ein Eingriff in die Menschenwürde liegen sollte. Denn der Einzelne wird hierdurch nicht zum Objekt staatlicher Gewalt gemacht, sondern zu ihrem Subjekt. Ein durch Objektivierung des Einzelnen erfolgender Menschenwürdeverstoß könnte hier allenfalls in der Verpflichtung an sich liegen. In einer bloßen Verpflichtung zu staatlichem Handeln kann indes keine Verobjektivierung gesehen werden. Zwar wird der Mensch hier in einem gewissen Grade „verzwecklicht“, denn in der Zweckerfüllung liegt der Grund einer jeden Verpflichtung. Jedoch ist zu bedenken, dass das Menschenbild des Grundgesetzes, das maßgeblich vom Menschenwürdegrundsatz geprägt ist, nicht das eines isolierten Individuums ist, sondern der Mensch als gemeinschaftsgebundenes Wesen vom Grundgesetz vorausgesetzt wird.311 Das Eingebundensein in die Gemeinschaft geht notwendig mit Verpflichtungen einher, die nicht per se einen Menschenwürdeverstoß darstellen. Andernfalls wären auch andere staatliche Verpflichtungen, wie z. B. die Wehrpflicht, per se verfassungswidrig.312 Die Verpflichtung, Wehrdienst zu leisten, lässt einen Menschenwürdeverstoß viel näher liegen, weil hier auch der Inhalt der Pflicht verobjektivierend wirkt. Zwar wird im Wehrdienst auch das Recht zur Landesverteidigung erblickt,313 dennoch ist dieses Recht in weit höherem Maße als das Wahlrecht von individuellen Fähigkeiten abhängig. Auch wird der Einzelne aufgrund des Prinzips von Befehl und Gehorsam im militärischen Kontext zum Werkzeug staatlichen Handelns gemacht. Er übt zwar auch Staatsgewalt aus, allerdings nicht selbstbestimmt. Er ist hier bei der Ausübung der Pflicht nicht in seiner Individualität gefragt. Dennoch ist die Möglichkeit zur Einführung einer Wehrpflicht als Ausdruck einer autonomen Gewissensentscheidung“ qualifiziert und dabei eigentlich auf die Gewissensfreiheit abstellt. Der Wähler würde gehindert, „durch eine Nichtwahl Protest oder Desinteresse“ auszudrücken. Hier wird dann wiederum unausgesprochen auf die Meinungsfreiheit abgestellt. 310 W. Frenz, Wahlrecht – Wahlpflicht, ZRP 1994, S. 91 (93). Die Argumentation von T. Silberhorn, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 (862), der darauf abstellt, dass der Einzelne zum Objekt staatlichen Handelns gemacht wird, wenn er zur Wahl verpflichtet würde, und so als Mittel zur Erreichung einer hohen Wahlbeteiligung eingesetzt würde, dann aber einen Eingriff in die Menschenwürde ablehnt, weil sich der Wähler der Stimme enthalten könnte, vermag nicht zu überzeugen. Denn für die Wahlbeteiligung, die unabhängig von der Anzahl der ungültigen Stimmen besteht, wäre er nach dieser Ansicht bereits „verzwecklicht“ worden. 311 BVerfGE 4, 7 (15) – Investitionshilfe, Urteil vom 20. 7. 1954. 312 Die Wehrpflicht wird (bzw. wurde vor ihrer Aussetzung) zwar teilweise für verfassungswidrig gehalten, allerdings nicht aufgrund ihres verpflichtenden Charakters, sondern aufgrund ihrer ungleichen Ausgestaltung; z. B. von U. Vosgerau, Zur Verfassungswidrigkeit der allgemeinen Wehrpflicht nach stillschweigender Umwandlung in eine Dienstpflicht, ZRP 1998, S. 84 f. 313 „Der Wehrpflicht […] entspricht vielmehr das Wahlrecht“, so O. Luchterhandt, Grundpflichten, S. 498. J. Isensee, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers, DÖV 1982, S. 609 (617) sieht die „Wehrpflicht als effektives demokratisches Integrationsmedium“.
VII. Grundrechtlicher und staatsrechtlicher Status beim Wähler
237
im Grundgesetz in Art. 12a GG normiert und wird von der Verfassung selbst anerkannt.314 Dies zeigt, dass die Verfassung in der bloßen Verpflichtung zu etwas keinen Menschenwürdeverstoß erblickt.315 Auch in der Normierung einer Wahlpflicht könnte deshalb kein Menschenwürdeverstoß erblickt werden. dd) Ergebnis Durch eine Wahlpflicht würden verschiedene Eingriffe in unterschiedliche Grundrechte vorgenommen. Diese sind jedoch allesamt durch die Notwendigkeit der Legitimation der Staatsgewalt und der Funktionsfähigkeit des Staates dann rechtfertigungsfähig, wenn diese mangels Beteiligung an der Wahl in Frage stehen oder in Frage gestellt zu werden drohen.
5. Ergebnis Eine Wahlpflicht ist damit jedenfalls verfassungsrechtlich zulässig.316 Dies ist auch deshalb notwendig, weil der oft zitierte Satz, der freiheitliche Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren könne,317 sich nur auf die materielle Legitimation der Staatsgewalt beziehen kann, nicht auf die formelle. Der Staat kann nicht nur auf die Beteiligung der Bürger an der Wahl hoffen, sondern muss sie im Notfall auch erzwingen können.
VII. „Verschmelzung“ von grundrechtlichem und staatsrechtlichem Status des Wählers? Wie gezeigt, unterscheidet sich die grundrechtliche Sphäre des Bürgers als Bourgeois und die staatliche Sphäre des Bürgers als Citoyen. Der Bürger ist damit
314 Allerdings wurde Art. 12a GG erst 1968 durch das siebzehnte Änderungsgesetz in das Grundgesetz eingeführt. Es wäre also möglich, dass es sich dabei um verfassungswidriges Verfassungsrecht handelt. 315 O. Luchterhandt, Grundpflichten, S. 498, sieht jedoch die Wahlpflicht „nicht in so enger Weise mit dem Demokratieprinzip verknüpft“. 316 So auch T. Zimmermann, Die Wahlfälschung im Gefüge des strafrechtlichen Schutzes der Volkssouveränität, ZIS 2012, S. 982 (987); C. Labrenz, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 2011, S. 214 (218); D. Merten, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Festschrift für Broermann, S. 301 (315); J. Roscheck, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, 2003, S. 68. 317 E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Festschrift für Forsthoff, 1967, S.75 (93).
238
F. Der Einzelne im Wahlakt
„Bürger zweier Reiche“,318 die jeweils von unterschiedlichen Prinzipien geprägt sind. Nach diesen Prinzipien sind auch die beiden unterschiedlichen Status geprägt, in denen er sich befindet. Diese Unterschiedlichkeit der Status ergibt sich bei allen Personen, die auch in der staatlichen Sphäre tätig sind. Hieran ändert nichts, dass der Bürger gerade als Person und nicht aufgrund von Wahl oder Benennung wegen bestimmter Kriterien in die staatliche Sphäre aufgenommen wird. Denn dies bezieht sich nur auf seine Bestellung als Teil des Staatsorgans Volk. Sein Eintreten in die staatliche Sphäre erfordert dennoch die Unterscheidung der Sphären in seiner Person. Die Unterscheidung der beiden Sphären besteht auch beim Abgeordneten, dessen verfassungsrechtlicher Status stark von seiner Individualität geprägt ist.319 Es sind hier Tendenzen zu erkennen, die Unterscheidung zwischen seinem Abgeordnetenstatus und seiner individuellen, grundrechtlich geschützten Sphäre zu vermischen.320 Diese werden besonders deutlich im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Abgeordnetengesetz.321 Das Bundesverfassungsgericht hatte die Frage zu beurteilen, ob die geänderten Vorschriften des Abgeordnetengesetzes sowie die Verhaltensregeln des Bundestages, die den verfassungsrechtlichen Status der Abgeordneten näher ausgestalten, mit eben diesem verfassungsrechtlichen Status des Abgeordneten vereinbar sind.322 Die Regelungen stellten im Wesentlichen zum einen die Ausübung des Mandats in den Mittelpunkt der Tätigkeit des Abgeordneten, zum anderen normierten sie eine Anzeigepflicht für Tätigkeiten, die vor oder während des Mandats ausgeübt wurden, sowie über die Höhe der hieraus erzielten Einkünfte. Abgeordnete verschiedener Fraktionen rügten die Verletzung ihres verfassungsrechtlichen Status aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 und Art. 48 Abs. 2 GG, hilfsweise eine Verletzung ihrer Grundrechte durch die Regelungen. Die Entscheidung spaltete den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts in der Frage, inwieweit der grundrechtliche und der verfassungsrechtliche Status des Abgeordneten nicht nur nebeneinander bestehen, sondern miteinander verflochten 318
J. Isensee, Grundrechte und Demokratie, Der Staat 20 (1981), S. 161 (166). Zur Abgrenzung des Volkes von der Gesellschaft, die die zwei Reiche bilden, in denen der Bürger lebt, siehe oben in Abschnitt E. V., S. 129 ff. 319 Siehe hierzu oben in Abschnitt F. III. 1., S. 185 ff. 320 In diese Richtung geht das Zugeständnis des BVerfG an Abgeordnete, ihre organschaftlichen Rechte dann, wenn sie mangels tauglichem Antragsgegner nicht im Organstreitverfahren geltend gemacht werden können, im Wege der Verfassungsbeschwerde zu verteidigen: BVerfGE 108, 251 (266 f.) – Beschlagenahme in Abgeordnetenbüro, Urteil vom 30. 7. 2003. 321 BVerfGE 118, 277 – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007; in diese Richtung auch K. Abmeier, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten, 1984, S. 67 f.: Die Freiheit des Abgeordneten weise Parallelen zum grundrechtlichen „status negativus“ auf. Es zeige sich die „Verbindung gesellschaftlicher Freiheit mit öffentlicher Verantwortung“, so W. Leisner, Öffentliches Amt und Berufsfreiheit, AöR 93 (1968), S. 161 (167 Fn. 2). 322 BVerfGE 118, 277 (281) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007.
VII. Grundrechtlicher und staatsrechtlicher Status beim Wähler
239
seien.323 Die eine Hälfte des Senats war der Ansicht, dass im Status des Abgeordneten auch dessen individuelle Interessen berücksichtiget werden müssten, so dass auch die Grundrechte der Abgeordneten bei der Ausgestaltung ihres verfassungsrechtlichen Status zu berücksichtigen seien und diese mitprägten. Demgegenüber sah die andere Hälfte der Richter des Senats, die die Entscheidung trugen, Grundrechte der Abgeordneten für die Bestimmung des Abgeordnetenstatus nicht als maßgeblich an. Die dissentierenden Richter zeichnen damit ein Bild des Abgeordnetenstatus, das Grundrechte des Abgeordneten nicht nur berücksichtigt, sondern in sich aufnimmt. Die grundrechtliche Sphäre des Abgeordneten und seine statusrechtliche stehen nach Ansicht der dissentierenden Richter nicht – wie beim Beamten – nebeneinander, sondern verschmelzen miteinander.324 Dies wird damit begründet, dass der Abgeordnete, anders als der Beamte, nicht nebeneinander Amtsträger und Staatsbürger, sondern „innerhalb seines Amtes zugleich Staatsbürger“ sei.325 Er solle seine gesellschaftliche Verwurzelung in seine Arbeit als Abgeordneter einbringen, so dass zwischen der persönlichen und der „amtlichen“ Sphäre nicht mehr zu unterscheiden sei. Er sei so „in gleichem Gewand“ Teil der Gesellschaft und des Staates; ihm komme eine Stellung als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft zu.326 Ähnliches könnte dann in einem Erst-recht-Schluss für den Wähler angenommen werden. Seine „Bindegliedstellung“ zwischen Staat und Gesellschaft könnte ebenfalls eine Vermischung seiner grundrechtlichen Sphäre und seiner Stellung als Teil des Staatsorgans Volk zur Folge haben.327 Zu welchen Unstimmigkeiten es jedoch führt, wenn die staatliche und die gesellschaftliche Sphäre des Abgeordneten vermischt werden, zeigt sich, wenn die dissentierenden Richter zu dem Schluss kommen, dass „jeder staatliche Eingriff in 323
Ähnlich M. Cornils, Leitbilder des Abgeordneten, Jura 2009, S. 289 (291). So auch M. Cornils, Leitbilder des Abgeordneten, Jura 2009, S. 289 (292). 325 BVerfGE 118, 277 (378) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007; wobei der Begriff hier mehr im Sinne von „Bürger“, also Privatmann, verwendet wird, weil es gerade nicht um den Abgeordneten in seiner staatsbürgerlichen Stellung, das heißt seiner Stellung zum Staat geht, sondern um die Verhaftung des Abgeordneten in der gesellschaftlichen Sphäre; in diese Richtung auch T. Streit, Entscheidung in eigener Sache, 2006, S. 112 f., wenn er konstatiert, dass Abgeordnete auch eigene Interessen in das Parlament einbringen dürfen, weil sie zugleich Teil des Volkes sind. 326 BVerfGE 118, 277 (378) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007. 327 Ähnliches wird auch gerade impliziert, wenn das Wahlrecht als Individualrecht gedeutet wird. Auch hier geht es um eine Verschmelzung des Status des Citoyen mit dem des Bourgeois. Der Wahlberechtigte wird aus seiner Rolle als Staatsbürger herausgerissen und nur noch in seiner bürgerlichen Stellung betrachtet, indem das Wahlrecht der grundrechtlichen Sphäre des Einzelnen zugeordnet wird. Der Unterschied zwischen beiden Entwicklungen liegt indes darin, dass im Hinblick auf die Bürger der staatsrechtliche Status vom grundrechtlichen vollkommen überlagert wird, gleichsam selbst in ein Grundrechtsverhältnis umgedeutet wird, so dass ein staatsrechtlicher Status dahinter nicht mehr eigens in Erscheinung tritt. Beim Abgeordneten hingegen wird der staatsrechtliche Status nur um den grundrechtlichen angereichert, so dass eine verfassungsrechtliche Hybridbildung [M. Cornils, Leitbilder des Abgeordneten, Jura 2009, S. 289 (294)] entsteht. 324
240
F. Der Einzelne im Wahlakt
die Ausübung eines Berufs durch den Abgeordneten neben seinem Mandat zugleich einen Eingriff in die Freiheit des Mandats selbst dar[stelle]“,328 und sie so in der Abgeordnetensphäre grundrechtliche Wertungen aufnehmen. Auf diese Weise sichern die als Abwehrrechte gegen den Staat konzipierten Grundrechte den im staatlichen Bereich liegenden Status des Abgeordneten gegen staatliche Eingriffe ab. Dies ist zwar logische Konsequenz der Konstruktion, weil sich der Status als Abgeordneter nicht mehr von dessen grundrechtlichem Status trennen lässt. Die Grundrechte werden so allerdings zu Abwehrrechten innerhalb der Staatsorganisation umgedeutet. Dies ist aber gerade aufgrund der „Konfusion der Grundrechtswirkungen“329 nicht möglich. Der Abgeordnete ist eindeutig Teil der staatlichen Sphäre, nicht der gesellschaftlichen,330 und damit seinerseits grundrechtsverpflichtet, nicht aber als solcher grundrechtsberechtigt.331 Die Ansicht der dissentierenden Richter steht dann auch im Widerspruch zur früheren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die den verfassungsrechtlichen Status des Abgeordneten klar von seinem grundrechtlichen Status trennte.332 Diese wird auch von der anderen Hälfte des Senats konsequent fortgeführt.333 Die Ausführungen der dissentierenden Richter zum Abgeordneten zeigen zweierlei: Zum einen wird einmal mehr deutlich, dass das Amt des Abgeordneten zwar stark von seiner gesellschaftlichen Verwurzelung geprägt und nicht mit dem Amt des 328
BVerfGE 118, 277 (378) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007. M. Cornils, Leitbilder des Abgeordneten, Jura 2009, S. 289 (295). 330 Das „freie Mandat“ ist deshalb keine Grundrechtsposition, so auch W. Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, 1994, S. 49; anders aber die dissentierenden Richter in BVerfGE 118, 277 (340) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007: der Abgeordnete befände sich in einer Position zwischen dem Staat und der Gesellschaft; so auch P. Häberle, Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit des Abgeordnetenstatus, NJW 1976, S. 537 (539): der Abgeordnete erfülle „öffentliche – aber gerade nicht staatliche! – Aufgaben“; G. P. Strunk, Anmerkung: Beschluss des Zweiten Senats des BVerG vom 14. 12. 1976, DVBl. 1976, S. 615 (616), nimmt an, dass der Abgeordnete nicht Teil der staatlichen Sphäre ist. 331 H. H. von Arnim, Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten, DÖV 2007, S. 897 (902 f.); G. P. Strunk, Anmerkung: Beschluss des Zweiten Senats des BVerG vom 14. 12. 1976, DVBl. 1977, S. 615 (616), wendet sich aus diesem Grund gerade gegen die Eingliederung des Abgeordneten in die staatliche Sphäre, weil damit die Möglichkeit verschlossen werde, den Abgeordnetenstatus als eine „staatsabwehrende“, verfassungsprozessual mit der Verfassungsbeschwerde zu rügende Grundrechtsposition gegenüber dem Staatsorgan „Parlament“ zu qualifizieren. Prozessual steht jedoch das Organstreitverfahren zur Verfügung, wenn sich der Abgeordnete gegen Handlungen anderer Staatsorgane wehren möchte. 332 BVerfGE 6, 445 (448) – Mandatsverlust, Beschluss vom 14. 5. 1957, BVerfGE 94, 351 (365) – Abgeordnetenprüfung, Beschluss vom 21. 5. 1996, BVerfGE 99, 19 (29) – Gysi III, Beschluss vom 30. 06. 1998. 333 Dabei erkennt auch dieser Teil der Richterschaft an, dass individual-rechtliche Gesichtspunkte bei der einfachgesetzlichen Ausgestaltung des Abgeordnetenstatus zu berücksichtigen sind, allerdings nicht innerhalb des verfassungsrechtlichen Status. BVerfGE 118, 277 (354) – Abgeordnetengesetz, Urteil vom 4. 7. 2007. 329
VII. Grundrechtlicher und staatsrechtlicher Status beim Wähler
241
beamtenrechtlichen Typus vergleichbar ist. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass die Vermischung der beiden Status zu unhaltbaren Konsequenzen der Grundrechtsanwendung führt, so dass auch beim Abgeordneten die Unterscheidung zwischen staatlicher und Individualsphäre aufrecht zu erhalten ist. Die entstehenden Probleme sind über die Grundsätze der Geltung von Grundrechten im Näheverhältnis zu lösen,334 wonach die Grundrechte selbstverständlich neben der funktionalen Stellung weiterhin gelten und Ausgestaltungen der funktionalen Stellung einen Eingriff in die Grundrechte darstellen, der dann rechtfertigungsbedürftig ist.335 Dies wird genährt durch die Annahme, die Grenze zwischen grundrechtlichem Aktivstatus und Organkompetenz seien fließend und würden ineinander übergehen.336 Rechte sind jedoch entweder dem grundrechtlichen Bereich oder dem organschaftlich-kompetentiellen Funktionskreis zuzuordnen.337 Das Wahlrecht gehört der staatlichen Sphäre und damit dem organschaftlich-kompetentiellen Funktionskreis an. Auch im Wahlakt vereint sich der grundrechtliche Status des Bürgers nicht mit dem staatsrechtlichen; er besteht aber neben dem staatsrechtlichen Status weiter. Es besteht hier nur die Besonderheit, dass das Wahlrecht, obwohl es ein Recht der staatlichen Sphäre ist, an die Person des Wahlberechtigten gebunden ist.
334 335 336
449.
Hierzu ausführlich S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012. M. Cornils, Leitbilder des Abgeordneten, Jura 2009, S. 289 (296). H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfG-Kommentar, § 90 Rn. 36,
337 J. Isensee, Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR, Bd. IV, § 71 Rn. 133: „Staatsfunktionen und Grundrechtsfreiheit sind schlechthin inkompatibel. Die Grenzen müssen deutlich markiert und streng eingehalten werden.“
G. Prozessuale Folgen Das Ergebnis, dass das Wahlrecht ein organschaftliches Recht ist, könnte sich auch auf das Prozessrecht auswirken. Dieses ist dazu bestimmt, das materielle Recht zu realisieren, indem es dort, wo dies vom Gesetzgeber für nötig gehalten oder von der Verfassung gefordert wird, Rechtsbehelfe bereit hält, mit denen das materielle Recht durchgesetzt werden kann.1 Für den Schutz von Individualrechten stehen andere Rechtsbehelfe als für denjenigen von organschaftlichen Rechten zu Verfügung. Da sich das Wahlrecht als ein Recht des Verfassungsrechtskreises offenbart hat, kommen zur Durchsetzung dieses Rechts lediglich verfassungsrechtliche Rechtsbehelfe in Betracht.2 Im Verfassungsprozessrecht gilt dabei das Enumerationsprinzip. Die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sind auf diejenigen beschränkt, die in Art. 93 GG oder sonst im Grundgesetz aufgezählt3 oder ihm durch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ausdrücklich zugewiesen sind.4 Eine Generalklausel, die entsprechend § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten verfassungsrechtlicher Art dem Bundesverfassungsgericht zuweisen würde, gibt es gerade nicht.5
1 E. Benda/E. Klein/O. Klein, Verfassungsprozessrecht, § 1 Rn. 34 f., S. 16 f.; E. Klein, Verfassungsprozeßrecht, AöR 108 (1983), S. 560 (562 ff.); ders., Zur objektiven Funktion der Verfassungsbeschwerde, DÖV 1982, S. 797 (805); A. Kollmann, Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht, 1996, S. 659. Nach F. Schorkopf, Die prozessuale Steuerung des Verfassungsrechtsschutzes, AöR 130 (2005), S. 465 (475), stehen Verfassungsprozessrecht und materielles Recht jedoch „in einem Verhältnis der Gleichordnung mit wechselseitigen Bezug- und Einflußnahmen“. 2 Lediglich der Grundsatz der allgemeinen Wahl enthält ausschließlich – wie oben in Abschnitt F. IV. 5., S. 206 ff., gezeigt – ein Individualrecht, bei dessen Schutz über den Verwaltungsrechtsweg nachgedacht werden könnte. 3 Dies ergibt sich aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG. 4 T. Maunz, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 33. Lfg. (Stand: Nov. 1997), Bd. VI, Art. 93 Rn. 1. 5 Bisweilen werden die Verfahren jedoch zur Durchsetzung von Rechten für zulässig gehalten, auf die sie nicht zugeschnitten sind. So eröffnet das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde dem Abgeordneten, der sein Zeugnisverweigerungsrecht nur deshalb nicht im Organstreitverfahren durchsetzen kann, weil kein tauglicher Antragsgegner zur Verfügung steht. BVerfGE, 108, 251 (251) – Abgeordnetenbüro, Urteil vom 30. 7. 2003.: „Soweit ein Abgeordneter die Verletzung eines Rechts, das sich aus seinem Status ergibt, in keinem anderen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geltend machen kann, ist die Verfassungsbeschwerde eröffnet.“
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
243
Es sollen im Folgenden die verfassungsgerichtlichen Verfahren, die im Wahlrecht für einschlägig gehalten werden, darauf untersucht werden, welche Rechtspositionen sie tatsächlich durchsetzen. Auf dieser Grundlage werden die Verfahren dann auf ihre Geeignetheit zum Schutz des Wahlrechts überprüft. Gegebenenfalls sollen dann andere verfassungsgerichtliche Verfahren vorgeschlagen werden, die der Rechtsnatur des Wahlrechts besser gerecht werden.
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten In Wahlrechtsangelegenheiten werden zwei unterschiedliche verfassungsgerichtliche Verfahren, die unterschiedliche Verfahrenszwecke verfolgen, für einschlägig gehalten. Zum einen ist im Wahlrecht die Wahlprüfungsbeschwerde nach Art. 41 GG vorgesehen. Ihr Hauptzweck liegt in der Überprüfung der Richtigkeit des Wahlergebnisses und der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag.6 Sie ist ex post einschlägig bei Verfahrensakten, die unmittelbar das Wahlverfahren betreffen, wie z. B die Eintragung in das Wählerverzeichnis, die Zurückweisung von Wahlvorschlägen und die Feststellung des Wahlergebnisses.7 Geht es hingegen um staatliche Akte, die sich nicht unmittelbar auf die Wahl beziehen, wird zum anderen bei einer Verletzung des Wahlrechts die Verfassungsbeschwerde gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG für statthaft gehalten.8 Dies ist insbesondere bei Wahlgesetzen der Fall,9 weil es sich hierbei um abstrakt-generelle Regelungen handelt, die sich nicht unmittelbar auf Wahlverfahren beziehen.
1. Die Wahlprüfungsbeschwerde Die Wahlprüfungsbeschwerde ist damit ein spezielles Verfahren in Wahlrechtsangelegenheiten. Zweck der Wahlprüfungsbeschwerde ist10 es nach herrschender Meinung, die richtige, d. h. mit dem Wählerwillen im Einklang stehende, Zusam6 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013) Bd. IV § 41 Rn. 43; W. Löwer, Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts, in HStR III, 2005, § 70 Rn. 159. 7 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 49, Rn. 2, 4. 8 Nach § 49 BWahlG können Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit den im Bundeswahlgesetz und in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen und im Wahlprüfungsverfahren angefochten werden. 9 W. Roth, Zur Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, S. 214 (214). 10 Dies war bis zur Änderung des Wahlprüfungsgesetzes vom 12. 07. 2012 ihr einziger Zweck. Hierzu sogleich in Abschnitt G. I. 1. b), S. 246.
244
G. Prozessuale Folgen
mensetzung des Bundestages zu gewährleisten.11 Dies wird auch als objektive Funktion des Verfahrens beschrieben.12 a) Die Wahlprüfungsbeschwerde bis zum „Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen“ Die Wahlprüfung ist ein zweistufiges Verfahren. Sie ist aus historischer Tradition zunächst ein Eigenprüfungsrecht des Parlaments.13 Ursprünglich war sie nur formelle Legitimations- und Mandatsprüfung der Abgeordneten, so dass die Prüfung der Richtigkeit des Wahlablaufs hier nur Vorfrage war, während die Richtigkeit des hieraus resultierenden Wahlergebnisses die eigentliche Frage war.14 Gemäß Art. 41 Abs. 1 GG ist sie weiterhin zunächst Sache Bundestages. Erst gegen dessen Entscheidung ist gemäß Art. 41 Abs. 2 GG die Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht zulässig; erst im zweiten Schritt wird die Wahlprüfungsbeschwerde also zum verfassungsgerichtlichen Verfahren.15 Im Grundgesetz nicht näher festgelegt ist indes der Inhalt der Wahlprüfung.16 Der Bundestag und im Folgenden das Bundesverfassungsgericht überprüfen die Richtigkeit der Wahl, indem sie feststellen, ob während des gesamten Wahlablaufes Wahlfehler, also Verstöße gegen das formelle und das materielle Wahlrecht, aufgetreten sind.17 Ist infolge solcher Fehler das Wahlergebnis falsch und können sich diese Fehler auf die Zusammensetzung des Bundestages ausgewirkt haben, kann die Wahl für ungültig erklärt werden.18 Es gibt jedoch keine absoluten Nichtigkeitsgründe für die Wahl.19 Im Wahlprüfungsverfahren werden zwei gegensätzliche Grundsätze zum Ausgleich gebracht,20 die beide im Demokratieprinzip wurzeln. Zum einen gebietet das 11 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013) Bd. IV, § 41 Rn. 43; Kretschmer, in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht, § 13, Rn. 1; N. Achterberg/ M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Bd. II, Art. 41 Abs. 1 Rn. 4. 12 H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. I, Art. 19, Rn. 40, N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 41 Abs. 1 Rn. 10. 13 H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 34; J. Ruszoly, Wahlprüfung in Europa, Der Staat 21 (1982), S. 203 (206 f.); R. Grawert, Normenkontrolle im Wahlprüfungsverfahren, DÖV 1968, S. 748 (748 f.). 14 M. Schröder, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts, 1979, S. 190; R. Grawert, Normenkontrolle im Wahlprüfungsverfahren, DÖV 1968, S. 748 (750 f.). 15 § 18 WahlprüfG, §§ 13 Nr. 3, 48 BVerfGG. 16 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Bd. II, Art. 41 Abs. 1 Rn. 4. 17 H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 28. 18 § 1 WahlprüfG. 19 H Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 29; N. Achterberg, Parlamentsrecht, S. 189; H. Schmitt-Vockenhausen, Die Wahlprüfung in Bund und Ländern, 1969, S. 25. 20 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013) Bd. IV; § 41 Rn. 106.
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
245
Demokratieprinzip, dass das Wahlergebnis dem Volkswillen21 entspricht, zum anderen fordert es, dass das vom Volk gewählte Parlament Bestand hat.22 Das Demokratieprinzip beinhaltet zudem nicht nur, dass Wahlen überhaupt stattfinden, sondern auch, dass sie nicht hinausgezögert werden.23 Da auch am Bestand des gewählten Parlaments ein dem Demokratieprinzip entspringendes Interesse besteht, kann ein Wahlfehler nur dann zur Ungültigkeit der Wahl und infolgedessen zu Neuwahlen führen, wenn Gesetzesverletzungen auf das Wahlergebnis, das sich in der Mandatsverteilung spiegelt,24 jedenfalls potentiell Einfluss gehabt haben können. Die Notwendigkeit der sogenannten „Mandatsrelevanz“25 des Wahlfehlers im Wahlprüfungsverfahren resultiert aus dieser konfligierenden Interessenlage. Die Rechtsnatur der Wahlprüfung ist hingegen ungeklärt.26 So ist fraglich, ob es sich um ein „Rechtsmittel“27, einen „außerordentlichen Rechtsbehelf, der von seiner Zielsetzung der Anfechtungsklage nachgebildet ist“28 oder um „ein Rechtsinstitut eigener Art“ handelt. Jedenfalls aber ist sie keine politische Entscheidung, sondern eine reine Rechtsprüfung.29 Ihr Verfahrenszweck wurde bis zu ihrer Änderung überwiegend als rein objektiv beschrieben, weil nur die Richtigkeit des Wahlergebnisses festgestellt werden sollte.30 21
Hier von der Abbildung des „Wählerwillens“ zu sprechen, ist irreführend, weil es nicht nur der Wille der Wähler ist, der sich im Wahlergebnis und der daraus ergebenden Mandatsverteilung niederschlägt, sondern der Wille aller Wahlberechtigten, der Aktivbürgerschaft. Denn auch diejenigen, die nicht gewählt haben, bekunden damit den Willen, dass die Mandate nach den Stimmen der Wählenden verteilt werden sollen. 22 BVerfGE 89, 243 (253) – Beschluss vom 23. 10. 1993. 23 T. Hüfler, Wahlfehler und ihre materielle Würdigung, S. 27. 24 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 49, Rn. 13. 25 W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 49, Rn. 14; auch „Erheblichkeitsgrundsatz“ genannt: W. Löwer, Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts, in HStR III, 2005, § 70 Rn. 159. 26 H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 34. 27 Storost, in: Umbach/Clemens, BVerfGG, § 48, Rn. 20; Schmidt-Bleibtreu, in: Maunz, BVerfGG, § 48, Rn. 25. 28 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Bd. II, Art. 41 Abs. 1 Rn. 54. 29 B. Schmidt-Bleibtreu, in: Maunz/ders./Klein/Bethge, BVerfGG-Kommentar, § 48, Rn. 25; F. Ossenbühl, Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen, in: Festschrift 25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (477). 30 BVerfGE 4, 370 (372) – Mandatsrelevanz, Beschluss vom 21. 12. 1955; BVerfGE 22, 270 (280), BVerfGE 79, 173; BVerfGE 103, 111 (134) – Wahlprüfung Hessen, Urteil vom 8. 2. 2001: Die Wahlprüfungsbeschwerde soll die „richtige, mit dem Wählerwillen in Einklang stehende Zusammensetzung des Bundestages gewährleisten“. A. A. H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, S. 182 f., der bereits vor der Änderung der Wahlprüfungsbeschwerde auch das „subjektive Wahlrecht“ von der Wahlprüfungsbeschwerde geschützt sah. Verletzungen des subjektiven Wahlrechts führten zwar nicht zur Ungültigkeit der Wahl, seien aber im Wahlprüfungsverfahren festzustellen. Ebenso K.-H. Seifert, Gedanken zu einer Reform
246
G. Prozessuale Folgen
Durch die Verfolgung dieses „objektiven Zwecks“ der Wahlprüfungsbeschwerde – die Richtigkeit des Wahlergebnisses und die dementsprechende Besetzung des Parlaments – wird jedoch gerade das Recht des Volkes auf eine seinem Willen entsprechende Zusammensetzung des Bundestages verwirklicht. Das Volk hat – wie oben gesehen – aufgrund seiner Kompetenz, den Bundestag zu wählen, ein Recht darauf, dass sein Wille auch verwirklicht wird und der Bundestag sich tatsächlich seinem Willen entsprechend zusammensetzt.31 Mit der Feststellung, dass das Wahlergebnis unrichtig ist, wird stets zugleich eine Verletzung des Rechts des Volkes auf ein richtiges Wahlergebnis festgestellt. Daraus ergibt sich, dass das Wahlprüfungsverfahren faktisch, indem es die objektive Richtigkeit des Wahlergebnisses sicherstellen soll, gerade das Recht des Volkes an einem richtigen Wahlergebnis verwirklicht. b) Kritik der Literatur am Verfahrensgegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde Gegen den eingeschränkten Verfahrenszweck der Wahlprüfung und der damit einhergehenden ausschließlichen Feststellung mandatsrelevanter Wahlfehler im Wahlprüfungsverfahren wurde jedoch in der Literatur Kritik laut. 32 Durch die angenommene Spezialität der Wahlprüfungsbeschwerde und der anderen im Bundeswahlgesetz gegebenen Rechtsbehelfe gegenüber der Verfassungsbeschwerde und anderen Rechtsbehelfen bei Verfahrensakten, die sich unmittelbar auf die Bundestagswahl beziehen, hätte sich eine Lücke im Rechtschutz des subjektiven Wahlrechts ergeben, die mit der Forderung eines effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG nicht zu vereinbaren sei.33 Der Kritik liegt die in der Literatur und in der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung verbreitete Annahme34 zugrunde, dass
des Wahlprüfungsrechts, DÖV 1967, S. 231 (236), der auch hervorhebt, dass der Verfahrenszweck nicht nur die Richtigkeit des Wahlergebnisses, sondern des gesamten Wahlablaufs sei. 31 Siehe hierzu oben in Abschnitt E. X., S. 172 ff. 32 R. Grawert, Normenkontrolle im Wahlprüfungsverfahren, DÖV 1968, S. 748 (750), K.-H. Seifert, Gedanken zu einer Reform des Wahlprüfungsrechts, DÖV 1967, S. 231 (235). 33 G. Roth, Subjektiver Wahlrechtsschutz und seine Beschränkungen durch das Wahlprüfungsverfahren, in: Festgabe für Graßhof, S. 53 (57 f.); H. Meyer, Der Überhang und anderes unterhaltsame aus Anlaß der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 (353), W. R. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2440 f.). Besonders bemängelt wurden stets die mangelnden Rechtsschutzmöglichkeiten für Wahlbewerber, im Vorfeld der Wahl gegen die Nichtzulassung vorzugehen. Diese sind mit dem Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1501) deutlich erweitert worden. Keinen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG sieht indes W. Schreiber, BWahlGKommentar, § 49 Rn. 4. 34 Hierzu oben in Abschnitt D., S. 56 ff.
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
247
das Wahlrecht ein Individualrecht sei, das aufgrund der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG umfassend prozessual zu schützen sei.35 c) Änderungen der Wahlprüfungsbeschwerde vom 12. 07. 2012 Das auf diese Kritik hin erlassene Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. 07. 201236 dehnte den ursprünglich objektiven Verfahrenszweck der Wahlprüfungsbeschwerde auf den Schutz des „subjektiven Wahlrechts“ aus,37 so dass das Verfahren nun auch dem Rechtsschutz des Einzelnen zu dienen bestimmt ist. Schon vor der Änderung wurde bisweilen vertreten, dass die Wahlprüfungsbeschwerde einen doppelfunktionalen Verfahrenszweck habe und neben dem objektiven Wahlrecht jedenfalls mittelbar auch das subjektive Wahlrecht des Einzelnen geschützt werden solle.38 Während bis zur Änderung des Verfahrenszweckes der Wahlprüfungsbeschwerde ihr Erfolg von der Mandatsrelevanz des Wahlfehlers abhing, ist der Wahlprüfungsbeschwerde nun auch Erfolg beschieden, wenn eine Verletzung des Wahlrechts des Einzelnen vorliegt. Eine solche Verletzung wird dann angenommen, wenn Rechte einzelner Wähler durch staatliche Akte verletzt werden. Sie wird insbesondere darin gesehen, dass einzelne Wahlberechtigte nicht zur Wahl zugelassen werden. Während allerdings ein mandatsrelevanter Wahlfehler zur Ungültigkeit der Wahl führen kann, führt die Verletzung des Rechts eines Einzelnen lediglich zu deren Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht im Wahlprüfungsverfahren. Die Wahlprüfungsbeschwerde ähnelt in diesem Fall einer Feststellungsklage, wie sie das Verwaltungsrecht kennt. Auf andere Weise als vom Gesetzgeber intendiert eignet sich die Wahlprüfungsbeschwerde auch mit ihrem erweiterten Verfahrenszweck zum Schutz des Wahlrechts; dieser sollte deshalb beibehalten werden. Dass daneben auch subjektive Rechtsverletzungen und damit nicht mandatsrelevante Wahlfehler festgestellt werden, ist unschädlich, auch wenn es sich dabei um die Feststellung der Verletzung organschaftlicher Rechte und nicht der individueller Rechte handelt.39 35 Es gab jedoch auch Stimmen in der Literatur, die das Wahlrecht zwar als Individualrecht ansahen, die Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses jedweden Individualrechtsschutzes aber durch die Spezialität des Wahlprüfungsverfahrens nach Art. 41 GG vor Art. 19 Abs. 4 zu begründen versuchten. So z. B. W. Keitz, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG, S. 109. 36 BGBl. I S. 1501. 37 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zum Gesetzesentwurf zur Verbesserung des subjektiven Rechtsschutzes in Wahlsachen, BT-Drucks 17/9733, S. 5 f. 38 Z. B. von H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997, S. 329. 39 Hierzu sogleich in diesem Abschnitt unter G. II. 2., S. 268 ff.
248
G. Prozessuale Folgen
2. Die Verfassungsbeschwerde als Rechtsbehelf in Wahlrechtsfragen Wird das Wahlrecht des Einzelnen durch nicht unmittelbar auf das Wahlverfahren bezogene Akte verletzt, wird die Verfassungsbeschwerde als einschlägig erachtet, weil Art. 38 GG, in dem das subjektive Wahlrecht normativ verortet wird,40 im Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG aufgezählt ist. Die Verfassungsbeschwerde ist der spezifische Rechtsbehelf des Bürgers gegen den Staat.41 Sie kann von jedermann mit der Behauptung erhoben werden, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Sie ist damit ein Instrument des Individualrechtsschutzes.42 Zwar dient sie sekundär auch dem Schutz des objektiven Rechts,43 primär jedoch ist sie dem Schutz subjektiver Individualrechte zu dienen bestimmt, die stets der Ausgangspunkt und der Anlass des Verfahrens sind.44 Sie ist damit der Individualrechtsbehelf des Bürgers schlechthin. Während die Wahlprüfungsbeschwerde also primär darauf gerichtet ist, das Gesamtergebnis der Wahl und die richtige Zusammensetzung des Bundestages zu überprüfen, knüpft die Verfassungsbeschwerde an Rechte Einzelner an. Sie ist dazu bestimmt, die Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten des Einzelnen durch Akte der öffentlichen Gewalt zu rügen und zu verhindern.45 Wird aus der Aufzählung des Art. 38 GG im Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte der Schluss gezogen, dass das Recht zu wählen selbst gemeint ist, wird das Wahlrecht selbst zum Recht, das mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden kann. Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass der individual-rechtliche Gehalt jeder Regelung des Art. 38 GG gesondert nachgewiesen werden muss und dem Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG ausdrücklich kein individual-rechtlicher Gehalt beigemessen wird,46
40
Innerhalb des Art. 38 GG wird es jedoch uneinheitlich verortet. Siehe hierzu oben in Abschnitt D. III., S. 71 f. 41 BVerfGE 4, 27 (30) – Klagebefugnis politischer Parteien, Plenumsbeschluss vom 20. 7. 1954; BVerfGE 6, 445 – Mandatsverlust, Beschluss vom 14. 5. 1957; ähnlich BVerfGE 96, 231 (239) – Müllkonzept, Beschluss vom 9. 7. 1997. 42 C. Gusy, Die Verfassungsbeschwerde, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. 1, S. 641 (644); H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGGKommentar, 42. Lfg. (Stand: Okt. 2013) § 90 Rn. 38. 43 BVerfGE 45, 63 (74) – Stadtwerke Hameln; E. Klein, Zur objektiven Funktion der Verfassungsbeschwerde, DÖV 1982, S. 797 (805). 44 E. Benda/E. Klein/O. Klein, Verfassungsprozessrecht, § 19 Rn. 432 f. 45 R. Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2013, Rn. 379, S. 124 f.; M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 470, S. 138. 46 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 68. Lfg. (Stand: Jan. 2013), Bd. IV, Art. 38 Rn. 183.
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
249
werden das Wahlrecht und überwiegend auch die Wahlgrundsätze47 als mit der Verfassungsbeschwerde rügefähig angesehen.48 Die Verfassungsbeschwerde wird damit nicht nur zum Rechtsbehelf zum Schutz der „eigentlichen […] Grundrechte“, sondern auch der „politischen Rechte des Aktivstatus“.49 a) Die Verfassungsbeschwerde als „Popularklage“ in Wahlrechtsfragen Die Besonderheiten des Wahlrechts treten dann, wenn es mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden soll, offen zutage. Der Einzelne wird durch die Möglichkeit, Wahlrechtsverletzungen mit der Verfassungsbeschwerde geltend zu machen, in die Lage versetzt, Rechte zu verteidigen, die nicht nur ihm, sondern auch allen anderen Wahlberechtigten zustehen. Weil sich die Verfassungsbeschwerde in Wahlrechtsfragen gerade auf Gesetze und damit auf abstrakt-generelle Regelungen erstreckt, wird der Einzelne ohnehin mehr zum Verteidiger der objektiven Rechtsordnung denn zum Verfechter eigener Rechte. Dies offenbart sich insbesondere in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Übertragung von Hoheitsrechten der Bundesrepublik Deutschland auf supranationale Einrichtungen.50 Gegen Übertragungsakte von Kompetenzen auf die Europäische Union und andere supranationale Einrichtungen wurde prozessual das Verfassungsbeschwerdeverfahren eröffnet, indem das „Wahlrecht aus Art. 38 (Abs. 1 S. 1) GG“ der Beschwerdeführer als verletzt gesehen wurde. Hierzu war zwar eine materielle Anreicherung des Rechts aus Art. 38 GG notwendig,51 dennoch blieb Art. 38 GG i. V. m. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG das prozessuale Einfallstor für „Integrationsverfassungsbeschwerden“52, in denen es primär nicht um das Recht zu wählen ging, sondern um weite Gehalte der Staatlichkeit, die
47 Damit wird alles, was als Gegenstand des „subjektiven Wahlrechts“ gesehen wird, zum tauglichen Gegenstand der Verfassungsbeschwerde. 48 Dies entspricht der materiell-rechtlichen Annahme, die Wahlgrundsätze seien subjektive Rechte. Hierzu oben unter D. IV. 2., S. 75 ff. 49 So ausdrücklich BVerfGE 4, 27 (30) – Klagebefugnis politischer Parteien, Plenumsbeschluss vom 20. 7. 1954. 50 BVerfGE 89, 155 – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993, BVerfGE 97, 350 – Euroeinführung, Beschluss vom 31. 3. 1998; BVerfGE 123, 267 Lissabon – Urteil vom 30. 6. 2009; BVerfGE 129, 124 – EFS, Beschluss vom 7. 9. 2011. 51 U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (433); M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 162 f., sieht hierin jedoch keine Erweiterung des Gewährleistungsgehalts des Wahlrechts, sondern eine Erweiterung des Eingriffsbegriffs. 52 Der Begriff stammt von R. Lehner, Die Integrationsverfassungsbeschwerde nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 52 (2013), S. 535 f.; E. Peuker, Die demokratische Auslegung des Völkerrechts, EuR 2013, S. 75 (78), spricht von „Wahlrechtsverfassungsbeschwerde[n]“.
250
G. Prozessuale Folgen
das Bundesverfassungsgericht dem Art. 38 GG in Verbindung mit anderen Normen entnommen hatte.53 Schon materiell stieß diese Auslegung des Art. 38 GG auf scharfe Kritik,54 prozessual jedoch wurde ihr der Vorwurf gemacht, die (Quasi-)Popularklage einzuführen.55 „Quivis ex populo“ werde in die Lage versetzt, als „verfassungsprozessualer Hüter“ der europäischen Demokratie zu fungieren.56 Der hierin liegende Vorwurf an das Bundesverfassungsgericht ist allerdings nur insoweit berechtigt, wie die materielle Anknüpfung der behaupteten Rechte an Art. 38 GG falsch ist.57 Der prozessuale Vorwurf jedoch müsste sich richtigerweise an den verfassungsändernden Gesetzgeber richten, der den Art. 38 GG in den Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte aufgenommen hat. Denn durch die prozessuale Möglichkeit des Einzelnen, Verletzungen des Wahlrechts zu rügen, wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, Rechte zu rügen, die nicht nur ihm zustehen, sondern meist allen Wahlberechtigten und damit einem signifikanten Teil des Gesamtvolkes. Meist sind nämlich auch die Rechte der anderen Wahlberechtigten verletzt, wenn der einzelne Wähler sich im Verfassungsbeschwerdeverfahren auf Art. 38 GG beruft, weil in diesem Verfahren eben nicht Einzelakte, die sich auf das Wahlverfahren beziehen, gerügt werden – hierfür steht, wie gesehen, das Wahlprüfungsverfahren zur Verfügung58 –, sondern Gesetze, die andere Wahlberechtigte gleichermaßen betreffen.59 Der Einzelne wird damit durch auf Art. 38 GG gestützte Verfassungsbeschwerden zum Hüter auch fremder Rechte und zugleich – weil er sich gegen Gesetze wendet – der objektiven Rechtsordnung.60 53 BVerfGE 89, 155 (171 f.) – Maastricht, Urteil vom 12. 10. 1993, BVerfGE 135, 317 (385) – ESM-Vertrag und Fiskalpakt, Urteil vom 12. 9. 2012: Recht auf dauerhafte Haushaltsautonomie des Bundestages aus Art. 38 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 und 3 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG; BVerfGE 129, 124 (169) – ESFS, Beschluss vom 7. 9. 2011. 54 Siehe für die Anreicherung des Rechts aus Art. 38 GG im Maastricht-Urteil U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (433); zum Lissabon-Urteil M. Jestaedt, Warum in die Ferne schweifen, wenn der Maßstab liegt so nah?, Der Staat 48 (2009), S. 497 (503 f.). 55 R. Lehner, Die Integrationsverfassungsbeschwerde nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 52 (2013), S. 535 (545); C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen Demokratiedefizit und Bundesstaatsverbot, Der Staat 48 (2009), S. 535 (540): „faktisch[e] Popularklage“; E. Benda/E. Klein/O. Klein, Verfassungsprozessrecht, § 19 Rn. 565. 56 C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen Demokratiedefizit und Bundesstaatsverbot, Der Staat 48 (2009), S. 535 (540). 57 So auch H. Grefrath, Exposé eines Verfassungsprozessrechts von den Letztfragen?, AöR 135 (2010), S. 221 (241): „Wenn man die materielle Deutung des Wahlrechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG als möglich erachtet, sind prozessualrechtliche Einwände der Schaffung einer angeblichen actio popularis präkludiert.“ 58 Siehe hierzu oben in diesem Abschnitt unter G. I. 1., S. 243 ff. 59 Nur dann, wenn Ungleichbehandlungen vorliegen, sind gerade nicht alle Wahlberechtigten betroffen. Zu dieser Problematik sogleich in diesem Abschnitt unter G. I. 2. b), S. 252. 60 Darauf, dass dieser „Kunstgriff“, über die Ausweitung von klagefähigen Individualrechten die objektive Rechtsordnung zu stärken, ursprünglich vom EuGH stammt, weisen
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
251
Um Popularklagen auszuschließen, besteht im Verfassungsbeschwerdeverfahren das Erfordernis der Beschwerdebefugnis, mit dem der weite Kreis der möglichen Beschwerdeberechtigten auf diejenigen verengt wird, die in ihren eigenen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt sind.61 Die Geltendmachung fremder Rechte im eigenen Namen ist hingegen im Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht möglich.62 Der Antragsteller muss vielmehr selbst, gegenwärtig und unmittelbar in einem seiner Grund- oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt sein.63 Eine Selbstbetroffenheit liegt dabei vor, wenn der Beschwerdeführer Adressat des Aktes der öffentlichen Gewalt ist, gegen den er die Verfassungsbeschwerde richtet. Dem Einzelnen wird hier mit der Zusicherung des Wahlrechts als verfassungsbeschwerdefähiges Recht ein prozessual durchsetzbares Recht verschafft, in dem er dann – neben vielen anderen – selbst betroffen ist. Das Ausschlusskriterium der Selbstbetroffenheit versagt in diesem Fall. Auf das Wahlrecht gestützten Verfassungsbeschwerden wohnt der Charakter der „Popularklage“64 damit bereits inne.65
K. F. Gärditz/C. Hillgruber, Volkssouveränität ernst genommen – Zum Lissabonurteil des BVerfG, JZ 2009, S. 872 (873), hin. Grundlegend hierzu J. Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997. 61 BVerfGE 43, 291 (385 f.) – Numerus clausus II, Urteil vom 8. 2. 1977; BVerfGE 60, 360 (371) – Beitragsfreie Krankenversicherung, Beschluss vom 18. 2. 1982; S. Ruppert, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG-Kommentar, § 90 Rn. 52, 79. 62 Zur Möglichkeit der Prozessstandschaft im Verfassungsbeschwerdeverfahren R. Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2013, Rn. 666 f., S. 226 f.; M. Cornils, Prozeßstandschaft im Verfassungsbeschwerdeverfahren, AöR 125 (2000), S. 45 (57 f.). 63 Erstmals BVerfGE 1, 97 (101 f.) – Hinterbliebenenrente, Beschluss vom 19. 12. 1951. 64 Dass hier jedoch das Kriterium der Selbstbetroffenheit eingehalten wird, heben H.-J. Cremer, Rügbarkeit demokratiewidriger Kompetenzverschiebungen im Wege der Verfassungsbeschwerde?, NJ 1995, S. 5 (7), und H. Grefrath, Exposé eines Verfassungsprozessrechts von den Letztfragen?, AöR 135 (2010), S. 221 (241), hervor. Es handelt sich deshalb dabei nicht um eine Popularklage im eigentlichen Sinne. Dies wenden auch M. Soppe, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 231, und A. Wolf, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils, 1999, S. 39, ein. Zur Popularklage: B. Bohn, Das Verfassungsprozessrecht der Popularklage, 2012. 65 So auch A. Wolf, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils, 1999, S. 39. Dass auch C. Schönberger, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie, zur Entgrenzung von Art. 38 GG im Europaverfassungsrecht, JZ 2010, S. 1160 (1161), eigentlich nur die materielle Anreicherung des Wahlrechts, nicht aber die „Ausweitung“ zur Popularklage beklagt, offenbart sich in dem Satz: „Die Umdeutung von Art. 38 GG zur Popularklage besteht gerade darin, dass der Bürger hier mehr und anderes verlangen können soll als die Teilnahme an einer ordnungsgemäßen Bundestagswahl.“ Wie sich aber aus einer materiellen Anreicherung eine prozessuale Umdeutung ergeben soll, bleibt unklar. Der Satz erhellt sich nur, wenn Kritik an der materiellen Anreicherung des Wahlrechts unterstellt wird, die dann das prozessuale Schicksal des materiellen „Grundgehalts“ teilt.
252
G. Prozessuale Folgen
Dass ein Individuum nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen in Rechten betroffen ist, schließt zwar die Verletzung von Individualrechten nicht aus,66 vielmehr ist diese gleichzeitige „Mitbetroffenheit“ anderer Rechtsträger bei Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze ein generelles Phänomen.67 Oftmas ist der Adressatenkreis von Gesetzen jedoch begrenzt.68 Auch durch Gesetze, die zwar einen sehr weiten Adressatenkreis haben, wie etwa durch das Einkommenssteuergesetz, werden die Normadressaten aber in unterschiedlicher Weise betroffen und jeder aufgrund der Erfüllung individueller Kriterien, die jeder Betroffene – mehr oder weniger zufällig – erfüllt. Im Wahlrecht hingegen ist die gemeinsame Betroffenheit nicht zufällig,69 sie resultiert vielmehr daraus, dass alle Betroffenen zur Aktivbürgerschaft gehören und ihre Betroffenheit dieser Zugehörigkeit entspringt. Die einzelnen Wahlberechtigten sind tatsächlich nicht einzeln, sondern gerade zusammen betroffen. Auch wenn die Aktivbürgerschaft in ihrem Bestand von den einzelnen Wahlberechtigten abhängig ist,70 leiten diese ihr Wahlrecht und damit ihre eigene Betroffenheit von ihrer Zugehörigkeit zu dieser ab. b) Weitere Friktionen Darüber hinaus lässt sich durch Regelungen, die die Wahlgleichheit betreffen, aber erst nach der Wahl Bedeutung erlangen, – wie oben gezeigt71 – nicht feststellen, wer von einer Regelung negativ betroffen sein wird. Aus der Ex-ante-Perspektive, aus der heraus über eine gegen Wahlgesetze gerichtete Verfassungsbeschwerde stets zu entscheiden ist, ist vielmehr jeder Wahlberechtigte potentiell betroffen, weil er immer zu der benachteiligten Wählergruppe gehören kann. Ob er dann tatsächlich selbst betroffen ist, ist hingegen ungewiss.72 66 R. Alexy, Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, Der Staat 29 (1990), S. 49 (66). Anders aber F. Ossenbühl, Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts, DÖV 1981, S. 1 (7). 67 K. A. Bettermann, Zur Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze, AöR 86 (1961), S. 129 (180). 68 K. A. Bettermann, Zur Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze, AöR 86 (1961), S. 129 (180). 69 So waren beispielsweise durch das Volkszählungsgesetz vom 25. März 1982 (BGBl. I S. 369) auch alle Bürger betroffen, jedoch waren sie nicht durch ihre Zugehörigkeit zur Aktivbürgerschaft miteinander verbunden, sondern in ihrer Eigenschaft als Herrschaftsunterworfene und damit einzeln betroffen. Das Bundesverfassungsgericht leitete aus diesem Anlass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung her: BVerfGE 65, 1 – Volkszählung, Urteil vom 15. 12. 1983. 70 Siehe hierzu oben in Abschnitt E. IX. 3., S. 170 f. 71 Siehe oben unter D. VIII. 3., S. 105 f. 72 Auch derjenige, der sich seiner Wahlentscheidung bereits sicher wähnt und eine Partei zu wählen beabsichtigt, die von der Ungleichbehandlung nicht betroffen sein kann, muss als potentiell betroffen gelten, selbst wenn er diese Absicht offenlegt, weil er sich aufgrund der
I. Aktuelle Rechtswege in Wahlrechtsangelegenheiten
253
Zudem würden sich auch aus der Ex-post-Perspektive einige Rechtsverletzungen nicht belegen lassen, weil zum einen die Wahlentscheidung aufgrund des Grundsatzes der geheimen Wahl73 nicht nachgewiesen werden kann;74 zum anderen ließen sich selbst dann, wenn man die abgegebenen Stimmen auf die einzelnen Wähler zurückführen könnte, manche Rechtsverletzungen nur zahlenmäßig erfassen, nicht hingegen ließen sie sich an einzelne Wähler anknüpfen.75 Es gibt damit nur solche auf Art. 38 GG gestützten Verfassungsbeschwerden, durch die entweder gleichzeitig die Rechte aller Wahlberechtigten verteidigt werden, oder solche, bei denen sich die Selbstbetroffenheit des Beschwerdeführers nicht feststellen lässt. Es zeigt sich, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde nicht auf „das Wahlrecht“ oder die Rechte aus Art. 38 GG zugeschnitten sind. Lediglich dann, wenn sich ein Wahlgesetz auf einen Umstand bezieht, der den Zugang zur Wahl regelt, lässt sich die Selbstbetroffenheit des Beschwerdeführers feststellen. Hier sind auch nicht notwendigerweise alle Wahlberechtigten von einer Regelung betroffen, weil gerade auch einzelne Personengruppen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden können. Nur in dieser Konstellation ist dann auch ein Individualrecht, nämlich der Grundsatz der allgemeinen Wahl, betroffen. Die übrigen Wahlgrundsätze sowie das Wahlrecht selbst sind – wie gesehen – organschaftliche Rechte.76 Nur dort, wo tatsächlich Individualrechte geltend gemacht werden, lassen sich die auf Individualrechte zugeschnittenen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Freiheit der Wahl vor der Wahl nicht selbst binden kann. So konnte sich beispielsweise der CSU-Wähler stets sicher sein, dass seine Stimme sich nicht negativ auswirkt, weil es keine Listenverbindung zwischen der CDU und der CSU gab und gibt, während Wähler anderer Parteien dies potentiell befürchten mussten. Wer CSU-Wähler ist, ist aber unklar. Anders ist es jedoch, wenn sich die Wahlmöglichkeit eines Wählers von vornherein auf Wahlalternativen verengt, die von der Ungleichbehandlung nicht betroffen sein können. So wäre es beispielsweise dann, wenn in einem Bundesland alle Parteien auf die Möglichkeit der Listenverbindung verzichtet hätten. Wahlberechtigte, die in diesem Land gewählt haben, wären dann auch nicht potentiell von Ungleichbehandlungen betroffen gewesen, die aus Listenverbindungen resultieren konnten. Zu der Möglichkeit des negativen Stimmgewichts durch Listenverbindungen und der daraus resultierenden Verfassungswidrigkeit ehemaliger Wahlgesetze BVerfGE 121, 266 (307 f.) – Landeslisten, Urteil vom 3. 7. 2008; BVerfGE 131, 316 – Landeslisten, Beschluss vom 25. 7. 2012. 73 So wurde auch in den auf Art. 38 GG gestützten Verfassungsbeschwerden gegen Kompetenzübertragungen auf die Europäische Union die Frage aufgeworfen, ob nur diejenigen beschwerdeberechtigt sein sollten, die eine europakritische Partei gewählt haben. Dann würde aus der Ausübung des Wahlrechts bei früheren Wahlen über das Rechtsschutzbedürfnis im Verfahren entschieden werden. Dies liefe jedoch auf eine Selbstbindung des Wählers hinaus, die dem Grundsatz der freien Wahl widerspräche, und wäre aufgrund der geheimen Wahl zudem unmöglich zu ermitteln. 74 Sie kann deshalb auch nicht Gegenstand einer eidesstattlichen Versicherung sein. 75 Siehe hierzu oben in Abschnitt D. VIII. 3., S.105 f. 76 Nur der Grundsatz der geheimen Wahl enthält daneben auch individual-rechtliche Gehalte. Siehe dazu oben in Abschnitt F. IV 4., S. 204 f.
254
G. Prozessuale Folgen
Verfassungsbeschwerde sinnvoll umsetzen. Dieser Befund lässt sich auch mit dem Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a vereinbaren. Wie oben gezeigt, zählt dieser das Wahlrecht nicht selbst als verfassungsbeschwerdefähiges Recht auf, sondern spricht von den u. a. in Art. 38 GG enthaltenen Rechten.77 Dies lässt sich durchaus so interpretieren, dass als in Art. 38 GG enthaltenes Recht nur der Grundsatz der allgemeinen Wahl gemeint ist.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung Es zeigt sich, dass die Verfassungsbeschwerde auf die Geltendmachung von Wahlrechtsverletzungen nicht zugeschnitten ist. Lediglich in dem Fall, in dem eine Verletzung der Allgemeinheit der Wahl als einzigem Wahlgrundsatz, der ausschließlich ein Individualrecht vermittelt, geltend gemacht wird, ist sie der richtige Rechtsbehelf.
1. Das Organstreitverfahren als einschlägiger Rechtsbehelf Mit der Wahl zum Deutschen Bundestag im Zusammenhang stehende Rechte könnten jedoch im Organstreitverfahren rügefähig sein. Da das Volk in der grundgesetzlichen Ordnung Staatsorgan ist und der einzelne Wahlberechtigte Organteil, liegt der Schluss nahe, dass es die Verletzung seiner Rechte durch andere Staatsorgane im Organstreitverfahren geltend machen kann. Es ist deshalb im Folgenden zu prüfen, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Organstreitverfahrens erfüllt sind, wenn das Volk oder der einzelne Bürger ihre Rechte im Zusammenhang mit der Wahl geltend machen. Ein Organstreit nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG ist statthaft, wenn über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter gestritten wird, die durch das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Da es sich beim Wahlrecht um ein organschaftliches Recht handelt, unterfällt es nicht der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG. Diese Norm – selbst ein Grundrecht78 – sichert nur dann Rechtsschutz zu, wenn der Bürger sich gerade dem Staat gegenübersieht und, im Außenrechtskreis stehend, durch Handlungen des Staates in seinen Rechten verletzt ist. Innerhalb des Staates hingegen gibt es keine 77
Siehe oben unter D. V. 2., S. 89 f. E. Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 72 Lfg. (Stand: Juli 2014), Bd. III; Art. 19 Abs. 4 Rn. 7. 78
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
255
Garantie für den Schutz von organschaftlichen Rechten. Bei Streitigkeiten in Organisationsrechtsverhältnissen kann gerichtlicher Rechtsschutz nur dann erlangt werden, wenn er explizit vorgesehen ist. Das Grundgesetz sieht für die Geltendmachung der Rechtsverletzung von Organen durch andere Organe das Organstreitverfahren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG vor. Damit erkennt es nicht nur Rechtsbeziehungen zwischen Organen an, sondern macht diese darüber hinaus klagefähig. In Betracht kommt sowohl ein durch den einzelnen Bürger, als auch ein durch das Gesamtvolk in Gang gesetztes Verfahren. Antragsgegenstand des Organstreitverfahrens sind Handlungen oder Unterlassungen des Antragsgegners.79 Die Handlungen oder Unterlassungen, die das Recht des Volkes auf die Wahl und auf die Durchsetzung des Wahlergebnisses, also der richtigen Zusammensetzung des Bundestages, konterkarieren, müssten sich also als Handlungen von anderen Organen, die im Organstreit parteifähig sind, darstellen. Zunächst müsste sich jedoch das Volk oder der einzelne Wahlberechtigte als Teil des Volkes selbst als im Organstreitverfahren parteifähig darstellen. a) Parteifähigkeit aa) Parteifähigkeit des Volkes Das Volk müsste zunächst im Organstreitverfahren parteifähig sein. Parteifähig im Organstreitverfahren sind gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG die obersten Bundesorgane und andere Beteiligte, die im Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. „Oberste Bundesorgane“ sind hier als oberste Staatsorgane des Bundes zu verstehen, zu denen – wie oben gesehen – auch das Volk zählt.80 Das Bundesverfassungsgericht hat die Einbeziehung des Volkes wie auch des Aktivbürgers in das Organstreitverfahren dennoch mehrfach abgelehnt.81 Zwar bezeichnet es selbst – wie gezeigt – das Volk bisweilen als Staatsorgan.82 Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet jedoch Organe im materiellen und im prozessualen Sinn. „Prozessuales Organ“ i.S.d. Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG und des § 63 BVerfGG könnten nur solche Organe sein, die eine „organisierte handlungsfähige Einheit“ darstellen.83 Dies treffe auf das Volk nicht zu, 79
H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/ders., BVerfGG-Kommentar, 37. Lfg. (Stand: Feb. 2012), § 63 Rn. 4. 80 Siehe oben in Abschnitt E. VIII., S. 167 f. 81 BVerfGE 13, 54 (96) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 9. 7. 1961; BVerfGE 49, 15 (19) – Volksentscheid Oldenburg, Beschluss vom 1. 8. 1978; BVerfGE 60, 175 (200) – Startbahn West, Beschluss vom 24. 3. 1982. Dies wird in der Literatur bisweilen als Defizit empfunden: M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 290, S. 90. 82 Siehe oben in Abschnitt E. II., S. 119 ff. 83 BVerfGE 13, 54 (96) – Neugliederung Hessen, Urteil vom 9. 7. 1961. Gegen die Handlungsfähigkeit des Volkes mangels Organisiertheit auch A. Voßkuhle, in: von Mangoldt/Klein/
256
G. Prozessuale Folgen
weshalb es prozessual nicht handlungsfähig und deshalb auch nicht als prozessuales Organ i. S. d. Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG anzuerkennen sei. Diese Unterscheidung zwischen materiell-rechtlichem und prozessualem Organ wird auch in der Literatur bisweilen vorgenommen.84 Das Volk unterscheidet sich jedoch eklatant von anderen, nicht hinreichend formierten Akteuren, denen – wären sie formiert – als mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen von obersten Bundesorganen die Parteifähigkeit im Organstreitverfahren zuerkannt werden müsste. Dies trifft etwa auf die Mehrheit des Bundestages zu. Sie ist im Grundgesetz mit dem Recht Beschlüsse zu fassen (Art. 42 Abs. 2 GG) ausgestattet. Im Organstreitverfahren ist die Mehrheit des Bundestages nicht parteifähig. Jedoch kann sie – wenn sie als Mehrheit noch besteht – den Beschluss fassen, dass der Bundestag als Ganzer ein Organstreitverfahren einleitet. Im Gegensatz zum Volk ist die Mehrheit des Bundestages eine unklare Größe, die sich in ihrer Zusammensetzung jederzeit weitgehend beliebig ändern kann. Das Volk hingegen ist in seiner Zusammensetzung stets bestimmt. Es ist nur deshalb nicht handlungsfähig, weil es keine Instanz kennt, die unabhängig von verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten sein Handeln organisiert. Es müsste sich, um prozessual handlungsfähig zu sein, aus sich selbst heraus organisieren können. Von der Möglichkeit der Selbstorganisation wird bei anderen Parteifähigen jedoch bisweilen auch dann ausgegangen, wenn diese keine Organisationsregelungen haben. So verhält es sich z. B. mit dem Viertel der Mitglieder des Bundestages, das nach Art 44 GG mit dem Recht ausgestattet ist, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu verlangen. Auch für diese Minderheit gibt es keine Regelungen, wie sie sich organisieren kann; insbesondere gibt es keinen Vorsitzenden. Dennoch ist diese Minderheit parteifähig und wird damit als in der Lage erachtet, dem Bundesverfassungsgericht einen schriftlichen, begründeten Antrag85 einzureichen, der zuvor von der Gruppe verfasst und konsentiert werden muss. Zwar handelt es sich bei Teilen des Bundestages um eine wesentlich kleinere Gruppe als beim Volk, vergleichbar sind die Fälle jedoch insofern, als es keine Regeln zur Entscheidungsfindung gibt.86 Allerdings ist zuzugestehen, dass das Volk tatsächlich nur dann als Akteur im Organstreitverfahren auftreten kann, wenn es verfassungsrechtlich vorgesehene Handlungsmöglichkeiten hat. Dies ist de lege lata nicht der Fall, weil das Volk gerade keine Unterorgane hat, die die Rechte des Gesamtvolkes geltend machen können, Starck, GG-Kommentar, Bd. III, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 Rn. 103; M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 290, S. 90. 84 U. Preuß, Das Landesvolk als Gesetzgeber, DVBl. 1985, S. 710 (711); K. Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, S. 116; ähnlich M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 290, S. 90. 85 § 23 Abs. 1 BVerfGG. 86 Ein Teil des Bundestages kann jedoch aus tatsächlichen Gründen eine Entscheidung deutlich leichter herbeiführen, weil sich alle Beteiligten in einem Raum versammeln können.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
257
und weil es keine Geschäftsordnung hat, in der festgelegt sein könnte, wer für das Volk zu handeln berechtigt ist. Auch umfasst es zu viele Personen, um sich aus sich heraus selbst zu organisieren. Das Volk ist auch nicht als Parteifähiger in § 63 BVerfGG genannt, der Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG einfachgesetzlich konkretisiert,87 indem er den Kreis der im Organstreitverfahren Parteifähigen nennt. Allerdings ist zum einen diese Aufzählung nicht abschließend – so ist auch die Bundesversammlung in § 63 BVerfGG nicht erwähnt, obwohl sie ein oberstes Staatsorgan ist88 –, zum anderen kann die einfachgesetzliche Regelung nicht den Kreis der im Grundgesetz festgelegten Staatsorgane bestimmen.89 bb) Prozessstandschaft für das Volk? Das Volk könnte seine Handlungsfähigkeit jedoch durch eine Prozessstandschaft verwirklichen. Die Prozessstandschafter könnten die Rechte des Volkes dann im eigenen Namen geltend machen. Als Prozessstandschafter für das Volk käme zunächst der einzelne Aktivbürger in Betracht. Der Einräumung der Prozessstandschaft für Organteile liegt der Gedanke des Minderheitenschutzes zugrunde.90 Im Falle der Aktivbürgerschaft würde die Prozessstandschaft aber nicht primär um des Schutzes einer Minderheit willen ermöglicht, sondern um der gesamten Aktivbürgerschaft erst zur Parteifähigkeit zu verhelfen. Sie würde damit nicht im Interesse des Organteils, sondern im Interesse des Gesamtorgans erfolgen. Eine Prozessstandschaft des einzelnen Aktivbürgers würde aber die Gefahr in sich tragen, dass vorwiegend Interessen des Einzelnen und nicht diejenigen des Volkes durchgesetzt werden. Sie ist deshalb abzulehnen. Jedoch ließe sich die Vertretung durch eine Gruppe von Mitgliedern des Volkes realisieren.91 Für das prozessuale Handeln durch eine Gruppe von Wahlberechtigten kann die hessische Landesverfassung als Beispiel dienen. Diese ermächtigt eine Gruppe aus dem Volk, die mindestens ein Hundertstel aller Stimmberechtigten umfasst, den Staatsgerichtshof des Landes anzurufen.92 Die Antragsbefugnis der Gruppe von Stimmberechtigten ist allerdings nicht auf Verfahren beschränkt, in denen Rechte des Volkes geltend gemacht werden. Die Gruppe aus dem Volk ist vielmehr in allen Verfahren vor dem Staatsgerichtshof antragsberechtigt. Es geht dort somit zwar nicht explizit um ein Handeln zugunsten des Volkes zur Durchsetzung seiner Rechte, 87
H. Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein, ders., BVerfGG Kommentar, § 63 Rn. 1. Siehe hierzu oben in Abschnitt E. IV., S. 124 ff. 89 U. Fink, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 54 Abs. 4, 5, Rn. 37. 90 R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, S. 136. 91 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, S. 103. 92 Art. 131 Abs. 2 HessV. 88
258
G. Prozessuale Folgen
sondern um eine eigene Antragsbefugnis einer Gruppe von Wahlberechtigten in objektiv-rechtlichen Verfahren. Allerdings muss die Voraussetzung eines bestimmten Quorums, das sich gerade auf die Anzahl der Stimmberechtigten bezieht, auch hier so verstanden werden, dass diese als ein signifikanter Teil des Volkes und damit stellvertretend für das Volk handeln. Nur so ist erklärlich, warum es immer ein bestimmter Prozentsatz des (aktiv berechtigten) Volkes sein muss, der zu Prozesshandlungen ermächtigt ist, und nicht lediglich eine bestimmte Anzahl von Personen oder ein Quorum der Einwohner. An eine Art von Vertretung für das Gesamtvolk erinnert auch das Wahlprüfungsverfahren mit seinem früheren Zulässigkeitskriterium, wonach dem Antragssteller mindestens hundert Wahlberechtigte beitreten mussten.93 Aus diesem Zulässigkeitskriterium lässt sich die Idee ablesen, dass es in diesem Verfahren nicht darum gehen sollte, subjektive Rechte der einzelnen Aktivbürger geltend zu machen, sondern vielmehr darum, die objektive Richtigkeit des Wahlergebnisses festzustellen, womit gleichzeitig immer auch das Recht des gesamten Volkes auf ein richtiges Wahlergebnis gewahrt bleibt.94 Einhundert Wahlberechtigte mögen zwar als unbeträchtliche Größe erscheinen, sie stehen aber für eine signifikante Zahl an Wahlberechtigten, die über den Einzelnen hinausreicht und das Volk repräsentieren kann, gleichzeitig aber auch in der Lage ist, sich selbst zu organisieren. Die einhundert Wahlberechtigten erscheinen dann als Prozessstandschafter für die gesamte Aktivbürgerschaft. Diese Idee eines „signifikanten Teils des Gesamtvolkes“ wurde auch im Verfahren des Verfassungsgerichtes zum Europäischen Stabilitätsmechanismus95 deutlich. Es darf vermutet werden, dass das Bundesverfassungsgericht die hiergegen eingelegten Verfassungsbeschwerden, die auf Art. 38 GG gestützt wurden, auch deshalb zur Entscheidung angenommen hat,96 weil sie nicht von einigen wenigen Bürgern eingelegt wurden, sondern ausweislich des Rubrums des Urteils über 11.000 Unterstützer fanden.97 Der einzelne Bürger trat hier in seiner Bedeutung hinter der Anzahl der Unterstützer zurück. Allerdings sehen das Bundesverfassungsgericht und die herrschende Literatur als Voraussetzung für eine Prozessstandschaft, dass auch das Gesamtorgan selbst par93
§ 2 Abs. 2 Alt. 1 WahlprüfG a. F. Siehe hierzu oben in diesem Abschnitt unter G. I. 1. c), S. 247 ff. 95 BVerfGE 132, 195 – ESM-Vertrag und Fiskalpakt, Urteil vom 12. 9. 2012. 96 Dem Bundesverfassungsgericht steht mit der Möglichkeit der Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung gemäß § 93a Abs. 1 BVerfGG ein Instrument zur Verfügung, über Verfassungsbeschwerden nicht zu entscheiden, es sei denn, es kommt ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zu oder es ist zur Durchsetzung der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte angezeigt, § 93 Abs. 2 BVerfG. 97 Laut dem Bündnis „Europa braucht mehr Demokratie e.V.“ unterstützten sogar mehr als 37.000 Bürger die Verfassungsbeschwerde (www.verfassungsbeschwerde.eu). Auf die historische beispiellose Zahl an Beschwerdeführern weist auch E. Peuker, Die demokratische Auslegung des Völkerrechts, EuR 2013, S. 75 (76), hin. 94
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
259
teifähig ist. Aus diesem Grund sei eine Prozessstandschaft für das Volk ausgeschlossen.98 Die Argumentation produziert jedoch einen Zirkelschluss. Durch die Prozessstandschaft könnte dem Volk gerade zur Handlungsfähigkeit verholfen werden. Wird die Prozessstandschaft aber deshalb ausgeschlossen, weil das Volk nicht handlungsfähig und deshalb nicht parteifähig ist, geht dies zu Lasten des Volkes. Für einen Ausschluss der Prozessstandschaft gibt es keinen Grund.99 Es sollte deshalb eine Prozessstandschaft für das Volk anerkannt werden.100 Diese sollte zwar nicht dem einzelnen Bürger, jedoch einer signifikanten Gruppe von Wahlberechtigten zugestanden werden. In der hessischen Landesverfassung ist eine Gruppe von einem Prozent der Stimmberechtigten vorgesehen, was etwa 44.000 Personen entspricht.101 Für das Bundesvolk könnte ein Quorum von einem Tausendstel vorgesehen werden, was aktuell etwa 62.000 Personen entsprechen würde.102 Dies mag als hohe Hürde erscheinen; es ist jedoch zu beachten, dass dann immer noch 99,9 Prozent der Aktivbürger das Vorhaben nicht unterstützt, die handelnde Gruppe aber dennoch Rechte der gesamten Aktivbürgerschaft geltend macht.103 cc) Parteifähigkeit des wahlberechtigten Bürgers Liegt eine Verletzung des Wahlrechts des Einzelnen vor, stellt sich die Frage, ob auch der einzelne Wahlberechtigte seine Rechte im Organstreitverfahren verteidigen kann. In der Literatur wird die Einbeziehung des Bürgers und des Volkes in das Organstreitverfahren überwiegend abgelehnt. Die Entstehungsgeschichte des Organstreits spreche gegen die Einbeziehung des Bürgers in den Kreis der im Organstreitverfahren Parteifähigen. Der Kreis der im Organstreit Parteifähigen sollte im Vergleich zur Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs keinesfalls erweitert wer-
98
E. Klein, Verfassungsprozeßrecht, AöR 108 (1983), S. 560 (567 Fn. 246); E. Benda/ E. Klein/O. Klein, Verfassungsprozessrecht, S. 405, Rn. 1004. 99 Für Organteile nicht formierter Organe im Allgemeinen: M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, S. 131, 158. 100 Ebenso M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, S. 131, 158. 101 Bei der Landtagswahl 2013 in Hessen waren 4.392.213 Personen wahlberechtigt: https://www.wahlen.hessen.de ! Land Hessen ! Landtagswahlen Ergebnisse ! Ergebnisse der Landtagswahl 2013 ! endgültiges Wahlergebnis (aufgerufen am 19. 6. 2017). 102 Bei der Bundestagswahl 2013 waren 61.946.900 Personen wahlberechtigt. Siehe die Veröffentlichung des Bundeswahlleiters unter https://www.bundeswahlleiter.de ! Bundestagswahl ! Publikationen ! Heft: Ergebnisse früherer Bundestagswahlen, S. 24 (aufgerufen am 19. 6. 2017). 103 Dass diese Zahl von Wahlberechtigten tatsächlich mobilisierbar ist, zeigt der Antrag von ca. 72.250 hessischen Wahlberechtigten vom 22. 6. 2007 an den Hessischen Staatsgerichtshof (Aktenzeichen AR 7/07), das Gesetz zur Einführung von Studienbeiträgen an Hochschulen des Landes Hessen für unvereinbar mit der Hessischen Verfassung zu erklären.
260
G. Prozessuale Folgen
den.104 Der verfassungsändernde Gesetzgeber habe dies durch die Aufnahme der Verfassungsbeschwerde in das Grundgesetz bestätigt. Hierdurch habe er zu erkennen gegeben, dass der Aktivbürger seine (Aktiv-)Rechte aus Art. 38 GG nur mit der Verfassungsbeschwerde verfolgen können soll.105 Von anderer Seite wird die Parteifähigkeit des Bürgers aber befürwortet.106 Gerade die Möglichkeit, eine Verletzung des Wahlrechts mit der Verfassungsbeschwerde zu rügen, wird dann lediglich als Ausgleich für die mangelnde Parteifähigkeit des Volkes und des Aktivbürgers gesehen.107 Wird hierin jedoch eine „Entschädigung“ gesehen, werden unterschiedliche Verfahren, die unterschiedliche Zielsetzungen haben, miteinander vermischt. Während die Verfassungsbeschwerde dem Rechtschutz des Einzelnen zu dienen bestimmt ist, soll das Organstreitverfahren Rechte von Organen untereinander schützen. Das Problem, ob der einzelne Bürger im Organstreitverfahren als parteifähig anerkannt werden muss, lässt sich parallel zur Parteifähigkeit des Abgeordneten des Deutschen Bundestages beurteilen. Denn hier wie dort ist der Einzelne Teil eines obersten Bundesorgans. Dem Abgeordneten wird das Recht zugestanden, im Organstreitverfahren seine eigenen Rechte als Teil eines obersten Bundesorgans geltend zu machen, auch wenn er nicht die Rechte des Bundestages in Prozessstandschaft durchsetzen kann.108 Diese Wertung lässt sich auf den Aktivbürger übertragen. Auch er sollte zur Geltendmachung seiner eigenen organschaftlichen Rechte als parteifähig anerkannt werden. Nicht jedoch sollte ihm – entsprechend dem Abge104
T. Clemens, Politische Parteien und andere Institutionen im Organstreitverfahren, in: Fürst/Herzog/Umbach, Festschrift für Zeidler, Bd. II, S. 1260 (1276 f.); D. C. Umbach, in: ders./Clemens/Dollinger, BVerfGG-Kommentar, §§ 63, 64 Rn. 128. Wenn dieses Ergebnis durch die Aufnahme des Art. 38 GG in den Katalog der verfassungsbeschwerdefähigen Rechte bestätigt gesehen wird, unterstreicht dies die mangelnde Systematik dieser Einordnung. 105 D. C. Umbach, in: ders./Clemens/Dollinger, BVerfGG-Kommentar, §§ 63, 64 Rn. 130; T. Clemens, Politische Parteien und andere Institutionen im Organstreitverfahren, in: Fürst/ Herzog/Umbach, Festschrift für Zeidler, Bd. II, S. 1260 (1279). 106 C. Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, § 7 II Rn. 12, S. 106; M. Goessl, Organstreiˇ opic´, Grundgesetz und politisches Strafrecht neuer tigkeiten innerhalb des Bundes, S. 133; H. C Art, 1967, S. 54; C. Arndt, Zum Begriff der Partei im Organstreitverfahren, AöR 87 (1962), S. 197 (235 – 239); J. Pietzcker, Organstreit, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 587 (594), hält die aktuelle Lösung nur deshalb für überzeugender, weil eine Aufnahme des Aktivbürgers in den Kreis der Antragsberechtigten im Organstreit zu einer Kontrolle des Bundeswahlgesetzes im Organstreitverfahren führen würde, während es für Streitigkeiten mit den übrigen Wahlorganen beim bisherigen Rechtszustand bliebe. Nichts anderes ist jedoch auch jetzt der Fall. Während für unmittelbar auf die Wahl bezogene staatliche Akte die speziellen Rechtsbehelfe des Wahlprüfungsrechts einschlägig sind, werden Wahlgesetze und andere, nicht unmittelbar auf die Wahl bezogene Akte der öffentlichen Gewalt mit der Verfassungsbeschwerde für den Einzelnen rügefähig. Das Argument läuft also ins Leere. Dagegen aber W.-R. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2442). 107 M. Sachs, Verfassungsprozessrecht, 2010, Rn. 290, S. 90. 108 BVerfGE 90, 286 (342 f.) – Out-of-area-Einsätze, Urteil vom 12. 7. 1994; BVerfGE 117, 359 (369) – Tornadoeinsatz Afghanistan, Beschluss vom 12. 3. 2007.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
261
ordneten des Deutschen Bundestages – die Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten des Volkes in Prozessstandschaft zugebilligt werden. b) Antragsgegenstand und Antragsgegner Das Organstreitverfahren könnte sich nur dann als geeignetes Verfahren zur Geltendmachung von Rechtsverletzungen des Wahlrechts darstellen, wenn sich die Rechtsakte, gegen die sich das Volk und der wahlberechtigte Bürger wenden wollen, als taugliche Antragsgegenstände im Organstreitverfahren darstellen. Wie gesehen, kann das Wahlrecht durch unterschiedliche Akte verletzt sein. Um im Organstreitverfahren gerügt werden zu können, müssen diese Akte als Handlungen oder Unterlassungen von Organen ausgehen, die Antragsgegner im Organstreitverfahren sein können. Es muss sich zudem um rechtserhebliche Handlungen oder Unterlassungen derselben handeln. aa) Erlass eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes Das Recht des Volkes, durch Wahlen in regelmäßigen Abständen den Bundestag zu wählen, kann insbesondere durch Akte der Gesetzgebung verletzt werden. Denn durch Gesetz kann beispielsweise eine Verlängerung der Wahlperiode geregelt werden, die das Recht des Volkes auf regelmäßige Wahlen verletzt. Auch können Wahlverfahren festgelegt werden, die nicht mit den Wahlgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG im Einklang stehen und so das Recht des Volkes auf ein richtiges Wahlergebnis verletzen.109 Im Falle von Rechtsverletzungen durch Gesetzgebungsakte ist der Antragsgegenstand, der eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners darstellen muss, nicht das Gesetz selbst, sondern der Erlass des Gesetzes. Auch Gesetzgebungsakte oder die Mitwirkung an einem mehrstufigen Gesetzgebungsakt stellen damit einen tauglichen Antragsgegenstand im Organstreitverfahren dar.110 Da die Gesetzgebungsorgane – Bundestag und Bundesrat (Art. 77 GG) – als oberste Bundesorgane parteifähige Antragsgegner sind, steht der Aktivbürgerschaft als Antragsteller hier in jedem Fall ein tauglicher Antragsgegner gegenüber. Als rechtserhebliche Maßnahme kommt für den Bundestag der Beschluss des Gesetzes gemäß Art. 77 Abs. 1 GG in Betracht. Eine rechtserhebliche Maßnahme des Bundesrates könnte in dem Unterlassen des Einlegens eines Einspruchs, zu dem der Bundesrat gemäß Art. 77 Abs. 3 S. 1 GG stets die Möglichkeit hat, gesehen werden.111 Auch der Bundespräsident kommt als Antragsgegner in Betracht, wenn es 109
Siehe zu diesen Rechten oben in Abschnitt E. XIII., S. 167 f. S. Detterbeck, Streitgegenstand und Entscheidungswirkungen im Öffentlichen Recht, 1995, S. 325 f. 111 Der Bundesrat scheidet jedoch dann als Antragsgegner aus, wenn er Einspruch eingelegt hat, dieser jedoch vom Bundestag gemäß Art. 77 Abs. 4 GG zurückgewiesen worden ist. 110
262
G. Prozessuale Folgen
sich um evidente Verstöße handelt. Denn er fertigt gemäß Art. 82 GG Gesetze aus, wobei ihm ein neben dem Prüfungsrecht im Hinblick auf die formelle Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen auch das Recht zukommt, diese auf evidente materielle Verfassungsverstöße zu überprüfen.112 Das Organstreitverfahren könnte sich also im Falle von Gesetzgebungsakten sowohl gegen den Bundestag als auch gegen den Bundesrat richten, die beide als Antragsgegner im Organstreitverfahren in § 63 BVerfGG aufgezählt sind; daneben im Fall von evidenten Verstößen auch gegen den Bundespräsidenten, der ebenfalls in § 63 BVerfGG explizit aufgezählt ist. Im Falle der Verletzung von Wahlgrundsätzen ist auch das organschaftliche Recht von einzelnen Aktivbürgern verletzt, soweit diese organschaftliche Rechte enthalten. Dies ist – wie gezeigt – bei den Grundsätzen der Unmittelbarkeit, der Freiheit, der Gleichheit und der Geheimheit der Wahl der Fall. Lediglich der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl enthält kein organschaftliches Recht, sondern ein Individualrecht darauf, als Teil des Staatsorgans Volk anerkannt zu werden.113 Auch die Aktivbürger können sich dann im Organstreitverfahren gegen die Verletzung ihrer Rechte durch die Gesetzgebungsorgane richten. bb) Nichterlass eines Wahlgesetzes Auch durch Unterlassen von Gesetzgebungsakten können Rechte des Volkes und der Aktivbürger verletzt werden. Denn das Volk kann seine Kompetenz zu wählen nur dann ausüben, wenn es ein gültiges, verfassungsmäßiges Wahlgesetz gibt; der Aktivbürger kann nur in diesem Fall an der Ausübung der Kompetenz teilhaben. Das Wahlsystem ist im Grundgesetz nur durch die Wahlgrundsätze determiniert, aus denen allein noch kein konkretes Verfahren hervorgeht, mit dem Wählerstimmen in Mandate umgesetzt werden. Das Wahlsystem ist deshalb durch einfaches Gesetz konkretisierungsbedürftig. Aus diesem Grund erteilt Art. 38 Abs. 3 GG dem Gesetzgeber den Regelungsauftrag, ein Wahlgesetz zu erlassen. Die Norm stellt eine Ermächtigungsnorm dar, die wegen der der Bedeutung des Wahlrechts für die Demokratie gleichzeitig die Verpflichtung enthält, tätig zu werden.114 Auch der Abs. 3 112 Dieses sogenannte „materielle Prüfungsrecht” des Bundespräsidenten wird unterschiedlich hergeleitet; es folgt letztendlich aus Art. 20 Abs. 3 GG. Hierzu C. Degenhart, Staatorganisationsrecht, § 10 II 1 Rn. 786 ff. 113 Siehe oben in Abschnitt F. IV., S. 200 ff. 114 N. Achterberg/M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Bd. II, Art. 38 Abs. 3 Rn. 157; H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 60. Lfg. (Stand: Okt. 2010), Bd. IV, Art. 38 Rn. 164. Das Unterlassen des Gesetzgebungsaktes kann indes nur dann Angriffsgegenstand sein, wenn eine Rechtspflicht des Gesetzgebers zum Handeln besteht. Diese ergibt sich jedoch aus den „normalen“ Gesetzgebungskompetenzen nicht ohne weiteres. Vielmehr bleibt dem Gesetzgeber ein politischer Ermessensspielraum darüber, ob er von einer Gesetzgebungskompetenz Gebrauch macht. Zum nicht stets verpflichtenden Charakter von Kompetenzen siehe auch oben in Abschnitt F. VI. 1., S. 217 f.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
263
des Art. 38 GG enthält damit Rechte des Volkes und der Aktivbürger gegenüber den Gesetzgebungsorganen. Allerdings sind am Gesetzgebungsprozess mehrere Akteure beteiligt, die in unterschiedlichen Verfahrensstadien in unterschiedlicher Weise auf den Gesetzgebungsprozess einwirken können. Dies erschwert die Frage nach dem verantwortlichen Antragsgegner. In der hochpolitischen Materie des Wahlrechts sind unterschiedliche Interessen verschiedener Akteure nicht die Ausnahme, sondern die Regel. So kann sich beispielsweise ein Einspruch des Bundesrates gegen einen Gesetzesentwurf darauf gründen, dass hier andere politische Mehrheiten als im Bundestag bestehen. Es stellt sich dann die Frage, ob sich z. B. der Bundesrat darauf berufen kann, er hätte den Einspruch unterlassen, wenn der Gesetzentwurf inhaltlich anders ausgestaltet gewesen wäre. Es ist hier dennoch davon auszugehen, dass als Antragsgegner sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat in Betracht kommen, weil sie gemeinschaftlich mit der Gesetzgebung betraut sind. Auch gegen die Bundesregierung ist ein Verfahren denkbar, dieses kann sich entsprechend der Kompetenz der Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren, das sich auf ein Initiativrecht beschränkt,115 auch nur auf Einbringung eines Gesetzesentwurfes richten. cc) Nichtanordnung von Neuwahlen Eine Verletzung des Rechts des Volkes, den Bundestag zu wählen, ist ebenso denkbar, wenn keine Neuwahlen in dem in Art. 39 Abs. 1 GG genannten Zeitraum stattfinden oder die Wahlperiode durch Gesetz in verfassungswidriger Weise verlängert wird.116 An diesem Recht haben die Aktivbürger aus eigenem Recht Anteil.117 Gemäß § 16 BWahlG ist der Bundespräsident zuständig für die Festsetzung des Wahltermins. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine einfachgesetzliche Zuständigkeitszuweisung. In der Verfassung findet sich hingegen keine explizite Zuständigkeitszuweisung zur Festsetzung eines Wahltages.118 In Art. 39 Abs. 1 GG ist nur der Zeitraum genannt, innerhalb dessen die Bundestagswahl stattzufinden hat. Das Grundgesetz setzt keinen festen Termin für Bundestagswahlen, sondern legt die Bestimmung des konkreten Datums in das Ermessen eines nicht näher beschriebenen Organs.
115
Art. 76 Abs. 1 GG. M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1952, S. 134. Auch das Bundesverfassungsgericht sieht in BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23. 10. 1953, das Wahlrecht auch dann beeinträchtigt, wenn fällige Wahlen hinaus geschoben werden, allerdings davon ausgehend, dass es sich beim Wahlrecht um ein subjektives Individualrecht handelt. Die Frage, durch wen die Rechtsverletzung geschehen sein soll, wenn niemand zuständig ist, stellt sich jedoch gleichermaßen. 117 Siehe oben in Abschnitt F. V., S. 211 ff. 118 H. Nawiasky, Die Grundgedanken des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 1950, S. 87. 116
264
G. Prozessuale Folgen
Die Anordnung der Neuwahl ist jedoch – wenn sie vollzogen wird – „staatsorganisationsrechtlicher Akt mit Verfassungsfunktion“,119 der von der Verfassung in Art. 39 Abs. 1 und 2 GG vorausgesetzt wird.120 Wenn jedoch eine Zuständigkeit niemandem zugewiesen ist, lässt sich auch das Unterlassen ihrer Ausübung niemandem zurechnen. Es stellt sich somit die Frage, ob die Regelung des § 16 BWahlG eine ungeschriebene verfassungsrechtliche Zuständigkeitszuweisung wiederholt.121 Die Zuständigkeit des Bundespräsidenten zur Festsetzung des Wahltages ergibt sich aus einer Verfassungstradition. Auch die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 und die Weimarer Reichsverfassung enthielten zu dieser Frage keine Regelung. Die Festsetzung des Wahltages wurde jedoch stets im Wahlgesetz dem Staatsoberhaupt übertragen.122 Die Kompetenz des Bundespräsidenten zur Festsetzung des Termins für die Bundestagswahl kann deshalb als ungeschriebenes Verfassungsrecht gelten. Setzt der Bundespräsident keinen Termin für Neuwahlen fest, kann sich das Volk hiergegen im Organstreitverfahren wenden. Auch der einzelne Aktivbürger kann sich gegen die Nichtfestsetzung von Neuwahlen im Organstreitverfahren wehren. Denn auch sein organschaftliches Recht ist verletzt, wenn er an der Kompetenz des Volkes zu wählen mangels stattfindenden Wahlen nicht teilhaben kann.123 dd) Entleerung der Herrschaftsgewalt des Volkes Auch im Falle der Entleerung der tatsächlichen Herrschaftsgewalt des Volkes durch Übertragung von Hoheitsrechten auf überstaatliche Einrichtungen sind Rechte des Volkes verletzt. Denn das Volk hat nicht nur ein Recht auf Ausübung seiner Kompetenz zu wählen und ein hieraus folgendes Recht auf Feststellung eines 119 E. Klein/T Giegerich, Grenzen des Ermessens bei der Bestimmung des Wahltages, AöR 112 (1987), S. 544 (548 f.); K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, 1980, § 26 III 3, S. 73. 120 BVerfGE 62, 1 (31) – Bundestagsauflösung I, Urteil vom 16. 2. 1983. Das Bundesverfassungsgericht leitet dies im Zusammenhang mit der Bundestagsauflösung her. Die Anordnung der Neuwahl teile als „Annex-Entscheidung“ der Bundestagsauflösung deren „rechtliches Schicksal“. Die Rechtsnatur der Entscheidung kann jedoch nicht davon abhängen, ob sie im Zusammenhang mit einer Bundestagsauflösung ergeht; sie ist vielmehr immer ein staatsorganisationsrechtlicher Akt. Für die Bildung der Wahlorgane und die Festlegung der Wahlräume als verfassungsrechtliche Akte W. R. Schenke, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 (2444). 121 Dagegen W. Schreiber, BWahlG-Kommentar, § 16 Rn. 2, S. 367. Die Zuweisung der Aufgabe an das Staatsoberhaupt sei verfassungsrechtlich nicht geboten, stelle aber eine unbedenkliche Konkretisierung des Art. 39 Abs. 1 GG dar. 122 L. Mehlhorn, Der Bundespräsident, S. 147, Fn. 769; P. Weides, Bestimmung des Wahltages von Parlamentswahlen, in: Börner/Jahrreiß/Stern, Festschrift für Carstens, S. 941 (942). Die einfachgesetzliche Regelung ist dann auch in expliziter Anlehnung an die Regelung des Reichswahlgesetzes vom 6. 3. 1924 ergangen; BT-Drucks. I/4090. S. 26. 123 Siehe oben in Abschnitt F. V., S. 216 ff.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
265
richtigen Wahlergebnis, sondern es hat daneben ein Recht auf seine Kompetenz, weil ihm durch Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG verfassungsänderungsfest das Recht zugebilligt wird, die Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen zu legitimieren. Werden Kompetenzen in dem Maße der deutschen Staatlichkeit entzogen und auf supranationale Einrichtungen übertragen, dass von einer Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk nicht mehr gesprochen werden kann, ist dieses Herrschaftsrecht des Volkes aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG verletzt. Nicht aber ist die Ausprägung dieses Rechts – das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – verletzt.124 Denn das Volk und mit ihm der einzelne Aktivbürger bleiben weiterhin befugt, den Deutschen Bundestag zu wählen; nur kann hierdurch nicht mehr der verfassungsmäßige Zweck der Wahl – die Legitimation von Herrschaftsgewalt – voll verwirklicht werden. Das Recht darauf, dass mit der Wahl zum Deutschen Bundestag das Herrschaftsrecht des Volkes verwirklicht wird, ergibt sich nicht aus Art. 38 GG selbst, sondern aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG im Zusammenspiel mit dem Umstand, dass das Herrschaftsrecht des Volkes in der aktuellen Ausgestaltung der Verfassung einzig durch Art. 38 GG umgesetzt wird. Problematisch könnte jedoch sein, dass sich das Recht des Volkes auf Legitimation der Staatsgewalt nicht primär gegen den Bundestag richtet, sondern gegen den Staat, als dessen Organ der Bundestag handelt. Indem der Bundestag aber über die tatsächliche Macht verfügt, die Kompetenz des Volkes durch Übertragung von Hoheitsgewalt oder genauer gesagt durch Kompetenzausübungsverzicht zu schmälern, ist er jedoch als der richtige Antragsgegner im Organstreitverfahren anzusehen. ee) Nichtzulassung zur Wahl (Nichtausstellen eines Wahlscheins / Nichteintragung in das Wählerverzeichnis) Auch der einzelne Bürger kann in seinem organschaftlichen Recht durch Akte anderer Organe verletzt sein. Die Nichtausstellung eines Wahlscheins und die Nichteintragung in das Wählerverzeichnis machen es dem Wahlberechtigten unmöglich, sein Wahlrecht auch tatsächlich auszuüben und damit als Teil des Volkes Staatsgewalt auszuüben. Dabei sind die Eintragung in das Wählerverzeichnis und das 124 Da das Bundesverfassungsgericht diese Rechte stets an Art. 38 GG anknüpfte, also an das Wahlrecht konkret zum Deutschen Bundestag, war es darauf festgelegt, auf eine Entleerung der Kompetenzen des Bundestages als demjenigen „Verfassungsorgan […], das unmittelbar nach den Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande gekommen ist“, abzustellen, weil hierdurch „die parlamentarische Repräsentation des Volkswillens“ unmöglich gemacht würde (BVerfGE 129, 124 (169, 170) – EFS, Beschluss vom 7. 9. 2011). Es ist aber gleichgültig, wie innerorganisatorisch die Kompetenzen verteilt sind, auf deren Ausübung durch „Kompetenzübertragung“ verzichtet wird; es kommt nur darauf an, ob trotz der Ausübung dieser Kompetenzen durch nicht vom Volk legitimierte Instanzen noch von einer Legitimation „der Staatsgewalt“ durch das Volk gesprochen werden kann, nicht jedoch darauf, welche Kompetenzen den einzelnen Organen verbleiben. Denn Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG würde auch andere Ausgestaltungen der Demokratie zulassen, bei denen dem vom Volk unmittelbar gewählten Organ weniger Kompetenzen zustünden.
266
G. Prozessuale Folgen
Ausstellen des Wahlscheins nur Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts, nicht aber für dessen Innehaben.125 Die Eintragung in das Wählerverzeichnis und die Erteilung des Wahlscheins ist für das Innehaben des Wahlrechts nicht konstitutiv, sondern deklaratorisch. Denn wer einen Wahlschein erhält, erhält diesen bereits als Teil des Staatsorgans Volk. Wer einen Wahlschein einfordert oder die Eintragung in das Wählerverzeichnis begehrt, macht damit seine Rechte als Teil des Staatsorgans Volk geltend. Die in der Literatur – soweit ersichtlich ausschließlich – vertretene Gegenansicht, die davon ausgeht, dass der sich um Zulassung zur Wahl bemühende Bürger Grundrechte geltend macht,126 verkennt, dass der Bürger nicht durch die Zulassung zur Wahl zum Teil der Aktivbürgerschaft wird, sondern dies kraft Verfassung bereits ist. Er möchte dann lediglich seine Rechte auf Teilnahme an der Ausübung der Kompetenz des Volkes im konkreten Fall, ein organschaftliches Recht, durchsetzen.127 Problematisch ist jedoch die Rechtsstellung der Behörde, die gemäß § 17 BWahlG das Wählerverzeichnis führt. Von der Eintragung in das Wählerverzeichnis ist abhängig, ob Wahlberechtigte ihr Wahlrecht auch ausüben können; die Behörde kommt deshalb einzig als Antragsgegner in Betracht. Auch sie müsste als oberstes Staatsorgan qualifiziert werden können, damit ein Organstreit in diesem Fall zulässig wäre, weil es eines ebenfalls parteifähigen Antragsgegners bedarf. Sie ist jedoch nur Verwaltungsbehörde, der die Aufgabe zukommt, das verfassungsrechtliche Handeln des Volkes zu organisieren. Ihr Handeln ist nicht verfassungsrechtlich vorgesehen, sie wird nur aus organisatorischen Gründen tätig. Die Wahlbehörde ist kein oberstes Bundesorgan und deshalb kein zulässiger Antragsgegner im Organstreitverfahren,128 so dass eine Nichteintragung ins Wählerverzeichnis nicht im Organstreitverfahren gerügt werden kann. 125 Siehe auch § 14 BWahlG, der die „Ausübung des Wahlrechts“ von der Eintragung ins Wählerverzeichnis oder das Innehaben eines Wahlscheins abhängig macht. 126 Die Ansicht wird selbst dann vertreten, wenn die Stimmabgabe selbst für die Ausübung einer Kompetenz gehalten wird, oder dies jedenfalls für möglich gehalten wird, so Franzke, Der Schutz des aktiven Wahlrechts durch die Verwaltungsgerichte, DVBl. 1980, S. 730 (731); B.-D. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, S. 112. 127 Dies verkennt auch B. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 154, der jedenfalls das Abstimmungsrecht als Kompetenz einstuft. Die Fehlannahme beruht auf einer Fehlauslegung des § 9 Abs. 1 NW KWG, der als Beispiel für eine Formulierung von Wahlausübungsvoraussetzungen als Voraussetzung der Wahlberechtigung fehlinterpretiert wird und der entsprechenden Vorschrift des BWahlG, § 14, wortgleich ist. Dass zwischen der Wahlrechts- und der Wahlausübungsvoraussetzung ein Unterschied besteht, macht die Vorschrift selbst in ihrem Absatz 2 deutlich. Dieser regelt, unter welchen Voraussetzungen der Wahlberechtigte selbst dafür Sorge tragen kann, in den Stand versetzt zu werden, sein Wahlrecht auch ausüben zu können. Es ist auch ein entscheidender Unterschied, ob der Bürger durch die Nichtzulassung zur Wahl von der Berechtigung zu wählen ausgeschlossen wird, oder ob er in der Ausübung seiner Berechtigung gehindert wird. Richtig aber K. Haas, Wahlrecht und verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz, VwBlBW 1990, S. 71 (72), der erkennt, dass die Wahlberechtigung Vorfrage für das Ausstellen eines Wahlscheins ist. 128 B.-D. Olschewski, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz, S. 113, 152.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
267
Es ist eine Besonderheit des Staatsorgans „Aktivbürgerschaft“, dass ihr Handeln von einer Behörde organisiert wird. Diese übernimmt Funktionen, die bei anderen Staatsorganen von Organteilen des Organs selbst übernommen werden. So werden etwa im Bundestag Sitzungen und Abstimmungen vom Bundestagspräsidenten geleitet. Werden hierbei organschaftliche Rechte der Abgeordneten verletzt, ist das Organstreitverfahren deswegen eröffnet, weil ihnen dann ebenfalls ein Teil eines obersten Bundesorgans gegenübersteht und diese sich über ein zwischen ihnen bestehenden Rechte- und Pflichtenverhältnis streiten. Mangels zulässigen Antragsgegners kann der Wahlberechtigte sich damit nicht im Organstreitverfahren gegen die Nichtzulassung zur Wahl oder das Nichtausstellen eines Wahlscheins wehren. Dies ist deshalb unproblematisch, weil es sich beim Wahlrecht nicht um ein Individualrecht i. S. d. 19 Abs. 4 GG handelt. Rechtsschutz ist deshalb nicht erforderlich. Das Enumerationsprinzip des Verfassungsprozessrechts führt vielmehr dazu, dass Rechtsschutz nur erlangt werden kann, wenn ein Verfahren vorgesehen ist und alle Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Der einzelne Bürger kann die Ausübbarkeit seines Wahlrechts damit nicht im Organstreitverfahren durchsetzen. c) Ergebnis Das Organstreitverfahren als Verfahren, das Streitigkeiten zwischen obersten Staatsorganen des Bundes beilegt, steht grundsätzlich auch dem Volk offen. Da es als Gesamtheit nicht handeln kann, ohne dass es von außen organisiert wird, muss ihm im Wege der Prozessstandschaft zur (prozessualen) Handlungsfähigkeit verholfen werden. Diese sollte nicht durch den einzelnen Aktivbürger erfolgen können, weil dies ihm ein zu großes Machtpotenzial innerhalb des Verfassungsgefüges verleihen würde. Jedoch sollte ein Quorum des Volkes in die Lage versetzt werden, Rechte des Volkes geltend zu machen. Zu denken ist etwa an ein Quorum von einem Tausendstel der Wahlberechtigten, was zurzeit etwa 62.000 Bürgern entspricht. Diese sind zwar schwerlich in der Lage, sich in einem Raum zu versammeln, allerdings erleichtert das Internet den Informationsfluss und die Kommunikationsmöglichkeiten.129 Es gibt dann auch mögliche Handlungen oder Unterlassungen von obersten Staatsorganen, die das Volk in seinem Recht auf Wahl des Bundestages und auf Umsetzung des Wahlergebnisses beeinträchtigen können, wie etwa der Nichterlass eines Wahlgesetzes oder der Erlass eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes sowie die Nichtanordnung von Neuwahlen durch den Bundespräsidenten. Gegen diese könnte das Volk im Organstreitverfahren vorgehen, wenn ihm durch die Möglichkeit einer Prozessstandschaft zu prozessualer Handlungsfähigkeit verholfen würde. 129 Dass auch weit mehr Bürger in der Lage sind, sich über das Internet einem gemeinsamen Anliegen zu widmen, zeigt gerade die Zahl der Beschwerdeführer im Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen den ESM, die größtenteils nur durch die Unterschrift eines Schriftsatzes zum Beschwerdeführer geworden sind.
268
G. Prozessuale Folgen
Eine Änderung des Wortlauts des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG bedürfte es hierfür nicht, weil das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft zu den obersten Staatsorganen zählt, die in dieser Norm als „oberste Bundesorgane“ bezeichnet werden. Der einzelne Wahlberechtigte ist im Grundgesetz als Teil der Aktivbürgerschaft als oberstem Staatsorgan mit eigenen Rechten in Art. 38 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 GG ausgestattet, diese sind gerade nicht grundrechtlicher, sondern staatsorganisationsrechtlicher Natur. Lediglich die Prozessstandschaft für das Volk müsste normiert werden. Hierfür würde sich eine Normierung in einem neuen § 64 Abs. 1 S. 2 BVerfGG anbieten. Die Regelung der Prozessstandschaft in dieser Norm würde dann die Funktion übernehmen, die im Übrigen die Normverbindung des § 64 BVerfGG mit der entsprechenden Norm der Geschäftsordnung des Bundestages oder des Bundesrates übernimmt,130 beim Volk jedoch mangels Bestehen einer Geschäftsordnung nicht möglich ist. Darüber hinaus sollte das Volk explizit als Antragsberechtigter in § 63 BVerfGG genannt werden. Es sollte dann ein Verweis auf Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG erfolgen, damit deutlich wird, dass das Volk in Form der Aktivbürgerschaft gemeint ist. In diesem Zuge könnte eine Umformulierung des § 63 BVerfGG in dem Sinne erfolgen, dass er auch die „anderen Beteiligten“ i. S. d. Art 93 Abs. 1 S. 1 umfassend aufgreift. Die Paragraphen könnten dann lauten: § 63 BVerfGG: Antragsteller und Antragsgegner können nur sein: der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung, das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) sowie andere oberste Bundesorgane und andere Beteiligte, wenn sie im Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung des Bundestages, des Bundesrates oder der Bundesregierung mit eigenen Rechten ausgestattet sind. § 64 Abs. 1 S. 2 BVerfGG: Die Rechte des Volkes können von einem Tausendstel der wahlberechtigten Aktivbürger geltend gemacht werden.
2. Bewertung des Wahlprüfungsverfahrens und der Änderung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe vor diesem Hintergrund Daneben ist jedoch weiterhin das Wahlprüfungsverfahren einschlägig, wenn es um Verfahrensakte geht, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, weil
130 Auch die in den Geschäftsordnungen verankerten Rechte verschaffen den Organteilen nur dann eine Antragsbefugnis, wenn sie unmittelbar im Grundgesetz verankert sind, R. Grote, Der Verfassungsorganstreit, S. 123; M. Goessl, Organstreitverfahren innerhalb des Bundes, S. 62, sieht hingegen auch einfachgesetzlich oder geschäftsmäßig begründete Rechte der Parteien als die Antragsbefugnis begründend an. Diese Begrenzung leitet sich jedoch aus der funktionellen Grenze der Verfassungsgerichtsbarkeit her.
II. Neubestimmung des Prozessrechts nach der hier gefundenen Lösung
269
es im Grundgesetz in Art. 41 vorgesehen ist. Soweit das Wahlprüfungsverfahren einschlägig ist, verdrängt es als spezielleres Verfahren das Organstreitverfahren.131 Das Wahlprüfungsverfahren stellt sich als Verfahren dar, in dem das Volk sein Recht auf ein richtiges Wahlergebnis einklagen kann. Denn die „objektive Funktion“ der Wahlprüfungsbeschwerde, die darin liegt, das richtige Wahlergebnis feststellen zu lassen, verwirklicht gerade das Recht des Volkes an einem richtigen Wahlergebnis und der Umsetzung desselben. Die Verbesserung des „subjektiven Wahlrechtsschutzes“ hingegen erweist sich als nicht erforderlich. Da das Wahlrecht kein Individualrecht ist, ist sein Rechtsschutz nicht durch Art. 19 Abs. 4 GG gefordert. Dem Gesetzgeber steht es jedoch frei, den Rechtsweg auch zur Durchsetzung organschaftlicher Rechte zu eröffnen. Durch die Änderung wurde ein bereits bestehendes Verfahren – die Wahlprüfungsbeschwerde – um einen Rechtsschutzaspekt erweitert. Es ist jedoch zu begrüßen, dass der Gesetzgeber auch dem organschaftlichen Wahlrecht durch die Erweiterung des Gegenstandes der Wahlprüfungsbeschwerde zur Durchsetzung verholfen hat. Auch wenn diese Änderung durch die nach hier vertretener Ansicht unzutreffende Annahme motiviert war, das Wahlrecht sei ein Individualrecht, dessen Verletzung aufgrund von Art. 19 Abs. 4 GG umfassend rügbar sein muss, unterstreicht diese neue Rechtschutzmöglichkeit die Bedeutung des Wahlrechts für die Demokratie. Im Zuge der Gesetzesänderung wurde auch das Erfordernis des Beitritts von hundert Wahlberechtigten für die Antragsberechtigung gestrichen. Damit ist nun jeder Wahlberechtigte in der Lage, eine Wahlprüfungsbeschwerde anzustoßen und dadurch das Recht des Volkes zu verteidigen. Auch wenn das Beitrittserfordernis von hundert Wahlberechtigten mehr symbolischer Art gewesen ist, hat es doch zum Ausdruck gebracht, dass hier primär für die Aktivbürgerschaft geklagt wird, die Antragssteller also nicht eigene Rechte, sondern die des Volkes geltend machen. Zudem wurde zur Einlegung eine Wahlprüfungsbeschwerde ein gewisser Aufwand erforderlich gemacht, der nun entfällt. Es sollen damit neuerdings im Wahlprüfungsverfahren Rechtsverletzungen nicht nur des gesamten Volkes, sondern auch der einzelnen Bürger festgestellt werden können. Nicht immer lassen sich diese aber personalisieren. Die Nichtrückführbarkeit der Stimmabgabe auf den einzelnen Wähler kann sich nicht nur dann ergeben, wenn man diesen als Träger eines Individualrechts qualifiziert, sondern auch, wenn man ihn als Organteil und damit als Träger eines organschaftlichen Rechts erkennt. Die tatsächliche prozessuale Unmöglichkeit hat somit den gleichen Ursprung wie die materielle Rechtslage: es ist bei geheimen Wahlen aus tatsächlichen Gründen ausgeschlossen, Rechtsverletzungen, die nach der Stimmabgabe eintreten, zurückzuverfolgen. Darüber kann auch die Einrichtung eines Verfahrens nicht hinweghelfen. Auch der mit dem Gesetz einhergehende „verbesserte“ Schutz des Wahlrechts durch Schaffung von Rechtsbehelfen vor den Verwaltungsgerichten ist verfehlt, weil 131
Auch hier gilt § 49 BWahlG.
270
G. Prozessuale Folgen
es sich bei einer Verletzung des Wahlrechts stets um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit handelt.132
3. Die Verfassungsbeschwerde als Rechtsbehelf zur Durchsetzung des Grundsatzes der allgemeinen Wahl Die Verfassungsbeschwerde ist der einschlägige Rechtsbehelf, wenn es um die Durchsetzung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl geht. Denn dieser enthält ausschließlich ein Individualrecht. Gleiches gilt bei Verletzungen des Grundsatzes der Geheimheit der Wahl, der neben dem organschaftlichen Recht auch ein Individualrecht des einzelnen Wahlberechtigten darauf enthält, dass seine Stimmabgabe geheim bleibt.133 Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch nur dann einschlägig, wenn die Rechtsverletzungen nicht von Verfahrensakten ausgehen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen. Denn in diesen Fällen ist die Wahlprüfungsbeschwerde einschlägig, die auch im Verhältnis zur Verfassungsbeschwerde das speziellere Verfahren darstellt.
III. Ergebnis zu den prozessualen Folgen Die beiden verfassungsgerichtlichen Verfahren, die im Wahlrecht für anwendbar gehalten werden, sind nur teilweise geeignet, den intendierten Zweck zu erfüllen. Indem die Wahlprüfungsbeschwerde, die gegen staatliche Akte, die sich unmittelbar auf das Wahlergebnis beziehen, zur Anwendung kommt, hauptsächlich einen „objektiven Verfahrenszweck“, nämlich die Richtigkeit des Wahlergebnisses verfolgt, sichert sie das Recht des Volkes an einem richtigen Wahlergebnis. Die Verfassungsbeschwerde erweist sich als ungeeignet, das Wahlrecht oder die Wahlgrundsätze zu verteidigen. Sie ist als Verfahren gegen Wahlgesetze einschlägig. Diese betreffen jedoch meist alle Wahlberechtigten gleichermaßen, so dass das Zulässigkeitskriterium der Selbstbetroffenheit faktisch leerläuft und die Verfassungsbeschwerde in die Nähe einer Popularklage rückt. Wenn sie sich gegen Regelungen 132 Wenn B. Hartmann, Volksgesetzgebung und Grundrechte, 2005, S. 198, das Gegenteil annimmt, weil die Wahlbehörden keine Verfassungsorgane seien und deshalb nach der Theorie der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit keine verfassungsrechtliche Streitigkeit vorliege, so zeigt dies nicht, dass eine solche tatsächlich nicht vorliegt, sondern es offenbart nur die Mangelhaftigkeit der Theorie der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit. Diese kann nur in relativ eindeutigen Fällen zur richtigen Unterscheidung von verwaltungs- und verfassungsrechtlichen Streitigkeiten führen. In Zweifelsfällen müssen jedoch differenzierende Kriterien angelegt werden. Hierzu S. Haack, Der Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeit als Prüfstein für Prozessrechtslehre und Verfassungsdogmatik, DVBl. 2014, S. 1566 f.; monografisch hierzu: J. Kraayvanger, Der Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeit im Sinne des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO, 2004. 133 Siehe oben in Abschnitt F. IV. 4., S. 204 f.
III. Ergebnis zu den prozessualen Folgen
271
richtet, die die Gleichheit der Wahl betreffen, aber erst nach der Stimmabgabe eingreifen, ergibt sich die Selbstbetroffenheit des Beschwerdeführers nur aus einer potentiellen Betroffenheit. Lediglich dann, wenn der Grundsatz der allgemeinen Wahl betroffen ist, der tatsächlich ein Individualrecht enthält, ist sie als Individualrechtsbehelf der passende Rechtsbehelf. Im Übrigen stellt sich das Organstreitverfahren als geeignetes Verfahren dar. Nicht immer gehen Verletzungen des Rechts aber von solchen Organen aus, die im Organstreitverfahren parteifähig sind. In diesem Fall ist ein Organstreitverfahren nicht statthaft. Dies ist jedoch deshalb unschädlich, weil das Wahlrecht als organschaftliches Recht nicht der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG unterfällt.
H. Fazit Die Rechtsnatur des Wahlrechts war in unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten umstritten. Während es die einen als Individualrecht betrachteten, das dem Einzelnen zur Verwirklichung seiner Freiheit zusteht, sahen andere die staatliche Funktion, die der Einzelne beim Wählen erfüllt, im Vordergrund. Sie betrachteten es entweder schlicht als staatliche Funktion oder aber sie erkannten eine organschaftliche Qualität des Volkes an und hielten dementsprechend auch das Wahlrecht für ein organschaftliches Recht. Wieder andere sahen beide Seiten dieser Medaille und erkannten eine Doppelnatur des Wahlrechts an. Dementsprechend lassen sich die Meinungen über die Rechtsnatur des Wahlrechts in individual-rechtliche Theorien, funktionale Theorien und Organtheorien sowie dualistische Theorien unterscheiden. Bei den Beratungen über das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass das Wahlrecht ein Individualrecht sei. Es wurde über die Einführung eines entsprechenden Grundrechtsartikels nachgedacht. Dieser wurde letztlich jedoch verworfen, auch weil Unsicherheit darüber bestand, inwieweit ein solcher das Wahlsystem determiniere. In der grundgesetzlichen Literatur und der Rechtsprechung wird das Wahlrecht meist ohne weitere Begründung als Individualrecht betrachtet. Dabei werden die Besonderheiten dieses auf die Staatsorganisation bezogenen Rechts nur selten besonders hervorgehoben; meist lediglich dadurch, dass es besonderen Rechtekategorien zugeordnet wird. Daneben finden sich auch einige wenige Autoren, die das Wahlrecht nicht eindeutig als Individualrecht qualifizieren, sondern entweder eine Doppelnatur des Wahlrechts als Individualrecht und als organschaftliches Recht annehmen oder keine eindeutige Zuordnung vornehmen. Nur sehr selten wird das Wahlrecht als organschaftliches Recht qualifiziert. Unsicherheiten über das Wahlrecht offenbaren sich auch daran, dass die normative Anknüpfung uneinheitlich vorgenommen wird und der Inhalt nicht gesichert ist. Die Begründungsansätze, die für die individual-rechtliche Qualität teilweise angenommen werden, sind jedoch allesamt nicht tragfähig. Das Wahlrecht weist hingegen Besonderheiten auf, die sehr stark gegen die individual-rechtliche Qualität des Wahlrechts und mehr für eine organschaftliche Qualität sprechen. Das Volk wird dann auch in der Literatur und in der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung bisweilen als Staatsorgan qualifiziert. Dies erscheint jedoch mehr als Nebenerzählung zur individual-rechtlichen Sicht auf das Wahlrecht, weil sie nicht näher begründet wird.
H. Fazit
273
Der wahlberechtigte Teil des Volkes, die Aktivbürgerschaft, ist in der grundgesetzlichen Demokratie jedoch tatsächlich Staatsorgan. Sie handelt, wenn sie wählt, für den Staat. Einwände, die in der Literatur gegen die staatsorganschaftliche Qualität des Wahlrechts vorgebracht werden, greifen letztlich nicht durch. Dennoch weist die Aktivbürgerschaft als Staatsorgan einige Besonderheiten auf: Sie ist zum einen das höchste Staatsorgan und damit den anderen Organen nicht gleichgeordnet. Zum anderen ist sie in ihrer Existenz von ihren Organwaltern abhängig. Daneben hat das Volk in seiner Gesamtheit auch andere Rollen inne, in denen es kein Staatsorgan ist. Die Aktivbürgerschaft ist, auch wenn sie nur in Wahlen in Erscheinung tritt, ein ständiges Organ, weil sie nur ständige Mitglieder hat. Die Aktivbürgerschaft hat als Staatsorgan sowohl ein Recht an ihrer Kompetenz zu wählen als auch ein Recht darauf, dass die Wirkungen ihrer Kompetenz auch vollzogen werden, dass also der Bundestag entsprechend dem Wahlergebnis zusammengesetzt wird. Darüber hinaus hat sie auch ein Recht auf ihre Kompetenz, durch Wahlen und Abstimmungen die Staatsgewalt zu legitimieren, das aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG folgt. Das Recht des Einzelnen, zu wählen, erweist sich dann ebenfalls als organschaftliches Recht, weil der Wähler als Teil des Staatsorgans Volk wählt. Seine individuelle Wahlhandlung lässt sich logisch nicht vom Gesamtakt der Wahl durch das Volk in Form seiner Aktivbürgerschaft trennen. Die individuelle Selbstbestimmung des Einzelnen wandelt sich in der Demokratie in ein Mitbestimmungsrecht am Gemeinwesen, das sich primär als Entscheidung über andere darstellt. Daneben muss dem Einzelnen aber stets ein Bereich individueller Freiheit verbleiben, der durch die Grundrechte des Grundgesetzes gesichert ist. Der Bürger ist im Wahlakt jedoch nicht Amtsträger, weil sich das „Amt“ des Wahlberechtigten nicht unabhängig von dem „Amtsträger“ denken lässt, es ist vielmehr von der Person des Wahlberechtigten abhängig. Dennoch hat der Wähler seine Wahlentscheidung nach seinen individuellen Vorstellungen vom Gemeinwohl zu treffen. Es ergibt sich, dass nicht nur das Recht zu wählen kein Individualrecht, sondern ein organschaftliches Recht des Bürgers als Citoyen ist, auch die Wahlgrundsätze enthalten überwiegend keine Individualrechte, weil sie mehrheitlich nur im staatlichen Bereich Wirkung entfalten. Lediglich der Grundsatz der allgemeinen Wahl enthält ausschließlich ein Individualrecht des Bürgers, das darauf gerichtet ist, als Teil der Aktivbürgerschaft anerkannt zu werden; dieses Recht wird durch Art. 38 Abs. 2 GG dann auch umgesetzt. Der Grundsatz der geheimen Wahl enthält in seinen über die Stimmabgabe hinausreichenden Gewährleistungen individual-rechtliche Gehalte. Während das Volk ein Recht auf ein richtiges Wahlergebnis hat und darauf, dass dieses auch umgesetzt wird, steht dem einzelnen Wahlberechtigten lediglich ein Recht darauf zu, an der Wahlentscheidung des Volkes teilzunehmen, nicht jedoch hat er vollumfänglich an den Rechten des Volkes Anteil.
274
H. Fazit
Auch eine Wahlpflicht stellt sich vor dem Hintergrund des organschaftlichen Charakters des Wahlrechts als verfassungsmäßig dar. Sie folgt zwar nicht unmittelbar aus der organschaftlichen Qualität des Rechts, sie könnte jedoch erforderlich werden, weil das Wahlrecht eine Kompetenz beinhaltet, deren Ausübung Voraussetzung für die gesamte Staatorganisation ist. Es würden sich aus einer Wahlpflicht verschiedenartige Grundrechtseingriffe ergeben, die jedoch überwiegend gerechtfertigt sind. Lediglich für den Fall der Kollision einer Wahlpflicht mit Gewissens- der Glaubensverboten wären Ausnahmen zu schaffen. Es ergibt sich beim Wähler, auch wenn er als Person in die staatliche Sphäre aufgenommen wird, keine „Verschmelzung“ von grundrechtlichem und staatsrechtlichem Status. Die Rechtsnatur des Wahlrechts als organschaftliches Recht macht auch ein Überdenken der prozessualen Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Wahlrechts erforderlich, denen bisher die Annahme zugrunde liegt, dass das Wahlrecht ein Individualrecht sei. Auf den zweiten Blick erweisen sich die verfassungsrechtlichen Rechtsbehelfe, die im Wahlrecht vorgesehen sind, jedoch nicht als primär individualrechtsschützend. Der objektive Verfahrenszweck der Wahlprüfung offenbart sich als Schutz des Rechtes des Volkes auf ein richtiges Wahlergebnis. Die Verfassungsbeschwerde erweist sich als ungeeignet, das Wahlrecht zu schützen, weil sich entweder eine gleichzeitige Mitbetroffenheit aller Wahlberechtigten ergibt oder sich eine Rechtsverletzung bei der Wahl nicht auf den Einzelnen zurückführen lässt. Das Organstreitverfahren ist das geeignete Verfahren, die Rechte des Volkes und des einzelnen Bürgers bei der Wahl geltend zu machen. Die Aktivbürgerschaft sollte als oberstes Staatsorgan als parteifähig im Organstreitverfahren anerkannt werden. Ihr sollte die Prozessführungsfähigkeit über eine Prozessstandschaft verschafft werden. Dabei sollte nicht der einzelne Wahlberechtigte, sondern ein Tausendstel der Aktivbürgerschaft in Prozessstandschaft antragsberechtigt sein. Der Aktivbürger wäre dann als Teil eines obersten Staatsorgans im Organgstreitverfahren parteifähig. Ein Organstreitverfahren ist allerdings nur dann statthaft, wenn es auch einen zulässigen Antragsgegner gibt. Dies ist im Fall von verfassungswidrigen Wahlgesetzen und der Nichtfestsetzung des Wahltages, aber auch wenn das Recht des Volkes auf Feststellung und Umsetzung des Wahlergebnisses nicht verwirklicht wird, der Fall, im Falle der Nichtzulassung des einzelnen Wahlberechtigten zur Wahl hingegen nicht. Dies ist jedoch deshalb unschädlich, weil das Wahlrecht als organschaftliches Recht nicht unter die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG fällt und Rechtsschutz deshalb nicht in allen Fällen zur Verfügung stehen muss. Die Anerkennung des Wahlrechts als organschaftliches Recht und die Trennung von Rechten des Volkes und des einzelnen Wahlberechtigten löst die Friktionen, die sich aus einer Qualifizierung des Wahlrechts ergeben. Prozessual würde die Geltendmachung von Verletzungen des Wahlrechts seiner Rechtsnatur entsprechend im Organstreitverfahren den verfassungsprozessualen „Notanker“ des Bundesverfas-
H. Fazit
275
sungsgerichts, alle im Zusammenhang mit Demokratie und Staatlichkeit stehenden Rechte an Art. 38 GG anzuknüpfen, überflüssig machen.
Literaturverzeichnis Abmeier, Klaus, Die parlamentarischen Befugnisse des Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach dem Grundgesetz, Berlin 1984. Achterberg, Norbert, Parlamentsrecht, Tübingen 1984. Adrian, Axel, Grundsatzfragen zu Staat und Gesellschaft am Beispiel des Kinder-/Stellvertreterwahlrechts. Eine rechtliche Untersuchung mit Bezügen zu Demographie, Demoskopie, Psychologie und Philosophie, Berlin 2016. Affolter, Urs, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie und der Begriff der politischen Rechte, Zürich 1948. Albrecht, Wilhelm Eduard, Rezension von Romeo Maurenbrecher: Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts, Göttingische gelehrte Anzeigen 1837, S. 1489 – 1515. Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, 1. Aufl., Baden-Baden 1985. Alexy, Robert, Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, Der Staat 29 (1990), S. 49 – 68. Arndt, Claus, Zum Begriff der Partei im Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, AöR 87 (1962), S. 197 – 239. von Arnim, Hans Herbert, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, Frankfurt am Main 1977. von Arnim, Hans Herbert, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, München 1984. von Arnim, Hans Herbert, Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten. Die Rechtslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juli 2007, DÖV 2007, S. 897 – 906. Auer, Andreas, Les droits politiques dans les cantones suisses, Genf 1978. Augustin, Angela, Das Volk der Europäischen Union. Zu Inhalt und Kritik eines normativen Begriffs, Berlin 2000. Badura, Peter, Über Wahlen. Rudolf Smend zum 90. Geburtstag, AöR 97 (1972), S. 1 – 11. Badura, Peter, § 25 Die parlamentarische Demokratie, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 497 – 540. Badura, Peter, Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 5. Aufl., München 2012. Balzer, Ralph, Republikprinzip und Berufsbeamtentum, Berlin 2009. Battis, Ulrich, Bundesbeamtengesetz, 4. Aufl., München 2009. Bauer, Hartmut, Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, Berlin 1986.
Literaturverzeichnis
277
Bauer, Hartmut/Kahl, Wolfgang, Europäische Unionsbürger als Träger von DeutschenGrundrechten?, JZ 1995, S. 1077 – 1085. Bausback, Winfried, Verfassungsrechtliche Grenzen des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, Frankfurt am Main u. a. 1998. Behrendt, Richard F., Menschenwürde als Problem der sozialen Wirklichkeit, in: Maihofer, Werner; Behrendt, Richard F. (Hrsg.), Die Würde des Menschen, Band II, Untersuchungen zu Art. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 1967. Benda, Ernst/Klein, Eckart/Klein, Oliver, Verfassungsprozessrecht. Ein Lehr- und Handbuch, 3. Aufl., Heidelberg 2012. Bethge, Herbert, Grundfragen innerorganisationsrechtlichen Rechtschutzes, DVBl. 1980, S. 309 – 315. Bethge, Herbert, Zwischenbilanz zum verwaltungsrechtlichen Organstreit, DVBl. 1980, S. 824 – 825. Bethge, Herbert, Die verfassungsrechtliche Problematik der Grundpflichten, JA 1985, S. 249 – 259. Bettermann, Karl August, Zur Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze und zum Rechtsschutz des Bürgers gegen Rechtssetzungsakte der öffentlichen Gewalt. Beiträge zur Art. 19 IV des Grundgesetzes, §§ 90 – 95 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung, AöR 86 (1961), S. 129 – 186. Birkenheier, Manfred, Wahlrecht für Ausländer. Zugleich ein Beitrag zum Volksbegriff des Grundgesetzes, Berlin 1976. Blasche, Sebastian, Die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung. Eine verfassungsdogmatische Untersuchung zu Art. 79 Abs. 3, 2. Var. GG vor dem Hintergrund einer möglichen Einführung von Volksgesetzgebung in das Grundgesetz, Baden-Baden 2006. Bleckmann, Albert, Das Nationalstaatsprinzip im Grundgesetz, DÖV 1988, S. 437 – 444. Bleckmann, Albert, Staatsrecht II. Grundrechte, Köln 1997. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung. Eine Untersuchung zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1964. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Erbracher Studien, Sakularisation und Utopie, Festschrift für Ernst Forsthoff zu 65. Geburtstag, S. 75 – 94. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit, Opladen 1973. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Organ, Organisation, Juristische Person. Kritische Überlegung zu Grundbegriffen und Konstruktionsbasis des staatlichen Organisationsrechts, in: Menger, Christian-Friedrich (Hrsg.), Fortschritte des Verwaltungsrechts, Festschrift für Hans J. Wolff zum 75. Geburtstag, München 1973, S. 269 – 305. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 1529 – 1538.
278
Literaturverzeichnis
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Mittelbare, repräsentative Demokratie als eigentliche Form der Demokratie. Bemerkungen zu Begriff und Verwirklichungsproblemen der Demokratie als Staats- und Regierungsform, in: Müller, Georg (Hrsg.), Staatsorganisation und Staatsfunktionen im Wandel, Festschrift für Kurt Eichenberger zum 60. Geburtstag, Basel u. a. 1982, S. 301 – 328. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, Frankfurt am Main 1986. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, § 22 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Grundlagen von Staat und Verfassung, Heidelberg 1987, S. 887 – 952. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 429 – 496. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, § 34 Demokratische Willensbildung und Repräsentation, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 31 – 53. Bohn, Bastian, Das Verfassungsprozessrecht der Popularklage. Zugleich eine Untersuchung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs der Jahre 1995 bis 2011, Berlin 2012. Borowski, Martin, Parlamentsgesetzliche Änderungen volksbeschlossener Gesetze, DÖV 2000, S. 481 – 490. Boulanger, Werner, Die geschichtlichen Grundlagen der heutigen Verfassungsbeschwerde, Diss. Heidelberg 1954. Braunias, Karl, Das parlamentarische Wahlrecht. Allgemeiner Teil, Bd. II, Berlin u. a. 1932. Breer, Dietmar, Die Mitwirkung von Ausländern an der politischen Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland durch Gewährung des Wahlrechts, insbesondere des Kommunalwahlrechts, Berlin 1982. Breuer, Marten, Verfassungsrechtliche Anforderungen an das Wahlrecht der Auslandsdeutschen, Berlin 2001. Breuer, Marten, Kinderwahlrecht vor dem BVerfG, NVwZ 2002, S. 43 – 44. Bryde, Brun-Otto, Ausländerwahlrecht und grundgesetzliche Demokratie, JZ 1989, S. 257 – 262. Bryde, Brun-Otto, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, Staatswissenschaft und Staatspraxis 5 (1994), S. 305 – 330. Bryde, Brun-Otto, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes als Optimierungsaufgabe, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Demokratie und Grundgesetz, Eine Auseinandersetzung mit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, Baden-Baden 2000, S. 59 – 70. Buchstein, Hubertus, Öffentliche und geheime Stimmabgabe. Eine wahlrechtshistorische und ideengeschichtliche Studie, Baden-Baden 2000. Bugiel, Karsten, Volkswille und repräsentative Entscheidung. Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit von Volksabstimmungen nach dem Grundgesetz, Baden-Baden 1991.
Literaturverzeichnis
279
Bühler, Ottmar, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, Berlin u. a. 1914. Bühler, Ottmar, Zur Theorie des subjektiven öffentlichen Rechts, in: Giacometti, Zaccharia; Schindler, Dietrich (Hrsg.), Festgabe für Fritz Fleiner zum 60. Geburtstag, Tübingen 1927, S. 26 – 58. Burkiczak, Christian, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wahl des Deutschen Bundestages, JuS 2009, S. 805 – 809. Carré de Malberg, Raymond, Contribution à la Théorie générale de l’État spécialement d’après les données fournier par le droit constitutionnel français, Bd. II, Paris 1922. Clemens, Thomas, Politische Parteien und andere Institutionen im Organstreitverfahren, in: Fürst, Walther/Herzog, Roman/Umbach Dieter C. (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Zeidler, Band 2, Berlin u. a. 1987, S. 1260 – 1287. Cˇ opic´, Hans, Grundgesetz und politisches Strafrecht neuer Art. Untersuchungen zur Problematik der Verfassungsmäßigkeit der Tatbestände und Deliktsfolgen der §§ 88 – 98 (incl. § 86), 100d II, 100d III i. V. m. II, 128, 129 StGB, § 20 VereinsG und der Deliktsfolgen gem. §§ 31 – 34, 37, 42e, 42 m, 42 l StGB im Falle ihrer Verknüpfung mit den vorgenannten politischen Straftatbeständen, Tübingen 1967. Cornils, Matthias, Prozeßstandschaft im Verfassungsbeschwerdeverfahren, AöR 125 (2000), S. 45 – 68. Cornils, Matthias, Leitbilder des Abgeordneten — Das Mandat als Lebensberuf oder Zeitengagement?, Jura 2009, S. 289 – 296. Cremer, Hans-Joachim, Rügbarkeit demokratiewidriger Kompetenzverschiebungen im Wege der Verfassungsbeschwerde, NJW 1995, S. 5 – 7. Dagtoglou, Prodromos, Kollegialorgane und Kollegialakte der Verwaltung, Stuttgart 1960. Das Bundesverfassungsgericht, Denkschrift des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juni 1952: Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts, JöR N.F. 6 (1957), S. 144 – 148. Degenhart, Christoph, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht, 30. Aufl., Heidelberg 2012. Demmler, Wolfgang, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, Berlin 1994. Denninger, Erhard, Demonstrationsfreiheit und Polizeigewalt, ZRP 1968, S. 42 – 46. Denninger, Erhard, Polizei in der freiheitlichen Demokratie, Frankfurt am Main u. a. 1968. Depenheuer, Otto, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 90 – 127. Depenheuer, Otto, § 36 Das öffentliche Amt, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 87 – 130. Detterbek, Steffen, Streitgegenstand und Entscheidungswirkungen im öffentlichen Recht. Grundlagen des Verfahrens vor den allgemeinen Verwaltungsgerichten und vor dem Bundesverfassungsgericht, Tübingen 1995. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 – 49. Akten und Protokolle, Bd. 5/I, Ausschuß für Grundsatzfragen, Boppard a. Rh. 1993.
280
Literaturverzeichnis
Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 – 49. Akten und Protokolle, Bd. 5/II, Ausschuß für Grundsatzfragen, Boppard a. Rh. 1993. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 – 49. Akten und Protokolle, Bd. 6, Ausschuß für Wahlrechtsfragen, Boppard a. Rh. 1994. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 – 49. Akten und Protokolle, Bd. 7, Entwürfe zum Grundgesetz, Boppard a. Rh. 1997. Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 – 49. Akten und Protokolle, Bd. 14/II, Hauptausschuß, München 2009. Diemert, Dörte, Der Innenrechtsstreit im öffentlichen Recht und im Zivilrecht, Berlin 2002. Doehring, Karl, Die allgemeinen Regeln des völkerrechtlichen Fremdenrechts und das deutsche Verfassungsrecht, Köln 1963. Doehring, Karl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsvergleichung und des Völkerrechts. Ein Lehrbuch, 3. Aufl., Frankfurt am Main 1984. Dolde, Klaus-Peter, Die politischen Rechte der Ausländer in der Bundesrepublik, Berlin 1972. Dolde, Klaus-Peter, Zur Beteiligung von Ausländern am politischen Willensbildungsprozess, DÖV 1973, S. 370 – 376. Dragunski, Robert/Berg, Wilfried, Die „Partei der Nichtwähler“, JuS 1995, S. 238 – 241. Dreier, Horst, Das Majoritätsprinzip im demokratischen Verfassungsstaat, ZParl 17 (1986), S. 94 – 118. Dreier, Horst, Dimensionen der Grundrechte, Hannover 1993. Dreier, Horst, Grenzen demokratischer Freiheit im Verfassungsstaat, JZ 1994, S. 741 – 752. Dreier, Horst, Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, Jura 1997, S. 249 – 257. Dreier, Horst (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Band I, Präambel, Art. 1 – 19, 3. Aufl., Tübingen 2013. Dreier, Horst (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Band II, Art. 20 – 82, 3. Aufl., Tübingen 2015. Duguit, Léon, Traité de droit constitutionnel. La règle de droit: le problème de l‘État, Bd. I, Paris 1911. Duguit, Léon, Traité de droit constitutionnel. La théorie générale de l‘État, Bd. II, Paris 1911. Dürig, Günter, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde. Entwurf eines praktischen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des Grundgesetzes, AöR 42 (1956), S. 117 – 157. Dustmann, Ulrike, Die Regelung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Kommunalverfassungen der Flächenstaaten der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main u. a. 2000. Ebsen, Ingwer, Abstimmungen des Bundesvolkes als Verfassungsproblem, AöR 110 (1985), S. 2 – 29.
Literaturverzeichnis
281
Emde, Ernst Thomas, Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung. Eine verfassungsrechtliche Studie anhand der Kammern, der Sozialversicherungsträger und der Bundesanstalt für Arbeit, Berlin 1991. Enders, Christoph, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung. Zur Dogmatik des Art. 1 GG, Tübingen 1997. Engelken, Klaas, Der Bürgerentscheid im Rahmen des Verfassungsrechts. Vom Unterschied zwischen Wahlen und Abstimmungen, DÖV 2002, S. 977 – 984. Enneccerus, Ludwig/Nipperdey, Hans Carl, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Erster Halbband: Allgemeine Lehren, Personen, Rechtsobjekte, Tübingen 1959. Ennuschat, Jörg, Volksgesetzgebung in den Ländern, in: Kluth, Winfried (Hrsg.), Gesetzgebung, Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle, Heidelberg 2014, S. 699 – 727. Epiney, Astrid, Der status activus des citoyen, Der Staat 34 (1995), S. 557 – 585. Epping, Volker, Grundrechte, 6. Aufl., Berlin 2015. Epping, Volker/Hillgruber, Christian, Grundgesetz. Kommentar, 2. Aufl., München 2013. Erichsen, Hans-Uwe, Die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes, Jura 1983, S. 635 – 647. Erichsen, Hans-Uwe, Wahlsysteme, Jura 1984, S. 22 – 34. Erichsen, Hans-Uwe, Der Innenrechtsstreit, in: Erichsen, Hans-Uwe/Hoppe, Werner/von Mutius, Albert (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, Köln u. a. 1985, S. 211 – 233. Esmein, Adhémar, Éléments de droit constitutionnel français et comparé. La liberté modèrne: principes et institutions, Bd. I, 7. Aufl., Paris 1921. Esmein, Adhémar, Éléments de droit constitutionnel français et comparé. La liberté modèrne: principes et institutions, Bd. I, 8. Aufl., Paris 1927. Fischer, Hans G., Rechtsschutz der Bürger bei Einwohneranträgen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, DÖV 1996, S. 181 – 189. Fleiner, Fritz, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 2. Aufl., Tübingen 1912. Fleiner, Fritz, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl., Tübingen 1928. Fleiner, Fritz/Giacometti, Zaccaria, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 1949. Flitsch, Michael, Die Funktionalisierung der Kommunikationsgrundrechte, Berlin 1998. Forsthoff, Ernst, Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, München 1971. Franzke, Hans-Georg, Der Schutz des aktiven Wahlrechts durch die Verwaltungsgerichte, DVBl. 1980, S. 730 – 736. Frenz, Walter, Die Zugehörigkeit der demokratischen Teilhabe zur gesellschaftlichen Sphäre, Rechtstheorie 24 (1993), S. 513 – 530. Frenz, Walter, Wahlrecht – Wahlpflicht?, ZRP 1994, S. 91 – 93.
282
Literaturverzeichnis
Fromme, Friedrich Karl, Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz. Die verfassungspolitischen Folgerungen des Parlamentarischen Rates aus Weimarer Republik und nationalsozialistischer Diktatur, Tübingen 1960. Frowein, Jochen Abr., Rechtsgutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen (Dreier-Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, Bonn 1968. Frowein, Jochen Abr., Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht, AöR 99 (1974), S. 72 – 110. Fügemann, Malte W., Der Gemeindebürger als Entscheidungsträger. Zur Organstellung der Bürgerschaft, DVBl. 2004, S. 343 – 351. Funke, Andreas, Wahlrecht, Republik, politische Freiheit. Zur Begründung des Rechts auf Wahl nach Art. 38 GG, Der Staat 46 (2007), S. 395 – 419. Fuß, Ernst-Werner, Die Nichtigerklärung der Volksbefragungsgesetze von Hamburg und Bremen, AöR 44 (1958), S. 383 – 422. Gärditz, Klaus Ferdinand/Hillgruber, Christian, Volkssouveräntiät ernst genommen – Zum Lissabonurteil des BVerfG, JZ, S. 872 – 881. Gassner, Ulrich M., Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1. S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 – 453. Geffcken, Heinrich, Die Wahlpflicht, ZfP 2 (1909), S. 159 – 185. Giacometti, Zaccaria, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zürich 1941. Giacometti, Zaccaria, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. I, Zürich 1960. Goessl, Manfred, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes. Eine Untersuchung des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes und der zu seiner Ausführung ergangenen Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, Berlin 1961. Görres-Gesellschaft, Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Bd. V, Sozialindikatoren – Zwingli, 7. Aufl. Graf von Kielmannsegg, Peter, Volkssouveränität. Eine Untersuchung der Bedingungen demokratischer Legitimität, Stuttgart 1977. Graf von Kielmannsegg, Peter, Das Experiment der Freiheit. Zur gegenwärtigen Lage des demokratischen Verfassungsstaates, Stuttgart 1998. Graf von Kielmannsegg, Sebastian, Grundrechte im Näheverhältnis. Eine Untersuchung zur Dogmatik des Sonderstatusverhältnisses, Tübingen 2012. Graf von Kielmansegg, Sebastian, Das Sonderstatusverhältnis, JA 2012, S. 881 – 886. Graichen, Herbert, Das Wahlrecht in der repräsentativen Demokratie unter besonderer Berücksichtigung der Wahlreformfrage, Bamberg 1932. Grawert, Rolf, Normenkontrolle im Wahlprüfungsverfahren, DÖV 1968, S. 748 – 758. Grawert, Rolf, Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft, Der Staat 1984, S. 179 – 205. Grawert, Rolf, § 16 Staatsvolk und Staatsangehörigkeit, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 107 – 141.
Literaturverzeichnis
283
Grawert, Rolf, § 81 Wechselwirkungen zwischen Bundes- und Landesgrundrechten, in: Merten, Detlef; Papier, Hans-Jürgen (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III, Allgemeine Lehren II, Heidelberg 2009, S. 1033 – 1095. Grefrath, Holger, Exposé eines Verfassungsprozessrechts von den Letztfragen? Das LissabonUrteil zwischen actio pro socio und negativer Theologie, AöR 135 (2010), S. 221 – 250. Greifeld, Andreas, Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unabhängigkeit der Abgeordneten, Der Staat 23 (1984), S. 501 – 521. Greifeld, Andreas, Zur Entstehung des Staatswillens aus dem Bürgerwillen nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes, in: Marko, Joseph; Stolz, Armin (Hrsg.), Demokratie und Wirtschaft, Wien u. a. 1987, S. 123 – 138. Grimm, Dieter, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union. Zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Der Staat 48 (2009), S. 475 – 496. Grimmer, Klaus, Demokratie und Grundrechte. Elemente zu einer Theorie des Grundgesetzes, Berlin 1980. Groß, Thomas, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, Tübingen 1999. Groß, Thomas, Postnationale Demokratie. Gibt es ein Menschenrecht auf transnationale Selbstbestimmung?, Rechtswissenschaft 2011, S. 125 – 153. Großfeld, Bernhard, Götterdämmerung? Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts, NJW 1995, S. 1719 – 1723. Großfeld, Bernhard, Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz, NJW 1998, S. 3544 – 3547. Grote, Rainer, Der Verfassungsorganstreit. Entwicklung, Grundlagen, Erscheinungsformen, Tübingen 2010. Grzeszick, Bernd, Verfassungsrechtliche Grundsätze des Wahlrechts, Jura 2014, S. 1110 – 1123. Guckelberger, Anette, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze Teil I. Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit und Geheimheit der Wahl, JA 2012, S. 561 – 566. Guckelberger, Annette, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze Teil II. Gleichheit und Öffentlichkeit der Wahl, JA 2012, S. 641 – 646. Gusy, Christoph, Das Mehrheitsprinzip im demokratischen Staat, AöR 106 (1981), S. 329 – 354. Gusy, Christoph, Die Verfassungsbeschwerde, in: Badura, Peter; Dreier, Horst (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungsprozeß, Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Band I, Tübingen 2001, S. 641 – 671. Haack, Stefan, Verlust der Staatlichkeit, Tübingen 2007. Haack, Stefan, Wahlpflicht und Demokratie, KritV 2011, S. 80 – 96. Haack, Stefan, Demokratie mit Zukunft? Zwei Alternativen der Neukonzeption einer Staatsform, JZ 2012, S. 753 – 763. Haack, Stefan, Der Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeit als Prüfstein für Prozessrechtslehre und Verfassungsdogmatik, DVBl. 2014, S. 1566 – 1572.
284
Literaturverzeichnis
Haas, Klaus, Wahlrecht und verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz, VwBlBW 1990, S. 71 – 73. Häberle, Peter, Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL 30 (1972), S. 43 – 141. Häberle, Peter, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Ein Beitrag zur pluralistischen und „prozessualen“ Verfassungsinterpretation, JZ 1975, S. 297 – 305. Häberle, Peter, Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit des Abgeordnetenstatus. Zum Diätenurteil des BVerfG, NJW 1976, S. 537 – 543. Häberle, Peter, Die europäische Verfassungsstaatlichkeit, KritV 1995, S. 298 – 312. Häberle, Peter, § 22 Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 317 – 367. Habermas, Jürgen, Zur Prinzipienkonkurrenz von Bürgergleichheit und Staatengleichheit im supranationalen Gemeinwesen. Eine Notiz aus Anlass der Frage nach der Legitimität der ungleichen Repräsentation der Bürger im Europäischen Parlament, Der Staat 53 (2014), S. 167 – 192. Hartmann, Bernd J., Volksgesetzgebung: Ausüben von Staatsgewalt oder Ausleben von Freiheit?, DVBl. 2006, S. 1269 – 1277. Hartmann, Bernd J., Eigeninteresse und Gemeinwohl bei Wahlen und Abstimmungen, AöR 134 (2009), S. 1 – 34. Hartmann, Bernd J., Volksgesetzgebung und Grundrechte, Berlin 2011. Hatschek, Julius, Kommentar zum Wahlgesetz und zur Wahlordnung im Deutschen Kaiserreich, Berlin 1920. Hattenhauer, Hans, Über das Minderjährigenwahlrecht, JZ 1996, S. 9 – 16. Heckmann, Dirk, Persönlichkeitsschutz im Internet. Anonymität der IT-Nutzung und permanente Datenverknüpfung als Herausforderungen für Ehrschutz und Profilschutz, NJW 2012, S. 2631 – 2635. Hellermann, Johannes, Die sogenannte negative Seite der Freiheitsrechte, Berlin 1993. Henke, Wilhelm, Staatsrecht, Politik und verfassungsgebende Gewalt, Der Staat 19 (1980), S. 181 – 211. Henke, Wilhelm, Die Republik. § 21, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Grundlagen von Staat und Verfassung, Heidelberg 1987, S. 863 – 886. Henkel, Joachim, Wahlrecht für Deutsche im Ausland, AöR 99 (1974), S. 1 – 31. Henseler, Peter, Verfassungsrechtliche Aspekte zukunftsweisender Parlamentsentscheidungen, AöR 108 (1983), S. 490 – 560. Herrmann, Klaus, Volksgesetzgebungsverfahren. Verfassungstheoretische Untersuchung der Rechtsstellung der Stimmberechtigten sowie der Zuständigkeiten der Abstimmungsorgane und Abstimmungsbehörden, Frankfurt am Main u. a. 2003. Herzog, Roman, Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit eines Verhältniswahlsystems in (kleinen) Mehrmandatswahlkreisen dem Bundesminister des Innern, Bonn 1968.
Literaturverzeichnis
285
Herzog, Roman, Allgemeine Staatslehre, Frankfurt am Main 1971. Herzog, Roman, Stellung des Bundesrates im demokratischen Verfassungsstaat. § 57, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 943 – 964. Hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl., Heidelberg 1999. Heun, Werner, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie. Grundlagen, Struktur, Begrenzungen, Berlin 1983. Heun, Werner, Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 2012. Heusch, Andreas, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Staatsorganisationsrecht, Berlin 2003. Heyen, Erk Volkmar, Über Gewissen und Vertrauen des Abgeordneten, Der Staat 25 (1986), S. 35 – 54. von Heyl, Arnulf, Wahlfreiheit und Wahlprüfung, Berlin 1975. Hiller, Christoph, Die Stimmrechtsbeschwerde, Zürich 1990. Hillgruber, Christian/Goos Christoph, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl., Heidelberg u. a. 2011. Hillner, Hans Christian, Kurt Georg Wernicke †, NJW 1998, S. 1469. Höfling, Wolfram, Demokratische Grundrechte. Zu Bedeutungsgehalt und Erklärungswert einer dogmatischen Kategorie, Der Staat 33 (1994), S. 493 – 510. Hohm, Karl-Heinz, Grundrechtsträgerschaft und „Grundrechtsmündigkeit“ am Beispiel öffentlicher Heimerziehung, NJW 1986, S. 3107 – 3115. Holste, Heiko, Wahlrecht von Geburt an: Demokratie auf Abwegen?, DÖV 2005, S. 110 – 115. Horn, Hans-Detlef, § 22 Demokratie, in: Depenheuer, Otto; Grabenwarter, Christoph (Hrsg.), Verfassungstheorie, Tübingen 2010, S. 743 – 776. Huber, Ernst R., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bismarck und das Reich, 3. Aufl., Stuttgart u. a. 1988. Huber, Hans, Die Garantie der individuellen Verfassungsrechte, Zeitschrift für schweizerisches Recht 55 (1936), S. 1a-200a. Huber, Peter M., Selbstbestimmung in Europa, ZSE 11 (2013), S. 484 – 505. Hufen, Friedhelm, Staatsrecht II. Grundrechte, 4. Aufl., München 2014. Hüfler, Thomas, Wahlfehler und ihre materielle Würdigung, Diss. Berlin 1979. Hüler, Georg, Rechttschutzprobleme beim Bürgerbegeheren, Diss. Würzburg 1999. Ipsen, Jörn, Nachwahl und Wahlrechtsgleichheit, DVBl. 2005, S. 1465 – 1469. Ipsen, Jörn, Grundzüge einer Grundrechtsdogmatik. Zugleich Erwiderung auf Robert Alexy: „Jörn Ipsens Konstruktion der Grundrechte“, Der Staat 52 (2013), S. 266 – 293. Ipsen, Jörn, Wahlrecht im Spannungsfeld von Politik und Verfassungsgerichtsbarkeit, DVBl. 2013, S. 265 – 274.
286
Literaturverzeichnis
Isensee, Josef, Der Dualismus von Staat und Gesellschaft, in: Böckenförde, Ernst-Wolfgang (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, Darmstadt 1976, S. 317 – 329. Isensee, Josef, Grundrechte und Demokratie. Die polare Legitimation im grundgesetzlichen Gemeinwesen, Der Staat 20 (1981), S. 161 – 176. Isensee, Josef, Republik – Sinnpotential eines Begriffs. Begriffsgeschichtliche Stichproben, JZ 1981, S. 1 – 7. Isensee, Josef, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers. Ein grundgesetzliches Interpretationsvakuum, DÖV 1982, S. 609 – 618. Isensee, Josef, Demokratie – verfassungsrechtlich gezähmte Utopie, in: Matz, Ulrich (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen der repräsentativen Demokratie, Köln u. a. 1985, S. 43 ff. Isensee, Josef, Abschied der Demokratie vom Demos. Ausländerwahlrecht als Identitätsfrage für Volk, Demokratie und Verfassung, in: Schwab, Dieter (Hrsg.), Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft, Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat, Berlin 1989, S. 705 – 740. Isensee, Josef, Gemeinwohl im Verfassungsstaat. § 71, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IV, Aufgaben des Staates, Heidelberg 2006, S. 3 – 81. Isensee, Josef, § 190 Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen an die Grundrechtsausübung, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX, Allgemeine Grundrechtslehren, 3. Aufl., Heidelberg 2011, S. 265 – 411. Isensee, Josef, § 191 Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX, Allgemeine Grundrechtslehren, 3. Aufl., Heidelberg 2011, S. 413 – 568. Isensee, Josef/Schmidt-Jortzig, Edzard, Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht. Dokumentation der Verfahren, Heidelberg 1993. Jahrreiß, Hermann, Demokratie. Selbstbewusstheit – Selbstgefährdung – Selbstschutz (Zur deutschen Verfassungsproblematik seit 1945), in: Thoma, Richard (Hrsg.), Festschrift für Richard Thoma, Dargebracht von Freunden, Schülern und Fachgenossen, Tübingen 1950, S. 71 – 91. Janssen, Albert, Die verfassungsrechtliche Bedeutung des Volkswillens für die Legitimation der Staatsgewalt. Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 20 Abs. 2 GG, DÖV 2010, S. 949 – 960. Jarass, Hans D., Bausteine einer umfassenden Grundrechtsdogmatik, AöR 120 (1995), S. 345 – 381. Jarass, Hans D., § 38 Funktionen und Dimensionen der Grundrechte, in: Merten, Detlef; Papier, Hans-Jürgen (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band II, Allgemeine Lehren I, Heidelberg 2006, S. 625 – 654. Jellinek, Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl., Tübingen 1905. Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 7. Neudruck der 3. Aufl. von 1914, Bad Homburg v.d.H. 1960.
Literaturverzeichnis
287
Jellinek, Georg, Mirabeau und das demokratische Wahlrecht. Geschichte eines Zitats, in: Jellinek, Georg (Hrsg.), Gesammelte Schriften und Reden, Band 2, Aalen 1970, S. 82. Jescheck, Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin 1996. Jestaedt, Matthias, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung. Entscheidungsteilhabe Privater an der öffentlichen Verwaltung auf dem Prüfstand des Verfassungsprinzips Demokratie, Berlin 1993. Jestaedt, Matthias, Warum in die Ferne schweifen, wenn der Maßstab liegt so nah? Verfassungshandwerkliche Anfragen an das Lissabon-Urteil des BVerfG, Der Staat 48 (2009), S. 497 – 516. Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus (Hrsg.), Münchener Kommentar zum StGB, Band 3, §§ 80 – 184 g StGB, 2. Aufl., München 2012. Junck, Robert, Strafrechtliche Grenzen der Beeinflussung von Wählern im Wahlkampf. Ein Beitrag zur Dogmatik der §§ 108 bis 108b StGB unter Berücksichtigung von kriminologischen und kriminalpolitischen Aspekten, Diss. Hamburg 1995. Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz. Loseblatt, Band II, Art. 4 – 6 I, Heidelberg , Stand: 170. Lieferung (Dezember 2014). Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz. Loseblatt, Band V, Art. 20, Heidelberg , Stand: 170. Lieferung (Dezember 2014). Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz. Loseblatt, Band VIII, Art. 34 – 45, Heidelberg , Stand: 170. Lieferung (Dezember 2014). Kaisenberg, Georg, Art. 125, Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis, in: Nipperdey, Hans Carl (Hrsg.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Kommentar zum 2. Teil der Reichsverfassung, Band 2, Art. 118 – 142, Berlin 1930, S. 161 – 175. Karpenstein, Peter, Die Wahlprüfung und ihre verfassungsrechtlichen Grundlagen, Mainz 1962. Katz, Alfred, Staatsrecht. Grundkurs im Öffentlichen Recht, 18. Aufl., Heidelberg u. a. 2010. Keitz, Werner, Der Schutz des subjektiven Wahlrechts nach Art. 38 GG gegen Verletzung durch Wahlverfahrensakte im Verlauf der Bundestagswahl, Diss. München 1971. Kelsen, Hans, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen 1911. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920. Kelsen, Hans, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925. Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre. Einführung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig 1934. Kelsen, Hans, Allgemeine Theorie der Normen. Herausgegeben von Kurt Ringhofer und Robert Walter, Wien 1979. Kempen, Bernhard, Grundgesetz oder neue deutsche Verfassung?, NJW 1991, S. 964 – 967.
288
Literaturverzeichnis
Kersten, Jens, Georg Jellineks System – Eine Einleitung. Einleitung zu: Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Nachdruck der 2. durchgesehenen und vermehrten Auflage von 1905, hrsgg. und eingeleitet von Jens Kersten, Tübingen 2011. Kind, Klaus, Die rechtliche Stellung des Volkes in der Demokratie, Bielefeld 1955. Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich/Albrecht, Hans-Jörg (Hrsg.), Strafgesetzbuch. Kommentar, Band 2, §§ 80 – 231, 4. Aufl., Baden-Baden 2013. Kirchhof, Paul, § 21 Die Identität der Verfassung in ihren unabänderlichen Inhalten, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 261 – 316. Kirchhof, Paul, Die Gleichheit als staatsrechtlicher Auftrag, in: Palm, Ulrich; Mellinghoff, Rudolf (Hrsg.), Gleichheit im Verfassungsstaat, Symposion aus Anlass des 65. Geburtstages von Paul Kirchhof, Heidelberg 2008, S. 1 – 22. Kirchhof, Paul, § 181 Allgemeiner Gleichheitssatz, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VIII, Grundrechte: Wirtschaft, Verfahren, Gleichheit, 3. Aufl., Heidelberg 2010, S. 697 – 838. Kisker, Gunter, Insichprozeß und Einheit der Verwaltung. Zur Frage der Zulässigkeit von Insichprozessen vor den Verwaltungsgerichten, Baden-Baden 1968. Klein, Eckart, Zur objektiven Funktion der Verfassungsbeschwerde, DÖV 1982, S. 797 – 805. Klein, Eckart, Verfassungsprozeßrecht. Versuch einer Systematik an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 108 (1983), S. 561 – 624. Klein, Eckart/Giegerich, Thomas, Grenzen des Ermessens bei der Bestimmung des Wahltages, AöR 112 (1987), S. 544 – 585. Klein, Hans H., Zur Auslegung des Rechtsbegriffs der „öffentlichen Sicherheit und Ordnung“, DVBl. 1971, S. 233 – 243. Klein, Hans H., Grundrechte im demokratischen Staat. Kritische Bemerkungen zur Auslegung der Grundrechte in der deutschen Staatsrechtslehre der Gegenwart, Stuttgart u. a. 1972. Klein, Hans H., § 50 Stellung und Aufgaben des Bundestages, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 711 – 740. Klein, Hans H., § 51 Der Status des Abgeordneten, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 741 – 767. Klein, Norbert, Grundrechte und Wesensgehaltsgarantie im besonderen Gewaltverhältnis, DVBl. 1987, S. 1102 – 1110. Kloepfer, Michael, § 42 Öffentliche Meinung, Massenmedien, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 389 – 424. Kloepfer, Michael, Verfassungsrecht. Grundlagen, Staatsorganisationsrecht, Bezüge zum Völker- und Europarecht, Bd. I, München 2011. Kloepfer, Michael, Verfassungsrecht. Grundrechte, Bd. II, München 2010.
Literaturverzeichnis
289
Klosa, Anette/Scholze-Stubenrecht, Werner/Wermke, Matthias, Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 6. Aufl., Mannheim u. a. 1998. Knies, Wolfgang, Auf dem Weg in den „verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat“?,. Das Bundesverfassungsgericht und die gewaltenteilende Kompetenzordnung des Grundgesetzes, in: Burmeister, Joachim (Hrsg.), Verfassungsstaatlichkeit, Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag, München 1997. Kögl, Michael, Religionsgeprägte Kleidung des Lehrers. Eine Betrachtung der Neutralitätspflicht des Staates und der Religionsfreiheit im Sonderstatusverhältnis, Frankfurt am Main u. a. 2006. Kokott, Juliane, Deutschland im Rahmen der Europäischen Union. Zum Vertrag von Maastricht, AöR 119 (1994), S. 207 – 237. Korioth, Stefan, Besprechung von Rainer Grote: Der Verfassungsorganstreit, AöR 137 (2012), S. 295 – 298. Köttgen, Arnold, Das anvertraute öffentliche Amt, in: Hesse, Konrad/Reicke, Siegfried/ Scheuner, Ulrich (Hrsg.), Staatsverfassung und Kirchenordnung, Festgabe für Rudolf Smend zum 80. Geburtstag am 15. Januar 1962, Tübingen 1962, S. 119 – 149. Kraayvanger, Jan, Der Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeit im Sinne des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO, Berlin 2004. Krause, Peter, Freies Mandat und Kontrolle der Abgeordnetentätigkeit. Zu Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Disziplinierung des Mandatsmißbrauchs, DÖV 1974, S. 325 – 337. Krause, Peter, § 35 Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 55 – 85. Krebs, Walter, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, in: Erichsen, HansUwe/Hoppe, Werner/von Mutius, Albert (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, Köln u. a. 1985, S. 191 – 210. Kriele, Martin, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL 29 (1971), S. 46 – 80. Kriele, Martin, Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 6. Aufl., Stuttgart u. a. 2003. Krüger, Herbert, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl., Stuttgart u. a. 1966. Krüger, Herbert, Verfassungsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen, in: Ehmke, Horst, Kaiser, Joseph H./Kewenig, Wilhelm A./Meesen Karl Matthias/Rüfner, Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Ulrich Scheuner zum 70 Geburtstag, Berlin 1973, S. 285 – 306. Krüger, Hildegard, Grundrechtsausübung durch Jugendliche (Grundrechtsmündigkeit) und elterliche Gewalt, FamRZ 1956, S. 329 – 335. Krüger, Wolfgang/Rauscher, Thomas (Hrsg.), Münchener Kommentar zur ZPO. §§ 1 – 354, Band I, München 2013. Krüper, Julian, Wahlrechtsmathematik als gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, Jura 2013, S. 1147 – 1158. Küchenhoff, Erich/Küchenhoff, Günther, Allgemeine Staatslehre, 8. Aufl., Stuttgart u. a. 1977.
290
Literaturverzeichnis
Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, Tübingen 1876. Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 5. Aufl., Tübingen 1911. Labrenz, Christoph, Die Wahlpflicht – unbeliebt, aber nicht unzulässig, ZRP 44 (2011), S. 214 – 218. Lamers, Karl A., Repräsentation und Integration der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Wahlrechts. Zugleich eine rechtsvergleichende Studie über das Kommunalwahlrecht in den Staaten der Europäischen Gemeinschaften, Berlin 1977. Lang, Gerhard, Das Problem der Wahl- und Stimmpflicht und seine Lösung im geltenden Recht der europäischen Staaten und seine Grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg i. B. 1962. Lang, Heinrich, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, Berlin 1997. Lang, Heinrich/Grzeszick, Bernd, Wahlrecht als materielles Verfassungsrecht. Der Wahlgesetzgeber zwischen verfassungsrechtlicher Bindung und politischer Gestaltungsfreiheit – Überlegungen am Beispiel des 19. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlrechts, BadenBaden 2012. Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus (Hrsg.), Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 4, §§ 80 bis 109k, 12. Aufl., Berlin 2007. Lehner, Roman, Die „Integrationsverfassungsbeschwerde“ nach Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG. Prozessuale und materiell-rechtliche Folgefragen zu einer objektiven Verfassungswahrungsbeschwerde, Der Staat 52 (2013), S. 535 – 562. Leibholz, Gerhard, Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des Repräsentativsystems. Ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Verfassungslehre, Berlin und Leipzig 1929. Leibholz, Gerhard, Der Status des Bundesverfassungsgerichts. Einleitung, JöR N.F. 6 (1957), S. 110 – 119. Leisner, Walter, Öffentliches Amt und Berufsfreiheit, AöR 93 (1968), S. 161 – 199. Leisner, Walter, Das Volk. Realer oder fiktiver Souverän?, Berlin 2005. Lenz, Christopher, Das BVerfG zwischen Selbstentlastung und Selbstbelastung. Zum Ausschluß der Verfassungsbeschwerde bei Länderwahlen, NJW 1999, S. 34 – 35. Lewin, Thomas, On the duties of voters and on the vote by ballot, London 1837. Liermann, Hans, Das deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichsstaatsrecht der Gegenwart, Berlin u. a. 1927. Lorenz, Dieter, Der Organstreit vor dem Bundesverfassungsgericht, in: Starck, Christian (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Festgabe aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens des BVerfG, Band I, Tübingen 1976, S. 225 – 259. Lorenz, Dieter, Verwaltungsprozeßrecht, Berlin u. a. 2000. Loschelder, § 202 Grundrechte im Sonderstatus, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX, Allgemeine Grundrechtslehren, 3. Aufl., Heidelberg 2011, S. 1077 – 1109.
Literaturverzeichnis
291
Loschelder, Hansjörg, Das aktive Wahlrecht und die Rechtsweggarantie des Artikels 19 Absatz 4 GG, Diss. Münster 1968. Löw, Konrad, Was bedeutet „Republik“ in der Bezeichnung „Bundesrepublik Deutschland“, DÖV 1979, S. 819 – 822. Löwer, Wolfgang, § 70 Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 1285 – 1526. Luchterhandt, Otto, Grundpflichten als Verfassungsproblem in Deutschland. Geschichtliche Entwicklung und Grundpflichten unter dem Grundgesetz, Berlin 1988. Luhmann, Niklas, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, 2. Aufl., Berlin 1974. Mahon, Paul, La citoyenneté active en droit public suisse, in: Thürer, Daniel/Aubert, JeanFrançois/Müller, Jörg P. (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, S. 335 – 347. Maihofer, Werner, Menschenwürde im Rechtsstaat, in: Maihofer, Werner; Behrendt, Richard F. (Hrsg.), Die Würde des Menschen, Band I, Untersuchungen zu Art. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Hannover 1967. von Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, Band I, Berlin u. a. 1957. von Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Band I, Präambel, Art. 1 – 19, München 2010. von Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Band II, Art. 20 – 82, München 2010. von Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Band III, Art. 83 – 146, München 2010. Masing, Johannes, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts. Europäische Impulse für eine Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht, Berlin 1997. Maunz, Theodor, Deutsches Staatsrecht, München 1951. Maunz, Theodor, Deutsches Staatsrecht, 21. Aufl., München 1977. Maunz, Theodor/Dürig, Günter, Grundgesetz. Loseblatt-Kommentar, München, Stand: 72. Lieferung (Juli 2014). Maunz, Theodor/Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Klein, Franz/Bethge, Herbert (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Kommentar, München Stand: 44. Lieferung (Juli 2014). Maurer, Hartmut, Plebiszitäre Elemente in der repräsentativen Demokratie, Heidelberg 1997. Maurer, Hartmut, Staatsrecht I. Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, 6. Aufl., München 2010. Mayer, Otto, Die Lehre vom öffentlichen Vertrage, AöR 3 (1888). Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. I, Leipzig 1895. Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. I, 3. Aufl., München 1924.
292
Literaturverzeichnis
Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. II, 3. Aufl., München 1924. Mehlhorn, Lutz, Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich, Baden-Baden 2010. Meixner, Gerhart, Plädoyer für ein „höchstpersönliches Elternwahlrecht zugunsten des Kindes“, ZParl 44 (2013), S. 419 – 426. Menger, Christian-Friedrich, Zur verfassungsrechtlichen Stellung der deutschen politischen Parteien, AöR 39 (1952), S. 149 – 162. Merten, Detlef, Wahlrecht und Wahlpflicht, in: Listl, Joseph; Schambeck, Herbert (Hrsg.), Demokratie in Anfechtung und Bewährung, Festschrift für Johannes Broermann, Berlin 1982, S. 301 – 315. Merten, Detlef, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996), S. 7 – 47. Meyer, Georg, Das parlamentarische Wahlrecht, Berlin 1901. Meyer, Georg/Anschütz, Gerhard, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts. Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von Gerhard Anschütz, 7. Aufl., Leipzig 1919. Meyer, Hans, Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes, VVDStRL 33 (1975). Meyer, Hans, Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlaß der Bundestagswahl 1994, KritV 1994, S. 312 – 362. Meyer, Hans, Wahlsystem und Verfassungsordnung. Bedeutung und Grenzen wahlsystematischer Gestaltung nach dem Grundgesetz, Goldbach 1973 (Nachdruck 1996). Meyer, Hans, § 45 Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 521 – 542. Meyer, Hans, § 46 Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 543 – 603. Mill, John Stuart, Considerations on representative government, London 1861. Möllers, Christoph, Gewaltengliederung. Legitimation und Dogmatik im nationalen und internationalen Rechtsvergleich, Tübingen 2005. Morlok, Martin, Demokratie und Wahlen, in: Badura, Peter; Dreier, Horst (Hrsg.), Klärung und Fortbildung des Verfassungsrechts, Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Band II, Tübingen 2001, S. 559 – 608. Morlok, Martin/Hientzsch, Christina, Das Parlament als Zentralorgan der Demokratie. Eine Zusammenschau der einschlägigen parlamentsschützenden Normen, JuS 2011, S. 1 – 9. Müller, Friedrich, Wer ist das Volk? Die Grundfrage der Demokratie, Berlin 1997. Müller, Ulrike/Mayer, Karl-Georg/Wagner, Ludwig, Wider die Subjektivierung objektiver Rechtspositionen im Bund-Länder-Verhältnis. Zugleich ein Beitrag zu neueren Entwicklungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung, der Finanzverfassung und des bundes-/ länderfreundlichen Verhaltens – 3. Teil, VerwArch 94 (2003), S. 295 – 318.
Literaturverzeichnis
293
Müller-Franken, Sebastian, Familienwahlrecht und Verfassung. Veränderungen des Wahlrechts zugunsten von Familien als Reaktion auf den „demographischen Wandel“ auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts, Tübingen 2013. Münch, Fritz, Die Menschenwürde als Grundforderung unserer Verfassung. Akademische Antrittsvorlesung, gehalten am 19. Nov. 1951 in der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn, Bocholt 1952. Murswiek, Dietrich, Die verfassunggebende Gewalt nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1978. Murswiek, Dietrich, Art. 38 GG als Grundlage eines Rechts auf Achtung des unabänderlichen Verfassungskerns, JZ 2010, S. 702 – 708. von Mutius, Albert, Grundrechtsfähigkeit, Jura 1983, S. 30 – 42. von Mutius, Albert, Der Embryo als Grundrechtssubjekt, Jura 1987, S. 109 – 111. von Mutius, Albert, Grundrechtsmündigkeit, Jura 1987, S. 272 – 277. Nahrgang, Nicolai, Der Grundsatz allgemeiner Wahl gem. Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG als Prinzip staatsbürgerlicher Egalität, Berlin 2004. Nass, Klaus O., Wahlorgane und Wahlverfahren bei Bundestags- und Landtagswahlen. Grundlagen des Wahlvollzuges, Göttingen 1959. Nawiasky, Hans, Die Grundgedanken des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Systematische Darstellung und kritische Würdigung, Stuttgart 1950. Nestler, Christian, Einzelbewerber bei Bundestagswahlen von 1949 bis 2013: zahlreich, aber chancenlos, ZParl 45 (2014), S. 796 – 811. Nettesheim, Martin, § 63 Die Bundesversammlung und die Wahl des Bundespräsidenten, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 1105 – 1113. Nettesheim, Martin, Ein Individualrecht auf Staatlichkeit? Die Lissabon-Entscheidung des BVerfG, NJW 2009, S. 2867 – 2869. von Niederhäusern, William, Zur Konstruktion des subjektiven öffentlichen Rechts, Winterthur 1955. Nohlen, Dieter, Wahlrecht und Parteiensystem. Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme, 6. Aufl., Opladen u. a. 2009. Nopper, Klaus M., Minderjährigenwahlrecht. Hirngespinst oder verfassungsrechtliches Gebot in einer grundlegend gewandelten Gesellschaft?, Tübingen 1999. Nowak, Manfred, Politische Grundrechte, Wien u. a. 1988. Obst, Claus-Henning, Chancen direkter Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Zulässigkeit und politische Konsequenzen, Köln 1986. Oebbecke, Janbernd, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, Köln u. a. 1996. Oebbecke, Janbernd, Das Wahlrecht von Geburt an, JZ 2004, S. 987 – 992.
294
Literaturverzeichnis
Oelbermann, Jan, Wahlrecht und Strafe. Die Wahl aus dem Justizvollzug und die Aberkennung des Wahlrechts durch das Strafgericht, Baden-Baden 2011. Olschewski, Bernd-Dietrich, Wahlprüfung und subjektiver Wahlrechtsschutz. Nach Bundesrecht unter Berücksichtigung der Landesrechte, Berlin 1970. Oppermann, Thomas, Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes, VVDStRL 33 (1975), S. 43 – 58. Ossenbühl, Fritz, Die Verwaltungsvorschriften in der verwaltungsgerichtlichen Praxis, AöR 92 (1967), S. 1 – 33. Ossenbühl, Fritz, Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen, in: Starck, Christian (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Festgabe aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens des BVerfG, Band I, Tübingen 1976, S. 458 – 518. Ossenbühl, Fritz, Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts, DÖV 1981, S. 1 – 11. Ossenbühl, Fritz, Verfahren der Gesetzgebung. § 102, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band V, Rechtsquellen, Organisation, Finanzen, Heidelberg 2007, S. 223 – 258. Pauly, Walter, Der Methodenwandel im deutschen Spätkonstitutionalismus. Ein Beitrag zu Entwicklung und Gestalt der Wissenschaft vom Öffentlichen Recht im 19. Jahrhundert, Tübingen 1993. Pauly, Walter, Das Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 123 (1998), S. 232 – 285. Pechstein, Matthias, Wahlrecht für Kinder?, FuR 1991, S. 142 – 146. Peine, Franz-Joseph, Volksbeschlossene Gesetze und ihre Änderung durch den Gesetzgeber, Der Staat 18 (1979), S. 375 – 401. Peine, Franz-Joseph, Der befangene Abgeordnete, JZ 1985, S. 914 – 921. Peschel-Gutzeit, Lore, Unvollständige Legitimation der Staatsgewalt oder: Geht alle Staatsgewalt nur vom volljährigen Volk aus?, NJW 1997, S. 2861 – 2862. Pestalozza, Christian, Der Popularvorbehalt. Direkte Demokratie in Deutschland, Berlin u. a. 1991. Pestalozza, Christian, Verfassungsprozeßrecht. Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder, 3. Aufl., München 1991. Peuker, Enrico, Die demokratische Auslegung des Völkerrechts – Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu ESM-Vertrag und Fiskal-Pakt vom 12. September 2012, EuGRZ 2013, S. 75 – 86. Pieroth, Bodo, Materiale Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 1989, S. 422 – 450. Pieroth, Bodo, Offene oder geheime Wahlen und Abstimmungen, JuS 1991, S. 89 – 97. Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard/Kingreen Thorsten/Poscher, Ralf, Staatsrecht II. Grundrechte, 30. Aufl., Heidelberg 2014.
Literaturverzeichnis
295
Pietzcker, Jost, Organstreit, in: Badura, Peter; Dreier, Horst (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungsprozeß, Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Band I, Tübingen 2001, S. 587 – 613. Pollmann, Hans, Repräsentation und Organschaft. Eine Untersuchung zur verfassungsrechtlichen Stellung des Bundesrates der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1969. Preuß, Ulrich K., Das Landesvolk als Gesetzgeber. Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Volksgesetzgebungsverfahren aus Anlaß eines baden-württembergischen Volksbegehrens, DVBl. 1985, S. 710 – 715. Preuß, Ulrich K., Plebiszite als Formen der Bürgerbeteiligung, ZRP 1993, S. 131 – 138. Quaritsch, Helmut, Staatsangehörigkeit und Wahlrecht. Zum Problem des Ausländer-Wahlrechts, DÖV 1983, S. 1 – 15. Quintern, Hanna, Das Familienwahlrecht. Ein Beitrag zur verfassungsrechtlichen Diskussion, Münster 2010. Randelzhofer, Albert, § 17 Staatsgewalt und Souveränität, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 143 – 162. Rauschning, Dietrich, Die Sicherung der Beachtung von Verfassungsrecht, Bad Homburg v.d.H. u. a. 1969. Recker, Sebastian, Subjektivierung der Staatsstruktur – Schutzmechanismus nationaler Identität in der Europäischen Union, Köln, München 2014 Rinck, Hans-Justus, Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl als Wegbereiter zu einem zeitgemäßen Verständnis der Menschenwürde, in: Leibholz, Gerhard (Hrsg.), Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung, Festschrift für Willi Geiger zum 65. Geburtstag, Tübingen 1974, S. 677 – 696. Rinken, Alfred, Demokratie und Hierarchie, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Demokratie und Grundgesetz, Eine Auseinandersetzung mit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, Baden-Baden 2000, S. 125 – 147. Ritgen, Klaus, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Dargestellt am Beispiel des § 26 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung, Baden-Baden 1997. Roelleke, Gerd, Roma locuta – Zum 50-jährigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichts, NJW 2001, S. 2924 – 2931. Roelleke, Gerd, § 67 Aufgaben und Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Verfassungsgefüge, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 1201 – 12219. Rohlfs, Angelo O., Hermann von Mangoldt (1895 – 1953). Das Leben des Staatsrechtlers vom Kaiserreich bis zur Bonner Republik, Berlin 1997. Rolvering, Heinrich, Die Rechtsgarantien für eine politische Betätigung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland, München 1970. Roscheck, Jan, Enthaltung und Nichtbeteiligung bei staatlichen Wahlen und Abstimmungen, Berlin 2003.
296
Literaturverzeichnis
Roth, Gerald, Subjektiver Wahlrechtsschutz und seine Beschränkungen durch das Wahlprüfungsverfahren, in: Pfeiffer, Gerd (Hrsg.), Der verfaßte Rechtsstaat, Festgabe für Karin Graßhof, Heidelberg 1998, S. 53 – 68. Roth, Gerald, Zur Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, S. 214 – 218. Roth, Wolfgang, Verwaltungsrechtliche Organstreitigkeiten. Das subjektive Recht im innerorganisatorischen Verwaltungsrechtskreis und seine verwaltungsgerichtliche Geltendmachung, Berlin 2001. Roth, Wolfgang, Die Grundrechte Minderjähriger im Spannungsfeld selbständiger Grundrechtsausübung, elterlichen Erziehungsrechts und staatlicher Grundrechtsbindung, Berlin 2003. Rottmann, Frank, Der Beamte als Staatsbürger. Zugleich eine Untersuchung zum Normtypus von Art. 33 Abs. 5 GG, Berlin 1981. Rupp, Hans Heinrich, Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre. Verwaltungsnorm und Verwaltungsrechtsverhältnis, 2. Aufl., Tübingen 1991. Rupp, Hans Heinrich, § 31 Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, Verfassungsstaat, 3. Aufl., Heidelberg 2004, S. 879 – 927. Rupprecht, Isabel, Das Wahlrecht für Kinder. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit und praktische Durchführbarkeit, Baden-Baden 2012. Ruszly, József, Die Institutionengeschichte der parlamentarischen Wahlprüfung in Europa 21 (1982), S. 203 – 229. Sachs, Michael, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, DVBl. 1995, S. 873 – 893. Sachs, Michael, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl., Tübingen 2010. Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 6. Aufl., München 2011. Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, München 2014. Sacksofsky, Ute, Wer darf eigentlich wählen? Wahlberechtigung in den USA und Deutschland, in: Bäuerle, Michael/Dann, Philipp/Wallrabenstein, Astrid (Hrsg.), Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013, S. 313 – 328. Savigny, Leo von, Das parlamentarische Wahlrecht im Reiche und in Preußen und seine Reform, Berlin 1907. Schachtschneider, Albrecht, Anspruch auf Demokratie. Überlegungen zum Demokratierechtsschutz des Bürgers, JR 1970, S. 401 – 409. Schachtschneider, Karl Albrecht, Anspruch auf Demokratie. Überlegungen zum Demokratierechtsschutz des Bürgers, JR 1970. Schenke, Wolf Rüdiger, Der gerichtliche Rechtsschutz im Wahlrecht, NJW 1981, S. 2440 – 2444. Scherzberg, Arno, Grundlagen und Typologie des subjektiv-öffentlichen Rechts, DVBl. 1988, S. 129 – 134.
Literaturverzeichnis
297
Schiedermair, Stephanie, Gefährden Wahlcomputer die Demokratie?, JZ 2007, S. 162 – 170. Schiffer, Eckart, Wahlrecht, in: Benda, Ernst/Maihofer, Werner/Vogel, Hans-Jochen (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin u. a. 1983, S. 295 – 315. Schiffer, Eckart/Wolff, Hans-Jürgen, Staatliche Willensbildung und nichtstaatliche Organisationen, AöR 116 (1991), S. 169 – 184. Schiffers, Reinhard, Grundlegung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951, Düsseldorf 1984. Schladebach, Marcus, Besprechung von S. Graf von Kielmannsegg: Grundrechte im Näheverhältnis, DÖV 2014, S. 31 – 32. Schliesky, Utz, Aktuelle Rechtsprobleme bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, DVBl. 1998, S. 169 – 176. Schliesky, Utz, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt. Die Weiterentwicklung von Begriffen der Staatslehre und des Staatsrechts im europäischen Mehrebenensystem, Tübingen 2004. Schmidt, Thorsten Ingo, Grundpflichten, Baden-Baden 1999. Schmidt, Walter, Organisierte Einwirkungen auf die Verwaltung, VVDStRL 33 (1975). Schmidt-Aßmann, Eberhard, Verwaltungslegitimation als Rechtsbegriff, AöR 116 (1991), S. 329 – 390. Schmitt, Carl, Verfassungslehre, München u. a. 1928. Schmitt, Walter O., Die Verwirkung des Wahlrechts und der Wählbarkeit nach § 39 Abs. 2 BVerfGG, NJW 1966, S. 1734 – 1737. Schmitt Glaeser, Walter, Mißbrauch und Verwirkung von Grundrechten im politischen Meinungskampf. Eine Untersuchung über die Verfassungsschutzbestimmung des Art. 18 GG und ihr Verhältnis zum einfachen Recht, insbesondere zum politischen Strafrecht, Bad Homburg v.d.H. u. a. 1968. Schmitt Glaeser, Walter, Partizipation an Verwaltungsentscheidungen, VVDStRL 31 (1973), S. 179 – 258. Schmitt Glaeser, Walter, Private Gewalt im politischen Meinungskampf. Zugleich ein Beitrag zur Legitimität des Staates, 2. Aufl., Berlin 1992. Schmitt Glaeser, Walter, § 38 Die grundrechtliche Freiheit des Bürgers zur Mitwirkung an der Willensbildung, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 229 – 261. Schmitt-Vockenhausen, Hermann, Die Wahlprüfung in Bund und Ländern unter Einbeziehung Österreichs und der Schweiz. Ein Beitrag zum Wesen der parlamentarischen Demokratie, Berlin 1969. Schneider, Jens-Peter, Eigenart und Funktion der Grundrechte im demokratischen Verfassungsstaat, in: Perels, Joachim (Hrsg.), Grundrechts als Fundament der Demokratie, Frankfurt am Main 1979, S. 11 – 49.
298
Literaturverzeichnis
Schnelle, Eva Marie, Freiheitsmissbrauch und Grundrechtsverwirkung. Versuch einer Neubestimmung von Artikel 18 GG, Berlin 2014. Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter/Bier, Wolfgang (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar, München 26. Ergänzungslieferung (Stand: März 2014). Schönberger, Christoph, Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer Repräsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreichs (1871 – 1918), Frankfurt am Main 1997. Schönberger, Christoph, Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit” und Bundesstaatsverbot. Anmerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Der Staat 48 (2009), S. 535 – 558. Schönberger, Christoph, Der introvertierte Rechtsstaat als Krönung der Demokratie? – Zur Entgrenzung von Art. 38 GG im Europaverfassungsrecht, JZ 2010, S. 1160 – 1165. Schönberger, Christoph, Anmerkungen zu Karlsruhe, in: Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver/ Möllers, Christoph/Schönberger, Christoph (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin 2011, S. 9 – 76. Schönke, Adolf/Schröder, Horst (Hrsg.), Strafgesetzbuch. Kommentar, 29. Aufl., München 2014. Schorkopf, Frank, Die prozessuale Steuerung des Verfassungsrechtsschutzes. Zum Verhältnis von materiellem Recht und Verfassungsprozeßrecht, AöR 130 (2005), S. 465 – 493. Schorkopf, Frank, Der Mensch im Mittelpunkt, in: Müller, Reinhard (Hrsg.), 100 Beiträge aus der F.A.Z.-Rubrik „Staat und Recht“, München 2011, S. 30 – 33. Schreiber, Wolfgang, Novellierung des Bundestagswahlrechts, NJW 1985, S. 1433 – 1440. Schreiber, Wolfgang, Novellierung des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, NVwZ 2002, S. 1 – 10. Schreiber, Wolfgang, Wahlrecht von Geburt an – Ende der Diskussion?, DVBl. 2004, S. 1341 – 1348. Schröder, Meinhard, Grundlagen und Anwendungsbereich des Parlamentsrechts. Zur Übertragbarkeit parlamentsrechtlicher Grundsätze auf Selbstverwaltungsorgane, insbesondere in der Kommunal- und Hochschulverwaltung, Baden-Baden 1979. Schroeder, Werner, Familienwahlrecht und Grundgesetz, JZ 2003, S. 917 – 922. Schüle, Adolf, Demokratie als politische Form und als Lebensform, in: Kaufmann, Erich/ Scheuner, Ulrich/Weber, Werner (Hrsg.), Rechtsprobleme in Staat und Kirche, Festschrift für Rudolf Smend zum 70. Geburtstag, Göttingen 1952, S. 321 – 344. Schulte, Klaus, Volksvertreter als Geheimnisträger. Zeugnisverweigerungsrecht und Verschwiegenheitspflicht des Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Pfaffenweiler 1987. Schulz-Schaeffer, Helmut, Der demokratische Rechtsstaat als Republik, als „gemeinsame Sache aller“, JZ 2003, S. 554 – 560. Schuppert, Gunnar Folke, Bürgerinitiativen als Bürgerbeteiligung an staatlichen Entscheidungen. Verfassungstheoretische Aspekte politischer Beteiligung, AöR 102 (1977), S. 369 – 409. Schuppert, Gunnar Folke, Grundrechte und Demokratie, EuGRZ 1985, S. 525 – 532.
Literaturverzeichnis
299
Schwabe, Jürgen, Probleme der Grundrechtsdogmatik, Darmstadt 1977. Seifert, Karl-Heinz, Gedanken zu einer Reform des Wahlprüfungsrechts, DÖV 1967, S. 231 – 240. Seifert, Karl-Heinz, Bundeswahlrecht. Wahlrechtsartikel des Grundgesetzes, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung und wahlrechtliche Nebengesetze, 3. Aufl., München 1976. Sendler, Horst, Auf jede Stimme kommt es an! Das Bundesverfassungsgericht und der Schutz der Wahlbeteiligungsfreiheit, NVwZ 2002, S. 2611 – 2612. Siegrist, Dave, Hoheitsakte auf fremdem Staatsgebiet, Zürich 1987. Silberhorn, Thomas, Wahlpflicht unter Strafandrohung, JA 2000, S. 858 – 865. Smend, Rudolf, Maßstäbe des parlamentarischen Wahlrechts in der deutschen Staatstheorie des 19. Jahrhunderts (1912), in: Smend, Rudolf (Hrsg.), Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin 1955, S. 19 – 38. Sommermann, Karl-Peter, Demokratie als Herausforderung des Völkerrechts, in: Dupuy, Pierre-Marie/Fassbender, Bardo/Shaw, Malcom. N./Sommermann, Karl-Peter (Hrsg.), Völkerrecht als Wertordnung, Festschrift für Christian Tomuschat, Kehl u. a. 2006, S. 1051 – 1065. Soppe, Martin, Parlamentarische Selbstentmachtung als faktische Wahlrechtsbeeinträchtigung. Ein Beitrag zum subjektiven Recht auf Demokratie aus Art. 38 Abs. 1 GG, Berlin 2002. Spies, Thomas, Die Schranken des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland, Diss. München 1979. Starck, Christian, § 33 Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 3 – 29. Starck, Christian, § 41 Teilnahmerechte, in: Merten, Detlef; Papier, Hans-Jürgen (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band II, Allgemeine Lehren I, Heidelberg 2006, S. 709 – 740. Steiger, Heinhard, Organisatorische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems. Eine Untersuchung zur rechtlichen Stellung des Deutschen Bundestages, Berlin 1973. Stein, Ekkehart/Frank, Götz, Staatsrecht, 21. Aufl., Tübingen 2010. Stein, Katrin, „Wer die Wahl hat…“. Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und der Ausschluss vom Wahlrecht wegen strafgerichtlicher Verurteilung, GA 151 (2004), S. 22 – 32. Steinberger, Helmut, Die europäische Union im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Oktober 1993, in: Beyerlin, Ulrich/Bothe, Michael/Hofmann, Rainer/Petersmann, Ernst-Ulrich (Hrsg.), Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, Festschrift für Rudolf Bernhardt, Berlin u. a. 1995, S. 1313 – 1335. Steiner, Udo, Verfassungsgebung und verfassungsgebende Gewalt des Volkes, Berlin 1966. Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz- und Haushaltsverfassung, Notstandsverfassung, Bd. II, München 1980. Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung, Bd. I, 2. Aufl., München 1984.
300
Literaturverzeichnis
Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Allgemeine Lehren der Grundrechte, Bd. III/1, München 1988. Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Allgemeine Lehren der Grundrechte, Bd. III/2, München 1994. Stern, Klaus, § 184 Idee und Elemente eines Systems der Grundrechte, in: Isensee, Josef; Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX, Allgemeine Grundrechtslehren, 3. Aufl., Heidelberg 2011, S. 3 – 55. Stern, Klaus/Becker, Florian (Hrsg.), Grundrechte-Kommentar, Köln 2010. Stettner, Rupert, Grundfragen einer Kompetenzlehre, Berlin 1983. Stier-Somlo, Fritz, Vom parlamentarischen Wahlrecht in den Kulturstaaten der Welt, Berlin 1918. Stober, Rolf, Grundpflichten und Grundgesetz, Berlin 1979. Stober, Rolf, Vom sozialen Rechtsstaat zum egoistischen Rechthaberschutzstaat? Plädoyer für eine Renaissance des Gemeinwohls, DÖV 1998, S. 775 – 783. Stolleis, Michael, Parteienstaatlichkeit – Krisensymptome des demokratischen Verfassungsstaats?, VVDStRL 44 (1986), S. 7 – 45. Streit, Thilo, Entscheidung in eigener Sache, Berlin 2006. Strunk, Gert Peter, Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde einer Paramentsfraktion: Beschluss des Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts vom 14. 12. 1976, 2 BvR 802/ 75. Anmerkung, DVBl. 1977, S. 615 – 617. Thieme, Werner, „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, JZ 1955, S. 657 – 659. Thoma, Richard, Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der Deutschen Reichsverfassungs im allgemeinen, in: Nipperdey, Hans Carl (Hrsg.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Kommentar zum 2. Teil der Reichsverfassung, Band I, Allgemeine Bedeutung der Grundrechte und die Art. 102 – 117, Kommentar zum 2. Teil der Reichsverfassung, Berlin 1929, S. 1 – 53. Thoma, Richard, Das System der subjektiven öffentlichen Rechte und Pflichten. § 102, in: Anschütz, Gerhard; Thoma, Richard (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staatsrecht, Band II, Tübingen 1932, S. 607 – 623. Tomuschat, Christian, Die Europäische Union unter der Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 1993, S. 489 – 496. Triepel, Heinrich, Besprechung von Emil Spira: Die Wahlpflicht. Öffentlich-rechtliche Studie, ZfP 2 (1909), S. 597 – 604. Tschannen, Pierre, Stimmrecht und politische Verständigung. Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter Demokratie, Basel u. a. 1995. Uhlenbrock, Henning, Der Staat als juristische Person. Dogmengeschichtliche Untersuchung zu einem Grundbegriff der deutschen Staatsrechtslehre, Berlin 2000. Umbach, Dieter C., Der „eigentliche“ Verfassungsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht: Abgeordnete und Fraktionen als Antragsteller im Organstreit, in: Fürst, Walther/Herzog, Roman/Umbach Dieter C. (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Zeidler, Band 2, Berlin u. a. 1987, S. 1235 – 1260.
Literaturverzeichnis
301
Unruh, Peter, Weimarer Staatsrechtslehre und Grundgesetz. Ein verfassungstheoretischer Vergleich, Berlin 2004. Vosgerau, Ulrich, Zur Verfassungswidrigkeit der Allgemeinen Wehrpflicht nach stillschweigender Umwandlung in eine Dienstpflicht, ZRP 31 (1998), S. 84 – 86. Voßkuhle, Andreas/Kaufhold, Ann-Katrin, Die Wahlrechtsgrundsätze, JuS 2013, S. 1078 – 1080. Vutkovich, Alexander, Wahlpflicht. Politische Studie. Nachdruck der Ausgabe von 1906, Keip 1970. Wagner, Ulrich, Die Verwirkung der Wählbarkeit, Diss. Mainz 1956. Waldhoff, Christian, Das missverstandene Mandat. Verfassungsrechtliche Maßstäbe zur Normierung der erweiterten Offenlegungspflichten der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, ZParl 37 (2006), S. 251 – 266. von Waldthausen, J. Christian, Gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit und öffentliche Kontrolle im Verfahren zur Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, Berlin 2000. Wallrabenstein, Astrid, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, Baden-Baden 1999. Weides, Peter, Bestimmung des Wahltages bei Parlamentswahlen, in: Börner, Bodo/Jahrreiß, Hermann/Stern, Klaus (Hrsg.), Einigkeit und Recht und Freiheit, Festschrift für Karl Carstens zum 70. Geburtstag am 14. Dezember 1984, Köln u. a. 1984, S. 941 – 951. Weigend, Thomas/Jescheck, Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin 1996. Wendelin, Elvira, Der Hochschulverfassungsstreit. Subjektive Organrechte im Binnenbereich der Hochschule und deren verwaltungsprozessuale Behandlung, Baden-Baden 2010. Wiegand, Marc André/Zabel, Benno, Der Demokratische Verfassungsstaats zwischen Ideal und Wirklichkeit. Anmerkungen zum Freiheitsverständnis der Moderne, Der Staat 50 (2011), S. 73 – 101. Wiethölter, Rudolf, Rechtswissenschaft, Frankfurt am Main 1970. Wild, Michael, Die Gleichheit der Wahl. Dogmengeschichtliche und systematische Darstellung, Berlin 2003. Wilke, Dieter, Die Verwirkung der Pressefreiheit und das strafrechtliche Berufsverbot. Zugleich ein Beitrag zur Rechtsnatur und zu den Grenzen der Grundrechte, Diss. Berlin 1964. Winkelmann, Ingo, Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 1993. Dokumentation des Verfahrens mit Einführung, Berlin 1994. Wintrich, Josef, Über Eigenart und Methode verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung, in: Süsterhenn, Adolf (Hrsg.), Verfassung und Verwaltung in Theorie und Wirklichkeit, Festschrift für Wilhelm Laforet anläßlich seines 75. Geburtstages, München 1952, S. 227 – 250. Wissenschaftlicher Rat der Dudenreaktion, Duden – Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, 3. Aufl., Mannheim u. a. 2003. Wissenschaftlicher Rat der Dudenreaktion, Duden – Die Grammatik, Bd. 4, 8. Aufl., Mannheim u. a. 2009.
302
Literaturverzeichnis
Wolf, Alexander, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, Frankfurt am Main u. a. 1999. Wolf, Thomas, Das negative Stimmgewicht als wahlgleichheitswidriger Effekt – Auswirkung, Bewertung und Chancen einer Neuregelung, Berlin 2016. Wolff, Hans-Jürgen, Organschaft und juristische Person. Theorie der Vertretung: Stellvertretung, Organschaft und Repräsentation als soziale und juristische Vertretungsformen, Berlin 1934. Wolff, Hans J./Bachof, Otto, Verwaltungsrecht. Organisations- und Dienstrecht, Bd. II, 4. Aufl., München 1976. Würtenberger, Thomas/Zippelius, Reinhold, Deutsches Staatsrecht. Ein Studienbuch, 32. des von Theodor Maunz begr. Werkes, München 2008. Zeh, Wolfgang, § 53 Parlamentarisches Verfahren, in: Isensee, Josef / Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Demokratie – Bundesorgane, 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 807 – 851. Zimmermann, Till, Die Wahlfälschung (§§ 107a f. StGB) im Gefüge des strafrechtlichen Schutzes der Volkssouveränität, ZIS 2011, S. 982 – 995. Zippelius, Reinhold, Allgemeine Staatslehre, 16. Aufl., München 2010. Zuck, Rüdiger, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 4. Aufl., München 2013. Zuleeg, Manfred, Menschen zweiter Klasse, DÖV 1973, S. 361 – 370. Zuleeg, Manfred, Grundrechte für Ausländer – Bewährungsprobe des Verfassungsrechts, DVBl. 1974, S. 341 – 349.
Sachwortverzeichnis Abstimmungen 81, 137, 144 f. Aktivbürger 169 Aktivbürger, Parteifähigkeit des 259 Aktivbürgerschaft 137, 140 Amt 185 Amt, organisatorisches 198 Amt, politisches 28, 44 Amtsbegriff 185 Amtsträger 185 Bourgeois 101 f. Bundespräsident 128 Bundespräsident, Festlegung des Wahltags durch den 154 Bundesrat 126 Bundesrat, Antragsgegner im Organstreitverfahren 262 Bundesrat, Einspruch des 261, 263 Bundesregierung 126, 261 Bundestag 168 Bundesverfassungsgericht 127 f. Bundesverfassungsgericht, Rechtsprechung des 56 f., 119 f. Bundesversammlung 128, 169, 257 Bürger 101 f. Bürger, Bourgeois 101 f. Bürger, Citoyen 101 f. Bürger zweier Reiche 238 Citoyen 101 f. Demokratieprinzip 86, 98, 134 f.,138 Demokratieprinzip, Herleitung des Wahlrechts aus dem 98 Deutsche Staatslehre 29 Englische Lehre 28 f. Erziehungsrecht, elterliches 108
Französische Lehre 23 f. Freiheit, demokratische Mitwirkungsfreiheit 182 Freiheit, individuelle 179 Freiheit, Selbstbestimmungsfreiheit 181 Freiheitsrechte 234 f. Gemeinwohl 37, 189 f. Gemeinwohl, Bildung des 191 f., 194 f. Gemeinwohlbindung 189 f. Gesellschaft 171 f. Gesellschaft, gesellschaftliche Willensbildung 156 f. Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen 247 Grundrechte, Verwirkung von 111 f. Grundrechtseingriff, direkter 225 f. Grundrechtseingriff, faktischer 224 f. Grundrechtsmündigkeit 107 Herrschaftsgewalt, Entleerung der 264 f. Individualrecht, 21 Individualrecht, Begründung des Wahlrechts als 87 f. Individualrechtliche Theorien 45 f. Kommunikationsgrundrechte 96, 100 Kompetenz, Rechte an der 173 Kompetenz, Rechte auf die 63, 173 Kompetenz, Rechte aus der 173 KPD-Verbotsurteil 91 f. Legitimationskette 143 Legitimationssubjekt 134, 146 Mehrheitswahl 83 f. Meinungsfreiheit, Verletzung der 223, 225 Menschenwürde, Herleitung des Wahlrechts aus der 90 f. Menschenwürde, Verstoß gegen die 235 f.
304
Sachwortverzeichnis
Minderjährige 106 Minderjährige, Ausschluss vom Wahlrecht 96 Nationalstaatsprinzip 135 Neuwahlen, Nichtanordnung von 263 f. Organ 123 f. Organ, Organteil 185, 211 f. Organ, Organwalter 123 f., 200 Organ, ständiges 168 f. Organkompetenz, 68 f. Organschaft 123 f. Organstreit 254 f. Organtheorien 46 f.
Status, grundrechtlicher des Wählers 237 f. Status, staatsrechtlicher des Wählers 237 f. Statuslehre 60 Stimmabgabe 230 Stimmenkauf, s. Wählerbestechung Stimmenverkauf, s. Wählerbestechung Theorien 45 ff. Theorien, dualistische 47 Theorien, funktionale 46 f. Theorien, individualrechtliche 45 f. Theorien, Organtheorien 46 f.
Recht, Abwehrrecht 185 Recht, Bewirkungsrecht 68 f Recht, bürgerliches Freiheitsrecht 100 f. Recht, grundrechtsähnliches 56 Recht, grundrechtsgleiches 56, 102 Recht, organschaftliches 21, 179 Recht, Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 181 Recht, Selbstbestimmungsrecht des Volkes 122 Recht, staatsbürgerliches Mitwirkungsrecht 100 f. Rechtskreis, Außenrechtskreis 21, 71 Rechtskreis, Innenrechtskreis 21, 71, 203 Religionsfreiheit 229 f.
Verfassungsbeschwerde 248 f., 270 Verfassungsgebende Gewalt 131 Verhältniswahl 84 f. Versammlungsfreiheit 104, 224 Volk 116 ff. Volk, Aktivbürgerschaft 137 f. Volk, deutsches 129 Volk, Gesamtvolk 135, 14, 167 Volk, Gleichordnung mit obersten Staatsorganen 167 f. Volk, Handlungsfähigkeit 152 f., 257 Volk, Parteifähigkeit des im Organstreitverfahren 255 f. Volk, Selbstherrschaft des 164 Volk als höchstes Organ 168 Volks als Legitimationseinheit 178 Volk als Staatsorgan 116 f. Volk als ständiges Organ 168 f. Volks als Ur-Organ 151, 167 Volkssouveränität 163 f. Volkswillen 156 f. Volkswillen, Uneinheitlichkeit des 155 Volkswillen, Vermittlungsbedürftigkeit des 160 f. Volkswillensbildung 156 f., 161
Schweizer Lehre 40 f. Sphäre, gesellschaftliche 237 f. Sphäre, staatliche 237 f. Staatsangehörigkeit 121, 136 Staatsgewalt, Ausübung der 134, 137 f. Staatsgewalt, Trägerschaft der 134 f. Staatsorgan, Volk als 116 f. Staatsvolk, Zugehörigkeit zum 121, 136 Staatswille, Volkswille als 159 f.
Wahlakt 120, 144, 171, 176 Wählerbestechung 113 f. Wählerstimme, Rückführbarkeit der 105 f. Wählerverzeichnis 169 f., 266 Wahlfreiheit, negative 220 Wahlfreiheit, Wahlbeteiligungsfreiheit 219 Wahlfreiheit, Wahlentscheidungsfreiheit 219 Wahlgleichheit 77 f. Wahlgrundsätze, allgemein 206 f.
Parlament 29, 84 Parlamentarischer Rat 48 ff. Popularklage 249 f. Pouvoir constituant 131 f. Pouvoir constitué 133 f. Prozessstandschaft 257 f.
Sachwortverzeichnis Wahlgrundsätze, frei 203 f. Wahlgrundsätze, geheim 204 Wahlgrundsätze, gleiche 201 Wahlgrundsätze, unmittelbar 203 Wahlpflicht 217 Wahlpflicht, passives Wahlrecht 217 Wahlpflicht, Verfassungsmäßigkeit 216 f. Wahlprüfungsbeschwerde 243 f. Wahlrecht, Aberkennung des nach Art. 18 GG 111 f. Wahlrecht, Ausschluss wegen strafgerichtlicher Verurteilung 110 Wahlrecht, Doppelnatur des 68 f. Wahlrecht, Inhalt 73 f. Wahlrecht, kein Abwehrrecht 58 Wahlrecht, normative Anknüpfung 71 f., 211 Wahlrecht, objektives 17 f. Wahlrecht, passives 38, 74
305
Wahlrecht, Rechtsträgerschaft des 106 f. Wahlrecht, subjektives 17 Wahlrecht als bürgerliches Ehrenrecht 110 Wahlrecht als demokratisches Grundrecht 59 f. Wahlrecht als Leistungsrecht 65 Wahlrecht als politisches Grundrecht 59 f. Wahlrecht als Recht des status activus 60 Wahlrecht als staatliche Funktionen 31 Wahlrecht als staatsbürgerliches Recht 59 Wahlrecht als Teilhaberecht 64 f. Wahlsysteme 82 f. Wahlvolk 151, 170, 178 Wehrpflicht 236 f. Weimarer Reichsverfassung 37 f. Willensbildung, gesellschaftliche 156 f. Willensbildung, staatliche 160
![Bemerkungen zum “Vorläufigen Entwurf eines Deutschen Scheckgesetzes” unter besonderer Berücksichtigung der Herbeiführung eines einheitlichen Scheck-Rechts in Deutschland, Österreich und Ungarn [Reprint 2018 ed.]
9783111720548, 9783111224527](https://dokumen.pub/img/200x200/bemerkungen-zum-vorlufigen-entwurf-eines-deutschen-scheckgesetzes-unter-besonderer-bercksichtigung-der-herbeifhrung-eines-einheitlichen-scheck-rechts-in-deutschland-sterreich-und-ungarn-reprint-2018nbsped-9783111720548-9783111224527.jpg)


![Ausschussöffentlichkeit im Deutschen Bundestag [1 ed.]
9783428582464, 9783428182466](https://dokumen.pub/img/200x200/ausschussffentlichkeit-im-deutschen-bundestag-1nbsped-9783428582464-9783428182466.jpg)
![Die Fragestunde im Deutschen Bundestag [1 ed.]
9783428461134, 9783428061136](https://dokumen.pub/img/200x200/die-fragestunde-im-deutschen-bundestag-1nbsped-9783428461134-9783428061136.jpg)

![Das europäische Umweltinformationszugangsrecht als Vorbild eines nationalen Rechts der Aktenöffentlichkeit [1 ed.]
9783428509713, 9783428109715](https://dokumen.pub/img/200x200/das-europische-umweltinformationszugangsrecht-als-vorbild-eines-nationalen-rechts-der-aktenffentlichkeit-1nbsped-9783428509713-9783428109715.jpg)

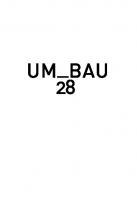
![Das Wissen der Architektur: Vom geschlossenen Kreis zum offenen Netz [1. Aufl.]
9783839415535](https://dokumen.pub/img/200x200/das-wissen-der-architektur-vom-geschlossenen-kreis-zum-offenen-netz-1-aufl-9783839415535.jpg)
![Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts [1 ed.]
9783428548378, 9783428148370](https://dokumen.pub/img/200x200/das-wahlrecht-zum-deutschen-bundestag-architektur-eines-organschaftlichen-rechts-1nbsped-9783428548378-9783428148370.jpg)